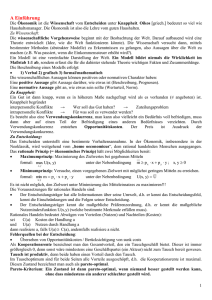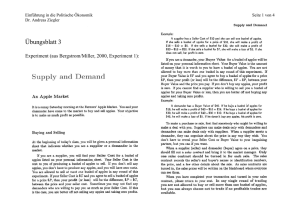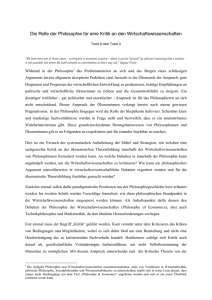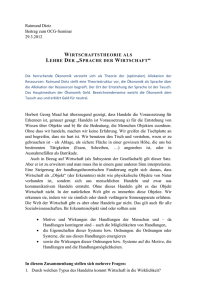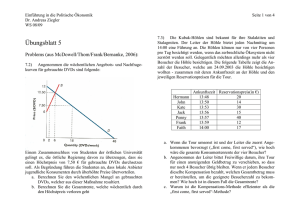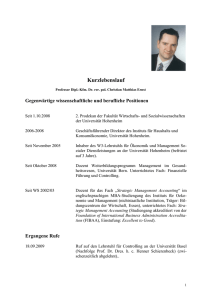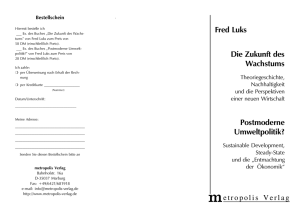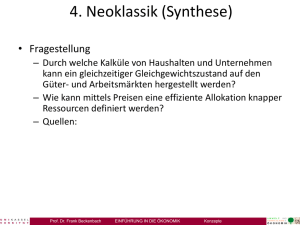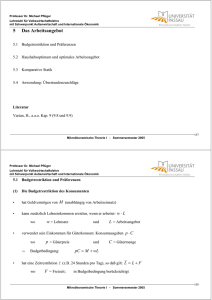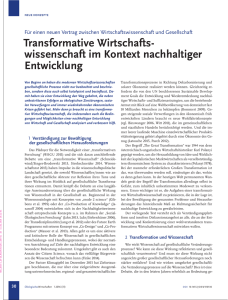Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung
Werbung
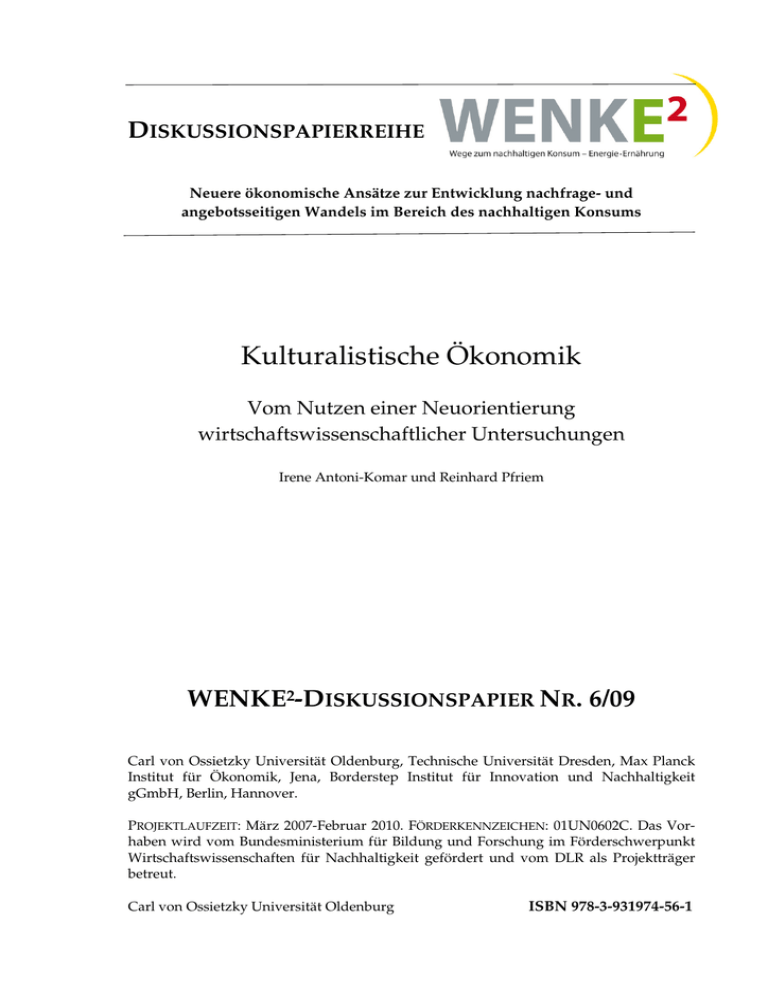
DISKUSSIONSPAPIERREIHE Neuere ökonomische Ansätze zur Entwicklung nachfrage- und angebotsseitigen Wandels im Bereich des nachhaltigen Konsums Kulturalistische Ökonomik Vom Nutzen einer Neuorientierung wirtschaftswissenschaftlicher Untersuchungen Irene Antoni-Komar und Reinhard Pfriem WENKE2-DISKUSSIONSPAPIER NR. 6/09 Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Technische Universität Dresden, Max Planck Institut für Ökonomik, Jena, Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit gGmbH, Berlin, Hannover. PROJEKTLAUFZEIT: März 2007-Februar 2010. FÖRDERKENNZEICHEN: 01UN0602C. Das Vorhaben wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Förderschwerpunkt Wirtschaftswissenschaften für Nachhaltigkeit gefördert und vom DLR als Projektträger betreut. Carl von Ossietzky Universität Oldenburg ISBN 978-3-931974-56-1 Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 2 Inhalt 1 Einführung .......................................................................................................................................... 3 2 Ökonomik als verflochtene Wissenschaft................................................................................ 4 3 Humanomics ....................................................................................................................................... 7 4 Ecological und Sustainability Economics............................................................................... 10 5 Evolutionary Economics ............................................................................................................... 12 6 Soziologische und philosophische Bezüge............................................................................ 15 7 Kulturalistische Ökonomik ......................................................................................................... 17 7.1 Zur Bedeutung und Definition von Cultural Economics....................................... 17 7.2 Der Kulturbegriff in der Konsumtheorie und der Identitätsdiskurs ................... 19 7.3 Das praxeologische Verständnis von Kultur und ökonomischer Praxis ............. 21 8 Reichweite und Grenzen der Wissenschaft: Glück als das gelingen könnende Leben – die praktizierte Ökonomie der Nachhaltigkeit .............................. 27 9 Zitierte Literatur .............................................................................................................................. 29 Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 1 3 Einführung „Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt, …dann muss es auch etwas geben, das man Möglichkeitssinn nennen kann.“ Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften Recht genau zwei Jahrzehnte, nachdem der staatsbürokratische Sozialismus sowjetrussischer Prägung auf breiter Front abgedankt hat, beobachten wir ein bemerkenswertes Phänomen. Die kapitalistischen Marktwirtschaften, die damit doch den endgültigen weltweiten Sieg davongetragen zu haben schienen, sind in eine fundamentale Krise geraten. Um die real existierenden Marktwirtschaften zu retten, scheinen die marktwirtschaftlichen Prinzipien über Bord geworfen werden zu müssen. Einerseits. Und andererseits: um weiterzumachen, gibt es scheinbar zum Weitermachen wie bisher keine Alternative. Krise, die per definitionem Umkehr ermöglichen würde, droht Einfalt statt Vielfalt zu bekräftigen. Der nachfolgende Text hat mit der Reflexion dieser Verhältnisse außerordentlich viel zu tun. Denn die tragende Konstruktionsidee der modernen Ökonomik hinsichtlich der dann als gesellschaftliches Feld identifizierten Ökonomie besteht unter Bezug auf das zweite Hauptwerk von Adam Smith (Smith 1776), also seit nun mehr als zwei Jahrhunderten, in nichts weniger als dem Bild eines sich selbst organisierenden Systems, das deshalb von externen Einflüssen möglichst frei gehalten werden solle. Dass diese Konstruktionsidee bis in die jüngste Zeit hinein dominiert, belegen nicht nur die von Ökonomen der meisten Wirtschaftsforschungsinstitute immer wieder vorgetragenen Warnungen vor zu starken staatlichen Eingriffen (die natürlich gegenwärtig in peinlicher Auffälligkeit zurückgehalten werden), sondern ebenso die einschlägigen theoretischen Begriffsverwendungen.1 Eine unserer wesentlichen Argumentationen läuft darauf hinaus, dass die Vorstellung eines isolierbaren und isolierten ökonomischen Systems immer schon ein theoretischer Irrtum war und heute mehr denn je alles dafür spricht, diesen Irrtum zu korrigieren. Weil wir im Ergebnis dieser Argumentation zu dem Vorschlag einer kulturalistischen Ökonomik kommen, führen wir diese Argumentation in folgenden Schritten durch: Mit einem zwangsläufig nur andeutenden Rückblick auf die ersten zwei Jahrhunderte der modernen Ökonomik wollen wir (2) aufzeigen, dass die Ökonomik bei näherem Hinsehen eine immer schon mit anderen verflochtene Wissenschaft war, die nie darum herum kam, sich mindestens implizit paradigmatisch und methodisch auf andere zu beziehen. Anläufe zu einer sozialwissenschaftlichen Öffnung solcher Ökonomik, die sich abgrenzend lieber nur als Wirtschaftswissenschaft und nicht übergreifend als Sozialwissenschaft versteht, gibt es schon seit längerem. Wir wollen (3) zeigen und begründen, dass und warum diese Anläufe noch nie so stark waren wie heute, welche Chancen, aber auch theoretischen Risiken damit verbunden sind. Eines von vielen Beispielen: der Wachstumstheoretiker Lucas spricht ausdrücklich von „mechanics of economic development“ (Lucas 1988). Lucas bekam 1995 den Nobelpreis für Ökonomie. 1 Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 4 Nicht zufällig sind die Überlegungen dieses Textes gewachsen im Rahmen langjähriger Forschungsarbeiten im Feld nachhaltiger Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft.2 Deswegen werfen wir (4) einen Blick auf das theoretische Feld von Ecological und Sustainability Economics. Innerhalb der Ökonomik hat sich während der letzten zwei Jahrzehnte eine Forschungsrichtung etabliert, die den Namen „Evolutionary Economics“ trägt. Mindestens heute noch ist diese Forschungsrichtung heterogener, als es auf den ersten Blick scheint, nicht nur wegen ihrer Leitidee, sondern gerade auch als Sammelbecken vieler unorthodoxer Ansätze, allerdings außerordentlich fruchtbar für unsere Überlegungen, weshalb wir uns damit (5) befassen. Das Projekt einer kulturalistischen Ökonomik wäre irreführend beschrieben, wenn nicht (6) ausdrücklich auf soziologische und philosophische Bezüge hingewiesen würde. Die führen wir natürlich (7) fort, wenn wir unsere Überlegungen erläutern, die uns aufbauend auf Forschungsarbeiten der letzten Jahre darin bekräftigen, in der kulturalistischen Perspektive eine zukunftsfähige Neuorientierung für wirtschaftswissenschaftliche Untersuchungen zu erkennen. Mit keinem theoretischen Zugang lässt sich alles sehen, es bleiben immer blinde Flecken. Es kann nur darum gehen, dass der eigene Scheinwerfer in die richtige Richtung leuchtet, und das möglichst hell. Einige Gedanken zur Reichweite und zu den Grenzen des wissenschaftlichen Umgangs mit gesellschaftlichen Phänomenen beenden (8) den Text. Wir hoffen, der diskursiven Klärung, dass es mit unserem kulturalistischen Zugang nicht etwa darum geht, jenseits der Ökonomik zu forschen, sondern gerade um eine zukunftsfähige Weiterentwicklung der Ökonomik, ein merkliches Stück beizutragen. 2 Ökonomik als verflochtene Wissenschaft Die politische Selbstaufklärung der Ökonomik als Wissenschaft lag nicht immer so stark danieder wie gegenwärtig. Gunnar Myrdal formulierte 1976: „Die Vorstellung, dass der Wirtschaftsablauf seinem Wesen nach eine nach einem einheitlichen Zweck orientierte Wirtschaftsführung einer personifizierten Gesellschaft mit gegebenen knappen Mitteln darstellt, ist die allgemeine Denkform der Wirtschaftswissenschaft bei der Formulierung und Beweisführung ihrer politischen Doktrinen. Sie gehen alle darauf hinaus festzustellen, was vom gesellschaftlichen Standpunkt aus am ‚wirtschaftlichsten’ ist.“ (Myrdal 1976, 14) Die Übertragung des Wirtschaftlichkeitsgedankens vom einzelnen Betrieb bzw. Unternehmen auf ganze Volkswirtschaften bzw. das System Wirtschaft als Ganzes ist eben eine solche Konstruktionsidee, wie wir diese oben markiert haben. Sie brauchte Zeit, um sich durchzusetzen. Noch mehr als ein Jahrhundert nach dem von Adam Smith gelieferten Startsignal für eine mit einem selbsttätigen Mechanismus beschäftigte Ökonomik waren die Wirtschaftswissenschaften von den anderen Sozial- und Kulturwissenschaften noch keineswegs so getrennt, wie das heute erscheint, die Betriebswirtschaftslehre ja auch erst in den Anfängen. Und es gab mächtige Gegenstimmen gegen die Idee, eine ökonomische Vgl. hierzu das von 2003 bis 2007 durchgeführte BMBF-Projekt OSSENA – Ernährungsqualität als Lebensqualität (www.ossena-net.de; Pfriem/Raabe/Spiller 2006; Antoni-Komar et al. 2008). 2 Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 5 Theorie könne auf zeitlosen Gesetzmäßigkeiten einer Mechanik von Nutzen und Eigeninteresse aufgebaut werden.3 In heutiger Rückschau zu nennen ist hier vor allem Thorstein Veblen, der uns im Abschnitt zur Evolutorischen Ökonomik noch genauer beschäftigen wird. Unter dem Titel „Theorie der feinen Leute“ ist in Deutschland vor allem seine „Theory of the Leisure Class“ (Veblen 1981, orig. 1899) bekannt geworden, eine inzwischen 110 Jahre alte brillante Kritik des demonstrativen Konsums und damit eben der kulturellen Aufladung des Wirtschaftslebens, die uns zur Begründung einer kulturalistischen Ökonomik dient. Die Zeit vor und nach der vorletzten Jahrhundertwende war zum einen die Zeit der Durchsetzung der neoklassischen Ökonomik mit starkem Gewicht auf mathematischen Modellbildungen als main-stream, verbunden mit Namen wie Jevons, Marshall und Walras. Zum anderen trat gerade im deutschen Sprachraum zu dieser Zeit eine Reihe von Autoren in Erscheinung, die der kulturellen Entstehung und Einbettung des Wirtschaftslebens das Wort redeten – eine heute eher verschüttete theoretische Tradition. So öffnete Max Weber mit seiner 1905 veröffentlichten Untersuchung „Die protestantische Ethik und der ‚Geist’ des Kapitalismus“ (Weber 1905) den Blick für die ökonomische Bedeutung geistig-kultureller Faktoren. Werner Sombart erforschte mit seinem 1913 erschienenen Buch „Der Bourgeois“ die Entwicklung und die Quellen des kapitalistischen Geistes (Sombart 1913), was er später zu seinem Hauptwerk „Der moderne Kapitalismus“ ausweitete (Sombart 1987). Zu erwähnen ist hier auch Simmel mit seiner 1900 veröffentlichten Philosophie des Geldes (Simmel 1989). Eine historisch und kulturell hinreichend reflektierte Untersuchung führt über die Wirtschaft als Gegenstand zwangsläufig hinaus – so formulierte Sombart in seiner 1922 entstandenen Studie „Luxus und Kapitalismus“ den Kern dieser Forschungsrichtung (Sombart 1967). Sicher mitbedingt durch die globalen gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen des (wirklichen oder vermeintlichen) Kampfs zweier Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme um die Rolle der überlegenen Wirtschaftsordnung kam nicht nur in den politischen, sondern auch in den wissenschaftlichen Diskursen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der differenzierende Blick auf unterschiedliche Wirtschaftskulturen innerhalb des Kapitalismus zu kurz und damit die eben skizzierte theoretische Tradition eher zum Erliegen. Bertram Schefold (Schefold 1994) war im deutschsprachigen Raum einer der wenigen theoretischen Ökonomen, der sich darum bemühte. Für die internationale Diskussion, die ähnlich zurückhaltend war, könnte der von Peter Berger entwickelte economic-cultureapproach angeführt werden. Berger weist anhand unterschiedlicher Beispiele die Interdependenzen von ökonomischem Handeln, sozialen und politischen Strukturen sowie kulturellen Mustern und Wertesystemen aus: „Economic Institutions do not exist in a vacuum but rather in a context of social and political structures, cultural patterns, and indeed structures of consciousness (values, ideas, belief-systems).“ (Berger 1986, 24) Der dazu viel zitierte Mark Granovetter betont analog die soziokulturelle „embeddedness” allen ökonomischen Handelns (vgl. Granovetter 1985), wobei – ein ganz wichtiger theoretischer Punkt, der schon hier angesprochen werden soll – eher die Idee einer einseitigen Jevons hatte 1871 formuliert: „The theory here given may be described as the mechanics of utility and selfinterest“ (Jevons 1970, 90). 3 Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 6 Geprägtheit des ökonomischen Handelns und Verhaltens durch das soziokulturelle Umfeld dominiert. Es wird im Zuge unseres Textes hoffentlich noch hinreichend deutlich werden, dass ein wesentliches Element der kulturalistischen Ökonomik gerade darin besteht, im Sinne von Giddens (Giddens 1984) die Rekursivität zwischen Handeln und Struktur(en) ernst zu nehmen, philosophisch formuliert: die wirkliche Dialektik von Subjekt und Objekt zu respektieren, also: Handeln und Subjekt nicht vor allem als determiniert zu behandeln. Dieses theoretische Erfordernis wird auch deutlich, wenn wir uns wie eingangs angesprochen vergewissern, dass es sich bei der herauslösenden Markierung des Ökonomischen aus der Gesellschaft um eine gesellschaftliche, also menschliche Konstruktionsleistung handelt. Ideen wie Wirtschaftlichkeit (ob als Produktivität oder als Rentabilität), Effizienz, aber insbesondere auch die Vorstellung, über immer mehr technischen Fortschritt und Wirtschaftswachstum das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl der Menschen erreichen zu können, sind nicht „an sich“ Bestandteile des Ökonomischen, sondern wurden und werden „von uns“ an die gedanklich zu ordnende Wirklichkeit herangetragen. Bei Castoriadis heißt es: „Selbstredend sind die gesellschaftlichen Dinge keine ‚Dinge’; gesellschaftliche Dinge, und zwar diese, sind sie nur, insofern sie gesellschaftliche Bedeutungen ‚verkörpern’ oder, besser gesagt, abbilden und darstellen. Die gesellschaftlichen Dinge sind das, was sie sind, nur aufgrund der Bedeutungen, die in ihnen unmittelbar oder mittelbar, direkt oder indirekt Gestalt annehmen.“ (Castoriadis 1984, 582) Daraus lässt sich präzise ableiten, was unter Ökonomie verstanden werden sollte. Es sind nämlich dann „die ‚Ökonomie’ und das ‚Ökonomische’ zentrale gesellschaftliche imaginäre Bedeutungen, die sich nicht auf ‚etwas’ beziehen, sondern die umgekehrt den Ausgangspunkt darstellen, von dem aus zahllose Dinge in der Gesellschaft als ‚ökonomisch’ vorgestellt, reflektiert, behandelt beziehungsweise zu ‚ökonomischen’ gemacht werden.“ (Castoriadis 1984, 592) Wenn wir uns im nächsten Abschnitt solchen neueren ökonomischen Ansätzen zuwenden, die mit dem Anspruch eines gegenüber vorheriger Neoklassik wirklichkeitsnäheren Menschenbildes argumentieren, dann sollten wir die Brille aufbehalten, nach den dahinter stehenden Konstruktionen zu schauen. Wir sollten dabei vor allem nicht die Augen verschließen davor, dass das aus dem 18. Jahrhundert stammende moderne Glücksversprechen4 in der weiteren Ausgestaltung von praktischer Ökonomie wie theoretischer Ökonomik verkoppelt wurde mit der Engführung von Produktion und Konsum auf ihre erwerbs- und warenförmigen Sektoren. So scheint die theoretische Ökonomik jenseits aller besonderen Richtungen und Ausprägungen bis zum heutigen Tage gebunden an die Gleichsetzung des menschlichen Lebensglücks mit der Maximierung materieller Güter. Und eben diese Gleichsetzung geht gegenwärtig praktisch zuschanden, theoretisch vernünftigerweise auch. „That action is the best that procures the greatest happiness for the greatest number” (Hutcheson 2002 (orig. 1726), 177). 4 Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 3 7 Humanomics Es ist hier nicht der Raum, eine kritische Rekonstruktion jener Geschichte vorzunehmen, als die seit Jahrzehnten versucht wird, dem Phänomen Rechnung zu tragen, dass zwischen den Gegenständen einer zu treffenden Entscheidung und dem vermeintlich rationalen Bemühen um die richtige Entscheidung menschliche Wahrnehmungsvorgänge stehen, die das Zustandekommen einer „an sich“ richtigen Entscheidung von vornherein verunmöglichen. Zu Recht wird weiterhin Herbert Simon (Simon 1957, Simon 1968) als Pionier für das theoretische Bemühen angeführt, zu erfassen, was denn unter „bounded rationality“ verstanden werden sollte. Wir werden zum Ende dieses Abschnitts noch sehen, dass das Festhalten an kalkulatorischer Rationalität und individueller Nutzenmaximierung bei Eingestehen der Unmöglichkeit, dies realisieren zu können (unvollständige Information etc.) einerseits, die Einsicht in die Heterogenität kultureller Grundlegungen der mit Entscheidungen verbundenen Ziele andererseits, zwei sehr unterschiedliche Linien in diesem Verständnis ausmachen. Für das, was Heuser unter dem Titel „Humanomics“ als „Die Entdeckung des Menschen in der Wirtschaft“ feiert (Heuser 2008), heißt einer der wichtigen Wegbereiter Daniel Kahneman. Der Psychologe arbeitete (früher gemeinsam mit dem inzwischen verstorbenen Amos Tversky) vor allem die Bedeutung von Framing-Effekten für ökonomische Entscheidungen heraus (vgl. Kahneman 2003, Kahneman/Tversky 1979). Diese umfassen zum einen Adaptionsprozesse im Zeitablauf (Gewöhnung) und zum anderen soziale Vergleichsprozesse (Peers). Gegenwärtig kommen solche eher psychologischen, kognitiven Untersuchungen und Erklärungsmuster zusammen mit anderen, die sich als physiologische, neuronale Methoden klassifizieren lassen.5 Der hohe Empirieaufwand, den beide Strömungen betreiben, führt inzwischen zu bedeutenden Reputationseffekten hinsichtlich der Wissenschaftlichkeit solcher Methoden. Nach unserem Eindruck sind damit aber zwei fundamentale theoretische Risiken verbunden. (1) werden damit die untersuchten (individuellen, nicht kollektiven) Akteure erneut und erst recht einseitig in ihren Verhaltensreaktionen auf Anreize, Sanktionsmechanismen und sonstige Umstände gefasst, nicht in Dimensionen vielfältig verändern könnenden eigenen strategischen Handelns. (2) werden durch die direkte (individuelle) Verknüpfung von Fragen, Experimenten, Hirnmessungen und Simulationen6 erneut und erst recht alle wesentlichen gesellschaftlichen Veränderungsprozesse außen vor (außerhalb der Betrachtung und Untersuchung) gehalten, die ja im Kern kollektive Prozesse sind.7 Dass Happiness-Forschung im zweiten Punkt auch ganz andere Wege gehen und ganz andere Ergebnisse zeitigen kann, hat Layard gezeigt (vgl. Layard 2005). Anknüpfend an die Arbeiten Kahnemans, betreffend etwa die möglichen Differenzen zwischen Erwartungsnutzen und Erfahrungsnutzen, wertet Layard eine Vielzahl internationaler Untersuchungen aus, die alle zu demselben Ergebnis kommen: in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind die Einkommen der Menschen in den frühindustrialisierten Ländern drastisch gestiegen, keineswegs aber analog dazu Glück und Zufriedenheit. Eine wichtige Vgl. hierzu Camerer/Loewenstein/Prelec 2005 sowie Priddat 2007. So stellt Heuser (2008, 36ff.) zutreffend die Verfahren „bei der neuen Vermessung des Menschen“ (Heuser 2008, 36) zusammen. 7 Etwa die Kulturkrankheit Konsumismus als Pendant zu dem Problem einer zunehmenden Zahl von Unternehmen, Marketing in gesättigten Märkten betreiben zu müssen – um hier nur ein Beispiel zu nennen, s. weiter Abschnitt 6 dieses Textes. 5 6 Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 8 Interpretation Layards lautet: Glück ist eben nicht die Resultante von materiellem Wohlstand, neben der finanziellen Lage spielen Familie, soziales Umfeld, Arbeit, Gesundheit, persönliche Freiheit und die Lebensphilosophie eine wichtige Rolle als Glücksfaktoren (Layard 2005, 78).8 Layards weitere Feststellungen, dass Verteilungsgleichheit das Glück der Gesellschaft fördere (Layard 2005, 65) und dass der Zwang zur kontinuierlichen Verbesserung der wahre Feind des Glücks sei (Layard 2005, 217), beziehen sich ebenfalls auf eine ökonomische Reflexionsebene, die mit den vorher beschriebenen individuellen Verknüpfungen von Umständen und Verhalten theoretisch nicht kompatibel ist. So enthält die noch recht junge ökonomische Happiness-Forschung nach unserem Eindruck zwei außerordentlich unterschiedliche Entwicklungsrichtungen ökonomischen Denkens. Die für uns also kritikwürdige bloß individuelle Verknüpfung von Umständen und Verhalten verbindet diese Richtung ökonomischer Verhaltensforschung ja auch mit einem Teil der Soziologie. Gegenüber Konzepten eines homo sociologicus, der vor allem sozialen Normen und Rollenverpflichtungen folgt, wollen wir allerdings den Umstand beachten, dass Strukturen und Kulturen nicht nur auf individuelle und kollektive Akteure einwirken, sondern letztere diese Strukturen und Kulturen in ihren Praktiken auch permanent verändern und hervorbringen. Das schließt eine kritische Sicht auf solche Konzeptionen von „bounded rationality“ ein, wonach für menschliches Handeln und Entscheiden alle möglichen Fehler, Wissenslücken und Täuschungen eingeräumt werden, die Grundorientierung an kalkulatorischer Rationalität jedoch weiterhin nicht aufgegeben wird.9 Diese Grundorientierung ist freilich auch in theoriegeschichtlicher Perspektive in Frage zu stellen. Unter Bezug auf die vielleicht wichtigste Schrift des Ökonomen Albert O. Hirschman (1980) könnte man formulieren: mit Beginn des 21. Jahrhunderts wird die Idee, die Interessen von den Leidenschaften zu separieren, die frühere Todsünde Habgier als ökonomisches Interesse zu pazifizieren und darauf die Erklärung und Gestaltung der Gesellschaft aufbauen zu können, wieder obsolet. Hirschman belegt in „The Passions and the Interests” durch vergleichende Quellenstudien des 17. und 18. Jahrhunderts die zunehmende Verdrängung der Leidenschaften des Menschen als Analysegegenstand durch den Fokus auf die Interessen. Gegenüber dem „Unsteten, Unberechenbaren der Leidenschaften als besonders verabscheuungswürdig und gefährlich“ (Hirschman 1980, 61) scheinen diese den Vorzug der Voraussagbarkeit und Beständigkeit zu erfüllen. Er identifiziert eine sich zuspitzende Dichotomie zwischen Interessen und Leidenschaften und zeigt auf, wie die Interessen zur Bezähmung der Leidenschaften eingesetzt werden. Nach Hirschman habe Adam Smith schließlich in „The Wealth of Nations“ (1776) den synonymen Gebrauch der beiden Begriffe eingeführt und betont, dass das materielle Wohl der ganzen Gesellschaft durch die Verfolgung der individuellen Interessen befördert werde. Damit verschwand die Analyse der Leidenschaften aus der Ökonomik und das Paradigma des rational begründeten Eigennutzes konnte sich entfalten. In dem 1977 veröffentlichten Aufsatz Rational Fools: A Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory kritisiert Amartya Sen eben jenen Ansatz einer allein auf Interessen Hier wie unmittelbar folgend zitiert nach der im selben Jahr erschienenen deutschen Übersetzung (Layard, R. (2005): Die glückliche Gesellschaft, Frankfurt/M.). 9 Bis auf weiteres wären nach unserer Beobachtung also der Framing-Ansatz und neuroökonomische Bemühungen hier kritisch dazu zu rechnen. 8 Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 9 und Rationalität fokussierten Ökonomik. Er referiert historische Quellen (z.B. Edgeworth 1881, Spencer 1879) zur Diskussion um Eigennutzen (Egoismus) und Utilitarismus bzw. Altruismus und kommt zu dem Schluss, dass zwar bereits zu Beginn des Diskurses die Problematik einer rein interessegeleiteten ökonomischen Entscheidung erkannt worden sei, diese Fokussierung auf den Eigennutzen aber dennoch bis zur Gegenwart Bestand habe. Den Grund, warum das Menschenbild des eigennützigen Egoisten (self-seeking egoist) in der Ökonomie so verbreitet sei, sieht er in der zugrunde liegenden Definition der Wahlhandlung: „It is possible to define a person’s interests in such a way that no matter what he does he can be seen to be furthering his own interests in every isolated act of choice… The reduction of man to a self-seeking animal depends in this approach on careful definition. If you are observed to choose x rejecting y, you are declared to have ‘revealed’ a preference for x over y. Your personal utility is then defined as simply a numerical representation of this ‘preference’, assigning a higher utility to a ‘preferred’ alternative. With this set of definitions you can hardly escape maximizing your own utility, except through inconsistency.” (Sen 1977, 322) Sen verwirft im Folgenden die Möglichkeit rein rationaler Entscheidung und stellt fest, dass das ökonomische Menschenbild, das von einer einzigen Präferenzordnung ausgehe, die verschiedene Funktionen von Eigeninteresse über Mitgefühl (sympathy, 326ff.) bis Engagement (commitement, 326ff.) zu erfüllen habe und keine (irrationalen) Inkonsistenzen zulasse, dem Bild eines sozialen Irren (social moron, 336) bzw. rationalen Trottels (rational fool) gleichkäme. Er plädiert für eine differenzierte Sichtweise höchst unterschiedlicher Präferenzen, die je nach Anlass eingesetzt werden. In der von uns verfolgten Weiterentwicklung der kulturalistischen Ökonomik sind die Leidenschaften, die Widersprüche und Emotionen der Akteure Teil kollektiver Wissensrepertoires, die in den sozialen Praktiken zur Anwendung gelangen. Damit knüpfen wir an alle jene Diskurse an, die die Unzulänglichkeit der ökonomischen Rationalitätsannahme herausstellen. „Rational zu sein ist vernünftig, wenn man Mathematik treibt – oder auch, wenn man ein Börsen-Portfolio ohne Seele verwaltet. Anders, wenn man auf den Markt geht oder eine Investition tätigt. Warum? Weil der Markt eine Begegnung mit menschlichen Subjekten voraussetzt. Dann ist es vernünftig, andere, nicht quantifizierbare Elemente in die Überlegung einzuführen, denn diese Überlegung ist nicht auf einen rein mathematischen Kalkül reduzierbar. Es ist kein Zeichen mangelnden Unterscheidungsvermögens (…), wenn man akzeptiert, für die Produkte des fairen und solidarischen Handels oder für umweltgerechte Produkte mehr zu bezahlen. Genauso wenig ist es unvernünftig, wenn man statt der großen Ladenketten den Kleinhandel, der das Leben im Viertel aufrecht hält, bevorzugt. (…) Es ist dann vernünftig, nicht allzu rational zu sein.“ (Latouche 2004, 91) Die jüngere ökonomische Theoriebildung bietet durchaus Anknüpfungspunkte, um für die Untersuchung der Entscheidungsverhältnisse individueller wie kollektiver Akteure weiterzukommen. Nach Arthur C. Denzau und Douglass C. North bildet die Ersetzung der Rationalitätsannahme der Wirtschaftswissenschaften und der Rational-Choice-Theorie „the single most important step that research in the social sciences can make“ (Den- Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 10 zau/North 1994, 5). Denzau/North sprechen von geteilten mentalen Modellen (shared mental models) als Interpretationsregeln, nach denen Menschen die Umwelt, in der sie leben, klassifizieren, sortieren und sich somit ihre ‚soziale Wirklichkeit’ konstruieren: „…people act in part upon the basis of myths, dogmas, idologies and ‚half-baked’ theories“ (Denzau/North 1994, 3). Individuen mit einem gemeinsamen Kulturverständnis und Erfahrungshintergrund verfügen damit über ausreichend konvergente mentale Modelle, Ideologien und Institutionen, um Unsicherheit abzubauen und um kollektive Handlungsfähigkeit zu entfalten. Diese mentalen Modelle (Konstruktionen, mittels derer die Menschen der Welt Sinn abgewinnen), Ideologien (die aus solchen Konstruktionen resultieren) und Institutionen (die in einer Gesellschaft zur Strukturierung überpersönlicher Austauschbeziehungen entwickelt werden) entwickeln sich ko-evolutiv (vgl. auch North 1992). Der Wandel von Präferenzen kann nun als zentrales Moment kultureller Veränderungsprozesse analysiert werden, die auf Kommunikation basieren. Die Tradierung der shared mental models macht den Kern des gemeinsamen kulturellen Gedächtnisses aus, das intergenerationell weitergegeben wird. Damit wird die Untersuchung des Entscheidungsverhaltens als einer überzeitlich-transkulturellen Optimierungsprämisse abgelöst und historisch kontextualisiert. Der Wandel von mentalen Modellen, Ideologien und Institutionen erweist sich als pfadabhängig (vgl. Tanner 2004, 85f.), der Begriff der „path dependence“ ersetzt den Begriff der „rational choice“ (vgl. Arthur 1989 und Pierson 2000; siehe auch Beyer 2006): „Es gibt nie einen temporalen Nullpunkt für eine Gesellschaft, kollektive Entscheidungen werden nie in einem Vakuum getroffen. Welche Optionen überhaupt verfügbar sind, hängt von vergangenen (institutionellen) Entscheidungen ab, durch die eine Gesellschaft – natürlich nicht als ganze, sondern in einzelnen Bereichen – einen bestimmten Pfad eingeschlagen hat, welcher bestimmte Handlungsoptionen verfügbar macht und andere ausschließt.“ (Biebricher 2004, 52) Weiter unten werden wir noch genauer sehen: Diese mentalen Modelle werden in der Praxistheorie in den kollektiven Wissensrepertoires als Hintergrundwissen eingefasst und als Kompetenzen in den Praktiken realisiert. Nicht mehr die mental-kognitiven Ordnungssysteme und die daraus abgeleiteten Hierarchien bilden nun die theoretisch reflektierten Konstrukte, sondern die daraus hervorgehenden Routinen und Kompetenzen stehen im Zentrum der Analyse. 4 Ecological und Sustainability Economics Dass wir uns im nächsten Schritt der theoretischen Option von Ecological und Sustainability Economics zuwenden, ist durchaus erklärungsbedürftig. Nachhaltigkeitsökonomik erscheint zunächst als Verlängerung von Ökologischer Ökonomik, und die scheint es für die Herleitung einer kulturalistischen Ökonomik nicht unbedingt zu brauchen. Eine solche Einschätzung wäre freilich höchst irrig. Wir haben argumentiert, dass die herauslösende Markierung des Ökonomischen gegenüber dem Rest von Gesellschaft praktisch wie theoretisch zu außerordentlich großen Problemen geführt hat. Eine wesentliche damit verbundene Verdrängungsleistung besteht in der konstruierten Ignoranz gegenüber den natürlichen Grundlagen des menschlichen Wirtschaftens. Darauf hat als Ökonom fundamental kritisch schon früh GeorgescuRoegen hingewiesen (vgl. Georgescu-Roegen 1971). In der Folgezeit haben sich in der Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 11 internationalen Ökonomik die Ecological Economics herausgebildet, Herman Daly war einer ihrer Pioniere (vgl. Daly 1977). Von Costanza et al. (vgl. Costanza et al. 2001) werden fünf Grenzen definiert, die das globale Ökosystem dem ökonomischen Subsystem setzt: Aneignung der Biomasse durch den Menschen, Klimawandel, Abbau der Ozonschicht, Zerstörung des Bodens, abnehmende Biodiversität. Damit werden eigentlich gesellschaftliche Veränderungen annonciert. Vermutlich ist es aber ein (immer noch existierendes) Problem der Ecological Economics auch in ihren radikaleren Ausprägungen, Ökonomie und Gesellschaft nur als Subsysteme des globalen Ökosystems verstehen zu können und damit Ökonomie und Gesellschaft nur im Sinne von Selbstbegrenzung, Korridorisierung etc., nicht aber im Sinne von multiplen alternativen Entwicklungspfaden denken zu können. Es entsteht ein naturalistischer Schein, der wissenschaftlich und politisch eher eindeutige Lösungen, zumindest Richtungen suggeriert, statt der prinzipiellen Offenheit gegenwärtiger und möglicher zukünftiger menschlicher Naturbeziehungen gerecht zu werden. Alle Bemühungen, Nachhaltigkeit zu operationalisieren, sind einerseits von der verständlichen Absicht getragen, Nachhaltigkeit mehr Geltung zu verschaffen. Auf der anderen Seite laufen ressourcen- bzw. beständefokussierte Ansätze (etwa Faber/Manstetten 2007) Gefahr, nur pluralistisch zu begreifende und prinzipiell konfliktäre Fragen gesellschaftlicher Entwicklung zu quasi-technischen Umsetzungsproblemen engzuführen. Auch materialbilanzorientierte Management-Regeln der Nachhaltigkeit wie etwa die Substitutionsregel, die Abbauregel, die Assimilationsregel und die Erhaltungsregel von Daly (vgl. Daly 1996) betrachten wir mit demselben kritischen Vorbehalt, sie liefern jedenfalls nur das Material für die Anschlussfrage, wie denn solche Ziele gesellschaftlich – in einem nicht nur technischen Sinne – umgesetzt werden könnten. An der Waldwirtschaft als historischem Urbeispiel für nachhaltiges Wirtschaften lässt sich das von uns markierte Engführungsrisiko übrigens gut demonstrieren: es geht eben nicht nur um das (quantitative) Problem, hinreichend wenig Holz abzuschlagen, damit genügend nachwächst, sondern auch um qualitative Probleme wie Monokulturen, wie Verdrängung von Laub- durch Nadelwald aus kurzfristig ökonomischen Gründen etc. Die regulative Idee nachhaltiger Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft ist ein kontrafaktisches Paradigma. Das Leitbild Nachhaltigkeit hat zum Inhalt, dass Veränderungen der überkommenen, im 20. Jahrhundert praktizierten Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensmodelle die Voraussetzung darstellen für die Erhaltung einer langfristig lebenswerten Zukunft der Menschen auf dieser Erde. Dabei ist sowohl intertemporal (zwischen den Generationen) wie auch intratemporal (also global zur selben Zeit) das Gerechtigkeitsproblem im politischen Sinne nicht hintergehbar (meint auch: nicht durch quantitative Operationen ersetzbar). Die Herausforderung Nachhaltigkeit ist eine kulturelle bzw. gesellschaftliche in dem Sinne, dass sie weder theoretisch durch bloßen Einsatz naturwissenschaftlicher oder anderer vermeintlich objektiver Methoden noch praktisch durch schieren Einsatz neuer Technologien erfolgreich angenommen werden kann. Nachhaltigkeit ist außerdem deshalb schwierig, weil sie offenkundig eine komplizierte Balance beinhaltet: eine Kultur der Bewahrung statt einer Fetischisierung des Neuen, weshalb Nachhaltigkeit durchaus Skepsis verlangt gegenüber dem zeitgenössischen Innovationsdis- Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 12 kurs. Nachhaltigkeit fordert aber auch ganz im Sinne von Schumpeter eine Kultur der schöpferischen Zerstörung.10 Für unsere weitere Argumentation hat die Frage, was denn Sustainability Economics zu ihrem Gegenstand haben, weit fundamentalere Folgen als jene, zu beachten, dass menschliches Wirtschaften auf natürliche Grundlagen angewiesen ist. Die Entwicklung von Ecological Economics zu Sustainability Economics führt uns zu einer theoretischen Schärfung, wie denn wirtschaftswissenschaftliche Untersuchungen generell zu betreiben wären: nicht zuletzt angesichts der Komplexität der Herausforderung Nachhaltigkeit wäre es eine analytische Sackgasse, nur auf individuelle Akteure zu schauen, in der schwierigen Balance zwischen Bewahrung und Neuerung ergibt sich die Aufgabe der Innovation in Richtung einer prinzipiell offenen Zukunft, und dieses nicht nur individuelle, sondern auch kollektive Handeln als notwendige Generierung von Neuem (Nachhaltigkeit als kontrafaktisch) ist also nicht Handeln im luftleeren Raum, sondern Handeln in Bezug auf etwas, in der Hinsicht, dass sich die Tauglichkeit des Handelns an den am „etwas“ stattfindenden Folgen zu beweisen und zu bewähren hat. Wir gewinnen also an dieser Stelle nicht weniger als eine im Unterschied zu vielen anderen angemessene Definition ökonomischen Handelns: als individuelles wie kollektives, auf Generierung von Neuem in eine prinzipiell offene Zukunft gerichtetes Handeln in Bezug auf etwas.11 Vor diesem Hintergrund werfen wir im folgenden Abschnitt einen Blick auf Evolutionary Economics. Die ausdrückliche Bezugnahme auf die Analogie zur natürlichen Evolution könnte ja auch bedeuten, dass sich die Evolutionary Economics mehr als andere Strömungen der ökonomischen Theorie auf die natürlichen Grundlagen menschlichen Wirtschaftens besinnen. 5 Evolutionary Economics Wer dieser (eigentlich plausiblen) Vermutung folgt, wird bei näherem Hineinsehen in die Literatur zu Evolutionary Economics rasch enttäuscht. Die Evolutorische Ökonomik beschäftigt sich so gut wie gar nicht mit dem Naturproblem. Als Befund ergibt sich eher: Durch Übertragung dynamischer Ordnungsmuster aus der Natur auf die Ökonomie wird die Evolutorische Ökonomik blind für die Bedingungen, die innerhalb der Ökonomie erfüllt sein müssen, damit die Natur in hinreichendem Maße bewahrt und stabil bleiben kann. Nun handelt es sich bei dem internationalen Komplex von Evolutionary Economics um ein außerordentlich heterogenes Gefüge, das an dieser Stelle nicht eingefangen werden kann. Die Idee, den am prominentesten von Darwin (1963, orig. 1859) mit der biologischen Evolutionstheorie vorgetragenen Gedanken natürlicher Auslese (Selektion) auf das System Wirtschaft zu übertragen, wurde jenseits von Schumpeter just in dessen Todesjahr Schumpeter 1993 (orig. 1950), 134 -142. Auf Schumpeter wird im nächsten Abschnitt genauer eingegangen. 11 Das schließt ökonomisches Handeln als Routinehandeln nicht aus, sondern ein: Routinehandeln ist eingebettet in die Logik, dass sich entwickelnde Zukunft über Veränderungen bearbeitet werden muss, nur nicht situativ in jedem Moment. 10 Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 13 schon von Alchian aufgebracht (Alchian 1950). Der Wettbewerb zwischen Unternehmen, der nicht nur zur Neugründung von Unternehmen führt, sondern auch zu deren Übernahme oder Auflösung, lässt sich insbesondere aus der Sicht des externen Beobachters retrospektiv als Ausleseprozess untersuchen. Allgemeiner geht es bei einer Übertragung des biologischen Evolutionsgedankens auf das System Wirtschaft darum, ähnlich den Theorien von Lamarck und Darwin erklärungsfähige Faktoren für längerfristige Entwicklungen und Veränderungen aufzuspüren. Für Darwin selbst folgte aus der Einsicht, dass die Menschen nicht als solche geschaffen wurden, sondern sich aus niederen Tierarten entwickelt haben, allerdings keineswegs, dass Überlegungen zur Evolution der Tiere einfach auf die Menschen und deren weitere Entwicklung übertragen werden können. In seinem 1871 erstmals veröffentlichten zweiten Hauptwerk „Descent of Man“ (Darwin 2002) setzt sich Darwin mit dem moralischen Sinn der Menschen als möglicherweise wichtigstem Unterschied zu den Tieren auseinander. Zutreffend fasst Eve-Marie Engels diese Auseinandersetzung so zusammen: „Die mentalen Fähigkeiten des Menschen, die sich für ihn während seiner Evolution als überlebensrelevant erwiesen, sind zugleich Bedingungen seiner Moralfähigkeit. Als organische Grundlage dieser Fähigkeiten ist unser plastisches Gehirn auf Moralfähigkeit eingerichtet, es verfügt über eine diese ermöglichende, komplexe Struktur.“ (Engels 2007, 171) Die Frage nach der Übertragbarkeit etwa des Schemas von Variation – Selektion – Retention bildet freilich nur einen Strang innerhalb der vielfältigen Evolutorischen Ökonomik. Der zu den Pionierschriften der inzwischen etwa ein Vierteljahrhundert mit zunehmender Intensität geführten Diskussion gehörende Text von Nelson/Winter (Nelson/Winter 1982) etwa bezog sich stark auf die seinerzeitigen Debatten zur „Bounded Rationality“ und arbeitete die Rolle von Verhaltensroutinen heraus, weswegen ökonomische Akteure (u. a. Unternehmen) nur eingeschränkt rational handeln könnten. Ein wiederum anderer Zugangsschwerpunkt wurde von Witt formuliert mit dem Gedanken, man könne „die generische Eigenschaft von Evolution daher ausdrücken als Selbst-Transformation des Systems im Zeitablauf durch endogen erzeugte Neuigkeit. Dabei kann man logisch (und meist auch ontologisch) zwei Prozesse voneinander unterscheiden: den der Entstehung von Neuigkeit im System und den der Ausbreitung.“ (Witt 2004, 35) In einem eigenen Sammelband unterscheidet Witt (2003, 9) drei Wege der Übertragung Darwinschen Denkens in ökonomische Theoriebildung: direkte Übertragung, Analogiebildung und Benutzung als Metapher. Wie auch in Witt (2004) plädiert er für eine domänen-unspezifische Konzeption von Evolution. Die Frage ist, was dann bleibt, um an den Gegen-stand (bestimmter ökonomischer Verhältnisse) herangetragen zu werden, und wie weit eine solche Vorgehensweise den inhaltlichen Besonderheiten des zu untersuchenden Gegenstandes gerecht werden kann. In dem Sinne scheinen uns alle jene Bemühungen Evolutorischer Ökonomik sehr produktiv zu sein, die sich etwa über den Blick auf die Geschichte ökonomischer Theorien auch der Inhalte vergewissern, mit denen sich Autoren beschäftigten, die heute als Frühgeschichte Evolutorischer Ökonomik reklamiert wer- Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 14 den können. Das zeigt sich insbesondere bei der Behandlung von Veblen und Schumpeter.12 Theoretische Zweifel kommen in dem Maße auf, in dem – nach welcher der von Witt genannten Varianten auch immer – eher formale begriffliche Übertragungen von einem (ja immer auch) eigenen Verständnis der Darwinschen Evolutionstheorie auf „das Ökonomische“ vorgenommen werden, ohne dass die ökonomischen Akteure und die ökonomischen Verhältnisse genauer untersucht werden, die doch dieses Ökonomische bilden. So lässt sich etwa über einzelne Ausprägungen der Evolutorischen Ökonomik hin formulieren: Entscheidungen fallen nach Auffassung der Evolutorischen Ökonomik unter Restriktionen, die Ausdruck kultureller sowie institutionell und historisch geprägter kognitiver Muster sind. Sie schaffen und sind zugleich selbst Ergebnis von Pfadabhängigkeiten, die ökonomischen Abläufen eine sich selbst verstärkende, oft irreversible Dynamik verleihen können. Damit hat man aber theoretisch noch gar nicht viel gewonnen für eine konkret-historische Analyse der ökonomischen Situation. Bei Hermann-Pillath findet sogar der Begriff Kultur Verwendung und wird auf „komplexe kognitive Schemata bezogen, die historische Wurzeln besitzen und über Sozialisationsprozesse übertragen werden“ (Hermann-Pillath 2002, 707f.). Auch das bleibt bis auf weiteres aber erst einmal sehr allgemein. Das Prüfkriterium, das wir am Ende des letzten Abschnittes erarbeitet haben, heißt: ökonomisches Handeln als individuelles wie kollektives, auf Generierung von Neuem in eine prinzipiell offene Zukunft gerichtetes Handeln in Bezug auf etwas anzuerkennen. Mit dem Ernstnehmen kollektiver Akteure und vor allem kollektiver kultureller Prozesse in der Gesellschaft tut sich eine theoretische Ökonomik, die im 20. Jahrhundert mit der Festlegung auf methodologischen Individualismus groß geworden ist, offenkundig sehr schwer. So schlägt Witt inzwischen eine „naturalistische Verortung der Evolutionsökonomik“ (Witt 2006, 53) vor, die nicht zufällig in ihrer Explikation auf die „individuelle Konditionierungsgeschichte“ (Witt 2006, 52) zurückführt. Trotz des artikulierten Anspruchs, die individuelle und die gesellschaftliche Ebene zu kombinieren, wird diese eher einseitig individualistische Betrachtungsweise unter dem Begriff der „learning theory of consumption“ fortgeführt bei Bünstorf (2007)13. Hier wird sowohl zwischen Grundbedürfnissen und zusätzlich erworbenen Bedürfnissen wie auch zwischen „associative learning“ und „controlled learning“ die kategoriale Möglichkeit einer sauberen Unterscheidbarkeit unterstellt. Damit können kollektive kulturelle Strömungen wie Konsumismus, aber auch überhaupt die kulturellen Aufladungen und Prägungen des Konsumverhaltens freilich nicht angemessen erfasst werden. Die normativen Bezüge, die jeder angemessenen Vorstellung von Lernen zugrunde liegen sollten, werden nicht aufgeklärt. Und Lernen geht dann nur in eine Richtung: Degradationsprozesse etwa im Sinne des Verlustes von kulturellen Kompetenzen, die heute in Bezug auf Nachhaltigkeit eine außerordentlich wichtige Rolle spielen (z. B. hinsichtlich der Entwicklung der Ernährungskultur) können so gar nicht analysiert werden. Hodgson hat in seiner Würdigung des Veblenschen Werkes hingegen vier wesentliche Punkte für eine angemessene und nicht-reduktionistische Sozialtheorie markiert: S. etwa die brillante Veblen-Analyse bei Hodgson 2004, 123-282. Auch Witt (2003) rückt Veblen und Schumpeter ins Zentrum der theoriegeschichtlichen Herleitung. 13 S. in derselben Richtung auch Bünstorf/Cordes 2008. 12 Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 1. 2. 3. 4. 15 “The dependence of social structures upon individuals…. The rejection of methodological individualism…. The dependence of individuals upon social structures…. The rejection of methodological collectivism….” (Hodgson 2004, 179) Natürlich ist es kein Zufall, wenn Hodgson an dieser Stelle u. a. auf die Kompatibilität mit der Strukturationstheorie von Giddens verweist: die dort fundierte Rekursivität von Handeln und Struktur liefert einen kategorialen Bezugsrahmen, um im Sinne unserer Definition ökonomischen Handelns den Bezug von Handeln auf etwas konkret in Augenschein zu nehmen. Das braucht die Evolutorische Ökonomik ja auch, wenn sie etwa „Firms as Realizations of Entrepreneurial Visions“ (Witt 2007) zu analysieren versucht. Wir wollen nicht schließen, ohne wie angekündigt auf Schumpeter als wichtigen Wegbereiter der Evolutorischen Ökonomik noch einmal zu sprechen zu kommen, hier allerdings nicht wegen des inflationär zitierten Prozesses der schöpferischen Zerstörung, sondern wegen eines Gedankens, den er in einem wenige Jahre vor seinem Tod geschriebenen und bis heute wenig beachteten Aufsatz niedergelegt hat (Schumpeter 1947) und der für unsere weitere theoretische Arbeit von fundamentaler Bedeutung sein wird. Schumpeter geht es um die „sadly neglected area of economic change“(Schumpeter 1947, 149). Dafür ist wichtig: „no factor acts in a uniquely determined way“(149). Insofern gibt es für den ökonomischen Akteur „different kinds of reaction“(150). Sein „creative response“ ist durch drei Merkmale charakterisiert: er kann eigentlich erst ex post verstanden werden, er schafft neue soziale und ökonomische Situationen, er bringt (mindestens möglicherweise) Entrepreneurship als persönliche und soziale Kompetenz zum Vorschein. Damit stellt sich die Frage nach den „returns to entrepreneurial activity“(154). Der ökonomische Wandel vollzieht sich im Austausch zwischen Produktion und Konsum, zwischen Angebot und Nachfrage. Wir brauchen Schumpeters „Kreativität“ des Entrepreneurs „nur“ zu beziehen auf die symbolökonomischen Spiele, die in dieser elementaren ökonomischen Beziehung gespielt werden, etwa auf die mögliche gesellschaftliche Empathie von Anbietern neuer Produkte oder Dienstleistungen, die um des ökonomischen Erfolgs willen auf deren kulturelle Anschlussfähigkeit setzen müssen: dann haben wir den „Creative Response“ als Ausgangsidee gewonnen für ein interaktionsökonomisches Denken. Das individuelle wie kollektive, auf Generierung von Neuem in eine prinzipiell offene Zukunft gerichtete Handeln in Bezug auf etwas ist performativ nicht nur in Bezug auf die Gestaltung der menschlichen Naturverhältnisse, wie wir das im Abschnitt zu Sustainability Economics gesehen haben, sondern natürlich auch permanent hinsichtlich der kulturellen Verständigung zwischen Angebot und Nachfrage. 6 Soziologische und philosophische Bezüge Wir haben bis jetzt versucht, uns fachdisziplinär gesehen möglichst stark in der ökonomischen Theorie zu bewegen. Gleichzeitig ist schon deutlich geworden, dass die theoretische Ökonomik aus guten Gründen immer in andere Bereiche des Denkens, zunehmend dann differente Fachdisziplinen geschaut hat, um für sich davon lernen zu können. Die Soziologie ist hier eine prominente Disziplin. Bis vor kurzem schien Luhmanns Systemtheorie besonders attraktiv zu sein (Luhmann 1984, Luhmann 1988), in jüngster Zeit lässt sich auch im deutschen Sprachraum dazu allerdings ein deutlich sinkendes Interesse beobachten: für das Funktionieren von Organisationen finden sich dort viele originelle Gedanken, gegenüber Ökonomie und Ökonomik ist die Luhmannsche Theorie freilich zu Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 16 affirmativ, um wichtige zusätzliche Einsichten zu generieren. Anders scheint es sich mit dem soziologischen Neo-Institutionalismus zu verhalten (vgl. Walgenbach 2006). „Der soziologische Neo-Institutionalismus ist Ende der 70er/Anfang der 80er Jahre aus der amerikanischen Organisationstheorie hervorgegangen“ (Beschorner et al. 2005, 29). Als tragende Autoren werden Meyer/Rowan (1977), Powell/DiMaggio (1991) und Zucker (1977) angesehen. Für uns interessant ist diese Theorierichtung, weil sie einen besonders genauen Blick auf Institutionalisierungsprozesse richtet und dabei unterschiedliche Grade der Institutionalisiertheit unterscheidet. Institutionalisierungsprozesse betreffen nichts weniger als den Kern der Rekursivität von Handeln und Struktur(en). Tolbert/Zucker (1996) systematisieren drei verschiedene Stufen der Institutionalisierung: 1. Habitualisierung: Aus zurückliegenden Erfahrungen inklusive gemachter Fehler werden Handlungsroutinen generiert, die sich für bestimmte soziale Situationen als stimmig erweisen. 2. Objektivierung: Diese Stufe zeichnet sich durch Handlungskoordination über Normativität aus und ist dadurch deutlich stabiler. 3. Sedimentierung: institutionelle Settings werden zu eigenen Realitäten, die sowohl tief verankert sind als auch breite Anerkennung finden. Institutionelle Arrangements werden demnach als wesentlich für Handlungsabläufe identifiziert. So bilden etwa Konsument/innen mit anbietenden Unternehmen, politischregulativen Instanzen und weiteren nicht-ökonomischen Anspruchsgruppen ein (je spezifisches) organisationales Feld, das durch „aufeinander bezogene Handlungen und gemeinsame Regulationsmechanismen erkennbar“ ist (Walgenbach 2000, 38). Kritische Stimmen gegenüber dem soziologischen Neo-Institutionalismus verweisen auf mangelnde Erklärungskraft für die Heterogenität in und zwischen organisationalen Feldern sowie Prozesse der De-Institutionalisierung (vgl. Walgenbach 2006). Hinsichtlich des letzteren Punktes und für die uns interessierende Frage nach den Bedingungen und Möglichkeiten institutionellen Wandels sei allerdings auf den frühen Ansatz der Modellierung von „institutional entrepreneurs“ (DiMaggio 1988) verwiesen. Entrepreneure schaffen, das können wir auch von Schumpeters „Creative Response“ her verlängern, neue Handlungsbedingungen, vielleicht auch weitergehend veränderte ökonomische und gesellschaftliche Verhältnisse. Ein so weiter geführter soziologischer Neo-Institutionalismus wie auch schon Schumpeters „Creative Response“ verweisen auf strategische Entscheidungs- und Handlungsfreiräume individueller wie kollektiver ökonomischer Akteure. Nach welchen Kriterien sollen solche strategischen Räume genutzt werden? Sowohl die Ökonomik als auch die Soziologie haben im 20. Jahrhundert im wesentlichen eine Entwicklung genommen, mit der sie sich in Bezug auf eine solche Frage größte Zurückhaltung auferlegt haben. Deshalb kommen wir nicht darum herum, auf die Philosophie zu verweisen als jene Disziplin, die wenn überhaupt eine für Fragen der Ethik zuständig ist. Wir wollen es in Sachen Ethik an dieser Stelle allerdings bei einer kurzen Verortung belassen und nur eine generelle Verknüpfung herstellen zu unserer Definition ökonomischen Handelns als (interaktionsökonomisch zu denkendem) individuellem wie kollektivem, auf Generierung von Neuem in eine prinzipiell offene Zukunft gerichteten Handeln in Bezug auf Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 17 etwas.14 Die Situation der heutigen Zeit ist dadurch gekennzeichnet, dass Ethik mit Blick auf die in der Welt bestehenden differenten Kulturen nur noch plural gedeutet werden kann. Es entwickelt sich ein Wettbewerb soziokultureller Deutungsmuster, strategischer Programme und Handlungsoptionen sowie normativer Orientierungen, dessen Plattform die moderne globalisierte Gesellschaft ist und der das Material liefert für begründete und angemessene ethische Reflexionen. Diese sind insofern nicht länger pflichtenethisch vorstellbar (abzuleiten aus welchem Allgemeinen auch immer), sondern bestehen eher darin, sich in der konkret-historischen Situation das ethisch Gute verantwortungsvoll erarbeiten zu müssen. Die diesbezüglich tief gehende Einsicht von Zygmunt Bauman („Pflichten machen Menschen tendenziell gleich, erst Verantwortung macht sie zu Individuen“, Bauman 1995, 87) ist im Sinne unserer Definition ökonomischen Handelns natürlich auch auf kollektive Akteure zu übertragen. Eine solche, der heutigen Zeit angemessene Verantwortungs- und insofern auch Tugendethik möchten wir als eine kulturalistische Theorie von Ethik bezeichnen. Deren Bedeutung läuft mit, wenn wir im Folgenden die Quellen und das Programm einer kulturalistischen Ökonomik umreißen. 7 Kulturalistische Ökonomik Um unsere Definition ökonomischen Handelns als (interaktionsökonomisch zu denkendem) individuellem wie kollektivem, auf Generierung von Neuem in eine prinzipiell offene Zukunft gerichteten Handeln in Bezug auf etwas präzisierend theoretisch und methodisch einzufassen, werden im Folgenden der wissenschaftliche Diskurs und die konzeptionellen Grundlagen einer kulturalistischen Ökonomik erörtert. 7.1 Zur Bedeutung und Definition von Cultural Economics Wenn wir von einer kulturalistischen Ökonomik sprechen, dann in bewusster Abgrenzung zur „Kulturökonomie“, die sich mit den ökonomischen Faktoren im Kultursektor beschäftigt. Das dort zugrunde liegende Kulturverständnis wird meist mit einem spätbürgerlichen Be-griff von Hochkultur eingefasst, der sich auf Musik, Literatur, Bildende und Darstellende Kunst bezieht und die vielfältige(n) Kultur(en) des Alltags ausschließt. Analog zum Begriff der „Kulturökonomie“ wird im Englischen von „Cultural Economics“ gesprochen. Aufgrund der Dominanz des Gebrauchs im Sinne der oben beschriebenen Kulturökonomie haben wir uns für die englische Sprachregelung des „cultural approach in ecomomic theory“ entschieden. Harry Hillman Chartrand dagegen definiert den Gegenstand einer „Cultural Economics“ in unserem Sinne folgendermaßen: „Cultural Economics can be defined as the study of the evolutionary influence of cultural differences on economic thought and behaviour. Cultural Economics assumes economic behaviour varies according to cultural context. The seminal and leading exponent of trans-disciplinary, relativistic cultural economics is Kenneth Boulding.“15 Kenneth Boulding hat sich mehrfach zu dem Kontext von Ökonomie und Kultur geäußert. Insbesondere in dem Beitrag „Toward the Development of a Cultural Economics” (1972) analysiert er das Verhältnis von Ökonomie und Kultur und identifiziert eine seit Adam Ausführlich s. Pfriem 2007. http://www.culturaleconomics.atfreeweb.com/Hard%20Facts.htm# Cultural%20Economics%20 versus%20the%20Economics%20of%20Culture, abgerufen am 05.03.2009. 14 15 Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 18 Smith abnehmende Beschäftigung bzw. Vermeidungsstrategie der Ökonomik mit dem Kontext Kultur. Er schreibt: „The founding father of economics, Adam Smith, had a strong sense of the cultural matrix of economic phenomena. One of the most interesting of the unasked questions of intellectual history is how the science of economics should have lost the sense and become an abstract discipline void almost of any cultural context. The loss of interest within the economics profession in the cultural matrix of its own discipline is a fairly continuous process, almost from the days of Adam Smith.” (Boulding 1972, 267) Boulding stellt weiter fest, dass sich die Ökonomik in fortschreitendem Maße auf abstrakte Berechnungen konzentriere und die Bezüge zur Kultur und zur „real world“ (Boulding 1972, 268) aus den Augen verloren habe. „In the present generation, as far as economic theory is concerned, abstraction has completely conquered the field. One can look in vain, for instance, through issue after issue of the American Economic Review to try to find anything which even remotely suggests a cultural context. The computer, if anything, has accentuated this trend. It has enabled economists to put a lot more variables together and to develop more complex models with larger numbers of equations.” (Boulding 1972, 268) Im Folgenden plädiert Boulding für den „cultural approach“, z.B. im Feld der Finanzwirtschaft, um dort die Kultur der „Banker“ oder die Interaktionen in der Steuerwirtschaft zu analysieren. Als kulturelle Leistung und Treiber des kulturellen Wandels identifiziert er den sozialen Prozess des Lernens, der vor allem in der Marktwirtschaft eine zentrale Bedeutung einnehme; dieser sei nicht so sehr durch Erfolg (success), sondern vor allem durch Scheitern bzw. Enttäuschung (failure; disappointment) gewährleistet. „It can hardly be said too often that we learn new things only from failure, never from success, and we learn a great deal from our failures in exchange. We buy a certain brand, and we don’t like it, so we do not buy it again … The emphasis of learning is perhaps the crucial difference between mechanistic economics and cultural economics. Mechanistic economics tends to take preferences and even skills and techniques for granted, as the data or ultimate determinants of the economic process. Cultural economics must look upon both preferences, skills, and techniques as essentially learned in the great processes of cultural transmission … Social learning, indeed, is the central concept of culture.” (Boulding 1972, 273) Es ist zudem kein Zufall, dass eine kulturalistische Orientierung im Rahmen unserer Forschungsarbeiten durch Beschäftigung mit der Konsumseite der ökonomischen Grundbeziehung an Fahrt gewonnen hat: auch wenn sie längst obsolet geworden ist, wird für die Unternehmens- bzw. Angebotsseite teilweise immer noch versucht, eine faktor- und effizienz-orientierte Sichtweise aufrechtzuerhalten. Vor allem in Konsumtheorien lässt sich allerdings eine häufige Affinität zum Kontext Kultur identifizieren. Dabei wird auch die Sinn- und Identitätskonstruktion durch Konsumhandeln herausgestellt. Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 7.2 19 Der Kulturbegriff in der Konsumtheorie und der Identitätsdiskurs Der seit den 1990er Jahren sich ausweitende cultural approach in der Konsumtheorie greift auf die Figur der embeddedness zurück. Nach Bocock ist Konsum nicht Ausdruck von marktgerechter Konsumentensouveränität, sondern ideologisch, ökonomisch, technisch, historisch und sozial eingebettet in den Kontext der Konsum- und Produktionsweise der jeweiligen Kultur (vgl. Bocock 1993). Slater geht über diese Einbettungsfigur hinaus, indem er Konsum als die Kultur der westlichen Welt akzentuiert, als zentrale Alltagspraxis, die nicht nur die dominanten Werte, Praktiken und Institutionen einer Gesellschaft organisiere, sondern rekursiv diese auch davon ableite: „Consumption is always and everywhere a cultural process, but ‘consumer culture’ – a culture of consumption – is unique and specific: it is the dominant mode of cultural reproduction developed in the west over the course of modernity. Consumer culture is in important respects the culture of the modern west – certainly central to the meaningful practice of everyday life in the modern world; and it is more generally bound up with central values, practices and institutions which define western modernity, such as choice, individualism and market relations… To talk this way is to regard the dominant values of a society not only to be organized through consumption practices but also in some sense to derive from them.” (Slater 1997, 8, 24) Auch bezeichnet Slater die moderne Konsumkultur als vorherrschende Praxis, um Identität und sozialen Status auszuhandeln. Identität und sozialer Status werden damit nicht als fixiert und zugeschrieben aufgefasst, sondern als erworben und sozial konstruiert: “Status is now an achievement of the moment … and not an attribute ascribed to one as part of an inheritance form the cosmic order. In a post-traditional society, social identity must be constructed by individuals, because it is no longer given or ascribed, but in the most bewildering of circumstances: not only is one’s position in the status order no longer fixed, but the order itself is unstable and changing and is represented through ever changing goods and images.” (Slater 1997, 30) Damit schließt Slater an die Auffassung von Identitätskonstruktionen durch Giddens (1991) an, wonach in durch Pluralisierung gekennzeichneten postmodernen Gesellschaften Identitäten weder zugeschrieben noch eindeutig, sondern als erwählte und konstruierte zu betrachten seien. In einer Pluralisierung der Lebenswelten müssten Individuen multiple und widersprüchliche Identitäten aushandeln, die sich in verschiedenen Kontexten unterschiedlich zeigten. Identität werde außerdem temporalisiert, bestehe aus „biographical narratives“, sei „an interpretative self-history produced by the individual” (Giddens 1991, 5, 76) und gekennzeichnet durch beständige individuelle Identitätsarbeit. Im Rahmen der ökonomischen Theorie haben Akerlof/Kranton (2000) gezeigt, dass Identität („a person’s sense of self“) Entscheidungen herbeiführen kann, die einem engen Eigennutzkalkül widersprechen. Identität kann die Wirkung ökonomischer Anreize konterkarieren, wenn die Individuen einen großen Nutzen aus einem ihrem Selbstbild entsprechenden Verhalten ziehen. Akerlof und Kranton argumentieren, dass die nach wie vor sehr ungleiche Verteilung der Geschlechter auf verschiedene Berufe auf dem Arbeitsmarkt kaum auf ein ökonomisches Kalkül der Individuen zurückzuführen sei. Sie ist Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 20 jedoch erklärbar, wenn die Individuen einen Nutzen aus der Erfüllung einer (sozial konstruierten) Geschlechteridentität ziehen. Die Identitätswahl bezeichnen sie als „the most ‚economic’ decision people make“ (Akerlof/ Kranton 2000, 717). Renn/Straub begreifen Identität transitorisch, d.h. Identität sei ein „praktisches Selbstverhältnis“. Sie verwirkliche und dokumentiere sich narrativ in sozialen Handlungskontexten. Nicht wer die Person sei, sondern als wen sie sich selbst entwerfe, stelle sich als Frage (Renn/Straub 2002). Diese Position greift Amartya Sen auf, wenn er davon spricht, dass wir von einer „unausweichlich pluralen Identität“ (Sen 2007, 9) ausgehen müssten, nach der wir uns im jeweils gegebenen Kontext entscheiden müssten, welche Bedeutung wir unseren einzelnen Bindungen und Zugehörigkeiten zumessen: „Jeder von uns hat in seinem Leben in unterschiedlichen Kontexten an Identitäten vielfältiger Art teil, die sich aus seinem Werdegang, seinen Assoziationen und seinen sozialen Aktivitäten ergeben. (…) Um die Welt der pluralen Identitäten richtig zu verstehen, müssen wir Klarheit über die Anerkennung unserer vielfältigen Bindungen und Zugehörigkeiten haben, auch wenn das möglicherweise untergeht in anderslautenden einseitigen Behauptungen, wir hätten nur die Wahl zwischen der einen oder der anderen Perspektive. Die Entkolonialisierung des Geistes verlangt, dass wir uns von der Versuchung exklusiver Identitäten und Prioritäten ein für allemal verabschieden.“ (Sen 2007, 38, 111) Die Reduktion des Menschen auf singuläre Identitäten sieht Sen als Gefahr, Entzweiung und Gewalt hervorzurufen (Sen 2007, 186). Identität wird demnach als beständiges Herstellen und Umbilden aufgefasst, das den sozialen, nationalen oder ethnischen Habitus eines zum Individuum gewordenen Subjektes beständig neu formt (vgl. Kimminich 2003, IX). Nach Charles Taylor sind Akteure „self-interpreting animals“, in deren sozialer Praxis kulturelle Codes wirksam werden. Diese Selbst-Interpretationen sind nicht in erster Linie Ergebnis reflexiver oder theoretischer Überlegungen, sondern sind „embedded in a stream of action“ (Taylor, 1985a; Taylor 1985b, 26). Damit wird Kontingenz zum zentralen Kennzeichen von Identität, wie der Soziologe Reckwitz feststellt: „Das Problem der Identität ist nun nicht mehr vorrangig das der Konstanz und Balanciertheit der Dispositionen des Individuums angesichts rollenspezifischer – und höchstens abstrakt zu universalisierender – sozialer Normen. Das Problem, das der Begriff ‚Identität’ nun bezeichnet, ist das des individuellen und kollektiven Selbstverstehens und seiner Kontingenz“ (Reckwitz 2001, 29). Reckwitz sieht die Gegenwartskultur durch die „Leitfigur eines konsumtorischen Subjektes“ (Reckwitz 2005, 425; vgl. auch Reckwitz 2006, 441ff.) bestimmt, für dessen Identität der Konsum von hervorragender Bedeutung ist. Über die Kulturalität des Konsums kann uns nun die heutige Kulturalität der Produktion deutlich werden, über die Kulturalität der Nachfragen die Kulturalität der Angebote.16 In für Ökonomen hilfreicher Klarheit wird damit auch die Obsoletheit faktor- und effizienzorientierter Theorien deutlich, so weit diese meinen, damit immer noch das Wesentliche des Ökonomischen erklären zu können. Denn solchen Theorien fehlt das analytische Sensorium für drei wesentliche Tatbestände: 16 S. den Titel von Pfriem 2004: Unternehmen sind kulturelle Angebote an die Gesellschaft. Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 21 die Sinnbezogenheit allen menschlichen (auch organisationalen) Handelns (Ökonomie als Sinnstiftung), die Diversität dieser Sinnbezüge (Komplexität und Heterogenität), die Wandelbarkeit und den Wandel dieser Sinnbezüge (Kontingenz). (vgl. Pfriem 2007, 171) Im Sinne einer Interaktionsökonomik rückt dabei die Rekursivität zwischen individuellem und kollektivem Handeln einerseits, auf dieses einwirkenden Strukturen und Kulturen (soziokultureller Kontext) andererseits in den Vordergrund. Wenn wir nun diese Bezüge aufgreifen und im Sinne einer praxeologischen Fokussierung präzisieren, wird gegenüber homo-oeconomicus-Konzepten akzentuiert, dass Kosten-Nutzen-Abwägungen von subjektiven Wahrnehmungen geprägt und durch kollektive Wissensrepertoires überlagert werden sowie das Aushandeln von Identitäten, Praktiken der Selbstinszenierung, des Geschlechts u. a. eine wesentliche Rolle spielen. Unser Zugang impliziert eine konsequente Öffnung für kulturelle Faktoren, also Beachtung der Wahrnehmungsweisen, Gefühle, Gewohnheiten, Ängste, Wissensrepertoires individueller und kollektiver Akteure, die letztlich nur in Praktiken sichtbar werden und als kontextgebunden und temporalisiert zu verstehen sind. 7.3 Das praxeologische Verständnis von Kultur und ökonomischer Praxis Im praxistheoretischen Verständnis wird Kultur als offenes und dynamisches, heterogenes System von kollektiven Repertoires definiert, die in den sozialen Praktiken zum Einsatz kommen (vgl. Schatzki 1996; Reckwitz 2003; Hörning/Reuter 2004). „Kultur“ ist dann nicht ein Ensemble von verfestigten Symbolen, sondern ein Prozess, in dem zahlreiche Aspekte und Dinge des täglichen Lebens als Wissens- und Bedeutungsbestände in die sozialen Umgangspraktiken verwickelt sind und dadurch ständig aktualisiert und modifiziert werden. Das praxeologische Verständnis akzentuiert, dass Bedeutungen sich nicht nur wandeln, sondern in Praktiken auch heterogen sind. Materialität ist Bestandteil und Ergebnis der sozialen Praktiken: „Kultur [ist] immer auch materiale Kultur, aber die Materialität ist keine physikalische oder biologische Größe. Sie ist eine praktisch hergestellte Materialität, die mit anderen Materialien und Praktiken netzwerkartig verknüpft ist.“ (Hörning/Reuter 2004, 12) Unter praxeologischer Perspektive, die Wirtschaften als (interaktionsökonomisch zu denkendes) individuelles wie kollektives, auf Generierung von Neuem in eine prinzipiell offene Zukunft gerichtetes Handeln in Bezug auf etwas konzipiert, bilden kollektive, kulturelle Wissensrepertoires, die inkorporiert und performativ in den Praktiken eingesetzt werden, die Voraussetzung gleichartiger Handlungsformen. Dabei werden einzelne Handlungen als Teil von kollektiven Handlungsgefügen erklärt und nicht einseitig aus Eigenschaften, Absichten, Strebungen und anderen mentalen Charakteristika der Individuen hergeleitet. In den sozialen Praktiken konkretisiert sich Ökonomie als Sinnstiftung (sensemaking economics) (vgl. Svetlova 2008). Ganz im Sinne von Berghoff/Vogel, die betonen: „Jedes Wirtschaftssystem und alles ökonomische Handeln basiert auf Sinnkonstruktionen und produziert zugleich selber Sinn, wirkt also kulturschaffend.“ (Berghoff/Vogel 2004, 13). Damit wird ein qualitativer Sprung gemacht von mental-kognitiven Modellen, die institutionell eingebettet und hierarchisch organisiert sind, zu praxeologisch-fundierten Kon- Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 22 zepten, in denen kollektive Wissensrepertoires die Routinen und Kompetenzen der Akteure strukturieren und von diesen performativ hervorgebracht und verändert werden. Die Theorie des Performativen legt den Fokus auf die Herstellung bzw. Bedeutungskonstruktion in den Praktiken der Akteure. Dabei geht es um die Austauschprozesse, Veränderungen und Dynamiken, die bestehende Strukturen auflösen und neue herausbilden. Daraus ergeben sich Perspektiven für eine prozessuale Theorie der Ökonomie, in der die Praktiken und Interdependenzen zwischen den Akteuren im Zentrum stehen und die (ökonomische) Produktion (Anbieterseite) und Konsumtion (Nachfragerseite) rekursiv aufeinander bezogen sind. „[Theories of practice] present pluralistic and flexible pictures of the constitution of social life that generally hypostatized unities, root order in social contexts, and/or successfully accommodate complexities, differences and particularities.“ (Schatzki 1996, 12) Neben der Pluralität und Komplexität sozialer Praxis repräsentieren Praktiken „both social order and individuality“ (Schatzki 1996, 13). Der Begriff der Praxis, der jenen des Handelns ergänzt, ermöglicht es, die Bedeutung der kulturellen Repertoires gegenüber dem willkürlichen Wollen (zweckorientiert: homo oeconomicus) und normativen Sollen (normorientiert: homo sociologicus) zu untersuchen. In Ergänzung zur Praxistheorie Pierre Bourdieus, der sozial klassifizierte Praktiken direkt auf einen sozial determinierten und ständig improvisierten Habitus zurückführt (vgl. Bourdieu 1976), verfolgt dieser Ansatz ein Konzept, in dem Repertoires zwischen inkorporierten Wissens- und Bedeutungsbeständen und realisierten Praktiken vermitteln. Somit stehen die Prozesse des Hervorbringens, des Gebrauchens als „Herstellung“ von Kultur im Zentrum. In diesem Kontext haben Hörning/Reuter (2004) den Begriff des „doing culture“ für Kultur in ihrem praktischen Vollzug eingeführt. Als Quelle dieser Konzeptualisierung lässt sich zum einen die in den 1960er Jahren im Umfeld des Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies (BCCCS) unter der Leitung von Stuart Hall gegründete kulturwissenschaftliche Forschungsrichtung der Cultural Studies anführen; andererseits finden sich in der kulturwissenschaftlichen Fokussierung der Performativität entsprechende Ansätze. Die Cultural Studies erweiterten den Gegenstand von der Hoch- zur Alltagskultur. Neben Bild- und Wortquellen wurden religiöse, ethnische wie soziale Rituale, Lebensstile, habituelle Muster des Agierens, Objekte materieller Kultur sowie Techniken der gesellschaftlichen Reproduktion und Naturbearbeitung als „gleichberechtigt“ anerkannt. Diese bilden zusammen den konstruktiven Rahmen und die Erzeugungsweisen einer Kultur. Bedeutungen werden als sozial konstruiert definiert und können nicht endgültig fixiert werden, sondern unterliegen Verschiebungen: „As a social account of consumption, the biggest gain is in recognizing that things do not have inherent meanings: meanings and things are socially organized.” (Slater 1997, 138) Die Cultural Studies betonen den kreativen Umgang mit kulturellen Gegenständen. So wird jugendkultureller Konsum als Bricolagepraxis untersucht und als Prozess des Deu- Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 23 tens und Umdeutens von Gütern, Freizeitaktivitäten, Musik und Kleidung in spezifische Sinnmuster bezeichnet (vgl. Hebdige 1979): „This kind of analysis – of people using the meanings of things, subverting them, squaring impossible circles of social contradiction through style – depends upon acknowledging, firstly, that things have many different, changing and contradictory meanings (they are polysemic) and secondly that things can be the sites of struggle over meaning in and through which people contest, invert, reinvent, appropriate things in line with their own developing social practices.” (Slater 1997, 166) Auch in der kulturwissenschaftlichen Fokussierung der Performativität, die seit Anfang der 1990er Jahre einen Perspektivwechsel in der Kulturtheorie markiert, gelangen gegen die Vorstellung einer Eigendynamik bzw. Wesenhaftigkeit von Kultur das Prozesshafte und die Kontingenz in den Fokus. Erfasst der linguistic turn Kulturen und einzelne kulturelle Phänomene als strukturierten Zusammenhang von Zeichen (Symbolische Codes, Mythen) und definiert diese als Sprache (Text, Lektüre, Diskurs) im Sinne eines Zeichensystems (Semiotik), so rückt der performative turn mit den Tätigkeiten des Herstellens, des Produzierens und des Machens die Handlungen als praktische Dimension der Herstellung kultureller Bedeutungen und Erfahrungen (z.B. Rituale, Zeremonien, Feste, Spiele etc.) (vgl. Wulf/Zirfas 2004) ins Zentrum. Der handlungsorientierte performative turn widmet sich den Austauschprozessen, den Veränderungen und Dynamiken, die bestehende Strukturen auflösen und neue herausbilden. Von dem amerikanischen Sprachwissenschaftler John L. Austin 1955 unter dem Titel „How to do things with words“ zur Beschreibung von Sprechakten eingeführt (vgl. FischerLichte 2004, 31ff.), verbreitet sich seit Judith Butlers 1990 publiziertem Aufsatz „Performative Acts and Gender Constitution. An Essay in Phenomenology and Feminist Theory“ der Begriff des Performativen für das Gemachtsein von Sprache und Wirklichkeit. Butler verwendet den Begriff ganz explizit für körperliche Handlungen. So wird der Körper entbiologisiert und als Ergebnis eines performativen Vorgangs des wiederholten und weitgehend unbewussten Zitierens von Geschlechternormen definiert. Geschlechtsidentität ist nach Butler das Ergebnis spezifischer kultureller Konstruktionsleistungen. „In this sense, gender is in no way a stable identity or locus of agency, from which various acts proceed; rather, it is …an identity instituted through a stylized repetition of acts.“ (Butler 1990, 270) Den Prozess der performativen Erzeugung von Identität bestimmt Butler als „a manner of doing, dramatizing and reproducing of historical situation“ (Butler 1990, 271). Durch die stilisierte Wiederholung performativer Akte werden bestimmte historisch-kulturelle Möglichkeiten verkörpert und zugleich der Körper als ein historisch-kultureller markiert (vgl. Fischer-Lichte et al. 2005, 236f.; Fischer-Lichte 2004, 36ff.). Fischer-Lichte kommt im Anschluss daran zu der Definition: „Der Begriff des Performativen bezeichnet die Eigenschaft kultureller Handlungen, selbstreferentiell und wirklichkeitskonstituierend zu sein.“ (Fischer-Lichte et al. 2005, 234). Die Perspektive der Performativität hat nicht nur die kulturwissenschaftliche Handlungstheorie weiter geführt, sondern auch die Neufassung des Identitätskonzepts als unabgeschlossenem und uneindeutigem insgesamt geprägt. Hörning/Reuter greifen diesen Ansatz im Begriff des „doing culture“ auf: Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 24 „Doing culture sieht Kultur in ihrem praktischen Vollzug. Es bezeichnet ein Programm, das den praktischen Einsatz statt die vorgefertigten kognitiven Bedeutungs- und Sinnstrukturen von Kultur analysiert. Es zielt auf die Pragmatik von Kultur; auf Praxiszusammenhänge, in die das Kulturelle unweigerlich verwickelt ist, in denen es zum Ausdruck kommt, seine Verfestigung und seinen Wandel erfährt. Die praktischen Verhältnisse des sozialen Lebens lassen Kultur erst zu ihrer Wirkung gelangen. Damit treten Fragen nach der praktischen Hereinnahme, des konkreten Vollzugs und der Reproduktion von Kultur, aber auch Fragen nach ihrer ungleichen Verteilung und Handhabung in den Vordergrund.“ (Hörning/Reuter 2004, 10) Doing culture bezeichnet kollektive Handlungsgefüge. Das praxeologische Konzept geht von einer dreiteiligen Handlungserklärung aus: Unbewusste Aktionen, kollektive Wissensbestände und die Kompetenz der Akteure gliedern den Handlungsprozess. In unbewussten Aktionen sind soziale Routinen und Gepflogenheiten als ‚eingespielte Handlungsprozeduren’ übersubjektiv eingebettet in Routinen sozialer Interaktionsprozesse (Erziehungspraktiken, Praktiken der privaten Lebensführung, Zeitpraktiken, Kommunikationspraktiken, Praktiken der Verhandlung, Arbeitspraktiken, Praktiken der politischen Debatte). Kollektive Wissensbestände finden als kollektives Bedeutungs- und Handlungswissen ihren impliziten Ausdruck, ohne mit der verbalisierten Einsicht der Akteure in ihre soziale Welt gleichgesetzt zu sein. Kollektive Wissensbestände bilden die Voraussetzung gleichartiger Handlungsformen. Schließlich ist die Kompetenz der Akteure im Praxiszusammenhang handlungsstrukturierend. Soziale Praktiken sind außerdem stets doppelt bestimmt als Wiederholung (Routine) und als Neuerschließung (Reflexion). Sie stützen sich auf Vorhandenes („Repertoires“) und sind produktiv als In-Gang-Setzen von Verändertem. Kultur ist in diesem Zusammenhang ein doppelseitiges Repertoire: Es besteht aus ‚aufgezeichneten’ kulturellen Wissensbeständen (culturally based knowledge) und aus kulturellem Können als ‚Wissen-wie’ (doing knowledge). Repertoires an kulturellen Wissens- und Bedeutungsbeständen, die in vielfältigen Formen (Rituale/Zeremonien, Symbolische Codes /Mythen, Texte/Diskurse, Modelle/Regelwerke, Artefakte/Technologien) aufgezeichnet, gespeichert und innerhalb und zwischen den gesellschaftlichen Gruppen und Generationen selektiv übertragen werden, bezeichnet Crane als „recorded culture“ (Crane 1994, 2f.). Andererseits besteht Kultur aus Repertoires an praktischem Wissen und interpretativem Können, die erst die kulturellen Wissens- und Bedeutungsbestände in der Praxis zur Wirkung bringen. Im Zentrum der neuen Praxistheorien steht damit der Begriff des ‚Wissens’. Wissen erscheint als Konglomerat von kontingenten Sinnmustern, die auf kulturspezifische Weise alltägliche Sinnzuschreibungen und somit ein Verstehen ermöglichen wie regulieren. Reckwitz spricht im Zusammenhang sozialer Praktiken von der „Inkorporiertheit“ des Wissens und der „Performativität“ des Handelns (Reckwitz 2004, 45). Mit Blick auf die beiden im Forschungsprojekt WENKE2 untersuchten Empiriefelder wurde zu dieser praxistheoretischen Fundierung ein Modell entwickelt, das Abbildung 1 wiedergibt. Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung Culturally-based Knowledge (Hintergrundwissen) Praxisfeld „privater Energiekonsum“ (energetische Praxis) Praxisfeld „Ernährung“ (alimentäre Praxis) Texte Diskurse Symbolische Codes Mythen Modelle, Regelwerke Doing Knowledge (Kulturelles Können) Performativität des Handelns Inkorporiertheit des Wissens Akteure Rituale Zeremonien 25 Ökostrom Solarthermie Repertoire an kulturellen Wissens- und Bedeutungsbeständen (recorded culture) Repertoire an praktischem Wissen und interpretativem Können Ökologisierung Regionalität Produkte Technologien Wiederholung (Routine) und Neuerschließung (Reflexion) Fair Trade Abb. 1: Modell des praxeologischen Ansatzes mit Blick auf zwei Empiriefelder (Quelle: eigene, nach Antoni-Komar 2006) Zwar können wir nicht von der Macht kultureller Regel- und Bedeutungsstrukturen absehen, doch sind diese kulturellen Vorgaben als „Rahmungen“ zu verstehen, die in den sozialen Praktiken als Hintergrundwissen existieren und implizit in die Praktiken eingehen und sich verändern, in der kulturellen Kompetenz der Akteure eine performative, d.h. kreative und explorative Auslegung erlangen. Dies beinhaltet die Unberechenbarkeit, Unsicherheit und Kontingenz sozialer Praktiken. Reckwitz (2003, 294ff.) identifiziert vor allem vier Eigenschaften sozialer Praktiken, die deren Unberechenbarkeit und Offenheit für kulturellen Wandel begründen: 1. Kontextualität kann mit Ereignissen, Personen, Handlungen, Objekten und Selbstreaktionen konfrontieren, für deren Behandlung die Routinen nicht die notwendigen ‚tools’ zur Verfügung stellen. Folgen sind Misslingen, Modifikation oder Wechsel der Routinen. 2. Zeitlichkeit als subjektive Zeit des Handelnden bedeutet Zukunftsungewissheit und Sinnverschiebung. Zeitliche Abstände und unterschiedliche räumliche Orte können Verschiebungen mit sich bringen. 3. Lose gekoppelte Komplexe von Praktiken in sozialen Feldern und Lebensformen können Konkurrenz und Mehrdeutigkeit darstellen. 4. Die Struktur des Subjekts als ein lose gekoppeltes Bündel von Wissensformen kann Unberechenbarkeit im historisch-spezifischen Praxiskomplex bedingen. Gleichzeitig werden unterschiedliche, heterogene, auch widersprechende Formen praktischen Wissens inkorporiert und praktiziert; diese ergeben ein Potenzial für Unberechenbarkeit und Transformation. An dieser Stelle sei trotz aller Zukunftsoffenheit und Kontingenz noch einmal auf die in Kapitel 2 angeführte (historische) Pfadabhängigkeit verwiesen. Nach unserer Auffassung beinhalten soziale Praktiken Teile eines kulturellen Programms als kollektive Wissensre- Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 26 pertoires, für das sich verschiedene Pfade identifizieren lassen. Shmuel Eisenstadt plädiert dafür, die Gegenwartsgesellschaft und die Moderne als eine Geschichte der Formierung und Neukonstitution multipler, sich wandelnder und oft strittiger und miteinander konfligierender „Modernen“ (multiple modernities) (Eisenstadt 2007) zu lesen. Als wesentliche Elemente einer kulturalistischen Ökonomik, die auf praxeologischen Ansätzen basiert, leiten wir daraus ab: Ökonomische Praxis ist historisch kontextualisiert (Temporalität) und Teil eines kulturellen Programms, das durch die Ambivalenz temporaler Pfade (multiple modernities) gekennzeichnet ist. So steht die Konsumkultur des 20. Jahrhunderts im Kontext kapitalistischer Industrialisierungsprozesse, die eine Ökonomisierung der sozialen Praktiken bewirken, indem sie z.B. ein Versprechen der Entlastung (Technisierung und Beschleunigung), des Erlebens (Subjektivierung) und der Erkenntnis (Verwissenschaftlichung) geben. Gleichzeitig geht von diesen temporalen Pfaden (vgl. Spiekermann 2008) als Kontinuitäten eine wachsende Dynamik der Steigerung aus, die zu Entmündigung, Überforderung, Orientierungsverlust und Entfremdung der Konsumentinnen und Konsumenten führt.17 In unserer Definition ökonomischen Handelns als (interaktionsökonomisch zu denkendem) individuellem wie kollektivem, auf Generierung von Neuem in eine prinzipiell offene Zukunft gerichteten Handeln in Bezug auf etwas geht es um ein Handeln im kulturellen Kontext, das situativ bzw. temporalisiert erfolgt und der subjektiven Identitätskonstruktion (biographical narratives; Giddens 1991, 5) dient. Abbildung 2 verdeutlicht die theoretische Konzeption am Beispiel der beiden Empiriefelder energetische und alimentäre Praxis, die den empirischen Analysen von Modul 5 im Projekt WENKE2 zugrunde liegt. 2 Subjektive Identitätskonstruktion „biographical narratives“ 3 Bedeutung temporaler Pfade „multiple modernities“ Energetische Praxis Alimentäre Praxis Demonstrative Logik Technisierung Politische Logik Beschleunigung Biographische Logik Subjektivierung Rituale 1 Kollektive Wissensrepertoires (Routine und Erfahrung/Kompetenz) Culturally based Knowledge Doing Knowledge Verwissenschaftlichung Lernprozesse Produkte Diskurse Symbolische Codes Modelle Kontextualität und Temporalität sozialer Praxis Abb. 2: Theoretische Konzeption zur Kontextualität und Temporalität sozialer Praxis (Quelle: eigene Darstellung) Vgl. zur Steigerungsdynamik Shove 2003, 170: „I suggest that the diffusion and appropriation of things like freezers, washing machines and answerphones paradoxically increases problems of scheduling and co-ordination and inspires the search for new, yet more convenient arrangements. In addition … reliance on convenient solutions has the cumulative effect of redefining what people take for granted.” 17 Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 27 Aus dem Vorgetragenen wird deutlich: die zeitgenössische (Kultur-)Soziologie liefert hervorragendes Material dafür, eine angemessene und zukunftsfähige Definition ökonomischen Handelns weiter auszuarbeiten. Wenn – aus guten Gründen – in der Ökonomik Forschungen zu Glück, Zufriedenheit usw. verstärkt werden, dann ergeben sich gerade für doing culture gute theoretische Anschlussmöglichkeiten: so stellt Amartya Sen in seiner Konzeption von Lebensqualität die menschlichen Fähigkeiten (capabilities) in den Mittelpunkt. Er schlägt vor, welfare als capabilities zu fassen, d.h. als individuelle Wahlmöglichkeiten und Wahlfreiheit. Denn der materielle Lebensstandard sei wenig aussagekräftig im Hinblick auf die Lebensqualität: „Tatsächlich sagt uns der Güterbesitz allein angesichts der faktischen interpersonellen Verschiedenheit, die auf Faktoren wie Alter, Geschlecht, natürliche Gaben, Behinderungen und Krankheiten beruhen, recht wenig darüber, was für ein Leben diese Menschen führen können. Das Realeinkommen ist daher ein dürftiger Indikator der verschiedenen Komponenten des Wohlergehens und der Lebensqualität, die Menschen vernünftigerweise anstreben. Allgemeiner gesagt: Bewertende Urteile sind beim Vergleich des individuellen Wohlergehens oder der Lebensqualität unverzichtbar.“ (Sen 2000, 100) 8 Reichweite und Grenzen der Wissenschaft: Glück als das gelingen könnende Leben – die praktizierte Ökonomie der Nachhaltigkeit In Weiterführung einer Überlegung von Wilber (Wilber 1999, 42ff.) haben wir schon an früherer Stelle darauf hingewiesen, dass die Entwicklung der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften im 20. Jahrhundert Theorien, die Akteure zu bloßen Beobachtungsobjekten degradiert haben (Verhaltens- und Systemtheorien), einseitig privilegiert hat gegenüber anderen Theorien, die so weit möglich Bedingungen und Probleme veränderungswilliger (individueller wie kollektiver) Akteure aufklären könnten (Handlungs- und Kulturtheorien) (vgl. Pfriem 2000, 442). Dafür, klüger mit unserer Definition von ökonomischem Handeln als (interaktions-ökonomisch zu denkendem) individuellem wie kollektivem, auf Generierung von Neuem in eine prinzipiell offene Zukunft gerichteten Handeln in Bezug auf etwas umgehen zu können, haben die vorherrschenden Theorien des 20. Jahrhunderts wenig gebracht. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts erleben wir, wie im zweiten Abschnitt analysiert, einen erneuten Anlauf solcher Theorien, die über den Einsatz quantifizierender Methoden auf wissenschaftliche Reputationseffekte setzen, bei denen die Menschen freilich abermals zu individuellen Manipulationsobjekten zu verkommen drohen, unter Absehung von den wirklichen wie möglichen ökonomischen Verhältnissen.18 Ein solcher Typ von Wissenschaft ist beseelt von dem Gedanken, vor nichts halt machen zu müssen. Bei unserer kulturalistischen Definition des ökonomischen Handelns sieht das anders aus: ab einer nicht präzise bestimmbaren Grenze zählt nur noch das Handeln und nicht mehr die Deutungsmacht der mathematisch und biologisch fundierten Wissenschaften19. Wissenschaft hat hier zu beherzigen, Diese Feststellung richtet sich selbstverständlich nicht allgemein gegen den Einsatz empirischer Methoden. Etwa im Projekt WENKE² (www.wenke2.de) verwenden wir eine Vielzahl und Vielfalt davon. So können z.B. computergestützte Simulationen agentenbasierter Modelle außerordentlich nützlich sein. Siehe dazu Lehmann-Waffenschmidt 2008. 19 Siehe Hüttemann 2008: „Kurzum, es gibt eine neue Deutungsmacht der Biowissenschaften, die mit dem Selbstverständnis von Psychologie und Geisteswissenschaften kollidiert“ (11). 18 Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 28 dass nicht alles vermessen werden kann und nicht alles vermessen werden darf. Und das ist auch gut so. Sowieso sind wissenschaftliche Überlegungen wie auch unsere immer bezogen auf Verhältnisse, deren substantielle Komponenten weit hinausgehen über das, was sie wenigstens ansatzweise behandeln können. Wir haben mit diesem Text etwa ungefähr nichts gesagt zu der Geldsteuerung der Wirtschaft unter dem Gesichtspunkt, dass der geldbasierte Fremdversorgungsmechanismus immer weniger Raum lässt für Prozesse der Selbstversorgung, nichts dazu, dass aus Arbeitsteilung in vielen Fällen Kompetenz vernichtende Überspezialisierung geworden ist, und irgendwie auch nichts dazu: wie viel Hoffnung noch bleibt. Dazu, kulturelle Phänomene zu verstehen, z.B. ob Menschen (als individuelle wie kollektive Akteure) die mit dem Handeln verbundenen Freiräume jenseits von (imperialen) Ansprüchen der Wissenschaft erneut schließen mit Gottesreligionen oder sonstigen metaphysischen Glaubensvorstellungen oder wirkliche Freiheit für sich finden, können quantitativ messende Wissenschaften vermutlich wenig beitragen. In ihrer kulturellen Dimension sind diese Phänomene Analysegegenstand der Kulturwissenschaften, die sich mit sozialen Praktiken als komplexen, dynamischen Netzwerken des Kulturellen auseinandersetzen. Hier kommt natürlich aber auch die Frage nach den Grenzen wissenschaftlicher Untersuchungen insgesamt auf: auch Wissenschaften, die sich als Möglichkeitswissenschaften versuchen, können über die Einlösung dieser Möglichkeiten letztlich so viel nicht sagen. Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 9 29 Zitierte Literatur Akerlof, G.A./Kranton, R.E. (2000): Economics and Identity, in: Quarterly Journal of Economics, Vol. 115, Issue 3, 715-753 Alchian, A.A. (1950): Uncertainty, evolution, and economic theory, in: Journal of Political Economy 58, 211-221 Arthur, B. (1989): Competing Technologies and Lock-in Historical Events, in: Economic Journal, 99, 116-131 Bauman, Z. (1995): Postmoderne Ethik, Hamburg Antoni-Komar, I./Pfriem, R./Raabe, T./Spiller, A. (Hrsg.) (2008): Ernährung, Kultur, Lebensqualität. Wege regionaler Nachhaltigkeit, Marburg Antoni-Komar, I. (2006): Ernährungskultur als alimentäre Praxis. Oder: Die Grenzen der bloßen Beschreibung, in: Pfriem, R./Raabe, T./Spiller, A. (Hrsg.): OSSENA – Das Unternehmen nachhaltige Ernährungskultur, Marburg, 53-98 Berger, P.L. (1986): The Capitalist Revolution. Fifty Propositions about Prosperity, Equality, and Liberty, New York Berghoff, H./Vogel, J. (2004): Wirtschaftsgeschichte als Kulturgeschichte. Ansätze zur Bergung transdisziplinärer Synergiepotentiale, in: dies. (Hrsg.): Wirtschaftsgeschichte als Kulturgeschichte. Dimensionen eines Perspektivenwechsels, Frankfurt/M. et al., 9-41 Beschorner, Th. et al. (2005): Institutionalisierung von Nachhaltigkeit. Eine vergleichende Untersuchung der organisationalen Bedürfnisfelder Bauen & Wohnen, Mobilität und Information & Kommunikation, Marburg Beyer, J. (2006): Pfadabhängigkeit: Über institutionelle Kontinuität, anfällige Stabilität und fundamentalen Wandel. Frankfurt/M. Biebricher, Th. (2004): Kulturelle Vielfalt und ihre Bewertung. Probleme und Lösungsansätze in der Vergleichenden Politikwissenschaft, in: Mandry, Ch. (Hrsg.): Kultur, Pluralität und Ethik. Perspektiven in Sozialwissenschaften u. Ethik, Münster, 39-60 Bocock, R. (1993): Consumption, London Boulding, K.E. (1972): Toward the Development of a Cultural Economics, in: Social Science Quarterly, Vol. 53, No. 2, September, 267-284 Bourdieu, P. (1976): Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen Grundlage der kabylischen Gesellschaft, Frankfurt/M. Buenstorf, G. (2007): A Transition towards Sustainability Based on Consumer Learning?, Jena Buenstorf, G./Cordes, Ch. (2008): Can Sustainable Consumption Be Learned?, Jena Butler, J. (1990): Performative Acts and Gender Constitution. An Essay in Phenomenology and Feminist Theory, in: Case, S.-E. (Ed.): Performing Feminism, Baltimore/Ldn. Camerer, C./Loewenstein, G./Prelec, D. (2005): Neuroeconomics: How Neuroscience can inform Economics, in: Journal of Economic Literature XLIII, 9-64 Castoriadis, C. (1984): Gesellschaft als imaginäre Institution. Entwurf einer politischen Philosophie, Frankfurt/M. Costanza, R./Cumberland, J./Daly, H./Goodland, R./Norgaard, R. (2001): Einführung in die Ökologische Ökonomik, Stuttgart Crane, D. (1994): The Sociology of Culture. Emerging Theoretical Perspectives, Oxford, Cambridge Daly, H.E. (1996): Beyond Growth, Boston Daly, H.E. (1977): Steady state economics, San Francisco Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 30 Darwin, Ch. (2002, orig. 1871): Die Abstammung des Menschen, Stuttgart Darwin, Ch. (1963, orig. 1859): Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl, Stuttgart Denzau, A.T./North, D.C. (1994): Shared Mental Models: Ideologies and Institutions, in: Kyklos, Jg. 47, 3-31 DiMaggio, P.J. (1988): Interest and agency in institutional theory, in: Zucker, L.G. (Hrsg.): Institutional Patterns and Organizations, Cambridge, 3-21 Eisenstadt, S.N. (2007): Multiple modernities: Analyserahmen und Problemstellung, in: Bonacker, T./Reckwitz, A. (Hrsg.): Kulturen der Moderne. Soziologische Perspektiven der Gegenwart, Frankfurt/M., New York, 19-45 Engels, E.-M. (2007): Charles Darwin, München Faber, M./Manstetten, R. (2007): Was ist Wirtschaft? Von der Politischen Ökonomie zur Ökologischen Ökonomie, Freiburg Fischer-Lichte, E. (2004): Ästhetik des Performativen, Frankfurt/M. Fischer-Lichte, E./Kolesch, D./Warstat, M. (2005): Metzler Lexikon Theatertheorie, Stuttgart, Weimar. Georgescu-Roegen, N. (1971): The Entropy Law and the Economic Process, Cambridge, London Giddens, A. (1991): Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age, Cambridge Giddens, A. (1984): The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration, Cambridge Granovetter, M. (1985): Economic Action and Social Structure. The Problem of Embeddedness, in: American Journal of Sociology 91, 1985, 481-510 Hebdige, D. (1979): Subculture: The Meaning of Style, London Herrmann-Pillath, C. (2002): Grundriss der Evolutionsökonomik, Teil 2, im Internet veröffentlicht unter www.evolutionaryeconomics.net Heuser, U.J. (2008): Humanomics. Die Entdeckung des Menschen in der Wirtschaft, Frankfurt/M., New York Hirschman, A.O. (1980): Leidenschaften und Interessen. Politische Begründungen des Kapitalismus vor seinem Sieg, Frankfurt/M. Hodgson, G.M. (2004): The evolution of institutional economics. Agency, structure and Darwinism in American Institutionalism, London, New York Hörning, K.H./Reuter, J. (Hrsg.) (2004): Doing Culture. Neue Positionen zum Verhältnis von Kultur und sozialer Praxis, Bielefeld Hüttemann, A. (Hrsg.) (2008): Zur Deutungsmacht der Biowissenschaften, Paderborn Hutcheson, F. (2002, orig. 1726): An Inquire into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue, 2. Ed., Chestnuthill Jevons, W.S. (1970, orig. 1871): The Theory of Political Economy, Harmondsworth Kahneman, D. (2003): Maps of Bounded Rationality: Psychology for Behavioural Economics, in: American Economic Review 93, Nr. 5, 1449 – 1475 Kahneman, D./Tversky, A. (1979): Prospect Theory of Decision under Risk, in: Econometrica 47, Nr. 2263 – 291 Kimminich, Eva (Hrsg.) (2003): Kulturelle Identität. Konstruktion und Krisen, Frankfurt/M. Latouche, S. (2004): Die Unvernunft der ökonomischen Vernunft, Zürich Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 31 Layard, R. (2005): The New Happiness, London Lehmann-Waffenschmidt, C. (2008): Konzeption einer Integration der theoretischen Ansätze des WENKE2-Projektes in ein agentenbasiertes Modell für nachhaltige Konsummuster (MONAKO). Quantitative Szenarien zum Praxisfeld Ernährung, unter Mitarbeit von Antes, R./Antoni-Komar, I./Fichter, K./Kühling, J./LehmannWaffenschmidt, M./Pfriem, R./Welsch, H./Woersdorfer, S., Oldenburg (WENKE2Diskussionspapier; abrufbar unter www.wenke2.de) Lucas, R.E. (1988): On the Mechanics of Economic Development, in: Journal of Monetary Economics 22, 3-42 Luhmann, N. (1988): Die Wirtschaft der Gesellschaft, Frankfurt/M. Luhmann, N. (1984): Soziale Systeme, Frankfurt/M. Meyer, J.W./Rowan, B. (1977): Institutionalized Organizations: Formal structure as myth and ceremony, San Francisco Myrdal, G. (1976): Das politische Element in der nationalökonomischen Doktrinbildung, Bonn-Bad Godesberg Nelson, R.R./Winter, S.G. (1982): An evolutionary theory of economic change, Cambridge North, D.C. (1992): Institutionen, institutioneller Wandel u. Wirtschaftsleistung, Tübingen Pfriem, R. (2007): Wollen können und können wollen. Die vermeintlichen Anpasser sind die Gestalter, in (Hrsg.) Pfriem, R.: Unsere mögliche Moral heißt kulturelle Bildung. Unternehmensethik für das 21. Jahrhundert, Marburg, 163-184 Pfriem, R./Raabe, T./Spiller, A. (Hrsg.) (2006): OSSENA – Das Unternehmen nachhaltige Ernährungskultur, Marburg Pfriem, R. (2004): Unternehmensstrategien sind kulturelle Angebote an die Gesellschaft, in: Forschungsgruppe Unternehmen und gesellschaftliche Organisation (Hrsg.): Perspektiven einer kulturwissenschaftlichen Theorie der Unternehmung, Marburg, 375-404 Pfriem, R. (2000): Jenseits von Böse und Gut. Ansätze zu einer kulturwissenschaftlichen Theorie der Unternehmung, in (Hrsg.) Beschorner, Th./Pfriem, R.: Evolutorische Ökonomik und Theorie der Unternehmung, Marburg, 437-476 Pierson, P. (2000): Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics, in: The American Political Science Review (94), 251-269 Powell, W.W./DiMaggio, P.J. (1991): The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago Priddat, B.P. (2007) (Hrsg.): Neuroökonomie. Neue Theorien zu Konsum, Marketing und emotionalem Verhalten in der Ökonomie, Marburg Reckwitz, A. (2001): Der Identitätsdiskurs. Zum Bedeutungswandel einer sozialwissenschaftlichen Semantik, in: Rammert, W. (Hrsg.): Kollektive Identitäten und kulturelle Innovationen. Ethnologische, soziologische und historische Studien, Leipzig, 21-38 Reckwitz, A. (2003): Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken: Eine sozialtheoretische Perspektive, in: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 32, Heft 4, 282-301 Reckwitz, A. (2004): Die Reproduktion und die Subversion sozialer Praktiken. Zugleich ein Kommentar zu Pierre Bourdieu und Judith Butler, in: Hörning, K.H./Reuter, J. (Hrsg.): Doing culture. Neue Positionen zum Verhältnis von Kultur und soziale Praxis, Bielefeld, 40-54 Reckwitz, A. (2005): Das Subjekt des Konsums in der Kultur der Moderne. Der kulturelle Wandel der Konsumtion, in: Rehberg, K.-S. (Hrsg): Soziale Ungleichheit – kulturelle Unterschiede, Wiesbaden 2005, 424-436 Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 32 Reckwitz, A. (2006): Das hybride Subjekt. Eine Theorie der Subjektkulturen von der bürgerlichen Moderne zur Postmoderne, Göttingen Renn, J./Straub, J. (2002): Transitorische Identität, in: dies. (Hrsg.): Transitorische Identität. Der Prozesscharakter des modernen Selbst, Frankfurt/M., 10-31 Schatzki, T.R. (1996): Social Practices. A Wittgensteinian Approach to Human Activity and the Social, Cambridge Schefold, B. (1994): Wirtschaftsstile. Bd. 1: Studien zum Verhältnis von Ökonomie und Kultur, Frankfurt/M. Schumpeter, J.A. (1993, orig. 1950): Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, Tübingen Schumpeter, J.A. (1947): The Creative Response in Economic History, in: Journal of Economic History, 7, 1947, Nov., 149-159 Shove, E. (2003): Comfort, Cleanliness and Convenience. The social Organization of Normality, Oxford, New York Sen, A. (1977): Rational Fools: A Critique of the Bahavioral Foundations of Economic Theory, in: Philosophy and Public Affairs, Vol. 6, No. 4 (Summer, 1977); 317-344 Sen, A. (1993): Capability und Well-Being, in: Nussbaum, M./Sen, A. (Hrsg.): The Quality of life. A Study prepared for the World Institute for Development Economics Research (WIDER) of the United Nations University, Oxford, 30-53 Sen, A. (2000): Ökonomie für den Menschen. Wege zur Gerechtigkeit und Solidarität in der Marktwirtschaft, München Sen, A. (2007): Die Identitätsfalle. Warum es keinen Krieg der Kulturen gibt. Aus dem Englischen von Friedrich Griese, München Simon, H.A. (1968): Theories of Decision-Making in Economics and Behavioural Science, Surveys of Economic Theory, Vol. III, London Simon, H.A. (1957): Models of Man. Social and rational. Mathematical essays on rational human behavior in a social setting, New York Simmel, G. (1989, orig. 1900): Philosophie des Geldes. Georg Simmel Gesamtausgabe, Bd. 6, Frankfurt/M. Sombart, W. (1913): Der Bourgeois. Zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen, Berlin Sombart, W. (1967, orig. 1922): Liebe, Luxus und Kapitalismus, München Sombart, W. (1987, orig. 1916-1927): Der moderne Kapitalismus, München Slater, D. (1997): Consumer Culture and Modernity, Cambridge Smith, A. (1776): An Inquire into the nature and causes of the wealth of nations, London Smith, A. (2004, orig. 1759): Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg Spiekermann, U. (2008): Ausdifferenzierung des Selbstverständlichen. Essen und Ernährung in Deutschland seit der Hochindustrialisierung, in: Antoni-Komar, I./Priem, R./Raabe, T./Spiller, A. (Hrsg.) (2008): Ernährung, Kultur, Lebensqualität. Wege regionaler Nachhaltigkeit, Marburg, 19-40 Svetlova, E. (2008): Sinnstiftung in der Ökonomik. Wirtschaftliches Handeln aus sozialphilosophischer Sicht, Bielefeld Tanner, J. (2004): Die ökonomische Handlungstheorie vor der „kulturalistischen Wende“? Perspektiven und Probleme einer interdisziplinären Diskussion, in: Berghoff, H./ Vogel, J. (2004) (Hrsg.): Wirtschaftsgeschichte als Kulturgeschichte. Dimensionen eines Perspektivenwechsels, Frankfurt/M., New York, 69-98 Taylor, Ch. (1985a): Self-interpreting animals, in: ders.: Human Agency and Language. Philosophical Papers 1, Cambridge, 45-76 Kulturalistische Ökonomik. Vom Nutzen einer Neuorientierung 33 Taylor, Ch. (1985b): Interpretation and the Sciences of Man (zuerst 1971), in: ders.: Philosophical Papers 2, Cambridge, 14-57 Tolbert, P.S./Zucker, L.G. (1996): The Institutionalization of Organizational Theory, in: Nord, Walter R. (Hrsg.): Handbook of Organizational Studies, London, 175-189 Veblen, Th. (1981, orig. 1899): Theorie der feinen Leute. Eine ökonomische Untersuchung der Institutionen, Frankfurt/M. Walgenbach, P. (2006): Neoinstitutionalistische Ansätze in der Organisationstheorie, in: Kieser, A./Ebers, M. (Hrsg.): Organisationstheorien, 6. Auflage, Stuttgart Walgenbach, P. (2000): Die normgerechte Organisation. Eine Untersuchung über die Entstehung, Verbreitung und Nutzung der DIN EN ISO 9000er Normenreihe, Stuttgart Weber, M. (1905): Die protestantische Ethik und der ‚Geist‘ des Kapitalismus, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 20, 1-54 Wilber, K. (1999): Das Wahre, Schöne, Gute. Geist und Kultur im 3. Jahrtausend, Frankfurt/M. Witt, U. (2007): Firms as Realizations of Entrepreneurial Visions, Journal of Management Studies 44: 7, Oxford Witt, U. (2006): Evolutionsökonomik – ein Überblick, in: Ökonomie und Gesellschaft, Jahrbuch 19, Marburg, 17-59 Witt, U. (2004): Beharrung und Wandel – ist wirtschaftliche Evolution theoriefähig?, in: ErwägenWissenEthik, Jg. 15, Heft 1, Paderborn, 33-45 Witt, U. (2003): Evolutionary Economics and the extension of evolution to the economy, in Hrsg. Ders.: The Evolving Economy. Essays on the Evolutionary Approach to Economics, Cheltenham/Northampton, 3-34 Wulf, Ch./Zirfas, J. (2004) Hrsg.): Die Kultur des Rituals. Inszenierungen, Praktiken, Symbole, München Zucker, L.G. (1977): The Role of Institutionalization in Cultural Persistence, in: American Sociological Review 42, 726-743