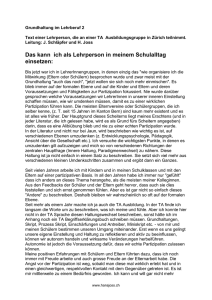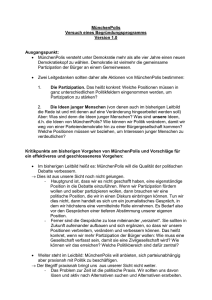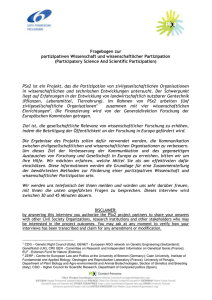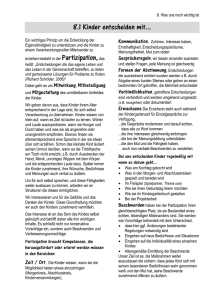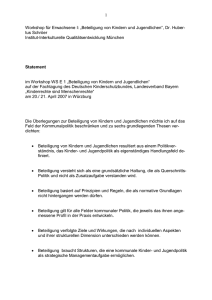Beteiligung von Kindern und Jugendlichen – eine Frage politischer
Werbung
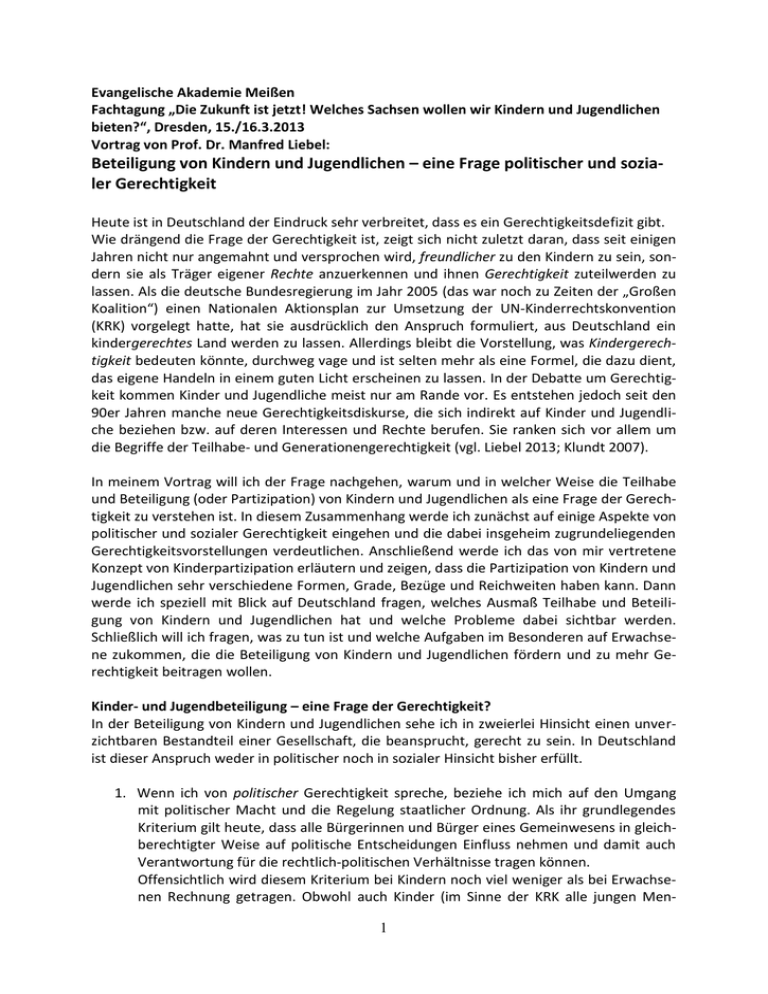
Evangelische Akademie Meißen Fachtagung „Die Zukunft ist jetzt! Welches Sachsen wollen wir Kindern und Jugendlichen bieten?“, Dresden, 15./16.3.2013 Vortrag von Prof. Dr. Manfred Liebel: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen – eine Frage politischer und sozialer Gerechtigkeit Heute ist in Deutschland der Eindruck sehr verbreitet, dass es ein Gerechtigkeitsdefizit gibt. Wie drängend die Frage der Gerechtigkeit ist, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass seit einigen Jahren nicht nur angemahnt und versprochen wird, freundlicher zu den Kindern zu sein, sondern sie als Träger eigener Rechte anzuerkennen und ihnen Gerechtigkeit zuteilwerden zu lassen. Als die deutsche Bundesregierung im Jahr 2005 (das war noch zu Zeiten der „Großen Koalition“) einen Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention (KRK) vorgelegt hatte, hat sie ausdrücklich den Anspruch formuliert, aus Deutschland ein kindergerechtes Land werden zu lassen. Allerdings bleibt die Vorstellung, was Kindergerechtigkeit bedeuten könnte, durchweg vage und ist selten mehr als eine Formel, die dazu dient, das eigene Handeln in einem guten Licht erscheinen zu lassen. In der Debatte um Gerechtigkeit kommen Kinder und Jugendliche meist nur am Rande vor. Es entstehen jedoch seit den 90er Jahren manche neue Gerechtigkeitsdiskurse, die sich indirekt auf Kinder und Jugendliche beziehen bzw. auf deren Interessen und Rechte berufen. Sie ranken sich vor allem um die Begriffe der Teilhabe- und Generationengerechtigkeit (vgl. Liebel 2013; Klundt 2007). In meinem Vortrag will ich der Frage nachgehen, warum und in welcher Weise die Teilhabe und Beteiligung (oder Partizipation) von Kindern und Jugendlichen als eine Frage der Gerechtigkeit zu verstehen ist. In diesem Zusammenhang werde ich zunächst auf einige Aspekte von politischer und sozialer Gerechtigkeit eingehen und die dabei insgeheim zugrundeliegenden Gerechtigkeitsvorstellungen verdeutlichen. Anschließend werde ich das von mir vertretene Konzept von Kinderpartizipation erläutern und zeigen, dass die Partizipation von Kindern und Jugendlichen sehr verschiedene Formen, Grade, Bezüge und Reichweiten haben kann. Dann werde ich speziell mit Blick auf Deutschland fragen, welches Ausmaß Teilhabe und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen hat und welche Probleme dabei sichtbar werden. Schließlich will ich fragen, was zu tun ist und welche Aufgaben im Besonderen auf Erwachsene zukommen, die die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen fördern und zu mehr Gerechtigkeit beitragen wollen. Kinder- und Jugendbeteiligung – eine Frage der Gerechtigkeit? In der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sehe ich in zweierlei Hinsicht einen unverzichtbaren Bestandteil einer Gesellschaft, die beansprucht, gerecht zu sein. In Deutschland ist dieser Anspruch weder in politischer noch in sozialer Hinsicht bisher erfüllt. 1. Wenn ich von politischer Gerechtigkeit spreche, beziehe ich mich auf den Umgang mit politischer Macht und die Regelung staatlicher Ordnung. Als ihr grundlegendes Kriterium gilt heute, dass alle Bürgerinnen und Bürger eines Gemeinwesens in gleichberechtigter Weise auf politische Entscheidungen Einfluss nehmen und damit auch Verantwortung für die rechtlich-politischen Verhältnisse tragen können. Offensichtlich wird diesem Kriterium bei Kindern noch viel weniger als bei Erwachsenen Rechnung getragen. Obwohl auch Kinder (im Sinne der KRK alle jungen Men1 schen, die jünger als 18 sind) inzwischen als Rechtssubjekte anerkannt sind, verfügen sie nicht über dieselben politischen Rechte wie Erwachsene und können selbst die ihnen zugestandenen Rechte aufgrund ihres relativ machtlosen Status nur in eingeschränkter Weise ausüben. Um im politischen Sinne als gerecht zu gelten, müsste gewährleistet sein, dass Kinder und Jugendliche auf die für ihr gegenwärtiges und künftiges Leben (und das künftiger Generationen) relevanten Entscheidungen in maßgeblicher Weise Einfluss ausüben können. 2. Wenn ich von sozialer Gerechtigkeit spreche, beziehe ich mich auf den Zugang zu materiellen und geistigen Gütern einer Gesellschaft, z.B. Lebensmittel, Information oder Bildung. Soziale Gerechtigkeit erfordert, dass diese Güter für alle Mitglieder eines Gemeinwesens ungeachtet ihrer individuellen Ausstattung in annähernd gleicher Weise erreichbar sind. Darin ist eingeschlossen, dass Personen, die aufgrund persönlicher Eigenschaften oder Lebensverhältnisse vergleichsweise geringe Zugangsmöglichkeiten zu lebenswichtigen Gütern haben, einen Ausgleich erhalten, der ihrer sozialen Benachteiligung entgegenwirkt (gemeinhin als kompensatorische Gerechtigkeit bezeichnet). Während traditionellerweise unter sozialer Gerechtigkeit die Verteilung der Güter verstanden wird („Verteilungsgerechtigkeit“), wird heute zunehmend auch von der Teilhabe an den Ressourcen eines Gemeinwesens gesprochen („Teilhabegerechtigkeit“), oder es wird auf die Verwirklichungschancen von Bedürfnissen und die zu erreichende Lebensqualität Bezug genommen („Befähigungsgerechtigkeit“). Mit Blick auf Kinder ist ähnlich wie bei der politischen Gerechtigkeit auch bei der sozialen Gerechtigkeit zu konstatieren, dass ihnen der eigenständige Zugang zu materiellen und geistigen Gütern nur in eingeschränktem Maße möglich ist und dass sie gegenüber Erwachsenen sozial benachteiligt sind. Zudem ist zu konstatieren, dass auch innerhalb der Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen ein erhebliches und sogar wachsendes Maß an sozialer Ungleichheit existiert („ungleiche Kindheiten“). Je größer die soziale Ungleichheit und je größer die Gruppe der sozial benachteiligten Kinder und Jugendlichen sind, desto geringer ist ihre Chance, sich an den für sie wichtigen Fragen durch eigenes Handeln zu beteiligen. Soziale Gerechtigkeit ist also nicht nur ein denkbares Ergebnis, sondern auch eine Voraussetzung dafür, sich maßgeblich in der Gesellschaft zu beteiligen. Wenn heute von Kinder- und Jugendbeteiligung (oder ihrer Partizipation) die Rede ist, wird durchweg an Projekte oder Modelle gedacht, die für oder mit Kindern und Jugendlichen eingerichtet werden. Dabei geht leicht unter, dass Partizipation zunächst eine Frage des täglichen Lebens jenseits aller pädagogischen oder rechtlichen Erwägungen ist. Als soziale Wesen haben Menschen jedweden Alters am gesellschaftlichen Leben teil. Sie sind Akteure, äußern ihre Bedürfnisse, organisieren ihr Leben, versuchen ihre Umwelt mitzugestalten, positionieren sich im Verhältnis zu anderen Menschen, stecken ihre Einflusssphären ab, übernehmen Aufgaben, kommen Verpflichtungen nach oder widersetzen sich ihnen. Auch Kinder und Jugendliche tun dies, je nach Alter und Lebenssituation in besonderer Weise, und es kommt darauf an, die verschiedenen Äußerungsformen als Formen von Partizipation oder als entsprechenden Anspruch zu verstehen und ernst zu nehmen. Partizipation kann nicht nur viele Formen annehmen, sondern auch viele Bedeutungen haben, sowohl für den Einzelnen als auch für seine Mitmenschen oder die Gesellschaft insgesamt. Während der Terminus Partizipation an sich ein leerer Begriff ist, der auf verschiedene 2 Weise gefüllt werden kann, sind in den Partizipationsdiskursen und -konzepten immer normative Komponenten enthalten in dem Sinne, dass in ihnen Erwartungen darüber mitschwingen, was wünschenswert und angemessen ist, wie weit Partizipation gehen und worauf sie sich beziehen soll, welchen Zweck sie erfüllen soll, wer von ihr profitieren soll, usw. Diese normativen Komponenten liegen nur selten offen zu Tage und eine der wichtigsten Aufgaben sehe ich darin, diese verborgenen Seiten, unausgesprochenen Ziele und uneingestandenen Folgen von Partizipation sichtbar zu machen. Im Folgenden will ich einige verborgene Seiten und Probleme des Partizipationsdiskurses und seiner Bezüge zur Frage der Gerechtigkeit beleuchten, insbesondere soweit er auf Kinder bezogen ist und in Praxiskonzepte oder Programme umgesetzt wird. Der Schwerpunkt liegt auf der Partizipationspraxis in Deutschland. Beginnen will ich mit einer Reflexion über die im deutschen Sprachraum gebräuchlichen Begriffe. Kinderpartizipation – was ist das? Partizipation bedeutet im Wortsinne, Teil eines größeren Ganzen zu sein. Deshalb wird im Deutschen auch von Teilnahme, Teilhabe oder Beteiligung gesprochen. In den Sozialwissenschaften werden die Begriffe vor allem in zweierlei Weise verwendet. Unter Teilhabe wird die Art und Weise verstanden, in der Menschen Zugang zu den Prozessen, Institutionen, Gütern und Leistungen einer bestimmten Gesellschaft haben. Je nachdem wie eine Gesellschaft strukturiert ist, kann diese Teilhabe für einzelne Menschen oder soziale Gruppen größer oder geringer sein. In diesem Sinne wird auch von einem Kontinuum oder Spannungsfeld zwischen sozialer Inklusion und Exklusion gesprochen. Eine Gesellschaft mit großer sozialer Ungleichheit ist durch ein hohes Maß an Exklusion gekennzeichnet, d.h. es besteht eine große Diskrepanz zwischen den Teilhabechancen einer privilegierten Minderheit und einer benachteiligten Mehrheit. Beispiele hierfür sind der Zugang zum Bildungssystem, die Höhe des Einkommens und verfügbaren Vermögens oder die Repräsentation im politischen System. Die andere Bedeutung, die meist mit den Begriffen Partizipation, Teilnahme oder Beteiligung ausgedrückt wird, bezieht sich auf die Art und Weise, in der Individuen oder soziale Gruppen ihren freien Willen zum Ausdruck bringen, Entscheidungen treffen oder Einfluss auf Entscheidungen nehmen können. In der Partizipationsforschung besteht heute Übereinstimmung, dass Partizipation nicht nur im formalen Sinn als Mitgliedschaft oder Mitwirkung in bestimmten Institutionen zu verstehen ist, sondern als aktives Handeln bei allen denkbaren Gelegenheiten und in allen gesellschaftlichen Bereichen, seien sie privat oder öffentlich, individuell oder kollektiv. Als politische Partizipation zum Beispiel wird nicht nur die Teilnahme an Wahlen, sondern die Mitwirkung an allen Angelegenheiten und in allen Bereichen des Gemeinwesens verstanden, welche Form auch immer diese Mitwirkung annimmt. Wenn im Besonderen von Kinder- und Jugendpartizipation gesprochen wird, wird implizit vorausgesetzt, dass für diese Altersgruppe spezifische Bedingungen gelten, die sich von denen Erwachsener unterscheiden, z.B. alters- oder generationsspezifische Interessen, besondere Verletzlichkeit, Schutzbedürftigkeit oder Entwicklungserfordernisse. Im Falle des erstgenannten Verständnisses von Partizipation (Teilhabe) stellt sich die Frage, wie das bestmögliche Leben und die Entwicklung der nachwachsenden Generationen zu gewährleisten ist, sei es im Sinne von Generationengerechtigkeit, sei es im Sinne von Teilhabegerechtigkeit und 3 der damit einhergehenden Abschaffung oder Vermeidung von Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, nationaler, ethnischer oder sozialer Herkunft, Sprache, Religion, politischer Anschauung, Vermögen, Behinderung oder des sonstigen Status des Kindes oder seiner Eltern (vgl. Art. 2.1 KRK). Im Falle des zweitgenannten Verständnisses von Partizipation (Beteiligung, Teilnahme) stellt sich die Frage, wie die Gleichberechtigung von Jung und Alt bei Entscheidungen über die Gegenwart und Zukunft der Kinder als nachwachsenden Generationen zu erreichen ist. Folgen wir der UN-Kinderrechtskonvention, so ist bei allen Entscheidungen das „beste Interesse des Kindes“ (im Amtsdeutsch das „Kindeswohl“) vorrangig zu berücksichtigen (vgl. Art 3.1 KRK). Allerdings wird Kinderpartizipation in der Praxis meist in einem wesentlich eingeschränkteren Sinne verstanden. Als „kindgemäße“ Partizipation wird sie in pädagogischen Institutionen oder als eine Art Vorform oder symbolische Form politischer Mitsprache an besonderen Orten jenseits der Erwachsenensphäre lokalisiert. Sie basiert auf der Annahme einer Trennung von Erwachsenen- und Kindheitssphäre und rüttelt daran auch nicht. Kindheit wird nicht als integraler Teil des Gemeinwesens, sondern als Vorstadium und Entwicklungsetappe auf dem Weg zum (vermeintlich rational denkenden und handelnden) Erwachsenen definiert. Dementsprechend wird Kinderpartizipation vornehmlich von Erwachsenen und zu Lernzwecken konzipiert. Zwar ist mitunter auch ein Einfluss auf die Entscheidungen von Erwachsenen vorgesehen, dieser verbleibt jedoch im Rahmen von Konsultationen, bei denen den Erwachsenen weitgehend freisteht, den artikulierten Ansichten und Erwartungen der Kinder zu folgen. Direkte Entscheidungsbefugnisse der Kinder sind nicht vorgesehen, insoweit sie über den Bereich persönlicher Lebensgestaltung hinausgehen. Kinderpartizipation – wie weit geht sie und worauf ist sie gerichtet? Die in der Praxis vorzufindende Begrenzung der Partizipation von Kindern ist immer wieder zum Anlass genommen worden, in kritischer Absicht verschiedene Grade oder Stufen der Partizipation zu unterscheiden und Kriterien hierfür zu formulieren. Am häufigsten geschieht dies in Form von Typologien, die auf das (Macht-)Verhältnis von Kindern einerseits und Erwachsenen andererseits Bezug nehmen. Die bekannteste Typologie dieser Art stammt von dem US-amerikanischen Psychologen Roger Hart und wurde erstmals 1992 in einer englischsprachigen UNICEF-Publikation veröffentlicht (Hart 1992; dt. erstmals in Liebel 1994). Hart unterteilt die Partizipation von Kindern in acht Stufen: 1. Manipulation, 2. Dekoration, 3. Symbolische Partizipation, 4. Kinder werden informiert, 5. Kinder werden konsultiert und informiert, 6. Partizipation wird von den Erwachsenen initiiert, Entscheidungen von den Kindern mitgetragen, 7. Partizipation wird von den Kindern initiiert und dirigiert, 8. Sie wird von den Kindern initiiert und von den Erwachsenen mitgetragen. Die ersten drei Stufen wertet Hart als Scheinpartizipation, während sich ab der vierten Stufe die wirkliche Partizipation bis hin zur genuinen oder authentischen Partizipation entwickelt. Einen Fall von Manipulation sieht Hart z.B. gegeben, wenn Vorschulkindern Schilder umgehängt werden, auf denen gegen eine bestimmte Politik protestiert wird, ohne dass die Kinder wissen und begreifen, worum es sich handelt. Als Beispiel von Dekoration gilt ihm, wenn Kindern T-Shirts geschenkt werden, mit denen sie auf einer Tanz- oder Sportveranstaltung Propaganda für ein Ereignis machen, an dessen Organisation sie nicht mitwirken können. Eine lediglich symbolische Form von Partizipation sieht Hart z.B. gegeben, wenn Kinder eingeladen werden, sich im Namen anderer Kinder in einer Podiumsdiskussion zu äußern, ohne dass sie sich vorab sachkundig machen und eine eigene Meinung bilden können und ohne 4 dass die angeblich vertretenen Kinder die Möglichkeit erhalten, an der Auswahl ihrer „Sprecher“ und ihrer Meinungsbildung mitzuwirken. Die diversen Formen von Scheinpartizipation sieht Hart gebündelt, wenn Kinder von Erwachsenen für ein bestimmtes Ziel mobilisiert werden, ohne selbst den Mobilisierungsprozess und das Ziel beeinflussen zu können. Wirkliche Partizipation beginnt für Hart dort, wo die Kinder als Partner respektiert und zumindest informiert werden, bevor mit ihnen etwas unternommen oder in ihrem Namen gehandelt wird. Zumindest müssten die Kinder begreifen können, worum es geht, darüber informiert werden, wer die Entscheidungen trifft, eine signifikante (und nicht nur dekorative) Rolle in dem Prozess spielen und sich nach vorheriger Information freiwillig für eine Beteiligung entscheiden können. Je höher er in der Partizipations-Leiter klettert, desto schwerer fällt es Hart, passende Beispiele aus der Praxis zu finden. Den wichtigsten Grund hierfür sieht er darin, „dass die Erwachsenen im allgemeinen nicht fähig sind, auf die Initiativen der Kinder zu antworten. […] Es fällt ihnen schwer, auf eine Führungsrolle zu verzichten“ (Hart 1992, S. 14). Harts Partizipations-Leiter wurde von dem deutschen Pädagogen Richard Schröder (1995) auf neun Stufen erweitert und in folgender Weise modifiziert: 1. Fremdbestimmung, 2. Dekoration, 3. Alibi-Teilhabe, 4. Teilhabe, 5. Zugewiesen, aber informiert, 6. Mitwirkung, 7. Mitbestimmung, 8. Selbstbestimmung, 9. Selbstverwaltung. Bei Mitbestimmung geht die Initiative zwar auch von Erwachsenen aus, aber die Entscheidungen werden gemeinsam mit den Kindern getroffen. Bei Selbstbestimmung handelt es sich um ein Projekt, das die Kinder selbst initiieren, dessen Gestaltung aber von Erwachsenen mitgetragen wird oder das im Rahmen einer bestehenden Organisation stattfindet. Bei der Selbstverwaltung haben die Kinder als Gruppe völlige Entscheidungsfreiheit und es liegt in ihrem Belieben, Erwachsene (z. B. als Berater) hinzuzuziehen oder nicht. Der wichtigste Unterschied zwischen beiden Typologien besteht darin, wie die höchsten Stufen konzipiert sind. Die höchste Stufe ist bei Hart erreicht, wenn Erwachsene die Ziele der Kinder teilen und unterstützen; bei Schröder, wenn Kinder selbst Entscheidungen treffen können. Darin kommt ein unterschiedliches Verständnis der gewünschten Stellung der Kinder in der Gesellschaft und der entsprechend anzustrebenden Partizipationsformen zum Ausdruck. An der Typologie von Hart ist denn auch gelegentlich kritisiert worden, sie basiere auf einem paternalistischen Verständnis von Partizipation, da sie sich diese selbst in ihren höchsten Graden nur unter der Obhut von Erwachsenen vorstellen könne. Die Typologien, die die Partizipation von Kindern nach Graden unterscheiden, kreisen um das Machtverhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen und sollen dazu beitragen, dieses zugunsten der Kinder zu verschieben. Ihr Wert liegt in der Einfachheit, und sie wurden vielfach von Organisationen, die mit Kindern arbeiten, aufgegriffen, um das erreichte Ausmaß an Partizipation zu messen. Ihr Nachteil ist, dass sie statisch sind und weder erlauben, das Nebeneinander verschiedener Formen von Partizipation in derselben Initiative, noch Übergänge von einer Form zur anderen zu erfassen. Die Typologien basieren auf vereinfachenden Dichotomien und werden der dynamische Natur und Widersprüchlichkeit von Machtbeziehungen nicht gerecht. Außerdem erfassen sie die verschiedenen situativen und soziokulturellen Kontexte nicht, in denen die Partizipation der Kinder verortet ist und erst ihre je spezifische Bedeutung erlangt. Sie geben auch keine Auskunft über die Ziele und Reichweite der Partizipation. Bei den höheren Stufen bleibt ungeklärt, ob die Partizipation der Kinder nur 5 auf ihre „eigenen Angelegenheiten“ bezogen ist oder auch die bisher den Erwachsenen vorbehaltenen Angelegenheiten berührt und deren Entscheidungen tatsächlich beeinflusst. Ein grundlegendes Problem vieler Partizipationsvorhaben besteht darin, dass sie von Erwachsenen ausgedacht und in einem funktionellen oder instrumentellen Sinn verstanden werden (Top-Down-Perspektive).1 Nach diesem Verständnis zählt vor allem ihr „Nutzen“, und sie wird nur so lange „eingesetzt“, wie sie dem Kalkül (der Erwachsenen) entspricht. Sie dient dann in erster Linie dazu, bei den Kindern Identifikation zu erzeugen und Widerstände abzubauen. Eine so verstandene Partizipation liegt etwa in der Schule nahe, um „schulmüde“ Kinder „bei der Stange zu halten“ und dazu zu bringen, sich mehr anzustrengen, oder um Konflikte mit „aufsässigen“ Kindern zu vermeiden. Oder bei kommunalpolitischen Planungsvorhaben wird durch die Einbeziehung von Kindern (und Jugendlichen) eine größere Effizienz oder ein „innovativer“ Standortvorteil im interkommunalen Wettbewerb gesehen (vgl. Olk & Roth 2007, S. 50 ff.). Ein Indiz für den instrumentellen Einsatz von Partizipation ist, wenn davon geredet wird, dass Kinder „beteiligt werden“ oder „einbezogen werden“ sollen, also als eine Art Objekte betrachtet werden, mit denen etwas geschieht oder unternommen wird. Um ein grundlegend anderes Verständnis von Partizipation handelt es sich, wenn diese in einem existentiellen Sinn und als ein Recht verstanden wird, das einem Menschen zusteht, egal ob es jemandem nützt oder nicht. Nach diesem Verständnis ist Partizipation ein inhärenter Bestandteil des handelnden Subjekts, die dessen Handlungsraum erweitert und es davor bewahrt, zum Objekt für heteronome Zwecke degradiert zu werden. Mit der UNKinderrechtskonvention wurde auch Kindern dieses Recht prinzipiell zugesprochen, wenn auch in eingeschränktem, an deren „Reife“ und „Fähigkeit“ gebundenem Maß.2 Dem Verständnis von Partizipation als Recht liegt ein Menschenbild zugrunde, demzufolge jeder Mensch daran interessiert ist und prinzipiell dazu fähig ist, von diesem Recht Gebrauch zu machen. Um beurteilen zu können, ob dieses Verständnis von Partizipation Kindern und ihrer Emanzipation und Gleichberechtigung tatsächlich zugutekommt, ist allerdings auch hier nach den dahinterstehenden Interessen und den konkreten Realisierungsbedingungen zu fragen. Nur so kann ermittelt werden, ob Kinder ihr Recht auf Partizipation überhaupt in Anspruch nehmen können und die Partizipation für sie einen Sinn ergibt (vgl. Liebel 2009, S. 29 ff.). Kinderrechtsbasierte Partizipationsansätze vernachlässigen oft einen solchen Bezug zu den konkreten Lebensumständen und Interessen der Kinder. Sie beschränken sich darauf, den Sinn von „Rechten“ und von „Demokratie“ auch für Kinder als (potenzielle) Bürgerinnen und Bürger zu beschwören, oder tendieren dazu, die Partizipation der Kinder als ein bildungspolitisches 1 Allerdings gibt es vereinzelt auch Versuche von Erwachsenen, Projekte zu initiieren, die von den Kindern selbst weiter entwickelt werden sollen, wobei den Kindern infrastrukturelle Unterstützung (z. B. eine Webseite oder finanzielle Mittel für die Veranstaltung eines Treffens) zur Verfügung gestellt wird. 2 Siehe Art. 12.1 KRK: „Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.“ Die britische Kindheitswissenschaftlerin Priscilla Alderson (2008, S. 86) weist darauf hin, dass dieses Prinzip der „evolving capacities“ in einem kontrollierenden und schutzbetonten oder in einem emanzipatorischen Sinn verstanden und umgesetzt werden kann. Im emanzipatorischen Sinn wird es im jüngsten General Comment Nr. 12 (2009) des UN-Komitees für die Rechte des Kindes über das „Recht, gehört zu werden“, interpretiert (siehe http://www2.ohchr.org/). 6 oder pädagogisches Mittel zu verstehen, sie zu „richtigen“ und „kompetenten“ Bürgerinnen und Bürgern „heranzubilden“.3 Sie sind also ebenso wenig wie am Nutzen orientierte Partizipationsansätze davor gefeit, Kinder für heteronome Zwecke zu instrumentalisieren. Wie steht es um die Teilhabe von Kindern in Deutschland? Wie ich zuvor zeigte, können die Begriffe Partizipation, Beteiligung oder Teilhabe verschiedene Bedeutungen haben. In einem UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland (Bertram 2008) wird unter Teilhabe der Zugang zum „gesellschaftlichen Ressourcenreichtum“ (a.a.O., S. 11) verstanden, insoweit er dem „kindlichen Wohlbefinden“ und der individuellen Entwicklung des Kindes dient. Den Kindern sollen hierfür „unabhängig von ihrer Lebensform oder dem kulturellen Hintergrund ihrer Eltern, vom Wohnort, aber auch unabhängig von ihrem Geschlecht und ihrer Religion“ (ebd.) die gleichen Chancen zur Verfügung stehen. Das kindliche Wohlbefinden wird in die Dimensionen „materielles Wohlbefinden, Bildung, Gesundheit, persönliche Sicherheit, Beziehung zu den Eltern und zu Freunden und persönliches Wohlbefinden“ (a.a.O., S. 12) aufgeschlüsselt. Diese erstmals im Ländervergleich angewandte Definition von Teilhabe hat den Vorteil, dass sie neben dem materiellen mehrere Aspekte der Lebenssituation von Kindern gewichtet und dabei auch die Sichtweise und das Empfinden der Kinder berücksichtigt. Schon der Titel des Berichts „Mittelmaß für Kinder“ drückt aus, dass Deutschland im Vergleich zu anderen sog. entwickelten oder wohlhabenden Ländern nicht mehr als einen Mittelplatz einnimmt, also – gemessen an seinen Möglichkeiten – nicht gerade als besonders kindergerecht gelten kann. Unter den europäischen Ländern schneiden die Niederlande, Schweden, Finnland und sogar Spanien wesentlich besser ab (zumindest war das vor einigen Jahren so). Die Leiterin des UNICEF-Forschungszentrums Innocenti in Florenz, Marta Santos Pais (2008, S. 225), kommentiert: „Das Wohlbefinden von Kindern wird auch in Industriestaaten trotz guter wirtschaftlicher Entwicklung und allgemeinem Fortschritt in beunruhigendem Ausmaß durch Marginalisierung und Ausgrenzung überschattet.“ Millionen von Kindern werden allein in Deutschland strukturell und willentlich oder durch Unterlassung notwendiger politischer Entscheidungen massiv in ihren Rechten verletzt. Der frühere Kinderbeauftragte von Nordrhein-Westfalen, Reinald Eichholz (2008), sieht darin sogar ein „eklatantes Rechtsstaatsdefizit“, welches das Sozialstaatsdefizit noch verschärft. Er bezieht sich dabei auf Art. 4 KRK, der die Vertragsstaaten verpflichtet, „alle geeigneten Maßnahmen zur Verwirklichung der in diesem Übereinkommen (KRK; Anm. ML) anerkannten Rechte“ zu treffen. Um von einer – gemessen an den vorhandenen Ressourcen – adäquaten Teilhabe sprechen zu können, müsste der sozialen Benachteiligung, Marginalisierung und Ausgrenzung all dieser Kinder ernsthaft begegnet werden. Aber auch dies wäre nicht genug. Der Teilhabe-Begriff des UNICEF-Berichts ist nützlich, um die komplexen Prozesse von Marginalisierung und Ausgrenzung und damit die Verletzung fundamentaler Kinderrechte zu erkennen. Aber er greift zu kurz, wenn wir die Kinder als aktive Subjekte von Rechten ins Auge fassen, die selbst eine wesentliche Rolle bei der Umsetzung und Ausgestaltung ihrer Rechte spielen. Mit anderen Worten: Während Teilhabe im Sinne des UNICEF-Berichts vor allem auf soziale Integration zielt, käme es auch darauf an, die 3 Olk & Roth (2007, S. 45) machen darauf aufmerksam, dass sich bei pädagogischen und bildungspolitischen Begründungen der Fokus vom „kompetenten“ zum „lernenden“ Kind verschiebt. 7 Emanzipation der Kinder aus unnötigen und unverschuldeten Abhängigkeiten ins Auge zu fassen und mit allen möglichen Mitteln zu fördern.4 Dies würde auch bedeuten, Bedingungen zu schaffen, die Kindern ermöglichen, den vollen sozialen Bürgerstatus (vgl. Liebel 2009, S. 107 ff.) im Sinne einer „gleichberechtigten Teilhabe“ (Fraser 2003) zu erlangen. Nur dann ließe sich davon sprechen, dass auch bei Kindern wirkliche „demokratische Teilhabegerechtigkeit“ (Brettschneider 2007, S. 368) gewährleistet ist. Vor welchen Problemen steht die Partizipationspraxis? Seit den 1980er Jahren sind in Deutschland tatsächlich zahlreiche Modelle und Projekte entworfen und Initiativen gestartet worden, um Kindern mehr Partizipationsmöglichkeiten zu verschaffen und ihre Mitwirkung in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zu steigern. Kaum eine Organisation oder Einrichtung, die mit Kindern zu tun hat oder für Kinderrechte eintritt, versäumt, deren Wichtigkeit zu betonen. Auch die damals amtierende Bundesregierung hatte in ihrem Nationalen Aktionsplan „Für ein kindergerechtes Deutschland 2005 – 2010“ (NAP) (BMFSFJ 2005) betont, sie wolle sich besonders dafür einsetzen, „die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden verbindlich zu regeln“. Kinder- und Beteiligungsrechte sollten in Bildungs- und Erziehungsplänen, Ausbildungs- und Studienordnungen und in spezifischen Weiterbildungsangeboten für einschlägige Fachkräfte verankert werden. Auch im Koalitionsvertrag der gegenwärtig amtierenden schwarz-gelben Bundesregierung findet sich ein deutliches Bekenntnis zur Beteiligung von Kindern: „Wir werden die Partizipation von Kindern und Jugendlichen von Anbeginn fördern und uns dafür einsetzen, dass Kinder und Jugendliche ihre Lebenswelten und die Gesellschaft ihrem Alter gemäß mitgestalten können“ (zit. n. Schneider, Stange & Roth 2011, S. 114). Ein Blick auf die tatsächliche Partizipationspraxis zeigt allerdings, dass sie noch immer weit hinter den formulierten Ansprüchen zurückbleibt. Der viel versprechende Nationale Aktionsplan wurde nur in geringen Teilen umgesetzt und nach seinem Auslaufen Ende 2010 nicht verlängert (vgl. BMFSFJ 2010). Aus der bisher einzigen für Deutschland repräsentativen Untersuchung über den Stand der Kinderpartizipation (Schneider, Stange & Roth 2011)5 geht hervor, dass es nachwievor „in allen Lebensbereichen offensichtlich mehr oder weniger große Kernbestände [gibt], die der Mitwirkung von Kindern entzogen werden“ (a.a.O., S. 117). Unter Einbeziehung anderer Studien (z.B. Betz, Gaiser & Pluto 2010) wird konstatiert, es werde insgesamt „eine enorme Kluft zwischen dem Bekenntnis zu der Begeisterung für Beteiligung einerseits und den realisierten partizipativen Prozessen andererseits deutlich“ (Schneider, Stange & Roth 2011, S. 118). Die Mitbestimmung von Kindern fällt in den Lebensbereichen Familie, Schule und Wohnort sehr unterschiedlich aus. Während die meisten Kinder ein positives Bild ihrer Mitwirkungsmöglichkeiten in der eigenen Familie zeichnen, ist es in der Schule umgekehrt. Jedes vierte Kind gibt an, in der Schule „überhaupt nicht“ mitbestimmen zu können (a.a.O., S. 131). Besonders gering sind die Möglichkeiten in den Bereichen, die unmittelbar die Lehrerautorität berühren, vor allem bei der Notengebung, den Haus- und Klassenarbeiten sowie den Unterrichts- und Pausenregeln (a.a.O., S. 129). Obwohl viele Kinder Interesse zeigen, auch an ihrem Wohnort mitreden zu können, sind hier die entsprechenden Möglichkeiten besonders begrenzt. Mehr als die Hälfte der Kinder bekundet, in 4 In einem nachfolgenden UNICEF-Bericht (Bertram, Kohl & Rösler 2011) wird das Verständnis von Teilhabe im Sinne der Förderung der Selbstachtung und des Gerechtigkeitssinns der Kinder erweitert. 5 Sie basiert auf Befragungen von Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren und ihrer Mütter bzw. Väter. 8 Fragen der kommunalen Lebensgestaltung weder gefragt zu werden noch mitwirken zu können. Bei den Kindern dominiert das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden (a.a.O., S. 147). Auch die in Deutschland geltenden Gesetze zeigen, dass zwischen der im Nationalen Aktionsplan und anderen offiziellen Verlautbarungen verbreiteten Rhetorik, sich für „verbindliche“ Regelungen der Mitwirkung von Kindern einzusetzen, und der geltenden Rechtslage noch immer eine große Lücke klafft. Dies gilt trotz mancher in den letzten Jahren erreichter Fortschritte im Sozial und Kindschaftsrecht, z.B. der Verankerung des Rechts auf gewaltfreie Erziehung, für alle Lebens- und Rechtsbereiche: für das Schul-, Jugendhilfe- und Familienrecht ebenso wie für das Wahl- und Vereinsrecht (vgl. Liebel 2009, S. 148 ff.; Kamp 2009). Hier will ich mich auf den Bereich der Schule und auf Kinder- und Jugendparlamente beschränken. In der Schule unterliegen die Kinder nachwievor einem „besonderen Gewaltverhältnis“, das die vorhandenen Mit- oder Selbstverwaltungsgremien weitgehend zur Farce macht. In verfassungsrechtlicher Sicht stellen Schülerinnen und Schüler (ebenso wie Eltern) ein nichtlegitimiertes „Teilvolk“ dar, das aus seiner unmittelbaren Betroffenheit von staatlichem Handeln in der Schule keinen Anspruch auf besondere Mitwirkungsrechte ableiten kann (vgl. Avenarius & Heckel 2000, S. 117). Die in den Schulgesetzen der Bundesländer für Schülerinnen und Schüler vorgesehenen Partizipationsmöglichkeiten sind fast vollständig auf Informations- und Beratungsrechte beschränkt. Soweit den Schülern eine Mitwirkung gestattet wird, macht sie vor Entscheidungsbereichen halt, die von den Schulbehörden nach eigenem Ermessen als „wesentlich“ eingestuft werden (vgl. Freitag 2007; Kamp 2009, S. 27 ff.). Auch die außerschulischen Kinder- und Jugendparlamente, die in zahlreichen Städten und Kommunen seit den 1990er Jahren entstanden sind, haben nicht das Recht, in Entscheidungen kommunaler oder staatlicher Behörden einzugreifen. Ihre Bedeutung ist eher symbolischer Natur, sie können eine Vorbildwirkung haben, werden aber weitaus häufiger zur Prestigesteigerung kommunaler oder staatlicher Funktionsträger missbraucht (vgl. Berger 2007, S. 125). Zudem springt bei den Kinderparlamenten ins Auge, „dass es die Wortgewandten und ganz Pfiffigen sind, die hier den Ton angeben. So erfreulich der Eindruck sein kann, den diese Veranstaltungen hinterlassen, so problematisch ist aber auch die damit verbundene starke soziale Selektion. Die Kinder und Jugendlichen, die weniger Voraussetzungen für diese Beteiligungsformen mitbringen, haben es schwer, mit ihren Anliegen überhaupt wahrgenommen zu werden“ (Eichholz 2007, S. 48 f.). Angesichts der weitgehenden Folgenlosigkeit solcher „Einübungsformen in demokratische Spielregeln“ stellt sich die Frage, ob nicht stattdessen – auch aus demografischen Gründen – die Frage des Wahlrechts für Kinder endlich ernsthaft angegangen werden müsste. Meines Erachtens sollten Kinder ungeachtet ihres Alters das Recht bekommen, sich an Wahlen auf allen Ebenen zu beteiligen, sobald sie Interesse daran bekunden. Konkrete und praktikable Vorschläge hierzu sind schon mehrfach gemacht worden (vgl. z.B. Weimann 2002; Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen 2008). In diesem Zusammenhang könnten auch die neuen Kommunikationstechnologien stärker genutzt werden, mit denen junge Leute oft schon vertrauter sind als Erwachsene, die aber bisher nur für die Ausgestaltung des Erwachsenenwahlrechts in Erwägung gezogen werden (z.B. die Nutzung der Software von Liquid Democracy bei Plebisziten oder der Aufstellung von kommunalen „Bürgerhaushalten“). Die 9 Ausweitung des allgemeinen Wahlrechts auf Kinder wäre gewiss nicht der einzige Weg, um die Partizipation von Kindern insgesamt voranzubringen, aber er würde die Ernsthaftigkeit der allgegenwärtigen vollmundigen Partizipationsversprechen auf die Probe stellen. Wer die Partizipation von Kindern erleichtern oder fördern und die gesellschaftliche Stellung der Kinder stärken will, kommt nicht umhin, sich über die bestehende, wenig Spielraum bietende Rechtslage klar zu sein, und sollte darauf dringen, sie zu ändern. Geschieht dies nicht, droht der Partizipationsdiskurs, der meist von gut gemeinten pädagogischen Zielsetzungen geleitet ist, zur Partizipationsfolklore zu verkommen und die tatsächliche Bedeutung und Reichweite der praktizierten oder anvisierten Partizipation der Kinder zu vernebeln oder überschätzen. Im Nationalen Aktionsplan hatte die Bundesregierung für die Partizipation von Kindern und Jugendlichen einen hohen Anspruch formuliert: „Gesellschaft und Politik müssen miteinander umdenken: Erforderlich ist eine offenere Grundhaltung gegenüber Kindern und Jugendlichen. Wir müssen ihre Beteiligungsrechte als selbstverständlichen Bestandteil der demokratischen Kultur unserer Gesellschaft akzeptieren, und das muss in der Praxis konkret sichtbar werden: mit entsprechenden Strukturen und mit einer neuen Austarierung von Machtverhältnissen zwischen den Generationen“ (BMFSFJ 2005, S. 51). Bei den seither (und zuvor schon) unternommenen Bemühungen um mehr Partizipation von Kindern lässt sich allerdings nicht erkennen, dass sie mit nennenswerten Strukturveränderungen einhergingen und die bestehenden Machtverhältnisse ernsthaft berührt haben. Es handelt sich fast immer um Projekte, deren Zielsetzungen und Rahmenbedingungen von Erwachsenen vorgegeben werden und die in erster Linie dazu dienen sollen, die Kinder – wie es so schön heißt – mit der Demokratie vertraut zu machen. Über die darin angelegte Top-Down-Perspektive wird wenig reflektiert, sie wird teilweise sogar als unvermeidlich betrachtet, da angenommen wird, die Kinder müssten erst zur Partizipation motiviert und „gebracht“ werden. Damit wird der Eindruck erweckt, die mangelnde Kompetenz der Kinder sei das Problem, statt sich zu fragen, was sich an der Art, Politik zu machen, ändern müsste, um das Interesse der Kinder (wieder) zu gewinnen. Kinder sind aufgrund gesellschaftlicher Strukturen und Bräuche (im Sinne mehrheitlich geteilter Vorurteile und Gewohnheiten) sowie gesetzlicher Einschränkungen („Minderjährige“) zu den eher machtlosen Bevölkerungsgruppen zu rechnen. Dies gilt umso mehr für Kinder, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft und Lebenslage, ihres Geschlechts oder als Angehörige kultureller oder religiöser Minderheiten zusätzlich und mehrfach benachteiligt sind. Erfahrungsgemäß beteiligen sich solche Kinder selten an den üblicherweise angebotenen Partizipationsprojekten. Grund dafür sind nicht zuletzt Erfahrungen von Frustration und Perspektivlosigkeit und das Gefühl, dass diese Projekte wenig mit ihrem Leben zu tun haben und nichts dazu beitragen, die eigene Lebenssituation zu verbessern. Mit Blick auf die Kinder griffe es auch zu kurz, „nur an die formalisierten und meist an die Sprache gebundenen Verfahren demokratischer Willensbildung zu denken; ernst zu nehmen und als Ausdruck der Persönlichkeit zu achten, sind gerade auch die individuellen Ausdrucksformen, durch die sich der Mensch mitteilt und kommunizierend auf die Gestaltung der Umwelt Einfluss nimmt“ (Eichholz 2012, S. 30 f.). In diesem Sinn beginnt Partizipation nicht erst dann, „wenn und soweit Kinder und Jugendliche in der Lage sind, sich der – meist von Erwachsenen vorgegebenen – Mitwirkungsformen zu bedienen“ (a.a.O., S. 31). Zum Beispiel 10 ist als Partizipation zu verstehen und anzuerkennen, wenn sich sehr junge Kinder in der ihnen eigenen Weise mitteilen und ihre Bedürfnisse einfordern. Entsprechend geht es auch im Kindergarten nicht nur um formalisierte Mitentscheidung über Tageslauf und Essensplan, sondern die Fachkräfte müssen im Verhalten der Kinder „lesen lernen“, was Kinder dazu kommunizieren. Gleiches gilt für die Art und Weise, in der sich Kinder ausdrücken, die als behindert gelten oder in „fremden“ kulturellen Zusammenhängen aufwachsen. Wenn Partizipation den Willensbekundungen eines jeden Kindes gerecht werden soll, kann sie nicht in den herkömmlichen Formen stecken bleiben (vgl. z.B. Lutz 2012). Welche Rolle kommt den Erwachsenen zu? Erwachsene können eine wichtige Rolle für das Gelingen der Partizipation von Kindern spielen, sie sind vielleicht sogar unverzichtbar. Sie können Kinder ermutigen, sich mehr zuzutrauen, oder die Kinder stärken, wenn sie mit als zu groß empfundenen Schwierigkeiten konfrontiert sind. Sie mögen Kindern auch Ideen für bestimmte Aktivitäten nahebringen. Aber die Basis ihrer Interventionen sollte sein, die Kinder als Subjekte mit eigenen Erfahrungen, Kompetenzen und Sichtweisen zu respektieren, und sie sollten sich darauf konzentrieren, die rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen für das eigenständige Handeln und die Einflussnahme der Kinder zu verbessern. Es gibt heute nicht wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pädagogischer Einrichtungen, z.B. im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit und in manchen Kindertagesstätten, die so denken und zu handeln versuchen. Sie beißen sich aber meist die Zähne aus an uneinsichtigen oder ängstlichen Vorgesetzten, oder sie scheitern oft an den äußerst begrenzten Befugnissen und finanziellen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Und diese Mittel werden sogar immer weiter beschnitten. Wie soll – so ließe sich fragen – die Partizipation von Kindern vor Ort glaubhaft gefördert werden und über die Symbolpflege demokratischer Spielwiesen hinauskommen, wenn die damit befassten Erwachsenen selbst in ihrem Bereich nichts zu sagen haben oder gar vorab vor unliebsamen Aktionen ihrer Schützlinge gewarnt und mit den Risiken ihrer rechtlichen Verantwortung allein gelassen werden? Leider klafft ein großer Widerspruch zwischen der vollmundigen Partizipationsrhetorik in Regierungs- und Verbandsbroschüren und der tatsächlichen Bereitschaft der politisch Verantwortlichen, sich vor Ort dafür stark zu machen und die eigenen Leute zu ermutigen. Während meiner siebenjährigen Arbeit als Streetworker und Berater in Lateinamerika bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass eine Lösung dieses Problems letztlich nur zu erwarten ist, wenn die Kinder und Jugendlichen selbst den nötigen Druck machen. Erst wenn diese sich in organisierter Weise zu Wort melden und auf ihren Rechten bestehen, vielleicht sogar eigene Rechte formulieren, werden sie ernst genommen und es besteht die Chance, dass sich auch die Strukturen und das Verhalten der politischen Entscheidungsträger ändern. In Lateinamerika hat sich hierfür die Rede vom Protagonismus der Kinder eingebürgert.6 Damit wird ausgedrückt, dass Kinder eine eigene Sicht der Dinge haben und diejenigen sind, die sich am ehesten kompetent und nachdrücklich für ihre Interessen und Rechte einsetzen. Wo sie ge6 Zur Entstehung der Kinderbewegungen in Lateinamerika und der Konzeption des protagonismo infantil vgl. Liebel (1994); zur Entstehung dortigen Kinder- und Jugendprotests gegen soziale Ungleichheit vgl. Liebel (2011). 11 meinsam aktiv werden, stellen sie sich nicht etwa gegen die Erwachsenen und schon gar nicht gegen ihre Eltern (sofern sie welche haben), sondern erwarten, dass diese zu KoProtagonisten werden, die sich in ihrem Leben ebenso engagieren und bewähren, wie sie dies von den Kindern erwarten. Dazu gehört auch, dass sie sich die nötige Unabhängigkeit verschaffen, um gemeinsam für ihre Rechte einzutreten (vgl. Liebel 2009, S. 199 ff.). Fazit: Mögliche Perspektiven von Kinderpartizipation Für die deutschen Verhältnisse könnte dies heißen, sich nicht immer wieder auf neue Partizipationsmodelle und -projekte stürzen, für die geeignete „Zielgruppen“ gesucht werden, sondern genauer hinzusehen, wo im Alltag Kinder und Jugendliche ihre Ansichten oder ihren Unmut ausdrücken und dabei sind, sich für sich und für andere zu engagieren und zu organisieren. Dazu mögen auch Aktivitäten gehören, die nicht besonders fein sind, z.B. die Kritik an Lehrern in Internetportalen, Blockierung des Autoverkehrs oder Graffiti an Hauswänden oder S-Bahn-Zügen. Es kommt drauf an, die Botschaften auch solcher Aktionen zu verstehen und ihnen ggf. zu mehr Resonanz und Wirkung zu verhelfen. Das Gleiche gilt, wie zuvor gezeigt, auch für die Willens- und möglicherweise Protestbekundungen sehr junger Kinder oder von Kindern, die sich nicht in der als „normal“ geltenden Weise artikulieren. Auch diese müssen „entziffert“ und in ihrem jeweiligen Sinngehalt verstanden und aufgegriffen werden.7 Partizipation kann in einem emanzipatorischen Sinn nur zum Zuge kommen, wenn Kinder die Möglichkeit haben, sie selbst in ihrem Interesse und in ihrem Sinn zu handhaben. Unter den in Deutschland gegebenen Bedingungen von struktureller Ungleichheit und kultureller Differenz heißt dies, dass auch besonders benachteiligte, ausgeschlossene oder diskriminierte Gruppen von Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit finden müssen, ihre Perspektiven in der Gesellschaft zur Geltung zu bringen. Dazu gehört zum einen, dass die ihnen unter den gegebenen Bedingungen möglichen und angemessen erscheinenden Artikulationsformen anerkannt werden, und zum anderen, dass Kindern und Jugendlichen Wege geebnet werden, sich in einer Weise einzubringen, die ihnen bedeutungsvoll erscheint. Dabei stellt sich die Frage, wie diejenigen, die sich ungerecht behandelt sehen und mit ihrer Situation unzufrieden sind, ermutigt und „ermächtigt“ werden können, sich zu Wort zu melden. Die Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen macht nur dann Sinn und entspricht dem Gebot politischer und sozialer Gerechtigkeit, wenn sie nicht nur dazu dient, Kinder und Jugendliche in das bestehende Sozialsystem zu integrieren, sondern wenn diese auch die Chance bekommen, über ihre Partizipation dieses System mit zu verändern. Mit anderen Worten: die Institutionen der bestehenden Gesellschaft müssen sich nicht nur für bislang ausgegrenzte Gruppen öffnen, sondern es muss auch eine neue politische Kultur mit neuer politischer Sprache und neuen politischen Praxisformen herausbilden, die nicht länger ausschließend und diskriminierend wirkt. Eigene Initiativen von Kindern und Jugendlichen, die es in Deutschland in beachtlicher Zahl gibt, geben Hinweise darauf, wie eine Partizipationspraxis im Sinne von Emanzipation und Gleichberechtigung der Kinder und Jugendlichen beschaffen sein könnte. Über ihren tatsächlichen Einfluss auf gesellschaftliche Strukturen und politische Entscheidungen besteht keine 7 Die empirischen Studien von van Deth et al. (2007) und des Projekts „Demokratie Leben Lernen“ (Tausendpfund 2008) verweisen darauf, dass auch bereits bei Kindern im Grundschulalter allgemeines politisches Interesse und Urteilsvermögen existieren, die mehr politische Beteiligung nahelegen. 12 Gewissheit. Aber sie tragen gewiss dazu bei, auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen und das Selbstbewusstsein junger Menschen über ihren möglichen Einfluss in der Gesellschaft zu fördern. Literatur Alderson, Priscilla (2008): Young Children’s Rights. London & Philadelphia: Jessica Kingsley. Avenarius, Hermann & Hans Heckel (⁷2000): Schulrechtskunde. Ein Handbuch für Praxis, Rechtsprechung und Wissenschaft. Neuwied: Luchterhand. Berger, Gundel (2007): Rechtlicher Rahmen für die Mitwirkung in der Kommune, in: Bertelsmann Stiftung (2007), S. 115-127. Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.) (2007): Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland. Entwicklungsstand und Handlungsansätze. Gütersloh: Bertelsmann. Bertram, Hans (Hrsg.) (2008): Mittelmaß für Kinder. Der UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland. München: C. H. Beck. Bertram, Hans; Steffen Kohl & Wiebke Rösler (2011): Zur Lage der Kinder in Deutschland 2011/2012. Starke Eltern, starke Kinder. Kindliches Wohlbefinden und gesellschaftliche Teilhabe. Köln: Deutsches Komitee für UNICEF; http://www.unicef. de/fileadmin/content_media/mediathek/AR_003_Zur_Lage_der_Kinder_in_Deutschl and_2011-2012.pdf Betz, Tanja; Wolfgang Gaiser & Liane Pluto (Hrsg.) (2010): Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Forschungsergebnisse und gesellschaftliche Herausforderungen. Schwalbach/Ts.: Wochenschau-Verlag. BMFSFJ (2005): Nationaler Aktionsplan (NAP) „Für ein kindergerechtes Deutschland 20052010“. Berlin: Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. BMFSFJ (2010): Perspektiven für ein kindergerechtes Deutschland. Abschlussbericht des Nationalen Aktionsplans „Für ein kindergerechtes Deutschland 2005-2010“. Berlin: Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Brettschneider, Antonio (2007): Jenseits von Leistung und Bedarf. Zur Systematisierung sozialpolitischer Gerechtigkeitsdiskurse. In: Zeitschrift für Sozialreform, 53(4), S. 365-390. Deutsches Kinderhilfswerk (Hrsg.) (2007): Kinderreport Deutschland 2007. Daten, Fakten, Hintergründe. Freiburg: Velber. Eichholz, Reinald (2007): Das Kindeswohl als Inbegriff der Rechte des Kindes. In: J. Maywald & R. Eichholz: Kindeswohl und Kinderrechte. Orientierungen und Impulse aus der UNKinderrechtskonvention. Expertise im Auftrag des AFET, Sonderveröffentlichung Nr. 9/2007. Hannover: Bundesverband für Erziehungshilfe e.V., S. 37-91. Eichholz, Reinald (2008): Kinderrechte unter „Ausschöpfung der verfügbaren Mittel umsetzen“. Folgerung aus Artikel 4 der UN-Kinderrechtskonvention. In: frühe Kindheit, 11(4), S. 48-49. Eichholz, Reinald (2012): Zum Stand der Umsetzung der Kinderrechtskonvention in Deutschland. In: S. Penka & R. Fehrenbacher (Hrsg.) (2012): Kinderrechte umgesetzt. Grundlagen, Reflexion und Praxis. Freiburg: Lambertus, S. 25-32. Fraser, Nancy (2003): Soziale Gerechtigkeit im Zeitalter der Identitätspolitik – Umverteilung, Anerkennung und Beteiligung. In: N. Fraser & A. Honneth: Umverteilung oder Anerkennung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 13-128. Freitag, Michael (2007): Demokratische Prozesse im „Volk der Schülerinnen und Schüler“. In: Bertelsmann Stiftung, S. 101-113. Hart, Roger A. (1992): Children’s Participation: from tokenism to citizenship. Florenz: UNICEF Innocenti Research Centre. 13 Kamp, Uwe (2009): Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Ein Vergleich der gesetzlichen Bestimmungen in den Bundesländern. Berlin: Deutsches Kinderhilfswerk e.V.; http://dkhw.de/cms/images/downloads/beteiligungsbroschuere_umschlag.pdf Klundt, Michael (2007): Von der sozialen zur Generationengerechtigkeit? Polarisierte Lebenslagen und ihre Deutung in Wissenschaft, Politik und Medien. Wiesbaden: VS-Verlag. Liebel, Manfred (1994): Wir sind die Gegenwart. Kinderarbeit und Kinderbewegungen in Lateinamerika. Frankfurt a.M.: IKO. Liebel, Manfred (2009): Kinderrechte – aus Kindersicht. Wie Kinder weltweit zu ihrem Recht kommen. Berlin & Münster: LIT. Liebel, Manfred (2011): Soziale Ungleichheit und Jugendprotest in Lateinamerika. In: A. Schäfer, M. D. Witte & U. Sander (Hg.) (2011): Kulturen jugendlichen Aufbegehrens. Jugendprotest und soziale Ungleichheit. Weinheim & München: Juventa, S. 137-149. Liebel, Manfred (2013): Kinder und Gerechtigkeit. Über Kinderrechte neu nachdenken. Weinheim & Basel: Beltz-Juventa. Lutz, Ronald (2012), unter Mitarbeit von Corinna Frey, Claudia Nürnberg und Maria Schmidt: Kinderreport Deutschland 2012. Mitbestimmung in Kindertageseinrichtungen und Resilienz. Berlin: Deutsches Kinderhilfswerk. Olk, Thomas & Roland Roth (2007): Zum Nutzen der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. In: Bertelsmann-Stiftung, S. 39-57. Santos Pais, Marta (2008): Kinder als Zukunft: Warum die Lebenssituation von Kindern durch internationale Vergleiche zur Lebenslage verbessert werden kann, in: Bertram, S. 220-227. Schneider, Helmut; Waldemar Stange & Roland Roth (2011): Kinder ohne Einfluss? Eine Studie der ZDF-Medienforschung zur Beteiligung von Kindern in Familie, Schule und Wohnort in Deutschland 2009. In: M. Schächter (Hrsg.): Ich kann. Ich darf. Ich will. Chancen und Grenzen sinnvoller Kinderbeteiligung. Baden-Baden: Nomos, S. 114-152. Schröder, Richard (1995): Kinder reden mit! Beteiligung an Politik, Stadtplanung und Stadtgestaltung. Weinheim & Basel: Beltz. Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen (Hrsg.) (2008): Wahlrecht ohne Altersgrenze? Verfassungsrechtliche, demokratietheoretische und entwicklungspsychologische Aspekte. München: oekom. Tausendpfund, Markus (2008): Demokratie Leben Lernen – Erste Ergebnisse der dritten Welle. Politische Orientierungen von Kindern im vierten Grundschuljahr. Mannheim: Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung, Arbeitspapiere Nr. 116; http://www.mzes.uni-mannheim.de/publications/wp/wp-116.pdf Van Deth, Jan W.; Simone Abendschön; Julia Rathke & Meike Vollmar (2007): Kinder und Politik. Politische Einstellungen von jungen Kindern im ersten Grundschuljahr. Wiesbaden: VS. Weimann, Mike (2002): Wahlrecht für Kinder. Eine Streitschrift. Weinheim, Berlin & Basel: Beltz. 14