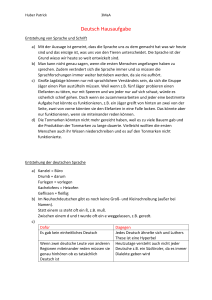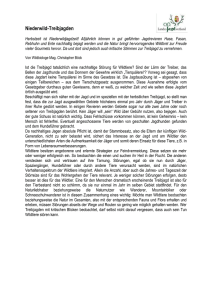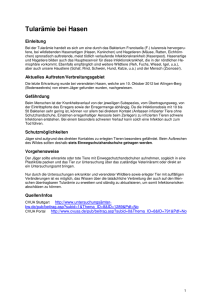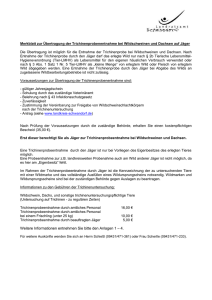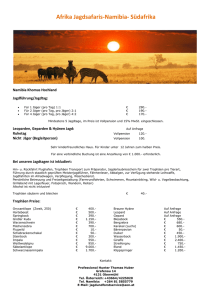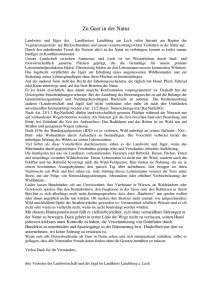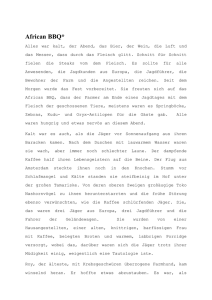Räuber-Beute-Beziehungen in
Werbung

Räuber-Beute-Beziehungen in der Kulturlandschaft Hilfe für die Schwachen – wo und wie muss der Jäger eingreifen? Wenn über Niederwild oder seltene Arten diskutiert wird, müssen wir immer berücksichtigen, dass wir in einer vom Menschen gestalteten Kulturlandschaft leben. Eine Naturlandschaft, in der ausgewogene ökologische Prozesse ablaufen, gibt es in Mitteleuropa praktisch nicht mehr. Das Wirken des Menschen verändert ständig die Lebensbedingungen unserer Wildtiere. Dr. Werner d’Oleire-Oltmanns erklärt warum, und welche Rolle der Jäger dabei spielt. D ie Veränderung der Lebensbedingungen beeinflusst die Tier- und Pflanzenwelt und ist eine zentrale Steuergröße für die Artenvielfalt. Vor allem seit der Mechanisierung der Land- und Forstwirtschaft ist ein solcher Wandel zu beobachten, mit vielfältigen Wirkungen auf das ganze System. In jedem Fall gibt es Gewinner und Verlierer. Dem Rebhuhn ging es besonders gut, als in der tra- 32 5/2012 Es gibt Jäger und Gejagte Wenn wir die Wildtiere in Jäger und Gejagte einteilen, gehören die Greifvögel, der Fuchs und das Wildschwein zum Beispiel zu den Jägern, Hase, Reh, Birkhuhn und Brachvogel zur Gruppe der Gejagten. In beiden Gruppen finden wir Arten, die mehr oder weniger streng abgegrenzte Reviere besetzen – wie das Reh oder der Adler – und solche, die in Streifgebieten leben und kein Territorium verteidigen. Dazu gehören etwa die Krähe und das Rotwild. Diese ganz grobe Unterteilung soll aufzeigen, dass wir Arten haben, die ein festes Revier brauchen. Beim Steinadler ist das besonders gut zu beschreiben. Das Revier eines Adlerpaares muss so groß sein, dass nachhaltig immer wieder eine Brut aufgezogen werden kann, der jagdbare Wildbestand ist die bestimmende Größe für das Revier. Diese Reviere werden gegen andere Adler verteidigt, deshalb ist die Zahl begrenzt. Im Gegensatz dazu stehen zum Beispiel die Rabenkrähen: Sie brüten in Kolonien und dürfen sich ihr Futter mehr oder weniger überall suchen. Hier bestimmt das Nahrungsangebot drastisch die Zahl der Tiere. Als Allesfresser haben sie es besonders gut: Vom Misthaufen bis zum Maissi- lo, von der Kläranlage bis zu den Straßenabfällen – überall finden sie etwas. Bei den „Jägern“ gibt es also solche, die eher spezielle Ansprüche an den Lebensraum stellen, und solche, die als Generalisten überall zurecht kommen. Der Fuchs braucht nicht unbedingt einen Junghasen, er kommt auch mit Regenwürmern und Fröschen zurecht. Diese opportunistischen Arten – dazu zählt zum Beispiel auch das Wildschwein — tun sich mit Veränderungen leicht, deshalb zählen sie zu den Gewinnern. Ohne Blütenpflanzen weniger Nachwuchs beim Feldhasen Arten, die höhere Ansprüche an den Lebensraum und auch noch an die Nahrungsqualität stellen, können nicht entsprechend auf Veränderungen der Lebensbedingungen reagieren. Am Beispiel des Feldhasen wird das deutlich: Die Hasen bekommen in unserer Kulturlandschaft genauso viele Junge wie früher. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Qualität der Nahrung sich direkt auswirkt auf den Fettgehalt in der Milch der Häsin. Dort, wo nichts mehr blüht, fehlen die Knospen, Blüten und Samen, die den Fettgehalt der Hasenmilch fördern. Stehen keine Blütenpflanzen auf dem Speisezettel der Häsin, brauchen die Jungen deutlich länger bis sie entwöhnt sind. Foto: M. Breuer Dr. Werner d’Oleire-Oltmanns, der Vorsitzende des Ausschusses Naturschutz und Landschaftspflege im BJV war viele Jahre lang Zoologe im Nationalpark Berchtesgaden und später an der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege in Laufen. ditionellen Landwirtschaft viele Randstreifen existierten und auch das so genannte Unkraut nicht intensiv bekämpft wurde. Das Auerhuhn liebte die ausgehagerten lichten Wälder, die oft als Weidewälder genutzt wurden. Heute genießen die Krähen die „Vollmast“ mit Silomais, der Fuchs freut sich über jeden Komposthaufen als Nahrungsquelle. Lebensraumverbesserung – nicht immer erfolgreich Die Folgen: Seit vielen Jahren engagieren wir uns in einer Fülle von Projekten zur Lebensraumverbesserung – nicht immer mit dem gewünschten Erfolg. Oft sind die zur Verfügung stehenden Flächen kleiner als wir es wünschen, so dass sich die Einflüsse außen herum auch mit auswirken. Nehmen wir als Beispiel das Haarmoos bei Laufen in Oberbayern. Ein begrenztes Feuchtgebiet mit elf Brachvogel-Paaren und mit geringem Bruterfolg. Der Grund: Neben allen Versuchen, den Lebensraum zu verbessern, ist dieses Gebiet umgeben von intensiv genutztem Grünland und Maisanbauflächen. Außerdem sind die Krähenbestände deutlich angestiegen. Immer wieder wird beobachtet, wie Krähen den Brachvögeln Eier stehlen. Die Krähen brauchen diese Eier nicht zum Überleben, sie sind eigentlich satt. Aber das Ei des Brachvogels ist vielleicht etwas Besonderes, so wie ein Dessert. Die Folge ist, dass trotz aller Bemühungen die Brachvögel in der Falle sitzen. In der Wildbiologie sprechen wir von der „Räuberfalle“. Dieses Beispiel können wir übertragen auf viele andere Situationen. Der Feldhase, der schon durch die schlechtere Muttermilch langsamer wächst, ist der Wildschweinrotte und dem Fuchs länger ausgesetzt. Nur Jäger können aus der „Räuberfalle“ helfen Es zeigt sich in vielen Projekten ganz klar: Wir Jäger haben in der sich dramatisch ändernden Kulturlandschaft eine immer grö ßere Verantwortung. Sowohl beim Niederwild als auch bei Naturschutzprojekten sind wir es, die den betroffenen Arten helfen können, aus der „Räuberfalle“ herauszukommen. Es ist unsere Aufgabe, in Bestände einzugreifen, die bejagt werden dürfen. Niemand sonst darf das tun. Wie man im Einzelfall vorgeht, hängt ganz von der Situation vor Ort ab, da ist viel Fingerspitzengefühl notwendig. Au- Eier von anderen Vögeln sind für die Krähe eine Art „Dessert“. Sie stibitzt es sozusagen aus Jux, der Bestohlene ist der Verlierer. Der Steinadler gehört zu den Jägern. Sein Revier muss so groß sein, dass immer wieder eine Brut aufgezogen werden kann. ßerdem brauchen wir gute fachliche Argumente. In vielen Fällen müssen auch vergessene legale Jagdmethoden wieder hervorgeholt und angewandt werden. Das heißt, die Fressfeinde müssen intensiv bejagt werden. Wer sich als Jäger für die Wildtiere einsetzt, der wird in unserer Gesellschaft zumindest hinterfragt. Wenn es um die Bejagung von Vögeln geht, stehen wir oft in der Kritik. Krähen sind hochintelligent und sozial. Das stimmt, doch Rotwild ist das auch. Dieses Argument muss man ernst nehmen und auch die entsprechenden Jagdmethoden wählen, die alle tierschutzrelevanten Aspekte berück- sichtigen. Sicher soll man nach Möglichkeit erlegtes Wild verwerten, doch das ist nicht immer möglich. In diesem Punkt bekommen wir auch von den Nichtjägern Rückendeckung: Niemand sagt etwas, wenn wir hochintelligente, sozial lebende Säugetiere, wie etwa Ratten, töten und dann verwerfen. Denn Ratten übertragen gefährliche Krankheiten. Die Arten, um die es uns geht, sind durch unsere Form der Landnutzung zu Gewinnern auf Kosten anderer geworden. Wir tragen mit unserem Eingreifen nur dazu bei, den Verlierern eine Chance zu geben und so einen aktiven Beitrag zur Artenvielfalt zu leisten. Der Feldhase hält oft vergeblich Ausschau nach Blütenpflanzen, die ihm schnellere Aufzucht durch fettreichere Milch garantieren. Fotos: J. Limberger/piclease, D. Hopf, M. Breuer Das heißt, sie sind länger den Einflüssen schlechter Wetterperioden ausgesetzt, die Jugendsterblichkeit ist höher und sie unterliegen länger dem Feinddruck. Bei Spezialisten wie dem Brachvogel wird das noch problematischer. 5/2012 33