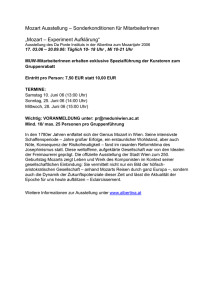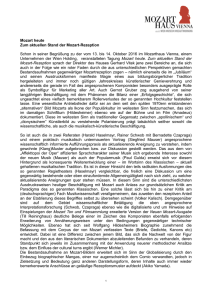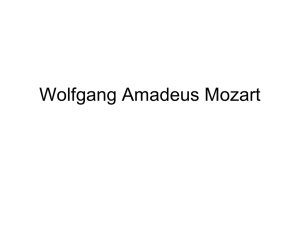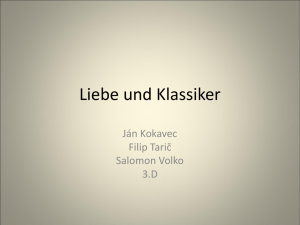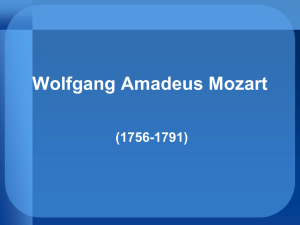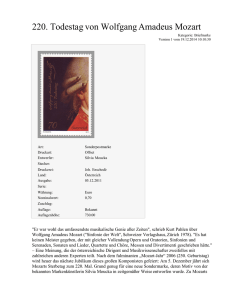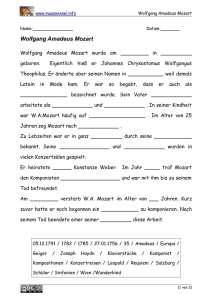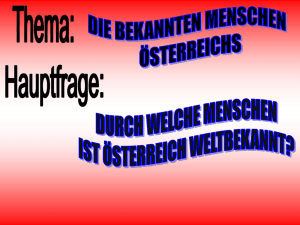Bundesfinanzministerium - Veranstaltung „Musik.Noten.Wert“
Werbung

Videos 29.06.2015 Veranstaltung „Musik.Noten.Wert“ Am 29. Juni 2015 lud das Bundesfinanzministerium zu einer musikalisch-literarischen Veranstaltung mit Katja Riemann (Rezitation), Daniel Hope (Violine) und Sebastian Knauer (Klavier). Daniel Hope und Sebastian Knauer spielen Johannes Brahms: Scherzo c-moll aus der FAE-Sonate für Violine und Klavier Steffen Kampeter: Meine Damen und Herren, nein, ich bin nicht Wolfgang Schäuble – unschwer erkennbar. Mein Name ist Steffen Kampeter, ich bin einer der parlamentarischen Staatssekretäre für Wolfgang Schäuble. Wenn ich jetzt am Anfang dieser Veranstaltung sage, es tut ihm leid, dass er nicht da ist, dann müssen Sie mir das wirklich abnehmen, denn ich kenne keinen oder wenige Menschen im politischen Berlin, die, wenn sie vor die Alternative gestellt werden, entweder den Abend in einer tollen, spannenden, aufregenden Sitzung oder in einem Konzert oder Opernaufführung zu verbringen, dann weiß ich, wie Wolfgang Schäuble sich in der Regel entscheidet: Er geht ins Konzert oder die Oper. Nur heute Abend – muss ich Ihnen leider die Wahrheit sagen – war er nicht ganz frei in seiner Entscheidung, denn die Bundestagsfraktionen lassen sich über das Ergebnis der am Wochenende gescheiterten Verhandlungen zur Stabilisierung von Griechenland unterrichten, und da ist der Bundesfinanzminister nicht ersetzbar. Wohl aber hoffentlich hier, so dass Sie das akzeptieren mit der herzlichen Begrüßung von seinem Staatssekretär hier im Matthias-Erzberger-Saal des Bundesfinanzministeriums. In diesem Saal machen wir eigentlich unsere Konferenzen. Da geht es manchmal spannend, manchmal langweilig, manchmal spanisch, manchmal griechisch, manchmal englisch, manchmal deutsch, mit Nobelpreisträger, ohne Nobelpreisträger vor. Aber er ist auch seit einigen Jahren der Konzertsaal des Bundesfinanzministeriums. Uns alle, die wir in diesem Ministerium arbeiten, hat über die vielen Jahre die schwierige Geschichte dieses Gebäudes stark beschäftigt, wie man damit umgehen kann und wie man vielleicht das Haus auch öffnen kann. Vielleicht ist sie nicht allen bekannt, deswegen ein paar Hinweise. Mitte der 30er Jahre hat sich Hermann Göring dieses Haus als Reichsluftfahrtministerium bauen lassen. Die Berliner wissen oder vermuten, dass mit Sagebiel der gleiche Architekt hier tätig war wie beim Flughafen in Tempelhof. Hier wurde dann nach dem Krieg die Deutsche Demokratische Republik ausgerufen, und es beherbergte über mehrere Jahrzehnte deren Haus der Ministerien. Am 16. Juni, also einen Tag vor dem üblicherweise bekannten Termin, fand hier der erste Aufstand oder die erste Massendemonstration des Volksaufstandes einen Tag später statt. In diesem Raum selbst, persönlich hat Ulbricht nicht nur angekündigt, dass es niemand die Absicht habe, eine Mauer zu bauen, sondern wenige Monate später auch die Anweisung gegeben, eben selbe zu machen. Die Geschichte können Sie dann fortschreiben, dann war hier die Treuhandanstalt, das Bundesfinanzministerium – es gibt wenige Orte, in denen heute Ministerien sind, die eine so wechselvolle Geschichte haben. Deswegen sind wir bereits vor einigen Jahren auf die Idee gekommen, in diesem historisch spannenden, herausfordernden, belasteten Haus an die Musik aus diesen langen Jahrzehnten auch der Unfreiheit zu erinnern und sie hier aufzuführen – die Musik, die von den Nationalsozialisten abgelehnt oder verboten war, oder Klassik und Jazz in der D D R. Wir haben extra eine Reihe aufgelegt, sie hieß „Musik.Zeit.Geschehen“ und war damit der erste dauerhafte musikalische Strang hier in diesem Ministerium. Die zweite Reihe, die wir sozusagen als Ergänzung dazu entwickelt haben, heißt „So klingt Europa“. Wir haben hier regelmäßig die Musik einer europäischen Nation zu Gast, zusammen mit dem Finanzminister oder der Finanzministerin des jeweiligen Gastlandes, die dann in ein Gespräch mit Schäuble über Kulturfragen eintreten. Ich kann Ihnen sagen, nicht jeder europäische Finanzminister B Z W. Kollegin ist an kulturellen Dingen so interessiert und so gesprächig zu diesen Fragen wie Wolfgang Schäuble, so dass manches dieser Interviews in der Vergangenheit auch eine Herausforderung war. Aber Europa ist eben weit mehr als eine Währung. Ich denke, Europa ist eine Wertegemeinschaft, und zu diesen Werten gehört auch die kulturelle Vielfalt in Europa, und damit wollen wir mit anderen Veranstaltungen, auch möglichweise fortentwickelten Reihen in diesem Haus erinnern. Wir wollen das auch machen, indem wir an einer weiteren Stärkung der Währungsunion arbeiten, beispielsweise Wolfgang Schäuble ein, zwei Kilometer an dieser Stelle im Reichstag. Wir wollen uns die europäische Vielfalt über die Musik der Nationen Europas sozusagen vor die Ohren führen. Eine weitere Begründung ist eben auch, dass der Hausherr schlicht und einfach ein Musikliebhaber ist. Und das muss auch zulässig sein in diesem Kontext. Unser Haus klingt dabei im Übrigen gar nicht so schlecht. Wir sind ja alle treue Verbündete der Berliner Philharmonie, aber auch unser Treppenhaus kann sich hören lassen. Das war beispielsweise eine Choraufführung, die viele Kolleginnen und Kollegen, aber auch viele Besucherinnen und Besucher doch sehr beeindruckt hat – Chöre und Ensembles im Treppenhaus. Heute auch, Sie sind herzlich eingeladen, die Akustik dieses Baus zu testen. Was wir aber nun heute Abend hier in diesem Raum erleben werden, hat viel mit dem Erstaunen über eine semantische Besonderheit zu tun. Haben Sie sich schon einmal klargemacht, dass die zentralen Größen in der Finanzwelt und in der Welt der Musik oftmals mit gleichen oder ähnlich klingenden Begriffen gefasst werden? Banknoten - Musiknoten, der Notenwert des Geldes - der Notenwert in der Komposition, die Notierung in der Musik - die Notierung an der Börse. Bis zu einem gewissen Grad ist der Notenwert beim Geld wie in der Musik eine Frage der Zuschreibung oder der Interpretation, also immer wieder neu. Man kann auch auf den Gedanken kommen, dass der Inflation des Geldwertes das Rubato beim Notenwert in der Musik entspricht, wörtlich das Stehlen von Tondauern. Etwas eingängiger und dabei ähnlich eng ist das Verhältnis von Musik und Geld natürlich auf der Ebene der Lebenshaltungskosten der Musikschaffenden bis hin zur kritischen Analyse der Künstlersozialkasse und der Künstlersozialversicherung. Wir werden heute von einigen Mühen selbst der größten Komponisten hören, „durch die Noten aus den Nöten zu kommen“, wie der Ringelnatz unter den deutschen Komponisten, Ludwig van Beethoven, einmal schrieb. Was nun genau aus all dem folgt, das will ich nicht vorgeben, das kann ich auch nicht vorhersagen. Improvisation in diesem Haus ist ja eine der Tugenden, die wir in den letzten Jahren stets entwickeln mussten. Der heutige Abend wird es jetzt zeigen, und ich möchte Sie einladen, diese Assoziationen freizusetzen, fortzuspinnen. Ich bin sehr gespannt auf diesen Abend und ich danke sehr den Mitwirkenden. Zuerst einmal Daniel Hope und Sebastian Knauer, die uns mit dieser Einführung von Brahms schon mal eine erste Visitenkarte gegeben haben, die nicht zum ersten Mal hier spielen, die schon ein begeistertes Publikum bei einer unserer Veranstaltungen gemacht haben. Daniel Hope muss man an sich die Idee nochmal zuschreiben, dass er im Dialog mit Wolfgang Schäuble gesagt hat, wir müssen mal was machen mit Noten in der Musik und Noten in der Finanzwelt. Herzlich willkommen, Sebastian Knauer und Daniel Hope. Ich vermute, dass im Laufe des Abends auch noch Katja Riemann auftauchen wird, sie steht zumindest im Programmheft. Sie werden sie wahrscheinlich sofort erkennen, wir haben eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen als Rezitatorin gewinnen können. Ihr war der Abend so wichtig, dass sie stets und ständig auch an den Texten selbst gearbeitet und richtig Herzblut in diese Veranstaltung [gesteckt hat]. Wenn sie kommt, bitte ein donnernder und tosender Applaus für Katja Riemann. Aber auch jetzt können wir schon mal einen kleinen Vorschuss darauf geben, einverstanden? Ich bedanke mich bei all denjenigen, die den heutigen Abend möglich gemacht haben innerhalb des Hauses. Da gibt es so eine Truppe, die heißt bei uns im Behördensprech ÖA – das ist die Öffentlichkeitsarbeit –, aber auch die musikalische Beraterin, Kuratorin unseres Hauses, von Wolfgang Schäuble, nämlich Frau D R . Ingrid Allwardt. Die hatte nämlich mit Wolfgang Schäuble diesen Termin ausgesucht, weil montags nie etwas passiert. Jetzt ist doch etwas passiert. Sie war nicht ganz glücklich mit dem Termin, sie hat heute nämlich Geburtstag. Herzlichen Glückwusch, liebe Frau Dr. Allwardt. Ihnen allen einen schönen Abend und Ihnen eine nettes Geburtstagsfest. Jetzt nach Brahms gibt es Mozart, und dann wollen wir mal schauen, was passiert. In diesem Sinne: herzlich willkommen im Bundesfinanzministerium. Daniel Hope und Sebastian Knauer spielen Wolfgang Amadeus Mozart: 1. Satz (Adagio – Allegro) aus der Sonate für Violine und Klavier K V 379 Katja Riemann: … Es ist nämlich so: Muse wie Musik. Als Muse spielen ich und meine vielen Musenkolleginnen nämlich viele Rollen. Es ist ein Riesen-Aufgabengebiet in diesem Job: Theater, Dichtung, Tanz, Geschichte, Philosophie… Wir sind sogar für Astronomie und Schulen zuständig. Griechische Verhältnisse halt, ein Wahnsinn. Wir sind neun Musen und alle Töchter des guten alten Zeus. Mein Name ist Euterpe. Das heißt die Erfreuende, und mein Ressort ist die Musik, ist der Auftrag, die edle Tonkunst zu beschützen und alle, die mit ihr zu tun haben. Das ist ein Fulltime-Job. Denn heutzutage geht es ja nicht ausschließlich um Kunst, sondern auch um Business, Produktplanung, Marktstrategie, Finanzen, Vertragsgestaltung, Imagepflege, Medienpräsenz, Pressearbeit, Networking, Networking, Networking, Networking. Davon macht sich ja kaum einer einen Begriff, auch die meisten Musiker nicht, wenn sie sich in Welt der Musik verlieben und hineinbegeben. Im besten Falle drücke ich ihnen meinen Musenkuss auf die Stirn, und damit ist dann auch der angenehme Teil der Sache beendet, für mich. Dann beginnt das Komponieren, beginnt die Kunst für den Künstler, und ich stehe vor den anderen Verpflichtungen, vor dem Auftrag, die Tonkunst und alle, die damit zu tun haben, zu beschützen. Haben Sie sich schon mal gefragt, weshalb die Buchstaben in der Musik „Noten“ heißen? Wie Banknoten? Geld hat in der Welt der Musik schon immer eine Rolle gespielt, und als Griechin verstehe ich was von Geld. Darum möchte ich Ihnen von ein paar großartigen Komponisten erzählen und ihrer Beziehung respektive ihrer Misere in monetärer Hinsicht. Aber zuvor: Musik. Daniel Hope und Sebastian Knauer spielen Felix Mendelssohn-Bartholdy: Andres Maienlied (Hexenlied) O P. 8 N R . 8 für Violine und Klavier Sie kennen bestimmt alle den berühmten Satz von Beethoven: „Ich schreibe Noten in Nöten.“ Balzac hat übrigens etwas ganz Ähnliches gesagt. Er sagte: „In der Stunde der größten Not, leuchtet mir die höchste Inspiration.“ Ach, Zeus, wie oft hat Beethoven mir sein Leid geklagt: „Ich kann eben nicht viel mehr in der Welt als Noten schreiben, aber alle Noten, die ich mache, bringen mich nicht aus den Nöten.“ Er hat gut verdient, er war damals in Wien der große Star. Als Solist am Klavier als auch als Komponist. Das Publikum ist in seine Konzerte gelaufen, und die Verleger im In- und Ausland haben sich um seine Werke gerissen. Aber er hat nie so viel eingenommen wie er brauchte. Für sich, seinen Pflegesohn, seine Haushälterin, für Miete, Heizung, Kleidung, Essen und für die Löhne der Menschen, die ihm die Noten kopierten. Das Leben in Wien war teuer, und es gab Inflation und Geldentwertung. Er lebte in der ständigen Angst, über kurz oder lang bettelarm zu enden. Ich will mal ein Beispiel nennen. Sebastian Knauer spielt Ludwig van Beethoven: Albumblatt für Elise W O O 59 Vielen Dank, Sebastian. Das kennt jeder: Albumblatt für Elise. Beethoven hat das Stück nebenbei komponiert und ihm keine ordentliche Opus-Zahl gegeben. Daher heißt die Komposition WoO, Werk ohne Opus. Und es hätte ihn zum Millionär machen können, vorausgesetzt es hätte 1810 bereits so etwas wie Urheberrecht, G E M A-Gebühren, Verlage, Lizenzen und Tantiemen gegeben. Und Rechteabgeltungen für die Klingeltöne von Handys. Alle Sorgen wäre er losgewesen und alle Schulden auch. Ganz zu schweigen von dem, was ihm all seine übrigen Werke eingebracht hätten, mit denen heutzutage andere viel Geld verdienen. Beethoven hätte einen guten Manager gebraucht und einen zuverlässigen Finanzberater. Hatte er aber nicht, und ich konnte ihm leider auch nicht weiterhelfen. Die Zeiten, sie waren nicht so. Und die Gesetze, inklusive des Steuerrechts, auch nicht. „Unsereiner bedarf immer Geld“, sagte er. „Ich will kein musikalischer Kunstwucherer werden, der nur schreibt, um reich zu werden.“ Unabhängig wollte er sein, wie alle Künstler. Und das kann ich nur mit einem kleinen Vermögen. Der Mann, der Eroica, Fidelio und die Neunte geschrieben hat, dem wir die Missa Solemnis verdanken, die Mondscheinsonate und die wunderbaren Klavierkonzerte, dieser Mann war in ständiger finanzieller Sorge – auch wenn er nicht mit jedem, schon gar nicht mit seinen Verlegern, darüber sprach. Er verstand nicht viel vom Kaufmännischen, aber mit Verkaufspsychologie kannte er sich aus. Wenn die Herrschaften erst dahinter kämen, wie dringend er Geld brauchte, würden sie die Preise noch weiter drücken als sie es ohnehin schon taten. Also besser sie nicht merken zu lassen „qu’on a besoin de l‘argent“. Mir gegenüber war er ganz offen. Irgendwann, als es finanziell mal wieder eng war, sagte er zu mir: „So glänzend die Außenseite des Ruhms auch ist, so ist mir doch nicht vergönnt, alle Tage im Olymp bei Jupiter zu Gast zu sein.“ Daniel Hope und Sebastian Knauer spielen Ludwig van Beethoven: 3. Satz (Finale.Presto) aus der „Kreutzer-Sonate“ op. 47, A-dur Manchmal frage ich mich, wie es wäre, wenn Beethoven in unserer Zeit leben würde. Oder Mozart. Was sie für Musik komponieren würden, wie sie komponieren würden. Ob sie sich für Homerecording-Computer-Software à la Pro Tools und Steinberg interessierten? Was sie zu 128–spurigen Mischpulten in den großen Studios dieser Welt sagen würden. Wie es ihnen ginge - künstlerisch und auch finanziell. Mozart zum Beispiel: Mozart wäre genauso reich geworden wie Elvis Presley, Michael Jackson oder Madonna. Oder sogar noch reicher. Zumindest hätte er so viel verdient wie Karajan, Lang Lang oder Anne-Sophie Mutter. Hätte, hätte Fahrradkette. Der heutzutage weltberühmte Mozart, dessen Musik sich mittlerweile als wahre Goldgrube erwiesen hat, musste seinerseits häufig bei seinem Freund Puchberg betteln gehen, und er konnte noch froh sein, dass er diesen Sponsor hatte. Manch einer seiner Kollegen hatte da weniger Glück. Franz Schubert zum Beispiel: arm und mittellos von Anfang bis Ende. So schlecht wie Schubert ist es Mozart niemals ergangen. Dass er, Mozart, sich nichts leisten konnte und für das Allernötigste Schulden machen musste, das stimmt nicht. Er hat schon ganz gut gelebt und sich manchen Luxus gegönnt. Sein Talent war nun mal nicht der Umgang mit Banknoten, und seine Frau war da keine Unterstützung. Immer haben sie mehr ausgegeben als Mozart eigenommen hat. Und nicht nur Privatleute wissen, wohin diese Spirale führt. Schulden, Kredite, mehr Schulden, neue Kredite – und so weiter bis zum Finanzcrash. Manches Mal wusste Mozart nicht mehr aus noch ein. Sein Vater hat ihm immer wieder geraten, er solle sich doch eine feste Anstellung suchen – so wie er selbst als Vize-Kapellmeister in Salzburg. Damit hat es aber niemals geklappt. Mozart war kein Typ für eine Festanstellung. Er war ein Künstler, kein Angestellter. Er war und wollte frei sein. Wie Künstler es bis heute sind, auch wenn sie dafür finanzielle Not und Ungewissheit und schlaflose Nächte der Existenzangst riskieren. Mozart mochte sich nicht bei Aristokraten und Hofschranzen einschleimen. Aber genau da lag das Problem: Es gab noch keinen freien Musikmarkt wie heute. Der war erst gerade dabei, sich ganz zaghaft zu entwickeln. Noch waren Oper und Konzert fest in adliger Hand. Die Obrigkeit entschied, was aufgeführt wurde und Erfolg haben durfte. Wenn ein Komponist nicht den Geschmack des Kaisers traf, war das unter Umständen fatal. Aber Mozart hielt an seiner Musik fest, und anfangs lief es auch ganz gut für ihn. Zum Beispiel mit der ersten Oper, die er in Wien herausbringen durfte, mit der „Entführung aus dem Serail“. Der Kaiser mäkelte zwar hinterher: „Gewaltig viele Noten, lieber Mozart“, aber Mozart antwortete: „Genauso viele Noten als nötig, Majestät.“ Und das Publikum gab ihm recht. 16 ausverkaufte Vorstellungen – ein Triumph. „Das Werk hat nicht einfach bloß gefallen, sondern es macht so Lärm, dass man gar nichts anderes hören will und das Theater allzeit von Menschen wimmelt“, schrieb Mozart an seinen Vater. Wenn jetzt ein Manager dagewesen wäre, der die „Entführung aus dem Serail“ schlau vermarktet hätte mit Gastspielen im Ausland, einer Tournee durch Österreich, einem Live-Mitschnitt, der erst im Kulturradio läuft und dann bei Grammophon oder Sony Classic veröffentlicht wird, bei iTunes gedownloaded werden kann mit Klavierauszügen für die Fans, dann wäre vielleicht einiges anders gelaufen für Mozart. Doch ungeachtet der vielen Schwierigkeiten, die ihm seine weniger talentierten Konkurrenten machen konnten, weil sie in der Gunst des Kaiser standen, kam er an beim Publikum, wurde gefeiert als Solist mit seinen eigenen Klavierkonzerten, schrieb Stücke für Kollegen, war beliebt als Klavierlehrer und bei den Verlagen gefragt als Komponist von Sonaten und Quartetten. „Ich habe so viel zu tun“, schrieb er mal seinem Vater nach Salzburg, „dass ich oft nicht weiß, wo mir der Kopf steht.“ Denn so wie sein väterlicher Freund Haydn wollte er es nicht machen. Der hatte die längste Zeit seines Lebens in den Diensten des Fürsten Esterházy gestanden und den Absprung in die freie Kunst niemals geschafft – erst als der Fürst gestorben war und der Nachfolger kein großes Interesse an der Musik zeigte. Welche Karriere machte Haydn dann in England! Ein umjubelter Star wurde er und viel Geld verdiente er. Das leidige Geld war für Haydn wie für Mozart wichtig. Doch die Musik spielte im wahrsten Sinne des Wortes immer die erste Geige. Sie war das Leben, der Grund alles Seins. Und außerdem dachte Mozart gar nicht daran, sich zum Sklaven deiner prekären Finanzsituation machen zu lassen. „So ist’s nun einmal auf der Welt, der eine hat den Beutel, die anderen haben’s Geld.“ Daniel Hope und Sebastian Knauer spielen Wolfgang Amadeus Mozart: 2. Satz (Tema (con variazioni). Andantino cantabile) aus der Sonate KV 379 „Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“, hat Nietzsche gesagt, der Frauenhasser. Also wenn das stimmt mit der Musik und dem Irrtum, dann müssten wir eigentlich heutzutage in einer Welt der reinen Wahrheit leben. Denn noch nie gab es so viel Musik wie heute. Wo man geht und steht, hört man Musik – ob man will oder nicht. In Kaufhäusern, Büros, beim Frisör, in Hotelaufzügen, in Hotellobbys, in Cafés, Bars, Restaurants, im Kinderzimmer, Wohnzimmer, beim Zahnarzt und bei der Massage, im Flugzeug, im Fußballstadion, drinnen, draußen, überall. Bahnhöfe werden mit Klassik beschallt, damit Obdachlose und Bettler wegbleiben – verstehe einer diese Maßnahme. Musik im Radio, im Fernsehen, im Kino, auf CDs, Vinyl, iTunes, Spotify, SoundCloud, YouTube, Shazam, das weite wilde Netz, you name it, auf allen Devices, Smartphones, auf digitalen Uhren, die eigentlich Computer sind, auf U S B ins Auto transferiert, per Free-WiFi, im Zug, Flugzeug oder Café, auf dem Fahrrad, beim Joggen, der Knopf im Ohr per Bluetooth oder Kabel in den Kopf gestreamt – überall und jederzeit: Musik. Und im Konzertsaal: Musik. Live. Klassische Musik im Konzertsaal wie früher. Wie hier und heute, jetzt, wie hoffentlich auch weiterhin und immerfort. Wer zu Mozarts Zeiten Musik hören wollte, musste ins Konzert gehen oder selber musizieren. Eine Sinfonie oder ein Streichkonzert zu hören, war etwas Besonderes. Der Klaviersonate, die man zuhause geübt hat, von einem großen Virtuosen gespielt zu lauschen, das war ein Highlight. Stellen Sie sich mal vor, Schubert käme für einen Tag in unsere Zeit nach Berlin und würde seine Unvollendete bei YouTube eingeben. Da sieht und hört man alle Orchester dieser Welt seine Sinfonie spielen. Oder er googelte seinen Namen – 16.600.000 Einträge. Oder er ginge zu Dussmann und sähe die vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, wirklich vielen Einspielungen all seiner Kompositionen, die über die Jahrzehnte… Oh, guten Abend. Das ist mal ein Auftritt. Guten Abend. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie es wäre, wenn Schubert jetzt unter uns weilte. Ich dachte gerade, er kommt. Und Schubert erfährt, stellen Sie sich vor, dass mit seiner Musik viel Geld gemacht wird und wurde, während er für ein lächerliches Stück Geld bei Verlegern Klinken putzen ging. „Wie ein Sklave unter elenden Krämern fühle ich mich“, schrieb er. Ausgenutzt um einen, um seinen gerechten Lohn zu bekommen. Doch was wäre eigentlich sein gerechter Lohn gewesen? Was ist überhaupt ein gerechter Lohn für eine Sinfonie? Für die Erfindung einer Sinfonie, eines Violinkonzertes oder eines Liederzyklus? Musik ist keine Ware wie eine Dose Bier oder ein Notenständer, das Komponieren keine Dienstleistung wie Kellnern oder Autoreparatur. Und was sollte einer machen, wenn er – wie Schubert – seiner Zeit kaum bekannt war und nur seine engsten Freunde wussten, wie wunderbar er komponierte, und dazu noch viel zu schüchtern ist, um in der Öffentlichkeit Reklame für sich zu machen? Richard Wagner beispielsweise war da ein völlig anderer Typ. „Die Welt ist mir schuldig, was ich brauche“, das war seine Devise. Zwar saßen ihm die Gläubiger oft genug im Nacken, aber am Ende hat er es geschafft und wurde Direktor vom Grünen Hügel, mit Ludwig II. als freigiebigem Spender. Bei Franz Schubert passierte nichts dergleichen. „Ich bin für nichts als für das Komponieren auf die Welt gekommen. Mich soll der Staat erhalten“, sagte er. Ein staatliches Grundeinkommen für Komponisten. Gut. Kühne Idee, damals wie heute mehr frommer Wunsch als Realität. Doch unendlich viel hat sich getan zugunsten der Musik zwischen 1828, Schuberts letztem Jahr, und 2015. Wer wüsste das besser als ich, der edlen Tonkunst holde Beschützerin. Dennoch wäre es nur recht und beglückend gewesen, wäre dem genialen Schubert wenigstens etwas, etwas von dem zuteil geworden, was später möglich oder sogar selbstverständlich geworden ist. Sebastian Knauer spielt Franz Schubert: Impromptu Es-Dur op. 90 Nr. 2 D 899 Nr. 2 Darf ich Sie einmal etwas fragen? Können Sie sich ein Leben ohne Musik vorstellen? Ohne Bachs Passionen und Händel Oratorien, ohne Haydn Sinfonien und Mozarts Figaro? Ohne Beethovens Fünfte und Schuberts Winterreise, ohne Schumann, Mendelssohn, Brahms oder die Beatles? Bob Dylan, Miles Davis, Chet Baker, Ella Fitzgerald? Das Leben wäre wohl tatsächlich ein Irrtum, ohne Musik, wie Nietzsche gesagt hat. Und es spielt keine Rolle, welche Musik gemeint ist. Musik ist in jeder Form ein Lebenselixier. Und falls Sie noch nicht darüber nachgedacht haben sollten, so sage ich es Ihnen als die vom Olymp bestellte Hüterin der Tonkunst. Jeder Mensch braucht Musik – bewusst oder unbewusst. Unterhaltung, Stärkung, Trost, Erbauung, Träume, Hoffnung, Sehnsucht, Rausch, Liebe – alles, alles kann sie sein. Seit 45.000 Jahren gibt es, so schätzt man, Musikinstrumente – Flöten und Perkussion. So lange, aber wahrscheinlich noch länger, machen Menschen Musik. Sie ist ein Wunderding, ein Zauber, der nie aufhört und den niemand, niemand jemals wird ergründen können. So, und jetzt noch einmal zurück zum Geld: Natürlich braucht die Musik Geld, damit Komponisten komponieren können, Musiker musizieren, opernaufführende neue Talente gefördert werden können. Zeiten gab es, in denen die Schönheit der Musik zwar willkommen war, ihre Schöpfer allerdings schlecht bezahlt und behandelt wurden. Macht die Musik die Menschen besser oder friedlicher? Ich glaube, ja. Die Macht der Musik kann Grenzen überwinden, Verbindungen schaffen und für Harmonie sorgen, wo zuvor Hass und Feindschaft waren – wenn man sie lässt. Immer wieder wurde sie gehindert, ihr Werk als Friedensbotin auszuüben. Viele Male wurde sie missbraucht, um Menschen gegeneinander aufzuhetzen. In den beiden Weltkriegen wurde sie in Deutschland manipulativ und propagandistisch eingesetzt, in Gefängnissen als Folter. In islamischen Ländern ist sie verboten. Ein kleiner, freundlicher Mann aus Norwegen mit blauen Augen und weißer Haarmähne war einer von jenen, die unverdrossen an die segensreiche Kraft der Musik geglaubt haben: Edvard Grieg. Er sagte vor über 100 Jahren: „Da sitzen wir Künstler nun und reden von Kultur und Zivilisation. Wie wenig haben wir ausgerichtet. Schlachtengesänge und Requiems mögen sehr schön sein, doch die Aufgabe der Kunst ist eine viel höhere. Sie sollte den Völkern so verständlich werden, dass sie als Friedensbote wirkt und dass ein Krieg als unmöglich empfunden wird. Dann erst wären wir Menschen geworden.“ Frieden – Frieden ist nicht die Abwesenheit von Krieg, sondern die Kunst, ein Leben zu führen, das mehr ist als das Warten auf den Tod.“ Daniel Hope und Sebastian Knauer spielen Edvard Grieg: 1. Satz (Allegro molto ed appassionato) aus der Sonate cmoll, op. 45 Steffen Kampeter: Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ja so, dass ich glaube, dass eine Steuerfahnderin noch nie mit so viel Begeisterung aufgenommen worden ist. Bei diesem Spiel zwischen Rezitation und Musik litt sie ja ein bisschen darunter, dass die Musik zu schnell angefangen hat, und deswegen nochmal einen tosenden Beifall für die bezaubernde, überzeugende, begeisternde Katja Riemann. Einen nicht minder herzlichen Dank an unser kongeniales Paar, das jetzt zum zweiten Mal, glaube ich, hier in diesen Hallen war. Herzlichen Dank, Sebastian Knauer und Daniel Hope. Ich nehme mir die Frechheit heraus, den Hausherrn und Musikfreund Lothar, nein, Wolfgang Schäuble zu begrüßen. Herzlichen Dank, dass Sie es noch geschafft haben, lieber Herr Schäuble. Mit Lothar lag ich nicht ganz falsch, denn es ist mir ein Anliegen, nochmal herzlich zu begrüßen, den einzigen freigewählten und letzten Ministerpräsidenten der DDR, Lothar de Maizière. Herzlichen Dank, Herr de Maizière, dass Sie da sind. Es bleibt mir, Ihnen Dank zu sagen und Sie im Namen von Wolfgang Schäuble [einzuladen], noch etwas zusammenzubleiben unten in der Steinhalle. Ich glaube, Schubert leitet über in das Finale. Toll, dass Sie da waren. Herzlichen Dank. Und herzlichen Dank an die Künstler. Katja Riemann: Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden, Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt, Hast du mein Herz zu warmer Lieb' entzunden, Hast mich in eine beßre Welt entrückt! Oft hat ein Seufzer, deiner Harf' entflossen, Ein süßer, heiliger Akkord von dir Den Himmel beßrer Zeiten mir erschlossen, Du holde Kunst, ich danke dir dafür! Daniel Hope und Sebastian Knauer spielen Franz Schubert: „An die Musik“ Mehr zum Thema Veranstaltung „Musik.Noten.Wert“ © Bundesministerium der Finanzen