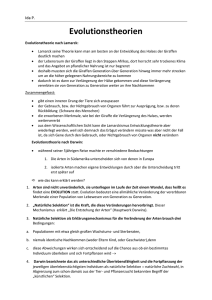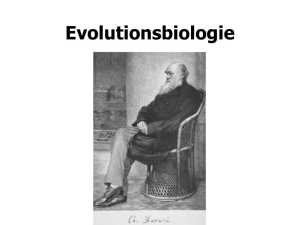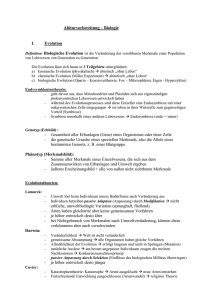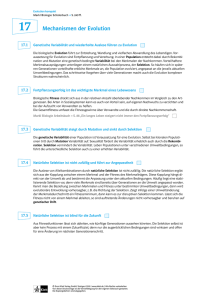11.2 Mechanismen
Werbung

11 Evolution toren. Koppelt man das Gen für ein Green fluorescent protein (GFP) an diese Enhancersequenzen und transformiert Drosophila mit diesem Konstrukt, exprimieren die Fliegen GFP in den Linsen ihrer nun grün fluoreszierenden Komplexaugen. Damit ist gezeigt, dass nicht nur Gene wie Pax-6, sondern auch die PAX-6-spezifischen Kontrollsequenzen in den beiden Enhancern evolutiv hochgradig konserviert sind. 11.2 Mechanismen Evolution heißt, dass sich der Genbestand einer Art in der Generationenfolge ändert und diese Änderung in einer Weise erfolgt, die den Trägern der Gene, den Individuen, eine bestmögliche Nutzung ihrer Umweltressourcen ermöglicht. Die Frage nach den Evolutionsmechanismen zielt damit letztlich auf die Faktoren, die zu solchen anpassungsrelevanten Änderungen im Genbestand von Arten führen. Charles Darwin (Plus 11.2) hat diese Frage nicht nur als erster formuliert, sondern auch mit einer in ihren wesentlichen Zügen bis heute gültigen Theorie beantwortet, der Selektionstheorie. Wie eingangs erwähnt (S. 502), war Darwin der erste, der in der natürlichen Selektion die treibende Kraft allen Plus 11.2 Charles Darwin (1809 – 1882) Als Darwin 1836 im Alter von 27 Jahren von seiner fünfjährigen Forschungsreise mit der „Beagle“ nach England zurückkehrte, hatte er 1529 Tier- und Pflanzenarten konserviert und weitere 3907 Bälge, Knochen und andere biologische Sammlungspräparate an Bord. Doch trotz dieser großen wissenschaftlichen Ausbeute war ihm klar „that skin and bones and isolated facts soon become uninteresting“. In seinen Notizbüchern, die er im März 1837 anzulegen begann, äußerte er denn auch schon bald seine ersten Gedanken zu einer „Transmutation hypothesis“, mit der er ausdrücken wollte, dass sich nicht nur Arten, Charles Darwin, im Alter von 31 und 73 Jahren. 528 sondern auch Individuen von Ort zu Ort und Generation zu Generation verändern. Ein Jahr später las er den „Essay on the Principle of Population“, in dem der englische Nationalökonom Thomas Malthus die These vertrat, das menschliche Populationswachstum erfolge geometrisch, die Zunahme an Nahrungsmitteln aber nur arithmetisch, sodass ein ständiger „Struggle for Existence“ resultiere. Inspiriert von diesen Argumenten, schrieb Darwin in sein Notizbuch: „Favourable varieties would tend to be preserved, and unfavourable ones to be destroyed. The result of this would be the formation of new species. Here, then, I have at last got a theory – the principle of natural selection – by which to work“. Die Idee der Selektionstheorie war geboren. Doch sollte es noch 20 Jahre dauern, bis sie Darwin in seiner epochalen Schrift „On the Origin of Species by Means of Natural Selection“ ausführlich vorstellte. Und hätte ihn am 18. Juni 1858 nicht völlig überraschend der Brief eines gewissen Alfred Russel Wallace erreicht, eines Biologen, der sich gerade auf Forschungs- und Sammelreise im Malaysischen Archipel befand, hätte Darwin wohl noch länger ungestört seinen Plan verfolgt, ein mehrbändiges Werk über „Natural Selection“ zu schreiben. Doch Wallace hatte seinem Brief ein Manuskript beigelegt, in dem er genau jene Selektionshypothese formulierte, die Darwin über Jahre hinweg entwickelt und in seinen Notizbüchern niedergelegt hatte. „If Wallace had seen my notebook sketches, he could not have made a better short abstract“, schrieb er an einen Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. wohl als Ausgangspunkt für die Evolution der verschiedenen Augentypen gedient haben (▶ Abb. 11.28): über Modifikation der bestehenden Augenentwicklungsprogramme und Rekrutierung neuer Gene durch Interkalation in die genetischen Kaskaden. Zwei genetische Mechanismen zur Rekrutierung neuer Gene sind bereits bekannt: Genduplikation und Enhancerfusion. Eine Genduplikation von Pax-6 findet sich bei Drosophila. Dort wurde das ursprüngliche Pax-6-Gen dupliziert (in die Gene eyeless und twin of eyeless). Anschließend entwickelten sich beide Gene in ihrer Funktion auseinander. Schließlich wurde eyeless unterhalb von twin of eyeless in die genetischen Kaskaden interkaliert und nun von twin of eyeless reguliert. Enhancerfusion ließ sich bei verschiedenen Protein-Genen nachweisen, die ursprünglich eine andere Funktion besaßen, z. B. als Enzyme oder Hitzeschockproteine dienten. Solche Gene sind bei verschiedenen Tiergruppen unabhängig voneinander durch Enhancerfusionen in die Linse rekrutiert worden. Die neu rekrutierten Linsenproteine sind also taxon-spezifisch, die linsenspezifischen Enhancer dagegen universell. Klar zeigt sich das beim linsenspezifischen Enhancer des δKristallin-Gens des Hühnchens. Es ist nur 25 bp lang und enthält je einen PAX-6- und einen SOX-2-Bindungsort, also Kontrollsequenzen für zwei Transkriptionsfak- 11.2 Mechanismen Königsfarne im Eukalyptuswald. Gegen Ende seiner Reise auf der „Beagle“ erkundete Darwin im Januar 1836 mit einem Begleiter die Blue Mountains im Hinterland Sydneys. Bei seinem Ritt durch die dichten Eukalyptuswälder folgte er dem Bachbett, das die Aufnahme zeigt. Er staunte über die ausladenden Königsfarne (Todea barbara) und sein erstes Beuteltier, das er in den Händen hielt, einen Potoroo (eine Kängururatte der Gattung Potorous): Der Evolutionsbiologe Darwin ist ohne den „Naturalist Darwin“ nicht zu denken. Schon 8 Jahre zuvor hatte er sich während seines Studiums in Cambridge leidenschaftlich dem „beetling“ verschrieben, dem Sammeln, Bestimmen und Klassifizieren von Käfern. (Foto: R. Wehner) a Darwins Schema eines „Tree of Life“ (Ausschnitt, 1859). b Darwins Sammlungsexemplar der Rotalge Amphiroa (= Bossea) orbignyana. (Bild: Cambridge University Library; H. Hamilton, London; Natural History Museum, London) Rotalge, eine Corallinacee, die er während der Beagle-Reise am Strand Patagoniens gefunden hatte (Teilabb. b). Das Entscheidende an Darwins genealogischem „Tree of Life“ besteht freilich darin, dass dieser „Tree“ erstens die zeitliche Abfolge von Generationen und nicht irgendwelche Vollkommenheitsstufen repräsentiert und zweitens bildhaft zum Ausdruck bringt, dass auf jeder horizontalen Zeitebene die natürliche Selektion an den Zweigspitzen angreift und nur wenige Zweige überleben lässt. In „The Variation of Animals and Plants under Domestication“ (1868) hat Darwin diesen Selektionsgedanken weiter ausgeführt. Auf die Evolution des Menschen kam er dagegen erst in seinen beiden späteren Büchern zu sprechen: „The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex“ (1871) und „The Expression of the Emotions in Man and Animals“ (1872). Wie brillant und in ihren Argumenten schlüssig diese vier Hauptwerke auch geschrieben sind, sie fußen in allen ihren Gedankenflügen auf minutiösen Detailarbeiten, die Darwin oft jahrelang beschäftigten: sei es über Seepocken, deren Systematik, Morphologie und Entwicklung er vier Bände widmete (1851 – 1854) – „I have become a man of one idea, barnacles morning and night“ –, oder über Orchideen und die Mechanismen ihrer Bestäubung durch Insekten (1877). Wohlhabend und als Angehöriger der englischen Oberschicht ganz Zeitgenosse der Viktorianischen Ära, konnte sich Darwin auf seinem Landsitz in Downe, 25 km von London entfernt, völlig seinen Studien widmen, auch wenn ihn ständig chronische Schmerzen, Übelkeit und Kopfweh plagten. Hier in Downe lebte er mit seiner Frau Emma, einer geb. Wedgwood, und seinen sieben Kindern (drei weitere waren im Kindesalter gestorben) nach strengem Arbeitsrhythmus: „Breakfast – Work – Mail – Walk – Lunch – Letters – Nap – Work – Rest – Tea – Books – Bed“, wie es ein Freund beschrieb; hier experimentierte er im Garten mit der Bestäubung und Zucht von Pflanzen; hier ging er auf seinem täglichen „Sandwalk“ seinen Gedanken nach; und hier schrieb er alle seine Arbeiten: „I am fixed in that spot, where I shall end it.“ Am 19. April 1882 starb Darwin in Downe. Doch begraben wurde er nicht, wie er es selbst gewünscht hatte, neben seinem Sandwalk, sondern auf Betreiben seiner einflussreichen Freunde Huxley und Hooker in Londons Westminster Abbey – neben Newton. 11 529 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. seiner besten Freunde, den Geologen Charles Lyell, „ ... all my originality, whatever it may amount to, will be smashed.“ Lyell, der Botaniker Joseph Hooker und der Zoologe Thomas Huxley wurden sofort aktiv. Sie erreichten, dass die Arbeit von Wallace zusammen mit einem frühen Essay von Darwin am 1. Juli 1858 an einer Sitzung der Linnean Society in London verlesen wurde. Darwin selbst war nicht zugegen, begann nun aber fieberhaft an einer Kurzfassung seines geplanten Hauptwerks zu arbeiten, die dann als „On the Origin of Species“ am 24. November 1859 erschien. Der Erfolg war durchschlagend, nicht nur in Wissenschaftlerkreisen, sondern auch in der breiteren Öffentlichkeit. Die generelle Idee organischer Evolution war freilich nicht völlig neu. Erasmus Darwin, Charles’ Großvater, hatte sie bereits vertreten (in seiner „Zoonomia, or the Laws of Organic Life“), ebenso der Geologe Robert Chambers in Schottland. In Frankreich waren es Buffon, Montesquieu, auch der Enzyklopädist Diderot und dann in erster Linie Lamarck, die erste Evolutionsdiagramme des Organismenreichs entworfen hatten – Leiterfiguren, die von den Einzellern bis zum Menschen führten. Doch Darwin wählte als Metapher für den phylogenetischen Zusammenhang aller Organismen nicht solche Sprossenleitern, sondern einen sich vielfach verzweigenden Baum, ja besser noch eine Koralle: „The tree of life should perhaps be called the coral of life“; denn – so argumentierte er – die unteren, abgestorbenen Teile der sich buschförmig verzweigenden Koralle könnten die ausgestorbenen Arten besser als das Baummodell illustrieren. Als Muster für die filigranen Stammbaum-Schemazeichnungen, die er mit größter Sorgfalt und genauen Anweisungen an den Drucker erstellte (Teilabb. a), diente ihm eine korallenartig versteinerte 11 Evolution 11.2.1 „Mikroevolution“: Populationen im Wandel Ausgangspunkt: Ideale Populationen Betrachtet man Evolution auf der niedersten (der Populations-)Ebene, spricht man häufig von Mikroevolution – im Gegensatz zur „Makroevolution“, zum langfristigen Formenwandel in geologischer Zeit. Mit dieser Unterscheidung, die sich lediglich auf die Zeitspanne des betrachteten evolutiven Geschehens bezieht, sei jedoch nichts über unterschiedliche Evolutionsmechanismen präjudiziert. Diese Frage wird uns später noch intensiver beschäftigen (S. 545). Hier geht es zunächst um Mikroevolutionsprozesse. 530 Nicht Individuen, sondern Populationen evoluieren. Genauer gesagt: Anhand des unterschiedlichen Fortpflanzungserfolgs der Individuen ändert sich mit der Zeit der Genbestand (engl.: gene pool) – d. h. die Häufigkeit der Allele und Genotypen – einer Population. In nicht evoluierenden („idealen“) Populationen bleiben die Allel- und Genotypfrequenzen einer Population über Generationen hinweg konstant. Es gilt das Hardy-Weinberg-Gleichgewicht. Als Ausgangspunkt diene uns eine Population, die bestimmte Idealbedingungen erfüllt: ● Die Population soll so groß sein, dass es zu keiner zufälligen Anreicherung einzelner Gene kommt. ● Die Paarung beliebiger heterosexueller Partner soll mit gleicher Wahrscheinlichkeit erfolgen (Panmixie). Die Population soll schließlich so stabil sein, dass in ihr ● weder Mutations- noch Selektionsprozesse stattfinden und ● keine Immigrationen und Emigrationen auftreten. In einer solchen Idealpopulation bleiben die Allel- und Genotypfrequenzen über Generationen hinweg konstant. In ihr findet keine Evolution statt. Die Beziehung, die in einem solchen Zustand des genetischen Gleichgewichts zwischen den Allel- und den Genotyphäufigkeiten besteht, lässt sich nach dem Hardy-Weinberg-Gleichgewicht berechnen. Es wurde 1908 unabhängig voneinander von dem englischen Mathematiker Godfrey Hardy und dem deutschen Mediziner Wilhelm Weinberg formuliert. Nehmen wir an, ein Genlocus sei durch die Allele A (dominant) und a (rezessiv) gekennzeichnet. In der Population sollen die beiden Allele die Häufigkeiten (Frequenzen) p (für A) und q (für a) besitzen: A a Allelfrequenzen: p + q = 1 [38] Bei der Zygotenbildung aus den A- und den a-tragenden Gameten ergeben sich dann für die Genotypen AA (homozygot dominant), Aa (heterozygot) und aa (homozygot rezessiv) die folgenden AA Aa aa Genotypfrequenzen: (p + q)2 = p2 + 2pq + q2 = 1 [39] In einer idealen Population stehen also Allel- und Genotypfrequenzen in einer festen Beziehung zueinander, eben der Hardy-Weinberg-Beziehung, und lassen sich wechselseitig auseinander berechnen (▶ Abb. 11.29). Kann man in einer Population die Hardy-Weinberg-Beziehung – gewissermaßen als Nullhypothese – verwerfen, darf man schließen, dass mindestens eine der oben genannten vier Idealbedingungen nicht erfüllt ist. Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. evolutiven Geschehens sah. Doch hatte er noch vage und, wie wir heute wissen, falsche Vorstellungen davon, wie Vererbung funktioniert. Zwar waren die Arbeiten Gregor Mendels über Züchtungsexperimente schon 1866, also nur sieben Jahre nach Darwins Hauptwerk erschienen. Doch Darwin sind sie auch später unbekannt geblieben. In seiner Pangenesis-Hypothese spricht er von „Keimchen“ (engl.: gemmules), die jede Zelle in verschiedener Größe produziere, die frei im Körper zirkulierten und sich bei der Vereinigung zweier Gameten vermischten, sodass die natürliche Selektion später ein breites Variationsspektrum vorfinden sollte. Mit dem Aufschwung der Genetik und Zellbiologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts traten diskrete „Gene“ und sprunghafte Mutationen in den Mittelpunkt des Interesses. Damit schien sich zwischen den Gesetzen der Vererbung diskreter Gene und Darwins Theorie der Selektion aus einem weitgehend kontinuierlichen Spektrum von Varianten eine Kluft aufzutun. Erst der Populationsgenetik, die in den 1930er Jahren von Ronald Fisher, John Haldane und Sewall Wright begründet wurde, gelang es, diese Kluft zu überbrücken. Indem die „Neodarwinisten“ auf die enorme genetische Variabilität innerhalb von Populationen verwiesen, kehrten sie zum Populationsdenken Darwins zurück. Schon im Titel von Fishers entscheidendem Werk – „The Genetical Theory of Natural Selection“ (1930) – kommt diese Synthese zum Ausdruck. Erweitert wurde sie ein Jahrzehnt später, als vier Biologen ganz verschiedener Couleur – Theodosius Dobzhansky als Genetiker, Georg Gaylord Simpson als Paläontologe, Julian Huxley als Systematiker und allen voran Ernst Mayr – die Ergebnisse biologischer Feldforschung (Systematik und Biogeographie) mit der Populationsgenetik zur „Synthetischen Theorie“ der Evolutionsbiologie verbanden. Mit ihr trat die natürliche Selektion Darwins wieder in den Mittelpunkt evolutionsbiologischen Denkens. Der Stellenwert der Selektion im Evolutionsgeschehen ist zwar immer wieder und zum Teil recht heftig diskutiert worden (S. 538), doch soll uns die Selektionstheorie gerade in ihrer neodarwinistischen (populationsgenetischen) Sicht zunächst als Ausgangspunkt dienen. 11.2 Mechanismen a b A 0,8 aa 0,6 Aa 0,4 0,2 0 0 1,0 0,2 a AA Spermien Genotypfrequenzen 1,0 Eier 0,4 0,6 0,8 1,0 p(A) 0,8 0,6 0,4 0,2 0 q(a) A AA Aa P a Aa aa q P q Abb. 11.29 Hardy-Weinberg-Gleichgewicht (nach Griffith; Stidwill). a Proportionale Anteile der drei möglichen Genotypen (AA, Aa, aa) für zwei Allele (A und a) mit den Frequenzen p und q. Man beachte, dass die Häufigkeit der Heterozygoten (Aa) bei einem Wert von p = q = 0,5 50 % beträgt und diesen Wert nicht überschreiten kann. b Anteile der drei Genotypen bei den in a durch rote Punkte gekennzeichneten Allelfrequenzen p = 0,7 und q = 0,3. Evoluierende Populationen Ideale Populationen sind mit ihren langfristig konstanten Allel- und Genotypfrequenzen Fiktionen. Unter natürlichen Bedingungen sind stets Faktoren am Werk, die wie Mutation und Selektion, Immigration und Emigration zu Änderungen der genannten Frequenzen – also zur Evolution – führen. Man spricht daher von Evolutionsfaktoren. Einer dieser Evolutionsfaktoren, die genetische Drift (Sewall-Wright-Effekt), kommt besonders nachhaltig in kleinen Populationen ins Spiel. In solchen Populationen können nämlich rein zufällig (ohne jegliche Selektion) einzelne Allele aus dem Genpool einer Population eliminiert und andere in ihr angereichert werden. Bei der Kolonisation neuer Gebiete, besonders so abgeschlossener Areale wie Inseln, bestehen Gründerpopulationen oft nur aus wenigen Individuen, die nur einen Bruchteil der Allele des Genpools der Ausgangspopulation mit sich tragen. Sie können diesen zufällig ausgelesenen Allelen in der sich entwickelnden neuen Population jedoch relativ rasch zu großer Häufigkeit verhelfen (Gründereffekt als besonders drastischer Spezialfall der Gendrift). Katastrophenereignisse, die eine Population stark dezimieren, haben in der Restpopulation eine ähnliche Verringerung der genetischen Variabilität zur Folge (Flaschenhalseffekt, engl.: bottleneck). Als viel zitierte Beispiele seien der südafrikanische Gepard (Acrinonyx jubatus) und der Nördliche See-Elefant (Mirounga angustrirostris) vor der Südwestküste Nordamerikas genannt. Die Populationen beider Arten waren durch Bejagung zu Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts auf weniger als 100 Individuen dezimiert worden, dann aber wieder angewachsen. In beiden Fällen zeigen alle untersuchten Genorte hochsignifikant geringere Variabilitäten als das bei verwandten Spezies der Fall ist, z. B. beim Südli- chen See-Elefanten (M. leonina, ▶ Abb. 9.30 b auf S. 441), dem mit seiner zirkumpolaren Verbreitung eine Flaschenhalssituation erspart geblieben ist. Bei Hauttransplantationen zwischen nichtverwandten Individuen der genannten Gepard-Population unterbleiben die sonst üblichen Abstoßungsreaktionen. Die bei Säugetieren sehr hohe Polymorphie des MHC-Clusters (S. 139 und S. 278) – beim Menschen handelt es sich um den am stärksten polymorphen Gen-Cluster überhaupt – ist beim Gepard also extrem reduziert. ▶ Abb. 11.30 liefert ein weiteres – und eines der zurzeit am besten dokumentierten – Beispiele eines Flaschenhalseffekts. Auch die Bedingung der Panmixie ist in natürlichen Populationen kaum je gegeben. Rein aufgrund räumlicher Nähe werden sich Verwandte häufiger als Nichtverwandte verpaaren. Dieser Inzuchteffekt, der natürlich in kleinen Populationen besonders ausgeprägt sein sollte, hat zur Folge, dass sich selbst bei konstanten Allelfrequenzen die Genotypfrequenzen innerhalb der Population verändern – und zwar in Richtung auf eine Zunahme der Homo- und Abnahme der Heterozygoten. Die Nachkommen leiden dann vermehrt an genetischen Defekten (Inzuchtdepression). 11 Selektion bewirkt, dass bestimmte Individuen mehr Nachkommen erzeugen und damit mehr zum Genbestand der nächsten Generation beitragen als andere. In der Generationenfolge führt dieser Prozess zu fortwährenden Änderungen im Genpool einer Population: zu Evolution. Bei der Formulierung seiner Selektionstheorie ging Darwin von drei entscheidenden Befunden aus: ● Alle Organismen erzeugen weit mehr Nachkommen, als bei den begrenzten natürlichen Ressourcen überleben können (Multiplikation). ● Diese Nachkommen stimmen nicht völlig mit ihren Eltern überein, sondern unterscheiden sich von diesen und untereinander (Variation). 531 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. Allelfrequenzen 120 0,18 90 0,12 60 0,08 30 0,04 0 1990 Zeit [Jahre] 1995 0 10 8 6 4 Abb. 11.30 Flaschenhalseffekt bei einer Inselpopulation von Singammern (Melospiza melodia) (nach Keller, Jeffery, Arcese, Bruford). Auf der vor Vancouver gelegenen, nur 6 ha großen kanadischen Insel Mandarte brüten pro Jahr im Mittel 90 Singammern. Während eines extrem kalten und stürmischen Winters (1989, s. Pfeilsignatur) überlebten nur 11 Individuen: 8 Männchen und 3 Weibchen. Doch schon im Verlauf weniger Jahre war die Population wieder auf die alte Größe angewachsen. Während des Flaschenhalsereignisses (Bottleneck) sank die genetische Variabilität (rot, mittlere Anzahl der Allele pro Genlocus, ermittelt an 8 Mikrosatelliten-Loci) auf ein Minimum, stieg jedoch nach dem Bottleneck gleich wieder an, obwohl – wie zu erwarten – die Inzuchtrate nach dem Bottleneck viel höher lag als zuvor (blau). Der Grund für den unerwarteten Wiederanstieg der genetischen Variabilität lag in der Einwanderung eines Weibchens von einer Nachbarinsel wenige Monate nach den Winterstürmen 1989 sowie drei weiterer Weibchen im Folgejahr. ● Den Varianten liegen erbliche Merkmale zugrunde (Heredität). Aus diesen drei Befunden zog er den entscheidenden Schluss: Die ökologische Konkurrenz führt zur verstärkten Auslese (Selektion). Sie hat zur Folge, dass einzelne Individuen einen höheren Fortpflanzungserfolg aufweisen als andere und damit – so können wir heute hinzufügen – aufeinander folgende Generationen in ihren Allelfrequenzen voneinander abweichen. Häufig wird dieses Selektionsszenario mit der Metapher „Survival of the fittest“ umschrieben und betont, dass es sich dabei um eine reine Tautologie handle: „Nur die Tauglichsten überleben, und die Überlebenden sind die Tauglichsten“. Wie unglücklich diese Metapher auch immer gewählt sein mag (sie stammt nicht von Darwin selbst, sondern wurde von Herbert Spencer erst fünf Jahre nach Erscheinen des „Origin“ eingeführt), für das Verständnis der oben erwähnten „Punkte“ in Darwins selektionstheoretischer Argumentation ist sie völlig entbehrlich. Die Selektion bewertet also nicht Gene, sondern Merkmale. Das Ergebnis der Bewertung wird jedoch von Generation zu Generation in Allelfrequenzen abgerechnet. Sind neben den Ausgangsallelfrequenzen auch die Selektionsdrücke – gewissermaßen die Zinssätze – bekannt, lässt sich diese Abrechnung populationsgenetisch erfassen. Vorteilhafte (selektionsbegünstigte) Allele werden 532 sich in der Population im Laufe der Generationenfolgen anreichern (gerichtete Selektion). Hierzu ein paar quantitative Überlegungen: Die Fitness F bezeichnet die Fähigkeit eines Genotyps, Gene zum Genpool der nächsten Generation beizutragen. Im optimalen Fall gilt F = 1. Unter natürlichen Bedingungen wird die Fitness durch einen gegen den Genotyp gerichteten Selektionsdruck (mit dem Selektionskoeffizienten s) vermindert. F=1–s [40] Richtete sich die Selektion (z. B. mit s = 0,001) allein gegen den Genotyp aa (vgl. Gleichung [39], S. 530), würden von 1000 AA- oder Aa-Individuen alle, von 1000 aaIndividuen dagegen nur 999 zur Fortpflanzung gelangen. Selbst geringe Selektionsdrücke können bei konstant anhaltender gleichgerichteter Selektion in geologisch relativ kurzen Zeiträumen zu großen Allelfrequenzänderungen führen. Nehmen wir z. B. an, die Selektion wirke zugunsten des Genotyps aa [F (aa) = 1, F (AA, Aa) = 1 – s]. Dann würde ein rezessives Allel a mit einer Ausgangshäufigkeit von 0,1 bei einem Selektionsdruck von lediglich s = 0,002 in ca. 8000 Generationen eine Häufigkeit von 0,99 erreichen, sich also in der Population nahezu vollständig durchsetzen. Bei s = 0,005 wäre das schon in ca. 3000 Generationen der Fall. Bei einer Generationendauer, die bei den meisten Tieren weniger als ein Jahr und nur bei wenigen mehr als zehn Jahre beträgt, bedeuten diese Zahlen Zeiträume von 103–104 Jahren. Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 0,20 genetische Variabilität 150 mittlerer Verwandtschaftsgrad Populationsgröße, N 11 Evolution b typica carbonaria SO2-Gehalt der Luft [µg × m–3] a wenn also die Vorteile eines Allels a in der heterozygoten Form (Aa) die Nachteile dieses Allels in der homozygoten Form (aa) aufwiegen. Man spricht dann von Heterozygotenvorteil (Heterosiseffekt). In diesem Fall führt die Selektion nicht zur Elimination eines Allels zugunsten eines anderen, sondern zur Fixierung beider Allele (stabilisierende Selektion). Selbst Allele, die im homozygoten Zustand Letalität, d. h. den Tod des Individuums zur Folge haben, können auf diese Weise in der Population erhalten bleiben, wenn sie den Heterozygoten Vorteile bringen. Das ist die genetische Last, die die Population bei Selektionsbegünstigung der Heterozygoten zu tragen hat. Im Endeffekt kommt es zu einer stabilen Gleichgewichtsverteilung verschiedener Typen von Individuen (verschiedener Morphen) innerhalb einer Population. Man spricht von balanciertem Polymorphismus. Ein Paradebeispiel für balancierten Polymorphismus als Folge eines Heterosiseffekts bildet die Sichelzellanämie des Menschen. Im Blutbild durch sichelförmig kollabierte Erythrocyten gekennzeichnet, beruht sie darauf, dass in dem für die β-Kette des Hämoglobins codierenden Gen (auf Chromosom 11) eine Mutation vorliegt, die in dieser β-Kette zum Austausch einer einzigen Aminosäure führt: Anstelle des hydrophilen Glutamats steht in Position 6 jetzt das hydrophobe Valin (▶ Abb. 2.17, S. 80). Diese Substitution hat derart gravierende Veränderungen der Tertiär- und Quartiärstruktur des Hämoglobins zur Folge, dass bei den homozygoten Trägern des Sichelzellallels die Erythrocyten eine sichelartige Form annehmen, bei geringen O2-Partialdrücken im Blut absterben und Verstopfungen der Kapillaren verursachen. Eine schwere, stets zum Tod führende Anämie ist die Folge. Heterozy- 1960 1970 typica 1980 11 300 0,8 200 0,6 0,4 100 Anteil carbonaria-Form Ein anschaulisches Beispiel für gerichtete Selektion liefert der Birkenspanner (Biston betularia), ein Schmetterling, der in der Normalform (Forma typica) durch seine Schwarzweiß-Sprenkelung auf moos- und flechtenüberzogenen Birkenstämmen gut vor Fressfeinden (Vögeln) getarnt ist. Bei ihm begannen sich in den Kohlebergbaugebieten Englands, Deutschlands und Nordamerikas unabhängig voneinander seit 1850 dunkel gefärbte Formen anzureichern (Forma carbonaria: Industriemelanismus, ▶ Abb. 11.31 a). Diese durch ein einziges dominantes Gen bedingte Dunkelfärbung dürfte auf rauchgeschwärzter Unterlage einen beträchtlichen Selektionsvorteil bieten, zumal auf den durch die SO2-Emissionen moos- und flechtenfrei gewordenen Baumstämmen die typica-Falter nicht mehr geschützt waren. In einigen Populationen stieg die Häufigkeit der carbonaria-Form im Laufe eines halben Jahrhunderts von weniger als 0,01 auf über 0,98 an. Wie rasch bei genügend hohem Selektionsdruck ein solcher evolutiver Wandel erfolgen kann, zeigt auch der Umstand, dass seit Ergreifen erster emissionsdämpfender Maßnahmen in den genannten Industriegebieten die Häufigkeit der hellen Form wieder zunimmt (▶ Abb. 11.31 b). Ähnliche Formen des Industriemelanismus sind inzwischen von über 70 Schmetterlings- und einigen Spinnenarten bekannt. Mit noch feinerer Zeitauflösung ließ sich das Wirken der natürlichen Selektion bei Darwin-Finken der Galapagos-Inseln demonstrieren: Erbliche Merkmalsveränderungen der Schnabelform waren hier bereits nach einer einjährigen Dürreperiode nachweisbar (Box 11.4, S. 534). Vielfach sind Allele selektionsbegünstigt, wenn sie in heterozygoter statt in homozygoter Form vorliegen, 0,2 0 1970 1980 1990 2000 carbonaria Abb. 11.31 Industriemelanismus beim Birkenspanner (Biston betularia) (nach Kettlewell; Clarke; Cook). a Verteilung der hellen (typica-) und dunklen (carbonaria-)Form in verschiedenen Regionen Großbritanniens (vgl. weiße und braune Kreissektoren). b Abnahme der carbonaria-Form (braune Kurve) in der Gegend von Manchester (rote Kreissignatur in a) und Rückgang der SO2Schadstoffbelastung der Luft (grüne Kurve). 533 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 11.2 Mechanismen 11 Evolution Box 11.4 Darwin-Finken: Mikroevolution direkt beobachtet 50 a P 1976 P 1976 40 30 Anzahl Individuen 20 10 0 40 b F1 1976 F1 1978 30 20 10 0 7 8 9 10 Schnabelhöhe [mm] 11 Entwicklung der Schnabeldicke bei Darwin-Finken nach einer Dürreperiode. Erklärung im Text. angegeben). Eine einzige Dürreperiode hatte also bereits ausgereicht, innerhalb der Finkenpopulation zu einer gerichteten Verschiebung von Allelfrequenzen zu führen: von Allelfrequenzen jener Gene, die an der Schnabelform beteiligt sind. Die Fotos zeigen denselben Geländeausschnitt auf Daphne im Trockenjahr 1977 und im folgenden Feuchtjahr 1978 (Aufnahmen: P. und R. Grant, Princeton, USA). gote zeigen dagegen nur leichte Krankheitserscheinungen – und zusätzlich Resistenz gegen Infektionen durch einen besonders gefährlichen Malariaerreger, den Einzeller Plasmodium falciparum (S. 569). In malariaverseuchten Gebieten haben sie trotz leichter Anämiesymptome höhere Überlebenschancen als jene an Malaria Erkrankten, die für das normale β-Ketten-Allel homozygot sind. Folglich kann sich das Sichelzellallel in Malariagebieten – und nur dort – in einem stabilen Gleichgewicht mit dem Normalallel halten (▶ Abb. 11.32). Neben dem geschilderten Sichelzellhämoglobin (HbS) tritt noch eine zweite Form (HbC) auf, bei der Glutamat durch Lysin ersetzt ist. Ein weiteres Beispiel bietet die Thalassämie, bei der das Hämoglobin zwar nicht verändert ist, aber in zu geringen 534 Konzentrationen gebildet wird und die β-Ketten ganz fehlen können. Homozygote für das betreffende Gen (auf Chromosom 16) leiden ebenfalls unter schweren Anämien und erhöhter Mortalität, doch Heterozygote sind gegen Infektionen durch den Malariaerreger Plasmodium vivax resistent. In diesem Fall dürfte das gehäufte Auftreten der Krankheit u. a. im Mittelmeerraum und in Vorderasien – also in Gebieten, in denen Malaria kaum mehr vorkommt – auf frühe Selektionsvorteile hinweisen, die heute am Abklingen sind. Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. Bei den samenfressenden Bodenfinken der Galapagos-Inseln führte eine extreme Dürreperiode (Trockenjahr 1977) zur gerichteten Selektion auf stärkere Schnäbel (gemessen als Schnabelhöhe an der Schnabelwurzel). Nur Vögel mit stärkeren Schnäbeln waren in der Lage, beim geringen Nahrungsangebot während der Dürrezeit auch die größeren und härteren Samen zu knacken. Die kleinen, weicheren Samen wurden von allen Individuen gleich häufig gewählt und waren daher schnell verzehrt. Auf Daphne, einer winzigen Felseninsel (▶ Abb. 11.23 b), auf der es dem Forscherehepaar Rosemary und Peter Grant von der Princeton University mit ihren Doktorandinnen und Doktoranden gelungen war, alle (fast 2 000) Finken der Art Geospiza fortis zu beringen, starben im Trockenjahr 1977 mehr als 80 % der Individuen, die 1976 gebrütet hatten. Die orange umrandeten Balken in Teilabb. a zeigen die Schnabeldicken der Elterngeneration, die 1976 gebrütet hatte (P 1976). Ebenso starben im Trockenjahr 1977 alle ihre Nachkommen (orange umrandete Balken in Teilabb. b, F1-Generation 1976). Während des Trockenjahrs 1977 kam es zu keiner einzigen Brut. Erst im Folgejahr brüteten jene, die die Trockenperiode überlebt hatten (blaue Balken in Teilabb. a, Elterngeneration P 1976). Ihre Nachkommen (blaue Balken in Teilabb. b, F1-Generation 1978) besaßen signifikant kräftigere Schnäbel als ihre Artgenossen, die im Jahr zuvor der Dürreperiode zum Opfer gefallen waren (die jeweiligen Mittelwerte sind durch Pfeilsignaturen am oberen Bildrand 11.2 Mechanismen Selektion stabilisierend disruptiv Häufigkeit Fitness gerichtet Sichelzellanämie < 1% 1– 5% HbS 5 –15 % >15 % > 1 % HbC Malaria Abb. 11.32 Geografische Verbreitung der Sichelzellanämie (rot) und der Malaria (schraffiert) in Afrika (nach de Beer; Buettner-Janusch). Die Häufigkeit der Sichelzellallele HbS und HbC ist durch unterschiedliche Rottöne gekennzeichnet. Beschließen wir vorerst unsere Betrachtungen zur Selektion mit einigen allgemeinen Bemerkungen zu den Erscheinungsformen der Selektion; denn je nach den quantitativen Beziehungen zwischen Fitness und Phänotyp kann die Selektion gerichtet, stabilisierend oder disruptiv auf die Häufigkeitsverteilung von Phänotypvarianten wirken. In ▶ Abb. 11.33 sind die drei oben genannten Möglichkeiten grafisch dargestellt. Erzielt ein extremer Phänotyp – z. B. bei Umweltveränderungen (▶ Abb. 11.31) oder bei Einwanderung einer Population in ein neues Habitat – besonders hohe Fitnesswerte, wird sich die Häufigkeitsverteilung der Phänotypen in Richtung auf diesen Phänotyp hin verschieben (gerichtete Selektion). Wie das in Box 11.4 geschilderte Beispiel zeigt, kommt es bei den samenfressenden Darwin-Finken während Dürreperioden zu einer selektiven Begünstigung breiterer und höherer gegenüber schmäleren und flacheren Schnabelformen. Sind dagegen generell extreme Varianten selektiv benachteiligt, begünstigt die Selektion also intermediäre Phänotypen, spricht man von stabilisierender (= optimisierender) Selektion. Bei Enten und Hühnern haben Eier mit intermediärem Gewicht den höchsten Schlüpferfolg, Abb. 11.33 Wirkungsweise der Selektion auf Mittelwert und Varianz einer Phänotypen-Verteilung (nach Cavalli-Sforza, Bodmer). Das obere Diagramm zeigt die Fitness der verschiedenen Phänotypvarianten (rot), das untere deren Häufigkeiten vor (schwarz) und nach (grün) Wirkung der Selektion. Innerhalb der Phänotypen-Verteilung führt gerichtete Selektion zur Verschiebung des Mittelwerts, stabilisierende Selektion zur Verkleinerung und disruptive Selektion zur Vergrößerung der Varianz, im Extremfall – wie hier gezeigt – zur Aufspaltung der Verteilung, d. h. zu Polymorphismus. und beim Menschen Kinder mit intermediärem Geburtsgewicht die höchste Überlebensrate (▶ Abb. 11.34). Im umgekehrten Fall, wenn die Selektion gegen die intermediären Phänotypen gerichtet ist, kann Polymorphismus resultieren: disruptive (= diversifizierende) Selektion. Die frühe Evolution von Mikro- und Makrogameten (Box 9.5, S. 436) kann hier als Beispiel dienen – oder aus evolutiv jüngerer Zeit der Polymorphismus klein- und großschnäbeliger Morphen einer westafrikanischen Finkenart (Pirenestes ostrinus). Offenbar wären hier mittelgroße Schnäbel weder für die weichen noch für die harten Pflanzensamen, die von den Klein- bzw. Großschnäblern bevorzugt werden, effiziente Werkzeuge. Vielfach besteht jedoch gar keine konstante Beziehung zwischen Fitness und Phänotyp, wie sie ▶ Abb. 11.33 voraussetzt. So kann die Fitness eines Phänotyps von dessen Häufigkeit in der Population abhängen (frequenzabhängige Selektion). Tritt z. B. eine Beuteart in zwei verschieden häufigen Varianten auf, werden Räuber eher ein „Suchbild“ (engl.: search image) für die häufigere Variante entwickeln und damit zur Stabilisierung des Beutepolymorphismus beitragen. 11 535 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. Phänotypen-Verteilung 100 0,20 0,10 10 0,05 0 1 2 3 4 5 Geburtsgewicht [kg] 6 Mortalität [%] Häufigkeit 0,15 1 Abb. 11.34 Stabilisierende Selektion für das Geburtsgewicht des Menschen (nach Karn, Penrose). Das mittlere Geburtsgewicht (Histogramm) liegt nahe bei der geringsten Mortalitätsrate (blaue Kurve). Die genetische Variabilität – gemessen z. B. als Anteil heterozygoter Genorte innerhalb einer Population – beruht auf der Mutation und Rekombination von Genen. Obwohl Mutation und Rekombination Zufallsprozesse sind, bilden sie die Grundlage für jegliche Selektionsvorgänge und damit für adaptive evolutive Veränderungen. Mutationen (S. 73) sind seltene Ereignisse. Die spontane Mutationsrate – im Mittel über verschiedene Gene und Organismen – liegt bei etwa 10–6 pro Gen und Zellgeneration. Bei der großen Zahl von Genen pro Organismus (105–106 Gene pro Genom) ergibt sich aber dennoch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb einer Generation in irgendeinem Individuum irgendeine Mutation auftritt. Nach molekularbiologischen Untersuchungen an einzelnen Mäusestämmen ist pro Genom alle zwei Jahre mit einer Nucleotidsubstitution zu rechnen. Darüber hinaus wird die Mutationsrate durch Temperaturanstieg, UV-Bestrahlung oder mutationsauslösende (mutagene) Substanzen erhöht. Phänotypisch kommt das breite Spektrum genetischer Variabilität allerdings nur teilweise zum Ausdruck. Die Degeneration des genetischen Codes hat z. B. zur Folge, dass der genetische Polymorphismus auf der Ebene der DNA den Enzympolymorphismus auf der Ebene der Proteine übertrifft, ohne funktionell in Erscheinung zu treten; denn Nucleotidsubstitutionen in der Drittposition eines Codons machen sich beim Genprodukt nicht bemerkbar (S. 69). Diese „stillen“ Mutationen tragen meistens nicht zum phänotypischen Polymorphismus bei. Potenziell wird der Selektion damit jedoch ein reiches Aus- 536 gangsmaterial geliefert, das unter veränderten genetischen Bedingungen und veränderten Umweltsituationen zum Einsatz kommen kann. Die Rekombination (S. 88) der Erbanlagen bei sexueller Fortpflanzung schafft nicht nur eine weitere, sondern die mit Abstand bedeutendste Quelle genetischer Variabilität innerhalb einer Population. Die rekombinationsbedingte Variabilität ist so groß, dass die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Weibchen zwei genetisch identische Eizellen produziert, mit nahezu Null zu veranschlagen ist. Nimmt man z. B. an, dass ein Organismus 104 frei rekombinierbare Genloci besitzt – eine Zahl, die für einen Prokaryoten eher zu hoch, für einen Eukaryoten eher zu tief gegriffen ist –, nimmt man ferner an, dass jeder Locus zwei Allele aufweist und dass alle Allele gleich häufig auftreten, beträgt die Zahl genetisch verschiedener Gameten, die ein Individuum erzeugen kann, 210 000 ≈ 103 000. Zum Vergleich sei angefügt, dass die Gesamtzahl der Elementarteilchen im Universum auf 10130 geschätzt wird. Die Bedeutung der sexuellen (genauer: bisexuellen) Fortpflanzung dürfte letztlich also in der Produktion einer genetisch mannigfaltigen Nachkommenschaft liegen. Diese Mannigfaltigkeit bietet zumindest zwei Vorteile. Zum einen vermindert sie in einer räumlich wie zeitlich heterogen strukturierten Umwelt die Kompetition zwischen den Nachkommen eines sich sexuell fortpflanzenden Weibchens und erhöht damit die Gesamtüberlebenswahrscheinlichkeit der Gene dieses Weibchens. Zum anderen liefert sie im „evolutiven Wettrüsten“ gegenüber Viren, Bakterien und anderen Parasiten, die mit ihrer kurzen Generationszeit und hohen Reproduktionsrate schon innerhalb weniger Lebensspannen ihrer Wirte bedeutende evolutive Anpassungen vornehmen können, eine günstige Verteidigungsposition, die den Angriff pathogener Mikroorganismen erschwert. Andererseits darf man nicht übersehen, dass Sexualität auch mit hohen Kosten verbunden ist. Bei asexueller (ungeschlechtlicher) Fortpflanzung kann ein Weibchen doppelt so viele (sich wiederum reproduzierende) weibliche Nachkommen erzeugen, als das bei sexueller Fortpflanzung möglich ist, bei der die Hälfte der Nachkommen in Männchen investiert werden muss – und bei der die Weibchen zudem nur die Hälfte ihres Genoms mit dem der Mutter gemeinsam haben. Bei einzelligen Eukaryoten schlagen schon die Kosten der Rekombination zu Buche. Metazoen, vor allem Vertebraten, müssen für sexuelle Selektion (S. 438) oft recht hohe evolutive Kosten aufbringen. Demgegenüber erlaubt die asexuelle Fortpflanzung (z. B. durch Zwei- oder Vielfachteilung bei Einzellern [▶ Abb. 12.3, S. 564]; Knospung bei Cnidariern) ebenso wie die Parthenogenese (unisexuelle Fortpflanzung durch unbefruchtete Eier; z. B. bei Rotatorien, Blattläusen und Hymenopteren, S. 442 und 537) die rasche und weniger kostspielige Erzeugung einer großen, genetisch aber recht homogenen Nachkommenschaft. Bei hohem Selektionsdruck und in relativ homogener Umwelt können ge- Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 11 Evolution 11.2 Mechanismen a MixisStimulus amiktisches Weibchen miktisches Weibchen 2n Subitanei 2n 1n 2n 1n Dauerei miktisches Weibchen haploides Ei Zwergmännchen b 2n Alata 2n StressStimulus KurztagStimulus 2n 2n Sexupara 2n Aptera (Oviparae) oder lebendgebärende (Viviparae). Meistens ist dieser Morphenwechsel mit einem Wirtswechsel verbunden. Beschleunigt werden die pathenogenetischen Vermehrungszyklen noch dadurch, dass bei vielen viviparen Blattlausarten die Weibchen nicht nur Töchter enthalten, die sich in ihrem Körper bereits zu entwickeln beginnen, sondern in den Töchtern auch schon ihre Enkelinnen heranwachsen (engl.: telescoping of generations). Erst wenn sich die Umweltbedingungen generell verschlechtern, was meistens im Herbst der Fall ist, schaltet sich ein bisexueller Fortpflanzungsmodus in die Parthenogenesezyklen ein: Bei Rädertieren bilden sich dann die miktischen Weibchen, bei Blattläusen die Sexuparae. Die resultierenden Dauereier überwintern. In wärmeren Gegenden, in denen kein Bedarf an einem frostresistenten Eistadium besteht, kann die sexuelle Generation aus- Abb. 11.35 Generationswechsel (Heterogonie): Wechsel zwischen parthenogenetischem und bisexuellem Fortpflanzungsmodus. a Rädertiere (Rotatoria). Unter günstigen Gewässerbedingungen vermehren sich amiktische Weibchen über mehrere Generationen mit Subitaneiern in schnellem Zyklus rein parthenogenetisch. Bei hoher Populationsdichte oder genereller Habitatsverschlechterung (Stressfaktoren: Mixis-Stimulus) entstehen aus den Subitaneiern miktische Weibchen, deren haploide Eier sich zu kleinen, kurzlebigen Männchen entwickeln. Diese sofort geschlechtsreifen Zwergmännchen, die keinen Verdauungstrakt besitzen, injizieren ihre Spermien in die Leibeshöhle der miktischen Weibchen. Im Gegensatz zu den unbefruchteten, männchenbildenden Eizellen werden die befruchteten Eizellen (Zygoten) mit Dotter und einer dicken Schale versehen und als trocken-, hitze und kälteresistente Dauereier entlassen. Bessern sich die Umweltbedingungen, entwickeln sich aus den Dauereiern wieder amiktische Weibchen. b Blattläuse (Aphidina). Im Frühjahr schlüpfen aus den überwinternden Eiern nur parthenogenetische Weibchen. Die Erstgeschlüpfte begründet als Fundatrix eine ganze Folge klonaler parthenogenetischer Generationen, die zunächst als Apterae (ungeflügelt), später aber auch als Alatae (gefügelt) erscheinen können und sich im hier gezeigten generellen Schema beide vivipar vermehren. Diese phänotypische Plastizität wird durch Umweltfaktoren gesteuert. Stress-Stimuli wie hohe Populationsdichte, abnehmende Nahrungsqualität oder vermehrter Feinddruck induzieren Alatae. Erst im Herbst werden Geschlechtstiere (Sexuparae) gebildet. Dabei wirkt die abnehmende Taglänge als photoperiodischer Stimulus. Ist der Generationswechsel mit einem Wirtswechsel verbunden, sind auch die Männchen geflügelt. Die farbigen Kreissignaturen symbolisieren Eizellen bzw. abgelegte Eier mit haploidem (1n) oder diploidem (2n) Chromosomensatz. Grau unterlegt: sexuelle Generation. Unterbrochener Pfeil: obligate Parthenogenese. 11 1n 2n Fundatrix 1n 2n Dauerei Ovipara Männchen 537 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. netische Homogenität und Ähnlichkeit mit der Mutter von Vorteil sein; hat doch ein Weibchen durch die reine Tatsache seiner erfolgreichen Reproduktion bereits „bewiesen“, dass sein spezifisches Genom an die lokale Umgebungssituation hinreichend gut angepasst ist und sich ein Auseinanderbrechen dieses günstigen Genoms durch Rekombination kurzfristig eher ungünstig auswirken müsste. Dem entspricht, dass beim Generationswechsel der Rädertiere und Blattläuse (▶ Abb. 11.35) unter konstant günstigen Umweltbedingungen – in der Regel im Sommer – jener Weibchentyp vorherrscht, der sich in rascher Generationenfolge parthenogenetisch fortpflanzt. Bei Blattläusen können die parthenogenetischen Weibchen zudem in verschiedenen Morphen auftreten: als geflügelte (Alatae) oder ungeflügelte (Apterae), als eierlegende 11 Evolution 538 Bakterien, die vor allem in den Ovarien vorkommen, nur maternal übertragen werden (befallene Männchen werden verweiblicht oder sterben), manipulieren sie ihre Wirte in Richtung auf die Entstehung von Töchtern, also auf die Erhaltung ihres eigenen Lebensraums. Die hohe genetische Variabilität innerhalb natürlicher Populationen führt zu immer wieder neuen Kontroversen über die evolutive Bedeutung der Faktoren Mutation und Selektion. Welche Anteile des gefundenen hohen Allelpolymorphismus sind durch Selektion, welche rein zufällig im Genpool einer Population fixiert worden? „Selektionisten“ und „Neutralisten“ bieten hier verschiedene – oft überspitzt formulierte – Antworten feil. Selektionisten waren bereits die Klassiker des Neodarwinismus (allen voran Fisher und Haldane, S. 530), die Anfang der 1930er Jahre aufgrund populationsgenetischer Berechnungen der evolutiven Effekte von Mutation, Selektion und Gendrift zu der Überzeugung gelangten, dass der Faktor Selektion die treibende Kraft allen evolutiven Wandels bildet. Danach verfügen natürliche Populationen aufgrund der über Generationen hinweg angereicherten Mutationen stets über eine so hohe genetische Variabilität, dass sie schnell auf die vielfältigsten Selektionsdrücke reagieren können: Die Geschwindigkeit phänotypischer Evolution wird nicht durch die Mutationsrate, sondern durch die Änderungsrate der äußeren Selektionsdrücke bestimmt. Selektion, nicht Mutation und genetische Zufallsdrift, erscheint den Selektionisten – wie bereits Darwin – als Mechanismus adaptiver Evolution. Neutralisten wie Motoo Kimura vertreten seit Ende der 1960er Jahre die Meinung, dass Mutationen mehrheitlich selektiv neutral sind, sich also nicht aufgrund eines bestimmten Selektionsvorteils, sondern in erster Linie über die Zufallsprozesse der Gendrift in einer Population ausbreiten. Sicher ist die selektive Überlegenheit einzelner Heterozygoten (S. 533) allein nicht in der Lage, den hohen Grad genetischer Vielfalt zu erklären, den man in natürlichen Populationen findet; und sicher geht von der Vielzahl der Mutationen, die in jeder auch nur einigermaßen großen Population pro Generation auftreten, ein Großteil innerhalb weniger Generationen durch reine Zufallsprozesse wieder verloren. Dafür zeichnet allein schon die endliche Populationsgröße verantwortlich. Diese Zufallselimination gilt nicht nur für nachteilige und selektiv neutrale, sondern auch für vorteilhafte Mutationen mit geringem positiven Selektionskoeffizienten. Zweifellos haben also die Neutralisten recht, wenn sie behaupten, dass Allele nicht immer selektive Vor- oder Nachteile bieten müssen, um sich in einer Population durchzusetzen oder eliminiert zu werden. Dabei gilt es natürlich zu bedenken, dass die Selektion stets auf den Gesamtphänotyp eines Organismus, nicht Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. fallen. Statt zur zyklischen kommt es dann zur obligaten Parthenogenese (unterbrochener Pfeil in ▶ Abb. 11.35 b). Beim Rädertier Brachionus calyciflorus fand man kürzlich ein rezessives Allel, das im homozygoten Zustand obligate Parthenogenese bedingt. Die Tiere sind dann nicht mehr in der Lage, auf bestimmte chemische Signale (sogenannte Mixis-Stimuli) zu reagieren, die normalerweise zur sexuellen Fortpflanzung führen. Unter den Wirbeltieren treten parthenogenetische Arten bei einigen Fischen und Reptilien auf. Von den 40 Arten der neuweltlichen Eidechsengattung Cnemidophorus lebt ein Drittel rein parthenogenetisch (Plus 9.3, S. 421). In den Trockensteppen im Südwesten der USA, in denen die meisten dieser parthenogenetischen Cnemidophorus-Arten vorkommen, herrschen relativ stabile Umweltbedingungen, sodass die Konstanz eines einmal als vorteilhaft herausselektionierten Genpools FitnessVorteile bieten dürfte. Generell lassen sich folgende Formen der Parthenogenese unterscheiden: Aus unbefruchteten Eizellen gehen bei der Arrhenotokie Männchen hervor (z. B. die Drohnen bei der Honigbiene und allgemein die Männchen der Hymenopteren), bei der Thelytokie dagegen diploide Weibchen. Letzteres tritt bei der Kapbiene (Apis mellifera capensis) auf, bei der die Arbeiterinnen weibliche Nachkommen erzeugen und diese sogar zu Königinnen aufziehen können. Bei einer japanischen Ameisenart (Pristomyrmex pungens) erfolgt thelytoke Parthenogenese sogar obligatorisch. Hier bestehen die Kolonien nur aus Arbeiterinnen, die kein Receptaculum seminis besitzen, aber alle fähig sind, diploide Eier zu produzieren. Damit ist auch schon das generelle Problem angedeutet, das sich der thelytoken Parthenogenese stellt: die Nachkommen mit diploiden Chromosomensätzen zu versehen. Das kann entweder durch vollständige Unterdrückung der Meiose geschehen (Apomixie), z. B. bei Blattläusen oder bei der Bildung der Subitaneier der Rotatorien (▶ Abb. 11.35), oder dadurch, dass zwar die Meiose eingeleitet, doch während oder nach ihr der diploide Zustand auf die eine oder andere Weise wieder hergestellt wird (Automixie), z. B. bei Schmetterlingsmücken (Psychodidae) und einer der wenigen Drosophila-Arten, für die Parthenogenese beschrieben worden ist (D. mercatorum). Bei der erstgenannten und weitaus häufigsten Form, der apomiktischen Parthenogenese, sind alle Töchter untereinander und mit der Mutter genetisch identisch und damit Klone. So variieren bei den erwähnten parthenogenetischen Cnemidophorus-Eidechsen sowohl morphologische Merkmale (z. B. Schuppenstrukturen) als auch elektrophoretische Proteinmuster zwischen den Individuen kaum. Von artgleichen Tieren übertragene Hauttransplantate werden nicht abgestoßen (hohe Histokompatibilität). Einige Bakterien wie Wolbachia, die Insekten intrazellulär infizieren, können bei ihren Wirten Parthenogenese auslösen. Über thelytoke Parthenogenese produzieren die befallenen Weibchen dann ausschließlich Töchter. Da die auf dessen Genotyp, geschweige denn isoliert auf einzelne Gene wirkt. Bei der polygenen Steuerung nahezu aller Merkmale und der polyphänen Wirkung (Pleiotropie) nahezu aller Gene hängt der Fitnessbeitrag eines Gens stets vom gesamten genetischen Umfeld ab, in dem das Gen zur Wirkung kommt. Daher dürften selbst scheinbar neutrale Allele in einer Population auch deshalb mehr als nur zufallsmäßig erhalten bleiben, weil ihnen in bestimmten Kombinationen ein hoher Selektionswert zukommt. Zudem erkennen wir mehr und mehr, dass sich auch zwischen den Genen innerhalb eines Genoms Selektionsprozesse abspielen (ähnlich wie zwischen Individuen innerhalb einer Population). Die Frage lautet letztlich, wie – und nicht dass – Selektion in den mehr oder weniger stochastisch fluktuierenden Genpool einer Population eingreift und damit die Zufallsfixierung und -elimination von Allelen in eine bestimmte Richtung lenkt. 11.2.2 Artbildung Warum äußert sich Biodiversität – die biologische Vielfalt der Organismen – nicht in einem kontinuierlichen Spektrum von Varianten, sondern in diskreten Einheiten, den Arten (Spezies)? Wie kommt es zu diesen Abgrenzungen? Wie entstehen neue Arten? Schon Darwin hat in der Artbildung (Speziation) die Kernfrage der Evolutionsforschung gesehen und Evolution als eine stete Folge von Artbildungsvorgängen betrachtet. Im Sinne eines biologischen Artbegriffs umfasst eine Art als Biospezies alle Populationen, deren Angehörige untereinander faktisch oder potenziell kreuzbar und unter natürlichen Bedingungen von den Angehörigen anderer Populationen reproduktiv abgegrenzt sind (reproduktive Isolation). Arten werden damit als potenzielle Fortpflanzungsgemeinschaften definiert. Operationell lässt sich diese Biospezies-Definition freilich nur in seltenen Fällen zur Abgrenzung von Arten heranziehen. Meistens sind die Taxonomen darauf angewiesen, Arten als die Gesamtheit der Individuen zu bezeichnen, die in allen wesentlichen morphologischen Merkmalen übereinstimmen und sich mit diesem Merkmalskomplex von anderen solchen Gesamtheiten unterscheiden (Morphospezies-Definition, die auch nichtmorphologische wie physiologische, biochemische und molekulare Merkmale einbezieht). Dass und wie sich Morphospezies in den meisten Fällen schon aufgrund äußerer Merkmalskomplexe gegeneinander abgrenzen lassen und eben kein Kontinuum von Varianten bilden, zeigen bereits ethnozoologische Studien: So haben die Tzeltal-Indianer Mexikos die gleichen Fisch-„Arten“ und die Papuas Neuguineas die gleichen Vogel-„Arten“ unterschieden und benannt, sind also zum gleichen Klassifikationsergebnis gelangt wie moderne Taxonomen. Offenbar sind die Diskontinuitäten real. Andererseits können Arten zwar nachweislich reproduktiv isoliert sein, ohne sich für den Taxonomen deutlich zu unterscheiden. Man spricht dann von Zwillingsarten (engl.: sibling species). Schließlich sei angefügt, dass man den biologischen Artbegriff prinzipiell weder auf fossile Arten noch auf sich asexuell oder parthenogenetisch fortpflanzende Arten anwenden kann. Bei weiträumig verbreiteten Arten ist der Genfluss zwischen geografisch getrennten Populationen natürlich stark eingeschränkt. Zwangsläufig müssen sich solche Populationen dann in ihren Genfrequenzen unterscheiden. Häufig spiegeln sich diese Unterschiede auch in divergierenden phänotypischen Merkmalen wider. Treten solche Merkmalsunterschiede diskontinuierlich auf, erkennt man den betreffenden lokalen Populationen den Rang von Subspezies zu (Unterarten, geografische Rassen). Bei kontinuierlichen Merkmalsgradienten spricht man von Clines (Sing. Cline). Letztere lassen sich häufig mit gradientmäßig variierenden Umweltfaktoren korrelieren. Zum Beispiel steigt bei vielen Vogel- und Säugetierarten mit zunehmender geografischer Breite, d. h. abnehmender mittlerer Jahrestemperatur, die Körpergröße an – verringert sich also das Oberflächen/Volumen-Verhältnis – und erhöht sich die Fell- bzw. Federkleiddichte. Gerade bei polytypischen (aus mehreren Unterarten bestehenden) Arten fällt es oft schwer, den biologischen Artbegriff konsequent anzuwenden und die Grenze zwischen Populationen, Unterarten und Arten begrifflich scharf zu fassen. Man erhält dann den Eindruck, in einem Augenblicksbild Arten in statu nascendi zu beobachten. So bilden Kohlmeisen (Parus major) in ihrer Verbreitung einen ausgeprägten „Rassenkreis“: Von Europa (P. major major) über Kleinasien, Persien, Indien (P. major bokharensis), China und Japan (P. major minor) folgen etwa 30 in ihrer Gefiederfärbung unterscheidbare Rassen aufeinander. In den Grenzgebieten je zweier Rassen treten Bastardierungszonen auf. Nördlich der genannten Rassenkette ist die major-Rasse durch ganz Zentralasien hindurch als einheitliche Subspezies verbreitet. Wo sie im Amurgebiet auf die minor-Rasse als Endglied der südlichen Rassenkette trifft, lebt sie mit ihr sympatrisch, ohne sich mit ihr zu vermischen. Die Endglieder des Rassenkreises verhalten sich also wie echte Arten. Ganz ähnlich bildet der asiatische Grüne Laubsänger (Phylloscopus trochiloides) einen Ring von Subspezies, der sich um das Hochland von Tibet spannt (▶ Abb. 11.36 a). Nach phylogeografischen Studien (anhand molekularer und paläoklimatischer Daten) haben sich nach Ende der Eiszeit Populationen dieser Laubsängerart vom Himalaya längs einer östlichen und westlichen Route um das baumlose tibetanische Hochplateau nach Norden ausgebreitet, wo die Endglieder dieser „Umfassungsbewegung“ – die Subspezies viridanus (V) und plumbeitarsus (P) – heute in Zentralasien als reproduktiv isolierte Populationen aufeinander treffen. In den Überlappungsgebieten der übrigen Subspezies bestehen dagegen keine oder nur sehr beschränkte Reproduktionsschran- 11 539 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 11.2 Mechanismen 11 Evolution b Gesangserkennung a N 50° V P 3 V und P versus L, T, O 2 1 V versus P 0 40° 0 1000 2000 3000 geografische Distanz [km] Tibetanisches Plateau L 20° O T 80° 90° 100° 110° 120° 130° E Abb. 11.36 Geografische Verbreitung und Gesangserkennung bei Subspezies des Grünen Laubsängers (Phylloscopus trochiloides) (nach Irwin, Bensch, Price). a Im „Rassenkreis“ dieser Art werden heute 5 Subspezies unterschieden: plumbeitarsus (P), obscuratus (O), trochiloides (T), ludlowi (L) und viridanus (V). Die Gesangsmuster der Männchen variieren längs des Populationsrings graduell. b Spielt man Tonbandaufnahmen von Gesängen den Artgenossen anderer geografischer Regionen vor, sprechen die Tiere auch dann noch voll auf die Gesänge an, wenn ihr Verbreitungsgebiet bis zu 1 500 km vom Aufnahmeort entfernt liegt. Nur Vertreter der beiden nördlichsten Kontaktpopulationen V und P reagieren selbst bei geringer geografischer Distanz überhaupt nicht mehr aufeinander. Als Gesangserkennung (Ordinate) gilt die Stärke der Antwort eines Artgenossen auf den Gesang des Angehörigen einer anderen Subspezies. ken. Als entscheidender Isolationsfaktor haben sich die Gesänge der Männchen erwiesen, die bei der Ausbreitung nach Norden zunehmend komplexere Struktur annahmen, sodass sich heute Angehörige der Supspezies V und P gesanglich nicht mehr erkennen, auch wenn sie sympatrisch leben (▶ Abb. 11.36 b): reproduktive Isolation aufgrund von Erkennungsmechanismen. Beim nordamerikanischen Leopardfrosch (Rana pipiens) kommt es in der Embryonalentwicklung von Subspezieshybriden umso früher zum Entwicklungsstillstand, je weiter die Elternrassen geografisch getrennt sind (▶ Abb. 11.37). Alle genannten Beispiele zeigen, dass sich die Grenze zwischen Rasse und Art oft nicht scharf ziehen lässt. Im Sinne der nun folgenden Betrachtungen zum Artbildungsvorgang ist das auch gar nicht anders zu erwarten. Neue Arten können durch geografische Separation und anschließende divergente Entwicklung der getrennten Populationen entstehen (allopatrische Artbildung). Der Genfluss wird zunächst eingeschränkt und schließlich ganz unterbunden. 540 A B C D E Abb. 11.37 Hybridisierungsexperimente mit geografischen Rassen des Leopardfrosches (Rana pipiens) (nach Moore). Eier aus Vermont (■) wurden mit Spermien der Lokalitäten A – E besamt. Spermien aus den Arealen A und B führten zu normaler Entwicklung (bei B nur Entwicklungsverzögerung und leichte Abnormitäten), Spermien aus den Arealen C – E zu schweren Defekten und Entwicklungsstillstand im frühen Larvenstadium (C), im Neurula- (D) und Gastrulastadium (E). Die notwendige Separation lässt sich auf verschiedene Art und Weise erreichen: über Splitterpopulationen am Rande des Artverbreitungsgebiets oder – noch extremer – über Gründerindividuen, die passiv über unwirtliche Ha- Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 30° bitate (Wüsten, Gebirge, Meere) verdriftet werden und jenseits dieser geografischen Barrieren neue „Inselpopulationen“ begründen. Solche Verdriftungen können über erstaunlich große Distanzen erfolgen. Die am weitesten vom nächsten Festland entfernten Inseln Neuseeland und Hawaii enthalten als natürlich vorkommende Landsäugetiere zwar nur (flugfähige) Fledermäuse, aber schon die Galapagos-Inseln, die immerhin durch 1000 km offenes Meer von Südamerika getrennt sind (▶ Abb. 11.23, S. 523), wurden nicht nur von Vögeln, sondern auch von flugunfähigen Säugetieren erreicht. Dass dabei kleine Tiere leichter als große verdriftet werden, spiegelt sich in den heutigen Inselfaunen wider: z. B. sind 19 von 20 flugunfähigen endemischen Säugetierarten der philippinischen Insel Luzon und alle flugunfähigen Placentalier Australiens kleine Nagetiere. Sollten Populationen, die über eine gewisse Zeit geografisch getrennt (allopatrisch) existierten, in erdgeschichtlich späterer Zeit wieder (sympatrisch) in Kontakt treten, können sie sich in der Zwischenzeit so weit evolutionär auseinander entwickelt haben, dass Fortpflanzungsbarrieren die beiden Genpools trennen, also zwei neue Arten entstanden sind. Die pleistozäne und postpleistozäne Geschichte Eurasiens (Box 10.6, S. 497) liefert dafür schlagende Beispiele: Mit der Ausdehnung der Gletscher während der Eiszeiten wurden viele Arten in südost- und südwesteuropäische Glazialrefugien abgedrängt, in denen sie sich genetisch isoliert weiterentwickelten. Breiteten sie sich in den folgenden Warmzeiten wieder nach Norden aus, kam es im mitteleuropäischen Raum zur Überlappung von Formen, die sich in ihren östlichen (E) und westlichen (W) Refugien bereits zu eigenen Unterarten oder Arten differenziert hatten. a Bekannte Beispiele bilden Nebelkrähe (Corvus corone cornix, E) und Rabenkrähe (C. c. corone, W), die längs der Elbe eine Bastardierungszone bilden, sich in ihren mtDNA-Mustern aber noch nicht unterscheiden; Sprosser (Luscinia luscinia, E) und Nachtigall (L. megarhynchos, W), die sich verbreitungsmäßig zwar nur geringfügig überlappen, aber nicht mehr kreuzen; oder Wintergoldhähnchen (Regulus regulus, E) und Sommergoldhähnchen (R. ignicapillus, W), die heute als getrennte Arten großräumig sympatrisch leben. Auch die zuvor genannten „Rassenkreise“ von Kohlmeisen und Laubsängern (▶ Abb. 11.36) sind über pleistozän/postpleistozäne Populationsverschiebungen entstanden. Der europäische Igel kommt heute in zwei durch eine Hybridzone getrennten Arten vor (▶ Abb. 11.38 a): einer westlichen (Erinaceus europaeus) und einer östlichen (E. concolor), die sich aufgrund ihrer genetischen Distanzen schon voreiszeitlich im frühen Pliozän getrennt haben müssen. Offenbar sind die nach Fossilfunden über ganz Europa verbreiteten Erinaceus-Vorformen durch die frühpliozäne Kaltperiode (▶ Abb. 10.42 a, S. 496) in südwestund südosteuropäische Refugien abgedrängt worden, aus denen sie sich dann während anschließend wärmerer Zeiten wieder nach Norden ausgebreitet haben. Dieses Szenario hat sich wahrscheinlich während des Wechsels pleistozäner Glazial- und Interglazialzeiten mehrfach wiederholt und zur heutigen Differenzierung der beiden Arten in verschiedene Clades geführt (▶ Abb. 11.38 b). Auch die hohe Artenvielfalt der Tropen (▶ Abb. 10.44, S. 500) wurde ganz wesentlich durch die pleistozän wechselnden Klimabedingungen geprägt. Den Kalt- und Warmzeiten nördlicher Breiten entsprachen in den Tropen Trocken- und Feuchtzeiten. Deren mehrfacher Wech- b 1 europaeus 2 concolor 12 11 6 7 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 1 5 12 4 13 14 14 14 12 europaeus B 11 C 13 15 15 11 A 2 3 concolor 14 0,01 15 D Abb. 11.38 Phylogeografie der beiden Arten des europäischen Igels, Erinaceus europaeus und E. concolor (nach Santucci, Emerson, Hewitt). a Geografische Verbreitung der beiden Arten (graue Schraffur) und Lokalitäten der in die systematische Analyse einbezogenen Populationen (1 – 15). b Phylogramm der Populationen 1 – 15, erstellt anhand von mtDNA-Daten. Phylogeografisch lassen sich vier von Westen nach Osten aufeinander folgende Hauptgruppen (Clades A – D) unterscheiden. Die im Balkan auftretenden Formen (Clade C) wurden auch schon als eigene Art (E. roumanicus) beschrieben. 541 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 11.2 Mechanismen 11 Evolution stant und zur eigenen Art werden. Dann erreichen sie vielleicht auf anderen Wegen auf das Neue die ebenfalls veränderte vorige Varietät, beide nun als sehr verschiedene und sich nicht mehr miteinander vermischende Arten.“ Ist reproduktive Isolation nicht an vorhergehende geografische Isolation gebunden, entsteht eine neue Art also innerhalb des Verbreitungsgebiets der Ausgangsart, spricht man von sympatrischer Artbildung. Schlagartig führen z. B. Genommutationen in Form von Polyploidisierungen zu genetischer Isolation, da Kreuzun- Plus 11.3 „Artenschwärme“ und Speziation bei Cichliden In den großen ostafrikanischen Seen (Tanganyika-, Malawi-, Victoria-See) besetzen die Buntbarsche (Cichlidae, Teilabb. a) alle ökologischen Nischen, die sonst auf mehrere Fischfamilien verteilt sind. Jeder See weist dabei ein ähnliches Spektrum hochspezialisierter endemischer Formen auf: Fischfresser, Molluskenfresser, Algenfresser, Zooplankton- und Detritusfresser haben sich seit der plio-pleistozänen Entstehung dieser Seen in jedem See parallel aus ernährungsmäßig relativ unspezialisierten Flussarten entwickelt: ein klassisches Beispiel adaptiver Radiation. Man spricht geradezu von „Artenschwärmen“ (engl.: species flocks) und meint damit monophyletische Gruppen eng verwandter Arten, die im selben Areal koexistieren. Wie molekulare Studien zeigen, stammen im Malawi- und Victoria-See sogar alle der jeweils über 500 CichlidenArten von je einer Stammart ab, bilden also zwei monophyletische Artenschwärme. Im Victoria-See ließ sich ihr Alter auf etwa 100 000 Jahre eingrenzen. Die extreme Diversifizierung, wie sie sich bei den Cichliden, aber keiner anderen Fischgruppe der ostafrikanischen Seen abgespielt hat, wurde evolutionsbiologisch geradezu als „Cichliden-Problem“ bezeichnet. Bei dieser Diversifizierung dürfte eine funktionsmorphologische Besonderheit der Cichliden eine entscheidende Rolle gespielt haben: Neben den „normalen“ Zähnen vorn im Kieferapparat, die zum Abschaben, -reißen und -saugen der Nahrung dienen, besitzen die Cichliden noch hintere Schlundzähne. Diese Pharyngealzähne, die sich vom 5. Kiemenbogen ableiten, können in ihrer Struktur enorm variieren (Teilabb. b) und den einzelnen Arten damit die verschiedensten Nahrungsnischen erschließen. Darüber hinaus müssen es aber reproduktive Spezialisierungen gewesen sein – die extreme Variation in den Farbmustern der Männchen und die sexuelle Selektion durch die Weibchen –, die die Artdiversifizierung auf die Spitze trieben. Die Cichliden könnten also ein Beispiel dafür liefern, wie in kleinen Populationen sexuelle Selektion zu sympatrischer Artbildung führt. 542 a b Verbreitung und Schlundzähne der Cichliden. a Geografische Verbreitung und phylogenetische Verwandtschaftsbeziehungen der Cichliden deuten auf einen Gondwanaland-Ursprung dieser Fischgruppe (nach Zardoya; Salzburger, Meyer). Die Formen von Indien, Sri Lanka und Madagaskar repräsentieren die basalen Stammlinien. Sie sind monophyletischen Ursprungs. Monophylie gilt auch für die amerikanischen und afrikanischen Gruppen (Schwestergruppen). b Schlundzähne einer Cichlidenart (REM-Aufnahme: A. Meyer, Konstanz). Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. sel führte dazu, dass Biotope immer wieder „verinselten“ und trug damit wesentlich zur Artendifferenzierung bei. Man spricht direkt von einer weltweit wirkenden „eiszeitlichen Artenpumpe“. Wissenschaftshistorisch sei angefügt, dass der Berliner Geologe und Naturforscher Christian Leopold v. Buch schon 1825, also Jahrzehnte vor Darwins „On the Origin of Species“ (1859), klare Vorstellungen darüber entwickelt hatte, wie aus einer Art allopatrisch zwei Tochterarten hervorgehen können. Im Anschluss an einen längeren Forschungsaufenthalt auf den Kanarischen Inseln schrieb er: „Die Individuen der Gattungen auf Continenten breiten sich aus, entfernen sich weit, bilden durch Verschiedenheit der Standörter, Nahrung und Boden Varietäten, welche ... nie von anderen Varietäten gekreuzt, endlich con- gen von Individuen, die sich in der Anzahl ihrer Chromosomensätze unterscheiden, Störungen in der Meiose nach sich ziehen. Bei Pflanzen recht häufig, treten Polyploidisierungen bei Tieren nur selten auf – und nahezu ausschließlich bei Formen, die sich parthenogenetisch fortpflanzen (z. B. Salinenkrebs Artemia; Eidechse Cnemidophorus, S. 421). Sexuelle Reproduktion führt im Falle von Polyploidie wegen der bei Tieren vorherrschenden genetischen Geschlechtsbestimmung (XY-Mechanismus, S. 153) zu Schwierigkeiten bei der Festlegung des Geschlechts. So sind alle bisexuellen Cnemidophorus-Arten diploid; bei den parthenogenetischen kommen dagegen auch tri- und tetraploide Formen vor. In letzter Zeit ist die Möglichkeit sympatrischer Artbildung auch bei Tieren stärker in den Blickpunkt evolutionsbiologischen Interesses getreten. Besonders wenn stabiler (balancierter) Polymorphismus vorliegt und Paarungen bevorzugt zwischen bestimmten Genotypen erfolgen (assortative Paarungen), kann es zu sympatrischer Artbildung kommen. Dabei dürften sexuelle Selektion (S. 438) und dadurch bedingte reproduktive Isolation die Hauptrolle spielen: z. B. wenn Hunderte von nahverwandten Arten auf engem Raum entstehen, wie das bei den Buntbarschen (Cichlidae) der ostafrikanischen Seen (Plus 11.3) und den Drosophila-Arten Hawaiis (S. 523) der Fall ist. Bei letzteren können die Allele eines einzigen Genorts zu derart unterschiedlichen Kopfformen der Männchen führen, dass die von den Weibchen aufgrund der Kopfform selektiv getroffene Partnerwahl ausreicht, Fortpflanzungsbarrieren zu errichten. Auf diese Weise hätten Variationen an einem einzigen Genort unmittelbar sympatrische Artbildung zur Folge. ser) differieren. Entsprechend suchen die einzelnen Arten zur Fortpflanzungszeit verschiedene Mikrohabitate auf und sind damit trotz großräumig sympatrischer Verbreitung während der Reproduktionsphase räumlich isoliert. Zeitliche Isolierung wird durch die Beschränkung der sexuellen Aktivität auf bestimmte Jahres- und Tageszeiten erreicht (▶ Abb. 11.39). Vielleicht am effizientesten dienen artspezifische Signale als verhaltensbiologische Fortpflanzungsbarrieren. Alle Sinneskanäle – chemische, vibratorische, akustische, optische oder elektrische – werden der Arterkennung nutzbar gemacht. Besondere Anforderungen an Prägnanz und Unverwechselbarkeit der Signale stellen sich dort, wo mehrere verwandte Arten sympatrisch leben. Von den 30 – 40 Grillenarten, die in Nordamerika im gleichen Biotop vorkommen und zur gleichen Tages- und Jahreszeit ihre Lockgesänge (Plus 9.2, S. 411) vortragen, besitzt jede ihr artspezifisches Lautmuster. Dagegen verfügen jahreszeitlich oder geografisch getrennte TeleogryllusArten über nahezu identische Gesangsrepertoires. Auch im optischen Bereich wird Artspezifität der Signale oft durch Rhythmusvariation eines einfachen Grundmusters erreicht: Bei Leuchtkäfern (▶ Abb. 9.9 auf S. 416; ▶ Abb. 11.40) und Winkerkrabben (▶ Abb. 9.8, S. 416) können Vertreter von mehr als zehn Arten gleichzeitig auf engem Raum mit „Variationen eines Themas“ artspezifisch kommunizieren. Ein besonders schlagendes Beispiel für die Notwendigkeit der Arterkennung anhand streng artspezifischer Signale liefert eine Gruppe afrikanischer Webervögel, die Witwenvögel, die bei Prachtfinken brutparasitieren (▶ Abb. 11.41). Im Gegensatz zu den Verhältnissen beim europäischen Kuckuck wachsen die Jungen hier gemeinsam mit den Jungen der Wirtsvogelart auf, denen sie in Aussehen und Verhalten bis ins Detail gleichen. In einem An der reproduktiven Isolation zweier Arten ist eine Vielzahl von Fortpflanzungsbarrieren beteiligt, die vor der Paarung (progam, präzygotisch) oder nach der Paarung (metagam, postzygotisch) eingreifen können. Waldfrosch R. clamitans Pickerelfrosch R. palustris Ochsenfrosch R. catesbeiana Leopardfrosch R. pipiens Paarungsaktivität Der Besprechung der Fortpflanzungsbarrieren sei eine prinzipielle Bemerkung vorausgeschickt: Primär besteht kein Selektionsdruck, Fortpflanzungsbarrieren zu errichten, also Arten zu bilden. Vielmehr gilt: Selektionsdrücke haben – ebenso wie genetische Drift und andere Faktoren – zur Folge, dass sich Populationen genetisch auseinander entwickeln und damit sekundär Reproduktionsschranken zwischen ihnen entstehen. Progame Barrieren können zunächst ökologisch rein dadurch gegeben sein, dass sich nahverwandte Arten in räumlichen und zeitlichen Merkmalen ihrer Fortpflanzungsbiologie unterscheiden. Die Fiebermücke Anopheles gambiae wird heute in sechs Zwillingsarten unterteilt, die zwar morphologisch nicht auseinander zu halten sind, aber in der Art des zum Blutmahl aufgesuchten Säugetierwirts und/oder im Eiablageort (Süß- bzw. Brackwas- 11 Grünfrosch R. sylvatica März April Mai Juni Jahreszeit Juli Abb. 11.39 Jahreszeitliche Verteilung der Paarungsaktivität bei fünf in Nordamerika sympatrisch lebenden Froscharten der Gattung Rana, neuweltliche Untergattung Lithobates (nach Wallace). Die Paarungsaktivität wurde anhand der Häufigkeit rufender Männchen bestimmt. An den gleichen Lokalitäten vorkommende Arten sind durch gleiche Farbsignaturen gekennzeichnet. 543 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 11.2 Mechanismen 11 Evolution P. consanguineus P. greeni P. macdermotti 0 5 10 Zeit [s] 15 20 Witwenvogel Tetranura regia Prachtfink Uraeginthus granatinus U. granatinus T. regia Abb. 11.41 Arterkennung bei brutparasitierenden Vögeln (nach Nicolai; Prentiss; Hayman, Arlott). Männchen der brutparasitierenden Witwenvogelart und der zugehörigen Wirtsart, eines Prachtfinken. Die Rachenzeichnungen der Nestlinge beider Arten ähneln sich derart, dass die Wirtseltern die Jungen des Brutparasiten nicht von ihren eigenen unterscheiden können und beide zusammen aufziehen. 544 Abb. 11.40 Zeitliche Blinkmuster der Männchen von vier nordamerikanischen Leuchtkäferarten der Gattung Photinus (nach Lloyd). Die Grundeinheit jeder Signalfolge ist zu Beginn durch die rechteckige rote Umrisslinie markiert. Sie enthält die artspezifische Information: einen Puls oder ein genau definiertes Zeitintervall zwischen zwei Pulsen (vgl. ▶ Abb. 9.9, S. 416). Die Abstände zwischen den Signaleinheiten können variieren und besitzen keine Signalfunktion. frühontogenetischen Prägungsvorgang erlernen die jungen Witwenvögel exakt den Gesang der Wirtsvogeleltern (vgl. S. 423). Damit wird einerseits erreicht, dass sie später als Erwachsene ihre Wirtsvogelart wiedererkennen und deren Nistplätze auffinden können, andererseits aber auch gewährleistet, dass sie sich mit einem artgleichen, d. h. an die selbe Prachtfinkenart angepassten und auf dieselbe Art gesangsgeprägten Geschlechtspartner verpaaren. Bei diesen Erfordernissen einer genauen Wirtsanpassung dürften Prägungsvorgänge schneller und genauer als längerfristige evolutive Adaptationen wirken. Gerade diese Partnererkennungsmechanismen demonstrieren das eingangs genannte Prinzip, dass der Selektionsdruck primär auf die Wahl eines aus derselben Population stammenden Partners gerichtet ist und die reproduktive Isolation gegenüber Vertretern anderer Populationen erst als sekundäre Folge resultiert. In diesem Sinne hat man den Begriffen der Morpho- und Biospezies (S. 539) sogar eine auf Erkennungsmechanismen beruhende Spezies-Definition zur Seite gestellt (vgl. das Beispiel des Grünen Laubsängers, ▶ Abb. 11.36, S. 540). Mechanisch funktionieren männliche und weibliche Kopulationsorgane oft nach hochkomplexen SchlüsselSchloss-Prinzipien (z. B. bei Spinnen, Tausendfüßlern, Insekten), sodass die Paarung nur zwischen artgleichen Sexualpartnern gelingt. Hier wie bei den zuvor genannten Erkennungssignalen ist freilich anzufügen, dass ein Individuum an den entsprechenden Merkmalen nicht nur die generelle Artzugehörigkeit, sondern auch noch speziellere Eignungsfaktoren des Partners evaluiert (sexuelle Selektion, S. 438). Gametische Isolation bildet schließlich die letzte Bastion progamer Artentrennung. Zwischen Drosophila virilis und D. americana sind zwar Kopulationen und Besamung (Insemination) möglich, doch kommt es nicht zur Befruchtung (Fertilisation), da die Spermien im Genitaltrakt des artfremden Weibchens immobilisiert werden und damit die Eizellen nicht erreichen. Zu den metagamen Barrieren zählen Störungen in der Embryonalenwicklung von Hybriden (Hybridensterblichkeit, ▶ Abb. 11.37), Hybridensterilität oder – in schwächerer Form – auch Konkurrenzunterlegenheit der Hybri- Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. P. aquilonius 11.2 Mechanismen Ob sich Arten wirklich allmählich (gradualistisch) aus divergierenden Populationen über Varietäten und Subspezies schließlich zu reproduktiv isolierten Einheiten (Spezies) evoluieren, wird in der modernen Gradualismus-Punktualismus-Debatte diskutiert. Darwin vertrat – wie auch die Neodarwinisten (S. 530) – einen gradualistischen Standpunkt und betrachtete Arten als „merely highly developed varieties“ (zum Gradualismus bei der Organevolution s. Plus 11.4, S. 546). Die Punktualisten akzeptieren zwar Variation und Selektion als Erklärung evolutiven Wandels innerhalb von Populationen, glauben jedoch für die Artbildung andere Mechanismen postulieren zu müssen, sodass die Evolution innerhalb der Arten (Mikroevolution) von der zwischen Arten (Makroevolution) abzukoppeln sei. Sie sind überzeugt, dass der Fossilbeleg mit seinem oft sprunghaften Auftreten neuer Formen ein weitgehend vollständiges Bild des Evolutionsgeschehens vermittelt. Nach diesem Konzept des „unterbrochenen Gleichgewichts“ (engl.: punctuated equilibrium) sollen Artbildungsprozesse relativ rasch erfolgen und durch lange Perioden der Artkonstanz (Stasis) getrennt sein. Während der Stasis-Perioden sei das Genom einer Art durch genetische Kontrollmechanismen gegen die Wirkung von Mutabilität und Umweltwandel gepuffert („genetische Homoiostase“). Erst wenn diese Faktoren einen kritischen Schwellenwert erreichten, bräche die Homoiostase zusammen; eine „genetische Revolution“ setze ein und führe zur Bildung einer neuen Art. In diesem Zusammenhang könnte man an Mutationen im Bereich homeotischer Gene denken, die auf die Anlage des generellen Körperbauplans Einfluss nehmen (S. 186, S. 198). Bei der Beurteilung beider Standpunkte sei zunächst auf das Problem der Zeit hingewiesen. Zeiträume, die für die Genetiker (in der Mehrzahl Gradualisten) lang genug sind, um gradualistische Artbildung zu ermöglichen, erscheinen den Paläontologen (aus denen sich die meisten Punktualisten rekrutieren) nur als kurze Intervalle längs der geologischen Zeitskala. Populationsbiologische Untersuchungen geben zudem wenig Anlass zu der Annahme, dass sich Artbildungsprozesse, gemessen an der nachfolgenden Dauer der Art, extrem rasch vollziehen müssten. Vorläufig scheint es jedenfalls nicht möglich, einem Artbildungsprozess ein bestimmtes relatives Zeitmaß zuzuordnen. Die mikroevolutiven Prozesse, die man z. B. bei den Darwin-Finken auf Galapagos direkt beobachten konnte (Box 11.4, S. 534), führten zu genetisch bedingten Merkmalsveränderungen, die in der Generationenfolge um einen Mittelwert schwankten. Diese Schwankungen um einen Mittelwert lassen sich zwanglos damit erklären, dass die treibenden Selektionsdrücke (letztlich bedingt durch die mittleren Jahresniederschläge) während des jahrzehntelangen Beobachtungszeitraums im Mittel konstant blieben. Doch dürften die gleichen mikroevolutiven Prozesse dann zu systematischen Merkmalsveränderungen führen, sollten sich die Selektionsdrücke über längere Zeit konstant in eine Richtung ändern. 11.2.3 „Makroevolution“: langfristiger Formenwandel Über die Artbildung hinaus führt Evolution langfristig zu tiefgreifenden Organisationsunterschieden zwischen Organismen: Neue Strukturen entstehen, evolutive „Durchbrüche“ erfolgen und erreichen neue evolutive Plattformen. In der klassischen Taxonomie haben solche Gruppenmerkmale zu einem hierarchischen System von „Ordnungen“, „Klassen“ und schließlich „Stämmen“ geführt. Doch evolutionsbiologisch lautet die Frage: Sind diese „makroevolutiven“ Vorgänge das Ergebnis zeitlich hochgerechneter mikroevolutiver Prozesse, oder sind hier andere Mechanismen am Werk? Gerade die Entwicklung komplexer Strukturen, die wie die Federn der Vögel zur taxonomischen Abgrenzung größerer Organismengruppen dienen, hat immer wieder zu Makroevolutions-Hypothesen Anlass gegeben. Die Evolution solcher höherrangigen Gruppenmerkmale müsse – so wird argumentiert – mithilfe anderer Mechanismen (sog. Makro- oder Systemmutationen) erfolgt sein, als sie bei der Artbildung wirksam sind. Die Argumente ähneln weitgehend denen des Punktualismus. Ihnen steht die Hypothese gegenüber, dass auch größere evolutive Durchbrüche zu neuen biologischen Organisationsniveaus durch Summation kleiner Evolutionsschritte zustande gekommen sind (Argument des Gradualismus). Einige Befunde mögen bei der Klärung dieser MikroMakro-Evolutionsdebatte hilfreich sein, ohne dass wir hier eine endgültige Entscheidung vornehmen wollen: Evolutive Durchbrüche sind meistens mit dem Angebot neuer ökologischer Lizenzen verbunden, mit der Erschließung neuer Lebensräume, d. h. dem Wirken neuer Selektionsdrücke. Radiationen wie die der Buntbarsche in den ostafrikanischen Seen (Plus 11.3, S. 542), der Darwin-Finken auf Galapagos (S. 520) oder der Drosophiliden auf Hawaii (S. 523) haben in jeweils neuen Habitaten zur raschen Besetzung eines weiten Spektrums ökologischer Nischen geführt. Doch spielten sie sich alle im relativ engen Rahmen eines niederen systematischen Ranges ab – innerhalb einer kleinen Gruppe von Fischen, Vögeln oder Fliegen. Mit der erstmaligen Besiedlung ganz neuer 11 545 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. den. Klassische Beispiele für Hybridensterilität bilden Maultier (Pferd ♀ × Esel ♂) und Maulesel (Esel ♀ × Pferd ♂), die immer wieder neu aus den Elternarten gezüchtet werden müssen. 11 Evolution Plus 11.4 Graduelle Evolution eines komplexen Organs (Linsenauge) – eine Modellrechnung Lebensräume wie z. B. des Festlandes eröffneten sich dagegen derart weite und völlig neuartige ökologische Zonen, dass adaptive Radiationen ungleich größeren Ausmaßes möglich wurden. Hier zeigt sich jedoch bereits ein zweites: Nur Angehörigen zweier Großgruppen (zweier „Tierstämme“) – nur den Arthropoden und den Vertebraten – ist es in größerem Umfang gelungen, die ökologischen Lizenzen terrestrischen Lebens zu nutzen und im Silur bzw. Devon (S. 629, S. 684) Radiationen einzuleiten, mit denen sie 546 538 495 192 308 Vom flachen Photorezeptorepithel zum Linsenauge. Fünf zufällig herausgegriffene Stadien der Modellrechnung. In blau ist jeweils die Anzahl der 1 %-Modifikationsschritte angegeben, die von einem Stadium zum nächsten führen. Ähnliche Stadien wie die hier gezeigten treten bei Mollusken und Anneliden als definitive Augenformen auf. die heutige Landfauna dominieren. Auch diese Großradiationen waren in ihrem Verlauf natürlich nicht vorhersagbar, erfolgten nicht im Sinne einer planmäßigen „Eroberung“ des Landes, sondern verliefen über lokale Anpassungsschritte, bei denen die Präadaptation (= Exaptation) einer Struktur für neue Funktionen günstige Voraussetzungen bot. Wir hatten bereits gesehen (S. 511), wie die muskulösen „Fleischflossen“ der SarcopterygierFische eine kurzfristige Fortbewegung über Land ermöglichten. Im trockenwarmen Klima der Devonzeit, in der Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. „If it could be demonstrated that any complex organ existed that could not possibly have been formed by numerous, successive, slight modifications, my theory would absolutely brake down“, schrieb Darwin in seinem Hauptwerk 1859 und bezog sich dabei speziell auf das menschliche Auge: „That it could have been formed by natural selection seems, I freely confess, absurd in the highest possible degree“. Aber so absurd erschien es ihm dann doch wieder nicht; denn anschließend vermutete er, dass das Auge doch entstanden sein könnte „by the gradual selection of slight, but in each case usefull devations“. Dass das in der Tat der Fall sein kann, zeigen moderne Modellrechnungen. Diese Berechnungen sind möglich, weil das Selektionsziel – ein Sehorgan mit immer besserer räumlicher Auflösung – bekannt ist und sich die strukturellen Parameter, die dazu nötig sind, quantitativ formulieren lassen (vgl. z. B. ▶ Abb. 7.19, S. 372). Wenn nämlich die natürliche Selektion die Auflösung von immer feinerem optischen Detail fördert, wird sich ein oberflächenparalleles Epithel von Photorezeptoren (rot), unterlagert von einem Schirmpigmentepithel (schwarz; beide zusammen bilden die Retina) und überlagert von einer transparenten Schutzschicht (grün) über graduell aufeinander folgende kleine Verbesserungen der Bildqualität schließlich in ein fokussiertes Linsenauge verwandeln: Die Retina senkt sich ein, die Grubenöffnung (Pupille) verkleinert sich, und die transparente Schutzschicht bildet durch schrittweise Änderung ihrer optischen Dichte eine lichtbrechende Linse. Selbst wenn man bei der Modellrechnung sehr konservativ vorgeht, d. h. bei jedem Evolutionsschritt nur eine Verbesserung von 1 % ansetzt, und mit sehr geringen Variationskoeffizienten und Selektionsdrücken arbeitet, genügen bereits ca. 350 000 Generationen, um aus einem flachen Rezeptorepithel ein Linsenauge hervorgehen zu lassen, wie es z. B. Fische, Anneliden und Cephalopoden besitzen. Nimmt man ferner an, dass die Generationsdauer etwa 1 Jahr beträgt (was für kleine und mittelgroße aquatische Tiere im Mittel zutreffen dürfte), ist der gesamte Prozess in weniger als 400 000 Jahren abgeschlossen. Darwins Zweifel lassen sich also zerstreuen. den Süßgewässern ständig Sauerstoffarmut und Austrocknung drohte, waren die Fleischflossen nützlich, um zusammen mit anderen Präadaptationen – z. B. speziellen Vorderdarmaussackungen, mit denen die Fische Luftsauerstoff aufnehmen konnten – die allmähliche Entwicklung landlebender Formen zu begünstigen. In jedem Fall sind Selektionsdrücke stets auf den jeweils herrschenden, niemals den zukünftigen Bedarf gerichtet. Kehren wir noch einmal zum Übergang Wasser-/Landleben zurück. Während sich die Extremitäten wasserlebender Vertebraten ebenso wie die wasserlebender Arthropoden zu Lokomotionsorganen terrestrischer Formen modifizieren ließen, war das z. B. beim Ambulacralfußsystem der Echinodermen, das mit dem Meerwasser in offener Verbindung steht (▶ Abb. 12.119, S. 646), nicht möglich. Lizenzen werden also nicht nur von der Umwelt, sondern auch von der jeweils erreichten Organisationsform der Organismen erteilt. Ein Beispiel: Landarthropoden können v. a. wegen des Gewichts und der geringen Stoßfestigkeit ihres Exoskeletts, aber auch aufgrund ihrer Tracheenatmung (S. 264) Körpergrößen von 10 – 20 cm und Körpergewichte von 50 – 100 g nicht überschreiten. Marine Arthropoden erreichen dagegen Spannweiten von bis zu 4 m und Körpergewichte von über 6 kg (Riesenkrabbe Macrocheira). Auch biogeografische Faktoren, die für das Fehlen oder Auftreten konkurrierender, möglicherweise ökologisch überlegener Organisationsformen verantwortlich sind, können die Radiations- und Existenzmöglichkeiten einer Tiergruppe in bestimmte Richtungen lenken. Hier sind es in erster Linie großräumige plattentektonische Veränderungen, die biogeografisch isolierte Entwicklungen oder Konfrontationen größerer Organismengruppen zur Folge haben. So wird die Tatsache, dass in Australien die Beuteltiere ökologisch jene Planstellen einnehmen, die andernorts den placentalen Säugetieren zukommt, aus der plattentektonischen Geschichte Australiens verständlich. Ursprünglich auf Nordamerika beschränkt, erreichten die Beuteltiere zu Ende der Kreidezeit über eine Reihe damals noch bestehender Verbindungen der auseinanderbrechenden Gondwana-Landmasse via Südamerika und Antarktika Australien, das sie im Eozän erreichten. Im Paläozän hatten sie auch ganz Eurasien und Nordafrika besiedelt, starben dort aber wieder aus. In Australien, das sich plattentektonisch vor 45 Mio. Jahren von allen anderen Kontinenten trennte, haben sie dann eine den Placentaliern der übrigen Welt vergleichbare Radiation mit verblüffenden Konvergenzen erlebt. Neben einer Vielzahl von Insektenfressern, die sich rennend, grabend, springend oder gleitfliegend fortbewegen (Beutelmaus, Beutelmaulwurf, Beutelspringmaus bzw. Flugbeutler) oder in ihrer Nahrungswahl extrem spezialisiert sind (Ameisenbeutler), entwickelten sich räuberische Fleischfresser (Beutelmarder, Beutelwölfe; ▶ Abb. 11.42), Nektarsauger (Honigbeutler), Frucht- und Blattfresser (Kletterbeutler, Koalas), nagetierähnliche Wurzelfresser (Wombats) a b Marsupialia Incisivi Oberkiefer Unterkiefer I Canini Praemolares Molares Zahnformel I I I I C P P P M M M M 5134 I I I I C P P P M M M M 4134 P3 M1 I1 C 11 P3 Placentalia P1 Oberkiefer I I I C P P P P M M M 3143 Unterkiefer I I I C P P P P M M M 3143 M1 P4 M4 M1 I1 C P4 M1 Abb. 11.42 Konvergenzen bei Beuteltieren (Marsupialia) und Placentaliern (nach Ax; Starck). a Zahnformel. In je einer Oberkiefer- und Unterkieferhälfte ist die Verteilung der Schneidezähne (Incisivi), Eckzähne (Canini), vorderen Backenzähne (Praemolares) und hinteren Backenzähne (Molares) angegeben. Die Umrandung markiert jene Zähne, die zunächst als Milchzähne ausgebildet und dann gewechselt werden. Bei den Beuteltieren ist das nur beim 3. (letzten) Praemolar der Fall. b Schädel. Oben Schädel eines Marsupialier-Raubtiers, des vor wenigen Jahrzehnten ausgerotteten tasmanischen Beutelwolfs (Thylacinus), unten der eines Placentalier-Raubtiers (Hund, Canis). Thylacinus besaß in jeder Kieferhälfte nur 2 Schneidezähne. Zum Brechscherengebiss der Placentalier vgl. ▶ Abb. 12.135 (S. 661). 547 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 11.2 Mechanismen sowie große grasende Pflanzenfresser (Kängurus). Beutelfledermäuse fehlen diesem weiten Marsupialierspektrum: Die zum aktiven Flug befähigten Fledermäuse sind die einzigen Placentalier, die Australien vor Ankunft des Menschen erreichten. Während im amerikanischen Ursprungsgebiet fossil nur insectivore und carnivore Formen vorkommen, rezent z. B. das Opossum (Didelphis), entstanden in Australien auch Herbivore (z. B. Kängurus). Alle bisher genannten Faktoren können an evolutiven Neuerungen größeren Umfangs – an phylogenetischen Großübergängen – beteiligt sein. Unser rasant steigendes Wissen um die genetische Steuerung der Entwicklung zeigt nun mehr und mehr, dass geringfügige Änderungen in relativ wenigen entwicklungsbestimmenden Genen oft gravierende Veränderungen der Körpergestalt zur Folge haben. Mutationen in solchen frühontogenetisch wirksamen Genen können die Entwicklungsgeschwindigkeit einzelner Körperteile erhöhen oder verringern (Heterochronie, S. 183) oder die räumliche Anordnung einzelner Körperteile verändern (Heterotopie). Kleine Differenzierungen der räumlichen und zeitlichen Entwicklungsmuster führen dann zu ganz neuen Gestalten, also „makroevolutiven Schritten“. Dabei kommt den Homeobox-Genen (S. 191), die bei Invertebraten wie Vertebraten für die Entwicklung des segmentalen Grundbauplans verantwortlich sind und gruppenspezifisch nach genauen zeitlichen und räumlichen Mustern exprimiert werden, eine besondere Bedeutung zu (Evo-Devo-Ansatz, S. 524). Kommt in einer Reihe von Segmenten die ursprüngliche Entwicklungspotenz eines Segments in einem anderen zum Ausdruck, spricht man von Homeosis, einem (gewissermaßen linearen) Spezialfall der Heterotopie. Versuchen wir zum Schluss dieses Kapitels, die Evolution der Organismen einmal in ihren großen Zügen zu erfassen, losgelöst von gruppenspezifischen Details, aber multidisziplinär mit Argumenten von der Paläontologie bis hin zur Zell- und Molekularbiologie. Dann erkennen wir eine Folge von Systemübergängen, von Megaschritten der Evolution, denen eines gemeinsam ist: Stets haben sich zuvor autonome Funktionseinheiten zu komplexeren Gebilden zusammengeschlossen. Welche Formen Lebewesen auch immer annehmen, welche Funktionen sie auch immer erfüllen mögen, die fundamentalsten Eigenschaften von Einheiten, die wir „lebend“ nennen, lauten (S. 531): Multiplikation (Vermehrung), Variation und Heredität (Erblichkeit). Dabei heißt Variation, dass es eine Vielzahl verschiedener vermehrungsfähiger Einheiten gibt (A, B, C etc.), und Erblichkeit, dass diese verschiedenen Einheiten bei der Vermehrung ihre Eigenheiten beibehalten (z. B. A → A, B → B), dass aber gelegentliche Störungen zu Abwandlungen führen (Variation; z. B. C → D statt C → C). 548 Diese drei Eigenschaften bezeichnen zwar notwendige, aber nicht hinreichende Bedingungen für die Existenz und Evolution von Lebewesen. Die Umwelt muss die nötigen Selektionssituationen schaffen, damit die Varianten mit ihrem jeweils unterschiedlichen Vermehrungspotenzial das Spiel der Evolution in Gang setzen können. Selbstreplizierende Makromoleküle, die alle drei genannten Eigenschaften in sich vereinen, sind zunächst in Form von RNA-, dann in Form von DNA-Molekülen schon relativ früh in der Erdgeschichte entstanden: im warmen, sauerstofffreien und nährstoffreichen Urozean (S. 245). Diese Replikationsmoleküle haben sich dann in einem ersten großen Innovationsschritt in einfache Zellen (Prokaryoten-Zellen) eingeschlossen und sich in diesen Zellen längs eines Chromosomenfadens miteinander verkoppelt. Während 2 Milliarden Jahren, also während nahezu der Hälfte der gesamten Erdgeschichte, waren diese Zellen die einzigen Lebewesen auf unserem Planeten. In Form dichter Matten von Cyanobakterien – als Stromatolithen die ältesten bekannten Fossilien – überzogen sie alle feuchten Zonen der Erdoberfläche. Später schlossen sich in einem weiteren Systemübergang mehrere solche Prokaryoten-Zellen – jede mit einer anderen Stoffwechselfunktion – kooperativ zu einem neuen, zehntausendmal größeren Zelltyp zusammen: zur Eukaryoten-Zelle. Nun beschleunigte sich der Gang der Evolution. In der großen kambrischen Wende (S. 514) traten in den Ozeanen fast sprunghaft komplexe mehrzellige Organismen auf den Plan, und zwar in einer Vielfalt von Konstruktionstypen, die sich seither kaum mehr vergrößert, eher verringert hat. Der darauf folgende Zusammenschluss mehrzelliger Organismen zu überindividuellen Strukturen ist recht jungen Datums. Er nahm verschiedene Wege und hat u. a. zu den Superorganismen der Insekten (S. 444) und verschiedenartigen Sozietäten bei Säugetieren (S. 447) geführt. Die schrittweise Zunahme an Komplexität (▶ Abb. 11.43) scheint ein generelles Prinzip der Evolution zu sein. Das Erscheinungsbild der einzelnen Stufen kann zwar von Fall zu Fall variieren, aber einen Weg zurück gibt es nicht. Nie ist im Laufe der Evolution eine Prokaryoten- aus einer Eukaryoten-Zelle hervorgegangen, nie eine solitäre Insektenart aus einer hoch sozialen. Sollte das Stück von der Evolution des Lebens auf unserer Erde noch einmal von vorn gespielt werden, dann wäre wohl die Harmonie der Musik dieselbe, auch wenn andere Melodien erklängen. Der Aufbau von Komplexität durch diese Art „stratifizierter Stabilität“ birgt jedoch Gefahren. In keinem der Systeme herrscht prästabilisierte Harmonie. Denn keines der Systeme wurde de novo am Reißbrett entworfen. Sie alle sind aus dem Zusammenschluss vorher selbständiger Einheiten hervorgegangen. Dieser Zusammenschluss erfolgte keineswegs uneigennützig. Stets versuchten die niederen Einheiten, das Vehikel eines übergeordneten Systems zu nutzen, um ihre eigene genetische Fitness zu erhöhen. Doch blieben dabei die angestammten Eigen- Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. 11 Evolution 11.3 Hominiden-Evolution 0 AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB AB überindividuelle Strukturen Milliarden Jahre –1 mehrzellige Organismen –2 –3 AB AB Eukaryoten-Zellen AB Prokaryoten-Zellen Abb. 11.43 Megaschritte der Evolution (nach Seeley; Buss). Die Hauptstufen biologischer Organisationsniveaus (Funktionseinheiten). Oberhalb der Stufe selbstregulierender Makromoleküle sind die einzelnen Funktionseinheiten dadurch ausgezeichnet, dass sie Einheiten der niederen Stufen inkorporiert haben. –4 Traditionell wurden die Hominiden mit der einzigen rezenten Art Homo sapiens den Pongiden – den „großen Menschenaffen“ – gegenübergestellt. Zu letzteren zählen die Orang-Utans Indonesiens (Pongo, 2 Arten: P. pygmaeus auf Borneo, P. abelii auf Sumatra) sowie die beiden afrikanischen Gattungen Gorilla (Gorilla, 2 Arten: G. gorilla, Flachlandgorilla; G. beringei, Berggorilla) und Schimpanse (Pan, 2 Arten: P. troglodytes, Schimpanse; P. paniscus, Bonobo). Doch wie bereits angedeutet, zeigen molekulare und morphologische Daten, dass die Pongiden eine paraphyletische Gruppe (S. 561) darstellen und damit keine Einheit im Sinne der phylogenetischen Systematik bilden (▶ Abb. 11.44). Catarrhini (Altweltaffen) 11.3 Hominiden-Evolution Hominoidea (Menschenaffen und Mensch) Hominidae Homo Pan Gorilla Pongo Homininae (Gibbons) Cercopithecidae Biologisch bildet der heutige Mensch als einzige Art (sapiens) der einzigen rezenten Gattung Homo einen Vertreter der Säugetiergruppe Primaten. Die Übereinstimmung in anatomischen, physiologischen und biochemischen Merkmalen (▶ Abb. 11.3, S. 506), in Chromosomstruktur und molekularem Genbestand zwischen dem Menschen und den afrikanischen Menschenaffen Schimpanse (Pan) und Gorilla (Gorilla) ist so groß, dass man letztere zweifellos als die nächsten biologischen Verwandten des Menschen betrachten kann (▶ Abb. 11.44). Hylobatidae interessen der niederen Einheiten durchaus bestehen. Ständig gefährden sie die Balance zwischen Kooperation und Konflikt. „Checks and balances“ spielen auf allen Ebenen: von den Chromosomen, wo sich die Jumping genes dem Chromosomenkonformismus synchroner Replikation entziehen, bis hin zum Superorganismus, in dem immer wieder einzelne Individuen über eigene Reproduktion ihre direkte Fitness zu steigern versuchen. Doch generell hat das Hochschrauben der Komplexitätsspirale dazu geführt, dass sich mit jedem neuen Komplexitätsniveau die ökologische Reichweite des Systems vergrößerte, damit aber auch die Vielfältigkeit der Welt, in der es operiert, und die Menge an Information, die zur Verarbeitung anfällt. 11 11.3.1 Evolutive Abläufe (Formenvielfalt) Nach molekularen Daten sind Mensch (Homo) und Schimpanse (Pan) näher miteinander verwandt – sie haben nahezu 99 % ihrer Gene gemeinsam – als die großen Menschenaffen (Pan, Gorilla, Pongo) untereinander. Die Systematik muss diesen Befunden Rechnung tragen. Abb. 11.44 Die Stellung des Menschen (Homo) im phylogenetischen System der Altweltaffen. Oben sind in blauer Schrift die heute gebräuchlichen Bezeichnungen der Gruppen angegeben, die die Stammbaumanalyse (unterer Teil des Bildes) als monophyletisch ausweist. Pongo, Gorilla und Pan (graues Feld) wurden früher als „Pongidae“ (große Menschenaffen; die Hylobatidae figurieren als kleine Menschenaffen) den Hominidae (nur mit Homo) gleichrangig gegenübergestellt. Doch zeigt die Stammbaumanalyse, dass es sich bei den Pongiden um eine paraphyletische Gruppe handelt. Zur Stellung der Altweltaffen im System der Primaten s. ▶ Abb. 12.178 (S. 700). 549 Heruntergeladen von: Thieme E-Books & E-Journals. Urheberrechtlich geschützt. Replikationsmoleküle (Hundsaffen) A B