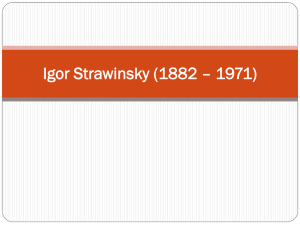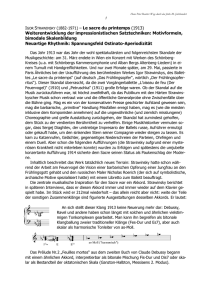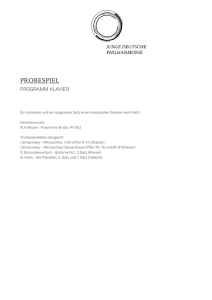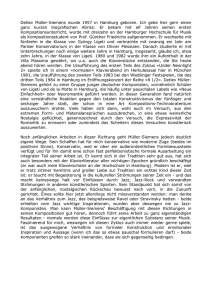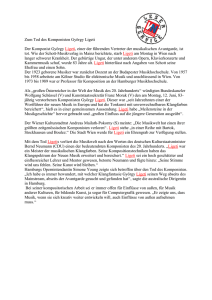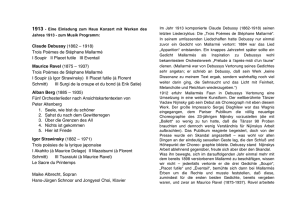dasselbe, anders
Werbung

↖ MUSIK A LISCHE LEIT J É R É MIE RHORER UNG: DA NIEKON ZERT ND E A , E B L E SS 4. SINFO RS LE GEL SPIE UHR CHE SPIE IS L A 13, 19.30 IK MUS M Ä R Z 20 . 4 | R H U L 2013, 11 V EN SA A 3. M Ä R Z BEE THO , E AS L L A N QUE Y R LIEDERH N- GUIHE A E J : O EL L V IOLONC KY 9) R AWINS IGOR STL A-SUITE (19 19 – 20 / 4 L P ULCINE E) V ER T ÜR NIA (OU O 1. SINFO NDA N T IN ATA GR O – A E 2. SEREN L L A – ZINO 3. S C H E R L L A TE N A R 4. TA NI TA A C C O VA RIA ZIO T . 5 ON DUE C A T T O 6. G AV 7. V IV O IN A L E E T TO – F 8. MINU IN. CA. 22 M 96 6) LIGETI UND ORCHE S TER (1 Y G R Ö Y G R CEL LO T FÜ KO N Z E R EL = 4 0 1. V IER T MP O E SSO TE T S 2. LO IN. C A . 15 M – PAUSE – R S Z END E N A H / Y EBU S S 19 9 1) / D CL AUDES (AUS WA HL) (1909 – 13 E P R É LUD R E T L ÉG É RÉ S. MODÉ CK . C A P RICIEU X ST YLE E L S N 1 . V OIL E A U D P . E IC D R T E S N CC E N 2 . L A DA V INE«-E WA L K ÉR A L L A N C A K EN É ’U G D » T . 3 N E M E V OU E T LE M IN. C A . 10 M ) KY AIKOWSMOZ A RTIA N A« (1887 H C S T R » PETE 4 G-DUR OP. 61 R. SUIT E N RO DE . A L L EG OLCE) 1. GIGUE RIP T ION ER ATO (D D O M . TR A NSC T E E N U U N E S È M 2. TO ’A P R NON TA N O HIER A (D 3. P R EG NDA N T E A L L EGR O GIUS T A ). T Z IS . L S Z N N IO A T FR VA RIA E E T [10] 4. T HÈ M IN. C A . 25 M 33 ND E R S A , E B L LE DA S SE GEL SPIE MUSIK A LISCHE SPIE Strawinsky entdeckte im Spiegel der Vergangenheit sich selbst – und so tanzt Pulcinella in seiner neoklassischen Ballettsuite nicht mehr ganz nach der Vorlage Pergolesis; mitunter steppt er auch durch die Taktwechsel des 20. Jahrhunderts. Das Programm von Jérémie Rhorer vereint liebevolle Anverwandlungen von Klassikern: Tschaikowskys »Mozartiana« übertragen mit leidenschaftlichem Strich Klavierstücke Mozarts aufs Orchester und verleihen seiner klassischen Heiterkeit einen Zug romantischer Leidenschaft. Zender übermalt in seiner Bearbeitung Debussys Musik mit instrumentatorischem Witz. Dass dasselbe nicht dasselbe ist, unterstreicht auch Ligetis Cellokonzert, in dem sich schwebende Klangflächen in einen rasenden Mechanismus verwandeln. 34 4. SINFONIEKONZERT ER S BE , A ND DA SSEL TINE A NDERSON V ON CHR IS »Musik über Musik« nannte sie der Geiger Rudolf Kolisch kurz und treffend. Wenn Komponisten fremde Werke bearbeiten, meist aus Anlass eines Auftrages, sehen sie sich nach kurzer Zeit mit grundsätzlichen ästhetischen Fragen konfrontiert. Sie müssen bewerten, auswählen, weglassen, hinzufügen, austauschen, was ein Vorgänger festgelegt und für unverzichtbar gehalten hat. Wie sich der Bearbeiter im Einzelfall entscheidet, ist abhängig von seinem individuellen Erfahrungshorizont und der herrschenden Ästhetik seiner Epoche. Mit jedem Detail, das der Bearbeiter an der historischen Vorlage verändert, erzählt er – ob er will oder nicht – etwas über sich selbst. Wer den Dialog mit der Vergangenheit wagt, schaut nicht nur in Truhen mit staubigem Papier, sondern auch in einen Spiegel. IGOR ST P ULCINE KY R AWINS L L A- S U IT E Im Frühjahr 1917 begleitet Igor Strawinsky ein Gastspiel der »Ballets russes« nach Rom. Stärker als die Experimente der italienischen Futuristen beeindruckt ihn auf dieser Reise die Entdeckung der Commedia dell’arte, die er mit Pablo Picasso teilt: »Wir reisten zusammen nach Neapel und verbrachten dort einige Wochen in ständigem Umgang. Wir waren beide tief beeindruckt von der ›Commedia dell’arte‹, die wir in einem überfüllten, von Knoblauch dampfenden Raum sahen. Der Pulcinella war ein großer betrunkener Tölpel und jede seiner Bewegungen, wahrscheinlich auch jedes Wort, wenn ich es verstanden hätte, war obszön.« Als der Impresario der »Ballets russes« Sergej Diaghilev drei Jahre später mit der Bitte an Strawinsky herantritt, eine Pulcinella-Ballettmusik nach Vorlagen von Giovanni Battista Pergolesi (1710– 36) zu schaffen, ist Strawinsky dennoch zunächst ratlos. Zwar kennt er Pergolesis Intermezzo La serva padrona (Die Magd als Herrin) und das Stabat mater, aber von Pergolesis Instrumentalmusik hat er bisher wenig gehört. Um den zögernden Strawinsky zu überzeugen, hatte Diaghilev in Bibliotheken und Archiven in Neapel und London echte (und wie sich später herausstellte auch unechte) Pergolesi-Manuskripte abschreiben lassen. Strawinsky sagt Diaghilev zu, obwohl der ihm nur vier Wochen für die Herstellung der gesamten Ballettmusik einschließlich der Gesangsnummern einräumt: »Ich begann mit dem Komponieren direkt an Pergolesi-Abschriften, so als ob ich ein altes Werk von mir selbst korrigieren würde. Den Anfang machte ich ohne vorgefasste Meinungen oder ästhetische Ansichten, und ich konnte über das Ergebnis nichts voraussagen. Ich wusste, dass ich keine Nachahmung DASSELBE, ANDERS 35 von Pergolesi verfertigen konnte, da meine motorisch-rhythmischen Bewegungsabläufe so anders waren. Bestenfalls konnte ich ihn wiederholen, in meinem eigenen Akzent. Pulcinella war meine Entdeckung der Vergangenheit, die Epiphanie, durch welche mein ganzes späteres Werk möglich wurde. Es war natürlich ein Blick zurück – die erste von vielen Liebesaffären in dieser Richtung –, aber es war auch ein Blick in den Spiegel.« Es war Strawinsky nicht leicht gefallen, Pergolesis Musik in seine eigene Sprache zu übersetzen. Er hatte zwar bereits unfertige Werke anderer Komponisten ergänzend instrumentiert, aber hier handelte es sich um tiefere Eingriffe in die Werkstruktur. In seinen Erinnerungen bekannte er: »Bevor ich an diese schwere Aufgabe heranging, musste ich mir die wichtigste Frage beantworten, die sich unter solchen Umständen von selbst stellt: Sollte meine Liebe oder mein Respekt für die Musik von Pergolesi die Linie meines Verhaltens bestimmen?« Sein Respekt vor Pergolesi hindert Strawinsky jedenfalls nicht daran, dessen Musik ins zwanzigste Jahrhundert zu transferieren, obwohl Diaghilev von ihm »eine peinlich gesittete Instrumentation von etwas sehr Lieblichem« erwartete. Zwar behält Strawinsky die barocke Konstellation von konzertierendem Solisten-Ensemble (Concertino) und Kammerorchester (Concerto grosso) bei. In formaler Hinsicht arbeitet er jedoch geradezu chirurgisch. Er schneidet aus dem musikalischen Verlauf Takte und Taktgruppen heraus, entfernt Stimmen, fügt neue hinzu, montiert Ausschnitte aus unterschiedlichen Quellen direkt aneinander und baut unauffällig neu komponierte Passagen ein. Mit Akzentverschiebungen, Taktwechseln und Tempobeschleunigungen greift er in die Rhythmik und Metrik ein. Endgültig »modernisiert« erscheint Pergolesis Musik durch winzige, aber wirkungsvolle Eingriffe in die Harmonik. Dissonierende Töne kommen hinzu, harmonische Wendungen verlaufen anders als erwartet, Orgelpunkte verbinden separate Schichten. Zwei Jahre nach der szenischen Uraufführung 1920 kombinierte Strawinsky die Instrumentalstücke zu der achtteiligen Suite, die in diesem Konzert erklingt. Zu den Höhepunkten der Suite gehört sicher die Nummer 7 mit dem Satztitel »Vivo«. Strawinsky hatte dafür einer Violoncello-Sonate von Pergolesi ein tänzerisches Motiv entnommen und es mit wenigen Kunstgriffen komplett verwandelt. Das eigentlich grazil-anmutige Motiv wird nun ausgerechnet von den schwerfälligsten Instrumenten gespielt, Posaune und Kontrabass – und zwar als Duett. In seinen späten Lebensjahren, als Strawinsky diesen Satz einmal mit einem Orchester einstudierte, verdeutlichte er den Musikern seine Vorstellung mit den Worten: »Duett zwischen zwei Pulcinellas. Der eine hat eine Stimme, die Posaune, und der andere hat keine Stimme, der Bass«. 36 4. SINFONIEKONZERT GYÖRGY LIGETI IOLONCE T F ÜR V KO N Z E R R CHE S T E UND OR L LO Fast alle Komponisten des 20. Jahrhunderts verehrten Strawinsky, wenn auch aus verschiedenen Gründen. György Ligeti lernte Strawinskys Musik bereits vor 1956 in Ungarn kennen, denn sie gehörte zu den wenigen Zeugnissen der klassischen Moderne, zu denen junge Musiker eingeschränkt Zugang hatten. Ligeti interessierte sich vor allem dafür, auf welche Weise Strawinsky mit der musikalischen Zeit umging, denn hier fand er Anknüpfungspunkte für die eigene Arbeit. Strawinsky »behandelt die Zeit so, dass er sozusagen Scheiben aus ihr schneidet und sie blockhaft übereinander und nebeneinander setzt«, erklärte Ligeti 1988, »deswegen ist es auch ganz gleich, ob er sich die Maske Bachs oder die eines russischen Bauern oder die Tschaikowskys oder Pergolesis aufsetzt: sein Formdenken ist die Konstante.« Zu Anfang der 1960er Jahre beschäftigte sich Ligeti mit zwei sehr gegensätzlichen Konzepten der musikalischen Zeit. Exemplarisch für eines der beiden Konzepte ist die orchestrale Klangflächenkomposition Atmosphères. Man begegnet darin einer fast statisch wirkenden Musik ohne zeitliche Markierungen. Es ist kaum möglich, sich beim Hören an einem Puls, an Rhythmik oder Metrik zu orientieren. Komplex aufgebaute Cluster und Farbspektren beginnen und enden kaum wahrnehmbar (»noch leiser als möglich«). Registerwechsel, irisierende Farbübergänge und Weitungen des Klanges in eine imaginäre Raumtiefe ereignen sich fließend, zeitlupenhaft. Ligetis zweites Zeitkonzept der 1960er Jahre ist dazu komplementär: Es verwirklicht sich in Werken, in denen, vereinfacht gesagt, sehr viel passiert. Kurze Episoden und Ereignisse werden aneinandergereiht, scheinbar ohne Vorbereitung, Entwicklung oder Konsequenz. Dennoch sind bei Ligeti solche Ereignisse in ihrer Tiefenstruktur verbunden, sie bearbeiten dasselbe IntervallMaterial oder sind Variationen einer Idee. Exemplarisch wäre hier Nouvelles Aventures zu nennen. In seinem Konzert für Violoncello und Orchester führt Ligeti erstmals beide Zeitkonzepte innerhalb eines Werkes zusammen. Im Programmheft der Berliner Uraufführung beschreibt der Komponist 1967, wie die beiden Sätze des Konzerts trotz ihres Kontrasts strukturell verbunden sind: »Das Werk besteht aus zwei Sätzen. Der erste Satz ist langsam und verhalten, seine allmähliche musikalische Entfaltung fast statisch. Der zweite Satz beginnt mit einer ruhigen, zarten Bewegung und durchschreitet Regionen verschiedenster Bewegungstypen, die aber insofern eine Einheit bilden, als jeder neue Bewegungstyp eine Variante der früheren ist. Die zarte Bewegung des Anfangs verdichtet sich, wird von innen heraus aufgerissen, erreicht Extreme wilder Leidenschaftlichkeit und uhrwerkartig starrer Verfremdung und stirbt dahin in einer fast lautlosen, gleichsam geflüsterten Schlusskadenz des Solocellos. Die beiden Sätze, so gegensätzlich sie auch erscheinen, stellen zwei verschiedene Realisationen derselben musikalisch-formalen Idee dar und haben sogar DASSELBE, ANDERS 37 ein und denselben musikalischen Bauplan als Grundlage. Als Beispiel für diese formale Korrespondenz seien die Schlussbildungen angeführt. Im ersten Satz suggeriert der Schluss Alleinsein und Verlorenheit: Das Solocello bleibt über abgrundtiefen Bässen wie in unermesslicher Höhe hängen, bis sein gefährlich dünner, pfeifender Flageolettton schließlich bricht. Den Schluss des zweiten Satzes bildet die wie im Nichts verhauchende Flüsterkadenz: eine figurierte Variante des brüchigen Flageoletttons. Ähnliche Korrespondenzen lassen sich an allen Details der beiden Sätze aufzeigen; musikalische Keime, die im ersten Satz angedeutet sind, kommen im zweiten zur vollen Entfaltung.« Nicht nur in seiner Zweisätzigkeit weicht das Konzert vom überlieferten Typus des Solokonzerts ab. Dem Orchester ist die schwierige Aufgabe übergeben, voneinander unabhängige Prozesse mit möglichst großer Transparenz, deutlicher Artikulation und räumlicher Tiefenschärfe darzustellen. Auch die Rolle des Solisten wird neu definiert. So spielt er zwar viel solistisch, ist aber häufig auch Teil des Orchesters oder Mitglied einer sich abspaltenden Teilgruppe. Die Schwierigkeiten des Solo-Parts sind dennoch immens. Sie betreffen beispielsweise zahlreiche damals neue Spieltechniken, die den brüchigen instabilen Bereich zwischen Ton und Geräusch erkunden. So gibt es mehrere Varianten des Spiels »sul ponticello« (»am Steg«). Auch die »maschinenartige« rhythmische Präzision, die dem Solisten im zweiten Satz über weite Strecken abverlangt wird, dürfte jeden Cellisten an seine Grenze führen. Ligeti hat in späteren Werken die Unerbittlichkeit solcher »maschineller« Verläufe weiter verfolgt und konsequent auskomponiert, wie eine solche Konstruktion zu stocken und zu »hinken« beginnt, bis sie schließlich aus dem Rhythmus gerät und die organisierte Ordnung ganz auseinanderbricht. Y/ D EBU S S C L AU D E ND ER HANS ZEUDE S DREI P R ÉL Zu den Schlüsselfiguren der Avantgarde gehörte nicht nur für Ligeti der französische Komponist Claude Debussy. Die anhaltende Debussy-Verehrung im 20. Jahrhundert spiegelt sich auch im Schaffen Hans Zenders, der – 1936 geboren – nicht mehr ganz der »ersten« Generation der Nachkriegsavantgarde von György Ligeti, Luigi Nono, Pierre Boulez und Karlheinz Stockhausen angehört. Zender hat sich mit Debussy zunächst als Dirigent auseinandergesetzt, 1991 dann auch kompositorisch. Für seine langjährigen Erkundungen des Bereiches zwischen Interpretation und Komposition formulierte er 1998 den Begriff der »komponierten Interpretation«: »Diese Bezeichnung beschreibt ein Paradox, […] die gleichzeitige Wirksamkeit zweier gegensätzlicher geistiger Grundeinstellungen: die spontan zugreifende schöpferische Freiheit des gestaltenden Interpreten auf dem Podium und die in langsam-mühevollem, immer wieder reflektiertem Prozess regelhafte Formen entwickelnde Arbeit des schreibenden Komponisten. […] 38 4. SINFONIEKONZERT Ich musste eine neue Dimension des Schreibens lernen, um diesen Dialog mit einem großen, alten Werk auszuhalten: denn dieses Werk stellt immer wieder bestimmte Ansprüche, […] wehrt sich gegen manche in anderem Zusammenhang bewährte Technik.« Hans Zenders Instrumentation von fünf der Préludes für Klavier von Claude Debussy lässt sich als »komponierte Interpretation« in diesem Sinne lesen. Es scheint ihm hier nicht um die Fülle der instrumentatorischen Möglichkeiten gegangen zu sein, sondern eher um eine bewusste Beschränkung, Reduktion und Zuspitzung von klanglichen Phänomenen. Debussy hatte seine Préludes für Klavier zwischen 1909 und 1913 geschrieben, ihnen assoziative Titel nachgestellt, und sie in zwei Büchern angeordnet. Aus diesen Miniaturen mit durchaus fernöstlichem Parfum hat Zender solche ausgewählt, die nicht unbedingt einen impressionistischen Farbenrausch nahelegen. Zwei der fünf Préludes charakterisieren literarische oder imaginäre Figuren durch Tänze (Nr. 2: La Danse de Puck. Capricieux et légér« und Nr. 3: Général Lavine-eccentric. Dans le style et le mouvement d’un cake-walk). Die drei anderen Préludes überhöhen Momente einer Natur- oder Landschaftserfahrung und wirken mit ihrer Intensität unmittelbar auf das Zeitempfinden des Hörers ein. Zender springt mit Debussy nicht so um wie Strawinsky mit Pergolesi. Er legt Wert darauf, keine Note und keinen Rhythmus hinzugefügt oder getilgt zu haben. Seine Arbeit bestand vielmehr im Verteilen der Klangereignisse auf die Instrumente, im genauen Mischen und Trennen der Klangfarben, im Aufbauen und Kombinieren von beweglichen Flächen, im Verdeutlichen der musikalischen Prozesse im Raum. In Zenders Orchester findet man neben stark besetzten Holzbläsern (darunter auch eine Melodica), wenigen Blechbläsern und Streichern eine Sektion mit Schlaginstrumenten aus aller Welt, die eine Vielzahl an Klangfarben zwischen Ton und Geräusch umfasst, so dass sich jedes der fünf Préludes in einer ganz eigenen Farbwelt bewegt. Dass die Partitur im dritten Satz (eccentric) einige Überraschungen bereithält, die der Dirigent ad libitum hinzufügen kann, macht jede Aufführung der Préludes unwägbar und einzigartig. DASSELBE, ANDERS 39 W SK Y SCHAIKO T R E T E E P A«-SUIT » M OZ A R T IA N Das Prinzip der »Musik über Musik«, das den heutigen Abend dramaturgisch durchzieht, wird mit Peter Tschaikowskys Mozartiana-Suite gleichermaßen exemplarisch vorgeführt wie übersteigert. Wenn – wie im Fall der Mozartiana – die Vorlage einer Bearbeitung bereits eine Bearbeitung ist, hat man es schließlich mit Musik zu tun, an der Urheber aus drei Epochen mitgewirkt haben. Der letzte Komponist der Reihe kann unmöglich den eventuell widersprüchlichen Intentionen seiner Vorgänger treu bleiben – und oft will er dies auch gar nicht. Die Mozartiana-Suite entsteht im Sommer 1887. Tschaikowsky ist in jenen Wochen viel unterwegs. Dennoch findet er jeden Tag ein wenig Zeit zum Komponieren. Am 24. Juni 1887 schreibt er an seinen Verleger Peter Jurgenson in Moskau: »Ich spüre bis jetzt nicht die geringste Lust zum Schaffen und tue daher fast gar nichts. Ich sage ›fast‹, weil ich täglich eine Stunde an der Instrumentation Mozartscher Klavierstücke sitze, aus denen gegen Ende des Sommers eine ›Suite‹ entstehen soll. Ich glaube, dass dieser Suite […] dank der Neuheit des Genres (Altes in moderner Bearbeitung) eine schöne Zukunft bevorsteht … « Wenige Monate später ist die Partitur fertig. Aus dem Geleitwort spricht die tiefe Verehrung, die Tschaikowsky Mozart stets entgegenbrachte: »Eine große Zahl der bewundernswertesten kleinen Kompositionen Mozarts ist unbegreiflicherweise nicht allein dem Publikum, sondern auch vielen Musikern sehr wenig bekannt. Der Autor […] wünscht einen neuen Anstoß zur Aufführung dieser kleinen Meisterwerke zu geben, die trotz ihrer gedrängten Form unvergleichliche Schönheiten bergen.« Die »kleinen Kompositionen Mozarts« stammen aus ganz unterschiedlichen Quellen und hatten ursprünglich keinerlei Zusammenhang. Die Vorlage für den ersten Satz ist Mozarts Kleine Gigue für das Klavier G-Dur KV 574. Sie trägt den Untertitel Leipziger Gigue, denn Mozart schrieb das Stück 1789 vor seiner Abreise aus Leipzig dem sächsischen Hoforganisten Karl Immanuel Engel ins Stammbuch. Der zweite Satz verwendet ebenfalls eine Klavierkomposition Mozarts, das Menuett KV 355 / 567b. Der dritte Satz ist die »Bearbeitung einer Bearbeitung«, denn die Preghiera (d’après une transcription de F. Liszt) greift zwar indirekt auf das Ave verum corpus KV 618 für vierstimmigen gemischten Chor, Orchester und Basso continuo von Mozart zurück, bei seiner Arbeit hatte Tschaikowsky jedoch Franz Liszts Klavier- bzw. Orgeltranskription des Ave verum vor Augen. Auch bei der Genese des vierten Satzes haben viele Hände mitgewirkt: Tschaikowsky instrumentierte zwar ein Klavierwerk Mozarts, doch bereits dieser hatte sich als Bearbeiter betätigt. Er entnahm Christoph 40 4. SINFONIEKONZERT Willibald Glucks Singspiel Die Pilger von Mekka (uraufgeführt 1785 in Wien) das Lied des Calender »Wenn der dumme Pöbel meint« und verwendete es als Vorlage für seine Klaviervariationen in G-Dur KV 455. Interessant ist nun, wie Tschaikowsky diese vier separat entstandenen Klavierkompositionen Mozarts dem spätromantischen Geschmack seiner Zeit anpasst. Er verteilt nicht nur einfach Stimmen auf Instrumente, sondern verändert die Vorlage ganz nach seinem Belieben. Dies betrifft neben unverfänglichen Oktav-Verdopplungen auch harmonische Wendungen, die Mozart nicht kannte, ja sogar Eingriffe in die kompositorische Struktur, beispielsweise im Variationensatz. Auch die Reihenfolge der vier Sätze ist dem romantischen Geschmack geschuldet. So steht bei Tschaikowsky die Gigue nicht an ihrem traditionell angestammten Platz am Ende einer Suite, sondern am Anfang, so dass der Variationensatz das Werk beschließt. Das Werk wurde bald zum Vorbild für andere Orchestersuiten nach historischen Vorlagen: Alexander Glasunows Chopiniana-Suite, Ottorino Respighis Orchestersuite Rossiniana und sein Ballett La Boutique fantasque nach Musik von Rossini wären hier zu nennen. Die erfolgreiche Uraufführung der Boutique fantasque ist wiederum keinem anderen als Sergej Diaghilev zu verdanken, der bald darauf von Strawinsky unverzüglich mehr von solcher »Musik über Musik« in Suitenform verlangt – und damit Pulcinella in Auftrag gibt. DASSELBE, ANDERS 41