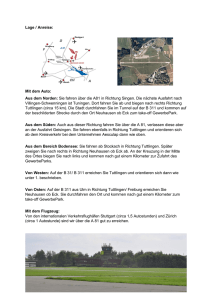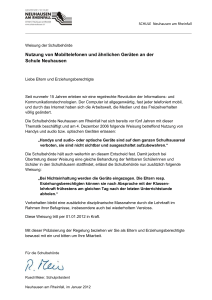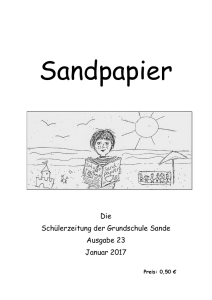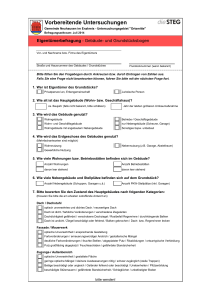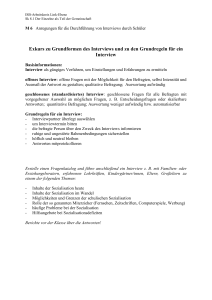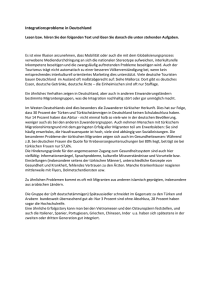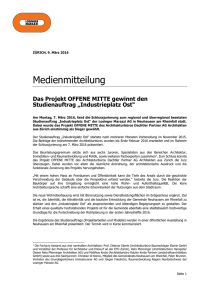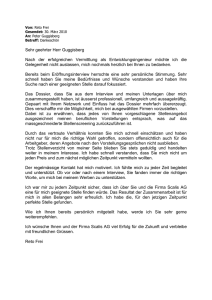Ethnologische Gemeindestudie Neuhausen ob
Werbung

Nachbarschaft, Gemeinschaft, bürgerschaftliches Engagement Eine ethnologische Gemeindestudie in Neuhausen ob Eck Dr. Franziska Becker Kreuzlinger Str. 11 78462 Konstanz Im Auftrag der Gemeindeleitung Neuhausen ob Eck, Januar 2014 1 Gliederung I. Einleitung …………………………………………………………………………………………………...... 2 1. Vorbemerkung ……………………………………………………………………………………………..... 2 2. Zur Charakteristik der Gemeinde Neuhausen ob Eck ……………………………………...... 2 3. Problembeschreibung aus der Sicht der Gemeindevertreter …………………………..... 4 4. Auftragsbeschreibung …………………………………………………………………………………..... 6 5. Zur ethnologischen Forschungsperspektive …………………………………………………..... 6 5.1 Fragestellungen ……………………………………………………………………………………… 7 5.2 Forschungszugang ………………………………………………………………………………….. 9 5.3 Methoden ……………………………………………………………………………………………... 10 II. Ergebnisse der empirischen Studie …………………………………………………………... 12 6. Altes Dorf und neue Siedlungen …………………………………………………………………… 12 7. Zur Beziehung zwischen Alteingesessenen und russlanddeutschen Migranten…16 8. Binnensichten russlanddeutscher Migranten ………………………………………………… 19 8.1 Sprachbarrieren und unsichtbare Grenzen ……………………………………………. 19 8.2 Zum Umgang mit Zweisprachigkeit ………………………………………………………. 22 8.3 Migration und verwandtschaftliche Netzwerke ………………………………………25 8.4 Freundschaftsnetzwerke ……………………………………………………………………… 30 9. Zum Engagement von Migranten in Schule und Kindergarten ………………………... 31 9.1 In der Grundschule ……………………………………………………………………………….. 32 9.2 Im Kindergarten …………………………………………………………………………………… 36 10. Vereine und Integration ……………………………………………………………………………….. 40 10.1 Bürgerschaftliches Engagement im Verein …………………………………………….. 45 10.2 Migranten in Vereinen ………………………………………………………………………… 48 11. Die ‚Sternhäuser‘ – „ein sozialer Brennpunkt“? …………………………………………….. 52 11.1 Binnensichten der Bewohner ……………………………………………………………….. 55 11.2 Ortsbindungen stärken ……………………………………………………………………….... 58 III. Zusammenfassung ……………………………………………………………………………….. 60 IV. Literaturverzeichnis / verwendete Quellen ………………………………………... 70 2 I. Einleitung 1. Vorbemerkung Der vorliegende Bericht ist das Ergebnis der ethnologischen Gemeindestudie, die von der Gemeindeleitung Neuhausen ob Eck im März 2013 in Auftrag gegeben wurde. Im Folgenden werden (I. 2) zuerst einige zentrale Charakteristika der Gemeinde beschrieben, (I. 3) die Problembeschreibung aus der Sicht der Gemeindeleitung rekapituliert sowie (I. 4) die Vorgeschichte und Inhalte des Auftrags zusammengefasst. Im Anschluss (I. 5) wird dargelegt, wie die Fragen der Gemeindeleitung operationalisiert wurden; in diesem Zuge werden auch die Prämissen der ethnologischen Untersuchung sowie die Konkretisierung der Fragestellungen und Methoden erläutert. Im Hauptteil dieses Berichts (II. 6-11) werden die Ergebnisse der ethnographischen Studie dargelegt und abschließend (III.) noch einmal zusammengefasst. 2. Zentrale Charakteristika der Gemeinde Neuhausen ob Eck Im Vordergrund der nun folgenden kurzen Betrachtung der Gemeinde stehen zentrale soziale und wirtschaftliche Transformationsprozesse, die Neuhausen ob Eck in den vergangenen Jahrzehnten erfahren hat. Die Gemeinde Neuhausen ob Eck besteht aus drei Ortschaften (Kernort, Worndorf, Schwandorf), die im Zuge der baden-württembergischen Kreisreform im Jahre 1973 zu einer Kommune mit unterschiedlichen historischen Wurzeln (württembergisch, habsburgisch, badisch) zusammengeführt wurden. Die Gemeinde hat zurzeit 3.950 Einwohner, wovon 1.500 Bewohner auf die beiden Ortsteile Schwandorf und Worndorf entfallen. Der Kernort ist württembergisch/evangelisch, die beiden anderen Ortsteile sind badisch/katholisch. Auch im Blick auf Zuzug und Zuwanderung ist Neuhausen ob Eck keine homogene Gemeinde, sondern weist eine ungewöhnlich große Binnendifferenzierung auf. In der Bewohnerschaft gibt es 30 verschiedene ausländische Nationalitäten und – laut einer Berechnung des Bürgermeisteramts – 47 verschiedene Geburtsnationen, unter denen durch den verstärkten Zuzug von sogenannten „Spätaussiedlern“ Anfang der 1990er Jahre auch Neubürger aus Kasachstan, Kirgisien und Russland, Ex-Jugoslawien (Kroatien, Serbien, Bosnien, Kosovo), Polen und Rumänien sowie den Baltischen Staaten sind.1 1 Im Kerndorf haben 5,8 Prozent der Bevölkerung eine ausländische Nationalität (Angabe der Ausländerbehörde Tuttlingen, Stand Juni 2013). 3 Insgesamt herrscht in Neuhausen ob Eck eine hohe soziale Fluktuation vor, d. h. der dörfliche Sozialraum ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten von einem Wechsel großer Teile seiner Bewohnerschaft betroffen.2 Dazu gehört auch der Wegzug der ehemaligen Bundeswehrangehörigen, der mit der Auflösung des Garnisionsstandortes im Jahr 1994 erfolgte. Zugleich hat die Gemeinde in historischer Perspektive schon lange Erfahrungen mit der Fluktuation ihrer Bevölkerung, denn die dörfliche Bevölkerung hatte schon vor der verstärkten Zuwanderung aus Osteuropa zu Beginn der 1990er Jahre vielfachen Zuzug erlebt (z. B. Wehrmacht, französische Alliierte, Flüchtlinge nach Kriegsende, Bundeswehr). Der Zuzug von Migranten aus Osteuropa Anfang bis Mitte der 1990er Jahre und der Wegzug der Bundeswehr verliefen parallel, was für den Ort erneut große soziale Veränderungen mit sich brachte. In der Gemeinde gibt es mehrere Gebäudekomplexe (Mehrfamilienhäuser) mit einem verhältnismäßig preiswerten Wohnraumbestand, in denen ab den 1960er Jahren vor allem Bundeswehrangehörige mit ihren Familien lebten. Anfang der 1990er Jahre waren diese Gebäudekomplexe überwiegend von „Spätaussiedlern“ (zumeist aus Kasachstan und Kirgisien) bewohnt, doch sind viele dieser Bewohner in der Zwischenzeit aus den Wohnblöcken ausgezogen und haben in einem der angrenzenden Neubaugebiete eigene Wohnhäuser gebaut. In die oben genannten Gebäudekomplexe („Sternhäuser“ und Schwandorfer Straße) sind inzwischen Familien aus dem gesamten Bundesgebiet (insbesondere aus den Ballungszentren der alten Bundesländer NRW, Niedersachsen und Berlin) eingezogen, von denen einige soziale Transferleistungen wie Hartz IV beziehen. Zugleich ist ein Zuzug von Familien aus der näheren Region zu verzeichnen, da die Gemeinde Neuhausen ob Eck neu erschlossenes Bauland, eine gute Infrastruktur und Arbeitsplätze in den beiden Gewerbegebieten des Ortes und in der umliegenden Region bietet. Eine besondere öffentliche Ausstrahlkraft haben Besuchermagnete wie das jährlich stattfindende, weltweit bekannte Festival „Southside“, das überregional ausgerichtete Freilichtmuseum sowie der stetig wachsende interkommunale Industriepark „Take Off“, in dem sich auch global agierende Unternehmen angesiedelt haben. Allein in den vergangenen zwei Jahrzehnten verzeichnete die Gemeinde einen Zuwachs von ca. Bis Mitte der 1990er Jahre war Neuhausen ob Eck ein Militärstandort mit Flugplatz; 1938 kam die Wehrmacht und nutzte den Flugplatz bis zum Kriegsende 1945; danach folgten französische Militärbesatzung und in den 1960er Jahren bis 1994 die Bundeswehr. Im Jahre 1997 wurde ein großer interkommunaler Gewerbepark auf dem ehemals militärisch genutzten Flughafengelände etabliert. 2 4 600 Einwohnern.3 Was die Bevölkerungsentwicklung anbelangt, kann die Region um Tuttlingen in den vergangenen Jahren somit als eine der am stärksten wachsenden Regionen Baden-Württembergs bezeichnet werden. 3. Problembeschreibung aus der Sicht der Gemeindevertreter Wie eben erläutert, hat die Gemeinde in den vergangenen Jahrzehnten im Blick auf wirtschaftliche Prosperität, Arbeitsplätze und Gemeindewachstum (Bauland, Wohnraum etc.) eine sehr gute Entwicklung durchlaufen. Im Kontrast zu diesen positiven Faktoren stehen nach Aussagen der Gemeindeleitung jedoch gewisse soziale Problemlagen und die weit verbreitete Stigmatisierung der Gemeinde als „Russenhochburg“. Die Gleichzeitigkeit dieser Problemlagen mit der guten wirtschaftlichen Entwicklung führe, so der Bürgermeister, zu einer „verwirrenden Außensicht“ auf die Gemeinde. Eine von der Gemeindevertretung identifizierte Problemlage hat mit der großen Fluktuation und dem „elementaren Wechsel“ seiner Bewohnerschaft seit Anfang der 1990er Jahre zu tun. Der Zuzug im Neubaugebiet ‘Im Morgen‘ und der Wegzug der Bundeswehr bzw. die Umwidmung der Kasernen verliefen parallel, was für den Ort eine Belastung („ein bisschen viel auf einmal“, so Herr Osswald) gewesen sei. Im Kernort habe man mit den Migranten nichts zu tun haben wollen. Und da im Laufe der 1990er Jahren auch keine Verteilung der Neuzugezogenen im alten Ortskern erfolgte, sei, so formuliert es der Bürgermeister, ein „Dorf im Dorf“ entstanden, das von den Alteingesessenen, aber auch im Außenblick auf die Gemeinde abschätzend als „Ghetto“ bezeichnet werde. Über das soziale Leben in den Neubaugebieten sei nicht viel bekannt; nur eine Handvoll Alteingesessene wohnt dort. Diese als sehr ausgeprägt beschriebene sozialräumliche Segregation zwischen alteingesessenen und zugezogenen Bewohnern spiegelt sich auch in der dörflichen Vereinsstruktur wider. Demnach seien in den traditionellen Vereinen bis auf wenige Ausnahmen keine (erwachsenen) Einwohner mit Migrationshintergrund vertreten; nur vereinzelt werden kleine Kinder in den Fußballverein geschickt. Das geringe bürgerschaftliche Engagement der Zugezogenen in traditionellen Vereinen und kommunalen bzw. staatlichen Einrichtungen (z. B. Gemeinderat, Schule, Kindergarten) stellt aus Sicht der Gemeindevertreter ein besonders großes Problem für das Gemeinwesen in Allein zwischen 1996 und 2008 hatte sich die Bevölkerungszahl in Neuhausen ob Eck um acht Prozent von 3.486 auf 3.840 Einwohner erhöht. Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (aus Unterlagen der Gemeindeverwaltung Neuhausen ob Eck). 3 5 Neuhausen ob Eck dar. So ist keiner der „Spätaussiedler“ Mitglied im Gemeinderat; die Zuwanderer würden auch allgemein „unter sich bleiben“, und besonders die mittlere Generation (30-60-Jährige) habe große Defizite in der deutschen Sprache. Das Problem der Nichtteilhabe spiegelt sich auf der Ebene der Wahlbeteiligung wider (z. B. nur 16 Prozent in den Neubaugebieten bei der Bürgermeisterwahl 2012)4, verweise möglicherweise auch auf ein „Demokratiedefizit“5, zumindest aber auf ein fehlendes Gefühl von Gemeinschaftlichkeit, die ja nicht nur von den wenigen alteingesessenen Bürgern getragen werden könne. Ein weiteres Problem stellt aus der Sicht der Gemeindeleitung der Zuzug von sozial benachteiligten Familien dar, die in die Wohnblocks (ehemalige Bundeswehrsiedlungen) gezogen seien. In der Gemeinde gibt es vielfältige Einrichtungen für Kinder und Jugendliche sowie eine ausgiebige Frühförderung in Form von Familienbetreuung durch Sozialarbeiter, d. h. die Gemeinde ist im Bereich sozialer Förderung sehr engagiert.6 Dennoch sei es nicht immer einfach, die Bewohner der „Problemquartiere“, von denen nach Angaben des Bürgermeisters 40 Prozent von sozialen Transferleistungen wie Hartz IV leben, für eine Nutzung dieser Angebote zu gewinnen, um positiv verändernd auf deren oft prekäre Lebensumstände einwirken zu können. Zusammenfassend besteht aus kommunalpolitischer Perspektive also vor allem folgendes Problem: Das Fehlen von gesellschaftlicher Teilhabe und gemeinwesenorientiertem Engagement auf Seiten der Zugezogenen (insb. Spätaussiedler) schlägt sich auf allen institutionellen Ebenen des Dorfes (Vereine, Schule, Kindergarten) bis hin zur Staatsebene (geringe Wahlbeteiligung) nieder. Vor diesem Hintergrund lauteten die Fragen der Gemeindeleitung zum Zeitpunkt der Auftragserteilung: Handelt es sich bei dieser Diagnose um ein Sonderproblem der Gemeinde oder ist Neuhausen ob Eck mit diesen Charakteristika „ein ganz normaler“ Ort? Was sind die Gründe für die fehlende bürgerschaftliche Beteiligung? Sind kommunalpolitische Handlungsstrategien erforderlich, die daran etwas ändern könnten? Und wenn ja, welche Strategien wären dazu geeignet und wie wären sie umsetzbar? Bei der Bundestagswahl 2013 lag die Wahlbeteiligung im Wahlbezirk „Rathaus“ bei 75 Prozent, im Wahlbezirk im Neubaugebiet ‘Im Morgen‘ bei 57,6 Prozent (nach Angaben des Jugendreferenten am 22.09.2013). 5 Dieser Begriff wurde im Sinne der Mitgestaltung des Gemeinwesens verwendet und meint damit auch die Stärkung der (lokalen) Demokratie als „Bürgergesellschaft“. 6 Insgesamt werden ca. 240 Kinder- und Jugendliche von Sozialarbeitern betreut. 4 6 4. Auftragsbeschreibung Im November 2012 wandte sich der Jugendreferent der Gemeinde Neuhausen ob Eck (Markus Sell) schriftlich mit einer Anfrage eines ethnologischen Beratungsgesprächs zu den Möglichkeiten einer gemeinwesenorientierten Dorfentwicklung an mich. Vereinbart wurde ein Arbeitstreffen vor Ort, das am 18. Januar 2013 mit dem Bürgermeister (HansJürgen Osswald), einem der Gemeinderäte (Markus Seeh), dem Jugendreferenten (Markus Sell) und mir in Neuhausen ob Eck abgehalten wurde. In diesem Gespräch gaben die Gemeindevertreter einen Überblick über die Gemeindeentwicklung und legten ihre Situationsbeschreibung gegenwärtiger Problemlagen der Gemeinde (s. oben) dar. Zugleich formulierten Bürgermeister und Gemeindevertreter in diesem Gespräch den Bedarf nach einem „offenen Außenblick“ und einer „realistischen Wirklichkeitssicht“ auf das Gemeindeleben in Neuhausen ob Eck. Dabei sollten die „Binnenperspektiven“ der unterschiedlichen Lebenswelten und sozialen Gruppen des Dorfes im Zentrum stehen. Die Ergebnisse dieses ersten Gesprächs mit anschließender Ortsbegehung wurden von mir in einem achtseitigen Dokument zusammengefasst (erstellt am 14. Februar 2013) und nach Absprache mit den Gemeindevertretern mit Blick auf eine zu unternehmende „ethnologische Gemeindestudie“ aufbereitet. Auf dieser Grundlage habe ich die wissenschaftliche Herangehensweise von ethnologischer Gemeindeforschung im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 19. März 2013 vorgestellt, woraufhin am 20. März 2013 die schriftliche Auftragserteilung durch den Bürgermeister erfolgte. 5. Zur ethnologischen Forschungsperspektive Meine empirische Untersuchung orientierte sich an der kommunalpolitisch relevanten Leitfrage nach dem Ausmaß „bürgerschaftlicher Beteiligung“ und an den Bedingungen bzw. Möglichkeiten für gemeinwesenorientiertes Handeln, wobei diese Fragestellung in eine ethnologische Herangehensweise übersetzt werden musste. Die ethnologische Perspektive zielt grundlegend auf das „Fremdverstehen anderer Lebensrealitäten“ ab und hinterfragt dabei gleichermaßen die Selbstverständlichkeit bestimmter Normen und Werte, die in unserer eigenen Gesellschaft als „normal“ und „alltäglich“ erscheinen. Dazu gehört der herkömmliche Begriff vom „bürgerschaftlichen Engagement“, beschränkt er sich doch in der Regel auf mittelschichtsorientierte Formen der Partizipation in gemeinschafts- und demokratiefördernden Institutionen der Mehrheits- 7 gesellschaft.7 Eine ausschließliche Verwendung des klassischen und oft normativ verwendeten Begriff des „bürgerschaftlichen Engagements“ würde zum einen die vielfältigen Formen, die soziales und politisches Engagement annehmen kann, ausblenden; zum anderen würden dadurch die soziale Ungleichheit bezüglich ethnischer Minderheiten und benachteiligter sozialer Schichten unberücksichtigt bleiben. Statt einem normativen Defizitansatz zu folgen, öffnet sich der ethnologische Blick also vorurteilslos und mit zunächst grundlegend offenen Fragen an das dörfliche Zusammenleben unterschiedlicher sozialer Gruppen und kultureller Milieus. In diesem, an den Lebenswelten und Binnenperspektiven der Menschen orientierten, ethnographischen Zugang liegt die Chance, jenseits der herrschenden Normalitätsvorstellungen etwas Neues sehen zu können, das der alltäglichen kulturgebundenen Blickweise verborgen bleibt. Dies schließt die Verwendung eines weiten Begriffs von „sozialem Engagement“ ein, der der Vielfalt von Engagementformen und -themen angemessen ist und auch die mit Minderheitenstatus und Migration, Ausgrenzung und Stigmatisierung verbundene soziale Ungleichheit berücksichtigt. In Anwendung des ethnologischen Blicks geraten folglich nicht nur die in der Öffentlichkeit wahrgenommenen, traditionellen Formen von Engagement (bspw. in Vereinen und Verbänden) in den Fokus der Untersuchung, sondern es werden auch die von Außenstehenden kaum registrierten informellen sozialen Formen (bspw. Solidarität und Versorgung in nachbarschaftlichen und familiären Netzwerken) sichtbar gemacht. 5.1 Fragestellungen Konzeptioneller Ausgangspunkt der ethnologischen Perspektive meiner Gemeindeforschung in Neuhausen ob Eck ist das „pluralistische Dorf“ – das heißt, ein Verständnis der Gemeinde Neuhausen ob Eck als einem von soziokultureller Vielfalt, gesellschaftlichem Wandel und Globalisierung durchdrungenen Sozialraum mit hoher Fluktuation. Gemeinden wie Neuhausen ob Eck sind keine in sich abgeschlossenen Mikrokosmen mit einer intern homogenen Kultur, sondern „lokale Arenen“, in denen sich Bedeutungswelten unterschiedlicher soziale Gruppen und Milieus kreuzen.8 In dieser Perspektive werden soziale Grenzen (z. B. zwischen Alteingesessenen und Zur Kritik an diesem eindimensionalen Verständnis von bürgerschaftlichem Engagement, das sich auf die mittelschichtsorientierten Formen von Partizipation beschränkt und nicht ohne weiteres zu den Lebensweisen von sozialen und/oder ethnischen Minderheiten passt, siehe Chantal Munsch: Engagement und Diversity. Der Kontext von Dominanz und sozialer Ungleichheit am Beispiel Migration. Weinheim 2010. 8 Vgl. Johannes Moser: Gemeindeforschung in der Spätmoderne. In: Schweizerisches Archiv für Volkskunde 98/2002, S. 295-315. 7 8 Zugewanderten) und „Defizite“ gesellschaftlicher Teilhabe nicht als gegeben vorausgesetzt. Vielmehr standen am Beginn der empirischen Untersuchung folgende offene Leitfragen: Was macht heute dörfliches Zusammenleben unter den Bedingungen von sozialer Heterogenität, Mobilität und der Pluralität von Lebensstilen aus? Was bedeutet der dörfliche Sozialraum für unterschiedliche Lebenswelten und Milieus, wie wird er wahrgenommen, gedeutet und bewertet? Bei der Arbeit mit diesen Leitfragen in der empirischen Untersuchung wurden vielfältige Faktoren einbezogen: Fluktuation und Zuwanderung, Mobilität und Ortsbezogenheit (Alteingesessene, Zugezogene mit und ohne Migrationshintergrund); sozialer Status, Migration, Alter, Generation, Geschlecht; formale Institutionen (Vereine/Verbände, Schule und Kindergarten) sowie informelle Netzwerke von Alteingesessenen und (migrantischen) Zugezogenen. In Bezug auf den Themenkomplex „Gemeinschaftlichkeit“ standen folgende Fragestellungen im Vordergrund: Welche Formen kultureller und sozialer Vergemeinschaftung existieren unter den oben genannten Bedingungen im dörflichen Lebenszusammenhang? Wie gestalten sich die Sozialbeziehungen zwischen Alteingesessenen und Zugezogenen vor Ort und in welchen Formen werden sie realisiert (Kontakte, Vereine, Kirche, Netzwerke)? Dies schließt gleichermaßen die Frage ein, welche sozialen und kulturellen Grenzziehungen, Ab- und Ausgrenzungen im dörflichen Zusammenleben relevant sind. Dass es die dörfliche „Gemeinschaft“ im Sinne eines geschlossenen und intern homogenen, traditionalen Sozialverbunds nicht gibt, haben zahlreiche volkskundliche und ethnologische Gemeindestudien immer wieder unter Beweis gestellt. Demnach sind Gemeinden „nie harmonieträchtige Gebilde (…), sondern werden u. a. von Hierarchien, Machtverhältnissen und verschiedenen Gruppierungen geprägt (…) und machen so aus einer lokalen Gemeinde ein ‚System eigener Art‘.“9 Vor dem Hintergrund dieser wissenschaftlichen Erkenntnis wird in der hier vorliegenden Untersuchung davon ausgegangen, dass die Existenz einer „dörflichen Gemeinschaft“ nicht à priori vorausgesetzt werden kann. Vielmehr stellt sich die Frage, in welcher Weise und mit welchen Ergebnissen „Gemeinschaftlichkeit“ hergestellt und praktiziert wird und wer daran teilhat, aber auch, wer davon ausgeschlossen ist und aus welchen Gründen. Demnach werden Ortsidentitäten als fragile soziale Errungenschaften verstanden, die unter den Bedingungen von Globalisierung, Mobilität, Enttraditionalisierung und Individua- 9 Ebd., S. 315. 9 lisierung immer wieder neu hervorgebracht und verteidigt werden müssen.10 Insgesamt schließt dieser konzeptionelle Zugang der Gemeindeforschung an neue Debatten in den Kultur- und Sozialwissenschaften an, wonach Gemeinden sozialräumliche Gebilde darstellen, die vor dem Hintergrund von Zuwanderung und Mobilität neue Fragen zum Zusammenleben von Alteingesessenen und Zugezogenen aufwerfen. 5.2 Forschungszugang Der Forschungszugang erfolgte über eine mehrwöchige stationäre ethnographische Feldforschung, die ich im Zeitraum von Mai bis Juli 2013 in Neuhausen ob Eck durchführte. Um Kontakte zu den verschiedenen Bewohnergruppen des Dorfes zu bekommen und als Forscherin soweit wie möglich an den Alltagsroutinen des dörflichen Lebenszusammenhangs teilzunehmen, bezog ich im Mai 2013 für einen Monat zunächst ein Privatquartier bei einer alteingesessenen Familie im Kernort und zog dann Anfang Juni 2013 für vier Wochen in eine Wohnung in einem Häuserblock der ehemaligen Bundeswehrsiedlung („Sternhäuser“). Die Materialerhebung, die aus qualitativen Leitfadeninterviews, informellen Gesprächen und teilnehmender Beobachtung bestand, begann Anfang Mai 2013. Die Kontaktaufnahme mit potentiellen Gesprächspartnern erfolgte zunächst über offizielle Empfehlungen des Bürgermeisters, eines Gemeinderatsmitglieds sowie des Jugendreferenten der Gemeinde. Daraus ergaben sich nach dem ethnologisch bewährten Schnellballsystem weitere Kontakte zu anderen Interviewpartnern; auf diese Weise kam die Mehrzahl meiner Kontakte in Neuhausen ob Eck ohne Vermittlung durch die Gemeindevertreter zustande. Schließlich konnte ich durch meine oben erwähnte Einmietung in ein am Dorfrand gelegenes Wohnquartier eine Reihe von Kontakten in diesem Umfeld herstellen, auch zu migrantischen und/oder sozial benachteiligten Bewohnermilieus, was ohne diesen Wohnaufenthalt nicht möglich gewesen wäre. Die Untersuchung wurde allen Gesprächspartnern gegenüber als eine ethnologische Auftragsforschung im Auftrag der Gemeindeleitung ausgewiesen und mit dem allgemein formulierten Forschungsinteresse begründet, sich „ein Bild von den vielfältigen Lebenswirklichkeiten im modernen Dorf“ machen zu wollen.11 Siehe auch Roland Robertson: Glokalisierung: Homogenität und Heterogenität in Raum und Zeit. In: Beck, Ulrich (Hg.): Perspektiven der Weltgesellschaft. Frankfurt am Main 1998, S. 192-220. 11 Einige Gesprächspartner schrieben mir die Rolle einer „Integrationsbeauftragten“ der Gemeinde zu, was ich mit dem Hinweis korrigierte, als Ethnologin eine Gemeindeforschung durchzuführen, ohne dass daran ein unmittelbarer sozialpolitischer Handlungsauftrag geknüpft ist. 10 10 5.3 Methoden Das methodische Vorgehen der Untersuchung erfolgte auf der Basis bewährter qualitativer Erhebungs- und Auswertungsverfahren, beansprucht im Unterschied zu quantitativen Verfahren der Sozialforschung also keine statistische Repräsentativität.12 Zum Selbstverständnis der Ethnologie als einer gegenwartsbezogenen Kultur- bzw. Sozialwissenschaft zählt es, methodische Verfahren zu favorisieren, die sich durch eine besondere Nähe gegenüber den Forschungssubjekten und ihren Binnensichten auszeichnen. Zu den grundlegenden Prinzipien qualitativer Forschung gehören somit Offenheit, Dialogform und Multiperspektivität, um sozial geteilte Sinngehalte, Deutungsmuster und Erfahrungsräume unterschiedlicher Lebenswelten erfassen und beschreiben zu können.13 Der Zugang zum Forschungsfeld berücksichtigt also verschiedene Perspektiven und kombiniert unterschiedliche methodische Herangehensweisen (Triangulation). Im Zentrum der Datenerhebung standen qualitative Interviews, die den Befragten durch allgemeine Frageformulierungen und den Verzicht von Antwortvorgaben viel Spielraum für die Darlegung ihrer subjektiven Wirklichkeitssicht und ihrer eigenen Relevanzsysteme lassen.14 Die Interviewpartner wurden so ausgewählt, dass in annähernd ausgewogenem Verhältnis Frauen und Männer, verschiedene Altersgruppen und Personen unterschiedlicher sozialer Schichtung zu Wort kamen. Im Mittelpunkt der Auswahl meiner Gesprächspartner stand die Differenzierung von „Alteingesessene“ und „Zugezogene (mit und ohne Migrationshintergrund)“. Insgesamt wurden mit 70 Gesprächspartnern leitfadengestützte Interviews durchgeführt.15 Darunter waren zwölf qualitative Experteninterviews (Bürgermeister, Vgl. dazu: Siegfried Lamnek: Qualitative Sozialforschung. Weinheim / Basel 2005. Vgl. Bettina Hollstein / Carsten G. Ulrich: Einheit trotz Vielfalt? Zum konstitutiven Kern qualitativer Forschung. In: Soziologie, 32. Jg. Heft 4, 2003, S. 29-43. 14 Vgl. Brigitta Schmidt-Lauber: Das qualitative Interview oder: Die Kunst des Redenlassens. In: Göttsch, Silke / Lehmann, Albrecht (Hg.): Methoden der Volkskunde. Positionen, Quellen, Arbeitsweisen der Europäischen Ethnologie. Berlin 2001, S. 165-186. 15 Die Leitfragen der Interviews wurden den jeweiligen Gesprächspartnern angepasst und umfassten Fragen nach dem persönlichen bürgerschaftlichen Engagement, der Vereinszugehörigkeit, dem Verhältnis von Alteingesessenen und Zugezogenen und der Qualität der Nachbarschaft. Bei den Zugezogenen kam als Einstiegsfrage hinzu, wie es zu ihrem Zuzug ins Dorf gekommen war – ein Erzählimpuls, der bei den russlanddeutschen Gesprächspartnern zur Folge hatte, dass die persönliche bzw. familiäre Migrationsgeschichte rekapituliert wurde. Da die ethnologische Untersuchung mit aktivierenden Methoden der Gemeinwesenarbeit kombiniert wurde, wurden die Gesprächspartner im Anschluss an das qualitative Interview auch nach ihren eigenen Interessen und Ideen zu Veränderungspotentialen und Mitgestaltungsmöglichkeiten des dörflichen Zusammenlebens gefragt. Diese Fragen erbrachten jedoch bei den meisten Gesprächspartnern lediglich Hinweise auf die Zufriedenheit mit der lokalen Daseinsfürsorge und Infrastruktur der Gemeinde. In den Interviews mit den Bewohnern der Hochhausanlage kam es dagegen zu Vorschlägen und Anregungen dazu, wie Ortsbindungen und die Identifikation der Bewohner mit dem 12 13 11 Ortsvorsteher, Schulleitung, Schulsozialarbeiterin, Kindergartenleitung, Sozialplaner und Sozialverwaltung des Landkreises Tuttlingen, Integrationsbeauftragte der Diakonie /Caritas, Vorstand der Wohnungsbaugesellschaft in Tuttlingen), um fachliches Kontextwissen bspw. zu Fragen der Partizipation von Migranten in Schule und Kindergarten, zur lokalen Vereinslandschaft und/oder zur Gemeindeentwicklung zu gewinnen. Unter den Interviewpartnern waren auch 21 russlanddeutsche Migranten; drei interviewte Personen haben eine nicht-deutsche Herkunft, aber eine deutsche Staatsbürgerschaft; fünf Gesprächspartner haben eine ausländische Nationalität (russisch, kasachisch, kroatisch). Die Interviews fanden in der Regel in den Wohnungen oder im beruflichen Kontext der Gesprächspartner statt; die Dauer der Interviews variierte zwischen zweieinhalb Stunden und 45 Minuten. Alle Interviews wurden auf Band aufgezeichnet, transkribiert und nach dem Verfahren einer regelgeleiteten qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.16 Hinzu kommen informelle Gespräche mit weiteren ca. 30 Personen, darunter mit den beiden Jugendreferenten, mit Bewohnern der „Hochhäuser“, die sich bei gutem Wetter in den Grünanlagen aufhielten, sowie mit Jugendlichen und Kindern an ihren angestammten Aufenthaltsplätzen im Dorf. Diese informellen Gespräche wurden in einem Feldtagebuch protokolliert, in dem darüber hinaus der gesamte Forschungsverlauf dokumentiert und reflektiert wurde. In diesem Feldtagebuch wurden auch die teilnehmenden Beobachtungen festgehalten (z. B. bei der Konfirmationsfeier von alteingesessenen und russlanddeutschen Jugendlichen, beim Maibaumfest, oder bei Bewohnertreffen in der Grünanlage der „Hochhäuser“). Zur Darstellungsweise der hier vorliegenden Studie ist zum einen anzumerken, dass die Bewohner selbst zur Sprache kommen sollen, d. h. dass durchgehend mit wörtlichen Zitaten gearbeitet wird, um dem Leser die vorhandene Perspektiven- und Stimmenvielfalt am konkreten Beispiel nachvollziehbar zu machen. Zum anderen soll betont werden, dass im Folgenden einem wichtigen Prinzip ethnologischer Forschungsethik gefolgt wird: alle zitierten Gesprächspartner werden anonym behandelt und in den jeweiligen Fußnoten mit einem anonymisierten Kurzzeichen gekennzeichnet. Nur bei den Experteninterviews bleibt die offizielle Funktion des jeweiligen Gesprächspartners erkennbar. Bei der Wiedergabe von (nicht muttersprachlichen) Interviewzitaten Quartier (mit eigener Beteiligung) gestärkt werden könnten (siehe dazu das letzte Kapitel „Die Sternhäuser“ in diesem Bericht). 16 Vgl. Uwe Flick: Qualitative Inhaltsanalyse. In: Ders.: Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften. Reinbek bei Hamburg 2000 (5. Auflage), S. 212 ff. 12 wurden, um die Verständlichkeit zu erhöhen, mitunter geringe paraphrasierende Anpassungen vorgenommen, ohne die Eigenart der Aussage inhaltlich zu verändern. II. Ergebnisse der empirischen Studie 6. Altes Dorf und neue Siedlungen Wer als Ortsfremder zum ersten Mal nach Neuhausen ob Eck kommt, dem fallen beim Betreten der Ortschaft die ausgedehnten Neubauviertel auf, die sich um den älteren Dorfkern herum im Osten der Gemeinde gebildet haben. Trotz der verschiedenen, teils sehr individuellen Baustile der Ein- und Zweifamilienhäuser hat der außenstehende Betrachter den Eindruck, dass es sich hierbei um verhältnismäßig geschlossene, einheitliche Wohnsiedlungen handelt, die abseits vom Gefüge des „alten Dorfes“ liegen. Dass diese „neuen Siedlungen“ seit Anfang der 1990er Jahre entstanden sind, ist vor allem auf die liberale Bauplatzpolitik der Gemeinde zurückzuführen, die das Bauland ‘Im Morgen‘ zu vergleichsweise günstigen Grundstückspreisen angeboten hatte und der Ortschaft damit einen spürbaren Zuzug von neuen Bewohnern, darunter auch russlanddeutsche „Neubürger“, verschaffte. Mitte der 1990er Jahre wurde so auch ein Ausgleich für den in der Bevölkerungsstatistik spürbaren Wegzug vieler Bundeswehrangehöriger geschaffen, erinnert sich der ehemalige Bürgermeister in einem Interview mit mir. Mit der liberalen Bauplatzpolitik verband sich zugleich die Hoffnung, die Gemeinde attraktiver zu machen für Familien, die sich ein Haus bauen wollten, was ja gut zur „schwäbischen Mentalität passen“ würde.17 An den so entstandenen Neubaugebieten mit neuen sozialen Schichten, Lebensstilen und soziokulturellen Milieus macht sich heute eine Debatte über den sozialen Wandel von Neuhausen ob Eck und seine Folgen für das lokale „Gemeinwesen“ fest. Zumindest aus der Sicht einiger gewählter Gemeindevertreter stellt dieses relativ schnelle Wachstum einer dörflich geprägten Ortschaft ein Problem dar, weil mit den Neubaugebieten ein „zweigeteiltes Dorf“ entstanden sei: auf der einen Seite das alte Kerndorf mit seinen ortsgebundenen gemeinschaftlichen Strukturen, auf der anderen Seite die Neubaugebiete (östlich der Eckstraße) mit einer Bewohnerschaft, die nur noch funktionale Ortsbindungen habe. So beklagt einer der Gemeinderäte: „Was mir nicht gefällt, dass es viele in diesem Gemeinwesen gibt, die hier ihre Bleibe haben, damit sie ein Dach über dem Kopf haben und sich nicht engagieren (…). Dieses Dorf ist ja nicht 17 Interview mit dem ehemaligen Bürgermeister am 11.06.2013. 13 irgendeine amorphe Masse, wo man halt in Häusern wohnt und damit hat sich’s. Hier (sollte man) zumindest das Verständnis erzeugen, dass Neuhausen nicht nur Wohnort ist, sondern auch ein sozialer Raum, in dem man leben kann, wo man mit anderen leben und kommunizieren kann, dass das Gemeinsame auch was bringt, mit den anderen in Kontakt zu kommen.“18 Solche Diagnosen, die ein Auseinanderdriften der dörflichen Bewohnerschaft und den Zerfall einer ortsgebunden praktizierten Gemeinschaftlichkeit konstatieren, sind im Blick auf die soziale Dorfentwicklung sicher nicht neu, doch gewinnen sie heutzutage Aktualität im Kontext von demographischem Wandel, Zuzug und Zuwanderung auch in ländlich geprägten Regionen Deutschlands. Vor diesem Hintergrund sieht der gegenwärtige Bürgermeister von Neuhausen ob Eck als wichtigstes Ziel der Gemeindeentwicklung, „dass die Gesellschaft, die sich in den letzten Jahrzehnten hier etwas auseinanderentwickelt hat, wieder enger zusammenwächst.“19 Dazu gehöre auch, Fehler der Vergangenheit zu vermeiden, denn „die Gemeindeentwicklung hat sich in den letzten Jahrzehnten so abgespielt: Man hat irgendwo Bauland erschlossen und dann geguckt, dass die Menschen da Häuser drauf bauen (…) Das war der falsche Weg. Man kann diese Entwicklung nicht umkehren, aber man kann sie stoppen. Man muss schauen, dass die Ortskerne wieder belebt werden, dass dort wieder junge Menschen wohnen, nicht nur alte, und ich denke, wenn das gelingt, wird der Zusammenhalt von vornherein wieder größer.“20 Zu diesen Maßnahmen gegen eine soziale Desintegration der Ortschaft gehören infrastrukturelle Vorhaben, wie sie der Bürgermeister beschreibt: „Zum Beispiel haben wir jetzt damit begonnen, eine neue Ortsmitte zu entwickeln (…). Früher war das bunt gemischt, bäuerliche Großfamilien, die sind jetzt weg, es sind jetzt sehr viele ältere Menschen, es gibt auch vereinzelt junge, das wollen wir nicht bestreiten, aber erst mal ist der Ortskern überaltert und da könnte es ein Ziel sein, diese Ortsmitte wieder zu stärken, die Bebauung wieder etwas zu verdichten, wie es eigentlich typisch für einen Ortskern ist, da war die Großfamilie mit drei Generationen unter einem Dach. So wird’s natürlich nicht mehr werden, aber dass nicht nur Einfamilienhäuser mit 1000 Quadratmetern rumstehen (…) und dass hier wieder mehr Menschen wohnen und dass wieder etwas mehr Kommunikation in Schwung kommt.“21 Zu dieser Vorstellung einer Interview mit einem Gemeinderat am 02.05.2013. Interview mit dem Bürgermeister von Neuhausen ob Eck am 25.07.2013. 20 Ebd. Auch die folgenden beiden Zitate entstammen diesem Interview. 21 Erste Planungen sehen zwei neue Gebäudekomplexe im Ortskern vor, u.a. mit Räumen zur Betreuung von Senioren sowie evtl. einem Jugendtreff (siehe: Südkurier vom 11.05.2013). 18 19 14 sozialräumlichen Verdichtung des Dorfes, das stärker zusammenwachsen soll, gehört auch, Alteingesessene und Zugezogene aller sozialer Schichten und Altersgruppen durch Dialog und Kommunikation stärker zusammenzubringen, d. h. mehr „Gemeinschaft“, Solidarität und positive Ortsidentifikation zu erzeugen: „Damit wir nicht das Schicksal anderer Dörfer erleiden, wo wir tatsächlich zu reinen Wohnstätten werden, wo das Dorf keine Rolle mehr spielt. Es gibt ja auch ein paar Vorteile, im Dorf zu wohnen, dass das wieder stärker in den Vordergrund gerückt würde.“ Während in dieser kommunalpolitischen Perspektive mehr ortsbezogene Gemeinschaftlichkeit geschaffen werden soll, verweisen Alteingesessene auf einen von ihnen wahrgenommenen zunehmenden Prozess der Verstädterung, der ebenfalls an den Neubaugebieten festgemacht wird. So stellt beispielsweise ein alteingesessener Bewohner die Frage: „Ist Neuhausen überhaupt noch ein Dorf? Also wenn Sie das UrNeuhausen anschauen, das hat schon noch Dorfcharakter, weil im alten Dorfkern, da kennen sich alle. Und das ist in den Neubaugebieten nicht so, das ist schon städtisch. Ich muss selber sagen, ich kenne die Fremden im Neubaugebiet gar nicht.“22 Mit Raumbildern wie „das ist eine ganz andere Welt da unten“ oder „da braucht man ja ein Navigationsgerät, um sich dort zurechtzufinden“23 bringen alteingesessene Neuhauser zum Ausdruck, dass sich der dörfliche Charakter Neuhausens durch den Zuzug neuer Bewohnergruppen ganz grundsätzlich verändert hat. Dem scheinbar überschaubaren Dorf mit seinen typisch dörflichen Kommunikationsregeln – man kennt sich, grüßt sich und ‚schwätzt‘ miteinander – wird in solchen Aussagen ein Wohngebiet mit vermeintlich anonymen, individualisierten Nachbarschaften gegenüber gestellt. Mit den Neubaugebieten ist also ein aus dieser Sicht unbekanntes Terrain entstanden, das von den vertrauten sozialen Kreisen des Kerndorfs weitgehend abgekoppelt erscheint: „Das schnelle Wachstum hier in den Neubaugebieten hat sicherlich was verändert. Also man merkt schon auch, dass ein Neuhauser sagt, er möchte nicht im ‚Morgen‘ bauen, da unten möchte er nicht wohnen (…). Es wird schon ein bisschen differenziert, also ‚das sind die Zugezogenen‘, hört sich jetzt komisch an. Wie gesagt, es gibt genug, die trotzdem in diesem Kreis drin sind, aber es ist nicht so einfach. Also die sind einem so fremd, weil man sie nirgends sieht.“24 Die hier beschriebene, scheinbar nur wenig durchlässige soziale Grenze zwischen Alteingesessenen und Neuzugezogenen Interview mit Herrn Fk. am 04.06.2013. Z.B. Interview mit Frau Rs. am 10.07.2013. 24 Interview mit Frau Sn. am 15.05.2013. 22 23 15 kehrt auch im Bild vom „Ghetto“ wieder, das mit einer Entwertung der Neubaugebiete einhergeht, und gegen das sich viele Zugezogene (mit und ohne Migrationshintergrund) wehren, indem sie explizit auf die gut funktionierenden Nachbarschaften verweisen. Frau Br. gehört zu den migrantischen Bewohnern mit bosnischer Herkunft: „Ich habe gehört, dass es eben dieses Ghettogebiet geben soll und da hab ich gefragt, ‚und wo ist das in Neuhausen, ich wohne ja mittendrin!‘ Also ich habe es weder mitgekommen noch fühle ich das. Man hat immer jemanden auf der Straße, den man grüßt, egal ob das ein Deutscher oder ein Russe ist, man hat hier neunzig Prozent freundliche Menschen. Auch die Hilfsbereitschaft ist sehr gut vorhanden. Es ist halt einfach dieser Alltag und wenn ich sagen kann, die Nachbarschaft ist wirklich so gut, dass ich auch nachts bei den Nachbarn klingeln kann, dann soll das ein Ghetto sein? Nee, ich habe das bisher noch nie gefühlt oder mitbekommen.“25 Auch andere Zugezogene in den Neubaugebieten wehren sich gegen Außenzuschreibungen wie „Kleinkasachstan“ oder das „Russenviertel“, verweisen auf die von ihnen empfundene gute Wohnqualität im Neubaugebiet ‚Im Morgen‘ und heben die multiethnische Nachbarschaft mit vielen jüngeren Familien als besonders positiv hervor: „Schauen Sie sich um, dort wohnen Russlanddeutsche, neben uns eine türkische Familie und dort drüben eine polnische Familie. Und wir kommen bestens miteinander klar. Wir sind ja alles Zugezogene“.26 Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach der Integration von Zugezogenen (mit und ohne Migrationshintergrund) für manche Bewohner Neuhausens als eine höchst relative Frage dar – wie beispielsweise formuliert von einem Alteingesessenem, der erst vor kurzem aus Neuhausen weggezogen ist: „Was heißt hier Integration? Sieht man das städtisch oder noch dörflich? Aus der städtischen Sicht würde ich sagen, die einen leben da und die anderen da. Die Ur-Neuhauser gucken aus einer dörflichen Sicht drauf und ich denke, die Ausdehnung, die man hier in Neuhausen gewonnen hat, da ist es eben kein kleines Dorf mehr und es ging ziemlich schnell. Das ist in anderen Dörfern anders, da wachsen die Neubaugebiete langsamer und sind vielleicht kleiner.“27 Mitunter wehren sich Zugezogene gegen eine Integrationsnorm, die sie dazu auffordert, sich stärker in die etablierten Gemeinschaftsstrukturen des Kerndorfes zu integrieren. So zum Beispiel eine jüngere Bewohnerin mit Migrationshintergrund: „Das Interview mit Frau Br. am 06.05.2013. Interview mit Frau Ls. am 04.07.2013. 27 Interview mit Herrn Pa. am 13.05.2013. 25 26 16 ist ein wundes Thema, weil es gibt ganz viele von diesen Grüppchen im Dorf, die – ich sag‘s jetzt mal ‚die Deutschen‘ und ‚die Russen‘ – wenn die Deutschen sich sonntags im Verein treffen, dann treffen sie sich halt im Verein, aber mein Vater trifft sich halt am Sonntag mit seinen Freunden oder mit der ganzen Nachbarschaft und sie grillen oder so. Und das sind halt so Sachen, die oft nicht gesehen werden und dann heißt es, ‚die schirmen sich total ab und haben mit niemanden was zu tun‘. Ich meine, das ist doch normal, dass man mit den Leuten, mit denen man sich eher verbunden fühlt, da ist es halt der Herkunftsort oder allein der Gedanke, dass man woanders herkommt und dass man für die anderen auch die anderen sind, das schweißt ja schon zusammen. Also ich vertrete inzwischen den Standpunkt, wenn die (zugezogenen Migranten) wollen, dann werden die sich beteiligen und integrieren und mitmachen und wenn nicht, dann ist das halt so.“28 Vor dem Hintergrund des oben skizzierten sozialen Wandels der Gemeinde Neuhausen ob Eck und den daran geknüpften Debatten um die „Integration“ von Zugezogenen soll im Folgenden dem Verhältnis zwischen Alteingesessenen und Russlanddeutschen im dörflichen Sozialgefüge nachgegangen werden. 7. Zur Beziehung zwischen Alteingesessenen und russlanddeutschen Migranten Fragt man Alteingesessene nach der Beziehung zu den nach Neuhausen ob Eck zugezogenen ‚Aussiedlern‘29, so lauten die Antworten in der Regel, dass man „eigentlich nichts miteinander zu tun“ habe, kaum etwas über deren Lebenswelt wisse, und es im Dorf ja auch keine Begegnungsräume gebe, wo man in wechselseitigen Kontakt treten könnte. Umso ausgeprägter ist das Wahrnehmungsmuster, dass die Russlanddeutschen einen besonderen familiären Zusammenhalt hätten, weitgehend „unter sich“ blieben und sich am Dorfgeschehen nicht beteiligen würden. „Man sieht sie nicht auf Festen oder Veranstaltungen, sie halten sich davon fern. Da entsteht dann so der Eindruck, dass sie sich gar nicht integrieren wollen.“30 Als Bestätigung dieser Wahrnehmung wurde von Interview mit Frau Bl. am 21.05.2013. Die in Neuhausen ob Eck lebenden „Russlanddeutschen“ stammen überwiegend aus Kasachstan und Kirgisien (Quelle: Unterlagen der Gemeindeleitung: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg). Die Bezeichnung ‚Russlanddeutsche‘ hat sich inzwischen eingebürgert. Da auch Interviewpartner sich selbst so bezeichnen, werden im Folgenden die Begriffe Russlanddeutsche oder nur Aussiedler verwendet. 30 Vgl. zum Begriff „Integrationsverweigerer“ die Studie über das Verhältnis von Aussiedlern und Einheimischen in einem Dorf im Hunsrück. Auch hier waren viele Einheimische anfangs enttäuscht, dass sich die Aussiedler wenig in die dörflichen Vereine integrierten. Dabei handelt es sich um ein Integrationsverständnis aus der dorfzentrierten Sicht, worunter die Anpassung an die Verhältnisse vor Ort verstanden wird. Dagegen haben Aussiedler ein Integrationsverständnis, wonach die gelungene Integration in den Arbeitsmarkt und der soziale Aufstieg in der Aufnahmegesellschaft im Vordergrund 28 29 17 meinen alteingesessenen Interviewpartnern immer wieder auf ein interkulturelles Begegnungsfest verwiesen, das vor einigen Jahren in der Grünanlage der „Sternhäuser“31 veranstaltet worden war.32 Dass es aus der Sicht der damals aktiv Teilnehmenden zu keinem sozialen Austausch zwischen Alteingesessenen und Zugezogenen gekommen sei, wird in den Erzählungen in eindrückliche Bilder eines gegenseitigen Befremdens gefasst: „Das war mal ein Versuch, die Leute so ein bisschen zusammenzubringen, also auch die Russen mehr ins Dorfgeschehen zu integrieren. Ist aber nichts geworden. Die Alteingesessenen waren alle da, aber die Leute, die man eigentlich erreichen wollte, die kamen gar nicht runter, die haben nur von oben aus den Fenstern zugeschaut. Aber die Geschichte hat man Ihnen ja bestimmt schon oft erzählt.“ Im Erzählrepertoire des Kerndorfes ist dieser inszenierte Begegnungsversuch zum symbolischen Schlüsselereignis eines gescheiterten Integrationsversuches geworden, weil „jede Gruppe dann doch wieder für sich“ gewesen sei.33 Neben den Dorffesten ist die evangelische Kirchengemeinde ein potentieller Begegnungsraum, wobei auch hier Grenzziehungen zwischen Alteingesessenen und zugezogenen Russlanddeutschen registriert werden.34 So wird bei religiösen Ereignissen der Kirchengemeinde eine gewisse soziale Segregation sichtbar, beispielsweise bei den Konfirmanden, worunter auch Jugendliche aus russlanddeutschen Familien sind. Der Pfarrer berichtet: „Die Trennung der zwei Gruppen hat sich leider so ergeben. Es war ein langes Hin- und Her, aber dann hat sich das doch so sortiert, dass in der einen Gruppe fast nur Alteingesessene waren, dass sie in Gruppen unter sich geblieben sind. Und die Alteingesessenen sind dann auch noch alle im Musikverein. Da können Sie mal sehen, wie eine Gruppe zerfällt. Das sieht man schon, dass sie im Konfirmationsunterricht getrennt sitzen. Und dann sind die Russlanddeutschen auch nicht zur Konfirmandenstehen (vgl. Sabine Zinn-Thomas: Fremde vor Ort. Selbstbild und regionale Identität in Integrationsprozessen. Bielefeld 2010, S. 191f.) Das hier verwendete Zitat stammt aus einem Interview mit Herrn Dn. am 06.05.2013 und fasst ähnliche Aussagen von anderen Gesprächspartnern prägnant zusammen. 31 Damit werden fünf Hochhäuser mit Mietwohnungen bezeichnet, die in den 1960er Jahren für Bundeswehrangehörige gebaut worden waren. 32 Dieses Integrationsprojekt fand unter dem offiziellen Namen „Sommerwiesen 2005“ am Neuhauser Hochhausgelände im Juli 2005 statt. Ziel dieser Veranstaltung war „die Begegnung zwischen Einheimischen und Russlanddeutschen“ aller Altersstufen (vgl. Südkurier vom 27.11.2004). 33 Diese Geschichte wurde mir von vielen Gesprächspartnern in ähnlicher Form erzählt. Das Zitat stammt aus dem Interview mit Herrn No. am 06.05.2013. 34 Durch den Zuzug von russlanddeutschen Familien seit den 1990er Jahren hat sich die Mitgliederzahl der evangelischen Kirchengemeinde in Neuhausen nach Angaben des Pfarramts um ein Viertel auf ca. 1.400 Personen erhöht. Nur wenige ältere Frauen der Russlanddeutschen besuchen noch regelmäßig den Gottesdienst. Dafür haben kirchliche Rituale wie Taufe und Konfirmation einen hohen Stellenwert in der jüngeren Generation, worin der Gemeindepfarrer den Willen bestätigt sieht, sich zur hiesigen Mehrheitsgesellschaft zu bekennen. 18 freizeit mitgekommen.“35 Der Pfarrer beschreibt diese Gruppenbildung als einen wechselseitigen Prozess: „Es gibt ganz starke Vorurteile, die beide Gruppen hier haben.“ Während die alteingesessenen Jugendlichen keinen besonderen Wert auf eine Begegnung mit russlanddeutschen Jugendlichen legen würden, hätten sich die letztgenannten mit dem Verweis auf familiäre Verpflichtungen der Teilnahme am gemeinsamen Freizeitereignis entzogen. Als Folge entstünde eine Struktur der sozialen Trennung, von der die Jugendlichen glaubten, dass sie dies selbst so gewollt hätten.36 Was hier als ein beidseitiger Prozess sozialer Grenzziehung beschrieben wird, bringt jedoch auch immer wieder Erklärungsversuche für eine einseitig gewollte ‚Integrationsverweigerung‘ hervor. So fragt sich eine in der Kirchengemeinde engagierte Bürgerin: „Und jetzt war es schon zweimal so, dass Kinder mit Migrationshintergrund nicht mitgehen, obwohl gesagt wird, es ist Pflicht. Wenn‘s am Geld liegt, gibt es Zuschüsse, man weiß den Termin rechtzeitig und kurz vorher heißt es dann immer, ‚meine Oma hat Geburtstag oder sonst ein wichtiges Fest‘. Also sie kommen einfach nicht. Und das sehen wir schon als schade und als Problem an, weil sich die Kinder dann doch nicht so integrieren können. Aber ich weiß auch nicht, wie man dem begegnen kann. Die Entschuldigung kam von den Eltern, aber vielleicht müsste man da einfach mal nachfragen?“37 Doch gelegentlich wird die Wahrnehmung einer mangelnden Integrationsbereitschaft migrantischer Familien auch gegen andere Eindrücke abgewogen: „Also ich weiß es von meinem Sohn letztes Jahr, es gibt auch Migrationsfamilien, die sind mit auf die Freizeit, also man darf das überhaupt nicht pauschalisieren, ich könnte Ihnen drei, vier Familien mit Migrationshintergrund nennen, die sind super integriert, die auch im Sportverein und im Albverein helfen. Also es gibt wirklich auch ganz integrierte Familien.“38 Wie dieses Beispiel zeigt, gelten im dörflichen Sozialzusammenhang vor allem diejenigen migrantischen Familien bzw. deren Kinder als integriert, die sich in den örtlichen Vereinen engagieren. Die Wahrnehmung einer soziokulturellen Abgrenzung unter Russlanddeutschen wird auch über deren russischen Sprachgebrauch in der Öffentlichkeit begründet. So schildert eine Alteingesessene: „Wenn ich ins Ausland gehe, dann muss ich die Sprache lernen, anders geht’s nicht. Der Wille wird den Osteuropäern hier bei uns abgesprochen. Interview mit dem evangelischen Pfarrer am 02.05.2013. Was hier als persönliche Verweigerung einer rituellen „interethnischen“ Vergemeinschaftung erscheint, verweist eher auf eine strukturelle soziale Trennung zwischen Migranten und Alteingesessenen. 37 Interview mit Frau Sn. am 15.05.2013. 38 Ebd. 35 36 19 Weil jetzt spielen ja hier viele Russlanddeutsche Fußball und dann heißt es ‚dawai dawai‘, das ist wirklich ein Problem, untereinander reden sie nur russisch. Und gerade für die Kinder finde ich das so unverständlich. Wie sollen die in der Schule mitkommen, wenn sie keine Gelegenheit haben, das zu lernen?“ Was hier als Integrationsdefizit bei Jugendlichen erscheint, löst sich bei genauerem Nachfragen jedoch im Gefühl auf, selbst ausgeschlossen zu sein. Franziska Becker: „Wenn Jugendliche jetzt russisch reden, ist das denn ein Indiz dafür, dass sie kein Deutsch können?“ Frau Kr.: „Nein, das glaube ich nicht, ich glaube, sie haben teilweise ihre Wurzeln in Russland und nicht in Deutschland. Aber es ist befremdlich, würde ich schon sagen. Das ist bei den Türken genauso, das ist kein russisches Phänomen. Ja, ich glaube schon, das ist eine Abgrenzung, weil man versteht‘s dann nicht und fühlt sich irgendwie ausgegrenzt, aber das muss denen genauso gehen, ja, irgendeine Hemmschwelle ist da, ich denke, dass das Generationen braucht.“39 Das eben angeführte Beispiel zeigt, dass Zweisprachigkeit in vielen Kontexten Neuhausen ob Ecks weniger als selbstverständliche Sprachkompetenz unter jungen Migranten interpretiert wird, sondern als Zeichen von Abgrenzung, die buchstäblich als ‚befremdlich‘ empfunden wird. 8. Binnensichten russlanddeutscher Migranten 8.1 Sprachbarrieren und unsichtbare Grenzen „Wir sind eigentlich nach Deutschland gekommen, um Deutsche zu werden, weil was haben wir gehabt? Nur im Pass waren wir Deutsche, aber sonst war alles russisch. Ja, bei Festen wurde mal was Deutsches gesungen, aber da hat man die Türe zu gemacht, damit niemand das gehört hat. Und da wollten unsere Eltern, dass wir richtige Deutsche werden, nicht nur im Pass“,40 so schildert mir ein Ehepaar unter den Spätaussiedlern, das seit etlichen Jahren in Neuhausen wohnt, dass ihre Eltern die treibende Kraft für die Migration waren. Das Motiv, wie auf der Flucht mit zwei Koffern nach Deutschland gekommen zu sein, durchzieht ihre lebensgeschichtliche Erzählung. Inzwischen sprechen beide schon seit längerem fast akzentfrei Deutsch mit schwäbischem Einschlag und fühlen sich in Neuhausen beheimatet. Doch auch sie machen immer wieder die Erfahrung, von den Alteingesessenen als „Russen“ wahrgenommen zu werden: „Auch bei der Arbeit sagen sie, ‚du bist Russe‘, das ist nicht böse gemeint, aber man wird 39 40 Interview mit Frau Kr. am 01.07.2013. Interview mit Frau und Herrn As. am 09.07.2013. 20 abgestempelt, egal wie lange du hier wohnst oder ob du einen deutschen Pass hast, du bist Russe.“41 Bei anderen Spätaussiedlern bleibt das Gefühl bestehen, noch nicht angekommen zu sein: „Wir sind zwar Deutsche und wollen auch Deutsche sein. Aber wenn wir russisch miteinander sprechen, dann heißt es immer ‚die Russen‘, die sich nicht integrieren wollen“42, so beschreibt ein aus Kasachstan stammender Neuhauser das Gefühl, nach wie vor „in zwei Welten zu leben“, das heißt als Deutscher akzeptiert werden zu wollen, aber aufgrund der eigenen Sprache von der Mehrheitsgesellschaft als nicht richtig zugehörig wahrgenommen zu werden.43 Eine aus der Ukraine stammende Frau mittleren Alters erklärt dieses Fremdheitsgefühl wie folgt: „Akzeptanz läuft ja auch über Sprache und das hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Es muss ja nicht perfekt Deutsch sein, aber man schämt sich, das wird sofort erkannt, das ist keine Deutsche, also was ist das dann? Daran merkt man sofort, dass man nicht so zu dieser Gesellschaft gehört. Mit einiger Zeit geht das alles vorbei, aber es ist dieser erste Schritt, dass man sich outet als Ausländer mit dieser Grundgeschichte der Migration, das hört man mit dem ersten Wort. ‚Guten Morgen‘ und dann hört man schon, irgendwas ist anderes.“44 Wie schwer und mitunter langwierig es sein kann, diese Sprachbarrieren zu überwinden, davon berichteten mir einige Gesprächspartnerinnen der Spätaussiedlerfamilien, darunter nicht berufstätige Mütter mit kleinen Kindern. Ein Beispiel: „Ich habe fünf Jahre gebraucht, bis ich mich hier selber ohne meinen Mann orientieren konnte. Da war immer die Angst da, wenn ich etwas sage, dann heißt es: ‚wie bitte?!‘ und dann habe ich mich nicht mehr getraut. Das war dann schon sehr schwer, weil ich keinen Kontakt gefunden habe.“45 Die Erfahrung von Orientierungslosigkeit und Fremdheit schilderten mir auch Frauen aus binationalen Ehen, wie Frau Gd., die die russische Nationalität auch nach ihrer Zuwanderung nach Deutschland behielt, während ihr Mann den Spätaussiedlerstatus mit deutscher Staatsbürgerschaft innehat. 46 Weil sie als ‚Heiratsmigrantin‘ nach Deutschland kam und als Ausländerin keinen Anspruch auf einen Sprachkurs hat, war es für sie besonders mühsam, deutsch zu lernen. Obwohl sie seit mehreren Jahren in Ebd. Interview mit Herrn Fm. am 20.06.2013. 43 Vgl. Paul Mercheril: Andere Deutsche. Zur Lebenssituation von Menschen mit multiethnischer und multikultureller Herkunft. Berlin 1994. 44 Interview mit Frau Hm. am 05.07.2013. 45 Interview mit Frau Sm. am 02.07.2013. 46 Interview mit Frau Gd. am 01.07.2013. Drei Ehefrauen unter meinen Gesprächspartnern hatten eine russische Nationalität. In der Mehrzahl der Interviewten hatten beide Ehepartner eine deutsche Nationalität. 41 42 21 Neuhausen lebt, empfindet sie eine ‚gläserne Wand‘ im Kontakt mit Einheimischen: „Ich fühle mich nicht ganz integriert, weil ich kann nicht so gut Leute kennenlernen und ich spreche nicht so gut. Ich weiß nicht, wie die Leute hier leben, die hier geboren und aufgewachsen sind, weil ich weiß nicht, wie das Leben läuft bei diesen Leuten. Also ich versuche es, aber es funktioniert nicht so. Es gibt andere Leute, die sind schon länger hier und sprechen gut, aber bei mir ist das wie eine Wand.“ Was Frau Gd. hier im Vergleich zu etablierten Migranten schildert, ist im Grunde ein präventiver Rückzug aus sozialen Kontakten, wobei die Norm, sich über persönliche Begegnungen zu integrieren, als individuelle Integrationsanforderung umso stärker empfunden wird. Dass Hemmschwellen nicht nur aus eigenen Sprachbarrieren resultieren, sondern mitunter auch als Folge der kontaktvermeidenden Zurückhaltung der ‚anderen Seite‘ wahrgenommen werden, zeigt ein anderes Beispiel: Frau Mk. hatte zunächst in einem Haus im Ortskern gewohnt und war dann mit ihrer Familie in eine Wohnung am Ortsrand gezogen. „Mit den Leuten vom Dorf war es nicht so einfach. Ich kann von meiner früheren Nachbarin erzählen: Am Anfang war sie irgendwie kalt, und da habe ich gedacht, sie hat wohl schlechte Erfahrungen mit anderen Familien aus Russland gemacht und hat dann auch was Schlechtes von meinen Kindern erwartet.“47 Dass Alteingesessene negative Erfahrungen mit russlanddeutschen Familien gemacht haben könnten, wird antizipiert und führt zu einer anfänglichen Verunsicherung, die sich erst im längeren direkten Kontakt und durch den Aufbau nachbarschaftlichen Vertrauens auflöste: „Ich bin so ein Mensch, ich freue mich über neue Kontakte und wollte zeigen, dass alle Leute verschieden sind, und nach einer Zeit war es besser und besser und jetzt freue ich mich sie zu sehen und sie freut sich auch und sie heißt jetzt ‚unsere Oma‘, sagen meine Kinder. Und als wir umgezogen sind, hat sie gesagt, ‚och ist das schade.‘“48 Auch andere russlanddeutsche Mütter schildern Situationen, in denen sie eine Zurückhaltung von Alteingesessenen empfinden, die für sie erklärungsbedürftig ist. „Da war ein Elterngespräch in der Schule und da war eine einheimische Frau, die hat ‚hallo‘ gesagt, aber dann ist sie einfach weggegangen. Ich weiß nicht, was passiert ist, ich fühle mich irgendwie wie ein anderer Mensch von einem anderen Planeten. Wahrscheinlich denke ich, dass es Probleme mit der Sprache gibt, aber ich konnte auch nicht lernen, wie mit diesen Leuten zu sprechen ist.“49 Eine andere Migrantin berichtet von einer Interview mit Frau Mk. am 01.07.2013. Ebd. 49 Interview mit Frau Ol. am 02.07.2013. 47 48 22 ähnlichen Situation einer für sie emotional nicht nachvollziehbaren sozialen Grenzziehung in der alltäglichen Begegnung: „Ich spüre, dass die anderen auch eine Grenze haben mit den Kindern, irgendwas ist anders. Nicht so wie mit den anderen Kindern. Zum Beispiel waren wir auf dem Spielplatz und dort neben uns war auch eine junge Familie mit dem Sohn. Und das Kind aus dieser Familie wollte zu unseren Kindern, aber die Eltern haben gesagt: ‚Nein, du musst zu uns!‘, also die haben das Kind nicht gelassen. Da hab ich gedacht, irgendwas stimmt nicht mit uns.“50 Wie die letztgenannten Fälle zeigen, sind es häufig unsichtbare Grenzen, die die Gesprächspartnerinnen auf wechselseitig wahrgenommene Sprachbarrieren zurückführen. Mitunter lösen sich diese Barrieren in alltäglichen Kontakten, in der Nachbarschaft, in Schule und Kindergarten auf. Sie können sich auf Seiten der Migranten aber auch zu einer diffusen Erwartungshaltung verdichten, bei Begegnungen mit Alteingesessenen auf eine vorurteilsbehaftete Ablehnung zu stoßen, was in der konkreten Begegnung zutiefst verunsichert. Die soziale Abgrenzung, die einige meiner Gesprächspartnerinnen empfinden, fällt mit einer stigmatisierenden Sprachgrenze zusammen, in der der Umgang mit der russischen Sprache defensiv wird. 8.2 Zum Umgang mit Zweisprachigkeit „Am Anfang, als wir hierher gezogen sind, haben wir kein Russisch mehr gesprochen, auch in der Familie haben wir nur deutsch gesprochen. Weil unsere Kinder sollten das einwandfrei lernen, und für uns war das auch wichtig.“51 Schilderungen wie diese hört man vor allem von denjenigen Familien der mittleren Generation, die Anfang der 1990er Jahre nach Deutschland kamen und zu den ersten Spätaussiedlern gehörten, die sich in den Neubaugebieten von Neuhausen ob Eck ansiedelten. Russisch weder in den Familien, noch in der Öffentlichkeit sprechen zu wollen, entsprang zum einen dem Bedürfnis, sich über eine möglichst eindeutige und schnelle sprachliche Anpassung zu assimilieren.52 Zum anderen wollte man darüber auch öffentlich eine deutsche Identität unter Beweis stellen, die von der Mehrheitsgesellschaft häufig angezweifelt wurde.53 Interview mit Frau Be. am 03.07.2013. Interview mit Frau und Herrn Em. am 27.06.2013. 52 64 Prozent der in Deutschland aufgenommenen Spätaussiedler gaben laut einer Studie der FriedrichEbert-Stiftung an, dass sie in ihrem Herkunftsland zu Hause kein Deutsch gesprochen hatten (siehe Wirtschafts- und sozialpolitisches Forschungs- und Beratungszentrum der Friedrich-Ebert-Stiftung (Hg.): Berufliche Qualifizierung und Eingliederung in den Arbeitsmarkt: Aufgaben der Aussiedler- und Integrationspolitik. Bonn 2003). 53 Einige ältere Gesprächspartnerinnen berichteten mir von Stigmatisierungen, die sie als Deutschsprachige in Russland erfahren hatten. Darin zeigt sich ein spezifisches Anerkennungsproblem dieser 50 51 23 Entsprechend schamvoll konnte der Umgang mit der russischen Herkunftssprache sein: „Wir haben nur Deutsch gesprochen und wenn überhaupt mal Russisch, dann nur ganz leise, also fast geflüstert. Es war uns peinlich, wir wollten nicht auffallen. Aber jetzt mittlerweile hört man viel mehr Russisch.“54 Inzwischen bedauern es einige dieser länger in Neuhausen ansässigen Personen, dass ihre Kinder kein oder kaum Russisch können. So hat in einigen Familien inzwischen ein Umdenken stattgefunden: „Es ist schade, dass die Kinder nicht ein bisschen mehr Russisch können, da haben wir einen Fehler gemacht, denn noch eine Sprache dazu wäre eigentlich nicht schlecht gewesen“.55 Hatte man in vielen Familien, die bis Mitte der 1990er Jahre zuzogen, noch Wert auf eine durchgängige Deutschsprachigkeit gelegt, wird in manchen jüngeren Familien inzwischen wieder Wert auf die Weitergabe russischer Traditionen gelegt, die innerfamiliär über die russische Sprache vermittelt werden. „Mein größerer Sohn kann nicht mehr russisch sprechen, aber ich lass ihm noch etwas Zeit und dann nehme ich das wieder in Angriff, weil der Kleine redet ja nur russisch, er versteht zwar deutsch durch den Großen, aber er möchte abends russische Geschichten und russische Musik hören, weil er das von klein auf kennt. Ich möchte ihm das mitgeben, weil ich es eben kann, so schnell lernt man nie wieder. Zweisprachigkeit ist ja was Gutes.“56 Während die Kinder mit dem Eintritt in den Kindergarten selbstverständlich deutschsprachig sozialisiert werden, kann Russisch innerhalb der Familien als eine wichtige intergenerative sprachliche Brücke fungieren, um sich mit den Großeltern in den russischsprachigen Herkunftsländern zu verständigen. Eine Gesprächspartnerin der mittleren Generation gibt einen Einblick in diese innerfamiliäre Sprachpraxis: „Ich muss sagen, ich habe nur Deutsch mit meinen Kindern geredet, aber unsere beiden Omas reden ja nur russisch. Mein kleiner Sohn weiß schon, was sie reden und er antwortet auf Deutsch, also er weiß, was sie wollen, er versteht alles.“57 Mit zweisprachigen Kompetenzen können in migrantischen Familien also transnationale familiäre Verbindungen älteren Generation: während sie im Herkunftsland als „Deutsche“ ausgrenzt worden waren, wurden sie im Aufnahmeland als „Russen“ diskriminiert – eine Stigmatisierung, die sich auch am Gebrauch der russischen Sprache festmachte. (Vgl. Barbara Dietz: Rückwanderung in eine fremde Gesellschaft. Zur sozialen Integration russlanddeutscher Aussiedler in der Bundesrepublik. In: Graudenz, Ines / Römhild, Regina (Hg.): Forschungsfeld Aussiedler. Ansichten aus Deutschland. Frankfurt am Main u.a. 1996, S. 123138. 54 Interview mit Frau und Herrn As. am 09.07.2013. 55 Interview mit Frau und Herrn Om. am 04.07.2013. 56 Interview mit Frau Dm. am 22.05.2013. 57 Interview mit Frau Ls. am 22.05.2013. 24 aufrechterhalten werden.58 Wenn Kinder umgekehrt kein Russisch (mehr) können, kann dies zum Problem in der innerfamiliären Begegnung werden. Ein Beispiel: „Unsere Bekannten haben die Großeltern in Russland besucht und die Kinder können kein russisch und die Oma kein Deutsch, das war ein Problem. Die Eltern sind ein paar Tage weggefahren und die Kinder wollten was und die Oma hat das nicht verstanden und hat dann mit Vorwürfen gesagt: ‚Was macht ihr mit den Kindern, warum können die kein Russisch mehr?‘ Unsere Kinder, wenn wir jetzt nach Russland fahren, haben das Problem nicht.“59 Doch kann es mitunter zu Spannungen im Umgang mit der Zweisprachigkeit kommen, wenn einer der Ehepartner keine deutsche Abstammung hat: „Wenn die Ehen gemischt sind und die Frau, die aus Russland mitgenommen wurde, die Sprache nicht vergessen will, wie sollen sich ihre Kinder mit den Omas und Opas in Kasachstan oder Tadschikistan dort unterhalten? Diese Mütter haben gute Argumente, doch viele erzählen mir: ‚Mein Mann sagt, er will das nicht, das braucht man hier nicht‘. Aber ich meine, wenn die Frau gut Russisch zuhause spricht, dann kann man darauf aufbauen, dann kriegen die Kinder das schon hin.“60 Wie diese zweisprachige Sozialisation gelingen kann, ist unter russlanddeutschen Familien in Neuhausen ein virulentes Thema: „Viele von unseren Leuten fragen uns hier immer wieder: ‚Wie habt ihr das mit euren Kindern gemacht?‘ Unsere Freundin hat den Fehler gemacht, dass die Kinder deutsche und russische Wörter gemischt haben und das ist nicht gut, entweder russisch oder deutsch.“61 Wie komplex solche bilingualen Identitätskonstruktionen im gelebten familiären Alltag sein können, zeigt folgender Fall: „Wir reden mit unseren Kindern bis zur Schule zuhause russisch und deutsch, und sie schwätzen mit anderen Kindern draußen nur deutsch. Auch wenn zwei russische Kinder in einer Klasse sind, schwätzen sie nur deutsch. Wenn unser Sohn heimkommt, schwätzt er russisch. Aber sobald es an der Tür klingelt, schwätzt er deutsch, obwohl der andere Junge auch russisch kann. Er kann ganz In vielen Fällen geschieht das inzwischen über Skype, weil regelmäßige Reisen in die Herkunftsländer zu kostspielig wären. 59 Interview mit Frau Be. am 03.07.2013. 60 Interview mit der Integrationsbeauftragten der Diakonie-Bezirksstelle in Tuttlingen, die selbst einen russischen Migrationshintergrund hat, am 05.07.2013. In solchen Beziehungskonflikten um die sprachliche Erziehung der Kinder bilden sich auch gesellschaftliche Debatten um die Rolle von Zweisprachigkeit in den Institutionen der Aufnahmegesellschaft ab, vgl. dazu im Kapitel „Vereine“ die Debatte um eine zweisprachige Veröffentlichung im kommunalen Amtsblatt „donnerstags“. 61 Interview mit Frau Ml. am 21.05.2013. 58 25 schnell hin- und herswitchen.“62 Die bilinguale Kompetenz wird auch für manche der Jugendlichen, die kein Russisch (mehr) können, in ihrer Peergroup wieder interessant: „In der Schule ist es jetzt schon ein Unterschied, wenn man eine andere Sprache spricht als Deutsch, das gefällt den anderen. In meiner Klasse sind auch ein paar Russische, aber die können kaum noch Russisch. Es ist langweiliger, nur eine Sprache zu sprechen. Ich fänd‘s toll, wenn sie das könnten, nur mal so untereinander, so wie die Türken in der anderen Klasse auch.“63 Für Jugendliche der dritten Generation russlanddeutscher Migranten sind damit zugleich komplexe Identitätsebenen zwischen Sprache, Herkunft und Nationalität im Generationenzusammenhang angesprochen. Dazu ein Beispiel aus einem familiären Dialog, der sich während eines Gruppeninterviews entspann: Vater (lacht): „Na, unsere Kinder diskriminieren uns ja sogar, sie sagen, ‚ihr seid Russen, wir sind Deutsche.‘“ Mutter (lacht): „Da sagen wir, ‚aber guck mal, wir sind doch Deutsche, das steht doch im Pass.‘“ 15-jähriger Sohn: „Nein, ihr seid Russen, weil ihr in Russland geboren seid. Wir sind Deutsche, wir sind in Tuttlingen geboren. Ich habe früher auch immer gedacht, dass meine Eltern Russen sind und ich auch. Meine Freunde, die haben ja auch manchmal erlebt, dass meine Eltern russisch sprechen und da haben die gedacht, ich kann Russisch, ich wäre Russe.64 Was hier als spielerischer innerfamiliärer Disput zur Frage doppelter Identitäten in Erscheinung tritt, spiegelt sich auch in einem neuen, selbstbewussten Umgang mit Bilingualität in den jüngeren Generationen der Russlanddeutschen wieder. Diese Entwicklung hat auch etwas mit der Wahrnehmung zu tun, dass Eltern, die ihre Kinder zweisprachig sozialisiert haben, mitunter die beruflichen Chancen ihrer Kinder fördern. So berichteten mir mehrere Gesprächspartner, dass ihre zweisprachig sozialisierten, inzwischen erwachsenen Kinder ihre Arbeitsstellen vor allem aufgrund ihrer bilingualen Kompetenzen bekommen hätten. 8.3 Migration und verwandtschaftliche Netzwerke Im Folgenden soll der Bedeutung verwandtschaftlicher Netzwerke nachgegangen werden, die im Integrationsprozess russlanddeutscher Migranten eine Rolle spielen. Bewohner, die zu den ersten Aussiedlerfamilien in Neuhausen ob Eck gehören, erinnern Interview mit Herrn Sm. am 02.07.2013. Interview mit einem Jugendlichen der Familie Em. am 27.06.2013. 64 Interview mit Familie Em. am 27.06.2013. 62 63 26 sich, wie wichtig die Unterstützung von Familienangehörigen besonders in den ersten Jahren nach ihrer Ankunft in Deutschland war. Verwandte, die bereits in Deutschland bzw. in der Region lebten, waren zuvor meist Auslöser gewesen, die Migration überhaupt zu realisieren: „Also 1973 ist die erste Tante nach Deutschland gefahren und dann hat meine Mutter gehört, da ist noch eine Verwandte und noch jemand. 1977 ist der erste Onkel gekommen, 1978 der nächste und wir dann 1986. Da hat der Gorbatschow die Tore aufgemacht und da hat es geheißen, wir sollten gleich kommen, aber irgendetwas war mit den Papieren nicht in Ordnung, bis mein Onkel sich eingeschaltet hat“.65 Bereits nach Deutschland übergesiedelte Verwandte halfen nicht nur bei bürokratischen Hürden, die sich im Zuge des Aufnahmeverfahrens einstellen konnten, sondern auch bei der Vermittlung von Arbeitsplätzen und Wohnraum. Aus meinen Gesprächen mit russlanddeutschen Familien wurde also deutlich, dass diese Familien durch Familiennachzug in verwandtschaftliche Netzwerke eingebunden waren und weiterhin sind, die sich über ganz Deutschland bzw. über die Region spannen: „Unsere Verwandten kamen aus Kasachstan, von der Krim und aus Sibirien. Ab und zu trifft man sich dann auch mit den Tanten und Onkeln, den Cousinen und Cousins hier in Neuhausen“.66 Oder der Fall einer anderen Familie: „Unsere ganzen Verwandten wohnen hier in der Nähe, in Tuttlingen, Emmingen, Fridingen und in der Umgebung. Am Anfang waren wir die ersten und dann kamen nach und nach Tanten und Onkels und haben sich zu uns gesellt. Wir sind so eine regionale Familie.“67 Auch für Jugendliche erfüllen diese Verwandtschaftsnetzwerke eine wichtige soziale Funktion im Prozess des Ankommens in einem für sie fremden Dorf. „Das hat ja eine ganze Zeit gedauert, bis wir hier in Neuhausen Fuß gefasst hatten. Da waren unsere Cousins und Cousinen ganz wichtig. Das ist für uns nicht nur Verwandtschaft, sondern wir sind auch mit ihnen befreundet.“68 Zu großen Familienfeiern, die anlässlich von runden Geburtstagen von Erwachsenen, Taufen oder Kindergeburtstagen mitunter in einem am Ortsrand gelegenen Restaurant in Neuhausen ob Eck ausgerichtet werden, treffen sich oft mehr als 50 Personen, die zum erweiterten Verwandtschaftsnetzwerk gehören. Mit solchen Familienfeiern sind auch reziproke Verpflichtungen verbunden: Interview mit Frau und Herrn As. am 09.07.2013. Kettenmigration wird jene Art von Migration genannt, die durch bereits im Aufnahmeland lebende Familienangehörige, Verwandte oder Bekannte verursacht oder befördert wird. Durch die residiale Konzentration in Stadtteilen oder Dörfern erhoffen sich Migranten Unterstützung von Seiten der Familie oder Landsleuten bei der Eingliederung in die Aufnahmegesellschaft. 66 Interview mit Frau und Herrn Om. am 04.07.2013. 67 Interview mit Frau Ek. am 16.05.2013. 68 Interview mit Frau und Herrn Em. am 27.06.2013. 65 27 „Wir haben eine große Verwandtschaft, wir treffen uns oft zwischen uns, muss ich ehrlich sagen. Das ist halt so, z. B. an meinem Geburtstag, dann müssen wir immer alle einladen und das ist ein bestimmter Kreis. Wehe man vergisst da jemanden.“69 Teilweise haben sich auch Familien im Ort angesiedelt, die aus demselben Dorf aus Sibirien stammen: „Von unserem Dorf sind hier in Neuhausen bestimmt zwölf Familien und in Tuttlingen nochmal ungefähr zwanzig. Das war kein Zufall. Zum Beispiel meine Geschwister, die waren in Meßkirch im Wohnheim und dann haben wir ihnen eine Wohnung gesucht und so sind sie dann hierhin. So ist mein Bruder hergekommen und meine Schwester, die kamen vom selben Dorf. Und meine Eltern und deren Freunde genauso.“70 Herr und Frau As. gehören zu denjenigen Aussiedlern, deren Verwandte schon seit den 1970er Jahren in Westdeutschland lebten und deren eigene Übersiedlung noch vor dem Mauerfall, Ende der 1980er Jahre, stattgefunden hatte. Zuvor waren die in Deutschland lebenden Verwandten die treibende Kraft gewesen, um die Migration zu forcieren, die von Herr und Frau As. folglich nicht als eine eigenständige Entscheidung empfunden wurde: „Da hat der Onkel gesagt, ‚Basta, ihr kommt nach Deutschland‘ und dann sind wir nach Deutschland gefahren. Wir haben zum Beispiel nicht gewusst, dass es einen Daimler gibt. Wir haben das erste Mal ausländische Autos gesehen oder der Eiffelturm, wir hatten keine Ahnung. Wir kamen ja aus einer geschlossenen Gesellschaft und waren erst mal ziemlich orientierungslos.“71 So hatte auch der Prozess des persönlichen Ankommens einige Jahre gedauert: „Also am Anfang haben wir viel mit uns selbst zu tun gehabt. Das wichtigste war die Arbeit und dann die Sprache lernen und dann haben wir angefangen zu bauen. Das war ganz wichtig, da hat man gesehen, es hat sich nach und nach so aufgebaut. Und jetzt sind wir heimisch.“ Wer in der deutschen Aufnahmegesellschaft angekommen war, war es aber noch lange nicht im kleineren Dorf. Bis sich bei Frau und Herrn Om. Zugehörigkeitsgefühle in Neuhausen ob Eck einstellten, dauerte es lange: „Wir kamen aus Kasachstan und da haben wir studiert und dann kamen wir in die DDR, die es damals noch gab, bevor wir nach Westdeutschland gekommen sind. Aber das hier war für uns auch ein fremdes Interview mit Frau und Herrn As. am 09.07.2013. Ebd. 71 Diese in Neuhausen ansässigen Aussiedler, die vor dem Mauerfall nach Deutschland kamen, unterscheiden sich auch in ihrem Selbstbild von den nach 1990 zugewanderten „Spätaussiedlern“. Zum Motiv, aus einer ehemals „geschlossenen“ sowjetischen Gesellschaft zu kommen und von Informationen über die deutsche Aufnahmegesellschaft abgeschnitten gewesen zu sein, siehe Franziska Becker: Ankommen in Deutschland. Berlin 2001, S. 146ff. 69 70 28 Dorf, und das hat auch eine Zeit gebraucht, bis wir überhaupt Freunde gefunden haben. Das ist halt Dorf, das ist auch in Neuhausen so, man lebt gerne unter sich und der wo aus Russland kommt, der ist irgendwie halt lange noch nicht richtig da. Das braucht seine Zeit.“72 Fand die Integration der Migranten im ersten Schritt über die Beschäftigung in einer der umliegenden Betriebe statt, war sie jedoch auch häufig mit der Erfahrung einer symbolischen und/oder realen Deklassierung des im Herkunftsland innegehabten sozialen Status verbunden. So gehörten einige meiner Gesprächspartner in der ehemaligen Sowjetunion zur Mittelschicht und waren beispielsweise Lehrer gewesen, deren Abschlüsse in Deutschland allerdings nicht anerkannt worden waren. „Für unsere Eltern muss das hart gewesen sein. Ja, das war sehr schwer. Mein Vater zum Beispiel ist früher in Anzug und Krawatte rumgelaufen und jetzt in Öl und Dreck. Meine Mama war Grundschullehrerin und was macht sie jetzt? Teile am Fließband. Aber was soll man machen. Alle haben sich eigentlich damit abgefunden, was heißt abgefunden, weiterentwickelt und teilweise hochgearbeitet.“73 Eines der zentralen Symbole für einen gelungenen sozialen Aufstieg in der Aufnahmegesellschaft stellt für viele Migranten der Bau eines eigenen Wohnhauses dar, wobei auch hier verwandtschaftliche Strukturen oft von großer Bedeutung sind. Solche Netzwerke stellen ein reziprokes System gegenseitiger Hilfeleistungen bereit, das bei der anfänglichen Verortung in der Aufnahmegesellschaft wichtig ist und doch auch seine Grenzen hat: „Als wir damals gebaut haben, haben unsere Verwandten viel geholfen, wenn wir gerufen haben. Aber nur beim ersten Haus! Man hilft, aber beim zweiten Haus ist es keine Hilfe, da ist es schon etwas anderes. Aber damals, als wir mit zwei Koffern und zwei Kindern kamen, da haben uns unsere Leute auch geholfen, das ist was anderes, das hat bei der Integration geholfen.“74 Auch heute sind diese Netzwerke gegenseitiger Hilfe im öffentlichen Raum in den Neubaugebieten sichtbar: „Wenn ich spazieren gehe, da sehe ich einen, der baut ein Haus, da sehe ich immer Jugendliche, die helfen, die sind nicht aus unserem Dorf, aber dann weiß ich, dass es unsere Leute aus Russland sind“.75 Im Hausbau realisiert sich also sichtbar, dass man den sozialen Aufstieg geschafft hat; umgekehrt werden daran aber auch Distinktionsprozesse festgemacht, wonach denjenigen, die kein Haus gebaut haben, der soziale Aufstieg eben nicht gelungen sei. Interview mit Frau und Herrn Om. am 04.07.2013. Interview mit Herrn Em. am 27.06.2013. 74 Interview mit Herrn As. am 09.07.2013. 75 In dieser gegenseitigen Hilfe beim Hausbau bestätigt sich auch in der Außenwahrnehmung von einheimischen Neuhausern das besondere Zusammenhalten russlanddeutscher Familien. 72 73 29 Soziale Abgrenzungen verlaufen hier mithin nicht zwischen Alteingesessenen und Zugezogenen, sondern zwischen Migranten, die sich zu den „Migrationspionieren“ zählen und denjenigen, die später, also ab Mitte der 1990er Jahre nach Neuhausen ob Eck zugezogen sind: „Wir merken da ganz große Unterschiede! Der eine hat schon ein Haus gebaut, der andere sitzt noch auf Sozialhilfe, das ist der Unterschied. Na klar gehe ich nicht zu denen, ich will das nicht, die Armut, die Unzufriedenheit, das will ich nicht dauernd in meiner Umgebung. Deshalb versuche ich schon mal Pflege und Kontakt mit den Leuten, die ungefähr mit uns gekommen sind. Da ist man gerne zusammen und hat auch die gleichen Interessen.“76 Hier wird eine interne Differenzierung unter Russlanddeutschen sichtbar, die über die Zugehörigkeit zur gleichen sozialen Schicht im deutschen Kontext verläuft. Aus welchem Herkunftsland der ehemaligen Sowjetunion man kommt, spielt hier keine Rolle, dafür jedoch umso mehr, wer zu welcher Zeit nach Deutschland gekommen ist: „Deshalb sind wir auch keine russische Community, sondern es gibt ganz verschiedene Familien in Neuhausen, die aus verschiedenen Ländern und Regionen der ehemaligen Sowjetunion hier ins Dorf gekommen sind“, so fasst ein Gesprächspartner die Vielfältigkeit in der russlanddeutschen Migrantengemeinde zusammen.77 Neuhausen ob Eck ist also ein translokaler Kreuzungspunkt von teils weitverzweigten Verwandtschaftsnetzwerken russlanddeutscher Familien und darin auch ein beispielhafter Ort von sozialräumlichen Vergemeinschaftsprozessen jenseits klassischer dörflicher Gemeinschaftsstrukturen (beispielsweise von Vereinen). Aus der Außenperspektive von Alteingesessenen werden solche verwandtschaftlich organisierten Vergemeinschaftungsformen der Russlanddeutschen mitunter als deren mangelnde Integrationsbereitschaft in die dörfliche „Gemeinschaft“ gedeutet. Doch aus der Binnenperspektive der Russlanddeutschen gewinnt man ein differenzierteres Bild: Zum einen sind es familiäre Strukturen, die gerade zu Beginn der Einwanderung wichtig waren, weil sie bei individuellen Eingliederungsprozessen unterstützend sein konnten. Zum anderen schaffen solche Netzwerke ‚soziale Nähe‘ aufgrund einer gemeinsamen Herkunftsgeschichte, sprachlicher Vertrautheit und einer geteilten Migrationserfahrung, auch wenn die Erinnerungen an die Migrationsgeschichte der Eltern und Großeltern in der dritten Generation mitunter verblasst sind. 76 77 Interview mit Herrn As. am 09.07.2013. Interview mit Herrn Sm. am 02.07.2013. 30 8.4 Freundschaftsnetzwerke Neben den eben beschriebenen verwandtschaftlichen Vergemeinschaftungsformen sind unter Russlanddeutschen der mittleren Generation auch freundschaftliche Netzwerke entstanden, die aus der geteilten Migrationserfahrung ihrer Familien resultieren. Diese Familien, von denen die meisten zuvor in Übergangswohnheimen verschiedener Bundesländer gelebt hatten, waren Anfang bis Mitte der 1990er Jahre in die Mietshäuser eingezogen, die in den 1960er Jahren für die in Neuhausen ob Eck stationierten Bundeswehrsoldaten und ihre Familien gebaut worden waren. Inzwischen sind einige der Russlanddeutschen, die zum Zeitpunkt ihrer Einreise nach Deutschland Jugendliche waren, in die Neubaugebiete ‚Im Morgen‘ umgezogen und haben dort eigene Wohnhäuser gebaut. Unter diesen damals Jugendlichen hatte sich eine Gemeinschaft gebildet, an die sich meine Gesprächspartnerinnen noch erinnern: „Wir gehörten zu den ersten zehn russlanddeutschen Familien, die hier nach Neuhausen kamen. Und wir Jugendlichen waren eine feste Clique damals in den Hochhäusern.“78 Teils haben sie noch eigene Erinnerungen an die Migration und besonders an die Zeit, die sie und ihre jeweiligen Familien in den Übergangswohnheimen verbrachten. Auch dort hatten sich Freundschaften unter Jugendlichen gebildet, die durch den Umzug nach Neuhausen getrennt worden waren. In den Hochhäusern bildete sich jedoch eine neue Clique, die bis heute ein festes Freundschaftsnetzwerk darstellt. Eine jüngere Frau beschreibt die erste Zeit des Ankommens: „Ich bin hierhergezogen, ich konnte kein Wort Deutsch, ich konnte weder lesen noch schreiben und als wir dann in die Hochhäuser kamen, da habe ich J. kennengelernt und die hat mir das alles beigebracht, das Lesen und das Schreiben.“79 Als Jugendliche mit Migrationshintergrund teilte man das Gefühl, Außenseiter zu sein und nicht zu den jugendlichen Cliquen der alteingesessenen Familien zu gehören. Diese Selbstwahrnehmung des Andersseins resultierte nicht nur aus sprachlichen Barrieren, sondern auch aus bestimmten soziokulturellen Unterschieden, die für Gleichaltrige erkennbar waren: „Man wurde ausgelacht, als junger Mensch empfindet man das intensiver, wir haben uns anders angezogen, wir hatten das Gefühl, dass wir anders aussehen als die anderen.“80 Ein ausgewählter Platz in der Nähe des Schulhofs bot diesen Jugendlichen eine der wenigen Möglichkeiten, sich im Dorf und außerhalb Interview mit Frau Pl. am 22.05.2013. Interview mit Frau Ek. am 16.05.2013. 80 Interview mit Frau Dm. am 22.05.2013. 78 79 31 des Umfelds der Mietshäuser zu treffen.81 Die geteilten Erfahrungen, aus den Mietshäusern zu kommen und von den Dorfbewohnern als ‚anders‘ wahrgenommen zu werden, verband diese jugendliche Clique. „Wir waren ja eigentlich alle gleich. Unsere Eltern kamen aus Russland und wir waren alle Zugezogene, die man im Dorf an der Sprache und am Aussehen erkannt hat“82, so schildert eine Gesprächspartnerin das Gefühl der gemeinsamen migrantischen Herkunft. Heutzutage spannt sich dieses Freundschaftsnetzwerk über die ganze Ortschaft, ist lokal fest verortet und hat eigene informelle Treffpunkte im Dorf: „Wir haben uns ja wirklich durch ganz Neuhausen verteilt. Und alle unsere Freunde haben da in den Hochhäusern gewohnt und dann hier gebaut und wir treffen uns oft in der Mitte beim Markant. Nur mit dem Oberdorf hat man nichts zu tun, eben weil wir damals zugezogen sind, entstand halt alles hier in den Neubaugebieten und das ging bei den Hochhäusern los. Wenn man hier nicht befreundet wäre, dann würde ich nicht bauen, dann geh‘ ich in die Großstadt und leb‘ da ganz allein.“83 Die Frauen dieses Netzwerkes verbindet heutzutage nicht nur Freundschaft, sondern auch ein gemeinsames Engagement in der Elternarbeit in der Schule bzw. im Kindergarten. 9. Zum Engagement von Migranten in Schule und Kindergarten „Migranten engagieren sich kaum oder zu wenig in der Elternarbeit und zeigen in der Regel auch kein Interesse an einem solchen Engagement“, so lautet eine weitverbreitete Einschätzung, wenn es um Fragen der Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund in den Bildungsinstitutionen der Mehrheitsgesellschaft geht.84 Am Beispiel der Grundschule und einem Kindergarten in Neuhausen ob Eck soll nun folgenden 81 Der Platz am Bushäuschen ist auch heute noch ein üblicher Treffpunkt, an dem sich überwiegend Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichem Migrationshintergrund treffen. Während meiner Feldforschung konnte ich öfters beobachten, dass sich dort Kinder und Jugendliche verschiedener Altersgruppen trafen, darunter meist Jungs mit einem Fußball oder Ältere mit ihren Autos; hin und wieder waren auch Mädchen dabei. Doch ist es für diese Jugendlichen nicht immer ohne weiteres möglich, sich dort aufzuhalten, weil sich Anwohner im unmittelbaren Umfeld über Lärm beschweren oder ein Gefühl der Bedrohung äußern, das von den „russischen“ Jugendlichen ausgehe. Diese Aussagen von Anwohnern knüpften an Stereotypen an, wonach vor allem russlanddeutsche Jugendliche für Zerstörungen, die vor einigen Jahren im Jugendhaus stattgefunden hatte, verantwortlich seien. Solche Vorurteile wurden mir gegenüber nicht nur von jugendlichen Besuchern des Jugendhauses, sondern auch von Vertretern der Gemeindeleitung und dem Jugendreferenten mit dem Hinweis korrigiert, dass auch Jugendliche aus alteingesessenen Familien sowie aus der Umgebung an den Vorfällen im Jugendhaus beteiligt gewesen seien (siehe dazu informelle Gespräche mit dem Jugendreferenten sowie das Interview mit dem Bürgermeister am 25.07.2013). 82 Interview mit Frau Pl. am 22.5.2013. 83 Interview mit Frau Ek. am 16.05.2013. 84 Vgl. Azra Vardar: Die Beteiligung von Migranteneltern an einer deutschen Grund- und Hauptschule. In: Arbeitskreis Ethnologie und Migration (ArEtMi) e.V. (Hg.): Migration – Bürokratie – Alltag. Ethnographische Studien im Kontext von Institutionen und Einwanderung. Berlin 2011, S. 119-141. 32 Fragen nachgegangen werden: Wie wird dort die Beteiligung migrantischer Eltern wahrgenommen? Welche Hindernisse, aber auch welche Beteiligungsformen werden dabei sichtbar? 9.1 In der Grundschule Die Homburgschule ist eine Grundschule, an der ca. 150 Schüler angemeldet sind, von denen fast alle einen deutschen Pass besitzen.85 Einige Schüler haben einen Migrationshintergrund, d. h. ihre Eltern oder Großeltern stammen aus Osteuropa bzw. aus südeuropäischen Herkunftsländern (z. B. Griechenland). Die Schule versteht sich als eine Institution, die dem sozialräumlichen Umfeld gegenüber ‚offen‘ ist.86 Dabei kommt der Elternarbeit und dem persönlichen Kontakt zwischen dem Lehrerkollegium und den Eltern ein besonders hoher Stellenwert zu. So hat die Schule auch einen „sehr engagierten und zuverlässigen“ Elternbeirat, wobei es meist immer wieder dieselben Eltern sind, die sich dort einbringen: „Das Ganze wird getragen von einer Gruppe gebürtiger Neuhauser“.87 Einige von ihnen haben neben der Elternmitarbeit auch einen Vereinsvorsitz im Dorf inne, bzw. die Ehemänner sind Mitglieder des Gemeinderats. Der Elternbeirat besteht folglich zu einem nicht unerheblichen Teil aus einem festen Netzwerk etablierter Alteingesessener, die auf mehreren bürgerschaftlichen Ebenen der Gemeinde engagiert sind, im Dorfgeschehen demnach namentlich bekannt und öffentlich sichtbar aktiv sind.88 Im Vergleich dazu fällt den beiden Schulleitern auf, dass das Elternengagement der zugezogenen Aussiedler „sehr zurückhaltend“ sei. Zugleich suchen sie nach Erklärungen für die mangelnde Beteiligung russlanddeutscher Eltern und finden diese vor allem in der Zugehörigkeit zu einer arbeiterlichen Sozialschicht begründet: „Oft arbeiten beide, in Nachtschichten und so, ich weiß gar nicht, ob sich die Eltern überhaupt sehen und dass da dann gar kein Familienleben stattfindet. Das hat wirklich nichts mit Russland zu tun. Ich weiß nicht, ob es jetzt in den unteren sozialen Schichten mehr Russlanddeutsche gibt, also vielleicht vom Gefühl, dass man dann sagt, vielleicht sind das die? Und wir sehen das gar nicht so als Schicht, sondern als Herkunft.“89 Der Anteil von Schülern mit einer ausländischen Nationalität ist sehr gering. Als Teil des Gemeindelebens gehört dazu auch die partielle Mitwirkung der Schule an Dorf- und Vereinsfesten. 87 Die folgenden Zitate stammen aus einem Experteninterview, das ich mit der Schulleiterin und dem Konrektor am 18.06.2013 geführt habe. 88 Nur eine Frau mit rumänischem Migrationshintergrund ist im Elternbeirat vertreten. 89 Die folgenden Zitate stammen von der Schulleiterin, s. Fußnote 87. 85 86 33 Mitunter werden auch Sprachbarrieren als Grund dafür vorgebracht, dass Migranten nicht mit Lehrern in Kontakt treten und schulischen Veranstaltungen fern bleiben: „Ich habe schon oft von Eltern gehört: ‚Ich kann nicht kommen, ich kann selber kein Deutsch und kann meinen Kindern nichts erklären.‘“ Damit stellen mangelnde Sprachkenntnisse einen lebenspraktischen Grund dar, der die Kommunikation zwischen Eltern und Schule erschwert. Aber auch Unsicherheiten auf Seiten der Schulleitung, die Eltern direkt anzusprechen, spielen eine Rolle: „Es ist schwierig, die Leute anzusprechen, arbeitet die Mutter und so, all das erschließt sich uns nicht, wir stochern da ein bisschen im Nebel.“ Insgesamt seien die migrantischen Eltern im Sprachverständnis jedoch so weit, dass Elternbriefe inzwischen nicht mehr auf Russisch verschickt werden müssten, denn in dieser Hinsicht sei man bereits „eine Generation weiter“. Dennoch spüre man „eine Mauer“, mit den migrantischen Eltern direkt in Kontakt zu treten. Ein weiterer Erklärungsversuch für diese Barrieren war der Schulleiterin aus einer migrantischen Binnensicht übermittelt worden: „Was wir auch schon gehört haben, dass es in Russland einfach so ist, dass die Institution Schule oder Kindergarten alles vorgibt, die Eltern müssen nur reagieren, bzw. sie geben ihr Kind ab und holen es abends wieder. Es ist gar nicht erwünscht, dass jemand mitarbeitet. Und es ist teilweise sogar so, dass gesagt wird: ‚Ich misch mich dann ein, oder wie ist das, wenn ich helfe, werde ich dann ausgekreuzt, hat meine Familie dann Nachteile?‘ Und dass dann da eher so eine Zurückhaltung da ist, und man sich nicht traut zu kommen. Da ist wahrscheinlich die direkte Ansprache ganz wichtig.“ Ob bei russlanddeutschen Eltern tatsächlich von einer nachhaltigen kulturellen Prägung durch das russische Schul- bzw. Bildungssystem ausgegangen werden kann, lässt sich an dieser Stelle nicht entscheiden.90 Wichtiger erscheint der Hinweis der Schulleiterin, dass Partizipationsmöglichkeiten von migrantischen Eltern etwas mit institutionellem Vertrauen, direkter Ansprache und selbstbewusstem Auftreten zu tun haben, über das Eltern aus (deutschen) Mittelschichtsfamilien habituell eher verfügen als diejenigen aus arbeiterlichen Schichten oder sozial benachteiligten Milieus. In Schiffauer u.a. haben gezeigt, dass in deutschen Schulen ein zivilgesellschaftliches Erziehungsmodell vorherrscht, das von einer geteilten Verantwortung zwischen Schule und Elternhaus ausgeht. Insofern wird in deutschen Schulen darauf gesetzt, dass Eltern bei Spracherwerb, Hausaufgaben und anderen schulischen Belangen ihrer Kinder mithelfen. An Schulen mit einem hohen Migrationsanteil oder einem hohen Anteil von Kindern aus sozial benachteiligten Milieus gerät diese Selbstverständlichkeit unter Druck. Dagegen wird in den Erziehungssystemen anderer europäischer Länder von vornherein auf eine strikte Trennung zwischen Elternhaus und Schule Wert gelegt. Vgl. Werner Schiffauer u.a. (Hg.): Staat – Schule – Ethnizität. Politische Sozialisation von Immigrantenkindern in vier europäischen Ländern. Münster, New York, München, Berlin 2002. 90 34 Zusammenhang mit der Schule ist „kulturelles Kapital“91 insofern wichtig, als dass sowohl die Lehrer als auch die nichtmigrantischen Eltern überwiegend der Mittelschicht angehören und über ein andere Ressourcen verfügen, als die migrantischen Eltern, die zur Arbeiterschicht zählen.92 Und schließlich kann ein Grund für die geringe Beteiligung von migrantischen Eltern in den formalen Beteiligungsstrukturen93 der Schule auch darin liegen, dass die Elternarbeit wesentlich von einem Netzwerk engagierter alteingesessener Personen in Neuhausen ob Eck getragen wird, zu denen man als ‚Außenseiter‘ im Dorf nur schwer Zugang finden kann. So ergeben sich Gruppenbildungen, die auch bei schulischen Veranstaltungen immer wieder sichtbar werden: „Bei Elternfesten stellen wir das fest, da gibt’s so drei Tische und da sind die russischen Familien immer zusammen.“ Solche Gruppenbildungsprozesse lassen sich auch unter Schülern beobachten, wie die Schulleiterin schildert: „Wenn Sie zum Beispiel den ‚Montagskreis‘ nehmen, mit wem sie gespielt haben: so gut wie keine Durchmischung (…) Was ich immer sehe, ist, dass die Kinder mit Migrationshintergrund, die treffen sich, egal wer mit wem, der Schlaueste trifft sich mit dem Dümmsten, aber sie treffen sich untereinander, während bei den deutschen, da sucht man sich schon einen adäquaten Spielpartner, das sieht man immer. Aber woran das liegt? Ob sich die Eltern treffen, oder liegt‘s am Zusammengehörigkeitsgefühl oder am Wohnumfeld? Da wird bei den Deutschen schon selektiert, ‚geh ich jetzt zu dem oder zu dem?‘ Das sehe ich so gar nicht bei den fünf Russenkindern, da trifft sich jeder mit jedem, die bilden schon so was wie eine Subgemeinschaft im Dorf, das ist also auch bei uns in der Schule erkennbar.“ In diesem Beispiel werden ‚feine‘ soziale Distinktionslinien sichtbar, die über Freundschaften und das Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Schülergruppen verschiedener sozialer Herkunft mitentscheiden. Mitunter werden russlanddeutsche Schüler von Mitschülern aber auch – zumindest gegenüber den Lehrern – offen diskriminiert. Darin wird eine ethnisierende Vorurteilsstruktur mit ausgrenzender Wirkung 91 Der Begriff „kulturelles Kapital“ bezeichnet unterschiedliche, schichtspezifische Bildungsressourcen und ist ein Kriterium für soziale Ungleichheit (vgl. Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede: Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main 1987.) 92 Selbstverständlich können nicht alle migrantischen Eltern generell der Arbeiterschicht zugeordnet werden. Von den Berufstätigen unter meinen russlanddeutschen Gesprächspartner arbeiteten jedoch der Großteil der Frauen und Männer im Schichtdienst in Fabriken und Betrieben. 93 Während Eltern mit Migrationshintergrund in den offiziellen Funktionen der schulischen Elternarbeit (bis auf eine Ausnahme) nicht vertreten sind, gibt es auf der Ebene von informellen Veranstaltungen ein anderes Beteiligungsmuster; so bringen russlanddeutsche Mütter selbstgebackene Torten zu Schulfesten mit und beteiligen sich dergestalt mit kulinarischen Beiträgen, die zur russischen Tradition gehören. 35 deutlich: „Man spürt’s auch in der Klasse immer wieder. Also mein bester Schüler, das ist ein Russlanddeutscher und da gab’s die Situation, dass man zu anderen gesagt hat ‚du arbeitest mit dem zusammen und du mit dem‘. Da kam die Antwort ‚mit dem mache ich nichts zusammen, das ist ein Russe!‘, also knallhart, ‚ich will das nicht!‘ Das kommt nicht vom Kind, das kommt von den Eltern. Dieses ‚Russe‘ ist total negativ besetzt, aber die Kinder, das wissen die gar nicht.“94 Inwiefern solche Vorurteile, die sich von Eltern auf Kinder übertragen können, tatsächlich Einzelfälle im schulischen Alltag sind, oder ob sie darüber hinaus als kollektives Muster sozialer Abgrenzung wirksam sind und auf diese Weise systematisch zur sozialräumlichen Segregation von „Etablierten und Außenseitern“95 im dörflichen Lebenszusammenhang beitragen, kann an dieser Stelle nicht eingeschätzt werden. Die Schule als eine Institution der Aufnahmegesellschaft stellt eine wichtige Schnittstelle von Staat und Lebenswelt dar, in der versucht wird, solchen ausgrenzenden Ethnisierungsprozessen entgegenzuwirken.96 Zugleich ist die Schule aber auch an Gruppenbildungsprozessen beteiligt, indem sie soziale bzw. ethnische Entmischung festigt oder Durchmischung fördert. Dies wird am Beispiel der Grundschule in Neuhausen besonders deutlich. So sah sich die Schulleitung der Vorhaltung ausgesetzt, sie würde „Ghettoklassen“ bilden, weil viele Kinder mit Migrationshintergrund aus dem im Wohngebiet ‚Im Morgen‘ gelegenen Kindergarten in eine Klasse kamen: „Mit dieser Ghettobildung wurde uns vorgeworfen, ich würde Klassen bilden, die nur aus diesem Gebiet bestehen und in den anderen Klassen sind die Neuhauser. Das hat sich so ergeben, dass in der einen Klasse fast nur Russlanddeutsche und in der anderen Alteingesessene waren. Das ist aber vom Namen der Kinder her nicht mehr erkennbar.“ Die konkrete Zusammensetzung der Klassen hatte sich zum einen daraus ergeben, dass aus den Jahrgangskohorten der insgesamt vier Kindergärten der Gemeinde drei Schulklassen gebildet worden waren; zum anderen hatte man Freundschaften unter Kindern berücksichtigt, die bereits in den Kindergärten entstanden waren. Wie diese soziale bzw. Experteninterview vom 18.06.2013 (zitiert wird hier der Konrektor). Siehe Norbert Elias / John L. Scotson: Etablierte und Außenseiter. Frankfurt /M. 2002. In dieser klassischen Gemeindestudie haben die Soziologen Elias und Scotson den sozialen Prozess der Stigmatisierung von zugezogenen Außenseitergruppen durch Einheimische untersucht. 96 „Ethnisierung“ bezeichnet die „Soziogenese einer Minderheit“, die ihrer „für selbstverständlich gehaltenen Gesellschaftlichkeit enthoben (ist) und in eine Minorität eingeordnet wird, und dabei in eine Dynamik des Ein- und Ausgrenzens sowie der ethnischen Fremd- und Selbstidentifikation gerät“, (siehe Wolf-Dieter Bukow / Roberto Llaryora: Mitbürger aus der Fremde. Soziogenese ethnischer Minderheiten. Opladen 1988, S. 51). 94 95 36 ethnische Durchmischung durch die Schule zukünftig organisiert und ggf. in Zusammenarbeit mit den Eltern gestaltet wird, bleibt abzuwarten. 9.2 Im Kindergarten Im Kindergarten, der im Neubaugebiet ‚Im Morgen‘ liegt und 53 Kindergartenplätze zur Verfügung stellt, haben 80 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund, wovon die meisten aus russlanddeutschen Familien stammen.97 Im Unterschied zur Grundschule gibt es hier einen Elternbeitrat, in dem sich Mütter mit Migrationshintergrund engagieren: „Jetzt haben wir einen russischstämmigen Elternbeirat, der sehr zuverlässig ist. Vorher waren’s deutsche Eltern, die ausgeschieden sind, weil ihre Kinder in die Schule kamen. Die waren auch gut, waren sehr anerkannt und kamen aus alteingesessenen Familien“, so die Leiterin des Kindergartens. Zum integrativen Selbstverständnis der Einrichtung gehört es, sich sozialräumlich, d. h. zum unmittelbaren Wohnumfeld hin zu öffnen und auch die dort lebenden migrantischen Eltern in die formalen und informellen Beteiligungsstrukturen des Kindergartens einzubeziehen.98 Dass dabei die persönliche Ansprache von großer Bedeutung ist, um die Eltern zu motivieren, macht die Leiterin deutlich: „Man muss die Leute wirklich einzeln ansprechen, es nützt nichts, sie auf Elternabenden einzuladen und anzuschreiben. Ich muss sie wirklich persönlich ansprechen. Dann geht’s den Weg, dass sie sich untereinander absprechen und organisieren, dann läuft‘s.“ So konnten einige Migrantinnen auch dazu motiviert werden, sich mit einer russischen Folkloredarbietung ihrer Kinder am Festprogramm anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Freilichtmuseums in Neuhausen ob Eck zu beteiligen. Ausgesprochen wichtig ist im Zusammenhang des letztgenannten Beispiels, dass die Zugehörigkeit zu einem ‚ethnischen‘ Netzwerk keine negativen Auswirkungen hat, sondern im Gegenteil eine positive Ressource für Migranten darstellt, um auch außerhalb des Kindergartens in der Dorföffentlichkeit präsent zu sein und in einer positiv bewerteten Rolle wahrgenommen zu werden. Der integrative Rückgriff auf die ‚ethnischen Ressourcen‘ der Migrantinnen, den die Kindergartenleitung unterstützt hatte, bedeutet jedoch nicht, dass sie von den Pädagoginnen stereotypisierend als Die folgenden Informationen und Zitate entstammen einem Experteninterview mit der Leiterin des Kindergartens am 07.05.2013. 98 Neben dem Elternbeirat hat sich ein Elternstammtisch gebildet, in dem ebenfalls Eltern mit Migrationshintergrund vertreten sind, die sich regelmäßig außerhalb des Kindergartens in einem am Ortsrand gelegenen Lokal treffen. 97 37 „Russen“ betrachtet werden. Weil ein kontinuierlicher Kontakt zu den russlanddeutschen Bewohnern besteht, sind die Wahrnehmungsmuster der Mitarbeiterinnen des Kindergartens sehr differenziert, wenn es um gängige ethnisierende Fremdzuschreibungen geht: „Sie wollen keine Russen mehr sein, sie wollen deutsch sein und deutsch behandelt werden. Deutlich war das zum Beispiel beim Elternbeirat, da hatten wir in einem Elternbrief was Russisches geschrieben und da haben sie ganz deutlich gesagt: ‚Wir wollen das nicht!‘ Das war also auch für mich neu. Sie wollen deutsch sein und sind Deutsche.“ In dieser Interviewpassage wird nicht nur auf ein wiederkehrendes Verkennungsmoment gegenüber Russlanddeutschen in der Mehrheitsgesellschaft verwiesen, sondern auch auf deren ausgeprägtes Bedürfnis, als Deutsche anerkannt zu werden. So legen manche Migranten ganz besonderen Wert darauf, von offiziellen staatlichen Institutionen wie dem Kindergarten ausschließlich auf Deutsch (d. h. nicht zweisprachig) angeschrieben zu werden. Wie in einem vorhergehenden Kapitel erwähnt, muss dieser Wunsch nach Anerkennung jedoch nicht dem Bedürfnis widersprechen, die russische Herkunftssprache im Alltag der Familien, Nachbarschafts- oder Freundeskreis beizubehalten. So bestätigt auch die Leiterin des Kindergartens: „Viele Kinder sprechen zuhause russisch, das finde ich auch gut. Das sind Wurzeln, das ist ja auch eine Fähigkeit, das fände ich schade, warum sollten sie die russische Sprache aufgeben? Aber in der Außenwahrnehmung wollen sie Deutsche sein, das ist wichtig. Die Kinder haben alle die deutsche Staatsbürgerschaft, die Eltern haben manchmal noch eine andere Nationalität, da gibt es ganz verschiedene.“ Aus der Sicht der Kindergartenmitarbeiterinnen werden muttersprachliche Bindungen also positiv bewertet und nicht als integrationshemmend betrachtet. Eine ähnliche Wertschätzung äußert die Leiterin der Einrichtung im Blick auf die migrantischen Netzwerke, wobei sie einen ‚interkulturellen‘ Perspektivenwechsel vollzieht: „Ja, sie haben schon einen besonderen Zusammenhalt, sie kennen sich untereinander, wohnen ja auch im selben Wohngebiet oder in denselben Häuserblöcken. Und das gibt ja auch Sicherheit und hat was mit Vertrautheit zu tun. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach Russland auswandern würden, wir würden’s doch wahrscheinlich genauso machen und mit unseren Leuten zusammen sein, die gleich reden, gleich kochen, die gleiche Kultur haben.“ Durch den professionellen, alltäglichen Kontakt mit Migranten und die partiellen Einblicke in deren Lebenswelten haben sich nicht nur Vorurteile relativiert; inzwischen ist hier auch die Rede von den Russlanddeutschen als „unseren Leuten“, was darauf hindeutet, dass soziale oder symbolische Grenzziehungen in der Einrichtung keine 38 wesentliche Rolle spielen. Migranten werden in ihrer Rolle als Eltern und nicht in ethnisierender Perspektive als „Russen“ wahrgenommen. Umso deutlicher registriert die Leiterin des Kindergartens Vorbehalte gegenüber den Russlanddeutschen im sozialen Umfeld des Kindergartens. Franziska Becker: „Ich höre hier oft, die Russlanddeutschen integrieren sich nicht. Nehmen Sie das auch so wahr?“ Die Leiterin: „Ich würde eher sagen, es ist andersrum (…). Ich sehe die Grenze eher, dass die Bewohner aus dem älteren Teil Neuhausens nicht das Bedürfnis haben, da zu kommunizieren oder herzugehen und den Kontakt zu suchen. Also das ist so eine schwammige Grenze, die jeder spürt, aber keiner überschreiten will, die man spürt, obwohl sie nie ausgesprochen wird“. So beschreibt die Leiterin des Kindergartens eine „mentale Grenze in den Köpfen“, die sich zwischen alteingesessenen und zugezogenen Milieus verfestigt hat. Franziska Becker: „Wie nehmen die Russischsprachigen diese Grenze wahr? Gibt es da vielleicht ein Bedürfnis, diese Grenze zu überschreiten, aber sie wissen auch nicht wie?“ Die Leiterin: „Grad wenn ich an unseren Elternbeirat denke, wir machen ab und zu Aktionen, wo dann alle aufeinander treffen und das ist auch sehr schön, aber außer hier im Kindergarten gibt’s gar keine Räume, wo die sich jetzt treffen könnten. Und dann ist da eben auch diese unsichtbare Grenze vorhanden, wo dann auch unsere (Russlanddeutschen) sagen, ‚wir wollen ja, aber wie sollen wir denn, wir kommen ja gar nicht an‘. Und es wird nicht gewünscht von Neuhausens Bürgern, denke ich mal, dieser Kontakt ist gar nicht gewünscht. (…) So dieses Umdenken, die (Russlanddeutschen) wollen gar nicht russisch sein, die wollen sich gar nicht abkapseln, das haben die noch gar nicht erkannt und das ist in den Köpfen noch drin, auch bei den Jungen. Und deswegen ist es auch so schwer, diese beiden Gruppen zusammenzubringen. Nicht die Migranten, sondern die anderen haben da eine Grenze und sagen, ‚da wollen wir ja gar nicht hin‘. Deshalb sind wir hier auch der Ghettokindergarten, so heißt es. Das ist auch nicht schön für unsere Arbeit. Wir engagieren uns hier und die Kinder sind wie alle anderen Kinder auch und die Eltern sind auch in Ordnung, also wir können wirklich nicht sagen, dass wir hier in einem Ghetto sind.“ Gegen die Stigmatisierung des Kindergartens im Neubaugebiet ‚Im Morgen‘ wendet sich auch die Gruppe migrantischer Mütter, die dort in der Elternarbeit der Einrichtung aktiv ist.99 Weil der Anteil der „Russenkinder“ in der Einrichtung sehr hoch sei, so hören sie in Gesprächen mit anderen Eltern immer wieder, bevorzuge man den 99 Die folgenden Zitate stammen aus einem Interview mit drei Migrantinnen des Elternbeirats am 22.05.2013. 39 anderen Kindergarten, also denjenigen, der in der Trägerschaft der evangelischen Kirche liegt. In solchen Gesprächen sehen sich die migrantischen Mütter damit konfrontiert, dass ihre Kinder als „Ausländer“ bezeichnet werden, obwohl sie in Deutschland geboren sind und auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben. „Ich habe das schon gehört, dass Leute sagen, ‚in den Kindergarten hier (im Neubaugebiet) würden wir unser Kind nicht schicken, da hab‘ ich gefragt, warum nicht, da sagen sie: ‚Wir sind Deutsche, diese Kinder sind ja nur Ausländer‘. Da sage ich dann ‚wenn Sie wüssten, was diese ausländischen Mütter hier alles anstellen, damit das richtig läuft!‘ Und dann erzähle ich ein paar Sachen, was wir hier alles so machen mit Elternarbeit und so und dann sehen manche das anders.“ So arbeitet diese Gruppe engagierter migrantischer Mütter in zentraler Rolle an einer Verbesserung des Images der Einrichtung in der öffentlichen Wahrnehmung mit. Zugleich befinden sind die Migrantinnen in einer wichtigen Vermittlerrolle zwischen staatlicher Einrichtung und der migrantischen Gemeinschaft. Dies zeigte sich beispielsweise in einem Versuch, andere Eltern mit Migrationshintergrund über eine ins Kyrillische übersetzte Einladung zur Mitarbeit zu gewinnen. Dagegen hatte sich bei einem Teil der Eltern zwar Widerstand geregt („Wir brauchen das nicht, wir sind hier in Deutschland“), doch insgesamt sei dieser Versuch erfolgreich gewesen, weil sich anschließend deutlich mehr Migranten an der Abstimmung über die Öffnungszeiten des Kindergartens beteiligt hatten, als dies vorher der Fall gewesen war. Darüber hinaus sind die engagierten migrantischen Mütter nicht nur im Elternbeirat des Kindergartens aktiv und helfen bei der Organisation von Festlichkeiten mit, sondern nehmen auch an offiziellen Veranstaltungen der Gemeinde teil. Ihre Motivation, sich ‚bürgerschaftlich‘ zu engagieren, resultiert nicht nur aus dem Interesse an der pädagogischen Sozialisation ihrer Kinder, sondern aus einem generellen Interesse am Gemeindeleben: „Wir sind hier aufgewachsen und wollen auch am Dorfgeschehen Anteil nehmen“.100 Teilweise kennen sich die jungen Mütter noch aus den ‚Sternhäusern‘, in denen ihre Familien in den Anfangsjahren nach der Immigration wohnten. Diejenigen, die bereits seit rund 20 Jahren im Ort leben, bezeichnen Neuhausen ob Eck ausdrücklich als ihre „Heimat“, ein Begriff, der ihre starke emotionale Bindung an den Ort zum Ausdruck bringt. Andere migrantische Mütter sind erst vor einigen Jahren aus umliegenden Ortschaften zugezogen und fühlen sich im Dorf zwar „zu Hause“, aber „noch nicht heimisch“. Die 100 Ebd. 40 Gruppe trifft sich sowohl privat zu Grillfesten und Spieleabenden, als auch beim Elternstammtisch oder zu gemeinsamen Ausflügen in die Region, an denen in der Regel mehrere Familien teilnehmen. Was sich am Fall dieses lokal verorteten Netzwerkes jüngerer Migrantinnen ganz deutlich zeigen lässt, ist, dass sich eine auf russischdeutscher Herkunft basierende Gemeinschaftlichkeit und ein ‚bürgerschaftlichen Engagement‘ keineswegs widersprechen müssen. Weder steht das Verbleiben in migrantischen Netzwerken einer Integration in die Aufnahmegesellschaft entgegen, noch führt dies zu einer Abgrenzung oder gar Abschottung gegenüber den traditionellen Strukturen des Dorfes. Dies erweist sich auch darin, dass einige der Frauen selbst in Vereinen aktiv sind oder großen Wert darauf legen, dass ihre Kinder in den örtlichen Vereinen sozialisiert werden. Der Kindergarten ermöglicht ihnen zudem ein relativ niedrigschwelliges Engagement in institutionalisierten Strukturen der Dorfgemeinschaft, in denen integrative Begegnung und sozialer Austausch stattfinden. Wie formulierte es eine der jungen Mütter: „Ich bin jetzt auch in der Krabbelgruppe im Kindergarten die einzige Russin, sag ich jetzt mal so, aber die anderen haben mit mir kein Problem und ich mit ihnen nicht. Unsere Kinder spielen zusammen, was wollen wir mehr? Wir kommunizieren miteinander und machen Feste und das ist doch auch Integration, das machen vor allem die Mütter.“101 Verglichen mit den klassischen Formen der bürgerschaftlichen Partizipation in den Vereinen, auf die im nächsten Kapitel eingegangen wird, bleibt das Engagement von Migrantinnen in den eben beschriebenen Formen zwar relativ unsichtbar, doch auch diese Art der Beteiligung ist ein wichtiger Bestandteil integrativer sozialer Arbeit im dörflichen Lebenszusammenhang.102 10. Vereine und Integration Im Folgenden geht es um lokale Vereine als traditionale Form der dörflichen Vergemeinschaftung, um ihre Bedeutung innerhalb des dörflichen Sozialverbunds und ihre Integrationskraft für Zugezogene (mit und ohne Migrationshintergrund) herauszuarbeiten. Interview mit Frau Dm. am 22.05.2013, an dem noch zwei weitere Mütter mit Migrationshintergrund teilnahmen. 102 Das Bedürfnis nach einer stärkeren Teilhabe am (politischen) Gemeindeleben kam auch im Wunsch der Migrantinnen nach einer besseren Kommunikation zwischen Elternbeiräten und Gemeindeleitung zum Ausdruck. Dies bezog sich auf den Konflikt um den geplanten Umzug der beiden Kindergärten im Zusammenhang mit der Einführung der Ganztagesbetreuung, was zu starken Protesten in großen Teilen der Elternschaft geführt hatte. Auf dieses Thema kamen vieler meiner Interviewpartner von sich aus zu sprechen. 101 41 „Die Kultur in unserer Gemeinde wird nahezu ausschließlich auf den Schultern der Vereine getragen“, so beschreibt der Bürgermeister die Bedeutung der rund 50 Vereine, die in seiner Gemeinde als „Stütze der dörflichen Kultur und des gesellschaftlichen Lebens“ tätig sind.103 Ein breit gefächertes Vereinsspektrum prägte die lokale Kultur Neuhausens bereits Ende des 19. Jahrhunderts und hat sich bis in die Gegenwart hinein erhalten.104 Heute zählen zu den klassischen Vereinsstrukturen der Gemeinde Sport- und Turnvereine, verschiedene musische Vereine (z. B. Musikkapelle, Harmonikaclub, Gesangverein), Traditionsvereine (z. B. Heimatverein), Hobbyvereine (z. B. Motorradclub), Vereine im Bereich Wandern, Umwelt- Naturschutz und Landschaftspflege (z. B. Schwäbischer Albverein, Obst- und Gartenbauverein); hinzu kommen karitative und humanitäre Dienste (z. B. DRK-Ortsgruppen) sowie die Freiwillige Feuerwehr, um nur einige der lokalen Institutionen bürgerschaftlichen Engagements zu nennen. Die Vereine in Neuhausen erweisen sich als eine heterogene Vielfalt institutionalisierter Gemeinschaftsformen, die auf unterschiedliche Zwecke hin ausgerichtet sind. Während einige kleinere Vereine, wie beispielsweise der Gesangverein oder der Motorradclub, ausschließlich auf den Zweck der geselligen Freizeitgestaltung einer überschaubaren Mitgliederzahl fokussiert sind, bietet ein großer überregionaler Vereinsverband wie der Schwäbische Albverein mit seiner rund 500 Mitglieder starken Ortsgruppe eine Vielzahl von Freizeitangeboten und sportlichen Aktivitäten für alle Altersgruppen und sozialen Schichten an, wobei zugleich Aufgaben der „gemeinnützigen Arbeit“ (bspw. im Naturund Umweltschutz) übernommen werden. Andere Kulturvereine wie die „Musikkapelle“ präsentieren sich über den engeren musischen Vereinszweck hinaus bei mehrmals jährlich stattfindenden Jahreskonzerten im öffentlichen Gemeindeleben.105 So ausdifferenziert und vielfältig sich das Vereinsleben von Neuhausen ob Eck einerseits darstellt, so deutlich werden andererseits strukturelle Grenzen in der Vereinslandschaft, wenn es um Fragen einer stärkeren sozialen Inklusion einzelner Interview mit Herrn Osswald in „Bürgerinformationen Neuhausen ob Eck“ (vgl. www.totallokal.de/pdf/78579_info.pdf). 104 Zu den ältesten Vereinen, die heute noch bestehen, gehören der Gesangverein Harmonie (1861), die Musikkapelle (1898), der Turn- und Sportverein (1873), der Obst- und Gartenbauverein (1889), die Ortsgruppe des Schwäbischer Albvereins (1901). Vgl. dazu auch Willi Hepfer: Neuhauser Vereine und Vereinigungen, in: 900 Jahre Neuhausen ob Eck 1095-1995. Ein Heimatbuch mit Beiträgen zur Vergangenheit und Gegenwart der Gemeinde, hrsg. von der Gemeinde Neuhausen ob Eck. Tuttlingen o. J., S. 435-461. 105 Ausführliche Interviews habe ich zu diesem Thema durchgeführt mit der Vorsitzenden der Musikkapelle, den Vorsitzenden der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins, des Heimatvereines, des Gesangvereins, des Harmonikaclubs und des Motoradclubs sowie dem Kommandanten und dem Jugendleiter der Freiwilligen Feuerwehr, die streng genommen kein Verein ist, aber vom ehrenamtlichen Engagement ihrer Mitglieder getragen wird. 103 42 Vereine geht. Mir wurde wiederholt mitgeteilt, dass sich in einigen Vereine mit gleichem Vereinszweck „Parallelstrukturen“ gebildet hätten, die einem Zusammenwachsen und einem umfassenden kulturellen Zugehörigkeitsgefühl im Gemeindeleben entgegenstehen würden. So gibt es beispielsweise in allen drei Ortsteilen jeweils einen Musikverein, wobei der Neuhauser Musikverein einem württembergischen und der Musikverein in Schwandorf einem badischen Verband angehört. Ähnliches gilt für den Turn- und Sportverein Neuhausen, der dem württembergischen Sportverband angehört, während die beiden Sportvereine Schwandorf und Worndorf wiederum einem (süd)badischen Dachverband angehören. Aufgrund dieser regionalen Verbandsgrenzen sei es bis vor kurzem nicht möglich gewesen, dass Fußballspieler aus Neuhausen im Fußballverein der beiden Ortsteile mitspielen können.106 Zugleich sind die Mitglieder dörflicher Vereine in der Regel „in ein Netz von Gegenseitigkeitsbeziehungen eingebunden, die das Verhältnis zwischen den Vereinen, des Einzelnen zu seinem eigenen Verein als auch die Verpflichtungen des Vereines gegenüber seinen Mitgliedern wesentlich markieren.“107 So helfen sich einige Vereine in Neuhausen beispielsweise untereinander bei Vereinsfesten: Wenn der Musikverein sein Jahreskonzert hat, dann bewirtet der Gesangverein und umgekehrt; wenn der Gesangverein Jubiläum hat, dann spielt der Musikverein. Diese wechselseitige Unterstützung der Vereine ist in Neuhausen ob Eck allerdings weniger ausgeprägt als in benachbarten Gemeinden, wo es feste Vereinsgemeinschaften gibt, die auch größere öffentliche Veranstaltungen zusammen ausrichten. So gibt es in Neuhausen ob Eck weder ein von den Vereinen gemeinsam ausgetragenes Dorffest wie sonst überall in der Region üblich, noch präsentieren sich die Vereine gemeinsam auf überregionalen Festen wie beispielsweise in der Kreisstadt.108 Dass eine öffentlich sichtbare Gemeinschaftlichkeit in Neuhausen ob Eck fehlt bzw. stark zurückgegangen sei, wird unter anderem mit dem Wegzug der Bundeswehr Siehe die Interviews mit dem Ortsvorsteher von Schwandorf am 01.07.2013 und dem Bürgermeister von Neuhausen ob Eck am 25.07.201, nach deren Ansicht man die Vereinslandschaft bereits 1973 im Zuge der baden-württembergischen Kreisreform neu hätte regeln müssen. 107 Siehe auch Gertrud Hüwelmeier: Hundert Jahre Sängerkrieg. Ethnographie eines Dorfes in Hessen. Berlin 1997, S. 12. 108 Sportverein, Gesangverein und Freiwillige Feuerwehr beteiligen sich an einem gemeinsamen Geschäftsmodell, für das sich die Gemeinde geöffnet hat: die Bewirtung bei traditionellen türkischen Hochzeitsfeiern; dazu werden Räumlichkeiten der Homburghalle mit bis zu 900 Besuchern vermietet; Anfragen für türkische Hochzeiten kommen aus dem gesamten süddeutschen Raum bis München. Für die Bewirtungsleistung erhalten die Vereine Geld, eine Dienstleistung, die neben Mitgliedsbeiträgen und der Pauschalförderung der Vereine durch die Gemeinde zur Haupteinnahmequelle geworden ist (vgl. Interview mit dem Bürgermeister am 25.07.2013). 106 43 Mitte der 1990er Jahre begründet. Tatsächlich hatte die Bundeswehr eine Vielzahl gemeinschaftlicher Aktivitäten organisiert, darunter Dorffeste, Partys in der Homburghalle, internationale Boxwettkämpfe, Countryfeste und Autorennen auf dem Flugplatz.109 Auf diese Weise sei die Bundeswehr stark in der Öffentlichkeit aktiv gewesen und habe das öffentliche Leben in Neuhausen sogar „teilweise komplett übernommen“.110 Aber auch das Vereinsleben hatte sich durch den Zuzug der Bundeswehr verändert. Ein Gesprächspartner unter den Alteingesessenen erläutert dies am Beispiel des Sportvereins: „In Neuhausen gab es die Tradition des Handballs und durch die Zugezogenen kam dann der Fußball, aber das war nie das Ureigene. Drum läuft hier der Fußball auch so schlecht, ich denke, das hat das bewirkt. Es waren alles Fremde, die das gemacht haben, alles Bundeswehr.“111 Die Rolle der Bundeswehr wird im Blick auf den sozialen und kulturellen Wandel Neuhausens je nach Perspektive der Gesprächspartner unterschiedlich und mitunter ambivalent bewertet. Für die einen sind durch den Zuzug der Bundeswehr ‚alte‘, traditionell geprägte Strukturen und Gemeinschaftsformen aufgebrochen. Dass dabei mitunter verklärende Bilder einer vermeintlich homogenen, bis in die 1960er Jahren noch überwiegend bäuerlich geprägten, dörflichen Solidargemeinschaft entworfen werden, zeigt folgende Interviewpassage: „Also früher war noch Dorfgemeinschaft bei uns, und als dann die Bundeswehr zu uns gekommen ist, die hat den Zusammenhalt schon auseinandergetrieben. Ja klar, die sind überall in den Vereinen gewesen, aber wenn damals von der Bundeswehr jemand mal einen Vorschlag gemacht hat, dann wurde das hochgejubelt und einen Neuhauser hat man gar nicht angehört (…) Früher ist man zusammengehockt als Nachbarn, da hat man die Bänke rausgeholt oder auch so im Austauschen hat man sich gegenseitig geholfen. Und nachher sind die Leute ganz anders geworden. Man hat immer mehr auf die Fremden gehört.“112 Für andere Bewohner hat der Zuzug der Bundeswehr wesentlich dazu beigetragen, dass sich das Dorf in einer positiven Weise gegenüber ‚Fremden‘ geöffnet habe, wobei in diesem Zusammenhang Quelle: Aus den Archivalien des Vorsitzenden des Heimatvereines, der selbst Bundeswehrangehöriger war. 110 Interview mit dem Bürgermeister am 25.07.2013. 111 Interview mit einem der beiden Vorsitzenden des Schwäbischen Albvereines (Ortsgruppe Neuhausen ob Eck) am 06.05.2013. Wie in vielen altwürttembergischen Gemeinden gab es in Neuhausen bis in die 1970er Jahre keinen Vereinsfußball, sondern Großfeldhandball. Mit dem Zuzug der Bundeswehr kam es zu einer Kampfabstimmung darüber, ob sich der Sportverein dem Fußball öffnen sollte. Dabei hatten sich die Fußballer der Bundeswehr knapp gegen die dörflichen Eliten durchgesetzt, die dagegen waren (vgl. Interview mit dem Bürgermeister am 25.07.2013). 112 Interview mit Frau Rs. am 10.07.2013. 109 44 immer wieder auf die (scheinbar problemlose) soziale Eingliederung der Bundeswehrangehörigen in die örtlichen Vereine verwiesen wird. Dass Neuhausen ein „offenes Dorf“ sei, in das man sich schnell integrieren könne, wird von ehemaligen Bundeswehrangehörigen bestätigt, die weiterhin in Neuhausen ob Eck wohnen und Funktionen im Vorstand des Sportvereins und in der Leitung der Jugendfeuerwehr innehaben: „Ohne die Soldaten wäre Neuhausen nicht das, was es heute ist, weil die Soldaten haben sich viel eingebracht in den Vereinen.“113 Was als beispielhafte Integration einer Gruppe von Zugezogenen in die dörflichen Strukturen gilt, richtet sich heute jedoch als normative Erwartungshaltung an andere, später Zugezogene in den Neubaugebieten: „Ich will mal so sagen, der wo zugezogen ist in Neuhausen, wenn sich einer in die Vereine integriert, der hat auch kein Problem. Der B. (Bundeswehrangehöriger) ist das beste Beispiel, die sind 30 oder 40 Jahre hier, das sind Neuhauser. Aber wenn jemand für sich sein will und nirgends mitmacht, der wird halt immer fremd sein, das gibt’s halt auch, also weniger im Kerndorf selber, aber jetzt in den Neubaugebieten, da ist das schon ein schwieriges Thema.“114 Ein Fremder ist demnach nicht einfach jemand, den man nicht kennt, sondern jemand, der als „nicht zugehörig“ gilt, weil er sich am Dorfgeschehen nicht beteiligt. In dieser wirkmächtigen Erwartungshaltung löst sich die zugeschriebene Fremdheit also dann erst auf, wenn man aktiv am Vereinsleben teilnimmt.115 Im Vergleich mit den ‚Fremden‘ der Bundeswehr, die auf diese Weise zu ‚Einheimischen‘ geworden sind, erscheinen die neuzugezogenen Russlanddeutschen in dieser Perspektive als ‚Integrationsverweigerer‘: „Früher war ja auch der Flugplatz oben mit vielen Soldaten, also wenn in Neuhausen sich jemand integrieren will und in einem Verein mitmachen will, ist das überhaupt kein Problem. Das Problem haben wir eher mit den russischen Einwanderern, weil die wohnen zwar in Neuhausen unten im (Wohngebiet) Morgen Richtung Osten, aber die sieht man in keinem Verein, die sieht man in keiner Wirtschaft, die kaufen auch selten in Neuhausen ein, die schaffen die ganze Woche und im Keller haben sie so einen Barraum und dann feiern sie da am Wochenende ihre Feste mit Wodka unter sich und das ist ein wenig schade.“116 Interview mit Herrn No. am 06.05.2013. Interview mit Herrn Ob. am 03.07.2013. 115 „Die Angliederung an die dörfliche Kultur und an die Formen dörflicher Interaktion gilt insbesondere dann als gelungen, wenn die Fremden zu Vereinsmitgliedern geworden sind.“ (Hüwelmeier 1997, S. 161) 116 Interview mit Herrn Dn. am 06.05.2013. 113 114 45 Die weitverbreitete Vorhaltung, dass die Russlanddeutschen sich in ihre Privatsphäre zurückziehen würden, da sie im öffentlichen Gemeindeleben nicht sichtbar seien, korrespondiert dabei mit dem Bild einer zweigeteilten dörflichen Gesellschaft: auf der einen Seite die Gruppe der engagierten ‚Bürger‘, die ihre lokale Verbundenheit über ihr öffentlich sichtbares bürgerschaftliches Engagement unter Beweis stellen; auf der anderen Seite jene ‚Bewohner‘, die das Dorf lediglich als funktionalen Wohnort nutzen, ohne dass sie weitergehende dorfgemeinschaftliche Verbindlichkeiten eingehen würden. Aufgrund dieser Zweiteilung gerate auch die Integrationskraft der klassischen Vereine zunehmend unter Druck, wie ein alteingesessener Kommunalpolitiker meint: „Vielleicht ist man im Dorf früher so erzogen worden, dass der hier Geborene und Aufgewachsene automatisch in dieser Vereinsgemeinschaft drin ist, dagegen der ‚Fremde‘ in Anführungszeichen, der kommt und nutzt die für ihn netten Möglichkeiten, Wald, Wiesen und so weiter, was die Stadt nicht so hat, aber sonst? Vielleicht will er sich nicht in ein Schema, in einen Verein reinbegeben. Er möchte da im Dorf leben, geht zum Arbeiten irgendwo hin und das war‘s.“117 10.1 Bürgerschaftliches Engagement im Verein Wie das zuletzt genannte Beispiel zeigt, gehört es bei Alteingesessenen oftmals zur familiären Tradition, sich ehrenamtlich in einem der klassischen Vereine, der Freiwilligen Feuerwehr oder der Kirchengemeinde zu engagieren. Es sind familiäre Traditionslinien, die teilweise über mehrere Generationen hinweg reichen, zum Beispiel bei Herrn Dn.: „Die ganze Familie war schon immer in Vereinen, alteingesessen halt, Uropa und Opa und Vater waren schon in der Musikkapelle, der Uropa war auch im Gesangverein und der Vater und einer meiner Brüder waren im Posaunenchor, ein anderer ist in der Feuerwehr, eine Schwester ist auch im Posaunenchor, die andere Schwester ist Messmerin.“ 118 Auch Mehrfachmitgliedschaften sind keine Seltenheit: „Wir haben Leute, die sind bei der Feuerwehr, die sind bei der Musik und noch beim Albverein, die ‚tanzen auf allen Hochzeiten‘.“119 Sich in einem Verein zu engagieren, sei, so formulierte es der Vorsitzende eines großen Vereins in Neuhausen ob Eck, „wie ein Virus in der Familie“ schon früh auf ihn übertragen worden.120 Bei der Freiwilligen Feuerwehr sei man als junger Mann von den älteren Mitgliedern regelrecht angeworben Interview mit dem Ortsvorsteher von Schwandorf am 01.07.2013. Interview mit Herrn Dn. am 06.05.2013. 119 Ebd. 120 Interview mit einem der beiden Vorsitzenden des Schwäbischen Albvereins am 06.05.2013. 117 118 46 worden, so erinnert sich der dort langjährig aktive Kommandant.121 Bei anderen ehrenamtlich Engagierten standen persönliche Freizeitinteressen im Vordergrund oder es motivierte sie der Wunsch, sich nach einem Unglücksfall karitativ zu betätigen. Andere der in einem Verein engagierten Personen heben hervor, dass eine Vereinstätigkeit vor allem soziale Anerkennung bedeute, die im beruflichen Alltag ja allzu oft fehle. Zugleich wird deutlich, dass ein solches Engagement unter den Bedingungen von Individualisierung und der Herauslösung des Einzelnen aus traditionellen Vergemeinschaftungsformen längst nicht mehr selbstverständlich ist, wie es ein Vereinsvorsitzender zum Ausdruck bringt: „Das ist wahrscheinlich auch ein gesellschaftliches Problem, ich möchte mir nicht vorschreiben lassen, Freitagabend immer zur Probe oder so. Solche Verpflichtungen wollen die Leute nicht mehr, wollen alleine Musik machen. Ich verstehe das, aber ich bin halt familiär mit diesem System aufgewachsen, ich kenn‘s nicht anders. Man hat vielleicht auch noch moralische Verpflichtungen, aber man empfindet es nicht als störend, dass man dahin muss. Es muss die Attraktivität gegeben sein und das Bedürfnis, es darf kein Druck gegeben sein.“122 Was für diesen Vereinsvorsitzenden als eine selbstverständliche moralische Bindung erscheint, stellt für andere meiner Gesprächspartner eher eine soziale Verpflichtung dar, im Dorfgeschehen wahrgenommen und gesehen zu werden: „Das ist halt manchmal die Kehrseite von der Vereinsarbeit, dass natürlich wieder Zwang entsteht, also zunächst mal an den Vereinsaktivitäten teilzunehmen, also Verein X als Beispiel macht jetzt regelmäßige Übungsabende und dann gibt’s natürlich das Grillfest und wenn du nicht zum Grillfest hingehst, wird wieder über Dich geredet: ‚wart ihr wieder nicht dabei‘, also es entsteht natürlich auch wieder ein Zwang, an so was teilzunehmen, oder jetzt beim Musikfest wird geschaut, wer war da, wer war nicht da.“123 Durch die sichtbare Präsenz im Dorfgeschehen zeigt man sich gegenüber anderen Bewohnern Neuhausens als ein engagierter Bürger und erfährt gleichzeitig die Akzeptanz, als der Dorfgemeinschaft zugehörig wahrgenommen zu werden. Eine Bewohnerin, die sich selbst immer noch als Zugezogene beschreiben würde, obwohl sie in Neuhausen aufgewachsen ist, beschreibt dies folgendermaßen: „Wenn ich mich als zugezogen fühle, ist es jetzt für mich okay, wir fühlen uns wohl, wir fühlen uns auch angenommen. Aber ich denke, das ist auch deshalb, weil wir uns hier engagieren, weil Interview am 04.06.2013. Interview mit dem Vorsitzenden des Harmonikaclubs am 13.05.2013. 123 Interview mit dem Bürgermeister am 25.07.2013. 121 122 47 man uns sieht, weil man weiß, die wohnen hier gerne und sind dabei. Also vielleicht muss man sich auch zeigen, dass man sieht, denen liegt was am Dorf. Und wenn man in einem Verein ist, dann ist es nicht schwer, akzeptiert zu werden.“124 In einem Dorf wie Neuhausen ob Eck besteht dieser Kern der Engagierten aus einem recht überschaubaren Personenkreis, deren Mitglieder sich bei Festen und vereinsinternen Veranstaltungen immer wieder begegnen; man kennt sich untereinander und weiß auch genau, wer in diesem Netzwerk „alteingesessen“ und wer „zugezogen“ ist. „Ob Sie zur Musik gehen, zum Schwäbischen Albverein, oder Sportverein – die Leute, die irgendwelche Feste ausrichten oder irgendwelche Arbeiten ausführen, sind immer die gleichen. Man kennt sich. Bei der Feuerwehr vielleicht ein paar mehr, beim Schwäbischen Albverein vielleicht 20 von 500, aber das ist wahrscheinlich nicht typisch Neuhausen.“125 Dass solche vereinsgebundenen Netzwerke von außenstehenden Betrachtern mitunter als ‚geschlossene‘, familienähnliche Gebilde wahrgenommen werden, schilderten mir mehrere Gesprächspartner, die schon lange im Ort wohnen, sich aber dennoch nicht richtig zugehörig fühlen, wie folgendes Beispiel zeigt: „Also ich kenne das ja schon aus meiner Kindheit und es hat sich großartig nichts geändert. Ich empfinde das immer noch so, dass sich die alteingesessenen Neuhauser so ein bisschen als Elite fühlen und alles, was dazu gezogen ist, das bleibt so außen vor. Ich habe auch immer noch das Gefühl, dass in den Vereinen die Leute bevorzugt werden, die schon immer im Ort waren, die man kennt, klar rutscht man auch irgendwo rein, aber man bleibt doch immer ein Außenseiter und außen vor, weil diese alten Strukturen, die herrschen immer noch vor und das ist weitergegangen über die Eltern, die Kinder zu den Enkeln und das ist erhalten geblieben, die helfen sich immer noch untereinander. Und selbst wenn man reinkommt und auch hilft, dann kriegt man meistens keine Gegenleistung. Oder man ist dann so eng eingestrickt, dass es schon wieder ein familienähnliches Gebilde ist, dass man halt ständig zusammenhockt.“126 Wie schwer es sein kann, sich in solche familienähnlichen sozialen Gebilde einzugliedern, schildern einige jene Gesprächspartner, die keine lineare Ortsbiographie haben, sondern über längere Zeit an anderen Orten berufstätig waren und später nach Neuhausen ob Eck zurückgekehrt sind. Diese Personen äußerten mir gegenüber auch, dass die Zugehörigkeit zu einem Verein keine Selbstverständlichkeit ist, weil man in Interview mit Frau Sn. am 15.05.2013. Interview mit Herrn Fm. am 06.06.2013. 126 Interview mit Frau Wn. am 12.07.2013. 124 125 48 unvertrauten sozialen Kontexten eben ‚fremdelt‘ und sich womöglich lange nicht aufgehoben fühlt. Solche Erfahrungen ermöglichen auch einen Perspektivenwechsel hinsichtlich der zugezogenen Russlanddeutschen: „Also ich stelle es mir schon schwierig vor, sich so in eine Dorfgemeinschaft hinein zu integrieren, also gerade, wenn man Migrant ist, aber auch andere Zugezogene. Wenn man neu in eine Ortschaft zieht, darf man grundsätzlich auch keine Hemmungen haben. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich war mal ein Jahr in Stuttgart und habe es auch versucht und bin in einen Musikverein gegangen und ich bin jetzt nicht so eine, die da kontaktscheu ist und nicht weiß, was zu reden ist, also ich bin nicht zurechtgekommen und habe die Flinte dann auch recht schnell ins Korn geworfen. Es war so mein Gefühl, dass ich da nicht dazugehört habe. Das ist nicht meine Gemeinschaft, ‚die kommt nicht von hier, die kennen wir nicht‘, also so hat sich‘s für mich angefühlt.“127 10.2 Migranten in Vereinen Fragt man nach der migrantischen Beteiligung in den Vereinen der Gemeinde Neuhausen ob Eck, so fällt auf, dass es nur äußerst wenige Migranten gibt, die sich in diesen traditionalen dorfgemeinschaftlichen Strukturen engagieren. Zu den alteingesessenen Vereinen mit einer über hundertjährigen Tradition zählt beispielsweise die Musikkapelle, die seit kurzem erstmals in ihrer Vereinsgeschichte von einer Frau geleitet wird.128 Bis auf ein einziges Vorstandsmitglied mit vietnamesischer Herkunft gibt es unter den ca. 100 Mitgliedern im Hauptorchester und in der Jugendkapelle keine Person mit Migrationshintergrund; alle Mitglieder stammen aus „gut bürgerlichen Mittelschichten“, so die Vereinsvorsitzende.129 Ansonsten sind weder im Heimatverein, noch im Motoradclub oder im Gesangverein Mitglieder mit Migrationshintergrund vertreten; eine Ausnahme stellt der Harmonikaclub dar, in dem sich eine russlanddeutsche Familie mit Großvater und Enkelkindern engagiert. Im Sportverein, der mit ca. 700 Mitgliedern der größte Verein in Neuhausen ist, zählt der Vereinsvorsitzende drei oder vier Spieler mit russlanddeutschem Hintergrund auf.130 Im Unterschied dazu sind auch in der Freiwilligen Feuerwehr mit ca. 100 Mitgliedern und der Jugendfeuerwehr (inzwischen) keine migrantischen Mitglieder vertreten. In der letztgenannten Organisation hatten sich zwischenzeitlich zwei Russlanddeutsche engagiert, aber dann habe es Interview mit Frau Ak. am 03.06.2013. Bis 1975 waren Frauen von der Mitgliedschaft in der „Musikkapelle“ ausgeschlossen. 129 Interview mit der Vorsitzenden der Musikkapelle am 03.06.2013. 130 Interview mit dem Vorsitzenden des Turn- und Sportvereins am 02.05.2013. 127 128 49 doch „irgendwie nicht funktioniert“, was möglicherweise an den vergleichsweise strengen Regeln der Feuerwehr gelegen habe, so der Kommandant: „Das Problem ist, wenn ich in einem Verein drin bin, dann muss ich mich auch damit identifizieren. Ich weiß nicht, wo der Trend zurzeit hinläuft, die Leute wollen einfach freier sein, wollen sich nicht mehr binden. Man muss das Pflichtbewusste halt auch wollen und bei der Feuerwehr ist das schon ein bisschen strenger.“ 131 In einem anderen großen Verein, dem Schwäbischen Albverein, der eine Vielzahl „offener Gruppen“132 anbietet, wird die Durchmischung von Alteingesessenen und Zugezogenen mit und ohne Migrationshintergrund jedoch längst für selbstverständlich gehalten, wie einer der beiden Vorsitzenden erläutert: „Vom Gefühl her würde ich sagen, Zugezogene mit und ohne Migrationshintergrund sind‘s beim Albverein garantiert vierzig Prozent. Wir hatten das Thema nämlich schon und da geht’s dann wirklich kontrovers zu und da hab‘ ich gesagt: ‚Jetzt überlegt mal, allein bei uns, was das für Leute sind, die teilweise Migrationshintergrund haben und Zugezogene, man weiß es teilweise gar nicht mehr.‘ (…) Wenn‘s aber mehr um die Perspektive geht, was jetzt auch die Gemeinde möchte, dass man die Leute mehr integriert, dann ist es vielleicht gut, dass es einem bewusst ist, dass man die Leute schon hat und dass es irgendwann zur Normalität gehört und wo man jetzt nicht diese Hemmungen und diese Abwehrhaltung braucht.“133 Mit dem Wort Abwehrhaltung wurde hier auf die massiven Proteste gegen eine interkulturelle Initiative der Albvereinsortsgruppe verwiesen, die von einem alteingesessenen Mitglied angeregt worden war. Da es sich bei diesen Protesten um einen einschlägigen Fall eines interkulturellen Konflikts im Vereinszusammenhang handelt, möchte ich nun etwas ausführlicher darauf eingehen. Auslöser des Streitfalls war ein zweisprachiges, auch auf Kyrillisch verfasstes Einladungsschreiben für eine Kindertanzgruppe des Albvereins, das im Gemeindeblatt abgedruckt worden war, um nicht nur mehr Migrantenkinder, sondern auch deren Interview mit dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr am 04.06.2013. Rettungsdienste wie die Freiwilligen Feuerwehr „wirken für Außenstehende oftmals als nach außen abgeschottete Gruppierungen, wo sich die Mitglieder schon lange kennen und aus demselben Milieu stammen. Es erscheint schwierig, als Neuankömmling dort einen Platz zu finden“. (Projektgruppe des Ludwig-UhlandInstituts: Meier. Müller. Shahadat. Migranten bei der Feuerwehr und dem Roten Kreuz. Tübingen 2011, S. 119). 132 Der Schwäbische Albverein ist längt kein klassischer Wanderverein mehr, sondern bietet in Neuhausen ob Eck eine Vielzahl von sportlichen Aktivitäten an, darunter Skikurse, Laufgruppen, Hochgebirgsklettern und Inlinescating. 133 Die folgenden Zitate stammen aus dem Interview mit einem der beiden Vorsitzenden des Schwäbischen Albvereins (Ortsgruppe Neuhausen ob Eck) am 06.05.2013. 131 50 Eltern besser zu erreichen.134 Der Abdruck löste eine für den Vereinsvorsitzenden unerwartete Welle des Protestes aus, im Zuge dessen nicht nur Vereinsmitglieder mit ihrem Austritt drohten, sondern sich auch aufgebrachte Bürger bei der Gemeindeleitung beschwerten. „Da kamen dann die Aussagen, ‚wieso russisch? Das ist ein deutsches kommunales Blatt und was schreiben wir das dann in russisch? Die sollen deutsch lernen!‘, so kolportiert der Vereinsvorsitzende den Widerstand aus den eigenen Reihen des Vereins. „Und dann kam von uns wieder die Begründung: ‚Das ist klar, die Kinder können deutsch, aber wir möchten doch auch die Eltern und Großeltern erreichen, die eben manchmal noch nicht so perfekt deutsch können, das ist das eine. Und das zweite ist, wenn unsereins jetzt im Ausland wäre und da würde etwas auf deutsch gedruckt, da würdet ihr doch auch denken, das ist ein netter Zug, das in unserer Sprache zu machen. Das ist doch eine bestimmte Wertschätzung den Leuten gegenüber und das wollten wir ausdrücken, damit die es wieder leichter haben mit dieser Hemmschwelle, in einen deutschen Verein reinzugehen.“ Zwar hätten sich die Gegner nicht überzeugen lassen, doch hatte die interkulturelle Initiative insofern Erfolg, als die Kindertanzgruppe durch die hinzugekommenen Kinder mit Migrationshintergrund deutlich gewachsen sei. Der Fall ist interessant und aussagekräftig, da sich hier zwei konträre Positionen gegenüberstehen: Auf der Seite der Gegner der Zweisprachigkeit wird mit einer absoluten Assimilationsnorm argumentiert, der zufolge sich Migranten im Zielland anzupassen haben. Die Befürworter der Zweisprachigkeit berücksichtigen Hürden und Hemmschwellen, die aus der spezifischen Migrationssituation resultieren; sie sind nicht der Ansicht, dass es die alleinige Aufgabe der Russlanddeutschen ist, sich als Zugezogene um Kontakt zu bemühen und auf Einheimische zuzugehen. Vielmehr müsse man ihnen mit einem wertschätzenden Angebot entgegenkommen, also selbst aktiv werden, um mehr Migranten für den Verein zu gewinnen. Wie sieht es aus der Binnenperspektive der Migranten selbst aus? Welche Hindernisse formulieren sie, und welche Gründe führen sie gegen den Beitritt zu einem Verein an? Diejenigen Migranten, die ich dazu befragt habe, hatten unterschiedliche Positionen zu diesen Fragen. Es gab einige Personen, die Sprachbarrieren als hauptsächlichen Grund angaben, sich keinem Verein anzuschließen: „Allgemein, man fühlt sich nicht frei, man muss gucken, wie man das sagt und so, etwas verklemmt. Wenn man sich kennt, mit den Nachbarn ist das kein Problem, aber mit fremden Leuten ist es 134 Die Leiterin der Kindertanzgruppe ist ukrainischer Herkunft. 51 schwer.“135 Ein anderes Beispiel: „Ich fühle mich halt schon unsicher, so mit der Sprache, auch wenn ich ganz gut schon Deutsch kann, aber dann in so einem Verein, da fühlt man sich dann doch wieder fremd, nicht so leicht, man kann dann keine Witze machen oder so, das ist dann da ernst.“136 Andere Gesprächspartner äußerten, über die Angebote der Vereine nicht hinreichend informiert zu sein, weil sie das kommunale Mitteilungsblatt nicht lesen. Wieder andere betonten, dass ihre Kinder bereits im Verein seien, während sie selbst aufgrund großer Arbeitsbelastungen keine Zeit dafür hätten: „Wir arbeiten beide im Schichtdienst, ich komme oft abends ganz spät nach Hause und dann ist da noch der Haushalt und das Enkelkind und dann bin ich viel zu kaputt, um mich da noch irgendwo zu engagieren.“137 Und schließlich erklärten mir wieder andere, dass sie auch in Russland in keinem Verein aktiv gewesen waren. Warum sollten sie dies also in Deutschland tun? Bei der letztgenannten Aussage spielt die Vorstellung, dass Vereine eine typisch deutsche Form der Geselligkeit ist, die man in Russland nicht kennt, eine wichtige Rolle: „Wir kommen aus Kirgisien aus einer großen Stadt und da sind wir das jetzt nicht so gewöhnt, auf dem Dorf in so eine Gruppe zu gehen, die Einheimischen kennen sich dann alle untereinander und da würde ich mich komisch fühlen.“138 Herr As. ist einer der wenigen Migranten, der sich mit seinen Familienmitgliedern in einem der musischen Vereine engagiert. Dass es dazu kam, hat mit seiner beruflichen Herkunft zu tun, denn er war in Russland als Musiklehrer tätig. Er argumentiert, dass es bei Migranten einfach Zeit brauche, bis sie sich so heimisch fühlen, dass eine Vereinsmitgliedschaft vorstellbar wird: „Wir waren auch nicht gleich in einem Verein, das hat Jahre gedauert. Zuerst kam die Sprache, dann die Arbeit, dann das Haus, das war das Wichtigste.“ Außerdem habe sein Engagement in einem Verein mit sozialer Anerkennung zu tun: „Man kennt uns hier, wir sind im Verein und die Enkelkinder. Wir fühlen uns heimatlich, wir fühlen uns anerkannt im Dorf, aber das braucht seine Zeit.“139 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es auf Seiten der Migranten besondere Hindernisse für einen Betritt zu einem Verein oder für ein ehrenamtliches Engagement gibt. Mangelnde Deutschkenntnisse können ein Grund dafür sein. Doch fehlendes Engagement in Vereinen kann bei Migranten auch dieselben Gründe haben wie bei (anderen) Deutschen: anders gelagerte Freizeitinteressen, berufliche Auslastung Interview mit Frau und Herrn Em. am 27.06.2013. Interview mit Frau und Herrn Om. am 04.07.2013. 137 Interview mit Frau Dl. am 05.06.2013. 138 Interview mit Frau und Herrn Om. am 04.07.2013. 139 Interview mit Frau und Herrn As. am 09.07.2013. 135 136 52 oder eine emotionale Distanz zu festen Gruppenverbänden mit eigenen Regeln und kulturellen Codes, die einem nicht vertraut sind. Wie brachte es ein alteingesessener Gesprächspartner auf den Punkt: „Was erwarten wir denn von den Russlanddeutschen, dass die hier in die Vereine gehen, das machen doch ganz viele von uns auch nicht!“140 11. Die Sternhäuser – ein „sozialer Brennpunkt“? Wer sich als Ortsfremder dem Dorf Neuhausen ob Eck von östlicher Seite her nähert, dem fallen die fünf mehrstöckigen „Sternhäuser“ auf, die aus der ansonsten durch Einfamilienhäuser geprägten Siedlungsstruktur des Neubaugebiets herausragen.141 So unbelebt die großzügige Grünfläche zwischen den Mietshäusern an manchen Tagen erscheinen mag, so lebendig wird sie an wärmeren Tagen, wenn zahlreiche Kinder unterschiedlichster Altersgruppen dort spielen. Ältere Mädchen passen auf ihre jüngeren Geschwister auf und schlichten Streit in der Gruppe. Eines dieser Mädchen, die sich als Polin bezeichnet, erzählt mir stolz, dass sie ab nächstes Jahr ein bilinguales Gymnasium in der nahe gelegenen Kreisstadt besuchen wird. Ihre Freundinnen in der Nachbarschaft seien überwiegend russische Mädchen aus Familien, die alle miteinander verwandt seien. An einigen Tagen konnte ich beobachten, dass mehr als ein Dutzend Kinder auf der Grünfläche spielten. Ab und an kamen ältere Bewohner dazu, ließen sich auf den Bänken am Spielplatz der Wohnanlage nieder und man kam leicht ins Gespräch.142 Die Erwachsenen würden alle ein Auge auf den Spielplatz haben und aufpassen, dass die kleineren Kindern nicht von Jugendlichen geärgert würden, so erklärte mir eine Frau im Rentenalter. Sie gehört zu der Gruppe russlanddeutscher Bewohner, die vor rund 20 Jahren mit ihren Familien direkt aus Kasachstan nach Neuhausen ob Eck in die Wohnanlage gezogen waren. Damals sei das Quartier noch schön und gepflegt gewesen, sagt sie, und der soziale Zusammenhalt habe gut funktioniert; so habe man mit den Nachbarn oft gemeinsam gegrillt, die „alles gute Leute“ gewesen seien.143 Interview mit Herrn Ma. am 07.05.2013. Unter den heutigen Bewohnern haben 70 bis 80 Prozent einen Migrationshintergrund (kasachisch, kirgisisch, russisch, polnisch, kroatisch, serbisch, türkisch und albanisch); vgl. Informationen zur Mieterstruktur aus einem Gespräch mit dem Mitarbeiter der Tuttlinger Wohnbau. 142 Im Rahmen meiner teilnehmenden Beobachtung auf dem Grünflächengelände kam ich mit Kindern und erwachsenen Mietern ins Gespräch. Ausführliche Interviews, die teils in den Wohnungen von Mietern und in einem Fall am Arbeitsplatz eines Mieters durchgeführt wurden, habe ich mit insgesamt acht Personen geführt, darunter waren überwiegend Russlanddeutsche. 143 Informelles Gespräch mit einer Mieterin am 12.06.2013. 140 141 53 Inzwischen gilt der Gebäudekomplex des sozialen Wohnungsbaus jedoch als „sozialer Brennpunkt“, wie es in der nachfolgend zitierten offiziellen Beschreibung im kommunalen Amtsblatt heißt: „Die auffälligsten Immobilien sind die Mehrfamilienhäuser („Hochhäuser“) in der Dorner- und Homburgstraße. Nach Abzug der Bundeswehr 1994 hat sich die Mieterstruktur – insbesondere in den Mehrfamilienhäusern – stark verändert. (…) Mittlerweile wohnen in diesen Wohnungen aber oftmals Personen mit sozialen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die Mehrzahl der Wohnungen wird überwiegend von Migranten, Alleinerziehenden und älteren Ehepaaren (oftmals auch mit Migrationshintergrund) bewohnt. Vor diesem Hintergrund hat sich dort – leider – ein für unsere ansonsten sehr dörflich strukturierte Gemeinde fühlbarer sozialer Brennpunkt entwickelt. Die Polizei wird immer wieder zu Sicherheitsstörungen und zu Sozialeinsätzen gerufen, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung wiederherzustellen.“144 Wirft man einen Blick auf die Berichterstattung in den Medien, so wird darin ein ähnliches Bild eines sozial benachteiligten Wohngebietes gezeichnet, wenn beispielsweise in der Lokalzeitung von einem „sozialen Brennpunkt mit 150 Hartz-IV-Empfängern“ die Rede ist, die in den Hochhäusern leben würden.145 Hinzu kam eine mediale Skandalisierung des Wohngebietes, nachdem bekannt wurde, dass es allein im Jahr 2011 angeblich 35 Fälle von „Inobhutnahmen“ von Kindern gegeben hatte, die aus ihren Familien genommen werden mussten.146 Diese Stigmatisierung des sozialen Raumes hat Einfluss auf den öffentlichen Diskurs in der Gemeinde und beschränkt sich nicht nur auf die Wohnanlage selbst, sondern hat sich in der Wahrnehmung Außenstehender mitunter auf die gesamten Neubaugebiete übertragen. „Das ist in Neuhausen wohl schon so, dass man da wegen dieser Hochhäuser gar nicht gerne hinzieht, hab ich schon oft gehört,“ so schilderte mir ein Zugezogener. Das schlechte Image des Wohnquartiers 144 Aus: „donnerstags“ – Amtsblatt der Gemeinde vom 3. Mai 2012. Die „Tuttlinger Wohnbau“ besitzt in Neuhausen ob Eck mehr als 100 Wohnungen und ist Eigentümerin der fünf Hochhäuser mit rund 60 Wohneinheiten und mehrerer Mehrfamilienhäuser in der Schwandorfer Straße. 145 Gränzbote vom 30.06.2012. Diese Zahlen stimmen mit der amtlichen Statistik nicht überein. Im März 2012 wurden in ganz Neuhausen mit Eingemeindungen 56 sog. Bedarfsgemeinschaften registriert; im Juni 2013 waren es noch 53 Bedarfsgemeinschaften. Davon entfielen auf die Straßen mit den Hochhaussiedlungen insgesamt zwei und auf die Schwandorfer Straße mit den Mehrfamilienhäusern insgesamt vier Bedarfsgemeinschaften (Quelle: Statistik des Sozialamtsleiters, Landratsamt Tuttlingen vom 17.06.2013.) 146 Vgl. Gränzbote vom 22.06.2013. Auch diese Zahl stimmt mit der amtlichen Statistik nicht überein; demnach hat es in Neuhausen im Zeitraum von 01.01.2011-30.06.2012 insgesamt sechs Inobhutnahmen von Kindern gegeben, eine Zahl, die verglichen mit anderen Gemeinden im Landkreis nicht außergewöhnlich hoch sei, so der Leiter des Sozialdezernats (Quelle: Email vom 04.06.2013 des Leiters des Sozialdezernats, Landratsamt Tuttlingen und Abschlussbericht „Projektgruppe Kindeswohlgefährdung“ am 13.02.2013). 54 habe sogar auf große Teile der Ortschaft ausgestrahlt.147 So hält sich hartnäckig das Gerücht, die Stadt Tuttlingen bzw. die dort angesiedelte Wohnbaugesellschaft würde sozial benachteiligte Mieter in die Mietshäuser nach Neuhausen ob Eck „abschieben“, weil der Wohnraum dort besonders billig sei.148 Selbst aus den Nachbargemeinden kommen Stimmen, die das negative Außenbild weitertragen: „Eigentlich nehme ich die Hochhäuser als Ghetto wahr, also in gewisser Weise ein Stigma, dass man damit nicht wirklich was zu tun haben will und sich auch nicht sonderlich interessiert, wer da wohnt.“149 Stattdessen würden wilde Gerüchte über „die in den Häusern“ kursieren, so berichtete mir der Jugendreferent der Gemeinde, der im Jahr 2005 ein Begegnungsfest beim Hochhausgelände initiiert hatte: „Man hört immer nur Sachen über die Leute, aber eigentlich kennt man niemanden von dort. Die Einheimischen laufen nicht durch die Hochhäuser.“ Er selbst habe dort mal einen Reifenwechsel machen lassen, aber das sei „schon verdächtig gewesen, wenn man mit jemandem von denen Kontakt hat,“ so kritisiert er das vorurteilsbeladende Bild, das über die Quartiersbewohner im Dorf entstanden sei.150 Auch die Schulsozialarbeiterin, die einzelne Kinder aus den Hochhäusern besonders betreut, merkt an, dass es sich bei diesem Wohnareal um einen vom Rest des Dorfes segregierten Raum mit eigenen sozialen Regeln und Umgangsformen handele: „Ich finde, das ist so eine andere Welt da unten. Das ist weg vom typischen Dorfleben, das ja auch schön ist, hin zu ganz eigenen Strukturen (…) Da unten ist vieles schon geprägt von sozialen Problemen und ich denke, diese Probleme spiegeln sich ja auch irgendwie im Umgang miteinander wieder. Ich finde, es gibt schon sehr viele Einzelkämpfer da unten auf einem Haufen. Also im alten Dorf ist mehr Gemeinschaft, und da unten löst sie sich auf. So ist es auch bei den Kindern, die Freundschaften von den Ureinwohnern sind ganz anders, stabiler als die Kindercliquen zwischen den Kindern im Hochhausviertel, so ist mein Eindruck.“151 In dieser Perspektive der Sozialarbeiterin löst sich jede Form von Gemeinschaftlichkeit bereits bei den Kindern, die in den Wohnblöcken leben, unter dem Druck gehäufter sozialer Problemlagen auf. Sie beschreibt eine Zur Stigmatisierung von Wohngebieten als „soziale Brennpunkte“, siehe Jens Adam: Kaum noch normale Berliner. Stadtethnologische Erkundungen in einem „sozialen Problemquartier“, hrsg. Vom Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität zu Berlin, Band 8. Münster 2005. 148 Diese Mutmaßung, die ich von einigen Gesprächspartnern gehört habe, wurde weder vom Leiter des Sozialamtes (vgl. Expertengespräch am 03.06.2013 im Landratsamt Tuttlingen) noch vom Geschäftsführer der Tuttlinger Wohnbau (Experteninterview am 15.05.2013) bestätigt. 149 Interview mit der Ortsvorsteherin von Worndorf am 10.07.2013. 150 Informelles Gespräch mit dem Jugendreferenten am 07.06.2013. 151 Interview mit der Schulsozialarbeiterin am 07.05.2013. 147 55 strukturelle Trennung zwischen Kindern und Jugendlichen, die in die dörflichen Rituale eingebunden sind und denjenigen, die daran nicht teilhaben oder davon ausgeschlossen sind: „Stigmatisierung ist immer wieder ein Thema, auch bei den Kindern untereinander. Ich denke, es gibt hier Familien, die sind hier total verwurzelt und sind auch total präsent in der Gemeinde und leben hier richtig und dann gibt’s Familien, wo die Kinder mit dem Dorf nichts zu tun haben. Und das fängt ja schon in der Schule an, wo sich die Kinder zusammentun, die beim Maibaumaufstellen dabei sind und andere, die damit nichts zu tun haben. Oft sind das dann die Kinder, die aus den Hochhäusern kommen.“ In meinen Interviews war immer wieder die Rede von einer starken sozialen Segregation zwischen den unterschiedlich geprägten Lebenswelten im Kerndorf und dem Hochhausquartier, die von meinen Gesprächspartnern in mitunter eindrückliche Bilder eines gegenseitigen Befremdens gefasst wird: „Also da gibt es wenig Kontakt. Mir ist das erst vor zwei oder drei Wochen wieder aufgefallen. Da gab‘s vom Albverein den Tag des Baumes (weltweit) und wir hatten genau an der Straße nach Worndorf (an den Hochhäusern) einen Baum gepflanzt, da waren ungefähr 30 Leute da für diese Aktion mit Kindern und allem. Und dann sind in diesem Hochhaus wirklich die Balkontüren aufgegangen und die Leute haben auf uns gestarrt wie im Zoo, ja wirklich, das war so! Die denken, ‚was machen die denn da?‘ Das war wirklich so eine Atmosphäre, das ist genau das: es gibt nur Blicke, aber es gibt keine Verbindung. Die schaffen‘s nicht auf uns zuzugehen und umgekehrt genauso.“152 Selbst bei ritualisierten Anlässen im öffentlichen Raum scheinen Kontakte zwischen Hochhausbewohnern und in den Vereinen engagierten Neuhausern kaum zustande zu kommen. 11.2 Binnensichten der Bewohner Die Stigmatisierung des Wohngebiets als „Ghetto“ oder „sozialer Brennpunkt“ ist eine von außen an das Quartier herangetragene Vorstellung, die von den Bewohnern auf unterschiedliche Weise rezipiert wird. Im Folgenden soll diesen Alltagswahrnehmungen aus der Binnenperspektive der Bewohner nachgegangen werden: Wie erleben sie ihr Wohnumfeld? Welche Form von Ortsbezogenheit bindet sie an den Raum? Ist die Stigmatisierung aus der Innensicht überhaupt bedeutsam? Welches sind Konfliktpunkte und soziale Spannungen im nachbarschaftlichen Zusammenleben? Und schließlich: Gibt es tatsächlich keine nahräumliche Gemeinschaftsbildung? 152 Interview mit dem Vorsitzenden des Schwäbischen Albvereines (Ortsgruppe) am 06.05.2013. 56 Ein Teil meiner Gesprächspartner verbindet mit der Wohnanlage eine insgesamt positive Ortsbezogenheit, darunter Familien mit kleinen Kindern, bei denen beide Elternteile einer geregelten Arbeit nachgehen. Von einer erzwungenen Mobilität, nach Neuhausen nur wegen des preiswerten Wohnraums zu ziehen, kann bei diesen Bewohnern keine Rede sein: „Wir wollten mit unseren Kindern ins Grüne ziehen und dann ist es schön für die Kinder hier. Man kann sie unbeaufsichtigt draußen lassen und sie kommen mit anderen Kindern in Kontakt, das finde ich toll hier, wie die Kinder mit unterschiedlicher Herkunft miteinander spielen.“153 Dass die Wohnanlage ein ‚sozialer Brennpunkt‘ sein soll, weisen diese Gesprächspartner nicht zuletzt mit dem Argument zurück, dass viele Bewohner erwerbstätig seien: „Ich war am Anfang verblüfft, dass sehr viele arbeiten gehen, wo man eigentlich denken muss, dass doch viele Migranten hier leben und von Hartz IV oder was auch immer, aber man sieht schon unter der Woche, dass hier keine Autos rumstehen, die meisten gehen arbeiten.“154 Frau Rb. gehört zu denjenigen Bewohnern der Wohnanlage, die kaum engere Kontakte im Wohngebiet haben und sich bei Nachbarschaftskonflikten in ihre ‚vier Wände‘ zurückziehen. Dass viele Migranten und einige Hartz-IV-Empfänger in den Hochhäusern leben, stellt für sie kein Problem dar: „Also dass das jetzt ein benachteiligtes Gebiet sein soll, ich weiß nicht, also ich würde das jetzt nicht auf das Viertel hier beziehen. Ich kann mir vorstellen, das ist das einzige Viertel, das so viele Wohnungen hat und auch so viele Menschen aufeinander. Es ist ja ganz anders als im Dorf, also da wohnen einfach ganz viele Familien miteinander, und umso mehr Vorfälle und Auseinandersetzungen gibt es, aber das ist halt in Mietshäusern so.“155 Frau Rb. verteidigt das Wohngebiet als „ein ganz normales Viertel“, wobei es für sie dennoch eine Übergangslösung sei, da sie mit ihrer Familie bald in ein eigenes Haus im Ortskern ziehen will, das seit einigen Jahren renoviert wird. Andere Bewohner der Wohnanlage haben bereits über Jahrzehnte eine positive Ortsbindung entwickelt, wie etwa der ehemalige Bundeswehrangehörige mit seiner Frau, für die Neuhausen aufgrund der zentralen Lage „der schönste Ort in Deutschland“ ist.156 Anders als Frau Rb. nimmt er durchaus Konflikte in den Hochhäusern wahr, die er jedoch weder mit der ‚ethnischen Mischung‘ der Bewohnerschaft begründet, noch aus dem hohen Anteil von Migranten insgesamt. Für ihn wie für einige andere meiner Interview mit Frau Ve. am 12.06.2013. Interview mit Frau Rb. am 14.06.2013. 155 Ebd. 156 Interview mit Herrn Fd. am 20.06.2013. 153 154 57 Gesprächspartner ist das Wohngebiet dennoch ein „sozial belasteter Ort“, weil es immer wieder zu nachbarschaftlichen Spannungen um Ordnung, Sauberkeit und Lärm kommt. Herr Ol., kroatischer Herkunft und Inhaber einer kleinen Firma im Gewerbegebiet, ist einer der wenigen, der die Wohnanlage aus diesem Grund schnellstmöglich verlassen möchte und das negative Bild aus einer Innensicht bestätigt: „Es ist zu einem ‚Ghetto‘ verkommen, zu einem Slum. Es kam schleichend, die guten Leute sind abgewandert, weil sie gebaut haben. Ich wäre auch längst weg, aber dadurch, dass ich Kinder aus der ersten Ehe habe, die ich zahlen muss (…), trotzdem, ich komme da früher oder später weg.“157 Bei Bewohnern wie Herrn Ol. ist der Ortsbezug überwiegend vom Gefühl geprägt, an einem Ort zurückbleiben zu müssen, den andere, sozial besser situierte Bewohner längst verlassen haben. Einige Bewohner der Wohnanlage äußern ein Gefühl der sozialen Benachteiligung und verweisen darauf, dass selbst ortsansässige Handwerker für Reparaturdienste nicht mehr in die Hochhäuser kommen wollten. Zu dieser Bewohnergruppe gehört Frau Ge., eine alleinerziehende Mutter, die vor einigen Jahren aus einer Nachbargemeinde in die Wohnblöcke gezogen war und sich seither dort ausgegrenzt fühlt: „Wenn im Dorf jemand fragt, wo man wohnt, dann sagt man schon selber: ‚Ich komm‘ aus den Häusern‘, da hat man schon einen eigenen Begriff dazu.“158 Besonders schlimm sei es gewesen, als ein privater Radiosender vor einiger Zeit eine Reportage in den Hochhäusern produziert hatte, weil es damals hieß, „in den Häusern“ seien so viele Kinder aus ihren Familien genommen worden: „Das hat mich besonders wütend gemacht, man wird schnell als asozial abgestempelt. Es sitzt auch bei mir im Hinterkopf, wenn ich irgendwo auf ein Amt gehe oder ins Jugendamt, da heißt es dann, ich wohne nicht da, wo man die Kinder so versorgt, wie es sein müsste.“159 Doch einige Mütter unter den Mieterinnen wägen die negativen Aspekte, in einem sprichwörtlichen ‚Problemviertel‘ zu wohnen, gegen die Vorteile ab, denn oftmals hilft ein Großelternteil, das im Nachbarblock oder im selben Haus wohnt, bei der Versorgung und Beaufsichtigung der Kinder. An solchen Beispielen zeigt sich, dass der Nahraum nicht nur als sozial belastet wahrgenommen wird, sondern auch wichtige familiäre Unterstützungsstrukturen gewährleistet. Derartige Funktionen erfüllen auch die sozialen Netzwerke unter den russlanddeutschen Bewohnern, die zumindest in einem der Interview mit Herrn Ol. am 11.06.2013. Interview mit Frau Ge. am 12.06.2013. 159 Ebd. 157 158 58 Wohnblocks darum bemüht sind, dass dort verwandte Familien einziehen, um die soziale Stabilität der Hausgemeinschaft aufrecht zu erhalten. Zu diesen Bewohnerinnen gehört Frauen wie Frau Pm., die sich auch vehement gegen das negative Bild des Wohnviertels wehrt, wenn sie sagt: „Das ist ein guter Ort zum Leben, ruhig und schöne Wohnungen! Wir haben Glück gehabt, als wir vor 16 Jahren hier hergekommen sind. Mein Mann hat gleich eine gute Arbeit gefunden (…). Wir tun hier schon selber was, damit die Hochhäuser nicht runterkommen.“160 Dazu gehören kleine Formen des nachbarschaftlichen Engagements wie etwa die Kehrwoche für einen ganzen Häuserblock zu übernehmen oder in gemeinschaftlicher Aktion Blumenbeete am Hauseingang anzulegen. Doch auch Konflikte und soziale Spannungen werden immer wieder benannt, wobei es vor allem um die Einhaltung einer bestimmten ‚kulturellen Ordnung‘ geht, nämlich des Kehrwochenprinzips, die in einigen Mietshäusern nicht funktioniert.161 An zweiter Stelle werden als Streitpunkte wiederkehrende Lärmbelastungen genannt, die in baulicher Hinsicht mit der Hellhörigkeit der Mietshäuser zu tun haben. 11.2 Ortsbindungen stärken Einige Bewohner, die sich gegen das negative Image des Wohnquartiers wehren, formulieren auch Handlungsforderungen ‚nach außen‘, sprich an die Wohnungsgesellschaft. So wird der Wunsch geäußert, dass verstärkt auf die Einhaltung der Hausordnung gedrängt wird, die Wohnungen innen saniert und die Grünflächen kindgerechter mit besseren Spielgeräten ausgestattet werden. Solche Vorschläge wurden von Gesprächspartnern gemacht, die darüber nachdachten, wie man langfristig versuchen könnte, eine positivere Identifikation der Bewohner mit der Wohnanlage zu erzeugen. Wie formulierte es eine Bewohnerin: „Die Wohnbau muss was machen, dann machen die Bewohner auch wieder selber was.“162 Mit diesem Hinweis auf Verbesserungsmaßnahmen, die mit dazu beitragen könnten, den Ortsbezug zu stärken, ohne bestimmte Bewohnerschichten aus den Hochhäusern zu verdrängen, ist freilich nicht gemeint, soziale Probleme zu übersehen oder zu verharmlosen. Vielmehr müssen jegliche Maßnahmen den wichtigen Umstand berücksichtigen, dass die Lebenswelten und Lebensstile in den Wohnblöcken weitaus Interview mit Frau Pm. am 12.06.2013. Die Kehrwoche gilt als typisch württembergische Erfindung; sie macht aus dem individuellen Fegen im Haus eine öffentliche soziale Verpflichtung, die über die Hausordnung in Mietshäusern ritualisiert geregelt wird. 162 Interview mit Frau Dl. am 05.06.2013. 160 161 59 differenzierter sind, als es die medialen oder offiziellen Beschreibungen des Wohngebietes als „sozial benachteiligtes Quartier“ vermuten lassen. Insgesamt lassen sich mehrere Punkte festhalten: Auch wenn es in einigen Häusern belastete Nachbarschaftsbeziehungen gibt, kann man im Blick auf das gesamte Wohnviertel keineswegs von durchweg „überforderten Nachbarschaften“163 sprechen. Vielmehr gibt es durchaus sehr stabile Nachbarschaften, in denen es regelmäßig zu freundlichen Alltagskontakten und gegenseitigen Hilfeleistungen kommt. Weiterhin kann festgestellt werden: Dass die Bewohner aus verschiedenen Ländern kommen oder selbst ethnische Unterschiede benennen, bedeutet nicht, dass sich dahinter automatisch und notwendigerweise ein Konfliktpotential verbirgt. Ferner erfüllt das Wohngebiet wichtige soziale Funktionen, z. B. familiäre Netzwerke, wo Großeltern gerade für berufstätige oder alleinerziehende Mütter eine notwendige Hilfe darstellen. Diese räumliche Nähe ist aber auch für diejenigen bedeutsam, die in den Neubaugebieten wohnen und sich im Hochhausquartier um Verwandte oder Eltern im gehobenen Alter kümmern. Zuletzt muss erwähnt werden, dass diese Wohngebiete besonders für junge Familien mit Kindern geeignet sind, weil man sich eine vergleichbare Wohnung in der Kreisstadt nicht leisten kann oder gerne mit der Familie im Grünen lebt. So ist das Hochhausareal keineswegs nur ein Sammelbecken für sozial benachteiligte Schichten, sondern ein in sich viel heterogener Sozialraum, als es der Außenblick vermuten lässt. An den Rändern von Neuhausen ob Eck wird die soziale und kulturelle Heterogenität des dörflichen Sozialgefüges sichtbar und wahrnehmbar. Doch genauso wie im Dorfkern gibt es im Hochhausgebiet soziale Bindekräfte, die in den Familien und kleinen nachbarschaftlichen Strukturen liegen. Hier organisieren sich Menschen in sozialen Netzwerken, auch wenn manche von ihnen dabei auf die Hilfe und Unterstützung von außen angewiesen sind. 163 Der Begriff der „überforderten Nachbarschaften“ stammt aus der Stadtsoziologie und bezeichnet sozial destabilisierte, häufig konfliktbelastete Wohnnachbarschaften in den Siedlungen des sozialen Wohnungsbaus. Vgl. Hartmut Häußermann / Andreas Kapphan: Berlin: Von der geteilten zur gespaltenen Stadt? Sozialräumlicher Wandel seit 1990. Opladen 2000. 60 III. Zusammenfassung A. Allgemeines Soziostrukturelle Ausgangssituation In den vergangenen Jahrzehnten hat die Gemeinde Neuhausen ob Eck mit rund 3.950 Bewohnern einen spürbaren Zuwachs von rund 600 Bewohnern erfahren. Im Zuge dieses Prozesses entstanden auch die Neubaugebiete ‚Im Morgen‘ mit neuen sozialen Schichten, Lebensstilen und Milieus, an denen sich heute eine Debatte über den sozialen Wandel der Ortschaft und seine Folgen für das lokale Gemeinwesen festmacht. Die Pluralisierung dörflicher Lebenswelten zeigt sich heutzutage unter anderem darin, dass Bewohner aus 47 verschiedenen Herkunftsländern in Neuhausen ob Eck leben, worunter (durch den verstärkten Zuzug von Spätaussiedlern Anfang der 1990er Jahre) Neubürger aus Kasachstan, Kirgisien und Russland, Ex-Jugoslawien, Polen und Rumänien sowie den Baltischen Staaten sind. Mitte der 1990er Jahren war der dörfliche Sozialraum zugleich vom Wegzug eines größeren Teils seiner Bewohnerschaft betroffen, als der Garnisionsstandort der Bundeswehr aufgelöst wurde. Seither hat die Gemeinde im Blick auf wirtschaftliche Prosperität, Arbeitsplätze und Gemeindewachstum (Bauland, Wohnraum etc.) eine sehr gute Entwicklung durchlaufen, infolge dessen auch Familien aus der näheren Region sowie aus den großstädtischen Ballungszentren Deutschlands zugezogen sind. Im Kontrast zu diesen positiven Faktoren der Gemeindeentwicklung stehen jedoch Problemlagen sozial benachteiligter Schichten sowie ein stigmatisierender Außenblick auf die Gemeinde als „Russenhochburg“. Auftrag und Durchführung der ethnographischen Studie Im März 2013 wurde ich von der Gemeindeleitung mit der Durchführung einer mehrwöchigen ethnologischen Gemeindestudie in Neuhausen ob Eck beauftragt. Der ethnologische Zugang basiert auf einem multiperspektivischen Forschungsansatz und fokussiert vor allem auf die Binnenperspektiven und das Sinnverstehen unterschiedlicher Lebenswelten und Milieus im dörflichen Sozialverbund. Dabei standen Fragen nach der Beziehung zwischen Alteingesessenen und Zugezogenen, Formen von Gemeinschaftlichkeit und bürgerschaftlichem Engagement sowie nach Prozessen der sozialen Ab- und Ausgrenzung im Mittelpunkt des Forschungsinteresses. Die Materialerhebung basierte neben Phasen teilnehmender Beobachtung vorwiegend auf qualitativen 61 Leitfadeninterviews mit unterschiedlichen Bewohnergruppen und Experten und wurde im Zeitraum von Anfang Mai bis Mitte Juli 2013 durchgeführt. B. Zum Verhältnis von Alteingesessenen und Zugezogenen im sozialen Raum Altes Dorf und neue Siedlungen Im Blick auf die sozialräumliche Segregation zwischen altem Dorf und neuen Siedlungen ist eines der wichtigsten Ziele der Gemeindeentwicklung aus der Sicht des Bürgermeisteramts, den sozialen Zusammenhalt im Dorf zu stärken, Alteingesessene und Zugezogene aller sozialer Schichten durch Dialog und Kommunikation stärker zusammenzubringen und auf diese Weise mehr Gemeinschaft, Solidarität und eine positive Ortsidentifikation zu erzeugen. Alteingesessene verweisen auf einen zunehmenden Prozess der Verstädterung, der an den Neubaugebieten festgemacht wird. Dem überschaubaren ‚alten Dorf‘ mit seinen typisch dörflichen Kommunikationsregeln steht ein Wohngebiet mit vermeintlich anonymen, individualisierten Nachbarschaften gegenüber, das von den sozialen Kreisen des Kerndorfes weitgehend abgekoppelt erscheint, und wo man die zugezogenen „Fremden“ nicht mehr kennt. Diese scheinbar nur wenig durchlässige soziale Grenzziehung zwischen Alteingesessenen und Neuzugezogenen kehrt auch im negativ konnotierten Bild der Neubaugebiete als „Ghetto“ wieder. Gegen diesen Außenblick wehren sich dort wohnende Zugezogene (mit und ohne Migrationshintergrund), indem sie auf gut funktionierende, vertrauensvolle Nachbarschaftsbeziehungen verweisen, die gute Wohnqualität betonen und die multi-ethnische Zusammensetzung der Bewohner mit vielen jüngeren Familien als einen positiv zu bewertenden Faktor hervorheben. Wahrnehmungsmuster von Alteingesessenen Fragt man Alteingesessene nach der Beziehung zu den nach Neuhausen ob Eck zugezogenen russlanddeutschen Aussiedlern, so lauten die Antworten in der Regel, dass man nichts miteinander zu tun habe, kaum etwas über deren Lebenswelt wisse, und es im Dorf keine Begegnungsräume gebe, wo man in persönlichen Kontakt kommen könnte. Umso ausgeprägter ist die Wahrnehmung, dass die Russlanddeutschen unter sich blieben, sich am Dorfgeschehen nicht beteiligen und von öffentlichen Festen und Veranstaltungen fernhalten würden. Als Schlüsselsymbol für diese soziale Segregation gilt ein interkulturelles Begegnungsfest, das vor einigen Jahren in der Grünanlage der „Stern- 62 häuser“ stattgefunden hatte; auch dort seien Alteingesessene und Zugezogene jeweils unter sich geblieben. Soziale Segregationsprozesse wurden aber auch in der evangelischen Kirchengemeinde bei religiösen Festlichkeiten (z. B. Konfirmation) registriert, als einheimische und russlanddeutsche Jugendliche getrennte Gruppen gebildet hatten. Auch wenn dies beidseitige Prozesse sozialer Grenzziehung sind, erscheinen sie in den Augen von Alteingesessenen oftmals als einseitige Integrationsverweigerung von Seiten der Russlanddeutschen. Diese Wahrnehmung einer vermeintlich mangelnden Integrationsbereitschaft zugezogener Personen ist ein wiederkehrendes Muster, auch wenn sie gelegentlich mit dem Verweis auf einige wenige Familien relativiert wird, die als „sehr integriert“ gelten, weil sie sich im Sport- oder Albverein engagieren. Dieses Wahrnehmungsmuster von „Integrationsdefiziten“ auf Seiten der Zugezogenen bezieht sich in starkem Maße auf deren russischen Sprachgebrauch in der Öffentlichkeit. Wenn Migranten – gerade Jugendliche – in Neuhausen ob Eck untereinander russisch sprechen, wird dies oft als befremdlich empfundenes Zeichen von sozialer Abgrenzung gewertet. Binnensichten Russlanddeutscher Auch wenn viele der in den 1990er Jahren zugezogenen Russlanddeutschen der mittleren Generation fließend Deutsch sprechen und sich in Neuhausen heimisch fühlen, machen sie noch immer die Erfahrung, in negativ stereotypisierender Weise als „Russen“ wahrgenommen zu werden. Wer Sprachschwierigkeiten hat, empfindet in der Begegnung mit Alteingesessenen oftmals eine „gläserne Wand“ oder zieht sich ganz aus sozialen Kontakten mit anderen Dorfbewohnern zurück. Eine gewisse Rolle spielt dabei die Antizipation, dass Alteingesessene negative Erfahrungen mit russlanddeutschen Familien gemacht haben könnten, was zur einer allgemeinen Verunsicherung führen kann. Mitunter erleben migrantische Mütter aber auch Situationen, in denen sie eine Zurückhaltung von Alteingesessenen an Kontaktorten wie Schule, Kindergarten oder auf Spielplätzen spüren. Solche Barrieren lösen sich in alltäglichen Kontakten nach einiger Zeit auf; doch können sie sich auf Seiten der Zugezogenen zu dem verunsichernden Gefühl verdichten, auf Seiten der Alteingesessenen auf vorurteilsbeladene Ablehnung zu treffen. 63 Teilfazit 1 In der Wahrnehmung Alteingesessener gelten die russlanddeutschen Bewohner von Neuhausen ob Eck häufig stereotyp als „Russen“, obwohl viele der letztgenannten Personengruppe fließend deutsch sprechen, einen deutschen Pass besitzen und ein deutsches Selbstverständnis entwickelt haben. Hierin liegt eines der wiederkehrenden Ethnisierungsmuster gegenüber Aussiedlern, die mit ihren Familien großenteils seit Jahrzehnten in Deutschland leben und mitunter gar keinen Bezug mehr zu einer russischen bzw. sowjetischen Herkunftskultur haben. Die sozialräumliche Segregation zwischen Kerndorf und Neubaugebieten befördert solche stereotypen Wahrnehmungsmuster, die von Migranten mitunter als stigmatisierend empfunden werden. Die Außenzuschreibung der Neubaugebiete als „Ghetto“ projiziert diese Stereotypen an einen Ort, der von den dort lebenden Bewohnern jedoch ganz anders wahrgenommen wird, nämlich als ein sozialer Raum mit (weitgehend) gut funktionierenden, multiethnischen (nationalen) Nachbarschaften. C. Integrationsverlauf Zur Rolle verwandtschaftlicher Netzwerke Besonders in den ersten Jahren nach ihrer Ankunft in Deutschland bzw. in Neuhausen ob Eck ist die Unterstützung von Familienangehörigen für russlanddeutsche Migranten sehr wichtig. Verwandte, die bereits länger in Deutschland bzw. in der Region leben, waren zuvor oftmals der Auslöser gewesen, die Migration nachfolgender Verwandter zu realisieren. Sie halfen nicht nur bei anfänglichen bürokratischen Hürden, sondern später auch bei der Vermittlung von Arbeitsplätzen und Wohnraum. Einzelne russlanddeutsche Familien sind durch den Familiennachzug in verwandtschaftliche Netzwerke eingebunden, die sich über ganz Deutschland bzw. über die Region spannen. Vereinzelt haben sich im Ort auch Familien angesiedelt, die aus demselben Dorf aus Sibirien stammen. Neuhausen ob Eck stellt sich demnach als ein translokaler Kreuzungspunkt von teils weitverzweigten Verwandtschaftsnetzwerken russlanddeutscher Familien dar. Fand Integration im ersten Schritt des Migrationsprozesses über die Anstellung in einem der umliegenden Betriebe statt, war sie jedoch auch häufig mit der Erfahrung einer Deklassierung des im Herkunftsland innegehabten sozialen Status verbunden. So gehörten einige meiner Gesprächspartner in der ehemaligen Sowjetunion zur Mittelschicht, deren akademische Abschlüsse in Deutschland allerdings nicht anerkannt worden waren. Eines der zentralen Symbole für den gelungenen sozialen Aufstieg in der Zielgesellschaft ist der Hausbau, wobei auch hier verwandtschaftliche Strukturen oft von 64 großer Bedeutung waren. Solche Netzwerke stellen ein reziprokes System gegenseitiger Hilfeleistungen dar, das bei der Verortung der Migranten in Deutschland wichtig war. Umgang mit Zweisprachigkeit Zu Beginn des Zuzugs russlanddeutscher Familien Anfang der 1990er Jahre wurde es in vielen dieser Familien vermieden, untereinander oder in der Öffentlichkeit russisch zu sprechen. Dies entsprang vor allem dem Bedürfnis, sich über eine möglichst eindeutige und schnelle sprachliche Anpassung vollständig in der deutschen Gesellschaft zu assimilieren. Inzwischen hat ein Umdenken stattgefunden, und es wird in jüngeren Familien mit einem russlanddeutschen Migrationshintergrund wieder mehr Wert auf die innerfamiliäre Weitergabe der russischen Sprache gelegt. Wie eine zweisprachige Sozialisation der Kinder gelingen kann, ist dabei ein beständig diskutiertes Thema. Gezeigt wurde in der hier vorliegenden Studie zum einen, dass Bilingualität als kommunikative Verständigungsbrücke zwischen den Generationen von großer familienund identitätsstabilisierender Bedeutung ist; zum anderen zeichnet sich darin ein neuer, selbstbewusster Umgang mit der Herkunftssprache in der jüngeren Generation ab. Teilfazit 2 Aus der Außenperspektive werden die Vergemeinschaftungsformen des „Unter-Sich-Bleibens“ russlanddeutscher Familien mitunter als mangelnde Integrationsbereitschaft gedeutet. Dabei sind es familiäre Strukturen, die gerade zu Beginn der Einwanderung für individuelle Eingliederungsprozesse wichtig sind. Zugleich schaffen solche familiären Netzwerke eine gewisse soziale Nähe aufgrund einer gemeinsamen Herkunftsgeschichte, sprachlicher Vertrautheit und der geteilten Migrationserfahrung. Diese familiären Bindungen stehen einer Integration in die Aufnahmegesellschaft nicht im Wege, sondern können vielmehr integrationsfördernde Selbsthilfestrukturen sein. Wenn Migranten also familiäre und muttersprachliche Bindungen aufrechterhalten, bedeutet dies nicht, dass sie nicht integriert sind. 65 D. Soziales Leben in Neuhausen Formen bürgerschaftlicher Beteiligung von Migranten Am Beispiel von Grundschule und Kindergarten wurden in dieser Studie einige Hindernisse für die Beteiligung von Migranten aufgezeigt, aber auch existierende Beteiligungsformen sichtbar gemacht, die oft übersehen werden. In der Grundschule (Homburgschule) wird der engagierte Elternbeirat von einer Gruppe gebürtiger Neuhauser getragen, die sich auf mehreren Ebenen in der Gemeinde bürgerschaftlich engagieren, im Dorfgeschehen also bekannt und sichtbar aktiv sind. Im Unterschied dazu wird das Engagement der Spätaussiedler von der Schulleitung als sehr zurückhaltend eingeschätzt. Hürden für eine stärkere Beteiligung sind mitunter mangelnde Sprachkenntnisse, aber auch das von Russlanddeutschen selbst vorgebrachte Argument, dass es im russischen Schulsystem nicht üblich sei, dass sich Eltern in schulische Belange einbringen. Wichtiger noch ist, dass Partizipationsmöglichkeiten von migrantischen Eltern mit institutionellem Vertrauen, direkter Ansprache und selbstbewusstem Auftreten zu tun haben, über das Eltern aus Mittelschichtsfamilien habituell eher verfügen als Personen aus arbeiterlichen Schichten oder sozial benachteiligten Milieus. Ein alltagspraktischer Grund für die mangelnde Teilnahme von russlanddeutschen Eltern in den formalen Beteiligungsstrukturen der Schule ist ferner die Tatsache, dass beide Elternteile häufig im Schichtdienst in den umliegenden Betrieben und Fabriken arbeiten, also keine Zeit für Elternaktivitäten haben. Im Kindergarten (Im Morgen), in dem ca. 80 Prozent der betreuten Kinder einen Migrationshintergrund haben, engagieren sich im Elternbeirat auch migrantische Mütter, die teilweise seit rund 20 Jahren in Neuhausen leben und zu einem Freundschaftsnetzwerk von jüngeren Russlanddeutschen gehören. Mitunter sehen sich diese Mütter in Gesprächen mit anderen Eltern damit konfrontiert, dass ihre Kinder als „Ausländer“ bezeichnet werden, obwohl sie in Deutschland geboren sind und die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Die migrantischen Mütter sind nicht nur im Elternbeirat des Kindergartens aktiv und helfen bei der Organisation von Festlichkeiten, sondern nehmen gelegentlich auch an anderen Veranstaltungen der Gemeinde teil. Zugleich befinden sich diese Migrantinnen in einer wichtigen Vermittlerrolle zwischen staatlicher Einrichtung und russlanddeutscher Gemeinschaft. Dies zeigte sich beispielsweise in dem Versuch, andere Eltern über eine ins Kyrillische übersetzte Einladung zur Mitarbeit zu gewinnen. Ihre Motivation, sich in Neuhausen ob Eck bürgerschaftlich zu 66 engagieren, resultiert nicht nur aus dem Interesse an der pädagogischen Sozialisation ihrer Kinder, sondern auch aus einem grundsätzlichen Interesse am Gemeindeleben. Der Kindergarten ermöglicht ihnen ein relativ niedrigschwelliges Engagement in institutionalisierten Strukturen, in denen integrative Begegnungen und sozialer Austausch stattfinden können. Die Bedeutung von Vereinen Das gesellschaftliche Leben des Dorfes spielt sich zu einem großen Teil in den rund 50 Vereinen ab, die in Neuhausen ob Eck tätig sind. Einige dieser Vereine helfen sich untereinander bei Vereinsfesten, wobei diese wechselseitige Unterstützung in Neuhausen ob Eck weniger ausgeprägt ist als in anderen Gemeinden der Region, in denen es feste Vereinsgemeinschaften und größere gemeinsam ausgerichtete Veranstaltungen (z. B. Dorffeste) gibt. Dass eine solche öffentlich sichtbare Gemeinschaftlichkeit der Vereine in Neuhausen ob Eck fehlt bzw. stark zurückgegangen ist, wird unter anderem mit dem Wegzug der Bundeswehr Mitte der 1990er Jahre begründet, die eine Vielzahl gemeinschaftlicher Aktivitäten (u. a. Dorffeste) organisiert hatte. Im Blick auf den sozialen und kulturellen Wandel der Gemeinde wird die Rolle der Bundeswehr jedoch unterschiedlich bewertet. Für die einen sind durch den Zuzug der Bundeswehr traditionell geprägte Strukturen und Gemeinschaftsformen aufgebrochen; für andere Bewohner hat der Zuzug der Bundeswehr wesentlich dazu beigetragen, dass sich das Dorf in einer positiven Weise gegenüber ‚Fremden‘ geöffnet habe. Dabei wird immer wieder auf die scheinbar problemlose soziale Eingliederung der Bundeswehrangehörigen in die örtlichen Vereine verwiesen. Was hier als beispielhafte Integration einer Gruppe von Zugezogenen in die dörflichen Strukturen gilt, richtet sich als normative Erwartungshaltung jedoch auch an andere, später Zugezogene in den Neubaugebieten, die im Vergleich zu den Angehörigen der Bundeswehr als „Integrationsverweigerer“ betrachtet werden. Bei alteingesessenen Neuhausern gehört es mitunter zur selbstverständlichen, über mehrere Generationen hinweg reichenden familiären Tradition, sich ehrenamtlich in einem Verein, der Freiwilligen Feuerwehr oder der Kirchengemeinde zu engagieren. Zugleich wurde in der vorliegenden Studie deutlich, dass ein solches Engagement unter den spätmodernen Bedingungen von Individualisierung und der Herauslösung des Einzelnen aus traditionellen Vergemeinschaftungsformen längst nicht mehr selbstverständlich ist. Der Kern der in Neuhausen ob Eck bürgerschaftlich Engagierten besteht 67 aus einem überschaubaren Personenkreis, die sich bei Festen und vereinsinternen Veranstaltungen immer wieder begegnen und untereinander kennen. Aus der Außenperspektive werden diese vereinsgebundenen Netzwerke mitunter als ‚geschlossene‘, familienähnliche und durchaus machtvolle Gebilde wahrgenommen, zu denen Zugezogene nur schwer Zugang finden. Im Blick auf die Beteiligung von Migranten war festzustellen, dass es in den kleineren Vereinen (bis auf eine Ausnahme) keine Mitglieder mit Migrationshintergrund gibt. Auch im Sportverein mit ca. 700 Mitgliedern sind nur wenige Spieler mit russlanddeutscher Herkunft aktiv. Im Schwäbischen Albverein mit einer ca. 500 Mitglieder starken Ortsgruppe hingegen wird die Durchmischung von Alteingesessenen und Zugezogenen (mit und ohne Migrationshintergrund) mit einem Anteil von ca. 40 Prozent längst für selbstverständlich gehalten. Allerdings hatte hier eine zweisprachige Initiative (deutsch-russisch) massive Proteste in der Gemeinde ausgelöst, was als einschlägiges Beispiel eines interkulturellen Konflikts genauer analysiert wurde. Aus der Binnenperspektive formulierten Migranten unterschiedliche Hindernisse und Gründe gegen den Beitritt zu einem Verein. So gaben einige Sprachbarrieren als hauptsächlichen Grund an, sich keinem Verein anzuschließen. Andere Gesprächspartner äußerten, über die Angebote der Vereine nicht hinreichend informiert zu sein, weil sie das kommunale Mitteilungsblatt nicht lesen. Wieder andere betonten, dass ihre Kinder bereits im Verein seien, während sie selbst aufgrund großer Arbeitsbelastungen keine Zeit dafür hätten. Und schließlich erklären wieder andere, dass sie auch in Russland in keinem Verein aktiv gewesen waren; warum sollten sie das also nun in Deutschland tun? Dabei spielte auch die Vorstellung, dass ein Verein eine typisch deutsche Form der Geselligkeit ist, die man in Russland nicht kennt, eine wichtige Rolle. Zusammenfassend kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass es auf Seiten der Migranten besondere Hindernisse für einen Beitritt zu einem Verein oder für ein ehrenamtliches Engagement gibt. Mangelnde Deutschkenntnisse können ein Grund dafür sein. Doch fehlendes Engagement in Vereinen kann bei Migranten dieselben Gründe haben wie bei (anderen) Deutschen auch: anders gelagerte Freizeitinteressen, berufliche Auslastung oder eine Distanz zu festen Gruppenverbänden mit eigenen kulturellen Codes, die einem nicht vertraut sind. 68 Teilfazit 3 Im Vergleich von Schule, Kindergarten und Vereinen zeigt sich, dass zwar relativ wenige Neubürger mit Migrationshintergrund in diesen formalen Strukturen der Aufnahmegesellschaft in Neuhausen engagiert sind. Aus zivilgesellschaftlich integrierender Perspektive sollten jedoch nicht nur die klassischen mittelschichtsorientierten Formen berücksichtigt werden, sondern auch weniger sichtbare, ggf. informelle bzw. niedrigschwellige Beteiligungsformen von Migranten gleichwertig in den Blick genommen werden. Wie das Beispiel der im Kindergarten engagierten Migrantinnen gezeigt hat, gilt es, auch solche in der Öffentlichkeit wenig registrierten Formen des sozialen Engagements als sozialintegrative Aktivitäten im Gemeinwesen anerkennend zu bewerten. Darüber hinaus lässt sich zeigen, dass sich eine auf russischdeutscher Herkunft basierende Gemeinschaftlichkeit unter Migrantinnen und ein bürgerschaftliches Engagement keineswegs widersprechen müssen. Weder steht das Verbleiben in migrantischen Netzwerken einer Integration in das Gemeindeleben entgegen, noch führt dies zu einer Abgrenzung oder gar Abschottung gegenüber alteingesessenen Milieus. E. Stigmatisierte Räume Es gibt in Neuhausen ob Eck ein Wohnquartier des sozialen Wohnungsbaus, das sowohl von Seiten der Gemeindeleitung als auch in der Außenwahrnehmung der Medien als „sozialer Brennpunkt“ gilt. Die Stigmatisierung dieses sozialen Raums zeigt sich im Gerücht, die Stadt Tuttlingen würde Mieter aus armen Sozialschichten nach Neuhausen „abschieben“. Dieses negative Außenbild wird aber auch innerhalb der Gemeinde aufgegriffen und weitergetragen, wenn beispielweise die Hochhäuser als „Ghetto“ bezeichnet werden, über das vorurteilsbeladene Zuschreibungen (bis hin zur „Asozialität“ der dort lebenden Menschen) kursieren. Im Blick auf die Binnensicht der Bewohner stellte sich dieses Bild weitaus differenzierter dar. Manche Bewohner verbinden mit der Wohnanlage eine durchaus positive Ortsbezogenheit, darunter Familien mit kleinen Kindern. Dass das Quartier ein „sozialer Brennpunkt“ sein soll, weisen sie nicht zuletzt mit dem Hinweis zurück, wie viele Bewohner erwerbstätig seien. Dass viele Migranten und einige Hartz-IV-Empfänger in den Hochhäusern leben, stellt für diese Bewohner kein Problem dar; vielmehr verweisen sie darauf, in „ganz normalen“ Mietshäusern zu leben. Für andere Bewohner ist das Wohngebiet ein sozial belasteter Ort, weil es hier immer wieder zu nachbarschaftlichen Spannungen um Ordnung, Lärm und Sauberkeit kommt. 69 Dennoch zeigt sich, dass der Nahraum der Wohnanlage auch wichtige familiäre Unterstützungsstrukturen gewährleistet, so zum Beispiel in Form von Netzwerken unter den russlanddeutschen Bewohnern, die sich um die soziale Stabilität ihrer Hausgemeinschaften kümmern. Einige Bewohner, die sich gegen das negative Außenbild des Wohnquartiers wehren, formulieren auch Wünsche an die Wohnungsbaugesellschaft, beispielsweise mehr auf die Einhaltung der Hausordnung zu drängen, die Wohnungen zu sanieren und die Grünflächen kindgerechter auszustatten. Mit diesen Hinweisen auf Verbesserungsmaßnahmen, die mit dazu beitragen könnten, den Ortsbezug zu stärken, ohne bestimmte Bewohnerschichten aus den Hochhäusern zu verdrängen, ist nicht darauf abgezielt, soziale Probleme zu verharmlosen. Vielmehr muss bei der Planung von Verbesserungsmaßnahmen berücksichtigt werden, dass die Lebenswelten und Lebensstile in den Wohnblöcken weitaus differenzierter sind, als es die medialen oder offiziellen Beschreibungen des Wohngebiets als „sozial benachteiligtes Quartier“ vermuten lassen. Teilfazit 4 Die Zuschreibung von bestimmten Wohngebieten als „Ghettos“ oder „soziale Brennpunkte“ verhindert nicht nur, die Vielfältigkeit von Lebenswelten und Milieus in der Bewohnerschaft differenziert wahrzunehmen, sondern damit werden auch ausgrenzende Stigmatisierungen von Bewohnern reproduziert. Am Rand von Neuhausen ob Eck (gemeint hier: die ‚Hochhäuser‘) wird die soziale und kulturelle Heterogenität der Dorfgesellschaft sichtbar und wahrnehmbar; aber genauso bestehen hier soziale Bindekräfte, die in den Familien und kleinen solidarischen nachbarschaftlichen Strukturen liegen. Trotz Stigmatisierung organisieren sich Menschen in den Wohnanlagen in sozialen Netzwerken, auch wenn manche von ihnen dabei auf Hilfe und Unterstützung von außen angewiesen sind. 70 IV. Literaturverzeichnis / verwendete Quellen Literatur Adam, Jens: Kaum noch normale Berliner. Stadtethnologische Erkundungen in einem „sozialen Problemquartier“, hrsg. Vom Institut für Europäische Ethnologie der HumboldtUniversität zu Berlin, Band 8. Münster 2005. Becker, Franziska: Ankommen in Deutschland. Einwanderungspolitik als biographische Erfahrung im Migrationsprozess russischer Juden. Berlin 2001. Bourdieu, Pierre: Die feinen Unterschiede: Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main 1987. Bukow, Wolf-Dieter / Llaryora, Roberto: Mitbürger aus der Fremde. Soziogenese ethnischer Minderheiten. Opladen 1988. Dietz, Barbara: Rückwanderung in eine fremde Gesellschaft. Zur sozialen Integration russlanddeutscher Aussiedler in der Bundesrepublik. In: Graudenz, Ines / Römhild, Regina (Hg.): Forschungsfeld Aussiedler. Ansichten aus Deutschland. Frankfurt am Main u.a. 1996, S. 123-138. Elias, Norbert / Scotson, John L.: Etablierte und Außenseiter. Frankfurt /M. 2002. Flick, Uwe: Qualitative Inhaltsanalyse. In: Ders.: Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften. Reinbek bei Hamburg 2000 (5. Auflage), S. 212 ff. Häußermann, Hartmut / Kapphan, Andreas: Berlin: Von der geteilten zur gespaltenen Stadt? Sozialräumlicher Wandel seit 1990. Opladen 2000. Hepfer, Willi: Neuhauser Vereine und Vereinigungen. In: 900 Jahre Neuhausen ob Eck 1095-1995. Ein Heimatbuch mit Beiträgen zur Vergangenheit und Gegenwart der Gemeinde, hrsg. Von der Gemeinde Neuhausen ob Eck. Tuttlingen o.J., S. 435-461. Hollstein, Bettina / Ulrich, Carsten G.: Einheit trotz Vielfalt? Zum konstitutiven Kern qualitativer Forschung. In: Soziologie, 32. Jg. Heft 4, 2003, S. 29-43. Hüwelmeier, Gertrud: Hundert Jahre Sängerkrieg. Ethnographie eines Dorfes in Hessen. Berlin 1997. Lamnek, Siegfried: Qualitative Sozialforschung. Weinheim / Basel 2005. Mercheril, Paul: Andere Deutsche. Zur Lebenssituation von Menschen mit multiethnischer und multikultureller Herkunft. Berlin 1994. Moser, Johannes: Gemeindeforschung in der Spätmoderne. In: Schweizerisches Archiv für Volkskunde 98 / 2002, S. 295-315. Munsch, Chantal: Engagement und Diversity. Der Kontext von Dominanz und sozialer Ungleichheit am Beispiel Migration. Weinheim / München 2010. 71 Projektgruppe des Ludwig-Uhland-Instituts (Leitung Bernd Jürgen Warneken): Meier. Müller. Shahadat. Migranten bei der Feuerwehr und dem Roten Kreuz. Hrsg. Von der Tübinger Vereinigung für Volkskunde. Tübingen 2011. Robertson, Roland: Glokalisierung: Homogenität und Heterogenität in Raum und Zeit. In: Beck, Ulrich (Hg.): Perspektiven der Weltgesellschaft. Frankfurt am Main 1998, S. 192220. Schiffauer, Werner u.a. (Hg.): Staat – Schule – Ethnizität. Politische Sozialisation von Immigrantenkindern in vier europäischen Ländern. Münster, New York, München, Berlin 2002. Schmidt-Lauber, Brigitta: Das qualitative Interview oder: Die Kunst des Redenlassens. In: Göttsch, Silke / Lehmann, Albrecht (Hg.): Methoden der Volkskunde. Positionen, Quellen, Arbeitsweisen der Europäischen Ethnologie. Berlin 2001, S. 165-186. Vardar, Azra: Die Beteiligung von Migranteneltern an einer deutschen Grund- und Hauptschule. In: Arbeitskreis Ethnologie und Migration (ArEtMi) e.V. (Hg.): Migration – Bürokratie – Alltag. Ethnographische Studien im Kontext von Institutionen und Einwanderung. Berlin 2011, S. 119-141. Zinn-Thomas, Sabine: Fremde vor Ort. Selbstbild und regionale Identität in Integrationsprozessen. Bielefeld 2010. Verwendete Quellen Unterlagen der Gemeindeverwaltung Neuhausen ob Eck: Statistiken zur Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde (Statistisches Landesamt BadenWürttemberg). Dokumentation über Stationierung und Abzug der Bundeswehr in Neuhausen ob Eck: Privatarchiv Heinrich Bastuk. „Bürgerinformationen Neuhausen ob Eck“, in: www.total-lokal.de/pdf/78579_info.pdf. „Neuhausen ob Eck Bortschtsch und Break-Dance“, in: Südkurier vom 27.11.2004. „3,6 Millionen Euro für eine neue Mitte“, in: Südkurier vom 11.05.2013 „Engagement der Tuttlinger Wohnbau in der Gemeinde / Bericht des Geschäftsführers“, in: „donnerstags“ – Amtsblatt der Gemeinde vom 03. Mai 2012. „Wir sind keine heile Welt mehr“, in: Gränzbote vom 22.06.2012. „‘TUTkids‘ startet ab Oktober in Neuhausen ob Eck“, in: Gränzbote vom 18.07.2012.