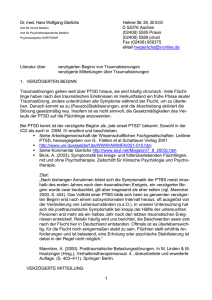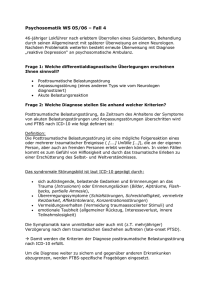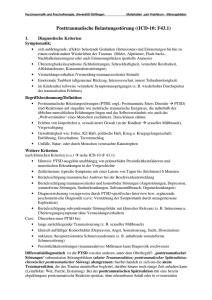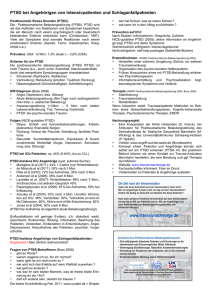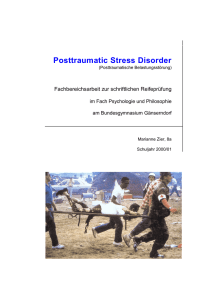NET
Werbung

Kontrollierte Therapieevaluation der Narrativen Expositionstherapie (NET) im Vergleich zu Stress-Impfungs-Training (SIT) bei posttraumatischer Belastungsstörung in Folge organisierter Gewalt Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades „Doctor rerum naturalium“ im Fachbereich Psychologie, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Sektion, Universität Konstanz vorgelegt von Diplom-Psychologin Dorothea Hensel-Dittmann Konstanz, im Dezember 2007 Tag der mündlichen Prüfung: 6. März 2008 1. Referent: Prof. Dr. Thomas Elbert 2. Referent: Prof. Dr. Frank Neuner Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS) URL: http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2008/5262/ URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-52629 Mein Dank geht an all diejenigen, die mein Projekt „Doktorarbeit“ in vielerlei Hinsicht unterstützt haben: Thomas Elbert für Deine Betreuung, Deine stets offene Bürotür, konstruktive Rückmeldungen, Deinen unerschütterlichen Optimismus trotz der oft schweren Arbeit im Bereich Trauma und vor allem auch Dein persönliches Engagement in meiner Therapiestudie. Frank Neuner zunächst für Dein Angebot, überhaupt bei Euch im Trauma-Team mitzuarbeiten (beim Mittagessen in der ZPR-Kantine)! Dann für Deine durchgehende Hilfsbereitschaft bezüglich inhaltlicher, methodischer und statistischer Fragen und nicht zuletzt für Deine eigene engagierte Mitarbeit in meiner Studie. Alle Patientinnen und Patienten, die an meiner Studie teilnahmen, deren ehrenamtliche BegleiterInnen sowie die beteiligten DolmetscherInnen. Das Team der Psychologischen Ambulanz für Flüchtlinge: Eurem besonderen Engagement als TherapeutInnen, DiagnostikerInnen, OrganisatorInnen (Heike!) und vor allem stets unterstützenden KollegInnen ist es zu verdanken, dass meine Studie überhaupt durchführbar war! Dank an Maggie Schauer, Martina Ruf, Claudia Catani, Silke Gotthardt, Britta Balliel, Michael Odenwald, Patience Onyut, Jens Borgelt, Dana Bichescu-Burian, Nadja Jacob, Elisabeth Schauer, Maria Roth, Heike Riedke, Brigitte Rockstroh, Iris Kolassa, Susanne Schaal, Franka Glöckner, Cindy Eckardt, Anne Kolb, Anna Halisch, Nina Winkler, Kay-Debora Lehmann, Hannah Adenauer, Hannah Aichinger und Tobias Schmitt (besonderen Dank für Deinen Einsatz in der Türkei!). Katalin Dohrmann für’s gegenseitige Mitfiebern beim jeweiligen Projekt „Doktorarbeit“, für’s Korrektur- und inhaltliche Lesen meiner Texte mit kritischen, konstruktiven Rückmeldungen, Dein stets offenes Ohr für mehr oder weniger „banale“ Fragen und jede Menge Pausen mit Ovo und Co., in denen (entgegen möglicher anderer Eindrücke) oft genug auch über unser Doktorarbeiten diskutiert wurde. ;) 4 Sandra Janzen als wichtiges Vorbild, indem Du mir vorgelebt hat, dass man Doktorarbeit und Therapieausbildung parallel bewältigen kann, und für Deine sonstige Unterstützung in verschiedenerlei Hinsicht. Daniela Djundja für das Versüßen des Arbeitslebens durch diverse lustige Pausen, Schokolade und unsere Doktorandinnen-Solidargemeinschaft (große Lücke, als Du weg warst!). Kristin Bohn als allererste Diskussionspartnerin hinsichtlich der Frage, ob ich eine Doktorarbeit überhaupt in Angriff nehmen soll (damals in der Seekuh), für Deine durchgehende Ermutigung und Unterstützung. Und überhaupt: „Kuck mal, ’n Eichhörnchen!“ Dani Fromm für Deine ungebrochen gnadenlosen und hochpräsizen Korrekturen meiner „inhaltlich fiesen, aber immerhin nicht langweiligen“ Arbeit. :) Sabine Vogt für’s blitzschnelle Korrekturlesen in letzter Minute! Niko Dittmann für Dein durchgehendes Interesse an meiner Arbeit, Deine umfangreiche technische und vor allem menschliche Unterstützung und liebevolle Ermutigung die ganze Zeit über (vor allem am Tag vor dem Drucken...). Ole Dittmann für Deine erfrischende Unwissenschaftlichkeit und die tägliche Erinnerung an das, was wirklich wichtig ist (regelmäßige, ausreichende Mahlzeiten, Kuscheln und jede Menge Schlaf!). Meine weitere Familie, insbesondere Euch, meine lieben Eltern, die Ihr die Entstehung meiner Doktorarbeit stets mit Interesse begleitet habt. Speziell möchte ich Dir, Mama, dafür danken, dass Du meine Arbeit sogar „freiwillig“ gelesen hast und dabei nebenher noch den einen oder anderen Fehler korrigieren konntest. :) 5 Zusammenfassung Das wiederholte Erleben von Gewalt führt in vielen Fällen zur Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD). Flüchtlinge und Asylbewerber in Deutschland sind häufig aufgrund von Erfahrungen organisierter Gewalt aus ihren Herkunftsländern geflohen und weisen hohe PTSD-Raten auf. Psychologische Behandlungsmöglichkeiten für diese Personengruppe sind bislang kaum erforscht worden – vor allem fehlen systematische Vergleiche verschiedener aktiver Therapiemethoden. In der vorliegenden Arbeit wird eine randomisierte kontrollierte Vergleichsstudie zweier Therapieverfahren zur Behandlung von PTSD nach organisierter Gewalt vorgestellt. Die Studie wurde in Deutschland durchgeführt. Die Stichprobe umfasste größtenteils Asylbewerber, die aufgrund von Gewalterlebnissen aus ihren Herkunftsländern geflüchtet waren. Sie hatten zumeist einen unsicheren Aufenthaltsstatus für Deutschland inne. Einige wenige Probanden waren ehemalige DDR-Bürger mit Erlebnissen organisierter Gewalt. Es wurden 28 Personen mit PTSD einander nach Geschlecht und Herkunft paarweise zugeordnet und zufällig auf die zwei Therapiebedingungen aufgeteilt. Sie erhielten je 10 Sitzungen „Narrative Expositionstherapie“ (NET) oder „StressImpfungs-Training“ (SIT). Standardisierte diagnostische Interviews wurden vor der Behandlung sowie 4 Wochen, 6 Monate und ein Jahr nach Therapieende durchgeführt. Vor der Therapie litten alle Patienten komorbid zur PTSD an einer affektiven Störung (82 % Major Depression, 18 % Dysthymia). Die PTSD-Häufigkeit nahm in der Gesamtstichprobe über die Zeit hinweg signifikant ab. Für die beiden Therapiebedingungen war dies jedoch einzeln betrachtet jeweils nicht der Fall. Bezüglich des PTSD-Schweregrades trat eine signifikante Reduktion zwischen dem Zeitpunkt der Erstdiagnostik und der 6Monats-Nachuntersuchung über beide Bedingungen hinweg auf. Bei getrennter Betrachtung der beiden Behandlungsgruppen zeigte sich eine signifikante Reduktion der PTSD-Symptomatik jedoch lediglich für NET, nicht für SIT. Die Symptomreduktion in der NET-Gruppe trat zwischen dem Zeitpunkt der Erstdiagnostik und der 6-Monats-Nachuntersuchung auf, die Effektstärke betrug d = 1,43 (für SIT: d = 0,12). Es bestand hinsichtlich des PTSD-Schweregrades zu keinem Untersuchungszeitpunkt ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Für die Häufigkeit von Major Depression und anderen komorbiden Störungen ergab sich in keiner der beiden Therapiebedingungen eine signifikante Reduktion. Auch der Depressivitätsschweregrad veränderte sich über die Zeit hinweg nicht signifikant. Die Befunde zeigen, dass Expositionsverfahren wie die Narrative Expositionstherapie auch bei Flüchtlingen und Asylbewerbern mit größtenteils unsicherem Aufenthaltsstatus zu signifikanten Verbesserungen der PTSD-Symptomatik führen. Vermutlich hat dieser unsichere Status jedoch eine erfolgreiche Behandlung komorbider Erkrankungen erschwert. 7 Abstract The repeated experience of violence has been shown to lead to the development of post-traumatic stress disorder (PTSD) in many cases. Refugees and asylum seekers in Germany have often fled from their countries of origin because of organized violence. They tend to show high rates of PTSD. To date, little research has been done on psychological treatments for this population. More specifically, there is a lack of systematic comparisons of different active treatments. The current thesis describes a randomized controlled clinical trial comparing two treatments for post-traumatic stress disorder (PTSD) as a consequence of organized violence. The study was conducted in Germany. The sample mainly consisted of asylum seekers who had fled from their countries of origin after having experienced violence. Most of them had an insecure legal status of residency in Germany. Some subjects were former German Democratic Republic residents who had experienced organized violence. Twenty-eight persons were matched pairwise according to sex and origin and were randomly allocated to one of the two treatments. They received 10 treatment sessions of either „Narrative Exposure Therapy“ (NET) or „Stress Inoculation Training“ (SIT). Standardized diagnostic interviews were conducted before treatment and 4 weeks, 6 months and one year after the end of treatment. All participants suffered from a comorbid mood disorder before the start of treatment (82 % major depression, 18 % dysthymia). The whole sample showed a significant reduction in PTSD rate over time at the six-months follow-up examination, but this was not the case when the two treatment groups were analysed separately. PTSD symptom severity decreased significantly across both treatment groups between the pretest and the six-months follow-up examination. However, regarding the two treatment groups separately, a significant reduction in PTSD severity was found for NET, but not for SIT. The symptom reduction in the NET group occurred between pretest and six-months follow-up examination, the effect size being d = 1.43 (for SIT: d = 0.12). There was no significant difference between NET and SIT regarding PTSD severity at any assessment point. The rates of major depression and other comorbid disorders did not decrease significantly over time in either of the two treatment groups. The scores of depressive symptoms also did not show a significant reduction over time. The results indicate that exposure treatments like Narrative Exposure Therapy lead to a significant PTSD symptom reduction even in refugees and asylum seekers with mainly insecure asylum status. However, this status might have hindered successful treatment of comorbid disorders. 9 Inhaltsverzeichnis 1 Theorie 21 1.1 Organisierte Gewalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.1.1 Definition „Gewalt“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.1.2 Definition „Organisierte Gewalt“ . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.1.3 Zahlen und Fakten zu organisierter Gewalt . . . . . . . . . . 25 Beispiele organisierter Gewalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1.2.1 Türkei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1.2.2 Serbien und Montenegro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Flüchtlinge in Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.3.1 Definition „Flüchtling“ nach der Genfer Konvention . . . . . 31 1.3.2 Zahlen zu Flüchtlingen in Deutschland . . . . . . . . . . . . . 32 1.3.3 Rechtliche Situation von Asylbewerbern . . . . . . . . . . . . 33 Psychische Folgen organisierter Gewalt . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1.4.1 Posttraumatische Belastungsstörung . . . . . . . . . . . . . . 39 1.4.2 Psychische Störungen komorbid zu einer PTSD . . . . . . . . 57 1.4.3 Weitere mögliche psychische Folgen organisierter Gewalt . . 69 1.4.4 Besonderheiten bei Asylbewerbern und Flüchtlingen . . . . . 71 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung . . . . . . . . . . 79 1.5.1 Kontroverse Therapieansätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 1.5.2 Therapie mit Exposition als festem Bestandteil . . . . . . . . . 81 1.5.3 Therapie ohne bzw. mit fakultativem Expositionsanteil . . . . 96 1.5.4 Therapie der PTSD bei Asylbewerbern und Flüchtlingen . . . 104 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 Zusammenfassung und Fragestellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Methoden 115 2.1 Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 2.2 Versuchspersonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 2.2.1 Rekrutierung der Versuchspersonen . . . . . . . . . . . . . . . 115 2.2.2 Ausschluss- und Aufnahmekriterien . . . . . . . . . . . . . . . 116 2.2.3 Beschreibung der Stichprobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 2.3 Therapeuten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 2.4 Dolmetscher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 2.5 Ablauf der Therapiestudie 2.6 Diagnostische Untersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 2.6.1 Fragebögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 2.6.2 Die Magnetenzephalographie-Messung (MEG) 11 . . . . . . . . 132 3 2.7 Durchführung der Narrativen Expositionstherapie . . . . . . . . . . . 132 2.8 Durchführung des Stress-Impfungs-Trainings . . . . . . . . . . . . . . 133 2.9 Datenanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Ergebnisse 3.1 3.2 3.3 Zusammenhang versch. Faktoren mit PTSD und Depressivität . . . . 137 3.1.1 Zusammenhang CAPS-Score und andere Faktoren . . . . . . 137 3.1.2 Zusammenhang HAM-D-Score und andere Faktoren . . . . . 137 Posttraumatische Belastungsstörung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 3.2.1 Verzögerter Beginn und Chronizität . . . . . . . . . . . . . . . 138 3.2.2 Häufigkeit der Diagnose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 3.2.3 Veränderung des Symptom-Scores im Fragebogen CAPS . . . 140 3.2.4 Funktionsbeeinträchtigung durch die PTSD-Symptomatik . . 145 3.2.5 Begleitsymptome im Fragebogen CAPS . . . . . . . . . . . . . 147 Affektive Störungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 3.3.1 Häufigkeit affektiver Störungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 3.3.2 Veränderung des Symptom-Scores in der HAM-D 3.3.3 Suizidalität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 . . . . . . 152 3.4 Zusammenhang PTSD und Depressivität . . . . . . . . . . . . . . . . 157 3.5 Weitere komorbide Störungen 3.6 4 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 3.5.1 Psychische Störungen bei der Erstuntersuchung . . . . . . . . 158 3.5.2 Psychische Störungen bei der Nachuntersuchung . . . . . . . 159 Therapieabbrecher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Diskussion 4.1 4.2 4.3 4.4 165 Zusammenhang versch. Faktoren mit PTSD und Depressivität . . . . 165 4.1.1 Zusammenhang CAPS-Score und andere Faktoren . . . . . . 165 4.1.2 Zusammenhang HAM-D-Score und andere Faktoren . . . . . 167 Posttraumatische Belastungsstörung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 4.2.1 Häufigkeit der Diagnose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 4.2.2 Veränderung des Symptom-Scores im Fragebogen CAPS . . . 169 4.2.3 Funktionsbeeinträchtigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 4.2.4 Begleitsymptome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Depression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 4.3.1 Häufigkeit der Diagnose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 4.3.2 Veränderung des Symptom-Scores in der HAM-D 4.3.3 Suizidalität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 . . . . . . 178 Zusammenhang PTSD – Depressivität . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 12 4.5 Weitere komorbide Störungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 4.5.1 Häufigkeit von Angst- und Zwangsstörungen . . . . . . . . . 183 4.5.2 Häufigkeit von Substanzmissbrauch . . . . . . . . . . . . . . . 185 4.5.3 Häufigkeit psychotischer Störungen . . . . . . . . . . . . . . . 185 4.5.4 Veränderung der Raten komorbider Störungen . . . . . . . . . 186 4.6 Therapieabbrecher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 4.7 Einschränkungen der Studie 4.8 4.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 4.7.1 Länge der Therapiesitzungen in den beiden Bedingungen . . 188 4.7.2 Stichprobengröße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 4.7.3 „Blindheit“ der Interviewer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 4.7.4 Arbeit mit Dolmetschern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Stärken der Studie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 4.8.1 Vergleich zweier aktiver Behandlungsverfahren . . . . . . . . 192 4.8.2 Abgrenzung der Verfahren hinsichtlich Exposition . . . . . . 192 4.8.3 Einbeziehung einer stark belasteten Stichprobe . . . . . . . . . 192 4.8.4 Durchführbarkeit und Erfolg von Exposition . . . . . . . . . . 193 Ausblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Literatur 199 Anhang 221 13 Tabellenverzeichnis 1 Beschreibung der Stichprobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 2 Medikamenteneinnahme bei Erstuntersuchung 3 Foltermethoden nach Häufigkeit (Gesamtstichprobe) . . . . . . . . . 123 4 Foltermethoden für NET und SIT getrennt 5 CAPS-Scores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 6 Funktionsbeeinträchtigung CAPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 7 Begleitsymptome CAPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 8 HAM-D-Scores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 9 Suizidrisiko nach M.I.N.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 10 Korrelationen CAPS- und HAM-D-Scores . . . . . . . . . . . . . . . . 157 11 Störungen komorbid zur PTSD (ohne affektive Störungen) . . . . . . 160 15 . . . . . . . . . . . . 122 . . . . . . . . . . . . . . . 124 Abbildungsverzeichnis 1 Herkunft der Probanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 2 Familienstand der Probanden und Anzahl Kinder . . . . . . . . . . . 119 3 Aufenthalts-/Asylstatus der Probanden . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 4 Flussdiagramm Therapiestudie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 5 Häufigkeit PTSD-Diagnose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 6 CAPS-Scores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 7 CAPS-Scores der einzelnen Symptomgruppen . . . . . . . . . . . . . 144 8 Funktionsbeeinträchtigung CAPS 9 Begleitsymptome CAPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 10 Schuldgefühle und Dissoziationssymptome CAPS . . . . . . . . . . . 150 11 Häufigkeit Depressionsdiagnose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 12 HAM-D-Scores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 13 Rate hohen Suizidrisikos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 14 Zusammenhang CAPS- und HAM-D-Scores Gesamtstichprobe . . . 158 15 Raten von Störungen komorbid zur PTSD (Erstdiagnostik) . . . . . . 161 16 Raten von Störungen komorbid zur PTSD (6-Monats-Nachunters.) . 162 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Anmerkungen: In dieser Arbeit werden zugunsten der besseren Lesbarkeit anstelle von männlichen und weiblichen Begriffen wie „KlientInnen“ und „TherapeutInnen“ usw. zumeist lediglich die maskulinen Bezeichnungen „Klienten“, „Therapeuten“ etc. verwendet. Sollte es nicht explizit anders gekennzeichnet sein, beziehen sich die Aussagen jedoch auf beide Geschlechter. Des Weiteren wird in der vorliegenden Arbeit anstelle der deutschen Abkürzung für posttraumatische Belastungsstörung „PTBS“ die gängigere englische Abkürzung „PTSD“ (posttraumatic stress disorder) verwendet. 19 1 1 THEORIE Theorie „Das 20. Jahrhundert wird in die Geschichte als ein Jahrhundert der Gewalt eingehen. Es hinterlässt uns das Massenvernichtungserbe einer Gewalt in noch nie da gewesenem Ausmaß, einer Gewalt, wie sie in der Geschichte der Menschheit bis dahin nicht möglich gewesen war.“ (Nelson Mandela, „Weltbericht Gewalt und Gesundheit - Zusammenfassung“, Weltgesundheitsorganisation WHO, Seite V, 2003) Betrachtet man den Verlauf der Geschichte bis hin zu den aktuellen Medienberichten, entsteht der Eindruck, dass die Menschheit nicht auf Gewalt verzichten kann oder will. Täglich findet man neue Meldungen über zivile Gewalt in Form von Kindesmissbrauch, Gewalt an den Schulen, in Familien usw., aber auch über organisierte Gewalt in Form von Kriegen, Folter und terroristischen Aktivitäten. So wurden etwa am 19. Mai 2007 bei einem Selbstmordattentat auf einem belebten Markt in der nordafghanischen Stadt Kundus elf Menschen getötet, darunter drei deutsche Soldaten der internationalen Afghanistan-Schutztruppe Isaf. Zudem wurden fünf weitere Bundeswehrsoldaten und 16 Afghanen verletzt (Tagesschau vom 19.5.2007). Ob die psychischen Reaktionen auf Gewalt im Verlauf der Menschheitsgeschichte dieselben waren, die man heute kennt, oder ob sie sich im Laufe der Zeit verändert haben, lässt sich nicht rekonstruieren. Es existieren lediglich einzelne Dokumente, die dieses Thema aufgreifen. Beispielsweise finden sich einige Beschreibungen von Reaktionen auf drohende oder bereits erlebte Gewalt in der Bibel, hier aus der Geschichte des bevorstehenden Untergangs der Stadt Babel: „Der Räuber raubt, und der Verstörer verstört [...] Derhalben sind meine Lenden voll Schmerzen, und Angst hat mich ergriffen wie eine Gebärerin. Ich krümme mich, wenn ich’s höre, und erschrecke, wenn ich’s ansehe. Mein Herz zittert, Grauen hat mich erschreckt; auch am Abend, der mir so lieb ist, habe ich keine Ruhe“ (Jesaja, Kapitel 21, Verse 2-4, „Die Bibel“, Seite 849, Württembergische Bibelanstalt, 1962). Ein weiteres Beispiel bietet die Geschichte des Sieges Davids über die Amalekiter: „Da nun David samt seinen Männern zur Stadt kam und sah, dass sie mit Feuer verbrannt war und ihre Weiber, Söhne und Töchter gefangen waren, hoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme auf und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten“ (Erstes Buch Samuel, Kapitel 30, Verse 3 und 4, „Die Bibel“, Seite 21 1.1 Organisierte Gewalt 1 THEORIE 849, Württembergische Bibelanstalt, 1962). Es werden also Angst- und Trauerreaktionen im Zusammenhang mit dem Erleben von Gewalt geschildert. Eine systematische Beschreibung psychischer Folgen von Gewalt begann erst in den letzten zwei Jahrhunderten. Freud und Breuer veröffentlichten beispielsweise 1895 ihre „Studien über Hysterie“ (Freud, 1969): Sie hatten die Theorie entwickelt, dass die meisten Hysterien und Ängste auf frühere Traumata zurückzuführen seien – später verwarfen sie diese Annahme jedoch wieder (Shorter, 1999). Fest steht, dass Menschen weltweit unter psychischen Folgen organisierter Gewalt leiden. Oftmals verlassen sie aufgrund der Gewalterlebnisse ihre Heimat und werden zu Flüchtlingen. Diese Arbeit befasst sich mit der Behandlung psychischer Störungen, unter denen Menschen nach dem Erleben organisierter Gewalt leiden können. Dabei wird im vorliegenden Kapitel zunächst der Begriff der organisierten Gewalt definiert. Des Weiteren wird das Thema „Flüchtlinge in Deutschland“ behandelt. In dieser Bevölkerungsgruppe finden sich viele Menschen, die organisierte Gewalt erlebt und aus diesem Grund ihre Heimat verlassen haben. Im Anschluss werden mögliche psychische Folgen organisierter Gewalt beschrieben. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf einer der häufigsten psychischen Störungen nach Gewalterlebnissen, der posttraumatischen Belastungsstörung (z. B. de Jong, Komproe & Van Ommeren, 2003; Bichescu, Schauer, Saleptsi, Neculau, Elbert & Neuner, 2005). Als letzter Punkt dieses Kapitels wird auf Behandlungsmöglichkeiten bei posttraumatischer Belastungsstörung (posttraumatic stress disorder, PTSD) eingegangen. Derzeit finden sich in Deutschland zwei gegenläufige Strömungen bezüglich der geeigneten Behandlungsmethode bei PTSD: Stabilisierung des Patienten, bevor man möglicherweise anschließend zu Expositionsverfahren übergeht, versus explizite Expositionsverfahren. Es wird der momentane Forschungsstand zu dieser Kontroverse aufgezeigt. Neben allgemeinen Befunden zur PTSD und ihrer Behandlung wird auch auf die besondere Situation von Flüchtlingen eingegangen, die unter einer PTSD leiden. 1.1 1.1.1 Organisierte Gewalt Definition „Gewalt“ Es scheint sinnvoll, sich zunächst mit der allgemeineren Definition von „Gewalt“ zu befassen, bevor man sich der spezifischeren Definition von „Organisierter Gewalt“ zuwendet. Das Definieren von Gewalt ist schwierig, da es sich um ein äußerst diffuses und komplexes Phänomen handelt, das von Einzelnen unterschiedlich betrachtet wird und wissenschaftlich nicht exakt fassbar ist (Weltgesundheitsorgani22 1.1 Organisierte Gewalt 1 THEORIE sation WHO, 2003). Je nach Kontext wird eine Definition unterschiedlich ausfallen. Zudem unterliegt die Vorstellung dessen, was Gewalt bedeutet, kulturellen Einflüssen und Veränderungen von Wertvorstellungen und Normen über die Zeit. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert einen weltweiten Konsens über die Definition von Gewalt, die idealerweise die gesamte Bandbreite der Täterhandlungen und die subjektive Erfahrung der Opfer einschließt, ohne zu ungenau zu werden. Die WHO selbst orientiert sich an folgender Definition von Gewalt: „Der absichtliche Gebrauch von angedrohtem oder tatsächlichem körperlichem Zwang oder physischer Macht gegen die eigene oder eine andere Person, gegen eine Gruppe oder Gemeinschaft, der entweder konkret oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, psychischen Schäden, Fehlentwicklung oder Deprivation führt.“ („Weltbericht Gewalt und Gesundheit“, Weltgesundheitsorganisation WHO 2003, Seite 6, nach Weltgesundheitsorganisation WHO 1996, „WHO Global Consultation on Violence and Health. Violence: a public health priority“) Mit dieser Definition sind sowohl interpersonelle Gewalt als auch Suizidhandlungen und bewaffnete Auseinandersetzungen abgedeckt. Auch die Androhung von Gewalt ist mit eingeschlossen. Gewalt ist ein Phänomen, das in jedem Land auftritt. Weltweit gehört Gewalt in der Altersgruppe der 15- bis 44-Jährigen zu den Haupttodesursachen und ist unter Männern für etwa 14 % und bei den Frauen für 7 % aller Sterbefälle verantwortlich (Weltgesundheitsorganisation WHO 2003, nach Weltgesundheitsorganisation WHO 1996, „WHO Global Consultation on Violence and Health. Violence: a public health priority“). Die WHO unterscheidet drei Typen von Gewalt: Gegen sich selbst gerichtete Gewalt, interpersonelle und kollektive Gewalt. Unter kollektiver Gewalt wird hier folgendes verstanden: Der instrumentelle Gebrauch von Gewalt durch Personen, die sich als zu einer mehr oder weniger festen Gruppe zugehörig fühlen, gegenüber Einzelnen oder einer anderen Gruppe mit der Absicht, politische, wirtschaftliche oder soziale Ziele zu erreichen (Weltgesundheitsorganisation WHO 2002, „Collective Violence“). Die Definition ist derjenigen der organisierten Gewalt von Neuner (2003) sehr ähnlich, wobei letztere weniger allgemein gefasst ist (siehe „1.1.2 Definition ,Organisierte Gewalt’“). Derrienic (1971) merkt allerdings an, dass kollektive und organisierte Gewalt sich oft überschneiden, jedoch nicht zwingend miteinander verknüpft sind: Beispielsweise kann es sein, dass Ausschreitungen einer Gruppe von Personen nur in geringem Maße organisiert sind. Er beschreibt Gewalt auf drei kontinuierlichen 23 1.1 Organisierte Gewalt 1 THEORIE Ebenen: So kann Gewalt mehr oder weniger direkt und mehr oder weniger organisiert sein, und potenzielle Gewalt kann weiter oder weniger weit davon entfernt sein, in tatsächliche Gewalt umzuschlagen. 1.1.2 Definition „Organisierte Gewalt“ Organisierte Gewalt kann als eine spezifische Form von Gewalt betrachtet werden, die weltweit in zahlreichen Ländern stattfindet. Sie umfasst Krieg, andauernde Verfolgung und Folter durch den Staat sowie Gewalt, die von Terrororganisationen ausgeht, und zeichnet sich dadurch aus, dass ein politisches Motiv hinter der Gewaltausübung steckt (Burnett & Peel, 2001). Neuner (2003) definiert organisierte Gewalt folgendermaßen: Es handelt sich um Gewalt, die systematisch und direkt von Mitgliedern einer Gruppe ausgeübt wird, die eine mehr oder weniger ausgeprägte zentral geleitete Struktur aufweist. Dies ist der Fall bei Polizeieinheiten, Rebellenorganisationen, Terrororganisationen, paramilitärischen und militärischen Verbänden. Die Gewalt wird mit einer gewissen Kontinuität gegen Individuen und Gruppen mit anderen politischen Einstellungen, Nationalitäten oder rassischen, kulturellen oder ethnischen Hintergründen ausgeübt. Sie ist charakterisiert durch Verletzung der Menschenrechte oder anderer Grundrechte von Menschen. Staatliche sowie quasi-staatliche Gewaltstrukturen werden zur systematischen Unterdrückung und Verfolgung der Bevölkerung oder Teilen derselben eingesetzt. Ein herausragendes Merkmal politisch organisierter Gewalt ist auch der Verschleierungscharakter in der Öffentlichkeit. So wird einerseits nicht offen eingestanden, dass der Staat zur Kontrolle „innerer Feinde“ Folter, Bespitzelung etc. einsetzt, andererseits ist der Einsatz von Gewalt allgemein bekannt. Dies dient der Einschüchterung und Entsolidarisierung innerhalb der Gesellschaft (Zebra, Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum, 2006). Schauer, Neuner und Elbert (2005) weisen darauf hin, dass die Konsequenzen organisierter Gewalt weitreichend sind und die Zukunft einer Gesellschaft nachhaltig beeinflussen. Nach den aufgeführten Definitionen kann man organisierte Gewalt stets als kollektive Gewalt nach der Definition der WHO bezeichnen. Ein weiterer ähnlicher Begriff ist der der Menschenrechtsverletzung, durch die organisierte Gewalt nach Neuner charakterisiert ist. Menschenrechte sind universelle Rechte, die jedem Menschen allein aufgrund der Tatsache, dass er ein Mensch ist, zustehen. Beispie24 1.1 Organisierte Gewalt 1 THEORIE le sind das Recht auf Leben, Freiheit, Eigentum und Sicherheit der Person. Auch Meinungs-, Versammlungs- und Religionsfreiheit gehören dazu. Die Menschenrechte sind ihrem Wesen nach Rechte des Einzelnen gegenüber dem Staat, der diese Rechte respektieren, schützen und für deren volle Verwirklichung Sorge tragen sollte (UN-Generalversammlung, 1998). Demnach kann aus juristischer Sicht lediglich ein Staat Menschenrechte verletzen, und jedes Individuum hat wiederum das Recht, staatliche Aktivitäten abzulehnen, die zur Verletzung der Menschenrechte beitragen. Es zeigt sich, dass sich organisierte Gewalt und Menschenrechtsverletzungen stark überschneiden. Organisierte Gewalt kann zwar auch von nichtstaatlichen Gruppierungen ausgehen. Jedoch ist möglicherweise das nicht ausreichende Bemühen um Bekämpfung dieser Gewalt durch den Staat wiederum als eine Verletzung der Menschenrechte zu betrachten: Es wird juristisch als mittelbare staatliche Verfolgung bezeichnet, wenn Übergriffe von Privatpersonen oder -gruppen ausgehen und der Staat trotz vorhandener Gebietsgewalt zu Verfolgungsmaßnahmen anregt oder sie unterstützt, billigt oder tatenlos hinnimmt und damit dem Betroffenen den erforderlichen Schutz versagt, weil er dazu nicht willens oder in der Lage ist (PRO ASYL, 2004). Andersherum geht jede Menschenrechtsverletzung per definitionem vom Staat aus, ist also organisiert. Fraglich ist, ob jede Form der Menschenrechtsverletzung als Gewalt nach der obigen Definition zu bezeichnen ist, z. B. Einschränkungen der Pressefreiheit. 1.1.3 Zahlen und Fakten zu organisierter Gewalt Zahlen zu organisierter Gewalt weltweit lassen sich nur schwer präzisieren. Eine systematische Erfassung ist beinahe unmöglich, da die Thematik politisch hochsensibel ist. Es muss also auf Angaben von Menschenrechtsorganisationen zurückgegriffen werden (Basoglu, 1993). So dokumentierte etwa amnesty international im Jahr 2004 folgende Beispiele von weltweiten Menschenrechtsverletzungen, die Zahl der tatsächlichen Vorkommnisse dürfte weitaus höher sein (amnesty international, 2005a): In 42 Staaten wurden Menschen willkürlich oder ohne Anklage und Verfahren verhaftet. In 28 Ländern wurden Zivilisten willkürlich von bewaffneten Gruppen angegriffen. Folterungen und Misshandlungen durch Polizei, Sicherheitskräfte oder andere Staatsangestellte fanden in 104 Ländern statt. Ebenso schwierig ist es, einzuschätzen, wie viele Menschen weltweit unter organisierter Gewalt leiden. Laut UNHCR befinden sich schätzungsweise über 44 Millionen Menschen auf der Flucht oder in flüchtlingsähnlichen Situationen (UNHCR, 2005). Sie fliehen unter anderem vor Krieg, Verfolgung und anderen Menschenrechtsverletzungen. Der 25 1.1 Organisierte Gewalt 1 THEORIE Anteil derjeniger Flüchtlinge, die aus den genannten Gründen ihre Heimat verlassen haben, ist unbekannt. Ebenso ist unklar, wie viele Menschen organisierte Gewalt erleben, ohne zu fliehen. Gibt es Staatsstrukturen, die das Auftreten organisierter Gewalt begünstigen? Nach Neuner (2003) lässt sich zumindest ein Teilaspekt organisierter Gewalt in allen Diktaturen und auch in manchen als demokratisch eingestuften Staaten finden: vom Staat finanzierte Verfolgung, z. B. Folter, extralegale Hinrichtungen oder „Verschwindenlassen“ von Personen. Bürgerkriege oder zwischenstaatliche Kriege können unabhängig von der Staatsstruktur auftreten, ebenso Gewalt, die von terroristischen Gruppierungen ausgeht. Es kommt auch in modernen Rechtsstaaten vor, dass Folter verharmlost und als nicht illegal bezeichnet wird, wenn sie einem bestimmten Zweck dienen soll: So wurden z. B. in den USA im Zusammenhang mit dem Kampf gegen den Terrorismus Folterpraktiken dadurch gerechtfertigt, dass man schnelle Informationen benötigt, um z. B. weitere Anschläge zu verhindern (Summerfield, 2003; Krauthammer, 2005). Erst im Sommer 2007 erließ US-Präsident George W. Bush u. a. unter juristischem Druck ein Folterverbot für Verhöre von Terrorverdächtigen durch den Geheimdienst CIA (Tagesschau vom 20.7.2007). Fakt ist, dass Folter immer die Würde des Gefolterten und damit die Menschenrechte verletzt. Das Folterverbot ist daher unabhängig von einem erhofften Nutzen der Gewaltanwendung nicht relativierbar (amnesty international, 2005b). Abgesehen davon, dass die Befürworter von Folter die Verletzung von Menschenrechten in Kauf nehmen, müssten sie sich zur „Rechtfertigung“ die Frage stellen, ob Folter zur angestrebten Informationsgewinnung überhaupt dienlich ist (Applebaum, 2005). Diese Frage wird jedoch oft nicht gestellt und erst recht nicht beantwortet; Applebaum spricht von einem „Folter-Mythos“ bezogen auf deren Wirksamkeit zur Informationsgewinnung, der bestehe, obwohl es keine hinreichenden Belege dafür gebe. Es werden höchstens Einzelfälle „erfolgreicher“ Folter zitiert (Krauthammer, 2005). Hingegen bestreiten einige in Verhörtechniken erfahrene ehemalige Militärs die Wirksamkeit von Folter zur Informationsgewinnung eindeutig: Die meisten verhörten Personen gäben Informationen auch ohne Gewaltanwendung preis, und unter Gewaltanwendung machten sie wahllos irgendwelche nicht verlässlichen Angaben, nur um die Folter zu beenden. Selbst wenn es Belege für die Wirksamkeit von Folter gäbe, wäre laut amnesty international „eine unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsprinzips angewendete Folterhandlung [...] nicht denkbar. Folter wohnt stets ein zerstörerischer Überschuss inne, der über die bloß präventiv motivierte Aussagenerzwingung weit 26 1.1 Organisierte Gewalt 1 THEORIE hinausgeht und dazu führt, dass zur Brechung des Willens des Aussageunwilligen dessen Psyche gezielt zerstört wird.“ („Nein zur Folter. Ja zum Rechtsstaat.“, amnesty international, 2005b, Januar, www2.amnesty.de/internet/deall.nsf/3c7abab8e052c42fc1256eeb004ce861/9f87934c699e9e5bc1256fb8004f3aad, eingesehen am 22.8.2006). Nach der Anti-Folter-Konvention der Vereinten Nationen (1984) ist Folter folgendermaßen definiert: „... Der Ausdruck ,Folter’ [bezeichnet] jede Handlung, durch die einer Person vorsätzlich große körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt werden, zum Beispiel um von ihr oder einem Dritten eine Aussage oder ein Geständnis zu erlangen, um sie für eine tatsächlich oder mutmaßlich von ihr oder einem Dritten begangene Tat zu bestrafen oder um sie oder einen Dritten einzuschüchtern oder zu nötigen, oder aus einem anderen, auf irgendeiner Art von Diskriminierung beruhenden Grund, wenn diese Schmerzen oder Leiden von einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft handelnden Person, auf deren Veranlassung oder mit deren ausdrücklichem oder stillschweigendem Einverständnis verursacht werden. Der Ausdruck umfasst nicht Schmerzen oder Leiden, die sich lediglich aus gesetzlich zulässigen Sanktionen ergeben, dazu gehören oder damit verbunden sind.“ (Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vom 10. Dezember 1984, Teil 1, Artikel 1, Vereinte Nationen, eingesehen am 24.4.2006 unter www.aufenthaltstitel.de/folter.html) Es scheint also, dass es keine Staatsstruktur gibt, die per se frei von organisierter Gewalt ist. Jedoch begünstigen Staatsformen wie Diktaturen das Auftreten von (organisierter) Gewalt: „Gewalt gedeiht dort, wo Demokratie und Achtung vor Menschenrechten fehlen und die Regierungsgeschäfte schlecht geführt werden. [...] Wahr ist auch, dass Gewalt in Gesellschaften, in denen die Behörden durch ihr eigenes Handeln Gewalt billigen, stärker um sich greift und weiter verbreitet ist. In vielen Gesellschaften ist Gewalt so vorherrschend, dass sie alle Hoffnungen auf eine wirtschaftliche und soziale Entwicklung vereitelt.“ (Nelson Mandela, Weltgesundheitsorganisation WHO „Weltbericht Gewalt und Gesundheit“, Seite V, 2003). Basoglu (1993) analysierte den Jahresbericht von amnesty international von 1992 hinsichtlich berichteter Folter weltweit und beobachteten Zusammenhängen mit bestimmten politischen Umständen in einem Land. Weit verbreitete Folter wur27 1.2 Beispiele organisierter Gewalt 1 THEORIE de eher aus Regionen berichtet, in denen politische und soziale Unruhen, bewaffnete Konflikte und politische Unterdrückung von ethnischen, religiösen oder ursprünglich dort ansässigen Minderheiten oder anderer oppositioneller Gruppen an der Tagesordnung waren. Betrachtet man alleine das Vorkommen von Folter – ungeachtet anderer Formen organisierter Gewalt – so scheint dies in etwa der Hälfte aller Länder weltweit ein Problem zu sein. Basoglu vermutet, dass in seiner Analyse die Zahlen zu Folter bei nicht-politischen Häftlingen möglicherweise deutlich niedriger sein könnten als in Wirklichkeit, da diese Foltervorkommnisse eventuell weniger Medienaufmerksamkeit erhalten als die Folter von politischen Gefangenen. 1.2 Beispiele organisierter Gewalt in ausgewählten Ländern Es sollen hier diejenigen Länder herausgegriffen werden, aus denen in den letzten Jahren die meisten Flüchtlinge einen Asylantrag in Deutschland gestellt haben, die Türkei sowie Serbien und Montenegro (siehe „1.3.2 Zahlen zu Flüchtlingen in Deutschland“). Die überwiegende Mehrheit der aus der Türkei kommenden Asylbewerber waren Kurden. Von den Asylbewerbern aus Serbien und Montenegro waren etwa die Hälfte Albaner, die andere Hälfte setzte sich aus anderen ethnischen Gruppen zusammen. Im Folgenden werden Beispiele organisierter Gewalt aufgeführt, wie sie von amnesty international im Berichtszeitraum 2004 beobachtet wurde (amnesty international, 2005a). Zudem werden Studien angeführt, in denen Einzelheiten zu Vorkommnissen organisierter Gewalt in den genannten Ländern untersucht wurden. Sicherlich stellen die folgenden Ausführungen kein umfassendes Bild aller Vorkommnisse und Formen organisierter Gewalt in der Türkei und in Serbien und Montenegro dar – es ist nicht möglich, das Phänomen an repräsentativen Stichproben zu untersuchen (Basoglu, 1993). Es soll jedoch ein Eindruck davon vermittelt werden, in welcher Form organisierte Gewalt in diesen Ländern vorkommen kann und was vermutlich viele Menschen, die von dort stammen, vorübergehend oder auch bis in die Gegenwart erlebt haben oder erleben. 1.2.1 Türkei Trotz einiger Reformschritte zur Anpassung des türkischen Rechtssystems an internationale Standards kam es in der Türkei auch 2004 bei Inhaftierungen nach wie vor zu Folterungen und Misshandlungen durch die Sicherheitskräfte. Auch wurde gegen abweichende Meinungen mit Gewalt vorgegangen, so wurden etwa Demonstrationen verboten und Teilnehmer friedlicher Protestkundgebungen fest28 1.2 Beispiele organisierter Gewalt 1 THEORIE genommen. Es wurde nicht ausreichend kontrolliert, ob die teilweise verbesserten Haftvorschriften eingehalten werden, und Folter- und Misshandlungsvorwürfen wurde nicht genügend nachgegangen. Es fehlen dort insgesamt nach wie vor unabhängige Mechanismen zur Untersuchung systematischer Übergriffe gegen die Menschenrechte. In Studien mit Folterüberlebenden aus der Türkei nennen Basoglu, Paker, Paker, Özmen, Marks, Incesu, Sahin und Sarimurat (1994) verschiedene Foltermethoden, die ihnen im Interview berichtet wurden: Nahezu alle früheren politischen Aktivisten (55 Personen) hatten Beleidigungen und Schläge erlebt. Zu den sonstigen häufigen Praktiken zählten das Verbinden der Augen, abwechselnd milde und grobe Behandlung durch die Folterer sowie Androhung weiterer Folter und erzwungenes langes Stehen in einer auf Dauer schmerzhaften Position. Etwa die Hälfte der Folterüberlebenden berichtete von Drohungen gegenüber ihrer Familie, mangelnde Versorgung mit Lebensmitteln, Unterbringung in schmutzigen Zellen oder Aufhängen an den Handgelenken. Zu den seltenen Praktiken zählten das Untertauchen in Wasser oder anderen Flüssigkeiten, das Anbringen von Nadeln unter den Finger- oder Zehennägeln, Verbrennungen, Überstrecken von Gliedmaßen und Vergewaltigung (Basoglu et al. hatten jeweils mehr Männer als Frauen befragt). Im Vergleich zu diesen Angaben wurden Folterüberlebenden, die nicht politisch aktiv gewesen waren (34 Personen), weniger häufig die Augen verbunden, es gab weniger abwechselnd milde und grobe Behandlung, sie hatten eher die Möglichkeit zur Körperpflege und erhielten weniger Elektroschocks. Des Weiteren wurden sie weniger von anderen isoliert und in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, sie erhielten öfter medizinische Hilfe und wurden nicht in verschmutzten Räumlichkeiten untergebracht. Zudem wurden sie weniger daran gehindert, auf die Toilette zu gehen, und mussten weniger in unbequemen Positionen stehen. Die sonstigen Foltererfahrungen deckten sich mit denen der politischen Aktivisten (Basoglu, Mineka, Paker, Aker, Livanou & Gök, 1997). Moisander und Edston (2003) befragten Folterüberlebende aus Bangladesh, dem Iran, Peru, Syrien, der Türkei und Uganda, um Unterschiede in den Foltermethoden verschiedener Länder und die Krankheitsfolgen der Folter zu erfassen. Von den 25 aus der Türkei stammenden Befragten wurden 84 % auf die Fußsohlen geschlagen (Falaka), davon wurden 12 % währenddessen auf einen Autoreifen gebunden. Über die Hälfte berichtete von Elektroschocks, 68 % waren in irgendeiner Weise aufgehängt worden. Folter an den Genitalien hatten 40 % der Überlebenden angegeben, 28 % waren vergewaltigt worden (vaginaler oder analer Verkehr oder 29 1.2 Beispiele organisierter Gewalt 1 THEORIE Penetration mit einem Stock, einer Flasche o. ä.). Von Scheinhinrichtungen berichteten 8 % der Befragten, 4 % wurden an Finger- oder Fußnägeln misshandelt. 1.2.2 Serbien und Montenegro In Serbien und Montenegro fanden 2004 verschiedene Menschenrechtsverletzungen statt. So wurden unter anderem Misshandlungen und Folterungen zur Erpressung von Aussagen durch die Polizei gemeldet, und frühere Fälle wurden nicht ausreichend untersucht. Es kam auch zu Ausschreitungen gegen Minderheiten, z. B. wurden in Nis und Belgrad Moscheen zerstört. Angehörige der Volksgruppe der Roma wurden diskriminiert, so lebten die meisten von ihnen beispielsweise in Siedlungen mit niedrigem hygienischen Standard, sie haben einen erschwerten Zugang zu Bildung und Arbeitsplätzen. In Serbien gab es behördliche Versuche, die Lage der Roma zu verbessern. Diese zeigten jedoch noch keine große Wirkung. In Montenegro gab es hingegen nicht einmal Ansätze, die Diskriminierungen von Roma zu verringern. Auch Gewalt gegen Frauen, z. B. in Form von Menschenhandel und Zwangsprostitution, fand im Berichtszeitraum statt. Kam es in diesem Zusammenhang zu Strafprozessen, erhielten die Angeklagten oft milde Strafen. In einer Untersuchung zur Prävalenz psychiatrischer Erkrankungen nach dem Krieg im Kosovo 1998/99 in der albanischen Bevölkerung erhoben Lopes Cardozo, Vergara, Agani und Gotway (2000) bei 1358 Erwachsenen folgende Erlebnisse organisierter Gewalt: Über 66 % der Befragten waren in Gefechtssituationen gewesen, nahezu die Hälfte gab an, Folter oder Misshandlungen erlebt zu haben (es wurde keine Definition von „Folter“ oder „Misshandlung“ vorgegeben). Aktiv an Kämpfen beteiligt waren 33 % der Befragten oder andere Personen aus deren Familien. Über ein Viertel hatte ein ermordetes Familienmitglied oder einen Freund zu beklagen, 23 % wurden Zeugen von Mord an fremden Personen. Nahezu 10 % der Befragten waren in Haft gewesen, 4,4 % der Frauen waren vergewaltigt worden. In Hinblick auf die Vergewaltigungen wurde hier jedoch nicht erfragt, durch wen die Vergewaltigungen begangen wurden, da die Interviews nicht ausschließlich auf das Erheben organisierter Gewalt ausgerichtet waren. Es bleibt also offen, ob es sich bei diesen Vergewaltigungen um eine Form organisierter Gewalt gehandelt hat. Eytan, Gex-Fabry, Toscani, Deroo, Loutan und Bovier (2004) führten zwei Jahre nach Ende des Krieges im Kosovo eine Studie mit albanischen Erwachsenen durch. Von den befragten 996 Personen waren 86 % in einer Kampfsituation gewesen, 36 % hatten beobachtet, wie eine fremde Person ermordet worden war, 28 % waren gefol- 30 1.3 Flüchtlinge in Deutschland 1 THEORIE tert worden, von Ermordung oder anderweitig unnatürlichem Tod eines Familienmitglieds oder Freundes berichteten 27 % bzw. 9 % der Befragten, und 3 % waren in Gefangenschaft gewesen. 1.3 Flüchtlinge in Deutschland Wie unter 1.1.3 („Zahlen und Fakten zu organisierter Gewalt“) bereits erwähnt, befinden sich laut UNHCR weltweit schätzungsweise über 44 Millionen Menschen auf der Flucht oder in flüchtlingsähnlichen Situationen (UNHCR, 2005). Letzteres kann z. B. bedeuten, dass jemand innerhalb seines Heimatlandes vertrieben wurde, wieder in die Heimat zurückgekehrt und dort schutzbedürftig ist oder außerhalb des Heimatlandes vorübergehend Schutz gefunden hat, ohne dass er den vollen Rechtsstatus eines Flüchtlings erhielte. Fluchtgründe sind unter anderem Krieg, Verfolgung und weitere massive Menschenrechtsverletzungen. In der Alltagssprache wird eine Person als Flüchtling bezeichnet, die durch politische Zwangsmaßnahmen, Kriege oder existenzgefährdende Notlagen veranlasst wurde, ihre Heimat vorübergehend oder auf Dauer zu verlassen. Im Folgenden wird der Begriff „Flüchtling“ meist in seiner alltagssprachlichen Bedeutung benutzt. Im juristischen Kontext bezeichnet der Begriff hingegen einen bestimmten Status, der einer Person zu- oder aberkannt wird (Ausländerrecht, 2005). 1.3.1 Definition „Flüchtling“ nach der Genfer Konvention Als Flüchtling gilt nach der Genfer Konvention von 1951 eine Person, die „aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder will“ (Genfer Flüchtlingskonvention, UNHCR, 1951, Kapitel I, Artikel 1 A.). Dies schließt auch Kriegsflüchtlinge ein. In dieser Definition nicht berücksichtigt sind Binnenflüchtlinge, die innerhalb ihres Landes geflohen sind und auch als „Vertriebene“ bezeichnet werden. Zudem klammert die Definition Elends- und Umweltflüchtlinge sowie Wirtschaftsflüchtlinge aus. Bis Flüchtlinge einen offiziellen Flüchtlingsstatus erlangt haben, gelten sie als Asyl Suchende oder Asylbewerber. Wird ihr Status als Flüchtling anerkannt, erhalten sie politisches Asyl: Wer nach § 16 a Grundgesetz als Flüchtling gilt, erhält den Status eines Asylberechtigten (Ausländerrecht, 2005). 31 1.3 Flüchtlinge in Deutschland 1.3.2 1 THEORIE Zahlen zu Flüchtlingen in Deutschland Flüchtlinge in Deutschland kommen hauptsächlich aus anderen Ländern Europas, häufig Zentral- und Osteuropa (Carta, Bernal, Harday & Haro-Abad, 2005). Von 1953 bis Ende 2004 wurden in Deutschland etwa 3,1 Millionen Asylanträge gestellt, davon drei Viertel im Zeitraum nach 1990 (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2006). 1992 wurden die meisten Asylanträge gestellt (438.191), seither geht die Zahl der Anträge pro Jahr zurück. So wurden beispielsweise im Jahr 2005 lediglich 48.102 Anträge gestellt. Davon wurden 27.452, also 57,1 %, als unbegründet oder offensichtlich unbegründet abgelehnt. Nicht berücksichtigt sind hierbei die formellen Entscheidungen über Asylanträge, das heißt die Fälle, in denen das Asylvorbringen nicht näher inhaltlich überprüft wird (z. B. Ablehnung des Asylantrags auf Durchführung eines weiteren Asylverfahrens oder Einstellung des Verfahrens wegen Antragsrücknahme durch den Asylbewerber). Diese belaufen sich auf 36,4 %. Insgesamt sind 2005 lediglich 411 (0,9 %) aller Asylbewerber aufgrund politischer Verfolgung als Asylberechtigte nach Artikel 16 a Grundgesetz und Familienasyl anerkannt worden. Vergleicht man diese Zahlen mit denjenigen seit 1991, wird deutlich, dass einerseits insgesamt immer weniger Anträge gestellt wurden, andererseits aber auch der Anteil derjeniger Asylbewerber, die als Asylberechtigte anerkannt wurden oder bei denen Abschiebehindernisse festgestellt wurden, zurückging. So wurden im Jahr 1995 beispielsweise 9 % der Asylbewerber als Asylberechtigte anerkannt, der höchste Prozentsatz zwischen 1991 und 2005. Im Jahr 2001 waren es 5,3 %, 2004 noch 1,5 %. Im Jahr 2005 wurde bei 4,3 % der Asylbewerber Abschiebeschutz gemäß § 60 Absatz 1 gewährt, bei 1,4 % ein Abschiebungsverbot gemäß § 60 Absätze 2, 3, 5 oder 7 festgestellt. Zu letzteren liegen lediglich Daten seit 1999 vor, die Quote war seither stets ähnlich gering. Abschiebeschutz nach (seit 1.1.2005) § 60 Abs. 1 wurde seit 2001 immer weniger gewährt (zu dem Zeitpunkt lag die Quote bei einem Spitzenwert von etwa 15 %), der Vergleich von 2004 mit 2005 zeigt allerdings einen leichten Anstieg von 1,8 % auf die genannten 4,3 %. Betrachtet man die zugangsstärksten Herkunftsländer bezüglich Erstanträgen auf Asyl zwischen 1995 und 2004, stellen Serbien und Montenegro (zuvor Bundesrepublik Jugoslawien) sowie die Türkei die beiden Länder mit den höchsten Zugangszahlen dar. Lediglich im Jahr 2000 rückte der Irak vor die Türkei auf Platz zwei. Auch im Jahr 2005 wurden die meisten Erstanträge von Personen aus der Türkei (10,2 %) und Serbien und Montenegro (19,1 %) gestellt: Es wurden 2958 Erstund 3027 Folgeanträge von türkischen Flüchtlingen gestellt, davon wurden 2922 als 32 1.3 Flüchtlinge in Deutschland 1 THEORIE unbegründet oder offensichtlich unbegründet abgelehnt, und bei 2347 wurden formelle Entscheidungen über die Asylanträge getroffen (inhaltlich nicht näher überprüft worden, siehe oben). Flüchtlinge aus Serbien und Montenegro stellten entsprechend 5522 Erst- sowie 5437 Folgeanträge. Davon wurden 4752 als unbegründet oder offensichtlich unbegründet abgelehnt. Bei 6100 wurden formelle Entscheidungen über die Asylanträge getroffen (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2006). 1.3.3 Rechtliche Situation von Asylbewerbern in Deutschland Aufenthaltsgesetz Seit dem 1.1.2005 ist das Zuwanderungsgesetz in Kraft. Dieses enthält das Aufenthaltsgesetz, das das bisherige Ausländergesetz ersetzt (Ausländerrecht, 2005). In Hinblick auf verschiedene Aufenthaltstitel ist die Gesetzeslage nun vereinfacht: Es gibt lediglich noch die Titel „Visum“, befristete „Aufenthaltserlaubnis“, unbefristete „Niederlassungserlaubnis“ und „Aufenthaltsgestattung“, ein Aufenthaltstitel zur Durchführung des Asylverfahrens. Zuvor gab es die Titel „Aufenthaltsberechtigung“ (zeitlich und räumlich unbeschränkt, § 27), „Aufenthaltserlaubnis“ (befristet oder unbefristet, ohne Bindung an einen bestimmten Aufenthaltszweck und bei Familiennachzug, §§ 15 und 17), „Aufenthaltsbewilligung“ (an einen Zweck gebunden und vorübergehend, auch für Familienangehörige, §§ 28 und 29), „Aufenthaltsbefugnis“ (wird aus humanitären Gründen erteilt, § 30). Nach wie vor existiert ein Paragraph zur „Vorübergehenden Aussetzung der Abschiebung (Duldung)“ (§ 60 a Aufenthaltsgesetz, vor 2005: §§ 55 und 56 Ausländergesetz), der dann in Kraft tritt, wenn eine Abschiebung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist und die Person keine Aufenthaltserlaubnis hat (Ausländerrecht, 2005). Am 31.12.2004 hatten in Deutschland 13.945 Asylbewerber aus der Türkei und 23.285 aus Serbien und Montenegro (Länder, aus denen zum Zeitpunkt der Studie die meisten Asylbewerber kamen) eine Duldung (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2005). Die durchschnittliche Dauer von Asylverfahren, die im Jahr 2004 letztinstanzlich abgeschlossen wurden, betrug 21,3 Monate. Das heißt, dass viele Asylbewerber ein Jahr oder länger in einer unklaren Lebenssituation bleiben. Laut PRO ASYL (2004) leben von den insgesamt 217.000 Geduldeten aller Nationalitäten ca. 150.000 bereits länger als fünf Jahre in Deutschland. Es gibt verschiedene Abschiebehindernisse, d. h. Gründe, aus denen ein Asylbewerber (zunächst) nicht abgeschoben wird (Ausländerrecht, 2005): Zuerst gilt nach Artikel 16 a des Grundgesetzes, dass politisch Verfolgte Asylrecht genießen. 33 1.3 Flüchtlinge in Deutschland 1 THEORIE Darüber hinaus haben nach dem neuen Zuwanderungsgesetz Personen Anspruch auf Schutz, bei denen Abschiebehindernisse nach § 60 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen (im Ausländergesetz vor 2005: §§ 51 und 53). Dieser Paragraph besagt, dass ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden kann, in dem er aufgrund seiner Rasse, Staatsangehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist. Auch die Bedrohung alleine aufgrund des Geschlechts der Person ist hiermit erfasst. Der Paragraph findet dann Anwendung, wenn eine Person Gefahr läuft, der Folter unterworfen zu werden, Opfer von Menschenrechtsverletzungen zu werden, oder wenn eine erhebliche konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit der Person besteht. Auch eine Krankheit oder mangelnde Behandlungsmöglichkeiten im Herkunftsland können Abschiebehindernisse darstellen (Zenker, 2006). Wie unter „1.3.2 Zahlen zu Flüchtlingen in Deutschland“ bereits angeführt, wurde 2005 nur einem sehr geringen Anteil von insgesamt weniger als 7 % aller Asylbewerber, deren Verfahren in dem Jahr abgeschlossen wurden, einer der genannten Paragraphen zuerkannt. In § 25 Absätze 1, 2 und 3 des Aufenthaltsgesetzes ist festgelegt, dass Ausländern, die unanfechtbar als Asylberechtigte gelten oder für die Abschiebehindernisse nach § 60 vorliegen, grundsätzlich eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden soll. In § 25 Absatz 4 ist festgelegt, dass ein Ausländer vorübergehend eine Aufenthaltserlaubnis erhalten kann, solange dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen seine vorübergehende weitere Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern. Eine Aufenthaltserlaubnis kann u. U. verlängert werden, wenn im Einzelfall das Verlassen des Bundesgebiets für den Ausländer eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde. amnesty international merkt im Jahresbericht 2005 an, dass es im neuen Zuwanderungsgesetz zwar einige Verbesserungen in Hinblick auf die Anerkennung als Flüchtling auch bei nichtstaatlicher oder geschlechtsspezifischer Verfolgung gibt, jedoch auch für viele Menschen ohne Aufenthaltstitel und Asylsuchende die Gefahr besteht, dass sich ihre Rechtsstellung durch die neuen Bestimmungen verschlechtert (amnesty international, 2005a). PRO ASYL (2004) kritisiert, dass das neue Zuwanderungsgesetz in vielen Problembereichen keine Lösungsansätze mit sich bringt, so gibt es z. B. nach wie vor keine Änderung bei der Praxis der Abschiebungshaft und keine obligatorische Verfahrensberatung. In einer Evaluation des geänderten Gesetzes, die u. a. von PRO ASYL auf Nachfrage des Bundesministeriums des Inneren durchgeführt wurde, kommt PRO ASYL (2006) nach einem Jahr zu dem Schluss, dass wichtige Ziele wie z. B. die Abschaffung von so genannten Kettenduldungen (ständige erneute Verlängerung der Duldung u. U. über mehre34 1.3 Flüchtlinge in Deutschland 1 THEORIE re Jahre), eine effektive Härtefallregelung sowie insgesamt eine Verbesserung des Flüchtlingsschutzes nicht erreicht wurden. Kettenduldungen sollten eigentlich mit einem Paragraphen des neuen Aufenthaltsgesetzes abgeschafft werden, der besagt, dass eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden soll, wenn die Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt ist und die Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist und mit dem Wegfall der Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist (Ausländerrecht, 2005). Aufenthaltsstatistiken zeigen, dass es nach der Gesetzesänderung auch nach der Frist von 18 Monaten ausgesetzter Abschiebung weiterhin zur Erteilung aufeinanderfolgender Duldungen kommt: Nach einer Bundestagsmitteilung auf eine Anfrage der Fraktion „Die Linke“ (Bundestag, 2005) leben über 170.000 geduldete Personen bereits seit über zwei Jahren in Deutschland, und 48.000 befinden sich schon über zehn Jahre im Land, ohne dass ihre Asylverfahren abgeschlossen worden wären. Hinzu kommt, dass diejenigen Geduldeten, deren Asylantrag als „offensichtlich unbegründet“ (o. u.) nach § 30 Absatz 3 des Asylverfahrensgesetzes abgelehnt wurde, keine Chance auf einen Aufenthaltstitel haben, da dies bereits mit der Einschätzung des Antrags als „o. u.“ nach § 10 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes wegfällt (PRO ASYL, 2006). PRO ASYL (2006) nennt eine Reihe weiterer Probleme aufgrund umstrittener Rechtsauslegung in der praktischen Umsetzung des Gesetzes: So stellen z. B. viele Ausländerbehörden keine Aufenthaltserlaubnis aus, weil die Person keinen Pass vorlegen kann. Es kommt zu Verweigerungen oder erheblichen Verzögerungen der Aufenthaltserlaubnis, da argumentiert wird, dass der Ausländer seiner Mitwirkungspflicht bei der Passbeschaffung nicht nachgekommen sei. Jedoch ist im Gesetz festgelegt, dass in den Fällen des § 25 Abs. 1 bis 3 (Aufenthalt aus humanitären Gründen) Passbeschaffungspflicht und Pflicht zur Identitätsklärung nachrangig sind. Ein weiteres Beispiel ist, dass manche Ausländerbehörden (meist angewiesen von den Innenministerien) die Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes verweigern mit der Begründung, es würden demnächst die rechtsbegründenden Voraussetzungen nach § 60, Absätzen 2, 3, 5 oder 7 wegfallen, oder sobald ein Widerrufsverfahren eingeleitet wurde. Generell kritisiert PRO ASYL (2006), dass die statistische Erfassung von Daten, die zur Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes notwendig sind, mangelhaft sei. So wurden bisher beispielsweise im Ausländerzentralregister, das seit 1.1.2005 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geführt wird, nicht erfasst, welche Aufenthaltszwecke einer Niederlassungs- oder Aufenthaltserlaubnis zugrunde liegen oder wie der Status einer Person vor Erteilung des Aufenthaltstitels war. 35 1.3 Flüchtlinge in Deutschland 1 THEORIE Zudem bezweifelt PRO ASYL (2006), dass die Anhörungs- und Entscheidungspraxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge dem Schutzbedürfnis der Asylantragsteller Rechnung trägt, und fordert eine effektive Qualitätskontrolle der Asylentscheidungen innerhalb des Amtes. Regelungen zur Lebenssituation von Flüchtlingen Ausländer, die einen Antrag auf Asyl in der Bundesrepublik Deutschland stellen, sind verpflichtet, mindestens sechs Wochen, längstens bis zu drei Monate in einer (Erst)Aufnahmeeinrichtung zu wohnen (§ 47 Asylverfahrensgesetz, Ausländerrecht, 2005). Endet diese Verpflichtung, sollen sie in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden (§ 53 Asylverfahrensgesetz). Asylbewerber leben in Gemeinschaftsunterkünften häufig in beengten Wohnverhältnissen. Es werden zwei Beispiele von Berichten aus Unterkünften in Lebach (Saarland) und Duisburg angeführt: Die Gemeinschaftsunterkunft Lebach wurde vom äußeren Erscheinungsbild und für vorübergehende Unterbringung für zufriedenstellend erachtet. Jedoch gibt es Probleme z. B. aufgrund der hohen Belegungsdichte. Es wohnen zwei bis fünf Asylbewerber in einem Raum. Eine vierköpfige Familie hat beispielsweise zwei Etagenbetten, einen Kleiderschrank, einen Tisch mit vier Stühlen und einen Kühlschrank zur Verfügung. Es existieren Gemeinschaftsküchen und -waschräume. Damit sind nach Ansicht der zuständigen Behörde die Grundbedürfnisse gedeckt. Problematisch ist, dass es keine Rückzugsmöglichkeiten gibt, dass z. B. Kinder und Jugendliche keine Möglichkeiten haben, ihre Hausaufgaben in Ruhe zu erledigen. Auch das Zusammenleben von Eltern als Paar ist schwierig, das Sexualleben ist oft gestört oder findet überhaupt nicht mehr statt (isoplan consult, 2005). In den Gemeinschaftsunterkünften in Duisburg stehen jedem Asylbewerber etwa zehn Quadratmeter Raum zu. Einzelpersonen wohnen zumeist in Mehrbettzimmern mit Gemeinschaftsküche, -dusche und -toilette (Lillig, 2004). Das Flüchtlingsaufnahmegesetz in Baden-Württemberg von 1998 weist an, pro Person in einer vorläufigen Unterbringung (Gemeinschaftsunterkunft) 4,5 Quadratmeter Wohn- und Schlaffläche zuzüglich der Gemeinschaftsräume zugrunde zu legen (FLüAG, 1998). Solange ein Asylbewerber eine Aufenthaltsgestattung zur Durchführung des Asylverfahrens (§ 55 Asylverfahrensgesetz) hat, darf er den Bezirk der zuständigen Ausländerbehörde nicht bzw. nur aus zwingenden Gründen, z. T. mit Genehmigung des Bundesamtes, verlassen (§§ 56 und 57 Asylverfahrensgesetz). Laut PRO 36 1.3 Flüchtlinge in Deutschland 1 THEORIE ASYL (2004) ist Deutschland mit dieser Form der Residenzpflicht eines der restriktivsten Länder in Europa. Es wird z. B. nicht berücksichtigt, inwieweit in dem festgelegten Aufenthaltsgebiet für den Asylbewerber die Möglichkeit besteht, mit Hilfsorganisationen oder einem Rechtsbeistand in Kontakt zu treten, medizinische Einrichtungen zu erreichen oder Sprachkurse besuchen zu können. Dies schränkt vor allem bei abgelegenen Unterkünften die Freiheit und Integrationsmöglichkeiten der Asylbewerber ein (Europäisches Netzwerk ICF, oJ, eingesehen 2006). Im ersten Jahr ist es einem Asylbewerber zudem nicht gestattet, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, danach kann er eine Erlaubnis dafür erhalten (§ 61 Asylverfahrensgesetz). Insbesondere für Geduldete ist es auch nach Ablauf des ersten Jahres häufig schwierig, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen (PRO ASYL, 2006). Dies hängt mit der Regelung zusammen, dass EU-Bürgern oder Drittstaatsangehörigen mit rechtmäßigem Aufenthalt bei der Besetzung eines Arbeitsplatzes Vorrang eingeräumt werden kann, was in der Praxis sehr restriktiv umgesetzt wird (Europäisches Netzwerk ICF, oJ, eingesehen 2006). Nach § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts durch Sachleistungen gedeckt, zusätzlich erhalten Asylbewerber ein geringes Taschengeld (zum Zeitpunkt des Gesetzerlasses 1997 waren es 80 Deutsche Mark pro Monat für einen über 15jährigen Asylbewerber). Es besteht für Asylbewerber keine Möglichkeit, Arbeitslosengeld II (ALG II) zu beantragen. Die Zuwendungen des Asylbewerberleistungsgesetzes liegen etwa 35 % unter dem Satz des ALG II. Gesundheitsleistungen für Ausländer in Deutschland sind je nach Aufenthaltsstatus nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder nach dem Sozialhilfegesetz geregelt (Flüchtlingshilfe Berlin, 2006). Für die Gestattung einer Behandlung muss das Sozialamt die finanzielle Notlage und den Behandlungsbedarf der Person anerkennen. Ein uneingeschränkter Behandlungsanspruch besteht bei akuten Erkrankungen oder Schmerzzuständen, Einschränkungen gibt es unter Umständen beim Zahnersatz. Laut Flüchtlingshilfe Berlin (2006) ist der rechtlich festgelegte Behandlungsumfang für Ausländer in fast allen Fällen derselbe wie der Behandlungsanspruch deutscher Staatsbürger, jedoch kommt es in der Praxis häufig zu rechtswidrigen Ablehnungen von Behandlungsanträgen durch Sozialämter und Amtsärzte aufgrund mangelnder Kenntnis der Rechtsgrundlagen des Asylbewerberleistungsund des Sozialgesetzes. Beispielsweise wird oft irrtümlich angenommen, dass die Behandlung einer chronischen Erkrankung nicht gestattet werden darf. Dies ist jedoch nicht der Fall, denn es besteht ein Behandlungsanspruch bei akuten oder 37 1.3 Flüchtlinge in Deutschland 1 THEORIE schmerzhaften Erkrankungen, nicht etwa lediglich bei akuten und schmerzhaften Zuständen. D. h. im Falle einer schmerzhaften chronischen Erkrankung besteht ebenfalls Behandlungsanspruch. Allgemein sollten solche Behandlungen gestattet werden, die zur Sicherung der Gesundheit unerlässlich sind. Dies ist immer dann der Fall, wenn bei Nichtbehandlung eine wesentliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes, Folgeerkrankungen oder dauerhafte, nicht wieder gutzumachende gesundheitliche Beeinträchtigungen drohen. PRO ASYL (2006) fordert, dass bei Anzeichen von Traumatisierungen das Verfahren ausgesetzt und dem Asylsuchenden die Möglichkeit gegeben werden sollte, fachärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dies sollte sowohl zur therapeutischen Behandlung als auch zu Beweiszwecken dienen. Zudem sollte den Betroffenen bereits während des Verfahrens eine Aufenthaltserlaubnis gegeben werden, um den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Der Rat der Europäischen Union hat 2003 eine Richtlinie zur Festlegung von Mindestnormen bei der Aufnahme von Flüchtlingen in den EU-Mitgliedsstaaten vorgelegt. Diese sollen sicherstellen, dass Asylbewerbern innerhalb der EU ein vergleichbarer, menschenwürdiger Lebensstandard gewährleistet wird (Rat der Europäischen Union, 2003). Das Europäische Netzwerk ICF (Informations- und Kommunikationsforum) hat Recherchen über die Einhaltung dieser Mindestnormen angestellt und kommt zu dem Schluss, dass die Richtlinie in vielerlei Hinsicht von den Mitgliedsstaaten nicht umgesetzt wurde oder zu viel Spielraum lässt, um möglichst hilfreich für die Betroffenen realisiert zu werden (Europäisches Netzwerk ICF, oJ, eingesehen 2006). Es wurde zudem darauf hingewiesen, dass es sich um Mindestnormen handelt und jeder Mitgliedsstaat die Freiheit hat, über diese Normen hinaus für bessere Lebensbedingungen der Asylbewerber zu sorgen. An Versäumnissen in der Umsetzung der Richtlinie nennt das ICF beispielsweise, dass die Aufnahmebedingungen für Asylbewerber zwischen den verschiedenen Ländern der EU, jedoch auch innerhalb einzelner Länder noch stark differieren. Auch fehlte es in fast allen der sieben untersuchten Länder (dazu gehörten u. a. Deutschland und Österreich) an psychologischer Betreuung und Therapiemöglichkeiten für Traumatisierte und Folteropfer. Die Standards der Unterbringungen wichen ebenfalls stark voneinander ab und waren laut ICF oftmals „defizitär und geeignet, das Wohlergehen der Insassen drastisch zu beeinträchtigen“ (Europäisches Netzwerk ICF, Unterpunkt „Unterbringung“, eingesehen am 7.8.2006 http://www.proasyl.de/de/informationen/europ-netzwerk-icf/die-eu-aufnahmerichtlinie/index.html). 38 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE Das Erleben organisierter Gewalt kann eine Reihe von Folgen für die psychische Gesundheit einer Person mit sich bringen. Im vorliegenden Kapitel soll ein Überblick über diese möglichen Konsequenzen gegeben werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der posttraumatischen Belastungsstörung, einer der häufigsten psychischen Störungen, die nach Gewalterfahrungen auftreten können (z. B. de Jong et al., 2003; Bichescu, Schauer, Saleptsi, Neculau, Elbert & Neuner, 2005). Die hier beschriebenen Störungen können nicht nur nach dem Erleben organisierter Gewalt, sondern generell nach dem Erleben von Belastungen und traumatischen Erfahrungen entstehen. Zu anderen psychischen Problemen außer PTSD, die auf traumatische Ereignisse folgen können, existieren bislang keine systematischen Studien – in einigen Untersuchungen werden jedoch Zusammenhänge zwischen traumatischen Erlebnissen und verschiedenen psychischen Problemen betrachtet (siehe „1.4.2 Psychische Störungen komorbid zu einer PTSD“, z. B. Perkonigg, Kessler, Storz & Wittchen, 2000; Maercker, Michael, Fehm, Becker & Margraf, 2004). 1.4.1 Posttraumatische Belastungsstörung Das Konzept der posttraumatischen Belastungsstörung (posttraumatic stress disorder, PTSD) beschreibt ein Symptommuster psychischer Probleme, das nach dem Erleben eines traumatischen Ereignisses bei einer Person auftreten kann. Erlebnisse wie Kriege, Naturkatastrophen, Unfälle, Folter oder sexuelle Übergriffe können potenziell traumatisch sein, d. h. vom Betroffenen als extrem bedrohlich bis zur Todesangst erlebt werden und mit Hilflosigkeit oder Entsetzen einhergehen. Auf physiologischer Ebene zeigt sich der subjektiv traumatische Charakter einer Situation als „Alarmreaktion“ des Organismus’ (Schauer et al., 2005), d. h. es finden vielfältige Aktivitäten des autonomen Nervensystems statt, die dem Betroffenen ermöglichen sollen, möglichst effektiv auf die Bedrohung zu reagieren. Dies begünstigt etwa die Flucht aus der Gefahrensituation oder auch den Kampf gegen die Bedrohung. Die Kriterien für das Vorliegen einer PTSD sind in den beiden Diagnosemanualen, dem Diagnostischen und Statistischen Manual psychischer Störungen der Amerikanischen Psychiatrischen Vereinigung DSM-IV (American Psychiatric Association, 1996) sowie der International Classification of Diseases der Weltgesundheitsorganisation ICD-10 (Weltgesundheitsorganisation, 1991), unterschiedlich gefasst, wobei das DSM-IV klarer umgrenzte und striktere Kriterien vorgibt. 39 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE Kriterien für die Diagnose einer PTSD nach DSM-IV und ICD-10 Für die Entwicklung einer PTSD werden nach DSM-IV subjektive und objektive Kriterien für das Erleben einer Situation als traumatisch vorausgesetzt: d. h. das subjektive Erleben der relevanten Situation als traumatisch in der oben beschriebenen Weise sowie eine objektive Gefahr für die körperliche oder seelische Unversehrtheit der Person selbst oder einer anderen Person bis hin zu Lebensgefahr. In der ICD-10 gilt hingegen ein Erlebnis als traumatisch, das in einer Weise eine außergewöhnliche Bedrohung darstellt oder katastrophenartiges Ausmaß hat, so dass dieses Erlebnis bei fast jedem eine tiefe Verstörung hervorrufen würde. Für die Diagnose einer PTSD wird also in beiden Manualen ein ursächliches Ereignis vorausgesetzt. In der ICD-10 (Weltgesundheitsorganisation, 1991) ist die PTSD der Kategorie der Anpassungsstörungen zugeordnet. Diesen ist der Einschluss eines ursächlichen Ereignisses (außergewöhnlich belastendes Lebensereignis oder besondere Lebensveränderung, die zu einer anhaltend unangenehmen Situation geführt hat) zur Diagnosestellung gemeinsam. Darin unterscheidet sich diese diagnostische Kategorie von allen anderen in der ICD-10. Im DSM-IV zählt die PTSD ebenso wie die akute Belastungsstörung zu den Angststörungen. Anpassungsstörungen bilden hier eine eigene Kategorie (American Psychiatric Association, 1996). Im Gegensatz zu einer PTSD, die das Erleben einer subjektiv und objektiv extremen Belastung voraussetzt, erfordert die Diagnose einer Anpassungsstörung nach DSMIV lediglich einen identifizierbaren Stressor beliebigen Schweregrades. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass die Symptome einer Anpassungsstörung spätestens sechs Monate nach Ende der Belastung oder deren Folgen nicht mehr vorhanden sein dürfen. Bei der PTSD wird keine entsprechende zeitliche Einschränkung vorgegeben, die Störung kann theoretisch lebenslang bestehen, selbst wenn das ursächliche Ereignis bereits jahrelang zurückliegt. Zudem kann eine PTSD auch erst längere Zeit nach dem Ereignis einsetzen, ab sechs Monaten bis hin zu Jahren spricht man von einem verzögerten Beginn (siehe weiter unten, Seite 41, „verzögerter Beginn“). Diese Unterscheidungen zwischen Anpassungs- und posttraumatischer Belastungsstörung werden in der ICD-10 in ähnlicher Art und Weise getroffen. Neben einem traumatischen Erlebnis in der Vorgeschichte erfordert die Diagnose einer PTSD das Vorliegen folgender weiterer Kriterien: Wiedererleben: Intrusionen, d. h. unwillkürliche belastende Erinnerungen an das traumatische Erlebnis, Alpträume über das Erlebnis, so genannte Flashbacks, d. h. dissoziative Zustände, in denen die Person sich so verhält, als ob sie das 40 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE Erlebnis in diesem Moment wiedererleben würde, intensives Leid und unangenehme Körperreaktionen bei Erinnerungen an das Erlebnis. Symptome des Wiedererlebens müssen sowohl nach DSM-IV als auch nach ICD-10 für die Diagnosestellung vorhanden sein. Vermeidung: Externale und internale Reize, die mit dem Trauma verbunden sind, werden vermieden. Die Person vermeidet dadurch die unangenehmen Gefühle und Körperreaktionen, die mit den Erinnerungen verbunden sind. Es kann sich unter Umständen um eine Vielzahl solcher Reize handeln, die der Betroffene zu vermeiden sucht – eine mögliche Erklärung dafür ist die Reizgeneralisierung, d. h. für die Person werden auch Reize, die denjenigen während des traumatischen Erlebnisses ähneln, angstauslösend. Man kann aktive und passive Vermeidungssymptome unterscheiden; erstere bezeichnet das absichtliche Wegschieben von Gedanken, Gefühlen und Gesprächen über das Trauma sowie Vermeidung von Orten, Aktivitäten und Personen, die mit dem Trauma assoziiert sind. Passive Vermeidung umfasst Symptome wie Gefühlstaubheit, Interessensverlust, Erinnerungslücken bezüglich des traumatischen Ereignisses, Gefühle einer verkürzten Zukunft und Entfremdungsgefühle gegenüber Mitmenschen. Vermeidungssymptome müssen für eine PTSD-Diagnose nach dem DSM-IV vorhanden sein, während sie in der ICD10 als häufig beobachtbare, jedoch für die Diagnosestellung nicht wesentliche Symptome bezeichnet werden. Übererregung: Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Reizbarkeit, übertriebene Wachsamkeit und Schreckhaftigkeit. Wie bei den Vermeidungssymptomen müssen nach DSM-IV Übererregungssymptome für die Diagnosestellung einer PTSD vorliegen. Laut ICD-10 tragen die genannten Symptome hingegen zur Diagnose bei, sind aber nicht von erstrangiger Bedeutung. Über die genannten Kriterien hinaus, die sowohl in der ICD-10 als auch im DSMIV genannt sind, ist in letzterem festgelegt, dass eine PTSD-Diagnose dann gestellt werden kann, wenn die genannten Kriterien und Symptome über einen Zeitraum von vier Wochen hinaus bestehen. Zudem muss die Symptomatik eine deutliche Funktionsbeeinträchtigung in wesentlichen Lebensbereichen der betroffenen Person mit sich bringen. Man spricht nach DSM-IV von einer chronischen PTSD, wenn die Symptomatik länger als drei Monate andauert. Zudem kann festgelegt werden, ob die Störung innerhalb der ersten sechs Monate nach dem traumatischen Ereignis auftrat oder ob es sich um eine PTSD mit verzögertem Beginn handelt. Die ICD-10 sieht keinen verzögerten Beginn einer PTSD vor. Tritt die Störung erst später als 41 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE sechs Monate nach dem belastenden Erlebnis auf, kann lediglich die „wahrscheinliche“ Diagnose einer PTSD gestellt werden. Es handelt sich um ein relativ neues Konzept: Obwohl der Zusammenhang zwischen belastenden Lebensereignissen und psychischen Störungen bereits bekannt war und z. B. nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Vietnamkrieg vielfach beschrieben wurde, wurde das Störungsbild erst 1980 präziser definiert und in das damalige DSM-III aufgenommen. In die ICD fand die PTSD sogar erst 1990 mit dem Wechsel von der 9. auf die 10. Version Eingang. Weitere häufige Folgen traumatischer Erlebnisse wie z. B. affektive Störungen, Substanzabhängigkeit oder Somatisierungssymptome (z. B. Perkonigg et al., 2000) sind nicht in das stärker umgrenzte PTSD-Konzept mit aufgenommen. Es werden also möglicherweise nicht alle denkbaren Reaktionen auf alle Arten von Traumata im Rahmen einer PTSD ausreichend beschrieben (Foa, Keane & Friedman, 2000). Die genannten anderen psychischen Reaktionen können jedoch als komorbide Störungen zusätzlich zu einer PTSD auftreten und diagnostiziert werden (siehe „1.4.2 Psychische Störungen komorbid zu einer PTSD“). Es gibt auch Hinweise z. B. aus der Reaktion auf psychopharmakologische Behandlung der PTSD (Gaffney, 2003), dass das Symptommuster einer PTSD von anderen psychischen Störungen wie Depression oder (anderen) Angststörungen deutlich abgrenzbar ist. Prävalenz von traumatischen Lebensereignissen und PTSD in der westlichen Allgemeinbevölkerung Es existiert derzeit insgesamt nur eine geringe Anzahl an Studien zur Prävalenz von PTSD in der Allgemeinbevölkerung, die meisten davon wurden in den USA oder in Kanada durchgeführt (Hepp, Gamma, Milos, Eich, Ajdacic-Gross, Rössler, Angst & Schnyder, 2006a). So führten etwa Breslau, Kessler, Chilcoat, Schultz, Davis und Andreski (1998) im Jahr 1996 eine Umfrage in der Allgemeinbevölkerung in der Gegend von Detroit, USA, durch und fanden heraus, dass mehr als 89 % der über 2000 Befragten in der Vergangenheit mindestens ein traumatisches Erlebnis hatten. Jedoch wiesen nur 9,2 % dieser Untergruppe eine PTSD auf (bedingtes PTSD-Risiko über alle traumatischen Erlebnisse hinweg, nicht nur anhand des subjektiv schlimmsten Ereignisses erhoben). Stein, Walker, Hazen und Forde (1997) führten eine Untersuchung in Kanada durch und fanden Prävalenzzahlen von potenziell traumatischen Lebensereignissen bei 45,8 % der befragten Frauen und 55,4 % der Männer. Es litten 2,7 % der Frauen und 1,2 % der Männer zum Zeit- 42 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE punkt des Interviews an einer PTSD. Subsyndromale PTSD-Symptome wurden bei 3,4 % der Frauen und 0,3 % der Männer festgestellt. Für Europa finden sich nur sehr wenige repräsentative Studien, in denen jeweils recht geringe PTSD-Raten zutage kamen: Beispielsweise gaben in einer Untersuchung von Hepp et al. (2006a) im Raum Zürich 28 % der Befragten an, mindestens ein potenziell traumatisches Erlebnis gehabt zu haben. Die Versuchspersonen waren sowohl 1993 als auch 1999 befragt worden. Unter den 28 % mit einem potenziell traumatischen Erlebnis in der Vorgeschichte hatte niemand eine PTSD, es kamen lediglich subsyndromale PTSD-Symptome bei 1,9 % der Befragten (12Monats-Prävalenz, Befragung 1993) bzw. 1,3 % (Befragung 1999) vor. Eine Studie von Perkonigg et al. (2000) im Raum München ergab, dass 21,4 % der interviewten Personen bereits ein Erlebnis hatten, das den objektiven Trauma-Kriterien entsprach. Jedoch waren nur bei 17 % aller Befragten zusätzlich die subjektiven Kriterien für ein traumatisches Erlebnis erfüllt. Es ergaben sich eine Lebenszeitprävalenz für die Entwicklung einer PTSD von 1,3 % und eine 12-Monats-Prävalenz von 0,7 %. Stein, Höfler, Perkonigg, Lieb, Pfister, Maercker und Wittchen (2002) werteten Daten aus derselben Untersuchung aus: Sie bezogen auch Fälle ein, die eine subsyndromale PTSD aufwiesen, und fanden Prävalenzen von 5,6 % PTSD oder subsyndromaler PTSD zum ersten Untersuchungszeitpunkt (von diesem Zeitpunkt stammen auch die Ergebnisse der vorher genannten Studie von Perkonigg et al., 2000) sowie 10,3 % zum letzten Untersuchungszeitpunkt 34 bis 50 Monate später. Maercker et al. (2004) untersuchten eine repräsentative Stichprobe junger Frauen im Raum Dresden und fanden potenziell traumatische Erlebnisse bei einem Viertel der Befragten, ein Fünftel hatte Situationen hinter sich, die auch subjektiv als traumatisch erlebt worden waren (am häufigsten nach Vergewaltigung). Insgesamt hatten 3,2 % der Versuchspersonen eine PTSD. Breslau (2002) weist darauf hin, dass die Methode zur Erhebung potenzieller traumatischer Lebensereignisse einen Einfluss auf die Prävalenzzahlen hat. So führt die Befragung anhand einer Liste von Ereignissen gegenüber etwa einer offenen Frage eher zur Nennung einer größeren Anzahl an potenziell traumatischen Erlebnissen. Hepp, Gamma, Milos, Eih, Ajdacic-Gross, Rössler, Angst und Schnyder (2006b) untersuchten die Konsistenz von Berichten über traumatische Lebensereignisse zu zwei verschiedenen, sechs Jahre auseinander liegenden Zeitpunkten. Es zeigte sich, dass die Berichte teilweise erheblich voneinander abwichen. So berichtete etwa ein Drittel der Probanden erst zum zweiten Zeitpunkt Erlebnisse, die jedoch bereits vor dem ersten Interview stattgefunden hatten, und 40 % der Befragten berichteten ein Lebensereignis, das sie zum ersten Zeitpunkt angegeben hatten, 43 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE zum zweiten Termin nicht mehr. Teilweise konnte die Inkonsistenz der Berichte auf die Art des erlebten Traumas, auf die subjektive Wahrnehmung des Traumas sowie auf die individuellen PTSD-Symptome zurückgeführt werden. Diese Befunde machen deutlich, dass Prävalenzzahlen zu traumatischen Lebensereignissen möglicherweise verzerrt sein könnten und vorsichtig interpretiert werden müssen. Prävalenz der PTSD nach dem Erleben organisierter Gewalt Unter „1.1.3 Zahlen und Fakten zu organisierter Gewalt“ wurde bereits angeführt, dass es schwierig ist, repräsentative Zahlen zu organisierter Gewalt weltweit aufzustellen (Basoglu, 1993). Ebenso lässt sich nicht lückenlos aufdecken, wie häufig Personen nach dem Erleben organisierter Gewalt an einer PTSD erkranken. Beispielsweise erreicht man oft nur Betroffene, die aus ihrem Herkunftsland geflohen sind. Forschung in entsprechenden Ländern mit repressiven politischen Systemen wird häufig nicht gestattet. Untersucht man jedoch die psychische Gesundheit von Personen, die aufgrund von organisierter Gewalt ihre Heimat verlassen haben, so ist oft unklar, ob die erhobenen Symptome von den Gewalterlebnissen herrühren oder aber beispielsweise von Stressoren während der Flucht, von Entwurzelung oder dem aktuellen Flüchtlingsstatus (Basoglu, 1993; Holtz, 1998). Hinsichtlich dieser Fragestellung verglich Holtz (1998) zwei Gruppen von tibetanischen Flüchtlingen – eine davon hatte Folter erlebt, die andere nicht – und fand heraus, dass die gefolterten Flüchtlinge eine deutlich höhere Angstsymptomatik zeigten als die anderen. Jedoch unterschieden sie sich nicht hinsichtlich ihrer Depressionssymptomatik. Dies lässt darauf schließen, dass die Spätfolgen von Folter über die Einflüsse fluchtbezogener Umstände hinausgehen können. Andersherum könnten Belastungen, die im Exil auf Flüchtlinge mit traumatischen Vorerfahrungen einwirken, deren psychische Befindlichkeit zusätzlich beeinträchtigen (Silove & Steel, 1998; siehe „1.4.4 Besonderheiten bei Asylbewerbern“). Auch für Untersuchungen von PTSD nach organisierter Gewalt gelten die oben angeführten Hinweise auf mögliche Verzerrungen in den Angaben der Probanden (siehe oben: Breslau, 2002). Ein weiteres Problem stellen methodische Mängel dar, wie sie z. B. aus dem Gebrauch von Fragebögen, die für die jeweilige Untersuchungssprache nicht validiert sind, oder aus nicht-randomisierten Auswahlverfahren der Stichprobe entstehen können (Neuner, 2003). Ganz allgemein sind die Angaben zu Prävalenz und Komorbidität über verschiedene Studien hinweg oft nicht vergleichbar, da unterschiedliche Untersuchungsinstrumente, Diagnosekriterien oder Interviewmethoden etc. zur Anwendung kamen (Kunzke & Güls, 2003). 44 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE Prävalenz der PTSD in Populationen mit erhöhtem Risiko für das Erleben organisierter Gewalt Die bisher bekannten Prävalenzzahlen zu PTSD nach den Kriterien des DSM-IV in der Allgemeinbevölkerung westlicher Staaten liegen je nach Lebensumständen etwa zwischen 1 und 10 % (siehe weiter oben). Dies umfasst PTSD in der Folge aller Typen von traumatischen Ereignissen, von Unfällen und bis hin zu Gewalterlebnissen. Betrachtet man die Häufigkeit von PTSD in Bevölkerungsgruppen, die ein höheres Risiko für das Erleben traumatischer Ereignisse in Form von organisierter Gewalt hatten – beispielsweise in Ländern, in denen Krieg herrscht(e) oder Folter an der Tagesordnung ist – finden sich meist höhere Prävalenzzahlen. So führten etwa Lopes Cardozo et al. (2000) nach dem Krieg im Kosovo 1998/99 in der albanischen Bevölkerung eine Befragung zu psychischen Erkrankungen durch und fanden eine PTSD-Prävalenz von 17,1 %. Ein hoher Anteil der befragten Personen hatte traumatische Ereignisse erlebt (siehe „1.2.2 Beispiele organisierter Gewalt – Serbien und Montenegro“). Da hier jedoch keine klinischen Interviews durchgeführt wurden, sondern die Teilnehmer selbst Fragebögen ausfüllten, ist fraglich, wie valide die Ergebnisse sind. Eine andere Studie mit Kosovo-Albanern, die teilweise während des Kosovo-Krieges in ihrer Heimat geblieben waren oder diese vorübergehend verlassen hatten, zeigte eine PTSD-Rate von 23,5 % auf (Eytan et al., 2004). Diejenigen Befragten, die ihre Heimat verlassen hatten, litten später signifikant häufiger an einer PTSD. Mollica, McInnes, Sarajlic, Lavelle, Saraljic und Massagli (1999) untersuchten bosnische Flüchtlinge in einem Flüchtlingscamp in Kroatien und fanden eine PTSD-Rate von 26,3 %. Allerdings unterschieden die Forscher nicht zwischen subjektivem und objektivem Traumaerleben, sondern gingen davon aus, dass das Kriterium A eines traumatischen Erlebnisses bei allen Teilnehmern alleine dadurch erfüllt war, dass sie aus ihrer Heimat geflohen waren und nun Flüchtlingsstatus innehatten. Drei Jahre später erfüllten immer noch 45 % der Betroffenen die Kriterien für eine PTSD (Mollica, Sarajlic, Chernoff, Lavelle, Vokovic & Massagli, 2001). Neuner (2003) beschreibt eine große Untersuchung, die in Uganda mit sudanesischen Flüchtlingen durchgeführt wurde. Die Sudanesen waren aufgrund des Bürgerkriegs in ihrem Heimatland geflohen. Es wurden über 1200 sudanesische Flüchtlinge sowie eine ugandische Vergleichsgruppe mit über 650 Personen und eine nicht geflohene sudanesische Vergleichsgruppe mit über 1400 Personen unter anderem zu PTSD-Symptomen befragt. Alle drei Gruppen hatten aufgrund von jahrelangen mehr oder weniger ausgeprägten Unruhen in den jeweiligen Regionen ein erhöhtes Risiko für das Erleben traumatischer Ereignisse. Es zeigte sich eine 45 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE PTSD-Prävalenz von 47,7 % in der Gruppe der Flüchtlinge sowie 48,7 % unter den nicht geflohenen Sudanesen; in der ugandischen Vergleichsgruppe fand sich eine PTSD-Prävalenz von 19,7 %. In einer Untersuchung mit 118 verwaisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Ruanda, die 1994 den Genozid erlebt hatten, fand Schaal (2006) eine Punktprävalenz der PTSD von 33,9 % und eine Lebenszeitprävalenz von 73,7 %. Die Befragten lebten entweder in einem Waisenhaus oder in einem lediglich von Kindern geführten Haushalt. Alle hatten potenziell traumatische Ereignisse erlebt, im Durchschnitt waren es neun. Diese waren keineswegs nur auf den Genozid beschränkt, sondern hatten teilweise auch erst in jüngster Zeit vor dem Interview stattgefunden. In einer weiteren Studie von de Jong et al. (2003) führten die Untersucher diagnostische Interviews in Hinblick auf psychiatrische Störungen in Bevölkerungsgruppen in verschiedenen Ländern nach gewalttätigen Konflikten durch: Sie befragten Personen in Algerien, Kambodscha, Äthiopien und Palästina und unterschieden zwischen denjenigen, die im Rahmen von bewaffneten Konflikten Gewalterfahrungen gemacht hatten, und denen, die nichts dergleichen erlebt hatten. In der Gruppe der Personen ohne solche Gewalterfahrungen hatten 13,2 % der Algerier, 6,9 % der Kambodschaner, 3,9 % der Äthiopier und 2,9 % der Palästinenser eine PTSD. Die Prävalenzzahlen von PTSD unter denjenigen, die im bewaffneten Konflikt potenziell traumatische Erfahrungen gemacht hatten, liegen deutlich höher und werden im nächsten Abschnitt aufgeführt. Prävalenz der PTSD in Stichproben von Überlebenden organisierter Gewalt Die vergleichsweise geringe PTSD-Prävalenz von 18 %, die Basoglu et al. (1994) bei politischen Aktivisten in der Türkei nach Folter gefunden hatten, führen die Autoren darauf zurück, dass diese Gruppe eine Erwartungshaltung und innere Bereitschaft gegenüber möglicher Gefangenschaft und Folter entwickelt hatten, die sie vor einer PTSD schützten (siehe weiter unten, Seite 48, „Risikofaktoren für die Entwicklung einer PTSD“). Untersuchungen einer Vergleichsgruppe von Personen, die ebenfalls gefoltert worden waren, jedoch nicht politisch aktiv waren, bestätigen die Vermutung, dass politisches Engagement mit einem geringeren Risiko für PTSD einhergeht: In der Vergleichsgruppe wiesen 58 % zum Untersuchungszeitpunkt das Symptommuster einer PTSD auf. Neuner (2003) weist allerdings auf die Möglichkeit hin, dass es sich vermutlich nicht um eine repräsentative Stichprobe handelte: Es könnte sein, dass sich aufgrund des Schneeball-Prinzips zur Gewin- 46 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE nung der Versuchspersonen nur Personen zur Teilnahme bereit erklärt haben, die weniger schwer erkrankt waren, und daher die PTSD-Rate vermutlich in Wirklichkeit höher als 18 % ist. In einer Studie von de Jong et al. (2003), in der wie im vorherigen Abschnitt erwähnt Überlebende organisierter Gewalt in Algerien, Kambodscha, Äthiopien und Palästina untersucht wurden, wiesen die Untergruppen mit potenziell traumatischen Erlebnissen aus bewaffneten Konflikten folgende PTSD-Raten auf: 39,5 % der Algerier, 33,4 % der Kambodschaner, 19 % der Äthiopier und 28 % der Palästinenser hatten zum Untersuchungszeitpunkt eine PTSD. Basoglu, Livanou, Crnobaric, Franciskovic, Suljic, Duric und Vranesic (2005) untersuchten eine Stichprobe im ehemaligen Jugoslawien, in der jeder Befragte mindestens eines von verschiedenen kriegsbezogenen traumatischen Erlebnissen gehabt hatte (z. B. Kampferlebnisse, Folter oder Vertreibung). Sie führten eine Untersuchung hinsichtlich psychischer Kriegsfolgen in der Allgemeinbevölkerung im ehemaligen Jugoslawien durch. Unter diesen Personen hatten 22 % zum Untersuchungszeitpunkt eine PTSD, die Lebenszeitprävalenz betrug 33 %. Dass Erfahrungen organisierter Gewalt auch noch lange Zeit danach die Lebensqualität der Betroffenen beeinflussen können, zeigten Bichescu et al. (2005) in einer Untersuchung mit im Schnitt über 70jährigen ehemaligen politischen Häftlingen in Rumänien. Auch lange nachdem sich die politischen Verhältnisse gewandelt hatten, wiesen 30,5 % der Befragten immer noch eine PTSD auf. Unter denjenigen, die die Kriterien einer PTSD nicht vollständig erfüllten, hatten alle bis auf 3 % der Gesamtstichprobe einzelne PTSD-Symptome. Die Gewalterlebnisse lagen im Schnitt knapp über 40 Jahre zurück. Ein weiteres Beispiel für mögliche Langzeitfolgen von organisierter Gewalt bietet eine Studie von Maercker und Schutzwohl (1997), die politische Häftlinge aus der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) untersuchten. Es zeigte sich eine Rate aktuell bestehender PTSD von 30 % der Befragten und eine Lebenszeitprävalenz von 60 %. Alle bisher aufgeführten Studien in diesem Abschnitt wurden jeweils in den Heimatländern der Befragten durchgeführt. Untersuchungen zur PTSD-Prävalenz im Exil werden unter „1.4.4 Besonderheiten bei Asylbewerbern und Flüchtlingen“, am Ende des Kapitels aufgeführt. 47 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE Risikofaktoren für die Entwicklung einer PTSD Wie bereits angeführt, ist ein objektiv und subjektiv traumatisches Erlebnis die Grundlage für die Diagnose einer PTSD (Weltgesundheitsorganisation, 1991; American Psychiatric Association, 1996). Jedoch ist dies allein nicht ausreichend zur Erklärung der Entstehung der Symptomatik, da nur ein geringer Anteil der Betroffenen nach dem Erleben eines traumatischen Ereignisses eine PTSD entwickelt (siehe Seite 42, „Prävalenz von traumatischen Lebensereignissen und PTSD in der westlichen Allgemeinbevölkerung“; McFarlane & Yehuda, 2000). Es kommt bei den Betroffenen zwar möglicherweise zunächst zu Belastungssymptomen, die dann jedoch nicht zwangsläufig chronifizieren (Ehlers & Clark, 2000). Selbst massive potenziell traumatische Lebensereignisse werden weder von allen Menschen im selben Ausmaß subjektiv als traumatisch erlebt noch entwickeln die Betroffenen in der Folge notwendigerweise eine (chronische) PTSD: Basoglu et al. (1997) untersuchten beispielsweise politische Aktivisten aus der Türkei, die auf extreme Weise gefoltert worden waren (siehe „1.2.1 Beispiele organisierter Gewalt - Türkei“). Es wiesen nur 18 % von ihnen zum Untersuchungszeitpunkt eine PTSD auf. Basoglu et al. gehen davon aus, dass „psychologische Bereitschaft“ für mögliche Gefangenschaft und Folter die politischen Aktivisten vor der Entwicklung einer PTSD schützte. Welche weiteren Einflüsse über ein traumatisches Erlebnis hinaus spielen also eine Rolle für die Entwicklung einer PTSD? Es wurden bestimmte Risikofaktoren gefunden, die vor, während oder nach dem Trauma zum Tragen kommen können (beispielsweise das Geschlecht einer Person, psychiatrische Vorerkrankungen, der subjektive Stress während des Traumas oder die Reaktionen anderer Personen nach dem Trauma – eine detaillierte Auflistung folgt weiter unten). Brewin, Andrews und Valentine (2000a) fanden in einer Metaanalyse, dass diese Faktoren eine PTSD zwar verlässlich voraussagten, jedoch lediglich in einem geringen Ausmaß. Die Effekte waren nicht über alle in die Analyse einbezogenen Studien gleichermaßen ausgeprägt. Jedoch ist bei Betrachtung neuere Studien zur Anzahl erlebter Traumata (z. B. Eytan et al., 2004; Neuner, Schauer, Karunakara, Klaschik, Robert & Elbert, 2004a; Mollica, McInnes, Pham, Fawzi, Murphy & Lin, 1998a; Mollica, McInnes, Poole & Tor, 1998b) fraglich, ob sich einige der genannten Faktoren nicht zu einem „DosisFaktor“ zusammenfassen ließen, der eine PTSD in hohem Ausmaß vorauszusagen scheint: Es zeigte sich, dass die Anzahl der erlebten Arten von Traumata einer der stärksten Prädiktoren für die Entwicklung einer PTSD zu sein schien bzw. mit stärker ausgeprägter Symptomschwere einher ging (Eytan et al., 2004; Neuner et al., 48 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE 2004a; Terheggen, Stroebe & Kleber, 2001). Je mehr verschiedene traumatische Erlebnisse eine Person hatte oder je bedrohlicher diese waren, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass sie an einer PTSD erkrankt war („building block“-Effekt der Belastung). Es wird angenommen, dass vermutlich jeder Mensch bei multipler Erfahrung traumatischer Lebensereignisse irgendwann eine PTSD entwickeln würde. D. h. auch Menschen, die zuvor keine Vulnerabilitätsfaktoren aufwiesen, können bei genügend hoher „Trauma-Dosis“ betroffen sein. Diese Dosis ist individuell verschieden, jedoch erfüllten beispielsweise in einer Untersuchung von Neuner et al. (2004a), in der über 3000 Personen im Sudan hinsichtlich PTSD befragt wurden, alle Probanden ab einer Anzahl von mehr als 28 erlebten Typen von traumatischen Erlebnissen die Kriterien einer PTSD. Die Dosis der erlebten Traumata hat nicht nur einen Einfluss auf die Entwicklung einer PTSD, sondern auf die gesamte psychische Gesundheit und das soziale Funktionsniveau einer Person (Lopes Cardozo et al., 2000). Neuner et al. (2004a) merken an, dass es sinnvoll wäre, in Untersuchungen zu Risikofaktoren stets den „building block“-Effekt zu untersuchen. In der genannten Metaanalyse von Brewin et al. (2000a) ist jedoch die Erhebung der Faktoren „vorherige Trauma-Erfahrungen“ und „weiterer Stress nach dem traumatischen Erlebnis“ in den einzelnen analysierten Studien nicht genau beschrieben. D. h. es bleibt unklar, ob das Ausmaß verschiedener traumatischer Vorerfahrungen oder auch nachfolgender Belastungen erhoben wurde oder lediglich danach gefragt wurde, ob je zuvor ein traumatisches Ereignis vorgekommen sei oder es später neue Belastungen gegeben habe. Die Ergebnisse der Metaanalyse werden im Folgenden hier dennoch kurz angeführt: Zu den Risikofaktoren, die bereits vor dem Trauma bestehen, zählen Geschlecht, Alter zum Zeitpunkt des Traumas und Rassenzugehörigkeit, sozioökonomischer Status, Bildung, Intelligenz, vorherige Trauma-Erfahrungen, psychiatrische Erkrankungen in der Vorgeschichte (auf die Person selbst oder auf ihre Familie bezogen) sowie Missbrauch oder andere belastende Einflüsse in der Kindheit. Es zeigte sich über verschiedene Stichproben hinweg, dass psychiatrische Vorerkrankungen beim Probanden oder seiner Familie sowie Missbrauchserlebnisse in der Kindheit relativ konstant die Entwicklung einer PTSD vorhersagten. In allen untersuchten Stichproben mit Ausnahme einer Gruppe, die Kriegserlebnisse gehabt hatte, zeigt sich zudem, dass weibliches Geschlecht durchgehend ein höheres Risiko für eine PTSD bedeutete. Hier bleibt jedoch unklar, ob Frauen allgemein vulnerabler sind oder ob sie beispielsweise eine höhere Dosis an Traumata erlebt hatten – auch hier fehlt zur Beurteilung die genauere Beschreibung des Faktors „früheres TraumaErleben“. Auch niedrigerer sozioökonomischer Status, niedrigere Bildung und In49 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE telligenz sowie frühere psychiatrische Erkrankungen und andere frühere Belastungen sagten eine PTSD in geringem, aber zuverlässigem Maß voraus. Niedrigeres Lebensalter zum Zeitpunkt des Traumas sowie die Rassenzugehörigkeit zu einer Minderheitengruppe – in den untersuchten Studien lediglich als „weiße Mehrheit“ vs. „Minderheiten“ klassifiziert – stellten nicht durchgehend in allen analysierten Stichproben ein Risiko für die Entwicklung einer PTSD dar (Brewin et al., 2000a). Eine Zwillingsstudie von True, Rice, Eisen, Heath, Goldberg, Lyons und Nowak (1993) mit Vietnamveteranen zeigte, dass das Risiko für die Entwicklung einer PTSD nach traumatischen Erfahrungen auch von genetischen Faktoren beeinflusst wird, sogar unabhängig von Unterschieden im Ausmaß der Kriegserfahrungen. Diejenigen Faktoren, die während oder nach dem Trauma zum Tragen kamen, sagten eine PTSD in etwas höherem Ausmaß voraus als solche, die vor dem Trauma bestanden (Brewin et al., 2000a). Risikofaktoren für die Entwicklung einer PTSD, die während des traumatischen Erlebnisses zum Tragen kommen, sind die Schwere des traumatischen Erlebnisses, starke Gefühle von Angst, Hilflosigkeit oder Entsetzen während des Traumas, Gefühle von Scham oder Wut gegenüber anderen sowie dissoziative Erfahrungen während und nach dem Erlebnis. In die genannte Metaanalyse von Brewin und Kollegen wurden lediglich diejenigen Risikofaktoren einbezogen, die in wenigstens vier der analysierten wissenschaftlichen Artikel untersucht worden waren. Aus diesem Grund wurde von den genannten Risikofaktoren während des Erlebnisses lediglich die Schwere des traumatischen Erlebnisses mit berücksichtigt. Diese zeigte sich neben zwei Posttrauma-Faktoren (siehe unten) als einer der drei stärksten Prädiktoren für die Entwicklung einer PTSD in dieser Studie (dennoch bewegen sich diese Einflüsse lediglich im unteren bis mittleren Bereich). Es ist allerdings nicht beschrieben, wie die Schwere der traumatischen Erlebnisse in den jeweiligen Studien erhoben wurde, also ob beispielsweise subjektive oder objektive Schwere-Einschätzungen vorgenommen wurden oder beides erhoben wurde. Die subjektive Schwere des traumatischen Ereignisses war in einer unveröffentlichten Untersuchung von Basoglu und Paker, auf die er in einem anderen Artikel hinweist (Basoglu, 1993), ein Prädiktor für die Entwicklung einer PTSD. Die Studie wurde mit Folterüberlebenden durchgeführt. Es zeigte sich, dass lediglich der wahrgenommene subjektive Stress während der Folter, nicht aber der objektive Schweregrad der Folter eine spätere PTSD voraussagte. Weitere der oben genannten peritraumatischen Risikofaktoren wurden von Brewin, Andrews und Rose (2000b) untersucht. Die Autoren untersuchten die subjektive Einschätzung der Intensität verschiedener traumarelevanter Gefühle der 50 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE Probanden. Sie fanden heraus, dass intensive Angst, Hilflosigkeit oder Entsetzen in hohem Maß eine spätere PTSD vorhersagten. Ein kleiner Teil der Probanden mit ebenso ausgeprägten PTSD-Symptomen berichtete nicht von solchen Gefühlen, jedoch von intensiver traumabezogener Wut und / oder Scham zum Zeitpunkt des Interviews. Diese Emotionen stellten in einer anderen Untersuchung ebenfalls Prädiktoren für eine spätere PTSD dar (Andrews, Brewin, Rose & Kirk, 2000). Briere, Scott und Weathers (2005) untersuchten verschiedene Dissoziationsphänomene als Prädiktoren für die Entwicklung einer PTSD. Es zeigte sich, dass sowohl peritraumatische Dissoziation als auch traumabezogene anhaltende Dissoziation und peritraumatischer Stress als auch bereits vor dem Trauma vorhandene generalisierte Dissoziation PTSD vorhersagten. Jedoch spielte die peritraumatische Dissoziation als Prädiktor keine Rolle mehr, sobald anhaltende Dissoziation vorlag. Briere et al. folgern aus den Befunden, dass peritraumatische Phänomene weniger wichtig für die Entstehung einer späteren PTSD zu sein scheinen als das, das nach dem Trauma geschieht. Nach dem Erleben eines traumatischen Ereignisses spielen folgende Faktoren eine Rolle für die Entwicklung einer PTSD (Brewin et al., 2000a): Stress in der Zeit nach dem Trauma, die Entwicklung einer akuten Belastungsreaktion und fehlende soziale Unterstützung bzw. negative Reaktionen der Umwelt. Letzterer Faktor sagte eine PTSD am stärksten voraus, wenn auch lediglich mit moderatem Einfluss. Brewin und Holmes (2003) merken an, dass negative soziale Erfahrungen wie Indifferenz oder Kritik eine PTSD zuverlässiger voraussagten als lediglich das Fehlen positiver Unterstützung. Darüber hinaus stellte die negative Bewertung des Betroffenen von an sich positiven Unterstützungsangeboten anderer ebenfalls einen Risikofaktor für eine spätere PTSD dar. Ehlers und Clark (2000) stellen in ihrem „Kognitiven Modell der posttraumatischen Belastungsstörung“ den Zusammenhang zwischen Faktoren wie z. B. Grübeln, Sicherheitsverhalten, Vermeidung von Gedanken an das Trauma und dem erhöhten Risiko für die Entwicklung einer PTSD dar (siehe weiter unten). Modelle der posttraumatischen Belastungsstörung Es werden im Folgenden drei neuere Modelle der PTSD vorgestellt sowie die Unterschiede zwischen ihnen aufgezeigt. Implikationen für eine Behandlung werden kurz erwähnt. Es handelt sich um die „dual representation theory“ von Brewin, Dalgleish und Joseph, die „emotional processing theory“ von Foa und Rothbaum 51 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE sowie das Kognitive Modell der posttraumatischen Belastungsstörung nach Ehlers und Clark. Die „dual representation theory“ von Brewin, Dalgleish und Joseph Brewin, Dalgleish und Joseph (1996) entwickelten ein Modell der PTSD, das von zwei verschiedenen, parallel arbeitenden Gedächtnissystemen ausgeht. Die Autoren beschreiben einerseits das „verbally accessive memory“ (VAM), das willentlich abrufbare, in einen autobiografischen Kontext eingebundene, bewusst wahrgenommene Informationen enthält. Jedoch ist angesichts einer bedrohlichen Situation die Kapazität des VAM stark eingeschränkt. Der Abruf von VAM ist von so genannten primären Emotionen begleitet, die während des traumatischen Erlebnisses aufgetreten waren, aber auch von sekundären Emotionen, die aus rückblickenden Bewertungen des Traumas entstehen. Auf der anderen Seite steht das „situationally accessible memory“ (SAM), das Informationen enthält, die auf weniger bewussten Ebenen wahrgenommen wurden und nicht willentlich abrufbar sind. Solche Informationen sind z. B. Veränderungen im Körper oder sehr kurz präsente sensorische Eindrücke, die kaum bewusst wahrgenommen werden konnten und deshalb nicht im VAM gespeichert wurden. Erinnerungen dieser Art sind lediglich von den oben bereits genannten primären Emotionen begleitet. Brewin et al. betrachten neuropsychologische Befunde als Untermauerung der „dual representation theory“: Das VAM ist mit dem Hippocampus assoziiert, der bewusste Informationen kohärent und eingebettet in einen zeitlichen und räumlichen Kontext speichert und der bei höherem Stress zunächst effizienter arbeitet, was bei andauerndem, intensivem Stress jedoch wieder abnimmt. Diese anhaltende Belastung beeinträchtigt das Funktionieren des Hippocampus. So erklären die Autoren, dass die Inhalte des VAM für ein traumatisches Ereignis oft lückenhaft und desorganisiert sind. Das SAM ist wiederum mit der Amygdala assoziiert, in der Informationen ohne kontextuelle Einbindung gespeichert werden und die bei höherem Stress allgemein mehr Aktivität zeigt. Die fehlende zeitliche Einbettung der Erinnerungen führt beim Abruf zu einem Hier-und-Jetzt-Gefühl, durch das Flashbacks charakterisiert sind. Dadurch, dass beständig der Eindruck von Gefahr besteht, kommt es auch zu Aufmerksamkeits- und Erinnerungsverzerrungen. Die Autoren gehen davon aus, dass die traumatischen Gedächtnisrepräsentationen – etwa durch eine Therapie – nicht verändert werden, sondern dass neue Trauma-Erinnerungen etabliert werden, die idealerweise irgendwann näherliegend und somit leichter abrufbar sein sollten als die alten Gedächtnisinhalte. Solange je- 52 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE doch das SAM im Verhältnis zum VAM noch zu viele Informationen enthält, die unzureichend im VAM repräsentiert sind, ist es wahrscheinlicher, dass die alten Trauma-Erinnerungen leichter abrufbar sind. D. h. im neuen VAM sind die Informationen aus dem SAM integriert und somit ebenfalls bewusst abrufbar und in den Kontext eingebettet. Brewin et al. nennen einige Implikationen für die Behandlung einer PTSD, die sich aus der „dual representation theory“ ergeben: Zum einen bestehen therapeutische Ansätze zum Beenden von Flashbacks darin, dass der Betroffene sich auf den Inhalt der Flashbacks konzentrieren soll, anstatt sie zu unterdrücken, um die Erinnerungen aus dem SAM in einen zeitlichen und räumlichen Kontext, also ins VAM-System, einzubetten. Zum anderen sollen negative Bewertungen korrigiert werden: Dies erfordert, dass der Patient explizit über diese Bewertungen spricht. Zur Symptomreduktion ist es notwendig, neue und hilfreichere Gedächtnisrepräsentationen des Traumas zu etablieren, die auch leichter abgerufen werden als die ursprünglichen Repräsentationen. Dabei kommt es nicht darauf an, dass diese neuen Informationen genauer sind oder korrektiven Charakter haben, sie sollen nur leichter aus dem Gedächtnis abrufbar sein (siehe „1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung“). Die „emotional processing theory“ von Foa und Rothbaum Foa und Rothbaum (1998) stellen ein Modell der PTSD auf, das Lerntheorien, kognitive und Persönlichkeitstheorien mit einbezieht und erklärt, warum einige Personen nach einem traumatischen Erlebnis an einer PTSD erkranken, während andere sich wieder erholen. Die Autoren gehen davon aus, dass die Unterschiede zwischen diesen beiden Personengruppen in der Beschaffenheit des Traumagedächtnisses liegen. Dem Modell liegt die kognitive Struktur der Angst zugrunde. Hinsichtlich dieser Struktur übernehmen Foa und Rothbaum die „bioinformational theory of emotion“ von Lang (1979, nach Foa & Rothbaum, 1998). Diese besagt, dass die Angststruktur grundsätzlich hilfreich ist, um vor Gefahren zu fliehen, und Informationen über traumabezogene Reize, Reaktionen und Bedeutungen enthält. Wenn die Bedrohung vorüber ist, lässt im Normalfall auch die Angstreaktion nach. In manchen Fällen wird diese Reaktion jedoch pathologisch: Wenn die Furchtreaktion besonders stark ist (ausgeprägte Vermeidung und physiologische Erregung), wenn die Furchtstruktur unrealistische Informationen enthält und wenn Verbindungen zwischen harmlosen Reizen und Flucht-/Vermeidungsreaktionen bestehen. Die As- 53 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE soziationen und Bewertungen eines normalen Traumagedächtnisses spiegeln die Realität hingegen unverzerrter wider. Die Besonderheit der Angststruktur bei PTSD im Vergleich zu sonstigen pathologischen Strukturen (z. B. bei einfachen Phobien) ist die besonders große Anzahl angstauslösender Stimuli. Die fehlerhaften Annahmen und Assoziationen in der pathologischen Furchtstruktur führen nach Annahme der Autoren dazu, dass der Betroffene sich selbst als inkompetent und die Welt als extrem gefährlich einschätzt. Ob jemand nach einem traumatischen Erlebnis an einer PTSD erkrankt oder sich wieder erholt, hängt von folgenden Faktoren ab: den Schemata, die derjenige über die Welt und sich selbst bereits vor dem Trauma hatte, den Erinnerungen an spezifische Ereignisse vor dem Trauma, den Erinnerungen an das Trauma selbst und den Erinnerungen an die Zeit nach dem Trauma. Diese Faktoren hängen außerdem zusammen, z. B. beeinflussen die bereits bestehenden Schemata die Wahrnehmung der traumatischen Situation. Bereits bestehende Schemata über die eigene Person und die Welt scheinen dann eine pathologische Furchtstruktur zu fördern, wenn sie extrem sind, sowohl in positiver als auch in negativer Richtung. Das Erleben eines traumatischen Ereignisses wird eine besonders positive Sichtweise über sich und die Welt extrem in Frage stellen und so den Betroffenen in seiner Einschätzung von Gefahr stark verunsichern. Hatte jemand zuvor jedoch bereits eine extrem negative Sichtweise seiner selbst und der Welt, so wird diese durch das Erleben eines Traumas bestätigt. Das subjektive Erleben des traumatischen Ereignisses als besonders schwer und starke Gefühle von Hilflosigkeit währenddessen begünstigen die Entstehung einer pathologischen Furchtstruktur (siehe weiter oben, „Risikofaktoren für die Entstehung einer PTSD“). Die Erinnerungen für die Zeit nach dem Trauma führen dann eher zu einer pathologischen Entwicklung, wenn Reaktionen von anderen oder eigene emotionale Probleme, die zunächst nach dem Trauma bestehen, als weitere Zeichen einer gefährlichen Welt oder eigener Inkompetenz gedeutet werden. Legt man dieses Modell der PTSD zugrunde, soll eine erfolgreiche Therapie der Störung dadurch erfolgen, dass die „gesunde“ emotionale Verarbeitung des Traumas vorangetrieben wird. Es ist also notwendig, diejenigen Faktoren zu identifizieren, die eine solche Verarbeitung behindern oder fördern. Zentrale Therapiemethode ist die Konfrontation mit dem erlebten Trauma: Um eine Habituation der Angstreaktion zu erreichen, soll sich der Betroffene den Erinnerungen wiederholt aussetzen. Gleichzeitig wird so die Vermeidung durchbrochen, die die Störung bisher aufrechterhält. Zudem werden beim Wiedererleben des Traumas in sicherer 54 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE Umgebung dem Traumagedächntis neue, sicherheitsbezogene Informationen hinzugefügt (siehe „1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung“). Das Kognitive Modell der posttraumatischen Belastungsstörung von Ehlers und Clark Ehlers und Clark (2000) entwickelten ein kognitives Modell der PTSD. Es dient zum einen dazu, zu erklären, wie sich nach einem traumatischen Erlebnis aus anfänglichen Belastungssymptomen eine chronische PTSD entwickelt. Zum anderen bietet es einen Rahmen für eine kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlung der PTSD. Es wird postuliert, dass eine PTSD nur dann entsteht, wenn ein Individuum ein traumatisches Erlebnis so verarbeitet, dass danach ein Gefühl ständiger hoher Bedrohung entsteht. Die Autoren nennen zwei Hauptprozesse, die zu einem aktuellen Bedrohungsgefühl ohne tatsächliche Gefahr führen: 1) negative Bewertung des Traumas oder der Folgeerkrankungen; 2) eine Störung des autobiografischen Gedächtnisses im Zusammenhang mit dem traumatischen Erlebnis. Negative Bewertungen des Traumas können übergeneralisierende Ansichten sein, z. B. dass man Unglück anzieht oder dass es notwendig ist, stets auf der Hut vor Gefahr zu sein. Bezogen auf die Folgen eines traumatischen Erlebnisses kann ein Betroffener beispielsweise befürchten, seine emotionale Abgestumpftheit sei nun für immer präsent und würde es ihm unmöglich machen, je wieder eine erfüllende Beziehung eingehen zu können. Ein Risikofaktor für solche negativen Bewertungen ist die „mental defeat“, das Gefühl, vollkommen hilflos zu sein, so dass man alle Versuche aufgibt, sein eigenes Leben zu beeinflussen und seine Identität zu wahren. Die Störung des autobiografischen Gedächtnisses bei PTSD ist durch Folgendes gekennzeichnet: unzureichende Ausarbeitung und Einfügung der Erinnerungen an das Trauma in das autobiografische Gedächtnis, was einerseits zu Schwierigkeiten beim Versuch führt, sich aktiv zu erinnern und das Erlebte in einen Kontext zu bringen, andererseits ungewolltes Wiedererleben mit sich bringt. Darüber hinaus bestehen starke assoziative Verbindungen sowohl zwischen Reizen als auch zwischen Reizen und Reaktionen, die mit dem Trauma in Zusammenhang stehen, sowie eine niedrige Wahrnehmungsschwelle für traumarelevante Reize. Die Autoren unterscheiden zwischen zwei Verarbeitungsmechanismen des Gedächtnisses: dem „conceptual processing“ (organisiert und bewertet Situationen und ordnet sie in einen Kontext ein) und „data-driven processing“ (Fokus auf sensorischen Informationen). Ersteres fördert die Integration von Erlebtem in das autobiografische 55 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE Gedächtnis, während zweiteres eher schwer abrufbare Erinnerungen mit unzureichender Einbettung in den Kontext mit sich bringt. Je mehr „data-driven processing“ auftritt, desto ausgeprägter wird die Störung des autobiografischen Gedächtnisses für das traumatische Erlebnis sein. Ob sich nach einem Trauma das Gefühl andauernder Bedrohung entwickelt, hängt mit der Art der Informationsverarbeitung im Gedächtnis zusammen, wird darüber hinaus jedoch zudem von weiteren Faktoren beeinflusst. So spielen etwa Charakteristika des Traumas und subjektive Wahrnehmung der Situation, frühere Erfahrungen und Überzeugungen wie auch Bewältigungsstrategien, die jemand in einer belastenden Situation zur Verfügung hat, eine Rolle. Das Bedrohungsgefühl ist begleitet von Intrusionen und anderen Symptomen des Wiedererlebens, Erregungs-, Angst- und anderen emotionalen Symptomen. Zudem treten eine Reihe kognitiver und Verhaltensstrategien auf, die kurzfristig die wahrgenommene Bedrohung und den Stress reduzieren sollen, jedoch langfristig verhindern, dass kognitive Veränderungen stattfinden, und die deshalb die Störung aufrecht erhalten. Legt man dieses Modell einer PTSD zugrunde, ergeben sich folgende Bausteine für eine Behandlung: die Ausarbeitung des Traumagedächtnisses und dessen Integration in den Kontext der anderen Lebenserfahrungen des Betroffenen, um Symptome des Wiedererlebens zu reduzieren sowie die Modifikation problematischer Bewertungen des Traumas und / oder der Folgen, um das Gefühl einer andauernden Bedrohung zu beenden. Um diese therapeutischen Schritte überhaupt einleiten zu können, ist es notwendig, die dysfunktionalen kognitiven und Verhaltensstrategien zu reduzieren, die eine Ausarbeitung des Traumagedächtnisses verhindern, Symptome verstärken oder eine Neubewertung des Geschehenen blockieren. Lässt sich ein Betroffener auf eine Traumatherapie ein, ist das bereits der erste Schritt zur Durchbrechung der Vermeidungsstrategien (siehe „1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung“). Ehlers und Clark betrachten es als erstaunlich, dass die PTSD im DSM-IV (American Psychiatric Association, 1996) den Angststörungen zugerechnet wird, bei denen aus kognitiver Sicht üblicherweise Angst vor einer angenommenen bevorstehenden Bedrohung besteht. Dahingegen sei die Bedrohung im Zusammenhang mit einer PTSD ja bereits in der Vergangenheit passiert. Betrachtet man hingegen die Symptomatik aus der Sicht der ICD-10 (Weltgesundheitsorganisation, 1991), in der die PTSD zu den Anpassungs- und nicht zu den Angststörungen zählt, tritt diese Diskrepanz nicht auf. Anpassungsstörungen bei schwerer oder kontinuierlicher Belastung sind nach ICD-10 dadurch gekennzeichnet, dass sie erfolgreiche 56 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE Bewältigungsmechanismen verhindern und deswegen zu einer Störung der sozialen Leistungsfähigkeit des Betroffenen führen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der drei Modelle Die drei beschriebenen PTSD-Modelle überschneiden sich in vielerlei Hinsicht (Brewin & Holmes, 2003). Alle Modelle gehen z. B. davon aus, dass im Falle einer PTSD Veränderungen in den Gedächtnisstrukturen stattgefunden haben. Die TraumaErinnerungen unterscheiden sich von anderen Gedächtnisrepräsentationen, da sie in anderer Art und Weise vom Gehirn verarbeitet wurden. Ebenso postulieren alle drei Modelle den Einfluss von Bewältigungsstrategien, Vorerfahrungen etc. auf die Entwicklung einer PTSD nach dem Erleben eines Traumas. Unterschiede bestehen in den Annahmen darüber, wie das Traumagedächtnis beschaffen ist: Während sowohl Brewin et al. als auch Ehlers und Clark jeweils von zwei unterschiedlichen Gedächtnismechanismen ausgehen, die zwar unterschiedlich bezeichnet werden, sich jedoch inhaltlich weitgehend entsprechen („verbally accessive memory“ (VAM) bzw. „conceptual processing“ und „situational accessive memory“ (SAM) bzw. „data-driven processing“), gehen Foa und Rothbaum lediglich von einer Angststruktur aus, die jedoch im Fall einer PTSD im Vergleich zum „Normalzustand“ pathologisch verändert ist. Bezogen auf Therapieempfehlungen stimmen die Modelle dahingehend überein, dass Konfrontation mit den Trauma-Erinnerungen das Mittel der Wahl ist. Jedoch liefern sie verschiedene Begründungen dafür: Foa und Rothbaum nehmen an, dass explizites Wiedererleben deshalb hilfreich ist, weil es die Integration der Trauma-Erinnerungen in das übrige Gedächtnisnetzwerk ermöglicht und die Assoziationen zwischen den traumatischen Elementen untereinander und mit sonstigen Elementen nunmehr in gesundem Ausmaß gebildet werden. Ehlers und Clark gehen hingegen davon aus, dass die Integration der Trauma-Erinnerungen in den autobiografischen Kontext das Abrufen sensorischer und physiologischer Reaktionen auf Erinnerungsreize hemmt. Brewin et al. wiederum postulieren den Nutzen der Konfrontation mit dem Trauma aufgrund der Neubildung von „verbally accessive memory“ (VAM), das die Reagibilität der Amygdala auf Erinnerungsreize verhindert. 1.4.2 Psychische Störungen komorbid zu einer PTSD Im Folgenden werden psychische Störungen (mit Ausnahme von Persönlichkeitsstörungen) aufgeführt, die häufig komorbid zu einer PTSD auftreten, sowie deren 57 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE Komorbiditätsprävalenzen. Der Begriff „Komorbidität“ wird hier so verstanden, dass mehrere Störungen gleichzeitig bei einer Person vorhanden sind, ohne dass eine der Störungen notwendigerweise deutlich im Vordergrund steht oder Mutmaßungen über mögliche Zusammenhänge zwischen den Diagnosen getroffen werden. Sowohl nach dem Diagnosemanual DSM-IV (American Psychiatric Association, 1996) als auch nach ICD-10 (Weltgesundheitsorganisation, 1991) soll zwar eine Hauptdiagnose genannt werden, die sich nach dem Störungsbild mit der größten aktuellen Bedeutung bzw. nach dem Konsultationsgrund richten soll. Jedoch wird im DSM-IV eingeräumt, dass diese Einschätzung schwierig und mehr oder weniger willkürlich ist. Zudem konsultieren Patienten im Rahmen einer Studie die Forscher meist nicht aus eigenem Leidensdruck heraus, sondern werden gezielt angesprochen, und es spielen in diesem Kontext weniger die für den Patienten im Vordergrund stehenden Beschwerden als vielmehr die wissenschaftliche Fragestellung eine Rolle (Kazdin, 2004). D. h. es existiert häufig kein Konsultationsgrund vergleichbar mit einem klinischen Setting im Alltag. Sollte in diesem Kapitel in einer zitierten Studie eine Einschätzung hinsichtlich primärer und sekundärer Diagnose vorgenommen worden sein, wird dies gesondert angeführt. Es werden Studien angeführt, in denen alle Arten potenziell traumatischer Ereignisse erhoben und einbezogen wurden, d. h. die Ergebnisse spiegeln nicht nur die Raten bei PTSD aufgrund von organisierter Gewalt wider. In vielen Studien mit Überlebenden organisierter Gewalt werden zwar sowohl der Anteil an PTSD als auch anderer psychischer Störungen erhoben, jedoch wird häufig nicht deutlich gemacht, welche der Störungen einzeln oder komorbid bei einem Probanden auftreten, da eher Gruppenvergleiche von z. B. Überlebenden und Kontrollpersonen im Vordergrund stehen (z. B. Basoglu et al., 1997; Bichescu et al., 2005; Lopes Cardozo et al., 2000; Maercker & Schützwohl, 1997). Da die Methodik der angeführten Studien große Variation aufweist (z. B. hinsichtlich verwendeter Fragebögen, Diagnosemanual, Alter der Versuchspersonen, Art der traumatischen Erlebnisse etc.), sind die Ergebnisse häufig nicht direkt miteinander vergleichbar bzw. geben nur ein ungefähres Bild der Realität wieder (Kunzke & Güls, 2003). Die in diesem Abschnitt aufgeführten Störungsbilder sind in den beiden Diagnosemanualen ICD-10 und DSM-IV teilweise unterschiedlich klassifiziert oder hinsichtlich der Symptome nicht exakt gleich definiert. Diese Unterschiede werden jeweils kurz beschrieben. Die genannten psychischen Störungen könnten grundsätzlich auch einzeln – ohne Komorbidität mit PTSD – als Reaktion auf das Erleben organisierter Gewalt auftreten. Jedoch beinhalten die diagnostischen Kriterien 58 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE dieser Störungen (mit Ausnahme der andauernden Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung) keine Nennung eines konkreten Auslösers (Weltgesundheitsorganisation, 1991), so dass ein Zusammenhang mit traumatischen Erlebnissen lediglich vermutet werden kann. Perkonigg et al. (2000) untersuchten allerdings den Zusammenhang zwischen traumatischen Erlebnissen und psychischen Störungen außer PTSD in der Allgemeinbevölkerung und fanden einen signifikanten, wenn auch lediglich moderaten Zusammenhang für die meisten dieser Störungen. Auch de Jong et al. (2003) fanden signifikant höhere Raten über alle untersuchten psychischen Störungen hinweg bei den Personen, die Gewalt im Rahmen von bewaffneten Auseinandersetzungen erlebt hatten. Über alle Störungsbilder komorbid zur PTSD hinweg (eine oder mehrere zusätzliche Diagnosen) finden sich z. B. bei Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes und Nelson (1995) Lebenszeitprävalenzen von 88,3 % bei Männern und 79 % bei Frauen. Die PTSD-Diagnose wurde nach DSM-III-R gestellt, ebenfalls hinsichtlich Lebenszeitprävalenz erfasst und betrug 7,8 %. Aufgrund der Erfassung der Lebenszeitprävalenzen ist in dieser Studie die Definition von Komorbidität als dem gleichzeitigen Vorhandensein mehrerer psychischer Störungen in unbekanntem Ausmaß nicht zutreffend. Mehr als drei komorbide Diagnosen bestehen in der Studie von Kessler et al. (1995) bei 59 % der Männer und 43,6 % der Frauen. Perkonigg et al. (2000) stellten bei 87,5 % der Befragten mit einer PTSD mindestens eine weitere Diagnose fest, 77,5 % hatten zwei oder mehr Diagnosen (ebenso Erfassung der jeweiligen Lebenszeitprävalenzen). Bolton, O’Ryan, Udwin, Boyle und Yule (2000) untersuchten Personen, die in ihrer Jugend ein Schiffsunglück überlebt hatten, und stellten eine Komorbiditätsrate für PTSD und mindestens eine andere erhobene psychische Störung für den Zeitraum seit dem Unglück (fünf bis acht Jahre) von 81,8 % fest, die Punktprävalenz zum Zeitpunkt der Untersuchung betrug noch 50 % (zu diesem Zeitpunkt ohne Einbeziehung von spezifischen Phobien)1 . Brady (1997) weist darauf hin, dass es beträchtliche Überlappungen zwischen PTSD-Symptomen und denjenigen anderer psychischer Erkrankungen gibt (z. B. mit Depression, Panikstörung oder generalisierter Angststörung). Dies kann die Diagnose einer PTSD erschweren. Es sollten stets spezifisch eventuelle PTSD-Symptome erfragt werden. 1 Bolton et al. (2000) ließen die im DSM-IV vorgegebenen Ausschlusskriterien für die Diagnose einer spezifischen Phobie und einer PTSD grundsätzlich außer Acht, diagnostizierten die Störung jedoch zum letzten aufgeführten Zeitpunkt nicht mehr. 59 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE Affektive Störungen Die Störungen dieser Kategorie sind laut ICD-10 allgemein dadurch gekennzeichnet, dass die Stimmung verändert ist, meist zur Depression hin. Dies geht in der Regel einher mit einem Wechsel des Aktivitätsniveaus (Weltgesundheitsorganisation, 1991). Das DSM-IV unterscheidet zwischen depressiven Störungen, bipolaren Störungen, affektiven Störungen aufgrund eines medizinischen Krankheitsfaktors und substanzinduzierten affektiven Störungen (American Psychiatric Association, 1996). Bis auf die zwei letztgenannten sind die Störungsbilder in der ICD-10 in gleicher Weise aufgeführt, jene sind dort den Kapiteln „Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen“ sowie „Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen“ zugeordnet. Kessler et al. (1995) analysierten Daten aus dem National Comorbidity Survey, einer Studie mit über 8000 Personen zur Erfassung von Prävalenz, Zusammenhängen und Folgen psychischer Störungen in den USA. Sie fanden einen Anteil an komorbiden affektiven Störungen von insgesamt 81 % bei Männern (47,9 % Major Depressive Disorder, 21,4 % Dysthymia, 11,7 % Manie) und 77,5 % bei Frauen (48,5 % Major Depressive Disorder, 23,3 % Dysthymia, 5,7 % Manie)2 . Es ergaben sich Hinweise darauf, dass in der untersuchten Stichprobe die PTSD den affektiven Störungen eher vorausging als sekundär auftrat. Zu diesem Ergebnis kommen auch Perkonigg et al. (2000). Hepp et al. (2006a) fanden in einer epidemiologischen Studie in der Schweiz bei 90,9 % der Versuchspersonen, die unter subsyndromaler PTSD litten, eine komorbide Major Depression. Suizidal waren zudem 45,5 % der Patienten. Unter einer komorbiden bipolaren Störung litten 9,1 % der Befragten. In anderen Untersuchungen fanden de Jong et al. (2003) nach bewaffneten Konflikten in Algerien, Kambodscha, Äthiopien und Palästina 1-Jahres-Komorbiditätsraten von PTSD und einer affektiven Störung von 0 bis 1,9 % bei denjenigen, die keine Gewalt im Rahmen von Kämpfen erlebt hatten, und 2,3 bis 11,5 % bei denjenigen mit solchen Gewalterfahrungen (die Prozentzahlen sind auf die gesamte untersuchte Stichprobe bezogen, nicht nur auf diejenigen mit einer PTSD). Unter gleichzeitiger PTSD, einer affektiven und einer Angststörung litten lediglich Personen mit Gewalterfahrungen aus dem bewaffneten Konflikt. Die Raten rangierten von 1,0 bis 5,2 %. Aus derselben Untergruppe hatten 0,2 bis 2,5 % eine PTSD, eine affektive und eine somatoforme Störung. In einer Untersuchung von Schaal (2006) mit verwaisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Ruanda, die den Genozid überlebt hatten, zeigte sich, dass 2 Beachte: Lebenszeitprävalenzen (nach DSM-IIII-R), d. h. Komorbidität bedeutet in der Studie von Kessler et al. (1995) nicht unbedingt „gleichzeitiges Vorhandensein der psychischen Störungen“. 60 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE 80 % derjenigen, die an einer PTSD erkrankt waren, zudem eine Major Depression aufwiesen. Eine komorbide Dysthymia wurde bei 12,5 % der Befragten festgestellt, 72,5 % waren suizidal (in verschiedenen Ausprägungen). Bolton et al. (2000) fanden eine Komorbiditätsrate von 63,6 % für affektive Störungen bei Überlebenden eines Schiffsunglücks (55,5 % Major Depression, 6,4 % Dysthymia, 2,8 % manische Störungen) für den Zeitraum zwischen Unglück und Untersuchung (fünf bis acht Jahre). Zum Untersuchungszeitpunkt fand sich eine Punktprävalenz von 18,4 % (davon 13,2 % Major Depression, 0 % Dysthymia und 5,3 % manische Störungen). Maercker et al. (2004) fanden in einer repräsentativen Stichprobe von Frauen in 29 % der PTSD-Erkrankten eine komorbide Major Depression. In der Gesamtstichprobe zeigte sich bei 3,0 % eine traumabezogene Major Depression. In einer Untersuchung von Mollica et al. (1999) mit bosnischen Flüchtlingen in Kroatien zeigte sich bei den Probanden mit PTSD in 20,6 % zusätzlich eine depressive Erkrankung. Angst- und Zwangsstörungen Generalisierte Angststörung Die Diagnosemanuale ICD-10 und DSM-IV geben ähnliche diagnostische Kriterien für eine generalisierte Angststörung vor (Weltgesundheitsorganisation, 1991; American Psychiatric Association, 1996). Bei dieser Störung steht eine generalisierte und anhaltende Angst, die nicht auf bestimmte Situationen beschränkt ist, im Vordergrund. Damit gehen verschiedene vegetative Anspannungs- und Übererregungssymptome einher. Im DSM-IV wird im Gegensatz zur ICD-10 betont, dass die auftretenden Sorgen für den Betroffenen schwer zu kontrollieren sind. Das Diagnostizieren einer PTSD und einer komorbiden generalisierten Angststörung ist nach beiden Manualen nicht generell ausgeschlossen, wobei die ICD-10 weniger strenge Kriterien vorgibt. Vor allem nach den Kriterien des DSM-IV sollten beide Diagnosen nur nach sorgfältiger Abwägung gleichzeitig gestellt werden, da Symptome einer generalisierten Angststörung, die nur im Rahmen einer bestehenden anderen psychischen Störung (z. B. einer PTSD) auftreten, nicht zur zusätzlichen Diagnosestellung einer generalisierten Angststörung führen. Es gilt, präzise abzuklären, worauf sich das Grübeln und die Sorgen beziehen, ob sie ausschließlich im Rahmen einer anderen Störung auftreten und ob diese Ängste exzessiv sind. Für die im Folgenden zitierten Untersuchungsergebnisse ist nicht bekannt, inwiefern diese Abwägungen sorgfältig getroffen wurden. Kessler et al. (1995) fanden Komorbiditätsraten der generalisierten Angststörung von 16,8 % bei Männern und 15 % bei Frauen mit PTSD in der Allgemein61 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE bevölkerung (siehe Fußnote 2 auf Seite 60). Sowohl für die generalisierte Angststörung als auch für die weiteren in dieser Studie untersuchten Angststörungen zeigte sich, dass die PTSD einer dieser Störungen eher selten vorauszugehen schien. Dies bestätigten Ergebnisse von Perkonigg et al. (2000), jedoch bildete die Agoraphobie hier eine Ausnahme: Sie trat deutlich häufiger nach einer PTSD auf. Bolton et al. (2000) stellten eine Punktprävalenz von generalisierter Angststörung komorbid zu einer PTSD von 15,8 % bei Überlebenden eines Schiffsunglücks fest, das fünf bis acht Jahre zurücklag. Weitere Angststörungen Angststörungen sind dadurch gekennzeichnet, dass der Betroffene unangemessen starke Angstsymptome verspürt, ohne dass eine konkrete Gefahr gegeben ist. Zudem ist die Vermeidung angstbesetzter Situationen oder Zustände oder das Durchstehen derselben mit Hilfsmitteln oder in Begleitung Teil der Problematik (Weltgesundheitsorganisation, 1991; American Psychiatric Association, 1996). Die komorbide Diagnose irgendeiner Angststörung mit PTSD trat bei de Jong et al. (2003) mit 1-Jahres-Raten von 0 bis 1,9 % bei Personen ohne Gewalterfahrungen in bewaffneten Konflikten auf, bei denjenigen mit solchen Gewalterfahrungen betrugen die Komorbiditätsraten 4,3 bis 13,5 % (untersucht wurden Algerier, Kambodschaner, Äthiopier und Palästinenser; die Prozentzahlen beziehen sich hier auf die Gesamtstichprobe). Die Diagnosen PTSD, Angststörung und somatoforme Störung traten bei 0,4 bis 2,2 % derjenigen mit Gewalterfahrungen auf. Die Diagnosen einer Panikstörung oder Agoraphobie sind nach ICD-10 und DSM-IV dergestalt unterschiedlich gefasst, als ersteres Kriterien für eine „Agoraphobie mit oder ohne Panikstörung“ oder auch eine isolierte Panikstörung vorsieht, während letzteres das Stellen der Diagnosen „Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie“ oder eine isolierte Agoraphobie ermöglicht. Die jeweiligen diagnostischen Kriterien entsprechen sich jedoch weitgehend. Eine Panikstörung, die komorbid zu einer PTSD besteht, zeigte bei Kessler et al. (1995) eine Auftretenshäufigkeit von 7,3 % bei Männern und 12,6 % bei Frauen – siehe Fußnote 2 auf Seite 60. Eine komorbide Agoraphobie bestand in derselben Studie bei 16,1 % der Männer und 22,4 % der Frauen. Hepp et al. (2006a) fanden eine Rate von 36,4 % komorbider Agoraphobie bei Befragten mit subsyndromaler PTSD. Die Kriterien für spezifische Phobien und soziale Phobie sind in beiden Diagnosemanualen weitgehend gleich gefasst. Eine Komorbidität von PTSD und spezifischer Phobie fanden Kessler et al. (1995) bei 31,4 % der Männer und 29 % der 62 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE Frauen. Bolton et al. (2000) fanden eine Komorbiditätsrate von 35,5 % mit spezifischer Phobie und 8,2 % sozialer Phobie bei Überlebenden eines Schiffsunglücks für den Zeitraum zwischen Unglück und Untersuchung (fünf bis acht Jahre). Zum Zeitpunkt der Untersuchung lagen die Punktprävalenzen bei 21,1 % für spezifische und 0 % für soziale Phobie, darüber hinaus bestand bei 13,2 % eine Panikstörung komorbid zur PTSD. Bei 27,6 % der befragten Männer und 28,4 % der Frauen bestand eine soziale Phobie komorbid zur PTSD (Kessler et al., 1995) – siehe Fußnote 2 auf Seite 60. Bei einer Stichprobe von Versuchspersonen mit subsyndromaler PTSD fanden Hepp et al. (2006a) einen Anteil von 36,4 % an komorbider sozialer Phobie. Orsillo, Heimberg, Juster und Garrett (1996) fanden sehr hohe Raten (72 %) komorbider sozialer Phobien bei Vietnamveteranen mit PTSD. Zwangsstörung Eine Zwangsstörung weist wiederkehrende Zwangsgedanken oder -handlungen auf, die fast immer quälend sind und als sinnlos erlebt werden, während sie gleichzeitig als eigene Gedanken oder Impulse (nicht wie etwa im Falle eines Wahns) wahrgenommen werden (Weltgesundheitsorganisation, 1991; American Psychiatric Association, 1996). Die Betroffenen versuchen, den Gedanken oder Impulsen zu widerstehen. Bei Zwangsstörungen werden in beiden Diagnosemanualen ICD10 und DSM-IV Ausprägungen eher hinsichtlich Zwangsgedanken oder eher hinsichtlich Zwangshandlungen unterschieden. Im DSM-IV ist jedoch deutlicher formuliert, dass die betroffene Person u. U. versucht, die Gedanken, Impulse etc. nicht nur zu ignorieren, sondern durch andere Gedanken oder Handlungen zu neutralisieren. Überlebende eines Schiffsunglücks wiesen im Zeitraum von fünf bis acht Jahren danach eine Zwangsstörungsrate von 5,5 % komorbid zu einer PTSD auf, zum Nachuntersuchungszeitpunkt waren es 5,3 % (Bolton et al., 2000). Substanzmissbrauch oder -abhängigkeit Die Diagnosemanuale DSM-IV und ICD-10 definieren Substanzabhängigkeit weitgehend gleich (Weltgesundheitsorganisation, 1991; American Psychiatric Association, 1996). Hinsichtlich des Substanzmissbrauchs bzw. schädlichen Gebrauchs ist in der ICD-10 das einzige diagnostische Kriterium eine durch den Konsum hervorgerufene körperliche oder psychische Gesundheitsschädigung, während das DSM-IV stattdessen verschiedene negative Folgen des Konsums als Kriterien nennt. 63 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE Kessler et al. (1995) fanden die komorbide Diagnose „Alkoholmissbrauch“ oder „-abhängigkeit“ bei 51,9 % der Männer und 27,9 % der Frauen. Komorbider Drogenmissbrauch oder -abhängigkeit bestand bei 34,5 % der Männer und 26,9 % der Frauen (siehe Fußnote 2 auf Seite 60). Bei einer Stichprobe von Versuchspersonen mit subsyndromaler PTSD stellten Hepp et al. (2006a) eine Rate von 9,1 % an komorbidem Missbrauch oder Abhängigkeit von Benzodiazepinen fest. Bolton et al. (2000) fanden eine Punktprävalenz von 2,6 % Substanzabhängigkeit bei Überlebenden eines Schiffsunglücks fünf bis acht Jahre danach. In einer Studie von Chilcoat und Breslau (1998) zeigte sich eine Komorbiditätsrate für Drogenmissbrauch oder -abhängigkeit mit PTSD von 29,1 %. Perkonigg et al. (2000) stellten fest, dass Störungen im Zusammenhang mit Substanzkonsum zu einem hohen Prozentsatz nach einer PTSD auftraten. Auch Chilcoat und Breslau (1998) fanden ein erhöhtes Risiko für eine dieser Störungen nach einer PTSD, nicht aber nach dem Erleben eines traumatischen Ereignisses. Zudem stellte die vorher bereits bestehende Diagnose einer substanzbezogenen Störung kein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer PTSD dar. Somatoforme Störungen Somatoforme Störungen zeichnen sich dadurch aus, dass körperliche Symptome berichtet werden, ohne dass nach sorgfältiger Untersuchung eine organische Ursache gefunden werden kann. Zudem lassen sich Betroffene durch solche oftmals wiederholten ärztlichen Negativbefunde nicht von einer Fortführung der Suche nach medizinischen Erklärungen abbringen. Diesen Störungen ist im DSM-IV ein eigenes Kapitel gewidmet, während sie in der ICD-10 mit den Angst-, Zwangs-, Anpassungs- und Dissoziativen Störungen in die Kategorie „Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen“ zusammengefasst wurden (Weltgesundheitsorganisation, 1991; American Psychiatric Association, 1996). Beide Manuale sehen die Diagnosen „Somatisierungsstörung“, „Hypochondrie / hypochondrische Störung“, „Undifferenzierte Somatisierungsstörung / Somatoforme Störung“ sowie „(anhaltende somatoforme) Schmerzstörung“ vor. Für die Somatisierungsstörung ist im DSM-IV genauer festgelegt, wie viele Symptome aus welchen Bereichen bestehen müssen. Bezogen auf die Schmerzstörung werden im DSM-IV die Unterkategorien „...in Verbindung mit psychischen Faktoren“ bzw. „...in Verbindung mit sowohl psychischen Faktoren wie einem medizinischen Krankheitsfaktor“ oder „...in Verbindung mit medizinischen Krankheitsfaktoren“ unterschieden, was in der ICD-10 fehlt. Die weiteren genannten Störungen sind mit sehr ähnlichen Kri- 64 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE terien beschrieben. Im DSM-IV findet sich in der Kategorie der Somatoformen Störungen zusätzlich die Diagnose „Konversionsstörung“, welche in der ICD-10 unter „Dissoziative Störungen“ klassifiziert ist. Die ICD-10 beschreibt darüber hinaus die „somatoforme autonome Funktionsstörung“, die sich auf verschiedene Organsysteme beziehen kann. Die „Körperdysmorphe Störung“ ist im DSM-IV eine eigenständige Diagnose, während sie in der ICD-10 lediglich als zur hypochondrischen Störung zugehöriger Begriff erwähnt wird. Bei Personen, die Gewalt in bewaffneten Konflikten in verschiedenen Ländern erlebt hatten, fanden de Jong et al. (2003) in der Gesamtstichprobe 1-Jahres-Raten von komorbider PTSD und einer somatoformen Störung von 0,6 bis 4,0 % (zusätzliche affektive oder Angststörungen: siehe weiter oben in den entsprechenden Abschnitten dieses Kapitels). Tull, Gratz, Salters und Roemer (2004) fanden in einer Befragung einer Stichprobe von Frauen, die potenziell traumatische Ereignisse erlebt hatten, eine starken Zusammenhang zwischen der Vermeidung von Gedanken, Gefühlen oder Körperempfindungen, die mit dem Erlebnis zusammenhingen, und Somatisierungssymptomen. In einer Untersuchung von Tagay, Herpertz, Langkafel und Senf (2004) mit Patienten in einer psychosomatischen Klinik zeigte sich, dass diejenige mit einer PTSD signifikant höhere Beschwerdescores in einem Fragebogen zu Somatisierungssymptomen aufwiesen als Personen, die potenziell traumatische Erlebnisse hatten, ohne eine PTSD entwickelt zu haben, und Personen ohne Traumaerfahrung. Vor allem neurologische und kardiopulmonale Beschwerden standen im Vordergrund. Es berichteten 63 % der PTSD-Patienten von gedanklicher Zentrierung auf Schmerzen und 91,3 % von Beeinträchtigungen im Alltagsleben aufgrund der somatoformen Störungen. Bei Perkonigg et al. (2000) zeigte sich, dass somatoforme Störungen zu einem hohen Prozentsatz einer PTSD vorausgingen. In einer Studie von Stein, Lang, Laffaye, Satz, Lenox und Dresselhaus (2004) mit Frauen nach sexuellen Angriffen, in der allerdings keine PTSD-Diagnosen erhoben wurden, zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen den Gewalterlebnissen und somatischen Symptomen sowie Gesundheitsangst. Zudem wiesen die betroffenen Frauen häufigere Krankheitstage sowie Arztbesuche auf. Psychotische Störungen Psychotische Störungen umfassen verschiedenste Symptome und Symptommuster und sind vor allem durch Denk- und Wahrnehmungsstörungen sowie veränderte Affektivität gekennzeichnet (Weltgesundheitsorganisation, 1991; American 65 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE Psychiatric Association, 1996). Die Beschreibung psychotischer Störungen in DSMIV und ICD-10 deckt sich weitgehend, auch wenn sie nicht immer gleich bezeichnet werden. Die Schizophrenie stellt die häufigste Störung dieser Gruppe dar. Die ICD-10 nennt lediglich einige zusätzliche (Unter-)Kategorien. Im DSM-IV sind auf einen medizinischen Krankheitsfaktor zurückzuführende oder substanzinduzierte psychotische Störungen innerhalb des Kapitels „Schizophrenie und andere psychotische Störungen“ genannt, während sie in der ICD-10 unter den Kapiteln „Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen“ sowie „Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen“ aufgeführt sind. Butler, Mueser, Sprock und Braff (1996) untersuchten Vietnamveteranen mit und ohne PTSD und fanden bei der Gruppe mit PTSD signifikant höhere psychotische Symptome als in der Vergleichsgruppe. Hinsichtlich der Negativsymptomatik stach lediglich eine ausgeprägte Anhedonie hervor, ansonsten wies die Gruppe mit PTSD eine deutlich erhöhte Positivsymptomatik auf, ohne dass eine Störung des formalen Denkens bestand. In einer Studie von David, Kutcher, Jackson und Mellman (1999) hatten 40 % der befragten Kriegsveteranen mit PTSD im vorausgegangenen Halbjahr psychotische Symptome erlebt. Davon waren auditorische und visuelle Halluzinationen am häufigsten, Wahnvorstellungen wies etwa ein Drittel der Personen in dieser Untergruppe auf. Sautter, Brailey, Uddo, Hamilton, Beard und Borges (1999) stellten in einer Untersuchung mit Kriegsveteranen eine Komorbiditätsrate psychotischer Störungen von 52 % zusätzlich zu einer PTSD fest. Spauwen, Krabbendam, Lieb, Wittchen und van Os (2006) fanden einen Zusammenhang zwischen selbst berichteten traumatischen Erlebnissen und psychotischen Symptomen, v. a. nach dem Erleben starker Hilflosigkeit, Angst und Entsetzen. Dissoziative Störungen Dissoziative Störungen sind dadurch gekennzeichnet, dass es bei den betroffenen Personen teilweise oder vollständig zu einer Fragmentierung von Bewusstsein, Wahrnehmung, Kognitionen, Affekten, Verhalten, Identitätsbewusstsein und Gedächtnis kommt (Weltgesundheitsorganisation, 1991; American Psychiatric Association, 1996). Sie bilden im DSM-IV eine eigene Kategorie, während sie in der ICD-10 wie unter „Somatoforme Störungen“ bereits erwähnt in das Kapitel „Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen“ integriert sind. Beide Manuale beschreiben die Diagnosen „dissoziative Amnesie“ und „dissoziative Fugue“ in ähnlicher Weise. Auch die dissoziative Identitätsstörung / multiple Persönlichkeitsstörung wird ähnlich beschrieben, wobei nach DSM-IV eine Voraussetzung 66 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE für die Diagnosestellung ist, dass mindestens zwei der verschiedenen Identitäten oder Persönlichkeitszustände wiederholt die Kontrolle über das Verhalten des Betroffenen übernehmen. Die Depersonalisierungsstörung ist im DSM-IV unter die Kategorie der dissoziativen Störungen gefasst, während sie in der ICD-10 zu den „anderen neurotischen Störungen“ gehört, immerhin im selben größeren Kapitel wie die dissoziativen Störungen. Die ICD-10 sieht einige weitere dissoziative Störungen vor, die im DSM-V nicht vorkommen. Dissoziative Symptome spielen eine wichtige Rolle bei dem noch nicht in das DSM aufgenommenen Störungsbild einer „Disorder of Extreme Stress not otherwise specified“ (DESNOS) bzw. der „Komplexen PTSD“ (siehe nächster Abschnitt, „Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung“). In einer Studie von Zucker, Spinazzola, Blaustein und van der Kolk (2006) zum Vergleich dissoziativer Symptomatik bei PTSD-Patienten mit oder ohne eine(r) zusätzliche(n) DESNOS zeigte sich, dass Patienten mit PTSD und DESNOS signifikant höhere Dissoziationswerte (in den Bereichen „Absorption / Fantasie“ und „Depersonalisation / Derealisation“) aufwiesen. Kennedy, Clarke, Stopa, Bell, Rouse, Ainsworth, Fearon und Waller (2004) entwickelten ein kognitives Modell der Dissoziation sowie einen Fragebogen (Wessex Dissociation Scale). In einer Studie mit verschiedenen klinischen und nicht-klinischen Untergruppen fanden sie einen signifikanten positiven Zusammenhang zwischen PTSD und dissoziativen Symptomen. Dalenberg und Palesh (2004) untersuchten Zusammenhänge zwischen potenziell traumatischen Erlebnissen und dissoziativen Symptomen. Es zeigte sich, dass Gewalterlebnisse, Kindesmissbrauch und / oder das Erleben eines furchteinflößenden Ereignisses dissoziative Symptome vorhersagten. Davidson, Kudler, Saunders und Smith (1990) vermuten aufgrund von Untersuchungen mit Veteranen aus dem 2. Weltkrieg und dem Vietnamkrieg, dass dissoziative Symptome, die mit einer PTSD assoziiert sind, im Laufe der Jahre zurückgehen, selbst wenn die PTSD noch bestehen bleibt. Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung Dieses Störungsbild ist lediglich in der ICD-10, nicht aber im DSM-IV vertreten (Weltgesundheitsorganisation, 1991; American Psychiatric Association, 1996). Es gibt jedoch Bestrebungen, eine ähnlich definierte Störung (Disorder of Extreme Stress not otherwise specified – DESNOS, siehe vorheriger Absatz) in die nächste Ausgabe des DSM aufzunehmen (z. B. Pain, 2002). Es handelt sich in der ICD-10 um eine Persönlichkeitsveränderung, die nach außergewöhnlicher Belastung auf- 67 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE treten kann. Die Belastung muss so ausgeprägt sein, dass nicht alleine die Vulnerabilität der Person zu diesem Störungsbild geführt hat, ebenso wie bei einer PTSD. Eine PTSD kann dem Störungsbild vorausgehen, dies muss aber nicht zwangsläufig der Fall sein. Falls vorher eine PTSD bestanden hat, wird die andauernde Persönlichkeitsänderung als eine chronische, irreversible Auswirkung derselben betrachtet. Eine Diagnose erfordert das Vorliegen einer generellen feindseligen oder misstrauischen Haltung, sozialen Rückzugs, eines Gefühls der Leere oder Hoffnungslosigkeit sowie der Entfremdung und einer chronischen Nervosität, als ob eine ständige Bedrohung bestehen würde. Die Probleme müssen überdauernd sein und zu Funktionsbeeinträchtigungen in verschiedenen Lebensbereichen führen. Fremdanamnestische Angaben sollen die Persönlichkeitsänderung bestätigen. Eine andere psychische Störung außer einer PTSD darf dem Symptommuster nicht vorausgegangen sein. Die Symptome müssen mindestens zwei Jahre lang vorliegen. Bislang ist das Konzept einer andauernden Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung in der ICD-10 nicht empirisch überprüft worden (Schreuder, 1999). DESNOS wird lediglich als besondere Ausprägung einer PTSD betrachtet (Ford, 1999). Es kann für das in der ICD-10 vorhandene Störungsbild der andauernden Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung nicht von einer tatsächlichen Komorbidität mit PTSD gesprochen werden – dies ist zwar in der ICD-10 nicht explizit ausgeschlossen, jedoch geht aus der Beschreibung des Störungsbildes hervor, dass es sich eher nach einer PTSD als parallel dazu entwickelt. Für die noch nicht in ein Diagnosemanual aufgenommene DESNOS liegen bislang keine Ausschlusskriterien vor. Es existieren verschiedene Untersuchungsergebnisse für das noch umstrittene Konzept der DESNOS, beispielsweise fanden Zucker et al. (2006) bei 16,1 % der untersuchten PTSD-Patienten zusätzlich eine DESNOS (siehe auch weiter oben, „Dissoziative Störungen“). Ford (1999) stellte in einer Studie mit Kriegsveteranen, die alle potenziell traumatische Ereignisse erlebt hatten, eine Komorbiditätsrate von 52 % DESNOS zusätzlich zur PTSD fest. In derselben Studie ergab sich zudem ein Anteil von 26 % der Gesamtstichprobe, der die Kriterien für eine DESNOS, nicht aber für eine PTSD aufwies. Insgesamt erfüllten 31 % der untersuchten Personen die Kriterien für beide Diagnosen, 29 % hatten eine PTSD, 26 % eine DESNOS und 13 % keine der Diagnosen. Diejenigen Probanden, die die Kriterien für eine DESNOS erfüllten, wiesen eine höhere Rate früher Traumatisierungen auf. 68 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1.4.3 1 THEORIE Weitere mögliche psychische Folgen organisierter Gewalt Im Folgenden werden weitere psychische Störungen aufgeführt, die nach dem Erleben von organisierter Gewalt auftreten können und die nicht komorbid zu einer PTSD diagnostiziert werden können. D. h. die aufgeführten Diagnosen und diejenige einer PTSD schließen sich aus. Akute Belastungsreaktion Die akute Belastungsreaktion setzt voraus, dass jemand eine außergewöhnliche körperliche und / oder seelische Belastung (ICD-10, Weltgesundheitsorganisation, 1991) bzw. ein traumatisches Ereignis nach denselben Kriterien wie für eine PTSD (DSM-IV, American Psychiatric Association, 1996) erlebt hat und anschließend mit bestimmten Stress-Symptomen reagiert: Nach ICD-10 treten gemischte und wechselnde Symptome von Depression, Angst, Ärger oder Verzweiflung auf, körperlich kommt es zu Panikattacken. Nach DSM-IV müssen für die Diagnosestellung dissoziative Symptome wie Betäubtsein oder Depersonalisierung sowie Symptome des Wiedererlebens, der Vermeidung und der Übererregung sowie eine Beeinträchtigung der Alltagsfunktionen des Betroffenen vorhanden sein. Der zeitliche Rahmen ist in der ICD-10 nicht genau festgelegt, es ist lediglich angegeben, dass die Symptome meist innerhalb weniger Tage wieder abklängen. Im DSM-IV ist zur Diagnosestellung vorgegeben, dass die Störung mindestens zwei Tage und maximal vier Wochen andauert und innerhalb von vier Wochen nach dem Erlebnis beginnt. Die akute Belastungsreaktion zählt in der ICD-10 zu den Belastungs- und Anpassungsstörungen, während sie im DSM-IV den Angststörungen zugerechnet wird. Seit 1994 ist die Störung im DSM-IV aufgenommen, während bereits die ICD-9 von 1976 (DIMDI, 2006) die Diagnose einer „Psychogenen Reaktion (akute Belastungsreaktion)“ enthielt. Grieger, Fullerton, Ursano und Reeves (2003) untersuchten Krankenhausangestellte nach einer Angriffsserie von Scharfschützen in Washington, D. C., und stellten fest, dass 6 % der Befragten unter einer akuten Belastungsreaktion litten. Risikofaktoren für die Entwicklung dieser Störung waren weibliches Geschlecht, erhöhter Alkoholkonsum, komorbide Depression, geringeres Sicherheitsgefühl, stärkeres Bedrohungsgefühl, stärker ausgeprägte peritraumatische Dissoziation und höhere Aktivitätsabnahme. Bryant und Harvey (1998) fanden bei Personen, die nach einem Verkehrsunfall ein leichtes Hirntrauma erlitten hatten, eine Rate akuter Belastungsreaktion von 13,9 %. In einer Studie von Kühn, Ehlert, Rumpf, Backhaus, Hohagen und Broocks (2006) zeigten 6,9 % der untersuchten Unfallopfer eine akute Belas69 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE tungsreaktion. Bei 12,1 % war das Störungsbild subsyndromal vorhanden. Rundell (2006) untersuchte militärisches Personal, das zu Friedenseinsätzen im Irak stationiert und aufgrund psychiatrischer Probleme aus dem Einsatzgebiet verlegt worden war. Von diesen Personen erfüllten 5,5 % die Kriterien für eine akute Belastungsreaktion. Anpassungsstörung Anpassungsstörungen sind dadurch charakterisiert, dass der Betroffene ängstliche und / oder depressive Symptome zeigt, die mit einem belastenden Ereignis oder auch länger andauernden belastenden Lebensumständen im Zusammenhang stehen. Nach der ICD-10 (Weltgesundheitsorganisation, 1991) spielt die persönliche Vulnerabilität zwar eine Rolle für die Entstehung der Störung, jedoch ist die Belastung der Hauptauslöser der Symptome. Nach DSM-IV (American Psychiatric Association, 1996) wird die Diagnose einer Anpassungsstörung dann gestellt, wenn der Betroffene eine stärker ausgeprägte Reaktion auf die Belastung zeigt als zu erwarten gewesen wäre, sowie Funktionsbeeinträchtigungen im Alltag bestehen. Zudem dürfen nicht gleichzeitig die Kriterien einer anderen spezifischen Störung vorliegen. In beiden Diagnosemanualen wird die Anpassungsstörung von einer Trauerreaktion abgegrenzt, und beide führen an, dass die Störung in der Regel nicht länger als sechs Monate anhält. Jedoch legt das DSM-IV fest, dass die Störung innerhalb von drei Monaten nach Auftreten der Belastung beginnt, während die Symptome nach ICD-10 in der Regel innerhalb eines Monats beginnen. Kühn et al. (2006) untersuchten psychische Folgen bei Überlebenden von schweren Unfällen und fanden bei 1,7 % der Befragten eine Anpassungsstörung. Basoglu et al. (1994) fanden bei 2 % einer Stichprobe von Folteropfern eine aktuelle Anpassungsstörung. Die Autoren gaben allerdings nicht an, ob die Ausschlusskriterien beachtet wurden oder ob es zu Mehrfachdiagnosen mit PTSD oder einer anderen spezifischen Störung kam. In einer Studie von Rundell (2006) mit Militärpersonal im Irak wiesen 3 % der Versuchspersonen eine Anpassungsstörung auf. 70 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1.4.4 1 THEORIE Besonderheiten bei Asylbewerbern und Flüchtlingen Im Folgenden werden Besonderheiten bei Asylbewerbern und Flüchtlingen in westlichen Staaten bezogen auf Belastungen sowie psychische und körperliche Gesundheit aufgeführt. Stressoren im Exil Asylbewerber erleben häufig Belastungen im Exil, die einen Einfluss auf ihre psychische Gesundheit haben und v. a. bei denjenigen, die bereits zuvor traumatische Ereignisse erlebt hatten, psychische Probleme hervorrufen oder verstärken können (Silove & Steel, 1998) – siehe auch „1.3.3 Rechtliche Situation von Asylbewerbern in Deutschland“. Beispielsweise befragten Steel, Momartin, Bateman, Hafshejani, Silove, Everson, Roy, Dudley, Newman, Blick und Mares (2004) Asylbewerber in Australien hinsichtlich belastender Erlebnisse, die diese in der Zeit in einem Auffanglager gemacht hatten. Insgesamt erhoben sie 60 verschiedene Stressoren, von denen im Folgenden einige Beispiele genannt werden. Alle Befragten nannten Langeweile, Isolation, schlechtes Essen und das Beobachten anderer Personen, die sich selbst verletzten oder sogar Suizidversuche unternahmen. Es gaben weiterhin 63 % an, dass Verzögerungen im Asylprozess sie belasteten. Etwa die Hälfte beklagte mangelnde Möglichkeiten, Englisch zu lernen, rassistische Kommentare und Sorgen bezüglich der zurückgelassenen Familie. Ungefähr ein Drittel der Personen war dadurch belastet, dass sie nicht wieder nach Hause zurückkehren konnten. Zwar sind die Belastungen der Asylbewerber sicherlich nicht in allen Staaten vergleichbar (z. B. existieren nicht überall Auffanglager vergleichbar mit denen in Australien), jedoch gelten viele der Stressoren länderübergreifend (z. B. Isolation, Sorge um das Asylverfahren oder um Angehörige etc.). Tamilische Asylbewerber in Australien (Silove & Steel, 1998) gaben an, unter einer Reihe von Stressoren aus allen Bereichen zu leiden (z. B. Schwierigkeiten, eine Arbeitserlaubnis zu erhalten, eingeschränkte Möglichkeiten, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, Trennung von der Familie, Verständigungsprobleme, Armut etc.). Die häufigsten Stressoren, die kambodschanische Flüchtlinge für die Anfangszeit in den USA nannten, waren mangelnde Englischkenntnisse (77 %), Gedanken an zurückgelassene Familienmitglieder (63 %). Für das Jahr vor der Befragung wurden Zukunftsängste (27 %) und Gesundheitssorgen (26 %) als häufigste Belastungen angegeben (Blair, 2000). Die Befragten lebten seit durchschnittlich 8,1 Jahren in den USA. 71 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE Wenk-Ansohn (2007) zählt über die bereits genannten Faktoren eine Reihe von Stressoren auf, denen Asylbewerber in Deutschland ausgesetzt sein können: fehlende Zukunftsperspektiven, Inaktivität, ungewollte Abhängigkeit vom Sozialstaat, degradierende und unverständliche bürokratische Vorgänge, Massenunterkünfte, eingeschränkte Reiseerlaubnis sowie in manchen Fällen fremdenfeindliche Übergriffe. Posttraumatische Belastungsstörung Die Frage, ob das PTSD-Konzept auf verschiedene (Flüchtlings-)Kulturen übertragbar ist (Friedman & Jaranson, 1994; Nicholl & Thompson, 2004) oder ob es sich um ein rein westliches Phänomen handelt, das anderen Kulturen nicht „übergestülpt“ werden darf (Summerfield, 1999), haben verschiedene Forscher untersucht: Sack, Seeley und Clarke (1997) führten beispielsweise eine Studie zur Faktorenstruktur posttraumatischer Reaktionen bei kambodschanischen Jugendlichen durch, die mit ihren Familien in die USA geflüchtet waren, im Vergleich zu entsprechenden westlichen Stichproben durch. Es fanden sich in der kambodschanischen Stichprobe die Faktoren „Erregung“, „Vermeidung“, „Intrusionen“ und „Emotionale Taubheit“. Diese Struktur wurde auch in den westlichen Stichproben gefunden. Die Autoren sind der Ansicht, dass das PTSD-Konzept als Folge traumatischer (Kriegs-)Erlebnisse über Sprach- und kulturelle Barrieren hinweg Gültigkeit zu haben scheint. In einer weiteren Studie von Terheggen et al. (2001) mit tibetanischen Flüchtlingen in Indien zeigten über die Hälfte der Befragten Intrusions- und Vermeidungssymptome, die meisten hatten chronische gesundheitliche Probleme. Diejenigen mit höheren Intrusions- und Vermeidungswerten berichteten auch von stärker ausgeprägtem Stress. Zudem fanden die Untersucher den oben beschriebenen Dosis-Effekt, d. h. höhere Belastung bei höherer Anzahl verschiedenartiger traumatischer Erlebnisse (siehe auch „1.4.1 Risikofaktoren für die Entwicklung einer PTSD“). Die Autoren folgern, dass westliche Konzepte von Stress und Traumatisierung sehr hilfreich sind und entsprechende Reaktionen auf traumatische Erlebnisse auch in der untersuchten asiatischen Stichprobe gefunden werden konnten. Jedoch weisen sie auf die Notwendigkeit hin, sich mit den jeweiligen kulturellen Sichtweisen hinsichtlich Symptomen etc. vertraut zu machen, um sicherzugehen, dass in einem diagnostischen Interview das erhoben wird, das man erfragen möchte. 72 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE Prävalenz Zur Prävalenz von PTSD bei Flüchtlingen und Asylbewerbern in westlichen Ländern liegen in unterschiedlichen Studien Raten von knapp 10 % bis über 90 % vor, je nachdem, ob die untersuchten Personen Gewalt oder Ähnliches erlebt hatten bzw. ob es sich um Ergebnisse aus repräsentativen Stichproben von Flüchtlingen oder um speziellere Untergruppen handelte. Zu Befunden anhand repräsentativer Populationen von Flüchtlingen und Asylbewerbern finden sich folgende Studien: Fazel, Wheeler und Danesh (2005) analysierten 20 Studien zur Prävalenz verschiedener psychischer Erkrankungen in allgemeinen Flüchtlingspopulationen in westlichen Ländern. Sie fanden eine mittlere PTSD-Rate von 9 % in den Untersuchungen, in denen größere Stichproben (nur asiatische Flüchtlinge, die meist in den USA lebten) interviewt worden waren, und bis zu 31 % unter Berücksichtigung der anderen untersuchten Stichproben mit größerer Streuung der Herkunfts- und Exilländer (Miller, Elbert & Rockstroh, 2005). Blair (2000) befragte kambodschanische Flüchtlinge in den USA und fand eine PTSD-Rate von 45 %. In Deutschland untersuchte Gäbel (2004), wie groß der Anteil vor kurzem eingereister Flüchtlinge mit PTSD war. Es stellte sich heraus, dass 40 % der befragten Erwachsenen in den Erstunterkünften unter einer PTSD litten. Dies umfasste sowohl Personen, die organisierte Gewalt erlebt hatten, als auch diejenigen mit anderen traumatischen Erlebnissen in der Vergangenheit. In verschiedenen Studien von Silove und Steel (1998) in Australien zeigte sich, dass Asylbewerber und als Flüchtlinge anerkannte Personen deutlich höhere Raten an Angst, Depression und PTSD aufwiesen als Einwanderer und v. a. die Allgemeinbevölkerung. Besonders gefährdet waren diejenigen Asylbewerber, die in einem Auffanglager lebten. In diesen Studien wurden teilweise repräsentative Stichproben, teilweise ausgewählte Gruppen untersucht. Zu den nicht-repräsentativen Stichproben zählen meist solche, die in Behandlungszentren rekrutiert wurden oder bei denen keine kompletten Personenverzeichnisse für eine Zufallsauswahl erhältlich waren. Moisander und Edston (2003) befragten in Schweden Flüchtlinge, die in ihren verschiedenen Herkunftsländern im Rahmen von Haft, Zwangsarbeit oder -prostitution gefoltert worden waren. Die Befragten waren aus Bangladesch, Peru, Syrien, Uganda, der Türkei und dem Iran nach Schweden geflohen. Die PTSD-Raten variierten von 68,8 % in der syrischen Gruppe bis hin zu 91,7 % unter den Iranern. Verglichen mit Prävalenzzahlen zu PTSD in der westlichen Allgemeinbevölkerung, ist dies ein sehr hoher 73 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE Anteil (siehe „1.4.1 Prävalenz von traumatischen Lebensereignissen und PTSD in der westlichen Allgemeinbevölkerung“). Gotthardt (2007) fand in einer Stichprobe von Asylbewerbern in einer psychologischen Ambulanz für Flüchtlinge eine PTSD-Rate von 86 %. Momartin, Silove, Maniavasagar und Steel (2003) untersuchten bosnische Flüchtlinge mit dauerhafter Aufenthaltserlaubnis in Australien und fanden ein PTSD-Rate von 63 %. Davon wies der größte Teil einen extremen oder hohen Schweregrad auf. Die höchste PTSD-Rate fand sich in einer Untergruppe jener Flüchtlinge, die in einem Konzentrationslager gewesen waren. In einer schwedischen Studie von Ferrada-Noli, Asberg, Ormstad, Lundin und Sundbom (1998a) mit Flüchtlingen aus verschiedenen Ländern, die schwere Gewalt erlebt hatten, zeigte sich eine Rate von PTSD als Erstdiagnose bei 83 %. Keller, Lhewa, Rosenfeld, Sachs, Aladjem, Cohen, Smith und Porterfield (2006) untersuchten Flüchtlinge und Folterüberlebende in einem Behandlungszentrum für Folteropfer in den USA. Die Stichprobe ist nicht repräsentativ, da die Probanden sich selbst an das Zentrum wandten, um Hilfe zu erhalten. Sie stammten aus diversen Herkunftsländern verschiedener Kontinente und hatten alle organisierte Gewalt erlebt. Die Autoren fanden eine PTSD-Rate von 45,7 %. Risikofaktoren Betrachtet man Befunde zu Risikofaktoren für die Entwicklung einer PTSD (z. B. Brewin et al., 2000a), so wird deutlich, dass Asylbewerber und v. a. Flüchtlinge, die organisierte Gewalt erlebt haben, oft viele der Faktoren aufweisen und somit eine Risikogruppe für PTSD darstellen: Wie unter „1.4.1 Risikofaktoren für die Entwicklung einer PTSD“ angeführt, zählt u. a. Stress nach dem Erleben eines traumatischen Ereignisses zu den Risikofaktoren für eine PTSD (Brewin et al., 2000a). Die weiter oben angeführten Stressoren im Exil, denen Asylbewerber häufig ausgesetzt sind, können das Risiko, z. B. an einer PTSD zu erkranken, erhöhen oder eine Besserung der Symptome verhindern (Silove & Steel, 1998). Der hohe Anteil an Isolationsgefühlen (siehe oben) zeigt einen anderen Risikofaktor auf, den der mangelnden sozialen Unterstützung nach dem Trauma. Sourander (2003) stellte fest, dass Asylbewerber in Finnland am meisten unter Angst vor einer Abschiebung und der Trennung von Familienmitgliedern litten. Auch eine belastende und angstbehaftete Flucht nach traumatischen Erlebnissen kann unter die Kategorie „Stress nach dem Trauma“ fallen und das Risiko für eine PTSD erhöhen (Holtz, 1998), ebenso der Verlust der Heimat und der bisherigen Lebensstrukturen (Baker, 1992). 74 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE Weitere Risikofaktoren, die für viele Flüchtlinge zum Tragen kommen, sind der Dosis-Effekt und der Schweregrad traumatischer Erlebnisse – ein großer Anteil an Flüchtlingen, die organisierte Gewalt erlebt haben, berichtet von mehreren verschiedenen traumatischen Ereignissen in der Vorgeschichte (z. B. Gotthardt, 2007; Silove & Steel, 1998; Blair, 2000; Momartin, Silove, Manicavasagar & Steel, 2002). Ebenso haben Asylbewerber öfter eine geringe Bildung (z. B. Birck, 2004: etwa 14 % der Versuchspersonen hatten maximal die Grundschule besucht; Gotthardt, 2007: durchschnittlich sieben Jahre Bildung) und v. a. zu Beginn des Asylverfahrens (in Deutschland) gezwungenermaßen einen niedrigen sozioökonomischen Status (siehe „1.3.3 Regelungen zur Lebenssituation von Flüchtlingen“). In Norwegen zählten Immigranten aus nicht-westlichen Ländern im Vergleich zu denjenigen aus westlichen Ländern zu einem hohen Anteil zu Geringverdienern und Arbeitslosen (Dalgard & Thapa, 2007). Diese Gegebenheiten stellen weitere Risikofaktoren für die Entwicklung einer PTSD dar (Brewin et al., 2000a). In der unter „1.4.4 Besonderheiten bei Asylbewerbern und Flüchtlingen“ angeführten Studie von Keller et al. (2006) wurde die Schwere der PTSD-Symptomatik durch erlebte Todesdrohungen vorhergesagt. Auch Vergewaltigung und Foltererfahrungen in der Familie beeinflussten die PTSD-Schwere. Jüngere Probanden wiesen eine höhere Symptomschwere auf, ebenso Christen und Muslime im Vergleich zu Buddhisten. Frauen wiesen generell eine höhere psychische Symptomatik auf (bezüglich PTSD, aber auch Depressions- und Angstsymptomen). Probanden aus Asien präsentierten den geringsten PTSD-Schweregrad, Probanden aus Südamerika den höchsten. PTSD und das Asylverfahren Leidet eine Person unter einer PTSD, kann dies verschiedene Auswirkungen auf ihr Asylverfahren haben: Herlihy, Scragg und Turner (2002) stellten beispielsweise fest, dass eine stärker ausgeprägte PTSD-Symptomatik mit einer höheren Anzahl an Diskrepanzen in der Schilderung ihrer Verfolgung im Heimatland einherging – Diskrepanzen in der Schilderung führen im Asylverfahren jedoch häufig dazu, dass die Glaubwürdigkeit des Betreffenden in Frage gestellt wird. Auch mit längerer Zeit zwischen zwei Befragungen kam es zu vermehrten Diskrepanzen. Im Laufe eines Asylverfahrens liegen oft lange Intervalle zwischen den Anhörungen. Weber (1998) untersuchte den Umgang mit Folteropfern in der Asylanhörung und die Bewertung ihrer Foltererlebnisse bei Gericht in Deutschland. Es zeigte sich, dass nur in 35 % der untersuchten Fälle in der Anhörung nach dem Gesundheits- 75 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE zustand des Asylbewerbers und danach, ob er sich gesundheitlich zur Anhörung in der Lage fühle, gefragt worden war. Lediglich die Hälfte der Flüchtlinge wurde bei Hinweisen auf potenziell traumatische Erlebnisse genauer danach befragt. Das heißt, dass entscheidende Informationen vor Gericht nicht oder unzureichend Beachtung fanden. Lehmann (2007) führte eine retrospektive Studie zum Einfluss des Asylstatus’ auf eine posttraumatische Belastungsstörung bei Flüchtlingen durch. Es zeigte sich, dass eine Veränderung eines unsicheren Asylstatus’ hin zu einem sicheren keine Veränderung der PTSD-Symptomatik mit sich brachte. Jedoch verbesserten sich mit der Statusänderung sowohl depressive als auch somatoforme Symptome signifikant. Im Gegensatz zu diesen Befunden stellten Davis und Davis (2006) in einer prospektiven Studie mit Flüchtlingen in Kanada fest, dass die offizielle Anerkennung als Konventionsflüchtling einen Einfluss auf die Schwere der PTSD-Symptomatik und generalisierten Stress hatte. Eine positive Gerichtsentscheidung ging mit einem Symptomrückgang von PTSD und Stress einher. Eine Ablehnung hingegen führte zu einer Aufrechterhaltung der psychischen Probleme. Die unterschiedlichen Befunde lassen sich möglicherweise dadurch erklären, dass in der Untersuchung von Lehmann (2007) keiner der Probanden den Status eines Konventionsflüchtlings erlangte, der mit besonders hoher Sicherheit einhergeht. Wie unter „1.3.3 Rechtliche Situation von Asylbewerbern in Deutschland“ angeführt, kann die Diagnose einer PTSD ein Abschiebehindernis darstellen (Zenker, 2006). In der oben angeführten Studie von Keller et al. (2006) zeigte sich entsprechend der Befunde von Davis und Davis (2006), dass Probanden mit anerkanntem Asylstatus eine signifikant geringere PTSD-Symptomatik aufwiesen. Weitere psychische Störungen Es werden hier Ergebnisse zu weiteren psychischen Störungen bei Asylbewerbern und Flüchtlingen angeführt, die z. T. Komorbidität mit PTSD aufzeigen, meist jedoch Störungsraten ohne Berücksichtigung möglicher Komorbidität darstellen. Sollte in einer hier angeführten Studie explizit die Komorbidität von anderen Störungen mit PTSD erhoben worden sein, wird dies gesondert angegeben. Raten von Depression bei Asylbewerbern und Flüchtlingen schwanken je nach untersuchter Stichprobe zwischen 33 und 86 %, weitere Störungen liegen bei etwa 3 bis 30 % der Probanden vor (hier nicht unterschieden nach Komorbidität zu PTSD oder zu anderen Störungen oder keiner Komorbidität). 76 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE Gotthardt (2007) fand in einer Stichprobe von Asylbewerbern vor einer Behandlung bei 70 % sowohl eine PTSD als auch eine komorbide Depression. Suizidpläne und -versuche in der Vorgeschichte bestanden bei 56 %. Es wiesen 3,8 % eine Panikstörung ohne Agoraphobie auf. Eine Panikstörung mit Agoraphobie bestand bei 7,7 % der Probanden, eine Agoraphobie ohne Panikstörung in der Vorgeschichte sowie eine soziale Phobie bei jeweils 3,8 %. Niemand zeigte eine Zwangsstörung. Bei 20 % wurde eine generalisierte Angststörung festgestellt, Raten von Substanzmissbrauch lagen bei 3,8 %. Steel et al. (2004) untersuchten Asylbewerber in einem Auffanglager, das diese nicht verlassen durften, und stellten in der befragten Stichprobe bei jedem Erwachsenen eine Major Depression und komorbid bei 86 % eine PTSD fest. Diese Raten waren dreimal so hoch wie vor der Inhaftierung. Blair (2000) fand unter Flüchtlingen aus Kambodscha in den USA eine Depressionsrate von 51 %. Asylbewerber in Australien wiesen Depressionsraten von 33 % und Angstsymptomraten von 23 % auf (Silove & Steel, 1998). Ferrada-Noli et al. (1998a) fanden bei 46 % einer Untergruppe von Flüchtlingen mit PTSD eine komorbide Störung aus dem depressiven Spektrum. Darüber hinaus wiesen 29 % komorbide Angststörungen auf. In der Gesamtstichprobe berichteten 50 % der Befragten von suizidalem Verhalten (Suizidgedanken, -pläne oder -versuche), innerhalb der PTSD-Gruppe waren es 57 %. Ferrada-Noli, Asberg und Ormstad (1998b) stellten einen Zusammenhang zwischen bestimmten hauptsächlich bei einer Person angewandten Foltermethoden und späteren ähnlichen Suizidphantasien, -plänen oder Methoden bei Suizidversuchen fest, z. B. hatten diejenigen suizidalen Befragten, die mit Wasser gefoltert worden waren, besonders häufig Gedanken an einen Tod durch Ertrinken. Die Autoren weisen jedoch darauf hin, dass es andere Faktoren geben könnte, die einen größeren Einfluss auf Suizidgedanken etc. haben könnten als die früheren Foltermethoden. Keller et al. (2006) – siehe weiter oben – fanden in einer Stichprobe von Überlebenden organisierter Gewalt eine Rate klinisch relevanter Depressionssymptome von 84,5 % und eine Angstsymptom-Rate von 81,1 %. Körperliche Beschwerden Asylbewerber und Flüchtlinge haben häufig mit einer Reihe körperlicher Symptome zu kämpfen: So berichteten beispielsweise Folterüberlebende aus sechs verschiedenen Ländern, die nun in Schweden lebten, von zahlreichen chronischen körperlichen Problemen seit der Folter (Moisander & Edston, 2003): Nahezu 50 % der Befragten litten unter chronischen Kopfschmerzen, 43,1 % unter Gelenkschmerzen und fast 42 % unter Rückenschmerzen; nahezu 30 % berichteten von überdauern- 77 1.4 Psychische Folgen organisierter Gewalt 1 THEORIE den gastrointestinalen Beschwerden. Silove und Steel (1998) fanden bei über 20 % von Asylbewerbern in Australien verschiedene physische Beschwerden (z. B. Kopfoder weitere Schmerzen, Schlafprobleme, Verdauungsbeschwerden etc.). Junod Perron und Hudelson (2006) stellten bei Asylbewerbern aus der Balkanregion, die jetzt in der Schweiz lebten, in 77 % der Fälle Kopfschmerzen fest, 46 % litten unter Müdigkeit und 65 % unter Knochen- und Gelenkschmerzen. Es zeigte sich, dass die Befragten ihre Beschwerden auf traumatische Erlebnisse vor der Flucht zurückführten, das Fortbestehen der Symptome brachten sie teilweise mit ihren momentanen schwierigen Lebensumständen und ihrem unsicheren Aufenthaltsstatus in Verbindung. Arztbesuche und Medikamenteneinnahme Asylbewerber mit PTSD und einem unsicheren Aufenthaltsstatus nahmen nach einer Studie von Gotthardt (2007) häufig Behandlungen in Anspruch: Bei mindestens einem Arzt waren 89 % der Befragten in Behandlung, bei einem Psychotherapeuten über 70 %. Lediglich 16 % waren überhaupt nicht in Behandlung. Über 80 % nahmen Medikamente ein, meist Psychopharmaka. Fast ein Drittel der untersuchten Frauen nahm täglich bis zu fünf verschiedene Präparate ein, und über 50 % der Gesamtstichprobe nahmen Antidepressiva. Silove und Steel (1998) berichten, dass es für Asylbewerber in Australien oft schwierig ist, ärztliche oder psychotherapeutische Behandlung zu erhalten. Drozdek, Noor, Lutt und Foy (2003) stellten in einer niederländischen Studie fest, dass Asylbewerber mit PTSD im Vergleich zu denjenigen ohne PTSD deutlich häufiger zum Arzt gingen. Munro, Freeman und Law (2004) untersuchten, wie gut es niedergelassenen Allgemeinärzten und Psychiatern gelang, eine PTSD anhand von Fallgeschichten zu erkennen und eine adäquate Behandlung einzuleiten. Es zeigten sich einige Lücken in der Diagnostik und in den Behandlungsvorschlägen. Im Gespräch mit einem realen Patienten wäre die Diagnosestellung je nach Offenheit des Betroffenen noch schwieriger. Bedenkt man, dass Flüchtlinge und Asylbewerber häufig nur unzureichend die Sprache ihres Exillandes beherrschen (Blöchliger, Tanner, Hatz & Junghanss, 1997) und oft kein Dolmetscher zur Verfügung steht (Salman & Collatz, 1999), ist anzunehmen, dass eine PTSD in diesem Kontext wohl noch seltener erkannt wird. Laut Brucks (2004) tragen sowohl der Stress bedingt durch die Migration selbst als auch das deutsche Gesundheitswesen, in dem ein Flüchtling häufig keine adäquate Behandlung erhält, zur Chronifizierung von Krankheiten bei. 78 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE Eine PTSD klingt oft nicht spontan wieder ab: So fanden z. B. Perkonigg, Pfister, Stein, Höfler, Lieb, Maercker und Wittchen (2005) in der westlichen Allgemeinbevölkerung bei unbehandelten Betroffenen nach mehreren Jahren noch eine PTSDRate von nahezu 50 %, Kessler et al. (1995) stellten fest, dass etwa ein Drittel der Befragten nach vielen Jahren noch eine PTSD hatte, obwohl sie teilweise in Behandlung gewesen waren. Schaal (2006) fand bei unbehandelten ruandischen Jugendlichen nach sechs Monaten noch eine PTSD-Rate von 96,3 %. Zahlreiche Behandlungsstudien mit verschiedenen Stichproben, die eine Wartelistenbedingung eingeschlossen hatten, zeigten auf, dass eine PTSD-Symptomatik selten ohne Behandlung signifikant zurückgeht (z.B. Keane, Fairbank, Caddell & Zimering, 1989; Brom, Kleber & Defares, 1989; Resick, Nishith, Weaver, Astin & Feuer, 2002; Foa, Rothbaum, Riggs & Murdock, 1991; Foa, Dancu, Hembree, Jaycox, Meadows & Street, 1999; Foa, Hembree, Cahill, Rauch, Riggs, Feeny & Yadin, 2005; Ruf, Schauer, Neuner, Schauer, Elbert & Catani, 2007). Eine PTSD verläuft also in vielen Fällen chronisch, unter Umständen bis hin zu Jahrzehnten nach dem auslösenden Ereignis bzw. dem ersten Auftreten von Symptomen (z. B. Bichescu et al., 2005; Maercker & Schützwohl, 1997). Vor allem diejenigen, die unter einer solchen chronischen PTSD leiden, suchen nach Behandlungsmöglichkeiten (Ehlers & Clark, 2000). Es existiert eine Reihe hauptsächlich psychotherapeutischer Behandlungsformen, die – soweit systematisch untersucht – im Allgemeinen häufig zu signifikanten Symptomverbesserungen führen (Sherman, 1998). Ein neues Feld stellt die Therapie über das Internet dar (Lange, van de Ven & Schrieken, 2003). Zudem gibt es Ansätze z. T. ergänzender medikamentöser Therapien, vor allem mit antidepressiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmern (SSRIs), deren Wirksamkeit am besten untersucht und hinreichend belegt ist (Cooper, Carty & Creamer, 2005; Foa et al., 2000), sowie Verfahren zur Krisenintervention und verschiedene gruppentherapeutische Angebote (Solomon & Johnson, 2002). Darüber hinaus existiert eine Vielzahl von alternativen Allein- oder Ergänzungsbehandlungen: z. B. Akupunktur (Ulett, 1996) oder die nach ähnlichen Prinzipien vorgehende „Thought Field Therapy“ (Folkes, 2002), Massage und verschiedene „Energie-Behandlungen“ wie Reiki (Collinge, Wentworth & Sabo, 2005), Kunsttherapie (Bowers, 1992) usw. Die Effektivität dieser Behandlungen wurde bisher nur vereinzelt oder gar nicht in wissenschaftlichen Studien überprüft – insgesamt finden sich zahlreiche Einzelfallstudien zu den einzelnen Behandlungsformen, in denen Aussagen über die jeweilige Wirksamkeit getroffen werden, jedoch werden seltener kontrollierte klinische Studien 79 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE dazu durchgeführt (Solomon & Johnson, 2002). Im Folgenden wird ausschließlich auf die hauptsächlich zur Anwendung kommenden einzel-psychotherapeutischen Verfahren unter Berücksichtigung der dazu vorliegenden klinischen Wirksamkeitsstudien genauer eingegangen. Therapiestudien mit Flüchtlingen und Asylbewerbern in westlichen Ländern werden gesondert und nicht nach Therapiemethoden getrennt am Ende des Kapitels angeführt. 1.5.1 Kontroverse Therapieansätze – Exposition unabdingbar oder potenziell gefährlich? Angesichts der Vielzahl an psychotherapeutischen Interventionen bei PTSD scheint es sinnvoll, eine grobe Einteilung z. B. anhand der jeweiligen Vorgehensweisen vorzunehmen. Eine solche mögliche Einteilung ist folgende: Einerseits finden sich Expositionsverfahren, d. h. solche, die eine Konfrontation des Patienten mit seinen Ängsten beinhalten und in denen zumeist die traumatischen Erfahrungen Thema der Behandlung sind. Andererseits existieren Verfahren, in denen der Schwerpunkt z. B. auf Stabilisierung, Veränderung der Kognitionen, Stress- oder allgemeiner Problembewältigung liegt; diese enthalten entweder keine Expositionsbausteine, oder diese kommen nur unter bestimmten Voraussetzungen zum Einsatz. Manche Ansätze kombinieren obligatorische Exposition und z. B. kognitive Arbeit. Jedoch gibt es jeweils Verfechter eines der beiden gegensätzlichen Prinzipien, und es besteht bislang Uneinigkeit darüber, welche therapeutische Vorgehensweise die beste ist (McFarlane & Yehuda, 2000). Beispielsweise werden Ansätze, die Exposition enthalten, von manchen Experten als schädlich eingeschätzt, wohingegen ihre Wirksamkeit andererseits am besten erforscht ist und sie in Richtlinien empfohlen werden (siehe nächster Abschnitt, „1.5.2 Therapieverfahren mit Expositon als festem Bestandteil“). Im Folgenden werden verschiedene Verfahren aus unterschiedlichen psychotherapeutischen Richtungen beschrieben sowie der jeweilige Forschungsstand dazu dargestellt. Es ist anzumerken, dass allgemein Kontroversen zwischen Therapieforschung und praktischer klinischer Tätigkeit bestehen: Niedergelassene Behandler wenden häufig nicht die Therapieverfahren an, die empirisch am besten abgesichert sind, sondern arbeiten anhand ihrer eigenen praktischen Erfahrungen, da sie die Ergebnisse aus der Forschung als zu praxisfern betrachten (z. B. Goldfried, Borkovec, Clarkin, Johnson & Parry, 1999; Herbert, 2003; Crits-Christoph, Wilson & Hollon, 2005). D. h. Klienten erhalten aus verschiedenen Gründen nicht regelhaft psycho- 80 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE therapeutische Behandlungen, deren Evidenz wissenschaftlich abgesichert wurde und die als empfohlene Standardverfahren gelten (Herbert, 2003). 1.5.2 Therapieverfahren mit Exposition als festem Bestandteil Nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung sind Behandlungsansätze der PTSD aus dem kognitiv-verhaltenstherapeutischen Spektrum am erfolgreichsten und somit die Methoden der Wahl (z. B. Richtlinien des National Institute of Clinical Excellence – NICE, England, National Collaboration Center for Mental Health, 2005; Foa et al., 2000). Diese Verfahren sind am besten und ausführlichsten wissenschaftlich untersucht worden (Solomon & Johnson, 2002). Irgendeine Form von Exposition ist meist ein Bestandteil von kognitiv-verhaltenstherapeutischen Behandlungen (Ehlers & Clark, 2000). In der Exposition wird der Patient in sensu oder in vivo und mit unterschiedlichen Vorgehensweisen mit angstauslösenden Reizen konfrontiert; dabei soll der konditionierten Angstreaktion auf diese Reize entgegengewirkt werden (Lyons & Keane, 1989; Foa & Meadows, 1997). Bei PTSD-Patienten bedeutet das z. B. eine Konfrontation mit der traumatischen Situation in der Erinnerung, mit angstauslösenden Körperempfindungen, vermiedenen Situationen im Alltag, u. U. sogar mit dem Ort des Geschehens (Robertson, Humphreys & Ray, 2004; Foa et al., 1999). Die verschiedenen im Folgenden genauer beschriebenen Expositionstechniken variieren hinsichtlich der Dimension (in vivo oder in sensu), Dauer und Intensität der Konfrontation (Foa & Meadows, 1997). Eines der ersten Expositionsverfahren war die Systematische Desensibilisierung, die in den 50er Jahren von Wolpe entwickelt wurde (Foa & Meadows, 1997). In der Systematischen Desensibilisierung erlernt der Patient zunächst Entspannungstechniken, dann findet eine abgestufte Exposition bezüglich vermiedener Stimuli statt, der Schwierigkeitsgrad wird dabei gesteigert. Mit Hilfe der Entspannung, die mit der Angstreaktion unvereinbar ist, soll die Angstreaktion gehemmt werden (Sherman, 1998). Der Stand der Forschung zur Wirksamkeit des Verfahrens bei PTSD werden am Ende des Abschnitts unter „Sonstige Studien zu kognitivverhaltenstherapeutischen Behandlungen mit Exposition“ angeführt. Ein weiteres frühes Expositionsverfahren war die „Implosive Therapie“ (eher als „Flooding“ bekannt), die in den 60er Jahren zur Behandlung von Angstsymptomen entwickelt wurde (Hogan, 1968). Es wurde davon ausgegangen, dass nach einem ängstigenden Erlebnis alle Reize, die in der Situation präsent waren, später Angst auslösen können. Der Betroffene lernt, diese aufsteigende Angst durch eine Reihe von Abwehrmechanismen wie z. B. Vermeidungsverhalten zu reduzieren. 81 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE Um diese Abwehrmechanismen zu „verlernen“ bzw. zu löschen, muss das Trauma in einem sicheren Umfeld, d. h. ohne dass negative Konsequenzen erfolgen, wieder durchlebt werden. Dabei werden Szenen imaginiert, die dem früheren Trauma oder sonstigen angstmachenden Situationen ähneln. Die Anwendung implosiver Techniken ist jedoch nicht auf die Behandlung von Angst nach traumatischen Ereignissen beschränkt, sondern ist bei allen Arten von Konflikten anwendbar (Zurückweisungen, frühere Erniedrigungen oder Entbehrungen, Aggressionen etc.). Lyons und Keane (1989) beschreiben ein modifiziertes Prinzip der Implosiven Therapie bei PTSD-Patienten, das Expositions- und Entspannungsbausteine enthält. Keane et al. (1989) führten mit dieser modifizierten Variante eine randomisierte kontrollierte Wirksamkeitsstudie mit 14 bis 16 Sitzungen implosiver Therapie bei 24 Vietnamveteranen durch, die infolge ihrer Kriegserlebnisse eine PTSD entwickelt hatten: Es zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen der Therapie- und einer Wartelistengruppe in der PTSD-Symptomatik. Vor allem verbesserten sich bei den Patienten die intrusiven Symptome, Angst und Depression, wohingegen sich emotionale Taubheit und die Vermeidung sozialer Situationen nicht veränderten. Obwohl in zahlreichen Studien die Effektivität von Expositionsverfahren belegt wurde (siehe weiter unten), profitieren nicht alle PTSD-Patienten davon: Ehlers, Clark, Dunmore, Jaycox, Meadows und Foa (1998) fanden heraus, dass z. B. bestimmte kognitive Unterschiede zwischen Probanden den gewünschten Erfolg einer Expositionstherapie schmälern können. Vergewaltigungsopfer, die sich während der Tat vollkommen hilflos fühlten und sich selbst aufgaben („mental defeat“) erzielten deutlich geringere Therapieerfolge als diejenigen, die unabhängig von tatsächlicher Hilflosigkeit weiterhin Handlungspläne im Kopf hatten („mental planning“). Auch Erfahrungen nach dem Trauma beeinflussten den Behandlungserfolg: Diejenigen, die eher negative Erfahrungen mit anderen Personen gemacht und sich vollkommen entfremdet von allen und dauerhaft verändert gefühlt hatten, erreichten geringere Besserung in der Behandlung als diejenigen, die sich eher sozial unterstützt gefühlt oder das Trauma als isoliertes Ereignis interpretiert hatten. Weitere Prädiktoren für Behandlungserfolg – sofern die jeweilige Studie entsprechende Analysen enthält – werden weiter unten aufgeführt. Scott und Stradling (1997) sind der Ansicht, dass Expositionsverfahren nicht für alle Patienten die Methoden der Wahl sind: Sie berichten von zwei Studien, in denen die Compliance von PTSD-Patienten gegenüber Expositions-Hausaufgaben untersucht wurde. Es zeigte sich, dass die Compliance bei höherer PTSD-Symptomatik niedriger war und die Patienten insgesamt wenig Bereitschaft zeigten, die Hausaufgaben durchzuführen. Es ist jedoch fraglich, inwieweit die Beurteilung der 82 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE Compliance allein anhand der Mitarbeit bei therapeutischen Hausaufgaben aussagekräftig ist – es sollte beachtet werden, dass beispielsweise Angst die Mitwirkung des Patienten an therapeutischen Hausaufgaben hemmen kann (Kanfer, Reinecker & Schmelzer, 2000). Pitman, Altman, Greenwald, Longpre, Macklin, Poiré und Steketee (1991) vermuten, dass Exposition nicht so gut gegen begleitende Gefühle wie Traurigkeit, Scham, Schuld oder Wut hilft wie gegen Angst. Sie führen sechs Fallbeschreibungen zu Komplikationen bei Flooding mit Vietnamveteranen an: Alle Patienten in den Fallbeschreibungen hatten entweder früher mindestens eine weitere psychische Störung komorbid zur PTSD gehabt oder hatten dies aktuell auch noch. Jedoch ist nicht anzunehmen, dass Flooding als spezifische Intervention für Angst alle anderen psychischen Probleme ebenfalls positiv beeinflusst. Zudem wird Exposition in der Regel (zumindest außerhalb von Therapieforschung) nicht isoliert von weiteren therapeutischen Interventionen stattfinden (wie in der Flooding-Studie der Fall). Summerfield (2005) kritisiert die Empfehlung in den NICE-Guidelines (National Collaboration Center for Mental Health, 2005), Expositionsverfahren bei PTSD einzusetzen. Er ist der Ansicht, dass der Fokus auf die Vergangenheit und die erlebten Belastungen sowie die Kranken- und Opferrolle die Befindlichkeit von Patienten eher verschlechtert und ihnen rehabilitative Maßnahmen mehr nützen würden. Cognitive Processing Therapy (CPT) Die „Cognitive Processing Therapy“ wurde Anfang der 90er Jahre von Resick und Schnicke (1992) zur Behandlung von PTSD bei Opfern sexueller Gewalt entwickelt und enthält zum einen Bausteine kognitiver Therapie und zum anderen Exposition mittels Aufschreibens und Vorlesens des traumatischen Erlebnisses. Die Elemente kognitiver Therapie fokussieren auf verzerrte und übergeneralisierte Annahmen über sich selbst, das Trauma und die Welt im Allgemeinen. Diese Annahmen werden mithilfe von sokratischem Dialog und dem Führen von Tagebüchern in Frage gestellt und durch angemessenere ersetzt, diese werden dann auch im Alltag getestet. Die Symptome werden auf die verzerrten Bewertungen der traumatischen Situation, Konflikte zwischen früheren Annahmen und den neuen Informationen durch das Trauma-Erleben, negative und mit eigenen Denkweisen unvereinbare Denkschemata von anderen oder die Unfähigkeit, das Erlebte überhaupt irgendeinem existierenden Erlebensschema zuzuordnen, zurückgeführt. Die Autoren gehen davon aus, dass die Exposition zwar bereits mit bisherigen Annahmen un- 83 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE vereinbare neue Erfahrungen bietet, dass dadurch jedoch möglicherweise lediglich die Angstreaktion verändert wird. Da jedoch verschiedene weitere emotionale Reaktionen außer der Angst bestehen können, die eine Besserung der Symptomatik behindern könnten, sind die genannten kognitiven Techniken zur Veränderung dieser Reaktionen in die Behandlung integriert. Nach einer vielversprechenden, jedoch methodisch mangelhaften Studie mit CPT als Gruppentherapie (Resick & Schnicke, 1992) führten Resick et al. (2002) eine randomisierte kontrollierte Studie mit über 150 Patientinnen zum Vergleich von CPT mit Prolonged Exposure (PE) durch. Es wurden jeweils dreizehn Sitzungen durchgeführt. Zusätzlich gab es eine so genannte „minimal attention“Wartelisten-Bedingung. In den beiden Behandlungsgruppen kam es zu signifikanten Symptomverbesserungen über die Zeit, die Wartelisten-Gruppe zeigte hingegen keine Veränderung der Symptomatik. Die Unterschiede zwischen den Ergebnissen in der CPT- und PE-Gruppe waren nicht signifikant. Von denen, die die Behandlung vollständig durchliefen, erfüllten in der CPT-Gruppe nach der Behandlung und zu den 3- und 9-Monats-Nachuntersuchungszeitpunkten nur noch jeweils 19,5 %, 16,2 % bzw. 19,2 % und in der PE-Gruppe lediglich jeweils 16,2 %, 29,7 % und 15,4 % die Kriterien für eine PTSD. Auch hinsichtlich depressiver Symptome erzielten beide Behandlungsgruppen signifikante Verbesserungen. Bezüglich Schuldgefühlen und -gedanken erreichten beide Gruppen eine signifikante Verbesserung, jedoch erwies sich CPT hier in bestimmten Bereichen als erfolgreicher (bezüglich der Skalen „rückblickender Verzerrung“ und „Fehlen von Rechtfertigung“). Es brachen insgesamt über 20 % die Behandlung ab: 26,8 % in der CPTGruppe, in der PE-Gruppe waren es 27,3 %, in der Wartelisten-Gruppe 14,9 %. Diese Versuchspersonen unterschieden sich jedoch hinsichtlich PTSD und Depression in der ersten Untersuchung nicht von den anderen. Prolonged Exposure (PE) Die „Prolonged Exposure“ (PE) wurde von Foa und Kollegen vor dem Hintergrund der „Emotional processing theory“ für die Arbeit mit Vergewaltigungsopfern entwickelt (Foa et al., 1991). Exposition findet dabei einerseits in sensu statt: Das traumatische Erlebnis wird in der Vorstellung noch einmal möglichst intensiv durchlebt und dabei im Präsens nacherzählt, dies soll mindestens 45 Minuten in Anspruch nehmen. Die Sitzungen werden aufgenommen, und die Patientin soll die Bänder täglich zuhause anhören. Zusätzlich sollen die Patientinnen zwischen den Sitzungen in vivo Exposition durchführen, indem sie objektiv ungefährliche Situationen 84 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE aufsuchen, die ihnen Angst machten oder die sie bisher vermieden hatten. Durch die Exposition soll eine Angstreduktion bezüglich der trauma-assoziierten Reize durch Habituation erreicht werden, zudem soll die Erfahrung gemacht werden, dass die Angstreaktion auch ohne Vermeidung oder Flucht nicht unendlich andauert. Gleichzeitig wird durch die absichtliche Konfrontation die negative Verstärkung unterbrochen, bei der die Angst längerfristig durch Vermeidung oder Flucht aufrecht erhalten bleibt. Durch das Wiedererleben in einem sicheren und unterstützenden Therapierahmen werden der Erinnerung an das Trauma neue, mit Sicherheit assoziierte Informationen hinzugefügt. Auch eine differenziertere Betrachtung des traumatischen Erlebnisses (z. B. als einzelnes Ereignis und nicht als Beweis dafür, dass das Leben an sich gefährlich ist) soll durch die wiederholte Beschäftigung damit erreicht werden. Zudem lernt der Betroffene, dass er die PTSD-Symptome aushalten kann, ohne die Kontrolle zu verlieren, und kann dadurch lernen, sie realistischer einzuschätzen. Auch weitere negative Bewertungen, die mit dem traumatischen Erlebnis in Zusammenhang stehen, können durch die wiederholte Exposition verändert werden (Foa & Rothbaum, 1998). Mehrere Studien belegen die Wirksamkeit der postulierten Therapiemechanismen der Prolonged Exposure (Brewin & Holmes, 2003): Foa et al. (1991) führten beispielsweise eine Studie mit 45 Vergewaltigungsopfern durch, die in der Folge an einer PTSD erkrankt waren. Die Patientinnen wurden einer von vier Bedingungen zugeteilt (Warteliste, Prolonged Exposure, Stress-Impfungs-Training – SIT – oder unterstützende Beratung). Es zeigte sich zu den verschiedenen Nachuntersuchungszeitpunkten, dass in allen vier Bedingungen die Symptomatik reduziert worden war – allerdings reduzierte sich in der Beratungs- und Wartelistenbedingung lediglich die Übererregungssymptomatik. Jedoch war unmittelbar nach der Behandlung die Symptomatik in der SIT-Gruppe signifikant stärker reduziert als in der Wartelisten- und Beratungsbedingung. Drei Monate nach Ende der Therapie zeigte sich die Prolonged Exposure als am wirkungsvollsten (jedoch keine signifikanten Unterschiede). Die Symptomverbesserungen bei PE und SIT bezogen sich auf alle drei Symptombereiche der PTSD. Die ebenfalls erhobene Depressionsund Angstsymptomatik wurde in allen vier Gruppen signifikant reduziert, was die Autoren allgemein auf den therapeutischen Kontakt zurückführen. In der PEGruppe brachen 28,6 % die Behandlung ab, in der SIT-Gruppe 17,6 % und in der Beratungs-Gruppe 21,4 %. Die Therapieabbrecherinnen unterschieden sich dahingehend signifikant von den anderen Teilnehmerinnen, dass sie geringerqualifizierte Arbeitsplätze innehatten, weniger verdienten und höhere Symptome im „Rape Aftermath Symptom Test“ (RAST) aufwiesen. 85 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE In einer weiteren Untersuchung von Foa et al. (1999) wurden wiederum PE und SIT miteinander verglichen, eine dritte Behandlungsbedingung stellte jedoch zusätzlich die Kombination aus beiden Verfahren dar (wurde ebenfalls bereits weiter oben beschrieben, siehe „Prolonged Exposure“). Zudem gab es eine WartelistenKontrollgruppe. Es brachen 8 % der Probandinnen in der PE-Gruppe die Behandlung ab, in der SIT-Gruppe und der PE-SIT-Gruppe waren es je 27 %, in der Warteliste keiner der Teilnehmerinnen. Es bestand ein Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Therapieabbrüchen. Es zeigte sich eine signifikante und über die Zeit stabile Symptomreduktion in allen drei Behandlungsgruppen hinsichtlich PTSD (alle Symptomgruppen), Depression und weiteren Angstsymptomen (letzteres nur in der Gruppe der Personen, die die Therapie zu Ende führten), in der SIT-Gruppe erfüllten 42 % der Patientinnen nach der Behandlung die Kriterien für eine PTSD nicht mehr (PE: 60 %, PE + SIT: 40 %). In der „Intent to treat“-Gruppe erreichte PE einen jedoch stärkeren Symptomrückgang als SIT und PE-SIT. Entgegen der Annahme der Untersucher stellte sich die kombinierte Behandlung aus PE und SIT nicht als erfolgreicher heraus als die jeweiligen Verfahren alleine. In einer zusätzlichen Studie von Foa et al. (2005) wurde PE mit und ohne kognitive Umstrukturierung miteinander verglichen (in vivo und imaginativ), zudem gab es eine Wartelistengruppe. Beide Behandlungsbedingungen reduzierten die PTSD- und Depressionssymptomatik der teilnehmenden Frauen nach Gewalterfahrungen signifikant und nachhaltig im Vergleich zur Wartelisten-Kontrollgruppe, und es gab keine Unterschiede zwischen den Behandlungsgruppen. Das Funktionsniveau hinsichtlich sozialer Variablen stieg in beiden Behandlungsgruppen signifikant bei denjenigen Frauen, die die Therapie zu Ende führten. Die Behandlungen wurden teilweise von Experten in kognitiver Verhaltenstherapie in akademischem Setting durchgeführt, teilweise von Beratern mit geringer Erfahrung in kognitiver Verhaltenstherapie in kommunalen Anlaufstellen für Vergewaltigungsopfer. Es zeigte sich, dass die Therapieergebnisse der beiden Behandlergruppen sich nicht unterschieden. In der PE-Gruppe brachen 34,2 % der Teilnehmerinnen die Behandlung ab, in der Gruppe mit PE und kognitiver Umstrukturierung waren es 40,5 %, in der Wartelistengruppe 3,8 %. Eine Studie von Resick et al. (2002) zum Vergleich von „Cognitive Processing Therapy“ mit „Prolonged Exposure“ wurde bereits im oben stehenden Abschnitt „Cognitive Processing Therapy (CPT)“ beschrieben. Die PTSD-Symptomatik der Versuchspersonen (sowohl in der CPT- als auch der PE-Gruppe) nahm über die Zeit signifikant ab. 86 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE Eine Untersuchung von van Minnen, Arntz und Keijsers (2002) hatte Prädiktoren für Therapieergebnisse und -abbrüche bei PE zum Thema. Auch in dieser Studie zeigte sich PE als erfolgreich in der Symptomreduktion der PTSD, ebenso hinsichtlich Depressivitäts- und weiteren Angstsymptomen. Es stellte sich hinsichtlich Prädiktoren des Therapieergebnisses heraus, dass in beiden untersuchten Gruppen höhere Symptomwerte vor der Therapie höhere Werte zu den Nachuntersuchungszeitpunkten voraussagten. Alle weiteren untersuchten Faktoren wie z. B. Persönlichkeitszüge, demografische Variablen oder Charakteristika des Traumas wiesen keinen Zusammenhang mit dem Behandlungserfolg auf. Es brachen insgesamt 28 % der Teilnehmer die Behandlung ab. Prädiktoren für den Therapieabbruch waren männliches Geschlecht bzw. Alkoholkonsum, was sich in dieser Stichprobe jedoch nicht getrennt voneinander betrachten ließ. Zudem ging Benzodiazepineinnahme mit einer geringeren Abbrecherrate, jedoch auch eher geringerem Therapieerfolg einher. In einer weiteren Studie untersuchten van Minnen und Foa (2006), inwieweit eine bestimmte Dauer einer Expositionssitzung notwendig ist, um die PTSD-Symptomatik erfolgreich zu reduzieren. Es zeigte sich, dass es für den Therapieerfolg hinsichtlich PTSD-, Depressions-, Angstsymptomatik und Funktionsniveau keinen Unterschied machte, ob die Exposition in sensu 30 oder 60 Minuten dauerte. Die Probanden mit 60-minütiger Exposition habituierten zwar eher innerhalb einer Sitzung, dies hatte jedoch keinen Einfluss auf den Gesamterfolg der Behandlung. In einer Studie von Rauch, Foa, Furr und Filipp (2004) zeigte sich, dass die Einschätzung der subjektiven Angststärke im Laufe der Behandlung mit PE oder PE mit kognitiver Umstrukturierung bei Vergewaltigungsopfern mit dem späteren Therapieerfolg zusammenhing: Je stärker die Angst über die Sitzungen hinweg abnahm, desto größer war die Symptomreduktion nach der Behandlung. Entgegen der Annahmen der Autoren gab es keinen Zusammenhang zwischen der Intensität des imaginativen Wiedererlebens in der Exposition und dem Therapieerfolg. Im Laufe einer Behandlung mit PE veränderten sich in einer Studie von Foa, Molnar und Cashman (1995) die Erzählungen des traumatischen Erlebnisses (länger, detailreicher, mehr Handlungsbeschreibungen und Dialoge), was mit einer Verminderung depressiver Symptome einherging. Zudem bestand ein Zusammenhang zwischen der Abnahme fragmentierter Erzählungselemente und der Reduktion der Symptomatik. In einer weiteren Untersuchung zeigen sich zudem Veränderungen von negativen Gedanken über sich selbst und die Welt sowie Selbstvorwürfen (Foa & Rauch, 2004). In der letztgenannten Studie machte es keinen Unter- 87 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE schied, ob PE oder PE mit zusätzlicher kognitiver Umstrukturierung durchgeführt wurde. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) EMDR wurde 1989 erstmals von Shapiro als Behandlung bei PTSD beschrieben (damals noch „EMD“; Shapiro, 1999). Es handelte sich um ein Verfahren mit imaginativer Exposition und gleichzeitigen sakkadischen Augenbewegungen. Das Verfahren wurde seither weiterentwickelt und enthält psychodynamische, verhaltenstherapeutische, kognitive, körperorientierte und systemische Behandlungsbausteine (Shapiro, Vogelmann-Sine & Sine, 1994). EMDR ist in acht Phasen unterteilt und wird wiederum als ein Baustein einer umfassenden Traumatherapie eingesetzt. Die Methode sollte erst nach erfolgreichem Aufbau einer therapeutischen Beziehung, Abklärung möglichen sekundären Krankheitsgewinns und ausreichender Stabilisierung des Patienten angewendet werden (Shapiro et al., 1994). Ein zentrales Element ist die bilaterale Stimulation des Klienten (mittels sakkadischer Augenbewegungen, die dadurch hervorgerufen werden, dass der Klient horizontalen Fingerbewegungen des Therapeuten folgt, oder auch Tönen oder abwechselnden Bewegungen der linken und rechten Hand etc.), während er sich gleichzeitig auf die Situation konzentrieren soll, die seiner psychischen Problematik zugrunde liegt (Erinnerungen an Traumata, später jedoch auch aktuelle Problemsituationen; Shapiro, 1996). Die Exposition ist jeweils nur wenige Minuten lang und findet in Form von freien Assoziationen anstelle einer konkreten Erinnerung an eine Situation statt (Shapiro, 1999). Kritiker stellen in Frage, inwieweit die bilaterale Stimulation zusätzlich zur Exposition von Nutzen ist (z. B. Robertson et al., 2004). Shapiro (1996) vertritt jedoch die Ansicht, dass jedenfalls nicht reine Exposition für den Effekt von EMDR verantwortlich sein kann, da ein erheblich höherer Expositionsanteil in einer Studie von Richards, Lovell und Marks (1994) zu geringeren Therapieerfolgen geführt hatte als EMDR in entsprechenden anderen Studien. Es ist fraglich, inwieweit diese Schlussfolgerung anhand des Vergleichs von (wenigen) Studien, die in keinerlei Zusammenhang stehen, gerechtfertigt ist. Andererseits betont Shapiro, dass alle Komponenten von EMDR in gleichem Maße wichtig für den Therapieerfolg seien und der Schwerpunkt keineswegs auf der bilateralen Stimulation liege (im Gegensatz zu ursprünglichen Beschreibungen des Verfahrens; Shapiro et al., 1994). Der Beitrag der bilateralen Stimulation müsse weiter erforscht werden, und möglicherweise könne der Fokus auf jegliches nicht-emotionale Geschehen zum Therapieerfolg beitragen. Es sei denkbar, dass EMDR aufgrund sei- 88 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE ner Komplexität auch ohne die bilaterale Stimulation erfolgreich wäre (Shapiro, 1999). Dem Verfahren liegt das Modell des „Accelerated Information Processing (AIP)“ zugrunde: Shapiro et al. (1994) gehen davon aus, dass die Informationsverarbeitung im Gehirn normalerweise auch bei kleineren Störungen reibungslos stattfindet, dieser Prozess jedoch nicht mehr funktioniert, wenn größere Störungen wie das Erleben traumatischer Ereignisse vorkommen. EMDR soll diesen an sich vorhandenen Verarbeitungs- und damit einen Selbstheilungsprozess anstoßen. Es wird angenommen, dass dabei die Erinnerungen an Traumata wieder mit Kontextinformationen verbunden werden. Nebeneffekte dieses Vorgangs sind eine Desensibilisierung des Klienten gegenüber angstauslösenden Reizen sowie kognitive Umstrukturierung. Der Betroffene soll durch EMDR neue Bewältigungsstrategien lernen. Die Effekte der bilateralen Stimulation habe Shapiro nur zufällig (und auch nicht als Erste) und entsprechend nicht theoriegeleitet entdeckt. Sie habe die Erfahrung gemacht, dass bei den Klienten die Hemmung unangenehmer Gedanken und das Auftreten anderer Gedankeninhalte mit sakkadischen Augenbewegungen einhergingen. Die Intensität der begleitenden Emotionen werde verringert (Shapiro, 1999). Es existiert eine Reihe von Studien zur Effektivität von EMDR, die Hinweise darauf geben, dass das Verfahren zur Behandlung von PTSD effektiv ist (siehe z. B. Devilly & Spence, 1999; Lee, Gavriel, Drummond, Richards & Greenwald, 2002; Rothbaum, Astin & Marsteller, 2005). Dies wiederum heißt jedoch lediglich, dass bisher signifikant größere Effekte erzielt wurden als ohne Behandlung, was beinahe bei jeder beliebigen Behandlung der Fall ist (Herbert, 2003). EMDR bleibt bislang umstritten, was damit zusammenhängt, dass verschiedene Aspekte in der Literatur zu EMDR unklar bleiben (Perkins & Rouanzoin, 2002): So existiere etwa derzeit noch kein empirisch validiertes Modell, das die Behandlungseffekte erklären könne. Es ist auch noch ungeklärt, was die einzelnen Therapiebausteine zum Behandlungserfolg beitragen und inwieweit sich EMDR überhaupt von anderen Therapieformen mit Exposition unterscheidet – weitere Studien sind also erforderlich (Robertson et al., 2004; Neuner, 2003). Narrative Expositionstherapie (NET) Die „Narrative Expositionstherapie“ (NET) ist ein standardisierter Kurzzeit-Ansatz, der von Forschern der Universität Konstanz und der Nichtregierungsorganisation „vivo international“ entwickelt wurde (Neuner, Schauer, Roth & Elbert, 2002; Neuner, Schauer, Karunakara, Klaschik, Robert & Elbert, 2004b; Schauer et al., 2005). 89 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE Das Prinzip der NET setzt sich aus dem Vorgehen der Testimony-Methode (Cienfuegos & Monelli, 1983) sowie der kognitiv-verhaltenstherapeutischen Methode der Exposition in sensu zusammen. NET wurde speziell zur Behandlung von PTSD in Folge von organisierter Gewalt entwickelt und zunächst in Krisengebieten nichtwestlicher Länder angewendet. Einerseits soll durch die Exposition eine Reduktion der konditionierten Angstsymptome erzielt werden, andererseits soll die chronologische Erfassung und Niederschrift der Lebensgeschichte des Patienten mit besonderem Fokus auf den traumatischen Erlebnissen das oftmals fragmentierte oder inkonsistente autobiografische Gedächtnis wieder herstellen. Das detaillierte Erheben der traumatischen Erlebnisse umfasst eine genaue Beschreibung der jeweiligen Situation auf allen Ebenen des menschlichen Erlebens (kognitiv, emotional, motorisch, physiologisch) sowie eine Einbettung in den autobiografischen Kontext. Es wird angenommen, dass die Gedächtniselemente für das sensorische und emotionale Erleben („hot memory“, gespeichert in einem neuronalen „Furchtnetzwerk“) und für die autobiografischen, „sachlichen“ Informationen („cold memory“) für traumatische Situationen aufgrund veränderter Gedächtnisprozesse anders als bei sonstigen Lebensereignissen nicht miteinander verknüpft sind (vergleiche auch „1.4.1 Modelle der posttraumatischen Belastungsstörung“). Durch das beschriebene Vorgehen in der NET sollen diese Elemente für die jeweilige Situation wieder zusammengefügt werden. Die Lebensgeschichte („Narration“) des Betroffenen wird vom Therapeuten immer wieder vorgelesen und laufend ergänzt. Zum Abschluss der NET erhält der Patient ein von allen Beteiligten unterschriebenes Exemplar der Narration seiner persönlichen Geschichte. Dieses Dokument kann auch für Menschenrechtsarbeit oder vor Gericht verwendet werden. Ein Element, das ursprünglich nur für die Arbeit mit Kindern (KIDNET; Onyut, Neuner, Schauer, Ertl, Odenwald, Schauer & Elbert, 2005) entwickelt wurde, ist die so genannte „lifeline“: Um einen plastischen chronologischen Überblick über die Lebensereignisse des Patienten zu bekommen, wird ein Seil auf den Boden gelegt, das den Verlauf des Lebens symbolisiert. Für die Zukunft bleibt ein Stück des Seils noch aufgerollt. Der Proband wird nun gebeten, aus einer Sammlung verschieden großer (Stoff-)Blumen und Steine diejenigen auszuwählen, die seinen Lebensereignissen entsprechen – die Blumen stehen dabei für positive, die Steine für negative Erlebnisse. Auch bei Erwachsenen zeigt sich die „lifeline“ als hilfreiche Methode, um zunächst einen Überblick über das Leben zu erhalten. Es existieren bislang folgende Studien zur Wirksamkeit der NET unter verschiedenen Bedingungen: 90 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE Neuner et al. (2004b) verglichen in einer Stichprobe von 43 sudanesischen Flüchtlingen in einem Flüchtlingscamp in Uganda zwei verschiedene Therapiebedingungen in einer randomisierten kontrollierten Studie miteinander: NET und unterstützende Beratung. Zusätzlich gab es eine dritte Gruppe von Teilnehmern, die lediglich die für alle Bedingungen vorgesehene Psychoedukation erhielten. In den beiden Therapie-Bedingungen fanden nach der Psychoedukation drei weitere Therapiesitzungen statt. Die Versuchspersonen wurden den verschiedenen Bedingungen zufällig zugeteilt. Es zeigte sich, dass sich die PTSD-Rate in der NETGruppe signifikant verringerte: Lediglich 29 % der Patienten aus der NET-Gruppe erfüllten ein Jahr nach der Therapie noch die Kriterien für eine PTSD, versus 79 % bzw. 80 % in der Beratungs- bzw. Psychoedukationsgruppe. Es gab nur wenige der zufällig ausgewählten Patienten, die nicht an der jeweiligen Behandlung teilnahmen oder sie abbrachen: Ein Patient aus der NET-Gruppe begann die Therapie gar nicht erst, zwei Patienten in der Gruppe mit unterstützender Beratung brachen die Behandlung ab. Die zusätzlich erhobenen Depressions- und Angstwerte sowie die allgemeine psychische Befindlichkeit verbesserten sich in keiner der Bedingungen signifikant. Eine weitere Studie von Gotthardt (2007) zum Vergleich von NET mit Standardbehandlung wird weiter hinten unter „1.5.4 Therapie der PTSD bei Asylbewerbern und Flüchtlingen“, aufgeführt. Bichescu (2006) führte eine randomisierte kontrollierte Therapiestudie zum Vergleich von NET und Psychoedukation mit ehemaligen politischen Gefangenen in Rumänien durch. Die Gefangenschaft lag im Schnitt über 40 Jahre zurück. Neben PTSD wurden depressive Symptome erhoben. Je neun Probanden erhielten fünf Sitzungen NET oder eine Sitzung Psychoedukation. Drei der Probanden aus der NET- und zwei aus der Psychoedukationsgruppe erhielten zusätzlich psychosoziale Betreuung in einem lokalen Zentrum für Opfer politischer Gewalt. Es zeigte sich sechs Monate nach der Behandlung eine signifikante Symptomreduktion hinsichtlich PTSD (in den Bereichen Vermeidung und Übererregung) und Depression in der NET-Gruppe, die Gruppe mit Psychoedukation wies keine signifikanten Veränderungen auf. Zum Zeitpunkt der Halbjahres-Nachuntersuchung hatten in der NET-Gruppe noch vier der neun Probanden eine PTSD, in der Gruppe mit Psychoedukation waren es acht von neun. Keiner der Patienten brach die Teilnahme an der Studie vorzeitig ab. Unklar ist, inwiefern die unterschiedliche Sitzungsanzahl in den beiden Bedingungen das Ergebnis beeinflusst haben könnte. Auch bei Kindern wurde die NET mit minimaler Abwandlung (KIDNET) durchgeführt: Onyut et al. (2005) behandelten im Rahmen einer Pilotstudie sechs somali91 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE sche Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren in einem Flüchtlingscamp in Uganda mit vier bis sechs NET-Sitzungen. Es zeigte sich neun Monate nach der Therapie ein signifikanter Symptomrückgang. Vier der sechs Patienten erfüllten die Kriterien für eine PTSD nicht mehr, die zwei weiteren hatten grenzwertige PTSD-Symptome. Zudem zeigte sich, dass die depressive Symptomatik, die zu Beginn bei vier der sechs Kinder gefunden worden war, zu den Nachuntersuchungszeitpunkten bei keinem der Patienten mehr klinisch relevant war. Es kam zu keinem Therapieabbruch. Eine randomisierte kontrollierte Studie zur KIDNET wurde mit Flüchtlingskindern in Deutschland durchgeführt (Ruf et al., 2007). Es wurden zwölf Kinder mit KIDNET behandelt, während 13 in einer Wartelistenbedingung waren. Es fanden im Schnitt acht Therapiesitzungen statt. In der Nachuntersuchung sechs Monate nach dem Erstinterview zeigte sich in der KIDNET-Gruppe eine signifikante Reduktion der PTSD-Symptomatik, während die Kinder in der Wartelistenbedingung keine Veränderung der Symptomatik aufwiesen. In der Behandlungsgruppe erfüllten 75 % der Kinder die Kriterien einer PTSD nicht mehr. In einer randomisierten kontrollierten Studie von Schaal (2006) wurden 26 an PTSD erkrankte jugendliche Überlebende des Genozids in Ruanda mit NET (n = 12) oder Interpersoneller Therapie (IPT3 ; n = 14) behandelt. Die NET-Bedingung bestand aus insgesamt vier Einzelsitzungen: drei Sitzungen, in denen die traumatischen Lebensereignisse thematisiert wurden, sowie eine Sitzung IPT. In der IPTBedingung wurden zunächst individuell die vorliegenden Schwierigkeiten erfasst und einem von vier Problembereichen zugeordnet, danach fanden vier Gruppensitzungen statt. Keiner der behandelten Jugendlichen brach die Therapie ab, es erschienen auch alle zu den Nachuntersuchungen. Jedoch wurden zwei Jugendliche der NET-Bedingung, die zwischen Therapieende und Nachuntersuchungen erneut potenziell traumatische Erlebnisse gehabt hatten, gesondert betrachtet bzw. teilweise aus den Analysen ausgeschlossen (siehe weiter unten). Es zeigte sich zum ersten Nachuntersuchungszeitpunkt drei Monate nach Ende der Therapie, dass sowohl in der NET- als auch in der IPT-Bedingung kein signifikanter Rückgang der Fallzahl von PTSD-Diagnosen sowie kein signifikanter Unterschied zwischen den Behandlungsgruppen aufgetreten war. Zum Zeitpunkt der Sechs-Monats-Nachuntersuchung wiesen die Teilnehmer der NET-Bedingung jedoch signifikant weniger PTSD-Diagnosen auf und unterschieden sich darin auch signifikant von den Teilnehmern der IPT-Bedingung: In der NET-Gruppe erfüllten noch 25 % die Diagnosekriterien, in der IPT-Gruppe hingegen 71,4 %. Betrachtet man Veränderun3 ursprünglich zur Behandlung von depressiven Erkrankungen entwickelt 92 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE gen in der Symptomschwere, zeigt sich für die NET-Bedingung, dass sich die Gesamtschwere sowie einzeln betrachtet die Intrusions- und Vermeidungssymptome, die Häufigkeits- und die Intensitätswerte über die Zeit signifikant verringerten. In der IPT-Bedingung verringerte sich lediglich der Vermeidungswert signifikant über die Zeit, dieser Effekt blieb jedoch nicht stabil bis zur Sechs-MonatsNachuntersuchung. Der Ausschluss der beiden o. g. Jugendlichen, die in der NET-Bedingung waren, führte dazu, dass einige der Symptomwerte (Intrusionen, Erregung und Intensität) in der NET-Gruppe noch stärker reduziert waren. Die beiden Jugendlichen wiesen zur Drei-Monats-Nachuntersuchung jeweils noch eine PTSD-Diagnose auf, zur Sechs-Monats-Nachuntersuchung jedoch nicht mehr. Es zeigte sich, dass Jugendliche aus von Kindern geführten Haushalten im Gegensatz zu denjenigen in Waisenhäusern langfristig keine signifikanten Veränderungen ihrer Symptomatik aufwiesen. Dies war unabhängig von der Therapiebedingung der Fall. Weitere Studien zur KIDNET in mit Flüchtlingskindern in Uganda sowie mit Schulkindern auf Sri Lanka werden in Kürze veröffentlicht (Neuner et al., in preparation). Cognitive Therapy (CT) Ehlers, Clark, Hackmann, McManus und Fennell (2005) entwickelten auf der Basis ihres kognitiven Modells der PTSD (siehe „1.4.1 Das Kognitive Modell der PTSD“) die „Cognitive Therapy“ (CT) für PTSD. Drei Bestandteile charakterisieren diesen Behandlungsansatz: Zum einen sollen die exzessiven negativen Bewertungen des Traumas und dessen Folgen modifiziert werden. Des Weiteren soll eine Reduktion der Intrusionssymptomatik mithilfe von Exposition erreicht werden. Die Exposition findet durch Aufschreiben der Trauma-Erinnerung, imaginiertes Wiedererleben oder Aufsuchen des Ortes des traumatischen Erlebnisses statt. Die dritte Komponente zielt darauf ab, kognitive und verhaltensbezogene Vermeidungsstrategien abzulegen. Der Anteil und die Zielsetzung der Exposition sind unterschiedlich zu anderen Verfahren wie z. B. der „Prolonged Exposure“: Die Exposition dient in der CT nicht zur Habituation bezüglich der traumatischen Erinnerungen, sondern zur Erhebung der schlimmsten Trauma-Momente („hot spots“) und der Ausarbeitung einer Trauma-Erzählung. Die „hot spots“ werden mittels kognitiver Umstrukturierung bearbeitet. Es findet in der CT deutlich weniger Exposition statt als in anderen konfrontativen Behandlungsansätzen. 93 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE In einer randomisierten kontrollierten Therapiestudie, in der CT mit einer Wartelistengruppe verglichen wurde (Ehlers et al., 2005), zeigte sich eine hochsignifikante Verringerung der Gesamtsymptomatik in der CT-Gruppe im Vergleich zur Warteliste, in der es keine signifikanten Veränderungen gab. Es wurden PTSD, daraus resultierende Funktionsbeeinträchtigungen, Depression und Angst erhoben. Über 70 % der Patienten in der CT-Gruppe erfüllten zum 3-Monats-Nachuntersuchungszeitpunkt die Kriterien für eine PTSD nicht mehr. Es stellte sich heraus, dass größerer Behandlungserfolg mit niedrigerem Bildungs- und sozioökonomischem Status einherging. Zudem wiesen die Patienten, die ihre Bewertungen des Traumas stärker verändert hatten, geringere Symptomwerte nach der Therapie auf. Es zeigte sich eine sehr geringe Abbrecherrate: Über eine Pilotstudie und die genannte Studie hinweg brachen lediglich 3 % der Probanden die Behandlung ab. Ehlers, Clark, Hackmann, McManus, Fennell, Herbert und Mayou hatten bereits 2003 eine randomisierte kontrollierte Studie zur Wirksamkeit von CT durchgeführt, allerdings mit Probanden, bei denen das traumatische Erlebnis (Verkehrsunfall) erst wenige Wochen zurücklag. Es gab nach einer Selbstbeobachtungsphase von drei Wochen folgende Behandlungsbedingungen: CT, ein Selbsthilfebuch und wiederholte Sitzungen zur Feststellung der Befindlichkeit des Patienten. Die Patienten in der CT-Gruppe wiesen im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen eine signifikant stärkere Symptomreduktion auf. Die Symptomatik der Patienten der Selbsthilfebedingung und der Bedingung mit wiederholten Sitzungen unterschied sich nicht. Weitere kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen mit Exposition Maercker, Zöllner, Menning, Rabe und Karl (2006) führten eine Studie mit einem modifizierten, bereits als wirksam erwiesenen kognitiv-verhaltenstherapeutischen Programm für PTSD von Blanchard, Hickling, Devineni, Veazey, Galovski, Mundy, Malta und Buckley (2003) mit zusätzlichen Bausteinen imaginativen Wiedererlebens, posttraumatischer Weiterentwicklung etc. durch4 . Die Behandlungsgruppe wurde mit einer Wartelistengruppe verglichen. Die Therapien wurden mit Überlebenden von Verkehrsunfällen durchgeführt, die jedoch zum Teil lediglich unter subsyndromaler PTSD litten. Das Behandlungsprogramm enthielt verschiedene Varianten von Exposition sowie Bausteine kognitiver Arbeit. Die Patienten der Behandlungsgruppe erreichten eine signifikante Symptomreduktion in Bezug auf PTSD und Depression im Vergleich zur Wartelistengruppe. 4 Eine randomisierte kontrollierte Studie von Blanchard et al. (2003) ist unter 1.5.3, „Therapieverfahren ohne bzw. mit fakultativem Expositionsanteil“ beschrieben. 94 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE Kubany, Owens, McCaig, Hill, Iannce-Spencer und Tremayne (2004) führten ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches Programm für Frauen durch, die von ihren Partnern misshandelt worden waren („Cognitive Trauma Therapy for Battered Women“, CTT-BW). Es enthält folgende Bausteine: Psychoedukation, Stressmanagement, Gespräche über das Trauma sowie Exposition zwischen den Sitzungen, Erfassen und Korrigieren irrationaler Schuld-Gedanken sowie Reduktion negativer Selbstgespräche. Darüber hinaus werden verschiedene Strategien zur Selbstbehauptung, Kommunikation und Identifikation potenzieller Täter vermittelt. In einer randomisierten kontrollierten Studie wurde den Teilnehmerinnen entweder unmittelbar oder verzögert CTT-BW angeboten. Es brachen insgesamt 20 % die Teilnahme an der Studie ab. Die Abbrecherinnen waren jünger, weniger gut ausgebildet, depressiver und hatten mehr Schamgefühle und geringeres Selbstwertgefühl als diejenigen, die die Therapie bis zum Ende durchführten. Die Patientinnen erhielten durchschnittlich etwa neun Sitzungen. Es zeigte sich, dass die Probandinnen in beiden Gruppen hochsignifikante Verbesserungen hinsichtlich PTSD, Stress, Depression, Schuldgefühlen und -gedanken, Scham sowie Selbstwertgefühl aufwiesen. Insgesamt erfüllten 87 % der Teilnehmerinnen nach der Therapie die Kriterien für eine PTSD nicht mehr. Igreja, Kleijn, Schreuder, van Dijk und Verschuur (2004) führten in zwei Dörfern in Mosambik eine Studie zur Wirksamkeit der Testimony-Methode bei Kriegsüberlebenden durch. Es wurden alle von PTSD betroffenen Bewohner eingeschlossen und nach dem Zufallsprinzip in die Therapie- oder Kontrollgruppe eingeteilt. Zudem wurde auch die Gruppe der Personen ohne PTSD-Diagnose untersucht. Es zeigte sich zur Nachuntersuchung eine signifikante Symptomreduktion sowohl in der Behandlungs- als auch in der Kontrollgruppe. Es ließ sich also nicht folgern, dass die Verbesserung der Symptomatik auf die therapeutische Intervention zurückzuführen war. Die Autoren führen die Ergebnisse auf Kommunikation und Interaktion innerhalb der Dorfgemeinschaft zurück, die möglicherweise durch die Intervention ausgelöst worden war und die Kontrolle der Therapiestudie erschwerte. Ein anderer Einflussfaktor könnte die Tatsache gewesen sein, dass lediglich eine einzige Therapiesitzung durchgeführt wurde. Eine Variante der Systematischen Desensibilisierung, die so genannte TraumaDesensibilisierung, wurde in einer Studie von Brom et al. (1989) mit psychodynamischer Therapie, Hypnotherapie und einer Wartelisten-Kontrollgruppe bei PTSD verglichen. In der Studie wurde PTSD-Diagnose nach DSM-III gestellt, allerdings lediglich anhand von Selbstbeurteilungsfragebögen, die die Patienten ausfüllten. Insgesamt brachen 11 % der Patienten über alle Therapiebedingungen hinweg die 95 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE Behandlung ab. Sie unterschieden sich nicht von den Nicht-Abbrechern. Alle drei Behandlungsbedingungen führten zu ähnlichen signifikanten Symptomverbesserungen im Vergleich zur Kontrollgruppe, in der keine Veränderungen stattfanden. In der Trauma-Desensibilisierungs- und in der Hypnotherapie-Gruppe verringerten sich die Intrusionssymptome in größerem Ausmaß als in der psychodynamischen Therapie-Bedingung, letztere hatte jedoch einen stärkeren positiven Einfluss auf die Vermeidungssymptome. In allen drei Therapiebedingungen wurden zur Überraschung der Autoren auch Persönlichkeitsmaße positiv verändert: Die Probanden berichteten von höherer Stressresistenz, höherem Selbstwertgefühl und geringerer Ängstlichkeit. Bei etwa 60 % der behandelten Patienten konnte eine klinisch relevante Symptomverbesserung festgestellt werden (26 % in der Kontrollgruppe). Da es ansonsten lediglich unkontrollierte weitere Studien zur systematischen Desensibilisierung gibt, ist die Wirksamkeit des Verfahrens bislang nicht ausreichend erwiesen (Foa et al., 2000). 1.5.3 Therapieverfahren ohne bzw. mit fakultativem Expositionsanteil In diesem Abschnitt werden diejenigen Therapieverfahren bei PTSD aufgeführt, die keine Expositionstechniken enthalten oder bei denen diese lediglich unter bestimmten Umständen zum Einsatz kommen. Verfahren, die sowohl stützende Elemente als auch obligatorische Expositionsbausteine in derselben Behandlung enthalten, wurden unter „1.5.2 Therapieverfahren mit Exposition als festem Bestandteil“ aufgeführt. In den Richtlinien des National Institute for Clinical Excellence (NICE, National Collaboration Center for Mental Health, 2005) wird aufgrund mangelnder Evidenz der jeweiligen Wirksamkeit davon abgeraten, einem an PTSD erkrankten Patienten eine nicht-konfrontative Behandlung wie unterstützende oder nondirektive Therapie, Hypnotherapie, psychodynamische oder systemische Therapie anzubieten. Gotthardt (2007) erhob bei 14 Behandlern Informationen zu Therapietechniken, die in deutschen Psychotherapiepraxen zur Behandlung von PTSD eingesetzt wurden. Es zeigte sich, dass die befragten Therapeuten hauptsächlich ressourcenorientierte stabilisierende Techniken verwendeten, den Patienten Problemlösestrategien beibrachten und Entspannungs-, kreative und kognitive Techniken einsetzten. Abgesehen davon, dass ein Teil der Therapeuten zu diesem Zeitpunkt an einer Studie zu narrativer Expositionstherapie teilnahm und dieses Verfahren daher zu diesem Zeitpunkt zu 60 % verwendeten (NET; siehe „1.5.4 Therapie der PTSD bei Flüchtlingen und Asylbewerbern“), kamen traumafokussierte Verfahren lediglich 96 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE in 21 % (Therapeuten mit Standardbehandlung) bis 31 % (NET-Therapeuten) der Zeit zum Einsatz. Stress-Impfungs-Training (SIT) Das „Stress-Impfungs-Training“ (SIT) wurde in den 70er Jahren von Meichenbaum entwickelt und ist ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches halbstrukturiertes Therapieprogramm zur Verbesserung der Stressverarbeitung des Klienten (Foa et al., 1999). Ursprünglich wurde es für Angstpatienten entwickelt und bei einer Reihe verschiedener psychischer Störungen angewandt. Veronen und Kilpatrick (1983) passten das SIT für Vergewaltigungsopfer an und führten zwei unkontrollierte Studien durch, jedoch wurde noch keine PTSD-Diagnostik vorgenommen. Foa et al. (1991) entwickelten das Therapieprogramm von Veronen und Kilpatrick weiter und führten zwei randomisierte kontrollierte Studien durch (siehe weiter unten). Das Stress-Impfungs-Training enthält eine Reihe von Angstbewältigungsstrategien auf verschiedenen Ebenen menschlichen Erlebens (körperlich, kognitiv und verhaltensbezogen). Die Patienten sollen lernen, ihre Angstreaktion frühzeitig durch den Einsatz der gelernten Strategien zu unterbrechen. Das SIT umfasst Entspannungs- und Atemübungen, Gedankenstopp, kognitive Umstrukturierung, geleiteten Selbst-Dialog, verdecktes Modeling sowie Rollenspiele. Der Patient soll die jeweiligen Techniken zwischen den Sitzungen zuhause üben (Foa et al., 1999). In einer Studie von Foa et al. (1991) mit Vergewaltigungsopfern (wurde bereits weiter oben beschrieben, siehe „1.5.2 Prolonged Exposure (PE)“) zeigte sich das SIT unmittelbar nach der Behandlung signifikant erfolgreicher in der Symptomreduktion hinsichtlich aller Symptomgruppen der PTSD als die Wartelistenund Beratungsbedingung. Zwischen der Symptomreduktion von SIT und der einer vierten Bedingung – Prolonged Exposure – bestand kein signifikanter Unterschied. Die Hälfte der Patientinnen wies nach der Therapie keine PTSD-Diagnose mehr auf, zum Nachuntersuchungszeitpunkt waren es 55 %. Die Therapieabbruch-Rate lag bei SIT mit 17,6 % niedriger als in der PE-Gruppe (28,6 %) und der BeratungsGruppe (21,4 %). In einer weiteren Untersuchung von Foa et al. (1999) wurden wiederum PE und SIT miteinander verglichen, eine dritte Behandlungsbedingung stellte zusätzlich die Kombination aus beiden Verfahren dar. Zudem gab es eine WartelistenKontrollgruppe. Es zeigte sich eine signifikante und über die Zeit stabile Symptomreduktion in allen drei Behandlungsgruppen hinsichtlich PTSD, Depression und weiteren Angstsymptomen (letzteres nur in der Gruppe der Personen, die die The- 97 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE rapie zu Ende führten). Es brachen in der SIT-Gruppe 27 % der Probandinnen die Behandlung ab (PE: 8 %, PE-SIT: 27 %). In den beiden beschriebenen Studien von Foa et al. (1991) sowie Foa et al. (1999) wurde das SIT strikt ohne Expositionsanteile durchgeführt, um es klar von der Vergleichsgruppe mit Prolonged Exposure trennen zu können. Jedoch enthält die ursprüngliche Version von Veronen und Kilpatrick (1983) einen geringen Anteil an Exposition: Die Patientinnen sollten sich als Hausaufgabe u. a. schrittweise in Form von praktischen Übungen mit ihren traumabezogenen Ängsten konfrontieren. Robertson et al. (2004) merken an, dass die Ergebnisse zwar für die Wirksamkeit von SIT sprechen, jedoch nicht verallgemeinerbar sind, da bisher lediglich weibliche Vergewaltigungsopfer untersucht wurden. Er schlägt vor, SIT auch an anderen Stichproben auf seine Wirksamkeit hin zu überprüfen. Weitere kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen ohne Exposition Marks, Lovell, Noshirvani, Livanou und Thrasher (1998) führten eine randomisierte kontrollierte Studie zum Vergleich von reiner kognitiver Umstrukturierung mit reiner Exposition bzw. einer Kombination beider Verfahren durch. Eine vierte Bedingung bildete eine Entspannungsintervention. Es nahmen 87 Patienten mit verschiedenen Traumata und chronischer PTSD an der Studie teil, zehn davon brachen die Behandlung vorzeitig ab (keine signifikanten Unterschiede in den Abbrecherraten zwischen den Therapiebedingungen. Abbrecher hatten bereits mehr psychologische Behandlungen gehabt und hatten etwas höhere Werte in der „Clinician Administered PTSD Scale“ (CAPS) als Nicht-Abbrecher). In allen drei Gruppen außer der Entspannungsbedingung nahm die Symptomatik hochsignifikant ab, auch die Patienten in der Entspannungsgruppe erreichten in den meisten erhobenen Symptomwerten signifikante Verbesserungen. Zum ersten Nachuntersuchungszeitpunkt erfüllten noch 35 % in der Gruppe mit reiner kognitiver Umstrukturierung die Kriterien für eine PTSD nach CAPS, in der reinen Expositionsgruppe waren es 25 %, in der gemischten 37 % und in der Entspannungsgruppe 45 % (gefragt wurde hier nach der vergangenen Woche; keine signifikanten Gruppenunterschiede). Unklar ist jedoch die Angabe der Autoren, dass zum Prä-Test 93 % (anstatt der erwarteten 100 %) der Probanden die diagnostischen Kriterien einer PTSD erfüllten – möglicherweise ergibt sich die Diskrepanz daraus, dass für die Diagnosestellung das Structured Clinical Interview for DSM-III-R, für die Einschätzung wie oben jedoch der Fragebogen CAPS herangezogen wurden. Die Ergebnisse blieben 98 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE bis zur letzten Nachuntersuchung nach sechs Monaten erhalten. Die Kombination von kognitiver Umstrukturierung und Exposition brachte keine besseren Ergebnisse mit sich als die jeweiligen Verfahren alleine. Tarrier, Pilgrim, Sommerfield, Faragher, Reynolds, Graham und Barrowclough (1999a) verglichen in einer randomisierten kontrollierten Studie Cognitive Therapy ohne Exposition mit Imaginal Exposure. Die 72 Patienten hatten verschiedene Arten von Traumata erlebt. Es zeigte sich, dass beide Therapieformen zu signifikanten Symptomverbesserungen bis hin zur Nachuntersuchung sechs Monate nach der Therapie führten und die jeweiligen Therapieerfolge sich nicht voneinander unterschieden. In jeder Bedingung wies ungefähr die Hälfte der Probanden zu beiden Nachuntersuchungszeitpunkten keine PTSD-Diagnose mehr auf. In der IE-Gruppe zeigten signifikant mehr Patienten eine Symptomverschlechterung zwischen den Erhebungen vor und nach der Therapie, die sich jedoch bei der späteren Nachuntersuchung nicht mehr zeigte. Die vorübergehende Symptomverschlechterung führte also nicht zu einem geringeren Therapieerfolg. Diejenigen Patienten mit Symptomverschlechterung neigten eher dazu, Sitzungen ausfallen zu lassen, glaubten weniger an die Wirksamkeit des Verfahrens und wurden vom Behandler als weniger motiviert eingeschätzt. Es brachen insgesamt 13 % der Patienten die Therapie vorzeitig ab (sechs Personen in der IE-Gruppe, vier in der CT-Gruppe). Zu einer weiteren Nachuntersuchung zwölf Monate nach der Behandlung konnten 87 % der Patienten erneut untersucht werden. Die Behandlungseffekte beider Therapiegruppen waren stabil geblieben. Es erfüllten noch 39 % der Teilnehmer die Kriterien für eine PTSD (Tarrier, Sommerfield, Pilgrim & Humphreys, 1999b). Unterstützende Beratung oder Therapie Unterstützende Beratung oder Therapie wurde oft als Kontrollbedingung in Therapiestudien angeboten und zeigte sich meist lediglich überlegen gegenüber keiner Behandlung: Blanchard et al. (2003) führten eine randomisierte kontrollierte Studie zum Vergleich von kognitiver Verhaltenstherapie mit expliziten Expositionsanteilen, unterstützender Therapie und einer Wartelistenbedingung durch (siehe auch „1.5.2 Weitere kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen mit Exposition“). Die Patienten hatten nach einem Verkehrsunfall eine chronische PTSD entwickelt. In der unterstützenden Therapie wurde neben Psychoedukation zunächst die Lebensgeschichte des Patienten mit besonderem Fokus darauf erhoben, wie der Betroffene mit früheren Traumata und Verlusten umgegangen war. Dies wurde in einer unterstützenden und fürsorglichen Art und Weise erfragt. Die weiteren Sit- 99 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE zungen waren für beliebige Themen reserviert, die der Patient gerne besprechen wollte. Er wurde vor allem nach seinen Gedanken und Gefühlen gefragt, und es wurde wenig aktiv eingegriffen. Themen, die mit Autofahren oder mit Therapiebausteinen zu tun hatten, wie sie in der Bedingung mit kognitiver Verhaltenstherapie vorkamen, wurden nicht aktiv unterstützt. Stattdessen sollte der Patient selbst entscheiden, ob er sich dem widmen wollte. Es zeigte sich, dass in der Gruppe mit kognitiver Verhaltenstherapie eine signifikant größere Symptomreduktion stattfand als in den beiden anderen Gruppen. Jedoch reduzierten sich die Symptomwerte in der Gruppe mit unterstützender Therapie wiederum signifikant stärker als in der Wartelistenbedingung. Letzteres zeigte sich nicht mehr, wenn man die Therapieabbrecher mit einbezog. In der Bedingung mit unterstützender Therapie erzielten 47,6 % eine Symptomverbesserung (d. h. von PTSD zu Sub-PTSD oder von Sub-PTSD zu keiner Diagnose mehr). In der Gruppe mit kognitiver Verhaltenstherapie hatte sich bei 76,2 % der Patienten die Symptomatik verbessert, in der Wartelistengruppe bei 23,8 %. Auch auf komorbide Störungen (Depression, generalisierte Angststörung) hatte die kognitive Verhaltenstherapie signifikant positiveren Einfluss als die anderen Bedingungen. Es brachen 20 % der Patienten die Behandlung ab (zehn aus der Gruppe mit kognitiver Verhaltenstherapie, neun aus der Gruppe mit unterstützender Therapie und einer aus der Wartelisten-Bedingung), meist nach der ersten Sitzung. Nach einem Jahr wurden 90 % der Teilnehmer erneut untersucht, und die Ergebnisse entsprachen denjenigen zum Zeitpunkt der 3-Monats-Nachuntersuchung (Blanchard, Hickling, Malta, Freidenberg, Canna, Kuhn, Sykes & Galovski, 2004). Zwei Jahre nach Ende der Therapie wurden noch 75 % der ursprünglichen Stichprobe nachuntersucht. Die Unterschiede in der Gesamtsymptomatik zwischen den beiden Behandlungsgruppen waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr signifikant, hinsichtlich der PTSDSymptome bestand lediglich ein Trend hin zu geringeren Symptomwerten für die Gruppe mit kognitiver Verhaltenstherapie. Foa et al. (1991) führten eine Studie mit 45 Vergewaltigungsopfern durch, die in der Folge an einer PTSD erkrankt waren (ausführlicher bereits unter „1.5.2 Prolonged Exposure (PE)“ beschrieben). Die Patientinnen wurden einer von vier Bedingungen zugeteilt (Warteliste, Prolonged Exposure, Stress-Impfungs-Training oder unterstützende Beratung). In der Beratungs- und auch der Wartelistenbedingung wurde lediglich die Übererregungssymptomatik reduziert. Ein positiver Einfluss auf die Depressions- und Angstsymptomatik zeigte sich in allen Gruppen, also auch in der Beratungs-Bedingung. In dieser Gruppe brachen 21,4 % der Teilnehmerinnen die Therapie vorzeitig ab. 100 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE Wie bereits unter „1.5.2 Narrative Expositionstherapie (NET)“ beschrieben, verglichen Neuner et al. (2004b) in einer Stichprobe von 43 sudanesischen Flüchtlingen in einem Flüchtlingscamp in Uganda zwei verschiedene Therapiebedingungen in einer randomisierten kontrollierten Studie miteinander: NET und unterstützende Beratung (zusätzlich zu einer Psychoedukations-Gruppe). Es zeigte sich, dass ein Jahr nach der Therapie noch 79 % der Patienten aus der Beratungs-Gruppe an einer PTSD litten (versus 29 % in der NET-Gruppe). Zwei Patienten in der Beratungs-Gruppe brachen die Therapie vorzeitig ab. In einer Studie von Bryant, Moulds, Guthrie, Dang und Nixon (2003) stellte sich heraus, dass unterstützende Beratung im Gegensatz zu reiner imaginativer Exposition (IE) und IE kombiniert mit kognitiver Umstrukturierung zu keinen Veränderungen der PTSD-Symptomatik führte. Psychodynamische Therapieverfahren Es existieren hauptsächlich Einzelfallstudien zu psychodynamischen Ansätzen bei PTSD (Robertson et al., 2004). Obwohl die Wirksamkeit dieser Verfahren für das Störungsbild bislang nicht hinreichend belegt ist und sogar in manchen Richtlinien von deren Einsatz abgeraten wird (siehe weiter oben, NICE-Guidelines, National Collaboration Center for Mental Health, 2005), wurden und werden diese Behandlungsansätze häufig eingesetzt (z. B. Kinzie & Fleck, 1987; Birck, 2001; Gotthardt, 2007). Robertson et al. (2004) weisen darauf hin, dass diese Interventionen möglicherweise methodisch schwieriger zu erfassen sind als manualisierte Verfahren, d. h. es ist nicht auszuschließen, dass auch psychodynamische Ansätze effektiv sein könnten. Brom et al. (1989) führten wie unter „1.5.2 Weitere kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen mit Exposition“ beschrieben einen Vergleich von psychodynamischer Therapie, Hypnotherapie, Trauma-Desensibilisierung und einer Wartelisten-Kontrollgruppe bei PTSD durch. Alle drei Behandlungsbedingungen führten zu ähnlichen Symptomverbesserungen im Vergleich zur Kontrollgruppe, in der keine signifikanten Veränderungen stattfanden. In Deutschland entwickelten Reddemann und Sachsse (1999) die „Traumazentrierte imaginative Therapie“, später „Psychodynamische imaginative Traumatherapie“ (PITT) (Reddemann, 2003). Die psychodynamische imaginative Traumatherapie ist ein integrativer ressourcenorientierter Behandlungsansatz, in dem die Patienten Fähigkeiten zu Stress-, Selbstmanagement und Selbstberuhigung erlernen oder ausbauen und somit die Kontrolle über ihre Befindlichkeit zurückgewinnen 101 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE sollen. Die PITT wird hier zu den stabilisierenden Maßnahmen gezählt, obwohl sie unter Umständen auch Expositionsanteile enthält. Jedoch findet Exposition nicht regelhaft statt, sondern ausschließlich dann, wenn die Patienten zuvor ausreichend stabilisiert werden konnten. Für viele Patienten beschränkt sich die Traumaarbeit also auf die Stabilisierungsphase, in der mithilfe von Imaginationsübungen positive Orte oder Figuren („innerer sicherer Ort“, „innere hilfreiche Wesen“ etc.) als Gegengewicht zu den erlebten negativen Erfahrungen etabliert werden sollen. Auf diese Phase folgt (ggf.) die Phase der traumazentrierten Arbeit. Diese ist in folgende Unterphasen gegliedert: „Geplantes und gezieltes Aufsuchen der Traumen“, „gesteuertes Begegnen mittels bewusst herbeigeführter Dissoziation / Assoziation“, „Abreaktion“, „innerer Trost“. Exposition findet in der PITT lediglich mithilfe von Distanzierungstechniken statt (z. B. „Bildschirmtechnik“, „innerer Beobachter“, auch EMDR). So sollen die Fähigkeit zur Dissoziation als therapeutische Technik eingesetzt und die emotionale Belastung gering gehalten werden. Ziel der Exposition ist (in diesem Punkt entsprechend anderer therapeutischer Schulen) die Integration von Gedanken, Gefühlen und Körpererfahrungen. Auch werden die Unterschiede zwischen der damaligen traumatischen Situation und der Gegenwart betont. Jedoch sollte Traumaarbeit „so wenig traumatisierend wie möglich sein“, und Reddemann empfiehlt allen in dem Bereich Tätigen, ihre Interventionstechniken daraufhin zu überprüfen. Exposition wird als kontraindiziert betrachtet, wenn bei einem Patienten die Stabilisierungstechniken der 1. Phase nicht ausreichend etabliert sind, wenn seine äußeren Lebensumstände instabil sind und v. a. wenn noch Kontakt zu einem Täter besteht. Laut Reddemann ist „das Erleiden unerträglicher Affekte über lange Zeit [ist] weder dienlich noch notwendig“, (Reddemann & Sachsse, 1999, „Traumazentrierte imaginative Therapie“, Sexueller Mißbrauch, Mißhandlung, Vernachlässigung. P. Joraschky. Stuttgart, New York, Schattauer, Seite 388). Es werden jedoch keine Wirksamkeitsstudien angeführt, die diese Aussage stützen, bzw. Studien, die die „Dienlichkeit“ von (längerer) Exposition in sensu bereits gezeigt haben (siehe „1.5.2 Therapieverfahren mit Exposition als festem Bestandteil“), werden nicht erwähnt. Es zeigt sich in der Schilderung von Fallgeschichten, dass die Exposition auch ggf. vorzeitig abgebrochen wurde, falls sich währenddessen herausstellte, dass der Patient nach Einschätzung der Therapeutin noch nicht stabil genug dafür war (d. h. dass er in der Sitzung dissoziierte). Nach verhaltenstherapeutischer Theorie wird die Angst somit aufrecht erhalten, da die korrigierende Erfahrung der Angstreduktion nach einer gewissen Zeit nicht gemacht werden konnte (z. B. Schneider & Margraf, 1998). Die letzte Phase der PITT 102 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE ist die des Trauerns und der Neuorientierung. Das Programm wird von Reddemann und Kollegen im stationären bzw. teilstationären Setting angewandt. Das PITT wurde in einer naturalistischen Behandlungsstudie von Sachsse, Vogel und Leichsenring (2006) mit einer Standard-Behandlung verglichen und für signifikant hilfreicher befunden, auch blieben die Verbesserungen über die Zeit hinweg stabil. Allerdings wurden Patienten mit komplexer PTSD und BorderlinePersönlichkeitsstörung untersucht, also einer speziellen Population, die sich von denjenigen in den anderen angeführten Studien unterscheidet. Aus diesen Gründen und aufgrund einiger methodischer Einschränkungen (keine randomisierte kontrollierte Studie; soweit nachvollziehbar, basierte ein Großteil der Diagnoseerhebungen bis zur Ein-Jahres-Nachuntersuchung nur auf Selbstbeurteilungsfragebögen der Patienten) sind die Ergebnisse nicht mit denen anderer angeführter Studien vergleichbar und werden hier nicht näher beschrieben. Hypnose und Entspannungsverfahren Es existieren nur wenige kontrollierte Studien bzw. eher Einzelfallstudien zu Hypnose (z. B. Pantesco, 2005) und Entspannungsverfahren bei PTSD (Foa et al., 2000), weitere Studien sind notwendig (Robertson et al., 2004). Brom et al. (1989) verglichen – wie unter „1.5.2 Weitere kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen mit Exposition“ bereits beschrieben – psychodynamische Therapie, Hypnotherapie, Trauma-Desensibilisierung und eine WartelistenKontrollgruppe bei PTSD miteinander. Alle drei Behandlungsbedingungen führten zu ähnlichen Symptomverbesserungen im Vergleich zur Kontrollgruppe, in der keine signifikanten Veränderungen stattfanden. Die Hypnotherapie hatte besonders großen positiven Einfluss auf die Intrusionssymptome. Bei etwa 60 % der behandelten Patienten in allen aktiven Behandlungsbedingungen konnte eine klinisch relevante Symptomverbesserung festgestellt werden (26 % in der Kontrollgruppe). Es ist zu beachten, dass die Symptomatik lediglich von den Patienten selbst eingeschätzt wurde. Marks et al. (1998) – siehe weiter oben, „Kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen ohne Exposition“ – fanden in einer randomisierten kontrollierten Studie zum Vergleich von reiner kognitiver Umstrukturierung mit reiner Exposition bzw. einer Kombination von beiden Verfahren mit einer Kontrollbedingung in Form einer Entspannungsintervention, dass letztere in den meisten erhobenen Symptomwerten zu signifikanten Verbesserungen führte. Jedoch brachten die anderen Behandlungsbedingungen deutlich größere Verbesserungen mit sich. Zum 103 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE ersten Nachuntersuchungszeitpunkt erfüllten noch 45 % in der Entspannungsgruppe die Kriterien für eine PTSD, die Ergebnisse blieben bis zur letzten Nachuntersuchung nach sechs Monaten erhalten. Carlson, Chemtob, Rusnak, Hedlund und Muraoka (1998) verglichen EMDR und biofeedback-unterstützte Entspannung miteinander, zusätzlich gab es eine Kontrollgruppe, die Standardbehandlung erhielt. Die Probanden waren Kriegsveteranen, die an einer PTSD litten. Zusätzlich wurden Informationen zu Depression, Angst und Persönlichkeitseigenschaften sowie psychophysiologische Daten erhoben. Generell führte lediglich die EMDR-Bedingung zu deutlichen Verbesserungen in allen erhobenen Symptombereichen. Nach der „Clinician Administered PTSD Scale“ (CAPS) hatten sieben der neun Probanden in der Entspannungs-Gruppe zum ersten Nachuntersuchungszeitpunkt immer noch eine PTSD, die zwei übrigen verfehlten die Diagnose nur knapp (EMDR-Gruppe: Sieben von neun Probanden erfüllten die Kriterien nicht mehr). 1.5.4 Therapie der PTSD bei Asylbewerbern und Flüchtlingen Im Folgenden werden Befunde zur Behandlung von PTSD bei Asylbewerbern und Flüchtlingen in westlichen Staaten aufgeführt. Es existieren nur wenige randomisierte kontrollierte Studien zu dieser Thematik (Hinton, Chhean, Pich, Safren, Hofmann & Pollack, 2005). Da es insgesamt kaum Studien zur PTSD-Behandlung bei Flüchtlingen gibt, werden hier auch Studien zu gruppentherapeutischen Angeboten mit angeführt. Bezüglich der Behandlungsempfehlungen in den NICE-Guidelines (National Collaboration Center for Mental Health, 2005) merken Hopkins, Seltzer und Avigaad (2005) an, dass diese für die Arbeit mit Flüchtlingen nur begrenzt anwendbar seien. Sie plädieren für eine Behandlung, die den Gesamtkontext in höherem Maße berücksichtigt und nicht lediglich auf die Psychopathologie des Betroffenen fokussiert. Studien aus den USA Otto, Hinton, Korbly, Chea, Ba, Gershuny und Pollack (2003) verglichen kognitive Verhaltenstherapie und gleichzeitige Behandlung mit einem selektiven SerotoninWiederaufnahme-Hemmer (SSRI) mit reiner SSRI-Gabe in einer Stichprobe kambodschanischer Flüchtlinge. Es nahmen fünf Patientinnen (keine männlichen Probanden) pro Bedingung an dieser Pilotstudie teil. Sie litten unter PTSD und hatten von einer vorausgegangenen psychopharmakologischen Behandlung nicht profi104 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE tiert (Benzodiazepin und ein anderer SSRI als in der Studie verwendet). Im Verlauf der Studie wurde die Benzodiazepin-Gabe konstant gehalten, und die Teilnehmerinnen erhielten nun einen anderen SSRI (Sertralin). Die kognitive Verhaltenstherapie fand im Rahmen von zehn Gruppensitzungen statt, und es wurden sowohl Psychoedukation und Exposition (bezüglich Trauma und Körpersensationen) durchgeführt als auch Angstmanagement-Strategien vermittelt. Die Kombination von Pharmako- und Psychotherapie zeigte deutlich größere positive Effekte als die rein medikamentöse Behandlung, während derer sich die PTSD-Symptomatik nicht verbesserte. Über Therapieabbrüche wird nichts berichtet. In einer weiteren Pilotstudie behandelten Hinton, Pham, Tran, Safren, Otto und Pollack (2004) kambodschanische und vietnamesische Flüchtlinge (je zur Hälfte Männer und Frauen) mit einer kulturell angepassten Form von kognitiver Verhaltenstherapie. Die Patienten galten als therapieresistent, da sie trotz mindestens eines Jahres laufender Pharmakotherapie und unterstützender Psychotherapie immer noch an einer PTSD litten. Es wurden zwei Gruppen mit je sechs Teilnehmern gebildet. Die erste erhielt unmittelbar eine Behandlung, die zweite erst nach einer Wartezeit. Die meisten litten zusätzlich zur PTSD an Panikattacken. Die Behandlung fand in Einzelsitzungen statt und enthielt Bausteine zu Angstmanagement, Exposition hinsichtlich Körperempfindungen, kognitiver und körperorientierter Arbeit. In der Behandlungsgruppe zeigte sich eine signifikante Symptomreduktion im Vergleich zur Wartelistengruppe. Alle Therapien wurden von demselben Behandler durchgeführt, was die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse einschränkt. Es wird nichts über Therapieabbrüche berichtet. Hinton et al. (2005) führten zudem eine randomisierte kontrollierte Studie mit 40 kambodschanischen Flüchtlingen durch. Die als therapieresistent (wie oben) eingeschätzten Patienten litten unter PTSD, generalisierter Angststörung und Panikattacken und wurden in Einzelsitzungen mit einer kulturell angepassten Form von kognitiver Verhaltenstherapie mit Elementen zur Panik-Kontrolle behandelt. Eine zeitlich verzögerte Therapiegruppe stellte die Kontrollbedingung dar. Vier der ausgewählten Patienten begannen die Therapie gar nicht erst, niemand brach eine laufende Therapie vorzeitig ab. Parallel wurden die medikamentösen Behandlungen (SSRI und Benzodiazepin) und die unterstützenden Psychotherapien fortgesetzt. Die Therapiebausteine entsprechen denjenigen der oben aufgeführten Studie von Hinton et al. (2004), ergänzt um Exposition bezüglich Erinnerungen an traumatische Erlebnisse und einem Baustein zum Training von kognitiver Flexibilität (metakognitive Fähigkeit zur Verringerung psychischer Störungen). Wiederum wurden alle Therapien vom selben Behandler durchgeführt. In der Gruppe, die 105 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE unmittelbar mit der Behandlung begonnen hatte, zeigte sich eine signifikante Symptomreduktion in allen erhobenen Bereichen im Vergleich zur verzögerten Therapiegruppe vor deren Behandlung. Es erfüllten 60 % die Kriterien für eine PTSD nicht mehr, in der verzögerten Bedingung hatten alle noch eine PTSD. Die großen Effekte (Cohens d zwischen 2.17 und 3.78) der Behandlung sind umso bemerkenswerter, als die Patienten zuvor als therapieresistent eingestuft wurden. Nachdem die verzögerte Gruppe ebenfalls eine Therapie erhalten hatte, zeigten sich keine Unterschiede zur unmittelbaren Behandlungsgruppe. Snodgrass, Yamamoto, Frederick, Ton-That, Foy, Chan, Wu, Hahn, Shinh, Nguyen, de Jonge und Fairbanks (1993) beschreiben eine Pilotstudie mit vietnamesischen Flüchtlingen, die als Kinder aus Vietnam geflohen waren und nun an einer Universität studierten. Es wurde im Rahmen eines Kurses eine kulturell angepasste Version des Stress-Impfungs-Trainings (SIT) durchgeführt. Der Kurs wurde etwa 50 vietnamesischen Studenten angeboten, es entschieden sich jedoch nur elf für eine Teilnahme. Eine Kontrollgruppe wurde dadurch gebildet, dass jeder der Kursteilnehmer einen Freund oder Bekannten bat, ebenfalls die Fragebögen auszufüllen, die die Teilnehmer auch ausfüllten. Die Kontrollgruppe umfasste schließlich sechs Personen, die SIT-Gruppe am Ende nur noch acht Personen. Die PTSD-Symptomatik und die Einschätzung der Kursteilnehmer hinsichtlich ihrer Fähigkeit, mit anderen Menschen Beziehungen einzugehen, verbesserten sich signifikant, während sich bei den Kontrollpersonen keine Veränderungen zeigten. Die Pilotstudie weist einige methodische Mängel auf: Die Rekrutierung der Kontrollgruppe lässt im Unklaren, ob die beiden Gruppen tatsächlich vergleichbar sind, es wurden lediglich Selbstauskunfts-Fragebögen verwendet, und die Stichprobe war klein und nicht repräsentativ. Zudem merken die Autoren an, dass möglicherweise eine kulturspezifische Form sozialer Erwünschtheit (Unterwürfigkeit gegenüber Autoritätspersonen) die Ergebnisse verzerrt haben könnte. Weine, Kulenovic, Pavkovic und Gibbons (1998) führten eine unkontrollierte Pilotstudie zur Testimony-Psychotherapie mit 20 bosnischen Flüchtlingen durch. In der Testimony-Psychotherapie erzählt der Überlebende seine Lebensgeschichte mit Fokus auf die traumatischen Erlebnisse. Die Geschichte wird dokumentiert und eventuell anderen zur Verfügung gestellt (vergleiche „1.5.2 Narrative Expositionstherapie (NET)“, jedoch hat die Testimony-Methode keinen verhaltenstherapeutischen Hintergrund). Die Probanden hatten organisierte Gewalt („ethnische Säuberung“) erlebt und litten an einer PTSD, darüber hinaus wurden Befunde zu Depression, traumatischen Ereignissen, Funktionsniveau und früheren psychiatrischen Erkrankungen erhoben. Die Behandlung führte zu signifikanten Verbesse106 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE rungen in allen Symptombereichen. Drei Personen lehnten ein Behandlungsangebot ab, während der laufenden Therapien kam es zu keinem Abbruch. Europäische Studien Drozdek (1997) führte in den Niederlanden eine Therapiestudie mit 120 männlichen Flüchtlingen aus Bosnien-Herzegowina durch, die in Konzentrationslagern gewesen waren. Die Behandlung begann drei Monate nachdem die Flüchtlinge die Lager verlassen hatten. Auch Probanden, die die Kriterien einer PTSD nicht erfüllten, wurden in die Studie mit aufgenommen. Es wurde entweder GruppenPsychotherapie, eine Kombination aus Gruppentherapie und medikamentöser Behandlung (mit Anxiolytika und trizyklischen Antidepressiva) oder alleinige medikamentöse Behandlung durchgeführt. Die Psychotherapie fand in Phasen statt: Zunächst wurde auf Stabilisierung und Identifikation von Intrusionsauslösern fokussiert. In der zweiten Phase wurden die individuellen Traumaerlebnisse berichtet mit dem Ziel der Integration traumatischer Erinnerung und Gefühle. In der letzten Phase wurden die Grundüberzeugungen der Teilnehmer thematisiert sowie Aspekte von Migration und dem Leben im Exil besprochen. Der Ansatz war realitätsorientiert und psychodynamisch, eine genauere rückblickende Beschreibung der Behandlung und der Gruppenprozesse geben Drozdek, Zan und Turkovic (1998) in einem gesonderten Artikel. Von der Gruppe derjeniger mit PTSD verweigerten 25 % die Teilnahme an einer Behandlung. Die Zuteilung zu den Therapiebedingungen fand nicht nach dem Zufallsprinzip statt. Nach der Behandlung wurden nicht alle Teilnehmer, sondern lediglich zufällig ausgewählte 50 Probanden über alle Gruppen hinweg nachuntersucht. Es zeigte sich, dass über alle Behandlungsformen hinweg 73 % der Patienten mit anfänglicher PTSD die Kriterien erfüllten, während der Rückgang der PTSD-Rate in der Gruppe der Behandlungsverweigerer nur 10 % betrug. Drei Jahre später wurden dieselben Personen erneut untersucht. Zu diesem Zeitpunkt wiesen 83 % der anfänglich mit PTSD diagnostizierten Patienten wiederum eine PTSD auf. In der Gruppe der Therapieverweigerer hatten jedoch lediglich noch 60 % eine PTSD. Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Behandlungsgruppen. Es ist nicht angegeben, ob die Behandlungs- und Verweigerungsgruppen sich signifikant voneinander unterschieden. Es zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Bestehen einer PTSD und des selbst eingeschätzten psychischen Wohlbefindens der Probanden. 107 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE Paunovic und Öst (2001) führten eine randomisierte kontrollierte Studie mit 20 Flüchtlingen in Schweden durch, in der sie kognitive Verhaltenstherapie (Cognitive Behavioural Therapy, CBT) und Expositionstherapie miteinander verglichen. Das CBT-Protokoll beinhaltete sowohl Exposition als auch kognitive Therapie und Atemtraining. In der Expositionsbedingung wurden die Patienten in gestufter Vorgehensweise mit traumatischen Erinnerungen konfrontiert, zudem fand später auch in vivo Exposition mit vermiedenen Situationen statt. Die Behandlung fand in Form von Einzelsitzungen statt. Es wurden nur Flüchtlinge in die Studie aufgenommen, die eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung für Schweden hatten und ausreichend Schwedisch sprachen, so dass ohne Übersetzer gearbeitet werden konnte. Zudem wurden besonders belastete Flüchtlinge nach der Erstdiagnostik ausgeschlossen. Medikamentöse Behandlung sollte über die Zeitdauer der Studie hinweg konstant gehalten werden, jedoch reduzierten die Probanden ihre Medikation um insgesamt 50 %, zur Halbjahres-Nachuntersuchung waren es 58 %. Beide Behandlungsformen zeigten sich sehr effektiv in der Reduktion aller erhobenen Symptome: PTSD (Symptomreduktion durch CBT: 53 %, durch Exposition: 48 %) Depression (CBT: 57 %, Exposition: 54 %) und generalisierte Angst (CBT: 50 %, Exposition: 49 %). Auch die Lebensqualität und die kognitiven Schemata der Patienten veränderten sich signifikant zum Positiven hin. Zwischen den beiden Behandlungsbedingungen zeigten sich keine Unterschiede in den Ergebnissen. Es werden keine Angaben zu den Herkunftsländern der Probanden gemacht. Vier Patienten wurden im Verlauf aus der Studie ausgeschlossen (einer in der Expositions-, drei in der CBT-Gruppe): Drei von ihnen hatten mehrere aufeinander folgende Sitzungen nicht wahrgenommen, einer (aus CBT) hatte sich gegenüber dem Therapeuten aggressiv verhalten. Diese Probanden hatten ein höheres Bildungsniveau und positivere kognitivere Schemata als die anderen Probanden, ansonsten bestanden keine signifikanten Unterschiede zwischen ihnen und den Übrigen. Basoglu, Ekblad, Bäärnhielm und Livanou (2004) führten eine Einzelfallstudie mit einem kurdischen Asylbewerber in Schweden durch. Der Patient erhielt 14 Sitzungen kognitiver Verhaltenstherapie mit Exposition in vivo bezüglich vermiedener Alltagssituationen, kognitive Interventionen bezogen sich lediglich auf Psychoedukation und Finden eines individuellen Störungsmodells. Die PTSD-, Depressions- und Angstsymptomatik des Patienten verringerte sich signifikant. Die Autoren vermuten anhand der Ergebnisse, dass kognitive Verhaltenstherapie trotz der zusätzlichen Stressoren für Asylbewerber hilfreich sein kann. Lehmann (2007) fand hingegen in einer Untersuchung der psychischen Befindlichkeit von Asylbewerbern in Abhängigkeit von ihrem Aufenthaltsstatus, dass diejenigen Probanden, 108 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE die irgendeine Form von ambulanter Psychotherapie erhalten hatten, keine signifikanten Verbesserungen ihrer PTSD-Symptomatik aufwiesen. Paradoxerweise hatte sich im Beobachtungszeitraum die Symptomatik derjenigen Patienten signifikant verbessert, die nicht in Behandlung gewesen waren, was möglicherweise auf geringeren subjektiven Leidensdruck dieser Personen zurückzuführen war. Es ist anzumerken, dass die Informationen zur Psychotherapie in der Stichprobe von Lehmann nur unsystematisch erhoben wurden, es wurde lediglich nach Teilnahme an Psychotherapie gefragt. Viele Probanden verfügten über schlechte Deutschkenntnisse und gaben an, dass die Therapien ohne ausreichende Übersetzung stattfanden, was sich vermutlich negativ auf den Behandlungserfolg auswirkte. Birck (2001) beschreibt eine unkontrollierte Behandlungsstudie mit 30 Patienten des Behandlungszentrums für Folteropfer in Berlin. Ursprünglich waren 57 Patienten in der Stichprobe, d. h. 47 % brachen die Teilnahme an der Studie ab, hauptsächlich aufgrund von Rückführungen in die Herkunftsländer der Patienten. Die meisten der übrigen 30 Patienten waren Folteropfer und Asylbewerber, den größten Teil stellten Kurden aus der Türkei. Von diesen Patienten hatten 27 eine PTSD. Die Behandlung dauerte im Schnitt knapp zwei Jahre. Der größte Teil der Patienten (25) erhielt psychodynamische Therapie, zwei erhielten systemische Therapie, zwei Gestalt- und ein Patient kognitive Verhaltenstherapie. Die diagnostische Erfassung der Symptomatik nach Beendigung der Therapien war sehr lückenhaft. Zum Nachuntersuchungszeitpunkt zwei Jahre nach Beginn der Behandlung zeigte sich, dass sich intrusive Symptome verringert hatten, nicht jedoch Symptome der Vermeidung und der Übererregung. Mehr als die Hälfte der Patienten erfüllte noch die Kriterien für eine PTSD. Dennoch waren die meisten Teilnehmer (27) völlig oder teilweise zufrieden mit der Psychotherapie. Viele Patienten hatten seit Ende der Therapie weitere Stressoren erlebt und führten das Gleichbleiben oder die Verschlimmerung von Symptomen darauf zurück. Der Asylstatus stand in keinem Zusammenhang mit der PTSD-Symptomatik. In einer weiteren explorativen Studie verglich Birck (2004) Patienten, die lediglich zu diagnostischen Untersuchungen gekommen waren, um eine klinische Stellungnahme zu erhalten, mit denjenigen, die im Behandlungszentrum für Folteropfer durchschnittlich zehn Monate lang Psychotherapie und ebenfalls Stellungnahmen erhalten hatten. Die Einteilung in die beiden Gruppen wurde nicht zufällig, sondern entsprechend dem Anliegen des Patienten vorgenommen, jedoch gab es für eine Therapie lange Wartelisten, was manche Interessierte abgeschreckt hatte. Von den 21 Patienten in der Therapie-Bedingung erhielten zehn tiefenpsychologische Gruppentherapie, fünf Psychodrama, sechs hatten Einzeltherapie (fünf 109 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE Personen tiefenpsychologisch, eine systemisch). Drei Probanden erhielten zusätzlich Musiktherapie. Sowohl in der Behandlungs- als auch in der StellungnahmeBedingung zeigten sich keine Veränderungen der Symptomatik hinsichtlich PTSD, Depression, Angst und somatoformen Beschwerden. Ein möglicher Einflussfaktor ist die Bedeutung der PTSD-Diagnose für das Asylverfahren: Hat jemand eine Aufenthaltserlaubnis aufgrund der PTSD als Abschiebehindernis, könnte einem Patienten die Abschiebung drohen, wenn die PTSD wegfällt. Birck räumt auch ein, dass die Wahl von hauptsächlich psychodynamischen und Gruppenbehandlungen möglicherweise suboptimal war. Eine weitere Therapiestudie wurde in Ulm von Schwarz-Langer, Deighton, Jerg-Bretzke, Weisker und Traue (2006) durchgeführt. Sie behandelten 13 PTSDPatienten mit Psychopharmaka und Psychotherapie (Phasen: „Sicherheit“, „Selbstkontrolle“, „Erinnerung und Trauer“, „Reintegration“). In der Erinnerungsphase wurde in begrenztem Maße, das der Patient selbst bestimmen sollte, Exposition durchgeführt. Jedoch wurde auch die Vermeidung als Strategie zum Schutz vor Intrusionen interpretiert und unterstützt (so auch bei Kinzie & Fleck, 1987), so dass die Exposition möglicherweise nicht optimal wirken konnte (z. B. Schneider & Margraf, 1998). Zudem erhielten die Patienten Unterstützung bei Schwierigkeiten in ihrem Asylantragsverfahren. Es gab keine Kontrollgruppe. Die PTSD-Diagnose wurde lediglich mithilfe eines Selbstauskunftsfragebogens gestellt. Weitere methodische Schwächen sind die stark variierende Anzahl an Therapiestunden pro Patient (16 bis 70) sowie die Auswertung des Therapieerfolgs lediglich anhand von Veränderungen in den Therapieprotokollen sowie mittels post hoc-Interviews mit den Patienten. Es ist fraglich, inwieweit sich die rückblickende Veränderungseinschätzung durch die Patienten in halbstrukturierten klinischen Interviews mit validen Instrumenten in gleicher Weise abbilden würde. Zumindest weichen beispielsweise bei Birck (2001), wie weiter oben beschrieben, die Zufriedenheit der Patienten mit dem Therapieerfolg (hier allerdings nicht symptomspezifisch erfragt) und die erhobenen klinischen Veränderungsmaße stark voneinander ab. Anhand der in der Studie vorgenommenen Evaluationen kommen die Autoren zu dem Schluss, dass die Behandlung positiven Einfluss auf die Schlafqualität sowie auf die Intrusions- und Übererregungssymptomatik hatte. Die meisten Patienten gaben überdies höhere Zufriedenheit, Vertrauen, Selbstbewusstsein und weniger Schmerzen, Schmerzmedikation und Arztbesuche an. Zudem berichteten sie von positiven Effekten der antidepressiven Medikation. Allerdings bekamen manche Patienten zusätzlich Benzodiazepine – teilweise nach Bedarf – oder Neuroleptika. Aufgrund 110 1.5 Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung 1 THEORIE der vielen methodischen Einschränkungen ist die Aussagekraft der Studie als gering einzuschätzen. In einer Studie von Gotthardt (2007) in der Psychologischen Forschungs- und Modellambulanz der Universität Konstanz wurde die „Narrative Expositionstherapie“ (NET) mit Standardbehandlung bei schwertraumatisierten Asylbewerbern mit unsicherem Aufenthaltsstatus verglichen. Die „Standardbehandlung“ fand außerhalb der Ambulanz für Flüchtlinge statt und konnte sowohl Psychotherapie oder Pharmakotherapie als auch gar keine Behandlung bedeuten. Auch die Teilnehmer in der NET-Gruppe hatten meist zusätzliche medikamentöse und / oder psychotherapeutische Behandlung im Untersuchungszeitraum erhalten. Pro Behandlungsbedingung nahmen 16 Patienten an der Studie teil. In der NET-Gruppe fielen bis zur Sechs-Monats-Nachuntersuchung zwei Patienten (12,5 %) für nachfolgende Analysen weg, einer erhielt zusätzliche Behandlung nach Beendigung der NET, ein weiterer verweigerte die Teilnahme. In der Gruppe mit Standardbehandlung kam es in diesem Zeitraum nicht zu Abbrüchen der Teilnahme an der Studie. Nach zwei Jahren konnten zehn Patienten (62,5 %) aus der Gruppe mit Standardbehandlung und zwölf (75,5 %) aus der NET-Gruppe erneut befragt werden. Die übrigen konnten nicht mehr aufgefunden werden oder hatten externe Gründe, nicht an der Nachuntersuchung teilzunehmen. Es zeigte sich, dass die Teilnehmer der NET-Bedingung nach sechs Monaten eine signifikant geringere PTSD-Symptomatik aufwiesen als diejenigen mit Standardbehandlung. Die Patienten in der NET-Bedingung zeigten diese Verbesserung auch noch zwei Jahre später. Zu diesem Zeitpunkt fand sich auch in der Gruppe mit Standardbehandlung eine deutliche Symptomreduktion, so dass sich die Ergebnisse nicht mehr von denen in der NET-Gruppe unterschieden. In der Bedingung mit Standardbehandlung hatten verglichen mit denen der NET-Gruppe viele der Patienten im Laufe des Untersuchungszeitraums einen sicheren Aufenthaltsstatus erlangt, so dass fraglich ist, inwieweit die Verbesserungen in der psychischen Befindlichkeit möglicherweise darauf zurückzuführen waren. In beiden Bedingungen erfüllten die meisten Patienten zu beiden Nachuntersuchungszeitpunkten noch die Kriterien für eine PTSD (kein signifikanter Gruppenunterschied). Komorbide Symptome (Depression, Suizidalität und Angst) veränderten sich bei den meisten Teilnehmern nicht signifikant. Die Stichprobe ist nicht repräsentativ, da sie sich hauptsächlich aus Kurden zusammensetzte und es sich zudem um Patienten handelte, die in der Psychologischen Ambulanz für Flüchtlinge vorstellig wurden. Jedoch lehnte nur einer der ausgewählten Patienten, der die Eingangskriterien für die Studie erfüllte, das Angebot einer NET ab. 111 1.6 Zusammenfassung und Fragestellungen 1 THEORIE In einer weiteren Studie von Gotthardt (2007) wurde das NET-Prozedere an niedergelassene Therapeuten weitervermittelt. Diese sollten NET als einen Baustein in der Behandlung von Asylbewerbern mit PTSD einsetzen. Es zeigte sich – allerdings nur mit einer kleinen Stichprobe – dass die Probanden, die zusätzlich zur sonstigen Behandlung NET erhielten, eine signifikant stärkere Symptomreduktion bezüglich der PTSD aufwiesen als diejenigen, die ausschließlich die reguläre Behandlung erhielten. 1.6 Zusammenfassung und Fragestellungen Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es zwar eine große Anzahl von Flüchtlingen in westlichen Ländern gibt, die an einer Posttraumatischen Belastungsstörung leiden, jedoch bislang kaum kontrollierte Studien zu geeigneten Therapieverfahren für diese Patientengruppe vorliegen. Aus den wenigen bisherigen Befunden geht hervor, dass kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlungen zur Reduktion der PTSD-Symptomatik bei Flüchtlingen geeignet scheinen, während zu anderen Therapieformen keine kontrollierten Studien vorliegen. In Deutschland gibt es bislang keine Studie zu PTSD bei Flüchtlingen, in der verschiedene systematisch angewandte Therapieverfahren miteinander verglichen wurden. In der unter „1.5.4 Therapie der PTSD bei Asylbewerbern und Flüchtlingen“ beschriebenen Studie von Paunovic und Öst (2001) aus Schweden wurden zwar zwei kognitivverhaltenstherapeutische Behandlungen systematisch miteinander verglichen, jedoch wurde zum einen in beiden Bedingungen Exposition durchgeführt – bislang existiert keine Studie mit Flüchtlingen zum Vergleich von evidenzbasierten Verfahren mit und ohne Exposition. Zum anderen wurden in der Studie von Paunovic und Öst lediglich Probanden ausgewählt, die einen sicheren Aufenthaltsstatus innehatten, die Sprache des Exillandes sprachen und nicht allzu schwer belastet waren. Für Flüchtlinge in westlichen Ländern, auf die diese Faktoren nicht zutreffen, liegt bislang keine der Autorin bekannte randomisierte kontrollierte Studie zum Vergleich zweier standardisierter Therapieverfahren vor. In der im Folgenden beschriebenen randomisierten kontrollierten Studie sollen die Anwendbarkeit und Wirksamkeit von „Narrativer Expositionstherapie“ (NET) und „Stress-Impfungs-Training“ (SIT) bei Personen, die in Deutschland leben, organisierte Gewalt erlebt haben und in der Folge an einer PTSD leiden, untersucht und verglichen werden. Die Stichprobe umfasst größtenteils Asylbewerber, die aufgrund von Gewalterlebnissen aus ihren Herkunftsländern geflüchtet sind, einen kleinen Teil stellen ehemalige DDR-Bürger mit Erlebnissen organisier- 112 1.6 Zusammenfassung und Fragestellungen 1 THEORIE ter Gewalt dar. Die meisten Probanden haben keinen sicheren Aufenthaltsstatus in Deutschland und sprechen nicht ausreichend Deutsch, um ohne Dolmetscher eine Therapie durchzuführen. Es kommen in der Studie zwei kognitiv-verhaltenstherapeutische Verfahren zur Anwendung, die sich in Untersuchungen mit anderem Klientel bzw. anderen Fragestellungen bereits als hilfreich zur Reduktion von PTSD-Symptomatik erwiesen hatten. Zudem sind die beiden Verfahren so ausgewählt, dass sie hinsichtlich Exposition eindeutig voneinander abgrenzbar sind: Der Hauptbestandteil von NET ist Exposition, während die hier verwendete Version des SIT keine Expositionsbausteine enthält. Darüber hinaus wird in der NETBedingung ausschließlich die Vergangenheit mit dem Ziel thematisiert, dass die Verarbeitung traumatischer Lebensereignisse sich anschließend positiv auf die psychische Befindlichkeit und das Funktionsniveau des Betroffenen in der Gegenwart auswirkt. In der SIT-Bedingung liegt der Fokus hingegen ausschließlich auf der Gegenwart und der Bewältigung der aktuellen Angstsymptome – die Beeinträchtigungen, die ihre Ursache in vergangenen Erlebnissen haben, sollen im SIT reduziert werden, ohne dass eine Konfrontation mit der Vergangenheit notwendig ist. Vor dem Hintergrund der bislang bekannten und weiter oben dargestellten Forschungsergebnisse wird angenommen, dass sowohl NET als auch SIT zu einer signifikanten Reduktion der PTSD-Symptomatik führen. In den NET-Studien, in denen kurz nach Ende der Behandlungen Nachuntersuchungen vorgenommen wurden (Neuner et al., 2004b; Onyut et al., 2005; Schaal, 2006) zeigten sich signifikante Therapieeffekte erst zu späteren Untersuchungszeitpunkten. Daher wird mit einer Symptomreduktion in der NET-Gruppe erst zum Zeitpunkt der SechsMonats-Nachuntersuchung gerechnet. In den bisherigen Studien zum SIT (Foa et al., 1991 & Foa et al., 1999) zeigten sich bezüglich des Zeitpunktes, zu dem die PTSDSymptomatik nach einem SIT verringert war, gemischte Befunde: Bei einer Intentto-treat-Analyse brachte SIT keine sofortige Reduktion der PTSD-Symptomatik mit sich, in zwei Completer-Analysen jedoch schon. In einer dieser Completer-Analysen zeigte sich SIT unmittelbar nach Therapieende gegenüber zweien von drei Vergleichsbehandlungen überlegen. Es wird in der hier beschriebenen Studie angenommen, dass SIT bereits zum ersten Nachuntersuchungszeitpunkt zu einem signifikanten Rückgang der PTSD-Symptomatik führt. Da die Probanden vermutlich stark belastet sind, wird nicht mit einem vollständigen Rückgang der PTSD-Symptomatik bis hin zum vollständigen Wegfall der PTSD-Diagnosen gerechnet. Es wird erwartet, dass eine größere Anzahl verschiedener traumatischer Erlebnisse mit stärkerer PTSD-Symptomatik einhergeht. Weiterhin wird angenommen, dass 113 1.6 Zusammenfassung und Fragestellungen 1 THEORIE diejenigen Patienten mit einer komorbiden depressiven Störung nach einem SIT deutlich reduzierte Depressionswerte aufweisen. Anhand der bisherigen gemischten Befunde lassen sich hier keine spezifischen Annahmen über den Zeitpunkt eines solchen Effekts treffen. Darüber hinaus ist von Interesse, wie sich die NET auf eine depressive Symptomatik auswirkt (bislang existieren gemischte Befunde), und wie groß der Anteil derjenigen Patienten ist, die nach der Behandlung nicht mehr die Kriterien für eine PTSD oder für eine depressive Störung erfüllen. Auch ein möglicher Zusammenhang zwischen Depressivitätsgrad und der Anzahl erlebter Gewalterfahrungen ist von Interesse. Der Einfluss von NET und SIT auf die einzelnen Symptombereiche der PTSD soll betrachtet werden: Dies schließt sowohl die Bereiche der Intrusionen, Vermeidungs- und Übererregungssymptome als auch die Funktionsbeeinträchtigung und die Begleitsymptome ein. Es soll zudem ein potenzieller Zusammenhang zwischen der Depressions- und der PTSD-Symptomschwere – auch bezogen auf einzelne Symptombereiche der PTSD – analysiert werden. Schließlich sind auch potenzielle Veränderungen sonstiger komorbider Störungen sowie der Suizidalität durch NET und SIT von Interesse. Abschließend soll untersucht werden, welche der im Folgenden angeführten Faktoren im Zusammenhang mit der Symptomschwere hinsichtlich PTSD und Depressivität stehen: Alter, Geschlecht, Bildung, Jahre in Deutschland, Erwerbstätigkeit, Partnerschaft, Kinder, frühere psychische Erkrankung, externe Psychotherapie und Anzahl verschiedener Medikamententypen. 114 2 2 METHODEN Methoden 2.1 Setting Die Studie zum Vergleich von „Stress-Impfungs-Training“ (SIT) und „Narrativer Expositionstherapie“ (NET) bei posttraumatischer Belastungsstörung in Folge von organisierter Gewalt fand in der Psychologischen Forschungs- und Modellambulanz für Flüchtlinge der Universität Konstanz statt. Sie wurde im Zeitraum von 2004 bis 2007 durchgeführt. Die Ambulanz wurde im Jahr 2003 gegründet und ist auf die wissenschaftliche und klinische Untersuchung und Behandlung traumatisierter Flüchtlinge spezialisiert. Sie entstand auf Initiative der Nichtregierungsorganisation vivo international in Kooperation mit der Arbeitsgruppe Psychotraumatologie am Lehrstuhl für Klinische Psychologie und Neuropsychologie der Universität Konstanz. Die Räumlichkeiten der Ambulanz befinden sich in einem Gebäude der Universität auf dem Gelände des Zentrums für Psychiatrie Reichenau. Die Forschungs- und Modellambulanz wird vom Europäischen Flüchtlingsfonds (EFF) gefördert. Die Ethik-Kommission der Universität Konstanz meldete keine Bedenken gegen die Durchführung der Studie an. Sowohl die Diagnostik-Termine als auch die Therapiesitzungen fanden ambulant in den Räumen der Psychologischen Forschungs- und Modellambulanz für Flüchtlinge statt (in einem Fall wurde die Hälfte der Therapiesitzungen auswärts abgehalten). Die Therapiesitzungen wurden bis auf wenige Ausnahmen mit einer Videokamera aufgenommen, nachdem das Einverständnis des Klienten eingeholt worden war. 2.2 2.2.1 Versuchspersonen Rekrutierung der Versuchspersonen Die Rekrutierung der Klienten erfolgte teilweise aus der Datenbank der Klienten, die bereits in der Psychologischen Forschungs- und Modellambulanz für Flüchtlinge im Rahmen von anderen Studien bzw. Begutachtungen untersucht wurden (etwas mehr als ein Drittel der Stichprobe). Die meisten anderen Klienten wurden von Sozialbetreuern oder anderen Behandlern erstmals in der Ambulanz angemeldet. Eine Klientin und ein Klient hatten sich selbst hier angemeldet, nachdem sie z. B. in Beratungsstellen für Flüchtlinge von Behandlungsmöglichkeiten in der Ambulanz gehört hatten. 115 2.2 Versuchspersonen 2.2.2 2 METHODEN Ausschluss- und Aufnahmekriterien Folgende Ausschlusskriterien bestanden für die Teilnahme an der Studie: Drogen-, Medikamenten- oder Alkoholabhängigkeit, mangelnde Bündnisfähigkeit bzgl. Suizidalität, Schizophrenie oder stationäre psychiatrische Behandlung während der Teilnahme an der Therapiestudie außer im hiesigen Zentrum für Psychiatrie Reichenau. Schwangerschaft war ein weiteres Ausschlusskriterium. Klienten, die in die Studie aufgenommen wurden, mussten folgende Voraussetzungen erfüllen: Der Proband hat organisierte Gewalt erlebt und ist in der Folge an einer aktuell bestehenden PTSD erkrankt. Zudem zeigte er sich durch Unterzeichnen einer Einverständniserklärung damit einverstanden, nach dem Zufallsprinzip in die NET- oder SIT-Behandlungsgruppe eingeteilt zu werden. Die Klienten erhielten keine materielle Entschädigung für die Teilnahme an der Studie. In Einzelfällen wurden bei Bedarf psychodiagnostische Befunde erstellt. Grundsätzlich wurden im Umgang mit Klienten die „Regeln zur Betreuung und zum Schutz von Personen, die im Rahmen der Zielsetzungen der Ambulanz für Flüchtlinge und Folteropfer an der Universität Konstanz diagnostisch untersucht werden“ (Rockstroh & Elbert, 2003, siehe Seite 221 im Anhang) eingehalten. Dies galt sowohl für alle diagnostischen als auch für alle therapeutischen Sitzungen. Die genannten Regeln spiegelten sich auch in den Einverständiserklärungen wider, die jeder Proband sowohl vor den diagnostischen Sitzungen, vor der Magnetenzephalographie-Messung (siehe „2.6.2 Die Magnetenzephalographie-Messung (MEG)“) als auch vor Beginn der jeweiligen Therapie nach ausführlicher Information unterschrieb. 2.2.3 Beschreibung der Stichprobe Im Folgenden werden die soziodemografischen Daten der Probanden aus dem ersten diagnostischen Interview angeführt. Zudem wird angegeben, ob sich die Teilnehmer der NET- und SIT-Bedingung hinsichtlich dieser Daten signifikant voneinander unterschieden. Dazu wurden für alle Variablen, je nachdem, ob eine Normalverteilung vorlag oder nicht, t-Tests oder Chi-Quadrat-Tests durchgeführt (bei letzteren wurden bei einer der erwarteten Häufigkeiten < 5 die Ergebnisse des Exakten Tests nach Fisher berücksichtigt). Eine Ausnahme bilden die Daten in Tabelle 1, in der z. B. Alter, Bildung etc., aufgelistet sind; hier wurden verschiedene Testverfahren verwendet, die jeweils gesondert angegeben sind. Es handelte sich stets um zweiseitige Testungen mit dem Signifikanzniveau α = .05. Bei Mehrfach- 116 2.2 Versuchspersonen 2 METHODEN Vergleichen wurde in den Fällen, in denen signifikante Effekte mit p < .05 auftraten, eine Bonferroni-Holm-Korrektur des Signifikanzniveaus durchgeführt. Die Herkunftsländer der Probanden sind in Abbildung 1 aufgeführt. Die Probanden wurden nach Geschlecht und Herkunft paarweise eingeteilt und per Zufall der NET- oder SIT-Gruppe zugeordnet, siehe „2.5 Ablauf der Therapiestudie“. Die beiden Behandlungsgruppen unterschieden sich also nicht hinsichtlich Herkunftsländern5 und Geschlechterverteilung (zu letzterem siehe auch Tabelle 1). Die ethnischen Zugehörigkeiten waren folgendermaßen verteilt (n): Kurdisch (11), Algerisch (4), Albanisch (2), Deutsch (2), Bassa (1), Amharisch (1), Roma (1), Kroatisch (1), Polisario (1), Bosnisch (1), Bafang (1), Bafut (1) und Afrikanisch (1). Ehem. DDR 7.1% Balkan 17.9% 39.3% Türkei 35.7% Afrika Abbildung 1: Herkunft der Probanden Afrika (n): Algerien (4), Äthiopien (1), Kamerun (2), Liberia (1), Sierra Leone (1), Marokko (1) Balkan (n): Bosnien-Herzegowina (1), Kosovo (1), Kroatien (1), (Süd-)Serbien (2) Die Interviews und Behandlungen wurden mit den Patienten in folgenden Sprachen durchgeführt (n): Türkisch (9), Deutsch (6), Englisch (3), Arabisch (3), Französisch (2), Kurdisch (2), Albanisch (1), Serbokroatisch (1) und Amharisch (1). Zwei der Deutsch sprechenden Patienten stammten aus der ehemaligen DDR, drei weitere stammten aus der Balkan-Region. Der sechste Deutsch sprechende Patient stammte aus Algerien und lebte bereits seit elf Jahren in Deutschland. Hinsichtlich dessen, ob die Patienten Deutsch sprachen und ob ein Dolmetscher benötigt wurde, unterschieden sich die beiden Therapiegruppen nicht (Exakter Test nach Fisher: p > .05). 5 bezogen auf die gröbere Einteilung der Herkunftsregionen wie in Abbildung 1 ersichtlich. 117 2.2 Versuchspersonen 2 METHODEN Tabelle 1: Beschreibung der Stichprobe Gesamt NET SIT (N = 28) (n = 15) (n = 13) Vergleich NET – SIT Median Range Median Range Median Range Alter in Jahren 33,5 17-55 35 21-55 28 17-44 n.s.a Bildung in Jahren: Schule Ausbildung 9,5 0 0-15 0-14 0-4 8 0 2-15 0-4 10 0 n.s.a n.s.a M SD M SD M SD 5,5 6,03 6,27 7,59 4,62 3,6 Jahre in Dtl.* (1-30) (1-30) 0-3 n.s.b (1-15) n % n % n % 16 12 57,1 42,9 8 5 61,5 38,5 8 7 53,3 46,7 n.s.c n.s.c 20 71,4 9 69,2 11 73,3 n.s.d 7 7 25 25 2 4 15,4 30,8 5 3 33,3 20 n.s.d n.s.d Krankenhausaufenthalte (j/n) 17 60,7 8 61,5 9 60 n.s.c derzeit Arbeit 8 28,6 5 38,5 3 20 n.s.d Geschlecht: männlich weiblich derzeit extern in Psychotherapie Sympt. vor Trauma: psychisch körperlich * entspricht „Jahren in der BRD“ für Probanden aus der ehemaligen DDR a U-Test nach Mann & Whitney für unabhängige Stichproben c Chi-Quadrat-Test b t-Test d Exakter Test nach Fisher 118 2.2 Versuchspersonen geschieden 4% 7% ledig 2 Partner (unverh.) verwitwet 2 Kinder 3 Kinder 18% 4% METHODEN 18% 3% 35% 1 Kind 5 Kinder 18% 50% 43% verheiratet keine Kinder Abbildung 2: Familienstand der Probanden und Anzahl Kinder Häufigkeitsangaben zu Familienstand und Anzahl der Kinder der Teilnehmer sind in Abbildung 2 dargestellt. Die Probanden in der NET- und SIT-Gruppe unterschieden sich hinsichtlich dieser Variablen nicht signifikant; aufgrund der geringen Personenzahl für die einzelnen Unterkategorien wurden die Variablen dichotomisiert („Kinder: Ja / Nein“ und „Partnerschaft / alleinstehend“). Abbildung 3 zeigt die Häufigkeit verschiedener Aufenthalts- bzw. Asylstatus der Probanden zum Zeitpunkt der Erstdiagnostik. Es lebten zu dem Zeitpunkt 60,7 % der Teilnehmer in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber, die übrigen in Mietwohnungen. Zwischen den beiden Behandlungsgruppen bestanden bezüglich der Wohnsituation und des Aufenthaltsstatus’ keine signifikanten Unterschiede. Die Variable „Asylstatus“ wurde für diese Berechnung dichotomisiert und in „sicheren“ vs. „unsicheren Status“ aufgeteilt (als „sicher“ wurden diejenigen Patienten eingestuft, die die deutsche Staatsbürgerschaft besaßen, sowie diejenigen mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis, als „unsicher“ wurden diejenigen Patienten klassifiziert, die sich im Erst- oder Folgeverfahren befanden bzw. geduldet oder von Abschiebung bedroht waren). Einen unsicheren Aufenthaltsstatus hatten bei der Erstdiagnostik 89,3 %, die übrigen 10,7 % hatten einen sicheren Aufenthaltsstatus (N = 28). Zum Zeitpunkt sechs Monate nach Therapieende wurden diese Informationen erneut erhoben: Es hatten nun 66,7 % einen unsicheren Aufenthaltsstatus, 23,8 % einen sicheren Status, und bei 9,6 % wurden die Angaben nicht erhoben. Da zu diesem Untersuchungszeitpunkt von insgesamt befragten 22 Patienten bei dreien die Angaben zum Asylstatus fehlten, werden hier die validen Prozentangaben angeführt. Im Exakten Test nach Fisher zeigte sich, dass sich das Verhältnis von sicherem und unsicherem Aufenthaltsstatus über die Zeit nicht signifikant verändert hatte, weder in der Gesamtstichprobe noch in der NET- bzw. SIT-Gruppe (p > 119 2.2 Versuchspersonen 2 METHODEN .05). Gleiches gilt für die Wohnsituation sechs Monate nach Therapieende im Vergleich zum Zeitpunkt der Erstdiagnostik. Auch für diese Analyse fehlten jedoch die Angaben von einem Patienten aus der NET- sowie einem aus der SIT-Bedingung. Beide wurden unter besonderen Bedingungen mit einem verkürzten Fragebogenset nachuntersucht (dieses entspricht dem Set für die Vier-Wochen- und Ein-JahresNachuntersuchung, siehe 2.6 und auch „2.5 Ablauf der Therapiestudie“). dt. Staatsbürger befr. Aufenthaltserlaubnis 7.1% 3.6% Erstverfahren 10.7% 78.6% Folgeverfahren Abbildung 3: Aufenthalts-/Asylstatus der Probanden Die Medikamenteneinnahme der Probanden zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung ist in Tabelle 2 aufgeführt. Die beiden Behandlungsgruppen unterschieden sich nicht signifikant hinsichtlich der Medikation. Es nahmen 14 % der Probanden keinerlei Medikamente ein. Zum Zeitpunkt sechs Monate nach Therapieende zeigte sich keine signifikante Veränderung der Medikamenteneinnahme im Vergleich zur ersten Untersuchung (Korrektur des Signifikanzniveaus nach Bonferroni-Holm auf α = .005; Exakter Test nach Fisher: p > .005). Es fehlen auch hier Angaben von je einem Patienten aus der NET- und SIT-Gruppe, siehe vorheriger Absatz. Ansonsten zeigte sich dasselbe Muster wie zum Zeitpunkt der Erstdiagnostik. Es nahmen insgesamt 11 % der Patienten keinerlei Medikamente ein, dieser Anteil unterscheidet sich nicht signifikant von demjenigen zum Zeitpunkt der Erstdiagnostik (Exakter Test nach Fisher: p > .05). Es wurde zudem die Gesamtanzahl verschiedener Medikamententypen berechnet, die die Patienten zum jeweiligen Untersuchungszeitraum einnahmen. Es wurden bei der ersten Untersuchung in der Gesamtstichprobe im Schnitt 1,96 verschiedene Arten von Medikamenten eingenommen (SD = 1,40; Minimum 0, Ma120 2.2 Versuchspersonen 2 METHODEN ximum 5). Zum Zeitpunkt der Sechs-Monats-Nachuntersuchung waren es durchschnittlich 1,60 Präparattypen (SD = .94; Minimum 0, Maximum 4). Zwischen den beiden Zeitpunkten veränderte sich die Anzahl von Medikamententypen in der Gesamtstichprobe nicht signifikant (t-Test: t (47) = 0,085; p > .05). In der NETGruppe wurden vor der Behandlung im Schnitt 2,27 Präparattypen eingenommen (SD = 1,28; Minimum 0, Maximum 4). Sechs Monate nach Therapieende waren es 1,45 (SD = .934; Minimum 0, Maximum 3). Die SIT-Patienten nahmen zur Erstdiagnostik durchschnittlich 1,62 verschiedene Präparattypen ein (SD = 1,50; Minimum 0, Maximum 5), zur Sechs-Monats-Nachuntersuchung waren es 1,78 (SD = .97; Minimum 1, Maximum 4). Zu keinem der beiden Zeitpunkte unterschieden sich die NET- und SIT-Gruppen signifikant hinsichtlich der Anzahl verschiedener Medikamententypen (Erstdiagnostik, t-Test: t (26) = -1,239; p > .05; Sechs-MonatsNachuntersuchung, t-Test: t (18) = 0,756; p > .05). Auch innerhalb der beiden Behandlungsgruppen veränderte sich die Anzahl der Medikamententypen nicht signifikant über die Zeit (NET, t-Test: t (25) = -0,217; p > .05; SIT, t-Test: t (21) = 0,404; p > .05). Die Probanden berichteten anhand der Liste zur Erfassung traumatischer Erlebnisse im PTSD-Fragebogen CAPS von 9,71 (4 - 18) verschiedenen Arten traumatischer Erlebnisse. In der NET-Gruppe waren es im Mittel 10 (5 - 18), in der SITGruppe 9,38 (4 - 14) verschiedene Erlebnis-Typen. Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Behandlungsgruppen (Bonferroni-HolmKorrektur des Signifikanzniveaus: α = .0028; t-Test: t (26) = -0,496; p > .0028). Zu Erfahrungen organisierter Gewalt befragt, berichteten über 70 % der Probanden, einmal oder mehrfach in Haft gewesen zu sein. Weitere Beispiele organisierter Gewalt waren das Miterleben von gewaltsamen Hausdurchsuchungen (über 70 %), von Verletzungen oder Tötung anderer Personen (über 70 %), der Anblick von Verstümmelungen oder Leichen (über 60 %) sowie das Erleben von kollektiven Bestrafungsaktionen (über 50 %) und bewaffneten Kampfhandlungen (über 40 %). Von Foltererfahrungen berichteten 76 % der Probanden. Die am häufigsten genannten Misshandlungsmethoden waren Schläge oder Tritte auf den Körper, Beleidigungen durch Polizeibeamte o. ä., sowie Todesdrohungen und Schläge auf den Kopf. Eine Auflistung aller Foltermethoden, die die Probanden angaben, findet sich in Tabelle 3, geordnet nach ihrer Auftretenshäufigkeit. In Tabelle 4 sind die Foltermethoden für die Probanden der NET- und SIT-Gruppen getrennt angegeben. Sie sind in derselben Reihenfolge aufgeführt wie in der Tabelle für die Gesamtstichprobe. Einige Probanden nannten zusätzlich zu den in der Tabelle aufgeführten spezielle Foltermethoden oder belastende Erlebnisse während der Inhaftierung, die sie 121 2.2 Versuchspersonen 2 METHODEN erlebt hatten und die nicht im Fragebogen vorkommen. Dazu gehörten unter anderem Bedrohung durch Schäferhunde, Ziehen der Zehennägel, Teilnahme an einem Hungerstreik und Verbrennungen, die dem Betroffenen durch Mithäftlinge zugefügt worden waren. Knapp 40 % der Probanden gaben an, heute noch sichtbare Narben oder andere Zeichen von Verletzungen zu haben, die von den Folterungen herrührten. Tabelle 2: Medikamenteneinnahme bei Erstuntersuchung Gesamt NET SIT Vergleich NET – SIT Schmerzmittel 53,6 % 66,7 % 30,8 % n.s.a Antidepressiva 42,9 % 53,3 % 23,1 % n.s.a Schlafmittel 35,7 % 33,3 % 30,8 % n.s.b Neuroleptika 32,1 % 20 % 38,5 % n.s.b Magenpräparate 10,7 % 20 % – n.s.b Benzodiazepine 7,1 % 6,7 % 7,7 % n.s.b Antimanika 3,6 % 6,7 % – n.s.b Blutdruckpräparate 3,6 % – 7,7 % n.s.b sonstiges 21,4 % 20 % 23,1 % n.s.b a Chi-Quadrat-Test b Exakter Test nach Fisher Die Probanden der SIT- und NET-Bedingungen unterschieden sich bezüglich aller erfragten Foltermethoden nicht signifikant in der Erlebnishäufigkeit (Bonferroni-Holm-Korrektur des Signifikanzniveaus: α = .0016; Exakter Test nach Fisher: p > .0016). Die Foltererlebnisse und sonstigen Erfahrungen organisierter Gewalt wurden mithilfe des „vivo Haft-, Kriegs- und Folterereignisfragebogen“ (siehe „2.6.1 Fragebögen“) erfasst. Die Probanden der Gesamtstichprobe gaben an, im Mittel 25,26 122 2.2 Versuchspersonen 2 METHODEN Tabelle 3: Foltermethoden nach Häufigkeit (Gesamtstichprobe) Foltermethode Schläge oder Tritte auf Körper Beleidigungen durch Polizei o. ä. Todesdrohung Schläge oder Tritte auf den Kopf erzwungene Nacktheit Androhung weiterer Folter Drohung gegen die Familie Mitanhören von Folter anderer mehrere Stunden gefesselt sein zuwenig zu essen bekommen Ziehen an Haaren / Koteletten Verbinden der Augen Isolation über mehrere Tage Androhung von Vergewaltigung Würgen / am Atmen hindern Anfassen der Genitalien Schläge oder Tritte der Genitalien zuwenig zu trinken bekommen Verhinderung der Körperhygiene extreme Hitze oder Kälte Schläge auf die Fußsohlen Quetschen der Genitalien in schmerzhafter Position stehen Vorenthalten ärztlicher Hilfe Scheinhinrichtungen Verhindern des Schlafs kleine oder überfüllte Zelle Verhindern des Toilettengangs Mitansehen von Folter anderer abwechselnd Grobheit & Milde Vergewaltigung Elektroschocks an Seil oder Kette aufhängen Untertauchen in Flüssigkeit Abspritzen mit kaltem Wasser gezwungen, andere zu foltern ja nein keine Angabe* 85,7 % 82,1 % 78,6 % 78,6 % 67,9 % 64,3 % 60,7 % 60,7 % 57,1 % 57,1 % 57,1 % 53,6 % 53,6 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 46,4 % 42,9 % 42,9 % 42,9 % 42,9 % 42,9 % 39,3 % 35,7 % 35,7 % 35,7 % 28,6 % 25,0 % 21,4 % 21,4 % 14,3 % 14,3 % 10,7 % 3,6 % 3,6 % 10,7 % 10,7 % 21,4 % 21,4 % 28,6 % 25,0 % 28,6 % 28,6 % 21,4 % 32,1 % 32,1 % 35,7 % 35,7 % 39,3 % 35,7 % 35,7 % 35,7 % 35,7 % 46,4 % 42,9 % 42,9 % 42,9 % 42,9 % 46,4 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % 57,1 % 64,3 % 64,3 % 64,3 % 67,9 % 71,4 % 85,7 % 10,7 % 14,3 % 10,7 % 10,7 % 10,7 % 14,3 % 10,7 % 14,3 % 10,7 % 14,3 % 21,4 % 14,3 % 14,3 % 14,3 % 14,3 % 10,7 % 14,3 % 14,3 % 14,3 % 17,9 % 10,7 % 14,3 % 14,3 % 14,3 % 14,3 % 14,3 % 14,3 % 14,3 % 14,3 % 14,3 % 10,7 % 14,3 % 14,3 % 17,9 % 14,3 % 14,3 % * entweder nicht in Haft gewesen, so dass der größte Teil der Symptomcheckliste gar nicht abgefragt wurde, Abbruch der Fragen nach Foltererfahrungen aufgrund zu hoher Belastung des Probanden oder einzelne fehlende Angaben 123 2.2 Versuchspersonen 2 METHODEN Tabelle 4: Foltermethoden für NET und SIT getrennt Foltermethode NET ja % nein Schläge oder Tritte auf Körper Beleidigungen durch Polizei o. ä. Todesdrohung Schläge oder Tritte auf den Kopf erzwungene Nacktheit Androhung weiterer Folter Drohung gegen die Familie Mitanhören von Folter anderer mehrere Stunden gefesselt sein zuwenig zu essen bekommen Ziehen an Haaren / Koteletten Verbinden der Augen Isolation über mehrere Tage Androhung von Vergewaltigung Würgen / am Atmen hindern Anfassen der Genitalien Schläge oder Tritte der Genitalien zuwenig zu trinken bekommen Verhinderung der Körperhygiene extreme Hitze oder Kälte Schläge auf die Fußsohlen Quetschen der Genitalien in schmerzhafter Position stehen Vorenthalten ärztlicher Hilfe Scheinhinrichtungen Verhindern des Schlafs kleine oder überfüllte Zelle Verhindern des Toilettengangs Mitansehen von Folter anderer abwechselnd Grobheit & Milde Vergewaltigung Elektroschocks an Seil oder Kette aufhängen Untertauchen in Flüssigkeit Abspritzen mit kaltem Wasser gezwungen, andere zu foltern 80,0 80,0 66,7 73,3 46,7 60,0 53,3 46,7 53,3 46,7 46,7 60,0 53,3 40,0 40,0 33,3 40,0 40,0 53,3 46,7 40,0 33,3 40,0 40,0 33,3 26,7 26,7 46,7 13,3 26,7 20,0 20,0 13,3 13,3 13,3 – 6,7 6,7 20 13,3 40,0 26,7 33,3 40,0 33,3 40,0 26,7 26,7 33,3 46,7 46,7 53,3 40,0 46,7 33,3 33,3 46,7 53,3 46,6 46,7 53,3 60,0 60,0 40,0 73,3 60,0 66,7 66,7 73,3 73,3 73,3 86,7 keine Angabe* 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 26,7 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 20,0 13,3 13,3 20,0 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 SIT ja % nein 92,3 84,6 92,3 84,6 92,3 69,2 69,2 76,9 61,5 69,2 69,2 46,2 53,8 61,5 61,5 69,2 61,5 61,5 46,2 46,2 46,2 53,8 46,2 46,2 53,8 53,8 46,2 23,1 61,5 30,8 30,8 23,1 30,8 15,4 15,4 – – – – 7,7 – 15,4 23,1 7,7 23,1 15,4 15,4 38,5 30,8 23,1 23,1 23,1 30,8 23,1 38,5 38,5 46,2 30,8 38,5 38,5 30,8 30,8 38,5 61,5 23,1 53,8 61,5 61,5 53,8 61,5 69,2 84,6 keine Angabe* 7,7 15,4 7,7 7,7 7,7 15,4 7,7 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 7,7 7,7 15,4 15,4 15,4 7,7 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 7,7 15,4 15,4 23,1 15,4 15,4 * entweder nicht in Haft gewesen, so dass der größte Teil der Symptomcheckliste gar nicht abgefragt wurde, Abbruch der Fragen nach Foltererfahrungen aufgrund zu hoher Belastung des Probanden oder einzelne fehlende Angaben 124 2.3 Therapeuten 2 METHODEN verschiedene solche Erfahrungen gemacht zu haben (SD = 9,99; Minimum 8, Maximum 40). Allerdings lagen zum Zeitpunkt der Erstdiagnostik von fünf Probanden keine vollständigen Angaben im Fragebogen vor, so dass sich die berichteten Werte auf die Aussagen der restlichen 23 Probanden beziehen. Betrachtet man die NET- und SIT-Gruppe getrennt, so zeigt sich, dass die Teilnehmer der SIT-Gruppe (n = 12) im Durchschnitt 28,58 Erlebnistypen berichteten (SD = 9,46; Minimum 9, Maximum 40), während es in der NET-Gruppe (n = 11) durchschnittlich 21,64 waren (SD = 9,67; Minimum 8, Maximum 33). Die Probanden der beiden Therapiegruppen unterschieden sich nicht signifikant in der Anzahl der Gewalterlebnisse (t-Test: t (21) = 1,74; p > .05). 2.3 Therapeuten Die Therapiesitzungen wurden von geschulten Therapeuten der Psychologischen Forschungs- und Modellambulanz für Flüchtlinge der Universität Konstanz durchgeführt. Es fand eine Team-Supervision statt, in der die einzelnen Behandlungsfälle diskutiert werden konnten. Sowohl die NET als auch das SIT wurden meistens zu zweit durchgeführt, wobei der zweite Therapeut in manchen Fällen eher die Rolle eines Co-Therapeuten innehatte. In anderen Fällen teilten sich beide Behandler die Verantwortung für die Therapie auf. In jedem Fall war ein geschulter Traumatherapeut mit abgeschlossener Hochschulausbildung, zumeist Diplom-Psychologe, involviert. In der Regel führte derjenige Therapeut, der die Behandlung eines Klienten übernehmen sollte, auch die Erstdiagnostik durch. Alle Behandler, die nicht ausschließlich eine Co-Therapeuten-Rolle innehatten, waren sowohl in NET- als auch in SIT-Behandlungen involviert, um einen Therapeuteneffekt zu vermeiden – jeder von ihnen war im Mittel an 1,5 NET- und SIT-Behandlungen beteiligt. Als „reine“ Co-Therapeuten bzw. Hospitanten fungierten gelegentlich auch Studenten der Psychologie im Rahmen eines Traumatherapie-Trainings. 2.4 Dolmetscher Die Dolmetscher waren zumeist Personen, bei denen die jeweilige Fremdsprache die Muttersprache war und die selbst nach Deutschland eingewandert waren. Es handelte sich bei den meisten nicht um staatlich geprüfte Dolmetscher. Sie wurden zu Beginn ihrer Tätigkeit ausführlich über die Anforderungen, Inhalte und Belastungen der Tätigkeit in der Psychologischen Forschungs- und Modellambulanz für Flüchtlinge informiert. Außerdem unterschrieben sie Schweigepflichterklärungen. Die Dolmetscher hatten im Anschluss an diagnostische oder Therapiesitzungen die 125 2.5 Ablauf der Therapiestudie 2 METHODEN Möglichkeit, mit dem Untersuchungsleiter bzw. Therapeuten zu sprechen, wenn sie das wünschten. Sie erhielten ein Honorar für ihre Dolmetschertätigkeit. 2.5 Ablauf der Therapiestudie Die Probanden, die für die Teilnahme an der Therapiestudie angemeldet worden waren, wurden einander paarweise nach Geschlecht, Herkunftsland (eindeutig zugeordnet für die kurdischen Teilnehmer aus der Türkei, gröber eingeteilt bei denjenigen aus der Balkanregion und aus Afrika) und ähnlichem Alter zugeordnet. Für jedes Patientenpaar wurde mithilfe einer Münze ausgelost, wer von beiden in die NET- und in die SIT-Bedingung eingeteilt wurde. Da sich erst mit der Erstuntersuchung zeigte, ob ein Proband die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Studie erfüllte, wurden die Paare teilweise neu gebildet, wenn eine Versuchsperson von der Teilnahme ausgeschlossen worden war. Im Verlauf der Studie stellte sich bei einer Zwischenanalyse heraus, dass die Probanden in der NET-Bedingung per Zufall tendenziell eine höhere Ausgangssymptomatik aufwiesen als diejenigen in der SIT-Bedingung. Der Unterschied war zwar zu diesem Zeitpunkt nicht signifikant, jedoch hätte er bei weiteren NETPatienten mit stärkerer oder SIT-Patienten mit schwächerer PTSD-Symptomatik Signifikanz erreichen können. Um dies zu verhindern, wurde bei den jeweils letzten zwei männlichen und weiblichen Versuchspersonen für die SIT-Gruppe darauf geachtet, dass sie im Fragebogen „Clinician Administered PTSD Scale“ (CAPS, siehe „2.6.1 Fragebögen“) einen Gesamtwert von mindestens 90 aufwiesen. Innerhalb von vier Wochen nach der Erstdiagnostik wurde mit der jeweiligen Behandlung begonnen. Sollte dies ausnahmsweise nicht möglich gewesen sein, wurde vor Therapiebeginn erneut geprüft, ob immer noch eine PTSD-Symptomatik vorlag. Zur Erfassung des Therapieerfolgs waren vier Wochen, sechs Monate und ein Jahr nach Therapieende zu Nachuntersuchungen geplant. Die erste Nachuntersuchung fand jedoch durchschnittlich fünf Wochen nach Beendigung der Behandlung statt. Die Halbjahres-Nachuntersuchung fand wie geplant im Schnitt sechs Monate, die Jahresuntersuchung zwölf Monate nach Therapieende statt. Diese Untersuchungen wurden jeweils von einem Mitarbeiter durchgeführt, der den zu befragenden Patienten zuvor noch nicht untersucht oder behandelt hatte. Da sowohl die Behandlungen als auch die Nachuntersuchungen von Mitarbeitern innerhalb der Arbeitsgruppe Psychotraumatologie vorgenommen wurden, waren die Nachuntersucher in der Regel nicht unwissend gegenüber der Therapiebedingung des 126 2.5 Ablauf der Therapiestudie 2 METHODEN Ablauf der Studie: Patientenzahlen N = 28 NET Aufnahme in die Studie n = 15 h n. ruc Abb SIT n = 13 zg. 1 Sit 2 13 uch abbr rapie The 1 THERAPIE 13 The 12 -------------------Therapieende 1 abbr uch 2 11 kein . ch-U Na e 1. kein 1 rapie e Na 11 4-WochenNachuntersuchung ch-U . 1 10 1 nur 1. N a ch-U . 1 12 6-Monats-Nachuntersuchung 10 U. ach- nur N .+2. 3 1 nur 7 ------1* 1-Jahres-Nachuntersuchung 1.+2 . Na 4 ------3* * 1-Jahres-Nachuntersuchung steht noch aus Abbildung 4: Flussdiagramm Therapiestudie 127 ch-U . 2 2.5 Ablauf der Therapiestudie 2 METHODEN Patienten. Zu Beginn jeder Untersuchung wurde der Patient über das Vorgehen aufgeklärt und unterzeichnete eine Einverständniserklärung. Es erfüllten 28 Personen die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Therapiestudie (siehe Abbildung 4). Davon begannen 15 eine NET und 13 ein SIT. Bei zwei NET-Patientinnen konnte die Behandlung bereits nach der ersten bzw. zweiten Therapiesitzung nicht fortgeführt werden, da sie aufgrund akuter Suizidalität in stationäre psychiatrische Behandlung kamen. Zwei Patienten aus der SITBedingung brachen die laufende Therapie nach fünf bzw. acht Sitzungen ab (sie nahmen die Sitzungen nicht mehr regelmäßig wahr und zeigten eine sinkende Therapiemotivation), eine Patientin aus der NET-Bedingung nach vier Sitzungen (u. a. aufgrund von Schwierigkeiten im Asylverfahren, die sie zwangen, vorübergehend unterzutauchen). Von demjenigen der SIT-Patienten, der acht Sitzungen erhalten hatte, liegt dennoch eine Sechs-Monats-Nachuntersuchung mit verkürztem Untersuchungsset vor6 . Es wurden also bei zwölf NET- und elf SIT-Patienten die Behandlungen zu Ende durchgeführt. Die Gesamtrate an Abbrüchen während der Therapie beträgt 17,9 %, für die NET-Gruppe 20 % und die SIT-Gruppe 15,4 % (kein signifikanter Unterschied zwischen der NET- und der SIT-Bedingung). Hinsichtlich aller bereits unter 2.2.3 („Beschreibung der Stichprobe“) aufgeführten soziodemografischen Variablen unterschieden die Abbrecher sich nicht signifikant von den übrigen Patienten. Auch bezüglich Foltererfahrungen gab es keine signifikanten Unterschiede (Bonferroni-Holm-Korrektur des Signifikanzniveaus: α = .0016; Exakter Test nach Fisher: p < .0016). Von denjenigen, die die Therapie zu Ende geführt hatten, konnte bei einer Patientin aus der SIT-Bedingung keine der Nachuntersuchungen vorgenommen werden, da sie vorher in ihr Herkunftsland Serbien abgeschoben worden war. Ein weiterer Patient, der eine NET erhalten hatte, reiste im Anschluss an die Therapie freiwillig in sein Herkunftsland Türkei zurück. Von ihm konnte keine VierWochen-Nachuntersuchung erhoben werden. Er wurde jedoch zur Sechs-MonatsNachuntersuchung von einem unserer Mitarbeiter in der Türkei aufgesucht und interviewt, allerdings mit verkürztem Untersuchungsset (siehe Fußnote auf dieser Seite). Von einem Patienten aus der SIT-Gruppe wurde lediglich die Vier-WochenNachuntersuchung durchgeführt: Er kam im Anschluss ins Gefängnis. Fünf Patienten beendeten ihre Teilnahme an der Studie nach der Sechs-MonatsNachuntersuchung. Von ihnen liegen also lediglich die Daten aus den ersten bei6 Es wurde hier lediglich die PTSD- und Depressivitätssymptomatik erhoben, weitere Angaben z. B. zu Medikamenten oder komorbiden Erkrankungen liegen nicht vor. 128 2.6 Diagnostische Untersuchungen 2 METHODEN den Nachuntersuchungen vor. Es handelte sich um einen Patienten und eine Patientin aus der SIT-Bedingung sowie zwei Patientinnen aus der NET-Bedingung. Dem männlichen SIT-Patienten wurde im Anschluss an die Sechs-Monats-Nachuntersuchung aufgrund seiner unveränderten psychischen Verfassung und seines hohen Leidensdrucks eine NET angeboten – das Angebot einer weiteren Behandlung wurde allen Personen, die zum Zeitpunkt sechs Monate nach Ende der Therapie eine unverändert hohe PTSD-Symptomatik sowie hohen Leidensdruck aufwiesen, gemacht. Sie sollten jeweils die Therapieform erhalten, an der sie zuvor noch nicht teilgenommen hatten. Dieses Angebot wurde bis zum Zeitpunkt der Datenanalyse drei Patienten gemacht, einer davon nahm es an (wie oben berichtet). Daten aus der Ein-Jahres-Nachuntersuchung dieses Klienten wurden für die Analysen nicht mehr berücksichtigt, da eventuelle Veränderungen nicht mehr eindeutig dem Einfluss von NET oder SIT zuordenbar gewesen wären. Die übrigen genannten Patientinnen gaben andere Gründen dafür an, dass sie nicht an der EinJahres-Nachuntersuchung teilnahmen (z. B. wegen Zeitmangels bzw. fehlender Gelegenheit, für das Interview Urlaub zu bekommen). Mit elf Patienten konnten bis zum Zeitpunkt der Datenauswertung alle drei Nachuntersuchungen planmäßig durchgeführt werden (sieben aus der NET- und vier aus der SIT-Bedingung). Bei weiteren vier Patienten wurden bis zum Zeitpunkt der Datenanalyse die Vier-Wochen- und die Sechs-Monats-Nachuntersuchungen durchgeführt, die Ein-Jahres-Nachuntersuchung steht noch aus. 2.6 Diagnostische Untersuchungen Die Erst-Diagnostik wurde in der Regel von demjenigen Mitarbeiter durchgeführt, der später die Behandlung durchführte, sofern beim jeweiligen Probanden die Aufnahmekriterien erfüllt waren. Bei Bedarf wurde ein Dolmetscher einbestellt, der in der Regel auch für eine nachfolgende Therapie zur Verfügung stand. Zu Beginn der Untersuchung wurde der Patient über das Vorgehen aufgeklärt und unterzeichnete eine Einverständniserklärung. Am Ende der Erst-Diagnostik wurde mit dem Patienten besprochen, ob er die Eingangsvoraussetzungen für die Aufnahme in die Therapiestudie erfüllte. Falls ja, wurde er über das Prozedere der Studie aufgeklärt und gefragt, ob er Interesse an einer Teilnahme habe. Wenn die Aufnahmekriterien nicht erfüllt waren, wurden ggf. gemeinsam mit der ehrenamtlichen Begleitperson weitere Behandlungsoptionen z. B. bei niedergelassenen Psychotherapeuten geplant oder besprochen, ob bestehende Behandlungen ausreichend erschienen. 129 2.6 Diagnostische Untersuchungen 2 METHODEN Das Prozedere der Erstdiagnostik entsprach dem der Halbjahresnachuntersuchung. Zu den Zeitpunkten vier Wochen und ein Jahr nach Ende der Therapie wurde eine verkürzte Variante des Interview durchgeführt, d. h. das ScreeningInstrument M.I.N.I. wurde nicht angewendet, und es fand darüber hinaus keine Magnetenzephalographie-Messung statt (siehe „2.6.2 Die MagnetenzephalographieMessung (MEG)“). Im Folgenden werden die verwendeten Fragebögen kurz beschrieben. 2.6.1 Fragebögen Zur Erfassung der soziodemografischen Daten wurde ein Fragebogen verwendet, der für das typische Klientel der Psychologischen Forschungs- und Modellambulanz für Flüchtlinge entwickelt wurde. Es wurden neben Namen und Anschrift der Patienten deren Alter, Wohnsituation (Flüchtlingswohnheim oder Mietwohnung), Herkunftsland und Geburtsort, Familienstand und Anzahl der Kinder, Ausbildungszeiten, Zeitpunkt der Einwanderung nach Deutschland und der aktuelle Asylstatus erfragt. Weiterhin erfasst der Fragebogen Medikamenteneinnahme, Teilnahme an Psychotherapie sowie psychische und körperliche Probleme vor und nach dem Trauma sowie psychische Auffälligkeiten in der Herkunftsfamilie und Krankenhausaufenthalte des Probanden. Zur Diagnosestellung und Einschätzung des Schweregrades der PTSD wurde die deutsche Version der „Clinician Administered PTSD Scale“ (CAPS) von Blake, Weathers, Nagy, Kaloupek, Klauminzer, Charney, Keane und Buckley (1995) angewendet (nicht validierte deutsche Version: Karl, 2000). Die CAPS ist ein halbstrukturiertes Interview und erfasst Häufigkeit und Schwere von PTSD- und Begleitsymptomen wahlweise in der letzten Woche oder den letzten vier Wochen, auch eine Lebenszeit-Diagnose ist möglich. In einer Liste traumatischer Erfahrungen werden standardmäßig 17 verschiedene Erlebnis-Typen abgefragt. Eine zusätzliche Kategorie, in der speziell nach Foltererlebnissen gefragt wird, wurde für die hier befragte Klientel ergänzt, so dass die Liste nun 18 Erlebnistypen umfasst. Es wird für jedes Symptom sowohl eine Häufigkeits- als auch eine SchweregradEinschätzung von je 0 bis 4 vergeben. Der höchstmögliche Summenwert ist 136. Das von den Autoren ursprünglich vorgeschlagene Beurteilungskriterium eines Symptoms als klinisch relevant fordert eine Symptomhäufigkeit von mindestens 1 und einen Schweregrad von mindestens 2 (Weathers, Ruscio & Keane, 1999). Dieses Beurteilungsmuster wurde bezogen auf die letzten vier Wochen auch in der vorliegenden Arbeit eingesetzt. Die Diagnose einer PTSD wurde anhand der Vorgaben 130 2.6 Diagnostische Untersuchungen 2 METHODEN im DSM-IV (American Psychiatric Association, 1996) dann gestellt, wenn zusätzlich zum Vorliegen mindestens eines objektiv und subjektiv traumatischen Erlebnisses (Kriterium A) mindestens ein Symptom aus dem Bereich „Intrusionen“ (Kriterium B), mindestens drei Symptome aus dem Bereich „Vermeidung“ (Kriterium C) und mindestens zwei Symptome aus dem Bereich „Übererregung“ (Kriterium D) klinisch signifikant waren und der Patient von Funktionsbeeinträchtigungen aufgrund der Symptomatik berichtete (Kriterium F). Hinsichtlich der Gütekriterien (Interrater- und Retest-Reliabilität, interne Konsistenz, Validität) wurde die CAPS durchgehend als zuverlässiges Instrument zur Erfassung der PTSD-Symptomatik in verschiedenen Traumapopulationen beurteilt (Blake et al., 1995). Für detaillierte Informationen über das Erleben organisierter Gewalt zusätzlich zur Ereignisliste im Fragebogen CAPS wurde der „vivo Haft-, Kriegs- und Folterereignisfragebogen“ (?) eingesetzt. Zu verschiedenen Untersuchungszeitpunkten eingesetzt, zeigte er bezüglich der Liste von Foltererlebnissen bei Gotthardt (2007) eine Retest-Reliabilität von rtt = .808 (p < .001). Zur Erfassung des Ausmaßes depressiver Symptome wurde die „Hamilton Depression Scale“ (HAM-D, Hamilton, 1960 und 1967) eingesetzt. Mithilfe der HAMD beurteilt der Kliniker anhand von Informationen des Patienten im Interview den Schweregrad von Depressions- und komorbiden Angstsymptomen. Hamilton macht keine Angaben zur Auswertung z. B. hinsichtlich milder, mittelschwerer oder schwerer depressiver Symptome, jedoch verwenden manche Kliniker Richtwerte zur Einschätzung, denen vermutlich eine empirische Basis fehlt (z. B. Deutsche Zentrale für biologische Information, oJ http://www.biologie.de/biowiki/ HAMD, o. J.: 15 bis 18 Punkte = milde bis mittelschwere Depression, > 25 Punkte = schwere Depression). Das „Mini International Neuropsychiatric Interview“ (M.I.N.I.) von Sheehan, Lecrubier, Sheehan, Amorim, Janavs, Weiller, Hergueta, Baker und Dunbar (1998) wurde zur Erfassung möglicher weiterer vorliegender psychischer Störungen sowie zur Einschätzung der Suizidalität verwendet. Das M.I.N.I. ist ein kurzes, strukturiertes Screening-Instrument, mithilfe dessen das Vorhandensein einer Störung7 , nicht jedoch ihre Ausprägung festgestellt werden kann. Hinsichtlich der Gütekriterien für Fragebögen erreichte das M.I.N.I. durchgehend positive Beurteilungen (Sheehan et al., 1998). 7 Das M.I.N.I. erlaubt die Diagnosestellung folgender psychischer Störungen: Major Depression, Dysthymia, Suizidalität, Manie, Panikstörung, Agoraphobie, soziale und spezifische Phobien, Zwangsstörung, generalisierte Angststörung, Alkohol- oder Drogenmissbrauch bzw. -abhängigkeit, psychotische Störungen, Essstörungen sowie antisoziale Persönlichkeitsstörung. 131 2.7 Durchführung der Narrativen Expositionstherapie 2.6.2 2 METHODEN Die Magnetenzephalographie-Messung (MEG) Zusätzlich zum diagnostischen Interview wurde bei den meisten Probanden8 zum Erstuntersuchungszeitpunkt und zur Halbjahres-Nachuntersuchung eine Messung der magnetischen Gehirnaktivität mittels eines Ganz-Kopf-Neuromagnetometers (MAGNESTM 2500 WH, 4D Neuroimaging, San Diego, USA) vorgenommen. Dabei wurde zunächst die Hirnaktivität während fünf Minuten unter Ruhebedingungen abgeleitet mit dem Ziel der Identifikation eventueller funktioneller Gehirnanomalien durch fokale langsame Wellen (ASWAM – Abnormal Slow Wave Mapping). Dieses Verfahren ermöglicht die Diskrimination zwischen Patientengruppen mit psychiatrischen Diagnosen wie z. B. PTSD und Kontrollprobanden durch die Identifikation gruppenspezifischer Foci von Delta- und Thetaaktivität (Wienbruch, 2007; Kolassa, Wienbruch, Neuner, Schauer, Ruf, Odenwald & Elbert, submitted 2007). Im Anschluss daran wurde affektives Material, das hinsichtlich der emotionalen Valenz abgestuft war (Bilder aus dem International Affective Picture System, IAPS), zur Messung der individuellen neurophysiologischen Antwort dargeboten. Während der MEG-Untersuchung wurden die Herzfrequenz mittels EKG und die Augenbewegungen mittels EOG aufgezeichnet. Die Ergebnisse dieser Magnetenzephalographie-Messungen sind in dieser Arbeit nicht dargestellt. Deshalb wird an dieser Stelle auf eine ausführlichere Beschreibung verzichtet. 2.7 Durchführung der Narrativen Expositionstherapie (NET) Das allgemeine Prinzip der Narrativen Expositionstherapie (NET) ist unter 1.5.2 aufgeführt. In der hier beschriebenen Studie waren zehn Therapiesitzungen à ungefähr 90 Minuten vorgesehen. Die Sitzungsdauer wurde nicht systematisch aufgezeichnet. Jedoch zeigte sich anhand der Videoaufnahmen, dass eine NET-Sitzung meist 90 Minuten oder länger dauerte. In Einzelfällen ergab sich die Notwendigkeit, einen Klienten auch über die zehn Sitzungen hinaus noch zu weiteren Terminen einzubestellen. Im Durchschnitt erhielten diejenigen NET-Klienten, die an der kompletten Therapie teilnahmen, 10,75 Sitzungen (SD = 1,215). Hierbei unterschieden sie sich nicht von den SIT-Klienten. Als ideal wurde eine wöchentliche oder 14-tägige Sitzungsfrequenz angesehen. Die NET-Sitzungen fanden durchschnittlich im Abstand von 9,82 Tagen statt (SD = 3,55; Min 4, Max 16). Auch diesbezüglich bestanden keine Unterschiede zwischen der SIT- und NET-Bedingung. Die 8 Gründe für den Wegfall der MEG-Messung bzw. für die Beschränkung auf die ASWA-Messung waren z. B. zu hohe Belastung des Patienten, Zeitmangel etc. 132 2.8 Durchführung des Stress-Impfungs-Trainings 2 METHODEN erste Sitzung beinhaltete eine ausführliche Psychoedukation über die Symptomatik einer posttraumatischen Belastungsstörung sowie über die geplante Therapie. Dem Klienten wurde die Einverständniserklärung für die Teilnahme an der Narrativen Expositionstherapie ausgehändigt bzw. vorgelesen und Fragen dazu beantwortet. Im Anschluss wurde anhand der „lifeline“ (siehe Seite 90) die Lebensgeschichte des Klienten veranschaulicht, und es wurden gemeinsam so genannte „hot spots“ (Ereignisse oder Elemente von Ereignissen, die den Klienten am meisten belasten) identifiziert, auf die ein besonderer Fokus in der Therapie gelegt werden sollte. In den weiteren Sitzungen wurde detailliert die Lebensgeschichte durchgesprochen. Dabei wurde explizit und besonders ausführlich bei den traumatischen Ereignissen verweilt. Dies wurde solange wiederholt, bis der Klient dabei keine Angstreaktion mehr zeigte. Die Geschichte wurde im Laufe der Therapie aufgeschrieben, so dass am Ende die Narration des Lebens des Klienten vorlag. Diese wurde in der letzten Sitzung von allen Beteiligten (Klient, Dolmetscher, Therapeut, ggf. Co-Therapeut) unterzeichnet und dem Klienten ausgehändigt. Es wurde betont, dass der Patient nun selbst entscheiden könne, was er mit dem Dokument tun wolle. 2.8 Durchführung des Stress-Impfungs-Trainings (SIT) Das allgemeine Prinzip des Stress-Impfungs-Trainings ist unter 1.5.3 aufgeführt. Es waren in der hier beschriebenen Studie ebenso wie in der NET-Bedingung zehn Therapiesitzungen à ungefähr 90 Minuten vorgesehen. Es zeigte sich anhand der Videoaufnahmen, dass eine SIT-Sitzung meist nicht länger als 90 Minuten dauerte. In Einzelfällen ergab sich auch in der SIT-Gruppe die Notwendigkeit, einen Klienten auch über die zehn Sitzungen hinaus noch zu weiteren Terminen einzubestellen. Im Durchschnitt erhielten diejenigen SIT-Klienten, die bis zum Ende an der Therapie teilnahmen, 10,36 Sitzungen (SD = 0,809). Wie unter 2.7 bereits angeführt, bestand diesbezüglich kein Unterschied zur NET-Bedingung. Als ideal wurde auch für das SIT eine wöchentliche oder 14-tägige Sitzungsfrequenz angesehen. Durchschnittlich erhielten die SIT-Klienten im Abstand von 9,89 Tagen eine Therapiesitzung (SD = 3,28; Min 4, Max 17), ebenfalls nicht verschieden vom Sitzungsabstand in der NET-Bedingung. In der ersten Sitzung fand eine ausführliche Psychoedukation über die Symptomatik einer posttraumatischen Belastungsstörung sowie über die geplante Therapie statt. Dem Klienten wurde die Einverständniserklärung für die Teilnahme am Stress-Impfungs-Training ausgehändigt bzw. vorgelesen und Fragen dazu beantwortet. Im Anschluss daran berichtete der Klient zunächst frei über derzeitig relevante Probleme. Dann wurden aktuelle traumabezogene Stresso- 133 2.9 Datenanalyse 2 METHODEN ren sowie Alltagsstressoren erfragt. Auch Ressourcen des Klienten wurden erfasst. In den weiteren Sitzungen wurden verschiedene Angst- bzw. Stressbewältigungsstrategien eingeführt. Auf körperlicher Ebene wurden dem Klienten Atemtraining (Bauchatmung, Betonung der Wichtigkeit des langsamen Ausatmens) und Progressive Muskelentspannung beigebracht. Auf kognitiver Ebene wurde die Technik des Gedankenstopps vermittelt, die es dem Klienten ermöglichen sollte, Grübeln zu unterbrechen. Des Weiteren wurde Kognitive Umstrukturierung eingesetzt, d. h. der Patient sollte lernen, schwierige und ängstigende Situationen aus einer anderen Perspektive zu betrachten und den Realitätsgehalt seiner Befürchtungen kritisch zu überprüfen. Im Geleiteten Selbstdialog wurden ermutigende und hilfreiche Sätze erarbeitet, die der Klient auf selbst gewählte Postkarten mit schönen Motiven schrieb und zuhause immer wieder lesen sollte. Auf der Ebene des Verhaltens wurden Rollenspiele und Verdecktes Modeling (d. h. Imaginieren der erfolgreichen Bewältigung einer potenziell schwierigen Situation) eingesetzt. Die letzten Sitzungen waren zur Wiederholung der Bewältigungsstrategien nach Bedarf des Klienten vorgesehen. 2.9 Datenanalyse Die statistischen Analysen wurden mithilfe des Statistikprogramms SPSS® 11.04 für Mac OS X oder JMPTM 5.0.1.2 für Mac OS X durchgeführt. Alle Variablen wurden hinsichtlich ihrer Verteilung überprüft. In Abhängigkeit von der Verteilung und der jeweiligen Skalierung der Variablen wurden entweder parametrische oder nonparametrische Verfahren angewendet bzw. Produktmomentkorrelationen oder Rangkorrelationen berechnet. Unterschiede zwischen dichotomen Variablen wurden mit Hilfe von Chi-Quadrat-Vierfeldertafeln überprüft. Erwies sich eine der erwarteten Häufigkeiten als < 5, so wurde das Ergebnis des Exakten Tests nach Fisher berichtet. Generell wurde ein Signifikanzniveau von α = .05 angelegt. Bei Mehrfach-Vergleichen wurde in den Fällen, in denen signifikante Effekte mit p < .05 auftraten, eine Bonferroni-Holm-Korrektur des Signifikanzniveaus durchgeführt. Alle Daten, die zum Zeitpunkt der Ein-Jahres-Nachuntersuchung erhoben worden waren, werden zwar dargestellt, nicht in die Analysen einbezogen, da die Stichprobengröße zum Zeitpunkt der Datenauswertung noch zu gering war. Um die Veränderungen des PTSD- und Depressivitätsschweregrades über die Zeit und diesbezügliche Unterschiede zwischen den beiden Behandlungsbedingungen zu untersuchen, wurden für die intervallskalierten abhängigen Variablen 134 2.9 Datenanalyse 2 METHODEN gemischte Modelle berechnet. Die Patientenkennnummer ging als zufälliger Effekt in die Analysen ein. Feste Faktoren waren die Therapiebedingung (NET oder SIT) sowie der Untersuchungszeitpunkt (Erstdiagnostik bis Sechs-Monats-Nachuntersuchung). Als Post-hoc-Test wurde der Tukey-Test verwendet. Darüber hinaus wurden zur Überprüfung der Untersuchungshypothesen geplante Kontraste berechnet, sofern sich nicht bereits im Tukey-Test ohnehin die erwarteten Effekte zeigten. Es wurde eine „Intent to treat“-Analyse gerechnet, bei der sowohl die Daten aller 28 Patienten zum Zeitpunkt der Erstdiagnostik einbezogen wurden – unabhängig davon, ob sie die Therapie abgebrochen oder zu einem späteren Zeitpunkt aus der Studie ausgeschieden waren – als auch die Nachuntersuchungsdaten derjenigen Patienten, die die Behandlung abgebrochen hatten. Dies war lediglich bei einem Patienten aus der SIT-Bedingung der Fall, der nach acht Sitzungen aus der Behandlung ausschied. Es liegen bei diesem Patienten Daten aus der Erstdiagnostik sowie aus einer Untersuchung sechs Monate nach Therapieabbruch vor. In der Depressivitätsskala HAM-D fehlten in manchen Fällen einzelne Werte innerhalb einer Erhebung. Waren es nicht mehr als drei pro Versuchsperson und Zeitpunkt, wurde diese anhand des Mittelwertes der übrigen 19 bis 21 Werte geschätzt. Bei mehr als drei fehlenden Werten wurde die Erhebung aus den Analysen ausgeschlossen. Dies war lediglich bei einer Patientin in der Erstuntersuchung sowie bei einer weiteren Patientin in der Vier-Wochen-Nachuntersuchung der Fall. Für signifikante Therapieeffekte sowie für die Ergebnisse zu den gerichteten Hypothesen wurde die Effektstärke nach Cohen (d) berechnet. 135 3 3 ERGEBNISSE Ergebnisse 3.1 Zusammenhänge verschiedener Faktoren mit dem PTSD- und dem Depressivitäts-Schweregrad Es wurden mögliche Zusammenhänge von PTSD- und Depressivitäts-Schweregrad zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung mit verschiedenen Faktoren (z. B. einige soziodemografische Variablen) betrachtet. Dafür wurden Korrelationen zwischen den Ergebnissen der Fragebögen CAPS und HAM-D und den jeweiligen Faktoren berechnet. 3.1.1 Zusammenhänge verschiedener Faktoren mit dem CAPS-Score Es wurde erwartet, dass eine größere Anzahl verschiedener traumatischer Erlebnisse mit stärkerer PTSD-Symptomatik einhergeht. Dies zeigte sich in der untersuchten Stichprobe jedoch nicht: Es ergab sich für den Gesamtschweregrad im Fragebogen CAPS zum Zeitpunkt der Erstdiagnostik kein signifikanter Zusammenhang mit der Anzahl an verschiedenen Typen belastender Lebensereignisse (r = .102; p > .05). Auch zwischen der Anzahl der Gewalterlebnisse im „vivo Haft-, Kriegsund Folterereignisfragebogen“ und dem PTSD-Schweregrad im CAPS zum Zeitpunkt der Erstdiagnostik zeigte sich kein signifikanter Zusammenhang (r = -.196; p > .05). Zudem wurde explorativ betrachtet, inwieweit der PTSD-Schweregrad in der CAPS zum ersten Untersuchungszeitpunkt mit folgenden Faktoren im Zusammenhang stand: Alter, Geschlecht, Bildung, Jahre in Deutschland, Erwerbstätigkeit, Partnerschaft, Kinder, Therapie mit oder ohne Dolmetscher, frühere psychische Erkrankung, externe Psychotherapie und Anzahl verschiedener Medikamententypen. Außer einem schwachen negativen Zusammenhang zwischen dem Gesamtscore in der CAPS zum ersten Untersuchungszeitpunkt und dem Faktor „Kinder ja / nein“ (rs = -.47; p < .05) ergaben sich keine weiteren signifikanten Korrelationen. 3.1.2 Zusammenhang verschiedener Faktoren mit dem HAM-D-Score Es wurde explorativ untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Depressivitäts-Schweregrad in der HAM-D zum ersten Untersuchungszeitpunkt und der Anzahl erlebter Gewalterfahrungen gab. Es zeigten sich keine signifikanten Zusammenhänge zwischen der Depressivität und der Erfahrungs-Anzahl in der CAPS (r = .070; p > .05) oder im „vivo Haft-, Kriegs- und Folterereignisfragebogen“ (r = .-162; p > .05). 137 3.2 Posttraumatische Belastungsstörung 3 ERGEBNISSE Zudem wurde betrachtet, inwieweit Zusammenhänge der Depressivität mit folgenden Faktoren bestanden: Alter, Geschlecht, Bildung, Jahre in Deutschland, Erwerbstätigkeit, Partnerschaft, Kinder, Therapie mit oder ohne Dolmetscher, frühere psychische Erkrankung, externe Psychotherapie und Anzahl verschiedener Medikamententypen. Es wurden keinerlei signifikante Zusammenhänge gefunden. 3.2 Posttraumatische Belastungsstörung 3.2.1 Verzögerter Beginn und Chronizität Von einem der 28 Patienten, die zum Zeitpunkt der Erstdiagnostik in die Studie aufgenommen wurden, fehlten die Angaben zu Beginn und Dauer der PTSDSymptomatik. Daher werden im Folgenden die validen Prozentwerte angegeben. Lediglich bei 14,8 % der Probanden hatte die PTSD verzögert eingesetzt (Beginn der Symptomatik frühestens ein halbes Jahr nach dem traumatischen Erlebnis). Bei 96,3 % der Probanden bestand die PTSD länger als drei Monate, hatte also einen chronischen Verlauf. 3.2.2 Häufigkeit der Diagnose Entsprechend der Eingangsvoraussetzungen wiesen alle 28 Patienten zu Beginn der Behandlung die Diagnose einer PTSD auf. Zum Zeitpunkt der Vier-WochenNachuntersuchung wiesen noch 90 % der Patienten in der Gesamtstichprobe eine PTSD-Diagnose auf (von n = 21, ohne die Therapieabbrecher und diejenigen, bei denen aus anderen Gründen keine Nachuntersuchung durchgeführt werden konnte). Sechs Monate nach Therapieende waren es noch 82 % (von n = 22) – zu Patientenzahlen siehe auch „2.5 Ablauf der Therapiestudie“. Ein Jahr nach Therapieende wiesen 54 % (von n = 11) eine PTSD auf. Betrachtet man die Häufigkeit der PTSD-Diagnose unter Ausschluss der Therapieabbrecher nach Behandlungsgruppen getrennt, zeigt sich, dass noch 82 % der Patienten in der NET-Gruppe zum Zeitpunkt vier Wochen nach der Behandlung eine PTSD aufwiesen (von n = 11). Sechs Monate nach der Behandlung waren es 83 % (von n = 12). Bei der Ein-Jahres-Nachuntersuchung litten noch vier von sieben Patienten an einer PTSD (aufgrund der geringen Probandenzahl wird auf eine Prozentangabe verzichtet). In der SIT-Gruppe lag die PTSD-Rate vier Wochen nach der Therapie immer noch bei 100 % (von n = 10), sechs Monate nach Therapieende bei 80 % (von n = 10). Zur Ein-Jahres-Nachuntersuchung wiesen noch zwei von vier Patienten eine PTSD auf. Die Häufigkeitsangaben für eine PTSD-Diagnose in 138 3.2 Posttraumatische Belastungsstörung Häufigkeit PTSD-Diagnose 100 100% 100% 3 ERGEBNISSE 100% 83% 82% 80% NET 70 SIT 40 Erstdiagnostik 4 Wochen 6 Monate Untersuchungszeitpunkt Abbildung 5: Häufigkeit PTSD-Diagnose über die Zeit in beiden Behandlungsgruppen beiden Therapiegruppen von der Erstuntersuchung bis zur Sechs-Monats-Nachuntersuchung sind in Abbildung 5 grafisch dargestellt. Die Unterschiede in der PTSD-Häufigkeit zwischen der NET- und der SITGruppe zu den verschiedenen Zeitpunkten sind nicht signifikant (Exakter Test nach Fisher: p > .05). Die Reduktion der Auftretenshäufigkeit der PTSD-Diagnose erreichte für die Gesamtgruppe Signifikanz. Die Häufigkeit nahm zwischen den folgenden Untersuchungszeitpunkten signifikant ab: • zwischen Erstdiagnostik und Sechs-Monats-Nachuntersuchung (Exakter Test nach Fisher: p < .05) • zwischen der Vier-Wochen- und Ein-Jahres-Nachuntersuchung (Exakter Test nach Fisher: p < .05) • sowie zwischen Erstdiagnostik und Ein-Jahres-Nachuntersuchung (Exakter Test nach Fisher: p = .001). Für die NET- und SIT-Gruppen wurden getrennte Analysen für mögliche Unterschiede in der PTSD-Häufigkeit über die Zeit berechnet. Dabei wurden die Daten 139 3.2 Posttraumatische Belastungsstörung 3 ERGEBNISSE zum Zeitpunkt der Ein-Jahres-Nachuntersuchung aufgrund zu geringer Stichprobengröße nicht berücksichtigt. Weder innerhalb der NET- noch der SIT-Gruppe zeigte sich ein signifikanter Rückgang der Häufigkeit einer PTSD (Exakter Test nach Fisher: p > .05). Es ist anzumerken, dass bei einem Patienten aus der NET-Bedingung zum Zeitpunkt sechs Monate nach Therapieende keine PTSD mehr festgestellt werden konnte, jedoch wies er ein Jahr nach Therapieende erneut die Symptomatik einer PTSD auf. Ein weiterer Patient aus der NET-Gruppe zeigte vier Wochen und ein Jahr nach Therapieende keine PTSD, jedoch vorübergehend zum Sechs-MonatsZeitpunkt. Die übrigen Patienten, die die Kriterien für eine PTSD-Diagnose zum Zeitpunkt ein Jahr nach Ende der Therapie nicht mehr erfüllten, wiesen keine derartigen Schwankungen auf. Sie hatten entweder bereits ab der Vier-Wochen-Nachuntersuchung keine PTSD mehr (n = 1, NET), ab der Sechs-Monats-Nachuntersuchung (n = 2, jeweils SIT) oder zur Ein-Jahres-Nachuntersuchung (n = 1, NET). 3.2.3 Veränderung des Symptom-Scores im Fragebogen CAPS Die Mittelwerte, Standardabweichungen sowie die Minimal- und Maximalwerte im Fragebogen CAPS sind für beide Therapiegruppen zu den Zeitpunkten vor der Therapie, vier Wochen sowie sechs Monate nach Therapieende in Tabelle 5 angegeben. Es werden jeweils der Gesamtmittelwert sowie die Mittelwerte innerhalb der drei Symptomgruppen „Intrusionen“, „Vermeidungs-“ sowie „Übererregungssymptome“ angegeben. Für den Zeitpunkt ein Jahr nach Therapieende werden die Werte gesondert angegeben, da sie aufgrund der geringen Stichprobengröße nicht in die Analysen mit aufgenommen werden. In der NET-Gruppe betrug der mittlere CAPS-Score ein Jahr nach Therapieende M = 64,29 (SD = 25,86), in der SIT-Gruppe M = 63 (SD = 36,98). Es ist anzumerken, dass bei einem Patienten zur Sechs-Monats-Nachuntersuchung ein einzelner Wert in der CAPS fehlte (die Schweregradeinschätzung des Gefühls, von anderen isoliert und entfremdet zu sein). Dieser Wert wurde anhand des Mittelwerts der übrigen CAPS-Werte in dieser Untersuchung geschätzt. Um Unterschiede im CAPS-Summenscore zwischen der NET- und der SIT-Bedingung und zwischen den verschiedenen Untersuchungszeitpunkten sowie Wechselwirkungen von Therapiebedingung und Zeitpunkt zu betrachten, wurde ein gemischtes Modell für den CAPS-Score über die Zeit (ohne die Ein-Jahres-Nachuntersuchung) und für beide Therapiebedingungen berechnet. 140 3.2 Posttraumatische Belastungsstörung 3 ERGEBNISSE Tabelle 5: CAPS-Scores über die Zeit in beiden Behandlungsgruppen Erstdiagn. (N = 28) 4 Wochen (n = 21) 6 Monate (n = 22) Mittelwert Standardabweichung Minimum – Maximum NET (n = 15) 96,47 15,89 52 – 117 Intrusionen Vermeidung Übererregung 29,33 37,40 29,73 4,90 8,81 4,15 17 – 36 14 – 48 21 – 36 SIT (n = 13) 85,15 12,95 61 – 105 Intrusionen Vermeidung Übererregung 26,92 31,08 27,15 4,92 7,38 4,90 20 – 37 20 – 40 18 – 34 NET (n = 11) 76,73 26,19 33 – 111 Intrusionen Vermeidung Übererregung 25,64 27,27 23,82 8,13 10,28 9,40 13 – 36 11 – 41 9 – 36 SIT (n = 10) 82,60 18,80 46 – 113 Intrusionen Vermeidung Übererregung 27,40 29,70 25,50 8,29 8,21 6,43 14 – 39 18 – 43 13 – 31 NET (n = 12) 72,33 18,10 41 – 100 Intrusionen Vermeidung Übererregung 27,00 24,67 20,83 5,83 9,09 7,72 18 – 37 6 – 37 12 – 35 SIT (n = 10) 82,70 26,16 39 – 115 Intrusionen Vermeidung Übererregung 24,30 31,80 26,60 9,29 12,30 6,57 10 – 34 11 – 49 17 – 34 141 3.2 Posttraumatische Belastungsstörung 3 ERGEBNISSE 100 96.47 Gesamtscore CAPS 85.15 82.7 82.6 76.73 72.33 70 NET SIT 40 Erstdiagnostik 4 Wochen 6 Monate Untersuchungszeitpunkt Abbildung 6: CAPS-Scores über die Zeit in beiden Behandlungsgruppen Es zeigte sich kein signifikanter Haupteffekt für den Faktor „Therapiebedingung“ (F (1; 26) = 0,051; p > .05). Für den Faktor „Zeitpunkt“ ergab sich ein signifikanter Haupteffekt (F (2; 39) = 4,638; p < .05). Im post hoc ausgeführten Tukey-Test wurde deutlich, dass die signifikante Veränderung über die Zeit zwischen der Erstdiagnostik und der Sechs-Monats-Nachuntersuchung auftrat (q = 2,436; p < .05). Zudem zeigte sich eine signifikante Interaktion für die Therapiebedingung über die Zeit (F (2; 39) = 3,269; p < .05). Im Tukey-Test wurde ersichtlich, dass sich der CAPS-Summenscore in der NET-Bedingung zwischen dem Zeitpunkt der Erstdiagnostik und dem Zeitpunkt sechs Monate nach Therapieende signifikant verringerte (q = 2,996; p < .05). Die Effektstärke betrug d = 1,42. Dies entsprach der Hypothese, dass NET keine unmittelbare, sondern eine zeitlich verzögerte Wirkung auf die PTSD-Symptomatik zeigen würde. Für SIT wurde erwartet, dass es zu einer unmittelbaren Reduktion der PTSD-Schwere führen sollte. Um dies zu überprüfen, wurde eine Kontrastanalyse vorgenommen. Es zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen dem CAPS-Score bei der Erstdiagnostik und der Vier-Wochen-Nachuntersuchung in der SIT-Bedingung (F (1; 39) = 0,083; p > .05). Die Effektstärke betrug d = 0,16. Zur Überprüfung der allgemeineren Hypothese, dass SIT zu irgendeinem Zeitpunkt zu einer signifikanten Reduktion des Sym142 3.2 Posttraumatische Belastungsstörung 3 ERGEBNISSE ptomscores in der CAPS führen würde, wurde zusätzlich eine Kontrastanalyse für die CAPS-Veränderung zwischen der Erstdiagnostik und der Sechs-MonatsNachuntersuchung innerhalb der SIT-Gruppe berechnet. Es ergab sich kein signifikanter Unterschied zwischen den CAPS-Scores zu diesen beiden Untersuchungszeitpunkten (F (1; 39) = 0,084; p > .05), hier betrug die Effektstärke d = 0,12. Eine grafische Darstellung der Veränderungen im CAPS-Score in beiden Gruppen findet sich in Abbildung 6. Für die Symptomgruppen „Intrusionen“, „Vermeidungs-“ und „Übererregungssymptome“ wurden jeweils gemischte Modelle entsprechend demjenigen für den Gesamtschweregrad in der CAPS berechnet. Eine grafische Darstellung der Schweregradentwicklung über die Zeit findet sich in Abbildung 7. Für die Intrusionssymptome ergaben sich keinerlei signifikante Effekte: Weder zwischen den beiden Behandlungsbedingungen (F (1; 26) = 0,349; p > .05) noch über die Zeitpunkte hinweg (F (2; 39) = 1,236; p > .05) oder hinsichtlich der Wechselwirkung von Therapiebedingung und Zeit (F (2; 39) = 1,078; p > .05). Für die Symptomgruppe „Vermeidung“ zeigte sich bei der Berechnung des gemischten Modells kein signifikanter Unterschied zwischen den Vermeidungssymptomwerten in der NET- und SIT-Bedingung (F (1; 26) = 0,004; p > .05). Für den Faktor „Zeit“ ergab sich ein signifikanter Haupteffekt (F (2; 39) = 4,934; p < .05). Im post hoc ausgeführten Tukey-Test wurde deutlich, dass die signifikante Veränderung über die Zeit zwischen der Erstdiagnostik und der Vier-Wochen-Nachuntersuchung sowie der Sechs-Monats-Nachuntersuchung auftrat (q = 2,436; p < .05). Die Effektstärken betrugen d = 1,06 für die Veränderung zwischen Erstdiagnostik und VierWochen-Nachuntersuchung sowie d = 1,42 zwischen Erstdiagnostik und SechsMonats-Nachuntersuchung. Zudem zeigte sich eine signifikante Interaktion für die Therapiebedingung über die Zeit (F (2; 39) = 4,759; p < .05). Im Tukey-Test wurde ersichtlich, dass signifikante Unterschiede des Vermeidungs-Summenscores in der NET-Bedingung zwischen der Erstdiagnostik und der Vier-Wochen-Nachuntersuchung bzw. der Sechs-Monats-Nachuntersuchung bestanden (q = 2,996; p < .05). Die Berechnung eines gemischten Modells für die Symptome der Übererregung zeigte keinen signifikanten Effekt für die Therapiebedingung (F (1; 26) = 0,935; p > .05). Es ergab sich jedoch ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor „Zeitpunkt“ (F (2; 39) = 4,120; p < .05). Im post hoc ausgeführten Tukey-Test zeigte sich, dass der Effekt zwischen dem Zeitpunkt der Erstdiagnostik und der Sechs-MonatsNachuntersuchung auftrat (q = 2,436; p < .05). Die Effektstärke betrug d = 0,08. Zudem wurde die Interaktion zwischen Therapiebedingung und Zeitpunkt signifikant (F (2; 39) = 3,544; p < .05). Der post hoc ausgeführte Tukey-Test machte deut143 3.2 Posttraumatische Belastungsstörung 3 ERGEBNISSE INTRUSIONEN Summenscore Intrusionen 40 29.3 26.9 25.6 27.4 27 24.3 20 NET SIT 0 Erstdiagnostik 4 Wochen 6 Monate Untersuchungszeitpunkt VERMEIDUNGSSYMPTOME Summenscore Vermeidung 40 37.4 31.1 31.8 29.7 27.3 NET 24.7 20 SIT 0 Erstdiagnostik 4 Wochen 6 Monate Untersuchungszeitpunkt ÜBERERREGUNGSSYMPTOME Summenscore Übererregung 40 29.7 27.2 27.3 26.6 25.5 20 NET 20.8 SIT 0 Erstdiagnostik 4 Wochen 6 Monate Untersuchungszeitpunkt Abbildung 7: CAPS-Scores der einzelnen Symptomgruppen über die Zeit in beiden Behandlungsgruppen 144 3.2 Posttraumatische Belastungsstörung 3 ERGEBNISSE lich, dass der Effekt in der NET-Gruppe zwischen dem Zeitpunkt der Erstdiagnostik und der Sechs-Monats-Nachuntersuchung auftrat (q = 2,996; p < .05). Hier betrug die Effektstärke d = 1,43. 3.2.4 Funktionsbeeinträchtigung durch die PTSD-Symptomatik Die Einschätzung der Funktionsbeeinträchtigungen aufgrund der PTSD-Symptomatik im Fragebogen CAPS kann auf einer Skala von 0 („keine Beeinträchtigung“) bis 4 („extreme Beeinträchtigung“) vorgenommen werden. Zur Analyse der Funktionsbeeinträchtigung der Probanden wurde der Mittelwert aus den CAPS-Items „Subjektiver Stress / Belastung“, „Beeinträchtigung der sozialen Beziehungen“ sowie „Beeinträchtigungen des Berufslebens“ gebildet. Für letzteres Item fehlten bei vielen Probanden die Angaben, da sie zum Untersuchungszeitpunkt nicht in einem Arbeitsverhältnis standen: Zu den Zeitpunkten der Erstdiagnostik sowie zur Vier-Wochen-Nachuntersuchung traf dies für über 50 % der Patienten zu, zum Zeitpunkt der Sechs-Monats-Nachuntersuchung für über 40 %. Jedoch wurde überprüft, ob sich die Mittelwerte der Funktionsbeeinträchtigung mit und ohne Einbeziehung der vorhandenen Angaben zu beruflichen Beeinträchtigungen signifikant unterschieden. Dies war über alle Zeitpunkte und die beiden Therapiebedingungen hinweg nicht der Fall (jeweils t-Tests für gepaarte Stichproben, p > .05). Daher wurden auch die Daten zu „Beeinträchtigungen des Berufslebens“ mit in den Gesamtmittelwert einbezogen. Ein Überblick über die Mittelwerte in den Angaben zu Funktionsbeeinträchtigungen findet sich in Tabelle 6. Die Daten zum Zeitpunkt der Ein-Jahres-Nachuntersuchung wurden aufgrund zu geringer Stichprobengröße nicht mit in die Analyse aufgenommen. Der Mittelwert der Funktionsbeeinträchtigung zu diesem Untersuchungszeitpunkt betrug in der NET-Gruppe M = 2,21 (SD = .91), in der SIT-Gruppe M = 1,96 (SD = 1,28). Eine grafische Darstellung der Mittelwerte für die Zeitpunkte der Erstdiagnostik bis zur Sechs-Monats-Nachuntersuchung findet sich in Abbildung 8. Um Unterschiede der Funktionsbeeinträchtigung zwischen der NET- und der SIT-Bedingung und zwischen den verschiedenen Untersuchungszeitpunkten sowie Wechselwirkungen von Therapiebedingung und Zeitpunkt zu betrachten, wurde ein gemischtes Modell für den Gesamtmittelwert der Funktionsbeeinträchtigung über die Zeit (ohne die Ein-Jahres-Nachuntersuchung) und für beide Therapiebedingungen berechnet. Es zeigte sich kein signifikanter Effekt für den Faktor „Therapiebedingung“ (F (1; 26) = 0,057; p > .05). Für den Faktor „Zeitpunkt“ ergab sich ein signifikanter 145 3.2 Posttraumatische Belastungsstörung 3 ERGEBNISSE Tabelle 6: Funktionsbeeinträchtigung CAPS über die Zeit in beiden Behandlungsgruppen Subjektiver Stress Soziale Berufsleben Beziehungen M (SD) M (SD) M (SD) (Min – Max) (Min – Max) (Min – Max) 3,13 (.64) 2,93 (.70) 2,14 (.90) (2 – 4) (1 – 4) (1 – 3) 3,38 (.65) 3,08 (.86) 2,5 (1,05) (2 – 4) (2 – 4) (1 – 4) 3,0 (.82) 2,40 (.97) .50 (.71) (2 – 4) (1 – 4) (0 – 1) 3,20 (.79) 2,50 (1,08) 2,43 (1,27) (2 – 4) (0 – 4) (0 – 4) 2,64 (.81)a 2,08 (1,08) 1,17 (1,17) (1 – 4) (0 – 3) (0 – 3) 2,90 (.88) 2,60 (1,08) 3,0 (.82) (2 – 4) (1 – 4) (2 – 4) Mittelwert Funktionsbeeinträchtigung M (SD) Erstdiagnostik NET SIT 2,93 (.57) 3,10 (.63) 4 Wochen NET SIT 2,60 (.94) 2,67 (.79) 6 Monate NET SIT a hier fehlen Werte von einem Patienten 146 2,13 (.73) 2,73 (.76) 3.2 Posttraumatische Belastungsstörung 3 ERGEBNISSE Mittelwert Funktionsbeeinträchtigung 3.5 3.1 2.93 2.6 2.73 2.67 2.13 NET 1.75 SIT 0 Erstdiagnostik 4 Wochen 6 Monate Untersuchungszeitpunkt Abbildung 8: Funktionsbeeinträchtigung CAPS Haupteffekt (F (2; 38) = 4,13; p < .05). Im post hoc ausgeführten Tukey-Test zeigte sich, dass es zwischen den Zeitpunkten der Erstdiagnostik und der Sechs-MonatsNachuntersuchung zu einer signifikanten Veränderung des Gesamtmittelwerts der Funktionsbeeinträchtigung kam (q = 2,44; p < .05). Die Interaktion zwischen Therapiebedingung und Zeitpunkt war nicht signifikant (F (2; 38) = 0,93; p > .05). 3.2.5 Begleitsymptome im Fragebogen CAPS In Tabelle 7 sind die Mittelwerte, Standardabweichungen sowie Minimal- und Maximalwerte der Summenscores für Begleitsymptome im Fragebogen CAPS für die Zeitpunkte der Erstdiagnostik sowie der Vier-Wochen- und Sechs-Monats-Nachuntersuchung aufgeführt. Die Werte zum Zeitpunkt der Ein-Jahres-Nachuntersuchung gehen aufgrund geringer Stichprobengröße nicht in die Analysen mit ein. Für die NET-Gruppe betrug der Mittelwert der Begleitsymptome M = 6,43 (SD = 3,82), für die SIT-Gruppe M = 10,25 (SD = 8,46). Zur Analyse von Unterschieden im Summenwert der Begleitsymptomatik zwischen der NET- und der SIT-Bedingung und zwischen den verschiedenen Untersuchungszeitpunkten sowie Wechselwirkungen von Therapiebedingung und Zeitpunkt wurde ein gemischtes Modell für den Begleitsymptom-Gesamtscore über die 147 3.2 Posttraumatische Belastungsstörung 3 ERGEBNISSE Tabelle 7: Begleitsymptome CAPS über die Zeit in beiden Behandlungsgruppen Mittelwert Standardabweichung Minimum – Maximum NET 11,40 6,98 2 – 24 Schuldgefühle (n = 15) Dissoziation (n = 15) 5,27 6,13 2,99 6,26 0 – 10 0 – 18 SIT 8,92 5,68 0 –22 Schuldgefühle (n = 13) Dissoziation (n = 12)a 3,46 5,17 3,87 3,99 0 – 12 0 – 12 NET 5,10 3,54 0 – 11 Schuldgefühle (n = 10)a Dissoziation (n = 10)a 3,90 1,20 3,04 2,90 0–8 0–9 SIT 12,70 8,96 5 – 31 Schuldgefühle (n = 10) Dissoziation (n = 10) 6,10 6,60 4,84 5,04 0 – 16 0 – 15 NET 7,45 6,88 0 – 23 Schuldgefühle (n = 11)a Dissoziation (n = 12) 3,73 4,08 3,74 4,93 0 – 10 0 – 16 SIT 9,33 5,22 0 – 16 Schuldgefühle (n = 10) Dissoziation (n = 9)a 6,30 2,33 4,74 2,78 0 – 14 0–8 Erstdiagn. 4 Wochen 6 Monate a hier fehlen Angaben von jeweils einem Patienten 148 3.2 Posttraumatische Belastungsstörung 3 ERGEBNISSE Zeit (ohne die Ein-Jahres-Nachuntersuchung) und für beide Therapiebedingungen berechnet. Es ergaben sich keinerlei signifikante Effekte, weder zwischen den beiden Behandlungsbedingungen (F (1; 25) = 0,154; p > .05) noch über die Zeitpunkte hinweg (F (2; 32) = 0,789; p > .05) oder hinsichtlich der Wechselwirkung von Therapiebedingung und Zeit (F (2; 32) = 0,669; p > .05). 15 Score Begleitsymptome CAPS 12.7 11.4 9.33 8.92 NET 7.5 7.45 SIT 5.1 0 Erstdiagnostik 4 Wochen 6 Monate Untersuchungszeitpunkt Abbildung 9: Begleitsymptome CAPS über die Zeit in beiden Behandlungsgruppen Zudem wurden für die Begleitsymptom-Untergruppen „Schuldgefühle“ und „Dissoziationssymptome“ getrennte gemischte Modelle berechnet. Die Berechnung des Modells für die Schuldgefühle führte zu keinerlei signifikanten Effekten (Faktor „Therapiebedingung“: F (1; 26) = 0,445; p > .05; Faktor „Zeitpunkt“: F (2; 37) = 0,271; p > .05; Interaktion „Therapiebedingung“ und „Zeitpunkt“: F (2; 37) = 0,788; p > .05). Auch für die Dissoziationssymptome ergaben sich keine signifikanten Effekte (Faktor „Therapiebedingung“: F (1; 26) = 0,105; p > .05; Faktor „Zeitpunkt“: F (2; 36) = 1,763; p > .05; Interaktion „Therapiebedingung“ und „Zeitpunkt“: F (2; 36) = 2,155; p > .05). Eine grafische Darstellung der Veränderungen im Begleitsymptom-Score in beiden Gruppen findet sich in Abbildung 9. Für die Untergruppen „Schuldgefühle“ und „Dissoziationssymptome“ sind die Scores in Abbildung 10 dargestellt. 149 3.2 Posttraumatische Belastungsstörung 3 ERGEBNISSE SCHULDGEFÜHLE 7 6.3 Score Schuldgefühle CAPS 6.1 5.27 NET 3.9 3.5 3.73 3.46 SIT 0 Erstdiagnostik 4 Wochen 6 Monate Untersuchungszeitpunkt DISSOZIATIONSSYMPTOME Score Dissoziationssymptome CAPS 7 6.6 6.13 5.17 NET 4.08 3.5 SIT 2.33 1.2 0 Erstdiagnostik 4 Wochen 6 Monate Untersuchungszeitpunkt Abbildung 10: Schuldgefühle und Dissoziationssymptome CAPS über die Zeit in beiden Gruppen 150 3.3 Affektive Störungen 3.3 Affektive Störungen 3 ERGEBNISSE In diesem Kapitel werden die Befunde hinsichtlich affektiver Störungen angeführt. Weitere psychische Störungen, die ebenfalls in der Stichprobe auftraten, sind unter „3.5 Weitere komorbide Störungen“ abgehandelt. Ein grafischer Gesamtüberblick über alle Störungen, die komorbid zur PTSD auftraten, findet sich in den Abbildungen 15 und 16. Häufigkeit Depressions-Diagnose 100 85% 78% 73% NET 60 56% SIT 20 Erstdiagnostik 6 Monate Untersuchungszeitpunkt Abbildung 11: Häufigkeit Depressionsdiagnose über die Zeit in beiden Behandlungsgruppen 3.3.1 Häufigkeit von Depression, Dysthymia und manischer Störung Zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung wiesen 82 % der Patienten in der Gesamtstichprobe (N = 28) nach dem Fragebogen M.I.N.I. eine komorbide depressive Störung auf. Alle übrigen Patienten erfüllten die diagnostischen Kriterien für eine dysthyme Störung. Also litten zu Beginn der Studie alle Teilnehmer an einer affektiven Störung. Keiner der Patienten berichtete zu irgendeinem Untersuchungszeitpunkt von manischen Symptomen aktuell oder in der Vergangenheit. Schließt man diejenigen Patienten aus, die später die laufende Therapie abbrachen, findet sich eine Rate komorbider Depression von 78 % und eine Dysthymia-Rate von 22 % (n = 23). 151 3.3 Affektive Störungen 3 ERGEBNISSE Zum Zeitpunkt der Sechs-Monats-Nachuntersuchung betrug die Depressionsrate für diejenigen, die die Therapie bis zum Ende durchgeführt hatten, noch 65 %, keiner der Patienten wies die Diagnose einer Dysthymia auf (n = 22). Betrachtet man die Depressions- und Dysthymia-Rate nach Behandlungsgruppen getrennt, zeigt sich folgendes Bild (für depressive Störung siehe Abbildung 11): In der NET-Gruppe wiesen 82 % vor der Therapie eine Depression auf, die Dysthymia-Rate vor der Behandlung betrug demnach 18 % (n = 15). Zur SechsMonats-Nachuntersuchung litten in der NET-Gruppe noch 73 % an einer Depression (n = 12). In der SIT-Gruppe waren vor der Behandlung 78 % depressiv (also hatten zu diesem Zeitpunkt 22 % eine dysthyme Störung; n = 13), sechs Monate nach Therapieende wiesen noch 56 % eine depressive Störung auf (n = 10). Die Depressions- und Dysthymia-Raten in der NET- und der SIT-Gruppe unterschieden sich zu keinem Zeitpunkt signifikant. Für die Erstdiagnostik galt das unabhängig von Einbeziehung oder Ausschluss der späteren Therapieabbrecher (Exakter Test nach Fisher: p > .05). Die Reduktion der Häufigkeit der Diagnosen einer Depression oder Dysthymia war weder für die Gesamtgruppe noch innerhalb der beiden Behandlungsgruppen signifikant (Exakter Test nach Fisher: p > .05). Alle vier Probanden, die zur Sechs-Monats-Nachuntersuchung die Kriterien einer PTSD nicht mehr erfüllten, hatten zu Beginn die Diagnose einer komorbiden depressiven Episode erhalten. Drei von ihnen wiesen zum Zeitpunkt sechs Monate nach der Therapie keine Depression mehr auf. 3.3.2 Veränderung des Symptom-Scores in der HAM-D Die Mittelwerte, Standardabweichungen sowie die Minimal- und Maximalwerte im Fragebogen HAM-D sind für beide Therapiegruppen zu den Zeitpunkten vor der Therapie, vier Wochen sowie sechs Monate nach Therapieende in Tabelle 8 angegeben. Für den Zeitpunkt ein Jahr nach Therapieende werden die Werte gesondert aufgeführt, da sie aufgrund der geringen Stichprobengröße nicht in die Analysen mit aufgenommen werden. Zu diesem Untersuchungszeitpunkt betrug der mittlere HAM-D-Score in der NET-Gruppe M = 22,29 (SD = 10,52) und in der SIT-Gruppe M = 20 (SD = 13,29). Zur Betrachtung möglicher Unterschiede im HAM-D-Summenscore zwischen der NET- und der SIT-Bedingung und zwischen den verschiedenen Untersuchungszeitpunkten sowie Wechselwirkungen von Therapiebedingung und Zeitpunkt wur- 152 3.3 Affektive Störungen 3 ERGEBNISSE Tabelle 8: HAM-D-Scores über die Zeit in beiden Behandlungsgruppen Erstdiagn. (n = 27)a 4 Wochen (n = 20) a 6 Monate (n = 22) Mittelwert Standardabweichung Minimum – Maximum NET (n = 14)a 29,64 6,73 11 – 38 SIT (n = 13) 26,54 8,59 10 – 38 NET (n = 10)a 24,70 8,13 12 – 36 SIT (n = 10) 28,10 9,93 13 – 42 NET (n = 12) 20,25 7,52 7 – 30 SIT (n = 10) 25,60 10,21 6 – 38 a hier fehlen Angaben von jeweils einem Patienten 36 29.64 28.1 Gesamtscore HAM-D 26.54 25.6 24.7 20.25 18 NET SIT 0 Erstdiagnostik 4 Wochen 6 Monate Untersuchungszeitpunkt Abbildung 12: HAM-D-Scores über die Zeit in beiden Behandlungsgruppen 153 3.3 Affektive Störungen 3 ERGEBNISSE de ein gemischtes Modell für den HAM-D-Score über die Zeit (ohne die Ein-JahresNachuntersuchung) und für beide Therapiebedingungen berechnet. Es zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen den Symptomwerten in der NET- und SIT-Bedingung (F (1; 25) = 0,707; p > .05). Für den Faktor „Zeitpunkt“ erreichte der Effekt ebenfalls keine Signifikanz mit einem p-Wert von .08 (F (2; 38) = 2,506; p > .05). Auch die Wechselwirkung von Therapiebedingung und Zeit war nicht signifikant (F (2; 39) = 1,962; p > .05). Um die Annahme zu überprüfen, dass die Depressivität in der SIT-Gruppe signifikant verringert werden würde, wurden geplante Kontraste für Effekte zwischen der Erstdiagnostik und sowohl der Vier-Wochen- als auch der Sechs-Monats-Nachuntersuchung in der SITGruppe berechnet. Es zeigte sich kein signifikanter Effekt (Erstdiagnostik – 4 WoTabelle 9: Suizidrisiko nach M.I.N.I. Erstdiagnostik Gesamtstichprobe % von N = 28 (NET n, SIT n) Erstdiagnostik ohne Therapieabbrecher % von n = 23 6-MonatsNachuntersuchung % von n = 20a (NET n, SIT n) (NET n, SIT n) kein Risiko geringes Risiko mittleres Risiko hohes Risiko 10,7 % (3) 13,0 % (3) 20 % (4) (NET 1, SIT 2) (NET 1, SIT 2) (NET 3, SIT 1) 28,6 % (8) 30,4 % (7) 40 % (8) (NET 3, SIT 5) (NET 3, SIT 4) (NET 3, SIT 4) 21,4 % (6) 17,4 % (4) 35 % (7) (NET 4, SIT 2) (NET 3, SIT 1) (NET 1, SIT 2) 39,3 % (11) 39,1 % (9) 5 % (1) (NET 7, SIT 4) (NET 5, SIT 4) (NET 1, SIT 0) a hier fehlen Angaben von zwei Patienten (ein NET-, ein SIT-Patient), bei denen zu diesem Zeitpunkt lediglich CAPS und HAM-D durchgeführt wurden chen: F (1; 38) = 0,287; p > .05; Erstdiagnostik – 6 Monate: F (1; 38) = 0,073; p > .05). Die Effektstärke für die Veränderung zwischen Erstdiagnostik und Vier-Wochen- 154 3.3 Affektive Störungen 3 ERGEBNISSE Nachuntersuchung betrug d = -0,17, zwischen Erstdiagnostik und Sechs-MonatsNachuntersuchung d = 0,10. Eine grafische Darstellung der Veränderungen im HAM-D-Score in beiden Gruppen findet sich in Abbildung 12. 3.3.3 Suizidalität Die Einschätzung des Suizidrisikos der Probanden wurde nach der Einstufung des Fragebogens M.I.N.I. vorgenommen (siehe Tabelle 9). In dieser standardisierten Weise wurde die Suizidalität vor der Behandlung und sechs Monate nach der Behandlung erfasst. Beim Vergleich der beiden Therapiebedingungen zeigten sich unabhängig vom Ein- oder Ausschluss derjenigen Probanden, die die laufenden Therapien abgebrochen hatten, jeweils keine Unterschiede hinsichtlich der Höhe des Suizidrisikos zu den beiden Zeitpunkten (Exakter Test nach Fisher: p > .05). In der Gesamtstichprobe veränderte sich die Variable „hohes Suizidrisiko“ zwischen den Zeitpunkten signifikant (Exakter Test nach Fisher: p < .01). Für die anderen Stufen des Suizidrisikos zeigte sich in der Gesamtgruppe keine signifikante Veränderung über die Zeit hinweg. Diese Befunde traten unabhängig davon auf, ob die Therapieabbrecher in die Analysen einbezogen wurden oder nicht. Bei getrennter Betrachtung der beiden Therapiebedingungen ohne Ausschluss der Abbrecher ergab sich in der NET-Gruppe für die Variable „hohes Suizidrisiko“ eine signifikante Veränderung zwischen Erstdiagnostik und Sechs-MonatsNachuntersuchung (Exakter Test nach Fisher: p < .05). In der SIT-Gruppe zeigte sich diesbezüglich ein Trend (Exakter Test nach Fisher: p = .09). Bezüglich der weiteren Stufen des Suizidrisikos lagen innerhalb der beiden Therapiegruppen jeweils keine signifikanten Veränderungen vor (Exakter Test nach Fisher: p > .05). Wurden die Therapieabbrecher ausgeschlossen, zeigte sich sowohl innerhalb der NET- als auch der SIT-Gruppe ein Trend bezüglich der Auftretenshäufigkeit von hohem Suizidrisiko (Exakter Test nach Fisher; NET: p = .09; SIT: p = .07). Es brachen zwei Patientinnen in der NET-Bedingung die Behandlung nach einer bzw. zwei Sitzungen aufgrund hoher und akuter Suizidalität ab. Eine grafische Darstellung der Veränderungen in der Rate hohen Suizidrisikos findet sich in Abbildung 13. 155 3.3 Affektive Störungen 3 ERGEBNISSE % Probanden mit hohem Suizidrisiko Hohes Suizidrisiko Gesamtstichprobe 60 39% Gesamte Gruppe 30 0 5% Erstdiagnostik 6 Monate % Probanden mit hohem Suizidrisiko Untersuchungszeitpunkt Hohes Suizidrisiko NET - SIT (inkl. Abbrecher) 60 47% NET 30 31% SIT 9% 0 Erstdiagnostik 6 Monate % Probanden mit hohem Suizidrisiko Untersuchungszeitpunkt Hohes Suizidrisiko NET - SIT (ohne Abbrecher) 60 42% 30 NET 36% SIT 9% 0 Erstdiagnostik 6 Monate Untersuchungszeitpunkt Abbildung 13: Rate hohen Suizidrisikos zur Erstdiagnostik und der Sechs-MonatsNachuntersuchung (beachte: Zum zweiten Zeitpunkt fehlen Angaben von je einem Patienten aus der NET- und der SIT-Gruppe) 156 3.4 Zusammenhang PTSD und Depressivität 3 ERGEBNISSE 3.4 Zusammenhang zwischen posttraumatischer Belastungsstörung und Depressivität In Tabelle 10 werden die Zusammenhänge zwischen dem Schweregrad der PTSD und demjenigen der Depressivität zu den einzelnen Untersuchungszeitpunkten für die Gesamtstichprobe sowie getrennt für die beiden Behandlungsgruppen aufgeführt. Da die Normalverteilung der jeweiligen Summenwerte zu jedem Zeitpunkt und über die beiden Therapiegruppen hinweg gegeben ist, werden ProduktMoment-Korrelationen nach Pearson (r) angegeben. In Abbildung 14 werden die Zusammenhänge zwischen den CAPS- und HAMD-Scores für die Gesamtstichprobe zum jeweiligen Untersuchungszeitpunkt grafisch dargestellt. Betrachtet man den Zusammenhang zwischen den Veränderungsscores in der CAPS und der HAM-D zwischen der Erstdiagnostik und der Sechs-Monats-Nachuntersuchung für die 22 Patienten von denen zu beiden Zeitpunkten Daten vorliegen, so findet sich für die Gesamtstichprobe ein Pearson-Korrelationskoeffizient von r = .71; p < .01. In der NET-Gruppe zeigt sich ein Korrelationskoeffizient von r = .70; p < .05 (n = 12), in der SIT-Gruppe von r = .67, p < .05 (n = 10). Tabelle 10: Korrelationen CAPS- und HAM-D-Scores Erstdiagn. 4 Wochen 6 Monate 1 Jahr Gesamtstichprobe NET-Gruppe SIT-Gruppe r = .64** r = .59* r = .69** (n = 27) (n = 14) (n = 13) r = .80** r = .80** r = .84** (n = 20) (n = 10) (n = 10) r = .72** r = .52, n. s. r = .80** (n = 22) (n = 11) (n = 9) r = .92** – – (n = 11) * p < .05 ** p < .01 157 3.5 Weitere komorbide Störungen 3 3.5 Weitere komorbide Störungen ERGEBNISSE Es wurden mithilfe des M.I.N.I. folgende weitere Störungen neben PTSD und den affektiven Störungen, die bereits unter „3.3 Affektive Störungen“ angeführt wurden, erhoben: Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie, Agoraphobie ohne vorherige Panikstörung, soziale Phobie, Zwangsstörung, Alkohol- und sonstiger Substanzmissbrauch, psychotische Störung aktuell oder in der Vorgeschichte, Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa und generalisierte Angststörung. Die Raten dieser Störungsbilder zum Zeitpunkt der Erstdiagnostik sowie zur Sechs-Monats-Nachuntersuchung sind in Tabelle 11 aufgeführt. Ein grafischer Gesamtüberblick über alle Krankheitsbilder inklusive affektiver Störungen, die in der Stichprobe komorbid zur PTSD auftraten, findet sich in den Abbildungen 15 und 16. Erstdiagnostik (n = 27) 4-Wochen-Nachuntersuchung (n = 20) 50 Schweregrad HAM-D Schweregrad HAM-D 50 25 0 0 60 25 0 120 0 Schweregrad CAPS 6-Monats-Nachuntersuchung (n = 22) 50 Schweregrad HAM-D Schweregrad HAM-D 120 1-Jahres-Nachuntersuchung (n = 11) 50 25 0 60 Schweregrad CAPS 0 60 25 0 120 Schweregrad CAPS 0 60 120 Schweregrad CAPS Abbildung 14: Zusammenhang CAPS- und HAM-D-Scores Gesamtstichprobe 3.5.1 Weitere psychische Störungen zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung In der Gesamtstichprobe wiesen vor der Behandlung insgesamt 53,6 % der Probanden zusätzlich zur PTSD und der affektiven Störung mindestens eine weitere 158 3.5 Weitere komorbide Störungen 3 ERGEBNISSE psychische Störung auf. Von diesen Probanden litten wiederum 53,3 % an einer zusätzlichen Störung, 46,7 % an zwei weiteren Störungen9 . Betrachtet man beide Therapiegruppen getrennt, zeigt sich folgendes Bild: In der SIT-Gruppe wiesen 46,2 % zusätzlich zur PTSD und der affektiven Störung weitere komorbide Störungen auf. Davon litt je die Hälfte unter einer bzw. zwei zusätzlichen psychischen Störungen. In der NET-Gruppe litten insgesamt 60 % an mindestens einer weiteren komorbiden Störung neben PTSD und affektiver Störung. Davon wiesen wiederum 55,5 % der Probanden eine und 44,5 % zwei zusätzliche psychische Störungsbilder auf. Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen der NET- und der SIT-Gruppe hinsichtlich der Anzahl weiterer komorbider Störungen (Exakter Test nach Fisher: p > .05). 3.5.2 Weitere psychische Störungen zum Zeitpunkt der Sechs-Monats-Nachuntersuchung Sechs Monate nach Therapieende wiesen in der Gesamtstichprobe (n = 16) 10 25 % eine weitere psychische Störung zusätzlich zu einer PTSD oder affektiven Störung auf. Keiner der Probanden litt unter mehreren komorbiden Störungen. Eine Übersicht über die Auftretenshäufigkeit der Störungsbilder findet sich in Tabelle 11. In den beiden Behandlungsgruppen zeigte sich folgendes Bild: Von den Patienten in der SIT-Gruppe (n = 7) zeigten noch 28,6 % (n = 2), in der NET-Gruppe (n = 9) noch 22,2 % (n = 2) eine weitere psychische Störung über PTSD und affektive Störungen hinaus. Bei diesen vier Patienten lag zu diesem Zeitpunkt sowohl eine PTSD als auch eine Major Depression vor. Daher geben die Daten die tatsächliche Rate von Komorbidität (i. S. v. gleichzeitigem Vorhandensein mehrerer psychischer Störungen) mit PTSD wieder. Einer dieser Patienten aus der SITGruppe hatte zu Beginn unter einer Dysthymia gelitten und erhielt zur SechsMonats-Nachuntersuchung aber die Diagnose einer Major Depression. Die übrigen drei hatten auch bereits zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung unter einer Major Depression gelitten. Bei einem der genannten Patienten wurde sechs Monate nach Ende der Therapie die Diagnose einer sozialen Phobie gestellt, die er zu Beginn noch nicht erhalten hatte. Die übrigen drei Patienten hatten zum Zeitpunkt 9 Es fehlen von zwei Patienten folgende Informationen: Bei einer Patientin aus der NET-Gruppe fehlt die Angabe zu Bulimia Nervosa, bei einem Patienten aus der SIT-Gruppe die Angabe zu sozialer Phobie (siehe auch Tabelle 11 auf Seite 160). 10 eigentlich n =22, jedoch lagen bei vier Patienten nur lückenhafte und von zweien überhaupt keine Angaben zu komorbiden Störungen vor; die Werte dieser Patienten werden daher für die Analysen nicht berücksichtigt. 159 3.5 Weitere komorbide Störungen 3 ERGEBNISSE Tabelle 11: Störungen komorbid zur PTSD (ohne affektive Störungen) Erst-Diagnostik Gesamtstichprobe % von N = 28 Panikstörung ohne Agoraphobie Panikstörung mit Agoraphobie Agoraphobie ohne vorher. Panikstörung Soziale Phobie Zwangsstörung Alkoholmissbrauch Substanzmissbrauch Erst-Diagnostik ohne Therapie- 6-MonatsNachunter- abbrecher suchung % von n = 23 % von n = 16b 7,1 % (2) 8,7 % (2) 6,3 % (1) (NET 0, SIT 2) (NET 0, SIT 2) (NET 0, SIT 1) 21,4 % (6) 21,7 % (5) 6,3 % (1) (NET 4, SIT 2) (NET 3, SIT 2) (NET 0, SIT 1) 3,6 % (1) 4,3 % (1) – (NET 1, SIT 0) (NET 1, SIT 0) 7,4 % (2)a 9,1 % (2)a 6,3 % (1) (NET 1, SIT 1) (NET 1, SIT 1) (NET 1, SIT 0) 10,7 % (3) 8,7 % (2) – (NET 2, SIT 1) (NET 1, SIT 1) 7,1 % (2) 8,7 % (2) 6,3 % (1) (NET 1, SIT 1) (NET 1, SIT 1) (NET 0, SIT 1) – 3,6 % (1) 4,3 % (1) (NET 0, SIT 1) (NET 0, SIT 1) 3,6 % (1) 4,3 % (1) (NET 0, SIT 1) (NET 0, SIT 1) Psychotische Störung 3,6 % (1) 4,3 % (1) 6,3 % (1) in der Vorgeschichte (NET 1, SIT 0) (NET 1, SIT 0) (NET 0, SIT 1) Anorexia Nervosa – – – Bulimia Nervosa –a –a – – Psychotische Störung aktuell Generalisierte 3,6 % (1) 4,3 % (1) Angststörung (NET 1, SIT 0) (NET 1, SIT 0) – a hier fehlten Angaben von je einem Patienten aus der NET- und SIT-Gruppe; es werden die validen Prozentwerte angegeben b bei vier Probanden sind die Angaben zu komorbiden Störungen lückenhaft und werden deshalb hier nicht berücksichtigt, bei zwei weiteren Patienten wurde wie oben angeführt lediglich eine verkürzte Interviewform ohne Erhebung komorbider Störungen durchgeführt 160 3.5 Weitere komorbide Störungen 3 ERGEBNISSE Komorbidität Erstdiagnostik (N = 28) % Störung komorbid zur PTSD 100 82% 50 21.4% 18% 7.1% 0 3.6% DEPR. DYSTH. PAN. PAN. AG. O. O. AG. M. AG. PAN. 7.4% 10.7% SOZ. ZWANG PH. 7.1% ALK. 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% SUBST. PSY. AKT. PSY. VORG. GEN. AN. Komorbide Störungen Komorbidität Erstdiagnostik ohne Abbrecher (n = 23) % Störung komorbid zur PTSD 100 78% 50 22% 21.7% 9.1% 8.7% 8.7% 8.7% 4.3% 0 DEPR. DYSTH. PAN. PAN. AG. O. O. AG. M. AG. PAN. 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% SOZ. ZWANG PH. ALK. SUBST. PSY. AKT. PSY. VORG. GEN. AN. Komorbide Störungen DEPR. = Major Depression DYSTH. = Dysthymia PAN. O. AG. = Panikstörung ohne Agoraphobie PAN. M. AG. = Panikstörung mit Agoraphobie AG. O. PAN. = Agoraphobie ohne Panikstörung in der Vorgeschichte SOZ. PH. = Soziale Phobie ZWANG = Zwangsstörung ALK. = Alkoholmissbrauch SUBST. = Substanzmissbrauch PSY. AKT. = Psychotische Störung aktuell PSY. VOR. = Psychotische Störung in der Vorgeschichte GEN. AN. = Generalisierte Angststörung Abbildung 15: Raten von Störungen komorbid zur PTSD (Erstdiagnostik) 161 Weitere komorbide Störungen 3 ERGEBNISSE Komorbidität 6-Monats-Nachuntersuchung (n = 16) 100 % Störung komorbid zur PTSD 3.5 65% 50 6.3% 0 DEPR. PAN. O. AG. 6.3% 6.3% PAN. M. SOZ. PH. AG. 6.3% 6.3% ALK. PSY. VORG. Komorbide Störungen DEPR. = Major Depression PAN. O. AG. = Panikstörung ohne Agoraphobie PAN. M. AG. = Panikstörung mit Agoraphobie SOZ. PH. = Soziale Phobie ALK. = Alkoholmissbrauch PSY. VOR. = Psychotische Störung in der Vorgeschichte Abbildung 16: Raten von Störungen komorbid zur PTSD (6-Monats-Nachunters.) 162 3.6 Therapieabbrecher 3 ERGEBNISSE der Erstdiagnostik bereits dieselben Diagnosen erhalten wie bei der Sechs-MonatsNachuntersuchung. Es lag auch zum Zeitpunkt sechs Monate nach Therapieende kein signifikanter Unterschied zwischen der NET- und SIT-Gruppe hinsichtlich der Anzahl weiterer komorbider Störungen vor (Exakter Test nach Fisher: p > .05). Diese Reduktion der Anzahl weiterer komorbider Störungen zwischen der Erstdiagnostik und der Sechs-Monats-Nachuntersuchung ist weder für die Gesamtstichprobe noch innerhalb der beiden Behandlungsbedingungen signifikant (Exakter Test nach Fisher: p > .05). 3.6 Therapieabbrecher Die fünf Probanden, die die laufenden Behandlungen abgebrochen hatten, unterschieden sich hinsichtlich des Schweregrades ihrer PTSD- und Depressivitätssymptomatik vor der Therapie nicht signifikant von den übrigen Teilnehmern ihrer jeweiligen Therapiebedingung. Auch bezüglich der Anzahl komorbider Störungen und der Ausprägung der Suizidalität ergaben sich keine signifikanten Unterschiede (jeweils U-Test nach Mann und Whitney: p > .05). 163 4 4 DISKUSSION Diskussion Es wurde eine randomisierte kontrollierte Vergleichsstudie zweier Therapieverfahren zur Behandlung von PTSD nach organisierter Gewalt durchgeführt. Die Stichprobe umfasste größtenteils Asylbewerber, die aufgrund von Gewalterlebnissen aus ihren Herkunftsländern geflüchtet waren. Sie erhielten entweder eine Behandlung mittels „Narrativer Expositionstherapie“ (NET) oder mit „Stress-ImpfungsTraining“ (SIT). Standardisierte diagnostische Interviews wurden vor der Behandlung sowie vier Wochen, sechs Monate und ein Jahr nach Therapieende durchgeführt. Es interessierte vor allem die Auswirkung beider Behandlungen auf die PTSD-Symptomatik inklusive der Funktionsbeeinträchtigung sowie Begleitsymptomen (Schuldgefühle und Dissoziationssymptome). Zusätzlich wurden Behandlungseinflüsse auf affektive sowie weitere komorbide Störungen und das Ausmaß der Depressivität erhoben. 4.1 Zusammenhänge verschiedener Faktoren mit dem PTSD- und dem Depressivitäts-Schweregrad 4.1.1 Zusammenhänge verschiedener Faktoren mit dem CAPS-Score Es wurde erwartet, dass eine größere Anzahl verschiedener traumatischer Erlebnisse mit stärkerer PTSD-Symptomatik einhergehen würde. Dies zeigte sich in der untersuchten Stichprobe nicht. Dieser Befund ist jedoch dadurch erklärbar, dass alle Probanden an einer PTSD litten und die Varianz der Anzahl erlebter Traumata gering war. Die Untersuchungen, in denen der sogenannte Dosis-Effekt gefunden worden war, waren Prävalenzstudien, in denen auch Personen ohne PTSD eingeschlossen waren (Neuner et al., 2004a; Eytan et al., 2004). Zudem war der Zusammenhang zwischen der PTSD-Symptomatik und einem sicheren oder unsicheren Asylstatus von Interesse. Hier zeigte sich weder zum Zeitpunkt der Erstdiagnostik noch sechs Monate nach Therapieende ein Zusammenhang. Die Studienergebnisse machen jedoch deutlich, dass eine Expositionsbehandlung trotz eines unsicheren Aufenthaltsstatus’ zu einem signifikanten Rückgang der PTSD-Symptomatik führen kann. Auch Drozdek (1997) weist darauf hin, dass in einer unsicheren Lebenssituation der Rahmen einer Therapie Sicherheit vermitteln kann, und dass eine Behandlung erfolgreich verlaufen kann, auch wenn das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Es wurde darüber hinaus explorativ betrachtet, inwieweit der PTSD-Schweregrad in der CAPS zum ersten Untersuchungszeitpunkt mit folgenden Faktoren in 165 4.1 Zusammenhang versch. Faktoren mit PTSD und Depressivität 4 DISKUSSION Zusammenhang stand: Alter, Geschlecht, Bildung, Jahre in Deutschland, Erwerbstätigkeit, Partnerschaft, Kinder, frühere psychische Erkrankung, externe Psychotherapie und Anzahl verschiedener Medikamententypen. Es zeigte sich lediglich ein schwacher negativer Zusammenhang zwischen dem Gesamtscore in der CAPS zur Erstdiagnostik und dem Faktor „Kinder ja / nein“ (rs = -.47; p < .05). Möglicherweise schützen die Verantwortung für die Kinder und die emotionale Bindung im Sinne positiver sozialer Unterstützung vor der Entwicklung einer extremen PTSDSymptomatik. Andererseits ist auch denkbar, dass bei Patienten mit ausgeprägterer PTSD-Symptomatik die Wahrscheinlichkeit einer Familiengründung z. B. aufgrund von Hoffnungslosigkeit gegenüber der Zukunft, Funktionsbeeinträchtigungen oder emotionaler Taubheit geringer ist als bei weniger schwer Erkrankten. Um diese Zusammenhänge genauer zu erklären, müsste betrachtet werden, ob die Probanden bereits vor ihren Gewalterfahrungen Kinder hatten oder diese erst später bekamen. Das Alter der Kinder ist jedoch in der hier beschriebenen Studie nicht erhoben worden. Ebenso wenig wurden die Probanden systematisch nach ihrer Zukunftsplanung z. B. hinsichtlich familiärer Themen oder diesbezüglicher Veränderungen in Folge der Therapie befragt. Der fehlende Zusammenhang zwischen PTSD-Symptomatik und externer Psychotherapie zusätzlich zur Teilnahme an der Studie findet sich auch bei Blanchard et al. (2004): In deren Studie brachte eine zusätzliche Behandlung – in diesem Fall im Anschluss an die Teilnahme an einer Therapiestudie – keine weitere Symptomreduktion hinsichtlich des CAPS-Scores mit sich. Auch Lehmann (2007) fand keinen positiven Einfluss von ambulanter Psychotherapie auf die PTSD-Symptomatik von Asylbewerbern in Deutschland. Gotthardt (2007) stellte in einer Untersuchung zur Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern in Deutschland fest, dass sich etwa 75 % der untersuchten Personen in ambulanter Psychotherapie befanden. Dennoch wies die Stichprobe eine PTSD-Rate von 86,5 % und eine Depressionsrate von 65 % auf. Gotthardt (2007) warf angesichts dieser Befunde die Frage auf, ob gerade eine PTSD möglicherweise häufig nicht korrekt diagnostiziert wird (siehe auch Munro et al., 2004, „1.4.4 Besonderheiten bei Asylbewerbern und Flüchtlingen“), oder ob keine geeigneten Behandlungsmethoden zum Einsatz kamen. Generell ist in der hier beschriebenen Studie jedoch auch denkbar, dass kaum Zusammenhänge zwischen dem PTSD-Schweregrad und anderen Faktoren gefunden wurde, weil die untersuchte Stichprobe insgesamt eine relativ hohe und homogene Symptomatik aufwies. In einer Studie mit Probanden, deren CAPS-Scores stärker variieren, ließen sich möglicherweise deutlichere Befunde über entsprechende Zusammenhänge aufzeigen. 166 4.2 Posttraumatische Belastungsstörung 4.1.2 4 DISKUSSION Zusammenhang verschiedener Faktoren mit dem HAM-D-Score Es wurde explorativ untersucht, inwieweit Zusammenhänge zwischen dem Ausmaß der Depressivität und folgenden Faktoren bestanden: Anzahl traumatischer Erlebnisse, Alter, Geschlecht, Bildung, Jahre in Deutschland, Erwerbstätigkeit, Partnerschaft, Kinder, frühere psychische Erkrankung, externe Psychotherapie und Anzahl verschiedener Medikamententypen. Es wurden keinerlei signifikante Zusammenhänge gefunden. Es ist zu vermuten, dass sich in der hier untersuchten Stichprobe – ebenso wie für die PTSD-Symptomatik im vorigen Abschnitt beschrieben – aufgrund der allgemein hohen und homogenen Belastung hinsichtlich der depressiven Symptomatik keine Zusammenhänge zeigten. Eine Untersuchung mit Patienten, deren Depressivitätsgrade stärker streuen, wäre hier möglicherweise aussagekräftiger. 4.2 4.2.1 Posttraumatische Belastungsstörung Häufigkeit der Diagnose Bezüglich der Häufigkeit der PTSD-Diagnose wurde erwartet, dass es nach der Behandlung nicht zu einem vollständigen Rückgang kommen würde. Dies zeigte sich entsprechend der Annahme in der hier beschriebenen Studie: Zum Untersuchungszeitpunkt vier Wochen nach der Therapie wiesen noch 82 % der NET-Patienten und nach wie vor 100 % der SIT-Patienten eine PTSD-Diagnose auf (n = 21, ohne die Therapieabbrecher und diejenigen, bei denen aus anderen Gründen keine Nachuntersuchung durchgeführt werden konnte). Sechs Monate nach Therapieende waren es noch 83 % in der NET- und 80 % in der SIT-Gruppe (n = 22), ein Jahr danach 54 % (n = 11). Die Reduktion der PTSD-Häufigkeit war damit stärker als bei Gotthardt (2007) in einer vergleichbaren Stichprobe zur Sechs-Monats-Nachuntersuchung – es wiesen dort über die Behandlungsbedingungen hinweg noch 94 % eine PTSD auf. Zur Zwei-Jahres-Nachuntersuchung waren es jedoch ebenfalls etwa 80 % (Prozentangaben beziehen sich auf die jeweilige untersuchte Gruppe ohne Abbrecher). In einer Studie von Drozdek (1997) mit bosnischen Flüchtlingen erfüllte hingegen ein deutlich größerer Anteil zur Sechs-Monats-Nachuntersuchung die Kriterien einer PTSD nicht mehr: Lediglich 27 % litten zu diesem Zeitpunkt noch unter einer PTSD, jedoch stieg die PTSD-Rate im Laufe der nächsten drei Jahre wiederum auf 83 % an. In anderen randomisierten kontrollierten Studien mit Expositionstherapie bei Flüchtlingen zeigten sich bereits unmittelbar nach der Behandlung ein Rückgang der PTSD-Rate auf etwa 50 %, diese blieb zu späteren Nachuntersuchungszeitpunkten stabil (Hinton et al., 2005; Paunovic & Öst, 2001). 167 4.2 Posttraumatische Belastungsstörung 4 DISKUSSION In der hier beschriebenen Studie ist für die Gesamtstichprobe der Rückgang der PTSD-Häufigkeit signifikant, zur Ein-Jahres-Nachuntersuchung sogar hochsignifikant. D. h. die Probanden profitierten insgesamt von der Behandlung. Jedoch lässt sich die Reduktion der Diagnosehäufigkeit nicht einer der beiden spezifischen Behandlungsformen zuordnen. Dies ist aus Befunden anderer Studien zur PTSDTherapie erklärbar, die besagen, dass irgendeine Form von Behandlung effektiver ist als keine Behandlung (z. B. Keane et al., 1989; Brom et al., 1989; Resick et al., 2002; Foa et al., 1991, 1999 & 2005; Ruf et al., 2007; Ehlers et al., 2005; Blanchard et al., 2003). Der signifikante Rückgang der PTSD-Rate über beide Therapiebedingungen hinweg trat erst zur Sechs-Monats-Nachuntersuchung auf. In weiteren NET-Studien wurde meist ein verzögerter Therapieerfolg berichtet, dort allerdings auf die Symptomschwere, nicht auf die PTSD-Rate bezogen. Zudem trat diese verzögerte Symptomreduktion in jenen Studien spezifisch für NET und nicht für die jeweilige Gesamtgruppe auf (Neuner et al., 2004b; Onyut et al., 2005; Schaal, 2006). Entgegen dieser Befunde führten verschiedene Expositionsverfahren bei Flüchtlingen in anderen Studien zu unmittelbaren Effekten (Paunovic & Öst, 2001 – auch dort bezogen auf den Schweregrad; Hinton et al., 2005: Rückgang der PTSD-Rate auf 40 %). Für das SIT zeigte sich bei Foa et al. (1991) ein unmittelbarer, signifikanter Rückgang der PTSD-Rate auf 50 %, zur Nachuntersuchung nach etwa drei Monaten waren es 45 %. In einer weiteren Studie kam es zu einer ebenfalls unmittelbar nach der Behandlung auftretenden Reduktion auf 58 % in einer Intent-to-treat-Analyse und auf 42 % bei Probandinnen, die die Therapie zuende brachten (Foa et al., 1999). Dies steht im Gegensatz zu den hier dargestellten Befunden, in denen es zu keinem Zeitpunkt zu einer signifkanten Reduktion der PTSD-Häufigkeit in der SIT-Gruppe kam. Es handelte sich in den Studien von Foa et al. (1991) und Foa et al. (1999) jedoch im Vergleich zur hier untersuchten Stichprobe jeweils um mutmaßlich geringer belastete Personen (siehe auch „4.2.2 Veränderungen des Symptom-Scores im Fragebogen CAPS“). Es ist zu beachten, dass die Betrachtung der Häufigkeit der Diagnose zur Beurteilung des Therapieerfolgs weniger aussagekräftig ist als die Analyse von Veränderungen in den Symptom-Scores: Probanden mit einem hohen Ausgangswert können durchaus eine signifikante Reduktion ihrer Symptomatik erreichen, dabei aber gleichzeitig noch einen Grad von Symptomhäufigkeit und -schwere aufweisen, mit dem die Kriterien für eine PTSD erfüllt bleiben. In der hier beschriebenen Studie war dies der Fall: Die immer noch hohe PTSDRate in der hier untersuchten Stichprobe hängt mit den hohen Ausgangswerten im Fragebogen CAPS zusammen (M = 91,21, SD = 15,44; Minimum 52, Maximum 117; 168 4.2 Posttraumatische Belastungsstörung 4 DISKUSSION maximal möglicher Wert ist 136), siehe auch nächster Abschnitt, „4.2.2 Veränderung des Symptom-Scores im Fragebogen CAPS“. In Stichproben von Flüchtlingen in westlichen Ländern sind CAPS-Summenwerte in dieser Höhe keine Seltenheit, es finden sich Mittelwerte von 75 bis 98 (Paunovic & Öst, 2001; Gotthardt, 2007; Hinton et al., 2005). Im Vergleich dazu wiesen Überlebende von Ziviltraumata, z. B. Verkehrsunfällen, mittlere CAPS-Summenwerte von 64 bis 74 auf (Hickling & Blanchard, 1997; Blanchard et al., 2004; Resick et al., 2002; Bryant et al., 2003). 4.2.2 Veränderung des Symptom-Scores im Fragebogen CAPS Im vorherigen Abschnitt wurde die Veränderung der PTSD-Auftretenshäufigkeit diskutiert. Im Folgenden wird hingegen auf die Veränderung des PTSD-Schweregrades eingegangen. Es wurde angenommen, dass sowohl NET als auch SIT zu einer signifikanten Reduktion der PTSD-Symptomatik führen würden. Eine signifikante Symptomverringerung zeigte sich im Verlauf der Studie sowohl für die Gesamtstichprobe als auch für die NET-Bedingung, entgegen der Erwartungen jedoch nicht für die SIT-Bedingung. In der Gesamtgruppe trat dieser Effekt zwischen Erstdiagnostik und SechsMonats-Nachuntersuchung auf. Für die NET-Gruppe wurde eine signifikante Verringerung der PTSD-Symptomatik nicht bereits zur Vier-Wochen-, sondern erst zur Sechs-Monats-Nachuntersuchung erwartet. Dies zeigte sich in den vorliegenden Daten und stimmte mit den Ergebnissen bisheriger Studien zur NET überein (Neuner et al., 2004b; Onyut et al., 2005; Schaal, 2006). Die Effektstärke von d = 1,42 für die Symptomreduktion zwischen der Erstdiagnostik und der Sechs-Monats-Nachuntersuchung in der NET-Gruppe entspricht derjenigen der Wirkung von Prolonged Exposure (PE) in einer Studie von Foa et al. (1999) sowie von NET bei Neuner et al. (2004b) und Gotthardt (2007) für spätere Nachuntersuchungszeitpunkte. Verglichen mit Angaben aus einer Meta-Analyse von van Etten und Taylor (1998), in der über verschiedenste Trauma-Stichproben hinweg die Effektstärken gemittelt wurden, zeigte sich der hier gefundene NET-Effekt etwas geringer als die mittlere Effektstärke für verhaltenstherapeutische Verfahren (d = 1,89). Es ging jedoch lediglich eine Studie zu PTSD bei Folteropfern in diese Analyse ein, so dass die untersuchten Stichproben größtenteils nicht mit der hier behandelten Gruppe verglichen werden können. Möglicherweise wurde hier aufgrund der geringen Stichprobengröße bei Anwendung von Cohens d die Effektstärke überschätzt (Foa et al., 2000) – eine andere Methode der Effektstärkenberechnung wie z. B. Hedges g anstelle von Cohens 169 4.2 Posttraumatische Belastungsstörung 4 DISKUSSION d wäre eventuell für die hier untersuchte Stichprobe angemessener gewesen. Es wurde sich hier dennoch für das vielfach verwendete Cohens d entschieden, um möglichst vergleichbare Studienergebnisse zu erreichen. Abgesehen davon handelte es sich bei der hier untersuchten Stichprobe um eine sehr heterogene Gruppe mit großer Varianz z. B. hinsichtlich der traumatischen Erlebnisse, der Herkunftsländer etc., so dass es hier im Gegenteil eher zu einer Unterschätzung der Effektstärke gekommen sein könnte. Für die SIT-Gruppe wurde mit einer unmittelbaren Reduktion der PTSD-Symptomatik gerechnet. Jedoch ergab sich weder für den Zeitpunkt vier Wochen noch sechs Monate nach Therapieende ein signifikanter Rückgang der Symptomatik. Die Annahmen wurden anhand von Ergebnissen aus Studien von Foa et al. (1991) und Foa et al. (1999) getroffen. Dass entsprechende Befunde in der hier beschriebenen Studie nicht gefunden werden konnten, kann damit zusammenhängen, dass Foa und Kollegen Vergewaltigungsopfer in den USA behandelten, während die hier untersuchten Probanden verschiedene Traumata über einen längeren Zeitraum hinweg erlebt hatten, die teilweise von erheblicher Schwere waren. Ob die Probanden in den Studien von Foa und Kollegen jedoch tatsächlich weniger schwer belastet waren, lässt sich nicht direkt vergleichen, da der PTSD-Schweregrad nicht wie hier mit dem Fragebogen CAPS erhoben wurde. Foa et al. (1991; 1999) verglichen das SIT ebenfalls mit einer Form von Expositionstherapie, Prolonged Exposure (PE). Es zeigte sich in diesen Studien, dass beide Therapieverfahren hilfreich zur Symptomreduktion der PTSD waren. Jedoch folgerten die Forscher aus den Ergebnissen, dass PE eher zu einer dauerhaften Veränderung des Traumagedächtnisses führt, während SIT kurzfristige Erleichterung bringt und v. a. dann nicht mehr wirken kann, wenn die Patienten die Techniken nicht mehr anwenden. Kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlungsprogramme wie das Stress-Impfungs-Training enthalten zumeist therapeutische Hausaufgaben, d. h. im Falle von SIT das Üben der erlernten Techniken im alltäglichen Umfeld. Dies dient zur Festigung des Gelernten sowie der Sicherstellung, dass die Methoden tatsächlich in den Alltag übertragbar sind. In der hier beschriebenen Studie wurde nicht durchgehend systematisch erhoben, inwieweit die Patienten in der SIT-Gruppe die Übungen zuhause anwendeten. Einige SIT-Patienten gaben jedoch an, zwar an die Übungen gedacht, sie jedoch nicht umgesetzt zu haben. Andere berichteten, dass sie sich in den entsprechenden Stresssituationen gar nicht an die Übungen aus dem SIT erinnert hatten. Es sei auch vorgekommen, dass sie die entsprechenden Techniken zuhause angewendet hatten, ohne einen unmittelbaren stressreduzierenden Effekt zu bemerken 170 4.2 Posttraumatische Belastungsstörung 4 DISKUSSION (vor allem bei starker Belastung). Es ist anzunehmen, dass darunter einige waren, die die Übungen lediglich einmal oder zumindest nur selten ausprobiert hatten, so dass sich der gewünschte Effekt noch gar nicht hätte einstellen können. Der Eindruck „das hilft mir nichts“ könnte in einem solchen Fall rasch dazu geführt haben, dass die Betroffenen es erst recht nicht mehr versuchten. Es ist anzunehmen, dass eher weniger geübt wurde als im Idealfall, so dass sich das Wirkpotenzial des SIT möglicherweise nicht optimal entfalten konnte. Die Mehrzahl der Probanden lebte während des Studienverlaufs in Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch die räumliche Begrenztheit in den Unterkünften und somit fehlende Rückzugsmöglichkeiten (isoplan consult, 2005) dazu beitrugen, dass die SIT-Patienten die gelernten Techniken kaum zuhause übten. Solomon und Johnson (2002) schlagen zur Lösung des Problems mangelnder Übe-Bereitschaft vor, das SIT um Bausteine zu erweitern, die zur Rückfallprophylaxe bzw. Beibehaltung des Gelernten beitragen sollen. Möglicherweise trug auch das geringere Bildungsniveau der Probanden in der hier beschriebenen Studie im Vergleich zu den Patientinnen bei Foa et al. (1991) und Foa et al. (1999) zum Ausbleiben eines Therapieeffektes in der SIT-Gruppe bei. Es bleibt unklar, inwieweit z. B. die Konzepte der Einteilung menschlichen Erlebens in „Gedanken“, „Gefühle“ und „Verhalten“ den Probanden in dieser Studie in gleichem Maße eingängig waren wie denjenigen in den Studien von Foa und Kollegen. Es entstand gelegentlich der Eindruck, dass SIT-Patienten lieber unstrukturiert über alltägliche Probleme o. ä. gesprochen hätten als dem festgelegten Sitzungsprotokoll zu folgen. Zudem weisen Flüchtlinge im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung häufig spezielle Risikofaktoren für die Entwicklung einer PTSD auf: eine hohe Dosis traumatischer Erlebnisse, Stressoren nach dem Trauma (Flucht, räumlich und rechtlich eingeschränkte Lebenssituation im Exilland) etc. Silove und Steel (1998) führen an, dass Stressoren nach der Flucht traumabezogene psychische Probleme noch verstärken. Kinzie und Fleck (1987) berichten, dass bei kambodschanischen Flüchtlingen im Exil in den USA bei erneutem Stress die Intrusionssymptomatik wieder aufflammte. Dieses Phänomen – bezogen auf die gesamte PTSD-Symptomatik – wird auch von Birck (2001) berichtet. Bei den Probanden in der hier beschriebenen Studie wurde zwar die Reaktion auf aktuelle Stressoren nicht systematisch erfasst, jedoch berichteten die meisten beispielsweise nach Erhalt eines Briefs von der Ausländerbehörde (unabhängig vom Inhalt des Schreibens) von einer deutlichen Verschlechterung ihres Befindens. Möglicherweise begünstigen diese Faktoren nicht nur die Ausbildung einer 171 4.2 Posttraumatische Belastungsstörung 4 DISKUSSION PTSD, sondern erschweren darüber hinaus auch die Reduktion der Symptomatik. Bezüglich dieser möglichen Stressoren im Exilland unterschieden sich NETund SIT-Probanden allerdings nicht signifikant. Jedoch hatten die Patienten in der NET-Gruppe trotz dieser Risikofaktoren eine signifikante Symptomverbesserung erreicht, die in der SIT-Gruppe ausblieb. Es lässt sich also nicht der Schluss ziehen, dass die genannten Faktoren eine Symptomreduktion generell verhindern. Basoglu (1993) merkt an, dass Ergebnisse von Studien mit Flüchtlingen im Exil schwierig zu interpretieren sind, da diese Personen auch durch das Verlassen ihres Heimatlandes und den damit verbundenen Stressoren und Veränderungen psychisch beeinträchtigt sein könnten. Diese Effekte ließen sich nicht von Funktionsbeeinträchtigungen aufgrund früherer Traumatisierungen trennen. Es wurde in der hier dargestellten Untersuchung auch der Einfluss von NET und SIT auf die einzelnen Symptombereiche der PTSD betrachtet. In den Intrusionssymptomen zeigte sich insgesamt keine Veränderung, während in der NETGruppe eine signifikante Reduktion der Vermeidungs- und Übererregungssymptomatik zwischen der Erstdiagnostik und sowohl der Vier-Wochen- als auch der Sechs-Monats-Nachuntersuchung auftrat. In anderen randomisierten kontrollierten Studie zu Expositionsverfahren bei PTSD zeigte sich stets auch eine signifikante Reduktion der Intrusionssymptome (Foa et al., 1991; Gotthardt, 2007; Schaal, 2006; Bichescu, 2006; Maercker et al., 2006; Igreja et al., 2004). Wie weiter oben erwähnt, berichteten Kinzie und Fleck (1987) von einem Wiederaufflammen von Intrusionen bei Flüchtlingen, die erneuten aktuellen Stressoren ausgesetzt waren. Möglicherweise fanden solche Vorgänge auch in der hier untersuchten Stichprobe im Zuge laufender Asylverfahren und belastender Lebensumstände im Flüchtlingswohnheim statt. Die Effektstärken für die Reduktion der Vermeidungs- und Übererregungssymptomatik entsprachen denjenigen, die auch Maercker et al. (2006) fanden. Sie waren etwas höher als diejenigen bei Gotthardt (2007) in einer Intent-toTreat-Analyse für die Vermeidungssymptome und etwas niedriger für die Übererregungs-Reduktion. Eine generelle Schwierigkeit in der NET stellt die Vermeidung sowohl von Seiten des Patienten als auch des Therapeuten dar (Schauer et al., 2005). Bei den Teilnehmern in der hier beschriebenen Studie äußerte sie sich teilweise in Zweifeln gegenüber der Notwendigkeit und Wirksamkeit der Exposition. Um Therapieabbrüchen vorzubeugen und die Compliance der Probanden aufrecht zu erhalten, wurde nach Bedarf wiederholt Psychoedukation über die Wirkmechanismen der Behandlung angeboten. In zwei Fällen erwähnten Patienten in der anfänglichen „lifeline“-Übung besonders belastende Erlebnisse, weigerten sich jedoch in Laufe 172 4.2 Posttraumatische Belastungsstörung 4 DISKUSSION der Therapie, genauer darüber zu sprechen. Die Stichprobe dieser NET-Probanden, bei denen bekannt ist, dass sie ihre belastendsten Erlebnisse nicht detailliert berichtet hatten, war zu klein, um sie mit den anderen Teilnehmern in der NET-Gruppe statistisch vergleichen zu können. Jedoch ist zu vermuten, dass es bei diesen Patienten nicht zu einer Habituation bezüglich dieser schlimmsten Erfahrungen kommen konnte. Belaise, Fava und Marks (2005) vermuten allerdings anhand von Ergebnissen einer Pilotstudie, dass Exposition hinsichtlich des Haupt-Traumas möglicherweise nicht notwendig für eine Symptomreduktion ist, sondern dass eine Konfrontation hinsichtlich der mit dem Trauma verbundenen Reize ausreicht. Sie hatten jedoch lediglich drei Patienten mit dieser Methode behandelt und weisen selbst darauf hin, dass die dargestellten Befunde mit Vorsicht zu interpretieren sind – eine kontrollierte Studie fehlt bislang. Generell ist angesichts der Therapieeffekte für die NET-Gruppe davon auszugehen, dass die NET-Probanden die Vermeidung, über ihre Erlebnisse zu sprechen, mit therapeutischer Unterstützung in ausreichendem Maße überwinden konnten. Bei einer Expositionsbehandlung werden die Symptome anfangs oft erwartungsgemäß stärker, da eine seit langem vermiedene Konfrontation mit den Erinnerungen nun aktiv stattfindet, siehe auch Basoglu et al. (2004) und Tarrier et al. (1999a). In der hier beschriebenen Studie wurde ein möglicher Symptomanstieg im Zuge der NET-Behandlung in der laufenden Therapie nicht systematisch erhoben, jedoch berichteten die Patienten, dass sie teilweise häufiger Alpträume oder Intrusionen im Wachzustand hatten. Diese Phänomene riefen bei den Teilnehmern gelegentlich Zweifel daran hervor, ob es tatsächlich hilfreich sei, über die Vergangenheit zu sprechen. In solchen Fällen wurde wiederholt Psychoedukation über die Wirkmechanismen der Behandlung und insbesondere eine Erklärung für den vorübergehenden Symptomanstieg angeboten. Es bleibt offen, inwieweit die drei Therapieabbrüche in der NET-Bedingung möglicherweise auf einen anfänglichen Symptomanstieg zurückzuführen waren. Vier Wochen nach Beendigung der NETBehandlung zeigte sich kein signifikanter Symptomanstieg. Möglicherweise wäre die Behandlung mit NET noch effektiver in der Symptomreduktion der PTSD gewesen, wenn neben dem detaillierten Bericht des Erlebten weitere Formen von Exposition, wie z. B. das Aufschreiben der Erinnerungen an das Trauma durch den Patienten selbst, oder das Aufsuchen des Orts, an dem das Trauma passiert ist, stattgefunden hätten. Ehlers et al. (2005) führten beispielsweise eine Studie zu Cognitive Therapy mit den genannten Expositionsformen durch. Es zeigten sich Effektstärken über d = 2,0 für Veränderungen im Fragebogen CAPS. Allerdings ist anzumerken, dass die Stichprobe bei Ehlers et al. (2005) 173 4.2 Posttraumatische Belastungsstörung 4 DISKUSSION aus Probanden mit gemischten Traumata und mittlerer Symptomschwere bestand und kaum mit der hier behandelten Personengruppe zu vergleichen ist. Ein umfassenderes Expositionsspektrum wäre zudem mit den Probanden der hier beschriebenen Studie kaum möglich gewesen. Zum einen wären die meisten Klienten beispielsweise nicht in der Lage gewesen, ihre Geschichte auf Deutsch niederzuschreiben, da sie zu geringe Deutschkenntnisse hatten – selbst in ihrer eigenen Sprache wären einige dazu nicht fähig gewesen. Zum anderen hatten die meisten Traumata in den Herkunftsländern der Patienten stattgefunden, in die sie nicht zurückkehren konnten oder wollten. Teilweise hätte die Rückkehr – abgesehen von organisatorischen und rechtlichen Schwierigkeiten – eine tatsächliche erneute Gefahr mit sich bringen können. Zudem hatten die meisten Patienten eine Vielzahl traumatischer Ereignisse erlebt, so dass unklar gewesen wäre, auf welche Orte man sich hätte konzentrieren sollen. Jedoch ist bemerkenswert, dass die NET auch ohne weitere Expositionsformen zu einer signifikanten Reduktion der PTSDSymptomatik führte. Dies zeigt, dass Traumatherapie mit Exposition auch mit vergleichsweise geringem organisatorischen Aufwand möglich und effektiv ist. Für den Einsatz in Krisengebieten müssen Therapieverfahren pragmatisch und unaufwändig sein. Die NET wurde als Kurzzeittherapie für diesen Zweck entwickelt und entspricht den Anforderungen in hohem Maße. In anderen randomisierten kontrollierten Studien mit Flüchtlingen in westlichen Ländern wurden bislang lediglich Expositionsverfahren systematisch untersucht (Hinton et al., 2005; Paunovic & Öst, 2001; Gotthardt, 2007). Es ist also noch unklar, ob kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlungskonzepte ohne Exposition wie das SIT in vergleichbaren Settings zu ähnlichen Ergebnissen wie den hier beschriebenen führen würden. Trotz der bedeutsamen Symptomreduktion in der NET-Gruppe in der hier beschriebenen Studie ist zu beachten, dass sich die Symptomwerte in den beiden Therapiebedingungen zu keinem Untersuchungszeitpunkt signifikant unterschieden. Es kann daher nicht der Schluss gezogen werden, dass es den Probanden der NETBedingung besser ging als denjenigen in der SIT-Bedingung. 4.2.3 Funktionsbeeinträchtigung Hinsichtlich der Funktionsbeeinträchtigung kam es für die Gesamtstichprobe zu einer signifikanten Reduktion über die Zeit. Diese Veränderung zeigte sich zwischen der Erstdiagnostik und der Sechs-Monats-Nachuntersuchung. Bei getrennter Betrachtung der beiden Behandlungsgruppen trat diese Reduktion jedoch we- 174 4.2 Posttraumatische Belastungsstörung 4 DISKUSSION der für NET noch für SIT auf. Offenbar fand eine allgemeine Verringerung der Funktionsbeeinträchtigung im Zuge der therapeutischen Behandlungen statt, ohne dass dieser Effekt auf eines der spezifischen Therapieverfahren zurückgeführt werden kann. Dieser Befund spiegelt möglicherweise ebenso wie bei der Reduktion der PTSD-Rate in der Gesamtstichprobe Erkenntnisse anderer Studien zur PTSDBehandlung wider, die zeigen konnten, dass irgendeine Form von Therapie effektiver ist als keine Therapie (z. B. Keane et al., 1989; Brom et al., 1989; Resick et al., 2002; Foa et al., 1991, 1999 & 2005; Ruf et al., 2007; Ehlers et al., 2005; Blanchard et al., 2003). Soweit der Autorin bekannt ist, wurde in keiner anderen Studie zu PTSD die Funktionsbeeinträchtigung im Fragebogen CAPS in quantifizierter Form berichtet und analysiert. Wenn sie überhaupt betrachtet wurden, wurden sie mit anderen Instrumenten gemessen oder ausschließlich qualitativ benannt (z. B. Basoglu et al., 2004; Bichescu, 2006; Weine et al., 1998; Resick et al., 2002; Kubany et al., 2004). Lediglich bei Tarrier et al. (1999b) wurde in einer Vergleichsstudie zu imaginativer Exposition und kognitiver Therapie bei Probanden mit verschiedenen TraumaArten das soziale Funktionieren in der CAPS berichtet. Die Veränderung des sozialen Funktionsniveaus zur Ein-Jahres-Nachuntersuchung erreichte in beiden Therapiegruppen ebenso wie hier beschrieben keine Signifikanz. Darüber hinaus können keine Vergleiche mit anderen Ergebnissen auf quantitativer Ebene vorgenommen werden. Da unklar ist, ob in den Studien, in denen keine Aussagen über das Funktionsniveau der Probanden gemacht wurde (z. B. Paunovic & Öst, 2001; Hinton et al., 2005), keine diesbezügliche Verbesserung stattfand oder die Informationen gar nicht erst erhoben oder analysiert wurden, ist auch ein Vergleich auf qualitativer Ebene wenig sinnvoll. Es lässt sich immerhin feststellen, dass in einigen Studien zur Therapie von PTSD eine Verbesserung des Funktionsniveaus berichtet wird (z B. Weine et al., 1998; Tarrier et al., 1999a; Resick et al., 2002; Kubany et al., 2004; Foa et al., 1999 & 2005; Ehlers et al., 2005). Die meisten dieser Studien untersuchten jedoch Probanden nach zivilen Traumata, die möglicherweise generell geringer belastet waren als die hier untersuchten Überlebenden organisierter Gewalt (zur Studie von Foa, 1999: siehe auch „4.2.2 Veränderungen des Symptomscores im Fragebogen CAPS“). 4.2.4 Begleitsymptome Es wurden die Gesamtscores der Begleitsymptome aus dem Fragebogen CAPS sowie die Scores der Symptom-Untergruppen „Schuldgefühle“ und „Dissoziati- 175 4.2 Posttraumatische Belastungsstörung 4 DISKUSSION onssymptome“ betrachtet. In den Analysen zeigten sich keine Veränderungen der Begleitsymptomatik über die Zeit. Auch zwischen den beiden Therapiegruppen bestanden zu keinem Untersuchungszeitpunkt signifikante Unterschiede in den dissoziativen Symptomen. Möglicherweise handelt es sich bei Schuldgefühlen um Symptome, die mit Depressivität im Zusammenhang stehen – letztere hatte sich in der hier beschriebenen Studie über die Zeit hinweg nicht signifikant verändert. Dies könnte erklären, weshalb auch keine Veränderung der Schuldgefühle auftrat. Dissoziative Symptome könnten mit dem Auftreten von Flashbacks, die zur Symptomgruppe der Intrusionen gehören, in Zusammenhang stehen. Wie weiter oben angeführt, zeigte sich in der untersuchten Stichprobe keine signifikante Veränderung der Intrusionssymptomatik, was eventuell das Ausbleiben einer Veränderung der Dissoziationssymptome erklären könnte. Möglicherweise sind jedoch generell sowohl Schuldgefühle als auch dissoziative Symptome besonders persistent. In anderen Studien zu PTSD, in denen der Fragebogen CAPS eingesetzt wurde, wurden bislang nach dem Kenntnisstand der Autorin keine Analysen zu den Begleitsymptomen vorgestellt (z. B. Paunovic & Öst, 2001; Hinton et al., 2005) – zu dissoziativen Symptomen wurden insgesamt keine Befunde in Behandlungsstudien zur PTSD gefunden. Schuldgefühle wurden in zwei anderen Studien erhoben: Resick et al. (2002) erfassten in einer Therapiestudie mit Vergewaltigungsopfern das Ausmaß traumabezogener Schuldgefühle mit dem Trauma-Related Guilt Inventory. Es zeigte sich, dass sowohl mittels Prolonged Exposure als auch durch Cognitive Processing Therapy eine signifikant stärkere Reduktion des globalen Schuldempfindens erreicht wurde als in der Wartelisten-Kontrollgruppe. Die Probandinnen wiesen jedoch geringere Werte im CAPS-Gesamtscore auf als die Teilnehmer der hier beschriebenen Studie, so dass vermutet werden kann, dass sie insgesamt etwas weniger belastet waren. Möglicherweise erleichtert dies eine Verringerung der Gesamtsymptomatik inklusive der Schuldgefühle. Auch bei Kubany et al. (2004) verringerten sich die traumabezogenen globalen Schuldgefühle bei Frauen mit PTSD infolge häuslicher Gewalt nach einer kognitiven Therapie signifikant (hier ebenfalls erhoben mit dem Trauma-Related Guilt Inventory). Ebenso wie bei Resick et al. (2002) zeigten diese Patientinnen vor der Behandlung geringere CAPSWerte als die in der hier beschriebenen Studie gefundenen, so dass wiederum auf eine geringere Gesamtbelastung geschlossen werden kann. 176 4.3 Depression 4.3 Depression 4.3.1 4 DISKUSSION Häufigkeit der Diagnose Die Rate einer Major Depression komorbid zur PTSD war in der hier dargestellten Studie zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung mit 82 % sehr hoch. Entsprechende Komorbiditätsraten bei Flüchtlingen und Asylbewerbern lagen in anderen Studien zwischen 46 und 86 % (Steel et al., 2004; Ferrada-Noli et al., 1998a; Gotthardt, 2007; Blair, 2000). Die übrigen Patienten wiesen bei der Erstdiagnostik eine dysthyme Störung auf, also litten alle Probanden zu Beginn unter einer affektiven Störung. Dies zeigt, dass die Stichprobe über die PTSD hinaus sehr belastet war. Sechs Monate nach Therapieende erfüllten noch 65 % der Therapieteilnehmer die Diagnose einer depressiven Störung. Diese Rate war im Vergleich zu denjenigen in anderen Untersuchungen mit Flüchtlingen nach wie vor hoch, zumal die Reduktion über die Zeit nicht signifikant war. Niemand wies zu diesem Zeitpunkt mehr die Diagnose einer Dysthymia auf. Auch Gotthardt (2007) fand in zwei verschiedenen Therapiestudien mit vergleichbaren Stichproben keinen signifikanten Rückgang in der Rate affektiver Störungen. Schaal (2006) fand bei Jugendlichen in Ruanda nach einer NET einen Rückgang in der Depressionsrate von 66,7 auf 50 %. Diese Reduktion erreichte jedoch ebenfalls keine Signifikanz. In einer Pilotstudie von Onyut et al. (2005) hatten hingegen die vier Patienten (von n = 6), die vor der Behandlung mit NET eine Depression aufwiesen, zur Nachuntersuchung keine depressive Störung mehr. Bei Neuner et al. (2004b) wurde in einer weiteren NET-Studie die Rate depressiver Störungen nicht erhoben, sondern lediglich der Grad der Depressivität (siehe „4.3.2 Veränderung des Symptom-Scores in der HAM-D“). Gleiches gilt für die kontrollierten Studien zum SIT (Foa et al., 1991 & 1999) – es wurde ebenfalls nur der Schweregrad der Depressivität erfasst. Es lassen sich also bezüglich der Depressionsraten keine Vergleiche zu den hier erhobenen Befunden in der SIT-Gruppe ziehen. Wie bei der PTSD ist es auch für die Beurteilung des Einflusses einer Behandlung auf eine Depression aussagekräftiger, die Veränderung des Schweregrades zu betrachten als die Veränderung in der Auftretenshäufigkeit der Diagnose. Es ist möglich, dass jemand eine signifikante Symptomreduktion aufweist, jedoch gleichzeitig nach wie vor die Kriterien für eine depressive Störung erfüllt. Die Veränderung des Ausmaßes der Depressivität wird im folgenden Abschnitt diskutiert. 177 4.3 Depression 4.3.2 4 DISKUSSION Veränderung des Symptom-Scores in der HAM-D Es wurde angenommen, dass Patienten nach einem SIT deutlich reduzierte Depressionswerte aufweisen würden. Im Gegensatz zur NET enthält das SIT verschiedene Elemente, die auch zur Behandlung depressiver Symptome eingesetzt werden (z. B. kognitives Umstrukturieren, geleiteter Selbstdialog, Rollenspiele). Diese wurden in der hier beschriebenen Studie entsprechend dem Manual von Foa auf Inhalte angewendet, die sich auf die PTSD bezogen. Jedoch bestehen viele Überschneidungen zwischen PTSD- und Depressionssymptomen, so dass in der hier beschriebenen Studie beispielsweise Themen wie Schuldgefühle oder sozialer Rückzug durchaus in einem SIT behandelt werden konnten. Entsprechend wäre ein positiver Einfluss des SIT auf den Grad der Depressivität zu erwarten gewesen. Dies zeigte sich jedoch nicht: Es kam zu keiner signifikanten Veränderung des Depressivitätsscores über die Zeit. In Studien von Foa et al. (1991) und Foa et al. (1999) führte SIT zu einem bedeutsamen Rückgang der Depressionssymptomatik. Wie in den Abschnitten zur PTSD bereits ausgeführt, waren die Probandinnen in diesen Studien mutmaßlich insgesamt weniger belastet als die Teilnehmer an der in dieser Arbeit beschriebenen Studie. Hier rührte die Belastung der Teilnehmer zu einem großen Teil von ihrem zumeist unsicheren Aufenthaltsstatus und den damit verbundenen Stressoren wie etwa fehlende Arbeitsmöglichkeit etc. her (siehe auch weiter unten). Auch innerhalb der NET-Gruppe trat keine signifikante Veränderung der Depressivität auf. Dies deckt sich teilweise mit Befunden aus anderen Studien, in denen NET untersucht wurde (Neuner et al., 2004b; Gotthardt, 2007). Im Verlauf der genannten Studien waren die Probanden ebenso wie in der hier beschriebenen Untersuchung jeweils akuten Stressoren ausgesetzt (Unterversorgung mit Nahrungsmitteln bei Neuner et al., 2004b, zumeist unsicherer Aufenthaltsstatus in Deutschland bei Gotthardt, 2007). In den Studien zur NET von Schaal (2006) und Bichescu (2006) zeigte sich jedoch ein signifikanter Rückgang der Depressionsschwere. Die bei Bichescu (2006) untersuchten Probanden waren keinen vergleichbaren akuten Stressoren ausgesetzt. Hingegen lebten die untersuchten Jugendlichen in Ruanda durchaus unter belastenden Umständen (z. B. unregelmäßiges Einkommen, Leben in Haushalten ohne Erwachsene etc.) und zeigten dennoch eine signifikante Verbesserung in ihrer depressiven Symptomatik. Bezüglich weiterer Expositionsverfahren bei Flüchtlingen mit PTSD fanden sich signifikante Therapieerfolge hinsichtlich der Depression: In einer Studie von Hinton et al. (2005) nahm bei kambodschanischen Flüchtlingen nach einer kognitiv-verhaltenstherapeutischen Behandlung mit 178 4.3 Depression 4 DISKUSSION Exposition der Stress im Zusammenhang mit depressiven Symptomen (erhoben mit der Symptom Checklist-90-R) signifikant ab. Paunovic und Öst (2001) fanden in einer Studie mit zwei verschiedenen Expositionsverfahren bei nicht allzu schwer belasteten Flüchtlingen in Schweden einen starken Rückgang in der Depressivität. Es ist zu beachten, dass NET eine spezifische Traumabehandlung ist, in der andere psychische Probleme nicht explizit aufgegriffen werden. In den aufgeführten Studien stellte Exposition häufig lediglich einen Teil des Behandlungskonzeptes dar. Es ist denkbar, dass diese weiteren Therapiebausteine einen positiven Einfluss auf eine depressive Symptomatik hatten. Entsprechende Effekte sind in einer NET aufgrund der hohen Spezifität mit geringerer Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Es bleibt jedoch generell unklar, ob das Ausmaß der Depressivität zwischen den Teilnehmern der verschiedenen Studien vergleichbar war. Möglicherweise waren die hier untersuchten Teilnehmer hinsichtlich depressiver Symptome insgesamt schwerer belastet als diejenigen in anderen Studien. Zumindest in der Studie von Paunovic und Öst (2001) wurden lediglich Probanden einbezogen, die geringen Belastungen ausgesetzt waren. Der zumeist unsichere Aufenthaltsstatus könnte in hohem Ausmaß zur Aufrechterhaltung des Depressivitätsgrades beigetragen haben. Lehmann (2007) fand in einer vergleichbaren Stichprobe von 45 Asylbewerbern in Deutschland, dass die Depressivität im Zusammenhang mit der Erlangung eines sicheren Aufenthaltsstatus’ signifikant abnahm. In der hier dargestellten Studie wurde zwar kein Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Depressionssymptomatik und dem Asylstatus beobachtet, jedoch hatte sich letzterer im Verlauf auch nicht signifikant verändert. Lediglich drei Probandinnen, die zunächst einen unsicheren Aufenthaltsstatus innehatten, hatten am Ende der Studie einen sicheren Status erlangt. Die Unsicherheit während des laufenden Asylprozesses stellt eine akute und andauernde Belastung dar (Wenk-Ansohn, 2007). Wie unter „1.3.3 Rechtliche Situation von Asylbewerbern in Deutschland“ ausgeführt, bringt ein unsicherer Aufenthaltsstatus nicht nur die Angst vor einer Abschiebung mit sich, sondern zudem erhebliche Einschränkungen im Alltagsleben (oftmals fehlende Arbeitserlaubnis, beengte Wohnverhältnisse, geringer finanzieller Spielraum etc.). Zusammen mit migrationsbedingten Stressoren wie Verlust der Heimat, sprachliche Schwierigkeiten sowie in manchen Fällen Trennung von Angehörigen erhöhen diese Umstände das Risiko, an einer depressiven Störung zu erkranken, in besonderem Maße. Beispielsweise fanden Stankunas, Kalediene, Starkuviene und Kapustinskiene (2006) einen Zusammenhang von Arbeitslosigkeit (v. a. länger andauernder), geringerer Bildung und niedrigerem Einkommen mit depressiven Erkrankungen. 179 4.3 Depression 4 DISKUSSION Dalgard und Thapa (2007) stellten fest, dass Immigranten aus nicht-westlichen Ländern in Norwegen ein deutlich höheres Stressniveau aufwiesen als Norweger oder Immigranten aus westlichen Ländern. Es ist anzunehmen, dass diese Faktoren nicht nur die Entstehung psychischer Störungen begünstigen, sondern darüber hinaus eine Besserung der Symptomatik im Rahmen einer Therapie erschweren. Die Einschränkungen in der Lebenssituation von Asylbewerbern in Deutschland lassen sich im Licht der Theorie der „gelernten Hilflosigkeit“ von Seligman und Kollegen betrachten (z.B. Seligman & Altenor, 1980; Miller & Seligman, 1976). Die Forscher stellten fest, dass fehlende Einflussmöglichkeiten auf eine bedrohliche Situation zu depressiven Symptomen führen sowie diese aufrecht erhalten. Dies zeigt sich auf motivationaler, kognitiver und emotionaler Ebene: Personen, die die Erfahrung fehlender Kontrolle über eine aversive Situation machen, suchen weniger Lösungsmöglichkeiten, es fällt ihnen schwerer, auf positive Veränderungen der Situation zu reagieren, und sie erleben Angst und depressive Gefühle. Asylbewerber, die auf den Ausgang ihres Asylverfahrens warten, zu dem sie nach der ersten Anhörung meist kaum Beiträge leisten können, und deren finanzielle, sprachliche, soziale, arbeits- sowie freizeitbezogene Spielräume extrem eingeschränkt sind, erleben ausgeprägte Hilflosigkeit und Kontrollverlust. Das Risiko, an einer Depression zu erkranken, ist in einer solchen Lebenssituation sehr hoch. Die erzwungene Passivität verhindert die Suche nach Lösungsmöglichkeiten, beeinträchtigt das Selbstvertrauen und führt bei längerer Dauer des Asylverfahrens zu einer Aufrechterhaltung der depressiven Symptomatik (Wenk-Ansohn, 2007). Es ist zu beachten, dass die Verwendung des Fragebogens HAM-D zur Erfassung der Depressivität möglicherweise nicht ideal war. Bagby, Ryder, Schuller und Marshall (2004) kritisieren die Gütekriterien der mittlerweile seit über 40 Jahren verwendeten HAM-D und zweifeln an, dass der Fragebogen ein gutes Messinstrument für den Depressionsschweregrad sei. Bei der Konzeption der hier beschriebenen Studie bestand jedoch die Notwendigkeit, ein FremdeinschätzungsInstrument auszuwählen, da die Probanden zumeist nicht ausreichend Deutsch sprechen und lesen konnten. Zwar sind einige Selbstauskunfts-Fragebögen in verschiedenen Sprachen erhältlich, jedoch gibt es kein Instrument, das in allen in dieser Studie auftretenden Sprachen vorhanden gewesen wäre. Aus diesem Grund fiel die Wahl auf die HAM-D, obwohl sie nicht als optimal geeignetes Depressionsmaß angesehen wurde. 180 4.3 Depression 4.3.3 4 DISKUSSION Suizidalität Die Ausprägung der Suizidalität wurde mit dem Fragebogen M.I.N.I. erhoben. Es fanden sich diesbezüglich zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung folgende Befunde: Insgesamt waren fast 90 % der Probanden in unterschiedlichem Ausmaß suizidal. Dies ist ein extrem hoher Prozentsatz. Die meisten Probanden (fast 40 %) wiesen eine hohe Suizidalität auf, bei 21 % lag ein mittleres, bei knapp 29 % ein geringes Suizidrisiko vor. In einer Studie von Gotthardt (2007) wiesen deutlich weniger Probanden suizidale Tendenzen auf (56 %). Auch in einer Untersuchung von Schaal (2006) waren von Jugendlichen, die den Genozid in Ruanda überlebt hatten, weniger als 40 % suizidal. Das Ausmaß der Suizidalität änderte sich im Verlauf der Studie lediglich bezogen auf die Rate derjeniger Patienten, die zu Beginn ein hohes Suizidrisiko aufwiesen. In der Gesamtstichprobe nahm der Anteil der Teilnehmer mit hohem Suizidrisiko signifikant ab. Dies war auch der Fall, wenn die Therapieabbrecher aus der Analyse ausgeschlossen wurden, obwohl zwei Patientinnen mit hohem Suizidrisiko die Teilnahme an der Behandlung abbrachen. Innerhalb der NET-Gruppe verringerte sich bei Einschluss der Therapieabbrecher die Rate der Patienten mit hohem Suizidrisiko signifikant. Schloss man jedoch diejenigen aus, die die Behandlungen nicht bis zum Ende durchführten, zeigte sich für die NET-Probanden lediglich ein abnehmender Trend bezüglich des Anteils der hochsuizidalen Patienten. Dies hängt damit zusammen, dass die beiden oben genannten Patientinnen mit hohem Suizidrisiko, die aus der Behandlung ausgestiegen waren, zur NET-Gruppe gehörten (siehe auch „4.6 Therapieabbrecher“). Es bleibt unklar, ob diese Patientinnen generell zu belastet waren, um an einer regelmäßigen ambulanten Therapie teilzunehmen. Möglicherweise hätten sie ebenso eine Behandlung mit SIT vorzeitig beendet. In der SIT-Gruppe lag die Verringerung des hohen Suizidrisikos sowohl bei Ein- als auch bei Ausschluss der Therapieabbrecher im Bereich von Trends. Die Befunde zeigen, dass eine Behandlung generell einen positiven Einfluss auf Patienten hatte, die zu Beginn ein hohes Suizidrisiko aufwiesen. Der insgesamt sehr ausgeprägten Suizidalität wurde somit immerhin die Spitze genommen. Der Ausschluss der Therapieabbrecher spielte hierbei für die Gesamtstichprobe keine Rolle, jedoch für die Analyse des hohen Suizidrisikos in der NET-Gruppe. Es brachen zwar zwei NET-Patientinnen aufgrund hoher Suizidalität die laufende Behandlung ab. Jedoch lassen sich aufgrund der geringen Teilnehmerzahl keine genaueren Analysen der Abbruchgründe in beiden Therapiebedingungen vorneh- 181 4.4 Zusammenhang PTSD – Depressivität 4 DISKUSSION men. Die Gesamtgruppe der Behandlungsabbrecher unterschied sich hinsichtlich der Suizidalität jedenfalls nicht von den Nicht-Abbrechern. Inwieweit die beiden Behandlungsformen positive Auswirkungen auf ein hohes Suizidrisiko hatten, lässt sich lediglich unter Ausschluss der Therapieabbrecher analysieren. Unter dieser Bedingung zeigten sowohl NET als auch SIT Tendenzen zur Reduktion des hohen Risikos. Man kann anhand dieser Befunde also nicht den Schluss ziehen, dass eine der beiden Therapiebedingungen geeigneter wäre, um eine Abnahme der Rate hoher Suizidalität zu erzielen. Würde man eine größere Stichprobe untersuchen, könnten möglicherweise verschiedene Untergruppen von Therapieabbrechern identifiziert und potenzielle Zusammenhänge mit spezifischen Therapiebedingungen betrachtet werden. Hinsichtlich aller Abstufungen von Suizidalität zeigten sich zu keinem Untersuchungszeitpunkt Unterschiede zwischen der NET- und der SIT-Gruppe. Daraus lässt sich folgern, dass eine Expositionsbehandlung nicht notwendigerweise eine höhere Suizidalität nach sich zieht als eine Behandlung ohne Expositionsanteile. Bei Gotthardt (2007) zeigte sich in einer Stichprobe von Asylbewerbern, die in Deutschland lebten, ein signifikanter Rückgang der Suizidalität in der Gesamtstichprobe, zusätzlich war der Rückgang in der NET-Behandlungsgruppe signifikant stärker als in der Standardbehandlungs-Gruppe. In einer Studie von Schaal (2006) führten hingegen weder NET noch Interpersonelle Psychotherapie (IPT) zu signifikanten Veränderungen der Suizidalität. In den bisherigen kontrollierten Studien zum SIT von Foa et al. (1991) und Foa et al. (1999) wurde Suizidalität nicht erhoben. Daher kann kein Vergleich hinsichtlich der Einflüsse von SIT auf diesen Symptombereich gezogen werden. 4.4 Zusammenhang zwischen dem Schweregrad von posttraumatischer Belastungsstörung und Depressivität Es zeigte sich ein sehr starker Zusammenhang zwischen dem Schweregrad der PTSD und der Depressivität zu allen Zeitpunkten und über alle Probanden hinweg. Dies ist hauptsächlich dadurch zu erklären, dass die Depressivitätsskala HAM-D ein Fremdeinschätzungs-Instrument und so konzipiert ist, dass der Untersucher die erhobenen und beobachteten Informationen aus dem diagnostischen Interview mit einfließen lässt. In der hier beschriebenen Studie wurde die Symptomeinschätzung nach der Durchführung des PTSD-Fragebogens CAPS vom Interviewer vorgenommen. Die Angaben aus der CAPS wurden für viele Items der HAM-D übernommen. Jedoch werden in der HAM-D einige im vorangegangenen Interview 182 4.5 Weitere komorbide Störungen 4 DISKUSSION noch nicht abgefragte Bereiche beurteilt. Zudem geht der klinische Eindruck des Patientenverhaltens in die Bewertung mit ein. D. h. die hohe Übereinstimmung ist nicht allein durch die Übertragung der in der CAPS bereits erhobenen Informationen in die HAM-D zu erklären. Vielmehr spiegeln die Befunde auch die hohe Komorbidität zwischen posttraumatischer und depressiver Symptomatik wider. 4.5 Weitere komorbide Störungen Es wurden mithilfe des Fragebogens M.I.N.I. folgende weitere Störungen neben PTSD und affektiven Störungen erhoben: Panikstörung mit oder ohne Agoraphobie, Agoraphobie ohne vorherige Panikstörung, soziale Phobie, Zwangsstörung, Alkohol- und sonstiger Substanzmissbrauch, psychotische Störung aktuell oder in der Vorgeschichte, Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa und generalisierte Angststörung. In der untersuchten Stichprobe traten keine Fälle von Anorexia Nervosa oder Bulimia Nervosa auf, so dass im Folgenden lediglich auf die weiteren genannten Störungen eingegangen wird. Es ist zu beachten, dass sich die folgenden Angaben zu komorbiden Störungsbildern auf geringe Fallzahlen beziehen und damit starken Zufallsschwankungen unterliegen können. Die gefundenen Häufigkeitswerte sind daher nicht sehr verlässlich. Es lässt sich also kein direkter Vergleich zu den angeführten Häufigkeitsbefunden aus weiteren Studien ziehen. 4.5.1 Häufigkeit von Angst- und Zwangsstörungen Zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung wurden in der Gesamtstichprobe bei 7,1 % der Probanden eine Panikstörung ohne Agoraphobie festgestellt, bei 21,4 % eine Panikstörung mit Agoraphobie (Gesamtrate an Panikstörungen: 14,25 %) und bei 3,6 % eine Agoraphobie ohne vorausgegangene Panikstörung. Gotthardt (2007) fand in einer Untersuchung mit einer vergleichbaren Stichprobe von Asylbewerbern eine Rate von Panikstörung ohne Agoraphobie von 3,8 % sowie eine Panikstörung mit Agoraphobie bei 7,7 % der Probanden. In einer Studie zur Komorbidität bei PTSD in der Allgemeinbevölkerung fanden Kessler et al. (1995) eine allgemeine Panikstörungs-Rate von knapp 10 %. Diese liegt etwas niedriger als die hier gefundene Gesamtrate von Panikstörungen, zumal Kessler und Kollegen auch Angaben zur Lebenszeitprävalenz einbezogen hatten (siehe auch Fußnote 2 auf Seite 60). Die Rate komorbider Agoraphobie lag bei Kessler et al. (1995) bei etwa 19 % und war deutlich höher als die hier gefundene Prävalenz (wiederum sei jedoch auf die Einbeziehung von Angaben zur Lebenszeitprävalenz bei Kessler et al. hingewie183 4.5 Weitere komorbide Störungen 4 DISKUSSION sen). Auch bei Hepp et al. (2006a) lag die Rate von Agoraphobie komorbid zu einer subsyndromalen PTSD mit 36,4 % um ein Vielfaches höher als in der hier beschriebenen Studie. Es liegen auch zur Agoraphobie bisher keine Daten zur Prävalenz in Flüchtlingspopulationen vor. Eine komorbide soziale Phobie wurde zum Zeitpunkt der Erstdiagnostik bei 7,4 % der Probanden diagnostiziert. Bolton et al. (2000) fanden eine Rate bei Überlebenden eines Schiffsunglücks von 8,2 %. Bei Gotthardt (2007) lag die Rate sozialer Phobie bei Asylbewerbern mit PTSD bei 3,8 %. In Untersuchungen in der Allgemeinbevölkerung lagen die Komorbiditätszahlen jedoch um einiges höher (28 % bei Kessler et al., 1995 – siehe Fußnote 2 auf Seite 60; 36,4 % bei Hepp et al. (2006a) in einer Stichprobe mit subsyndromaler PTSD). Orsillo et al. (1996) diagnostizierten bei Vietnam-Veteranen eine sehr hohe Rate komorbider sozialer Phobie von 72 %. Bei Ferrada-Noli et al. (1998a) findet sich in einer Untersuchung mit Flüchtlingen eine allgemeine Rate komorbider Angststörungen von 29 %. Eine Zwangsstörung wurde in der hier beschriebenen Stichprobe bei 10,7 % der Befragten gefunden. Bei Gotthardt (2007) zeigte keiner der untersuchten Asylbewerber dieses Störungsbild komorbid zur PTSD. Bolton et al. (2000) fanden Raten komorbider Zwangsstörungen von etwa 5 % bei Überlebenden eines Schiffsunglücks. Es lag bei 3,6 % der Befragten eine generalisierte Angststörung vor. Bei Gotthardt (2007) waren es 20 % sowie 15,9 % bei Kessler et al. (1995) – siehe hierzu jedoch wiederum Fußnote 2 auf Seite 60. Die geringe Rate generalisierter Angststörungen in dieser Studie ist möglicherweise folgendermaßen zu erklären: Symptome einer solchen Störung waren bei vielen Probanden vorhanden. Jedoch kann die Diagnose nur dann vergeben werden, wenn das Grübeln und die Sorgen exzessiv sind bzw. durch eine andere vorliegende psychische Störung besser erklärt werden. Da sich die meisten Probanden in einem laufenden Asylverfahren mit unklarem Ausgang und drohender Abschiebegefahr befanden, wurden die auf diese reale Unsicherheit bezogenen Sorgen nicht als exzessiv eingestuft. Zudem wurden Grübeleien, die im Rahmen der PTSD oder einer affektiven Erkrankung auftraten, nicht als Symptome einer generalisierten Angststörung betrachtet. Es bleibt unklar, ob entsprechende Abwägungen in den Studien von Gotthardt (2007) und Kessler et al. (1995) vorgenommen wurden. 184 4.5 Weitere komorbide Störungen 4.5.2 4 DISKUSSION Häufigkeit von Substanzmissbrauch In der hier beschriebenen Studie wiesen 7,1 % der Probanden zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung die Diagnose „Alkoholmissbrauch“ und 3,6 % die Diagnose „Substanzmissbrauch“ auf. Gotthardt (2007) fand in einer Stichprobe von Asylbewerbern mit PTSD eine Rate von Substanzmissbrauch bei 3,8 % der Probanden. Bei Überlebenden eines Schiffsunglücks zeigte sich in einer Untersuchung von Bolton et al. (2000) eine Substanzabhängigkeits-Rate von 2,6 %. In der Allgemeinbevölkerung wurden deutlich höhere Raten von Alkohol- und Substanzmissbrauch bzw. abhängigkeit komorbid zu einer PTSD zwischen 29 und 40 % gefunden (Chilcoat & Breslau, 1998; Kessler et al., 1995 – beachte hierzu Fußnote 2 auf Seite 60). In der Allgemeinbevölkerung fanden Hepp et al. (2006a) bei 9 % der Befragten Missbrauch oder Abhängigkeit von Benzodiazepinen komorbid zu einer subsyndromalen PTSD. Die relativ geringe Rate an Alkohol- oder Drogenmissbrauch in der hier vorgestellten Studie kann einerseits darin begründet liegen, dass viele Probanden Muslime waren und angaben, aus religiösen Gründen weder Alkohol noch sonstige Substanzen zu konsumieren. Zum anderen nahmen 86 % der Teilnehmer ohnehin bereits Medikamente ein – zumeist Psychopharmaka und Schmerzmittel. Möglicherweise reduzierte dies die Wahrscheinlichkeit, zusätzlich Alkohol oder Drogen einzunehmen. 4.5.3 Häufigkeit psychotischer Störungen Zu psychotischen Störungen bei Flüchtlingen mit PTSD liegen bislang keine Untersuchungen vor. In der hier beschriebenen Studie wurde die Diagnose einer aktuellen psychotischen Störung in 3,6 % der Fälle vergeben, ebenso häufig wurde eine psychotische Störung in der Vorgeschichte diagnostiziert (in letzterem Fall handelt es sich also nicht um eine Komorbiditätsangabe im Sinne von gleichzeitigem Vorhandensein der Störung und einer PTSD). In Studien mit Kriegsveteranen fanden sich deutlich höhere Prävalenzzahlen von 40 % bis 50 % (David et al., 1999; Sautter et al., 1999). Es ist jedoch anzumerken, dass für die hier vorgestellte Studie das Bestehen einer Schizophrenie ein Ausschlusskriterium darstellte und es sich um eine kleine Stichprobe handelte, was die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer psychotischen Störung verringerte. Es zeigten zwar einige Probanden einzelne psychotische Symptome, jedoch nicht in einem Ausmaß, das die Diagnose einer psychotischen Störung gerechtfertigt hätte. 185 4.6 Therapieabbrecher 4.5.4 4 DISKUSSION Veränderung der Raten weiterer komorbider Störungen im Verlauf der Studie Es war von Interesse, wie sich NET und SIT auf die Raten komorbider Störungen auswirken würden. Es stellte sich heraus, dass weder in der Gesamtstichprobe noch in den beiden Behandlungsgruppen getrennt betrachtet signifikante Veränderungen der Komorbiditätsraten auftraten. Auch Gotthardt (2007) fand keine signifikante Veränderung komorbider Erkrankungen in einer Studie mit Asylbewerbern, unabhängig davon, ob die Probanden zusätzlich zur Standardbehandlung mit NET behandelt worden waren oder nicht. Bei Neuner et al. (2004b) veränderten sich die Raten komorbider Erkrankungen bei sudanesischen Flüchtlingen in Uganda nach einer Behandlung mit NET, unterstützender Beratung und Psychoedukation ebenfalls nicht signifikant. Die Befunde spiegeln die Spezifität von NET als traumafokussiertes Therapieverfahren wider. Zur Reduktion komorbider Störungen scheinen ergänzende Therapiebausteine notwendig zu sein. Hinsichtlich des Einflusses von SIT auf psychische Störungen komorbid zu PTSD liegen bislang kaum Befunde vor. Es existiert lediglich der Entwurf eines spezifischen Therapieprogramms für PTSD und komorbiden Substanzmissbrauch, das u. a. SIT beinhaltete (Triffleman, Carroll & Kellogg, 1999). Jedoch ist hierzu noch keine Behandlungsstudie veröffentlicht worden. SIT wurde nicht nur zur PTSDBehandlung, sondern auch bei einem breiten Spektrum verschiedener Indikationen eingesetzt. Es sind der Autorin jedoch auch unabhängig vom Kontext der Komorbidität mit PTSD keine Studien zum Einfluss von SIT auf die hier erhobenen weiteren psychischen Störungen bekannt. 4.6 Therapieabbrecher Die Rate von Abbrüchen der laufenden Therapien lag bei insgesamt 17,9 % (15,4 % in der SIT- und 20 % in der NET-Bedingung). Im Vergleich mit anderen Therapiestudien bei PTSD liegen diese Abbruchquoten eher niedriger, in jedem Fall jedoch in einem üblichen Rahmen (z. B. Resick et al., 2002; Foa et al., 1991, 1999 und 2005; van Minnen et al.; Ehlers et al., 2005). Bei Gotthardt (2007) brachen in einer Studie mit vergleichbaren Stichproben zum Vergleich von NET und externer Standardbehandlung 12,5 % der NET-Patienten und niemand aus der Vergleichgruppe die Teilnahme ab. Zur Nachuntersuchung zwei Jahre später fielen aus der Gruppe der Patienten mit Standardbehandlung knapp 40 % der Probanden weg, in der NET186 4.6 Therapieabbrecher 4 DISKUSSION Bedingung waren es etwa 25 %. In einer weiteren Studie zum Vergleich von „Standardbehandlung“ mit „Standardbehandlung ergänzt durch NET“ lagen die Abbruchquoten bei etwa 40 % (Gotthardt, 2007). Die Abbruchrate bei NET in der hier beschriebenen Studie liegt höher im Vergleich zu anderen Studien, in denen NET in Uganda und Rumänien untersucht wurde (Neuner et al., 2004b; Bichescu, 2006; Onyut et al., 2005). Allerdings wurden in diesen Studien jeweils lediglich vier bis sechs Therapiesitzungen durchgeführt, was einen Therapieabbruch unwahrscheinlicher gemacht haben dürfte. Zudem ist das gesamte Setting der hier beschriebenen Untersuchung kaum mit den genannten Therapiestudien vergleichbar. Bei anderen Studien mit Flüchtlingen in westlichen Ländern lagen die Abbruchraten zwischen 0 und 47 %, wobei die verschiedensten Gründe für die Abbrüche vorlagen (z. B. Abschiebung ins Herkunftsland) oder aber gar keine genaueren Begründungen angegeben wurden. In der vorliegenden Studie ist bemerkenswert, dass sich die Abbruchraten für NET und SIT nicht signifikant unterschieden. Beide Verfahren wurden also in gleichem Maße von den Probanden akzeptiert. Dieses Ergebnis ist konsistent mit Befunden von Hembree, Foa, Dorfan, Street, Kowalski und Tu (2003), die die Abbrecherraten bei Exposition, Cognitive Therapy, SIT und EMDR verglichen und herausfanden, dass es bei Expositionsverfahren nicht zu häufigeren Abbrüchen kommt als bei den anderen Verfahren. Jedoch unterschieden sich in der hier beschriebenen Studie die Abbrecher der beiden Behandlungsbedingungen hinsichtlich der Gründe für den Abbruch: Zwei von drei Probandinnen brachen die NET-Behandlung ab, weil sie akut suizidal waren und in stationäre psychiatrische Behandlung kamen, wohingegen die beiden Abbrecher in der SITBedingung die Therapie aus anderen Gründen abbrachen. Letztere Gründe sind nicht genauer bekannt – außer der Tatsache, dass die beiden Patienten nicht in stationäre Behandlung kamen, bleibt unklar, inwieweit sich ihre Situation überhaupt von denen der anderen Abbrecher unterschied. Möglicherweise fiel es den beiden bereits vor Beginn der Behandlung ausgeprägt suizidalen Patientinnen in der NETBedingung schwer, einen möglichen anfänglichen Symptomanstieg zu tolerieren, der bei Exposition zu erwarten ist (Tarrier et al., 1999a, siehe auch „1.5.3 Weitere kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen ohne Exposition“). Es ist allerdings nicht bekannt, ob es bei den beiden Patientinnen tatsächlich zu einem Symptomanstieg kam. Zudem bedeutete ausgeprägte Suizidalität in der Studie nicht generell, dass die Behandlung oder insbesondere eine NET nicht bis zum Ende durchgeführt werden konnte: Es gab keinen Unterschied zwischen Abbrechern und Nicht-Abbrechern hinsichtlich der Suizidalität. Die beiden genannten Patientinnen waren zwar jeweils bereits in der Vorgeschichte in stationärer Be187 4.7 Einschränkungen der Studie 4 DISKUSSION handlung gewesen, es hatte sich jedoch kein Unterschied zwischen Therapieabbrechern und den übrigen Probanden hinsichtlich vorheriger stationärer Aufenthalte gezeigt. Somit bleibt unklar, ob und inwieweit sie sich von den anderen Abbrechern und den übrigen Probanden unterschieden, die die Behandlung zu Ende geführt hatten. Schnyder (2005) fordert, dass weitere Studien zu unterschiedlichen Behandlungsformen der PTSD durchgeführt werden sollen, um Patienten verschiedene Therapiemöglichkeiten anbieten zu können und auf diese Weise die Abbruchraten zu senken sowie die Effektivität der Behandlungen zu steigern. 4.7 Einschränkungen der Studie 4.7.1 Länge der Therapiesitzungen in den beiden Bedingungen Die Länge der einzelnen Therapiesitzungen wurde nicht systematisch gemessen. Anhand der Videoaufnahmen wurde jedoch deutlich, dass eine SIT-Sitzung üblicherweise kürzer und eine typische NET-Sitzung länger als 90 Minuten dauerte. Es lässt sich also nicht ausschließen, dass die umfangreichere therapeutische Zuwendung in der NET-Gruppe zur signifikanten PTSD-Reduktion in dieser Behandlungsbedingung geführt hatte. Allerdings untersuchten van Minnen und Foa (2006), inwiefern sich die Sitzungslänge einer Expositionsbehandlung auf den Therapieerfolg hinsichtlich der PTSD-Symptomatik auswirkte. Es zeigte sich, dass es keinen Unterschied machte, ob die Sitzung 30 oder 60 Minuten dauerte – beide Varianten führten zu vergleichbarer Symptomreduktion. Es ließe sich also der Schluss ziehen, dass auch bei kürzeren NET-Sitzungen ähnliche Therapieerfolge erzielt worden wären. Unklar bleibt, inwieweit eine Verlängerung der SIT-Sitzungen zu einem positiveren Therapieergebnis geführt hätten. Die Inhalte jeder Sitzung waren genau vorgegeben. Diese waren innerhalb von eineinhalb Stunden sehr gut zu vermitteln. Darüber hinaus hätte man lediglich mehr Zeit zum Üben der erlernten Techniken einräumen können. Es ist möglich, dass dies den Therapieerfolg hätte erhöhen können – vor allem hinsichtlich geringer Compliance gegenüber der Anwendung der Übungen im häuslichen Umfeld. Foa et al. (1991) und Foa et al. (1999) hielten in zwei Studien zum Vergleich von Prolonged Exposure (PE), Stress-Impfungs-Training und unterstützender Beratung bzw. einer Kombination aus PE und SIT die Sitzungsdauer über alle Bedingungen hinweg konstant. In beiden Studien erwiesen sich sowohl PE als auch SIT als erfolgreich in der Reduktion der PTSD-Symptomatik. Es ist denkbar, dass in 188 4.7 Einschränkungen der Studie 4 DISKUSSION der hier beschriebenen Untersuchung bei konstanter Sitzungslänge in beiden Therapiegruppen vergleichbare Ergebnisse erzielt worden wären. Turner, Valtierra, Talken, Miller und DeAnda (1996) verglichen zwei Patientengruppen, die dieselbe Anzahl an psychotherapeutischen Sitzungen durchliefen. Jedoch dauerten diese entweder 30 oder 50 Minuten. Es zeigte sich, dass die kürzeren Sitzungen zu ebenso guten Verbesserungen in Hinblick auf Symptomverbesserungen und Zufriedenheit der Probanden führten wie die länger andauernden. Es handelte sich dabei allerdings um eher gering belastete Studenten. Die Autoren ziehen den Schluss, dass die Therapie an sich einen deutlich größeren Einfluss auf die Symptomatik hatte als die Sitzungsdauer. In der in dieser Arbeit beschriebenen Studie lassen sich die Faktoren „Sitzungslänge“ und „Therapiebedingung“ nicht getrennt voneinander betrachten. Es ist jedoch denkbar, dass auch hier die Behandlung an sich eine größere Rolle spielte als die Sitzungsdauer. Auch in einer Studie von Barkham, Connell, Miles, Stiles, Margison und Mellor-Clark (2006) zeigte sich, dass es für eine erfolgreiche Psychotherapie nicht notwendigerweise einer bestimmten (Mindest-)Behandlungsdauer bedarf (hier allerdings in Anzahl der Sitzungen gemessen), bzw. dass der Bedarf an Psychotherapie bis zum Erreichen einer zufrieden stellenden Verbesserung individuell sehr unterschiedlich ist. 4.7.2 Stichprobengröße Die untersuchte Stichprobe weist nur eine geringe Größe auf. Dies liegt nicht an einem Mangel an Flüchtlingen in Deutschland, die organisierte Gewalt erlebt haben und in der Folge an einer PTSD leiden. Studien zeigen, dass ca. 40 % der Flüchtlinge bei ihrer Erstanhörung eine PTSD aufweisen (Gäbel, 2004). Allerdings kamen in den letzten Jahren wie unter „1.3.2 Zahlen zu Flüchtlingen in Deutschland“ immer weniger Asylsuchende nach Deutschland, was sich auch in den Neuanmeldungen in der Psychologischen Ambulanz für Flüchtlinge der Universität Konstanz bemerkbar macht. Diese Studie war jedoch aus Gründen mangelnder Personalkapazität angesichts des Aufwandes für jede einzelne Behandlung inklusive der vier Termine für die psychodiagnostischen Untersuchungen bis zu einem Jahr nach Therapieende nicht in größerem Rahmen durchführbar. Jedoch hat sie Pioniercharakter und sollte idealerweise mit einer größeren Probandenzahl wiederholt werden. 189 4.7 Einschränkungen der Studie 4.7.3 4 DISKUSSION Unwissenheit der Interviewer in den Nachuntersuchungen gegenüber der Therapiebedingung Da alle Behandlungen und diagnostische Interviews von Mitarbeitern der Psychologischen Forschungs- und Modellambulanz für Flüchtlinge durchgeführt wurden und häufig ein Austausch über die laufenden Therapien im Sinne einer Intervision stattfand, waren die Interviewer in den Nachuntersuchungen oft nicht unwissend („blind“) gegenüber der Therapiebedingung, in die ein Patient eingeteilt worden war. Jedoch wurde darauf geachtet, dass jede Nachuntersuchung von einem Mitarbeiter durchgeführt wurde, der zuvor noch keinen Kontakt zu dem jeweiligen Patienten gehabt hatte. Blanchard et al. (2003) hatten zwar in einer Behandlungsstudie eine entgegengesetzte Strategie eingesetzt: Es wurde dort pro Patient derselbe Untersucher für alle Diagnostiksitzungen hinzugezogen, um Rating-Unterschiede im einzelnen Fall auszuschließen. Die Interviewer waren in der Studie von Blanchard et al. (2003) blind gegenüber der Behandlungsbedingung und unabhängig von den Therapeuten. Diese Strategie hätte in der hier beschriebenen Studie jedoch nicht zum Einsatz kommen können, da es zumeist organisatorisch nicht möglich gewesen wäre, die Interviewer in Unwissenheit gegenüber den Bedingungen sowie unabhängig vom Ambulanzbetrieb zu belassen. Insofern schien in diesem Fall das Vorgehen, die jeweiligen Interviewer zumindest „blind gegenüber dem Patienten“ bzw. dessen vorausgegangener Befindlichkeit zu halten, eine angemessene Alternative zu sein. 4.7.4 Arbeit mit Dolmetschern Bei fast 80 % der Teilnehmer der Therapiestudie fanden die Gespräche mit Hilfe von trainierten Dolmetschern statt. Inwieweit diese Form der Kommunikation möglicherweise öfter zu einer fehlerhaften Verständigung führte oder die Anwesenheit einer weiteren Person in der Therapie den Behandlungserfolg beeinflusst haben könnte, bleibt unklar. Abdallah-Steinkopff (1999) nennt eine Reihe von möglichen Schwierigkeiten, die in der Zusammenarbeit mit Dolmetschern bei der Behandlung von Flüchtlingen mit PTSD auftreten können: Beispielsweise kann es zu Konflikten aufgrund politischer, ethnischer oder religiöser Differenzen kommen, ein Dolmetscher kann in einen Loyalitätskonflikt geraten, wenn der Patient ihn bittet, dem Therapeuten manche Dinge nicht zu sagen, oder sich weigern, bestimmte tabuisierte Themen zu übersetzen. Derartige Probleme wurden in der hier beschriebenen Studie jedoch nicht berichtet. 190 4.7 Einschränkungen der Studie 4 DISKUSSION Green, Ngo-Metzger, Legedza, Massagli, Phillips und Iezzoni (2005) fanden heraus, dass asiatische Patienten mit geringen Englischkenntnissen in den USA in der allgemeinen Gesundheitsversorgung offener waren, wenn der Behandler ihrer eigenen Sprache mächtig war, als wenn mit Übersetzern gearbeitet wurde. Es konnte lediglich mit einer kleinen Gruppe von Patienten ohne Dolmetscher gearbeitet werden, so dass keine systematischen Vergleiche zwischen diesen Probanden und denjenigen durchgeführt werden konnten, bei denen Dolmetscher dabei gewesen waren. In der Studie von Green et al. (2005) waren die Patienten bei Hinzuziehen eines Dolmetschers zufriedener mit der Gesundheitsversorgung, je höher sie die Qualität der Übersetzung einschätzten. In der hier beschriebenen Studie wurde die Zufriedenheit der Probanden mit der Arbeit der Dolmetscher nicht erfasst. Die Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Dolmetscher wurde jedoch von keinem der Patienten verweigert. Karliner, Jacobs, Chen und Mutho (2007) führten eine Metaanalyse zur Qualität der Gesundheitsfürsorge für Patienten mit unzureichenden Englischkenntnissen in den USA mithilfe von professionellen Dolmetschern versus untrainierten Übersetzern (z. B. Familienmitgliedern) durch. Es zeigte sich, dass Übersetzungen durch professionelle Dolmetscher mit einer Verbesserung der Versorgungsqualität einhergingen: Es traten insgesamt weniger Kommunikationsfehler auf als beim Einsatz von untrainierten Übersetzern, und die Patienten verstanden besser, was die Behandler ihnen vermitteln wollten. In einer der analysierten Studien führten psychiatrische Interviews mit professionellen Dolmetschern zu denselben Einschätzungen hinsichtlich der psychischen Gesundheit sowie der Familiengeschichte wie Interviews durch Behandler, die dieselbe Sprache wie die Patienten sprachen. Zudem zeigten sich zumindest in medizinischen Studien bessere Gesundungserfolge. Die Patienten selbst waren mit Kommunikation und Versorgung zufriedener. Gotthardt (2007) merkt an, dass es nicht nur von Nachteil sein müsse, in Anwesenheit einer weiteren Person über traumatische Erlebnisse zu sprechen: Es könne dem Betroffenen ebenso gut zu der Erkenntnis verhelfen, dass das Anhören belastender Geschichten nicht nur von Therapeuten, sondern auch von anderen Personen ertragen werden kann. Dies könnte wiederum dabei helfen, das Schweigen zu durchbrechen, mit dem traumatisierte Menschen abgesehen von der eigenen Vermeidung oftmals ihr Umfeld vor dem vermeintlich unerträglichen Wissen über das Erlebte schützen wollen. Abgesehen davon ist das Arbeiten mit Dolmetschern oftmals die einzige Möglichkeit, um Asylbewerbern mit unzureichenden Deutschkenntnissen überhaupt eine Psychotherapie anbieten zu können. Es wäre 191 4.8 Stärken der Studie 4 DISKUSSION aus ethischen Gesichtspunkten heraus nicht vertretbar, diesen Personen keine Behandlung anzubieten, nur weil eine Übersetzung möglicherweise einen Therapieerfolg schmälern könnte. Zudem ermöglichen Dolmetscher nicht nur eine sprachliche Verständigung, sondern sind auch Kulturmittler (Abdallah-Steinkopff, 1999) und können so zum besseren Verständnis etwa kulturspezifischer Erklärungen von Symptomen verhelfen. 4.8 4.8.1 Stärken der Studie Vergleich zweier aktiver Behandlungsverfahren Mit der hier dargestellten randomisierten kontrollierten Studie wurde erstmals ein Vergleich zweier aktiver psychotherapeutischer Behandlungsmethoden bei Asylbewerbern und Flüchtlingen mit PTSD im deutschsprachigen Raum durchgeführt. Bislang wurde ansonsten lediglich von Gotthardt (2007) untersucht, welchen Einfluss eine spezifische Traumabehandlung (Narrative Expositionstherapie) im Vergleich zu irgendeiner Standardbehandlung auf die PTSD-Symptomatik von Flüchtlingen hatte. Gotthardt analysierte zudem anhand einer kleinen Stichprobe, inwieweit NET in die übliche Behandlung durch niedergelassene Therapeuten integriert werden konnte sowie den Therapieerfolg beeinflusste. Weitere Studien im deutschsprachigen Raum sind unkontrolliert und wenig aussagekräftig (Birck, 2001; Birck, 2004; Schwarz-Langer et al., 2006). 4.8.2 Abgrenzung der Verfahren hinsichtlich Exposition Die einzige kontrollierte Studie zum Vergleich zweier aktiver PTSD-Behandlungsverfahren bei Flüchtlingen in westlichen Ländern wurde von Paunovic und Öst (2001) in Schweden durchgeführt. Hier wurden jedoch zwei Therapiemethoden gewählt, die jeweils Expositionsbausteine enthielten. Nach dem Kenntnisstand der Autorin handelt es sich bei der hier beschriebenen Studie um die erste überhaupt, in der Therapieverfahren bei Flüchtlingen mit PTSD solchermaßen ausgewählt wurden, dass sie hinsichtlich Exposition und Vergangenheits- bzw. Gegenwartsbezug eindeutig voneinander abgrenzbar waren. 4.8.3 Einbeziehung einer stark belasteten Stichprobe Die hier untersuchte Stichprobe umfasste größtenteils schwer belastete Asylbewerber in unklaren und unsicheren Lebenssituationen. Die meisten sprachen nicht ausreichend Deutsch, so dass mit Dolmetschern gearbeitet wurde. Mit vergleichbaren 192 4.9 Ausblick 4 DISKUSSION Populationen wurden bisher in westlichen Ländern kaum Studien durchgeführt. Beispielsweise schlossen Paunovic und Öst (2001) Probanden mit diesen Charakteristika aus ihrer Therapiestudie aus. Soweit der Autorin bekannt ist, lagen hierzu bislang zumindest keinerlei Ergebnisse aus randomisierten kontrollierten Therapiestudien vor. Eine Ausnahme stellt die Studie von Gotthardt (2007) dar. 4.8.4 Durchführbarkeit und Erfolg von Exposition Die in dieser Arbeit dargestellte Studie zeigt auf, dass Expositionsverfahren wie NET auch mit Asylbewerbern und Flüchtlingen durchführbar und erfolgreich sind, obwohl diese zumeist eine hohe PTSD-Symptomatik, mangelnde Deutschkenntnisse und einen unsicheren Asylstatus aufwiesen. Hingegen führte die Behandlung mit Stress-Impfungs-Training nicht zu einer bedeutsamen Symptomreduktion. Möglicherweise waren die Probanden zu schwer erkrankt, um mithilfe von Techniken zur Stressreduktion, die ein hohes Engagement erfordern, eine Verbesserung der Symptomatik zu erreichen. Vermutlich trug die mangelnde Anwendung der erlernten Übungen im Alltag zum Ausbleiben eines Therapieerfolgs bei, ohne die ein solches Behandlungsprogramm seine Wirkung kaum ausreichend entfalten kann. Auch kulturelle und bildungsbezogenen Aspekte könnten eine Symptomreduktion in der SIT-Gruppe erschwert haben. 4.9 Ausblick Die in dieser Arbeit dargestellte Studie leistet einen Beitrag zur Auswahl geeigneter Therapiemethoden für Flüchtlinge in westlichen Ländern, die nach dem Erleben organisierter Gewalt eine PTSD entwickelt haben. Es wurden erstmals zwei aktive, zuvor bereits für wirksam befundene Behandlungsverfahren miteinander verglichen. Insbesondere die Abgrenzbarkeit der beiden Therapiemethoden in Hinblick auf Exposition stellt eine Neuerung auf dem Gebiet der Behandlungsstudien mit traumatisierten Flüchtlingen dar. Die wichtigste unmittelbar anstehende Weiterführung dieser Studie besteht in der Einbeziehung der Daten aus den Ein-Jahres-Nachuntersuchungen. Es lagen zum Zeitpunkt der Datenauswertung die Befunde von sieben Patienten aus der NET- und vier Patienten aus der SIT-Bedingung vor. Sollten die noch ausstehenden Ein-Jahres-Nachuntersuchungen planmäßig durchgeführt werden können, werden für diesen Zeitpunkt insgesamt Daten von acht NET- und sieben SIT-Patienten vorliegen. Zum einen interessiert, ob der positive Therapieeffekt der NET über 193 4.9 Ausblick 4 DISKUSSION die Zeit stabil bleibt. Zum anderen soll betrachtet werden, ob sich in der PTSDSymptomatik der SIT-Probanden weiterhin keine signifikante Veränderung ergibt. Idealerweise sollte die Studie mit einer größeren Stichprobe wiederholt werden. Es gilt v. a. den potenziellen therapeutische Nutzen von SIT weiter zu untersuchen, denn die Effektivität von Expositionsbehandlungen auch bei Flüchtlingen und Asylbewerbern ist bereits in mehreren Studien aufgezeigt worden. In einer Replikationsstudie sollte die Sitzungslänge in den verschiedenen Therapiebedingungen konstant gehalten werden, um mögliche Therapieeffekte aufgrund längerer Behandlungszeiten in einer Bedingung ausschließen zu können. Möglicherweise könnte es sinnvoll sein, zu diesem Zweck die Dauer der SIT- denen der NET-Sitzungen anzupassen und die zusätzliche Zeit im SIT für weitere Übungen zu nutzen. Dies könnte einen Ausgleich zur geringen Compliance gegenüber der häuslichen Anwendung der erlernten Techniken darstellen. Interviewer sollten zu den Nachuntersuchungszeitpunkten blind gegenüber der therapeutischen Bedingung des jeweiligen Probanden sein. Wie in der hier beschriebenen Studie sollten professionelle Dolmetscher eingesetzt werden, um eine hohe Qualität der Behandlung zu gewährleisten. Die verwendeten Fragebögen wurden sorgfältig ausgewählt, um den Gegebenheiten der Studie bestmöglich zu entsprechen und eine hohe Güte der erhobenen Daten zu erreichen. Jedoch kann eine Therapie zu positiven Veränderungen der Lebensqualität führen, die anhand dieser oder ähnlicher Fragebögen nicht adäquat erfasst werden können: So war beispielsweise eine Probandin vor der Behandlung mit SIT nicht in der Lage, ohne ihren Ehemann im Supermarkt einzukaufen. Im Anschluss an das SIT gelang es ihr wieder, alleine einkaufen zu gehen, und somit ihren Handlungsspielraum sowie ihre Selbstständigkeit erheblich zu erweitern. Eine weitere Probandin, die sich vor der Behandlung durch NET lediglich zu den notwendigsten Besorgungen aus dem Haus begeben hatte, baute sich nach der Therapie wieder ein vielfältiges soziales Netzwerk auf. Ein anderer NET-Patient entschied sich im Anschluss an die Behandlung für eine freiwillige Rückkehr in sein Herkunftsland Türkei, obwohl er dort zuvor Folter erlebt hatte. Diese Veränderungen bilden sich höchstens indirekt in den psychodiagnostischen Instrumenten ab, etwa in den Angaben zur Funktionsbeeinträchtigung. Jedoch ist denkbar, dass diese Verbesserungen für den einzelnen Probanden eine deutlich entscheidendere Erleichterung der Belastung darstellen als die mittels Fragebögen messbare Symptomreduktion. Es wäre wünschenswert, auch diese eher inhaltlichen Veränderungen nach einer Behandlung in zukünftigen Studien einzubeziehen, um den Therapieerfolg auf verschiedenen Ebenen zu bewerten. 194 4.9 Ausblick 4 DISKUSSION Schnyder (2005) argumentiert, dass Forschung hinsichtlich der Notwendigkeit von Exposition für eine erfolgreiche Behandlung der PTSD erst begonnen hat und sich möglicherweise Therapiemethoden ohne Exposition ebenfalls als effektiv erweisen könnten. Die hier dargestellten Befunde tragen zur Klärung dieser Frage bei. Abgesehen von der geringen Stichprobengröße und der Tatsache, dass noch nicht alle Daten aus den Ein-Jahres-Nachuntersuchungen vorlagen oder in die Analysen aufgenommen wurden, weisen die Ergebnisse nicht darauf hin, dass ein expositionsfreies Verfahren wie das SIT zur Symptomreduktion bei Flüchtlingen mit PTSD zu empfehlen ist. Es konnte im Gegenteil erneut gezeigt werden, dass Expositionsverfahren zur Behandlung einer PTSD hilfreich sind – sogar in einer Stichprobe von stark belasteten Asylbewerbern und Flüchtlingen in unsicheren und unklaren Lebenssituationen. Angesichts dieser Befunde stellt sich einmal mehr die Frage, weshalb die Behandlungsrichtlinien etwa in England (NICE-Guidelines, National Collaboration Center for Mental Health, 2005) den Einsatz von Expositionsverfahren empfehlen und sogar von anderen Therapieverfahren abraten, während etwa in den deutschen Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. (AWMF, 2006) ohne Anführung entsprechender Evidenzbelege eine nicht näher definierte „Stabilität“ vor Beginn einer dosierten Rekonfrontation mit dem Trauma gefordert sowie vor „zu frühem oder alleinigem Einsatz konfrontierender traumatherapeutischer Verfahren“ gewarnt wird (Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. (AWMF, 2006, http://leitlinien.net/, eingesehen am 16.11.2007). Um nach dem derzeitigen Forschungsstand die Empfehlung des Einsatzes nicht-konfrontativer Verfahren zu rechtfertigen, müssten – wie auch Schnyder (2005) fordert – zunächst kontrollierte Studien durchgeführt werden, die die Effektivität und Notwendigkeit dieser Behandlungsmethoden belegen. Die bisherige Bilanz von psychotherapeutischer Behandlung bei Flüchtlingen und Asylbewerbern mit PTSD in Deutschland fällt jedenfalls ernüchternd aus: Beispielsweise stellten Gotthardt (2007) und Lehmann (2007) jeweils fest, dass Asylbewerber oft ambulante Psychotherapie erhielten, jedoch trotzdem eine hohe PTSDSymptomatik aufwiesen. Es bleibt allerdings unklar, ob sich die Symptomatik der untersuchten Personen zwar im Rahmen dieser psychotherapeutischen Behandlungen reduziert hat, aber die PTSD-Kriterien immer noch erfüllt waren, wie es auch in kontrollierten Therapiestudien häufig der Fall ist. Jedoch wiesen die jeweiligen Probanden in den Studien sehr hohe Symptomwerte auf, was bedeuten würde, dass sie vor Beginn der ambulanten Psychotherapie unter noch ausgeprägterer, extremer Symptomatik gelitten hätten. Eventuell wurde auch in manchen Fällen 195 4.9 Ausblick 4 DISKUSSION eine PTSD nicht erkannt und daher nicht adäquat behandelt. Ein Problem besteht unzweifelhaft darin, dass es kaum Möglichkeiten gibt, in ambulanten psychotherapeutischen Behandlungen in Deutschland einen professionellen Dolmetscher hinzuzuziehen. Gotthardt (2007) untersuchte, welche Behandlungsverfahren in ambulanten psychotherapeutischen Behandlungen von PTSD eingesetzt werden. Es zeigte sich, dass in der Regel ressourcenorientiert bzw. stabilisierend gearbeitet wird – für die Wirksamkeit dieser psychodynamischen Verfahren zur Behandlung einer PTSD existieren allerdings bislang keine wissenschaftlichen Belege. Die therapeutische Vorgehensweise, deren Effektivität hingegen vielfach gezeigt wurde – Exposition – wurde von Behandlern, die ihre Standardvorgehen beschrieben, lediglich in 21 % der Zeit eingesetzt. In der Studie von Gotthardt (2007) konnte zudem gezeigt werden, dass die Ergänzung der Standardbehandlung durch Exposition den Therapieerfolg erhöhte. Auch Herbert (2003) merkt an, dass Patienten oft nicht diejenigen Behandlungsformen erhalten, deren Wirksamkeit am besten wissenschaftlich belegt wurde. Es ist davon auszugehen, dass die Bilanz der Behandlungen von Flüchtlingen und Asylbewerbern mit PTSD in Deutschland positiver ausfallen würde, wenn der Einsatz evidenzbasierter Verfahren einen größeren Anteil in der Therapie einnähme. Hierzu könnte eine Ausrichtung von Behandlungsleitlinien an wissenschaftlichen Erkenntnissen zur erfolgreichen Therapie einer PTSD entscheidend beitragen. 196 LITERATUR Literatur Abdallah-Steinkopff (1999). Psychotherapie bei Posttraumatischer Belastungsstörung unter Mitwirkung von Dolmetschern. Verhaltenstherapie, 9:211–220. American Psychiatric Association (1996). Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM-IV: Übersetzt nach der vierten Auflage des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders der American Psychiatric Association. Hogrefe, Verl. für Psychologie, Göttingen [u.a.]. amnesty international (2005a). amnesty international - Jahresbericht 2005. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main. amnesty international (2005b). Nein zur Folter. Ja zum Rechtsstaat. http:// www2.amnesty.de/internet/deall.nsf/3c7abab8e052c42fc1256eeb004ce861/ 9f87934c699e9e5bc1256fb8004f3aad [eingesehen am 22.8.2006]. Andrews, B., Brewin, C. R., Rose, S. & Kirk, M. (2000). Predicting PTSD symptoms in victims of violent crime: The role of shame, anger, and childhood abuse. J Abnorm Psychol, 109(1):69–73. Applebaum, A. (2005). The torture myth. http://www.washingtonpost.com/ wp-dyn/articles/A2302-2005Jan11.html [eingesehen am 12.2.2007]. Ausländerrecht (2005). Deutsches Ausländerrecht. Deutscher Taschenbuch Verlag, Beck-Texte. AWMF (2006). Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Me- dizinischen Fachgesellschaften. http://leitlinien.net/ [eingesehen am 16.11.2007]. Bagby, R. M., Ryder, A. G., Schuller, D. R. & Marshall, M. B. (2004). The Hamilton depression rating scale: Has the gold standard become a lead weight? Am J Psychiatry. Baker, R. (1992). Psychosocial consequences for tortured refugees seeking asylum and refugee status in Europe. In Basoglu, M., Ed., Torture and its consequences: current treatment approaches, pages 83–106. Cambridge University Press, Cambridge. 199 LITERATUR Barkham, M., Connell, J., Miles, J., Evans, C., Stiles, W., Margison, F. & Mellor-Clark, J. (2006). Dose-effect relations and responsive regulation of treatment duration: The good enough level. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74(1):160– 167. Basoglu, M. (1993). Prevention of torture and care of survivors. An integrated approach. Jama, 270(5):606–11. Basoglu, M., Ekblad, S., Baarnhielm, S. & Livanou, M. (2004). Cognitive-behavioral treatment of tortured asylum seekers: A case study. J Anxiety Disord, 18(3):357–69. Basoglu, M., Livanou, M., Crnobaric, C., Franciskovic, T., Suljic, E., Duric, D. & Vranesic, M. (2005). Psychiatric and cognitive effects of war in former Yugoslavia: Association of lack of redress for trauma and posttraumatic stress reactions. Jama, 294(5):580–90. Basoglu, M., Mineka, S., Paker, M., Aker, T., Livanou, M. & Gök, S. (1997). Psychological preparedness for trauma as a protective factor in survivors of torture. Psychological Medicine, 27:1421–1433. Basoglu, M., Paker, M., Paker, O., Ozmen, E., Marks, I., Incesu, C., Sahin, D. & Sarimurat, N. (1994). Psychological effects of torture: A comparison of tortured with nontortured political activists in Turkey. Am J Psychiatry, 151(1):76–81. Belaise, C., Fava, G. A. & Marks, I. M. (2005). Alternatives to debriefing and modifications to cognitive behavior therapy for posttraumatic stress disorder. Psychotherapy and Psychosomatics, 74:212–217. Bichescu, D. (2006). Long-term consequences of political detention and torture in aged victims: A clinical and psychophysiological assessment and treament study on a Romanian sample. Dissertation, Universität Konstanz. Bichescu, D., Schauer, M., Saleptsi, E., Neculau, A., Elbert, T. & Neuner, F. (2005). Long-term consequences of traumatic experiences: An assessment of former political detainees in Romania. Clin Pract Epidemol Ment Health, 1(1):17. Birck, A. (2001). Torture victims after psychotherapy - a two yrs follow-up. Torture, 11(2):55–58. Birck, A. (2004). Symptomatik bei kriegs- und folterüberlebenden Flüchtlingen mit und ohne Psychotherapie. Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 33 (2):101–109. 200 LITERATUR Blair, R. G. (2000). Risk factors associated with PTSD and major depression among Cambodian refugees in Utah. Health Soc Work, 25(1):23–30. Blake, D. D., Weathers, F. W., Nagy, L. M., Kaloupek, D. G., Gusman, F. D., Charney, D. S. & Keane, T. M. (1995). The development of a clinician-administered PTSD scale. J Trauma Stress, 8(1):75–90. Blanchard, E. B., Hickling, E. J., Devineni, T., Veazey, C. H., Galovski, T. E., Mundy, E., Malta, L. S. & Buckley, T. C. (2003). A controlled evaluation of cognitive behavioural therapy for posttraumatic stress in motor vehicle accident survivors. Behav Res Ther, 41(1):79–96. Blanchard, E. B., Hickling, E. J., Malta, L. S., Freidenberg, B. M., Canna, M. A., Kuhn, E., Sykes, M. A. & Galovski, T. E. (2004). One- and two-yr prospective followup of cognitive behavior therapy or supportive psychotherapy. Behav Res Ther, 42(7):745–59. Blöchliger, C., Tanner, M., Hatz, C. & Junghanss, T. (1997). Asylsuchende und Flüchtlinge in der ambulanten Gesundheitsversorgung: Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Praxis, 86:800–810. Bolton, D., ORyan, D., Udwin, O., Boyle, S. & Yule, W. (2000). The long-term psychological effects of a disaster experienced in adolescence: II: General psychopathology. J Child Psychol Psychiatry, 41(4):513–23. Bowers, J. J. (1992). Therapy through art. Facilitating treatment of sexual abuse. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv, 30(6):15–24. Brady, K. T. (1997). Posttraumatic stress disorder and comorbidity: Recognizing the many faces of PTSD. J Clin Psychiatry, 58(9):12–15. Breslau, N. (2002). Epidemiologic studies of trauma, posttraumatic stress disorder, and other psychiatric disorders. Can J Psychiatry, 47(10):923–9. Breslau, N., Kessler, R. C., Chilcoat, H. D., Schultz, L. R., Davis, G. C. & Andreski, P. (1998). Trauma and posttraumatic stress disorder in the community: The 1996 Detroit area survey of trauma. Arch Gen Psychiatry, 55(7):626–32. Brewin, C. R., Andrews, B. & Rose, S. (2000a). Fear, helplessness, and horror in posttraumatic stress disorder: investigating DSM-IV criterion A2 in victims of violent crime. J Trauma Stress, 13(3):499–509. 201 LITERATUR Brewin, C. R., Andrews, B. & Valentine, J. D. (2000b). Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults. J Consult Clin Psychol, 68(5):748–66. Brewin, C. R., Dalgleish, T. & Joseph, S. (1996). A dual representation theory of posttraumatic stress disorder. Psychol Rev, 103(4):670–86. Brewin, C. R. & Holmes, E. A. (2003). Psychological theories of posttraumatic stress disorder. Clin Psychol Rev, 23(3):339–76. Briere, J., Scott, C. & Weathers, F. (2005). Peritraumatic and persistent dissociation in the presumed etiology of PTSD. Am J Psychiatry, 162(12):2295–301. Brom, D., Kleber, R. J. & Defares, P. B. (1989). Brief psychotherapy for posttraumatic stress disorders. J Consult Clin Psychol, 57(5):607–12. Brucks, U. (2004). Der blinde Fleck der medizinischen Versorgung in Deutschland - Migration und psychische Erkrankung. psychoneuro - Zeitschrift für Praxis und Klinik, 30(4):228–231. Bryant, R. A. & Harvey, A. G. (1998). Relationship between acute stress disorder and posttraumatic stress disorder following mild traumatic brain injury. Am J Psychiatry, 155(5):625–9. Bryant, R. A., Moulds, M. L., Guthrie, R. M., Dang, S. T. & Nixon, R. D. (2003). Imaginal exposure alone and imaginal exposure with cognitive restructuring in treatment of posttraumatic stress disorder. J Consult Clin Psychol, 71(4):706–12. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2005). und Asyl. Teilstatistik: Migration http://www.bamf.de/cln_043/nn_564242/SharedDocs/Anlagen/ DE/DasBAMF/Downloads/statistik-1-migration-asyl.html [eingesehen am 23.1.2006]. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2006). Migration, Asyl und Integration in Zahlen. http://www.bamf.de/cln_011/nn_441702/SharedDocs/Anlagen/ DE/DasBAMF/Publikationen/broschuere-statistik-2005,templateId=raw, property=publicationFile.pdf/broschuere-statistik-2005.pdf [eingese- hen am 29.8.2006]. Bundestag (2005). Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulla Jelpke, Sevim Dagdelen, Kersten Naumann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. http://dip.bundestag.de/btd/16/003/ 1600307.pdf [eingesehen am 3.11.2006]. 202 LITERATUR Burnett, A. & Peel, M. (2001). Asylum seekers and refugees in Britain. The health of survivors of torture and organised violence. Bmj, 322(7286):606–9. Butler, R. W., Mueser, K. T., Sprock, J. & Braff, D. L. (1996). Positive symptoms of psychosis in posttraumatic stress disorder. Biol Psychiatry, 39(10):839–44. Carlson, J. G., Chemtob, C. M., Rusnak, K., Hedlund, N. L. & Muraoka, M. Y. (1998). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) treatment for combatrelated posttraumatic stress disorder. J Trauma Stress, 11(1):3–24. Carta, M. G., Bernal, M., Hardoy, M. C. & Haro-Abad, J. M. (2005). Migration and mental health in Europe (the state of the mental health in Europe working group: appendix 1). Clin Pract Epidemol Ment Health, 1:13. Chilcoat, H. D. & Breslau, N. (1998). Posttraumatic stress disorder and drug disorders: Testing causal pathways. Arch Gen Psychiatry, 55(10):913–7. Cienfuegos, A. J. & Monelli, C. (1983). The testimony of political repression as a therapeutic instrument. Am J Orthopsychiatry, 53(1):43–51. Collinge, W., Wentworth, R. & Sabo, S. (2005). Integrating complementary therapies into community mental health practice: An exploration. J Altern Complement Med, 11(3):569–74. Cooper, J., Carty, J. & Creamer, M. (2005). Pharmacotherapy for posttraumatic stress disorder: Empirical review and clinical recommendations. Aust N Z J Psychiatry, 39(8):674–82. Crits-Christoph, P., Wilson, G. T. & Hollon, S. D. (2005). Empirically supported psychotherapies: Comment on Westen, Novotny, and Thompson-Brenner (2004). Psychol Bull, 131(3):412–7, discussion 427–33. Dalenberg, C. J. & Palesh, O. G. (2004). Relationship between child abuse history, trauma, and dissociation in Russian college students. Child Abuse Negl, 28(4):461– 74. Dalgard, O. S. & Thapa, S. B. (2007). Immigration, social integration and mental health in Norway, with focus on gender differences. Clin Pract Epidemol Ment Health, 3:24. David, D., Kutcher, G. S., Jackson, E. I. & Mellman, T. A. (1999). Psychotic symptoms in combat-related posttraumatic stress disorder. J Clin Psychiatry, 60(1):29– 32. 203 LITERATUR Davidson, J. (1990). Symptom and comorbidity patterns in World War II and Vietnam veterans with PTSD. Comprehensive Psychiatry, 31:162–70. Davis, R. M. & Davis, H. (2006). PTSD symptom changes in refugees. Torture, 16(1):10–19. de Jong, J. T., Komproe, I. H. & Van Ommeren, M. (2003). Common mental disorders in postconflict settings. Lancet, 361(9375):2128–30. Derrienic, J. P. (1971). Theory and ideologies of violence. Journal of Peace Research, 8:361–374. Deutsche Zentrale für biologische Information (o.J.). HAMD. http://www. biologie.de/biowiki/HAMD [eingesehen am 5.2.]. Devilly, G. J. & Spence, S. H. (1999). The relative efficacy and treatment distress of EMDR and a cognitive-behavior trauma treatment protocol in the amelioration of posttraumatic stress disorder. J Anxiety Disord, 13(1-2):131–57. DIMDI (2006). Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten, Ver- letzungen und Todesursachen 9. Revision. http://www.dimdi.de/static/de/ klassi/diagnosen/alt/icd-9-das.htm [eingesehen am 4.9.2006]. Drozdek, B. (1997). Follow-up study of concentration camp survivors from BosniaHerzegovina: Three yrs later. J Nerv Ment Dis, 185(11):690–4. Drozdek, B., de Zan, D. & Turkovic, S. (1998). Short-term group psychotherapy of ex-concentration camp prisoners from Bosnia-Herzegovina. Acta Med Croatica, 52(2):119–25. Drozdek, B., Noor, A., Lutt, M. & Foy, D. (2003). Chronic PTSD and medical services utilization by asylum seekers. Journal of Refugee Studies, 16(2):202–211. Ehlers, A. & Clark, D. M. (2000). A cognitive model of posttraumatic stress disorder. Behav Res Ther, 38(4):319–45. Ehlers, A., Clark, D. M., Dunmore, E., Jaycox, L., Meadows, E. & Foa, E. B. (1998). Predicting response to exposure treatment in PTSD: The role of mental defeat and alienation. J Trauma Stress, 11(3):457–71. Ehlers, A., Clark, D. M., Hackmann, A., McManus, F. & Fennell, M. (2005). Cognitive therapy for post-traumatic stress disorder: Development and evaluation. Behav Res Ther, 43(4):413–31. 204 LITERATUR Ehlers, A., Clark, D. M., Hackmann, A., McManus, F., Fennell, M., Herbert, C. & Mayou, R. (2003). A randomized controlled trial of cognitive therapy, a self-help booklet, and repeated assessments as early interventions for posttraumatic stress disorder. Arch Gen Psychiatry, 60(10):1024–32. Europäisches Netzwerk ICF (o.J.). Die EU-Aufnahmerichtlinie: Grenzen und Chancen für den Flüchtlingsschutz. http://www.proasyl.de/de/informationen/ europ-netzwerk-icf/die-eu-aufnahmerichtlinie/index.html [eingesehen am 3.11.2006]. Eytan, A., Gex-Fabry, M., Toscani, L., Deroo, L., Loutan, L. & Bovier, P. A. (2004). Determinants of postconflict symptoms in Albanian Kosovars. J Nerv Ment Dis, 192(10):664–71. Fazel, M., Wheeler, J. & Danesh, J. (2005). Prevalence of serious mental disorder in 7000 refugees resettled in western countries: A systematic review. Lancet, 365(9467):1309–14. Ferrada-Noli, M., Asberg, M. & Ormstad, K. (1998a). Suicidal behavior after severe trauma. Part 2: The association between methods of torture and of suicidal ideation in posttraumatic stress disorder. J Trauma Stress, 11(1):113–24. Ferrada-Noli, M., Asberg, M., Ormstad, K., Lundin, T. & Sundbom, E. (1998b). Suicidal behavior after severe trauma. Part 1: PTSD diagnoses, psychiatric comorbidity, and assessments of suicidal behavior. J Trauma Stress, 11(1):103–12. FLüAG (1998). Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen (Flüchtlingsaufnehmegesetz FlüAG). http://www.lexsoft.de/lexisnexis/ justizportal_nrw.cgi?sessionID=1235600689521501662&templateID= main&treeOrdnerId=&highlighting=off&xid=167087,1 [eingesehen am 3.11.2006]. Flüchtlingshilfe Berlin (2006). tungsgesetz. Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleis- http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/arbeitshilfen/ krankenhilfe_asylblg.doc [eingesehen am 24.04.2006]. Foa, E. B., Dancu, C. V., Hembree, E. A., Jaycox, L. H., Meadows, E. A. & Street, G. P. (1999). A comparison of exposure therapy, stress inoculation training, and their combination for reducing posttraumatic stress disorder in female assault victims. J Consult Clin Psychol, 67(2):194–200. 205 LITERATUR Foa, E. B., Hembree, E. A., Cahill, S. P., Rauch, S. A., Riggs, D. S., Feeny, N. C. & Yadin, E. (2005). Randomized trial of prolonged exposure for posttraumatic stress disorder with and without cognitive restructuring: Outcome at academic and community clinics. J Consult Clin Psychol, 73(5):953–64. Foa, E. B., Keane, T. M. & Friedman, M. J. (2000). Guidelines for treatment of PTSD. In Studies, I. S. f. T. S., Ed., Effective treatments for PTSD: practice guidelines, page 388. Guilford, New York. Foa, E. B. & Meadows, E. (1997). Psychosocial treatments for posttraumatic stress disorder: A critical review. Annual Review of Psychology, 48:449–480. Foa, E. B., Molnar, C. & Cashman, L. (1995). Change in rape narratives during exposure therapy for posttraumatic stress disorder. J Trauma Stress, 8(4):675–90. Foa, E. B. & Rauch, S. A. (2004). Cognitive changes during prolonged exposure versus prolonged exposure plus cognitive restructuring in female assault survivors with posttraumatic stress disorder. J Consult Clin Psychol, 72(5):879–84. Foa, E. B. & Rothbaum, B. O. (1998). Treating the trauma of rape: Cognitive-behavioral therapy for PTSD. Guilford, New York. Foa, E. B., Rothbaum, B. O., Riggs, D. S. & Murdock, T. B. (1991). Treatment of posttraumatic stress disorder in rape victims: A comparison between cognitivebehavioral procedures and counseling. J Consult Clin Psychol, 59(5):715–23. Folkes, C. E. (2002). Thought field therapy and trauma recovery. Int J Emerg Ment Health, 4(2):99–103. Ford, J. D. (1999). Disorders of extreme stress following war-zone military trauma: Associated features of posttraumatic stress disorder or comorbid but distinct syndromes? J Consult Clin Psychol, 67(1):3–12. Freud, S. (1969). Werke aus den Jahren 1892 - 1899: Studien über Hysterie. Frühe Schriften zur Neurosenlehre. Gesammelte Werke. S. Fischer Verlag. Friedman, M. & Jaranson, J. (1994). The applicability of the posttraumatic stress disorder concept to refugees. In Marsella, A., Ed., Amidst peril and pain: The mental health and wellbeing of world’s refugees., pages 207–227. American Psychiatric Association, Washington, D.C. 206 LITERATUR Gäbel, U. (2004). Epidemiologie und Diagnostizierbarkeit der Posttraumatischen Belastungsstörung bei Asylbewerbern in Deutschland. Diplomarbeit, Humboldt- Universität zu Berlin. Gaffney, M. (2003). Factor analysis of treatment response in posttraumatic stress disorder. J Trauma Stress, 16(1):77–80. Goldfried, M. R., Borkovec, T. D., Clarkin, J. F., Johnson, L. D. & Parry, G. (1999). Toward the development of a clinically useful approach to psychotherapy research. J Clin Psychol, 55(11):1385–405. Gotthardt, S. (2007). Health Care and Treatment of Posttraumatic Stress Disorder in Asylum Seekers in Germany. Dissertation, Universität Konstanz. Green, A. R., Ngo-Metzger, Q., Legedza, A. T., Massagli, M. P., Phillips, R. S. & Iezzoni, L. I. (2005). Interpreter services, language concordance, and health care quality. Experiences of Asian Americans with limited English proficiency. J Gen Intern Med, 20(11):1050–6. Grieger, T. A., Fullerton, C. S., Ursano, R. J. & Reeves, J. J. (2003). Acute stress disorder, alcohol use, and perception of safety among hospital staff after the sniper attacks. Psychiatr Serv, 54(10):1383–7. Hamilton, M. (1960). A rating scale for depression. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, (23):56–62. Hamilton, M. (1967). Development of a rating scale for primary depressive illness. British journal of social and clinical psychology., (6):278–296. Hembree, E. A., Foa, E. B., Dorfan, N. M., Street, G. P., Kowalski, J. & Tu, X. (2003). Do patients drop out prematurely from exposure therapy for PTSD? J Trauma Stress, 16(6):555–62. Hepp, U., Gamma, A., Milos, G., Eich, D., Ajdacic-Gross, V., Rossler, W., Angst, J. & Schnyder, U. (2006a). Inconsistency in reporting potentially traumatic events. Br J Psychiatry, 188:278–83. Hepp, U., Gamma, A., Milos, G., Eich, D., Ajdacic-Gross, V., Rossler, W., Angst, J. & Schnyder, U. (2006b). Prevalence of exposure to potentially traumatic events and PTSD: The Zurich cohort study. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 256(3):151–8. Herbert, J. D. (2003). The science and practice of empirically supported treatments. Behav Modif, 27(3):412–30. 207 LITERATUR Herlihy, J., Scragg, P. & Turner, S. (2002). Discrepancies in autobiographical memories - implications for the assessment of asylum seekers: Repeated interviews study. British Medical Jornal, 324:324–327. Hickling, E. J. & Blanchard, E. B. (1997). The private practice psychologist and manual-based treatments: Post-traumatic stress disorder secondary to motor vehicle accidents. Behav Res Ther, 35(3):191–203. Hinton, D. E., Chhean, D., Pich, V., Safren, S. A., Hofmann, S. G. & Pollack, M. H. (2005). A randomized controlled trial of cognitive-behavior therapy for Cambodian refugees with treatment-resistant PTSD and panic attacks: a cross-over design. J Trauma Stress, 18(6):617–29. Hinton, D. E., Pham, T., Tran, M., Safren, S. A., Otto, M. W. & Pollack, M. H. (2004). CBT for Vietnamese refugees with treatment-resistant PTSD and panic attacks: A pilot study. J Trauma Stress, 17(5):429–33. Hogan, R. A. (1968). The implosive technique. Behav Res Ther, 6(4):423–31. Holtz, T. H. (1998). Refugee trauma versus torture trauma: A retrospective controlled cohort study of Tibetan refugees. J Nerv Ment Dis, 186(1):24–34. Hopkins, W. B., Seltzer, A. & Avigaad, J. (2005). NICE PTSD guidelines - not easily applicable to refugees. http://www.bmj.com/cgi/eletters/330/7499/1038 [eingesehen am 25.7.2007]. Igreja, V., Kleijn, W. C., Schreuder, B. J., Van Dijk, J. A. & Verschuur, M. (2004). Testimony method to ameliorate post-traumatic stress symptoms. Communitybased intervention study with Mozambican civil war survivors. Br J Psychiatry, 184:251–7. isoplan consult (2005). Weißbuch Flüchtlinge und Asylbewerber/innen im Saarland 2004. Bericht, isoplan consult - Sozioökonomische Forschung und Beratung Zwick und Schmidt-Fink GbR. Junod Perron, N. & Hudelson, P. (2006). Somatisation: Illness perspectives of asylum seeker and refugee patients from the former country of Yugoslavia. BMC Fam Pract, 7:10. Kanfer, F., Reinecker, H. & Schmelzer, D. (2000). Selbstmanagement-Therapie - Ein Lehrbuch für die klinische Praxis. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong, Barcelona. 208 LITERATUR Karl, A. (2000). Klinische PTB-Skala für DSM-IV (KPS-TX). Fragebogen, Technische Universität Dresden, Abteilung für Biopsychologie. Karliner, E. A., Jacobs, A., Chen, H. & Mutha, S. (2007). Do professional interpreters improve clinical care for patients with limited English proficiency? A systematic review of the literature. Health Services Research, 42(2):727–754. Kazdin, A. E. (2004). Evidence-based treatments: Challenges and priorities for practice and research. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am, 13(4):923–40, vii. Keane, T. M., Fairbank, J. A., Caddell, J. M. & Zimering, R. T. (1989). Implosive (flooding) therapy reduces symptoms of PTSD in Vietnam combat veterans. Behavior Therapy, 20:245–260. Keller, A., Lhewa, D., Rosenfeld, B., Sachs, E., Aladjem, A., Cohen, I., Smith, H. & Porterfield, K. (2006). Traumatic experiences and psychological distress in an urban refugee population seeking treatment services. J Nerv Ment Dis, 194(3):188– 94. Kennedy, F., Clarke, S., Stopa, L., Bell, L., Rouse, H., Ainsworth, C., Fearon, P. & Waller, G. (2004). Towards a cognitive model and measure of dissociation. J Behav Ther Exp Psychiatry, 35(1):25–48. Kessler, R. C., Sonnega, A., Bromet, E., Hughes, M. & Nelson, C. B. (1995). Posttraumatic stress disorder in the national comorbidity survey. Arch Gen Psychiatry, 52(12):1048–60. Kinzie, J. D. & Fleck, J. (1987). Psychotherapy with severely traumatized refugees. Am J Psychother, 41(1):82–94. Kolassa, I., Wienbruch, C., Neuner, F., Schauer, M., Ruf, M., Odenwald, M. & Elbert, T. (2007). Imagine the trauma: altered cortical dynamics after repeated traumatic stress. unpublished, Universität Konstanz. Krauthammer, C. (2005). The truth about torture. http://www.weeklystandard. com/Content/Public/Articles/000/000/006/400rhqav.asp?pg=1 [eingesehen am 22.8.2006]. Kubany, E. S., Hill, E. E., Owens, J. A., Iannce-Spencer, C., McCaig, M. A. & Tremayne, K. J. (2004). Cognitive trauma therapy for battered women with PTSD (CTT-BW). Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72(1):3–18. 209 LITERATUR Kühn, M., Ehlert, U., Rumpf, H. J., Backhaus, J., Hohagen, F. & Broocks, A. (2006). Onset and maintenance of psychiatric disorders after serious accidents. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 256(8):497–503. Kunzke, D. & Güls, F. (2003). Diagnostik einfacher und komplexer posttraumatischer Störungen im Erwachsenenalter. Psychotherapeut, 48:50–70. Lange, A., van de Ven, J. P. & Schrieken, B. (2003). Interapy: treatment of posttraumatic stress via the internet. Cogn Behav Ther, 32(3):110–24. Lee, C., Gavriel, H., Drummond, P., Richards, J. & Greenwald, R. (2002). Treatment of PTSD: Stress inoculation training with prolonged exposure compared to EMDR. J Clin Psychol, 58(9):1071–89. Lehmann, K. (2007). Psychische Gesundheit und Aufenthaltssituation bei Flüchtlingen. Diplomarbeit, Universität Konstanz. Lillig, M. (2004). Polizisten und Asylbewerber in Duisburg. Duisburger Beiträge zur soziologischen Forschung. Lopes Cardozo, B., Vergara, A., Agani, F. & Gotway, C. A. (2000). Mental health, social functioning, and attitudes of Kosovar Albanians following the war in Kosovo. Journal of the American Medical Association, 284(5):569–577. Lyons, J. & Keane, T. (1989). Implosive therapy for the treatment of combat-related PTSD. Journal of Traumatic Stress, 2(2). Maercker, A., Michael, T., Fehm, L., Becker, E. S. & Margraf, J. (2004). Age of traumatisation as a predictor of post-traumatic stress disorder or major depression in young women. Br J Psychiatry, 184:482–7. Maercker, A. & Schutzwohl, M. (1997). Long-term effects of political imprisonment: A group comparison study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 32(8):435–42. Maercker, A., Zollner, T., Menning, H., Rabe, S. & Karl, A. (2006). Dresden PTSD treatment study: Randomized controlled trial of motor vehicle accident survivors. BMC Psychiatry, 6:29. Marks, I., Lovell, K., Noshirvani, H., Livanou, M. & Thrasher, S. (1998). Treatment of posttraumatic stress disorder by exposure and/or cognitive restructuring: A controlled study. Arch Gen Psychiatry, 55(4):317–25. 210 LITERATUR McFarlane, A. C. & Yehuda, R. (2000). Clinical treatment of posttraumatic stress disorder: Conceptual challenges raised by recent research. Aust N Z J Psychiatry, 34(6):940–53. Miller, G. A., Elbert, T. & Rockstroh, B. (2005). Judging psychiatric disorders in refugees. Lancet, 366(9497):1604–5; author reply 1605. Miller, R. W. & Seligman, M. E. P. (1976). Learned helplessness, depression and the perception of reinforcement. Behaviour Research and Therapy, 14:7–17. Moisander, P. A. & Edston, E. (2003). Torture and its sequel - a comparison between victims from six countries. Forensic Sci Int, 137(2-3):133–40. Mollica, R. F., McInnes, K., Pham, T., Smith Fawzi, M. C., Murphy, E. & Lin, L. (1998a). The dose-effect relationships between torture and psychiatric symptoms in Vietnamese ex-political detainees and a comparison group. J Nerv Ment Dis, 186(9):543–53. Mollica, R. F., McInnes, K., Poole, C. & Tor, S. (1998b). Dose-effect relationships of trauma to symptoms of depression and post-traumatic stress disorder among Cambodian survivors of mass violence. Br J Psychiatry, 173:482–8. Mollica, R. F., McInnes, K., Sarajlic, N., Lavelle, J., Sarajlic, I. & Massagli, M. P. (1999). Disability associated with psychiatric comorbidity and health status in Bosnian refugees living in Croatia. Jama, 282(5):433–9. Mollica, R. F., Sarajlic, N., Chernoff, M., Lavelle, J., Vukovic, I. S. & Massagli, M. P. (2001). Longitudinal study of psychiatric symptoms, disability, mortality, and emigration among Bosnian refugees. Jama, 286(5):546–54. Momartin, S., Silove, D., Manicavasagar, V. & Steel, Z. (2002). Range and dimensions of trauma experienced by Bosnian refugees resettled in Australia. Australian Psychologist, 37(2):149–155. Momartin, S., Silove, D., Manicavasagar, V. & Steel, Z. (2003). Dimensions of trauma associated with posttraumatic stress disorder (PTSD) caseness, severity and functional impairment: A study of Bosnian refugees resettled in Australia. Soc Sci Med, 57(5):775–81. Munro, C. G., Freeman, C. P. & Law, R. (2004). General practitioners’ knowledge of post-traumatic stress disorder: A controlled study. Br J Gen Pract, 54(508):843–7. 211 LITERATUR National Collaboration Center for Mental Health (2005). Post-traumatic stress disorder - The management of PTSD in adults and children in primary and secondary care. Royal College of Psychiatrists, London. Neuner, F. (2003). Epidemiology and Treatment of Posttraumatic Stress Disorder in WestNile Populations of Sudan and Uganda. Dissertation, Universität Konstanz. Neuner, F., Schauer, M., Karunakara, U., Klaschik, C., Robert, C. & Elbert, T. (2004a). Psychological trauma and evidence for enhanced vulnerability for posttraumatic stress disorder through previous trauma among West Nile refugees. BMC Psychiatry, 4:34. Neuner, F., Schauer, M., Klaschik, C., Karunakara, U. & Elbert, T. (2004b). A comparison of narrative exposure therapy, supportive counseling, and psychoeducation for treating posttraumatic stress disorder in an African refugee settlement. J Consult Clin Psychol, 72(4):579–87. Neuner, F., Schauer, M., Roth, W. & Elbert, T. (2002). A narrative exposure treatment as intervention in a refugee camp: A case report. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 30:211–215. Nicholl, C. & Thompson, A. (2004). The psychological treatment of post-traumatic stress disorder (PTSD) in adult refugees: A review of the current state of psychological therapies. Journal of Mental Health, 13(4):351–362. Onyut, L. P., Neuner, F., Schauer, E., Ertl, V., Odenwald, M., Schauer, M. & Elbert, T. (2005). Narrative exposure therapy as a treatment for child war survivors with posttraumatic stress disorder: Two case reports and a pilot study in an African refugee settlement. BMC Psychiatry, 5(1):7. Orsillo, S. M., Heimberg, R. G., Juster, H. R. & Garrett, J. (1996). Social phobia and PTSD in Vietnam veterans. J Trauma Stress, 9(2):235–52. Otto, M. W., Hinton, D., Korbly, N. B., Chea, A., Ba, P., Gershuny, B. S. & Pollack, M. H. (2003). Treatment of pharmacotherapy-refractory posttraumatic stress disorder among Cambodian refugees: A pilot study of combination treatment with cognitive-behavior therapy vs sertraline alone. Behav Res Ther, 41(11):1271–6. Pain, C. (2002). PTSD and comorbidity or disorder of extreme stress not otherwise specified? CPA Bulletin, August 2002. 212 LITERATUR Pantesco, V. F. (2005). The body’s story: A case report of hypnosis and physiological narration of trauma. Am J Clin Hypn, 47(3):149–59. Paunovic, N. & Öst, L. G. (2001). Cognitive-behavior therapy vs exposure therapy in the treatment of PTSD in refugees. Behav Res Ther, 39(10):1183–97. Perkins, B. R. & Rouanzoin, C. C. (2002). A critical evaluation of current views regarding eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Clarifying points of confusion. J Clin Psychol, 58(1):77–97. Perkonigg, A., Kessler, R. C., Storz, S. & Wittchen, H. U. (2000). Traumatic events and post-traumatic stress disorder in the community: Prevalence, risk factors and comorbidity. Acta Psychiatr Scand, 101(1):46–59. Perkonigg, A., Pfister, H., Stein, M. B., Hofler, M., Lieb, R., Maercker, A. & Wittchen, H. U. (2005). Longitudinal course of posttraumatic stress disorder and posttraumatic stress disorder symptoms in a community sample of adolescents and young adults. Am J Psychiatry, 162(7):1320–7. Pitman, R. K., Altman, B., Greenwald, E., Longpre, R. E., Macklin, M. L., Poire, R. E. & Steketee, G. S. (1991). Psychiatric complications during flooding therapy for posttraumatic stress disorder. J Clin Psychiatry, 52(1):17–20. PRO ASYL (2004). Das Zuwanderungsgesetz. http://www.proasyl.de/texte/ gesetze/brd/zuwanderungsgesetz/positionen/proasyl0904.pdf [eingesehen am 27.3.2006]. PRO ASYL (2006). Ein Jahr Zuwanderungsgesetz - Stellungnahme zur Evaluierung des Zuwanderungsgesetzes. http://www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/fm_ redakteure/stellungnahmen/PRO_ASYL_Evaluierung_ZuwG_20.3.06__F.pdf [eingesehen am 02.08.2006]. Rat der Europäischen Union (2003). Richtlinie 2003/9/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Festlegung von Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedsstaaten. http://register.consilium.eu.int/pdf/de/02/ st15/15398d2.pdf [eingesehen am 3.11.2006]. Rauch, S. A., Foa, E. B., Furr, J. M. & Filip, J. C. (2004). Imagery vividness and perceived anxious arousal in prolonged exposure treatment for PTSD. J Trauma Stress, 17(6):461–5. 213 LITERATUR Reddemann, L. (2003). Die Psychodynamisch Imaginative Traumatherapie (PITT). Zeitschrift für Psychotraumatologie und Psychologische Medizin, 1(2). Reddemann, L. & Sachsse, U. (1999). Traumazentrierte imaginative Therapie. In Joraschky, P., Ed., Sexueller Mißbrauch, Mißhandlung, Vernachlässigung. Schattauer, Stuttgart/New York. Resick, P. A., Nishith, P., Weaver, T. L., Astin, M. C. & Feuer, C. A. (2002). A comparison of cognitive-processing therapy with prolonged exposure and a waiting condition for the treatment of chronic posttraumatic stress disorder in female rape victims. J Consult Clin Psychol, 70(4):867–79. Resick, P. A. & Schnicke, M. K. (1992). Cognitive processing therapy for sexual assault victims. J Consult Clin Psychol, 60(5):748–56. Richards, D. A., Lovell, K. & Marks, I. M. (1994). Post-traumatic stress disorder: Evaluation of a behavioral treatment program. J Trauma Stress, 7(4):669–80. Robertson, M., Humphreys, L. & Ray, R. (2004). Psychological treatments for posttraumatic stress disorder: Recommendations for the clinician based on a review of the literature. J Psychiatr Pract, 10(2):106–18. Rothbaum, B. O., Astin, M. C. & Marsteller, F. (2005). Prolonged exposure versus eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) for PTSD rape victims. J Trauma Stress, 18(6):607–16. Ruf, M., Schauer, M., Neuner, F., Schauer, E. & Elbert, T. (2007). KIDNET - Narrative Expositionstherapie (NET) für Kinder. Hogrefe Verlag für Psychologie. Rundell, J. R. (2006). Demographics of and diagnoses in operation enduring freedom and operation Iraqi freedom personnel who were psychiatrically evacuated from the theater of operations. Gen Hosp Psychiatry, 28(4):352–6. Sachsse, U., Vogel, C. & Leichsenring, F. (2006). Results of psychodynamically oriented trauma-focused inpatient treatment for women with complex posttraumatic stress disorder (PTSD) and borderline personality disorder (BPD). Bull Menninger Clin, 70(2):125–44. Sack, W. H., Seeley, J. R. & Clarke, G. N. (1997). Does PTSD transcend cultural barriers? A study from the Khmer adolescent refugee project. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 36(1):49–54. 214 LITERATUR Salman, C. & Collatz, J. (1999). Der Einsatz von Dolmetschern im Gesundheitswesen als Beitrag zur Integration. http://www.haeverlag.de/archiv/n0999_0.htm [eingesehen am 20.11.2006]. Sautter, F. J., Brailey, K., Uddo, M. M., Hamilton, M. F., Beard, M. G. & Borges, A. H. (1999). PTSD and comorbid psychotic disorder: Comparison with veterans diagnosed with PTSD or psychotic disorder. J Trauma Stress, 12(1):73–88. Schaal, S. (2006). Erkrankungen des Traumaspektrums bei ruandischen Waisen des Genozids - Epidemiologie und Behandlung. Dissertation, Universität Konstanz. Schauer, M., Neuner, F. & Elbert, T. (2005). Narrative Exposure Therapy. Hogrefe und Huber, Göttingen. Schneider, S. & Margraf, J. (1998). Agoraphobie und Panikstörung, volume Band 3 of Fortschritte der Psychotherapie, Manuale für die Praxis. Hogrefe Verlag für Psychologie, Göttingen/Bern/Toronto/Seattle. Schnyder, U. (2005). Why new psychotherapies for posttraumatic stress disorder? Psychotherapy and Psychosomatics, 74:199–201. Schreuder, B. J. (1999). Cognitive ego-disturbances in the elderly who have become victims of organized violence. Z Gerontol Geriatr, 32(4):266–72. Schwarz-Langer, G., Deighton, R. R., Jerg-Bretzke, L., Weisker, I. & Traue, H. C. (2006). Psychiatric treatment for extremely traumatized civil war refugees from former Yugoslavia. Possibilities and limitations of integrating psychotherapy and medication. Torture, 16(2):69–80. Scott, M. J. & Stradling, S. G. (1997). Client compliance with exposure treatments for posttraumatic stress disorder. J Trauma Stress, 10(3):523–6. Seligman, M. E. P. & Altenor, A. (1980). Part II: Learned helplessness. Behaviour Research and Therapy, 18(5):462–473. Shapiro, F. (1996). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Evaluation of controlled PTSD research. J Behav Ther Exp Psychiatry, 27(3):209–18. Shapiro, F. (1999). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) and the anxiety disorders: Clinical and research implications of an integrated psychotherapy treatment. J Anxiety Disord, 13(1-2):35–67. 215 LITERATUR Shapiro, F., Vogelmann-Sine, S. & Sine, L. F. (1994). Eye movement desensitization and reprocessing: Treating trauma and substance abuse. J Psychoactive Drugs, 26(4):379–91. Sheehan, D. V., Lecrubier, Y., Sheehan, K. H., Amorim, P., Janavs, J., Weiller, E., Hergueta, T., Baker, R. & Dunbar, G. C. (1998). The mini-international neuropsychiatric interview (M.I.N.I.): The development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview for DSM-IV and ICD-10. J Clin Psychiatry, 59 Suppl 20:22–33; quiz 34–57. Sherman, J. J. (1998). Effects of psychotherapeutic treatments for PTSD: A metaanalysis of controlled clinical trials. J Trauma Stress, 11(3):413–35. Shorter, E. (1999). Geschichte der Psychiatrie. Alexander Fest Verlag, Berlin. Silove, D. & Steel, Z. (1998). The Mental Health an Well-Being of On-Shore Asylum Seekers in Australia. Report, Psychiatry Research and Teaching Unit, University of New South Wales. Snodgrass, L., Yamamoto, J., Frederick, C., Ton-That, N., Foy, D., Chan, L., Wu, J., Hahn, P., Shinh, D., Nguyen, L., de Jonge, J. & Fairbanks, L. (1993). Vietnamese refugees with PTSD symptomatology: Intervention via a coping skills model. Journal of Traumatic Stress, 6(4):569–575. Solomon, S. D. & Johnson, D. M. (2002). Psychosocial treatment of posttraumatic stress disorder: A practice-friendly review of outcome research. J Clin Psychol, 58(8):947–59. Sourander, A. (2003). Refugee families during asylum seeking. Nord J Psychiatry, 57(3):203–7. Spauwen, J., Krabbendam, L., Lieb, R., Wittchen, H. U. & van Os, J. (2006). Impact of psychological trauma on the development of psychotic symptoms: Relationship with psychosis proneness. Br J Psychiatry, 188:527–33. Stankunas, M., Kalediene, R., Starkuviene, S. & Kapustinskiene, V. (2006). Duration of unemployment and depression: a cross-sectional survey in Lithuania. BMC Public Health, 6:174. Steel, Z., Momartin, S., Bateman, C., Hafshejani, A., Silove, D. M., Everson, N., Roy, K., Dudley, M., Newman, L., Blick, B. & Mares, S. (2004). Psychiatric status of 216 LITERATUR asylum seeker families held for a protracted period in a remote detention centre in Australia. Aust N Z J Public Health, 28(6):527–36. Stein, M. B., Hofler, M., Perkonigg, A., Lieb, R., Pfister, H., Maercker, A. & Wittchen, H. U. (2002). Patterns of incidence and psychiatric risk factors for traumatic events. Int J Methods Psychiatr Res, 11(4):143–53. Stein, M. B., Lang, A. J., Laffaye, C., Satz, L. E., Lenox, R. J. & Dresselhaus, T. R. (2004). Relationship of sexual assault history to somatic symptoms and health anxiety in women. Gen Hosp Psychiatry, 26(3):178–83. Stein, M. B., Walker, J. R., Hazen, A. L. & Forde, D. R. (1997). Full and partial posttraumatic stress disorder: Findings from a community survey. Am J Psychiatry, 154(8):1114–9. Summerfield, D. (1999). A critique of seven assumptions behind psychological trauma programmes in war-affected areas. Soc Sci Med, 48(10):1449–62. Summerfield, D. (2003). Fighting ’terrorism’ with torture. Bmj, 326(7393):773–4. Summerfield, D. A. (2005). Coping with the aftermath of trauma: NICE guidelines on post-traumatic stress disorder have fundamental flaw. Bmj, 331(7507):50; author reply 50. Tagay, S., Herpertz, S., Langkafel, M. & Senf, W. (2004). [trauma, post-traumatic stress disorder and somatization]. Psychother Psychosom Med Psychol, 54(5):198– 205. Tagesschau (2007a). Bundeswehrsoldaten sterben bei Anschlag. http://www. tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID6782862,00.html [eingesehen am 22.08.2007]. Tagesschau (2007b). Bush erlässt Folterverbot bei Verhören. http://www. tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID7143934,00.html [eingesehen am 22.08.2007]. Tarrier, N., Pilgrim, H., Sommerfield, C., Faragher, B., Reynolds, M., Graham, E. & Barrowclough, C. (1999a). A randomized trial of cognitive therapy and imaginal exposure in the treatment of chronic posttraumatic stress disorder. J Consult Clin Psychol, 67(1):13–8. 217 LITERATUR Tarrier, N., Sommerfield, C., Pilgrim, H. & Humphreys, L. (1999b). Cognitive therapy or imaginal exposure in the treatment of post-traumatic stress disorder. Twelve-month follow-up. Br J Psychiatry, 175:571–5. Terheggen, M. A., Stroebe, M. S. & Kleber, R. J. (2001). Western conceptualizations and eastern experience: A cross-cultural study of traumatic stress reactions among Tibetan refugees in India. J Trauma Stress, 14(2):391–403. Triffleman, E., Carroll, K. & Kellogg, S. (1999). Substance dependence posttraumatic stress disorder therapy. An integrated cognitive-behavioral approach. Journal of Substance Abuse Treatment, 17(1-2):3–14. True, W. R., Rice, J., Eisen, S. A., Heath, A. C., Goldberg, J., Lyons, M. J. & Nowak, J. (1993). A twin study of genetic and environmental contributions to liability for posttraumatic stress symptoms. Arch Gen Psychiatry, 50(4):257–64. Tull, M. T., Gratz, K. L., Salters, K. & Roemer, L. (2004). The role of experiential avoidance in posttraumatic stress symptoms and symptoms of depression, anxiety, and somatization. J Nerv Ment Dis, 192(11):754–61. Turner, P., Valtierra, M., Talken, T., Miller, I. & DeAnda, J. (1996). Effect of session length on treatment outcome for college students in brief therapy. Journal of Counseling Psychology, 43(2):228–232. Ulett, G. A. (1996). Conditioned healing with electroacupuncture. Altern Ther Health Med, 2(5):56–60. UN-Generalversammlung (1998). Themenbericht - Erklärung über das Recht und die Pflichten von Einzelpersonen, Gruppen und gesellschaftlichen Organen, allgemein anerkannte Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen. http://www2.amnesty.de/internet/deall.nsf/ 3c7abab8e052c42fc1256eeb004ce861/d90c709befb43673c1256ef90036c5b3 [eingesehen am 12.9.2006]. UNHCR (1951). Genfer Flüchtlingskonvention. http://www.aufenthaltstitel. de/genferkonvention.html [eingesehen am 3.11.2006]. UNHCR (2005). UNHCR auf einen Blick, Juli 2005. http://www.unhcr.de/unhcr. php/cat/14/aid/1235 [eingesehen am 30.1.2006]. van Etten, M. & Taylor, S. (1998). Comparative efficacy of treatments for posttraumatic stress disorder: A meta-analysis. Clinical Psychology and Psychotherapy, (5):126–144. 218 LITERATUR van Minnen, A., Arntz, A. & Keijsers, G. P. (2002). Prolonged exposure in patients with chronic PTSD: Predictors of treatment outcome and dropout. Behav Res Ther, 40(4):439–57. van Minnen, A. & Foa, E. B. (2006). The effect of imaginal exposure length on outcome of treatment for PTSD. J Trauma Stress, 19(4):427–38. Vereinte Nationen (1984). Übereinkommen gegen Folter und andere grausa- me, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vom 10. Dezember 1984. http://www.aufenthaltstitel.de/folter.html [eingesehen am 24.04.2007]. Veronen, L. & Kilpatrick, D. (1983). Stress management for rape victims. In Meichenbaum, D., Ed., Stress reduction and prevention, pages 341–374. Plenum Press, New York. Weathers, F. W., Ruscio, A. & Keane, T. M. (1999). Psychometric properties of nine scoring rules for the clinician administered posttraumatic stress disorder scale. Psychological Assessment, 11(2):124–133. Weber, R. (1998). Extremtraumatisierte Flüchtlinge in Deutschland - Asylrecht und Asylverfahren. Interpersonelle Einflüsse/Prozesse bei der Untersuchung von traumatisierten Flüchtlingen am Beispiel der Asylanhörung und Empfehlungen für deren zukünftige Gestaltung aus therapeutischer Sicht. Campus Verlag. Weine, S. M., Kulenovic, A. D., Pavkovic, I. & Gibbons, R. (1998). Testimony psychotherapy in Bosnian refugees: A pilot study. Am J Psychiatry, 155(12):1720–6. Weltgesundheitsorganisation (1991). Internationale Klassifikation psychischer Störungen: ICD-10 Kapitel V (F), klinisch-diagnostische Leitlinien, Weltgesundheitsorganisation. Huber, Bern [u.a.]. Weltgesundheitsorganisation (2003). Weltbericht Gewalt und Gesundheit: Zusammenfassung. Bericht, Weltgesundheitsorganisation WHO. Weltgesundheitsorganisation WHO (2002). Collective Violence. Bericht, Weltgesundheitsorganisation WHO. Wenk-Ansohn, M. (2007). Treatment of torture survivors - influences of the exile situation on the course of the traumatic process and therapeutic possibilities. Torture, 17(2). 219 LITERATUR Wienbruch, C. (2007). Abnormal slow wave mapping (ASWAM) - a tool for the investigation of abnormal slow wave activity in the human brain. J Neurosci Methods, 163(1):119–27. Württembergische Bibelanstalt, Ed. (1962). Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung Martin Luthers mit erklärenden Anmerkungen. Württembergische Bibelanstalt Stuttgart, Stuttgart. Zebra, Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum (2006). Zebra Lexikon. http://www.zebra.or.at/faqs1.html [eingesehen am 23.1.2006]. Zenker, H. (2006). Krankheit als Abschiebehindernis im Spannungsfeld von Politik, Verwaltung, Fachlichkeit und Ethik - zur Begutachtung ausländischer Flüchtlinge nach dem Ausländerrecht und Aufenthaltsgesetz. http://www.gesundheitsamt-bremen.de/aktuell/pdf/Bericht%20Loehr% 2002.11.05%20Endfassung-abtl3neuneuneu.pdf [eingesehen am 3.11.2006]. Zucker, M., Spinazzola, J., Blaustein, M. & van der Kolk, B. A. (2006). Dissociative symptomatology in posttraumatic stress disorder and disorders of extreme stress. J Trauma Dissociation, 7(1):19–31. 220 ANHANG Anhang Regeln zur Betreuung und zum Schutz von Personen, die im Rahmen der Zielsetzungen der Ambulanz für Flüchtlinge und Folteropfer an der Universität Konstanz diagnostisch untersucht werden. Die Mitarbeiter der Ambulanz und der Abteilung Klinische Psychologie und Neuropsychologie verpflichten sich mit ihrer Unterschrift, diese Regeln zur Kenntnis zu nehmen und einzuhalten. Der Schutz der untersuchten Person beinhaltet umfassende Aufklärung über Ziele, Vorgehensweise und mögliche Belastungen der Untersuchung, die Aufmerksamkeit für den psychischen Zustand während der Untersuchung und die Sicherung gegebenenfalls erforderlicher Nachbetreuung. Diese Regeln zur Wahrung des Patientenschutzes dienen dazu, mögliche Krisen, die durch die Untersuchung in Gang gesetzt werden könnten, aufzufangen. Die Untersuchung selbst ist so gestaltet, dass Krisen soweit möglich vermieden werden Die Zielsetzung korrekter Diagnostik insbesondere aber die Erstellung rechtlich tragfähiger Gutachten impliziert jedoch notwendigerweise die Konfrontation mit Erinnerungen, die viele Klienten bislang vermieden und zu vermeiden versuchten. Im Einzelfall ist zwischen der momentanen Belastung eines Patienten und den möglicherweise lebensbedrohenden Konsequenzen eines Gutachtens, das nicht hinreichend detailliert und widerspruchsfrei ist, sorgfältig abzuwägen. Wir wissen aus den Berichten der Klienten, dass sie Krisen und belastende Zustände unabhängig von unserer Untersuchung immer wieder erleben, ein Zustand der Belastetheit ist daher nicht das Produkt oder die Konsequenz der Untersuchung, kann jedoch durch die Problem-Konfrontation mitunter ausgelöst werden. Wir verstehen Patientenschutz daher nicht als Sicherung, dass der Klient (hier sind ebenso Klientinnen gemeint) sich während der gesamten Untersuchung wohl, unbeeinträchtigt und unbelastet fühlt, sondern als Sicherung der lückenlosen Betreuung und therapeutischen Hilfe im Falle einer emotionalen Belastung und Krise. Vor Beginn der Untersuchung: • Bei der Terminbekanntgabe erhält der Klient über die Person, die ihn zur Untersuchung angemeldet hat, eine schriftliche Einladung zur Untersuchung. 221 ANHANG Die anmeldende Person wird gebeten sicherzustellen, dass der Klient die Informationen verstanden hat. • Befindet sich der Klient in ambulanter Therapie und ist der Name des Therapeuten aus dem Anmeldeformular bekannt, so wird dieser telefonisch über den Untersuchungstermin informiert; es wird seine Einschätzung bezüglich des derzeitigen psychischen Zustandes des Klienten erfragt. • Am Untersuchungstag wird der Klient vor Beginn der diagnostischen Untersuchung im Detail über das in der Einladung beschriebene Prozedere der Untersuchung informiert. Dabei wird auf Ziele, Dauer, Inhalt und Vorgehensweise der diagnostischen Untersuchung eingegangen. Der Klient unterzeichnet – gegebenenfalls nach Übersetzung – die schriftlich vorliegende Einverständniserklärung. • Die Aufklärung umfasst den Hinweis auf die jederzeit bestehende Möglichkeit, die Untersuchung abzubrechen. • Übersetzer und sonstige anwesende Personen werden über die Schweigepflicht aufgeklärt und unterschreiben Schweigepflichterklärungen. Während der Untersuchung: 1. Das psychodiagnostische Gespräch: • Die die Untersuchung durchführenden Mitarbeiter vergewissern sich nach den einzelnen Untersuchungsphasen über Zustand, Belastungserleben, Wohlbefinden des Klienten. • Ein verantwortlicher Projektleiter oder Supervisor ist im Haus bzw. telefonisch erreichbar und wird im Falle einer Krise hinzugezogen; die Exploration möglicher traumatischer Ereignisse erfolgt in Form eines standardisierten Interviews. Um die emotionale Belastung des Klienten in der Untersuchungssituation möglichst gering zu halten, wird er durch Fragen des Interviewers in der Schilderung der Erlebnisse geleitet und nicht aufgefordert, die traumatischen Erlebnisse frei zu schildern. Eine ausführliche, auch emotionale Exploration ist der Therapie vorbehalten. • Der Untersucher bietet regelmäßig Pausen an bzw. legt Pausen ein, wenn der Klient es wünscht. 222 ANHANG • Bei Anzeichen internistischer oder neurologischer Auffälligkeiten wird umgehend der verantwortliche Stationsarzt (Station 33 befindet sich ein Stockwerk über Ambulanz und Untersuchungsräumen) hinzugezogen. Im Falle dessen Abwesenheit ist ein 2. Stationsarzt erreichbar oder der Arzt vom Dienst im ZPR zu rufen. • Äußert der Klient den Wunsch, die Untersuchung abzubrechen, wird dem unmittelbar stattgegeben und der psychische Zustand abgeklärt. 2. Die neurophysiologische Untersuchung: • Vor der MEG-Untersuchung findet eine ausführliche Aufklärung über die Untersuchung statt. Der Klient wird darauf hingewiesen, welche Teile der MEG-Untersuchung in das Gutachten einfließen können und welche zunächst wissenschaftlichen Zwecken dienen. Der Klient wird darüber aufgeklärt, dass eine Gutachtenerstellung unabhängig von der Teilnahme an der MEG-Untersuchung erfolgen kann. • Während der Untersuchung befindet sich auf Wunsch des Patienten ein ausgebildeter Mitarbeiter gemeinsam mit dem Patienten im Messraum. Es besteht zu jeder Zeit Sicht- und Sprachkontakt. Bei Anzeichen einer psychischen Krise wird ein erfahrener Psychologe, bei internistischen oder neurologischen Auffälligkeiten ein Arzt verständigt (siehe oben). • Auf Wunsch des Patienten wird die Untersuchung abgebrochen. • Im Anschluss an die MEG-Untersuchung erfolgt eine genaue Exploration des Befindens und Erlebens des Patienten während der Untersuchung. Nach der Untersuchung: • Oberstes Ziel ist es, eine lückenlose Betreuung sicher zu stellen. • Der Klient wird darüber informiert, dass bei Verschlechterung des Zustandes nach der Untersuchung einer der Mitarbeiter jederzeit telefonisch erreichbar ist und kontaktiert werden kann. • Der Untersucher vergewissert sich über den psychischen Zustand, das Wohlbefinden des Klienten, bevor dieser die Ambulanz verlässt. • Im Falle unklaren Zustands wird – in Absprache mit dem Klienten – der betreuende Hausarzt oder Therapeut informiert. 223 ANHANG • In Absprache mit dem Klienten wird ein Kurzprotokoll der Untersuchung dem betreuenden Hausarzt/Therapeuten zugeschickt bzw. es wird telefonisch mit den Betreffenden Kontakt aufgenommen. Die beiden letzten Punkte setzen die schriftliche Schweigepflichtentbindung durch den Klienten voraus! 224