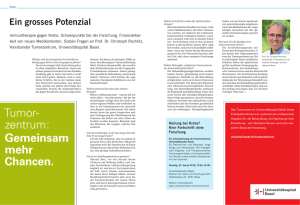Personalisierte Medizin - Universitätsspital Basel
Werbung
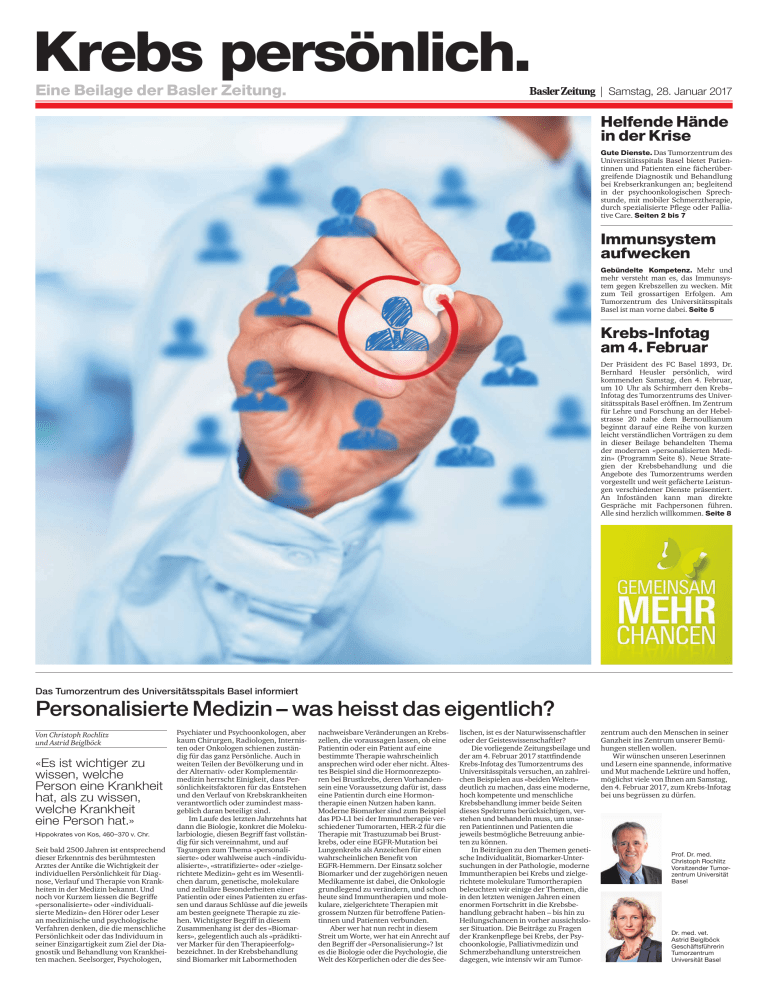
Krebs persönlich. Eine Beilage der Basler Zeitung. | Samstag, 28. Januar 2017 Helfende Hände in der Krise Gute Dienste.Das Tumorzentrum des Universitätsspitals Basel bietet Patientinnen und Patienten eine fächerübergreifende Diagnostik und Behandlung bei Krebserkrankungen an; begleitend in der psychoonkologischen Sprechstunde, mit mobiler Schmerz­therapie, durch spezialisierte Pflege oder Palliative Care. Seiten 2 bis 7 Immunsystem aufwecken Gebündelte Kompetenz.Mehr und mehr versteht man es, das Immunsystem gegen Krebszellen zu wecken. Mit zum Teil grossartigen Erfolgen. Am Tumorzentrum des Universitätsspitals Basel ist man vorne dabei. Seite 5 Krebs-Infotag am 4. Februar Der Präsident des FC Basel 1893, Dr. Bernhard Heusler persönlich, wird kommenden Samstag, den 4. Februar, um ­10 Uhr als Schirmherr den Krebs– Infotag des Tumorzentrums des Universitätsspitals Basel eröffnen. Im Zentrum für Lehre und Forschung an der Hebelstrasse 20 nahe dem Bernoullianum beginnt darauf eine Reihe von kurzen leicht verständlichen Vorträgen zu dem in dieser Beilage behandelten Thema der modernen «personalisierten Medizin» (Programm Seite 8). Neue Strategien der Krebsbehandlung und die Angebote des Tumorzentrums werden vorgestellt und weit gefächerte Leistungen verschiedener Dienste präsentiert. An Infoständen kann man direkte Gespräche mit Fachpersonen führen. Alle sind herzlich willkommen. Seite 8 Das Tumorzentrum des Universitätsspitals Basel informiert Personalisierte Medizin – was heisst das eigentlich? Von Christoph Rochlitz und Astrid Beiglböck «Es ist wichtiger zu wissen, welche Person eine Krankheit hat, als zu wissen, welche Krankheit eine Person hat.» Hippokrates von Kos, 460–370 v. Chr. Seit bald 2500 Jahren ist entsprechend dieser Erkenntnis des berühmtesten Arztes der Antike die Wichtigkeit der individuellen Persönlichkeit für Diagnose, Verlauf und Therapie von Krankheiten in der Medizin bekannt. Und noch vor Kurzem liessen die Begriffe «personalisierte» oder «individualisierte Medizin» den Hörer oder Leser an medizinische und psychologische Verfahren denken, die die menschliche Persönlichkeit oder das Individuum in seiner Einzigartigkeit zum Ziel der Diagnostik und Behandlung von Krankheiten machen. Seelsorger, Psychologen, Psychiater und Psychoonkologen, aber kaum Chirurgen, Radiologen, Internisten oder Onkologen schienen zuständig für das ganz Persönliche. Auch in weiten Teilen der Bevölkerung und in der Alternativ- oder Komplementärmedizin herrscht Einigkeit, dass Persönlichkeitsfaktoren für das Entstehen und den Verlauf von Krebskrankheiten verantwortlich oder zumindest massgeblich daran beteiligt sind. Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat dann die Biologie, konkret die Molekularbiologie, diesen Begriff fast vollständig für sich vereinnahmt, und auf Tagungen zum Thema «personalisierte» oder wahlweise auch «individualisierte», «stratifizierte» oder «zielgerichtete Medizin» geht es im Wesentlichen darum, genetische, molekulare und zelluläre Besonderheiten einer Patientin oder eines Patienten zu erfassen und daraus Schlüsse auf die jeweils am besten geeignete Therapie zu ziehen. Wichtigster Begriff in diesem Zusammenhang ist der des «Biomarkers», gelegentlich auch als «prädiktiver Marker für den Therapieerfolg» bezeichnet. In der Krebsbehandlung sind Biomarker mit Labormethoden nachweisbare Veränderungen an Krebszellen, die voraussagen lassen, ob eine Patientin oder ein Patient auf eine bestimmte Therapie wahrscheinlich ansprechen wird oder eher nicht. Ältestes Beispiel sind die Hormonrezeptoren bei Brustkrebs, deren Vorhandensein eine Voraussetzung dafür ist, dass eine Patientin durch eine Hormontherapie einen Nutzen haben kann. Moderne Biomarker sind zum Beispiel das PD-L1 bei der Immuntherapie verschiedener Tumorarten, HER-2 für die Therapie mit Trastuzumab bei Brustkrebs, oder eine EGFR-Mutation bei Lungenkrebs als Anzeichen für einen wahrscheinlichen Benefit von EGFR-Hemmern. Der Einsatz solcher Biomarker und der zugehörigen neuen Medikamente ist dabei, die Onkologie grundlegend zu verändern, und schon heute sind Immuntherapien und molekulare, zielgerichtete Therapien mit grossem Nutzen für betroffene Patientinnen und Patienten verbunden. Aber wer hat nun recht in diesem Streit um Worte, wer hat ein Anrecht auf den Begriff der «Personalisierung»? Ist es die Biologie oder die Psychologie, die Welt des Körperlichen oder die des See- lischen, ist es der Naturwissenschaftler oder der Geisteswissenschaftler? Die vorliegende Zeitungsbeilage und der am 4. Februar 2017 stattfindende Krebs-Infotag des Tumorzentrums des Universitässpitals versuchen, an zahlreichen Beispielen aus «beiden Welten» deutlich zu machen, dass eine moderne, hoch kompetente und menschliche Krebsbehandlung immer beide Seiten dieses Spektrums berücksichtigen, verstehen und behandeln muss, um unseren Patientinnen und Patienten die jeweils bestmögliche Betreuung anbieten zu können. In Beiträgen zu den Themen genetische Individualität, Biomarker-Untersuchungen in der Pathologie, moderne Immuntherapien bei Krebs und zielgerichtete molekulare Tumortherapien beleuchten wir einige der Themen, die in den letzten wenigen Jahren einen enormen Fortschritt in die Krebsbehandlung gebracht haben – bis hin zu Heilungschancen in vorher aussichtsloser Situation. Die Beiträge zu Fragen der Krankenpflege bei Krebs, der Psychoonkologie, Palliativmedizin und Schmerzbehandlung unterstreichen dagegen, wie intensiv wir am Tumor- zentrum auch den Menschen in seiner Ganzheit ins Zentrum unserer Bemühungen stellen wollen. Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern eine spannende, informative und Mut machende Lektüre und hoffen, möglichst viele von Ihnen am Samstag, den 4. Februar 2017, zum Krebs-Infotag bei uns begrüssen zu dürfen. Prof. Dr. med. Christoph Rochlitz Vorsitzender Tumorzentrum Universität Basel Dr. med. vet. Astrid Beiglböck Geschäftsführerin Tumorzentrum Universität Basel Krebs persönlich. Kompass in der Not Die psychoonkologische Beratung steht allen offen | Samstag, 28. Januar 2017 | Seite 2 Jeder Mensch ist einzigartig Die genetische Individualität ist die Grundlage personalisierter Medizin Von Brigitta Wössmer Von Sven Cichon Es kann – alle wissen es – ein riesiger Schock sein, wenn man erfährt, dass man Krebs hat. Wer das erlebt, rutscht in eine verständliche Krise, mit der es nun umzugehen gilt. Das Tumorzen­ trum des Universitätspitals Basel ist in der glücklichen Lage, Krebspatientinnen und -patienten in dieser Situation mit psychoonkologischer Unterstützung neben der Krebsbehandlung beizustehen, wenn es um die Bewältigung der existenziellen Krise und drängender Fragen zur Zukunft geht. Sie werden oft als schwere Belastung erlebt. Unser Dienst steht allen offen, die in dieser schwierigen Situation oder später nach neuer Orientierung und Halt suchen. Wer ihn in Anspruch nimmt, ist nicht etwa psychisch krank, sondern ein Mensch, der aus einer ungewissen Zukunft das Beste machen will und dafür vorhandene Ressourcen nutzt. Jeder Mensch ist einzigartig. Die allermeisten werden da wohl zustimmen und vor allem an das Aussehen, an die Persönlichkeit sowie Begabungen denken. Viele individuelle Unterschiede liegen darin begründet, dass wir uns alle geringfügig in unserer genetischen Ausstattung (unserer Erbinformation, der DNA) unterscheiden. In der Tat wird man wohl keine zwei Menschen auf der Erde finden, deren Erbinformation absolut identisch ist. Die Ausnahme bilden lediglich eineiige Zwillinge. Diese «genetische Individualität» spielt eine zunehmend wichtige Rolle in der Medizin, denn sie kann Auswirkungen auf die Behandlung von Krankheiten haben. Schon lange ist bekannt, dass zwei Patienten mit identischer Diagnose ganz unterschiedlich auf das gleiche Medikament ansprechen können. Während die Behandlung dem einen guttut, erweist sie sich beim anderen als wirkungslos. Daneben gibt es zudem oft noch eine Gruppe von Patienten, bei denen das Medikament zu leichten bis schweren Nebenwirkungen führt. Diese Situation ist sowohl für Patientinnen und Patienten wie auch die Ärzte eine unbefriedigende Situation. Zudem wird das Gesundheitssystem mit Ausgaben für Medikamente belastet, die keinen Behandlungserfolg zeigen. Voraussagen, was wirkt Was man sich wünscht, ist eine für den einzelnen Patienten wirksame Behandlung. Ist ein Medikament beispielsweise bei 60 Prozent aller Behandelten wirksam, möchte man gern schon im Voraus wissen, ob es konkret auch bei Patient XY wirkt. Dies verspricht die personalisierte Medizin, sie stützt sich auf individuelle genetische «Wer uns in Anspruch nimmt, will aus einer ungewissen Zukunft das Beste machen.» Denn vieles stellt sich plötzlich in anderem Licht dar. Die Zukunft wird ungewisser und die Frage danach, was dem Leben Sinn und Wert gibt, stellt sich akuter denn je. Die Beziehungen mit den Nächsten werden noch wichtiger; jetzt sollte man reden können. Doch der Schlag macht oft erst mal sprachlos. Es stellt sich auf einmal auch die Frage, wie soll und kann ich über meine Diagnose, meine Krankheit, meine Befürchtungen und Hoffnungen reden? Wer hilft mir zu verstehen, wie ernst das Problem und wie gross meine Chancen und die Ungewissheiten sind? Wie gebe ich das weiter? Soll ich besser die Nächsten verschonen oder offen mit ihnen alles teilen? Belaste ich sie damit? Wie sage ich es gar meinen Kindern? Und wie geh ich damit um, dass nun alle mich schonen? Es gilt, vieles vorzusorgen. Wer übernimmt, wenn ich nicht mehr kann? Familie und Freunde sind nun wichtige Stützen. Wir von der Psychoonkologie bieten hier stationär und ambulant zusätzlich unser Wissen und unsere Erfahrung an. In einem geschützten Rahmen, auf Wunsch auch im Beisein von Partnern und Familie, wollen wir der Patientin oder dem Patienten helfen, die richtige Sprache zu finden, die Sicherheit zu stärken und die Orientierung zu verbessern. Um wieder zu einer Balance der Gefühle zurückzufinden und sogar Neues zu entdecken. Wichtig ist uns auch, den Weg zurück an die Arbeit zu begleiten, wo das erwünscht ist, und so ein wichtiges Stück normalen Lebens zurückzugewinnen. Am turbulenten Anfang nach der Diagnose steht der Körper im Vordergrund, der Kampf gegen den Krebs. Die Behandlung muss rasch beginnen und kann belastend sein. Ängste und depressive Verstimmungen können auftreten. Da können wir mit unserer Erfahrung helfen: Die Mitglieder unseres Teams wissen über die medizinische Behandlung Bescheid, sind an den Tumorkonferenzen dabei und in das Behandlungsteam integriert. Ein grosser Vorteil. Auch geheilte Menschen kommen mit guten Gründen zu uns. Etwa weil sie vom Schatten des Zweifels eingeholt werden. Ihnen bieten wir ambulante Begleitung an. Erfreulicherweise empfehlen uns heute auch auf Krebsbehandlung spezialisierte niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Wir werten es als Beleg dafür, dass die Qualität unserer Dienste stimmt. Dr. phil. Brigitta Wössmer Psychologische Leitung Psychosomatik Individuelle Unterschiede.Aus genetischen Daten lassen sich Rückschlüsse auf Wahl von Medikamenten und Behandlungen ziehen. Foto Fotolia und andere biologische Daten einer Patientin oder eines Patienten und bezieht diese in die Auswahl der Behandlungsmassnahmen ein. Die personalisierte Medizin wägt ab zwischen den Besonderheiten jedes Einzelnen und der vom Einzelnen unabhängigen, systematischen Zuordnung zu Krankheitsbildern und den zugehörigen Behandlungsstandards. Wie sieht das ganz konkret etwa für die Auswahl einer medikamentösen Behandlung aus? Ein Patient kommt zum Arzt. Der erkennt die Krankheit des Patienten. Für sie gibt es eine bestimmte Therapie-Empfehlung. Bevor der Arzt aber nun die Entscheidung für die Therapie trifft, nimmt er eine Blutprobe und führt einen genetischen oder molekularbiologischen Vortest durch. Dieser soll zeigen, ob das bei dieser Krankheit standardmässig verabreichte Medikament X helfen wird. Auch über die richtige Dosierung des Medikaments kann der Test eine Voraussage machen. Stellen wir uns vor, der Test ergibt, dass der Patient auf Medikament X nicht ansprechen wird. Dann führt der Arzt einen Test für ein alternatives Medikament Y durch. Hier ergeben die Labordaten, dass der Patient eine Unverträglichkeit gegen das Medikament Y hat. Somit kommt auch dieses Medikament nicht infrage. Schliesslich testet der Arzt noch auf eine weitere Alternative, Medikament Z. Hier zeigt sich, dass der Patient auf Medikament Z ansprechen wird. Er bekommt nun also Medikament Z in der richtigen Dosierung verabreicht, und schon bald geht es ihm besser. Sie bemerken den Unterschied zur herkömmlichen Vorgehensweise: An­­ statt zunächst Medikament X und Y verschrieben zu bekommen und festzustellen, dass diese Medikamente nicht wirksam oder unverträglich sind, erhält der Patient das bei ihm wirksame Medikament. Diese Vorgehensweise erspart dem Patienten unangenehme Erfahrungen und führt sehr viel schneller zum Behandlungserfolg. beeinflusst Entscheidungen bezüglich des therapeutischen Vorgehens. Eine sehr enge Zusammenarbeit besteht zwischen der Medizinischen Genetik und der Klinik für Hämatologie am Universitätsspital Basel. Bei Patientinnen und Patientenen mit krankhaften Veränderungen der Blutzellen wird in der Medizinischen Genetik individuell nach genetischen Veränderungen in den weis­sen Blutzellen gesucht (siehe Beitrag auf Seite 3). Man kann davon ausgehen, dass in der Zukunft bei der personalisierten Medizin noch weitaus umfangreichere genetische und andere biologische Daten eines Patienten erhoben und daraus persönliche Gesundheitsprofile erstellt werden. Diese Ergebnisse könnten dann individuell auch zur Prävention bzw. Sensibilisierung genutzt werden und das Setzen von Prioritäten wie Sport und Ernährung unterstützen. Generell sollten Umweltfaktoren (z.B. Ernährung, Bewegung, Grösse/ Gewicht, Medikamenteneinnahme, Vorerkrankungen, etc.), die bei fast allen Erkrankungen individuell einen Einfluss haben, in Gesundheitsprofile mit einbezogen werden. Enorme Chancen Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Behandelnden. Hatte die standardisierte Medizin klare, wenn auch häufig unflexible Leitlinien, mündet die umfassende personalisierte Medizin in eine komplexe medizinische Situation, in der es viele verschiedene Faktoren gegeneinander abzuwägen gilt. Die Chancen sind jedoch enorm. Personalisierte Medizin wird zum Vorteil der Patientinnen und Patienten sein und die Effizienz des Gesundheitswesens steigern. Am Tumorzentrum etabliert Am Tumorzentrum des Universitätsspitals Basel spielt personalisierte Medizin bereits eine wichtige Rolle und Prof. Dr. rer. nat. Sven Cichon Leiter Medizinische Genetik Eierstockkrebs hat viele Gesichter Forschung deckt die individuellen Unterschiede des Ovarialkarzinoms auf Von Viola Heinzelmann-Schwarz Der Eierstock- oder Eileiterkrebs, in der Medizin das Ovarialkarzinom, wird in vielen Fällen leider erst spät entdeckt und kann sich sehr aggressiv verhalten. Wird er dann aufgespürt, stellt die Pathologie einen ersten Befund. Gleichzeitig wird festgestellt, wie weit sich der Krebs schon ausgebreitet hat und in welchem Stadium er sich befindet. Beides beeinflusst die Wahl der Therapie. Das ist das schon lange übliche Vorgehen. Bei jeder Frau anders Das tönt nun so, als seien alle Eierstockkrebse gleich und alle Patientinnen in einer Gruppe identisch. Tatsächlich sehen unter dem Mikroskop alle Ovarialkrebszellen gleich aus. Aber je genauer wir hin- und hineinschauen, und das tun wir forschend auch hier an der Frauenklinik des Universitätsspitals, desto deutlicher zeigen sich Unterschiede, die mehr als nur zufällig und für den Verlauf der Krankheit bedeutsam sind. Mehr und mehr lernen wir, dass sie wichtig sein können, wenn wir eine Behandlung fest­ legen. Es wird immer deutlicher, dass auch beim Ovarialkarzinom individuelle Unterschiede bestehen, die wir in eine auf die einzelne Frau «perso­­na­li­sierte» Behandlung einbeziehen ­können. Wir haben schon immer beobachtet, dass Patientinnen verschieden auf eine Behandlung reagieren, und wir sind uns klar darüber, dass keine zwei Frauen gleich sind. Wären alle gleich, würde die Behandlung auch immer gleich wirken. Und das tut sie nicht. Wir beobachten zum Beispiel, dass in der Pathologie als «serös» bezeichnete Karzinome zwar gleich aussehen, aber eine Therapie unterschiedlich wirkt. Diese Karzinome haben wahrscheinlich den gleichen Ursprung in Eierstock und Eileiter. Aber wir sehen, dass es dann darauf ankommt, wo die gestreuten Zellen sich als Metastasen festsetzen, oder bildlich gesprochen, auf welchen Boden der Samen fällt. Je nachdem, wo sich der Krebs weiterentwickelt, ändern sich Therapie und Prognose. Wir sehen aber auch, dass wir je nach individueller Lage die übliche Standardtherapie besser verlassen. Patientinnen, deren Krebs vor allem Metastasen in den Lymphknoten absiedelt, profitieren davon, wenn man sie, statt mit Chemotherapie zu behandeln, bald neu operiert und bestrahlt. Prognosen verbessern Das dritte und eigentlich schönste Beispiel sind Patientinnen, die mit gleicher Ausgangslage und eigentlich ursprünglich schlechter Prognose ihren Krebs doch mehr als zehn Jahre überleben. Natürlich vermuten wir hier einen Schalter, nach dem man vielleicht auch bei anderen Patientinnen greifen könnte. Untersuchungen haben gezeigt, dass bestimmte genetische Veränderungen die Prognose bestimmen. Wir sind daran herauszufinden, wie man das für eine Verbesserung der Behandlung verwenden könnte, um mehr erkrankte Frauen zu Langzeitüberlebenden zu machen. Ideal wäre, wir könnten von Anfang an genau bestimmen, welche spezielle und erfolgversprechendste Therapie für eine Patientin gewählt werden soll und dies auch bei einem Rezidiv, einer Rückkehr des Karzinoms, genau so fortsetzen. So weit sind wir noch nicht und ich glaube, dass es da viele Mosaiksteine gibt, die man zusammensetzen können muss. Es kommt sicher auf die ererbte genetische Ausstattung und allfällig angelegte Disposition an, dann aber auch auf den Verlauf – die Kinetik – die Umgebung und die Auslöser, die das Wachstum und den Erfolg des Karzinoms beeinflussen. Das ganze Bild haben wir noch nicht und es wird weit mehr als nur von der molekularen Genetik bestimmt. So haben die meisten Eierstockkrebse eine sogenannte p53-Mutation, aber dazu kommen jeweils noch weitere Veränderungen, die nicht einmal krank machende Folgen haben müssen. Am Ende müssen wir verstehen lernen, warum die Zellen zu wuchern beginnen und auf welche Signale sie reagieren. Zuckermoleküle sind zum Beispiel daran beteiligt, dass es verschiedene Blutgruppen gibt. Vielleicht – so vermuten wir – gibt es hier Ansatzpunkte, die vorbeugend oder in der Therapie von Eierstock- oder Eileiterkrebs wirksam sind. Es sind viele Schritte zu einer auf jede einzelne Patientin passenden optimalen Behandlung. Wir sind aber ziemlich gut unterwegs. Zuckermoleküle als Antennen In meiner Forschungsgruppe untersuchen wir zum Beispiel die Rolle von komplizierten Zuckermolekülen, sogenannten Glykanen. Sie befinden sich aussen an der Zellhülle und dienen etwa als Antennen, über die Signale ins Innere der Zelle geleitet werden und dort Veränderungen unter anderem an Signalwegen bewirken. Solche Eine Verlagsbeilage der Basler Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Tumorzentrum des Universitätsspitals Basel. Prof. Dr. med. Viola HeinzelmannSchwarz Leiterin Frauenklinik, Gynäkologisches Tumorzentrum Impressum Krebs persönlich. Verlag und Redaktion: Basler Zeitung Inhalt: Tumorzentrum Universitätsspital Basel Redaktion: Martin Hicklin Gestaltung: Reto Kyburz, Korrektorat: Markus Riedel, Rosmarie Ujak Druck: DZZ Druckzentrum Zürich AG Krebs persönlich. | Samstag, 28. Januar 2017 | Seite 3 Präzisere Sicht auf akute Leukämien Die molekulare Diagnostik hilft, die Behandlung zu revolutionieren und wirksamer zu machen Von Michael Medinger, Pontus Lundberg und Jakob R. Passweg Basel. «Leukämie» bedeutet weisses Blut (griech. leukos=weiss). Tatsächlich beobachtet man bei einer Leukämie, wie sich die weissen Blutkörperchen (Leukozyten) im Blut vermehren. Der Begriff wurde erstmals 1845 von Virchow verwendet und hat seither Eingang in die Medizin gefunden. Leukämien sind krebsartige Vermehrungen unreifer Zellen des blutbildenden Systems. Die leukämischen Zellen sammeln sich im Knochenmark an und verdrängen die normale Blutbildung. Hieraus entstehen die Symptome, die Zeichen der Erkrankung: Die regulären Knochenmarkfunktionen versagen, Blutarmut (Anämie) sowie Blutungen treten auf und schwere Infektionen zeigen sich gehäuft. Die leukämischen, unreifen Zellen zirkulieren im Blut bald durch den ganzen Körper. Die akuten Leukämien werden eingeteilt in «Akute lymphatische Leukämie» (ALL) und «Akute myeloische Leukämie» (AML) je nach ihrem Ursprung aus «myeloischen» oder «lymphatischen» Vorläuferblutzellen. Wie Leukämien entdeckt werden Akute Leukämien sind insgesamt selten; an AML erkranken pro Jahr fünf bis acht Erwachsene aller Alter auf 100 000 Einwohner. Unter den über 70-Jährigen steigt diese Zahl auf 15 bis 25 Fälle. Die ALL ist insgesamt noch seltener als die AML und hat zwei Gipfel in der Kurve der Altersverteilung: Sie ist der häufigste Knochenmarkkrebs im Kindesalter und bei Jugendlichen (in der Phase, in der sich das Immunsystem aufbaut) und hat einen zweiten Häufigkeitsgipfel im höheren Alter. Die akute Leukämie ist die Folge des unkontrollierten Wachstums des bösartigen Zell-Klons und der fehlenden Ausreifung dieser Zellen. Um sie diagnostizieren zu können, müssen wir unter dem Mikroskop Blutausstriche und Knochenmarkszellen und Gewebe analysieren. Es kommt auf das Aussehen der Zellen (die Morphologie) und auf ihre Färbeeigenschaften (Zytochemie) an. Wir bestimmen die Oberflächeneigenschaften der Zellen (man nennt das Immunphänotypisierung) und schauen, ob es Veränderungen in den Chromosomen gibt (Zytogenetik). Krankhafte Veränderungen der Gene bestimmen wir durch eine Technik, die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) heisst. Sie kann mit sehr kleinen Mengen des DNA-Erbmoleküls arbeiten. Mit ihr erstellt man sonst auch DNA-Fingerabdrücke, wie man zum Beispiel aus «Tatort» weiss. Diese bisher für die Diagnose, Klassifizierung und Prognose der Leukämien angewendeten Methoden werden heute mit sehr schnell arbeitenden Techniken ergänzt oder gar durch sie ersetzt. Sie erlauben, die ins Erbgut (die Gene) geschriebene Information weitgreifend und schnell zu buchstabieren und zu lesen. Ein Genom in wenigen Tagen Mit diesem sogenannten «Next Generation Sequencing» (NGS) kann heute das individuelle Genom eines Menschen in nur wenigen Tagen ermittelt (sequenziert) werden. Sie erlaubt uns, entscheidende molekulare und für Leukämie-Zellen typische Eigenschaften zu identifizieren. Zum Beispiel Mutationen. Als Mutation (von lat. mutare «ändern, verwandeln») wird in der Biologie eine dauerhafte Veränderung des Erbgutes bezeichnet. Diese Veränderung betrifft bei der Leukämie zunächst das Erbgut nur einer Zelle, wird aber bei der Vermehrung an deren Tochterzellen weitergegeben. Um diese neuen Daten nutzen zu können, wurde als erstes eine Art «Landkarte» erstellt, auf der die Gene, die regelmässig mutiert waren, dargestellt wurden. Dann wurden diese Daten mit dem Überleben der AML-Patientinnen und -patienten in Zusammenhang gebracht. So konnte man in aufwendigen statisti- schen Verfahren ermitteln, welche Mutationen die Überlebenschance einer Patientin oder eines Patienten verbessern oder verschlechtern. Die mit «Next Generation Sequencing» bei Leukämien gewonnenen Einsichten haben wichtige Auswirkungen. Sie erlauben eine genauere Prognose und präzisere Therapie. Sind bei der Diagnose bestimmte Mutationen vorhanden, so werden entsprechend die Weichen gestellt. Durch die geschilderten molekularen Methoden werden zwei wichtige Klassen an Mutationen identifiziert: Eine wichtige entsteht durch Vertauschung eines Stücks auf einem Chromosom mit einem andern auf einem anderen: Zum Beispiel von Chromosom 8 auf Chromosom 21. Wir nennen das eine Translokation (von lateinisch locus=Ort). Da Gene den Bau von bestimmten Eiweissmolekülen steuern, entsteht durch die Neukombination ein anderes Eiweiss: ein Fusionsprotein. Doch man kann nun auch andere Mutationen schnell orten, welche die Funktion eines Proteins verändern. Sie können die Genaktivität verstärken oder sogar zu einer neuen Funktion des Gens führen. Im umgekehrten Fall kann eine Mutation die Funktionsfähigkeit des vom betroffenen Gen gesteuerten Genprodukts einschränken. Je nach Mutation wachsen und vermehren sich die Leukämiezellen schneller und werden aggressiver. Ein krankhafter Überfluss kann auch dadurch entstehen, dass eine Mutation das programmierte Sterben überflüssiger Blutzellen bremst. Versteckte Zellen aufspüren Musste früher noch jedes Gen aufwendig untersucht werden, kommen wir heute dank der NGS-Technik solchen für Therapie und Prognose entscheidenden Mutationen rasch auf die Spur und können schneller die beste Therapie für die Patientin oder den Patienten wählen. Nach einer Chemotherapie oder auch nach einer Stammzelltransplantation findet man häufig unter dem Mikroskop keine Leukämiezelle mehr. Sie ist – morphologisch – nicht mehr nachweisbar. Doch mit der molekularen Diagnostik können wir anhand der Mutationen manchmal doch wenige noch vorhandene bösartige Zellen oder «Blasten» aufspüren. Das hat natürlich Einfluss auf die weitere Therapie und den Krankheitsverlauf. Sind noch eine kleine Anzahl mutierter Zellen nach einer Leukämiebehandlung vorhanden, können sie im Knochenmark dafür verantwortlich sein, dass die Leukämie wieder auftritt. Mit den NGS-Techniken können wir heute eine leukämische Zelle noch unter bis zu 100 000 normalen Zellen dingfest machen. Weil wir die Leukämie nun auch auf molekularer Ebene noch nachweisen können, erlaubt das, die entsprechenden Therapieschritte einzuleiten. Mit dem Ziel, auch noch diese letzten Leukämiezellen zu vernichten. Wir verwenden dazu zum Beispiel immunologische Therapien mit Spender-Lymphozyten oder sogenannte epigenetische Therapien. Präziser wirkende Medikamente Das laufend präziser werdende Wissen fördert auch die Entwicklung neuer Medikamente und hilft zu bestimmen, welche Ziele bei welchen Zellen am besten angegriffen werden. Die klassischen Zytostatika in der Therapie der AML wirken unspezifisch auf alle sich schnell teilenden Zellen im Körper, sowohl auf die ins Visier genommenen Leukämiezellen, aber auch normale Zellen des Körpers wie etwa die Schleimhaut-Zellen in Magen und Darm oder der Haarwurzel. Weil wir heute Mutationen identifizieren können, die ausschliesslich in Leukämie-Zellen vorkommen, kann die Therapie spezifischer und damit häufiger mit weniger Nebenwirkungen durchgeführt werden. Bereits gibt es Medikamente, die direkt diese Mutationen in Leukämiezellen beeinflussen und zum Beispiel in den Zellstoffwechsel der mutierten Zellen eingreifen. Zurzeit befinden sich viele Medikamente dieser «zielgerichteten» Therapien in klinischer Entwicklung. In den letzten Jahren ist das Wissen um die Mutationen, welche Leukämie hervorrufen können, regelrecht explodiert. Die Therapiemöglichkeiten, die den Zellstoffwechsel der Leukämiezellen beeinflussen, werden stetig grösser. So haben zum Beispiel sogenannte Kinaseinhibitoren mittlerweile die Prognose der Patienten bestimmter Typen von Leukämie verbessert. Es besteht berechtigte Hoffnung, dass die Patientinnen und Patienten von diesen beeindruckenden neuen Erkenntnissen profitieren. PD Dr. med. Michael Medinger Hämatologie Innere Medizin PhD Dr. Pontus Lundberg Fachlicher Leiter molekulare Diagnostik Prof. Dr. med. Jakob R. Passweg Chefarzt Hämatologie Carlas Reise nach Basel und zurück ins Leben Wie spezialisierte Pflegebegleitung die Rückkehr in den Alltag erleichtert Von Monika Kirsch und Cornelia Bläuer «Wie aus dem Leben gerissen», mit kurzen Worten beschreibt Carla Fonte (Name geändert) ihre Gefühle, als sie von ihrer Diagnose erfuhr: Lymphdrü­ senkrebs – ein grosser Schock. Damals lebte die 47-jährige lebensfrohe, ge­ schiedene Frau mit ihrer Tochter im Tessin. Vier Jahre ist es nun her, dass sie einen geschwollenen Knoten am Hals bemerkt hatte. In der Nacht schwitzte sie stark und verlor fünf Kilo an Gewicht. Sie ging zu ihrem Arzt und musste sich vielen Untersuchungen unterziehen. Dann die ernüchternde Diagnose. Im Spital Bellinzona erhielt sie Chemotherapie, Bestrahlungen und es wurden ihr körpereigene Stammzellen transplantiert. Drei Jahre lebte sie darauf einigermassen beschwerdefrei, bis sie eines Tages wieder einen Lymphknoten spürte. Ein Rückfall. Und alles ging wieder von vorne los. Nur wenige Spitäler in der Schweiz verfügen über die Expertise in der Stammzelltransplantation. So wurde Carla Fonte zur weiteren Behandlung ins Universitätsspital Basel überwiesen. Eine neue Stammzelltransplantation, diesmal mit fremden Blutzellen, wurde erforderlich. Alleine im Netz der Behandlung Die Behandlung einer Blutkrebserkrankung benötigt das Zusammenspiel von vielen Experten: Ärztinnen und Ärzte, Pflege, Ernährungsberatung, Physiotherapie, Psychoonkologie und viele mehr. Betroffene berichten, sie fänden sich in diesem komplexen Betreuungsnetzwerk schwer zurecht. Auch Carla Fonte ging es so. Die Familie war weit weg im Tessin. Sie kam in ein unbekanntes Spital und wurde von einem neuen, für sie fremden Behandlungsteam betreut. Eine besondere Stütze für Carla war in dieser Zeit Sabine Degen Kellerhals. Die Pflegefachfrau mit über dreissig Jahren Berufserfahrung ist eine von neun Advanced Practice Nurses (APNs), die am Universitätsspital Basel arbeiten. Pflegeexpertinnen APN sind Pflegefachpersonen, die nach mehreren Jahren Berufserfahrung nochmals den Weg zurück an die Uni oder Fachhochschule wagen, um dort Pflegewissenschaft zu studieren. Als Pflegeexpertin spezialisiert, kümmert sie sich nur um eine bestimmte Patientengruppe und kennt sich somit in diesem Bereich bestens aus. Bei Sabine Degen sind es Patientinnen und Patienten mit einer Stammzelltransplantation. In der Schweiz gibt es APNs erst seit rund einem guten Jahrzehnt, in den USA ist die Berufsrolle schon seit mehr als vier Jahrzehnten etabliert. Tägliche individuelle Unterstützung Sabine Degen ist eine Allrounderin mit hohem Anspruch an die Betreuung ihrer Patientinnen und Patienten. Täglich besucht sie stammzelltransplantierte Patientinnen oder Patienten wie Carla, um mit ihnen Befinden, Beschwerden und Bedürfnisse zu klären. Carla Fonte zum Beispiel hat grosse Probleme mit dem Essen, weil sie unter Übelkeit und Geschmacksveränderungen leidet. Sabine Degen zeigt ihr verschiedene Therapiemöglichkei- Eng begleitet.Pflegeexpertin Sabine Degen Kellerhals geht mit einer Patientin durch, was zu Hause alles berücksichtigt und getan werden muss. Foto Unispital Basel ten auf und zieht zur Unterstützung die Ernährungsberaterin bei. Ein weiteres Problem ist die gerötete juckende Haut, eine bekannte Nebenwirkung der Stammzelltransplantation. Sabine Degen eruiert mit Carla die Möglichkeiten der Hautpflege und passt mit dem Arzt die medikamentöse Therapie an. Vom profunden Wissen und der Erfahrung der Pflegeexpertin profitieren auch die Kollegen. Die schwierigen Fragen zu der hochspezialisierten Behandlung klärt sie in regelmässigem Austausch mit Pflegefachpersonen, Ärztinnen und Ärzten. Der grosse Schritt nach Hause Für viele Patientinnen und Patienten stellt die Entlassung aus dem Spital eine Herausforderung dar: Wie geht es weiter? Wer unterstützt mich? Erkenne ich eine Verschlechterung rechtzeitig? Auch Carla Fonte ist verunsichert. Für sie ist der Schritt von Basel ins Tessin ein grosser und erfordert gute Organisation und Kommunikation zwischen den Behandlungsteams. Auch hier nimmt Sabine Degen eine Schlüsselfunktion ein. Früh knüpft sie Kontakt mit der Pflegeexpertin des Ambulatoriums in Bellinzona. Bald haben die beiden Pflegeexpertinnen alles aufgegleist: zum Beispiel den Fahrdienst zum Spital, das vollständige Rezept in der richtigen Apotheke, der Termin im Spital Bellinzona und die Schulung zur richtigen Einnahme der Medikamente. Nach 15 Tagen steht die Entlassung aus dem Universitätsspital Basel an. Sabine Degen klärt mit Carla Fonte die Fragen rund um den Austritt. Die beiden gehen die Informationen für zu Hause nochmals durch. Sorgfältig wird geprüft, ob die Patientin alles verstanden hat, welche gesundheitlichen derungen sie beobachten und Verän­ wann sie sich sofort melden muss. Die Rund-um-die-Uhr-Telefonnummer hat sie bereits im Natel. Sabine Degen ist erleichtert. Sie glaubt, dass alles so organisiert ist, dass Carla Fonte nach der intensiven Behandlung wieder ihren Weg zurück in einen «fast normalen» Alltag finden kann: «Ich lerne täglich, wie Menschen mit solchen schweren Lebenssituationen umgehen und dabei Zuversicht und Kraft entwickeln. Ich habe grösste Achtung vor allen Patienten und ihrem Weg durch die Zeit mit Krebs.» Es sind nun sieben Wochen seit dem Eintritt ins Universitätsspital Basel vergangen. Carla Fonte ist zur Zeit beschwerdefrei. Im Februar wird sie ihre Arbeitstätigkeit halbtags wieder aufnehmen. PhD RN Monika Kirsch Pflegeexpertin Hämatologie PhD RN Cornelia Bläuer Chefin Pflege Spezialkliniken Krebs persönlich. Die feinen Unterschiede Von vielen Mensc Molekulare Onkologie bietet Zugang zu personalisierter Krebsbehandlung Von Sacha Rothschild und Andreas Wicki Wir erleben zurzeit in verschiedenen Gebieten der Krebsforschung und -behandlung eine wahrhaft aufregende Entwicklung. Der rasche Fortschritt neuer Techniken erlaubt es uns, immer tiefer in die molekularen Mechanismen der Krebsentstehung zu sehen und bösartige Tumoren in einer Art und Weise feiner zu unterscheiden, die noch vor Kurzem unvorstellbar war. Wie in dieser Beilage an verschiedenen Orten und aus verschiedenen Blickwinkeln aufgezeigt wird, lassen sich aus unverwechselbaren genetischen Veränderungen, die ursächlich für Auftreten und Wachstum eines Tumors sind, auf neue Wege schliessen, wie man diesen spezifischen Tumor gezielt angehen und erfolgreicher behandeln könnte. Dabei wird in mancher Hinsicht immer deutlicher, dass man einen bösartigen Tumor nicht mehr nur nach dem Organ, in dem er auftritt, behandelt, wie man das früher tat. Sondern dass seine genetische Ausstattung und die für das Geschehen in den Zellen verantwortlichen Signalwege ihn in neue Kategorien einordnen lassen, die aus rationalen Gründen eine gezielte und präzise Behandlung sinnvoll machen. Heute wissen wir viel mehr darüber, wie Krebszellen sich durch Mutationen im Laufe der Krankheit verändern. Damit bieten sie auch neue verwundbare Seiten, die man therapeutisch nutzen kann. Rasch wachsendes Wissen verlangt gebündelte Kompetenz Derzeit wächst das Wissen in diesen Dingen schnell und eine Menge erhobener Daten drängt auf Auswertung. Dies alles mit dem Ziel, die Behandlungsstrategien präziser und personalisierter auf die Patientin und den Patienten auszurichten und damit erfolgreicher zu gestalten. Dieses wachsende Gebiet ist die Domäne der Molekularen Krebsmedizin oder Molekularen Onkologie, einer vergleichsweise jungen Disziplin, die sich an dieser vielversprechenden, aber auch anspruchsvollen Entwicklung massgeblich beteiligt und sie in inter- disziplinärer Arbeitsweise weiterbringt. Wie wichtig dieser Blick auf die molekularen Mechanismen ist, hat man am Tumorzentrum des Universitätsspitals früh erkannt. Um der internationalen Entwicklung nahe folgen zu können und im Tumorzentrum des Universitätsspitals Basel die fachlichen Ressourcen zu bündeln, wurde ein Kompetenznetzwerk für Molekulare Tumortherapie geschaffen. Es vereint das klinische Wissen der spezialisierten Ärztinnen und Ärzte mit jenem von Grundlagenforschern und hat zum Ziel, die faszinierenden neuen Möglichkeiten, Tumoren entsprechend ihrer molekularen Eigenschaften gezielter zu behandeln, rasch und umfassend zugunsten jedes einzelnen Patienten zu erweitern. Es arbeitet auch eng mit dem Kompetenznetzwerk Immuntherapien zusammen (siehe nebenstehend Seite 5), ebenfalls eine Neugründung des Tumorzentrums. Gemeinsam mit den Fachleuten des Instituts für Pathologie des Universitätsspitals Basel (siehe untenstehenden Artikel), dem Institut für Medizinische Genetik (Seite 2) und Hand in Hand mit dem Kantonsspital Baselland hat das Universitätsspital Basel als erstes Zen­ trum der Schweiz zudem eine Molekulare Tumorkonferenz eingerichtet. Hier treffen sich zweimal monatlich alle beteiligten Spezialistinnen und Spezialisten und besprechen die Resultate der genomischen Analyse von Tumoren. In Zusammenschau mit den klinischen Angaben wird so für jeden Patienten eine individualisierte und personalisierte Behandlungsstrategie aufgestellt. Die Behandlung bösartiger Tumoren richtet sich heute nicht mehr allein nach dem Ursprungsorgan und den Gewebemerkmalen, sondern wird nach den vorgefundenen genetischen Veränderungen justiert. Dank den Daten von Tausenden analysierter Tumoren sind neue Einteilungen möglich, weil die entsprechenden genetischen Merkmale als sogenannte Marker diagnostische, prognostische und am allerwichtigsten therapeutische Deutungen und Vorhersagen erlauben. Bestimmte tumorspe­ zifische genetische Varianten kommen in Tumoren ganz verschiedener Ursprungsorgane vor und lassen schlies­sen, dass man hier mit der gleichen Behandlung Erfolg haben kann. So werden die Therapieansätze mehr und mehr von den in den Genen des Krebsgewebes gefundenen molekularen Eigenschaften bestimmt, wobei zu Hilfe kommt, dass am Tumorzentrum die neusten technologischen Errungenschaften zur molekularen analyse (etwa GensequenzieTumor­ rungsgeräte der neusten Generation, sog. NGS) standardmässig zum Einsatz kommen. Seit April 2015 werden die Tumoren aller Patientinnen und Patienten mit diesen modernsten Technologien untersucht und die Daten samt Interpretation der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt zur Verfügung ge­stellt. Netzwerk bringt verschiedene Fachleute an den gleichen Tisch Die Deutung der grossen Menge von fallspezifischen Daten erfordert das Wissen und die Kompetenz von Fachleuten aus verschiedenen Disziplinen. In unserem Netzwerk Molekulare Tumortherapie arbeiten denn auch Spezialistinnen und Spezialisten der Molekularpathologe, der Molekularbiologie, der Genetik und der Bioinformatik mit Onkologinnen und Onkologen sowie anderen klinisch tätigen Medizinern Hand in Hand, um die für einen Patienten erhobenen Daten und ihre Bedeutung zu diskutieren und die beste vorhandene Therapiestrategie zu wählen. Der in der täglichen Routine etablierte hohe Standard der molekularen Diagnostik und Therapie öffnet uns die Türen zu internationalen Studien, damit wir unseren Patientinnen und Patienten möglichst früh neue Krebsmedikamente zur Verfügung stellen können. Unsere Expertise erweitert sich laufend und verbessert, so die Hoffnung, auch die Erfolge der gewählten Therapien. Wir wollen aber die Daten noch besser nutzen und arbeiten mit akademischen Partnern wie der Nexus-Plattform der ETH Zürich zusammen. Heute beteiligt sich das Tumorzen­ trum des Universitätsspitals Basel an klinischen Studien, in denen Patientinnen und Patienten mit Tumoren behandelt werden, die gleiche molekulare Eigenschaften aufweisen, aber aus unterschiedlichen Ursprungsorganen stammen (sog. «Korb-» oder «Basket-Studien»). Diese Entwicklungen beflügeln die Grundlagenforschung in der Krebsmedizin und die klinische Forschung und Arbeit im Tumorzentrum gleichermassen. Sie stellen aber auch hohe Anforderungen, etwa was den Umgang mit den Daten betrifft. Hohe qualitative Standards müssen befolgt werden, wenn es darum geht, molekulare und klinische Daten zu erheben. Erfinderisch und motiviert Erfinderisch müssen wir auch sein, wenn es darum geht, die Datenfülle, die heute für einen einzelnen Fall erhoben wird und ihn eben, wie gewünscht, «personalisiert», übersichtlich und verständlich darzustellen und zu einem klinischen Nutzen zu interpretieren. Wir sind als Kompetenznetzwerk Molekulare Tumortherapie gut aufgestellt, um als aktive Teilnehmer in internationaler Zusammenarbeit dieses faszinierende Feld voranzubringen. Zum Wohl des einzelnen an Krebs erkrankten Menschen, der unsere Hilfe und die beste verfügbare Behandlung benötigt. PD Dr. med. Dr. phil. Sacha Rothschild Oberarzt, Onkologe, Leiter Kompetenznetzwerk Molekulare Onkologie PD Dr. med. Andreas Wicki Oberarzt, Onkologe, Leiter Kompetenznetzwerk Molekulare Tumortherapie Gemeinsam und verschieden. Jede und jeder un Mehr und mehr weiss man heute aus den Erfahrun lernt, eine präzis auf die einzelne Patientin oder de Basler Gen-Panel hilft 70 genetische Varianten bei L Neu entwickeltes Hilfsmittel erlaubt zusätzlich zur Gewebeanalyse Krebsformen zu typisieren und damit die wirksamste Th Von Alexandar Tzankov und Stephan Dirnhofer Moderne Methoden der Gewebediagnostik ermöglichen es heute dem Pathologen, nicht nur das mikroskopische Erscheinungsmuster (das «Passfoto») der Tumoren, sondern auch ihre mo­­lekulare Identität (den «biometrischen Pass») zu überprüfen. Wie aber untersucht man den biometrischen Pass der Tumoren und warum ist er so wichtig? Bei praktisch allen Tumoren ist die Balance zwischen Zellvermehrung und Zelluntergang zugunsten der Zellvermehrung gestört. Der Grund dafür sind Veränderungen im genetischen Programm der Zelle. Zum einen können diese direkt zur Zellvermehrung führen, zum andern werden es immer mehr Zellen, weil der programmierte Zelltod, der sonst für Ausgleich sorgt, gestört ist. Beide Entstehungswege haben am Ende unter dem Mikroskop das gleiche Erscheinungsbild: Wir sehen einen Krebs­zellhaufen. Will man jetzt neben allen bisherigen Behandlungen eine Therapie finden, die neu auf die Ursache der Entstehung zielt und sie trifft, muss man wissen, welcher der beiden Wege vom Tumor begangen wird und wo seine Achillesferse liegt. Die Krebszelle ist davon abhängig, dass die molekularen Störungen, welche zu ihrer Vermehrung führen oder sie vor dem Sterben schützen, aufrechterhalten bleiben. Das macht sie verwundbar. Gelingt es nämlich, eines oder mehrere Glieder der gestörten molekularen Kommunikation abzuschalten, kann das zum Stopp der Krebswucherung, sogar zum völligen Absterben der Krebszellen führen. Welcher der beiden Wege zum Krebs geführt hat, sieht man allerdings nicht unter dem Mikroskop. Hierfür braucht man weiterführende Untersuchungen, die gestörte molekulare Kommunikationsstafetten im Gewebe entschlüsseln können. Den Genvarianten auf der Spur Seit nunmehr vierzig Jahren nutzen die diagnostisch tätigen Pathologen die Methode der Immunhistochemie, mit der man normale, aber auch krankhaft veränderte Eiweisse im Gewebe darstellen kann (siehe Abbildung A). Später kamen Methoden dazu, die es ermöglichen, Genmengen und Genkonfigurationen abzubilden (in situ Hybridisierung, Abb. B), und andere, die den chemischen Code einzelner Gene in Buchstaben übersetzen (Abb. C). Doch jetzt ist ein neues Kapitel aufgeschlagen: Mit einer massiven parallelen Gencodeübersetzung oder Gensequenzanalyse (dem «Next Generation Sequencing») können rasch und anhand kleiner Mengen genetischen Materials Hunderte Gene kontrolliert und auf allfällige Abweichungen ihres Vier Steckbriefe.Viermal ein anderer Zugang zu einem Lymphom: Immunhistochemie hilft krankhafte Eiweisse entdecken (A). Gene und ihre Anordnung lassen sich darstellen (B). Die Häufigkeit der vier Buchstaben in der Genschrift lässt sich eruieren (C) und schliesslich kann der Gentext rasch entziffert und auf Hunderte Mutationen untersucht werden (Next Generation Sequencing). Die Bewertung zeigt, welche Behandlung im Moment am meisten Erfolg verspricht.Bilder Institut für Pathologie | Samstag, 28. Januar 2017 | Seite 5 chen lernen, was auf den Einzelnen passt Das Immunsystem gegen Krebs aktivieren Revolutionäre Entwicklungen in der Therapie Von Heinz Läubli, Frank Stenner und Alfred Zippelius Das Immunsystem ist für unseren Körper ein entscheidender natürlicher Schutz gegen Krebsentstehung und -erkrankung. Patienten mit einer Immunschwäche, zum Beispiel aufgrund einer HIV-Infektion oder Immununterdrückung nach Organtransplantation, haben deshalb ein vielfach erhöhtes Risiko, an Krebs zu erkranken. In den meisten Fällen werden entstehende Krebszellen unmittelbar durch das Immunsystem eliminiert. Es besteht aber die Möglichkeit, dass das Immunsystem die Krebszellen zunächst zwar in Schach hält, in einem zweiten Schritt aber die bösartigen Zellen Mechanismen entwickeln, um sich vor dem Immunsystem zu verstecken, sodass es zu einem Fortschreiten der Erkrankung kommt und der Krebs sich nun ungehindert im Körper des Patienten ausbreiten kann. nter diesen Frauen und Männern hat sehr vieles mit allen anderen gemeinsam und unterscheidet sich doch entscheidend von allen. ngen mit vielen, dass es wichtig ist, in der Behandlung von Krebserkrankungen genau auf individuelle Unterschiede zu achten. Und en einzelnen Patienten abgestimmte «personalisierte» Therapie zu entwerfen. Foto Fotolia Lymphomen zu unterscheiden herapie gegen Krebs der Lymphdrüsengewebe zu finden Codes (Punktmutationen) oder ihrer Menge (Genzugewinne oder -verluste) überprüft werden (Abb. D). Die Erfahrung zeigt, dass es bei den meisten Krebsarten auf die Störung nur einiger Dutzend Gene ankommt. Längst nicht alle Gene müssen daher überprüft werden. Das spart Aufwand und Kosten. Die typischen Genkombinationen variieren von Tumortyp zu Tumortyp. Den zum Tumortyp passenden Test kann nur der Pathologe oder die Pathologin bestimmen. Bei dieser mikroskopischen Analyse muss festgelegt werden, welche Genkombinationen man mit «Genpanels» untersuchen sollte. Für die häufigsten Tumoren wie Lungenkrebs, Dickdarmkrebs und Tumoren des weiblichen Genitaltraktes sind solche Panels kommerziell erhältlich. Als eines der ersten Institute für Pathologie in Europa haben wir, aufgrund unseres besonderen Forschungsinteresses und des Schwerpunkts, den der Bereich der Hämatoonkologie (Blutkrebsbehandlung) am Universitätsspital Basel bildet, für Lymphdrüsenkrebserkrankungen (Lymphome) ein spezifisches Panel entwickelt, publiziert und in die tägliche klinische Diagnostik eingeführt. Ein Fallbeispiel Mit diesem Werkzeug können wir simultan die rund siebzig am häufigsten bei Lymphomen mutierten Gene «lesen» und wichtige Rückschlüsse auf die Abstammung der Tumoren, ihre Aggressivität und Therapiesensitivität ziehen, wie das am folgenden Fallbeispiel veranschaulicht wird: Eine 23-jährige Patientin aus der Ostschweiz entwickelt Anfang des letzten Jahres ein Lymphom hinter dem Brustbein. Es handelt sich um eine Variante, welche erfahrungsgemäss eigentlich ausgezeichnete Heilungschancen aufweist. Der Tumor spricht aber nur unvollständig auf die Chemotherapie an und wächst prompt wieder. In dieser Situation entschliesst man sich, eine aggressive Chemotherapie, unterstützt durch Transplantation eigener Stammzellen, durchzuführen. Aber auch unter dieser Therapie schreitet der Tumor weiter fort. Was tun? Die behandelnden Onkologen nehmen Kontakt mit der Hämatoonkologie in Basel auf. Wir raten, das Gewebe des therapieresistenten Tumors für weiterführende Analysen an das Institut für Pathologie des Universitätsspitals Basel zu schicken. Das geschieht: Die Analyse der Tumorproteine und -gene zeigt, welche Genmutationen für die Entstehung des Lymphoms verantwortlich sind (Mutationen von STAT6 und MCL1). Es stellt sich heraus, dass der Tumor mit einer Vervielfältigung des sogenannten PDL1-Gens und durch Mutation eines anderen Gens namens B2M in der Lage ist, die immunologische Kontrolle des Körpers auszuschalten. Diese Information fliesst in einen Bericht (Abb. D) ein. Man weiss nun: Gegen die Wirkung der mutierten Gene kann mit neuen Medikamenten vorgegangen werden. Die klinischen Kollegen in der Ostschweiz wenden die durch die Panel­ analyse gewonnenen Informationen an und entschliessen sich, neben einer Radiotherapie, für ein Medikament gegen die Effekte der PDL1-Vervielfältigung (Nivolumab) aus dem Bereich der Immuntherapie (siehe Artikel rechts). Die erste Gabe wurde vor Kurzem verabreicht, und der Tumor beginnt zu schrumpfen ... Prof. Dr. med. Alexandar Tzankov Bereichsleiter Histopathologie Prof. Dr. med. Stephan Dirnhofer Stv. Chefarzt Pathologie Krebszellen sichtbar machen Die Forschung hat in den letzten Jahren auf diesem Gebiet grosse Fortschritte gemacht und wir verstehen diese molekularen Mechanismen heute viel besser, vor allem die Wege, wie die Krebszellen das Immunsystem manipulieren. Wissenschaftliche Erkenntnisse haben nun ermöglicht, die versteckten Krebszellen mit neuen Medikamenten für das Immunsystem in einem Teil der Krebspatienten wieder gezielt sichtbar zu machen, sodass das Immunsystem wieder die Kontrolle über den Krebs zurückgewinnen kann. Dabei gelingt es, dass – anders als bei herkömmlichen Therapien wie Chemotherapie – das Immunsystem bei einigen Patienten trotz fortgeschrittener Erkrankung über lange Zeit den Krebs kontrollieren oder gar komplett vernichten kann. Die neuen Immuntherapien sind breit einsetzbar und werden aktuell vor allem beim Schwarzen Hautkrebs (dem sogenannten Melanom), dem Lungenkrebs, bei Hals-Nasen-Ohren-Tumoren, beim Blasenkrebs sowie beim Nierenkrebs erfolgreich angewendet. Bei vielen weiteren Krebsarten wie Brustkrebs, Eierstockkrebs oder auch Lymphdrüsenkrebs laufen zurzeit Studien; die ersten Resultate sind sehr vielversprechend. In der Zukunft werden verschiedene Immuntherapien und auch konventionelle Therapien wie Chemo­­ therapie und Radiotherapie kombiniert werden, um bei einer noch grösseren Zahl von Patienten eine langfristige Kontrolle auch bei weit fortgeschrittener Krebserkrankung zu ermöglichen. Immuntherapeutische Kompetenz Das Universitätsspital Basel hat seit vielen Jahren ein spezielles Interesse an Immuntherapien von Krebserkrankungen, gerade auch, weil Immunologie ein wichtiger Forschungsschwerpunkt ist. Daher wurde im Tumorzentrum am Universitätsspital Basel auch ein klinischer Schwerpunkt im Bereich der Immuntherapien eingerichtet, um den Umgang mit dieser neuen Art von Medikamenten möglichst optimal zu begleiten und zu steuern. Aktuell werden eine grosse Zahl von Forschungsprogrammen und Studien durchgeführt, um dieses neue Wissen unmittelbar den Patientinnen und Patienten zur Verfügung zu stellen. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung war die Gründung eines Kompetenznetzwerks für Immuntherapien am Tumorzentrum. Hier arbeiten Spezialisten verschiedener Fachrichtungen und somit auch Ärztinnen und Ärzte zusammen, die sich mit nicht bösartigen Erkrankungen des Immunsystems beschäftigen. Alle bringen sich in das Netzwerk ein und teilen ihre Expertise. Dies ist nicht nur für die individuelle Behandlung des Patienten wichtig, sondern darüber hinaus auch für das Management von Nebenwirkungen der Therapie. Immuntherapien von Krebspatienten können neue und sehr spezielle Nebenwirkungen verursachen, die erfordern, dass Spezialisten verschiedener Disziplinen eng zusammenarbeiten. So werden die behandelten Patientinnen und Patienten regelmässig in interdisziplinären Tumorkonferenzen von den beteiligten Immuntherapieexperten besprochen. Hochaktuelles gemeinsames Wissen und klinische Kompetenz kommen den Patientinnen und Patienten des Universitätsspitals Basel zugute. Dabei werden therapeutische Strategien laufend an den internationalen Standard angepasst. Eine Vielzahl immuntherapeutischer Studien sind gegenwärtig am Universitätsspital Basel eröffnet. Auf den Patienten zugeschnitten Die stets aktuelle Forschung erlaubt es uns heute, für eine Patientin oder einen Patienten, so weit sinnvoll und verfügbar, jene Immuntherapie zu wählen, die am wahrscheinlichsten eine Wirkung erzielt. Dafür analysieren wir die molekularen Veränderungen der Krebszellen und Eigenschaften der Immunzellen des Patienten. So können wir die Immuntherapie genau gegen die für den Tumor spezifischen Veränderungen und damit auf den individuellen Patienten ausrichten. Eine weitere Therapie, die wir in der Zukunft anbieten wollen, ist eine Behandlung des Patienten mit seinen eigenen Immunzellen. Sie werden entnommen, im Labor vermehrt und gegen den Krebs aufgerüstet und dann dem Patienten oder der Patientin wieder zurückgegeben. Diese Methode wird in verschiedenen Krebszentren in der Welt bereits erfolgreich angewendet. In der Schweiz wird diese Therapieform aktuell entwickelt und in Zukunft auch Patientinnen und Patienten am Tumorzentrum des Universitätsspitals Basel zur Verfügung stehen. Tumorimmunologische Spezialsprechstunde Das Tumorzentrum des Universitätsspitals Basel will seine Erfahrungen auf dem Gebiet der Immuntherapie und der zahlreichen immuntherapeutischen Studien möglichst vielen Patientinnen und Patienten zugänglich machen. Es wurde deshalb eine Spezialsprechstunde für Immuntherapie bei Krebserkrankungen eingerichtet. Hier wird für die jeweilige Patientin oder den Patienten ein individueller Therapieplan mit angepasster Reihenfolge und, wo sinnvoll, auch einer Kombination von Immuntherapien mit zielgerichteten Therapien oder Chemotherapien erstellt. Auch die Behandlung eines Patienten durch eigene Immunzellen wird in dieser Sprechstunde geplant und koordiniert werden. Sie hilft uns auch entscheidend, möglicherweise auftretende Nebenwirkungen optimal im Zusammenspiel mit anderen Spezialisten am Universitätsspital wie etwa Magen-Darm-Spezialisten oder Haut­ ärzten zu erkennen und zu behandeln. Diese Sprechstunde findet in der Medizinischen Onkologie statt und steht allen Patientinnen und Patienten offen. Dr. med. Heinz Läubli Oberarzt Onkologie PD Dr. med. Frank Stenner Leiter Zentrum für Hämato-Onkologie Prof. Dr. med. Alfred Zippelius Stv. Chefarzt Onkologie Krebs persönlich. | Samstag, 28. Januar 2017 | Seite 6 Leben gut erleben Jeder Brustkrebs ist ein einzelner Fall Wie Palliative Care hilft Basler Forscher und Kliniker Hand in Hand gegen Mammakarzinom und Metastasen Von Sandra Eckstein Mit dem Ziel, die Behandlung von Brustkrebs präziser zu gestalten, arbeiten im Tumorzentrum des Universitätsspitals Basel die Teams des Leiters des Brustzentrums, Prof. Walter P. Weber, und des Grundlagenforschers Prof. Mohamed «Momo» Bentires-Alj am Departement für Biomedizin an der Hebelstrasse zusammen. Beide gehören zu den Gründern des «Basel Breast Consortium» und sind Hauptakteure in dem vom Schweizerischen Nationalfonds und SystemsX finanzierten Projekt Meta­stasiX, dessen Leitung Prof. Walter P. Weber innehat und das sich auf die Spuren der Metastasenbildung konzentriert, um deren Abwehr und Behandlung zu verbessern. Menschen, die an Krebs erkranken und mit der Möglichkeit konfrontiert werden, dass es für die Krankheit keine Heilung geben könnte, haben vielfältige Fragen: «Was kommt auf mich zu? Werde ich leiden müssen? Wie geht es meiner Familie? Wie kann ich mein Leben weiter autonom gestalten? Was braucht es, damit meine Wünsche beachtet und umgesetzt werden?» Oft sind auch Familie und Freunde durch Fragen und Sorgen belastet. Das Palliative-Care-Team vom Tumorzentrum des Universitätsspitals Basel möchte Patientinnen und Patienten sowie Angehörige bei diesen schwierigen Fragen unterstützen und begleiten. Beschwerden lindern Der Schwerpunkt der Behandlung und Begleitung liegt in der bestmöglichen Therapie, Linderung und Vorbeugung von körperlichen und seelischen Beschwerden, ebenso wie in der Unterstützung von sozialen und auch spirituellen Bedürfnissen. Ziel ist die bestmögliche und angemessene Behandlung zu jedem Zeitpunkt der Erkrankung. Die Behandlung der Grunderkrankung, zum Beispiel eine Chemotherapie oder Strahlenbehandlung, und Palliative Care schliessen sich dabei nicht aus, sondern ergänzen sich sinnvoll. Der etwas fremde Begriff palliativ bekommt etwas Positives, wenn man weiss, dass er sich vom lateinischen Wort pallium für Mantel, Umhang ab­leitet. Das englische Wort Care wiederum lässt neben Pflegen auch Kümmern, Sorgen und Behüten anklingen. Wir wollen das Gefühl von Schutz und Sicherheit geben, dem Patienten unter diesem umfassenden Mantel Autonomie und Lebensqualität ermöglichen. Dame Cicely Saunders (1918–2005), Begründerin der Palliativmedizin, sagte es so: «Wir können zwar nicht die ganze Last des Geschehens wegnehmen, aber wir können helfen, sie in handhabbare Proportionen zu bringen.» Damit wir dieses Ziel erreichen, planen wir vorausschauend mit den Betroffenen eine individuelle Behandlung, wobei der Respekt für Werte und Wünsche im Mittelpunkt steht. Unser Angebot stationär und ambulant umfasst: > Behandlung und Linderung von Beschwerden wie Schmerzen, Atemnot, Übelkeit, Schlafstörungen und anderen körperlichen Beschwerden sowie psychischen Belastungen; > Begleiten und Unterstützen bei schwierigen Therapieentscheidungen, Beratung zu Patientenverfügungen; > Unterstützung bei der Organisation und dem Aufbau eines Versorgungsnetzes, in das der Patient stabilisiert entlassen werden kann; > Erstellung von Notfallplänen für zu Hause wie zum Beispiel für Schmerzoder Atemnotkrisen; > Schützende Begleitung von sterbenden Patienten sowie deren Angehörigen. Wir betreuen unsere Patientinnen und Patienten in enger Zusammenarbeit mit Ärztinnen, Ärzten und der Pflegepersonen des Tumorzentrums, den Kolleginnen und Kollegen der Physiotherapie, Ernährungsberatung, Psychoonkologie, der Seelsorge, des Schmerz dienstes und des Sozialdiensts. Darüber hinaus haben wir engen Austausch mit dem Hausarzt, der Spitex, der Onko-Spitex und anderen ambulanten Diensten. Unser Ziel ist es, Menschen in schwierigen Situationen den Blick für neue Wege zu öffnen, die ihnen Sicherheit, Würde und Selbstbestimmung ermöglichen. Dr. med. Sandra Eckstein Leiterin Palliative Care BaZ: Herr Weber, Brustkrebs ist die häufigste Krebsart von Frauen, jede dritte Diagnose gilt diesem Krebs. Was weiss man noch zu wenig von diesem gefährlichen Krebs? Walter P. Weber: Anders als bei eini- gen anderen Krebsformen, wo man detaillierter unterscheiden kann, teilen wir Brustkrebs immer noch in vier grosse Gruppen ein, die jeweils ähnlich behandelt werden. Wir wissen aber aus der klinischen Beobachtung, dass es weitere feinere Unterschiede gibt und im Prinzip jeder Krebs individuell ist. Hier suchen wir nach neuen Ansätzen, die hoffentlich auch die Therapie weiter verbessern. Herr Bentires-Alj, Sie sind vom Basler Friedrich-Miescher-Institut an das Departement Biomedizin gekommen und forschen grundlegend mit einer 15-köpfigen Gruppe auf dem Thema Brustkrebs, was sind Ihre Fragen? Mohamed Bentires-Alj: Wie Walter Weber gesagt hat, ist im Grunde jeder Krebsfall einzigartig. Den feinen Unterschieden gehen wir nach. Warum finden sich bei Brustkrebszellen so unterschiedliche molekulare Eigenschaften? Zum Zweiten schauen wir auf die Umgebung der Zellen, das Mikro-Umfeld. Es spielt sicher eine grosse Rolle und die wollen wir aufklären. Aufbauend auf das Verständnis für die Mechanismen, die der Erkrankung zugrunde liegen, suchen wir nach neuen Zielen und Angriffspunkten und bewegen uns rasch in Richtung einer personalisierteren, besser auf die einzelne Patientin ausgerichteten Therapie. Grundlagenforschung und Klinik sind am Basler Universitätsspital sehr nahe beieinander. Bentires-Alj: Das ist ein unschätzba- rer Vorteil, wie es ihn sonst selten gibt und den ich mit dem Wechsel hierher erst voll nutzen kann. Wir haben laufend direkten Kontakt mit der Klinik und den Patientinnen, wir reden viel miteinander. Das klappt hervorragend im Tumorzentrum des Universitätsspitals Basel. Als Forscher sitze ich bald auch in der Tumorkonferenz. Ideale Verhältnisse. Weber: Wir können sogar während der Operation zusammenarbeiten. In zehn Minuten ist eine Gewebeprobe auch bei Momo im Labor. Wie nutzen Sie das für Ihre Arbeit? Bentires-Alj: Wir wollen den Tumor jeder Patientin begleitend im Labor untersuchen. Dazu halten wir die Zellen entweder im Mausmodell oder in Kultur. Wir analysieren sie auf der molekularen Ebene und wollen so auch Behandlungen auf ihre Wirksamkeit testen. Das Ziel ist, so schnell wie möglich die Erkenntnisse bei der Patientin anzuwenden. Präziser und hoffentlich effizienter. Dieses Projekt starten wir jetzt. Dazu ist unsere Zusammenarbeit mit der Klinik ideal. Die grösste Herausforderung ist die Frage, warum es zu Resistenzen kommt. Zweitens wollen wir Überbehandlung vermeiden und nur Medikamente einsetzen, die auch wirken. Wie wird solche Forschung bezahlt? Weber: Wir werden zum Beispiel vom Einzigartig.Das Basel Breast Consortium trifft sich regelmässig. Hier im historischen Hörsaal des Universitätsspitals Basel. Foto Universitätsspital Basel Schweizerischen Nationalfonds im Rahmen der Schweizer Initiative für Systembiologie mit 2,2 Millionen in dem Forschungsprojekt Meta­ stasiX unterstützt, das sich mit Partnern des Tumorzentrums des Universitätsspitals Basel, der Universitäten Basel und Zürich, des Friedrich-Miescher-Instituts und mit der IBM darauf konzentriert, die Signalwege aufzudecken und zu nutzen, die beteiligt sind, wenn sich der Krebs mit Metastasen in anderen Organen ansiedelt. Da vergleichen wir mit komplexen Techniken gewonnene Daten direkt mit den Gewebeproben der Patientinnen. Wir hoffen die Behandlung der noch viel zu oft tödlichen Krebsausbreitung zu verbessern. Wie gut läuft der Austausch unter den Beteiligten? Bentires-Alj: Wir haben dazu das «Basel Breast Consortium» gegründet, eine Plattform, auf der wir uns austauschen. Das gibt es so sonst nirgends auf der Welt. Wer macht da mit? Weber: Das Konsortium steht allen in der trinationalen Region offen, die sich mit Brustkrebs oder der Entwicklung der Brustdrüse befassen. Da treffen sich Ärztinnen und Ärzte, Forscher aus Labor und Klinik und Leute aus der Industrie. Auch Vertreterinnen von Patientenorganisationen sind willkommen. Wir sehen uns mindestens alle vierzehn Tage und sind sehr motiviert. Basel Breast Consortium: www.baselbc.org Die Fragen stellte Martin Hicklin Prof. Dr. med. Walter P. Weber Leiter Brustzentrum Prof. Dr. Mohamed Bentires-Alj Forschungsgruppenleiter Departement für Biomedizin Bildgebendes Werkzeug als Waffe Mit Radionuklid beladenes Kombi-Molekül greift Tumoren an – eine Basler Pionier-Entwicklung Von Damian Wild In der Nuklearmedizin des Universitätsspitals Basel haben wir in den letzten zwanzig Jahren eine Methode zur Anwendungsreife entwickelt, die ein diagnostisches Verfahren zu einer präzise wirkenden Waffe der Radiotherapie schärft und als «theranostisches» Verfahren weltweite Anerkennung gefunden hat. Die entscheidende Rolle bei der Entwicklung hat dabei die Abteilung für Radiopharmazeutische Chemie im Universitätsspital gespielt, mit der wir eng zusammenarbeiten. Die Nuklearmedizin am Universitätsspital Basel ist auf Bildgebung und Therapien mit Radioisotopen spezialisiert und sehr modern eingerichtet. Im Bereich Krebs nutzen wir den Umstand, dass sich ein radioaktiv markiertes Medikament oder ein Radionuklid ganz spezifisch im Tumorgewebe anreichern kann. So entsteht anhand der gemessenen Strahlenverteilung ein Bild der Lage des Primärtumors und allenfalls von Metastasen. Man kann nun aber auch Radioisotope zum Tumor lenken, die nur in ihre unmittelbare Umgebung Partikel aussenden und damit das Tumorgewebe bestrahlen und zerstören. Es ist uns in Zusammenarbeit mit dem Institut für Pathologie der Universität Bern gelungen, diese Technik gegen bestimmte, sogenannte neuroendokrine Tumoren einzusetzen. Es sind Tumore, die dadurch auffallen, dass sie auf ihren Zellen sehr viele Rezeptoren oder Bindungsstellen für das Hormon Somato­ statin tragen. Somatostatin wird im Körper etwa in der Bauchspeicheldrüse, im Magen und anderen Orten produziert und sehr schnell wieder abgebaut. Darum wurden Moleküle gesucht, die sich wie Somatostatin an die Rezeptoren binden, aber länger Bestand haben. Die Somatostatin gleichende oder «analoge» Substanz soll aber auch die Fähig- Anhand der sehr guten Bildqualität Tumoren langfristigen Aufschub vervon Gallium-68-Dota-Toc kann die schaffen, die etwa im Dünndarm aufBehandlungsstrategie für den einzel- treten, langsam wachsen und darum nen Patienten massgeschneidert und einer die Zellteilung bremsenden Cheindividuell festgelegt werden, mit dem motherapie nicht zugänglich sind. Die Ziel minimaler Nebenwirkungen bei mit Lutetium­-177-Dota-Toc behandelmaximalem Therapieeffekt. Das radio­ baren Tumoren sind zwar selten, ihre aktiv beladene Medikament wird zwar Zahl nimmt aber derzeit laufend zu. rasch über die Nieren ausgeschieden, Wir sind stolz darauf, dass wir in es muss aber darauf geachtet werden, diesem Bereich weltweit eine PionierIn zwei Stunden ein genaues Bild Das kann zum Beispiel Gallium-68 dass dort möglichst wenig Schaden rolle einnehmen. Die Lu-177-­Dota-Tocsein. Gallium-68 sendet sogenannte angerichtet wird. Es können auch Aus- Therapie gilt seit 2010 als spitzenmediziPositronen aus, genau jene Strahlung, wirkungen auf die Blutbildung im Kno- nischer Schwerpunkt des Universitätsspidie in einem PET-Gerät (Positronen-­ chenmark beobachtet werden. Die tals Basel, der international in Anspruch Emissions-Tomografen) zur Bildge- Nebenwirkungen auf die Blutbildung genommen wird und den wir forschend bung verwendet werden. Kombiniert sind aber vorübergehend. Unange- weiter zu stärken bestrebt sind. man PET mit Computertomografie nehme Nebenwirkungen wie Erbre(CT), liefert mit Gallium-68 beladenes chen und schwerere Nebenwirkungen Dota-Toc als sogenannter Radio­tracer wie eine bleibende Verschlechterung innert weniger als zwei Stunden ein der Nierenfunktion sind selten und genaues Bild von der Lokalisation und kommen bei weniger als einem von Ausdehnung der Tumorläsionen im 100 Patienten vor. Das bedeutet, dass ganzen Körper, da im Tumorgewebe die Therapie mit Lutetium-177Prof. Dr. med. gehäuft Somatostatin-Rezeptoren als Dota-Toc insgesamt gut, mit wenigen Damian Wild Andockstellen für Gallium-68-­Dota-Toc Nebenwirkungen, toleriert wird. Sie Leiter Nuklearvorhanden sind. Dabei ist die Bildquali- kann vor allem bei neuroendokrinen medizin tät viel besser als bei der nur mit Gammastrahlen arbeitenden szintigrafischen Methode, die ebenfalls die Viel mehr Details in viel kürzerer Zeit Rezeptoren identifiziert (siehe Vergleich im Bild). Mit der szintigrafischen Aus Diagnose wird Therapie.Die auch die Therapie mit Lutetium-­177Methode wird der Patient zudem mit Szintigraphie (links) zeigt nur eine DOTA-TOC wurden am Universitätsspieiner dreimal höheren Radioaktivität Metastase in der Leber 24 Stunden tal Basel entwickelt. Bild Damian Wild / Universitätsspital Basel belastet, und erst noch können Bilder nach Injektion des «Radiotracers» von diagnostischer Qualität erst (siehe Pfeil). Die kurz danach durchge24 Stunden nach Injektion des Radio- führte PET-Aufnahme des gleichen tracers angefertigt werden. Patienten (rechts) entdeckt viele Hat die zwingend nötige Vorunter- Metastasen in der Leber, nur eine suchung ergeben, dass die zu behan- Stunde nach Injektion von Gallidelnden Tumoren genügend viele um-68-DOTA-TOC. Im Gegensatz zu Somatostatin-Bindungsstellen aufwei- andern Therapiemethoden kann die sen, wird nun Dota-Toc mit einem Anreicherung von radioaktiv markierRadio­ nuklid beladen, das Elektronen tem DOTA-TOC im Tumor schon vor (Betastrahlen) ausschickt, die benach- der Therapie sichtbar gemacht werden. barte Tumorzellen zerstören können. Nur wenn das sichtbar wird, erfolgt die Heute wird vor allem Lutetium-177 Therapie mit Lutetium-177-DOTA-TOC verwendet, weil dank der kurzen Reich- im Sinne eines massgeschneiderten weite von Lutetium-177 kaum gesun- individuellen Vorgehens. Sowohl die PET mit Gallium-68-DOTA-TOC als des Gewebe mitbestrahlt wird. keit haben, radioaktive Isotopen ans Ziel zu bringen. Ein solches Kombi-Molekül ist Dota-Toc. Das -Toc bezeichnet den Teil des Medikaments, der sich an den Rezeptor bildet. Das Dota- steht für eine Art chemischen Korb oder chemische Zangen, die es erlauben, ein radio­ aktives Atom mitzutragen. Krebs persönlich. | Samstag, 28. Januar 2017 | Seite 7 Millimetergenau aus 3000 Richtungen Bei Brustkrebs bringt eine individuelle Strahlenbehandlung gute Erfolge Von Anna-Lena Hottinger und Frank Zimmermann Zu einer erfolgreichen Behandlung des Brustkrebses gehört die Heilung vom Krebs bei gleichzeitig guter, wenn möglich unveränderter Lebensqualität. Waren früher sehr grosse und ausgedehnte chirurgische Eingriffe nötig, konnten in den letzten zwanzig Jahren das Ausmass der Operation und die Anzahl der Brustentfernungen durch die Möglichkeit der Strahlentherapie deutlich reduziert werden. Eine kleinere Operation mit nachfolgender Strahlentherapie bedeutet für die betroffenen Patientinnen eine ausgezeichnete Lebensqualität, bei sehr gutem kosmetischem Ergebnis und geringerer psychischer Belastung. Innovation, langjährige Erfahrung und perfekt abgestimmte Richtlinien begleiten uns in unserem klinischen Alltag und garantieren fachlich fundierte Therapieentscheide im Einklang mit den Wünschen unserer Patientinnen. Dieses Zusammenspiel prägt für uns die «personalisierte Medizin». Das von uns am häufigsten eingesetzte Behandlungsgerät ist der Linearbeschleuniger, der individuell angepasste Bestrahlungsfelder beliebiger Grösse aus mehr als 3000 Einstrahlrichtungen und sogar während laufender Drehung des Gerätes um die Patientin herum erlaubt, und dies millimetergenau. Diese Technik der «dynamischen intensitätsmodulierten Radio­therapie» ermöglicht die Behandlung von Tumorzellen bei gleichzeitig opti- Viele Faktoren.Eine genaue Planung der Behandlung erlaubt eine schonende Bestrahlung – so wenig wie möglich, so viel wie nötig.Foto Universitätsspital Basel maler Schonung der gesunden Gewebe wie Lunge, Herz und Nerven. Viele verschiedene Faktoren beeinflussen die Art der Strahlentherapie. So spielen das Alter der Patientin, die Tumorgrösse, das Wachstumsmuster und die Lage des Tumors sowie der Befall von Lymphknoten eine wichtige Rolle. Ferner beeinflusst die Notwendigkeit einer zusätzlichen plastischen Rekonstruktion oder Hormon- und Chemotherapie die nachfolgende Strahlentherapie. Wurden ältere Frauen an kleinen Tumoren erfolgreich operiert, ist nur Rote Karte für den Schmerz eine Strahlenbehandlung der früheren Tumorregion in der Brust nötig. Diese kann noch während der Operation als einmalige Behandlung mit mobilen Spezialgeräten (intraoperative Radiotherapie) oder anschlies­ send an die Operation mit dem Linearbeschleuniger während drei Wochen mit täglich zehnminütigen Strahlenbehandlungen durchgeführt werden. Bei aggressiveren Tumoren wird die ganze Brust behandelt und die Therapie dauert vier Wochen. Bei empfindlicheren Patientinnen oder nach plastischen Rekonstruktionen wird die tägliche Strahlen- dosis zur besseren Schonung reduziert, sodass die gesamte Behandlung fünf bis sechs Wochen dauert. Verhalten sich die Tumoren aggressiver und liegt bereits ein Befall der umgebenden Lymphknoten vor, so werden während sechs bis sieben Wochen je nach Lage und Grösse des Tumors zusätzlich die Lymphbahnen der Achselhöhle, entlang des Schlüsselbeins oder des Brustbeins bestrahlt. Neben der optimalen Auswahl des jeweils besten Behandlungskonzeptes und der sicheren Durchführung der Strahlentherapie mit modernsten Techniken ist uns das individuelle Beratungsgespräch mit der betroffenen Patientin und ihren Angehörigen sehr wichtig. So können wir gemeinsam die optimal und individuell abgestimmte Strahlenbehandlung zum richtigen Zeitpunkt beginnen. Dr. med. Anna-Lena Hottinger Assistenzärztin Radioonkologie Prof. Dr. med. Frank Zimmermann Chefarzt Radioonkologie Kurt Vögtlin (Name geändert) ist eigentlich ein Mann der Tat. Wie der Schmerztherapeut ihn aber das erste Mal sieht, sitzt ihm ein 74-jähriger Mann gegenüber, der einfach nicht mehr mag. Angefangen hatte alles im Jahr 2006, als die Diagnose Prostatakrebs gestellt wurde. Jetzt bereiten Metastasen in der Wirbelsäule und im Becken grosse Schmerzen. Zur neu vorgeschlagenen Chemotherapie setzt er darum Fragezeichen: «Für was soll ich das noch machen, wenn ich wegen meiner Schmerzen sowieso nicht so leben kann, wie ich will?» Der Schmerztherapeut weiss, zuerst müssen die Schmerzen gelindert werden, sonst verliert der einst so lebensfrohe Mann den Mut vollends. Kurt Vögtlin wird beraten, welche Medikamente er einnehmen soll und was er im Alltag beachten sollte. Schon nach kurzer Zeit ist der Schmerz in die Schranken gewiesen. Was Patient Kurt Vögtlin erlebt, ist kein Einzelfall. Rund 75 Prozent aller Krebspatienten leiden während ihrer Erkrankung unter Schmerzen, bei zwanzig Prozent sind sie sogar sehr stark. Die gute Nachricht ist aber, dass meist eine gute und effiziente Schmerztherapie möglich ist. In der Schmerzabteilung der Anästhesiologie des Universitätsspitals Basel werden sowohl stationäre wie auch ambulante Patientinnen und Patienten in allen Phasen einer Krebserkrankung begleitet und behandelt. In vertieften Gesprächen wird das genaue Schmerz­ erleben erhoben. So kann die passende Therapie individuell ermittelt werden. Meist sind es medikamentöse Therapien wie bei Kurt Vögtlin, aber es können auch sogenannt minimalinvasive interventionelle Schmerztherapien Anwendung finden. Dabei kann man mit gezielten Injektionen oder mittels eines Schmerzkatheters Schmerzen dauerhaft nehmen. So im Fall von Dora M. Die 67-jährige Patientin litt an einem metastasierten Eierstockkrebs. Da konservative Methoden keine Linderung brachten, wurde ein Katheter am Rückenmark eingelegt. Er ermöglichte, dass Medikamente direkt appliziert werden konnten, so dass Dora M. wieder fast schmerzfrei war. Kurze danach entschied sie sich, in ein Hospiz zu wechseln, wo sie noch mehrere dass die Tumorzellen sehr gut auf eine hormonelle Therapie reagieren werden. Sie wird als Massnahme nach der Operation eingeleitet. Zwei aus der Achselhöhle entnommene Lymphknoten waren ohne Tumorbefall. Allerdings leidet die Patientin noch an anderen Erkrankungen. Sie hatte vor fünf Jahren einen Herzinfarkt und die Halsschlagadern weisen Kalkablagerungen auf. Aufgrund der Gefässerkrankungen möchten wir vor allem das Herz der Patientin möglichst schonen, weshalb wir uns für eine dreiwöchige Strahlenbehandlung entscheiden, die sich ausschliesslich gegen die ehemalige Tumorregion in der linken Brust richten wird (siehe Bild). Hightech macht Reparatur von krebsbedingtem Defekt präziser und schneller Wochen schmerzfrei verbringen und diese wertvolle Zeit mit ihrem Mann teilen konnte. Innovatives Projekt lanciert Viele schwer kranke Patienten haben den Wunsch, so viel Zeit wie möglich daheim zu verbringen und auch zu Hause zu sterben. Sehr oft müssen sie wegen quälender Schmerzen kurz vor Lebensende doch wieder ins Spital. Darum hat die Abteilung Schmerztherapie des Universitätsspitals Basel dieses Jahr ein innovatives Projekt lanciert, das hier gezielt Hilfe anbietet: Die Abteilung Schmerztherapie /Anästhesiologie und Spitex /Onko-Spitex Basel arbeiten neu nach festen Regeln zusammen, sodass selbst komplizierte Schmerztherapien nun in der Stadt Basel auch zu Hause angeboten werden können, Hand in Hand mit dem Hausarzt oder Onkologen und der Onko-Spitex. Ganz wichtig ist dabei, die Angehörigen zu stützen, welche meist die Hauptlast der Pflege zu Hause tragen. Das Team möchte alle Patientinnen und Patienten erreichen, die eine solche Unterstützung nötig hätten, und ihnen in dieser schwierigen Lebensphase helfen und mehr Lebensqualität erhalten. PD Dr. med. Wilhelm Ruppen Leitender Arzt Schmerztherapie Schonend bestrahlen.Bei Doris F. (61) wurde vor zwei Monaten ein 1,5 Zentimeter kleiner Tumor im oberen äusseren Bereich der linken Brust entdeckt und nach Probeentnahme die Diagnose Brustkrebs bestätigt. Die brusterhaltende Operation verlief ohne Komplikationen, und Doris F. stellt sich für eine Strahlentherapie der linken Brust bei uns in der Klinik vor. Aus den detaillierten Unterlagen geht hervor, Das Wadenbein als Ersatz im Kiefer Der Schmerzdienst ist auch mobil unterwegs Von Monika Kirsch und Wilhelm Ruppen Das Fallbeispiel PhD, RN Monika Kirsch Pflegeexpertin Hämatologie So sind wir erreichbar Der mobile Schmerzdienst betreut Patientinnen und Patienten in BaselStadt im Verbund mit Spitex und Onko-Spitex. Bei Interesse und Bedarf wenden Sie sich bitte per Mail an [email protected] oder wählen werktags zwischen 8 und 17 Uhr unser Pikett-Natel: 079 812 61 37. Hightech.Im Voraus wird geplant, wie aus dem Wadenbein passende Stücke samt Blutversorgung für die Lücken rekrutiert werden können.Foto Universitätsspital Basel Von Claude Jaquiéry und Jörg Beinemann Die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am Universitätsspital Basel bewältigt eine grosse Vielfalt von Behandlungen am Kopf. Von Fehlstellungen, Missbildungen, Wachstumsstörungen über komplizierte unfallbedingte Verletzungen bis hin zur rekonstruktiven Chirurgie nach Tumoroperationen reicht unser Gebiet. Als wichtiger Versorger in der Region und Teil der universitären Medizin haben wir nicht nur breite Erfahrung, sondern verwenden auch modernste Techniken und entwickeln sie weiter. Was unsere Rolle in der Krebsbehandlung betrifft, so gilt bei uns von Anfang an wie immer in ganz besonderem Masse ein auf das behandelte Individuum bezogenes Vorgehen. Schliesslich gilt es nicht nur, Tumoren zu entfernen, sondern dies auch so zu tun, dass der Patient oder die Patientin wieder möglichst alle Funktionen wie zum Beispiel die Kaufähigkeit zurückgewinnt. Sehr wichtig ist es aber auch für uns und die Behandelten, dass das Resultat ästhetisch befriedigt und im wörtlichen Sinne das Gesicht des behandelten Menschen bewahrt wird. Denn eines ist uns aus unserer vielseitigen Arbeit sehr bewusst: Das eigene Gesicht definiert nicht nur die Identität, es ist auch entscheidend für den Umgang mit der Umwelt und anderen Menschen. Nun liegen im Kopf auf engem Raum verschiedene Gewebe und Strukturen beieinander, die ganz verschiedene Aufgaben und Funktionen haben. Das ergibt zwangsläufig eine komplizierte anatomische Situation, die besonders präzises Vorgehen erfordert. Um hier ein Maximum erreichen zu können, beginnen wir – immer in Absprache mit anderen an der Behandlung beteiligten Disziplinen – sehr früh mit der Planung des Eingriffs. Gerade wenn es darum geht, im engen Raum der Mundhöhle einen Tumor zu entfernen, kommt es häufig vor, dass auch der Knochen des Kiefers betroffen ist und entfernt werden muss. Diese Leerstelle muss wieder passgerecht repariert werden. Als Ersatz können wir heute dank moderner Techniken und Routine eigenes Knochengewebe der Patientin oder des Patienten «rekrutieren» und verwenden. Das können zum Beispiel für tumorbedingt entfernte Teile eines Unterkiefers verschiedene Stücke des Wadenbeins sein. Das Kunststück: Die Segmente müssen passen, sie müssen aber immer auch mit einem Blutgefäss und teilweise auch angeschlossenem Hautareal transplantiert werden. In drei Dimensionen assistiert Um diese technisch und zeitlich anspruchsvolle Operation perfekt vorbereiten zu können, benützen wir einen computerisierten Helfer, der erlaubt, die ganze Operation in drei Dimensionen räumlich zu planen und dann auch in der realen Operation mitzusteuern, dass das Geplante auch 1:1 Realität wird. In dem unserer Abteilung angeschlossenen Hightech-Forschungszentrum HFZ wird an der Verfeinerung dieser Methoden bis hin zur Planung des passgenauen Knochenschnitts mit Lasern, der Navigation der Instrumente während der Operation in Echtzeit gearbeitet. Auch die Konstruktion neuer Instrumente, Schablonen und sogar von Knochenersatz gehören zu den bearbeiteten Themen. Das ist ein riesiger Vorteil für uns – und die Patienten. In unserem Bildbeispiel geht es um den Ersatz nach einem Eingriff am Unterkiefer. Er wurde nötig, weil beim betreffenden Patienten ein sogenanntes Plattenepithelkarzinom in der Mundhöhle auch den Kiefer befallen hatte. Im Bild wird gezeigt, wie man durch die (in Realität dreidimensionale) Überlagerung der Bilder nachprüft, dass die Stücke aus dem Wadenbein exakt in die tumorbedingt geschlagenen Lücken des Unterkiefers passen. Ist dies erwiesen, werden sie zugeschnitten. Nach ihrer Einpflanzung müssen sie sofort mikrochirurgisch an die Blutversorgung des Halses angeschlossen werden. Die heute erreichte hohe technische Präzision und die gute planerische Vorbereitung der Chirurgen, die so im Voraus wissen, was sie erwartet, bringt nachweislich bessere Resultate – bei erst noch verkürzter Operationsdauer. Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Claude Jaquiéry Leitender Arzt Kiefer- und Gesichtschirurgie Dr. med. Jörg Beinemann HighTechForschungsZentrum HFZ Krebs persönlich. | Samstag, 28. Januar 2017 | Seite 8 «Es ist anstrengend, sich dem Leiden zu nähern» Vom Training zu gutem Kommunizieren profitieren alle, sagt Psychosomatiker Alexander Kiss Zufriedenheit der Teilnehmenden ist hoch, unabhängig davon, ob sie freiwillig kamen oder ob sie teilnehmen mussten. Prof. Dr. med. Alexander Kiss, von Haus aus Gastroenterologe, ist Leiter der Psychosomatik am Universitätsspital Basel und hat in nationalen Gremien mitgearbeitet, um Trainingsmodelle aufzustellen, die es in der Krebsmedizin tätigen Ärztinnen und Ärzten erlauben, ihre Fähigkeiten in der Kommunikation mit Patienten zu verbessern. Das «Swiss Communication Skills Training», unterstützt von der Krebsliga, ist seit 2006 für Fachärzte der Onkologie in der Schweiz obligatorisch. Wie geht das denn vor sich? Wir arbeiten in kleinen Gruppen zu 4 bis 6 Personen. Kommunikation muss man selber üben, nur vom Zuschauen lernt man das nicht. Ausgangspunkt sind die eigenen schwierigen Gesprächssituationen der Teilnehmenden. Manche halten Pausen im Gespräch mit Patienten gar nicht gut aus, obwohl diese wichtig sind, damit der Patient seine eigenen Anliegen zur Sprache bringen kann. In kurzen Rollenspielen kann der Teilnehmer erleben, wie es ist, wenn er als «Patient» nicht «zugetextet» wird, oder als Onkologe, wie durch die Pausen aus einem Monolog ein Dialog mit dem Patienten entsteht. Jeder Teilnehmer entscheidet für sich, ob und welche Gesprächstechniken er in der Praxis «ausprobieren» möchte und, wenn es funktioniert, in seine Gesprächsführung übernimmt. BaZ: Professor Kiss, warum braucht es ein spezielles Kommunikationstraining für Krebsärztinnen und -ärzte? Alexander Kiss: Die häufigste Klage von Patienten ist: «Mein Arzt hört mir nicht zu, und was er mir erklärt, versteh ich nicht.» Man sollte als Arzt sowohl eine medizinische, aber auch eine psychosoziale Kompetenz haben, nämlich mit Patienten gut zu kommunizieren. Es ist wichtig, mit ganz unterschiedlichen Patientinnen und Patienten passend umzugehen. Der eine Patient kommt zum Arzt wie zu einem Automechaniker, der nächste Patient erwartet etwas ganz anderes. Er kommt schon weinend herein und erwartet, dass sein Leid von der Ärztin wahrgenommen und vielleicht auch geteilt wird. Die nächste Patientin will ganz sicher ihre Emotionen nicht mit dem Arzt teilen, das tut sie lieber mit ihrem Mann. «Heute ist man bei der Information ehrlicher, das hat aber auch Probleme gebracht.» Was soll erreicht werden? Der Patient soll verstehen, was er hat. Meist will er wissen, wie es weitergeht. Solche Gespräche gut zu führen, kann man auch lernen. Im Gespräch führt meist der Arzt. Bei bestimmten Gesprächsabschnitten sich vom Patienten «führen» zu lassen, fällt manchen Ärzten schwer. Wenn der Patient fragt, wie geht es jetzt weiter, dann geht es um Informationsvermittlung von Seiten des Arztes und wenn der Patient sagt, oh Gott, wie soll ich das schaffen, geht es ums Zuhören und Umgang mit den Emotionen des Patienten. Die Themen des Patienten können im Das Gespräch mit dem Patienten ist auch für den Arzt anstrengend? Alexander Kiss:«Gute Kommunikation ist eine Fähigkeit, die man als Arzt haben muss und auch trainieren kann.» F oto USB Gespräch rasch wechseln und es ist nicht immer einfach, sich dem Tempo des Patienten anzupassen. Schlechte Nachrichten zu überbringen belastet auch den Arzt ... ... ausser er freut sich am Leid anderer, dann wäre er ein Sadist. Tatsächlich ist es nicht angenehm, manchmal peinigend, Menschen etwas zu sagen, was grosses Leid verursacht und oft ihr Leben und ihre Zukunftsperspektiven nachhaltig durcheinander bringt. Früher hat man zurückhaltend informiert, um Patientinnen und Patienten scheinbar so wenig wie möglich zu belasten. Heute ist man direkter. Das kann dann auch brutal wirken. Heute ist man tatsächlich ehrlicher. Das hat aber auch Probleme gebracht. Früher hat man die Leute «geschont». Das war scheinbar einfacher, viele haben trotzdem die Wahrheit erfahren oder geahnt. Was nicht immer vertrauensfördernd war. Heute ist man schon vom Gesetz her verpflichtet zu informieren. Das kann eine Gratwanderung sein. Einerseits muss ich dem Patienten die notwen- digen Informationen geben, anderseits muss ich hellhörig sein, was und wie viel er überhaupt hören kann und will. Viele Menschen können schwer Hoffnung konstruieren, wenn man hartnäckig danach fragt, ob sie jetzt verstanden haben, dass sie bald tot sind. Das ist grausam und ein falsches Verständnis von Wahrheit. Besser wäre es zu vermitteln, dass ihre Lebenszeit begrenzt ist und das Ziel der Therapie darin besteht, mehr Zeit und mehr Lebensqualität zu gewinnen, man sie aber nicht heilen kann. Sie meinen, es gibt verschiedene Arten, mit der Wahrheit umzugehen? Es beschäftigt mich, wie man Menschen die Wahrheit sagen kann, ohne sie noch zusätzlich durch das eigene Verhalten bei der Mitteilung zu schädigen. Den Mechanismus der Verdrängung kennen wir alle. Das ist ein Weg, mit Dingen, die unerträglich scheinen, umzugehen. Gegen diesen Umgang müssen wir nur angehen, wenn dadurch wichtige therapeutische Massnahmen vernachlässigt werden. Man kann als Patient immer damit argumentieren, dass man zu den vielleicht wenigen Glücklichen gehört, die davonkommen und der Statistik entwischen? Bleiben die guten Effekte in der Praxis erhalten? «Verdrängung ist ein Weg, mit Dingen, die unerträglich scheinen, umzugehen.» Der Arzt wird zum Partner des Patienten? So ist es. Wir sind schlecht in der Prognose (Vorhersage) für den Einzelfall, aber gut für grosse Patientengruppen mit gleichen Risikoeigenschaften, wo wir sagen können, wie viele nach fünf Jahren noch leben werden, aber halt nicht wer. Haben die Ärztinnen und Ärzte überhaupt Zeit, das Gespräch zu trainieren? Da könnte man auch fragen, haben die Chirurgen Zeit, ihr Handwerk zu lernen? Gute Kommunikation ist eine Basisfähigkeit, die man als Arzt und Ärztin haben sollte und die man auch trainieren kann. Wenige Ärzte sind hochbegabt, brauchen eigentlich kein Training, einige lernen kaum etwas durch das Training, aber die meisten profitieren von diesen Kursen. Die Programm GEMEINSAM MEHR CHANCEN Medizin. «Personalisierte » as? Was bedeutet d unispital-basel.ch/tumorzentrum 10.00 Uhr Begrüssung durch den Schirmherrn Bernhard Heusler 10.10 Uhr Einleitung durch den Vorsitzenden des Tumorzentrums Prof. Dr. Christoph Rochlitz 10.35 Uhr Tumoranalyse durch den Pathologen – Voraussetzung für eine gezielte Krebstherapie Prof. Dr. Lukas Bubendorf 10.50 Uhr Forschung für eine individualisierte Medizin der Zukunft Prof. Dr. Viola Heinzelmann 11.05 Uhr Von der detaillierten molekularen Diagnose zur zielgerichteten onkologischen Therapie PD Dr. Sacha Rothschild anschliessend: Erfahrungen eines Patienten Musikalisches Intermezzo Mittagspause und Informationsstände 13.00 Uhr Die Rolle der Genetik in der personalisierten Medizin Prof. Dr. Sven Cichon 13.15 Uhr Palliative Care – dem Leben mehr gute Tage geben Dr. Sandra Eckstein 13.30 Uhr Gezielt gegen Krebs mit dem eigenen Immunsystem Dr. Heinz Läubli 13.45 Uhr Psychoonkologie: von Krankengeschichten zu Lebensgeschichten Dr. phil. Diana Zwahlen Kaffeepause an den Informationsständen 14.30 Uhr Basel Brustkonsortium BBC – Plattform für personalisierte Brustkrebsforschung Prof. Dr. Walter Weber 14.45 Uhr Seelsorge Gudrun Dehnert, Valeria Hengartner 15.00 Uhr Aus dem Leben gerissen – Ein Dialog zwischen Betroffenen und Pflege Dr. Monika Kirsch, Sabine Degen Kellerhals anschliessend: Erfahrung eines Patienten Ja, es ist anstrengend in die Nähe des Leidens und Elends zu kommen. Nicht nur für Ärzte. Ja. Damit der Effekt nachhaltig ist, rufen wir die Teilnehmenden nach dem Kurs 4- bis 6-mal in den folgenden Monaten an. Wir fragen, was hast du vom Kurs ausprobiert, wie hat es funktioniert (oder auch nicht) und vereinbaren ein neues konkretes Ziel für die Gesprächsführung für das nächste Telefongespräch. Diese Feedbacks verstärken den Effekt des Kurses. Nein, partnerschaftlich ist meiner Meinung nach das Verhältnis zwischen Patient und Arzt nicht wirklich. Der Arzt ist gesund und hat das Wissen. Der Patient ist krank und weiss – zumindest am Anfang – nichts oder wenig. Die Ärztin oder der Arzt kann aber die Bedingungen schaffen, dass der Patient auf Augenhöhe angesprochen ist. So kann der Patient sich mit seinen Werten und Präferenzen in den Entscheidungsprozess einbringen und daran partizipieren. Die Fragen stellte Martin Hicklin Krebs-Infotag: 4. Februar 2017 Am 4. Februar 2017 laden wir Betroffene, Angehörige und Interessierte dazu ein, sich über die neusten Erkenntnisse zum Thema Krebs zu informieren und die Angebote unseres Zentrums kennenzulernen. Mit Vorträgen rund um das Schwerpunktthema «Personalisierte Medizin. Was bedeutet das?» sowie Informationsständen aus allen Bereichen bieten wir Ihnen die Möglichkeit zum Austausch. Fachpersonen der Organtumorzentren, der Querschnittsbereiche sowie der unterstützenden Angebote stehen Ihnen bei Fragen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. Samstag, 4. Februar 2017, 10 –16 Uhr ZLF (Zentrum für Lehre und Forschung) Hebelstrasse 20, 4031 Basel