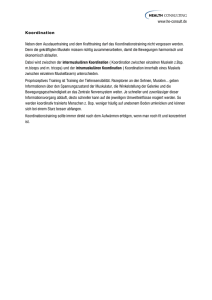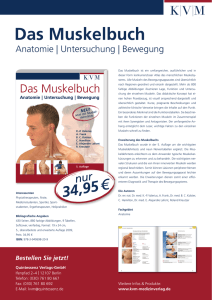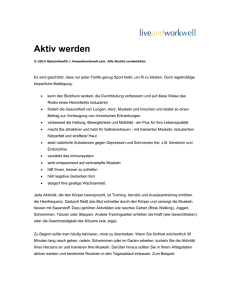Inhaltsverzeichnis.
Werbung

Inhaltsverzeichnis. Seite Einleitung I. Hüfte und Oberschenkel A. A n a t o m i s c h e O r i e n t i e r u n g ü b e r d a s S k e l e t t a) Die Hüftgelenkpfanne ,•.*••*. ß) Das Oberschenkelbein (Femur) . .y^f'':s. ." 2vy^ y) Erste Orientierung über das Knie&eßnir'?'. *?•'.vi',*;"• '. . B. Ü b e r s i c h t ü b e r d i e M u s k e l n a n , der,IIüf1;e>u'nd"'am Obers c h e n k e l . Oberschenkelfasziö,';!„.'• X?v;'--">'i'--;s'j-. . . . . . . a) I. Muskelgruppe. Die Adductoren invwej|eran ; Sinne des Wortes. ß) I I . Gruppe. Der Extensor cruris qu'aäric^|is""<4". . . . . < . . . y) I I I . Gruppe. Iliopsoas und Sartoriüs-- :,*».-•?*'. <S) IV. Gruppe. Die tiefen äußeren und hinteren Muskeln der Hüfte e) V. Gruppe. Die langen Kniegelenkbeuger am Oberschenkel. . . f) VI. Gruppe. Die oberflächlichen äußeren und hinteren Muskeln der Hüfte •ri) Das Basisfeld der Extremität &) Bemerkungen über die Faszien im allgemeinen und über die Oberschenkelfaszie im besonderen C. S t e l l u n g e n u n d Bewegungen am H ü f t g e l e n k a) Beurteilung und Definition der Stellungen des Femur im Hüftgelenk 1. Die Bestimmungsebenen des Beckens 2. Bestimmungspunkte und Bestimmungsebene des Femur . . . 3. Graphische Darstellung der Femurstellung. Exkursionskugelfläche mit Gradeinteilung. Skelettphantom 4. Bestimmung beim Lebenden ß) Bestimmung und Registrierung der Stellungsänderungen des Femur 1. Definitionen 2. Bewegungsmöglichkeiten (Bewegungsumfang) im Hüftgelenk. a) Am Bänderpräparat b) Am Lebenden y) Instantane Drehungen und Drehbeschleunigungen Vereinbarung bezüglich der Wahl der Achsen a) Inkorrekte Wahl der Hauptachsen b) Zum Becken feste Achsen c) Zum Femur feste Achsen (H. v. Meyer) d) Wahl der Achsen nach S t r a ß e r D . K r ä f t e zur D r e h u n g im Hüftgelenk a) Die Beurteilung der statischen Momente 1. Der physiologische Faktor a) Die Spannung des Muskels prc Einheit des Querschnittes. . b) Der maßgebende Querschnitt des Muskels Einfache Methode zur Bestimmung des effektiven Querschnittes : . . . http://d-nb.info/368339378 1 3 3 3 5 10 10 11 14 17 17 18 20 21 22 27 27 28 30 30 32 34 c 34 34 34 37 39 39 40 41 42 43 45 45 46 46 49 50 IV Inhaltsverzeichnis. 2. Der geometrische Faktor a) Bestimmung durch Projektion b) Koordinatenmethode von A. F i c k c) Verfahren von A. E. F i c k d) Wahl der Achsen e) Das Skelettmuskelphahtom f) Das Globusmuskelphantom von S t r a ß er und G a ß m a n n . g) Zerlegung der resultierenden Drehungsmomente nach den drei Hauptachsen (graphische Darstellung) h) Einfaches Verfahren zur Bestimmung des Drehungseinflusses der Hüftgelenkmuskeln bei den verschiedenen Gelenkstellungen i) Abänderung des geometrischen Faktors mit der Stellungsänderung jß) Kinetische Aufgaben 1. Drehbeschleunigungen und Drehungsebene 2. Das Arbeitsvermögen der Hüftgelenkmuskeln E. Z u s a m m e n f a s s u n g der B e o b a c h t u n g e n ü b e r die W i r k u n g s weise der e i n z e l n e n H ü f t g e l e n k m u s k e l n : a) ß) y) 6) e) f) Vorbemerkungen Die Adductoren Der Musculus reotus femoris Iliopsoas und Sartoriüs Tiefe hintere und äußere Muskeln der Hüfte Mm. semimembranosus, semitendinosus und langer Biceps if) Glutaeus maximus und Tensor fasciae latae 62 66 69 71 71 72 74 74 75 78 79 80 Kopf des F. Bau u n d E i n r i c h t u n g ( S c h l u ß p r ä p a r a t i o n ) des H ü f t g e l e n k e s a) Genaueres über die Gelenkkörper Seite 52 52 53 53 55 56 58 82 83 86 86 1. Das obere Gelenkende des Femur 86 2. Die Hüftgelenkpfanne » 89 ß) Unmittelbar am Hüftgelenk gelegene Muskeln und ihr Verhalten zur Gelenkkapsel. Schleimbeutel ." 90 1. Verhalten des M. iliopsoas zum Gelenk 93 2. Verhalten des M. obturator externus zum Gelenk 94 . y) Präparation und Untersuchung der Hüftgelenkkapsel mit ihren Bändern von außen 96 1. Übersicht über die langen Bänder 96 2. Inanspruchnahme der Bänder bei den verschiedenen Stellungen. und Bewegungen des Femur im Hüftgelenk 97 Beurteilung nach der Stellung des Schenkelhalses zur Pfanne, Orientierungspunkte am Pfannenrand 97 Mittelstellung und abgelenkte Stellungen 102 3. Das Lig. iliofemorale 104 4. Das Lig. ischiofemorale 109 5. Das Lig. pubofemorale (superfieiale) 110 ' ' ' 6. Genaueres über den Ursprung und Ansatz der Kapsel . . . . 1 1 1 • • 7. Gelenkkapsel von innen 112 Zona orbicularis 112 Zusammenschiebung und Faltung der Kapsel 117 Kbrae recurrentes. Retinacula des Orbiculus 118 8. Das Lig. teres (Lig. intraarticulare) des Hüftgelenkes . . . . 120 5) Bemerkungen über die Hüftgelenkluxationen und ihre Reposition 122 Inhaltsverzeichnis. V Seite e) Entwicklung des Hüftgelenkes ' 125 Ossifikation. Gestalt und Entwicklung der Gelenkkörper. Die kongenitale Hüftgelenkluxätion 125 G. Die W i r k u n g des L u f t d r u c k e s am Hüftgelenk 1. Orientierung. Historisches und Kritisches 2. Die ökonomische Bedeutung der Wirkung des Luftdruckes am Hüftgelenk '. Zusammenfassung H. Die F e s t s t e l l u n g der Hüftgelenke im S t a n d a) Stand auf einem Bein ß) Stand auf beiden Beinen 1. Vereinfachter Fall: Die Fußpunkte, die Hüftgelenke und die drei Partialschwerpunkte liegen in der gleichen Vertikalebene . a) Die Schwere habe keinen Einfluß zur seitlichen Verschiebung des Beckens b) Die Schwere wirke an und für sich zur seitlichen Verschiebung des Beckens 2. Verallgemeinerte Behandlung der Aufgabe a) Projektion auf die Vertikalebene durch die Hüftlinie . . . . b) Projektion auf eine Vertikalebene, welche zur Vertikalebene durch die Hüftlinie senkrecht steht c) Projektion auf die Horizontalebene II. Fuß und Unterschenkel 128 128 132 134 137 137 138 140 141 144 149 149 150 152 156 A. Anatomische Orientierung über das Unterschenkel- und Fußskelett 156 a) Das Skelett des Unterschenkels 156 1. Die Tibia 156 2. Die Fibula 159 3. Die Membrana interossea 160 ß) Das Fußskelett 160 1. Übersicht über die Skelettstücke' 160 2. Übersicht über die Gelenke des Fußes 164 3. Genaueres; über einzelne Skelettstücke des Fußes 166 Calcaneus 166 Talus . • 166 , B. Muskeln und Faszien 168 a) Übersicht über die Muskeln des Unterschenkels und Fußes. . . 168 1. Dorsale Muskeln 168 2. Plantare Muskeln 169 3. Die kurzen, plantaren Muskeln der Skolettstrahlen 175 a) Dorsale, abduktorische Muskeln 176 b) Plantare, adduktorische Muskeln 176 c) Intermediäre Muskeln 177 ß) Die Faszien am Unterschenkel und Fuß 179 1. Dorsalseite 179 2. Faszie der Plantarseite 182 a) Am Unterschenkel 182 b) Am Fuß 183 d) Tiefe Faszie der gemeinsamen Fußsohle 183 /?') Plantare Faszie der Zehen. 183 /') Oberflächliche Faszie der gemeinsamen Fußsohle . . . 185 VI Inhaltsverzeichnis. Seite C. P r ä p a r a t i o n , Bau und E i n r i c h t u n g der F u ß g e l e n k e . . . . 189 a) Bemerkungen zur Präparation der Gelenke im allgemeinen und der Gelenke des Fußes im besonderen 189 ß) Die Interphalangealgelenke 190 y) Die Metatarsophalangealgelenke 191 1. Das erste Metatarsophalangealgelenk 194 2. Die irbrigen Metatarsophalangealgelenke 195 6) Gelenke und Bänder am Lisfrane und Vordertarsus 196 1. Gelenkspalten und Gelenkflächen 196 2. Ligamenta interossea des Vordertarsus und der Lisf rancschen Zone 198 3. Dorsale Bänder des Lisfrane 199 4. Dorsale Bänder zwischen den Elementen des Vordertarsus . . 201 5. Die plantaren Bänder des Vordertarsus 202 Ausstrahlung der Sehne des Tibialis post 203 6. Plantare Bänder am Lisfrane 203 Sehne und Sehnenscheide des M. peroneus longus 205 e) Das Lig. plantare commune . 206 f) Die Verbindung zwischen Calcaneus und Vordertarsus (Articulatio calcaneo-cuboidea) 207 " ff) Das gemeinsame Sprunggelenk 209 1. Äußere Formverhältnisse der Sprunggelenkgegend 210 2. Die Kapseln der drei Sprunggelenke 212 3. Die Bewegung in den unteren Sprunggelenken 214 a) Motus talo-calcaneus 214 b) Motus talo-navicularis 217 4. Die Bewegung im oberen Sprunggelenk (Motus talo-cruralis). 217 5. Der Bandapparat der Sprunggelenke 218 a) Der oberflächliche Bandapparat des gemeinsamen Sprunggelenkes 218 b) Eigenbänder und anatomische Besonderheiten des vorderen unteren Sprunggelenkes 220 c) Eigenbänder und anatomische Besonderheiten des hinteren unteren Sprunggelenkes 222 d) Anatomische Besonderheiten des oberen Sprunggelenkes; Gelenkcharakter; Eigenbänder; Bewegungsumfang . . . . 225 •&) Die Tibio-Fibularverbindung 229 1. Das untere Tibio-Fibulargelenk : 229 2. Die Membrana interossea tibio fibularis • 230 3. Das obere Tibio-Fibulargelenk 231 4. Federn der Mälleolusgabel 232 D. Der F u ß als Ganzes. Ä n d e r u n g der F u ß s t e l l u n g und F u ß form. Wirkungsweise der K r ä f t e zur F e s t s t e l l u n g und Bewegung in den verschiedenen Gelenken des F u ß e s . . . . 234 a) Übersicht über die an den Fuß hinsichtlich der aktiven und passiven Beweglichkeit gestellten Ansprüche 234 ß) Der Zehenteil 236 y) Die Bewegung der Metatarsalia in der Lisfrancschen Gelenkzone 238 a) Bewegungsmöglichkeiten. Natürliche Torsion des Matatarsus. Hypertorsion und Detorsion 238 b) Torsion, Hypertorsion und Detorsion des ganzen Fußes. Verhältnisse beim Plattfuß und Hohlfuß 239 S) Durchbiegungsmöglichkeit im Vordertarsus 241 o e) Wirkung der Kräfte zur Feststellung und zur Bewegung im Chopart 242 j) Bewegung und Feststellung in den unteren Sprunggelenken bei aufgesetztem Fuß 244 Inhaltsverzeichnis. VII Seite 1. Motus talo-calcaneus 244 2. Mitbewegung in der Articulatio calcaneo-cuboidea und Motus talo-navioularis -. 245 a) Gleichsinnige Bewegung in den beiden Junkturen um die beiden schrägen Achsen; Talusexzenter; Form der Pfanne am Naviculare 245 b) Ungleichsinnige Bewegung um die beiden schrägen Achsen. 249 Verhältnisse bei vorn aufgesetzter Sohle . . , . , . . . . 249 Verhältnisse bei vorn und hinten aufgesetzter Sohle . . . . 250 TJ) Die Wirkung der Muskeln am Chopart und an den Sprunggelenken 252 a) Muskelwirkung am Chopart (Motus talo-navicularis) 253 b) Muskelwirkung an der Talo-calcaneus-Junktur 254 c) Arbeitsleistung der Muskeln an der Talo-Calcaneusjunktur . . 255 d) Wirkungsweise der Muskeln am oberen Sprunggelenk . . . . 256 e) Kombinierte Aktionen an beiden Gelenken 258 i?) Bedingungen der Feststellung und Bewegung im oberen Sprunggelenk • 260 a) Statische Verhältnisse. Allgemeine Bedingungen der Feststellung des Gelenkes beim Stehen 260 b) Erhebung in den Zehenstand 260 c) Genauere theoretische Analyse der Bedingungen des Zehenstandes und der Erhebung des Fußes auf die Zehen 263 1. Zehenstand. Kräfte am Oberstück. Kräfte am Unterstück 263 2. Erhebung auf die Zehen 264 d) Weitere Bemerkungen über die Streckaktion am oberen Sprunggelenk 265 e) Aktion der Beuger des oberen Sprunggelenkes und Bedeutung der Ferse beim Stand 267 f) Inanspruchnahme der Fibula und der Tibiofibularverbindung . 269 Federnde Feststellung des Talus in der Beugestellung . . . . 2 7 1 E. Die besonderen E i n r i c h t u n g e n der F u ß k o n s t r u k t i o n zur F e s t i g u n g gegen B e l a s t u n g 271 a) Die Wölbung des Fußes. Allgemeines über Gewölbekonstruktionen 271 ß) Piantare Bindungen und Verklammerungen am Fuß 273 y) Gewölbebogen und Gewölbesteinschnitt am Fuß 274 1. Stand auf dem inneren Fußrand 274 2. Stand auf, dem äußeren Fußrand 276 3. Stand auf ganzer Vordersohle. Zehenstand 277 4. Rückblick ' 277 5. Beziehung des Fugenverlaufes zur Bewegung 280 ö) Die Ansichten der Autoren über die Gewölbekonstruktion, des Fußes 281 F. Anhang. Zur Lehre vom P l a t t f u ß 283 a) Vorbemerkungen 283 ß) Entwicklungsgeschichte des statischen Plattfußes 288 1. Der Fuß beim Neugeborenen und bis zum Erlernen des Stehens und Gehens 288 2. Der kindliche Plattfuß 289 s 3. Der Plattfuß der Pubertätszeit und des späteren Lebensalters 290 y) Entwicklungsmechanik des Plattfußes 291 1. H. v. Meyers Lehre von der Pronation zwischen Talus und Calcaneus und von der Totaleinknickung im Chopart. Kritik derselben. Notwendigkeit der Detorsion im vorderen Teil des Fußes 291 VIII Inhaltsverzeichnis. Seite 2. Der Vorgang der Abflachung der Fußwölbung beim Plattfuß nach unserer Auffassung 3. Das Verhalten der Muskeln bei der Entstehung des Plattfußes 4. Rückblick». 6) Skelettdeformationen beim Plattfuß 294 302 304 306 III. Das Kniegelenk 310 . A. E r s t e O r i e n t i e r u n g . Grundzüge d e s B a u e s und d e r F u n k t i o n 310 B. Legende zur P r ä p a r a t i o n des Kniegelenkes 319 a) Vorderseite 319 1. Präpatellare Schleimbeutel und Faszie 319 2. Quadriceps, Patella und Ligg. patellaria 320 3. Lageveränderungen der Kniescheibe und des Quadriceps bei der Bewegung im Gelenk 321 4. Der Raum unter der Sehnenkappe und seine Ausfüllung . . . 324 5. Die Bursa synovialis suprapatellaris 328 ß) Die Hinterseite des Kniegelenkes 329 1. Grundschicht der hinteren Kapselwand und Kreuzbänder . . 329 2. Einstrahlung der Semimembranosussehne 331 3. Die Wadenmuskeln hinten am Kniegelenk 331 4. Hintere Ränder der Muskelkappe 333 y) Die Seiten des Kniegelenkes 335 C. Genaueres ü b e r die Bewegungen im Kniegelenk 335 a) Die Hauptprofile der tibialen Gelenkflächen des Femur 335 ß) Die mit der Beugung und Streckung kombinierte Längsrotation. 338 y) DrehgleitenJund Rollung bei der Beugung und Streckung. . . . 340 1. Theoretisches über Achsenebenen und Pollinien, Abrollung und Drehgleiten 341 a) Fortlaufende Drehung zweier starrer Körper gegeneinander um wandernde Achsen. Achsenflächen und Pollinien . . . 341 b) Die Bewegung zweier starrer Körper aneinander unter Beibehaltung des Kontaktes 341 a') Gleiten und Drehgleiten 341 ß) Rollbewegung, Kombinierte Bewegungen 350 2. Drehgleiten und Rollbewegung im Kniegelenk 353 D. Die B ä n d e r des K n i e g e l e n k e s und die Menisci 358 a) Die Seitenbänder . . 358 1. Das mediale Seitenband (Lig. collaterale mediale) 358 2. Das laterale Seitenband (Lig. collaterale laterale) 361 ß) Die Kreuzbänder 363 1. Anatomie der Kreuzbänder 363 2. Die Stellungsänderung der. Ansatzpunkte und die Spannungsänderung der Kreuzbänder 367 3. Das hintere innere Kreuzband .> 371 4. Das vordere äußere Kreuzband 372 5. Verhalten der Kreuzbänder und Seitenbänder bei der Ausund Einwärtsrotation des Unterschenkels 374 6. Bedeutung der Kreuzbänder zur Verhinderung der Abscherung 375 7. Zusammenfassung mit Bezug auf die Kreuzbänder 378 y) Die Schlußrotation bei der Streckung 379 ö) Die Menisci 381 1. Anatomisches. Bewegungsmöglichkeiten 381 2. Verhalten der Menisci bei der Beugung und Streckung . . . . 383 3. Verhalten der Menisci bei der Längsrotation 386 Inhaltsverzeichnis. IX Seite E. Bewegungsumfang im Kniegelenk, Drehungseinfluß Muskeln 1. Grundstellung des Kniegelenkes 2. Bewegungsumfang der Beugung und Streckung 3. Umfang der Längsrotation, Torsion der Tibia 4. Wirkungsweise der Muskeln am Kniegelenk a) Strecker des Kniegelenkes. Kniescheibe b) Beuger c) Längsrotierende Wirkung der Muskeln der 389 389 389 390 392 392 . 393 394 IV. Das Bein als Ganzes. Kombinierte Aktion an den Hauptgelenken. . . «) Die Feststellung der Beingelenke beim Stand Die Theorie von H. v. Meyer ß) Abhängigkeit der Beingelenke voneinander bei der Bewegungsaktion 1. Erscheinungen an den zwei- und mehrgelenkigen Muskeln. . . 2. Die Bedeutung der zweigelenkigen Muskeln y) Die Arbeitsleistung an den verschiedenen Gelenken bei kombinierter Aktion 6) Weitere kombinierte Aktionen Literaturverzeichnis 396 396 396 399 399 400 406 410 411