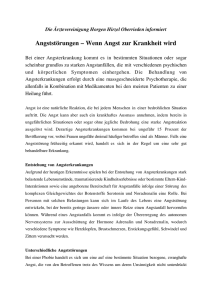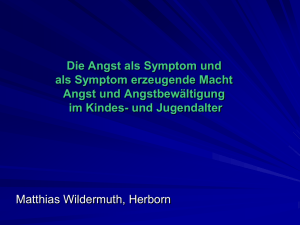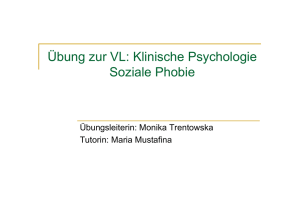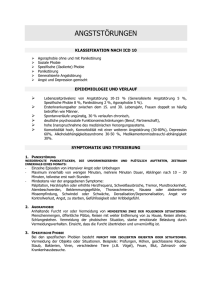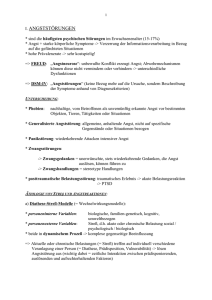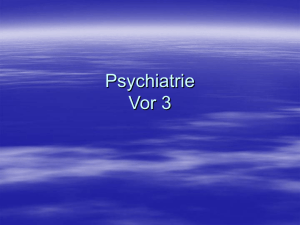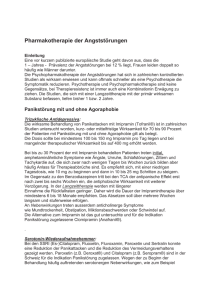Aktuelle Verhaltenstherapie Heft 2: Angststörungen (pdf, 1 MB )
Werbung

Herausgeber: AHG Klinik für Psychosomatik Ltd. Arzt Dr. med. Klaus G. Limbacher Facharzt für Neurologie und Psychiatrie Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie - Rehabilitationswesen Kurbrunnenstraße 12 67098 Bad Dürkheim Tel.: 06322 / 934 259 Fax: 06322 / 934 266 Redaktion: Dipl.-Psych. Reiner Wieland Dr. med. Klaus G. Limbacher 6. Auflage 2013 2500 Exemplare ISSN 1432-5845 Themenhefte dieser Reihe erscheinen in unregelmäßigen Abständen. 2 Reiner Wieland Angststörungen 3 Ansprechpartner für den Bereich Angststörungen Reiner Wieland, Dipl.-Psych. Psychologischer Psychotherapeut Leitender Psychologe Tel.: 06322 / 934 271 4 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 6 2. Beschreibung der Störungsbilder – Formen der Angst 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Agoraphobie und Panikstörung Soziale Phobie Generalisierte Angststörung Spezifische Phobie Krankheitsängste 6 8 10 11 13 3. Indikation zur stationären Behandlung 14 4. Therapieziele 16 5. Das stationäre Behandlungskonzept 17 6. Literatur 21 5 1 Einleitung Angst weist Menschen auf Gefahren hin und hat damit eine Signal- und Schutzfunktion. Angstgefühle können aber auch ihren ursprünglichen Sinn verlieren und sich zu übermäßigen Befürchtungen und entsprechenden Verhaltensweisen verselbständigen. Angststörungen unterscheidet man danach, worauf sich die übertriebenen Ängste beziehen. Gemeinsam ist ihnen, dass sie zu massiven Einschränkungen im Leben führen. Angststörungen sind weit verbreitet und gehören mit einer Lebenszeitprävalenz von etwa 15 - 20% zu den häufigsten psychischen Störungen überhaupt. Sie treten zudem kaum isoliert auf, es besteht eine hohe Komorbidität mit anderen psychischen Störungen. So leiden Betroffene häufig an mehr als einer Angststörung, hinzukommen kann auch eine zusätzliche depressive Störung oder ein Substanzmissbrauch. Der unbehandelte Verlauf von Angststörungen ist in der Regel ungünstig, so dass eine Behandlung notwendig ist. Moderne Störungskonzeptionen beschreiben die Ätiologie im Rahmen eines Vulnerabilitäts-Stress-Modells, bei dem prädisponierende, auslösende und aufrechterhaltende Faktoren unterschieden werden. Für alle Angststörungen gilt, dass Vermeidungs- und Sicherheitsverhalten eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Erkrankung spielen. 2 Beschreibung der Störungsbilder – Formen der Angst 2.1 Agoraphobie und Panikstörung Kennzeichen der Panikstörung sind wiederholt und spontan auftretende Panikattacken in Form von plötzlichen, intensiven körperlichen Reaktionen (meist Herzrasen, Druck- bzw. Engegefühlen in der Brust, Schwindel oder Atemnot), die von den Betroffenen als bedrohlich empfunden werden. Sie befürchten zu sterben oder „verrückt“ zu werden, wenn dieser Zustand anhält. Die in der Folge entstehende Tendenz zur Selbstbeobachtung erhöht die Wahrscheinlichkeit für erneute Attacken i.S. eines Teufelskreises. Panikattacken sind zeitlich abgrenzbar und nicht auf bekannte oder vorhersagbare Situationen beschränkt („Angst aus heiterem Himmel“). Von einer Agoraphobie („Furcht 6 vor öffentlichen Plätzen“) spricht man, wenn Panikattacken in bestimmten Situationen auftreten, in denen eine Flucht erschwert wäre (z.B. Aufenthalt in großen Menschensammlungen oder Reisen mit Entfernung von Zuhause, aber auch im Kaufhaus in einer Schlange stehen, Auto oder Zug fahren). Aufgrund befürchteter Angstattacken werden diese Situationen häufig vermieden, was dann zur Angstgeneralisierung führt. Für beide Störungen beträgt die Lebenszeitprävalenz jeweils etwa 2%. Frauen sind etwa doppelt so häufig betroffen. Beide Störungen treten häufig gemeinsam auf, wobei neuere Studien nahelegen, dass eine Agoraphobie sowohl einer Panikstörung nachfolgen, als auch ihr vorangehen kann. Sie beginnen meist im jungen Erwachsenenalter (Mitte 20), bei Männern scheint es einen zweiten Gipfel jenseits den 40. Lebensjahres bezogen auf das Erstauftreten von Panikanfällen zu geben. Wenn sich eine Störung voll ausgebildet hat, sind Spontanremissionen selten. Die Komorbidität mit anderen psychischen Störungen ist hoch, v.a. mit anderen Angststörungen, Depressionen, somatoformen Störungen und Abhängigkeitserkrankungen sowie Persönlichkeitsstörungen. Bezogen auf die Lebenszeit treten die Panikstörung bzw. Agoraphobie kaum jemals isoliert auf. Auch körperliche Erkrankungen (Herzkreislauferkrankungen, chronische Erkrankungen der Atemwege, Diabetes) sind häufig mit ihnen vergesellschaftet. An prädisponierenden Bedingungen kommen biologische und psychologische Vulnerabilitäten in Betracht. Die familiäre Häufung von Panikstörungen weist auf den Einfluss genetischer Faktoren hin, wobei aufgrund der moderaten Konkordanzraten davon ausgegangen wird, dass eine unspezifische Vulnerabilität vererbt wird. Traumatische Erfahrungen wie eine frühe Störung der Bindung zu den Eltern (z.B. durch frühen Tod eines Elternteils oder Trennung bzw. Scheidung der Eltern) sind psychologische Faktoren, die einen unspezifischen Einfluss ausüben. Dagegen ist die sog. Angstsensitivität, d.h. die Neigung, körperliche Empfindungen bedrohlich zu bewerten (z.B. als einen Hinweis auf eine Erkrankung) und ängstlich zu reagieren, ein spezifischer psychologischer Risikofaktor für die Entstehung einer solchen Angststörung. Personen mit einer hohen Angstsensitivität (Angst vor der Angst) scheinen ein höheres Risiko zu haben, später eine Angststörung zu entwickeln. Auch spezifische Erfahrungen mit Erkrankungen 7 in Kindheit und Jugend gehen mit einem erhöhten Risiko für Panikstörungen einher (z.B. das Erleben von Personen mit chronischen Erkrankungen im Haushalt oder die Erfahrung, selbst eine Atemwegserkrankung gehabt zu haben). Belastende Lebensereignisse können Panikattacken, ebenso wie andere psychische Erkrankungen, auslösen. Aufrechterhalten werden eine Agoraphobie oder eine Panikstörung aufgrund von störungsspezifischen Mechanismen wie agoraphobisches Vermeidungsverhalten, interozeptive Vermeidung (körperliche Anstrengungen, koffeinhaltige Getränke, Saunabesuche, „Aufregungen“ vermeiden) sowie Ablenkung und Sicherheitsverhalten (nur in Begleitung das Haus verlassen, Handy mitnehmen, Medikamente mit sich führen). 2.2 Soziale Phobie Das zentrale Merkmal einer sozialen Phobie ist die übermäßige Befürchtung, sich vor anderen Menschen aufgrund des eigenen Verhaltens oder aufgrund von körperlichen Symptomen blamieren zu können. Dabei sind die Erscheinungsformen vielfältig: die Befürchtung, unangenehm aufzufallen oder peinlich zu wirken, kann in einzelnen oder in vielen sozialen Situationen auftreten (wie z.B. in Gegenwart anderer essen, trinken oder schreiben; eine Rede vor anderen halten; eine Person des anderen Geschlechts ansprechen). Die Befürchtung geht mit starken Angstund Schamgefühlen sowie körperlicher Anspannung einher (evt. auch mit Erröten, Zittern, Schwitzen oder Stottern) und führt zu einer Vermeidung der Situationen, in denen eine Konfrontation mit der negativen Bewertung möglich ist. Die Situationen werden danach unterschieden, ob mehr der Leistungs- (öffentliches Reden, sich in einer Besprechung äußern, mündliche Prüfungen) oder mehr der Interaktionsaspekt im Vordergrund steht (Unterhaltungen, Reklamation in Geschäften). Grundsätzlich ist von einem Kontinuum sozialer Ängste auszugehen, das von weitverbreiteten, subklinischen Unsicherheiten, spezifischen sozialen Ängsten, generalisierten sozialen Phobien bis hin zu Interaktionsauffälligkeiten entsprechend einer ängstlich-vermeidenden Persönlichkeitsstörung reicht. Die Schwelle zu einer psychischen Störung wird dann überschritten, wenn Situationen durchgängig vermieden werden oder es zu massiven Beeinträchtigungen im Alltag kommt (berufliche Schwierigkeiten wie z.B. Vermeidung angstauslösender beruflicher Positionen, soziale Isolation im Privatleben). Die Soziale Phobie ist eine der häufigsten Angststörungen und auch eine 8 der häufigsten psychischen Störungen überhaupt. Epidemiologische Untersuchungen in den USA schätzen die Lebenszeitprävalenz auf etwa 13%, in Deutschland geht man von etwas niedrigeren Prävalenzzahlen aus (etwa 5%). Frauen sind 1,4-mal so häufig betroffen. Der Beginn ist in 75% der Fälle vor dem 16. Lebensjahr. Der Verlauf ist in der Regel chronisch, die durchschnittliche Dauer vom Beginn der Störung bis zum Beginn einer Behandlung beträgt 18 Jahre. In aller Regel leiden Personen mit einer sozialen Phobie unter mindestens einer weiteren psychischen Störung, wobei weitere Angststörungen, depressive Störungen und Substanzmissbrauch bzw. –abhängigkeit am häufigsten vorkommen (Lebenszeitkomorbidität 81%). In Dreiviertel der Fälle geht die Soziale Phobie der komorbiden Störung voraus. Damit stellt die Soziale Phobie bei frühem Beginn einen Risikofaktor für die Entwicklung weiterer psychischer Störungen, vor allem von Depressionen und Suchterkrankungen, dar. Es scheint auch einen Anstieg der Häufigkeit zu geben, insbesondere der Generalisierten Sozialen Phobien mit früherem Beginn und höherem Schweregrad, was mit den sich wandelnden sozialen Bedingungen in Verbindung gebracht wird. Trotz des häufigen Auftretens werden Soziale Phobien oft nicht erkannt, da sie von anderen Störungen überlagert werden oder Patienten das Ausmaß ihrer Ängste bagatellisieren. Auch Therapeuten greifen entsprechende Hinweise mitunter nicht auf, da soziale Ängste unter ihren Patienten weit verbreitet sind, so dass sie die Bedeutung unterschätzen. Prädisponierend für die Entstehung einer Sozialen Phobie können als psychologische Vulnerabilität der elterliche Bindungsstil (überbehütend oder gleichgültig), sozial traumatisierende Erlebnisse (z.B. Hänseleien oder Ausgrenzungserfahrungen in der Schule) oder soziale Kompetenzdefizite sein. Mögliche biologische Vulnerabilitäten bestehen in einer erhöhten Erregbarkeit der Amygdala (Hirnareal, das Furchtreaktionen steuert), einer Hypersensitivität des Neurotransmittersystems oder in einer genetisch verankerten Bereitschaft, Angst vor aggressiven, kritischen oder ablehnenden Gesichtern zu entwickeln (i.S. einer „preparedness“). Auslösende Faktoren für eine Soziale Phobie sind kritische Lebensereignisse bzw. erhöhte soziale Anforderungen. Entscheidende aufrechterhaltende Mechanismen für die Störung sind, neben der Vermeidung angstauslösender Situationen, eine erhöhte Selbstaufmerksamkeit und Sicher9 heitsverhaltensweisen. So beobachten sich Personen mit einer Sozialen Phobie ständig selbst, um Anzeichen für eventuelle Fehler im eigenen Verhalten wahrzunehmen. Weiterhin versuchen sie mit Hilfe verschiedener Strategien negative Bewertungen zu verhindern (z.B. durch exzessive Vorbereitung auf einen Vortrag, Konsum von Alkohol zur Angstreduktion, Verhinderung von Körpersymptomen wie Schwitzen). Dies führt aber dazu, dass die ängstlichen Befürchtungen nicht überprüft werden können. Außerdem werden dadurch aber häufig auch tatsächliche soziale Ungeschicktheiten provoziert, da die Person z.B. aufgrund der nach innen gerichteten Aufmerksamkeit Gesprächsinhalte nicht mitbekommt oder aufgrund angstreduzierender kurzer Sätze im Gespräch unnatürlich wirkt. 2.3 Generalisierte Angststörung Menschen, die unter einer Generalisierten Angststörung (GAS) leiden, machen sich praktisch ständig übertriebene Sorgen um Ereignisse, auf die sie keinen Einfluss haben. Die Sorgen oder ängstlichen Erwartungen beziehen sich auf (mindestens zwei) unterschiedliche Lebensbereiche und können von den Betroffenen nur unzureichend oder gar nicht kontrolliert werden. Sie drehen sich z.B. um die eigene Gesundheit oder die der Angehörigen, um die Beziehungen zu anderen Menschen, um finanzielle Angelegenheiten oder um die eigene Leistungsfähigkeit. Hinzu kommt ein ständig erhöhtes Anspannungsniveau mit Ruhelosigkeit, rascher Ermüdbarkeit, Konzentrationsstörungen und Schlafstörungen. Die Anspannung steigert sich dabei im Allgemeinen nicht bis zu Panikanfällen. Die Sorgen lassen sich von Alltagssorgen aufgrund ihrer Häufigkeit und Beschaffenheit (Sorgenketten), aber nicht aufgrund ihrer Inhalte unterscheiden, weshalb die Störung häufig nicht oder erst spät erkannt wird. Die GAS ist mit einer geschätzten Lebenszeitprävalenz von 5% eine häufige Störung (das Verhältnis von Frauen zu Männern beträgt etwa 3:2) und verläuft unbehandelt chronisch mit Schwankungen. Sie beginnt zwischen 20 und 30 Jahren, wobei Frauen einen zweiten Gipfel zwischen 55 und 60 Jahren zu haben scheinen. Sie wird als die Angststörung angesehen, die bei älteren Menschen am häufigsten vorkommt. Die Komorbidität mit anderen psychischen Störungen ist hoch (etwa 90% Lebenszeitprävalenz, meist handelt es sich dann um 10 eine andere Angststörung oder um eine Depression). Dabei ist die GAS häufig nicht die Störung, die zur Behandlung Anlass gibt, was die Diagnosenstellung ebenfalls erschwert. Bei der Entstehung der GAS scheint es einen eher mäßigen prädisponierenden genetischen Effekt zu geben. An psychologischen Vulnerabilitäten kommen Entwicklungsbedingungen in Betracht, die zur Ausbildung eines sog. „Gefahren-Schemas“ führen. Ein unspezifischer Einfluss, der mit einer erhöhten Vulnerabilität für Angststörungen insgesamt einhergeht, ist ein elterlicher Erziehungsstil, der Bindungs- und Kontrollbedürfnisse eines Kindes verletzt. Eine spezifische psychologische Vulnerabilität für die GAS sind erworbenen Annahmen, die Sorgen seien im Leben wichtig und sinnvoll (z.B. „Meine Sorgen helfen mir zu verhindern, dass negative Ereignisse eintreten“). Wenn eine GAS aufgrund von belastenden Lebensereignissen ausgelöst wurde, dann wird sie durch Mechanismen aufrechterhalten, die sich auf die Vermeidung innerer Erlebnisse beziehen. So helfen Sorgen physiologische Erregungsprozesse zu begrenzen, was sie negativ verstärkt. Aufgrund der abstrakten Beschäftigung mit (verbalen) Sorgen werden emotional belastendere (bildhafte) Themen ausgeklammert und vermieden, was eine Habituation verhindert. Sorgenketten verhindern damit eine emotionale Verarbeitung von Belastungen, weil die Betroffenen „nicht auf den Punkt kommen“. Dies führt aber dazu, dass die entsprechenden Gedankeninhalte immer wieder ins Bewusstsein drängen. Weiterhin führen Kontrollstrategien langfristig dazu, dass Sorgen sich verfestigen (Ablenkung, Gedankenunterdrückung, Rückversicherungen bei anderen, Vermeidung wie z.B. keine Zeitung mehr lesen). Diese Mechanismen werden noch verschärft, wenn Sorgen hinzukommen, die sich auf den Prozess des Sorgens beziehen (sog. Meta-Sorgen wie z.B. „Wenn ich meine Sorgen nicht unter Kontrolle bekomme, werde ich krank“). 2.4 Spezifische Phobie Eine Spezifische (oder einfache) Phobie bezeichnet eine unangemessene und ausgeprägte Angst vor bestimmten Objekten oder Situationen (ausgenommen sind dabei sozial- und agoraphobische Ängste). 11 Man unterscheidet dabei verschiedene Situationstypen: − Tier-Typ: Spinnen, Hunde, Mäuse − Naturgewalten-Typ: Gewitter, Sturm, Wasser −Blut-Injektions-Verletzungs-Typ − Situativer Typ: Fahrstuhl, Tunnel, Brücke, Flugzeug Auch in diesem Bereich ist von einem Kontinuum von milden und weitverbreiteten Ängsten bis hin zu ausgeprägten und einschränkenden Phobien mit Krankheitswert auszugehen. Viele Menschen kennen z.B. eine Furcht vor Spinnen oder vor Höhen, das Erleben mulmiger Gefühle bei starken Unwettern oder aufkommende Ängste beim Einsteigen in ein Flugzeug bzw. bei auftretenden Turbulenzen im Flugzeug. Diese Ängste sind aber in den meisten Fällen milde ausgeprägt und stellen kein Problem dar. Bei einer starken Ausprägung kommt es zu massiven Einschränkungen im privaten oder beruflichen Bereich, da die angstauslösenden Situationen weitgehend vermieden werden, so dass hieraus eine Behandlungsbedürftigkeit resultiert (z.B. wenn bei Höhenängsten Brücken nicht mehr überquert oder bei Flugängsten beruflich notwendige Flugreisen nicht mehr durchgeführt werden können oder bei einer Spritzenphobie medizinisch notwendige Operationen vermieden werden). Die Schätzungen für die Lebenszeitprävalenz für die einzelnen Arten spezifischer Phobien liegen zwischen 6 - 20 %, wobei Tier- und Höhenphobien am häufigsten vorkommen. Frauen sind von spezifischen Phobien häufiger betroffen (im Verhältnis 2:1). Tierphobien scheinen meist in der Kindheit zu beginnen (mit ca. 7 Jahren), gefolgt von der Blutphobie (mit ca. 9 Jahren) und der Zahnarztphobie (mit ca. 12 Jahren). Bisher liegen nur wenige Studien zum Verlauf vor. Diese ergeben Hinweise, dass spezifische Phobien mit steigendem Alter eher zunehmen. Im Hinblick auf die Entstehung Spezifischer Phobien wird davon ausgegangen, dass Menschen auf bestimmte Reize hin schneller Ängste entwickeln, weil diese in der Evolution tatsächlich Gefahren darstellten (Tiere, Höhen). Neben dieser biologischen Prädisposition („preparedness“) wird auch eine mögliche Überaktivierung der Amygdala angenommen. Ausgelöst werden Spezifische Phobien in „Krisenzeiten“ mit verschiedenen Belastungen. Aufrechterhalten 12 werden sie aufgrund des ausgeprägten Vermeidungs- bzw. Sicherheitsverhaltens (einschließlich Anklammerungsverhalten an andere, Ablenkungsstrategien und Einnahme von Beruhigungsmitteln oder Alkohol). 2.5Krankheitsängste Krankheitsängste kommen auch bei manchen der zuvor beschriebenen Angststörungen vor, insbesondere bei der Panikstörung bzw. der Agoraphobie und der Generalisierten Angststörung. Weiterhin finden sich Krankheitsängste bei den Somatoformen Störungen und hier vor allem bei der Hypochondrischen Störung. Auch nach körperlich schwerwiegenden Erkrankungen (z.B. nach einem Herzinfarkt oder einer Krebserkrankung) können sich verständliche Ängste vor einem Wiederauftreten verselbständigen. Das Kernmerkmal der Hypochondrischen Störung ist die übermäßige Angst, an einer ernsthaften oder gar vital bedrohlichen Erkrankung zu leiden, was zu Beeinträchtigungen im Leben der Betroffenen führt. Trotz angemessener medizinischer Abklärung bleibt die Angst vor der befürchteten Krankheit bestehen. Obwohl bedeutsame Ähnlichkeiten zu Angststörungen, z.B. zur Panikstörung, bestehen, wird die Hypochondrische Störung nosologisch unter die somatoformen Störungen eingeordnet, was zwar immer wieder diskutiert, aber wohl auch in Zukunft beibehalten wird. Aufgrund der bestehenden Parallelen werden die Hypochondrische Störung und die damit verbundenen Krankheitsängste dennoch hier mit aufgeführt. Die Lebenszeitprävalenz der Hypochondrischen Störung wird auf 0,4 - 1% geschätzt (ausgewogenes Geschlechterverhältnis), damit tritt diese Erkrankungsform deutlich seltener auf. In Allgemeinarztpraxen wird die Häufigkeit weit höher eingeschätzt (4 - 9%). Die Störung kann in jedem Alter beginnen (mittleres Erkrankungsalter 27 Jahre). Der Verlauf scheint variabel zu sein, wobei die Datenlage hierzu eingeschränkt ist. Zu Beginn kann die Störung vollständig remittieren. Je ausgeprägter die Krankheitsangst aber ist und je länger sie besteht, desto wahrscheinlicher bleibt das Krankheitsbild bestehen. Komorbide bestehen meist eine depressive Störung, eine Angst- oder eine Zwangsstörung. Frühe Lernerfahrungen mit eigenen Krankheiten oder Krankheiten im persönlichen Umfeld (z.B. Unfälle in der Kindheit, chronische Erkrankung eines Fa13 milienmitglieds, schwere Erkrankung eines engen Freundes) stellen einen spezifischen psychologischen prädisponierenden Faktor für die Hypochondrische Störung dar. Kognitiven Theorien zufolge führen diese Erfahrungen zur Ausbildung dysfunktionaler Grundannahmen über Krankheiten (z.B. „Körperliche Symptome sind immer ein Zeichen für eine schwere Erkrankung“). Ausgelöst werden Krankheitsängste z.B. durch ein Bagatellsymptom oder durch Hinweisreize (z.B. Medienberichte), die automatische Gedanken und bildliche Vorstellungen hervorrufen. Aufrechterhalten werden die Krankheitsängste aufgrund von verschiedenen Prozessen: Es findet eine Aufmerksamkeitsausrichtung auf den Körper statt, wodurch normale oder zuvor unbemerkte Merkmale in den Fokus geraten, die wiederum Quelle von Befürchtungen werden. Zudem lösen Ängste physiologische Erregung und vegetative Symptome aus, die i.S. der befürchteten Krankheit interpretiert werden. Sicherheitsverhaltensweisen wie Selbstuntersuchungen („checking-behavior“), Rückversicherung über medizinische Literatur oder über das Internet, Arztbesuche („Ärztehopping“) und Schonverhalten reduzieren kurzfristig Ängste, bewirken langfristig aber deren Verfestigung aufgrund der intensiveren Beschäftigung mit den körperlichen Symptomen. 3. Indikation zur stationären Behandlung Nach wie vor bestehen keine klaren Regeln zur Frage der Differentialindikation: Ist beim Vorliegen einer Angststörung eine ambulante Psychotherapie ausreichend oder ist eine stationäre bzw. teilstationäre (ganztägig ambulante) Behandlung notwendig? Immer häufiger erfolgt eine pragmatische Indikationsstellung aufgrund sozialmedizinischer Gegebenheiten. So werden Patienten bei langer Arbeitsunfähigkeit über ihre Krankenkasse aufgefordert, einen Rehabilitations-Antrag zu stellen, der sie dann in eine (teil-) stationäre psychosomatische Behandlung führt. Wegen der langen Wartezeiten auf einen ambulanten Psychotherapieplatz kann es vorkommen, dass die (teil-) stationäre Maßnahme dann einfach „schneller“ erfolgt. Dennoch gibt es einige Konstellationen, die aus unserer Erfahrung bei einer Angststörung aus inhaltlichen Erwägungen heraus für eine stationäre Behand14 lung und gegen eine ambulante bzw. ganztätig ambulante Maßnahme sprechen: − Hohe Ausprägung der Ängste: Je stärker ausgeprägt Ängste und die damit einhergehenden Einschränkungen sind, desto sinnvoller ist eine stationäre Behandlung. Bei einem massiven Vermeidungsverhalten ist eine intensive Übungsbehandlung unbedingt notwendig, die so im ambulanten Rahmen nicht gewährleistet werden kann. Zu berücksichtigen ist, dass der Wunsch eines Betroffenen, eine ganztätig ambulante Maßnahme durchführen zu wollen, Teil des Vermeidungsverhaltens sein kann. Im beschützten stationären Rahmen bestehen zudem vielfältige Therapiemaßnahmen, um es einem Patienten zu ermöglichen, wieder Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Ressourcen zu entwickeln. − Vorliegen verschiedener Problembereiche: Wenn gleichzeitig mehrere private oder berufliche Belastungsfaktoren bestehen (Probleme in der Partnerschaft, soziale Isolation, Konflikte bei der Arbeit, längere Arbeitslosigkeit, unklare berufliche Perspektive) oder Kompetenzdefizite vorliegen (soziale Kompetenzen, Entspannungsfähigkeit, Emotionsregulation) oder interaktionelle Schwierigkeiten so gravierend sind, dass sie Problemlösungen verhindern, dann ist auch eine stationäre Maßnahme indiziert. Die Herausnahme aus dem sozialen Umfeld ist zur Bearbeitung der Problembereiche daher sinnvoll, außerdem sind in diesem Fall auch mehrere therapeutische Ansatzpunkte notwendig. − Komorbidität mit anderen psychischen Störungen: Sehr häufig liegen neben einer Angststörung komorbid weitere psychische Störungen vor, wie z.B. eine Depression, die die Behandlung erschweren. Um sich gegenseitig beeinflussende Teufelskreise zu durchbrechen, ist eine stationäre Behandlung mit ihrem multimodalen Angebot oft angezeigt. − Komorbidität mit körperlichen Erkrankungen: Bei bestehenden körperlichen Erkrankungen (z.B. des Herz-Kreislauf-Systems: Zustand nach Herzinfarkt) ist eine enge medizinische und psychotherapeutische Abstimmung notwendig. Im stationären Rahmen wird dies durch eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit gewährleistet. 15 − Chronisches Krankheitsverhalten: Die Folge einer seit langem bestehenden Erkrankung können eine ausgeprägte Passivität und Hilflosigkeit im Umgang mit Ängsten sein. Aufgrund des Aufforderungs- und Aktivierungscharakters der verschiedenen Maßnahmen im stationären Umfeld wird dieser Tendenz entgegen gewirkt. 4. Therapieziele Übergeordnete Ziele einer stationären Behandlung sind neben der Überwindung der Leitsymptomatik die Sicherung der beruflichen und sozialen Leistungsfähigkeit sowie die Verhinderung weiterer gesundheitlicher Beeinträchtigungen. Hieraus ergeben sich bezogen auf Angststörungen folgende Therapieziele: − Verbesserung der Angstbewältigungsstrategien und − Abbau des Vermeidungs-, Schon- und Sicherheitsverhaltens sowie − Verbesserung der Entspannungsfähigkeit. Die konkrete Ausgestaltung dieser allgemeinen Ziele gestaltet sich für die einzelnen Angststörungen mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen: Bei den phobischen Störungen geht es um die Bewältigung der jeweiligen angstauslösenden Situationen. Um den Aktionsspielraum der Betroffenen wieder zu erweitern, sollen diese in die Lage versetzt werden, ihre Ängste vor Menschenmengen bzw. Entfernungen von zuhause (Agoraphobie), vor der Bewertung durch andere (Soziale Phobie) oder vor bestimmten Situationen oder Objekten (Spezifische Phobie wie Höhenangst, Flugangst) zu überwinden. Hierbei ist ein Verzicht auf das meist umfangreiche Vermeidungs- und Sicherheitsverhalten notwendig (z.B. Begleitung durch andere, exzessive Vorbereitung auf soziale Situationen, aber auch Alkoholkonsum oder Medikamentenmissbrauch). Bei der Sozialen Phobie wird zusätzlich ein Abbau der erhöhten Selbstaufmerksamkeit angestrebt. Die Bewältigung ängstigender Körpersymptome steht bei der Panikstörung und der Hypochondrischen Störung im Vordergrund. Hierbei wird besonders auf den 16 Abbau des körperlichen Schonverhaltens und auf die Verbesserung der körperlichen Belastbarkeit fokussiert. Weiterhin wird der Abbau des relevanten Sicherheitsverhaltens, insbesondere Selbstuntersuchungen und Informationssuche (wie Arztbesuche, Internetrecherchen), angestrebt. Bei der Generalisierten Angststörung dagegen geht es um die Überwindung von gedanklichen Sorgenketten (Katastrophengedanken) und um die Veränderung von Einstellungsmustern, die übermäßige Sorgen begünstigen. Spezifisches Vermeidungsverhalten (Verhinderung von Aufregungen z.B. durch Schonung von Seiten der Bezugspersonen, Zeitung nicht mehr lesen) sollte unbedingt abgebaut werden. Weitere mögliche Therapieziele ergeben sich aus der bedingungsanalytischen Betrachtung im Einzelfall. So kann z.B. eine Verbesserung der Körperwahrnehmung und ein Erkennen von Belastungsgrenzen oder eine Verbesserung sozialer Kompetenzen (angemessenes Abgrenzen gegenüber Erwartungen anderer, Delegieren von Aufgaben) oder eine Verbesserung emotionaler Bewältigungskompetenzen sinnvoll sein. Weiterhin kommen z.B. bei Heranwachsenden auch die Notwendigkeit zu einer verbesserten Verselbständigung und bei einer Paarproblematik die Verbesserung der partnerschaftlichen Interaktion in Betracht. 5. Das stationäre Behandlungskonzept Therapeutische Grundprinzipien sind für alle Indikationsbereiche ein biopsychosoziales Krankheitsverständnis und das Bezugstherapeutensystem, das die Integration verschiedener Therapiebausteine gewährleistet. Jedem Patienten werden bei Aufnahme ein Bezugstherapeut (Arzt oder Psychologe) und ein Co-Therapeut (Angehöriger eines Pflegeberufes) zugewiesen, die Hauptansprechpartner für alle relevanten Belange sind. Die Behandlung von Angsterkrankungen orientiert sich an den bestehenden evidenzbasierten psychotherapeutischen Leitlinien. Für Patienten mit Angsterkrankungen stehen neben den Einzelgesprächen mit dem Bezugs- und Co-Therapeuten, in deren Rahmen auch Expositionsübungen 17 vorbereitet und durchgeführt werden, folgende störungsspezifische Angebote zur Verfügung: − Psychoedukative Angstgruppe: In einer offenen, 4-wöchigen Großgruppe werden Grundlagen zu Angststörungen vermittelt (Formen von Angsterkrankungen, therapeutische Behandlungsmöglichkeiten, biologische Grundlagen der Körperreaktionen, Vermeidungs- vs. Bewältigungsverhalten, aufrechterhaltende Bedingungen und Rückfallprophylaxe). −Angstkleingruppen: Die jeweiligen Inhalte der Großgruppe werden in darauf bezogenen Kleingruppen vertieft (Dauer ebenfalls 4 Wochen). Dabei wird auch auf die Erfahrungen der Patienten mit ihren selbst durchgeführten Angstbewältigungsübungen eingegangen, was Korrekturen ermöglicht. −Angstexpositionsgruppe: Diese halboffene, bis zu 4 Wochen dauernde Kleingruppe richtet sich vor allem an Patienten mit agoraphobischem Vermeidungsverhalten. Nach intensiver Vorbereitung (inklusive sog. Angstsportgruppe) finden zwei invivo-Expositionstage statt (halb- bzw. ganztägig). Hierbei werden insbesondere Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, der Besuch von Kaufhäusern in einer nahe gelegenen Großstadt oder das Fahren in Aufzügen geübt. Auch für Patienten mit Höhenängsten (Besuch eines Fernsehturms) oder Sozialer Phobie (vielfältige Übungsmöglichkeiten in Geschäften oder Restaurants) ist die Gruppe geeignet. −Hyperventilationsgruppe: Diese Gruppe zielt auf Patienten, die entweder zu Hyperventilationszuständen neigen oder unter situationsunabhängigen Panikattacken leiden. Wenn im letzteren Fall angstähnliche Symptome unter Hyperventilation auftreten, dann dient dies der Simulation von Angstanfällen. Die Patienten lernen diese Symptome zu bewältigen, zudem erlernen sie die Bauchatmung. − Soziales Kompetenztraining (SKT): Diese Gruppe wendet sich u.a. an Patienten mit einer Sozialen Phobie. Falls Kompetenzdefizite bestehen, können diese in der Gruppe trainiert werden. Zusätzlich bietet die kleine Gruppe die Möglichkeit, Expositionsübungen durchzuführen (z.B. eine Rede vor anderen halten oder eine Forderung an den Chef richten). 18 − Virtuelle Exposition: Patienten mit ausgeprägten und beeinträchtigenden Flugängsten können Bewältigungserfahrungen mit Hilfe der sog. virtuellen Exposition machen. Dabei werden Flugsituationen (Start, Kurvenflug, Turbulenzen, Landung) über ein Display dargeboten und die entsprechenden Flugbewegungen gleichzeitig durch einen hydraulischen Stuhl simuliert, was Angstreaktionen provozieren und einer Bearbeitung zugänglich machen kann. Darüber hinaus bestehen weitere allgemeine bzw. störungsübergreifende Therapieangebote, die für Patienten mit einer Angsterkrankung aber in besonderem Maße geeignet sind: −Sportherapie: Die Teilnahme an einer oder mehrerer der bestehenden Sportgruppen (Teamsport, Fit up, Adipositassport, Zirkeltraining, Anfängerschwimmkurs, Energiegruppe) ermöglicht z.B. bei körperbezogenen Ängsten Vertrauen in die Funktionstüchtigkeit des eigenen Körpers zurückzugewinnen oder bei sozialen Ängsten Unsicherheiten und Hemmungen anderen gegenüber durch einen spielerischen Zugang abzubauen. −Entspannungstraining nach Jacobson: Die Teilnahme am Entspannungstraining zielt auf eine Senkung des allgemeinen Anspannungsniveaus, was für alle Patienten mit einer Angsterkrankung, insbesondere aber für diejenigen mit einer Generalisierten Angststörung wichtig ist. Weiterhin bestehen vielfältige weitere therapeutische Angebote, die nach individueller Indikationsstellung erfolgen. Sie werden im Gespräch mit dem Bezugstherapeuten gemeinsam festgelegt: − Psychoedukative Großgruppen zu Depression, Schmerz, PTBS und Persönlichkeitsstilen/-störungen − Störungsspezifische Kleingruppen: Depressionskleingruppe, Anorexie-Buli mie-Gruppe, Gruppe für Adipositas und Binge Eating, Zwangsbewältigungs gruppe, Skilllsgruppe für Borderline-Patienten − Problemlösegruppe (PLG) oder Psychosomatikgruppe (PSG) − Soziotherapeutische Einzelgespräche, Bewerbungstraining, Psychoedukative 19 Informationsveranstaltung über sozialmedizinische Aspekte der psychoso matischen Rehabilitation − Belastungstrainings in der Ergotherapie: Ergotherapeutischer Aktivtag, PC Training, externe Belastungserprobung − Offene Werkstätten der Ergotherapie: Holz-, Papier-, Tonwerkstatt − Ergotherapeutische Kleingruppen: Projektgruppe, Feldenkrais und Plastizie ren, Aktivität und Genuss, Farb- und Stilberatung −Achtsamkeitsmeditation − Achtsam in den Tag − Sporttherapeutische Einzelbetreuung: Boxsacktraining − Krankengymnastische Einzel- und Gruppenbehandlung, Rückenschule, Me dizinische Trainingstherapie, Atementspannung, Beckenbodentraining, Funktionsdiagnostik − Neuropsychologische Diagnostik − Altersbezogene Angebote: Soziales Kompetenztraining bzw. Problemlöse gruppe für Jugendliche und junge Erwachsene, Problemlösegruppe für die 2. Lebenshälfte − Paar- bzw. Familiengespräche −Gesundheitstraining: Vorträge zu Gesunder Ernährung, Bluthochdruck, Nichtrauchervortrag und –training, Rückenfit am PC, Sport und Gesundheit, Menopause etc. − Ernährungsberatung sowie Kochgruppen für Patientinnen mit Essstörungen − Physio- und Balneotherapie Schließlich besteht für Patienten der Kostenträger DRV Bund und DRV Rheinland-Pfalz auch die Möglichkeit der Teilnahme an einer Rehabilitations-Nachsorgegruppe (IRENA, ERNA). 20 6 Literatur Becker, E. & Margraf, J. (2007). Generalisierte Angststörung. Ein Therapieprogramm. Weinheim: Beltz. Bentz, D. & Margraf, J. (2010). Panikstörung und Agoraphobie. In Noyon, A. (Hrsg.). Themenheft Angststörungen. Verhaltenstherapie & Verhaltensmedizin, 31 (2), 130-150. Ehrhardt, M. & Sturm ,J. (1990). Angstbewältigung im Rahmen eines verhaltensmedizinischen Gruppenkonzeptes bei Herzphobikern. In M. Zielke, M. & Mark, N. (Hrsg.) Fortschritte der angewandten Verhaltensmedizin. Berlin: Springer. Heinrichs, N., Alpers, G.W. & Gerlach, A.L. (2009). Evidenzbasierte Leitlinie zur Psychotherapie der Panikstörung und Agoraphobie. Göttingen: Hogrefe. Heinrichs, N., Stangier, U., Gerlach, A.L., Willutzki, U. Fydrich, T. (2010). Evidenzbasierte Leitlinie zur Psychotherapie der Sozialen Angststörung. Göttingen: Hogrefe. Hoyer, J. & Beesdo-Baum, K. (2010). Generalisierte Angststörung: Sorgen als kognitives Vermeidungsverhalten. In Noyon, A. (Hrsg.). Themenheft Angststörungen. Verhaltenstherapie & Verhaltensmedizin, 31 (2), 151163. Lang, T., Helbig-Lang, S., Westphal, D., Gloster, A.T. & Wittchen, H.-U. (2012). Expositionsbasierte Therapie der Panikstörung mit Agoraphobie – Ein Behand-lungsmanual. Göttingen: Hogrefe. Neng, J.M.B. & Weck, F. (2012). Hypochondrie und Krankheitsangst – ein kognitiver Behandlungsansatz. Psychotherapie, 17 (1), 100-110. Schneider, S. & Margraf, J. (2008). Panik: Angstanfälle und ihre Behandlung. Berlin: Springer. Stangier, U., Heidenreich, T. & Peitz, M. (2009). Soziale Phobien. Ein kognitivverhaltenstherapeutisches Behandlungsmanual. Weinheim: Beltz. Wade, A. (2010). Spezifische Phobien. In Noyon, A. (Hrsg.). Themenheft Angststörungen. Verhaltenstherapie & Verhaltensmedizin, 31 (2), 179-193. Wells, A. (1997). Cognitive therapy of anxiety disorders: A practice manual and conceptual guide. Chichester, UK: Wiley. Wells, A. (2011). Metakognitive Therapie bei Angststörungen und Depression. Weinheim: Beltz. 21 Patientenratgeber: Consbruch von, K. & Stangier, U. (2010). Ratgeber Soziale Phobie. Göttingen: Hogrefe. Heinrichs, N. (2007). Ratgeber Panikstörung und Agoraphobie. Göttingen: Hogrefe. Hoyer, J., Beesdo, K. & Becker, E. (2007). Ratgeber Generalisierte Angststörung. Göttingen: Hogrefe. Leidig, S. & Glomp, I. (2003). Nur keine Panik! Ängste verstehen und überwinden. Kösel. 22 In dieser Reihe sind bisher erschienen: Heft 1 Heft 2 Heft 3 Heft 4 Heft 5 Heft 6 Heft 7 Heft 8 Heft 9 Heft 10 Heft 11 Heft 12 Heft 13 Heft 14 Indikation zur stationären Therapie Angststörungen Zwangsstörungen Psychogene Essstörungen Somatoforme Störungen Chronischer Kopfschmerz Biofeedbacktherapie Psychosomatische Behandlung bei Jugendlichen Psychosomatik gynäkologischer Störungsbilder Die Aufmerksamkeitsdefizit / Hyperaktivitätsstörung des Jugend und Erwachsenenalters Sexuelle Traumatisierungen Persönlichkeitsstörungen Depression Chronischer Schmerz ISSN 1432-5845 23