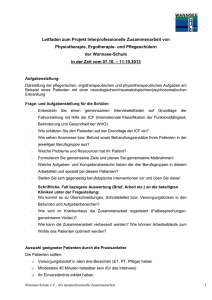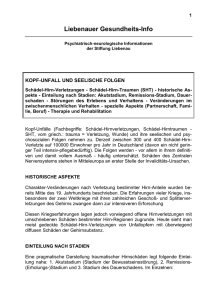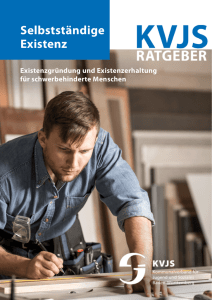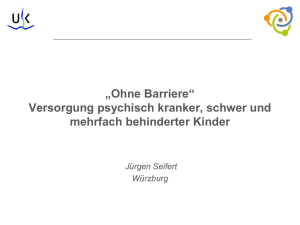Die neue internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Be
Werbung

Prof. Dr. Christian Lindmeier Die neue internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der WHO – Darstellung und Kritik Vorbemerkungen Die Abkürzung ›ICF‹ steht für die ›Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit‹ (engl.: ›International Classification of Functioning, Disability and Health‹). Diese neue Klassifikation wurde im Mai 2001 von der 54. Vollversammlung der WHO (an der auch Vertreter der deutschen und der schweizerischen Bundesregierung teilgenommen haben) als Nachfolgerin der ›Internationalen Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen‹ (›International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps‹) verabschiedet. Diese alte WHO-Klassifikation von 1980 ist unter der Abkürzung ›ICIDH‹ bekannt geworden. Mit der Verabschiedung der ICF haben sich die Gesundheitsministerien der Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, die ICF als konzeptuelle Grundlage für ihr Verständnis von Behinderungen und bei der Berichterstattung gegenüber der WHO zu verwenden. Umgekehrt verpflichtete sich die WHO, die Mitgliedländer bei den dadurch entstehenden Entwicklungsaufgaben zu unterstützen. 1 Bereits 2001 wurde die ICF sowohl als Buch und ›Vollversion‹ als auch als ›Kurzversion‹ (short version) in englischer Sprache veröffentlicht (vgl. WHO 2001a, 2001b). Außerdem wurde 2001 eine ›mehrsprachige CD ROM‹ veröffentlicht, die die Vollversionen der ICF in arabischer, chinesischer, englischer, spanischer, französischer und russischer Sprache enthält (vgl. WHO 2001c). Auf dieser CD ROM fehlt allerdings eine Vollversion in deutscher Sprache; denn obwohl seit 2002 ein Übersetzungsentwurf von Fachleuten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (unter Federführung des Verbands Deutscher Rentenversicherungsträger/Dr. Michael Schuntermann) vorliegt, steht die endgültige Veröffentlichung einer deutschsprachigen Ausgabe der ICF immer noch aus. Diese Verzögerung hat mit Problemen zu tun, die die deutsche Übersetzung zentraler englischer Begriffe der ICF betreffen. Nach einer Korrekturphase von mehr als 1 In Deutschland ist man dieser Verpflichtung bereits ein Stück weit nachgekommen, denn das neue Behinderungsverständnis der WHO ist sowohl in das 2001 in Kraft getretene Sozialgesetzbuch IX mit dem Titel ›Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen‹ als auch in das 2002 in Kraft getretene ›Bundesgleichstellungsgesetz‹ eingeflossen. 1 zwei Jahren hat das Deutsche Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI), das zur Herausgabe einer deutschsprachigen Ausgabe autorisiert ist, im Oktober 2004 allerdings eine vorläufige Endfassung (›final draft‹) ins Internet gestellt (www.dimdi.de). Damit dürfte eine endgültige Veröffentlichung unmittelbar bevorstehen. In meinen weiteren Ausführungen werde ich mich auf den Wortlaut dieser vorläufigen Endfassung des Deutsche Instituts für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) beziehen (vgl. DIMDI 2004). Die ICF gehört zu der von der WHO entwickelten ›Familie‹ von Klassifikationen für die Anwendung auf verschiedene Aspekte der Gesundheit. Diese Klassifikationen stellen einen Rahmen zur Kodierung eines breiten Spektrums von Informationen zur Gesundheit zur Verfügung (z. B. Diagnosen; Funktionsfähigkeit und Behinderung; Gründe für die Inanspruchnahme der Gesundheitsversorgung) und verwenden eine standardisierte allgemeine Sprache, welche die weltweite Kommunikation über Gesundheit und gesundheitliche Versorgung in verschiedenen Disziplinen und Wissenschaften ermöglicht. Gesundheitsprobleme werden innerhalb der Internationalen Klassifikationen der WHO hauptsächlich in der ICD-10 – so die Kurzbezeichnung für die 1993 verabschiedete ›Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision‹ (›International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems‹) (1993) klassifiziert. Die ICD-10 liefert einen ätiologischen Rahmen für die Klassifikation von Gesundheitsproblemen, während die ICF die Funktionsfähigkeit und Behinderung, verbunden mit einen Gesundheitsproblem, klassifiziert. Da die ICD-10 und ICF einander ergänzen (›Komplementärklassifikationen‹), ruft die WHO die Anwender auf, beide Klassifikationen der WHO-Familie der Internationalen Klassifikationen gemeinsam zu verwenden. Wörtlich heißt es hierzu in der ICF: »Die ICD-10 stellt eine ›Diagnose‹ von Krankheiten, Gesundheitsstörungen oder anderen Gesundheitszuständen zur Verfügung, und diese Information wird mit zusätzlichen Informationen über die Funktionsfähigkeit, welche die ICF liefert, erweitert. Informationen über Diagnosen (ICD-10) in Verbindung mit Informationen über die Funktionsfähigkeit (ICF) liefern ein breiteres und angemesseneres Bild über die Gesundheit von Menschen oder Populationen, welches zu Zwecken der Entscheidungsfindung herangezogen werden kann (DIMDI 2004, 10). Nach diesen Vorbemerkungen komme ich nun zur Gliederung meines Beitrags. Dieser wird vor allem einen Überblick über die ICF vermitteln. Weil man Neuerungen nie nur aus sich heraus verstehen kann, werde ich zu Beginn auf die Gründe für die Re2 vision der ICIDH und die Entstehungsgeschichte der ICF eingehen. Danach möchte ich in einem längeren Teil die konzeptionellen Unterschiede zwischen der ICIDH und der ICF herausarbeiten. Nach dieser Darstellung folgt die Bewertung der Bedeutung der ICF für die Entwicklung eines neuen Verständnisses von Rehabilitation. Von der ICIDH (1980) zur ICF (2001) – ein Paradigmenwechsel im Gesundheitssystem Die WHO klassifiziert Behinderung erst seit 1980 in eigenständiger Form klassifiziert. Vorher gab es nur internationale medizinische Klassifikationen wie die ICD, mit denen Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen klassifiziert werden konnten (vgl. Hirschberg 2003). Da in den 1970er Jahren auch im Gesundheitssystem erkannt wurde, dass Behinderung nicht mit Krankheit gleichgesetzt und deshalb mit einer Klassifikation der Krankheiten nicht adäquat beschrieben werden kann, legte die WHO 1980 (im Hinblick auf das internationale Jahr der Behinderten 1981) mit der ICIDH erstmals eine internationale behinderungsspezifische Klassifikation vor, die in deutschsprachigen Ländern unter dem Titel ›Internationalen Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen‹, abgekürzt ICIDH (für: ›International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps‹) bekannt geworden ist. Hauptzweck dieser international gültigen Klassifikation sollte es sein, zur internationalen Verständigung beizutragen und vergleichbare Zahlen für internationale Statistiken über die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung in den Mitgliedstaaten zu erhalten (vgl. Lindmeier 1993; WHO 1995). Bereits der ICIDH liegen zwei neue Erkenntnisse zu Grunde, die einen erheblichen Fortschritt gegenüber früheren Definitionsversuchen von Behinderung aus dem Gesundheitssystem darstellen: 1. Behinderung ist etwas Relatives. Ein Mensch mit Behinderung ist in aller Regel nur in ganz bestimmten, beschreibbaren Lebenssituationen behindert; 2. ein Mensch, der eine Gesundheitsstörung aufweist, kann durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Hindernisse oder die Bedingungen der natürlichen Umwelt zusätzlich sozial beeinträchtigt werden. Umgekehrt kann ein Wechsel des sozialen Rahmens oder die Beseitigung von Hindernissen zumindest die soziale Beeinträchtigung bzw. das ›handicap‹ als mangelnde soziale Anpassung des Betroffenen aufheben.2 2 In der Sonderpädagogik weiss man von diesen Dingen im Grunde schon, seit dem Heinrich Hanselmann 1941 in seinen ›Grundlinien einer Theorie der Sondererziehung‹ die Relativität der Behinderung und die Gefahr einer aus der Behinderung resultierenden soziale Beeinträchtigung beschrieben hat. 3 Ausgehend von diesen beiden Erkenntnissen der Relativität der Behinderung und der zusätzlichen sozialen Beeinträchtigung, hat die WHO mit ihrer Klassifikation von 1980 Folgendes geleistet (vgl. Schuntermann 1994): 1. Sie hat den Begriff der Behinderung ›entmythologisiert‹, indem sie ihn den modernen Anforderungen angepasst und so entwickelt hat, dass er wissenschaftlich und rehabilitationspraktisch zugänglich wurde. Das Ergebnis ist das WHO-Modell der nachteiligen Auswirkungen von Krankheiten, angeborenen Leiden und Unfällen, welches als ›Krankheitsfolgenmodell‹ bezeichnet worden ist. 2. Sie hat eine Klassifikation für die drei zentralen Sachverhaltsbereiche Gesundheitsschäden, einschließlich Funktionsstörungen, funktionelle Einschränkungen im täglichen Leben und soziale Beeinträchtigung erstellt und veröffentlicht, und sie hat 3. den Begriff der Rehabilitation auf der Grundlage des Krankheitsfolgenmodells neu gefasst. Bei dem von WOOD entwickelten Krankheitsfolgenmodell handelt es sich um ein heuristisches Modell, das die Krankheitsfolge ›Behinderung‹ auf den drei Eben der Schädigung (›impairment‹), Fähigkeitsstörung (›disability‹) und soziale Beeinträchtigung (›handicap‹) betrachtet (vgl. Abb. 1). Das Krankheitsfolgenmodell von WOOD als Grundlage der ICIDH (1980) der WHO Krankheit/ Störung Schädigung (impairment) Fähigkeitsstörung (disability) soziale Beeinträchtigung (handicap) führt zu kann führen zu [Behinderung] Abb. 1: Das Krankheitsfolgenmodell von WOOD als Grundlage der ICIDH (1980) der WHO Welchen Erklärungswert einem solchen Mehrebenenmodell zukommt, kann man sich am besten an Hand von Beispielen vergegenwärtigen. 4 Beispiel 1: »Ein Kind, das mit einem fehlenden Fingernagel geboren wurde, hat eine Missbildung – eine strukturelle Schädigung – , aber das beeinflusst in keiner Weise die Funktion der Hand; es ergibt sich keine Fähigkeitsstörung; die Schädigung ist nicht besonders augenfällig; entsprechend dürfte eine soziale Beeinträchtigung unwahrscheinlich sein.« (WHO 1995) Beispiel 2: »Kurzsichtige oder diabetische Menschen leiden an einer funktionellen Schädigung, müssen aber nicht in ihren Fähigkeiten gestört sein, da diese Schädigung durch Hilfsmittel, Geräte oder Arzneimittel korrigiert oder aufgehoben werden kann; der nicht in seinen Fähigkeiten gestörte jugendliche Diabetiker könnte trotzdem sozial beeinträchtigt sein, durch den erheblichen Nachteil, zum Beispiel nicht mit seinen Altersgenossen Konfekt essen zu dürfen oder sich regelmäßig Injektionen verabreichen zu müssen.« (WHO 1995) Beispiel 3: »Eine subnormale Intelligenz ist eine Schädigung, muss aber nicht zu einer bemerkenswerten Aktivitätseinschränkung führen; andere Faktoren als die Schädigung können die Beeinträchtigung bestimmen, weil die Beeinträchtigung minimal sein kann, wenn der Betreffende in einer entlegenen ländlichen Gemeinschaft lebt – sie kann aber bei einem in der Großstadt lebenden Kind von Universitätsabsolventen, von dem mehr erwartet wird, schwerwiegend sein.« (WHO 1995) Trotz der Fortschritte, die durch die ICIDH erzielt wurden, ist insbesondere der Begriff des ›handicaps‹ innerhalb und außerhalb der WHO von Anfang an erheblicher Kritik ausgesetzt gewesen (vgl. Schuntermann 1994; WHO 1995). Vor allem die Behindertenverbände in den USA und in Kanada widersetzten sich einer verengten Auffassung des Begriffs ›handicap‹, die das ›handicap‹ als Eigenschaft der Person auslegte. Diese Kritik war zweifellos berechtigt, denn im Rahmen des für die ICIDH maßgeblichen Krankheitsfolgenmodells wurden die ›sozialen Beeinträchtigungen‹ als Merkmal oder Status einer Person aufgefasst: »Die Beeinträchtigung ist charakterisiert durch eine Diskrepanz zwischen Verhalten und Status der Person und der Erwartung der speziellen Gruppe, deren Mitglied sie ist. Soziale Beeinträchtigung entsteht im Ergebnis ihrer Unfähigkeit, sich den Normen dieser Umwelt anzupassen [Hervorh. C. L.]. Somit ist Beeinträchtigung ein soziales Phänomen, das die gesellschaftlichen und Umweltfolgen für den Menschen zum Ausdruck bringt, die seiner Schädigung und Fähigkeitsstörung zuzuschreiben sind [Hervorh. C. L.]« (WHO 1995, 246). Wie die Behindertenverbände zu Recht monierten, weist ein ›handicap‹ aber stets zwei Aspekte auf: Eine Person kann ihre Rolle in Familie, Arbeit und Gesellschaft nicht aufrechterhalten, weil sie entweder aus körperlichen, geistigen oder seelischen Gründen dazu nicht in der Lage ist oder weil die Umwelt sie diese Rollen nicht aufrechterhalten lässt. Diese zwei Aspekte können als ›gehandicapt sein‹ und 5 ›gehandicapt werden‹ beschrieben werden. Wenn heute in deutschsprachigen Ländern heute zwischen ›behindert sein‹ und ›behindert werden‹ unterschieden wird, ist wohl Ähnliches gemeint (vgl. z. B. Eberwein/Sasse 1998).3 Eine Weiterentwicklung des ›handicap‹-Konzepts musste also sinnvoller Weise in der Einbeziehung von Umweltfaktoren und des Aspektes ›gehandicapt werden‹ bestehen, und genau in diese Richtung hat sich die WHO-Klassifikation mit der 1993 begonnenen Revision der ICIDH bewegt. Dabei ist ausdrücklich zu würdigen, dass Menschen mit Behinderung von Anfang in diesen Revisionsprozess involviert warnen (vgl. Hurst 2003; Hollenweger 2005). Der entscheidende Fortschritt, der durch die Revision der ICIDH erzielt wurde, besteht also darin, dass man nicht mehr von ›Behinderung‹ als von etwas spricht, was eine Person ›ist‹ oder ›hat‹, sondern von einer ›Behinderungs-Situation‹. Eine solche ›Behinderungs‹-Situation entsteht erst durch die negative Wechselwirkung zweier Gegebenheiten: die durch Krankheit, das Ergebnis einer Verletzung (Unfall, Gewalteinwirkung, Krieg) oder ein angeborenes ›Leiden‹ bedingten Gegebenheiten bei einer Person auf der einen Seite und die Gegebenheiten des Kontextes einer solchen Person auf der anderen Seite. Konzeptionelle Unterschiede zwischen der ICIDH und der ICF Da die ICF nicht nur eine Klassifikation zur Beschreibung von Behinderungssituationen sein soll, wurde außerdem als Bezeichnung für die Situation der positiven Wechselwirkung dieser beiden Gegebenheiten der Begriff der Funktionsfähigkeit eingeführt. Dabei ist zu beachten, dass es sich auf Seiten der Person um Gegebenheiten handeln muss, die grundsätzlich mit der ICD beschreibbar sind. Diese Eingrenzung auf ein gesundheitliches Problem ist wichtig, denn für andere (Mit-)Ursachen von Funktionsfähigkeit und Behinderung ist die ICF nicht vorgesehen. 3 Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat diesen Vorwurf in den am 20.12.1993 verabschiedeten Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte, den sog. ›Standard Rules‹, aufgegriffen:»Einige Fachleute haben ihrer Besorgnis darüber Ausdruck gegeben, dass die in der Klassifikation [gemeint ist die ICIDH von 1980, C. L.] des Begriffs ›soziale Beeinträchtigung‹ noch immer als zu medizinisch und zu sehr auf den Einzelnen ausgerichtet angesehen werden kann und die Wechselbeziehung zwischen den gesellschaftlichen Bedingungen und Erwartungen und den Fähigkeiten des Einzelnen vielleicht nicht genügend klar herausstellt. Diesen und anderen von den Benutzern der Klassifikation in den zwölf Jahren seit ihrer Veröffentlichung zum Ausdruck gebrachten Bedenken wird bei künftigen Änderungen der Klassifikation Rechnung getragen werden« (1993, 5). Die Einleitung der ICF bezieht sich auf diese Vorgabe: »Die ICF bezieht sich auf und enthält die Rahmenbestimmungen für die Herstellung von Chancengleichheit von Personen mit Behinderungen« (4). 6 Als ein erster grundlegender Unterschied zwischen der ICIDH und der ICF lässt sich also festhalten, dass in der ICF die Einheiten der Klassifikation keine Personen, sondern Situationen sind. Die ICF klassifiziert also nicht Personen, sondern sie beschreibt die Situation einer jeden Person mittels Gesundheits- oder mit Gesundheit zusammenhängenden Domänen. Darüber hinaus erfolgt die Beschreibung immer im Zusammenhang mit den Kontextfaktoren, die in Umwelt- und personbezogene Faktoren unterteilt werden (vgl. DIMDI 2004).4 (Erkenntnis-)Theoretisch betrachtet handelt es sich dabei um ein relationales Verständnis von Behinderung und Funktionsfähigkeit (vgl. Lindmeier 1993), das durch die Integration zweier gegensätzlicher Erklärungsmodelle, nämlich des medizinischen und des sozialen Modells, zu Stande kommt: »Es wurde eine Vielfalt von Konzepten und Modellen zum Verständnis und zur Erklärung von Funktionsfähigkeit und Behinderung vorgeschlagen. Diese können in dialektischer Weise von ›medizinischen Modell‹ versus ›sozialem Modell‹ ausgedrückt werden. Das medizinische Modell betrachtet ›Behinderung‹ als ein Problem der Person, das unmittelbar von einer Krankheit, einem Trauma oder einem anderen Gesundheitsproblem verursacht wird, und welches der medizinischen Versorgung bedarf, etwa in Form individueller Behandlung durch Fachleute. Das Management der Behinderung zielt auf Heilung, Anpassung oder Verhaltensänderung ab. Der zentrale Anknüpfungspunkt ist die medizinische Versorgung, und vom politischen Standpunkt aus gesehen geht es grundsätzlich darum, die Gesundheitspolitik zu ändern oder zu reformieren. Das soziale Modell der Behinderung hingegen betrachtet Behinderung hauptsächlich als ein gesellschaftlich verursachtes Problem und im Wesentlichen als eine Frage der vollen Integration Betroffener in die Gesellschaft. Hierbei ist ›Behinderung‹ kein Merkmal einer Person, sondern ein komplexes Geflecht von Bedingungen von den viele vom gesellschaftlichen Umfeld geschaffen werden. Daher fordert die Handhabung dieses Problems soziales Handeln, und es gehört zu der gemeinschaftlichen Verantwortung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, die Umwelt so zu gestalten, wie es für eine volle Partizipation an allen Bereichen des sozialen Lebens der Menschen mit Behinderun- 4 Dieser grundlegende Unterschied zeigt sich im Übrigen auch auf der sprachlichen Ebene. Während in der ICIDH mit ›disability‹ die Dimension der Fähigkeitsstörung begrifflich gefasst wurde, wird der Begriff ›disability‹ in der ICF als Oberbegriff zur Bezeichnung des Gesamtzusammenhangs der negativen Wechselwirkung zwischen einer Person mit einem Gesundheitsproblem und ihren Kontextfaktoren benutzt. Während der Behinderungsbegriff also zuvor nur eine Ebene innerhalb des Mehrebenenmodells der ICIDH bezeichnete, umfasst er nunmehr das Ganze der Behinderungssituation. 7 gen erforderlich ist. Das zentrale Thema ist daher ein einstellungsbezogenes und weltanschauliches, welches soziale Veränderungen erfordert. Vom politischen Standpunkt aus gesehen wird das Problem zu einer Frage der Menschenrechte. Für dieses Modell ist Behinderung ein politisches Thema.« (vgl. DIMDI 2004, 25) Um diese beiden gegensätzlichen Perspektiven zu integrieren, verwendet die WHO in der ICF einen ›erheblich erweiterten‹ ›bio-psycho-sozialen‹ Ansatz. Damit versucht sie »eine Synthese zu erreichen, die eine kohärente Sicht der verschiedenen Perspektiven von Gesundheit auf biologischer, individueller und sozialer Ebene ermöglicht« (ebd.). Die Auffassung, dass Funktionsfähigkeit und Behinderung eines Menschen eine dynamische Interaktion zwischen dem Gesundheitsproblem (Krankheiten; Gesundheitsstörungen, Verletzungen, Traumata usw.) und den Kontextfaktoren darstellen, verdeutlicht auch die grafische Darstellung der einzelnen interagierenden Komponenten (vgl. Abb. 2). Wie die Grafik veranschaulicht, werden die von der ICF bezüglich menschlicher Funktionsfähigkeit und ihrer Beeinträchtigungen gelieferten Beschreibungen in zwei Teile gegliedert: der erste Teil befasst sich mit Funktionsfähigkeit und Behinderung und den Komponenten des Körpers, der Aktivitäten und der Partizipation, der zweite Teil mit den beiden Komponenten (Umweltfaktoren, personenbezogene Faktoren) der Kontextfaktoren. Die personenbezogenen Faktoren sind allerdings in der ICF »wegen der mit ihnen einhergehenden großen sozialen und kulturellen Streuung nicht in der ICF klassifiziert« (a.a.O., 14). Das bio-psycho-soziale Modell der ICF – Schaubild Gesundheitsproblem (Gesundheitsstörung oder Krankheit, ICD) Körperfunktionen und -strukturen Aktivitäten Umweltfaktoren Partizipation Personbezogene Faktoren Abb. 2: Das bio-psycho-soziale Model der ICF (2001) der WHO 8 Personenbezogene Faktoren stellen den individuellen Hintergrund des Lebens einer Person dar. Diese setzen sich nach Angaben der ICF aus Attributen oder Eigenschaften der Person zusammen, die nicht Teil ihrer körperlichen, geistigen und seelischen Verfassung oder ihres funktionalen Zustandes sind. Als solche kommen Alter, Geschlecht, Bildung, Ausbildung, Erfahrung, Persönlichkeit und Charakter, Fitness, Lebensstil, Gewohnheiten, Erziehung, Bewältigungsstile, sozialer Hintergrund, Beruf sowie vergangene oder gegenwärtige Erlebnisse in Frage. In diesem Zusammenhang gilt es noch einmal herauszustellen, dass die Komponenten der Funktionsfähigkeit und Behinderung in zweifacher Weise betrachtet werden können: »Zum einen können sie verwendet werden, um Probleme aufzuzeigen (z. B. Schädigungen, Beeinträchtigungen der Aktivität oder Beeinträchtigungen der Teilhabe, zusammengefasst unter dem Oberbegriff Behinderung). Zum anderen können sie verwendet werden, um nicht-problematische (z. B. neutrale) Aspekte des Gesundheitszustandes und der mit Gesundheit zusammenhängenden Zustände aufzuzeigen (zusammengefasst unter dem Oberbegriff Funktionsfähigkeit).« (ebd.) Als ein zweiter grundlegender Unterschied zwischen ICIDH und ICF lässt sich daher festhalten, dass sich die ICIDH mit der ICF von einer Klassifikation der ›Krankheitsfolgen‹ hin zu einer Klassifikation der ›Komponenten der Gesundheit‹ weiterentwickelt hat: »›Komponenten der Gesundheit‹ kennzeichnen Bestandteile der Gesundheit, während ›Folgen‹ den Blick auf die Auswirkungen von Krankheiten oder anderen Gesundheitsproblemen lenkt, welche aus diesen als Ergebnis folgen können. Insofern nimmt die ICF nimmt bezüglich der Ätiologie eine unabhängige Position ein, sodass Forscher mit Hilfe geeigneter wissenschaftlicher Methoden kausale Schlüsse ziehen können. Darüber hinaus unterscheidet sich dieses Konzept auch von Modellen der ›Determinanten der Gesundheit‹ oder der ›Risikofaktoren‹. Um jedoch das Studium dieser Determinanten oder Risikofaktoren zu erleichtern, enthält die ICF eine Liste von Umweltfaktoren, die den Lebenshintergrund von Menschen beschreiben.« (DIMDI 2004, 10) Nach dem bisher Ausgeführten lassen sich also folgende Verbesserungen der ICF gegenüber der ICIDH festhalten: Das Krankheitsfolgenmodell von Wood, das der ICIDH von 1980 zu Grunde gelegt wurde, war als multidimensionales Modell hilfreich, um Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und soziale Beeinträchtigungen als Dimensionen oder Ebenen einer Behinderung zu unterscheiden. Damit wurde eine ausschließlich an negativ attribuierten Persönlichkeitsmerkmalen (ätiologischen Schädi9 gungsklassen) orientierte, eindimensionale biomedizinische Klassifikation überwunden (vgl. auch van Bennekom/Jelles/Lankhorst 2001). Der Nachteil des ansatzweise bio-psycho-sozial angelegten Krankheitsfolgenmodells von Wood ist: – die Vorstellung einer kausal-linearen Verknüpfung von Krankheit, Unfall oder angeborenem Leiden mit Schädigung, Fähigkeitsstörung und sozialer Beeinträchtigung; – die Vorstellung einer unidirektionalen Entwicklung von einer Krankheit usw. zu einer Schädigung, einer Schädigung zu einer Fähigkeitsstörung, einer Fähigkeitsstörung zu einer sozialen Beeinträchtigung, oder aber auch von einer Schädigung zu einer sozialen Beeinträchtigung; – die Vernachlässigung der aktiven Rolle (›behindert werden‹) der sozialen und natürlichen Umwelt bei der Entwicklung des Behinderungszustandes und -prozesses. Der Vorteil des erweiterten bio-psycho-sozialen Modells der ICF besteht demgegenüber darin, dass Funktionsfähigkeit und Behinderung als Ergebnis einer dynamischen Interaktion zwischen dem Gesundheitsproblem einerseits und den Kontextfaktoren andererseits angesehen werden. Das bedeutet, dass – die Vorstellung einer kausal-linearen Verknüpfung der Dimensionen durch die Vorstellung einer relationalen Beziehung von persönlichen Dimensionen (Körperfunktionen und strukturen, Aktivität), Person-Umwelt-Dimension (Partizipation an Lebensbereichen) und Kontextfaktoren ersetzt wird; – die dynamische Interaktion innerhalb der drei Dimensionen bidirektional aufgefasst wird, was bedeutet, dass Partizipationsprobleme oder Aktivitätsstörungen auch Schäden und Gesundheitsprobleme nach sich ziehen können; – die Kontextfaktoren bei der Analyse eines Behinderungszustandes oder -prozesses eine aktive Rolle spielen, weil nun anerkannt wird, dass die gesundheitlichen Probleme einer Person durch günstige oder ungünstige Kontextbedingungen in ihren behindernden Auswirkungen verstärkt oder abgeschwächt werden können. Insbesondere die Einbeziehung von Umweltweltfaktoren als ›äußeren Einflussfaktoren‹ war ja von Kritikern der ICIDH immer wieder gefordert worden. Die Einteilung der Umweltfaktoren in der entsprechenden ICF-Klassifikation bezieht sich auf zwei Ebenen: 1. Die Ebene des Individuums: Hierunter fällt die unmittelbare, persönliche Umwelt eines Menschen einschließlich des häuslichen Bereichs, des Arbeitsplatzes und der Schule. Diese Ebene des Individuums umfasst auch die physikalischen und materiellen Gegebenheiten der Umwelt, denen sich einen Person gegenübersieht, sowie den persönlichen Kontakt zu anderen wie zu Familie, Bekannten, Seinesgleichen (Peers) und Fremden. 10 2. Die Ebene der Gesellschaft: Hierunter fallen die formellen und informellen sozialen Strukturen, Dienste und die übergreifenden Ansätze oder Systeme in der Gesellschaft, die einen Einfluss auf Individuen haben. Diese Ebene umfasst (a) Organisationen und Dienste bezüglich der Arbeitsumwelt, kommunalen Aktivitäten, Behörden und des Kommunikations- und Verkehrswesens sowie informelle soziale Netzwerke und (b) Gesetze, Vorschriften, formelle und informelle regeln, Einstellungen und Weltanschauungen. Wie die personenbezogenen Faktoren sind die Umweltfaktoren ›neutral‹ definiert. Sie können also sowohl positiven als auch negativen Einfluss auf den Zustand der Funktionsfähigkeit ausüben und diesen sowohl verschlechtern als auch verbessern. Als Konstrukte zur Beurteilung dieses Einflusses verwendet die ICF die Begriffe ›Förderfaktoren‹ und ›Barrieren‹. Sie werden folgendermaßen definiert: »Förderfaktoren [›facilitators‹] sind (vorhandene oder fehlende) Faktoren in der Umwelt einer Person, welche die Funktionsfähigkeit verbessern und eine Behinderung reduzieren. Förderfaktoren umfassen insbesondere Aspekte wie die materielle Umwelt, die zugänglich ist, Verfügbarkeit relevanter Hilfstechnologie, positive Einstellungen der Menschen zu Behinderung, sowie Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze, die darauf abzielen, alle Menschen mit Gesundheitsproblemen in alle Lebensbereiche einzubeziehen. Das Fehlen eines Umweltfaktors kann sich ebenfalls günstig auswirken, z.B. das Fehlen von Stigmata oder negativen Einstellungen. Förderfaktoren können die Entwicklung einer Beeinträchtigung der Partizipation … aus einer Schädigung oder Aktivitätseinschränkung verhindern, weil die tatsächliche Leistung einer Person im Hinblick auf eine Handlung trotz eines Problems der Leistungsfähigkeit der Person verbessert wird.« (DIMDI 2004, 145f.) »Barrieren [›barriers‹] sind (vorhandene oder fehlende) Faktoren in der Umwelt einer Person, welche die Funktionsfähigkeit einschränken und Behinderung schaffen. Diese umfassen insbesondere Aspekte wie Unzugänglichkeit der materiellen Umwelt, mangelnde Verfügbarkeit relevanter Hilfstechnologie, negative Einstellungen der Menschen zu Behinderung, sowie Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze, die entweder fehlen oder die verhindern, dass alle Menschen mit Gesundheitsproblemen in alle Lebensbereiche einbezogen werden.« (DIMDI 2004, 146) Durch die Aufnahme der Klassifikation der Umweltfaktoren in die ICF wird nun zum Beispiel auch beschreibbar, dass eine Partizipationsbeeinträchtigung in Form einer sozialen Isolation oder Deprivation unmittelbar zu einem gesundheitlichen Schaden führen kann. Dies veranschaulicht Schuntermann mit einem aufschlussreichen Beispiel aus der internationalen Diskussion über die ICF: 11 »Eine Partizipationsstörung führt zu einem Schaden: Eine ältere Person, die für eine längere Zeit in relativer Isolation gelassen wird (Partizipationsstörung), erleidet einen Mangel an intellektueller Stimulation und sensorischer Aufnahme mit der Folge eines graduellen Verlustes kognitiver Fähigkeiten wie Gedächtnis oder Orientierung (beides Schäden).« (Schuntermann 1999, 352) Außerdem macht es die Abkehr vom Krankheitsfolgenmodell möglich, Behinderungssituationen zu beschreiben, die auf eine Beeinträchtigung in nur einer der drei Dimensionen der Funktionsfähigkeit zurückzuführen sind. Der Geltungsbereich der ICF umfasst sogar die Möglichkeit, dass eine Gesundheitsstörung allein oder ein gesundheitsrelevanter Risikofaktor direkt zu Partizipationsstörungen führen können, ohne dass Schädigungen oder Aktivitätsbeeinträchtigungen vorliegen: »Eine vermutete Schädigung führt zu Partizipationsbeeinträchtigungen, ohne dass eine tatsächliche Schädigung oder eine Aktivitätsbeeinträchtigung vorliegt: Eine Person arbeitet mit AIDS-Patienten: Die Person ist gesund, muss sich aber periodisch einem HIV-Test unterziehen. Bekannte und Freunde dieser Person befürchten jedoch, dass sie sich infiziert. Dies führt zu einschneidenden Problemen der Person in den interpersonellen Interaktionen sowie im Gemeinschafts-, sozialen und staatsbürgerlichen Leben. Ihre Partizipation ist wegen der negativen Einstellungen der Menschen in ihrer Umwelt eingeschränkt« (DIMDI 2004, 169). Ein weiteres Beispiel ist in diesem Zusammenhang eventuell noch aufschlussreicher »Schädigungen, die gegenwärtig nicht in der ICF klassifiziert werden, aber zu Partizipationssproblemen führen: Eine 45-jährige Frau, deren Mutter an Brustkrebs gestorben ist, hat sich vor kurzem freiwillig einer genetischen Untersuchung unterzogen, bei der festgestellt wurde, dass sie den genetischen Code aufweist, der für ein erhöhtes Brustkrebsrisiko verantwortlich gemacht wird. Sie hat weder Probleme in den Körperfunktionen oder -strukturen noch Einschränkungen der Leistungsfähigkeit, aber ihre Versicherungsgesellschaft weigert sich aufgrund ihres erhöhten Brustkrebsrisikos, sie gegen Krankheit zu versichern. Ihre Partizipation an der Domäne ›sich um seine Gesundheit zu kümmern‹ ist wegen der Politik ihrer Versicherungsgesellschaft eingeschränkt.« (ebd.) Solche Wirkungszusammenhänge waren mit der ICIDH ebenfalls nicht darstellbar (vgl. WHO 1995, Schuntermann 1996). Sie zeigen noch einmal mit aller Deutlichkeit, dass die ICF keine Personmerkmale, sondern (Handlungs-)Situationen von Personen (die von Gesundheitsproblemen mittelbar oder unmittelbar betroffen sind) klassifiziert, die je nach Einfluss der Kontextfaktoren tendenziell eher als Behinderung oder als Funktionsfähigkeit beschrieben werden können. Ich möchte deshalb dieser Stelle 12 noch einmal hervorheben, dass die ICF eine defizit- und ressurcenorientierte Klassifikation ist (vgl. z. B. Hollenweger/Lienhard/Milic 1998; Fischer 2000). Dies ist ein dritter grundlegender Unterschied zwischen der ICF und der ICIDH, denn die ICIDH war eine ausschließlich defizitorientierte Klassifikation.5 Die Aufnahme der Kontextfaktoren ist sicherlich der bedeutendste Unterschied zwischen der ICIDH und der ICF. Der Vollständigkeit halber möchte ich deshalb auch noch zeigen, wie sich dies auf diejenigen Fälle auswirkt, bei denen eine Schädigung oder Aktivitätseinschränkung der Person vorliegt und von denen auch die ICIDH ausgegangen war. Dabei muss man sich zunächst einmal vergegenwärtigen, welche Konstrukte in der ICF zur Beurteilung der Körperfunktionen und -strukturen und der Aktivität und Partizipation herangezogen werden. Bei den Körperfunktionen werden in der Regel physiologische und psychologische Veränderungen als Beurteilungskonstrukte herangezogen, bei den Körperstrukturen in der Regel anatomische Veränderungen des Körpers. Ungleich schwieriger verhält es sich mit den Komponenten der Aktivität und der Partizipation, die in ein und derselben Klassifikation klassifiziert werden, weil sie nicht immer trennscharf unterschieden werden können. Als Konstrukte zur Beurteilung von Aktivität und Partizipation verwendet die ICF die Begriffe ›Leistungsfähigkeit‹ und ›Leistung‹. Die ICF definiert diese beiden Begriffe folgendermaßen: »Leistungsfähigkeit [›capacity‹] ist ein Konstrukt, das als Beurtei-lungsmerkmal das höchstmögliche Niveau der Funktionsfähigkeit, das eine Person in einer Domäne der Aktivitäts- und Partizipationsliste zu einem gegebenen Zeitpunkt erreicht, angibt. Die Leistungsfähigkeit wird in einer uniformen oder Standardumwelt gemessen und spiegelt daher das umweltadjustierte Leistungsvermögen wider. (…) Leistung [›performance‹] ist ein Konstrukt, das als Beurteilungsmerkmal angibt, was Personen in ihrer gegenwärtigen, tatsächlichen Umwelt tun, und deshalb den Gesichtspunkt des Einbezogenseins einer Person in Lebensbereiche berücksichtigt.« (DIMDI 2004, 146) Zur Verdeutlichung dieser Konstrukte bietet die ICF im Anhang einige Fallbeispiele: »Eine frühere Schädigung, die zu keinen Einschränkungen der Leistungsfähigkeit führt, aber dennoch Leistungsprobleme verursacht: Eine Person, die sich von einer akuten psychischen Episode erholt hat, aber das Stigma eines ›psychiatrischen Patienten‹ trägt, kann wegen der 5 Das ist unter anderem der Grund, warum die Vereinten Nationen die ICF als eine der sozialen Klassifikationen anerkannt haben. 13 negativen Einstellungen der Menschen in ihrer Umwelt Leistungsprobleme in den Domänen ›Beschäftigung‹ und ›interpersonelle Interaktionen‹ haben. Daher ist Partizipation … der Person an der Beschäftigung und am sozialen Leben eingeschränkt.« (DIMDI 2004, 168) Ebenso aufschlussreich ist das folgende Beispiel: »Unterschiedliche Schädigungen und Einschränkungen der Leistungsfähigkeit, die zu ähnlichen Leistungsproblemen führen: Eine Person wird vielleicht wegen des Ausmaßes ihrer Schädigung (Tetraplegie) auf einen Arbeitsplatz nicht eingestellt, weil sie einige Arbeitsanforderungen nicht durchführen kann (z.B. die Tastatur eines Computers bedienen). Der Arbeitsplatz hat nicht die notwendigen Anpassungen, um der Person die Erfüllung dieser Anforderungen zu ermöglichen (z.B. Spracherkennungs-Software, welche die Tastatur ersetzt). Eine andere Person mit einer weniger schweren Tetraplegie, welche die notwendigen Arbeitsaufgaben erfüllen kann, wird jedoch vielleicht nicht eingestellt, weil die Quote für die Einstellung von Personen mit Behinderung bereits erfüllt ist. Eine dritte Person, die fähig ist, die geforderten Arbeitsaktivitäten durchzuführen, wird vielleicht nicht eingestellt, weil sie eine Aktivitätseinschränkung hat, die zwar durch die Benutzung eines Rollstuhls gemildert wird, der Arbeitsort jedoch für einen Rollstuhl nicht zugänglich ist. Eine Person schließlich, die einen Rollstuhl benutzt, wird vielleicht für die Stelle eingestellt. Sie ist leistungsfähig, die Arbeitsaufgaben zu erfüllen, und führt diese auch in der gegebenen Arbeitsumwelt aus. Trotzdem hat diese Person vielleicht noch Leistungsprobleme in den Domänen der interpersonellen Interaktionen mit Mitarbeitern, weil für sie der Zugang zu Aufenthaltsräumen für die Pausen nicht möglich ist. Dieses Leistungsproblem beim geselligen Beisammensein am Arbeitsplatz kann den Zugang zu Gelegenheiten, im Beruf aufzusteigen, verbauen. Die vier Personen erfahren Leistungsprobleme in der Domäne ›Beschäftigung‹ wegen unterschiedlicher Umweltfaktoren, die mit ihren Gesundheitsproblemen bzw. Schädigungen wechselwirken. Bei der ersten Person bilden nicht vorhandene Anpassungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz und möglicherweise negative Einstellungen die Umweltbarrieren. Die zweite Person ist mit negativen Einstellungen im Hinblick auf die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen konfrontiert. Die dritte Person sieht sich der mangelnden Zugänglichkeit der baulichen Gegebenheiten gegenüber und die letzte Person ist mit negativen Einstellungen gegenüber Behinderungen im allgemeinen konfrontiert.« (ebd.) 14 Die Bedeutung der ICF für die Entwicklung eines neuen Verständnisses von Rehabilitation Die WHO trägt mit der ICF zweifellos dem Sachverhalt Rechnung, dass das Behinderungsproblem in Deutschland und anderen Ländern mit einem hoch entwickelten Gesundheitssystem sowie hohen Hygiene- und Ernährungsstandards in erster Linie ein soziales Exklusionsproblem darstellt. Der zentrale Ansatzpunkt der ICF ist also das Partizipationskonzept (vgl. Schuntermann 1999). Damit wird nachhaltig anerkannt, dass die erschwerte Partizipation am Leben der Gesellschaft die ›eigentliche Behinderung‹ (vgl. Metzler/Wacker 2001) darstellt und zum zentralen Ansatzpunkt der rehabilitativen Hilfen werden muss. Diese Auffassung vertritt auch Michael Schuntermann, der deutsche ICF-Koordinator vom Verband Deutscher Rentenversicherungsträger. Seiner Auffassung nach hat die ICF für die Rehabilitation und für die Gesundheits- und Sozialpolitik folgende Bedeutung: »1. Die Wiederherstellung oder wesentliche Besserung der Funktionsfähigkeit insbesondere auf den Dimensionen der Aktivitäten und der Partizipation einer Person ist die zentrale Aufgabe der Rehabilitation. Daher ist die ICF für die Rehabilitation bei der Feststellung des Reha-Bedarfs, bei der funktionalen Diagnostik, bei der Interventionsplanung und bei der Evaluation rehabilitativer Maßnahmen unverzichtbar. 2. Der Abbau von Hemmnissen in der Gesellschaft und physikalischen Umwelt, die die Partizipation erschweren oder unmöglich machen, und der Ausbau von Schutzfaktoren und Erleichterungen, die die Partizipation trotz erheblicher gesundheitlicher Beeinträchtigungen wiederherstellen oder unterstützen, sind wichtige Aufgaben der Gesundheits- und Sozialpolitik sowie der Behinderten- und Menschenrechtspolitik.« (2000, 1) Schuntermann beschreibt daher den Gegenstand der Rehabilitation unter Verwendung der neuen Klassifikation und in Anlehnung an die bisherige WHO-Definition der Rehabilitation wie folgt: »Rehabilitation umfasst alle Maßnahmen, die das Ziel haben, die negativen Wirkungen jener Bedingungen abzuschwächen, die zu Aktivitätsstörungen oder Partizipationsstörungen führen, und die hilfreich oder notwendig sind, um Personen mit Aktivitäts- und Partizipationsstörungen zu befähigen, soziale Integration zu erreichen. Rehabilitation zielt nicht nur darauf, Personen mit Aktivitäts- und Partizipationsstörungen die Anpassung ihres Lebens an ihre Umwelt zu ermöglichen, sondern auch auf Intervention und Vermittlung innerhalb ihrer unmit- 15 telbaren Umwelt sowie innerhalb der Gesellschaft insgesamt, um ihre soziale Integration zu erleichtern.« (Schuntermann 1999, 353) Es ist allerdings zu Recht kritisiert worden, dass die Bedeutung der Partizipationskonzepts dadurch geschwächt wird, dass die Komponenten der Aktivität und der Partizipation in einer Klassifikation zusammengefasst sind und durch zwei schwer voneinander abgrenzbare individuumbezogene Beurteilungsmerkmale – nämlich Leistungsfähigkeit und Leistung - beurteilt werden sollen (vgl. Hirschberg 2003). Dies mag zwar praktischen Erwägungen genügen, hält jedoch einer handlungstheoretischen Analyse nicht stand (vgl. Nordenfeldt 2003). Die zu geringe Beachtung der sozialen Dimension zeigt sich auch an der stärkeren Gewichtung der Körperfunktionen und -strukturen, die Schädigungen, die in der ICF zwei eigenständige Klassifikationen mit je 8 Kapitel umfassen, während die Klassifikation der Umweltfaktoren nur 5 Kapitel umfasst. Das medizinische Modell und die Defizitorientierung haben also in der ICF zumindest noch ein quantitatives Übergewicht, was vor allem damit zu tun haben dürfte, dass die ICF als Komplementärklassifikation zur ICD-10 konzipiert wurde. Eine stärkere Gewichtung der Umweltfaktoren und des sozialen Modells ist allerdings nicht nur wegen der quantitativen Ausgewogenheit zu fordern, sondern schon allein deshalb, weil die Umweltfaktoren im Gegensatz zu den meisten Schädigungen und Aktivitätsbeeinträchtigungen veränderbar sind. Stellt man sich die Frage, welche Schlüsse aus diesem veränderten Rehabilitationsverständnis für das Hilfesystem zu ziehen sind, dann wird man zuallererst zu der Forderung gelangen, eine stärkere ›Ambulantisierung‹ des Rehabilitationssystem herbeizuführen (vgl. Zuber/Weis/Koch 1998; von Kardorff 2001). Dies liegt im Trend der letzten Jahre, in denen nicht nur im Bereich der Frührehabilitation und der sog. ›schulisch-pädagogischen‹ Rehabilitation, sondern auch im Bereich der medizinischen und beruflichen Rehabilitation modellhafte Ansätze zu einer wohnortnahen ambulanten Versorgung zu verzeichnen waren. Wie die ›Deutsche Vereinigung für die Rehabilitation Behinderter e. V.‹ in ihren Vorschlägen (vgl. 1999) zur Etablierung einer qualifizierten wohnortnahen Rehabilitation betont, kann die ambulante Rehabilitation durch ihre Nähe zum Wohnumfeld und zum Arbeitsplatz den ›wünschenswerten Alltagsbezug‹ der Rehabilitation herstellen. Eingliederungshemmnisse im beruflichen und vor allem im sozialen Umfeld werden so schon während der Rehabilitation evident, und es können frühzeitig zielgerichtete Maßnahmen wie z. B. eine stufen16 weise Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess eingeleitet werden. Außerdem wird die Möglichkeit der Nutzung eingliederungsfördernder sozialer Ressourcen eines vorhandenen sekundären ambulanten sozialen Netzwerks von Hilfen (z. B. Sozialstationen, Berufsintegrationsfachdienste) und der Rückhalt und die soziale Unterstützung des primären sozialen Netzes (z. B. Familie, Angehörige, Partner) hervorgehoben. Mit dieser ›Ambulantisierung‹, die sich auf der makrostrukturellen Ebene als Regionalisierung und Deinstitutionalisierung der rehabilitativen Hilfen darstellt, sollte aber auch eine Umorientierung hinsichtlich der personenbezogenen Kontextfaktoren und insbesondere bezüglich der psychischen personalen Ressourcen als bedeutendstem Rehabilitationspotenzial der Betroffenen einhergehen. Zwar haben Badura und Gross (vgl. 1977) schon in den 70-er Jahren des 20. Jahrhunderts darauf hingewiesen, dass bei personenbezogenen sozialen Dienstleistungen bessere und vor allem auch dauerhaftere Erfolge erzielt werden können, wenn sie den Eigenbeitrag und die aktive Mitarbeit des Dienstleistungsempfängers einbeziehen und nicht zu seiner Passivierung beitragen. Obwohl diese These der Dienstleistungsökonomie durch die Stressforschung und die Forschungen zur sozialen Unterstützung in den 80-er Jahren bestätigt wurde (vgl. z. B. Badura 1981; Hurrelmann 1988; von Ferber 1988), ist es zu einem entsprechenden Wandel der Leitbilder in der Rehabilitation bislang nicht gekommen (Badura 1996). Leider darf man sich diesbezüglich auch von der ICF keine entscheidende Verbesserung erwarten, denn die personenbezogenen Kontextfaktoren wurden ja bekanntlich wegen der großen sozialen und kulturellen Streuung nicht klassifiziert. Die ICF könnte also sehr wahrscheinlich noch innovativer wirken und auch für die Rehabilitationspsychologie noch attraktiver werden, wenn sie auch die personenbezogenen Kontextfaktoren näher definieren und klassifizieren würde. Zwar geht sie davon aus, dass auch personenbezogene Faktoren Einfluss auf Funktionsfähigkeit und Behinderung nehmen und dabei mit den Umweltfaktoren interagieren; auf modellhafte Konstrukte zur Erklärung und Beschreibung dieser Faktoren, die von verschiedenen wissenschaftlichen (Teil-)Disziplinen wie z. B. der Sozialepidemiologie, der Sozialisationstheorie, der Gemeinde- und der Gesundheitspsychologie herausgearbeitet wurden, lässt sie sich aber nicht ein. Dabei liegen seit längerer Zeit Erkenntnisse aus der Krankheits- und Behinderungsbewältigungsforschung vor, die darüber Auskunft geben, wie durch den Patienten oder Rehabilitanden als Mitprodu17 zenten die Wirksamkeit und Effizienz der Rehabilitation erhöht werden kann (vgl. z. B. Badura 1996; Zuber/Weis/Koch 1998; Gerber/von Stünzner 1999). Chronischen Krankheit und Behinderung werden hier als kritische Lebensereignisse begriffen, deren Erleben und deren Bewältigung eben nicht nur von den sozialen, sondern auch von den persönlichen Voraussetzungen der Betroffenen abhängen. Dabei ist die subjektive Wahrnehmung, Deutung und Bewertung von Krankheit und Behinderung von zentraler Bedeutung. Sie steht in ebenso engem Zusammenhang mit der Biographie und den biografisch generierten Bewältigungsstrategien der Betroffenen, wie mit den aus der sozialen Umwelt bereitgestellten emotionalen und praktischen Hilfestellungen und dem Maß an sozialer Integration in ein Netzwerk sozialer Beziehungen, die als wertvoll, hilfreich und erfreulich empfunden werden. In diese Richtung weisen im Übrigen auch die Erfahrungen der professionell unterstützten Selbsthilfegruppenarbeit oder der Elternarbeit in der Frühförderung, die sich in den letzten Jahren zunehmend am gemeindepsychologischen Konzept des ›Empowerment‹ orientiert haben (vgl. z. B. Stark 1996; Theunissen/Plaute 1995, Weiß 2000). Ohne die Einbeziehung der Strategien der Belastungsverarbeitung (Coping) ist jedenfalls eine moderne Rehabilitation nicht mehr denkbar. Da es sich um zeitstabile und relativ situationsunabhängige Persönlichkeitsmerkmale handelt, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen, ließen sich diese personalen Ressourcen auch näher bestimmen. Ich teile daher nicht die positive Einschätzung Ernst von Kardorffs, dass die ICF neben der körperlichen Integrität, der Integrität von Aktivitäten und Leistung und der sozialen Integrität auch die seelische Integrität und das psychische Wohlbefinden gebührend berücksichtigt. Personenbezogene Faktoren bleiben zwar in der ICF nicht unberücksichtigt; sie tauchen aber nur vage als besonderer Hintergrund des Lebens und der Lebensführung auf (vgl. Schuntermann 2002b). Wenn seelisches Gleichgewicht, Motivation und Qualifikation der Rehabilitanden und ihrer Angehörigen von so entscheidender Bedeutung für den Eigenbeitrag zum Erfolg des Rehabilitationsgeschehens sind, wenn die Mobilisierung der personalen Ressourcen von Menschen mit Behinderungen entscheidend zur Effektivität der Rehabilitation beiträgt, dann sollte der personalen Identität und Integrität und der Wiederherstellung der physischen, psychischen und sozialen Selbstregulierungsfähigkeiten geschädigter und in Aktivitäts- und Partizipationssituationen eingeschränkter Personen zukünftig bei allen Rehabilitationsmaßnahmen wesentlich mehr Bedeutung beigemessen werden. 18 Da die ICF hauptsächlich für die bessere Einschätzung des Rehabilitationsbedarfs entwickelt worden ist, sind hier Defizite zu konstatieren, die in der Rehabilitationspraxis zu einer geringeren Gewichtung oder gänzlichen Vernachlässigung der in ihrer Bedeutung gar nicht zu überschätzenden personenbezogenen Einflussfaktoren führen könnte. Die WHO hat die genannten Defizite allerdings während des Revisionsprozesses bereits selbst erkannt und auf die Prioritätenliste für die zukünftigen Entwicklungen der ICF gesetzt. Allerdings betont sie auch, dass sich die Konstrukte Krankheit und Behinderung auf objektivierbare und äußere Merkmale eines Individuums beziehen. Personenbezogene Faktoren und Lebensqualitität stellten demgegenüber subjektive Konstrukte dar. Trotzdem hält die WHO hält folgende zukünftige Arbeiten für die Entwicklung und Anwendung der ICF für notwendig (ausgewählte Aspekte): • die Entwicklung der Komponente der personenbezogenen Faktoren; • das Herstellen von Bezügen zu Konzepten der Lebensqualität und der Messung von subjektivem Wohlbefinden (z.B. zu den WHO-Instrumenten zur Erfassung von gesundheitsbezogener Lebensqualität – WHOQOL); • weitere Forschung zu den Umweltfaktoren, um die notwendige Detailliertheit für die Beschreibung zu bieten (vgl. DIMIDI 2004). Zumindest für die Rehabilitationspsychologie und -pädagogik dürfte die Verringerung oder Beseitigung der angesprochenen Defizite eine Voraussetzung für eine effektive und effiziente Gestaltung des Rehabilitationsprozesses sein (vgl. Lindmeier 2002, 2003). Literatur Badura, B. (Hrsg.): Soziale Unterstützung und chronische Krankheit. Zum Stand sozialepidemiologischer Forschung. Frankfurt am Main 1981 Badura, B.: Systemprobleme der Rehabilitation. In: Schott, Thomas u. a. (Hrsg.): Neue Wege in der Rehabilitation. Von der Versorgung zur Selbstbestimmung chronisch Kranker. Weinheim, München: Juventa 1996, 12-19 Badura, B.; Gross, P.: Sozialpolitik und soziale Dienste. Entwurf einer Theorie personenbezogener Dienstleistungen. In: Ferber, Ch. von; Kaufmann, F. X. (Hrsg.): Soziologie und Sozialpolitik. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 19. Opladen: Westdeutscher Verlag 1977, 361-385 Bennekom, C. A. M. van; Jelles, F.; Lankhorst, G. J.: RAP Reha Aktivitäten Profil. Handbuch und Beschreibung. Bearbeitet und übersetzt von Robb Waanders unter Mitarbeit von Michael Schulz. Mit einem Beitrag von Johann Behrens. Ulm: Univ.-Verl. 2001 Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation: BAR-Positionspapier zur Weiterentwicklung der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation in der 14. Legislaturperiode. In: Rehabilitation 38 (1999), 38-43 Eberwein, H.; Sasse, A. (Hrsg.): Behindert sein oder behindert werden? Neuwied, Berlin: Luchterhand 1998 19 Ferber, Ch. von: Auswirkung und Bewältigung von Behinderung: Soziologische und sozialpolitische Zugangsweisen. In: Koch, U.; Lucius-Hoene, R.; Stegie, R. (Hrsg.): Handbuch der Rehabilitationspsychologie. Berlin u. a.: Springer-Verlag 1988, 74-85 Gerber, U., Stünzner, W. von: Entstehung, Entwicklung und Aufgaben der Gesundheitswissenschaften. In: Hurrelmann, K. (Hrsg.): Gesundheitswissenschaften. Berlin u.a.: Springer 1999, 964 Hirschberg, M.: Die Klassifikationen von Behinderung der WHO. Gutachten, erstellt im Auftrag des Institutes Mensch, Ethik und Wissenschaft (IMEW). Berlin 2003 Hollenweger, J.: Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF): Ein neues Modell von Behinderungen (Teil I). In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik (2003a) 10, 4-8 Hollenweger, J.: Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF): Ein neues Modell von Behinderungen (Teil II). In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik (2003b) 10, 40-46 Hollenweger, J.: Die Relevanz der ICF für die Sonderpädagogik. In: Sonderpädagogische Förderung 50 (2005), 150-168 Hurrelmann, K.: Sozialisation und Gesundheit. Somatische, psychische und soziale Risikofaktoren im Lebenslauf. Weinheim, München: Juventa 1988 Hurst, R.: The International Disability Rights Movement and the ICF. In: Disability and Rehabilitation 25 (2003), 11-12 Kardorff, E. von: Rehabilitation im Alter. Sozial- und rehabilitationswissenschaftliche Perspektiven. In: Jansen, B. et al. (Hrsg.): Soziale Gerontologie. Ein Handbuch für Lehre und Praxis. Weinheim und Basel: Beltz 1999, 579-603 Lindmeier, Ch.: Behinderung - Phänomen oder Faktum. Versuch einer Klärung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1993. Lindmeier, Ch.: Rehabilitation und Bildung – Möglichkeiten und Grenzen der neuen WHOKlassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) Teil I. In: Die neue Sonderschule 47 (2002), 404-421 Lindmeier, Ch.: Rehabilitation und Bildung – Möglichkeiten und Grenzen der neuen WHOKlassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). Teil II. In: Sonderpädagogische Förderung 48 (2003), 3-23 Metzler, H.; Wacker, E.: Behinderung. In: Otto, H.-U.; Thiersch, H. (Hrsg.): Handbuch Sozialarbeit Sozialpädagogik. 2. völlig überarb. Aufl. Neuwied, Kriftel: Luchterhand 2001, 118-139 Nordenfeldt, L.: Action theory, disability and ICF. In: Disability an Rehabilitation 25 (2003), 10751079 Schuntermann, M. F.: Die internationale Klassifikation der Schäden, funktionellen Einschränkungen und sozialen Beeinträchtigungen. Konzept und Anwendungsmöglichkeiten. In: Siek, K. u. a. (Hrsg.): Erfolgsbeurteilung in der Rehabilitation: Begründungen, Möglichkeiten, Erfahrungen. Arbeitstagung der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation Behinderter e. V. vom 10. bis 12. November 1993 in Potsdam.. Ulm: Univ.-Verl. Ulm 1994, 53-74 Schuntermann, M. F. Die internationale Klassifikation der Impairments, Disabilities und Handicaps ICIDH – Ergebnisse und Probleme. In: Rehabilitation 35 (1996), 6-13 Schuntermann, M. F.: Behinderung und Rehabilitation: Die Konzepte der WHO und des deutschen Sozialrechts. In: Die neue Sonderschule 44 (1999), 342-363 Schuntermann, M. .: Stand des Revisionsprozesses der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit und Behinderung (ICF) – Was gibt es Neues? In: Deutsche Vereinigung für Rehabilitation e. V. (DVfR); Rische, H.; Blumenthal, W. (Hrsg.): Selbstbestimmung in der Rehabilitation: Chancen und Grenzen. Tagungsbericht zum 33. Kongress der DVfR vom 13. Bis 15. Oktober 1999 in Berlin. Ulm: Univ.-Verl. 2000, 152-154 Schuntermann, M. F.: Behinderung nach ICF und SGB IX – Erläuterungen und Vergleich. 2002 a. URL: www.vdr.de (Stand: 4/2002) Schuntermann, M. F.: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Einführung und Kurzfassung der ICF. März 2002. 2002b. URL: www.vdr.de (Stand: 4/2002) 20 Standard Rules. Rahmenbestimmungen für die Herstellung der Chancengleichheit für Behinderte. Hrsg. v. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung. URL: www.infothek.paritaet.org Stark, W.: Empowerment. Neue Handlungskompetenz in der psychosozialen Praxis. Freiburg i. Br.: Lambertus 1996 Theunissen, G.; Plaute, W.: Empowerment und Heilpädagogik. Freiburg i. Br.: Lambertus 1995 Weiß, H.: Empowerment in der Heilpädagogik und speziell in der Frühförderung – ein neues Schlagwort oder eine handlungsleitende Idee? In: Rische, H.; Blumenthal, W. (Hrsg.): Selbstbestimmung in der Rehabilitation: Chancen und Grenzen. Ulm: Univ.-Verl. 2000, 93-102 World Health Oranization, Geneva (Hrsg.); Matthesius, Rolf-Gerd (Übers.): Die ICIDH; Intenationale Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen. Berlin, Wiesbaden: Ullstein 1995 World Health Organization: ICF – International Classification of Functioning, Disability and health. Genf 2001a World Health Organization, Geneva: ICF – International Classification of Functioning, Disability and health. Short version. Genf 2001b World Health Organization, Geneva: ICF – International Classification of Functioning, Disability and health. Multilingual CD ROM. Genf 2001c Zuber, Johannes; Weis, Joachim; Koch, Uwe: Psychologische Aspekte der Rehabilitation. In: Baumann, U.; Perrez, M. (Hrsg.): Lehrbuch Klinische Psychologie – Psychotherapie. 2., vollst. überarb. Aufl. Bern u. a.: Huber 1998, 485-506 21