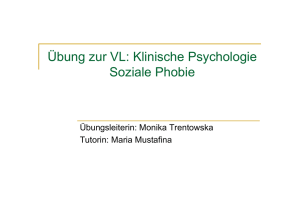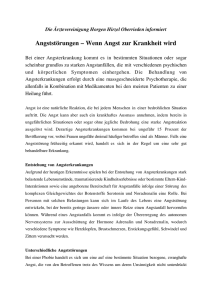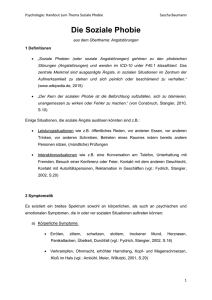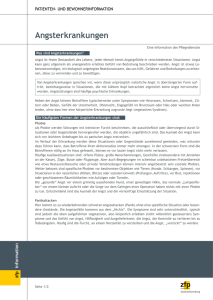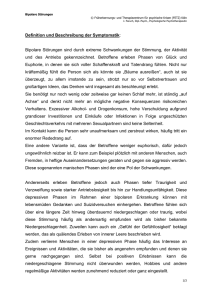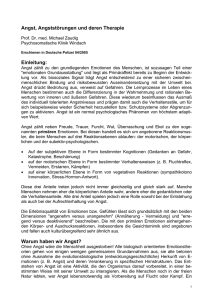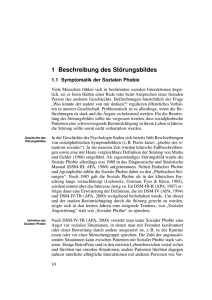Früherkennung und Unterstützung von
Werbung
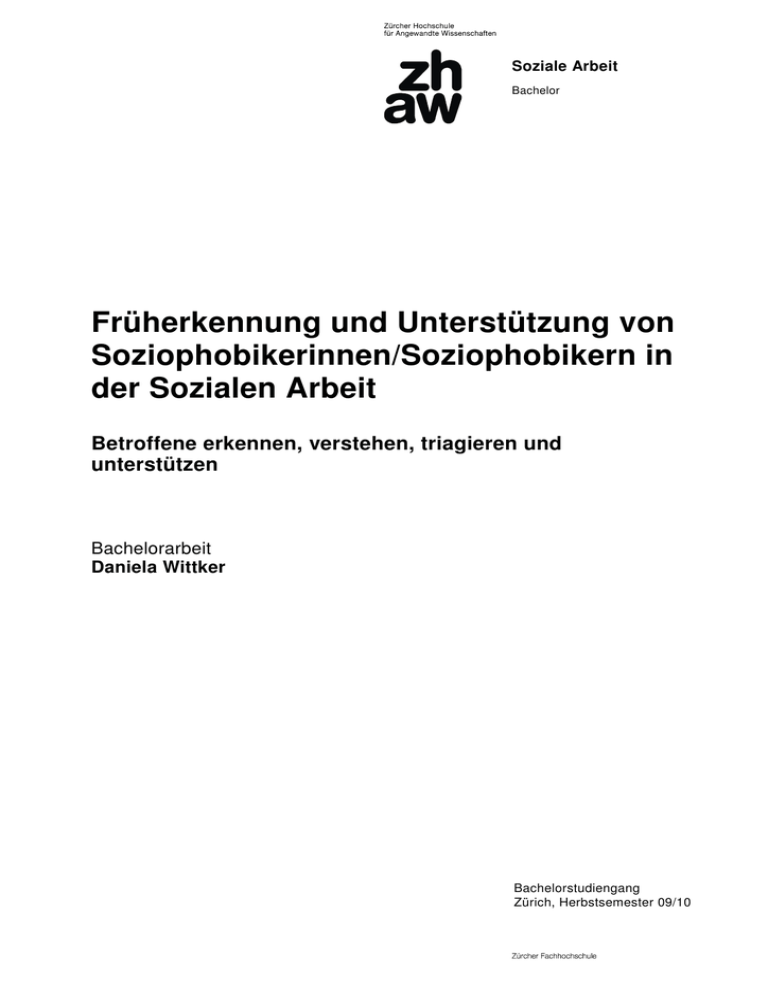
Soziale Arbeit Bachelor Früherkennung und Unterstützung von Soziophobikerinnen/Soziophobikern in der Sozialen Arbeit Betroffene erkennen, verstehen, triagieren und unterstützen Bachelorarbeit Daniela Wittker Bachelorstudiengang Zürich, Herbstsemester 09/10 ABSTRACT In der Schweiz erkranken 7 von 100 Menschen im Verlaufe ihres Lebens an der Sozialen Phobie. Die Betroffenen haben übermässige Angst in zwischenmenschlichen Situationen, in denen sie mit unbekannten Personen konfrontiert oder von anderen Personen beurteilt werden könnten. Sie befürchten, ein Verhalten (oder Angstsymptome) zu zeigen, das demütigend oder peinlich sein könnte. Da psychische Krankheiten wie die Soziale Phobie Ursache oder Folge von sozialen Problemen (dem zentralen Gegenstandsbereich der Sozialen Arbeit) sein können, stellen sie einen Problembereich der Sozialen Arbeit dar. Ziel dieser Arbeit ist es, Sozialarbeitende zu befähigen, dass sie Soziophobikerinnen/Soziophobiker erkennen, verstehen, triagieren und unterstützen können. In dieser Bachelorarbeit wird zunächst grundlegendes Wissen zur Störung vermittelt. Anschliessend werden deren psychosoziale Auswirkungen sowie verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene und Angehörige erläutert. Das Vorstellen der systemischen Denkfigur, eines Instruments zur Problem- und Ressourcenanalyse in der Sozialen Arbeit, sowie Hinweise für den Umgang mit Betroffenen runden den Hauptteil ab. Die aus diesen Ausführungen ersichtliche Tatsache, dass die Soziale Phobie in der Regel chronisch verläuft und mit einem grossen Leidensdruck und deutlichen psychosozialen Einschränkungen einhergeht, weist auf die Wichtigkeit einer frühzeitigen Erkennung der Störung hin. Sind Sozialarbeitende über die Soziale Phobie informiert, bemerken sie möglicherweise in einem Prozess der Problem- und Ressourcenanalyse mittels systemischer Denkfigur Hinweise auf das Vorliegen der Störung. Anhand bestimmter Fragen können sie dann eruieren, ob ein differenzierter Abklärungsbedarf besteht. Ist ein solcher angezeigt, bildet eine sorgfältige Abklärung durch eine Psychiaterin/einen Psychiater oder eine Psychologin/einen Psychologen die Grundlage für die Behandlungsplanung. Basierend auf der vorgängigen Problemanalyse sollen Sozialarbeitende interne und externe Ressourcen von Soziophobikerinnen/Soziophobikern erkennen, aktivieren und einsetzen, um soziale Beziehungen zu ermöglichen, zu erhalten oder zu verbessern. Das Erkennen der Sozialen Phobie und das Vermitteln von Unterstützung sind erste, ganz entscheidende Schritte in Richtung Gesundheit, Wohlbefinden sowie sozialer und beruflicher Integration der Betroffenen. 2 VORWORT Innerhalb dreier Monate sind mir drei Zeitungsartikel aufgefallen, die sich mit der Sozialen Phobie oder Angststörungen im Allgemeinen auseinandergesetzt haben. Die darin enthaltenen Schilderungen von Betroffenen haben mich berührt und liessen es zu, den durch die Angststörungen entstandenen Leidensdruck und die Einschränkungen im Alltag nachzuempfinden. Da die Soziale Phobie verbreiteter ist als ich zuvor angenommen hatte und gravierende psychosoziale Auswirkungen haben kann, erkannte ich die Relevanz des Themas für die Soziale Arbeit. Deshalb entschied ich, mich in meiner Bachelorarbeit eingehend damit zu befassen. Das Ergebnis aus den intensiven aber auch bereichernden Wochen, in denen ich mich mit der Sozialen Phobie beschäftigt habe, liegt nun vor. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei den Menschen bedanken, die mich in verschiedener Form unterstützt haben, insbesondere bei: • meiner Familie, für das Durchlesen und die anderweitige Unterstützung • Lara Elia, für ihre fachliche und persönliche Unterstützung • Martina Feer und ihrer Familie, die mir einen kreativen Raum zur Verfügung stellten • Gabrielle Marti, für die fachlichen Inputs und die angenehme Art und Weise der Begleitung. Ein grosses Dankeschön gilt auch dem weiteren Familienkreis und all meinen Freunden, die mich motivierten, unterstützten und mir auch immer wieder Gelegenheiten gaben abzuschalten, sodass ich Kraft für das Weiterschreiben tanken konnte. Nun wünsche ich viel Spass und viele Anregungen beim Durchlesen meiner Bachelorarbeit. 3 INHALTSVERZEICHNIS I EINLEITUNG.................................................................................................. 7 1. Einleitung.......................................................................................................... 7 1.1 Problemstellung und Fragestellung.......................................................................................... 7 1.2 Aufbau der Arbeit .................................................................................................................... 8 II HAUPTTEIL.................................................................................................. 10 2. Soziale Phobie................................................................................................. 10 2.1 Einordnung der Sozialen Phobie in den Klassifikationssystemen DSM-IV und ICD-10...... 10 2.2 Definitionen der Sozialen Phobie .......................................................................................... 11 2.3 2.3.1 2.3.2 Diagnostik der Sozialen Phobie nach dem DSM-IV und der ICD-10 ................................... 12 Differentialdiagnostik ............................................................................................................ 14 Soziale Phobie und Schüchternheit........................................................................................ 16 2.4 Komorbidität.......................................................................................................................... 18 2.5 Epidemiologie........................................................................................................................ 20 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 Ätiopathogenese..................................................................................................................... 21 Das biopsychosoziale Modell ................................................................................................ 22 Biologische Ansätze............................................................................................................... 23 Psychologische Ansätze......................................................................................................... 25 Soziale Ansätze...................................................................................................................... 26 3. Auswirkungen der Sozialen Phobie auf das Leben von Betroffenen........ 29 3.1 Leistungs- und Interaktionssituationen .................................................................................. 29 3.2 Vermeidungsverhalten, Flucht und Verhaltungshemmung.................................................... 29 3.3 Sicherheitsverhalten und sozial inadäquates Verhalten ......................................................... 30 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 Auswirkungen der Sozialen Phobie auf den Alltag ............................................................... 31 Ausbildung/Beruf................................................................................................................... 32 Soziale Beziehungen, Partnerbeziehungen und Isolation ...................................................... 33 Suizidalität ............................................................................................................................. 34 4. Hilfe für Betroffene und Angehörige ........................................................... 35 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 Behandlungsarten der Sozialen Phobie.................................................................................. 36 Psychopharmakotherapie ....................................................................................................... 36 Psychotherapie ....................................................................................................................... 36 Psychosoziale Beratung ......................................................................................................... 37 4.2 4.2.1 4.2.2 Institutionen für die Behandlung der Sozialen Phobie........................................................... 39 Psychiatrisch-Psychologische Versorgung ............................................................................ 39 Psychosoziale Beratung und Hilfe ......................................................................................... 40 4 4.3 Selbsthilfe .............................................................................................................................. 41 4.4 Hilfe für Angehörige.............................................................................................................. 42 5. Soziale Phobie in der Sozialen Arbeit .......................................................... 44 5.1 Berührungspunkte von Sozialer Phobie und Sozialer Arbeit: Soziale Probleme................... 44 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 Die systemische Denkfigur (SDF) ......................................................................................... 46 Grundsätzliches zur SDF ....................................................................................................... 46 Analyse des Individuums ....................................................................................................... 47 Analyse sozialer Systeme beziehungsweise sozialer Beziehungen ....................................... 48 Begründung von Problemen und von problemlösenden Ressourcen..................................... 52 5.3 Der Umgang mit Betroffenen ................................................................................................ 53 III SCHLUSSTEIL.............................................................................................. 56 6. Beantwortung der Fragestellungen und Fazit ............................................ 56 6.1 Was ist die Soziale Phobie? ................................................................................................... 56 6.2 Wie wirkt sich die Soziale Phobie auf das Leben von Betroffenen aus?............................... 58 6.3 Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es für Betroffene und ihre Angehörigen? .......... 59 6.4 Welche Rolle haben Sozialarbeitende im Bezug auf die Thematik und welchen Beitrag können sie für Betroffene leisten? ......................................................................................... 61 6.5 Was können Sozialarbeitende zur Früherkennung und Unterstützung von Soziophobikerinnen und Soziophobikern beitragen? ............................................................ 62 6.6 Fazit ....................................................................................................................................... 65 LITERATURVERZEICHNIS .............................................................................................. 66 Anhang A: Diagnosekriterien der Vermeidend-Selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung ................... 68 Anhang B: Die systemische Denkfigur (Individuum)........................................................................... 69 Anhang C: Aufrechterhaltung der Sozialen Phobie .............................................................................. 70 Anhang D: Die Soziale Phobie erkennen .............................................................................................. 71 Anhang E: Interne Ressourcen erkennen .............................................................................................. 72 Anhang F: Wichtige Adressen .............................................................................................................. 73 5 TABELLEN- UND ABBILDUNGSVERZEICHNIS Tabellenverzeichnis Tabelle 1: Diagnostische Kriterien der Sozialen Phobie nach dem DSM-IV ....................................... 12 Tabelle 2: Diagnostische Kriterien der Sozialen Phobie nach der ICD-10 ........................................... 13 Tabelle 3: Differentialdiagnostische Abgrenzung der Sozialen Phobie................................................ 15 Tabelle 4: Lebenszeitkomorbiditäten von Sozialer Phobie und anderen psychischen Störungen......... 19 Abbildungsverzeichnis Abb. 1: Das Kontinuitätsmodell der Sozialen Phobie ........................................................................... 17 Abb. 2: Das biopsychosoziale Modell................................................................................................... 22 Abb. 3: Das kognitive Modell von Clark und Wells ............................................................................. 25 Abb. 4: Die systemische Denkfigur (Individuum) ................................................................................ 47 Abb. 5: Die Ausstattungsdimensionen der Denkfigur als Austauschmedien........................................ 48 Abb. 6: Die Austauschbeziehung .......................................................................................................... 49 Abb. 7: Die Ausstattungsdimensionen der Denkfigur als Machtquellen .............................................. 50 Abb. 8: Die vertikal strukturierte Beziehung ........................................................................................ 50 6 I EINLEITUNG 1. Einleitung In der Einleitung wird auf die Relevanz der Sozialen Phobie für die Soziale Arbeit hingewiesen und es werden die Fragestellungen sowie der Aufbau dieser Bachelorarbeit vorgestellt. 1.1 Problemstellung und Fragestellung Angst und ihre körperlichen Begleitsymptome wie Herzklopfen, Schwitzen oder Zittern sind jedem Menschen bekannt. Sie ist ein normales Gefühl wie Wut, Freude oder Traurigkeit. Angst hilft, sich risikobewusst mit der Umwelt auseinanderzusetzen und kann in Extremsituationen lebensrettend sein. Sie kann aber auch belastend, behindernd und quälend sein. Wenn die Angst ohne reale Bedrohung auftritt, lange anhält, lähmt, zu Vermeidungsverhalten und ausgeprägter Angst vor der Angst (Erwartungsangst) führt, kann sie einen Menschen in seinem Alltag derart beeinträchtigen, dass sie eine psychische Störung ist. Die Soziale Phobie (SP) ist eine der Angststörungen. Betroffene haben übermässige Angst in zwischenmenschlichen Situationen, in denen sie sich im Mittelpunkt der Bewertung durch Andere erleben. Sie befürchten, negativ bewertet zu werden, sich zu blamieren oder peinlich aufzufallen. Heimberg, Liebowitz, Hope & Schneider (1995; zit. nach Hiemisch, 2000, S. 12) beschreiben die SP als „the least well known of the anxiety disorders and … also the least well unterstood“. Obwohl eine in Zürich durchgeführte Langzeitstudie (Kapitel 2.5) ergab, dass 7 von 100 Menschen im Verlaufe ihres Lebens an SP erkranken, ist diese in unserer Gesellschaft dennoch ziemlich unbekannt. Betroffene leiden oftmals „vor sich hin“, wissen nicht, dass sie eine Störung haben und/oder wo sie Unterstützung bekommen können. Weiter ist es möglich, dass Betroffene aus Scham oder Unsicherheit nicht über ihr Problem sprechen. Wenn die SP unbehandelt bleibt, verläuft sie in der Regel chronisch. Dies hat meist fatale Folgen. Die Betroffenen ziehen sich mehr und mehr zurück, und es besteht die Gefahr, dass sie zusätzlich an anderen psychischen Störungen erkranken oder sogar einen Suizidversuch unternehmen. Damit Betroffene adäquate Unterstützung erhalten und dadurch eine Verschlimmerung ihrer Situation abgewendet werden kann, ist eine frühzeitige Erkennung der SP wichtig. Angesichts der Auftretenshäufigkeit der SP ist die Wahrscheinlichkeit relativ gross, dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter (SA) im Verlaufe ihres Arbeitslebens mit Betroffenen in Kontakt kommen. 7 Ich möchte mit dieser Bachelorarbeit dazu beitragen, dass die SP durch SA möglichst frühzeitig erkannt wird und so Betroffenen lange Leidenswege erspart beziehungsweise diese verkürzt werden. Demnach lautet meine Hauptfragestellung: • Was können Sozialarbeitende zur Früherkennung und Unterstützung von Soziophobikerinnen und Soziophobikern beitragen? Um die Frage beantworten zu können, befasse ich mich mit folgenden Teilfragen: • Was ist die Soziale Phobie? • Wie wirkt sich die Soziale Phobie auf das Leben von Betroffenen aus? • Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es für Betroffene und ihre Angehörigen? • Welche Rolle haben Sozialarbeitende im Bezug auf die Thematik und welchen Beitrag können sie für Betroffene leisten? Diese Arbeit bezieht sich auf Soziophobikerinnen/Soziophobiker im erwerbsfähigen Erwachsenenalter. Eine spezifische Bezugnahme auf Betroffene im Kindesalter und in späteren Lebensphasen sowie Migrantinnen und Migranten ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Ebenfalls nicht eingehen werde ich auf kulturspezifische Ausprägungen der SP. Grundsätzlich können SA aus allen Bereichen der Sozialen Arbeit mit Betroffenen in Kontakt kommen. Meine Arbeit ist hauptsächlich der Früherkennung der SP, der Triage von Betroffenen an Fachpersonen sowie der Triage an Stellen, welche Unterstützung für Betroffene und Angehörige anbieten, gewidmet. Dadurch ist die Arbeit nicht in erster Linie für SA gedacht, die mit Betroffenen arbeiten, die bereits die Diagnose SP haben (beispielsweise im Sozialdienst einer Psychiatrie oder auf einer Wohngruppe für psychisch kranke Menschen). Trotzdem können allenfalls auch SA aus diesen Bereichen mit dieser Arbeit ihr Wissen erweitern und Wichtiges für den Umgang mit betroffenen Menschen lernen. 1.2 Aufbau der Arbeit Nach dieser Einleitung folgt der theoretische Hauptteil (Kapitel 2-5). Im zweiten Kapitel vermittle ich grundlegendes Wissen zur SP, um SA auf die Thematik zu sensibilisieren. Den Grossteil der Informationen beziehe ich aus der Disziplin der Psychologie, werde aber bei der Beschreibung von möglichen Ursachen auch biologische und soziale Faktoren miteinbeziehen. Das darauf folgende Kapitel befasst sich mit typischen Verhaltensweisen von Betroffenen, die diese entwickeln, um mit den Ängsten (bes8 ser) umgehen zu können. Weiter werde ich die gravierenden Auswirkungen der SP auf das Leben von Betroffenen beschreiben. Da die SP relativ weit verbreitet ist, gibt es dementsprechend eine Vielzahl von bereits bestehenden Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene und Angehörige. Eine Auswahl davon stelle ich im vierten Kapitel vor. Den Theorieabteil abrunden werden das Vorstellen der systemischen Denkfigur, ein Instrument zur Problem- und Ressourcenanalyse der Sozialen Arbeit und Hinweise für den Umgang mit Betroffenen. Im Schlussteil greife ich die Haupt- und die Teilfragestellungen dieser Bachelorarbeit wieder auf und beantworte sie mit dem Wissen aus dem Theorieteil. Dies soll SA befähigen, Betroffene zu erkennen, zu verstehen, zu triagieren und zu unterstützen. 9 II HAUPTTEIL 2. Soziale Phobie In diesem Kapitel wird SA grundlegendes Wissen zur SP vermittelt. Es hilft SA und Betroffenen, die Störung zu erkennen und zu verstehen. 2.1 Einordnung der Sozialen Phobie in den Klassifikationssystemen DSM-IV und ICD-10 Im Folgenden wird erläutert, was Klassifikationssysteme sind, welche in der Schweiz gebräuchlich sind und wo darin die SP eingeordnet ist. Psychische Störungen werden in Störungsgruppen, sogenannte Klassen eingeteilt und in ein System eingeordnet (Klassifikationssystem). Klassifikationssysteme dienen in erster Linie dem klaren und effizienten Informationsaustausch zwischen einzelnen Praktikern (beispielsweise Ärztinnen/Ärzten, Psychiaterinnen/Psychiatern) und Forscherinnen/Forschern (Zimbardo & Gerrig, 2004, S. 661). In der Schweiz ist die von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebene International Classification of Diseases (ICD) verbindlich. Diese liegt momentan in der 10. Revision vor (ICD-10, deutsche Ausgabe aus dem Jahr 2004: ICD-10-GM) und enthält nebst den psychischen Störungen in Kapitel F auch körperliche Erkrankungen (Zimbardo & Gerrig, 2004, S. 662). Als Angststörungen im engeren Sinne werden Phobien, darunter fällt auch die SP, und sonstige Angststörungen unterschieden. Phobien sind situativ gebundene Ängste, das heisst, Betroffene haben eine beständige und intensive Angst, wenn sie mit einem bestimmten Auslöser konfrontiert werden. Obwohl die Angst angesichts der tatsächlichen Bedrohung stark übertrieben und unbegründet ist, können Betroffene sie nicht kontrollieren. Phobien führen zu Leidensdruck und gehen mit relevanten Behinderungen in der Lebensführung einher (Angenendt, 2002, S. 119f). Neben der ICD-10 findet in der Schweiz auch das von der American Psychiatric Association entwickelte und herausgegebene Diagnostic and Static Manual of Mental Disorders (DSM) Anwendung. Die vierte, revidierte Version dieses Klassifikationssystems ist unter dem Namen DSM-IV-TR bekannt („TR“ steht für „text revision“), wurde im Jahr 2000 publiziert und enthält über 200 psychische Störungen. Die deutsche Ausgabe trägt denselben Namen und wurde 2003 veröffentlicht. Die SP gehört darin zur Klasse der Angststörungen (Zimbardo & Gerrig, 2004). Im Folgenden wird die Abkürzung DSV-IV verwendet. 10 Die SP ist somit in beiden in der Schweiz anerkannten Klassifikationssystemen ein eigenständiges Störungsbild innerhalb der Klasse der Angststörungen. In der ICD-10 wurde diese Klasse noch aufgeteilt, wonach die SP zu den Phobien gehört. 2.2 Definitionen der Sozialen Phobie Gemäss der Einordnung in der ICD-10 und wie es der Name der Störung sagt, gehört die SP zu den Phobien. Anhand von Definitionen wird nun aufgezeigt, worauf sich die Ängste der Betroffenen beziehen. In der Literatur und im Internet existieren viele verschiedene, teilweise auch unvollständige oder falsche Definitionen der SP. Zwei davon werden nun vorgestellt und kommentiert. Die erste ist auf Wikipedia, einer bekannten freien Enzyklopädie auf dem Internet, aufgeführt: Als Soziale Phobie werden in der Psychopathologie dauerhafte, irrationale starke Angstzustände, die an die Anwesenheit anderer Menschen gebunden sind, bezeichnet (Wikipedia, 2009). Diese Definition ist insofern richtig, als dass sich die Ängste auf andere Menschen beziehen. Allerdings sei bemerkt, dass nicht jede Begegnung mit einer anderen Person bei den Betroffenen Angstzustände auslösen muss. Die SP kann sich auch nur auf eine soziale Situation oder wenige soziale Situationen beziehen. Die folgende Definition von Möller, Laux und Deister (1996) enthält die wesentlichen Aspekte der SP: Die soziale Phobie ist eine anhaltende Angst vor Situationen, in denen die Person im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit anderer steht. Die Angst wird als übertrieben oder unvernünftig empfunden und führt in der Regel zu ausgeprägtem Vermeidungsverhalten (S. 104). Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass Phobien zu Leidensdruck führen und mit relevanten Behinderungen in der Lebensführung einhergehen. Dies trifft auch bei der SP zu. Die Definition der SP von Möller et al. (1996) lässt einen relativ grossen Interpretationsspielraum offen. Demnach würde die Frage, ob eine Person von SP betroffen ist oder nicht, von verschiedenen Fachpersonen unterschiedlich beantwortet werden. Im Folgenden wird erläutert, wie dieses Problem in der Praxis angegangen wird. 11 2.3 Diagnostik der Sozialen Phobie nach dem DSM-IV und der ICD-10 Für die Diagnosestellung der SP sind Psychiaterinnen/Psychiater und Psychologinnen/Psychologen zuständig. Die Klassifikationssysteme enthalten Ein- und Ausschlusskriterien, die für die Diagnose SP erfüllt sein müssen. Die Durchführung von an diesen Diagnosekriterien orientierten Interviews ermöglicht Fachpersonen, Informationen über eine Patientin/einen Patienten gezielt zu sammeln und auszuwerten. Dadurch kommen verschiedene Interviewerinnen/Interviewer dazu, die gleiche Diagnose bei einer Patientin/einem Patienten zu stellen (Mitte, Heidenreich & Stangier, 2007, S. 23). In den Tabellen 1 und 2 sind die Diagnosekriterien des DSM-IV (A-H) und der ICD-10 (A-E) ersichtlich. Tabelle 1: Diagnostische Kriterien der Sozialen Phobie nach dem DSM-IV (Stangier, Heidenreich & Peitz., 2009, S. 11) 12 Tabelle 2: Diagnostische Kriterien der Sozialen Phobie nach der ICD-10 (Stangier et al., 2009, S. 12) Die Kriterien überlappen sich stark, dennoch unterscheiden sie sich in einigen Punkten. In der ICD-10 werden für die Diagnose im B-Kriterium bestimmte körperliche Angstsymptome gefordert, die empirisch nicht gestützt sind. So kritisieren Mitte et al. (2007, S. 11), dass von Anderen sichtbare Symptome (Erröten oder Zittern), die von Betroffenen sehr intensiv wahrgenommen werden können, objektiv oftmals nicht oder nicht dermassen deutlich beobachtbar sind. Weiter sind in der ICD-10 mögliche akustische Symptome (beispielsweise Stottern) nicht erwähnt. Das DSM-IV beschreibt die situativen Aspekte detaillierter und es enthält die Möglichkeit, einen generalisierten Subtyp der SP zu bestimmen. In der Literatur liegen geteilte Meinungen vor, was unter „fast allen sozialen Situationen“ verstanden werden soll (Mitte et al., 2007). In der Praxis wird derzeit eine generalisierte SP diagnostiziert, wenn für eine betroffene Person drei oder mehr Situationen angstbesetzt sind. Die nicht-generalisierte SP beschränkt sich auf 1 bis 2 gefürchtete Situationen, kann aber in die generalisierte Form übergehen (Berghändler, Stieglitz & Vriends, 2007, S. 225). Der Schweregrad der SP wird durch Psychiater/Psychiaterinnen und Psychologinnen/Psychologen mittels Verwendung von Instrumenten zur Selbst- und Fremdbeurteilung erfasst (Mitte et al., 2007, S. 15). Des Weiteren trägt das DSM-IV im Gegensatz zur ICD-10 der Tatsache Rechnung, dass die SP bereits in jungen Jahren auftreten kann. So wurden die Kriterien A-C ergänzt mit spezifischen Hinweisen für Kinder und das Kriterium F gibt vor, dass die Phobie bei Personen unter 18 Jahren mindestens 6 Mo13 nate anhalten muss (Tabelle 1). Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das DSM-IV, da es im Vergleich zu der ICD-10 die situativen Aspekte detaillierter beschreibt und weil die in der ICD-10 geforderten körperlichen Symptome empirisch nicht gestützt sind. Nach dem DSM-IV ist SP die Angst vor einer oder mehreren sozialen oder Leistungssituationen. Diese kann auftreten, wenn die betroffene Person auf Fremde trifft oder der Beurteilung anderer Leute unterstehen könnte. Die Person befürchtet, dass sie in solchen Situationen ein Verhalten oder Angstsymptome zeigt, welches/welche demütigend oder peinlich sein könnte/könnten. Dabei sieht die Betroffene/der Betroffene ein, dass die Angst, die das Ausmass einer Panikattacke einnehmen kann, übertrieben und unvernünftig ist. Wenn die beschriebenen Situationen nicht vermieden werden (können), werden sie meistens nur unter grosser Angst/grossem Unwohlsein überstanden. Das Kriterium E geht auf den grossen Leidensdruck und die psychosozialen Folgen der SP ein, die für die Diagnosestellung vorliegen müssen. Hierbei wird die Beeinträchtigung in Hinblick auf die normale Lebensführung der Person, ihre berufliche oder schulische Leistung oder soziale Aktivitäten oder Beziehungen genannt. Kriterien G und H gehen darauf ein, dass die sozialen Ängste nicht durch andere körperliche oder psychische Störungen erklärt werden können (Tabelle 1). Das DSM-IV gibt also vor, welche Kriterien für die Diagnose SP erfüllt sein müssen. Es besagt aber auch, dass die SP von anderen Störungen abgegrenzt werden muss. 2.3.1 Differentialdiagnostik Mit der Differentialdiagnostik wird die SP von anderen Diagnosen abgegrenzt, die ebenfalls sozialen Rückzug oder Befürchtungen hinsichtlich sozialer Situationen beinhalten. So wird verhindert, dass eine Patientin/ein Patient eine falsche Diagnose erhält (Stieglitz, Freyberger & Mombour, 2002, S. 29f). In der Tabelle 3 sind die für die Differentialdiagnostik der SP zu verschiedenen Störungen relevanten gemeinsamen und unterscheidenden Merkmale ersichtlich. 14 Tabelle 3: Differentialdiagnostische Abgrenzung der Sozialen Phobie (Mitte et al., 2007, S. 20) Besonders die Abgrenzung der SP zu anderen Angststörungen und depressiven Störungen gestaltet sich aufgrund der grossen Ähnlichkeiten und den hohen Komorbiditätsraten schwierig. Wichtigste Unterscheidungsmerkmale und deshalb genau zu explorieren sind die Auslöser der Ängste/Symptome und die Inhalte der zentralen Befürchtungen der Patientinnen und Patienten (Stangier & Fydrich, 2002, S. 23ff). 15 Das folgende Beispiel soll dies verdeutlichen: Sowohl von SP als auch von Depression Betroffene haben ein negatives Selbstbild und ziehen sich sozial zurück. Bei depressiven Personen geschieht dies vor allem aus Antriebs- und Hoffnungslosigkeit. Dadurch sind sie wenig an sozialen Kontakten interessiert. Soziophobische Personen hingegen wünschen sich meistens soziale Kontakte, fürchten oder vermeiden diese aber aus Angst vor Abwertung durch andere Menschen. Wenn sich Personen nur in depressiven Episoden zurückziehen und nach dem Rückgang der Symptome wieder vermehrt soziale Kontakte eingehen (und diese nicht aus Angst vor Abwertung meiden), ist nur die Diagnose Depression, ansonsten zusätzlich die Diagnose SP zu stellen (Mitte et al., 2007, S. 21). Auch die differentialdiagnostische Abgrenzung der SP zur Vermeidend-Selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung (Anhang A) gestaltet sich aufgrund der sich stark überlappenden Diagnosekriterien schwierig. Demnach ergaben verschiedene Studien, dass durchschnittlich 56% der von SP betroffenen Personen gleichzeitig die Diagnosekriterien der Vermeidend-Selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung erfüllten. Bei Personen mit einer generalisierten SP betrug dieser Anteil sogar 90%. Stangier und Fydrich (2002, S. 22f) folgern daraus, dass aufgrund der kleinen qualitativen Unterschiede zwischen SP und Vermeidend-Selbstunsicherer Persönlichkeitsstörung von einem Kontinuum unterschiedlicher Ausprägungsgraden sozialer Angst ausgegangen werden muss. Aufgrund der Ähnlichkeiten und deshalb Verwechselbarkeit der SP mit anderen Störungen ist eine sorgfältige differentialdiagnostische Abklärung durch eine Psychiaterin/einen Psychiater oder eine Psychologin/einen Psychologen unabdingbar. Nur so kann eine adäquate Unterstützung ausgewählt werden. Abschliessend sei bemerkt, dass auch die anderen Störungen mit einem grossen Leidensdruck und/oder psychosozialen Beeinträchtigungen einhergehen und behandelt werden können. 2.3.2 Soziale Phobie und Schüchternheit Wie vorangehend erläutert, weist die SP teilweise grosse Ähnlichkeiten mit anderen Störungen auf und muss von diesen abgegrenzt werden. Auch was sich hinter dem in der Umgangssprache häufig verwendeten Begriff der Schüchternheit verbirgt, weist eine grosse Übereinstimmung mit der SP auf. Nach einer Definition der Schüchternheit und Nennung der Gemeinsamkeiten mit der SP, werden die beiden Begriffe soweit als möglich voneinander abgegrenzt. Nach Zimbardo & Gerrig (2004, S. 612) kann Schüchternheit als Unbehagen und/oder Hemmung in zwischenmenschlichen Situationen definiert werden, was der Verfolgung der eigenen zwischenmenschlichen oder beruflichen Ziele im Weg steht. 16 Das Auftreten von unangenehmen Gefühlen in zwischenmenschlichen Situationen und auch deren behindernde Auswirkungen auf soziale Beziehungen und das Arbeitsleben (teilweise aufgrund des Vermeidungsverhaltens) decken sich mit der Beschreibung der SP. Weitere Gemeinsamkeiten sind nach Beidel und Turner (1999; zit. nach Ambühl, Meier & Willutzki, 2001, S. 23f) eine erhöhte körperliche Erregung und negative Gedanken in sozialen Situationen sowie ein Mangel in der sozialen Kompetenz, wobei letzteres nicht zwingend zutreffen muss. Als Unterschiede nennen Beidel und Turner (1999), dass die SP seltener auftritt, die Störung durchschnittlich später beginnt, häufiger chronisch verläuft sowie eine stärkere funktionale Beeinträchtigung nach sich zieht. Ambühl et al. (2001) kommen in Anbetracht dieses Vergleiches und den grossen Gemeinsamkeiten zwischen Schüchternheit und SP zum Schluss, dass deren Unterschiede eher auf quantitativer denn auf qualitativer Ebene festzumachen [sind], und zwar vor allem im Hinblick auf den Grad der funktionalen Beeinträchtigung und das Ausmass der Vermeidung sozialer Situationen (S.24). Bei der Diagnostik der SP wären demnach im DSM-IV das Kriterium E und in der ICD-10 das Kriterium C für die Abgrenzung von der Schüchternheit entscheidend (Tabellen 1 und 2). In Anbetracht der beschriebenen Tatsachen, dass es schwierig ist, die SP sowohl von der Schüchternheit, als auch von der Vermeidend-Selbstunsicheren Persönlichkeitsstörung abzugrenzen, ist das Kontinuitätsmodell der SP (Abbildung 1) geeignet, um die fliessenden Übergänge der verschiedenen Formen sozialer Ängste zu visualisieren. Abb. 1: Das Kontinuitätsmodell der Sozialen Phobie (Stangier & Fydrich, 2002, S. 23) 17 Da der Übergang fliessend ist, kann man nicht sagen, dass Personen mit der Diagnose SP Hilfe brauchen und dass im Gegensatz dazu Schüchterne „gesund“ sind und deshalb jede Unterstützung falsch wäre. SA können auch schüchternen Menschen helfen, beispielsweise indem sie ihnen Lernfelder wie Rollenspiele anbieten, damit sie durch Erweiterung ihres Verhaltensrepertoires neue Erfahrungen in sozialen Situationen sammeln können. 2.4 Komorbidität Wie im vorangehenden Beispiel anhand der Depression beschrieben, ist es möglich, dass Soziophobikerinnen/Soziophobiker von einer oder mehreren zusätzlichen Störungen betroffen sein können. Dass dies häufig vorkommt und dass das Risiko von SP Betroffenen gross ist, an weiteren Störungen zu erkranken, sollen die nachfolgenden Zahlen verdeutlichen. Im Anschluss werden Ansätze erläutert, die das häufige gleichzeitige Auftreten von SP und anderen Störungen erklären. Lieb und Müller (2002, S. 48-53) verglichen mehrere Studien, die das gleichzeitige Auftreten von SP mit einer oder mehreren anderen psychischen Störungen bei einer Person innerhalb einer definierten Zeitspanne untersuchten (Komorbidität). Die Lebenszeitkomorbiditätsrate der SP gibt den prozentualen Anteil der Soziophobikerinnen und Soziophobiker an, die im Verlaufe ihres Lebens mindestens einmal die Kriterien einer bestimmten anderen psychischen Krankheit erfüllen. Besonders andere Angststörungen, Major Depression (eine schwere depressive Erkrankung) und Substanzstörungen weisen eine hohe Lebenszeitkomorbiditätsrate von SP auf. Für Personen ohne SP ist das Risiko, im Verlaufe ihres Lebens an diesen und auch anderen Störungen zu erkranken, wesentlicher geringer. Die Zahlen in Tabelle 3 verdeutlichen dies. In der linken Spalte ist die Bandbreite der Lebenszeitkomoribiditätsraten der SP aus verschiedenen Studien aufgeführt. Die Odds Ratios geben an, um ein Wievielfaches höher die Wahrscheinlichkeit einer von SP betroffenen Person im Vergleich zu einer nicht-betroffenen Person ist, an einer bestimmten Störung zu erkranken. Das folgende Lesebeispiel anhand der Spezifischen Phobie soll dies verdeutlichen: 37.6 – 59 % der Soziophobikerinnen/Soziphobiker sind mindestens einmal im Leben auch von einer Spezifischen Phobie betroffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Verlaufe ihres Lebens an einer Spezifischen Phobie erkranken, ist 3.7-9.2-mal höher als bei Personen, die nicht von SP betroffen sind. 18 Tabelle 4: Lebenszeitkomorbiditäten von Sozialer Phobie und anderen psychischen Störungen (Lieb & Müller, 2002, S. 49) Lebenszeitkomorbiditätsrate Odds Ratio Angststörungen: Spezifische Phobie Agoraphobie Panikstörung Generalisierte Angststörung Zwangsstörung Posttraumatische Belastungsstörung 37.6 - 59% 8.8 – 44.9% 4.7 – 10.9% 2.3 – 13.3% 2.3 – 11.1 % 5.9 – 15.8 % 3.7 – 9.2 5.5 – 16.7 3.1 – 4.7 2.4 – 5.8 3 – 4.4 2.7 – 6.2 Depressive Störungen: Major Depression 16.6 - 37.2 % 2.7 – 4.4 Substanzstörungen Alkoholmissbrauch/ -abhängigkeit Drogenmissbrauch/ -abhängigkeit 10.9 – 19.4 % 5.3 – 13 % 1.1 – 3.5 1.2 – 2. 9 Wie sind die hohen Komorbiditätsraten zu erklären? Entwickelt sich ein Alkoholmissbrauch (und möglicherweise eine daraus resultierende Abhängigkeit), weil eine von SP betroffene Person die angstlösende Wirkung des Alkohols zum Durchhalten von schwierigen sozialen Situationen einsetzt? Oder entwickelt eine Person eine SP, weil sie wegen Alkoholmissbrauch Entzugserscheinungen oder berufliche Probleme hat und fürchtet, deshalb stigmatisiert zu werden? Merikangas und Angst (1995; zit. nach Stangier, Heidenreich & Peitz, 2009, S. 18f) werteten verschiedene Studien aus, um die Frage zu beantworten, welche der komorbiden Störungen häufiger als Erste auftritt und somit Ursache der anderen Störung sein könnte. Es zeigte sich, dass die SP in drei von vier Fällen der komorbiden Störung vorausgeht. Am häufigsten (in 95% der Fälle) ist dieses zeitliche Muster bei depressiven Störungen. Aber auch andere Angststörungen treten in 80% und Alkoholmissbrauch oder –abhängigkeit in 65% und somit überwiegender Zahl der Fälle nach der SP auf. Einzig die spezifische Phobie geht der SP zeitlich voraus. Im Falle der komorbiden SP und Depressionen könnte der Zusammenhang darin bestehen, dass Betroffene „mit starken Vermeidungstendenzen eine zunehmende Demoralisierung und ein negatives Selbstbild entwickeln“ (Stangier, et al., 2009, S. 19). Im beschriebenen Beispiel zwischen der SP und Alkoholabhängigkeit und –missbrauch sind beide Varianten möglich. Als Grund für das häufige gleichzeitige Auftreten von Angststörungen und SP werden gemeinsame Vulnerabilitätsfaktoren diskutiert (Stangier et. al., 2009, S. 19f). Komorbiditäten können einen grossen Einfluss auf die Therapieplanung und deren Verlauf haben. Wenn beispielsweise aufgrund einer komorbiden Depression Suizidgefahr besteht, ist es prioritär, dass die Person emotional stabilisiert und allenfalls auch stationär behandelt wird. 19 Es ist also wichtig, dass komorbide Störungen durch Fachpersonen (Psychiaterinnen/Psychiater und Psychologinnen/Psychologen) erkannt werden und in die Behandlungsplanung mit einbezogen werden. Prioritäten in der Behandlung der Probleme sollten soweit als möglich gemeinsam mit der Patientin/dem Patienten besprochen werden (Stangier et al., 2009, S. 83). 2.5 Epidemiologie Die psychiatrische Epidemiologie befasst sich mit der Verteilung psychischer Krankheiten in der Bevölkerung, den Faktoren, die unterschiedliche Auftretenshäufigkeiten beeinflussen sowie den Bedingungen des Auftretens und des Verlaufs psychischer Krankheiten (Weyerer & Lucht, 2002, S. 32). Nebst der Verbreitung der SP in der Bevölkerung wird in diesem Kapitel thematisiert, wie der übliche Verlauf der Störung ist, in welchem Alter die SP durchschnittlich beginnt und wie das Geschlechterverhältnis bei den Betroffenen ist. Gemäss Aussage von Erwin Wüest, Mitarbeiter des Bundesamtes für Statistik, gibt es keine spezifischen, aktuellen Zahlen zur Epidemiologie der SP in der Schweiz (persönliche Mitteilung, 23. Juli 2009). In kleineren Ländern wie der Schweiz, wo eine institutionelle Basis für die psychiatrische Epidemiologie fehlt, sind deren Bestehen und Kontinuität von der Initiative einzelner Forscher abhängig (Ajdacic-Gross & Graf, 2003, S. 26). Einer dieser Forscher ist Jules Angst, der die sogenannte Zürich-Studie, eine der wenigen psychiatrisch-epidemiologischen Längsschnittstudien durchführte. An der Studie haben 591 erwachsene Personen aus dem Kanton Zürich teilgenommen. Nach der ersten umfassenden Befragung 1979 wurden die Teilnehmenden noch fünfmal mit demselben, DSM- und ICD-kompatiblen, strukturierten Interview befragt. 1999 fand die letzte Befragung statt, an welcher sich etwas mehr als 60% des Ausgangssamples beteiligten. Knapp die Hälfte hatte an allen Befragungen teilgenommen. Die Zürich-Studie ergab eine Lebenszeitprävalenz für alle Angststörungen zusammen von 25%, diejenige für SP betrug 7%. Die 12-Monatsprävalenz (und somit der Anteil der Personen, die innerhalb eines Jahres von SP betroffen sind) betrug 1.5 % (Ajdacic-Gross & Graf, 2003). Im bevölkerungsrepräsentativen deutschen Bundes-Gesundheitssurvey von 1998 (BSG98) wurden Häufigkeit, Auswirkungen und Versorgungssituation von Angststörungen erhoben. Die Ergebnisse wurden 2004 vom Robert-Koch-Institut im Rahmen des Hefts „Gesundheitsberichterstattung des Bundes“ zum Thema Angststörungen herausgegeben. Demnach betrug die 12-Monatsprävalenz der SP (nach dem DSM-IV) bei Männern 1.3 % und bei Frauen 2.7 % (Robert-Koch-Institut, 2004). Weil die 20 12-Monatsprävalenzen der beiden Studien in etwa übereinstimmen und die beiden Länder geografisch und kulturell naheliegend sind, sind die Ergebnisse des BSG98 auf die Schweiz übertragbar. Angststörungen (inklusive die SP) weisen gemäss Studien aus verschiedenen Ländern nur kleine Unterschiede zwischen der 12-Monatsprävalenz und der Lebenszeitprävalenz auf und alle Altersgruppen sind etwa gleich häufig von ihnen betroffen. Diese Tatsachen lassen auf den üblicherweise chronischen Verlauf der Angststörungen schliessen (Robert-Koch-Institut, 2004, S. 11f). Auch Stangier et al. (2009) kommen zum Schluss, dass sich die SP in der Regel chronifiziert. So dauert die Krankheit durchschnittlich 20 Jahre. Am Häufigsten findet sich dabei ein konstanter und phasenhafter („Auf und Ab-“) Verlauf, in einigen Fällen, insbesondere bei Komorbidität, auch eine zunehmende Verschlechterung – bei einer Minderheit eine spontane Remission (S. 17). Einen günstigeren Verlauf attestieren Stangier et al. Personen mit höherem Bildungsniveau, Abwesenheit von Komorbidität und Beginn der Störung nach dem 11. Lebensjahr. Das durchschnittliche Alter bei Beginn der SP lag beim BSG98 bei Männern bei 19.4, bei Frauen bei 22.7 Jahren, was aber aufgrund der rückwirkenden Angaben eher obere Schätzgrenzen seien (RobertKoch-Institut, 2004, S. 13). Bandelow (2006, S. 126) kommt in Anbetracht verschiedener Studien zum Schluss, dass die meisten Personen im Kindes- und Jugendalter und nur 10% nach dem 26. Lebensjahr erkranken. Der Frauenanteil bei den von SP Betroffenen ist zwischen 1.5 und 2mal höher als derjenige der Männer (Bandelow, 2006, S. 126). Gemäss der Zürich-Studie sind also 7 von 100 Personen im Verlaufe ihres Lebens von SP betroffen, innerhalb eines Jahres sind es ungefähr 1.5% der Bevölkerung. Die Wahrscheinlichkeit, dass SA in ihrem Berufsleben mit einer oder mehreren Personen in Kontakt kommen, die von SP betroffen sind, ist also relativ hoch. 2.6 Ätiopathogenese Die SP tritt in der Bevölkerung häufig auf. Welche Gründe gibt es für diese Tatsache? Die Ätiopathogenese befasst sich mit den Ursachen (Ätiologie) sowie der Entstehung und Entwicklung (Pathogenese) von Krankheiten (Pschyrembel, 2004, S. 1377). Das Wissen um mögliche Ursachen kann sowohl von SP Betroffenen, als auch SA helfen, die Störung zu verstehen. Weiter wird aufgezeigt, was zur Aufrechterhaltung (oder Verschlimmerung) der SP beitragen kann. 21 2.6.1 Das biopsychosoziale Modell In der Psychiatrie hat sich seit den 1970er Jahren die Überzeugung etabliert, dass sowohl biologische, psychologische als auch soziale Faktoren den Menschen und dessen Gesundheit beeinflussen, was das Arbeitsfeld der Psychiatrie auch für andere Professionen (wie der Psychologie und der Sozialen Arbeit) geöffnet hat (Grabert, 2007, S. 12-15). Im Folgenden wird auf das auf dieser Sichtweise aufgebaute biopsychosoziale Modell eingegangen. Das biopsychosoziale Modell (Abbildung 2) besagt, dass die menschliche Entwicklung ein multidimensionales Geschehen ist und sowohl bei der Ätiologie, der Krankheitsentwicklung und der Behandlung psychischer (und physischer) Krankheiten sowohl biologische, psychologische soziale Faktoren eine Rolle spielen. Auch die Manifestation einer psychischen Krankheit geschieht auf allen drei Ebenen (Bosshard, 2008, S. 155). Dabei sind diese Ebenen sehr eng miteinander vermischt, beeinflussen sich gegenseitig stark und deren Unterscheidung stellt nur eine künstliche Trennung zur besseren Orientierung dar (Knölker, Mattejat & Schulte-Markwort, 2002, S. 23). Abb. 2: Das biopsychosoziale Modell (Scharfetter, 1996, S. 39) hereditär/somatisch soziogen psychogen Zur hereditären/somatischen Ebene „gehören“ demnach laut Knölker et al. (2002) die Genetik, „die körperliche Entwicklung und somatische Einflüsse“ und zur psychologischen Ebene „alle Aspekte der menschlichen Persönlichkeit wie Fähigkeiten und Fertigkeiten“ sowie der kognitive, der emotionale und der Verhaltensbereich. Zur sozialen Ebene zählen „die direkte Interaktion und Kommunikation mit anderen Personen“, die Teilhabe an sozialen Systemen, sozialen Normen und Wertsystemen „bis hin zu sozioökologischen Faktoren“ (S. 23). Aufgrund von neuen Erkenntnissen in der Hirnforschung geht der Trend in der Psychiatrie wieder verstärkt in die Biologie über. Diese Erkenntnisse sind zu würdigen, aber nach dem biopsychosozialen 22 Verständnis sind sie im beschriebenen Zusammenhang mit psychologischen und sozialen Faktoren zu betrachten. Demnach haben nicht nur biologische (unter anderem neurobiologische) Vorgänge Einfluss auf die psychische und die soziale Systemebene eines Menschen, umgekehrt prägen auch die psychosozialen Vorgänge/die gesellschaftlichen Lebensverhältnisse das Gehirn stark (Pauls, 2004). Da die ausführliche wissenschaftliche Beschäftigung mit der SP erst in den letzten Jahren stattgefunden hat, existieren nur wenige Studien, die sich mit der Ätiopathogenese der SP befassen (Bandelow, 2006, S. 132). Trotzdem könnte man allein über die momentan diskutierten ursächlichen und aufrechterhaltenden Faktoren ein Buch schreiben. Aus diesem Grund werden in dieser Bachelorarbeit nur ausgewählte Theorien erläutert. Gewisse Theorien (beispielsweise psychodynamische Erklärungen oder Provokationsmethoden) werden ganz weggelassen, da sie teilweise noch wenig erforscht sind, verschiedene Studien unterschiedliche Ergebnisse ergaben und/oder weil das Verstehen dieser Theorien ein relativ grosses Basiswissen verlangt. 2.6.2 Biologische Ansätze Es gibt verschiedene biologische (inklusive neurologische) Erklärungsansätze zur SP und deren Aufrechterhaltung. Näher beschrieben und exemplarisch veranschaulicht wird, welche Rolle das Gehirn, insbesondere der Mandelkern bei der SP spielt. Der Mandelkern vermittelt zwischen sensorischen Informationen und den vegetativ-motorischen Angstreaktionen (Stangier et al., 2009, S. 26). Im Anschluss an diese Theorie wird kurz auf die Vererbbarkeit der SP eingegangen. Neurobiologische Theorien Mandelkern und Gesichtserkennung Im Folgenden werden die von Schmitt (2008) ausführlich beschriebenen Abläufe im Gehirn bei Angstreaktionen und –störungen verkürzt und sehr vereinfacht wiedergegeben. Wenn die Sinnesorgane einen angsterregenden Stimulus (bei SP: Leistungs- oder Interaktionssituationen oder auch die Gedanken daran) wahrnehmen, schicken sie diese Information über Nervenfasern an das Gehirn, wo sie auf bewusst wahrgenommenem oder unbewusstem Weg zum Mandelkern gelangt. Die Information wird zusätzlich in anderen Teilen des Gehirns subjektiv bewusst bewertet und mit gespeicherten Erinnerungen (beispielsweise eine vergangene, traumatische Situation) abgeglichen. All diese Vorgänge (und genetische Voraussetzungen) haben Einfluss darauf, wie aktiv der Mandelkern wird und wie er auf die Information reagiert. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder „geht das Leben weiter“ (die Information ist unbedrohlich) oder es werden das Stresssystem und somit die vegetativ-motorischen Angstreaktionen aktiviert. Durch subjektive, bewusste Bewertung des Angster- 23 lebens können sich die Ängste bis zu einer Panikattacke aufschaukeln. Nun kann die Person (bewusst) an mögliche Vermeidungs-, Sicherheits- oder Fluchtverhaltensstrategien denken und diese in die Tat umsetzen, was meistens eine angstlindernde Wirkung hat. Diese „positive“ Erfahrung brennt sich (allenfalls erneut) in das Gedächtnis der betroffenen Person ein. So erfährt das Prinzip des Vermeidungs-, Sicherheits- oder Fluchtverhaltens und die entsprechenden Nervenbahnen Verstärkung und die Chance ist gross, dass die Verhaltensstrategie auch bei einer nächsten bedrohlichen Situation angewandt wird (Schmitt, 2008). Neuere Untersuchungen haben übereinstimmend ergeben, dass der Mandelkern von Personen mit SP stärker reagiert als bei Kontrollpersonen, insbesondere auf die Wahrnehmung von Gesichtern mit ärgerlichem Ausdruck. Eine Ursache von SP könnte also sein, dass der Mandelkern von Betroffenen im Hinblick auf soziale Reize empfindlicher, dadurch die Erregungsschwelle der beschriebenen neuronalen Angstschaltkreise niedriger und dadurch leichter konditionierbar ist. Die Überaktivität des Mandelkerns geht erwiesenermassen bei erfolgreicher Behandlung zurück (Stangier et al., 2009, S. 25). Biologische Dispositionen Familien- und Zwillingsstudien Fast alle Studien fanden im Verwandtenkreis von Soziophobikerinnen und Soziophobikern eine Häufung von ebenfalls Betroffenen. Diese Ergebnisse sind aber insofern mit Skepsis zu betrachten, als dass die Eltern auch durch Modell-Lernen sozial ängstliches Verhalten auf ihre Kinder übertragen können. Somit ist es unklar, worauf die Häufung von SP im Verwandtenkreis zurückzuführen ist. Hinweise, ob die familiäre Übertragung eher über Modell-Lernen oder die Genetik geschieht, geben Zwillingsstudien (Bandelow, 2006, S. 133f). Die Ergebnisse der Zwillingsstudien und die Tatsache, dass die SP oftmals schon im Kindesalter beginnt, lassen darauf schliessen, dass biologische Dispositionen ein wichtiger Faktor für die Entstehung sozialer Ängste sind (Stangier et al., 2009, S. 24). Eine genetische Disposition zur SP kann man nicht verändern. Es kann einer betroffenen Person zwar Schuldgefühle nehmen, wenn sie um die Veranlagung weiss, weshalb kurz auf die Vererbung eingegangen wurde. Auf die Hoffnung, dass sich an der bedrückenden Situation etwas ändern kann, wird dieses Wissen allerdings eher negative Auswirkungen haben. Der neurologische Erklärungsansatz soll hingegen zeigen, dass Gedanken einen Einfluss darauf haben, wie stark das Angstsystem aktiviert wird. Zudem ist erwiesen, dass die Überaktivität des Mandelkerns bei erfolgreicher Behandlung zurückgeht und somit auch die unbewusst ablaufenden, neurologischen Vorgänge verändert werden können. 24 2.6.3 Psychologische Ansätze Das Modell von Clark und Wells (1995; zit. nach Stangier et al., 2009, S. 29-33) ist die bislang am besten ausgearbeitete Theorie auf kognitiver Grundlage und erklärt die Aufrechterhaltung der SP. Dessen zentrale Aussagen konnten in mehreren empirischen Studien nachgewiesen werden, weshalb im Folgenden die wichtigsten Elemente und Mechanismen dieses kognitiven Modells wiedergegeben werden. Das kognitive Modell von Clark und Wells Abb. 3: Das kognitive Modell von Clark und Wells (Stangier et al., 2009, S. 33) Das Modell (Abbildung 3) stellt die kognitive Repräsentation des Selbst in den Mittelpunkt. Betroffene haben demnach ein negatives und verzerrtes (häufig visuell oder akustisch repräsentiertes) Bild oder eine dementsprechende Vorstellung konstruiert, wie Andere sie sehen. Sie erwarten, dass sie von anderen Menschen negativ bewertet werden. Soziophobikerinnen/Soziophobiker haben meistens schon negative Gedanken vor einem kritischen Ereignis. Diese sind teilweise an frühere, (zumindest 25 subjektiv) schlimme Erinnerungen geknüpft und können dazu führen, dass Betroffene die Situation vermeiden oder mit Sicherheitsverhalten reagieren. Falls sie sich in die schwierige Situation gewagt haben, beobachten sie sich selbst akribisch (erhöhte Selbstaufmerksamkeit), um im eigenen Verhalten mögliche Anzeichen dafür zu finden, die ihre Erwartung, dass Andere sie negativ bewerten, bestätigen können. Wenn Betroffene in schwierigen Situationen dann Angstsymptome wahrnehmen, (fehl-)attribuieren sie diese oftmals auf eine tatsächliche negative Bewertung der Anderen. Die innere Erregung in Kombination mit der Fehlattribution kann sich bis zu einer Panikattacke steigern. Wenn die Situation überstanden ist, dominieren negative Gedanken, welche die soziophobischen Überzeugungen bestätigen. Da ein reales, eindeutiges Feedback in den sozialen Situationen meistens fehlt, greifen die Betroffenen auf die eigenen (vom negativen Selbstbild geprägten) Eindrücke und Gefühle zurück, die ihre im Vorfeld gemachten Erwartungen bestätigen. Diese Erfahrung ist demnach ein weiterer „Beweis“ dafür, dass sie sich unangemessen verhalten und sie von Anderen negativ bewertet werden. Das führt zu einem noch negativeren Selbstbild und steigert die Erwartungsangst in Bezug auf weitere soziale Situationen (Stangier, 2009, S. 29-33). Als zentral für die Aufrechterhaltung der SP wurde erwiesen, dass insbesondere die erhöhte Selbstaufmerksamkeit und die Sicherheitsverhaltensweisen eine grosse Rolle spielen (Stangier, 2009). Beides kann verändert werden und somit den beschriebenen Teufelskreis durchbrechen. 2.6.4 Soziale Ansätze In diesem Kapitel werden verschiedene Lerntheorien vorgestellt. Eine davon ist die Theorie der sozialen Kompetenzdefizite, welche stark umstritten ist. Sie wird trotzdem thematisiert, um darauf aufmerksam zu machen, dass die meisten Betroffenen sehr wohl sozial kompetent sind, auch wenn dies möglicherweise auf den ersten Blick nicht so scheint. Anschliessend wird auf den Einfluss der elterlichen Interaktions- und Erziehungsstile eingegangen. Sie können Hinweise darauf geben, was im Umgang mit einer Betroffenen/einem Betroffenen wichtig ist. Lerntheorien In den 70er Jahren wurden soziale Kompetenzdefizite als Ursache der SP angesehen. Diese Theorie besagt, dass Personen mit sozialen Kompetenzdefiziten den sozialen Anforderungen nicht gerecht werden können und sie dadurch negative Bewertung durch Andere und negative soziale Konsequenzen erfahren. Diese Erfahrungen würden zu Ängsten vor weiterer negativer Bewertung und so zu sozialen Ängsten führen. 26 Es wurde festgestellt, dass viele Personen mit SP keine sozialen Kompetenzdefizite aufweisen. Die Ergebnisse von Studien, die den Zusammenhang von SP und sozialer Performanz (dem direkt beobachtbaren Verhalten) untersuchten, sind widersprüchlich. Heute wird eher diskutiert, dass die intensive Angst und/oder das Sicherheitsverhalten das sozial kompetente Verhalten von Betroffenen beeinträchtigen können (Stangier et al., 2009, S. 23f). Eine weitere lerntheoretische Erklärung für die SP ist die klassische Konditionierung. So berichteten viele Betroffene, dass sie traumatische soziale Erfahrungen gemacht haben (beispielsweise Ausgelachtwerden in der Schule oder Denk- oder Sprechblockaden in sozialen Situationen). Wenn nun eine Betroffene/ein Betroffener auf eine ähnliche Situation wie beim sozial traumatischen Erlebnis trifft, werden die Ängste reaktiviert. Da Betroffene solche Situationen deshalb oftmals vermeiden, ist eine Gegenkonditionierung oder Löschung nicht möglich. In anderen Worten, wenn die Person erneut in die angstauslösende Situation gerät, wird sie wieder mit der konditionierten Angst reagieren. Da 60% vom nicht-generalisierten und 40% vom generalisierten Subtyp Betroffene von solchen früheren, traumatisierenden sozialen Erlebnissen berichten, spielt die klassische Konditionierungstheorie wahrscheinlich vor allem bei der nicht-generalisierten SP eine Rolle (Stangier et al., 2009, S. 23). Dysfunktionale Grundannahmen und sozial ängstliche Verhaltensweisen können auch über ModellLernen von den Eltern zu den Kindern übertragen werden. Dabei lernen die Kinder beispielsweise, dass soziale Situationen angstbesetzt sind und man diese wenn möglich vermeiden soll. So haben Betroffene retrospektiv berichtet, dass ihre Eltern die Meinung anderer Menschen überbetonten, die Bedeutung sozialer Kompetenz dagegen weniger hervorheben und stärker versuchten, ihre Kinder zu isolieren als die Eltern von Agoraphobikern [Tabelle 3] oder gesunden Kontrollen (Bandelow 2006, S. 133). Elterlicher Interaktions- und Erziehungsstil Bandelow (2006, S. 132f) und Stangier et. al (2009, S. 24) betrachteten verschiedene Studien zum Erziehungs- und Interaktionsstil der Eltern. Dabei kamen einige Studien zum Ergebnis, dass Betroffene ihre Eltern retrospektiv als überprotektiv oder zurückweisend (oder zumindest als gleichgültig) einschätzten und sie zu wenig Wärme und Zuneigung erhielten. Ein überkritischer oder überbehütender Erziehungsstil der Eltern kann die Entwicklung eines positiven Selbstbildes und Selbstvertrauen erschweren beziehungsweise die Entstehung negativer Grundüberzeugungen fördern (Stangier et al., 2009, S. 27). Aufgrund der Retrospektivität der Aussagen über die Erziehungs- und Interaktionsstile der Eltern muss aber die Möglichkeit einbezogen werden, dass der subjektive Eindruck der Betroffenen nicht zwingend mit einem tatsächlichen Fehlverhalten der Eltern einhergeht (Bandelow, 2006, S. 132f). 27 Die Lerntheorien besagen alle, dass von SP betroffene Personen gelernt haben, dass soziale und/oder Leistungssituationen eine Gefahr darstellen und sie deshalb unbewusst oder bewusst Ängste vor solchen Situationen haben. Mittels Therapien können solche Konditionierungen verändert oder gelöscht werden. Wie anhand des biopsychosozialen Modells beschrieben wurde, kann keine der Theorien als alleingültige Erklärung für die Entstehung und Ursache der SP angesehen werden. Empirische Befunde bestätigen dies. Es ist davon auszugehen, dass sowohl biologische, psychologische und soziale Faktoren „in jeweils unterschiedlichem Masse zusammenwirken können“ (Stangier et al. 2009, S. 35). 28 3. Auswirkungen der Sozialen Phobie auf das Leben von Betroffenen In diesem Kapitel werden die im DSM-IV erwähnten sozialen und Leistungssituationen und im Anschluss die Verhaltensstrategien von Betroffenen, um mit solchen Situationen (besser) umgehen zu können, beschrieben. Der Schluss dieses Kapitels widmet sich der Beantwortung der Frage, welche Auswirkungen die SP und die Verhaltensstrategien auf das Leben der Betroffenen haben können. Auch die Informationen aus diesem Kapitel dienen dem besseren Verständnis von Betroffenen. SA schieben beispielsweise das Nichterscheinen von Betroffenen zu Terminen nicht deren Vergesslichkeit oder Faulheit zu, sondern beziehen die Möglichkeit des Vermeidungsverhaltens der Betroffenen mit ein. Dies ermöglicht, zusammen mit Betroffenen nach einer adäquaten Lösung zu suchen. 3.1 Leistungs- und Interaktionssituationen Das DSM-IV beschreibt in Kriterium A, dass Betroffene in „sozialen oder Leistungssituationen“ unter Ängsten leiden (Tabelle 1). Auf diese zwei Situationsarten wird nun eingegangen. Leistungs- oder Darstellungssituationen sind Situationen, in welchen Betroffene eine Handlung durchführen, „die einer Beobachtung und Bewertung durch andere Personen unterliegen könnte“ (Stangier et al., 2009, S. 9). Das am weitesten verbreitete Beispiel ist hier öffentliches Reden, aber auch Essen, Trinken und Schreiben vor anderen Menschen, einen Raum zu betreten, in welchem bereits Personen sitzen oder (mündliche) Prüfungen zählen dazu. Unter die Interaktionssituationen fallen Situationen, in welchen Betroffene mit anderen Personen interagieren. Als Beispiele nennen Stangier et al. (2009, S. 9) die Kontaktaufnahme mit (insbesondere heterosexuellen) Fremden, den Besuch von Konferenzen, Feiern oder Versammlungen oder die Kommunikation mit Autoritätspersonen. Weiter kann es für Betroffene schwierig sein, wenn sie telefonieren, die eigene Meinung äussern oder Jemandem widersprechen müssen. Soziophobikerinnen und Soziophobiker sind also im Gegensatz zu beispielsweise Spinnenphobikerinnen und Spinnenphobikern sehr häufig mit ihrem Angstauslöser (Menschen) konfrontiert. 3.2 Vermeidungsverhalten, Flucht und Verhaltungshemmung Die meist alltägliche Konfrontation mit dem Angstauslöser zwingt die Betroffenen Strategien oder Verhaltensweisen zu entwickeln, um mit der ständigen subjektiven Bedrohung (einigermassen) klarzukommen. 29 Stangier und Fydrich (2002, S. 18f) nennen als typische Verhaltensweisen von Soziophobikerinnen und Soziophobikern das Vermeidungs- und das Fluchtverhalten sowie die Verhaltungshemmung. Vermeidungs- und Fluchtverhalten bedeutet, dass Betroffene die für sie bedrohlichen Situationen sozusagen „präventiv“ nicht aufsuchen, respektive diese verlassen. Betroffene hoffen, sich durch diese Verhaltensweisen vor negativen Erfahrungen zu schützen. Weiter können sie auch ein gehemmtes Verhalten (in Form eines passiven, unterwürfigen Verhaltens bis hin zu einer völligen Verhaltensblockade) zeigen. Besonders das Vermeidungsverhalten ist als problematisch anzusehen. Einerseits lässt es keine Widerlegung der soziophobischen Überzeugungen zu, andererseits kann es zu beträchtlichen sozialen Nachteilen führen (Stangier & Fydrich, 2002, S. 18f). 3.3 Sicherheitsverhalten und sozial inadäquates Verhalten Es gibt zwei weitere, für Betroffene typische Verhaltensweisen. Einerseits das Sicherheitsverhalten, um befürchtete Blamagen zu vermeiden, andererseits können Betroffene ein sozial inadäquates Verhalten zeigen. Das Sicherheitsverhalten kann sich dadurch äussern, dass Betroffene einen Vortrag ablesen, um nicht den Faden zu verlieren, Blickkontakt vermeiden, damit Zeichen von Schwäche vom Gegenüber nicht gesehen werden können, dass Betroffene keine Tasse benützen oder diese mit beiden Händen halten, damit das Zittern nicht oder weniger gesehen wird oder sie helle Kleidung tragen, damit das Schwitzen nicht auffällt. Weiter kann es sein, dass Alkohol, Nikotin, Medikamente oder Drogen zur Spannungsreduktion verwendet werden. Solche Sicherheitsverhaltensweisen können die Selbstaufmerksamkeit der Betroffenen erhöhen und die Angstsymptome verursachen oder verstärken (Stangier & Fydrich, 2002, S. 18f). Betroffene können auch tatsächlich ein sozial inadäquates Verhalten zeigen. Dies kann sich durch „ungeschicktes, selbstunsicheres oder distanziertes Verhalten“ (Stangier & Fydrich, 2002, S. 18f) äussern, oder aus einer mangelhaften sozialen Wahrnehmung resultieren. Gründe für Letztere können unter anderem eine erhöhte Selbstaufmerksamkeit von Betroffenen oder ein hohes Angstniveau sein. Beide Verhaltensweisen haben problematische Folgen. Wie das Vermeidungsverhalten verhindert das Sicherheitsverhalten das Widerlegen von dysfunktionalen Überzeugungen und trägt somit zur Aufrechterhaltung der SP bei. Folgen des sozial inadäquaten Verhaltens können (die von Betroffenen so gefürchtete) Abwertung durch Andere sein, oder die tatsächliche Unfähigkeit von Betroffenen, soziale Anforderungen zu erfüllen (Stangier & Fydrich, 2002, S. 18f). 30 Die genannten Verhaltensweisen können gravierende Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen haben. 3.4 Auswirkungen der Sozialen Phobie auf den Alltag Datenmaterial über die Auswirkungen der SP auf das Leben von Betroffenen ist nur spärlich vorhanden. Für die folgenden Ausführungen wird hauptsächlich auf die von Müller, Beloch und Wittchen (1998) besprochene Studie aus Deutschland von Wittchen und Beloch (1996; zit. nach Müller et al., 1998, S. 67-80) eingegangen. Diese Studie untersuchte die Lebensqualität, die lebenslangen und aktuellen psychosozialen Beeinträchtigungen aufgrund der SP und gesundheitsökonomischen Aspekte von 65 Betroffenen. Die Probandinnen/Probanden hatten alle die Diagnose SP und litten an keiner komorbiden Störung. Bei der Studie waren viele Betroffene beteiligt, die eine langandauernde, chronische und unbehandelte SP vorwiesen. Zudem lag bei mehr als der Hälfte der generalisierte Subtypus vor (drei oder mehr soziophobische Situationen), bei 10 Probanden eine isolierte SP (1-2 Situationen). 92.1% berichteten über schwere kognitive und psychophysiologische Angstreaktionen, 83.6% über anhaltendes Vermeidungsverhalten und 12.4% gaben an, dass sie schwierige Situationen durchstehen. Die zwei am meisten gefürchteten Situationen waren das Sprechen vor (91%) und das Sprechen mit (59%) anderen Personen. Von der ebenfalls 65 Personen umfassenden Kontrollgruppe war niemand von SP betroffen, aber alle hatten eine Herpes Simplex-Infektion, eine körperliche Krankheit. Dies ermöglichte eine strenge Testung …, da auch bei der Kontrollgruppe eine geringere Lebensqualität und eine häufigere Konsultation von Ärzten als in der Allgemeinbevölkerung zu erwarten war (Müller et al., 1998, S. 69). Das durchschnittliche Alter betrug bei beiden Gruppen etwa 37 Jahre, und bei Beiden betrug der Frauenanteil 63.1 %. Mittels eines störungsunabhängigen Fragebogens wurde in acht verschiedenen Bereichen die allgemeine Lebensqualität der Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer erhoben. Dabei ergab sich in allen Bereichen eine signifikant tiefere Lebensqualität für die von SP Betroffenen. Besonders stark eingeschränkt war sie in den folgenden Bereichen: 31 • Rollenfunktionen in emotionaler Hinsicht • Soziale Funktionsfähigkeit • Psychisches Wohlbefinden • Vitalität Wenn man die letzten drei Bereiche als „emotionales Wohlbefinden“ zusammenfasst, ergibt sich für 23.1% der von SP Betroffenen eine sehr starke und für 24.2% eine leicht eingeschränkte Lebensqualität. Bei der Kontrollgruppe berichteten nur 4.6% über eine sehr starke oder leicht eingeschränkte Lebensqualität (Müller et al., 1998). Im Folgenden werden die jeweiligen Ergebnisse der Kontrollgruppe in Klammern gesetzt. 3.4.1 Ausbildung/Beruf Die beschriebenen sozialen und Leistungssituationen kommen im beruflichen Alltag und in der Ausbildung häufig vor. Die folgenden Zahlen verdeutlichen, dass die SP demnach auch Auswirkungen auf diese Bereiche hat. In der vorangehend vorgestellten Studie waren 10.8% der von der SP Betroffenen arbeitslos (3.1%) und 54% von ihnen gaben an, dass sie mindestens einmal im Leben schwerwiegende psychosoziale Einschränkungen in Ausbildung oder Beruf gehabt haben (keine Angabe). 8.3% berichteten, dass sie in den vergangenen Wochen aufgrund ihrer Störung von ihrer Arbeit ferngeblieben sind (0%), wobei die durchschnittliche Fehlzeit 11.7 Stunden/Woche betrug. Weitere 23.3% gaben an, aktuell in ihrer Arbeitsleistung stark eingeschränkt zu sein (2.4%) (Müller et al., 1998). Die Ergebnisse des BSG98 (Robert-Koch-Institut, 2004) bestätigen die gravierenden Auswirkungen im Arbeitsbereich. Über 25% der männlichen und über 45% der weiblichen Betroffenen berichteten, dass sie aufgrund der SP im vergangenen Monat mindestens einen Tag nicht in der Lage waren, der Arbeit/Ausbildung oder dem Haushalt nachzukommen (Ausfalltage). Bei den Vergleichsgruppen ohne psychische Störung/ohne körperliche Erkrankung betrug dieser Anteil jeweils knapp über 10%. Die durchschnittliche Anzahl Ausfalltage pro Monat betrug bei den von SP betroffenen Männern 6.9, bei den Frauen 1.9. Bei den Vergleichsgruppen waren es 0.9/0.6 bzw. 0.6/0.7 Ausfalltage. Aufgrund der Einschränkungen im Arbeitsbereich haben epidemiologische Studien durchgängig ergeben, dass Betroffene einen geringeren sozioökonomischen Status haben, einhergehend mit einer niedrigeren Bildung, niedrigerem Einkommen, dadurch schlechtere finanzielle Situation und niedrigerer Schichtzugehörigkeit. Gründe dafür können unter anderem Kündigungen (beispielsweise aufgrund des Vermeidungsverhaltens) sein, oder dass Betroffene sich aufgrund der Ängste nicht trauen, Arbeitsstel- 32 len anzunehmen, welche die Konfrontation mit kritischen Situationen mit sich bringen (Stangier et al., 2009, S. 20f). Nebst dem Leidensdruck für die Betroffenen wird angesichts dieser Zahlen und der Tatsache, dass die SP relativ weit verbreitet ist, deutlich, dass sie eine „kostenintensive Krankheit“ ist, die durch Arbeitsbeeinträchtigung, –unfähigkeit und –losigkeit sowie durch frühzeitige Berentungen einen „Ressourcenverlust für die Gesellschaft“ darstellt (Robert-Koch-Institut, S. 15ff). 3.4.2 Soziale Beziehungen, Partnerbeziehungen und Isolation Verschiedene Studien verdeutlichen, dass sich die SP, wie es der Name schon sagt, stark auf die sozialen Beziehungen der Betroffenen auswirkt. Personen mit SP haben gemäss Schneider, Johnson, Hornig, Liebowitz und Weissmann (1992; zit. nach Stangier et al., 2009, S. 21) weniger freundschaftliche Beziehungen, eingeschränkte familiäre Beziehungen, ein schlechteres soziales Netzwerk und sie beteiligen sich weniger an Vereinen oder anderen sozialen Einrichtungen. Eine weitere Studie mit 14- bis 24-jährigen Personen ergab, dass sich 35.5% der vom generalisierten und 8.8% der vom nicht-generalisierten Subtyp Betroffenen in sozialen Kontakten/Beziehungen beeinträchtigt fühlen (Lieb & Müller, 2002, S. 56). Die Probleme im zwischenmenschlichen Bereich zeigen sich auch im Zivilstand der Betroffenen. In der von Müller et al. (1998) zitierten Studie waren mit 34% signifikant weniger Personen der Fallgruppe verheiratet (57%), geschieden waren hingegen 16.9% (7.7%). Auch Stangier et al. (2009, S. 21) kommen aufgrund von Studienergebnissen zum Schluss, dass Betroffene seltener verheiratet sind, seltener mit einem Partner zusammenwohnen sowie häufiger noch im elterlichen Haushalt leben. Gründe dafür sehen sie unter anderem darin, dass Betroffene Hemmungen haben, Personen des anderen Geschlechts anzusprechen und dass sie aufgrund ihres oftmals geringeren sozioökonomischen Status für andere Menschen weniger attraktiv sind. Weiter bemerken Stangier et al. (2009, S. 21), dass Probleme, welche die SP begleiten können (wie depressive Verstimmungen oder erhöhter Alkoholkonsum) Partnerschaften zusätzlich belasten können. Es ist davon auszugehen, dass die genannten Gründe auch ausschlaggebend dafür sein können, dass Betroffene generell weniger soziale Beziehungen haben und dadurch verstärkt soziale Isolation erfahren. 33 An dieser Stelle ebenfalls zu erwähnen ist die gesellschaftliche Stigmatisierung psychisch kranker Menschen, die Betroffene zu spüren bekommen und sich negativ auf die sozialen Beziehungen auswirken kann. Die Stigmatisierung kann in verschiedenen Formen auftreten. Darunter fallen unter anderem stigmatisierende Medienberichte („Scheininvalide“), Witze über psychisch Kranke oder Ablehnung bei der Arbeits- und Wohnungssuche. In den USA wurde untersucht, inwieweit verschiedene Verhaltensweisen in den USA akzeptiert sind und wie die jeweils „angemessene gesellschaftliche Bestrafung“ ausfällt. Die gesellschaftliche Bestrafung für Angstreaktionen liegt zwischen „privater Zurückweisung“ und „öffentlichem Tadel“. Die Betroffenen können sich indes durch Verheimlichung ihrer Krankheit auch selber stigmatisieren (Zimbardo & Gerrig, 2004, S. 698f). 3.4.3 Suizidalität In Anbetracht des grossen Leidensdrucks und den Auswirkungen durch die SP, stellt sich die Frage nach der Suizidalität der Betroffenen. Der Begriff Suizidalität steht für die Neigung, einen Suizid zu begehen (Pschyrembel, 2004, S. 1768). Es verwundert nicht, dass gemäss Olfson, Guardino, Struening, Franklin, Schneider, Hellmann & Klein (2000; zit. nach Stangier et al., 2009, S. 21) Betroffene häufiger als die Kontrollgruppe unter Hoffnungslosigkeit, Sorgen, Freud- und Lustlosigkeit und Suizidgedanken leiden. Eine etwas ältere Untersuchung von Cox, Dierfeld, Swinson und Norton (1994) kam zu einem ähnlich traurigen Schluss. Cox et al. untersuchten 41 Personen mit SP im Hinblick auf Suizidgedanken und -versuche. Die Studie ergab, dass 14 Personen (und somit 24%) im vergangenen Jahr Suizidgedanken hatten. Zwei davon unternahmen tatsächlich einen Suizidversuch. Fünf der Befragten hatten in früheren Jahren einen Suizidversuch unternommen. Die SP und die daraus entstehenden Probleme können also einen so grossen Leidensdruck bewirken, dass die Betroffenen nicht mehr leben möchten. Es gibt verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten, damit es nicht soweit kommen muss. 34 4. Hilfe für Betroffene und Angehörige Damit die mit der SP zusammenhängenden, weitreichenden Probleme nicht eintreten oder zumindest angegangen werden können, ist eine möglichst frühzeitige und adäquate Unterstützung für Betroffene wichtig. Dieses Kapitel beginnt mit Zahlen und Kommentaren zum Hilfesuchverhalten von betroffenen Menschen. Im Anschluss wird erläutert, wie Betroffenen und ihren Angehörigen durch SA und Triage geholfen werden kann und wo diese Hilfe zu finden ist. In der bereits von Müller et al. (1998) zitierten Studie berichteten 70.8% der Soziophobikerinnen/Soziophobiker, dass sie sich durch die Krankheit stark beeinträchtigt fühlen. Trotzdem haben nur ein Drittel aller untersuchten soziophobischen Probandinnen/Probanden in ihrem Lebenslauf mindestens einmal (speziell aufgrund der SP) Hilfe aufgesucht. Am häufigsten wurde dabei mit 24.6% eine medikamentöse Behandlung gewählt. Gründe für die seltene Inanspruchnahme von Hilfe können sein, dass die meisten Patientinnen/Patienten ihre Problematik als unveränderbar oder schicksalhaft ansehen, oder dass sie die SP als charakterliches Defizit betrachten, das demnach therapeutisch nicht beeinflussbar ist. Weiter können Betroffene Angst davor haben, von ihren Problemen zu erzählen und damit auf Unverständnis zu stossen. Oftmals gründet diese Angst auf bereits gemachten, schlechten Erfahrungen bei der Offenbarung der Ängste, indem diese von Anderen nicht ernst genommen oder bagatellisiert wurden. Es ist auch möglich, dass sich Soziophobikerinnen/Soziophobiker im Verlaufe ihrer Krankheit eine unauffällige „Fassade“ zugelegt haben, sodass Andere ihre Ängste nicht sehen, oder dass sie ihre Ängste beispielsweise mit Alkohol selbst zu therapieren versuchen (Bandelow, 2006). Ajdacic und Graf (2003) weisen auf mögliche Konsequenzen von psychischen Störungen bei NichtInanspruchnahme von Hilfe auf individueller Ebene hin: • Erhöhtes Risiko für die Chronifizierung und/oder die Zunahme des Schweregrades bzw. der Beeinträchtigungen • Erhöhtes Risiko für Komorbidität mit Substanzstörungen und anderen psychischen Störungen • Erhöhtes Risiko für Suizidalität • Soziale Desintegration, Isolierung, Konflikte in Familie/Netzwerk • Erhöhtes Risiko für Verarmung und Deprivation (S.78) Gemäss Stangier, Clark und Ehlers (2006, S. 25f) suchen Betroffene häufig erst spät Hilfe auf, nämlich wenn gravierende soziale und/oder berufliche Folgeprobleme und/oder sekundäre Störungen (insbesondere Depressionen oder Sucht) auftreten. Auslöser sind häufig Veränderungen in den persönli35 chen Lebensumständen (Umzug, neue Arbeitsstelle), durch welche die Personen mit neuen Anforderungen an das Verhaltensrepertoire konfrontiert werden. Seltener ist das vordergründige Problem für das Aufsuchen von Hilfe die SP selber. Den Betroffenen kann mittels verschiedener Behandlungsarten geholfen werden. 4.1 Behandlungsarten der Sozialen Phobie Zu Beginn jeder Behandlung steht die Aufklärung über die Krankheit. Dazu gehören unter anderem Informationen über mögliche Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten der SP. Weiter kann es sinnvoll sein, Betroffene darauf hinzuweisen, dass die SP eine relativ weit verbreitete und ernst zu nehmende psychische Störung ist. Bereits dieses Wissen kann Betroffenen helfen, weil dadurch Schuldgefühle abgebaut und Hoffnung geschöpft werden können/kann (Hättenschwiler & Höck, 2002). Im Folgenden werden Möglichkeiten beschrieben, um die SP und die damit zusammenhängenden Probleme anzugehen. 4.1.1 Psychopharmakotherapie Die Behandlung der SP mittels Psychopharmaka wurde in den letzten Jahren intensiv untersucht. Es gilt mittlerweile als gesichert, dass mehrere Präparate (insbesondere Antidepressiva) den Placebos überlegen sind. Als am effektivsten, verträglichsten, sichersten und hinsichtlich Beeinflussung komorbider Störungen am günstigsten gelten momentan selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI). Leider liegen zu diesen Antidepressiva kaum Studien über die Effekte über einen längeren Zeitraum hinweg vor (Stangier et al., 2009, S. 50f). Auf den genauen Wirkmechanismus der SSRI und weitere Medikamente wird an dieser Stelle nicht näher eingegangen, da die Entscheidung ob und welches Psychopharmakon eingenommen wird, bei den zuständigen Fachpersonen (Psychiaterinnen/Psychiater oder Ärztinnen/Ärzte) sowie den betroffenen Personen liegt. Die Entscheidung sollte vom Leidensdruck und drohenden Komplikationen (sekundären Erkrankungen) abhängen. In vielen Fällen kann die Lebensqualität der Betroffenen durch Medikamente massiv gesteigert werden (Bandelow, 2006). 4.1.2 Psychotherapie In Psychotherapien wird mittels verschiedener Methoden und Behandlungstechniken das Erleben, Fühlen, Denken und Verhalten von Menschen beeinflusst und in eine gewünschte Richtung verändert. 36 Durchgeführt werden sie von Psychiaterinnen/Psychiatern und Psychologinnen/Psychologen mit psychotherapeutischer Spezialausbildung (Fäh, 2003, S. 241). Die kognitive Verhaltenstherapie ist in Bezug auf die Behandlung der SP der am häufigsten untersuchte und angewandte psychotherapeutische Ansatz und kann im Einzel-, wie auch im Gruppensetting durchgeführt werden. Sie besteht aus Konfrontationen der Betroffenen mit den angstbesetzten Situationen, „dem bewussten Überprüfen der Reaktionen anderer Menschen sowie dem Korrigieren bisheriger kognitiver Schemata“ (Berghändler et al., 2007, S. 229). Soziophobikerinnen/Soziophobiker lernen so, dass sie schwierige Situationen erfolgreich meistern und feststellen können, dass befürchtete Reaktionen ausbleiben oder unwichtig sind. Die kognitive Verhaltenstherapie hat sich kurz- und langfristig als effektiv erwiesen. Bei knapp 85% der Betroffenen besserte sich unter anderem die Hauptsymptomatik und dadurch die Lebensqualität in den Bereichen Familie, Beruf und Freizeit. Verschiedene Studien zeigten, dass sich die positive Wirkung bis zu fünf Jahre als stabil erweist (Bandelow, 2006, S. 138-142). Die Pharmakotherapie mit SSRIs ist im Vergleich zu der kognitiven Verhaltenstherapie wirksamer, aber die Rückfallquote ist höher und die Therapie somit weniger nachhaltig. Eindeutige empirische Belege, bei welchen Personen welche der beiden Behandlungsarten oder deren Kombination besser ist, gibt es noch nicht (Stangier et al., 2009, S. 53f). Für die Entscheidung, ob die Pharmako-, die Psychotherapie oder deren Kombination vorgezogen wird, spielen Präferenz der Patientin/des Patienten, Nebenwirkungen der Medikamente, Schweregrad, Komorbidität, Verfügbarkeit der Psychotherapie und Qualifikation der Therapeutin/des Therapeuten sowie ökonomische Überlegungen eine Rolle (Bandelow, 2006, S. 146). 4.1.3 Psychosoziale Beratung Unter diesem Begriff sind viele Unterstützungsarten einzuordnen. Im Folgenden wird auf die Bereiche Arbeit/Ausbildung, Wohnen, Finanzen und weitere Ressourcen eingegangen, in welchen Betroffene beraten und unterstützt werden können. Zuständig dafür sind SA in Zusammenarbeit mit Fachpersonen aus anderen Disziplinen. Dieses Kapitel wurde mit fachlicher Unterstützung von Lara Elia, Sozialarbeiterin FH bei der Pro Infirmis, erarbeitet (persönliche Mitteilung, 4. November 2009). Arbeit/Ausbildung Je nach dem, wie stark eine Person von der SP betroffen ist, ob sie sich in der Ausbildung befindet, eine Arbeitsstelle hat oder arbeitslos ist, sind andere Unterstützungsarten möglich. Angezeigt können sein: 37 • Anpassungen des Arbeitsplatzes • Berufsberatung • Arbeitsvermittlung • Übernahme von Kosten für die berufliche Erstausbildung, Umschulung oder Weiterbildung • Ausbildungskurse • Beschäftigungsstätten (im geschützten Rahmen) • Taggelder • Unter Umständen Kapitalhilfe zum selbstständig werden Wohnen Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Soziophobikerinnen/Soziophobiker im Bereich Wohnen unterstützt werden können: • Haushaltshilfe • Mahlzeitendienst • Unterstützung bei der Alltagsplanung und bei der Umsetzung dieser Pläne Wenn ein selbstständiges Wohnen vorübergehend nicht möglich ist, können • begleitete oder betreute Wohnformen angezeigt sein. Die Aufnahmebedingungen und Angebote der Institutionen variieren stark, weshalb am besten individuell Erkundigungen eingeholt werden. Finanzielle Sicherheit Wenn die finanzielle Existenzsicherung der betroffenen Person nicht mehr gegeben ist, müssen folgende Möglichkeiten abgeklärt werden: • Taggeldversicherung • Arbeitslosentaggelder • IV- oder Pensionskassenrente, Ergänzungsleistungen • Erspartes • Sozialhilfe 38 Weitere Ressourcen Nebst den bereits aufgelisteten gibt es weitere Unterstützungsmöglichkeiten, sowohl professionelle als auch solche in den privaten Netzwerken der Betroffenen: • Unterstützung in verschiedener Form durch Angehörige, Freundinnen/Freunde, Nachbarinnen/Nachbarn, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter et cetera • Hobbies • Vereine • Bildungs- und Freizeitkurse • spezialisierte Beratungsstellen (zu den Themen Familie, Alkohol et cetera) 4.2 Institutionen für die Behandlung der Sozialen Phobie Im Folgenden wird eine Auswahl von Institutionen vorgestellt, eingeteilt in die psychiatrischpsychologische Versorgung und die psychosoziale Hilfe und Beratung, welche die erwähnten Unterstützungsarten anbieten. Einige wichtige Adressen von Institutionen sind im Anhang F aufgelistet. 4.2.1 Psychiatrisch-Psychologische Versorgung Die psychiatrisch-psychologische Versorgungsstruktur kann aufgeteilt werden in stationäre und teilstationäre Einrichtungen, ambulante Dienste und die nicht-institutionelle Versorgung. Sie unterscheiden sich vor allem in Bezug auf die Intensität der Behandlung und der Betreuung (Ajdacic-Gross & Graf, 2003, S. 63f). Auf die nicht-institutionelle Versorgung durch Psychiaterinnen/Psychiater, Psychologinnen/Psychologen und Hausärztinnen/Hausärzte in privaten Praxen wird nicht näher eingegangen. Stationäre und teilstationäre Einrichtungen Ein stationärer Aufenthalt stellt einen grossen Einschnitt in das Leben von Betroffenen dar, kann aber aufgrund der intensiven Behandlung und Betreuung durch interdisziplinäre Teams (Psychiaterinnen/Psychiater, Psychologinnen/Psychologen, SA et cetera) eine Chance oder bei Selbst- und/oder Fremdgefährdung notwendig sein. Tageskliniken als teilstationäre Einrichtungen stellen eine weitere interdisziplinäre Behandlungsmöglichkeit dar. Betroffene können zuhause wohnen und besuchen tagsüber verschiedene Therapien in der Klinik. Weiter gibt es Nachtkliniken, deren interdisziplinäre Teams in den Abendstunden und in der Nacht Betreuung und Behandlung anbieten. Tages- und Nachtkliniken bieten die Möglichkeit, dass die 39 Integration in soziale Netzwerke weitgehend erhalten bleibt und diese gleichzeitig vorübergehend entlastet werden (Ajdacic-Gross & Graf, 2003, S. 63). Ambulante Dienste Bei der ambulanten Versorgung wohnen die Betroffenen in ihrem Wohnumfeld und gehen zu vereinbarten Terminen (oder auch notfallmässig) in ein Ambulatorium. Dort werden psychiatrische Abklärungen gemacht und die Betroffenen von interdisziplinären Teams behandelt. Bei Kindern und Jugendlichen sind hierfür Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste zuständig. 4.2.2 Psychosoziale Beratung und Hilfe Es gibt psychosoziale Beratungsstellen, deren Mitarbeitende Betroffene aus der ganzen Schweiz bei Fragen und Problemen in mehreren Lebensbereichen beraten, unterstützen und weitervermitteln (Triage an die psychiatrische Spitex, die IV et cetera). Dabei gibt es polyvalente (beispielsweise Sozialdienste) und spezialisierte Beratungsstellen. Im Folgenden werden zwei Institutionen vorgestellt, die auf die Beratung von psychisch kranken Menschen spezialisiert sind. Spezialisierte Beratungsstellen Die Pro Infirmis ist ein Verein, welcher Menschen mit körperlichen, geistigen und psychischen Behinderungen und ihre Angehörigen unterstützt. Ihr Kerngeschäft ist die Sozialberatung durch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie ist kostenlos und steht auch Soziophobikerinnen und Soziophobikern aus allen Landesteilen offen. In Basel Land ist hierfür de Stiftung Mosaik, im Wallis die Stiftung Emera zuständig. Beide haben das gleiche Angebot wie die Pro Infirmis und sind Partnerorganisationen von ihr. Die Beratung bezieht die ganze Lebenssituation der Betroffenen und somit viele Themen (unter anderem Alltagsbewältigung, Wohnen, Finanzen, Arbeit/Ausbildung et cetera) mit ein. Sie kann über mehrere Jahre bestehen und bei Bedarf auch im Wohnumfeld der Betroffenen stattfinden. In komplexen Fällen können Case Managerinnen/Case Manager der Pro Infirmis beigezogen werden. Anmeldungen für Beratungsgespräche werden per Telefon und per Kontaktformular auf der Pro Infirmis Homepage entgegengenommen. Die Beraterinnen/Berater der Pro Infirmis stehen auch nicht direkt Betroffenen (unter anderem SA) zur Verfügung, die Fragen zu den Themen (psychische, körperliche oder geistige) Behinderung und Integration haben. Sie informieren zudem über weitere Angebote der Pro Infirmis, beispielsweise den Bildungsklub, in welchem günstige Kurse für IV-Bezüger aus der ganzen Schweiz angeboten werden (Lara Elia, Sozialarbeiterin FH, persönliche Mitteilung, 4. November 2009). 40 Die Pro Mente Sana ist eine Stiftung, die sich in der Schweiz auf vielfältiger Ebene für die Anliegen von psychisch beeinträchtigten (und somit auch von SP betroffenen) Menschen einsetzt. Das interdisziplinäre Team besteht unter anderem aus Fachleuten aus den Bereichen Psychiatrie, Psychologie, Sozialarbeit und –pädagogik sowie Recht. Die Pro Mente Sana bietet Betroffenen, Angehörigen und Fachleuten kostenlose telefonische Beratungen bei psychosozialen und rechtlichen Problemen an. Die Rechtsberatung beantwortet Fragen zum Sozialversicherungsrecht und zum Sozialhilferecht (beispielsweise bei Schwierigkeiten mit der Krankenkasse, der Invalidenversicherung, dem Arbeitgeber oder in vormundschaftlichen und existenzsichernden Belangen), berät bei Auseinandersetzungen mit Institutionen und erteilt Auskünfte über die Rechte der Betroffenen und Angehörigen. Das psychosoziale Team berät Menschen in psychischen Krisen und ihre Angehörigen, bei Schwierigkeiten mit Fachpersonen und informiert über psychische Störungen, deren Behandlung und Unterstützungsangebote. Weitere Tätigkeiten der Stiftung sind das Publizieren von Ratgebern, Verzeichnissen, Broschüren sowie einer vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift, das Unterhalten einer Website mit nützlichen Adressen und Informationen sowie das Anbieten von Veranstaltungen und Kursen. Die vorgestellten Arten und Stellen für Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene sind nicht abschliessend. Je nach Kanton bestehen weitere Angebote und Projekte für psychisch kranke und somit auch von SP betroffene Menschen. 4.3 Selbsthilfe Selbsthilfe ist, wenn ein Mensch individuell oder in Gemeinschaft mit anderen Menschen etwas gegen seine Not unternimmt (Mäder, 2003, S. 267). Für von SP betroffene Menschen können folgende Arten von Selbsthilfe von Nutzen sein, da sie ihnen Wissen über die Ängste und Tipps für den Umgang mit diesen vermitteln können: • Internet (Anhang F) • Selbsthilfegruppen • (Selbsthilfe-) Bücher • Patientenratgeber Nun werden der Verein Angst- und Panikhilfe Schweiz (APhS) und die Stiftung Koordination und Förderung von Selbsthilfegruppen in der Schweiz (KOSCH) vorgestellt. Beide bieten von SP betroffenen Menschen Unterstützung im Bereich Selbsthilfe an: Die APhS ist eine Selbsthilfeorganisation. Sie bietet nicht nur Soziophobikerinnen/Soziophobikern Informationen, Beratung und Betreuung an. Auch für Angehörige, SA, Therapeuten, Medien et cetera 41 ist sie (via Telefon und Internet) eine nationale Anlaufstelle. Unter das breite Angebot der APhS fallen eine kostenlose Telefon-Hotline, eine Website, ein Chat, ein Forum, Öffentlichkeitsarbeit, Aufbau und Unterstützung von Selbsthilfegruppen sowie speziell für Mitglieder ein Patienten-Magazin und Treffen. Die Mitarbeitenden der Hotline sind Freiwillige, die nicht psychologisch oder medizinisch geschult sind. Sie leisten dadurch keine psychologische oder medizinische Beratung. Da die Mitarbeitenden aber selber von Angststörungen betroffen waren, können sie den Anrufenden einfühlsam zuhören, diese informieren und beraten, an welche Stellen sie sich wenden können. Für APhS-Mitglieder, aber auch für Personen, die sich eine Mitgliedschaft nicht leisten können, bieten sie zudem eine von Fachärztinnen/Fachärzten für Angststörungen unterstützte Ärztinnen-/Ärztevermittlung an. Die KOSCH ist nebst der APhS für Soziophobikerinnen/Soziophobiker eine Anlaufstelle, um lokale Selbsthilfegruppen zu finden. Sie ist die Dachorganisation der regionalen Kontaktstellen für Selbsthilfegruppen in der Schweiz. Sie vernetzt und koordiniert die lokalen Selbsthilfezentren und bietet Informationen über lokale Selbsthilfegruppen sowie Hilfe beim Aufbau von Selbsthilfegruppen an. Es bestehen mehrere Selbsthilfegruppen in der Schweiz, die sich mit Angststörungen, teilweise auch spezifisch mit der SP befassen. Betroffene können sich telefonisch oder per E-Mail bei der KOSCH, bei den lokalen Selbsthilfezentren oder bei der APhS informieren, ob es in ihrer Nähe eine passende Selbsthilfegruppe gibt. So unterschiedlich die Ursachen, die aufrechterhaltenden Faktoren und die Folgen der SP sein können, so individuell sind auch adäquate Behandlungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für die Betroffenen auszuwählen. Die im biopsychosozialen Modell beschriebenen Wechselwirkungen zwischen der biologischen, psychischen und sozialen Ebene sind indes auch bei der Behandlung der SP mit zu berücksichtigen. 4.4 Hilfe für Angehörige Die SP hat nicht nur Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen, sondern auch auf dasjenige ihrer Bezugspersonen. Es gibt in der Schweiz Angebote, die das Leiden und die Scham- und Schuldgefühle der Angehörigen mindern, deren Krankheitsverständnis mehren und deren Überforderung thematisieren. Information und Beratung Das Wissen über die Krankheit ist auch für Angehörige zentral. So können sie die Betroffenen, deren Erleben und Verhalten besser verstehen. Nebst Patientenratgebern, Selbsthilfebüchern und dem Internet stellt das persönliche oder telefonische Gespräch mit den behandelnden Fachpersonen (beispiels42 weise mit Ärztinnen/Ärzten) eine gute Informationsquelle dar. Für das Gespräch muss allerdings die schriftliche oder die mündliche Einwilligung der Soziophobikerin/des Soziophobikers vorliegen (Guillod, 2003, S. 38). Die beschriebenen Beratungsangebote der Pro Infirmis, der Pro Mente Sana und der APhS stehen auch den Angehörigen von SP betroffenen Menschen offen. Sie können sich dort über die Krankheit informieren, damit in Zusammenhang stehende Fragen besprechen oder auch einfach ein offenes Ohr finden. Angehörige für Angehörige Dem Dachverband Vereinigung der Angehörigen von Schizophrenie- und Psychisch Kranken Schweiz (VASK) sind die einzelnen regionalen/kantonalen Vereinigungen (beispielsweise die VASK Zürich) angeschlossen, diese arbeiten jedoch autonom. Sie wenden sich an Mütter, Väter, Geschwister, Kinder, Partnerinnen und Partner, Verwandte und Freundinnen/Freunde von psychisch kranken Menschen. Das Angebot der regionalen/kantonalen Vereinigungen ist breit. Es umfasst unter anderem Telefonberatungen (offen für Anrufende aus der ganzen Schweiz), Beratungsstellen, Webseiten, Erfahrungsaustausch in Selbsthilfegruppen und Seminare. Die Selbsthilfegruppen der VASK sind für Angehörige von Betroffenen mit verschiedenen psychischen Störungen und somit nicht spezifisch auf die SP ausgerichtet. Auf der Homepage der Stiftung KOSCH werden die aktiven Selbsthilfegruppen für Angehörige von Menschen mit Angsterkrankungen publiziert. Die KOSCH bietet des weiteren Hilfe beim Aufbau von Selbsthilfegruppen an. Weitere Unterstützungsangebote Wenn sich Angehörige mit der Situation überfordert fühlen, ist es wichtig, dass sie ermutigt werden, Hilfe von Fachpersonen (beispielsweise von Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten) in Anspruch zu nehmen und/oder Entlastungsangebote (Spitex, Nachtkliniken et cetera für die Betroffenen) in Betracht zu ziehen. Es lohnt sich auch, bei den jeweiligen Institutionen (Psychiatrischen Kliniken et cetera) nachzufragen, ob Unterstützungsangebote für Angehörige (beispielsweise von Fachpersonen geleitete Angehörigengruppen) angeboten werden. Angehörige müssen auch gut für sich selbst sorgen. Einerseits für ihr eigenes Wohlbefinden, andererseits können sie auch den Betroffenen nicht mehr helfen, wenn sie selber krank werden. 43 5. Soziale Phobie in der Sozialen Arbeit In diesem Kapitel wird aufgezeigt, weshalb die SP ein Problembereich der SA sein kann. Anschliessend werden relevante Aspekte der systemischen Denkfigur, einem Instrument der Sozialen Arbeit, erläutert. Das Kapitel abrunden wird eine Auflistung relevanter Aspekte, die im Umgang mit Betroffenen zu berücksichtigen sind. 5.1 Berührungspunkte von Sozialer Phobie und Sozialer Arbeit: Soziale Probleme Im Folgenden werden Berührungspunkte der SP und der Sozialen Arbeit aufgezeigt, indem auf den Gegenstand der Sozialen Arbeit eingegangen wird. Im Anschluss wird der Bezug von sozialen Problemen (als zentraler Gegenstandsbereich der Sozialen Arbeit) zur SP hergestellt. Gegenstand Sozialer Arbeit sind Individuen als Komponenten sozialer Systeme, beziehungsweise soziale Systeme mit Individuen als Komponenten. Deren Probleme manifestieren sich in vier Klassen, nämlich als physikalische und chemische, biologische, psychische und soziale Probleme. Den Adressatinnen/Adressaten Sozialer Arbeit fehlen die Ressourcen (oder sie können diese nicht nutzen oder kennen diese nicht) und können die Probleme aus eigener Kraft zugunsten Gesundheit, Wohlbefinden und sozialer Integration nicht mildern, lösen, beziehungsweise neue Probleme nicht vermeiden (praktische Probleme) (Geiser, 2007 S. 65f). Alle Professionellen der Sozialen Arbeit verbindet, dass sie soziale Probleme von Individuen und sozialen Systemen bearbeiten. Ein soziales Problem ist nach Obrecht (zit. nach Geiser, 2007, S. 60): a) ein praktisches Problem, das b) ein sozialer Akteur c) mit seiner interaktiven Einbindung und Position (Rollen-Status) in die sozialen Systeme hat, deren Mitglied er faktisch ist. Ein solches Problem äussert sich als Spannungszustand (=Bedürfnis) innerhalb des Nervensystems als Folge des Auseinanderfallens zwischen einem im Organismus registrierten Istwert in Form des Bildes oder internen Modells des Individuums in seiner Situation und einem organisimisch repräsentierten Sollwert (Bedürfnisbefriedigung). Dieser Spannungszustand kann mit den verfügbaren internen (Motivation, Wissen und Können) und externen Ressourcen (vorderhand oder endgültig) nicht reduziert werden. Im Folgenden werden soziale Probleme in Bezug auf Probleme in sozialen Interaktionen und solche in Bezug auf die soziale Position unterschieden (Geiser, 2007). In den Klammern werden die Bedürfnisse, die beim Auftreten des jeweiligen sozialen Problems nicht erfüllt sind, genannt. 44 Probleme in Bezug auf soziale Interaktionen • Unfreiwilliges Alleinsein, fehlende Mitgliedschaften, letztlich soziale Isolation (Beziehungen und Austausch) • Gebundensein in letztlich belastenden Pflichtbeziehungen und diese nicht beeinflussen können (sozial(kulturell)e Zugehörigkeit/Mitgliedschaft) • Sozialer Ausschluss aufgrund von kulturellen Differenzen, mangels Sprachkenntnissen, wegen fehlender Orientierung über Gemeinwesen bzw. Institutionen. Im Extremfall Diskriminierung aufgrund Alter, Geschlecht, Hautfarbe (sozial(kulturell)er Zugehörigkeit/Mitgliedschaft) • Ungerechte – auf Dauer einseitige bzw. ungleichwertige – Tauschbeziehungen im privaten und/oder beruflichen Bereich, beispielsweise „Ausgenutztwerden“, Privilegierung anderer ((Tausch-)Gerechtigkeit) Probleme in Bezug auf die soziale Position • Unmöglichkeit, Einfluss auf den Zugang zu Ressourcen zu nehmen, die für die Bedürfnisbefriedigung unerlässlich sind (Kompetenz und Kontrolle in Bezug auf soziale Kontexte) • Tiefer Status, Statusunvollständigkeit und Statusungleichgewicht (Zugehörig- keit/Mitgliedschaft) • Fremdbestimmung wie Sklaverei, aber auch durch künstliche Verknappung lebensnotwendiger Güter oder durch Drohung und Gewalt (Autonomie) • Soziale Deklassierung, dauerhaft fehlende soziale Anerkennung – allenfalls soziale Verachtung (soziale Anerkennung) (Geiser, 2007, S. 59f) Nebst sozialen Problemen gibt es wie erwähnt drei weitere Problemklassen: Die Biologische, die Psychische und die Physikalisch-Chemische. Geiser (2007) weist darauf hin, dass jedes Problem einer bestimmten Klasse zu einem Problem in einer anderen Klasse führen kann. In anderen Worten, psychische Probleme können unter anderem zu sozialen Problemen führen; und umgekehrt können soziale Probleme psychische zur Folge haben. Wenn die Betroffenen die sozialen Probleme nicht lösen können, kann dies zu weiteren Störungen führen, welche das Problemlösungsvermögen weiter reduzieren. Wenn die beschriebenen Auswirkungen der SP auf das Leben der Betroffenen mit der Auflistung verschiedener Arten von sozialen Problemen verglichen werden, wird ersichtlich, dass Soziophobikerinnen/Soziophobiker oftmals unter mehreren sozialen Problemen (insbesondere unfreiwilligem Alleinsein, fehlenden Mitgliedschaften, sozialer Isolation, tiefem Status, Statusunvollständigkeit, Statusungleichgewicht und/oder dauerhaft fehlender sozialer Anerkennung) leiden. 45 Unabhängig von Adressatengruppen, Organisationen (beispielsweise aus dem Sozial- oder Gesundheitswesen) oder von spezifischen Problemen machen soziale Probleme den zentralen Gegenstand der Sozialen Arbeit aus. Psychische Krankheiten wie die SP können dabei Ursache oder Folge sozialer (und anderer) Probleme sein, weshalb sie ein Problembereich der Sozialen Arbeit sind. Soziale, biologische, psychische und physikalisch-chemische Probleme gehen mit unbefriedigten Bedürfnissen einher. 5.2 Die systemische Denkfigur (SDF) Im Folgenden werden die Entwicklung, der Nutzen und die Grundlagen der SDF dargestellt. 5.2.1 Grundsätzliches zur SDF Nach der Erläuterung der Entwicklung und des Nutzens der SDF, werden die wichtigsten Schritte bei deren Anwendung genannt. Silvia Staub-Bernasconi hat als Sozialarbeiterin und Soziologin die Prozessual-systemische Denkfigur (PSDF) entwickelt. Dieses Modell erlaubt es, Dimensionen sozialer Probleme zu erfassen und zu beschreiben. Die PSDF wurde weiterentwickelt und in das von Werner Obrecht (Soziologe, Philosoph und Sozialarbeitswissenschafter) ausgearbeitete Systemtheoretische Paradigma Sozialer Arbeit und die dazugehörigen Teiltheorien eingebettet. Heute wird das Modell unter dem Namen SDF gelehrt, angewandt und weiterentwickelt (Geiser, S.22f). Im Buch „Problem- und Ressourcenanalyse in der Sozialen Arbeit“ von Kaspar Geiser (2007), Sozialarbeiter und Dozent an der Hochschule für Soziale Arbeit in Zürich, wird die SDF umfassend beschrieben. Deshalb basieren meine nachfolgenden Ausführungen auf dieser Publikation. Die SDF ist kognitives und praktisches Instrument für SA. Ihre Anwendung unterstützt die systemische und die systematische Erfassung, Strukturierung, Beschreibung und Bewertung von Informationen aus dem Gegenstandsbereich Sozialer Arbeit (Geiser, 2007, S. 25). Mittels SDF werden lebensrelevante Bereiche eines Menschen und dessen soziale Beziehungen berücksichtigt. So wird ein Mensch ganzheitlich erfasst, und man verliert sich nicht in einzelne Aspekte, sondern sieht deren Zusammenhänge und Wechselwirkungen. 46 Die Anwendung der SDF besteht aus folgenden Schritten (Geiser, 2007, S. 27f): • Analyse des Individuums (Ausstattung) • Analyse sozialer Systeme bzw. sozialen Beziehungen (Positions- und Interaktionsstruktur) - Austauschbeziehungen (Horizontal strukturierte Systeme bzw. Beziehungen) - Macht-/Abhängigkeitsbeziehungen (Vertikal strukturierte soziale Systeme bzw. Beziehungen) • Begründung von Problemen bzw. von problemlösenden Ressourcen Diese Schritte werden im Folgenden näher beschrieben. 5.2.2 Analyse des Individuums In diesem Kapitel wird erläutert, wie SA mit der SDF Individuen als Komponenten sozialer Systeme erfassen und beschreiben können. Abb. 4: Die systemische Denkfigur (Individuum) (Geiser, 2007) Individuen werden in Form einer SDF dargestellt (Abbildung 4). In den fünf „Ecken“ (Dimensionen) werden Eigenschaften des Individuums mit (unter anderem) sozialer Bedeutung beschrieben. Diese „Ausstattungseigenschaften“ werden unterschieden in Eigenschaften in den Dimensionen Umwelt intern (Ui), Umwelt Extern (Ue), Wissen (M) und Erlebnismodi (E), Handeln/Verhalten (A) sowie Rezeptoren (R) (Geiser, 2007). Im Anhang B werden die einzelnen Dimensionen näher beschrieben. Im weiteren Verlauf dieser Arbeite werden die Kürzel dieser Dimensionen verwendet. Das Resultat einer strukturierten Erfassung der verschiedenen Eigenschaften (in Form von Aussagen über Fakten), ist ein Bild über die Ausstattung eines Individuums zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die einzelnen Ausstattungsdimensionen werden in Bezug auf soziale Beziehungen als Austauschmedien 47 und Machtquellen betrachtet, die in ihrer Gesamtheit als Austausch- und Machtpotenzial eines Individuums bezeichnet werden. Die visuell dargestellten Verbindungslinien zwischen den Dimensionen stellen konkrete systeminterne Interaktionen dar und machen dadurch die interaktive Dynamik der SDF sichtbar (Geiser, 2007). Das Beschreiben eines Individuums anhand der SDF ergibt ein umfassendes Bild über dessen Ausstattung und macht die Vermischung und gegenseitige Beeinflussung der verschiedenen Dimensionen – wie beim biopsychosozialen Modell - sichtbar. Die Ausstattungsdimensionen des Individuums sind in Bezug auf soziale Beziehungen als Austauschmedien und Machtquellen zu verstehen. Das Fazit der Austauschmedien wird als Austauschpotenzial und das Fazit der Machtquellen als Machtpotenzial eines Individuums bezeichnet. 5.2.3 Analyse sozialer Systeme beziehungsweise sozialer Beziehungen Die Ausstattung eines Individuums hat Einfluss auf die sozialen Beziehungen/sozialen Systeme und umgekehrt. Nebst diesem Einfluss wird auf die Unterscheidung zwischen Austausch- und Abhängigkeits-/Machtbeziehungen eingegangen. Austauschbeziehungen Abb. 5: Die Ausstattungsdimensionen der Denkfigur als Austauschmedien (Geiser, 2007, S. 192) 48 Abb. 6: Die Austauschbeziehung (Geiser, 2007, S. 192) Die SDF in Abbildung 5 zeigt die Ausstattungsdimensionen eines Individuums als Austauschmedien. In anderen Worten, die Eigenschaften der einzelnen Dimensionen können mit anderen Menschen/sozialen Systemen ausgetauscht werden. Austausche finden zwischen Individuen (innerhalb eines sozialen Systems oder zwischen sozialen Systemen), die miteinander in horizontaler Beziehung stehen, statt. Diese Beziehungen werden Austauschbeziehungen genannt und werden aus mindestens zwei sich auf gleichem sozialem Niveau bewegenden Individuen gebildet, das heisst, keines der Individuen verfügt (idealtypischerweise) über die Kontroll- oder Entscheidungsinstanz (Geiser, 2007, S. 27). Das Austauschpotenzial eines Individuums (als das Fazit der Austauschmedien) bildet die Voraussetzung, um mit anderen Menschen in Beziehung zu treten. In anderen Worten, wenn ein Individuum im weitesten Sinne genug attraktiv ist, kann es befriedigende (partnerschaftliche, kollegiale et cetera) Beziehungen aufnehmen, mitgestalten und erhalten (Geiser, 2007, S. 129). Die horizontalen Verbindungen zwischen zwei SDF veranschaulichen mögliche Interaktionsebenen der Beteiligten (Abbildung 6). Die Analyse einer Austauschbeziehung ergibt ein Bild über die Austauschmuster. Je nach vorhandenen Eigenschaften und Austauschmuster ist das „Geben und Nehmen“ der Beteiligten ausgeglichen (Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit der Beziehung), oder aber die Austauschmuster verweisen auf individuelle und/oder soziale Probleme (Geiser, 2007). 49 Macht-/ Abhängigkeitsbeziehungen Abb. 7: Die Ausstattungsdimensionen der Denkfigur als Machtquellen (Geiser, 2007, S. 211) Abb. 8: Die vertikal strukturierte Beziehung (Geiser, 2007, S. 215) 50 Bei einer vertikalen Macht-/Abhängigkeitsbeziehung verfügt das übergeordnete Individuum (idealtypischerweise) über mehr Entscheidungs- und Kontrollkompetenz und steht deshalb hierarchisch über dem Anderen (Geiser, 2007, S. 28). Die SDF in Abbildung 7 zeigt die Ausstattungsdimensionen eines Individuums als Machtquellen. Das heisst, bestimmte Ausstattungseigenschaften (Machtquellen) eines Individuums sind beispielsweise eine Quelle für Autonomie, oder Mittel dafür, um andere Menschen von sich abhängig zu machen. Die Machtquellen können Interaktionen (die vertikalen Verbindungen zwischen zwei SDF) ermöglichen, verhindern, beziehungsweise bestimmte Machtformen begründen (Abbildung 8). Die zusammenfassende Beschreibung und Bewertung der Ausstattung eines Individuums mit Machtquellen wird dabei als Machtpotenzial bezeichnet. Dieses ist in Bezug auf eine konkrete Beziehung mitbestimmend für die Chancen der Beteiligten, auf die Beziehung mehr oder eben weniger Einfluss zu nehmen (Geiser, 2007). Die Analyse von sozialen Beziehungen und die daraus entstehenden Bilder ergänzen das Bild der Ausstattung eines Individuums, wodurch Zusammenhänge sichtbar werden. Je nach Ausstattung eines Individuums verfügt es über mehr oder weniger Austausch- und Machtpotenzial. Das Austauschpotenzial bestimmt, wie „attraktiv“ ein Individuum für Andere ist und gilt als Voraussetzung, um mit anderen „attraktiven“ Menschen befriedigende Beziehungen aufnehmen und pflegen zu können. Das Machtpotenzial kann, je nach seiner qualitativen und quantitativen Beschaffenheit mehr oder weniger grosse Chancen für Machtausübung beinhalten, oder aber durch ihr Fehlen Abhängigkeiten entstehen lassen. Wenn eine Austauschbeziehung ungleichwertig ist, leidet ein Individuum unter sozialen Problemen in Form von Interaktionsproblemen, wenn ein Individuum von einem Anderen abhängig ist, unter sozialen Problemen in Form von Positionsproblemen (Geiser, 2007). Die verschiedenen Arten dieser Probleme in Bezug auf soziale Interaktionen beziehungsweise die soziale Position wurden vorangehend beschrieben. Aus den Ausführungen lässt sich folgern, dass eine bessere Ausstattung eines Individuums dessen Austausch- und Machtpotenzial vergrössert und dadurch Probleme in sozialen Beziehungen verhindert, verkleinert oder gelöst werden können oder das Eingehen von sozialen Beziehungen dadurch erst möglich gemacht wird. Durch das Erkennen von vertikalen Beziehungen können SA in Zusammenarbeit mit den Beteiligten möglicherweise einen Ausgleich schaffen und dadurch vertikale zu horizontalen Beziehungen machen. 51 5.2.4 Begründung von Problemen und von problemlösenden Ressourcen Wer bestimmt und begründet, was ein Problem/eine Ressource ist, und wann besteht Handlungsbedarf? In diesem Kapitel werden diese Fragen beantwortet. Die Beschreibung und die Bewertung einer Situation als problematisch, ressourcenträchtig oder als unproblematisch ist ein Prozess, der wenn möglich gemeinsam mit den Adressatinnen und Adressaten der Sozialen Arbeit geschieht. Die Begründung für die Problembestimmung setzt ein Werturteil im Sinne einer bewerteten Aussage voraus. Als Referenzgrössen für die Werturteile dienen dabei bestimmte (Soll-) Werte beziehungsweise Bedürfnisse in Bezug auf die zuvor beschriebenen biologischen, psychischen und sozialen Fakten (Geiser, 2007). Dabei geht es gemäss Geiser (2007) um Werte, • die für das unmittelbare Funktionieren und Bestehen des Organismus unabdingbar sind, • die innerhalb eine bestimmten sozialkulturellen Kontextes als für die soziale Integration erforderlich erscheinen und die Voraussetzungen erfüllen, um die Werte gemäss a) sicherzustellen bzw. die Bedürfnisbefriedigung dauerhaft zu gewährleisten (S. 254) Die Begründung für die Problembestimmung (Ausstattungs-, Austausch- oder Machtprobleme) können SA einerseits in einer normativen Bewertung finden. Dabei wird bei einer als problematisch angesehenen sozialen Situation nach den „eigentlich“ situationsangemessenen sozialen Normen und Standards und damit nach den Werten gefragt wird, die nicht realisiert scheinen. Andererseits kann die Problembegründung mittels Feststellung einer dauerhaften Nicht-Befriedigung von Bedürfnissen gefunden werden. Dabei wird aufgezeigt, dass ein weiterer Aufschub der Bedürfnisbefriedigung negative Konsequenzen nach sich zieht. Die Begründung kann weiter durch den Verweis auf Erklärungstheorien (beispielsweise aus der Psychologie oder der Soziologie) erfolgen. Auch so wird ersichtlich, dass sich die bestehende Situation bei Nicht-Intervention wahrscheinlich nicht nur negativ verfestigt, sondern in problemverschärfender Weise verändert und/oder Folgeprobleme verursacht. Aus solchen möglichen Zukunftsbildern (Prognosen) kann ein Handlungsbedarf abgeleitet werden (Geiser S. 266f). Basierend auf der Problembestimmung und –begründung werden Fakten als Ressourcen bewertet, aktiviert und eingesetzt. Geiser (2007, S. 342) unterscheidet interne und externe Ressourcen: 52 Interne Ressourcen Dazu gehören „Gesundheit, Kraft, Wissen, Intelligenz und Fertigkeiten, soziale Kompetenzen und ökonomische Mittel von Adressatinnen und Adressaten.“ Externe Ressourcen Externe Ressourcen (im Sinne des Subsidiaritätsprinzips) können im nahen sozialen Umfeld (Familie, Freundinnen/Freunde, Bekannte) und im weiteren sozialen Umfeld (Arbeitgeberin/Arbeitgeber, Nachbarinnen/Nachbarn, Selbsthilfegruppen et cetera) der Betroffenen erschlossen werden. Weiter können Wissen, Fertigkeiten, Einfluss und ökonomischen Güter von privaten und kirchlichen Instanzen (anderen Professionellen, Hilfswerken et cetera) sowie Wissens- und ökonomische Ressourcen des staatlichen Systems sozialer Sicherheit hinsichtlich Existenzsicherung, Wohnraum, Beschäftigung (Sozialversicherungen, Arbeits- und Wohnungsämter et cetera) oder auch des Gesundheitssystems zur Problemlösung beitragen. Nun kennen wir die wichtigsten Schritte für den Prozess der Problem- und Ressourcenanalyse. Es gibt einige Punkte, die SA in diesem Prozess beachten sollten. 5.3 Der Umgang mit Betroffenen Die Beziehung zwischen SA und Betroffenen stellt eine soziale Beziehung dar, was – in Anbetracht des Störungsbildes – für Soziophobikerinnen/Soziophobiker schwierig ist. Es gibt einige Aspekte, die SA beachten sollten, sodass diese Beziehung für die Betroffenen eine weniger grosse (subjektive) Bedrohung darstellt. Willutzki (2002) hat sich mit der Beziehung zwischen Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten und Soziophobikerinnen/Soziophobikern auseinandergesetzt. Ihre Erkenntnisse sind auf die Beziehung zwischen SA und Betroffenen übertragbar. Die Beziehungen zwischen SA und betroffenen Personen sind vertikal strukturiert, da Erstere als Repräsentantinnen/Repräsentanten einer Organisation über eine Entscheidungs- und Kontrollinstanz verfügen (Geiser, 2007, S. 235). Je nach Institution und deren Auftrag stellen diese Beziehungen für die Klientinnen/Klienten Zwangsbeziehungen dar, das heisst, die Betroffenen hatten gar keine andere Wahl, als mit den SA in Kontakt zu treten. So müssen sie, trotz möglicherweise sehr grossen Ängsten, zu den Terminen erscheinen. Bei einem Erstkontakt zwischen SA und Betroffenen stellt die Sozialarbeiterin/der Sozialarbeiter einerseits eine fremde Person dar, andererseits steht die betroffene Person im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Dies sind bereits zwei Tatsachen, die für Soziophobikerinnen/Soziophobiker belastend sind. Weiter fühlen sich diese möglicherweise durch die Vorschläge oder Forderungen („Melden Sie sich 53 beim regionalen Arbeitsvermittlungszentrum an.“) der SA überfordert und gleichzeitig möchten sie sich nicht vor den Augen der SA blamieren. Eine schwierige Situation, weshalb Betroffene oftmals in ihrer Aufnahmekapazität eingeschränkt sind (Willutzki, 2002). Deshalb kann es hilfreich sein, wenn SA: • sich gegenüber den Betroffenen freundlich und sie persönlich wertschätzend verhalten. • Betroffene würdigen und loben, dass sie Termine trotz den Ängsten wahrnehmen und/oder Fortschritte machen. • aufgrund der eingeschränkten Aufnahmekapazität der Betroffenen diese um Rückmeldung, Wiederholung oder Zusammenfassung bestimmter Gesprächsinhalte bitten. Weiter können Betroffene ermuntert werden, Notizen zu machen. • die äusseren Rahmenbedingungen so gestalten, dass die Ängste der Soziophobikerinnen/Soziophobiker nicht zusätzlich aktiviert werden. So sollte der Wartebereich wenn möglich genug Raum bieten, damit Betroffene nicht zu nahe bei anderen Menschen sitzen müssen. Weiter ist es sinnvoll, dass sie nicht zu lange warten müssen, da sie sonst bei einem nächsten Termin aus Angst „gezwungen“ werden, das Wartezimmer zu vermeiden und deshalb zu spät zum Termin erscheinen. • die Verbindlichkeit der Termine erhöhen, indem die Wichtigkeit der Sozialen Arbeit betont wird und/oder Vereinbarungen für den Fall, dass die Person aufgrund der Ängste nicht zu einem Termin erscheinen kann, getroffen werden. • das in den alltäglichen Interaktionen wohlgemeinte Verhalten, sich jemandem speziell zuzuwenden und den Blickkontakt zu intensivieren, um grosses Interesse zu signalisieren, vermeiden. Der direkte Blickkontakt kann bei Soziophobikerinnen/Soziophobikern Angst auslösen. • mit schriftlichen Aufzeichnungen, grafischen Darstellungen et cetera arbeiten, auf welche sich SA und Betroffene gemeinsam konzentrieren können. Dadurch wird der direkte Blickkontakt reduziert. • die räumliche Distanz zur betroffenen Person vergrössern. So erleben sich Betroffene weniger stark beobachtet und fokussiert. • darauf achten, was Gesprächspausen bei den Betroffenen auslösen. Bei den Einen ist es sinnvoll, Gesprächspausen zu reduzieren oder zu vermeiden, da diese bei den Betroffenen einen Aufschaukelungsprozess zwischen Selbstaufmerksamkeit und negativer Bewertung auslösen können. SA können in diesem Fall das Schweigen überbrücken und das Gespräch aufrecht erhalten. Dies kann durch Zusammenfassungen des Besprochenen oder Ermunterung der betroffenen Person geschehen. Bei den Anderen ist es hingegen wichtig, ihnen Zeit zum Überlegen und Antworten zu geben, da sie sonst denken, sie seien zu langsam. 54 • Betroffene auf Eigenheiten oder Gewohnheiten ansprechen, die sie durch die fehlende soziale Rückmeldung und/oder durch die Angstsymptomatik an sich entwickelt haben (Körpergeruch durch mangelnde Hygiene, übermässige Parfümierung, ungepflegte Haare et cetera). Auch wenn es heikel ist, kann die Thematisierung sinnvoll sein, weil diese Eigenschaften oder Gewohnheiten dazu führen können, dass Betroffene von Anderen negativ bewertet werden. Einerseits fallen so von Betroffenen gemachte „Hypothesen“ über die Ablehnung durch Andere weg und andererseits ist die Wahrscheinlichkeit in sozialen Situationen grösser, dass sie erfolgreich verlaufen. Das Ansprechen der Eigenheiten oder Gewohnheiten sollte auf Basis einer guten Beziehung zwischen SA und Betroffenen geschehen. Sprachlich ist es hilfreich, Ich-Botschaften zu formulieren und sachlich, direkt und konstruktiv über die eigenen Wahrnehmungen zu sprechen. Weiter kann es helfen darauf hinzuweisen, dass die sozialen Ängste und der damit einhergehende Rückzug solche Eigenheiten geradezu fördern, weshalb viele Betroffene entsprechende Probleme haben (Willutzki, 2002). Willutzki (2002) macht zudem darauf aufmerksam, dass die Ängste der Betroffenen oftmals unterschätzt werden, da sie in einer guten Beziehung zwischen Therapeutin/Therapeut (in unserem Fall SA) und betroffener Person nicht so stark oder gar nicht auftreten. Dies kann dazu führen, dass so hohe Anforderungen an die Betroffenen gestellt werden, die sie bei stark aktivierter Angst nicht bewältigen können, sodass Misserfolge die Folge sind. Deshalb rät Willutzki (2002), sich immer wieder die Innenperspektive der Betroffenen vor Augen zu führen, die sozialen Ängste sehr ernst zu nehmen und diese nicht zu übergehen. Die beschriebenen Hinweise können es Betroffenen erleichtern, die Beziehung zu SA als Ressource wahrzunehmen und von der Beziehung zu profitieren. 55 III SCHLUSSTEIL 6. Beantwortung der Fragestellungen und Fazit Im Schlussteil wird das im Hauptteil vermittelte Wissen zusammengefasst und in Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellungen dieser Bachelorarbeit verknüpft. Dies soll SA befähigen, Betroffene zu erkennen, zu verstehen, zu triagieren und zu unterstützen. 6.1 Was ist die Soziale Phobie? Nach einer Zusammenfassung des 2. Kapitels ziehe ich Folgerungen in Bezug auf die Früherkennung und die Behandlung der SP. Die SP ist eine psychische Störung, die zur Klasse der Angststörungen gehört. Sie zeichnet sich durch eine dauerhafte und übertriebene Angst vor einer oder mehreren sozialen und/oder Leistungssituationen aus. Die Betroffenen befürchten, dass ihr Verhalten oder ihre Angstsymptome von Anderen als demütigend oder peinlich beurteilt werden könnte/könnten. Obwohl sie einsehen, dass die Angst übertrieben und unvernünftig ist, können die Betroffenen nicht gegen die Ängste, die sich bis zu einem Panikanfall steigern können, ansteuern. So bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die soziophobischen Situationen zu vermeiden, oder sie unter intensiven Ängsten oder Unbehagen zu ertragen. Die SP geht mit einem grossem Leidensdruck und deutlichen psychosozialen Einschränkungen einher. Die Diagnose wird von Psychiaterinnen/Psychiatern oder Psychologinnen/Psychologen gestellt. Diese sind auch für die im Hinblick auf die Behandlung und deren Verlauf wichtige differentialdiagnostische Abgrenzung zuständig. Dasselbe gilt für die Abklärung von Komorbiditäten. Soziophobikerinnen/Soziophobiker sind häufig von einer oder mehreren zusätzlichen, psychischen Störung/Störungen betroffen. Die Komorbiditäten erschweren es, die SP zu erkennen (Kapitel 2). Es kann sein, dass SA denken, jemand ziehe sich aus Antriebsverlust aufgrund einer Depression zurück, oder dass eine Klientin/ein Klient „nur“ ein Alkoholproblem hat und SA nicht beachten, dass die Klientin/der Klient ihre/seine sozialen Ängste mit dem Alkohol zu unterdrücken versucht. Deshalb sollten SA die Gründe für verschiedene Verhaltensweisen genauer explorieren. Es sind etwa 7 von 100 Menschen, wobei der Frauenanteil grösser ist, während ihres Lebens von einer SP betroffen. Die Erkrankung beginnt am häufigsten im Kindes- und Jugendalter und zeigt in der Regel einen chronischen Auf und Ab-Verlauf. 56 Das biopsychosoziale Modell besagt, dass sowohl bei der Ätiologie, der Krankheitsentwicklung und der Behandlung psychischer Krankheiten biologische, psychologische und soziale Faktoren eine Rolle spielen. In Bezug auf die SP werden verschiedene Ursachen diskutiert und erforscht, unter anderem biologische Dispositionen, Lerntheorien (insbesondere das Modell-Lernen und die klassische Konditionierung) und bestimmte Interaktions- und Erziehungsstile der Eltern. Übereinstimmend ergaben verschiedene Studien, dass der Mandelkern von Personen mit SP insbesondere auf die Wahrnehmung von Gesichtern mit ärgerlichem Ausdruck stärker reagiert als bei Kontrollpersonen. Diese Überaktivierung geht bei erfolgreicher Behandlung zurück. Ebenfalls gut belegt sind die zentralen Aussagen des kognitiven Modells von Clark und Wells. Es besagt, dass insbesondere die erhöhte Selbstaufmerksamkeit und die Sicherheitsverhaltensweisen eine grosse Rolle bei der Aufrechterhaltung der SP spielen. Weiter gilt das Vermeidungsverhalten als die SP aufrechterhaltend, da dadurch Gegenkonditionierungen oder Löschungen nicht möglich sind. In empirischen Studien wurde erwiesen, dass bei der Entstehung einer SP sowohl biologische, psychologische und soziale Faktoren in jeweils unterschiedlichem Masse zusammenwirken (Kapitel 2). Ich zeige dies anhand eines Beispiels auf: Wenn davon ausgegangen wird, dass einzig ein überbehütender Erziehungsstil „schuld“ ist für die Entstehung einer SP, müssten demnach sämtliche überbehütenden Kinder an SP erkranken. Folglich würden all diese Personen „geheilt“ sein, sobald die elterliche Erziehung abgeschlossen ist. Da dies nicht der Fall ist, sind weitere ursächliche Faktoren und deren Wechselwirkungen mit zu berücksichtigen und somit in die Behandlung mit einzubeziehen. Es kann aber beispielsweise im sozialpädagogischen Kontext klar sein/werden, dass die Eltern überbehütend waren/sind. In diesem Fall kann es hilfreich sein, der/dem Betroffenen Lernfelder zu bieten, in welchen sie/er durch eigenes Handeln positive Erfahrungen sammeln kann. Oder, wenn die Eltern überkritisch sind/waren, kann es der Soziophobikerin/dem Soziophobiker helfen, wenn sie/er ermutigt und gelobt wird. Beides kann positive Auswirkungen auf das Selbstbild und das Selbstvertrauen der Betroffenen haben. SA können Soziophobikerinnen/Soziophobikern Schuldgefühle nehmen, wenn sie ihnen vermitteln, dass biologische Dispositionen einen ursächlichen Faktor für die SP darstellen können. Es ist aber ebenfalls wichtig, dass bei den Betroffenen die Hoffnung auf und die Motivation für eine Veränderung ihrer Situation geweckt oder gestärkt wird. So sollen sie auch darauf hingewiesen werden, dass Lernerfahrungen gegenkonditioniert/gelöscht und somit auch Gehirnstrukturen verändert werden können und die Überaktivierung des Mandelkerns bei erfolgreicher Behandlung erwiesenermassen verschwindet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die SP eine sehr ernstzunehmende Störung ist, die oftmals mit einem grossen Leidensdruck, komorbiden Störungen und psychosozialen Beeinträchtigungen einhergeht und in der Regel chronisch verläuft. Dies determiniert die Wichtigkeit, die SP frühzeitig zu er- 57 kennen. Ein weiteres Fazit ist, dass mit einer daraufhin eingeleiteten Behandlung die SP überwunden werden kann. 6.2 Wie wirkt sich die Soziale Phobie auf das Leben von Betroffenen aus? Nach einer kurzen Zusammenfassung des 3. Kapitels beschreibe ich anhand einer SDF, wie bestimmte Verhaltensweisen den „Teufelskreis“ der SP aufrechterhalten und so die Situation von Soziophobikerinnen/Soziophobikern verfestigen oder sogar verschlimmern können. Anschliessend zeige ich anhand der SDF einer „typischen“ betroffenen Person auf, welche Ausstattungseigenschaften eines Individuums auf das Vorliegen einer SP hinweisen können. Soziophobische Situationen werden in Leistungs- und Interaktionssituationen unterschieden. Die Konfrontation damit oder die Aussicht darauf und die dadurch hervorgerufenen starken Ängste führen dazu, dass Betroffene bewusst oder unbewusst typische Verhaltensweisen zeigen Dazu gehören Vermeidungs-, Flucht-, Sicherheits- und sozial inadäquates Verhalten. Weiter kann es sein, dass Betroffene sich gehemmt verhalten. All diese Verhaltensformen können dazu führen, dass Betroffene von Anderen tatsächlich negativ bewertet werden, da sie desinteressiert, abweisend, unauffällig, irritierend oder unverlässlich wirken. Es kann auch sein, dass ein tiefer sozioökonomischer Status für Andere „unattraktiv“ ist oder komorbide Störungen oder ständige Selbst-Abwertungen der Betroffenen bestehende soziale und berufliche Beziehungen belasten oder das Eingehen von neuen Beziehungen verhindern. So belegen auch mehrere Studien, dass sich das Vorliegen einer SP negativ auf die Arbeit/Ausbildung und die sozialen Beziehungen auswirkt. Im schlimmsten Fall führt die SP zur Isolation, oder noch tragischer, zur Suizidalität (Kapitel 3). Im Anhang C findet sich eine SDF, die ich vorwiegend auf der Basis des kognitiven Modells von Clark und Wells erstellt habe. Sie visualisiert unter anderem, wie bestimmte Verhaltensweisen dazu beitragen, dass die SP aufrechterhalten oder verschlimmert wird. Dadurch wird das Leben der Betroffenen je länger je stärker eingeschränkt. Voraussetzung für das Durchbrechen dieses Teufelskreises ist, dass die SP erkannt wird. Deshalb habe ich im Anhang D das bisherige Wissen zusammenfassend eine SDF (als Fremdbild) skizziert, die aufzeigt, auf welchen Dimensionen eines Individuums sich die SP manifestieren und demnach erkannt werden kann. Diese SDF ist mit „typischen“ individuellen Eigenschaften und deren Auswirkungen auf die sozialen Beziehungen einer Soziophobikerin/eines Soziophobikers ausgestattet. Ich merke an, dass ich mir bewusst bin, dass Individuen in ihrer individuellen und sozialen Ausstattung einzigartig sind. Da meine Bachelorarbeit den Anspruch hat, verschiedene Aspekte zu berück- 58 sichtigen, die im Zusammenhang mit der SP stehen können, muss ich gewisse Aussagen verallgemeinern. Demnach meine ich mit dem Wort „typisch“, dass die Eigenschaften bei vielen Betroffenen zutreffen und sie deshalb charakteristisch für die SP sind. So zeigt die SDF Eigenschaften eines Individuums, die auf eine SP hindeuten können. Auch aus den möglichen Auswirkungen der SP schliesse ich, dass die Früherkennung der SP sehr wichtig ist. Im folgenden Kapitel werden Unterstützungsmöglichkeiten verschiedener Disziplinen aufgezeigt. 6.3 Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es für Betroffene und ihre Angehörigen? Nebst der Zusammenfassung von Kapitel 4 befasse ich mich in diesem Kapitel mit den Wirkungsweisen von Psycho- und Pharmakotherapien auf betroffene Personen anhand deren Ausstattungsdimensionen. Ausserdem gehe ich beispielhaft darauf ein, was Voraussetzung und Wirkung einzelner Unterstützungsmöglichkeiten sein können. Am Beginn jeder Behandlung steht die Information über die Krankheit. Erste, grundlegende Informationen können durch SA vermittelt werden. Anschliessend ist es wichtig, dass die betroffene Person einen Termin bei einer Psychiaterin/einem Psychiater oder einer Psychologin/einem Psychologen bekommt und wahrnimmt. Dabei wird abgeklärt, ob die Ängste nicht auf körperlichen Ursachen beruhen und ob wirklich eine SP vorliegt. Allenfalls müssen auch noch eine oder mehrere weitere Störung/Störungen diagnostiziert werden. Die Diagnose/die Diagnosen bildet/bilden die Grundlage für die Behandlungsplanung. In der Regel werden Betroffene mit Psycho- und/oder Pharmakotherapien behandelt (Kapitel 4). Im Folgenden zeige ich anhand der SDF-Dimensionen auf, wie diese beiden Therapien den im Anhang C beschriebenen Teufelskreis durchbrechen können. Psychotherapie Durch das Verändern des Erlebens, Fühlens, Denkens und Verhaltens der Betroffenen können unter anderem das Selbstbild verbessert (M), neue Verhaltensweisen (A) erlernt und problematische Lernerfahrungen (R -> E/M) bearbeitet werden. Dies wird nicht nur Einfluss auf die individuellen Eigenschaften des Individuums haben, sondern auch auf dessen soziale Beziehungen. 59 Pharmakotherapie Psychopharmaka nehmen Einfluss auf Vorgänge im Gehirn (Ui) und dadurch über die Rezeptoren (R) auf das Angsterleben (E). Dies kann dazu führen, dass soziale Situationen kognitiv weniger mit Angst besetzt sind (M), was wiederum Einfluss auf das Verhalten (A) und dadurch auf soziale Beziehungen haben kann. Es gibt keine empirischen Studien die aufzeigen, welche der beiden Therapien oder deren Kombination für welche Personen am Besten ist. Auf die Entscheidung Einfluss haben Präferenz der betroffenen Person, Nebenwirkungen der Medikamente, Schweregrad, Komorbidität, Verfügbarkeit der Psychotherapie, Qualifikation der Therapeutin/des Therapeuten sowie ökonomische Überlegungen. Beide Therapiearten können in ambulanten, teilstationären und stationären Einrichtungen oder in privaten Praxen durchgeführt werden, je nach dem, welche Intensität der Behandlung und der Betreuung notwendig ist (Kapitel 4). Psychosoziale Beratung Da Betroffene oftmals erst Hilfe suchen, wenn gravierende soziale und/oder berufliche Folgeprobleme oder sekundäre Störungen auftreten, sind psychosoziale Beratungsstellen oftmals eine erste Anlaufstelle. Diese können Betroffene aber auch über einen längeren Zeitraum begleiten und unterstützen. In der psychosozialen Beratung werden Betroffene möglichst ganzheitlich erfasst und deren relevante Lebensbereiche berücksichtigt. Die psychosoziale Beratung dient der Existenzsicherung und der sozialen und beruflichen Integration der Betroffenen, erschliesst deren internen und externen Ressourcen und kann mittels Case Management-Methode durchgeführt werden. Dabei erscheint mir besonders das Angebot der Pro Infirmis umfassend und deshalb empfehlenswert. Die spezialisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch Hausbesuche machen, können Betroffene aus der ganzen Schweiz kompetent, kostenlos und bei Bedarf über mehrere Jahre beraten. In komplexen Fällen werden Case Managerinnen/Case Manager der Pro Infirmis beigezogen (Kapitel 4). Selbsthilfe Mittels Selbsthilfe erhalten Betroffene Wissen über die Ängste und den Umgang mit diesen. Hervorheben möchte ich Internetplattformen und speziell Selbsthilfegruppen, da sie Betroffenen ermöglichen, ihre sozialen Kompetenzen zu stärken und Beziehungen aufzubauen (Kapitel 4). Je nach Person und Situation sind andere Unterstützungsmöglichkeiten angebracht. Wie bereits beschrieben, beeinflussen sich die verschiedenen Dimensionen eines Individuums gegenseitig. So hat auch die Unterstützung auf einer Dimension Auswirkungen auf andere Dimensionen. Ich zeige dies nun beispielhaft auf: 60 Wenn eine Person sehr stark von ihren sozialen Ängsten geplagt ist, kann eine medikamentöse Therapie eine notwendige Voraussetzung für den Beginn einer Psychotherapie und/oder die Inanspruchnahme von psychosozialer Hilfe sein. Die Medikamente mildern die Angstsymptome, was bereits Einfluss auf das Erleben, das Denken und das Verhalten von Betroffenen haben kann. Um die Erfolge aber für die Zeit nach der Medikamenteneinnahme zu sichern, ist meistens psychotherapeutische Hilfe angezeigt. Einerseits, weil die Wirkung des Medikaments nach dessen Absetzung abklingen wird, andererseits weil die Betroffenen die Verbesserung ihrer Situation möglicherweise dem Medikament (und nicht sich selber) zuschreiben, wodurch ihr Selbstbild nicht verbessert wird. Weiter können psychosoziale Interventionen nötig sein. Das Abklingen der Ängste hilft den Betroffenen wenig, wenn ihre Existenz nicht gesichert ist und sie weder sozial noch beruflich integriert sind. Hilfe für Angehörige Nicht nur Betroffene, sondern auch Angehörige können und sollen bei Bedarf Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen. Sie helfen damit nicht nur sich selber, sondern dies kann Voraussetzung dafür sein, dass sie für die Betroffenen weiterhin eine Ressource darstellen können (Kapitel 4). Zu Beginn und im Hinblick auf die Behandlungsplanung ist eine kompetente, sorgfältige Abklärung durch Psychiaterinnen/Psychiater oder Psychologinnen/Psychologen wichtig. Es gibt vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten für Betroffene und ihre Angehörigen. Wenn SA die Angebote kennen, können sie adäquate Hilfestellung leisten und/oder Unterstützung vermitteln. 6.4 Welche Rolle haben Sozialarbeitende im Bezug auf die Thematik und welchen Beitrag können sie für Betroffene leisten? In diesem Kapitel fasse ich zusammen, weshalb die SP ein Problembereich der Sozialen Arbeit ist. Im Anschluss zähle ich Punkte auf, die für SA im Prozess der Problem- und Ressourcenanalyse in Bezug auf das Erkennen und die Unterstützung von Soziophobikerinnen/Soziophobikern wichtig sind. Alle Professionellen der Sozialen Arbeit verbindet, dass sie soziale Probleme von Individuen und sozialen Systemen bearbeiten. Nebst sozialen Problemen gibt es biologische, psychische und physikalisch-chemische Problemklassen. Dabei können psychische Krankheiten wie die SP Ursache oder Folge von sozialen (und anderen) Problemen sein, weshalb sie ein Problembereich der Sozialen Arbeit sind. Die SDF als Instrument der Sozialen Arbeit erlaubt es SA, Individuen und ihre sozialen Beziehungen ganzheitlich zu analysieren und ihre Probleme und Ressourcen zu erkennen (Kapitel 5). Dank der sys- 61 tematischen Erfassung der verschiedenen Dimensionen von Klientinnen/Klienten und deren Wechselwirkungen können unter anderem „tiefer liegendere“ Probleme (in unserem Fall die SP) als beispielsweise Arbeitslosigkeit erkannt und angegangen werden. Da Soziophobikerinnen/Soziophobiker aus verschiedenen Gründen oftmals erst Hilfe aufsuchen, wenn gravierende soziale und/oder berufliche Probleme und/oder sekundäre Probleme auftreten (und somit nicht wegen der SP an sich, Kapitel 4) ist das Erkennen des tiefer liegenden Problems der SP wichtig. So wird verhindert, dass falsche Interventionen gewählt und dadurch interne und externe Ressourcen verschwendet werden. Auf Basis einer sorgfältigen Problemanalyse mittels der SDF werden adäquate Ressourcen erkannt, aktiviert und eingesetzt. Die Behandlung des grundlegenden Problems kann einen „Domino-Effekt“ zur Folge haben, indem durch die Stärkung der Ausstattungseigenschaften eines Individuums dessen Austausch- und Machtpotential vergrössert wird und dadurch soziale Beziehungen ermöglicht, erhalten oder gestärkt werden. In Bezug auf de SP ist es im Prozess der Problem- und Ressourcenanalyse wichtig, dass SA: • (als Voraussetzung) über die SP informiert sind. • bei einer Klientin/einem Klienten Hinweise auf das Vorliegen einer SP erkennen. • bei der Klientin/dem Klienten gezielt nachfragen um herauszufinden, ob eine genauere Abklärung angezeigt ist. Wenn ja, folgt die Problembegründung. • der Klientin/dem Klienten grundlegende Informationen zur SP vermitteln. • sicherstellen, dass die Klientin/der Klient einen Termin bei einer Psychiaterin/einem Psychiater oder einer Psychologin/einem Psychologen erhält. • interne und externe Ressourcen der betroffenen Person erkennen, aktivieren und einsetzen. Zusammenfassend besteht der Beitrag der SA, die ich mit dieser Arbeit hauptsächlich anspreche, in Bezug auf die SP in der Früherkennung und der Unterstützung von Betroffenen. 6.5 Was können Sozialarbeitende zur Früherkennung und Unterstützung von Soziophobikerinnen und Soziophobikern beitragen? Die im vorherigen Kapitel angesprochenen Punkte, die SA zur Früherkennung und Unterstützung von Betroffenen leisten können, werde ich nun detaillierter ausführen, um die Hauptfragestellung dieser Bachelorarbeit zu beantworten. Dafür werde ich auf das bisher vermittelte Wissen zurückgreifen. Für die Zusammenarbeit ist es sinnvoll, wenn SA die in Kapitel 5.3 erwähnten Hinweise für den Umgang mit Betroffenen beachten, damit es diesen leichter fällt, SA als Ressource wahrzunehmen. 62 Aneignung von Wissen über die SP Wenn SA weiterer Informationen zur SP bedürfen, können sie auf die Angebote der Pro Infirmis, der Pro Mente Sana und der Angst- und Panikhilfe Schweiz zurückgreifen. Hinweise auf das Vorliegen einer SP erkennen Im Anhang D habe ich eine SDF mit „typischen“ Eigenschaften einer von SP betroffenen Person aufgeführt. In Gesprächen, beispielsweise bei der Analyse von Klientinnen/Klienten und deren sozialen Beziehungen anhand der SDF, oder durch Beobachtungen kann es nun sein, dass SA Übereinstimmungen zwischen Klientinnen/Klienten und der „typischen“ SDF wahrnehmen. Diese Hinweise bedeuten noch nicht, dass ein zwingender Abklärungsbedarf besteht, da es beispielsweise viele Menschen gibt, die sich in sozialen Situationen unwohl fühlen. Deshalb sollen SA gezielte Fragen stellen, um den Verdacht auf das Vorliegen einer SP zu erhärten oder auszuschliessen. Gezieltes Nachfragen und Problembegründung Die folgenden, aus den Diagnosekriterien des DSM-IV abgeleiteten Fragen helfen SA herauszufinden, ob eine genauere Abklärung nötig ist. • Haben Sie Angst vor und/oder in einer oder mehreren Situation/Situationen, in welcher/welchen Sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit Anderer stehen oder mit unbekannten Personen konfrontiert werden? • Befürchten Sie, dass andere Personen Sie negativ beurteilen könnten (aufgrund Ihres Verhaltens oder Angstsymptomen)? • Finden Sie, dass diese Angst übertrieben oder unvernünftig ist? • Vermeiden Sie soziale und/oder Leistungssituationen oder überstehen Sie diese nur unter intensiver Angst oder Unbehaglichkeit? • Leiden Sie stark unter den Ängsten und/oder • fühlen Sie sich durch diese in Ihrer Lebenssituation beeinträchtigt? Die letzten drei Fragen sind besonders wichtig. Wenn sie mit „ja“ beantwortet werden, ist die Klientin/der Klient in ihrer/seiner Lebensqualität und –führung beeinträchtigt, wodurch die Ängste als problematisch anzusehen sind. Die Problembegründung (Ausstattungs-, Austausch- und/oder Machtproblem) sollte mit der betroffenen Person gemeinsam im Gespräch gemacht werden. Diese kann durch den Verweis auf die SDF im Anhang C geschehen, welche auf der psychologischen Erklärungstheorie von Clark und Wells basiert. Dieser Theorie nach besteht die grosse Gefahr, dass sich die sozialen Ängste bei Nicht-Intervention nicht nur verfestigen, sondern stärker werden und/oder Folgeprobleme nach sich ziehen (Prognose). 63 Daraus ist der Handlungsbedarf abgeleitet (Kapitel 5). Es geht nicht darum, ein „Katastrophenszenario“ aufzuzeigen, sondern aufgrund der erwiesenen Tatsachen, dass die SP unbehandelt üblicherweise chronisch verläuft und/oder Komorbiditäten und/oder Folgeprobleme mit sich bringt, den Betroffenen unnötig lange Leidenswege zu ersparen. Grundlegende Informationen zur SP vermitteln SA sollen Klientinnen/Klienten in erster Linie signalisieren, dass sie deren Ängste und die damit einhergehenden Beeinträchtigungen sowie den Leidensdruck ernst nehmen. Sie können darauf hinweisen, dass es ein relativ weit verbreitetes Krankheitsbild gibt, dessen Charakteristika Übereinstimmungen mit den Äusserungen der Person aufweisen. Weiter kann es sinnvoll sein, Klientinnen/Klienten auf die multifaktoriell bedingten Ursachen und die Behandelbarkeit der SP hinzuweisen. Wichtig ist dabei, dass SA die Ursachen nicht bestimmen, sondern die Betroffenen nur auf mögliche ursächliche Faktoren aufmerksam machen. Termin bei einer Psychiaterin/einem Psychiater oder einer Psychologin/einem Psychologen vereinbaren Da Menschen mit sozialen Ängsten sich oftmals fürchten zu telefonieren, kann es sinnvoll oder notwendig sein, wenn SA oder Angehörige das Telefonat übernehmen oder als Sicherheit neben den Betroffenen sitzen, um bei Bedarf einzuspringen. Weiter können SA schwierige, anstehende Situationen (beispielsweise einen Termin bei einer Psychiaterin/einem Psychiater) vorgängig mit den betroffenen Personen besprechen, damit diese einen Termin nicht vermeiden oder Sicherheitsverhaltensweisen (vorgängig Alkohol trinken et cetera) einsetzen „müssen“. So können beispielsweise SA oder Angehörige Betroffene zu einem Termin begleiten. Bei der Psychiaterin/dem Psychiater/der Psychologin/dem Psychologen wird abgeklärt, ob tatsächlich eine SP und/oder eine oder mehrere weitere psychische Störung/Störungen vorliegt/vorliegen. Die Diagnose/Diagnosen bildet/bilden die Grundlage für die Behandlungsplanung. Anschliessend können medikamentöse und/oder psychotherapeutische Behandlungen eingeleitet werden. Interne und externe Ressourcen erkennen, aktivieren und einsetzen An dieser Stelle sollen für die Problemlösung relevante, interne und externe Ressourcen erkannt und/oder erfragt werden. Eine SDF mit möglichen Ressourcen findet sich im Anhang E. Diese gilt es nun zu aktivieren und einzusetzen. SA können zusätzliche externe Ressourcen (von privaten und kirchlichen Instanzen und/oder dem staatlichen System sozialer Sicherheit) für die Problemlösung erschliessen. Mögliche konkrete Unterstützungsmöglichkeiten habe ich in Kapitel 4 aufgeführt. Die SA, an welche die Arbeit hauptsächlich gerichtet ist, haben vor allem eine Triage-Funktion. So können sie die Betroffenen beispielsweise an die Pro Infirmis vermitteln. Wie vorgängig beschrieben, 64 kann es sinnvoll oder notwendig sein, Betroffene beim Vereinbaren und/oder beim Wahrnehmen von Terminen zu unterstützen. Wenn die Ausstattung eines Individuums gestärkt wird (beispielsweise durch Psychotherapie oder Arbeitsvermittlung), wird auch dessen Austausch- und Machtpotenzial vergrössert, was Probleme in sozialen Beziehungen verhindern, verkleinern beziehungsweise lösen, oder auch Voraussetzung für das Eingehen von sozialen Beziehungen sein kann. Dadurch wird die Befriedigung der sozialen Bedürfnisse und die soziale und die berufliche Integration erreicht oder verbessert. 6.6 Fazit An dieser Stelle fasse ich die relevanten Aspekte zusammen, hauptsächlich in Bezug auf die Frage, wie SA Betroffene erkennen und unterstützen können. Die SP ist eine relativ weit verbreitete, in der Regel chronisch verlaufende, häufig mit weiteren psychischen Störungen einhergehende und mit grossem Leidensdruck und psychosozialen Einschränkungen verbundene Angststörung. Dies determiniert die Wichtigkeit, die SP frühzeitig zu erkennen. Alle Professionellen der Sozialen Arbeit bearbeiten soziale Probleme von Individuen und sozialen Systemen. Die sozialen Probleme können Ursache oder Folge der SP sein. SA können mit der SDF Individuen und deren sozialen Beziehungen mehrdimensional und ganzheitlich erfassen. Dadurch können Ursachen, Wechselwirkungen und Folgen von einzelnen Eigenschaften verschiedener Dimensionen erkannt werden. Auf Basis einer sorgfältigen Problemanalyse und – begründung können für die Problemlösung adäquate Ressourcen erkannt, aktiviert und erschlossen werden. Wenn SA als Voraussetzung über die SP informiert sind, bemerken sie möglicherweise in einem Prozess der Problem- und Ressourcenanalyse mittels SDF Hinweise auf das Vorliegen der Störung. In diesem Fall sollen SA genauer nachfragen um herauszufinden, ob Handlungsbedarf gegeben ist. Ist ein solcher angezeigt, sollen SA die betroffene Person informieren und mit ihr das weitere Vorgehen bestimmen. Am Anfang steht in jedem Fall die Abklärung bei einer Psychiaterin/einem Psychiater oder einer Psychologin/einem Psychologen. Es gibt eine Vielzahl weitere, interne und externe Ressourcen, die durch SA erkannt, aktiviert und/oder erschlossen werden können und sollen. Eine Stärkung der Ausstattung der betroffenen Person erhöht deren Austausch- und Machtpotenzial, wodurch soziale Beziehungen ermöglicht, erhalten oder verbessert werden. Die in dieser Arbeit angesprochenen SA haben vorwiegend eine Triagefunktion. Das Erkennen der SP und das Vermitteln von Unterstützung sind aber erste, ganz entscheidende Schritte zugunsten von Gesundheit, Wohlbefinden sowie sozialer und beruflicher Integration der Betroffenen. 65 LITERATURVERZEICHNIS Ajdacic-Gross, V. & Graf, M. (2003). Bestandesaufnahme und Daten zur psychiatrischen Epidemiologie. Arbeitsdokument 2. Neuchâtel: Schweizerisches Gesundheitsobservatorium. Ambühl, H., Meier, B. & Willutzki, U. (2001). Soziale Angst verstehen und behandeln. Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta. Angenendt, J. (2002). Angststörungen. In H. J. Freyberger, W. Schneider & R.-D. Stieglitz (Hrsg.), Kompendium Psychiatrie Psychotherapie Psychosomatische Medizin (11. Aufl.). (S. 119-130). Basel: Karger. Bandelow, B. (2006). Angst- und Panikerkrankungen. Ätiologie – Diagnostik – Therapie (2. Aufl.). Bremen: UNI-MED. Beidel, D. C. & Turner, S. M. (1999). The natural course of shyness and related syndromes. In L.A. Schmidt & J. Schulkin (Eds.), Extreme fear, shyness, and social phobia. Origins, biological mechanism, and clinical outcomes (pp. 203-223). New York, Oxford: Oxford University Press. Berghändler, T., Stieglitz, R. D. & Vriends, N. (2007). Die Soziale Phobie: Ätiologie, Diagnostik und Behandlung. Schweizerisches Medizin-Forum, 7 (9), 225-230. Bosshard, M. (2008). Soziale Arbeit und Psychiatrie. In S. Gahleitner & G. Hahn (Hrsg.), Klinische Sozialarbeit. Zielgruppen und Arbeitsfelder (S. 151-162). Bonn: Psychiatrie-Verlag. Clark, D. M. & Wells, A. (1995). A cognitive model of social phobia. In R. G. Heimberg, M. Liebowitz, D. Hope & F. Schneider (Eds.), Social phobia: diagnosis, assessment and treatment (pp. 6993). New York: Guilford. Cox, B.J., Dierfeld, D.M., Swinson, R.P. & Norton, G.R. (1994). Suicidal ideation and suicide attempt in panic disorder and social phobia. Abgerufen am 02.11.2009 unter: http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/151/6/882 Fäh, M. (2003). Psychotherapie. In E. Cariget, U. Mäder & J.-M. Bonvin (Hrsg.), Wörterbuch der Sozialpolitik (S. 241f). Zürich: Rotpunktverlag. Geiser, K. (2007). Problem- und Ressourcenanalyse in der Sozialen Arbeit (3. Aufl.). Luzern: interact. Grabert, A. (2007). Salutogenese und Bewältigung psychischer Erkrankung. Einsatz des Kohärenzgefühls in der Sozialen Arbeit. Lage: Jacobs-Verlag. Guillod, O. (2003). Ärztliche Schweigepflicht. In E. Cariget, U. Mäder & J.-M. Bonvin (Hrsg.), Wörterbuch der Sozialpolitik (S. 38). Zürich: Rotpunktverlag. Hättenschwiler, J. & Höck, P. (2002). Angststörungen Behandlung. Schweizerisches Medizin Forum, 7, 149-154. Heimberg, R. G., Liebowitz, M., Hope, D. & Schneider, F. (1995). Social phobia: diagnosis, assessment, and treatment. New York: Guilford Press. Hiemisch, A. (2000). Eine handlungstheoretische Beschreibung sozialer Phobien. Lengerich: Pabst. Knölker, U., Mattejat, F. & Schulte-Markwort, M. (2000). Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapie systematisch (2. Aufl.). Bremen: UNI-MED. Lieb, R. & Müller, N. (2002). Epidemiologie und Komorbidität der Sozialen Phobie. In U. Stangier & T. Fydrich (Hrsg.), Soziale Phobie und Soziale Angststörung. (S. 34-65). Göttingen: Hogrefe. Mäder, U. (2003). Selbsthilfe. In E. Cariget, U. Mäder & J.-M. Bonvin (Hrsg.), Wörterbuch der Sozialpolitik (S. 267f). Zürich: Rotpunktverlag. Merikangas, K. R. & Angst, J. (1995). Comorbidity and social phobia: evidence from clinical, epidemologic, and genetic studies. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 244, 297-303. 66 Mitte, K., Heidenreich, T. & Stangier, U. (2007). Diagnostik bei Sozialen Phobien. Göttingen: Hogrefe. Möller, H.-J., Laux, G. & Deister, A. (1996). Psychiatrie. Stuttgart: Hippokrates. Müller, N., Beloch, E. & Wittchen, H. U. (1998). Lebensqualität und störungsspezifische Beeinträchtigungen bei Sozialphobie – Ergebnisse einer empirischen Studie. In H. Katschnig, U. Demal & J. Windhaber (Hrsg.), Wenn Schüchternheit zur Krankheit wird… (S. 67-80). Wien: Facultas. Obrecht, W. (2000). Das Systemtheoretische Paradigma der der Sozialarbeitswissenschaft und der Sozialen Arbeit. Eine transdisziplinäre Antwort auf die Situation der Sozialen Arbeit im deutschsprachigen Bereich und die Fragmentierung des professionellen Wissens. In H. Pfaffenberger, A. Scherr & R. Sorg (Hrsg.), Von der Wissenschaft des Sozialwesens. (S. 115-143). Wiesbaden: Sozial-Extra Verlag. Olfson, M., Guardino, M., Struening, E., Franklin, R., Schneider, F. R., Hellmann, F. & Klein, D. F. (2000). Barriers to the treatment of social anxiety. American Journal of Psychiatry, 157, 521-527. Pauls, H. (2004). Klinische Sozialarbeit. Grundlagen und Methoden psycho-sozialer Behandlung. Weinheim und München: Juventa. Pschyrembel. (2004). Pschyrembel Klinisches Wörterbuch (260. Aufl.). Walter de Gruyter: Berlin. Robert-Koch-Institut. (2004). Gesundheitsberichterstattung des Bundes – Heft 21. Berlin: Selbstverlag. Scharfetter, C. (1996). Allgemeine Psychopathologie. Eine Einführung (4. Aufl.).Stuttgart: Thieme. Schmitt, T. (2008). Das soziale Gehirn. Eine Einführung in die Neurobiologie für psychosoziale Berufe. Bonn: Psychiatrie-Verlag. Schneider, F. R., Johnson, J., Hornig, C.D., Liebowitz, M.R. & Weissmann, M. M. (1992). Social phobia: comorbidity and morbidity in an epidemiological sample. Archives of General Psychiatry, 49, 282-288. Stangier, U., Clark, D. M. & Ehlers, A. (2006). Soziale Phobie. Göttingen: Hogrefe. Stangier, U. & Fydrich, T. (2002). Das Störungskonzept der Sozialen Phobie oder der Sozialen Angststörungen. In U. Stangier & T. Fydrich (Hrsg.), Soziale Phobie und Soziale Angststörung. (S. 1033). Göttingen: Hogrefe. Stangier, U., Heidenreich, T. & Peitz, M. (2009). Soziale Phobien. Ein verhaltenstherapeutisches Behandlungsmanual (2. Aufl.). Weinheim: Beltz PVU. kognitiv- Stieglitz, R.-D., Freyberger, H. J. & Mombour, W. (2002). Klassifikation und diagnostischer Prozess. In H. J. Freyberger, W. Schneider & R.-D. Stieglitz (Hrsg.), Kompendium Psychiatrie Psychotherapie Psychosomatische Medizin (11. Aufl.). (S. 17-31). Basel: Karger. Weyerer, S. & Lucht, M. (2002). Psychiatrische Epidemiologie und Prävention. In H. J. Freyberger, W. Schneider & R.-D. Stieglitz (Hrsg.), Kompendium Psychiatrie Psychotherapie Psychosomatische Medizin (11. Aufl.). (S. 32-38). Basel: Karger. Wikipedia. (2009). Soziale Phobie. Abgerufen am: 28.10.2009 http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Soziale_Phobie&oldid=66037056 unter: Willutzki, U. (2002). Allgemeine Prinzipien der Psychotherapie sozialer Ängste: Die Rolle von Ressourcen. In U. Stangier & T. Fydrich (Hrsg.), Soziale Phobie und Soziale Angststörung. (S. 370396). Göttingen: Hogrefe. Wittchen, H.-U. & Beloch, E. (1996). The impact of social phobia on quality of life. International clinical psychopharmacology, 11, 15-23. Zimbardo, P. G. & Gerrig, R. J. (2004). Psychologie (16. Aufl.). München: Pearson Studium. 67 ANHANG A: DIAGNOSEKRITERIEN DER VERMEIDENDSELBSTUNSICHEREN PERSÖNLICHKEITSSTÖRUNG Quelle: Mitte et al. (2007, S. 16) 68 ANHANG B: DIE SYSTEMISCHE DENKFIGUR (INDIVIDUUM) Quelle: Geiser (2007, S. 95) 69 ANHANG C: AUFRECHTERHALTUNG DER SOZIALEN PHOBIE Reiz Auswirkungen auf soziale Beziehungen •Eine Information über eine soziale oder eine Leistungssituation wird über R aufgenommen. •Wahrnehmung und Bewertung dieser Situation durch E/M (inkl. Vergleich mit früheren Erfahrungen). Die betroffene Person erwartet, dass sie von Anderen negativ bewertet werden wird. Je nach dem setzt die Person deshalb Sicherheitsverhaltensweisen ein (A). •Ui reagiert mit Angstsymptomen. •R nimmt die Informationen aus Ui auf. •Die betroffene Person nimmt die Angstsymptome bewusst wahr (E/M), was zu einer „präventiven“ Vermeidung der Situation (A) führen kann, oder – falls sich die Person in die schwierige Situation gewagt hat, richtet sie die ganze Aufmerksamkeit auf sich und fehlattribuiert die Angstsymptome mit einer tatsächlichen negativen Bewertung der Anderen (E/M). Dieser Kreislauf kann sich bis zu einer Panikattacke steigern. •Möglicherweise verhält sich die Person deshalb sozial inadäquat, oder sie flüchtet aus der Situation (A). Nach der Situation, oder falls sie vermieden wurde: •E/M: Die Person greift auf die vom negativen Selbstbild geprägten Eindrücke und Gefühle zurück, die ihre im Vorfeld gemachten Erwartungen bestätigen. Das führt zu einem noch negativeren Selbstbild (weitere Lernerfahrung) und noch mehr Angst vor weiteren sozialen oder Leistungssituationen. • Die Gehirnstrukturen (Ui) für Vermeidungs- oder Sicherheitsverhaltensweisen oder die Fluchtreaktionen erhalten Verstärkung. •Die verschiedenen Verhaltensweisen können sich negativ auf soziale Beziehungen und Ue auswirken. Quellen: Inhalt: Clark und Wells (1995; zit. nach Stangier et al., 2009), Stangier et al. (2009), Schmitt (2008) Grafik: Geiser (2007), nachbearbeitet von Daniela Wittker 70 ANHANG D: DIE SOZIALE PHOBIE ERKENNEN Individuum • Hat Angst/Panik vor/in sozialen und/oder Leistungssituationen •Hat Schamgefühle •Ist verletzlich •Macht sich viele Sorgen •Ist depressiv •leidet •Erwartet, dass sie/er sich unakzeptabel verhält/unakzeptable Angstsymptome zeigt und dies/diese von Anderen negativ bewertet wird/werden •Denkt schlecht über sich selber (negatives Selbstbild) •Erwartet, dass Andere sie/ihn abwerten •Denkt, dass sie/er perfekt sein muss •Vermeidet sozial bedrohliche Situationen (auch bei der Arbeit) •Flüchtet aus solchen Situationen •Zeigt Sicherheitsverhalten (vermeidet, Blickkontakt, Alkoholkonsum o.ä.) •Zeigt sozial inadäquates (z.B. ungeschicktes, selbstunsicheres oder distanziertes) Verhalten •Ist verhaltensgehemmt (in Form eines passiven, unterwürfigen Verhaltens bis hin zur völligen Verhaltensblockade) •Widerspricht nicht/äussert die eigene Meinung ungern oder gar nicht •Errötet, zittert, schwitzt •Hat die Muskeln angespannt •Ist vegetativ erregt •Hat Herzrasen/Schwindel/ Panikattacken •Verfügt über einen tiefen Status/ Statusunvollständigkeit/Statusungleichgewicht •Hat wenig Mitgliedschaften Soziale Austausch- und Machtbeziehungen In Anbetracht bestimmter, typischer Ausstattungseigenschaften (typische Verhaltensweisen, tiefer Status etc.) verwundert es nicht, dass Betroffene oftmals über eher wenig Austausch- und Machtpotential verfügen, was sich negativ auf die Qualität und die Quantität von Austausch- und Machtbeziehungen auswirkt. Quellen: Inhalt: Stangier (2009), Stangier und Fydrich (2002) Grafiken: Geiser (2007), nachbearbeitet von Daniela Wittker 71 ANHANG E: INTERNE RESSOURCEN ERKENNEN Individuum •Ist intelligent •Behält trotz Ängsten in bestimmten Situationen einen kognitiven Zugang •Ist ansonsten psychisch gesund •Die Ängste haben sich noch nicht chronifiziert •Ist motiviert für konstruktive Veränderungen •Verfügt über erstrebenswerte und realisierbare Werte und Ziele (als Quelle für hohe Motivation) •Kennt Lösungen bzw. Methoden im Hinblick auf die Problemlösung •Wagt sich auch in für sie/ihn schwierige Situationen und flüchtet nicht •Zeigt keine Sicherheitsverhaltensweisen •Verhält sich sozial adäquat •Ist körperlich gesund •Sieht attraktiv aus •Verfügt über eine abgeschlossene Ausbildung/Berufslehre •Hat eine Arbeitsstelle •Verfügt über ein gutes Einkommen und/oder Erspartes •Ist krankenversichert •Wohnt in der Nähe von Stellen für Unterstützungsmöglichkeiten •Ist Mitglied sozialer Systeme Soziale Austausch- und Machtbeziehungen Soziale Austausch- und Machtbeziehungen stellen wichtige Ressourcen dar (Verwandte, Freundinnen/Freunde, Partnerin/Partner, Nachbarinnen/Nachbarn, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter etc.) Quellen: Inhalt: Stangier (2009), Geiser (2007) Grafiken: Geiser (2007), nachbearbeitet von Daniela Wittker 72 ANHANG F: WICHTIGE ADRESSEN Hauptsitz der Pro Infirmis: Pro Infirmis Schweiz Feldeggstrasse 71 Postfach 1332 8032 Zürich Telefon: 044 388 26 26 Fax: 044 388 26 00 E-Mail: [email protected] URL: http://www.proinfirmis.ch/ Pro Mente Sana: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana Hardturmstrasse 261 Postfach 8031 Zürich Telefon: 044 563 86 00 Beratungstelefon: 0848 800 858 Fax: 044 563 86 17 URL: http://www.promentesana.ch Angst- und Panikhilfe Schweiz (APhS): APhS Ahornweg 6074 Giswil Hotline: 0848 801 109 Fax: 061 793 00 50 E-Mail: [email protected] URL: http://www.aphs.ch 73 Koordination und Förderung von Selbsthilfegruppen in der Schweiz (KOSCH): Stiftung KOSCH Koordination und Förderung von Selbsthilfegruppen in der Schweiz Laufenstrasse 12 4053 Basel Telefon: 061 333 86 01 Auskunftsdienst: 0848 810 814 Fax: 061 333 86 02 E-Mail: [email protected] URL: http://www.kosch.ch Dachverband der Vereinigung der Angehörigen von Schizophrenie- und Psychisch Kranken Schweiz (VASK): VASK Schweiz Engelgasse 94 4052 Basel Telefon: 061 271 14 60 E-Mail: [email protected] URL: http://www.vask.ch Internetressourcen: http//www.online-therapy.ch Auf dieser Seite findet sich ein webbasiertes Selbsthilfeprogramm, welches für die Behandlung von sozialen Ängsten konzipiert ist und die wichtigsten Aspekte des kognitiv-verhaltenstherapeutischen Ansatzes integriert. Angeboten werden Selbsthilfemodule, die unter anderem Informationen zu sozialen Ängsten und Multimedia-Elemente enthalten. So können beispielsweise vorangehend eingeblendete Texte vor einem virtuellen Publikum vorgetragen und dadurch öffentliche Auftritte trainiert werden. Den Betroffenen stehen online Therapeutinnen/Therapeuten zur Seite, welche sie unterstützen und anleiten. Das Angebot ist kostenlos und wird stets weiterentwickelt. Die sehr gute Wirksamkeit dieses Programms wurde in einer vom schweizerischen Nationalfonds geförderten Studie erwiesen. http://www.aphs.ch Die Homepage der APhS enthält unter anderem viele Informationen über die verschiedenen Angststörungen, ein Form und einen Chat, zudem werden Kontaktstellen für Selbsthilfegruppen genannt. 74