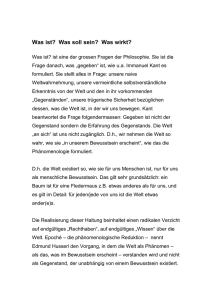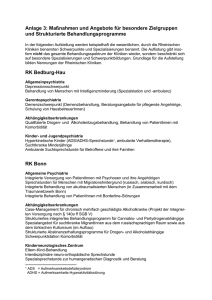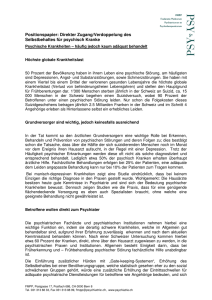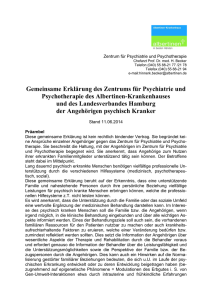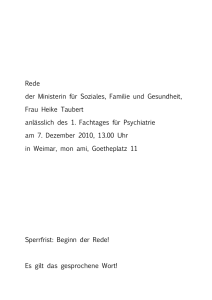Thorwart Artikel 12-2009
Werbung

Hilfe – EREEPRO-Blätter Überarbeiteter Teil des Beitrages Gemeindepsychiatrie – Zum schwierigen Verhältnis von professioneller Kooperation und beruflicher Verschwiegenheit. In: Sozialpsychiatrische Informationen (4/2001) 31: 34-42 12/2009 Berufliche Verschwiegenheit und kollegiale Zusammenarbeit innerhalb und zwischen psychiatrischen bzw. psychosozialen Institutionen Die Kooperation zwischen KollegInnen verschiedener Institutionen gehört, obwohl oder auch gerade weil sie in vielen Fällen als wenig befriedigend erlebt wird, zu den am häufigsten beschworenen Prinzipien des medizinischen und psychosozialen Feldes. Damit einhergehende Fragen nach Datenschutz insbesondere aber der Schweigepflicht werden selten thematisiert, allenfalls wird die Ansicht vertreten, die Weitergabe personenbezogener Daten geschehe zum Wohl der jeweils Betroffenen. Zunächst möchte ich mich der Frage zuwenden, weshalb Kooperation zwischen Institutionen häufig entweder erst gar nicht stattfindet oder oft als nicht zufriedenstellen bzw. problematisch erlebt wird. Zum einen wird die Zusammenarbeit mit MitarbeiterInnen anderer Einrichtungen mehr oder weniger bewußt als bedrohlich, eigene fachliche und persönliche Überzeugungen in Frage stellend und damit konflikthaft erlebt. Psychodynamisch scheint sich hier zwischen den Professionellen auch die Problematik von Nähe und Distanz der KlientInnen/PatientInnen wiederzuspiegeln, wie sie insbesondere für psychotische PatientInnen auf dem Hintergrund ihrer eingeschränkten Fähigkeit zur Differenzierung zwischen Selbst und Objekt charakteristisch ist (Mentzos 1992, Lempa & Böker 1999) und dann zu intensivem Angst- und Fragmentierungserleben führt. Kommt es hingegen zur Kooperation kann diese von Faktoren bestimmt sein, die nur auf den zweiten Blick in ihrer tieferen Bedeutung erkennbar sind. So ist etwa das Modell einer durchorganisierten Kooperation (Stichworte: 'Versorgungskette', KlientInnen an einer Einrichtung 'anbinden') dazu geeignet, Hoffnungen bzw. Phantasien persönlicher Entlastung von der Auseinandersetzung mit den als schwierig und unbequem empfundenen chronisch Kranken zu nähren. Ebenso kann es um Größenphantasien gehen (alles regeln, organisieren, heilen zu können), die narzißtischen, also Bedürfnissen nach Anerkennung und Aufmerksamkeit, geschuldet sind. Andererseits kann die Zusammenarbeit mit anderen am 'Fall'1 beteiligten ExpertInnen gruppendynamisch der Herstellung (vermeintlicher) Nähe geschuldet sein (Gruppenkohäsion), mittels der die oft diametral unterschiedlichen Ansichten, etwa über Genese, Psychodynamik, Behandlungsansätze, ethische Aspekte psychiatrischer Behandlung oder 'unvernünftige' Wünsche der Betroffenen weitgehend ausblendet werden (können). Die Delegation von Verantwortung an jeweils koordinierende Bezugspersonen (die sogenannten 'Case-ManagerInnen') oder an ÄrztInnen2 erscheint wiederum geeignet, die Bedeutung der professionellen Leitung zu zementieren und Widersprüche zwischen den Beteiligten einzuebnen. Die vielfach betonte Notwendigkeit der Einbeziehung der Betroffenen hat hier beschwörenden Charakter – vermutlich als Reaktion auf die wenn auch nur unterschwellig vorhandene Ahnung, daß die Betroffenen mit ihrer (häufig als krankhaft oder unvernünftig bzw. uneinsichtig erachteten) Sicht der Dinge aufgrund der beschriebenen Konflikte zuweilen eine nur noch marginale Rolle spielen. 1 2 Hier deutet bereits der Begriff die emotionale und soziale Distanz zwischen Behandelten und Behandelnden an: KlientInnen bzw. PatientInnen werden zum geschlechtslosen Objekt transformiert. In dem vor einigen Jahren diskutierten "Integrierten Behandlungs- und Rehabilitationsplan" wurde betont, daß sowohl die Erarbeitung des Plans als auch die Erbringung diagnostischer und therapeutischer Leistungen "(...) in ärztlich verantworteter berufsgruppenübergreifender Teamarbeit" zu erfolgen habe (vgl. Kauder & AKTION PSYCHISCH KRANKE 1997, S. 29). Als langjähriger Mitarbeiter eines Sozialpsychiatrischen Dienstes (München-Bogenhausen und Ebersberg bei München) verkenne nicht, daß viele Bemühungen um inner- und interinstitutionelle Kooperation der Verbesserung der psychosozialen, psychotherapeutischen und medizinischen Angebote geschuldet sind. Dennoch war und bin ich immer wieder irritiert, daß viele MitarbeiterInnen psychiatrischer Einrichtungen ihre persönliche und fachliche Position in der Institution und gegenüber den PatientInnen/KlientInnen kaum reflektieren. Im Gegenteil wird die aus meiner Sicht zunehmend technizistisch anmutende Perfektionierung der Abläufe in stationären und ambulanten Einrichtungen oft nur aus der Perspektive möglicher Verbesserungen der Versorgung betrachtet. Dabei steht sie nahezu immer auch im Dienste einer wenig erfreulichen Entwicklung unserer Kultur im Sinne der Anpassung des 'sperrigen' Subjekts an die herrschenden Vorstellungen von Normalität, zunehmend aber vor allem von ökonomischer Effizienz. Die "(...) Achtung vor dem was wir nicht wissen, vor der Fremdheit, der unerhörten Komplexität der inneren Welt eines anderen Menschen" (Grubrich-Simitis 1999, 6) droht auf diese Weise verloren zu gehen3. Aus juristischer Sicht besteht heute kein ernsthafter Zweifel an der Schweigepflicht zwischen MitarbeiterInnen derselben Institution, soweit sich ein Vertrauensverhältnis zu einer(m) MitarbeiterIn entwickelt hat, z.B. gegenüber der/m BeraterIn einer Beratungsstelle. Eine andere Beurteilung wird sich allenfalls dann ergeben können, wenn das Geheimnis nicht einer bestimmten Person, sondern einem bestimmten Personenkreis, etwa im Rahmen einer Krankenhausbehandlung, anvertraut wird; insoweit liegt eine konkludente bzw. stillschweigende Einwilligung im Sinne schlüssigen Handelns vor. Der Kreis der an der Behandlung beteiligten Personen muß in diesem Fall für die Betroffenen erkennbar sein, zudem dürfen nur solche Informationen weitergegeben werden, die für die (gewünschte) Behandlung notwendig sind, gegebenenfalls sind die Themenbereiche (Wohnangelegenheiten, Medikamente etc.) zu spezifizieren. Auch in einer Beratungsstelle gilt nichts grundsätzlich anderes, wenn etwa in der Supervision nicht-anonymisiert über KlientInnen gesprochen werden soll. Zu bedenken ist dann, daß eine Einwilligung, etwa in Supervisionssitzungen des Teams, Rückwirkung auf die therapeutische Dyade hat: Je mehr therapeutische (im Unterschied zu psycho-sozialen) Aspekte eine Rolle in der Beratung spielen, um so bedeutsamer ist der Schutz der anvertrauten Informationen (Diskretion/Vertraulichkeit) für den therapeutischen Prozeß. Die Weitergabe anvertrauter Informationen und Geheimnisse ohne entsprechende Einwilligung des Betroffenen ist nur im Ausnahmefall auf der Grundlage besonderer Rechtfertigungstatbestände zulässig (näheres siehe unter www.schweigepflicht-online.de). Dieser Grundsatz gilt analog für den Austausch patientenbezogenen Informationen und Geheimnissen zwischen Institutionen. Werden beispielsweise bei der institutionsübergreifenden Erstellung eines Behandlungs- und Rehabilitationsplans Daten erhoben und zwischen den beteiligten Institutionen bzw. Personen ausgetauscht, ist dies nur auf der Grundlage entsprechender Einwilligungen zulässig. Nur am Rande sei angemerkt, das Einwilligungen im Bereich des Sozialgesetzbuchs (z. B. SGB-V/Krankenversicherung: Krankenhausbehandlung) schriftlich zu dokumentieren sind. Andernfalls (z.B. SPDi's) ist die Schriftform nicht zwingend, oft aber im Sinne der Transparenz (gelegentlich auch zu Beweiszwecken) empfehlenswert. Im Unterschied zu somatisch Kranken besteht im Bereich der Psychiatrie die Tendenz PatientInnen bzw. KlientInnen Krankheitsuneinsichtigkeit, mangelnde Compliance (bzw. das Bestreben, sich psychiatrischer Behandlung zu entziehen) zu unterstellen. Das führt in einzelnen Fällen dazu, daß Entscheidungen für PatientInnen gegen oder ohne deren (explizites) Einverständnis getroffen wird. So schreibt Siekmann (ein Richter im Ruhestand) in einem Kommentar zur Entscheidung des Bayerischen Obersten Landesgerichts im Zusammenhang der Ablehnung einer 3 Zwar bezieht sich die Autorin explizit auf die Psychoanalyse, ihr Zitat scheint mir jedoch auf den von mir dargestellten Kontext übertragbar (Grubrich-Simitis 1999, S. 6). sofortigen weiteren Beschwerde im Rahmen der zwangsweisen Unterbringung eines Betreuten in einem psychiatrischen Krankenhaus (§ 1906 BGB): "Der »gesunde« Mensch kann aufgrund seiner Entscheidungsfreiheit und -fähigkeit darüber befinden, ob er sich einer Heilbehandlung unterziehen will oder nicht. Er kann z.B. frei entscheiden, ob er sich einer Operation unterziehen will, ob er z.B. in einem sogenannten Patiententestament bestimmte Behandlungsmöglichkeiten (Intensivmedizin) an sich vornehmen lassen will oder nicht. Das setzt einen freien Willen und eine entsprechende Einsichtsfähigkeit voraus. Diese Voraussetzungen liegen beim psychisch Kranken oder geistig oder seelisch Behinderten nicht vor" (Siekmann 1996, S. 38). Wie ich an anderer Stelle ausgeführt habe (Thorwart 1998, S. 127), besteht das Problem solcher und ähnlicher Aussagen in ihrer unzulässigen Verallgemeinerung: Das implizite Argument psychisch Kranke wären grundsätzlich nicht in der Lage, die ihre Person betreffenden Angelegenheiten eigenverantwortlich zu regeln und entsprechende Entscheidungen zu treffen, ist weder aus psychiatrisch-psychotherapeutisch noch juristischer Sicht zutreffend. Die Frage einer 'objektiv' feststellbaren Beeinträchtigung der Einsichtsfähigkeit (die zudem von juristischen Laien meist mit der Einsicht in die medizinische Notwendigkeit einer bestimmten Behandlung verwechselt wird) läßt sich lediglich im Einzelfall von JuristInnen mit Hilfe von GutachterInnen beantworten und stellt ausschließlich auf die Tatsache ab, inwieweit der Betroffene sich der Tragweite und Konsequenz der zu treffenden Entscheidung im klaren ist und nach dieser Einsicht zu handeln vermag. Werden die Betroffenen anwaltlich beraten (was ich in gravierenden Fällen empfehlen würde) kommt es in den seltensten Fällen zu Zwangsmaßnahmen! Nach Ansicht von Henry steht die Vorstellung eines Rechtsanspruches auf Entscheidung über die eigenen Angelegenheiten (und hier vor allem die Behandlung betreffende Fragen) in Widerspruch zur traditionellen Psychiatrie: "Im Rahmen dieses Modells nimmt man die Stimme des Wahnsinns lediglich als Ausdruck von Symptomen wahr und befördert mit einer solchen klinischen Einstellung die Entwertung der Stimme des Kranken, was dazu führt, daß man ihm/ihr die Anerkennung seiner/ihrer bürgerlichen Rechte verweigert." (Henry 1995, S. 145)4 Daß die Vermischung medizinisch-psychiatrischer und gesellschaftlich-staatlicher Aufgaben und Normen Tradition hat belegt Dörner am Beispiel der europäischen Psychiatrie (Großbritannien, Frankreich und Deutschland). In seinem Buch "Bürger und Irre" hat er diese bis in das 18. Jahrhundert zurückverfolgt. Zusammenfassend formuliert er: "Seit Abschluß ihrer Entstehungsphase hat die Psychiatrie weitere hundert Jahre lang die ihr von Staat und Gesellschaft zugewiesenen Aufgaben nicht eben unwillig und reflexionsfreudig erfüllt. Ihre Abhängigkeiten sind bis heute dieselben geblieben, ob sie ihre Zuständigkeit bedenkenlos ausdehnte, ob sie sich der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie gefügig machte, ob sie naturwissenschaftlich ihre diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten erweiterte oder ob sie sich psychoanalytisch und gegenwärtig sozialpsychiatrisch ihres emanzipatorischen Anspruches erinnerte. Daher bleibt auch heute die Frage offen, ob die Psychiatrie mehr Emanzipations- oder mehr Integrationswissenschaft ist, d.h. ob sie mehr auf die Befreiung der psychisch Leidenden oder auf die Disziplinierung der bürgerlichen Gesellschaft aus ist (...)." (Dörner 1969, S. 380) Aus dieser Perspektive erscheint es wenig verwunderlich, wenn Fragen der Schweigepflicht in der Psychiatrie und auch im Zusammenhang des vieldiskutierten Gemeindepsychiatrischen Verbunds kaum Erwähnung finden. Das zuweilen vorgebrachte Argument es sei nicht notwendig die Thematik ausdrücklich zu erwähnen, da diese juristisch 4 Die weitergehende These "(...) organische Psychiatrie und Psychoanalyse unterschieden sich in dieser Hinsicht nur wenig, da das "(...) was der psychisch Kranke sagt, nach (...) vorgefertigten Modellen" interpretiert würde, vermag ich allerdings – als Psychoanalytiker – keineswegs zu teilen (Henry 1995, S. 145). bereits eindeutig und im Sinne der Betroffenen geregelt sei verkennt aber, daß psychiatrische Hilfe in vielen Fällen da ansetzt, wo psychisch erkrankte Menschen, aus welchen Gründen auch immer, eine Behandlung oder anderweitige Hilfeleistungen nicht aus eigener Initiative, sondern unter dem Druck der jeweiligen Umstände (Androhung der Einleitung zivil- oder öffentlich-rechtlicher Unterbringungsmaßnahmen, der Anregung einer Betreuung oder der Heimeinweisung) in Anspruch nehmen. Aber auch wenn von professioneller Seite kein Zweifel an der Einsichtsfähigkeit besteht und die Betroffenen zudem der Weitergabe von Informationen (so etwa bei der Einbeziehung verschiedener anderer psychiatrischer Institutionen im Rahmen der Erstellung eines Behandlungsplans oder einer Fallkonferenz) zustimmen, sind erteilte Schweigepflichtentbindungen nur insoweit wirksam, als den Betroffenen die Tragweite ihrer Entscheidung deutlich wird. Je pauschaler eine Einwilligung erfolgt, d.h. je weniger aus ihr hervorgeht, mit welchen Institutionen bzw. Personen welche Informationen ausgetauscht werden, desto mehr Zweifel sind an der Rechtswirksamkeit der Schweigepflichtentbindung angebracht. Dies gilt insbesondere für pauschale Einwilligungserklärungen welche sich auf ein Gremium von Fachleuten (z.B. Arbeitskreis 'Fallkonferenz' eines Gemeindepsychiatrischen Verbundes) beziehen, deren Mitglieder den Einwilligenden nicht im Einzelnen bekannt sind; aber auch wenn die Einwilligung bereits längere Zeit zurückliegt und damals die nun erfolgende Weitergabe noch nicht absehbar war. Fallkonferenzen bei denen die in einer Region als besonders schwierig erlebten (und vielen TeilnehmerInnen auch ohne Namensnennung bekannten) PatientInnen ohne deren Wissen und Einverständnis 'besprochen' werden sind eindeutig unzulässig und erfüllen für die offenbarenden schweigepflichtigen Mitglieder der Konferenz den Tatbestand einer strafbaren Handlung. Sind anonymisierte PatientInnen/KlientInnen für einzelne TeilnehmerInnen erkennbar, sollten diese die Besprechung verlassen. Andernfalls wären die Vortragenden (in dem Moment wo deutlich wird, daß die Anonymität aufgehoben ist) verpflichtet ihre Falldarstellung abzubrechen. Schweigepflichtverletzungen dieser und anderer Art sind (leider) an der Tagesordnung. Aus beziehungsdynamischer Sicht wäre hier zu überlegen, inwieweit die aggressive Überschreitung von Persönlichkeitsrechten und Intimitätsgrenzen bzw. die Zerstörung der Diskretion als Gegenübertragungsreaktion in der Beziehung mit einzelnen PatientInnen zu verstehen ist – möglicherweise aber auch der Abwehr gruppendynamischer Konflikte dient. In letzterem Fall könnte es beispielweise darum gehen, mittels der gemeinsamen Pathologisierung besonders schwieriger PatientInnen (häufig sind das BorderlinePatientInnen mit ihrer Tendenz zur Spaltung) die Kohäsion der Gruppe zu erhöhen, um auf diese Weise Rivalitäts- und Autonomie- bzw. Abhängigkeitskonflikte zwischen Gruppenmitgliedern zu entschärfen bzw. zu vermeiden5. Die notwendige Zusammenarbeit Professioneller innerhalb und/oder zwischen Institution/en steht im Einklang mit dem Gebot der beruflichen Verschwiegenheit soweit sie im Interesse und mit Wissen und Einverständnis der Betroffenen stattfindet. Probleme ergeben sich dann, wenn dies nicht oder aber nicht uneingeschränkt der Fall ist. Wiederholt habe ich die Erfahrung gemacht, daß intimste Informationen (Lebensumstände, Phantasien, Sexualität/Partnerschaft etc.) im Zusammenhang der Klärung von Fragen weitergegeben werden (etwa die weitere Planung der Wohnsituation nach der Entlassung), bei denen sie sachlich unerheblich oder jedenfalls nicht zwingen notwendig sind. Auch wenn im Einzelfall zu bedenken und zu klären ist, inwieweit das von KlientInnen manchmal ausgesprochene 'Verbot' der Weitergabe bestimmter Informationen die Problematik der Triangulierung (es geht dann um die vermutlich biographisch begründete Phantasie des Ausschlusses einer dritten Person aus der therapeutischen Dyade) berührt, verbietet schon der Respekt vor den sich anvertrauenden PatientInnen bzw. KlientInnen eine Offenbarung ohne deren Einwilligung. In einer Gesellschaft, die aus historischer Erfahrung heraus dem Persönlichkeitsrecht (und damit auch den Abwehrrechten gegenüber staatlichen 5 Auf die verschiedenen beziehungsdynamischen Aspekte der Schweigepflicht bin ich an anderer Stelle ausführlich eingegangen (Thorwart 1998, S. 79-123). Eingriffen) hohen Stellenwert einräumt, müssen Eingriffe in die verfassungsrechtlich geschützte Sphäre auf ein Mindestmaß beschränkt bleiben und gesetzlich geregelt sein. Die Berufung auf einen rechtfertigenden Notstand (§ 34 StGB) ist nur unter den dort festgelegten Voraussetzungen zulässig – wird jedoch nach meiner Erfahrung in der Praxis (von Nichtjuristen) allzu leichtfertig herangezogen um die Weitergabe von Geheimnissen auch ohne die Einwilligung der Betroffenen zu rechtfertigen6. Die allgemein festzustellende politische Tendenz einer Aufweichung der strafrechtlich verankerten Schweigepflicht (§ 203 StGB), zuletzt im Zusammenhang der Vorratsdatenspeicherung und des BKA-Gesetzes, ist letztlich ebenso wie die in der (medizinischen, psychologischen und psychosozialen) Praxis zu beobachtende Fahrlässigkeit im Umgang mit anvertrauten Geheimnissen dazu geeignet, das Vertrauen der Bevölkerung in die Verschwiegenheit der Angehörigen der dort genannten Berufsgruppen zu beeinträchtigen (vgl. Thorwart 1999). Differenziertes Leistungsangebot versus 'weiche Mauer' – Gefahren und Chancen psychiatrischer Versorgungssysteme In Anbetracht des seit der Psychiatrie-Enquete vergangenen Zeitraums ist es zu einem insgesamt beeindruckenden Ausbau gemeindepsychiatrisch orientierter Institutionen und Angebote gekommen. Es entstanden neue 'extramurale' Versorgungslandschaften, die bezogen auf das jeweils regionale Geflecht von Institutionen ihrerseits Begriffe wie Sektor, Verbund, Versorgungskette hervorgebracht haben. Angesichts der in mancher Hinsicht berechtigten Kritik an institutions- statt personenzentrierten Hilfeleistungen, an mangelnden Absprache von Leistungsanbietern und an der Zersplitterung des Leistungsangebotes und des kaum zu bestreitenden Umstands, daß die Betroffenen manche der von ihnen gewünschten bzw. benötigten Hilfe nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung erhalten, erscheint die regionale Abstimmung der Angebote sinnvoll und notwendig. Nicht unberechtigt scheint aber auch die Warnung vor einem "psychiatrischen Absolutismus" (Kruse 2000, 15) einer Gemeindepsychiatrie, in der psychisch Kranke erfaßt, kontrolliert und (natürlich zu ihrem Wohl) versorgt werden. Auf dem Hintergrund der subtilen Vermischung von Kontrolle und Hilfe scheinen vielerorts 'weiche Mauern' entstanden zu sein, deren psychologische Wirksamkeit nicht in erster Linie auf Zwang, sondern vielmehr auf einer inneren Abhängigkeit der Betroffenen beruht. Aufgrund der sich bei den Betroffenen immer wieder manifestierenden Ich/Selbst-Schwäche frequentieren sie die einschlägigen Einrichtungen, induzieren oder fordern bestimmte Umgangsstile heraus, die Abhängigkeitswünsche solcherart befriedigen, zugleich aber auch reproduzieren (Wolf 1992, 238)7. Um eine neue Hospitalisierung zu vermeiden, bzw. entstandene innere Abhängigkeiten nicht weiter zu fördern, bedarf es "mindestens einer langfristigen therapeutisch wirksamen Beziehung (...)", welche die beeinträchtigte Beziehungsstruktur der PatientInnen nicht fortsetzt (a.a.O.). Die berufliche Verschwiegenheit ist in diesem Zusammenhang insoweit von Bedeutung, als sie den Schutz der therapeutischen Arbeit vor intrusiven Einflüssen garantiert und so eine von Vertrauen getragene Beziehung ermöglicht, welche ihrerseits erst die Einbeziehung Dritter in die dyadische Beziehung im Sinne einer Triangulierung ermöglicht. Das Prinzip der Kooperation psychiatrischer Institutionen zur Optimierung des Behandlungsangebotes8 einerseits und die Grundsätze der informationellen Selbstbestimmung und der beruflichen Verschwiegenheit andererseits stehen in einem antinomischen Verhältnis, können also unabhängig voneinander Gültigkeit beanspruchen. Die Erwartung der Betroffenen nach einer Bewahrung der von ihnen im Vertrauen auf die Verschwiegenheit anvertrauten Geheimnisse ist – ungeachtet einer etwaigen therapeutischen Bearbeitung – ebenso zu respektieren wie ihr Wunsch nach Kooperation der 6 7 8 Häufig ist das Tatbestandsmerkmal einer "(...) gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit" nicht erfüllt; ebenso ist die Tat (hier die unbefugte Offenbarung) in vielen Fällen nicht geeignet, die Gefahr abzuwenden (§ 34 StGB). In Anlehnung an die damals Ost- und Westdeutschland noch trennende Berliner Mauer assoziierte Wolf an den Grenzen der eingerichteten psychiatrischen Sektoren unsichtbare Schilder mit der Aufschrift 'You are leaving the social-psychiatric sector' (Wolf 1992, S. 237). Ebenso wäre an dieser Stelle die Zusammenarbeit mit Angehörigen zu nennen. an der Betreuung beteiligten Institutionen. Das von Psychiatrieerfahrenen zuweilen empfundene Defizit im Hinblick auf Absprachen zwischen Professionellen stellt dabei – wie ich weiter oben ausgeführt habe – kein grundsätzliches Problem der Schweigepflicht dar. Geraten die beiden Prinzipien im Einzelfall in Konflikt, sind also die Betroffenen etwa mit der Kooperation bestimmter Einrichtungen oder der Weitergabe bestimmter Informationen innerhalb der Einrichtung nicht einverstanden, so ist dieser Wunsch schon deshalb anzuerkennen, weil andernfalls das Vertrauen in die Verschwiegenheit und die Bereitschaft sich mit subjektiv als schützenswert erachteten Informationen über die eigene Person, Beziehungen zu Dritten und dazugehörige Lebenssituationen MitarbeiterInnen psychiatrischer Institutionen anzuvertrauen ernsthaft gefährdet ist. Das Vertrauen in die Verschwiegenheit (Diskretion) ist aber Grundlage und Voraussetzung jedweder therapeutischer, beraterischer oder pflegerischer Tätigkeit der zum Kreis der schweigepflichtigen zählenden Berufsgruppen und Personen. Im Hinblick auf die Diskussion über die Qualität der in psychiatrischen und sozial- bzw. gemeindepsychiatrischen Einrichtungen geleisteten Arbeit wird es entscheidend darauf ankommen, inwieweit sich die MitarbeiterInnen die im Zusammenhang der vielbeschworenen personenzentrierten Perspektive auftretenden Angst- und Ohnmachtgefühle, aber auch Macht- und Größenphantasien zugestehen und konstruktiv bewältigen können. Wenn weder die emotionale Verwicklung der TherapeutInnen noch die Art der Beziehungsgestaltung der PatientInnen pathologisiert werden müssen, kann gelingen, was eine Psychoanalytikerin in Zusammenhang mit der Sichtweise der TherapeutInnen in einem (Behandlungs-) System formulierte: "Eine echte Notwendigkeit, aber auch eine echte Möglichkeit zur Veränderung ergibt sich erst, wenn zur Erkenntnis der eigenen Betroffenheit auch die der eigenen Beteiligung hinzukommt. Ich meine damit nicht die Erkenntnis von Schuld oder Mitschuld, sondern ein Erkennen der eigenen Position im Gesamtsystem. Es ist ein großer Unterschied, ob ich mich außerhalb eines zu bekämpfenden oder eines zu verändernden Systems erlebe, oder ob ich mich als Teil dieses Systems erkenne." (Bauriedl 1986, 241) Ein erster Schritt im Hinblick auf die berufliche Verschwiegenheit könnte dabei die kritische Reflexion des eigenen Umgangs mit anvertrauten Informationen sein und die Bereitschaft, entsprechende Ergebnisse für die Betroffenen transparent zu machen. Literaturverzeichnis Bauriedl, T. (1980): Beziehungsanalyse. Das dialektisch-emanzipatorische Prinzip der Psychoanalyse und seine Konsequenzen für die psychoanalytische Familientherapie. Frankfurt/M.: Suhrkamp Dörner, K. (1969): Bürger und Irre. Zur Sozialgeschichte und Wissenschaftssoziologie der Psychiatrie. Frankfurt/M.: Europäische Verlagsanstalt Grubrich-Simitis, I. (1999): Sprache: Königsweg zum Unbewußten. Dankrede. Psyche 53: 1-7 Henry, P. (1995): Psychiatrische Rehabilitation und bürgerliche Rechte aus psychologischer Sicht. In: T. Bock et al (Hg.).: Abschied von Babylon. Verständigung über die Grenzen in der Psychiatrie. Bonn: Psychiatrie-Verlag Kauder & AKTION PSYCHISCH KRANKE [Hg.] (1997): Personenzentrierte Hilfen in der psychiatrischen Versorgung. Psychosoziale Arbeitshilfen 11. Bonn: Psychiatrie-Verlag Kruse, G. (2000): Wider den psychiatrischen Absolutismus – vor allem am Beispiel der Forensik. Sozialpsychiatrische Informationen 30: 15-18 Lempa, G. & Böker, H. (1999): Schizophrene Psychosen aus psychoanalytischer Sicht. Psychotherapie in Psychiatrie, Psychotherapeutischer Medizin und Klinische Psychologie 4: 98-106 Mentzos, S. (1992): Einführung. In: S. Mentzos (Hg.): Psychose und Konflikt. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 9-28 Siekmann, G. (1996): Zur Unterbringung eines Betreuten gegen seinen Willen. In: Kerbe. Die Fachzeitschrift der Sozialpsychiatrie, Heft 4: 187-191 Thorwart, J. (1998): Berufliche Verschwiegenheit. Juristische, beziehungsdynamische und praktische Aspekte der innerinstitutionellen Schweigepflicht in psychosozialen Institutionen. München und Wien: Profil Thorwart, J. (1999): Juristische und ethische Grenzen der Offenbarung von Geheimnissen: Anmerkungen zur aktuellen Gesetzgebung und zu juristischen sowie beziehungsdynamischen Aspekten der innerinstitutionellen Schweigepflicht. Recht & Psychiatrie 17: 10-16 Wolf, M. (1992): Die weiche Mauer. Die Behandlung des Patienten und der psychiatrischen Einrichtung mit Psychotherapie, Supervision und gemeindepsychiatrischer Intervention. In: S. Mentzos (Hg.): Psychose und Konflikt. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 224-252 Biographische Angaben: Jürgen Thorwart (Jg. 1961), Dipl.- Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut, Psychoanalytiker in eigener Praxis; Weiterbildung in psychoanalytischer Psychosentherapie