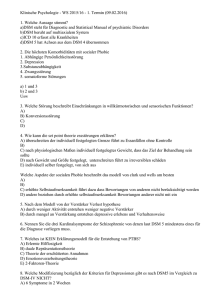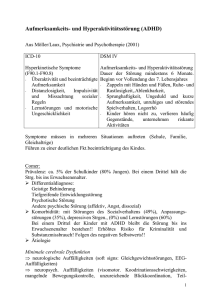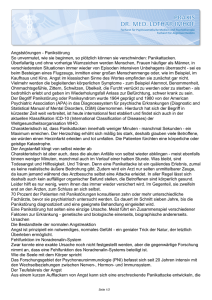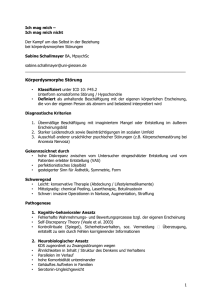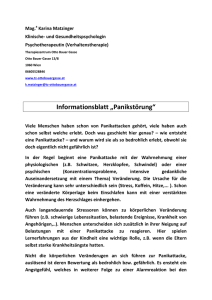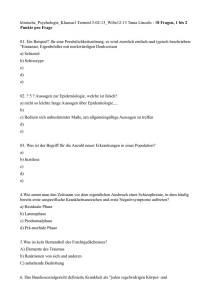Ansicht
Werbung
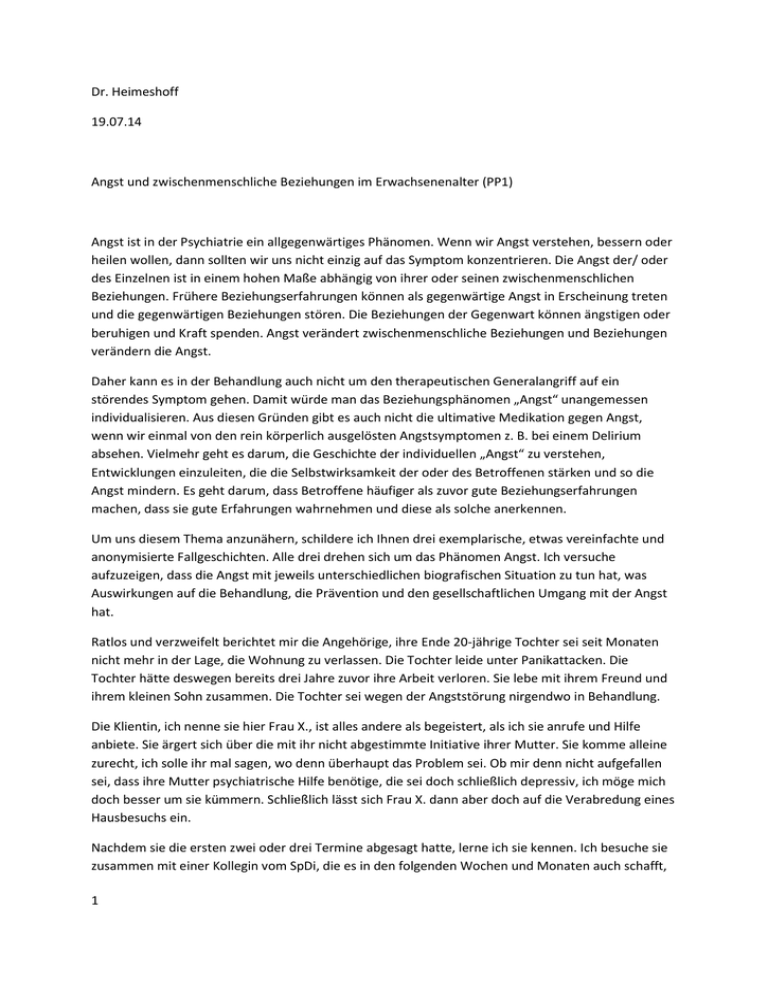
Dr. Heimeshoff 19.07.14 Angst und zwischenmenschliche Beziehungen im Erwachsenenalter (PP1) Angst ist in der Psychiatrie ein allgegenwärtiges Phänomen. Wenn wir Angst verstehen, bessern oder heilen wollen, dann sollten wir uns nicht einzig auf das Symptom konzentrieren. Die Angst der/ oder des Einzelnen ist in einem hohen Maße abhängig von ihrer oder seinen zwischenmenschlichen Beziehungen. Frühere Beziehungserfahrungen können als gegenwärtige Angst in Erscheinung treten und die gegenwärtigen Beziehungen stören. Die Beziehungen der Gegenwart können ängstigen oder beruhigen und Kraft spenden. Angst verändert zwischenmenschliche Beziehungen und Beziehungen verändern die Angst. Daher kann es in der Behandlung auch nicht um den therapeutischen Generalangriff auf ein störendes Symptom gehen. Damit würde man das Beziehungsphänomen „Angst“ unangemessen individualisieren. Aus diesen Gründen gibt es auch nicht die ultimative Medikation gegen Angst, wenn wir einmal von den rein körperlich ausgelösten Angstsymptomen z. B. bei einem Delirium absehen. Vielmehr geht es darum, die Geschichte der individuellen „Angst“ zu verstehen, Entwicklungen einzuleiten, die die Selbstwirksamkeit der oder des Betroffenen stärken und so die Angst mindern. Es geht darum, dass Betroffene häufiger als zuvor gute Beziehungserfahrungen machen, dass sie gute Erfahrungen wahrnehmen und diese als solche anerkennen. Um uns diesem Thema anzunähern, schildere ich Ihnen drei exemplarische, etwas vereinfachte und anonymisierte Fallgeschichten. Alle drei drehen sich um das Phänomen Angst. Ich versuche aufzuzeigen, dass die Angst mit jeweils unterschiedlichen biografischen Situation zu tun hat, was Auswirkungen auf die Behandlung, die Prävention und den gesellschaftlichen Umgang mit der Angst hat. Ratlos und verzweifelt berichtet mir die Angehörige, ihre Ende 20-jährige Tochter sei seit Monaten nicht mehr in der Lage, die Wohnung zu verlassen. Die Tochter leide unter Panikattacken. Die Tochter hätte deswegen bereits drei Jahre zuvor ihre Arbeit verloren. Sie lebe mit ihrem Freund und ihrem kleinen Sohn zusammen. Die Tochter sei wegen der Angststörung nirgendwo in Behandlung. Die Klientin, ich nenne sie hier Frau X., ist alles andere als begeistert, als ich sie anrufe und Hilfe anbiete. Sie ärgert sich über die mit ihr nicht abgestimmte Initiative ihrer Mutter. Sie komme alleine zurecht, ich solle ihr mal sagen, wo denn überhaupt das Problem sei. Ob mir denn nicht aufgefallen sei, dass ihre Mutter psychiatrische Hilfe benötige, die sei doch schließlich depressiv, ich möge mich doch besser um sie kümmern. Schließlich lässt sich Frau X. dann aber doch auf die Verabredung eines Hausbesuchs ein. Nachdem sie die ersten zwei oder drei Termine abgesagt hatte, lerne ich sie kennen. Ich besuche sie zusammen mit einer Kollegin vom SpDi, die es in den folgenden Wochen und Monaten auch schafft, 1 den Kontakt zu Frau X. aufrechtzuhalten. Frau X. erklärt uns in dem ersten Gespräch, dass es schon schwer für sie sei mit den Panikattacken, wir sollten uns aber keine Gedanken um sie machen. Sie werde schon zurechtkommen. Um den Job sei es nicht schade. Sie habe schon einmal, vor zwei Jahren nämlich, solche Panikattacken überwunden. Ihr Partner helfe ihr im Alltag. Sie können vielleicht nachvollziehen, dass wir uns von Frau X. nicht gerade eingeladen fühlten, sie weiter zu unterstützen. Aber bevor ich diese Geschichte weiterverfolge, möchte ich einige allgemeine Bemerkung dazu machen. (PP 2) Angst ist grundsätzlich ein nützliches Signal: Angst warnt uns, macht uns auf Gefahren aufmerksam und bewirkt, dass wir uns auf Gefahren einstellen. Angst ist eine der sogenannten primären Emotionen, neben Freude, Trauer, Furcht, Wut, Überraschung und Ekel: Angeborene Reaktionsmuster, die in der Beziehung mit anderen geformt und ausdifferenziert werden. In der Fallgeschichte liegen die Verhältnisse aber anders. Beim Verlassen der Wohnung droht keine Gefahr, die Angst ist nicht nützlich sondern bewirkt, dass die junge Frau in ihrer Lebensgestaltung extrem eingeschränkt ist: Sie vermeidet es, ihre Wohnung zu verlassen. Leidet sie aber unter der Angst? Während wir Helfer, wie auch schon zuvor ihre Mutter, handeln, eingreifen, therapieren wollen, entgegnet die Klientin kühl und scheinbar sehr souverän, in ihrer Wohnung komme sie klar und habe keine Angst, im Übrigen werde sie sich schon selbst helfen und der SpDi möge sich um die kümmern, die das dringender benötigten. (PP 3) Diagnostisch haben wir es hier mit einer Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] zu tun. Diese ist definiert durch das wiederkehrende Auftreten schwerer Angstattacken (Panik), die sich nicht auf eine spezifische Situation oder besondere Umstände beschränken und deshalb auch nicht vorhersehbar sind. Wie bei anderen Angsterkrankungen zählen zu den wesentlichen Symptomen plötzlich auftretendes Herzklopfen, Brustschmerz, Erstickungsgefühle, Schwindel und Entfremdungsgefühle (Depersonalisation oder Derealisation). Oft entsteht sekundär auch die Furcht zu sterben, vor Kontrollverlust oder die Angst, wahnsinnig zu werden. (ICD 10, DIMDI, Online Version). Die Panikstörung ist eine von verschiedenen Angststörungen. (PP 4) Die klassischen Angstkrankheiten sind 1. die Phobien, 2. die Panikstörung und 3. die generalisierte Angstkrankheit. (PP 5) Es handelt sich um häufige Erkrankungen: Im Laufe des Lebens treten diese Angsterkrankungen bei etwa 15% der Bevölkerung auf (Lebenszeitprävalenz). Diese Störungen bilden sich selten spontan zurück, die mittlere Dauer vom ersten Auftreten einer solchen Störung und der Diagnose beträgt einige Jahre, oft kommt es zu einer Chronifizierung, oft entwickeln sich weitere, das Krankheitsbild komplizierende, Störungen. Unsere Besorgnis im Falle der Frau X. ist also gut begründet. Eine Chronifizierung ist bereits eingetreten, erste Symptome hat sie vor drei Jahren bemerkt und dann nur teilweise überwunden. Sie hatte eine ambulante Psychotherapie in Anspruch genommen sowie auch angstlösende Medikamente. Wenn sie jetzt nicht mehr `rausgeht, weil sie sich nur in der Wohnung sicher fühlt, handelt es sich um eine Vermeidungsstrategie. Das Vermeiden der Angst wird ihre Angststörung allerdings nicht bessern können, denn Frau X. macht kaum noch die korrigierende Erfahrung, dass sie selbständig und selbstwirksam sein kann. 2 Wie können wir uns die hier vorliegende Panikstörung erklären? Wie immer bei schweren Erkrankungen, müssen wir ein Zusammenwirken biologischer, psychologischer und sozialer Faktoren annehmen. Die biologischen und genetischen Aspekte möchte ich hier nicht weiter vertiefen. Bei der Panikstörung sind es ja oft die körperlichen Symptome, die anfangs ganz im Vordergrund stehen. Lerntheoretische Modelle gehen in ihren Erklärungsansätzen davon aus, dass in einem ersten Schritt an sich harmlose oder unbedeutende Körpersignale mit dem Empfinden von Gefahr verknüpft werden. Solche Körpersignale können z. B. ein Spannungsgefühl im Kopf, ein beschleunigter Herzschlag oder ein unbestimmter Schwindel sein. Diese ungerechtfertigte Bewertung eines führt zu einer erhöhten Aufmerksamkeit gegenüber eben diesen Körpersignalen, was die Wahrnehmung intensiviert: Aus dem Spannungsgefühl werden Kopfschmerzen, die etwas höhere Herzfrequenz verwandelt sich in Herzrasen, der leichte Schwindel wird zu einem schwer erträglichen Benommensein. In diesem zweiten Schritt wird die Verknüpfung – dass eine ängstigende körperliche Missempfindung Gefahr bedeutet - also gerade nicht auf ihre Plausibilität überprüft, sondern als stimmig erlebt und so noch verstärkt. Ich horche nun in mich hinein, achte besonders auf das störende Symptom, spüre meine Missempfindungen noch deutlicher. Das steigert wiederum die Annahme einer Gefahr: So kann eine Eskalation der Angst zu Panik entstehen. In der Folge werde ich versuchen, die Auslösung des Symptoms zu vermeiden. Gelingt mir dies, so tritt die befürchtete Angstreaktion nicht ein und die ungerechtfertigte Verknüpfung des Körpersignals mit der Annahme einer Gefahr und der daraus resultierenden Angstreaktion erscheint mir genau durch mein Vermeidungsverhalten als belegt. In diesem Modell wäre es auch denkbar, dass eine neutrale Situation mit „Gefahr“ verknüpft wird und der gleiche Mechanismus wie beschrieben eintritt: Ich nehme in der an sich ungefährlichen Situation Angst wahr, gehe davon aus, dass es diese Situation ist, die die Angst bewirkt, horche in mich hinein, nehme die Angst dadurch stärker wahr, fühle mich so in der Vermutung bestätigt, dass diese Situation für meine Angst verantwortlich ist und gerate in eine eskalierende Situation. Diese Situation werde ich in der Folge vermeiden, werde dadurch weniger Angst haben und bewerte das als Bestätigung für meine anfangs getroffene, allerdings eigentlich unzutreffende Verknüpfung. Typischerweise treten Panikattacken erstmals im jungen Erwachsenenalster auf. Betroffen fühlen sich davon überwältigt, sie wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Ihre Angst körperlich krank zu sein führt zu aufwändiger medizinischer Diagnostik, ihre Beunruhigung ist so ansteckend, dass oft auch die Behandler zunächst fest von gefährlichen körperlichen Ursachen ausgehen. Es dauert oft lange, bis Betroffene akzeptieren können, dass es sich bei dem erschreckenden Schwindel, den Atembeschwerden, dem Schwitzen um Angstäquivalente handelt. Vielleicht ist Ihnen ja aufgefallen, dass die Skizze unserer lerntheoretischen Modelle nicht nur einige Fragen offen gelassen hat – z. B. warum ein zufälliges körperliches Symptom oder eine an sich neutrale Situation mit „Gefahr“ verknüpft wird - sondern dass dieses Modell ganz auf das Individuum zentriert ist und ohne ein Gegenüber, ohne zwischenmenschliche Beziehung auskommt. Verspricht der Titel „Angst und zwischenmenschliche Beziehungen im Erwachsenenalter“ also zuviel? Um uns der Bedeutung des Beziehungsaspektes zu widmen, möchte ich nun skizzieren, dass es eine gelungene seelische Entwicklung ist, die uns davor schützen kann, die oben beschriebenen 3 Fehlverknüpfungen vorzunehmen und die uns hilft, nicht in ein solch eskalierendes Angsterleben zu geraten. Dazu werde ich mir erlauben, stark vereinfachend vorzugehen. Ich hatte bereits die angeborenen primären Emotionen erwähnt. (PP 6) Ab dem ersten Lebenstag nimmt eine feinfühlige Beziehungsperson, oft die Mutter, die Gefühle des Säuglings wahr, spiegelt und beantwortet diese und baut damit die Grundvoraussetzungen dafür auf, dass das Kind im Laufe der weiteren Entwicklung Gefühle zur eigenen Orientierung nutzen kann, d. h. bei sich und anderen erkennt. Die Überschrift für diese Entwicklungsaufgabe ist „Nähe“. (PP7) In dieser Phase geht es ganz besonders auch um die ausreichende Versorgung des Babys, das Stillen körperlicher Bedürfnisse. Die Bezugsperson hilft dem Kind, unerträgliche Spannungen zu regulieren, eine Voraussetzung dafür, dass wir später eigenständig negative Gefühle (Angst, Wut) regulieren können. Nähe und Distanz werden erlebbar, der andere wird als von mir getrennt wahrgenommen. (PP 8) Im ersten Lebensjahr ist das Bindungssystem etabliert, die Überschrift für diese Entwicklungsaufgabe ist also „Bindung“. Bindung ist die Gewähr dafür, dass ich mich bei meinem Gegenüber sicher, dass ich mich geborgen fühle und mich selbst als lebendig und liebenswert erlebe. Dieser sowie der vorherige und die folgenden Entwicklungsschritte sind natürlich nicht nur immateriell „psychologisch“, sie gehen mit einer Reifung des Gehirns einher und haben als solche anatomische und biochemische Entsprechungen. (PP 9) Die inzwischen erreichte Stabilität in einer sicheren Bindung ermöglicht es dem Kleinkind dann, etwa ab dem 2. oder 3. Lebensjahr, die Nähe zur Mutter zu verlassen, sich zu entfernen, die Welt zu erkunden und sich zu trauen, zu widersprechen, seinen Willen deutlich zu artikulieren und sich durchzusetzen. Dies ist also die Aufgabe der Autonomieentwicklung. (PP 10) Vom dritten bis sechsten Lebensjahr steht die Ausformung der eigenen Identität ganz im Vordergrund der Entwicklung, wobei man sich nicht vorstellen darf, dass die vorherigen Entwicklungsschritte erledigt, quasi abgehakt wären. Das Kleinkind erlebt sich in unterschiedlichen sozialen Rollen, in der Gruppe im Kindergarten, in der Beziehung zu Geschwistern, in den geschlechtsspezifischen Beziehungen zu Vater und Mutter. Hier geht es darum sich abzugrenzen, sich zu identifizieren, zu konkurrieren und sich so selbst zu finden. (PP 11) In der Adoleszenz sind viele dieser Entwicklungsthemen, von Identität, Autonomie und Intimität unter den neuen Voraussetzungen enormer körperlicher Veränderungen und einer neuen Bedeutung sozialer, insbesondere der Peer Beziehungen, erneut Themen und erfordern nun neue, erwachsene Antworten. Sie ahnen und haben es auf den Bildern der Präsentation bereits angedeutet gesehen: In dieser Entwicklung sind verschiedene Krisen denkbar, der Begriff der Entwicklungsaufgabe impliziert, dass diese Aufgaben nicht immer gelöst werden können. Ich hoffe es ist deutlich geworden, dass die psychologischen Themen in einem Beziehungsgefüge, einem sozialen Kontext entwickelt werden und, wie angedeutet, dass die psychologische Reifung immer mit einer Reifung und Entwicklung des Gehirns verbunden ist. Jetzt möchte ich mich wieder der Problematik von Frau X. zuwenden. Können wir vor dem Hintergrund dieses Entwicklungsmodells vielleicht schon etwas über das „woher“ ihrer Angst sagen? 4 Es stellt sich heraus, dass Frau X. erstmals mit Panikattacken reagierte, als sie, gemäß dem von mir gezeigten Entwicklungsmodell, mit Mitte zwanzig gerade erwachsen geworden war. Ihr Kind war, nach einer ungewollten Schwangerschaft, auf der Welt, sie hatte sich von dem Vater des Kindes getrennt und war eine neue Beziehung eingegangen. Ich möchte keine weiteren Einzelheiten zu ihrer Biografie benennen, um die Anonymität der Fallgeschichte zu bewahren. Was ich Ihnen bereits beschrieben habe war das Auftreten und die Beziehungsaufnahme der Frau X. gegenüber uns Helfern. Sie erinnern sich: Sie war etwas forsch, abweisend, bestand auf ihrer Autonomie und gab vor, eigentlich keine Hilfe zu wollen. Lassen Sie und nun einige Vermutungen anstellen zu dem „woher“ der Panikstörung. Wir haben ein sehr auf Autonomie drängendes Beziehungsverhalten bei Frau X. gesehen, was überraschend und wenig angemessen wirkte, weil sie ja tatsächlich abhängig von der sicheren Umgebung, abhängig von der Hilfe ihres Partners war. Möglicherweise ist dieses Beziehungsverhalten am besten als „pseudoautonom“ zu beschreiben. Frau X. lehnt Hilfe ab, tut so, als habe sie alles im Griff. Es täte ihr einerseits gut Hilfe anzunehmen, andererseits würde sie sich, so wie wir sie kennen gelernt haben, wahrscheinlich bevormundet, also in ihrer Autonomie bedroht fühlen. Gemäß diesen Überlegungen könnte ihrem merkwürdigen Beziehungsverhalten (vorausgesetzt wir hätten in dem kurzen ersten Kontakt etwas für sie typisches erlebt) eine lebensgeschichtlich ungelöste Entwicklungsaufgabe auf dem Feld der Autonomie vorliegen. Wenn wir dieser Annahme folgen, müssten wir das ungelöste Thema „Autonomie und Abhängigkeit“ an dem Punkt ihrer Biografie wiederfinden, als die ersten Paniksymptome aufgetreten sind. Und hier werden wir fündig: Mit dem Beginn ihres Erwachsenseins hatte Frau X. eine gewisse Autonomie erreicht. Diese war aber vermutlich wenig gefestigt. Sie verdiente ihr eigenes Geld, hatte eine Ausbildung beendet. Nun wird sie ungewollt schwanger. Sie hat vermutlich keine Antworten auf die Frage, wie das zu einem selbständigen Leben passen könnte? Sie bekommt das Kind, wir nehmen an, dass sie eine erhebliche Einengung erlebt, wir vermuten, sie hat erste Panikattacken als Reaktion auf diese Einengung, sie findet sich in einer abhängigen Lebenssituation wieder. Trotz einer Besserung der Symptome nach einer Behandlung schafft sie ihren Job nicht mehr wegen der Angst, trennt sich, beginnt aber nahtlos eine andere Beziehung. Wir können das so interpretieren, dass sie die Sicherheit einer Paarbeziehung nicht aufgibt, sie wechselt von der einen Sicherheit, wahrscheinlich Abhängigkeit, in die andere. Ein adäquater Umgang mit ihren Wünschen nach Selbstständigkeit und der Tatsache neuer, durch die Beziehung zum Kind generierter Abhängigkeiten ist ihr nicht gelungen. Ich komme zu meinem zweiten Fall. Herr Y., Mitte 30, ein schmächtiger, freundlich lächelnder, etwas schüchtern wirkender Mann, berichtet, er habe schon immer Angst. Vor vier Jahren sei er erstmals stationär psychiatrisch behandelt worden, seit drei Jahren könne er nicht mehr arbeiten, seit zwei Jahren sei er berentet. Er habe zeitweise viel getrunken, sei im Rausch sehr aggressiv gewesen. Jetzt kiffe er regelmäßig, dadurch reduziere er seine enorme innere Anspannung. Er vermeide die Begegnung mit anderen Menschen. Gegenüber seinen Angehörigen komme er sich vor wie ein Schauspieler, unecht eben. Sein wahres Ich erlebe er nur, wenn er allein in seiner Wohnung sei: Dieses Ich sei ein Nichts, eine völlige Leere. Er sei einsam, halte das Alleinsein in der Wohnung kaum aus. Manchmal ziehe er sich Frauensachen an, betrachte sich lange im Spiegel oder 5 erstelle Fotomontagen am PC, füge sein Gesicht in das Foto einer unbekleideten Frau ein. Er hasse seinen Körper: Wenn eine Frau ihm sage, er sehe gut aus, mache ihn das rasend wütend. Herr Y. hat ständig Angst. Er sagt, er erlebe mal ein Gefühlschaos mal eine quälende innere Leere. Die Gefühle die er kenne seien Angst, Wut und Hass. Er kämpfe gegen die innere Anspannung, schlage manchmal mit den Fäusten gegen die Wand, manchmal dusche er extrem heiß, um sich weh zu tun, habe sich auch schon Schnittverletzungen zugefügt. Schauen wir auf unser Fallbeispiel, Herrn Y. um etwas genauer zu verstehen, woher hier die Angst kommt. Herr Y. beschreibt sich als innerlich leer, er ist sich unsicher, ob er männlich oder weiblich ist, probiert weibliche und männliche Rollen aus, findet aber keine Antwort. Hier schildert er Aspekte einer massiven Identitätsstörung. Außerdem deutet er an, dass er seine negativen Emotionen ausgeliefert ist, oft kann er diese innerlich nicht regulieren und verletzt sich äußerlich, um von der inneren Spannung abzulenken oder aber um sich einfach nur zu spüren. Er hat Angst, wenn er alleine ist, kann diesen Zustand kaum ertragen. Und er hat Angst, wenn er anderen begegnet, diese erscheinen ihm bedrohlich und er selbst kommt sich vor wie ein Schauspieler, der nur vorgibt jemand zu sein. Herrn Y. fehlt das grundlegende psychologische Handwerkszeug um zwischenmenschliche Beziehungen zu gestalten. Das sind diejenigen psychologischen Werkzeuge, die uns in der Regel erlauben, uns selbst und unser Gegenüber zu verstehen und uns so mitzuteilen, dass wir grundsätzlich verstanden werden. Dieses Werkzeug ermöglicht es uns auch zu wissen, dass es andere gibt denen wir wichtig sind und andere, die uns wichtig sind. Wir wissen das unabhängig davon, ob diese Personen gerade anwesend sind. Was ich hier umgangssprachlich als „psychologisches Werkzeug“ bezeichnet habe, wird fachlich als „psychische Struktur“ bezeichnet. Bei Defiziten derselben bezeichnen wir das als „strukturelle Störung der Psyche“. Sie werden jetzt verstehen, wie orientierungslos und daher verängstigt jemand ist, der strukturelle derartig gestört ist und wie ängstlich man werden kann, wenn der Halt gebende Andere sofort aus meinem Bewusstsein verschwindet, wenn er körperlich nicht mehr in meiner Nähe ist. Letzteres ist ein klarer Hinweis auf eine Bindungsstörung, diese, wie auch die Störung der Identität sind Aspekte der bei Herrn Y. vorliegenden strukturellen Störung. Vielleicht erinnern sie sich daran, dass das Thema Identität in dem kurzen entwicklungpsychologischen Abriss bereits vorkam. (PP 12) Schwierigkeiten diese Entwicklungsaufgaben des 3. Bis 6. Lebensjahres zu bewältigen, können zu Identitätskonflikten führen. Bei einem Konflikt sind zwei Positionen nicht miteinander vereinbar, Positionen, die im Falle eines neurotischen Konflikte nicht oder nur teilweise bewusst sind. Bei Herrn Y. haben wir es aber nicht mit einem Konflikt sondern um ein Defizit in Sachen Identität zu tun: Es gibt keine unbewussten Vorstellungen, wer er eigentlich ist und was ihn dabei hemmt, seine Wünsche zu verfolgen. Wir müssen also in unserem entwicklungspsychologischen Modell an einer anderen Stelle suchen, wenn wir herausbekommen wollen, wann und wie dieses Entwicklungsdefizit, die strukturelle Störung, entsteht. (PP 13) Wir können uns das so vorstellen, dass strukturelle Fehlentwicklungen aus der fehlenden Passung zwischen den Grundbedürfnissen des Kindes und den 6 Versorgungsmöglichkeiten der Betreuungsperson resultieren. (Rudolf 2006) Insofern wird es sie nicht überraschen, dass wir dazu an den Anfang der Entwicklung zurückgehen müssen. (PP 14) Schauen wir uns das noch etwas genauer an. Die Grundlagen für die Entwicklung der psychischen Struktur werden in den ersten ein bis zwei Lebensjahren gelegt. (PP 15) Diese Grundlagen werden in der weiteren Entwicklung ausdifferenziert, ich benötige aber Grundfertigkeiten, wenn ich die entwicklungspsychologischen Aufgaben der Autonomie, der Identität und des Erwachsenwerdens meistern will. (PP 15, PP 16) Ich möchte noch eine kurze Bemerkung zur psychiatrischen Diagnose bei Herrn Y. machen. Mit dem Begriff der strukturellen Störung haben wir uns ein Modell der seelischen Funktion angeschaut, dass von entwicklungspsychologischen Beobachtungen und Befunden abgeleitet ist. Wenn wir das Phänomen seines Verhaltens beschreiben, und das ist der Ansatz der gültigen Klassifikation psychischer Störungen, stellen wir bei ihm eine Persönlichkeitsstörung fest. (PP 18) Das diagnostische Konzept der Persönlichkeitsstörungen ist kritisiert worden, weil es in gewisser Weise eine Krankheit ohne Beginn und ohne Ende ist. Wenn wir diese Diagnose stellen, müssen wir nachweisen, dass das Bündel problematischer Eigenschaften rückblickend bereits in Kindheit und Jugend erkennbar war und sich während des gesamten Erwachsenenalters bis zum Zeitpunkt der Diagnosestellung nachweisen lässt. Das Konzept der Persönlichkeitsstörungen ist außerdem, mehr als andere psychiatrischen Diagnosen daran ausgerichtet, was man unter Normalität versteht. (PP19) „Die charakteristischen und dauerhaften inneren Erfahrungs- und Verhaltensmuster der Betroffenen weichen insgesamt deutlich von kulturell erwarteten und akzeptierten Vorgaben („Normen“) ab. … Abweichungen… [der] 1. Kognition (d. h. Wahrnehmung und Interpretation von Dingen, Menschen und Ereignissen… Vorstellungen von sich und anderen…. 2. Affektivität (Variationsbreite, Intensität und Angemessenheit der emotionalen Ansprechbarkeit und Reaktion…. 3. Impulskontrolle und Bedürfnisbefriedigung [und] 4. Die Art des Umgangs mit anderen Menschen und die Handhabung zwischenmenschlicher Beziehungen.“ (ICD 10) Das wird natürlich in unseren diagnostischen Inventars noch weiter spezifiziert, aber vielleicht sehen sie schon das Dilemma: Verdeutlichen wir uns die Schilderung des Herrn Y. und die damit verbundenen innere Not, so haben wir wenig Zweifel daran, dass er mit seinem Verhalten und seinen Gefühlen weit von einer angenommenen Norm entfernt ist. Wenngleich diese Zustandsbilder in der internationalen Klassifikation als Krankheiten erfasst sind, verstehen wir diesen Zustand eher, wenn wir ihn als Störungen bezeichnen und Menschen meinen, deren Verhalten und deren Art für sie selbst oder für andere störend oder auch verstörend ist. Menschen mit diesen Störungen haben nicht selten zusätzlich eine Suchterkrankung. Bei Herrn Y., dessen zwischenmenschliche Kompetenzen durch die strukturelle Störung beeinträchtigt ist, liegt zweitweise auch eine psychotische Symptomatik vor, er fühlt sich in der Wohnung abgehört und beobachtet. Wenn man es salopp formuliert könnte man sagen, er hat in Bezug auf die soziale Realität ohnehin schon wenig Bodenhaftung, weil er sich und andere wegen der strukturellen Störung schlecht oder kaum versteht. Wenn er seine Wahrnehmung und sein Urteilsvermögen durch Cannabis weiter schwächt, hebt er (psychotisch) ab. 7 Bevor ich zu einem dritten Fall komme, möchte ich eine kurze Zwischenbilanz ziehen. Diese zwei sehr unterschiedlichen psychiatrischen Fallgeschichten vermitteln typische Konstellationen von „Angst im Erwachsenenalter“. Frau X. ringt um Autonomie. Wir nehmen an, dass die Geburt ihres Kindes und die damit zusammenhängende neue Lebenssituation ihr psychologisches Gleichgewicht gestört haben und als Reaktion darauf die Panikstörung aufgetreten ist. Wir nehmen ferner an, dass dieses Gleichgewicht schon vorher labil war, weil die Autonomieentwicklung in der Kleinkindzeit nur unzureichend gelungen ist. Wenn das stimmt, wird es Frau X. Entwicklungsaufgabe in zwischenmenschlichen Beziehungen sein, Unterstützung anderer anzunehmen ohne diese als Angriff auf die Eigenständigkeit zu verstehen, auf unvermeidliche Abhängigkeiten gelassen zu reagieren und in der Außenwelt zu erproben, dass das Verlassen der Wohnung keine Gefahr für sie bedeutet. Bei Herrn Y. liegen die Dinge anders. Wir kennen die soziale Konstellation nicht, die ihn zur Dekompensation im Erwachsenenalter gebracht hat. Hier müssen die Sucht und die psychotische Störung, beides steht im engen Zusammenhang zu seinen entwicklungspsychologischen Defiziten, die wir als strukturelle Störung bezeichnet haben, behandelt werden. Sich überwacht und beobachtet zu fühlen verhindert zwischenmenschliche Begegnungen und führt, besonders im Zusammenhang mit der Sucht, zu Beziehungsabbrüchen, Arbeitsunfähigkeit und sozialer Isolation. Bei Herrn Y. nehmen wir eine sehr frühe Störung der psychischen Entwicklung an, bei Frau X. eine spätere Komplikation der Entwicklung. Der psychologische Werkzeugkasten von Frau X. ist einigermaßen gefüllt, die Werkzeugkiste von Herrn Y. ist ziemlich leer. Mein dritter Fall: Frau Z. ist Anfang 40, sie leidet unter Herzrasen, Kopfschmerzen und Angst. Körperlich ist sie gesund. Besonders nachts ist es schlimm, sie hat Alpträume, sieht ängstigende Schatten, wenn sie aufwacht, sie lässt nachts deswegen das Licht an. Tagsüber ist sie nervös und ängstlich, quälende Erinnerungen brechen in den Alltag ein. Bei einem Termin mit mir berichtet sie angstvoll, sie sei sich sicher, am Vortag einen ihrer Peiniger auf der Straße gesehen zu haben. Frau Z. stammt aus einem afrikanischen Staat. Sie ist nach Deutschland geflüchtet, hat ihre Kinder bei ihren Eltern zurückgelassen und bei ihrer Ankunft auf dem Flughafen Frankfurt Asyl beantragt. Sie berichtet, sie sei aus politischen Gründen in ihrer Heimat unter unmenschlichen Bedingungen inhaftiert gewesen und sei körperlich misshandelt worden. Wegen erheblicher Verletzungen sei sie dann in einem Krankenhaus behandelt worden und habe von dort fliehen können. Frau Z. ist vorher nicht psychiatrisch behandelt worden, vor der Inhaftierung war sie seelisch gesund. Sie hatte ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern, hat studiert und hatte später eine feste Arbeit. Bei Frau Z. liegt eine Posttraumatische Belastungsstörung vor. Eine paradoxe Situation ist eingetreten: Sie ist in Deutschland in Sicherheit, sie hat aber dennoch große Angst. Durch die Flucht aus dem Gefängnis und die Flucht aus ihrem Heimatland hat sie Fakten geschaffen, die sie dort noch angreifbarer machen. Sie weiß, dass der Ausgang ihres Asylverfahrens offen ist und auch mit einer Abschiebung enden kann. Die PTSD ist psychiatriegeschichtlich bedeutsam, weil sie eine wesentliche Erkenntnis aufgreift und in ein diagnostisches Konzept bringt (PP 20): Dass es nämlich plötzliche Ereignisse „von außergewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophalem Ausmaß“ gibt, die „ bei nahezu jedem 8 tiefgreifende Verzweiflung auslösen würden.“ (ICD 10) Solch ein „Ereignis oder Geschehen“ bezeichnen wir als Trauma. Das Konzept der PTSD stellt darüber hinaus klar, dass dies zu nachhaltigen psychischen Folgen führen kann. Sie werden jetzt vielleicht einwenden, dass das lange bekannt und eine banale Erkenntnis sei. Traumatisierte Soldaten mit typischen Symptomen, die „Kriegszitterer“, habe es schon im und nach dem ersten Weltkrieg gegeben. Wenn wir genauer nachschauen, sind Traumatisierungen schon bei einem Soldaten des amerikanischen Bürgerkriegs beschrieben. Bringt die Diagnose PTSD also nichts Neues? (PP 21) Ich denke, dass wir mit der Betrachtung der PTSD schon eine entscheidende Erweiterung für unser Thema „Angst und zwischenmenschliche Beziehungen im Erwachsenenalter“ gewinnen. Bei den ersten beiden Fällen entstanden wesentliche Grundlagen der Angst in der kindlichen Entwicklung. Im ersten Fall, Frau X., nehmen wir eine unzureichende Bewältigung der Aufgabe an, selbständig (autonom) zu sein, selbständig in der Bezogenheit auf Andere und in der Gewissheit verlässlicher, ausreichend guter Beziehungen. Im zweiten Fall, Herr Y., sind auf Grund fehlender oder unzuverlässiger Sorge und Zuwendung Defizite der Selbstwahrnehmung, der Identität und im Umgang mit andrängenden Gefühlen entstanden. Bei Frau Z., unserem dritten Fall, nehmen wir hingegen an, dass ihre Angst durch traumatische Erfahrungen im Erwachsenenalter entstanden ist und dass sie eine im Wesentlichen positive eigene psychologische Entwicklung in Kindheit und Jugend hatte. Möglicherweise wenden Sie weiterhin ein, dass auch das nicht Neues sei, vielleicht fallen Ihnen eigenen Erfahrungen oder Beispiele aus der eigenen Familiengeschichte ein, sie denken an eigene Angehörige, die Soldaten im zweiten Weltkrieg waren, oder an Angehörige, die durch Flucht, Vertreibung oder die Bombardements der Städte seelisch beschädigt wurden. An dieser Stelle möchte ich dazu lediglich feststellen, dass das Konzept der PTSD vielleicht ja dazu beitragen kann, dass auch über diese Belastungen mehr gesprochen und weniger schamhaft geschwiegen wird. Wenn man mit Angstsymptomen Erkrankten dabei helfen möchte, Angst zu überwinden, gilt es Entwicklungen einzuleiten. Dazu ist es oft sinnvoll, Psychopharmaka zur Entlastung einzusetzen. Die Entwicklungen um die es geht betreffen die persönliche Beziehungsgestaltung, die Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie, es geht aber auch darum freundschaftliche und familiäre Kontakte zu führen, sicher und angemessen zu wohnen und eine sinnstiftende Beschäftigung zu haben. Mein letztes Fallbeispiel, Frau Z. mit der PTSD, macht das deutlich: Für die Bewältigung ihrer Angst war es wichtig, mir, einer Vertrauensperson, über das Trauma berichtet zu haben und in den Behandlungskontakten ihre Angst zum Thema zu machen. Medikamente haben ihr kaum geholfen. Was ihr in der Behandlung genau geholfen hat ist schwer in Worte zu fassen: Ich glaube es war so etwas wie eine weltliche Form der Seelsorge. Wichtig für die Bewältigung der Angst waren aber auch die Aktivitäten der Behörden (Ausländerbehörde, Sozialamt, Bundesamt für Migration), also die Aktivitäten der Verwaltungsangestellten, ihrer Anwältin, Aktivitäten die zur Feststellung der Verfolgung führten und dazu, dass sie hier in Deutschland Asyl erhielt. Dadurch ist ihr die Teilhabe an Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und sozialer Sicherung auf Dauer garantiert, was eines der stärksten Mittel gegen Existenzangst darstellt. Frau Z. ist natürlich nicht geheilt von ihrer Angst. Sie kann aber 9 damit leben und schlägt Angebote aus, die Posttraumatische Belastungsstörung mit speziellen Verfahren zu behandeln. Sie möchte nicht mehr darüber reden, sie will sich der Gegenwart stellen. Sie ist aus dem Asylbewerberheim ausgezogen, ihre minderjährigen Kinder sind inzwischen aus Afrika nach Wolfsburg gekommen. Frau Z. spricht inzwischen so gut deutsch, dass ein Dolmetscher nicht mehr benötigt wird. Ein Beispiel dafür also, dass Psychiatrie und Psychotherapie beim Thema „Angst“ nicht alles sind und, wenn sie sich die Häufigkeit von Angststörungen, über die ich berichtet habe, noch einmal vor Augen führen, auch nicht alles sein können. Ich möchte Ihnen jetzt noch berichten, wie es mit Frau X. (Panikattacken) weitergegangen ist. Frau X. war vor kurzem bei mir zu einem Termin in der Ambulanz. Ich hatte sie länger Zeit nicht gesehen. Seit dem ersten Kontakt sind etwa drei Jahre vergangen. Frau X. erschien ohne Begleitung bei mir, hatte sich getraut alleine das Haus zu verlassen und war mit dem Bus gekommen. Sie berichtete mir stolz, dass sie umgezogen sei in den ihr vertrauten Stadtteil in dem sie aufgewachsen ist und dass sie wieder arbeite. Eine tolle Entwicklung: Ihr haben die ambulante Psychotherapie und die Psychopharmaka weitergeholfen, sie hat aber parallel dazu wichtige soziale Entwicklungsschritte (Umzug, vorsichtiger Arbeitsversuch etc.) gemacht. Hier lief die seelische parallel mit der sozialen Entwicklung, innere und äußere Entwicklung ergänzten und verstärkten sich gegenseitig. Die Geschichte von Herrn Y. zeigt, so glaube ich, recht gut, dass seelische Entwicklung ohne eine Entsprechung im wirklichen Leben, also ohne eine soziale Entwicklung, kaum möglich ist. Seine drogeninduzierte Psychose ließ sich medikamentös recht gut behandeln. Eine lange und aufwändige psychotherapeutische Behandlung im psychiatrischen Krankenhaus hat ihn nicht stabilisieren können. Aus meiner Sicht war das ein zu ehrgeiziger Plan. Es wäre besser gewesen, ihn durch eine geringfügige Beschäftigung oder ein Praktikum in Wolfsburg zu stabilisieren, seine Wohnsituation vorsichtig zu verändern und die unvermeidlichen seelischen Krisen, mit THC Rückfällen und psychotischen Ängsten, ambulant frühzeitig zu behandeln. Die lange stationäre Psychotherapie hat ihn aber aus seinen sozialen Bezügen in Wolfsburg gelöst; hier gab es keine Entsprechung der seelischen Entwicklung mit der Entwicklung im sozialen (äußeren) Leben. Herr Y. machte eher einen Rückschritt und wird in eine Einrichtung für Menschen mit einer seelischen Behinderung ziehen. Ich komme zum Schluss. Ich hatte anfangs bemerkt, dass Angst ein allgegenwärtiges Phänomen in der Psychiatrie und Psychotherapie ist. Ich habe Ihnen drei psychiatrische Fallgeschichten zum Thema „Angst“ geschildert. Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass ich nichts über die Angst der Psychiater gesagt habe, eine Angst, die wie eine Ansteckung in der Begegnung mit angstvollen Patienten auftreten kann, ein Befremden der Behandler, wenn er oder sie mit der Fremdheit bestimmter Symptome (Stimmenhören, Wahn) konfrontiert ist. Und dann gibt es noch die Angst, als Psychiater einer Gefährdung ausgesetzt zu sein, wenn man als Behandler mit sehr verwirrten und angespannten Patientinnen oder Patienten zu tun hat. Nur so viel dazu: Genauso wie wir unsere Patientinnen und Patienten auffordern über die Angst zu sprechen, müssen wir in der Psychiatrie Tätigen über die im beruflichen Kontext auftretenden eigenen Ängste sprechen und diese bearbeiten. Versäumen wir dies, so laufen wir Gefahr mit der Psychiatrie und der Psychotherapie großen Schaden anzurichten. 10 Mehrfach war die Rede von belasteten, problematischen Entwicklungen in der Kindheit, der Jugend und im Erwachsenenalter, die sich negativ auf die seelische Gesundheit auswirken können. Die Risikofaktoren für die seelische Entwicklung können wir inzwischen sehr genau benennen; das ist hilfreich, es hilft uns nicht nur das problematische Verhalten unserer Patienten zu erklären, wenn wir uns mit deren Lebensgeschichte auseinandersetzen. Dieses Wissen um Risikofaktoren ist auch nützlich, für die Prävention seelischer Störungen, für die Frage, welche Lebensverhältnisse die Chancen einer gesunden seelischen Entwicklung verbessern. Diese Aufgabe der Prävention seelischer Störungen geht alle Behandler an, sie verweist aber auch auf andere Wissensgebiete und Handlungsfelder. Bei der Behandlung von Angst im Erwachsenenalter geht es darum, individuelle Entwicklungen zu unterstützen, deren Ergebnisse die Angst mindern oder die Angst überflüssig machen. Das gelingt, wenn wir uns zum einen mit der Person, ihrer Lebensgeschichte, ihrem Verhalten, ihren Stärken und ihren Schwächen, also mit dem Individuellen beschäftigen. Wir müssen es aber zum anderen beim Behandeln fertig bringen, den Fokus in eine gänzlich andere Richtung zu verschieben: Mit der gleichen Intensität sollten wir uns um das Nicht-Individuelle, nämlich um das soziale Umfeld, um die Lebensverhältnisse, die sozialen Chancen und die Rechte der Person kümmern. In der Behandlung gilt es, diese Perspektiven alternierend einzunehmen. Die Sorge um unsere Patienten gibt uns schließlich auch auf, öffentlich Stellung zu beziehen gegenüber Vorurteilen über „die Psychiatrie“ und gegenüber „den psychisch Kranken“. Auch die Aufklärung der Öffentlichkeit stärkt unsere Patientinnen und Patienten und wirkt gegen Angst. 11