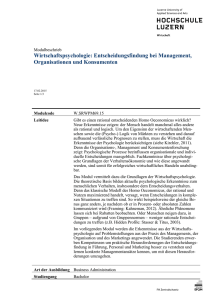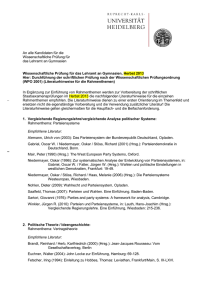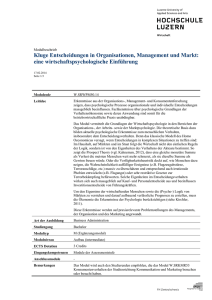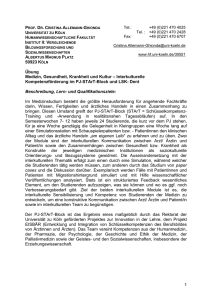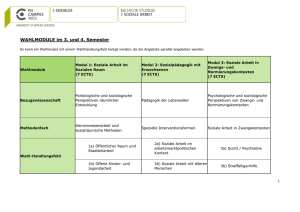Professor Dr - Technische Hochschule Nürnberg
Werbung
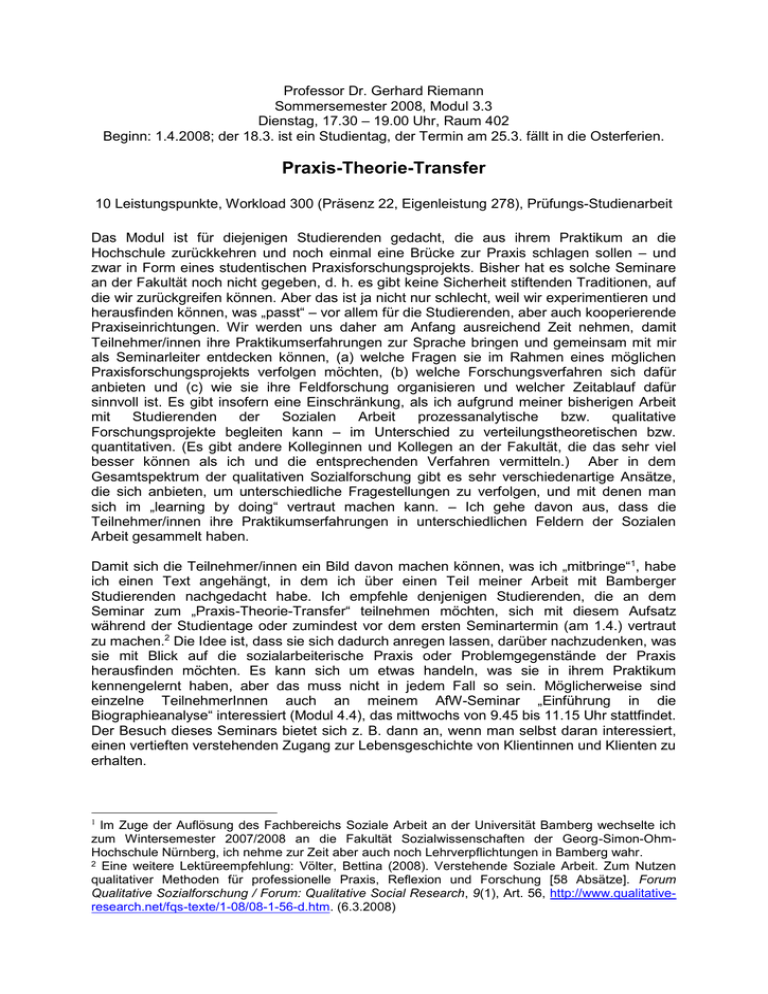
Professor Dr. Gerhard Riemann Sommersemester 2008, Modul 3.3 Dienstag, 17.30 – 19.00 Uhr, Raum 402 Beginn: 1.4.2008; der 18.3. ist ein Studientag, der Termin am 25.3. fällt in die Osterferien. Praxis-Theorie-Transfer 10 Leistungspunkte, Workload 300 (Präsenz 22, Eigenleistung 278), Prüfungs-Studienarbeit Das Modul ist für diejenigen Studierenden gedacht, die aus ihrem Praktikum an die Hochschule zurückkehren und noch einmal eine Brücke zur Praxis schlagen sollen – und zwar in Form eines studentischen Praxisforschungsprojekts. Bisher hat es solche Seminare an der Fakultät noch nicht gegeben, d. h. es gibt keine Sicherheit stiftenden Traditionen, auf die wir zurückgreifen können. Aber das ist ja nicht nur schlecht, weil wir experimentieren und herausfinden können, was „passt“ – vor allem für die Studierenden, aber auch kooperierende Praxiseinrichtungen. Wir werden uns daher am Anfang ausreichend Zeit nehmen, damit Teilnehmer/innen ihre Praktikumserfahrungen zur Sprache bringen und gemeinsam mit mir als Seminarleiter entdecken können, (a) welche Fragen sie im Rahmen eines möglichen Praxisforschungsprojekts verfolgen möchten, (b) welche Forschungsverfahren sich dafür anbieten und (c) wie sie ihre Feldforschung organisieren und welcher Zeitablauf dafür sinnvoll ist. Es gibt insofern eine Einschränkung, als ich aufgrund meiner bisherigen Arbeit mit Studierenden der Sozialen Arbeit prozessanalytische bzw. qualitative Forschungsprojekte begleiten kann – im Unterschied zu verteilungstheoretischen bzw. quantitativen. (Es gibt andere Kolleginnen und Kollegen an der Fakultät, die das sehr viel besser können als ich und die entsprechenden Verfahren vermitteln.) Aber in dem Gesamtspektrum der qualitativen Sozialforschung gibt es sehr verschiedenartige Ansätze, die sich anbieten, um unterschiedliche Fragestellungen zu verfolgen, und mit denen man sich im „learning by doing“ vertraut machen kann. – Ich gehe davon aus, dass die Teilnehmer/innen ihre Praktikumserfahrungen in unterschiedlichen Feldern der Sozialen Arbeit gesammelt haben. Damit sich die Teilnehmer/innen ein Bild davon machen können, was ich „mitbringe“1, habe ich einen Text angehängt, in dem ich über einen Teil meiner Arbeit mit Bamberger Studierenden nachgedacht habe. Ich empfehle denjenigen Studierenden, die an dem Seminar zum „Praxis-Theorie-Transfer“ teilnehmen möchten, sich mit diesem Aufsatz während der Studientage oder zumindest vor dem ersten Seminartermin (am 1.4.) vertraut zu machen.2 Die Idee ist, dass sie sich dadurch anregen lassen, darüber nachzudenken, was sie mit Blick auf die sozialarbeiterische Praxis oder Problemgegenstände der Praxis herausfinden möchten. Es kann sich um etwas handeln, was sie in ihrem Praktikum kennengelernt haben, aber das muss nicht in jedem Fall so sein. Möglicherweise sind einzelne TeilnehmerInnen auch an meinem AfW-Seminar „Einführung in die Biographieanalyse“ interessiert (Modul 4.4), das mittwochs von 9.45 bis 11.15 Uhr stattfindet. Der Besuch dieses Seminars bietet sich z. B. dann an, wenn man selbst daran interessiert, einen vertieften verstehenden Zugang zur Lebensgeschichte von Klientinnen und Klienten zu erhalten. 1 Im Zuge der Auflösung des Fachbereichs Soziale Arbeit an der Universität Bamberg wechselte ich zum Wintersemester 2007/2008 an die Fakultät Sozialwissenschaften der Georg-Simon-OhmHochschule Nürnberg, ich nehme zur Zeit aber auch noch Lehrverpflichtungen in Bamberg wahr. 2 Eine weitere Lektüreempfehlung: Völter, Bettina (2008). Verstehende Soziale Arbeit. Zum Nutzen qualitativer Methoden für professionelle Praxis, Reflexion und Forschung [58 Absätze]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 9(1), Art. 56, http://www.qualitativeresearch.net/fqs-texte/1-08/08-1-56-d.htm. (6.3.2008) Erschienen in: Andreas Hanses, Hrsg., Biographie und Soziale Arbeit. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2004, S. 190-208 Gerhard Riemann Die Befremdung der eigenen Praxis3 1 Vorbemerkungen Im Folgenden geht es mir darum, einen Teil meiner Arbeit mit Studierenden des Sozialen Arbeit an der Universität Bamberg sichtbar zu machen, der sich als Versuch verstehen lässt, sie anzuregen und dabei zu begleiten, ihre eigene Praxis (insbesondere im Kontext von studienbegleitenden Praktika oder integrierten Berufspraktika) und die von Professionellen, mit denen sie in Berührung kommen, mit einem fremden – ethnographischen - Blick zu betrachten. Ein solches Lehr- und Lernarrangement trägt dazu bei, dass (1) angehende Professionelle sozialwissenschaftlich-fallanalytische Kompetenzen erwerben, die für ihre spätere berufliche Tätigkeit grundlegend sind, (2) sich selbstkritische professionelle Diskurse über die eigene Praxis und das, was daran problematisch sein kann, entwickeln und (3) unprätentiöse (studentische) Beiträge zur empirischen Erkundung professioneller Handlungsfelder im Stil einer Grounded Theory (Glaser und Strauss 1967) entstehen. Ich orientiere mich dabei an der Vorstellung von einer Sozialforschung von unten und in eigener Sache. Auch wenn ich mich hier ausschließlich auf die Soziale Arbeit beziehe, lässt sich vieles auf andere professionelle Ausbildungs- und Handlungsfelder übertragen. Bei der Entscheidung für die Überschrift zu meinem Artikel ließ ich mich von dem Titel eines Sammelbands anregen, der von Stefan Hirschauer und Klaus Amann (1997) herausgegeben wurde. Sie verwenden, um ethnographisches Arbeiten in der Soziologie zu kennzeichnen, die Formulierung „Die Befremdung der eigenen Kultur“. Auch wenn es bei ihnen um die „Befremdung“ von etwas Eigenem – d. h. zur eigenen Gesellschaft Gehörendem - geht, ist hier noch immer eine klare Trennung von soziologischem Feldforscher und seinem Forschungsgegenstand mitgedacht – seien es „spezialsprachliche Expertengemeinschaften und Subkulturen“ oder „allgemein zugängliche Bereiche der Alltagserfahrung, z. B. städtische Öffentlichkeiten“, die „unter der Prämisse des zu entdeckenden Unbekannten“ betrachtet werden (Hirschauer und Amann 1997a, S. 12). Eine solche Trennung verschwimmt, wenn die Untersuchung der eigenen Praxis und des entsprechenden professionellen Handlungsfeldes und in diesem Zusammenhang die Rekonstruktion und Reflexion des eigenen Kompetenzerwerbs ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Die (angehende) Sozialarbeiterin wird selbst zur Ethnographin und zur Sozialforscherin in eigener Sache, zumindest ist dies das Ziel. Den Begriff der „Ethnographie“ verwende ich im Folgenden nicht, wie dies häufig geschieht, im Sinn einer bestimmten Methode, sondern um eine systematische Fremdheitshaltung gegenüber der sozialen Realität zu kennzeichnen, „die gleichwohl auf Verstehen abzielt“: „eine metatheoretische und metamethodische Haltung, die 3 Ich danke Thomas Reim und Fritz Schütze für ihre Anmerkungen zu einer ersten Fassung dieses Aufsatzes. eine prinzipielle Phänomenoffenheit und eine verfremdende Perspektive auf die zu erkundenden Phänomene impliziert. Sie muss sowohl Tendenzen zur Einvernahme (Nostrifizierung) als auch solche zur verdinglichenden Fremdmachung abwehren. Die ethnographische Sichtweise kann durch alle Verfahrensweisen der interpretativqualitativen Sozialforschung realisiert werden“ (Schütze 1994, S. 189f).4 Meine Vorgehensweise ist sowohl beeinflusst von meiner langjährigen Zusammenarbeit mit Fritz Schütze, insbesondere am Fachbereich Sozialwesen der Universität Kassel5, als auch von den Arbeitsuntersuchungen von Anselm Strauss und seinen Mitarbeiterinnen, die immer stark von der Reflexion eigener Arbeits-, aber auch Krankheitserfahrungen geprägt waren (Strauss und Glaser 1970, Strauss et al. 1985, S. 294f.) – in seiner Sprache: „experiential data“ (Strauss 1987, S. 10 – 13).6 Strauss´ wichtigste Forschungsmitarbeiterinnen waren in seinen letzten Lebensjahrzehnten in erster Linie berufserfahrene und soziologisch ausgebildete Krankenschwestern. Bevor ich näher auf das Lehr- und Lernarrangement eingehe, auf das ich mich eingangs bezogen habe, möchte ich, um den Sinn einer solchen forschungsbezogenen Ausbildung in der Sozialen Arbeit zu plausibilisieren, mit einer Beobachtung aus einer eigenen Untersuchung beginnen und anschließend ein paar grundsätzliche Anmerkungen zum Stellenwert sozialwissenschaftlicher Fallanalysen in der Sozialen Arbeit machen. 2 Das (Miss-)Verstehen einer Erzählung Ich beginne mit einer Beobachtung aus einem arbeits-, biographie- und interaktionsanalytischen Forschungsprojekt, das ich zur sozialpädagogischen Familienberatung durchgeführt habe (Riemann 2000) und das in der Tradition der Arbeits- und Professionsstudien von Everett Hughes (1984) und Anselm Strauss (Strauss et al. 1985) steht, also in der Tradition des Chicagoer Interaktionismus. Es geht um ein Gespräch7 zwischen einem Sozialarbeiter und einem männlichen Klienten (in der Anfangsphase eines längeren Arbeitsprozesses). Der Sozialarbeiter 4 Eine weite Verwendung des Ethnographiebegriffs findet sich auch in neueren Handbüchern (Atkinson et al., Hrsg., 2001) und programmatischen Erklärungen. Vgl. etwa Willis und Trondman (2000, S. 5): „What is ethnography for us? Most importantly it is a family of methods involving direct and sustained social contact with agents, and of richly writing up the encounter, respecting, recording, representing at least partly in its own terms, the irreducibility of human experience. Ethnography is the disciplined and deliberate witness-cum-recording of human events.” (kursiv im Original, G.R.) 5 Schütze hatte im Jahr 1994 einen längeren Artikel zur ethnographischen Perspektive in der Sozialen Arbeit verfasst (vgl. insbesondere Schütze 1994, S. 265-280), der für meine im Folgenden dargestellte Ausbildungspraxis wichtig wurde. 6 Ich sehe ebenfalls Anknüpfungspunkte bei den von Harold Garfinkel angeregten „studies of work“ (Sharrock und Anderson 1986), für deren Durchführung von ihm die Beherrschung der entsprechenden praktischen Kompetenzen als „unique adequacy requirement“ postuliert wird – eine Forderung, die mir zu scharf erscheint, zumal gerade die Schwellensituation der „Praxisnovizin“, der die Praxisroutinen noch nicht „in Fleisch und Blut übergegangen“ sind, für die Entdeckung von Neuem besonders fruchtbar ist. Das, was gegenwärtig unter dem Konzept der „Autoethnographie“ verstanden und diskutiert wird, ist in diesem Zusammenhang aufgrund der Tendenz zur „Selbstabsorption“ der Feldforscher / Autoren nicht so hilfreich. Hinweise auf diese Variante ethnographischen Schreibens finden sich bei Emerson et al. (2001, S. 361)), Murphy (2001, S. 345) und Reed-Danahay (2001, S. 407). 7 Die Ausführungen zu diesem Beispiel habe ich teilweise übernommen aus Riemann (2000, S. 321f.). bittet seinen Gesprächspartner, ihm einfach seine Lebensgeschichte zu erzählen. Der Klient beginnt mit seiner Erzählung, er ist außerordentlich motiviert, seine Geschichte zu rekapitulieren, und überlässt sich seinem Erinnerungsstrom. Es entsteht eine detaillierte und facettenreiche Stegreiferzählung, und der Sozialarbeiter, der ein sehr freundlicher Mann und ein erfahrener Professioneller ist, hört gut zu und ist sehr sparsam mit seinen Nachfragen, so das der Erzählfaden - die Orientierung an der eigenen autobiographischen Erfahrungsaufschichtung; oder weniger technisch formuliert: wie so eins zum anderen gekommen ist in der eigenen Lebensgeschichte - nicht unterbrochen wird. Aber zugleich ist für einen aufmerksamen Beobachter - und das war ich in dieser Situation - an einigen Reaktionen des Professionellen erkennbar, dass ihn irgendetwas an der Darstellung irritiert, und was das ist, wird deutlich, als der Klient gegangen ist und der Sozialarbeiter mir seine Eindrücke von dieser Sitzung und seine Einschätzungen von dem Klienten mitteilt: Er habe die Erzählung als diffus und ungeordnet erlebt, es habe ihn außerordentlich gestört, wie sein Gesprächspartner ständig gesprungen sei. Und diese Gesprächseindrücke verbindet er dann recht schnell mit leicht abschätzigen diagnostischen Typisierungen des Klienten überhaupt. Der Sozialarbeiter hat erst einmal etwas getan, was gute Professionelle tun sollten, was aber längst nicht selbstverständlich ist - er hat eine Situation herbeigeführt, in der sein Interaktionspartner frei von sich erzählen konnte, er hat ihm zugehört und sich bemüht, ihn zu verstehen. Aber zugleich ist bei diesem Verstehensprozess etwas missglückt. Wenn man etwas anders hingehört hätte - und dieses “Etwas anders Hinhören” lässt sich einüben - , hätte man entdeckt, dass die Erzählung in der Tat kompliziert war, aber nicht ungeordnet, und dass das, was erst einmal Mühe beim Zuhören bereitete, eine wichtige Ressource hätte sein können, um ein tieferes Verständnis für schwierige lebensgeschichtliche Erfahrungen des Interaktionspartners zu entwickeln - und auch für seine Probleme mit ihrer nachträglichen Verarbeitung. Das vermeintlich Diffuse waren die Anstrengungen des Erzählers, seine Darstellung an den Stellen zu korrigieren, an denen er merkte, dass er etwas ganz Wichtiges ausgelassen hatte, das unbedingt nachgetragen werden musste – man spricht von „Hintergrundskonstruktionen“, durch die die Erzähllinie zeitweilig unterbrochen wird (vgl. Schütze 1987, S. 207-235); und manchmal werden auch solche korrigierenden Einschübe selbst noch einmal unterbrochen, wenn ein Erzähler erneut auf Stellen mangelnder Plausibilität stößt – man spricht hier von “doppelt eingebetteten Hintergrundskonstruktionen”. Das sind jetzt keine erzählanalytischen oder soziolinguistischen Spitzfindigkeiten, die bloß für eine akademische Betrachtung von Texten interessant wären. Die eingehende und vergleichende Auseinandersetzung mit Stegreiferzählungen hat immer wieder deutlich werden lassen, dass solche Hintergrundskonstruktionen häufig auf ganz schwierige - turbulente, undurchschaute, traumatische oder mit Scham- bzw. Schuldverstrickungen verbundene - Erfahrungen verweisen, deren narrative Rekapitulation erst einmal schwierig ist; in der Erinnerung sträubt sich etwas dagegen, und dann kommen solche Erfahrungen aufgrund der Zugzwänge des Erzählens doch noch zur Sprache (Schütze 1987, S. 207-235; Riemann 2000, S. 57f., S. 230f., S. 272; Riemann 2002, S. 181-190). So etwas herauszuhören ist für Professionelle in ihrer praktischen Arbeit nicht unwichtig. Ihre Tätigkeit ist riskant, sie können Schaden anrichten, wenn sie nicht richtig hinhören und dann schnell mit stigmatisierenden Zuschreibungen bei der Hand sind. 3 Zum Stellenwert sozialwissenschaftlicher Fallanalysen in der Sozialarbeitsausbildung Ich bin zu Beginn meiner Ausführungen auf ein Beispiel aus der Praxis eingegangen, um zu illustrieren, dass ein wichtiger Teil der Arbeit von Sozialarbeitern aus Fallanalysen besteht. Damit wird keine schlichte Gleichsetzung von Fallanalysen in der professionellen Praxis und Fallanalysen in der Sinnwelt der Wissenschaft vorgenommen, die von praktischem Handlungs- und Entscheidungsdruck entlastet sind, aber es handelt sich auf jeden Fall um komplexe Prozesse der Erkenntnisbildung und der eigenen Verstrickung in das Geschehen, die sich nicht auf die bloße Anwendung von Orientierungswissen reduzieren lassen, wie dies bisweilen geschieht.8 Wenn der hier vorgestellte Sozialarbeiter seinem Klienten, den er aufgefordert hat, von sich zu erzählen, zuhört und fortlaufend und nachträglich seine Schlüsse zieht, dann ist das eine Fallanalyse – unabhängig davon, was dabei schief geht. Es entsteht die Frage, wie man Kompetenzen zu solchen praktischen Fallanalysen erwerben kann und dabei lernt, sich gewissermaßen selbstkritisch über die Schulter zu schauen, was die eigene Handlungsbeteiligung und die potentielle Folgenhaftigkeit der eigenen Analysearbeit betrifft. Wichtig ist jetzt der Gesichtspunkt, dass die explizite Einsozialisation in Verfahren der sozialwissenschaftliche Fallanalyse in der professionellen Ausbildung - und die sequentielle Analyse von Transkriptionen autobiographischer oder interaktionsgeschichtlicher Stegreiferzählungen gehört dazu, ist aber nur eine von mehreren Möglichkeiten - ein wichtiges Fundament für die eigene spätere praktischprofessionelle und auf Abkürzungspraktiken (Schütze 1994, S. 280–287) basierende Fallanalyse sein kann, die sich notwendigerweise unter einem großen Zeit- und Handlungsdruck vollzieht. Sowohl in der sozialarbeiterischen Praxis (als einer Form von professioneller Arbeit überhaupt) als auch in der interpretativen Sozialforschung geht es - allgemein gesprochen - um die rekonstruktive Analyse individueller und kollektiver Einzelfälle. Dabei spielt es eine besondere Rolle, einen verstehenden Zugang zu Erscheinungen zu gewinnen, die oft - gemessen an vorherrschenden Normalitätsvorstellungen - als fremdartig, unverständlich oder moralisch anstößig bewertet und stigmatisiert werden. Professionelle in der Sozialen Arbeit haben einen besonderen Zugang zu Leidenserfahrungen und Milieus, die der großen Mehrheit der Bevölkerung verschlossen bleiben, insofern gibt es viele Berührungspunkte zu dem, 8 Vor kurzem hörte ich den Vortrag eines Erziehungswissenschaftlers, der sozialwissenschaftliche und berufspraktische Fallanalysen dadurch von einander abgrenzte, dass die ersteren eben mehr seien als die Anwendung von Orientierungswissen. Ein ähnlich verkürztes Verständnis der hier relevanten Erkenntnisprozesse – eine Art subsumptionslogische Vereinseitigung – findet sich auch in der (in der Sozialen Arbeit) weitverbreiteten Formulierung, dass „eine Theorie auf Fälle anzuwenden“ sei – etwa im Rahmen von Instruktions- und Prüfungssituationen, in denen Studierende als angehende Professionelle ihre Fachlichkeit unter Beweis zu stellen haben. Was in solchen Situationen „Fälle“ sind, ist oft ungeklärt und höchst uneindeutig. Vor allem in den USA, in Großbritannien und in anderen englischsprachigen Ländern hat das von Donald Schön (1983, 1987) unter dem Einfluss von Dewey vorgeschlagene Konzept des „reflective practitioner“ dazu beigetragen, dass in ganz unterschiedlichen professionellen Ausbildungen – vor allem in der Sozialen Arbeit und im Pflegewesen - ein solches topdown-Modell der bloßen Applikation höherprädikativer Theoriebestände auf die Niederungen der Praxis zunehmend in Zweifel gezogen wurde und sich stattdessen das Augenmerk sowohl auf das „implizite Wissen“ (Polanyi 1985) und die intuitive Kunstfertigkeit als auch die Theoriebildung in der Praxis selbst richtete (vgl. seine Konzepte des „reflecting-in-action“ and „reflecting-on-action“). Vgl. auch Taylor und White (2000, S. 180-201) zu einer Gegenüberstellung von „evidence-based practice“ und „reflective practice“ und zur Kritik an manchen Verkürzungen im Schrifttum über „reflective practice“, in dem der Reflexionsprozess ihres Erachtens nicht weit genug getrieben wird. was ethnographisch orientierte Sozialwissenschaftler tun, u.a. solche, die - wie die Soziologen und Soziologiestudenten in Chicago in den zwanziger und dreißiger Jahren - die unterschiedlichen sozialen Welten ihrer eigenen Stadtgesellschaft zum Untersuchungsgegenstand gemacht haben. Es geht aber nicht nur um die Annäherung an das Fremde, sondern auch um einen verfremdenden Blick auf das vermeintlich Vertraute, um sich davor zu schützen, es zu schnell unter die vertrauten Kategorien zu subsumieren, es zu „nostrifizieren“ (Stagl 1981) und damit zu beherrschen. Wenn sich angehende oder schon im Beruf stehende Sozialarbeiter/innen mit unterschiedlichen Ansätzen und Verfahren vertraut machen, die sich im Gesamtspektrum der qualitativen oder interpretativen Sozialforschung entwickelt haben, und ggf. zur Durchführung eigener Studien angeregt und dabei begleitet werden, dann erwerben sie Kompetenzen, die für ihre praktische Arbeit mit Klienten hilfreich sind - und die auch hilfreich sind für die Entwicklung einer selbstbewussten Haltung gegenüber Angehörigen “stolzer” Professionen (Hughes (1984b)). Ich denke dabei an Ansätze wie die sozialwissenschaftliche Biographieanalyse, die sich vor allem auf der Basis autobiographisch-narrativer Interviews entwickelt hat, an die Interaktionsanalyse, an Analysen langfristiger Arbeitsabläufe und Professionellen-Klientenbeziehungen, an die Erkundung sozialer Welten (Strauss 1978) und Milieus und an die selbstreflexive ethnographische Untersuchung der eigenen Praxis. Auf diese letztere Variante – und auf das entsprechende Lehr- und Lernarrangement, das ich eingangs angedeutet hatte – konzentriere ich mich im Folgenden. 4 Erfahrungen mit einem Lehr- und Lernarrangement zur „Befremdung“ der eigenen Praxis Eine Vorbemerkung: Um studentische Forschung, um die es hier geht, anzuregen und zu ermöglichen, ist es zum einen wichtig, dass die Studierenden die Möglichkeit haben, intensive und ausgedehnte Erfahrungen in professionellen Handlungsfeldern zu sammeln und diese Erfahrungen in die Hochschule (ob Fachhochschule oder Universität) - in welcher Form auch immer - „hereinzuholen“. Ich denke hier in erster Linie an integrierte Berufspraktika und studienbegleitende Praktika, aber auch an Praxiserfahrungen, die Studenten schon vor Aufnahme ihres Studiums gemacht haben (z. B. während eines Sozialen Jahrs, eines Zivildiensts oder einer Tätigkeit als Krankenschwester oder Erzieher/in) und in der Hochschule zum Reflexionsgegenstand machen könnten. Ich habe es in unterschiedlichen sozialarbeiterischen Ausbildungseinrichtungen erlebt, dass das Lehrpersonal dazu tendiert, solche Erfahrungen als Ressourcen für die Ausbildung und die Forschung entweder nicht zur Kenntnis zu nehmen oder abzuwerten, und dass Studierende häufig zu der Auffassung gelangen, dass sie Fragestellungen, die sich aus solchen Vorerfahrungen ergeben, in einer Weise reformulieren sollten, dass sie ihren Entstehungskontext nicht mehr erkennen lassen. Um ein konkretes Beispiel zu erwähnen: Eine Studentin, die vor Aufnahme ihres Studiums über einen längeren Zeitraum in einem U.S.-amerikanischen Indianerreservat gelebt hatte und dort mit Erscheinungen biographischer und kollektiver Demoralisierung (aufgrund der Zerstörung der indigenen Kultur) konfrontiert worden war, die sie sehr beschäftigen, ohne dass sie sie in der Hochschule irgendwo zur Sprache bringen konnte, transformierte diese Erfahrungen in die Frage nach „Ursachen des Alkoholismus“, d. h. sie entwertete den Gesamtzusammenhang ihrer eigenen Erfahrungen und isolierte ein bestimmtes Phänomen in Termini, die diesen lebensweltlichen Kontext verleugneten, um eine „wissenschaftlichen Ansprüchen genügende“ Hausarbeit schreiben zu können (Riemann 1999). Zum anderen ist es wichtig, dass der Gesamtrahmen der Ausbildung so organisiert ist, dass tatsächlich ein Raum für studentische Forschung existiert und als wertvoll angesehen wird. Studierende geraten in einer Reihe von Ausbildungsstätten durch disparate und kumulierte Prüfungsanforderungen in einen Zustand der Kurzatmigkeit und können überhaupt nicht, falls dies überhaupt vorgesehen ist, in Ruhe eigene studentische Forschungsfragestellungen entwickeln. Diese Tendenz wird durch technokratische Standardisierungstendenzen in der Hochschulausbildung und die selbstverständliche Akzeptanz vermeintlicher Qualitätskriterien, wie sie etwa durch bundesweite „Rankings“ nahegelegt wird, weiter vorangetrieben. Es versteht sich heute fast von selbst, dass eine kurze Ausbildung per se eine gute Ausbildung ist – ohne Rücksicht auf die individuellen Bildungsprozesse und die gesellschaftlichen Kosten, die entstehen, wenn unzureichend ausgebildete Absolventen auf die Menschheit losgelassen werden. Ich hatte mich in der Vergangenheit sowohl mit dem Lehr- und Lernarrangement der Forschungswerkstatt beschäftigt und gemeinsam mit anderen dazu etwas veröffentlicht (Riemann/Schütze 1987, Reim/Riemann 1997) als auch mit der Betreuung von qualitativ-empirischen Studienarbeiten in der Anfangsphase des Studiums (Riemann 1999). Beide Ausbildungssettings existieren weiterhin in meiner Ausbildung von Studierenden der Sozialen Arbeit. Ich möchte mich im Folgenden aber ausschließlich auf ein drittes soziales Arrangement konzentrieren, nämlich die Begleitung von Studierenden bei der selbstreflexiven-ethnographischen Auseinandersetzung mit ihren eigenen Berufspraktika und studienbegleitenden Praktika und Hospitationen, für die ich den Begriff der „Befremdung der eigenen Praxis“ verwende. Wenn man Studierenden nahe legt, Feldprotokolle über ihre eigenen – aktuellen oder vor ihnen liegenden - praktischen Arbeitserfahrungen anzulegen9, die i. d. R. später zumindest auszugsweise im Rahmen von Praxisanalyseseminaren vorgestellt und diskutiert werden, dann fühlen sie sich häufig angesichts der vermeintlichen Diffusität der Aufforderung, „einfach mal aufzuschreiben, was man erlebt hat“ 10, überfordert: „Soll ich jetzt einen Roman schreiben, oder was?“ Es lassen sich eine Reihe von Vorbehalten entdecken, die sich aus unterschiedlichen Bedingungen und Vorerfahrungen herleiten lassen. 9 Ich empfehle Studierenden außerdem häufig, anderen über zurückliegende Praxiserfahrungen im Stegreif zu erzählen und solche Erzählungen auf Band aufzuzeichnen, z. B. dann, wenn sie über diese Erfahrungen (noch) keine Feldnotizen angefertigt haben. In meiner Arbeit mit Berufspraktikanten im Rahmen sogenannter „Arbeitsfeldgruppen“ (einer Begleitveranstaltung zu den beiden berufspraktischen Studiensemestern) handhabe ich dies anfänglich immer so, dass die Teilnehmer ausführlich über ihre ersten Wochen im Praktikum erzählen. Auf diese Weise entsteht eine Datengrundlage, auf die die Studierenden bei der Erstellung ihrer (sequentiellen) Berichte zurückgreifen können, wenn sie sich retrospektiv, indem sie selbst ihrer Erzählung zuhören, etwas von den biographischen und sonstigen sozialen Prozesse während ihres Praktikums in Erinnerung rufen möchten. Transkriptionen solcher narrativen Darstellungen lassen sich natürlich auch mit Mitteln der sozialwissenschaftlichen Erzählanalyse (Riemann 2003) analysieren, wenn Studierende ihre eigene Praxis genauer rekonstruieren und die entsprechenden Kernprobleme aufdecken möchten. Dafür ist das soziale Arrangement einer Forschungswerkstatt hilfreich, weil man den fremden Blick der Kommilitonen braucht. 10 Natürlich beschränkt sich die Einstimmung der Studierenden nicht auf eine so schlichte und lakonische Formulierung (vgl. die etwas später aufgelisteten Empfehlungen), aber ich tendiere immer wieder dazu, auch solche Äußerungen zu verwenden. 1. Es gibt bisweilen die anfängliche Abwehrhaltung gegenüber einem Dozenten, der einem zumutet, in die längst überwunden geglaubte Phase schulischer „Erlebnisaufsätze“ zurückzufallen. Außerdem hat man oft in der Schule gelernt, den eigenen Schreibfähigkeiten gründlich zu misstrauen. 2. Es herrscht oft die Vorstellung, dass so etwas mit ernsthafter „Wissenschaftlichkeit“ überhaupt nichts zu tun hat: „Das ist doch bloß subjektiv.“ Wenn man in anderen Seminaren lernt, dass die erste Person Singular des Personalpronomens in wissenschaftlichen Texten nichts verloren hat, dann ist die Aufforderung, solche persönlichen Texte zu schreiben, erst einmal irritierend und provoziert Reaktionen der Abwehr und der Abwertung. – Ernsthafte Wissenschaftlichkeit und Fachlichkeit verbindet man auch oft mit dem top-downModell der „Anwendung von Theorie auf Praxis“11. Wenn Studierende lernen, sich an bestimmten weitverbreiteten Orientierungs- und Erklärungstheorien für das, was in der Interaktion mit Klienten geschieht oder geschehen sollte, auszurichten und sich zu ihnen zu bekennen12, dann stößt die Aufforderung, bei der Beobachtung und Beschreibung von Prozessen und Situationen in beruflichen Handlungsfeldern „received ideas“ einzuklammern und die Applikation eines entsprechenden Kategorien- oder Fragesets erst einmal zu vermeiden, oft auf Unverständnis. 3. Manche Schwierigkeiten mit einer ethnographischen Beobachtungshaltung und Schriftlichkeit haben auch mit beruflichen Prägungen zu tun wie der Einsozialisation in die Sprache der Aktenführung. Ein Student schilderte mir plastisch eine Art Initiationsritus während seines Praktikums in einem Gesundheitsamt: Sein Anleiter zerriss mehrmals und demonstrativ seine Berichtsentwürfe für eine Akte, bis er schließlich den Eindruck hatte, dass es sein Praktikant begriffen hatte, worauf es bei dieser Form des Schreibens ankommt. Das Umlernen in Richtung eines anderen Beschreibungsstil – z. B. weg von der Subsumption von Ereignissen unter vorgegebene Kategorien - fiel diesem Studenten anfangs sichtlich schwer. 4. Vorbehalte rühren z. T. aus der Beziehung zu den Praktikern in dem zu beobachtenden Handlungsfeld – Professionellen, mit denen man sich identifiziert, mit denen man vielleicht befreundet ist und gegenüber denen man sich solidarisch verhalten möchte, d. h. man erlebt es als Zumutung, sie in Feldprotokollen, die für eine fremde Leserschaft bestimmt sind, „vorzuführen“, auch wenn alle Angaben, die erkennen lassen, mit wem man es zu tun hat, so verändert sind, dass eine Identifizierung der beteiligten Personen und Einrichtungen nicht möglich ist. 5. Natürlich spielt auch die Beziehung zu Mitstudenten eine wichtige Rolle, denen man – im Setting von Praxisanalyseseminaren - persönliche Einblicke in das geben soll, was man „draußen“ erlebt hat und wie es einem dabei ergangen ist, und die man vielleicht noch gar nicht ausreichend kennt, um ihnen wirklich 11 Vgl. Fußnote 6. Eine solche Orientierung an bestimmten Schulen oder Ansätzen kann eher einen pragmatischstrategischen Charakter annehmen – „das ist eine Theorie, die ich wenigstens verstehe und von der ich glaube, sie in einer Prüfungssituation am leichtesten anwenden zu können“ – oder von einer tieferen Loyalität geprägt sein: wenn man sich etwa die Terminologie und die Fragestellungen der systemischen Sozialarbeit angeeignet hat und sich am Ende des Grundstudiums als (angehender) „Systemiker“ sieht. 12 vertrauen zu können. Deshalb dürfen solche Praxisanalyseseminare auch nicht zu groß sein. 6. Anders als ein soziologischer Ethnograph, der sich gewöhnlich einem ihm bis dahin unbekannten Ausschnitt der sozialen Wirklichkeit nähert und sich mit ihm nach und nach vertraut macht, ohne die Absicht zu haben, in dieser „Szene“, diesem Milieu, dieser „sozialen Welt“ (Strauss 1978) usw. zu bleiben – auch wenn das hin und wieder passiert13 - , stimmen sich angehende Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter gerade darauf ein, in Praktikumssituationen wertvolle Kompetenzen in einem Beruf zu erlangen, für den sie sich i. d. R. entschieden haben. Ihre existenzielle Situation ist eine andere. Dass man der Weltsicht und dem Kategoriensystem, in die man jetzt in der Praxis eingeführt wird, mit einer relativierenden Haltung begegnen und Geltungsansprüche einklammern soll, kann immer wieder als schmerzhaft und als Überforderung erlebt werden. M.a.W., der Dozent, der von mir erwartet, das, was ich mir jetzt an Sicherheiten angeeignet habe, wieder in „Anführungszeichen“ zu setzen oder dort den Konjunktiv zu verwenden, wo es „normal“ und „natürlich“ und auch „moralisch geboten“ ist, den Indikativ zu verwenden (weil Anführungszeichen und Konjunktiv als Ausdruck von Ironie oder Zweifeln an der Geltung einer Kategorie verstanden werden könnten), ist nicht nur so etwas wie ein nervender Deutschlehrer, der die schlimmsten Erinnerungen in mir weckt, sondern - schlimmer noch - ein akademischer Spinner, der nicht ausreichend mit der Sache der Sozialen Arbeit identifiziert ist.14 Für manche Studierende ist erst einmal die Vorstellung fremd, dass es zwischen dem Satz „Die Sozialarbeiter in dieser Einrichtung arbeiten systemisch.“ und dem Satz „In der Konzeption der Einrichtung heißt es, dass sie ´systemisch` arbeite.“ einen nicht-trivialen Unterschied gibt. Es ist etwas anderes, ob man schreibt: „Wie wir vom Heimleiter erfuhren, leben in seinem Haus zwölf Schizophrene.“ oder ob es heißt: „Der Heimleiter sagte mir, in seinem Haus lebten zwölf `Schizophrene´.“, wobei der Begriff „schizophren“ in Anführungszeichen gesetzt wird, ohne damit in eine ironische oder strittige Haltung zum jeweiligen Sprecher zu geraten. Es geht einfach nur um die Kennzeichnung der Sprache des Feldes und um die Entwicklung eines Gespürs dafür, dass die so Bezeichneten sich selbst möglicherweise anders verstehen als „schizophren“ oder andere Dinge als das so gekennzeichnete psychische Leiden für ihr eigenes Selbstverständnis wichtig sind und sie sich nicht auf diese Kategorie reduzieren lassen möchten. Nach meinen Erfahrungen führt in so einem Kontext die Empfehlung, Anführungszeichen zu verwenden, unter Studierenden manchmal zu dem anfänglichen Missverständnis, man wolle sie auf eine antipsychiatrische Haltung festlegen. Wie können sich Studierende darauf einstimmen, worum es bei der Anlegung von Feldnotizen geht? Das Thema des Schreibens von „fieldnotes“ ist in den letzten Jahren in einer Reihe von Arbeiten in der Kulturanthropologie und der Soziologie behandelt worden, z. T. auch in einer Weise, die für angehende Feldforscher sehr hilfreich ist (vgl. Emerson et al. 1995, 2001).15 Eine gute Vorbereitung besteht sicher Eine witzige literarische Verarbeitung dieses Seitenwechsels ist Alison Luries Roman „Imaginary Friends“ (1967): Der Soziologieprofessor Tom McCann wandelt sich vom Feldforscher zum Aktivisten einer kleinen Sekte, die zuvor sein Forschungsgegenstand gewesen war. 14 Wenn ich mein eigener Student gewesen wäre, hätte ich mir den Indikativ an dieser Stelle nicht durchgehen lassen. 15 Vgl. auch Sanjek, Hrsg., 1990. Die stärker auf die Vermittlung von Handwerkszeug ausgerichteten Darstellungen von Emerson et al. (1995, 2001), die etwas schriftlich fixieren möchten, was in der 13 darin, veröffentlichte ethnographische Studien zu lesen und sich zugleich auszugsweise damit vertraut zu machen, was Kommilitoninnen und Kommilitonen vor einem zu Papier gebracht haben, wenn sie ihre Praktikumserfahrungen mit einem fremden Blick betrachteten. Dabei sollten solche Berichte keinesfalls als Regieanweisungen oder Kochbuchrezepte („So wird´s gemacht.“) missverstanden werden, weil dadurch die Kreativität des freien Schreibens behindert würde. Ein kurzes Feldprotokoll, das aus einem studentischen Praktikumsbericht stammt, findet sich im Folgenden – ein Beispiel dafür, dass eine gute Ausgangsbedingung für die Entwicklung einer ethnographischen Haltung darin besteht, dass einem das zu beobachtende Handlungsfeld noch nicht vertraut ist: Man stößt auf Neues – auch in sich selbst. In dem Bericht rekonstruiert die Studentin, Ingrid Hornung, ihre Erfahrungen während eines studienbegleitenden Blockpraktikums in einer psychiatrischen Bezirksklinik. 16 Im Anfangsteil diskutiert sie eine Situation am ersten Tag ihres Praktikums, als sie sich um 8 Uhr morgens beim Sozialdienst der Klinik einfinden soll, aber vor verschlossenen Türen steht. Sie berichtet, dass sie sich auf den Rasen vor der Tür gesetzt und gewartet habe. Während sie noch darüber nachgegrübelt habe, ob sie sich evtl. in der Zeit geirrt habe, sei ein junger Mann erschienen („Er war in einen Jogging-Anzug gekleidet, trug Birkenstock-Sandalen und rauchte.“). Dann präsentiert sie folgenden Ausschnitt aus ihren Feldnotizen, in dem es um ihre erste Begegnung mit Patienten dieser Klinik geht: „Das ist jetzt wohl der erste Klient, dem ich hier begegne. Er sieht unsicher aus. Er hat die Zigarette weggeworfen und fummelt die ganze Zeit nervös an einem Zettel, der in einer Klarsichthülle steckt. Ich begrüße ihn mit einem „Guten Morgen!“ Wir grinsen einander an. Er sagt nichts. Während ich gerade überlege, ob und wie ich ein Gespräch mit ihm beginnen kann, meint er: `Hi, bist Du auch wegen der Abrechnung hier?´ Ich schau bestimmt etwas merkwürdig drein. Mir ist überhaupt nicht klar, um welche ´Abrechnung` es sich hier handeln könnte. Er sieht mir meine Verwirrung wohl an, schaut weg. Ich spreche ihn an: `Nein, ich bin nicht wegen der Abrechnung hier. Ich mache hier im Sozialdienst die nächsten Wochen ein Praktikum und soll heute anfangen. Ich warte schon ein Weile auf Frau K.´ Ich komme mir etwas seltsam vor, wie wir so versuchen, Kontakt aufzunehmen, er an der Tür lehnend, ich auf dem Rasen sitzend. Es gefällt mir nicht, zu ihm `aufzublicken´, während ich mich mit ihm unterhalte. `Ah so, hm´ ist seine Reaktion. Außerdem kommt mir langsam zu Bewusstsein, dass er mich tatsächlich für eine KLIENTIN hält. Mein Bauch sagt mir: Geschichte der interpretativen Sozialforschung (z. B. in der Tradition des Chicagoer Interaktionismus) gewöhnlich mündlich vermittelt wurde, unterscheiden sich deutlich von den zahlreichen Abhandlungen einer postmodernen ethnographischen Selbstreflexion, in denen es um die Krise, die Stilvielfalt und die Rhetorik ethnographischer Repräsentation geht. Die Wende hin zur primären Fokussierung auf das eigene Schreiben wurde durch das einflussreiche Buch von Clifford und Marcus (Hrsg., 1986) eingeleitet. 16 Seit längerem organisiere ich gemeinsam mit meinem Kollegen Jörg Wolstein, einem Mediziner, am Fachbereich Soziale Arbeit der Universität Bamberg einen Studienschwerpunkt „Soziale Arbeit mit psychisch kranken und suchtkranken Menschen“. (Wenn die Studierenden im sechsten Semester in diesen Studienschwerpunkt kommen, haben sie gerade ein zweisemestriges Berufspraktikum absolviert.) Ein wichtiger Bestandteil des Studienschwerpunkts besteht in einem (erneuten und diesmal) studienbegleitenden Praktikum, über das die Studierenden fortlaufend ethnographische Feldnotizen anlegen, die längerfristig für die Erstellung eines Berichts genutzt werden. Meine folgenden Ausführungen basieren vor allem auf meinen Erfahrungen mit der Begleitung solcher Praktika, die entweder über einen Zeitraum von zwei Semestern stattfinden (in Form von regelmäßigen Besuchen in einer Einrichtung einmal pro Woche) oder in den Semesterferien als Blockpraktika absolviert werden. Ungeheuerlich! Mein Kopf sagt mir: Na ist doch klar, warum auch nicht?! Ich stehe auf und blicke auf die Uhr. Schon 20 nach acht. Ich schaue wieder zu dem jungen Mann und sehe aus den Augenwinkeln eine Frau Mitte Vierzig des Weges kommen. Ob das meine Anleiterin ist? Nein, ich glaube nicht. Sie hält auch so einen Zettel in Händen. Ob der wohl was mit dieser Abrechnung zu tun hat? Die Frau kommt näher, grüßt und meint: `Ha, ich werde heute entlassen!´ Sie wendet sich mir zu: `Müssen Sie noch lange hier bleiben? Ich kann mich gar nicht an Sie erinnern?` `Jetzt hält die mich auch noch für eine von hier´, schießt es mir durch den Kopf. So was ist mir ja noch nie passiert. Warum eigentlich nicht? ....“17 Es ist schwierig, Studierenden eine Liste von „zu beachtenden“ Merkmalen an die Hand zu geben, die nicht dazu führt, dass Befangenheit entsteht („Mache ich es richtig?“). Auch fühlen sie sich anfangs häufig, bevor sich schließlich im Prozess der Feldforschung sukzessive bestimmte Beobachtungsintereressen und –foki entwickeln, angesichts der vor ihnen liegenden Aufgabe schlicht überfordert. Die studentischen Ethnographen erwerben eine Sicherheit letztlich erst dann, wenn sie sich auf den Prozess des Beobachtens und Schreibens einlassen – ein Fall von „learning by doing“ - , ihre Schreibversuche anderen (einschließlich dem Dozenten) zugänglich machen und persönliche Rückmeldungen zu dem bekommen, was in den Augen der Leser an ihren Texten besonders interessant oder noch unklar ist. Aber trotzdem erscheint es mir sinnvoll, ihnen vorab einige Elemente des Schreibens zu nennen, die sich bei der Anfertigung ethnographischer Feldnotizen bewährt haben 18: Man sollte für eine fremde Leserschaft schreiben, die mit dem hier relevanten Praxisfeld und der Geschichte „meines“ Praktikums nicht vertraut ist, die etwas darüber – und auch über „mich“ als damalige Akteurin und nachträglich Reflektierende - erfahren möchte und der man zugleich unterstellt, „mich“ nicht entlarven zu wollen. Es ist sinnvoll, sich immer wieder zu fragen: Mache ich mich gegenüber außenstehenden Lesern ausreichend verständlich? Werden z. B. die sozialen Rahmen und Territorien erkennbar und gewinnen die erwähnten Personen eine hinreichend klare Kontur? Es geht darum, systematisch eine Haltung des Sich-Wunderns einzuüben, d. h. möglichst wenig als selbstverständlich zu betrachten und Aufmerksamkeitsspannen einzunehmen, die im Alltag ungewöhnlich sind: um z. B. Prozesse im Detail zu betrachten, auf man sich im Jargon der entsprechenden Einrichtung mit großer Selbstverständlichkeit – etwa mithilfe eines programmatischen Kürzels („lebensweltorientiert“, „lösungsorientiert“, „humanistische Psychologie“ usw.) – bezieht. 17 Ich habe diesen Ausschnitt nur als Beispiel für eine lebendig geschriebene Feldnotiz ausgewählt, in der die inneren Zustände einer Protokollantin in der damaligen Situation erkennbar werden. Ingrid Hornung, die Autorin, setzt sich in ihrem Bericht ausführlich mit ihren eigenen damaligen Reaktionen in dieser Situation auseinander - einem unfreiwilligen und irritierenden Krisenexperiment, durch das sie am eigenen Leib etwas von der Übermächtigkeit und der Stigmaqualität der Kategorie „psychisch krank“ und der Quasi-Natürlichkeit der Gegensatzanordnung von „psychisch krank“ und „normal“ erfährt. Sie berichtet auch davon, dass sie kurze Zeit später - nach dem ersten Vertrautwerden mit den lokalen Gegebenheiten - entdeckt habe, wie die falsche Zuordnung zustande gekommen sei: aufgrund der strikten Kleiderordnung der Klinik für unterschiedliche Personenkategorien, die ihr zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt gewesen sei, hätten ihre Interaktionspartner sie wegen ihrer Kleidung in dieser Situation für eine Mit-Patientin gehalten. 18 Es geht im Folgenden noch nicht um Merkmale (abschließender) ethnographischer Untersuchungsberichte, wie sie von Schütze (1994, S. 235ff.) diskutiert werden, sondern erst um die schriftliche Fixierung von Feldbeobachtungen. Das „Ich“ sollte zu unterschiedlichen Zeitpunkten erkennbar werden: als Akteur/in in der damaligen Situation, später und bei der Verschriftlichung und Reflexion der eigenen Erlebnisse; diese Zeitpunkte müssen sich klar unterscheiden lassen. M. a. W., die eigenen inneren Zustände sollten zum Ausdruck kommen, auch das Unbehagen über das, was man getan und erlebt hat und was nicht nachträglich „aufpoliert“ werden sollte. Aber natürlich sollte dies nicht als Aufforderung zur ausschließlichen Selbstbespiegelung und „Selbstabsorption“ missverstanden werden, wie dies etwa in einem privaten Tagebuch der Fall sein kann, da es schließlich darum geht, etwas über ein professionelles Handlungsfeld zu erfahren (zu dem der Protokollant als Akteur gehört). Es ist wichtig, eine sequenzierende Haltung einzunehmen, um die Ordnung, aber auch die Unordnung von sozialen Prozessen herauszuarbeiten und nicht in zufälligen Impressionen stecken zu bleiben, die dann spekulativ und dekontextualisiert ausgedeutet werden. Das Interesse kann sich z. B. auf die sequentielle Struktur eines alltäglichen Gesprächs richten (unter Beachtung der „adjacency pairs“ wie Frage-Antwort-Sequenzen); auf den Ablauf eines professionellen Handlungsschemas (wie etwa eine Beratung, die gelingen oder misslingen kann); auf die Entstehung und Dynamik von Erzählungen oder Argumentationen in bestimmten Handlungsabläufen; auf langfristige kollektive Prozesse, eine Beziehungsgeschichte, ein Projekt usw.. Dabei kann es um alltägliche, wiederkehrende Rhythmen, aber auch historisch einmalige soziale Prozesse gehen. Man sollte darauf achten, die relevanten Aktivitäten in ihrer Abfolge und ihrer Interaktion in den Blick zu bekommen und sie nicht durch anonymisierende Passiv-Formulierungen („Die Klienten wurden davon in Kenntnis gesetzt, ...“) zu verschleiern. Es ist notwendig, in seinen Feldbeobachtungen die Perspektiven unterschiedlicher Akteure (etwa unterschiedliche Kategorien von Professionellen, Klienten, Angehörige usw.) zu berücksichtigen und sie zu differenzieren, ohne bestimmte mächtige und etablierte Sichtweisen als selbstverständlich, maßgeblich, „normal“ usw. zu übernehmen und zu privilegieren – eine Problematik, auf die sich Howard Becker (1967) mit seinem Konzept der „Hierarchie der Glaubwürdigkeit“ bezieht. Die Sprache des Feldes sollte als solche kenntlich gemacht und damit von der eigenen Beobachtungssprache unterschieden werden. Zu der Sprache des Feldes gehören die vorherrschenden Selbstverständlichkeiten, wie sie sich beispielsweise im Diagnosevorrat, in informellen Typisierungen und offiziellen und prestigereichen Konzepten niederschlagen. Indem man die „native categories“ als solche kennzeichnet – schon durch die Verwendung von Anführungszeichen - , wahrt man analytische Distanz und klammert Geltungsansprüche ein. Die sozialen Prozesse, Situationen, inneren Zustände und Reflexionen sollten in einer sequentiellen Darstellung so präsentiert werden, dass eine Analyse des Textes durch einen fremden Leser möglich wird. Es ist wichtig, die perspektivischen Grenzen, aber auch Möglichkeiten solcher Materialien – im Unterschied zu anderen Texten wie Transkriptionen aktualtextlicher Aufzeichnungen oder narrativer Interviews – im Auge zu behalten.19 Natürlich entstehen auch schon dann, wenn man sich seinen Erinnerungen überlässt und – möglichst noch unter dem unmittelbaren Eindruck des Geschehens - seine Feldbeobachtungen zu Papier bringt, neue Erkenntnisse, wie an der oben zitierten Notiz der Studentin ersichtlich ist (vgl. etwa ihre Frage am Ende des Ausschnitts: „Warum eigentlich nicht?“), aber es ist darüber hinaus notwendig, einen sozialen Rahmen zu schaffen, der aufgrund der aufmerksamen Rückmeldungen der anderen Interaktionsteilnehmer noch mehr analytische Distanz ermöglicht und einen Schutzraum darstellt für Prozesse der Selbstvergewisserung und der Aufdeckung von Vagheits- und „Blindstellen“. Dies wird in Praxisanalyseseminaren angestrebt, in denen die Studierenden reihum ihre Beobachtungsprotokolle zur Verfügung stellen und sich bei der Erstellung ethnographischer Abschlussberichte begleiten; ein Termin wird jeweils für die Besprechung eines einzigen Feldprotokolls reserviert, derjenige, der an der Reihe ist, erhält außerdem schriftliche Rückmeldungen zu seinem Protokoll von Seiten des Dozenten. „Schutzraum“ bedeutet nicht, auf Kritik zu verzichten, aber dies sollte in einer respektvollen, angstfreien und egalitären Form geschehen, in der jeder Anflug einer Entlarvungshaltung vermieden wird. Nach meiner bisherigen Erfahrung gelingt dies auch, vor allem dann, wenn die Teilnehmerzahl überschaubar bleibt.20 In der Evaluation dieser Veranstaltungsform wurde von den Studierenden immer wieder erwähnt, dass es für die Entwicklung einer vertrauensvollen Atmosphäre unter den Studierenden in diesem Studienschwerpunkt wesentlich gewesen sei, dass sie sich dabei abgewechselt hätten, den jeweils anderen mithilfe ihrer Feldprotokolle Einblick in ihre Praxiserfahrungen zu geben und von ihnen dazu Rückmeldungen zu bekommen. Die Normalform der Arbeit in solchen Praxisanalyseseminaren sieht folgendermaßen aus: 19 Wenn für eine Seminarteilnehmerin ein Termin festgelegt ist, übernimmt sie es, rechtzeitig den anderen ein von ihr ausgewähltes Beobachtungsprotokoll zur Verfügung zu stellen (mit einführenden Hintergrundinformationen zum studienbegleitenden Praktikum, so dass der nachfolgende Text hinreichend verstanden werden kann). Ein solches Beobachtungsprotokoll bezieht sich auf ein Diese Unterscheidung von perspektivischen Grenzen und Möglichkeiten unterschiedlicher qualitativer Daternmaterialien ist wesentlich. Es greift m. E. zu kurz, ethnographische Beschreibungen dem 19. Jahrhundert zuzurechnen und als grundsätzlich defizitär gegenüber Datenmaterialien auf der Grundlage von Tonband-, Video- oder Filmaufzeichnungen zu kennzeichnen, da sie das methodische Defizit „der zirkulären Verschlingung von Datenerhebung und – auswertung“ (Oevermann 2001, S. 85) aufwiesen. Entscheidend ist vielmehr, dass sich in der Analyse einzelner mündlicher oder schriftlicher Texte die unterschiedlichen Kommunikationsschemata der Sachverhaltsdarstellung (Kallmeyer und Schütze 1977) – Erzählung, Beschreibung und Argumentation – auseinanderhalten lassen und kein „Schemasalat“ (Schütze 1987, S. 256) entsteht, durch den die Analyse erschwert wird. Es wird im Folgenden noch deutlich, dass in dem von mir skizzierten Lehr- und Lernarrangement ethnographische Gedächtnisprotokolle keinesfalls „at face value“ genommen und als QuasiTranskripte behandelt werden, sondern kritisch hinterfragt werden sollen: sowohl auf Stellen mangelnder Plausibilität in der Darstellung von Ereignisabläufen als auch auf die Beobachtungsfoki und -kategorien, Deutungen und Wertungen des Protokollanten selbst. Gerade weil solche Texte soviel über den Protokollanten als angehenden Professionellen preisgeben, sind sie eine wichtige Grundlage, um einen Zugang zu beruflichen Sozialisationsprozessen zu gewinnen und sie selbstkritisch zu reflektieren. 20 Eine Faustregel für die maximale Teilnehmerzahl ist, dass für jeden Seminarteilnehmer mindestens ein Termin im Semester für die Besprechung seines Protokolls reserviert werden kann. Ggf. müssen zwei Praxisanalyseseminare parallel angeboten werden, um allen Teilnehmern die Möglichkeit zur Präsentation und Diskussion ihrer Materialien zu geben. Geschehen, das klar markiert ist und in einer bestimmten Weise bezeichnet werden kann: beispielsweise als „erster Tag im Praxisfeld“, als „professionelles Handlungsschema“ (wie etwa eine Beratung, ein psychiatrisches Aufnahmegespräch, eine Visite, ein Teamgespräch usw.), als die „Geschichte der Beziehung zu einem Klienten“, als „wiederkehrende alltägliche Abläufe“ (wie beispielsweise die Tischgespräche in einer Wärmestube für Menschen, die obdachlos oder von Obdachlosigkeit bedroht sind usw.). Von den anderen Seminarteilnehmern wird erwartet, dass sie sich intensiv mit diesem Text beschäftigen: ihn auf seine sequentielle Struktur hin durchmustern und Fragen und Beobachtungen festhalten, die sie später in die Seminarkommunikation einbringen können. Je differenzierter und detaillierter das Beobachtungsprotokoll ist, umso ergiebiger wird in der Regel die anschließende interaktive Erkenntnisbildung im Praxisanalyseseminar. Sehr lakonische Protokolle eignen sich lediglich dazu, Fragen über Fragen zu stellen oder Empfehlungen für weitere Feldbeobachtungen zu geben. Zu Beginn der Zusammentreffens mit den anderen Seminarteilnehmern berichtet die Kommilitonin, die ihren Text verschickt hat, noch einmal kurz über die Rahmenbedingungen und den bisherigen Verlauf ihres Praktikums und beantwortet Fragen, die dazu entstehen. Anschließend gibt es eine erste Einschätzungsrunde, in der die Teilnehmer reihum unter Rückgriff auf ihre Notizen den Text in seiner Gesamtheit kommentieren und Fragen stellen. Dabei geht es sowohl um Auffälligkeiten des Materials – stilistische Merkmale, besonders lebendige Passagen, Vagheiten, Widersprüche, Diskrepanzen, Stellen mangelnder Plausibilität - als auch um Prozesse, Problemstellungen und soziale Rahmen, die in ihm repräsentiert sind. Die „Texteinbringerin“ soll ihr Protokoll jetzt selbst nicht kommentieren, kann aber, wenn sie möchte, zu dem, was von den anderen vorgetragen wird, Stellung beziehen. Falls sich die anderen Teilnehmer zuvor nicht die Mühe gemacht haben, das Datenmaterial durchzuarbeiten und Stichworte festzuhalten, entsteht in dieser Phase – und natürlich auch im Folgenden – die Gefahr, dass der Dozent zu stark seine eigenen Interpretationen ins Spiel bringt und durch sein Amokreden dazu beiträgt, dass sich unter den Studierenden eine passiv-rezeptive Haltung verfestigt. Gleichzeitig ist es natürlich immer wieder notwendig, dass auch der Dozent vorführt, wie er etwas analysiert und was er für Einsichten meint gewonnen zu haben. Es ist aber i. d. R. besser, wenn dies im Anschluss und in Anknüpfung an studentische Beiträge geschieht. Es folgt eine Phase eher mikroskopischer Analysen, in denen man sich gemeinsam auf bestimmte Textpassagen konzentriert, um im Stil des offenen Kodierens (Strauss 1987) zu lernen, sich zu wundern, generierende Fragen zu stellen und interessante Phänomene versuchsweise beim Namen zu nennen, d. h. analytische Konzepte zu bilden.21 Dabei geht es vor allem darum, (a) die Strauss (1987, S. 28) schreibt über das „offene Kodieren“: „This open coding is done (......) by scrutinizing the fieldnote, interview, or other document very closely: line by line, or even word by word. The aim is to produce concepts that seem to fit the data. These concepts and their dimensions are as yet entirely provisional; but thinking about these results in a host of questions and equally provisional answers, which immediately leads to further issues pertaining to conditions, strategies, interactions, and consequences. As the analyst moves to the next words, next lines, the process snowballs, with the quick surfacing of information bearing on the questions and hypotheses, and sometimes even possible crosscutting of dimensions. A single session with a single document can often astonish even the experienced researcher, especially when the document at first glance 21 Abfolgestruktur der jeweils interessierenden soziale Prozesse und die Perspektiven unterschiedlicher Interaktionsteilnehmer aufzudecken und Problemstellungen des professionellen Handelns und Formen ihrer Bearbeitung zu erfassen; (b) Eindrücke zu den Erfahrungen und Interpretationen des studentischen Feldforschers festzuhalten – Eindrücke, die sich sowohl auf seine damalige Handlungsbeteiligung als auch seine nachträglichen Interpretationen beim Vorgang des Protokollierens beziehen; und (c) Ansätze zu einer nichtnormativen Praxiskritik (Riemann 2002) zu formulieren, beispielsweise wenn es um die – in Feldbeobachtungen aufgedeckte - fehlende Reziprozität in der Beziehung von Professionellen und Klienten (etwa in Form von Degradationen oder Ansätzen zur Verhörkommunikation) oder Störungen in der sequentiellen Ordnung von Arbeitsabläufen und Handlungs- oder Kommunikationsschemata geht. In solchen gemeinsamen und recht detaillierten Textanalysen kristallisieren sich immer wieder Fragestellungen, Konzepte und Beobachtungsfoki heraus, die für die weitere Teilnahme der jeweiligen Praktikantin / Ethnographin am Geschehen in dem betreffenden Handlungsfeld und für ihre Reflexionen darüber hilfreich sind. Auch kann zu diesem Zeitpunkt schon ansatzweise darüber nachgedacht werden, was Schwerpunkte des ethnographischen Abschlussberichts sein können. Von denjenigen, die ihr Beobachtungsprotokoll eingebracht haben, wird erwartet, dass sie eine schriftliche Ergebnissicherung der Seminardiskussion anfertigen, um auf diese Weise mit dazu beizutragen, analytische Distanz zu ihren eigenen Erfahrungen herzustellen. Die Studierenden fertigen Im Verlauf ihrer studienbegleitenden Praktika Entwürfe ihrer ethnographischen Abschlussberichte an, die sie dem Dozenten und den Kommilitonen zur Verfügung stellen, um Rückmeldungen für die Überarbeitung zu erhalten, bevor die Berichte in ihrer Endfassung eingereicht werden. In der Diskussion der Entwürfe wird nach und nach sichtbar, welche Darstellungsarchitektonik den jeweiligen Praktikumserfahrungen am ehesten Rechnung trägt. Wichtig ist auf jeden Fall, dass erkennbar wird, wie sich die Praktikantin nach und nach mit dem Praxisfeld vertraut gemacht hat und sich ihre Wahrnehmungsperspektiven verändert haben, aber darüber hinaus weichen die Berichte hinsichtlich der Komplexität ihrer Darstellungsstruktur stark voneinander ab. Manche Berichte konzentrieren sich beispielsweise lediglich unter Bezugnahme auf unterschiedliche Belege aus dem Datenmaterial auf ein bestimmtes wiederkehrendes professionelles Handlungsschema (wie etwa das Aufnahmegespräch in einer psychiatrischen Tagesklinik) , während andere Berichte den Charakter von Mehrebenenanalysen haben, in denen etwa zugleich Einblicke in die Alltagskommunikation von Klienten einer Einrichtung, in professionelle Handlungsschemata, in langfristige ProfessionellenKlientenbeziehungen und in Biographien vermittelt werden. Auf jeden Fall ist es erforderlich, dass die Darstellungsebenen der Feldnotizen und des ethnographischen Endberichts – also des Datenmaterials und der darauf bezogenen analytischen Kommentare - unterscheidbar bleiben (Schütze 1994, S. 236). seemed not to promise much in the way of leads. The point is really that the potential is not so much in the document as in the relationship between it and the inquiring mind and training of a researcher who vigorously and imaginatively engages in the open coding.” 5 Abschließende Bemerkungen Insgesamt lässt sich festhalten, dass die meisten Studierenden dieser Arbeit der „Befremdung“ ihrer eigenen Praxis – und natürlich der Praxis anderer professioneller Akteure in einem bestimmten professionellen Handlungsfeld - etwas abgewinnen können und es zu ihrer Sache machen, auch wenn es anfangs und zwischendurch charakteristische Phasen der Unsicherheit und der Irritation gibt. Eine Reihe von ihnen entwickeln in diesem Zusammenhang Ideen für empirische Diplomarbeiten. Ein solches Lehr- und Lernarrangement zielt darauf ab, dass sich professionelle Kompetenzen und Sensibilitäten entwickeln, die zur Fundierung einer fallanalytischen Praxis dienen. In diesem Prozess des genauen und perspektivenreichen Zur-Sprache-Bringens eigener Erfahrungen und der allmählichen Erkenntnisbildung ist – im Unterschied zu Formen der beruflichen Selbstreflexion im Rahmen der Supervision – das Element der Schriftlichkeit von besonderer Bedeutung. Wie eine Studentin in einer gemeinsamen Abschlussevaluation feststellte: „Erst wenn ich´s hinschreibe, habe ich´s richtig begriffen.“ in der Auseinandersetzung mit qualitativen Datenmaterialien – in diesem Fall: selbstreflexiven ethnographischen Beobachtungsprotokollen - ein spontaner und möglichst egalitärer professioneller Diskurs über die eigene Arbeit, ihre Paradoxien, Kernprobleme und Fehlertendenzen (Schütze 1992, 1996, 2000, Riemann 2000, 2002) eingeübt wird. Ein solcher Diskurs, in dem es um die professionelle Praxis selbst und nicht nur um Konzeptionen und Selbstverständnisse geht, ist für die kollektive Entwicklung einer Profession und ihre Beziehungen zu anderen Professionen nicht unwichtig (um es sehr zurückhaltend zu formulieren). Die sehr genaue, offene und selbstkritische Repräsentation und diskursive Reflexion dessen, was die professionelle Praxis ausmacht und welche Folgen mit ihr verbunden sind, sollte immer selbstverständlicher werden. Eine solche Form der professionellen Selbstverständigung muss organisiert und begleitet werden, wenn sie Bestand haben soll. studentische Forschungsbeiträge zu einer Grounded Theory (Glaser und Strauss 1967) bestimmter professioneller Handlungsfelder entstehen, die u.a. in der forschungsbezogenen Ausbildung zukünftiger Professioneller eine wichtige Rolle spielen können. In meinem Aufsatz sollte deutlich geworden sein, dass gerade die Schwellensituation von „Praxisnovizen“, die sich einerseits ernsthaft darauf vorbereiten, professionelle Kompetenzen zu erwerben, aber andererseits die Selbstverständlichkeiten eines bestimmten professionellen Handlungsfelds noch nicht übernommen haben und noch nicht „betriebsblind“ geworden sind, besondere Chancen bietet für die Entdeckung von Neuem. Angesichts einer Hochschullandschaft, in der die Qualität von Forschung und das „standing“ von Universitäten, Fachbereichen und Hochschullehrern oft ausschließlich an der Quantität der eingeworbenen Drittmittel festgemacht werden und die Lehre trotz aller Evaluationsrhetorik nach wie vor randständig bleibt, ist daran zu erinnern, dass in der Geschichte der Sozialwissenschaften Neues oft dann entstanden ist, wenn der quasi „natürliche“ Gegensatz von Forschung und Lehre nicht existierte und studentische Forschung in werkstattförmigen Zusammenhängen einen besonderen Stellenwert besaß.22 Das war etwa in der frühen Chicagoer Soziologie der zwanziger und dreißiger Jahre im Umkreis von Robert Park der Fall, aber auch bei Anselm Strauss und anderen Interaktionisten in der Chicagoer Tradition. Literatur Atkinson, Paul, Amanda Coffey, Sara Delamont, John Lofland und Lyn Lofland, Hrsg. (2001): Handbook of Ethnography. London, Thousand Oaks und New Delhi: Sage Publications Becker, Howard S. (1967): Whose Side are we on? In: Social Problems, Vol. 14 (Winter), S. 239 –247 Clifford, James und George E. Marcus, Hrsg. (1986): Writing Culture. Berkeley, Los Angeles und London: University of California Press Emerson, Robert M., Rachel I. Fretz und Linda L. Shaw (1995): Writing Ethnographic Fieldnotes. Chicago und London: The University of Chicago Press dies. (2001): Participant Observation and Fieldnotes. In Paul Atkinson et al., Hrsg., S. 352 – 368 Glaser, Barney und Anselm Strauss (1967): The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine Hirschauer, Stefan und Klaus Amann, Hrsg. (1997): Die Befremdung der eigenen Kultur. Zur ethnographischen Herausforderung soziologischer Empirie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp dies. (1997a): Die Befremdung der eigenen Kultur. Ein Programm. In: dies., Hrsg., S. 7-52 Hughes, Everett C. (1984): The Sociological Eye. Selected Papers. New Brunswick (USA) und London: Transaction Books ders. (1984a): The Humble and the Proud: The Comparative Study of Occupations. In: ders.. S. 417427 Kallmeyer, Werner und Fritz Schütze (1977): Zur Konstitution von Kommunikationsschemata der Sachverhaltsdarstellung. In: Dirk Wegner, Hrsg., Gesprächsanalysen. IKP-Forschungsberichte, Reihe I, Band 65. Hamburg: Buske, S. 159-274 Lurie, Alison (1967): Imaginary Friends. New York: Avon (auf Deutsch unter “Varna oder Imaginäre Freunde“. Zürich: Diogenes, 1988) 22 Für den Erkenntnisertrag einer solchen Sozialforschung von unten ist es schlicht irrelevant, ob sie an Universitäten oder Fachhochschulen betrieben wird. Es kommt lediglich darauf an, ob die beteiligten Dozenten und Studierenden ein Bewusstsein davon haben, dass professionelle Praxiskompetenzen auf dem Erwerb von entsprechenden Forschungsfertigkeiten beruhen und im Rahmen der Ausbildung Freiräume für studentische Forschung entwickelt und bewahrt werden können. Das ist gerade auch in anwendungsbezogenen Studiengängen wie dem der Sozialen Arbeit von großer Bedeutung. Die Auseinandersetzung mit Paradoxien und Kernproblemen professionellen Handelns, die seit Beginn der neunziger Jahre verstärkt in der sozialwissenschaftlichen Professionsforschung eine Rolle spielt, wurde durch die Betreuung von Studienarbeiten, Diplomarbeiten und Dissertationen von Studierenden der Sozialen Arbeit und der Supervision im Rahmen von Forschungswerkstätten angeregt (Riemann/Schütze 1987, Reim/Riemann 1997), in denen narrative Interviews, Beobachtungsmaterialien, Transkriptionen von Aktualtexten wie Beratungs- und Therapiegesprächen und andere sprachliche Materialien bearbeitet wurden. - Die permanente Konfrontation mit und Reflexion von Praxiserfahrungen schafft für die sozialwissenschafltiche Forschung ein besonderes Anregungspotential, was in den „professional schools“ des angloamerikanischen Universitätssystems schon seit langem erkannt worden ist. Murphy, Elizabeth und Robert Dingwall (2001): The Ethics of Ethnography. In: Paul Atkinson et al., Hrsg., S. 339 – 351 Oevermann, Ulrich (2001) : Das Verstehen des Fremden als Scheideweg hermeneutischer Methoden in den Erfahrungswissenschaften. In: Zeitschrift für qualitative Bildungs-, Beratungs- und Sozialforschung. Heft 1, S. 67 – 92 Polanyi, Michael (1985): Implizites Wissen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Reed-Danahay, Deborah (2001) : Autobiography, Intimacy and Ethnography. In: Paul Atkinson et al., Hrsg., S. 407 - 425 Reim, Thomas und Gerhard Riemann (1997): Die Forschungswerkstatt. In: Gisela Jakob und HansJürgen von Wensierski, Hrsg., Rekonstruktive Sozialpädagogik. Konzepte und Methoden sozialpädagogischen Verstehens in Forschung und Praxis. Weinheim und München: Juventa, S. 223 – 238 Riemann, Gerhard (1999): Ein Blick von innen – ein Blick von außen. Überlegungen zum Studium der Sozialarbeit / Sozialpädagogik. In: Regina Kirsch und Florian Tennstedt, Hrsg., Engagement und Einmischung. Festschrift für Ingeborg Pressel zum Abschied vom Fachbereich Sozialwesen der Universität Gesamthochschule Kassel. Kassel: Gesamthochschul-Bibliothek, S. 71 - 85 ders. (2000): Die Arbeit in der sozialpädagogischen Familienberatung. Interaktionsprozesse in einem Handlungsfeld der sozialen Arbeit. Weinheim und München: Juventa ders. (2002): Biographien verstehen und missverstehen – Die Komponente der Kritik in sozialwissenschaftlichen Fallanalysen des professionellen Handelns. In: Margret Kraul, Winfried Marotzki und Cornelia Schweppe, Hrsg., Biographie und Profession. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, S. 165 – 196 ders. (2003): Erzählanalyse / Narrationsanalyse. In: Bohnsack, Ralf, Michael Meuser und Winfried Marotzki, Hrsg., Hauptbegriffe qualitativer Sozialforschung. Opladen: Leske und Budrich ders. und Fritz Schütze (1987): Some Notes on a Student Research Workshop on Biography Analysis, Interaction Analysis, and Analysis of Social Worlds. In: Newsletter No. 8 (Biography and Society) of the International Sociological Association Research Committee 38, hgg. Von Erika M. Hoerning und Wolfram Fischer, Juli, S. 54 - 70 Sanjek, Roger, Hrsg. (1990): Fieldnotes. The Making of Anthropology. Ithaca und London: Cornell University Press Schön, Donald A. (1983): The Reflective Practitioner. New York: Free Press ders. (1987): “Educating the Reflective Practitioner”. Presentation to the 1987 meeting of the American Educational Research Association. Washington, DC.. Verfügbar unter: http://hci.stanford.edu/other/schon87.htm (letzter Zugriff: 20.7.2003) Schütze, Fritz (1987): Das narrative Interview in Interaktionsfeldstudien I. Studienbrief der Fernuniversität Hagen, Fachbereich Erziehungs- und Sozialwissenschaften ders. (1992): Sozialarbeit als „bescheidene“ Profession. In: Bernd Dewe, Wilfried Ferchhoff und FrankOlaf Radtke, Hrsg., Erziehen als Profession. Zur Logik professionellen Handelns in pädagogischen Feldern. Opladen: Leske und Budrich, S. 132 – 170 ders. (1994): Ethnographie und sozialwissenschaftliche Methoden der Feldforschung. Eine mögliche methodische Orientierung in der Ausbildung und Praxis der Sozialen Arbeit? In: Norbert Groddeck und Michael Schumann, Hrsg., Modernisierung Sozialer Arbeit durch Methodenentwicklung und –reflexion. Freiburg: Lambertus, S. 189 – 297 ders. (1996): Organisationszwänge und hoheitsstaatliche Rahmenbedingungen im Sozialwesen: Ihre Auswirkungen auf die Paradoxien des professionellen Handelns. In: Arno Combe und Werner Helsper, Hrsg., Pädagogische Professionalität. Untersuchungen zum Typus pädagogischen Handelns. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 183 – 275 ders. (2000): Schwierigkeiten bei der Arbeit und Paradoxien professionellen Handelns. Ein grundlagentheoretischer Aufriss. In: Zeitschrift für qualitative Bildungs-, Beratungs- und Sozialforschung. Heft 1, S. 49 - 96 Sharrock, Wes und Bob Anderson (1986): The Ethnomethodologists. Chichester und London: Ellis Horwood und Tavistock Publications Stagl, Justin (1981): Die Beschreibung des Fremden in der Wissenschaft. In: Hans Peter Duerr, Hrsg., Der Wissenschafter und das Irrationale. Band 1. Frankfurt a. M., S. 273 – 295 Strauss, Anselm (1978): A Social World Perspective. In: Norman K. Denzin, Hrsg., Studies in Symbolic Interaction. Vol. 1, S. 119-128 ders. (1987): Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge u. a. O.: Cambridge University Press ders. und Barney Glaser (1970): Anguish. The Case History of a Dying Trajectory. Mill Valley, CA: The Sociology Press ders. und Shizuko Fagerhaugh, Barbara Suczek und Carolyn Wiener (1985): Social Organization of Medical Work. Chicago und London: The University of Chicago Press Taylor, Carolyn und Susan White (2000): Practicing Reflexivity in Health and Welfare. Making knowledge. Buckingham und Philadelphia: Open University Press Willis, Paul und Mats Trondman (2000): Manifesto for Ethnography. In: Ethnography, Vol. 1, Nr. 1 (Juli), S. 5 - 16