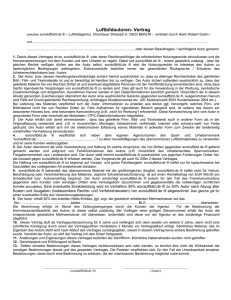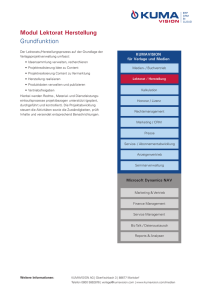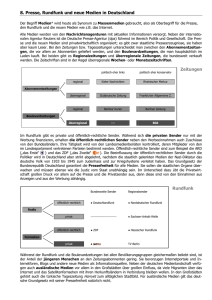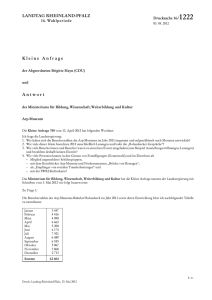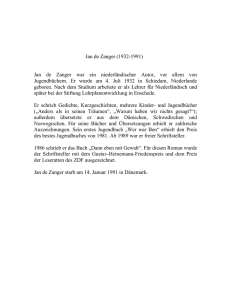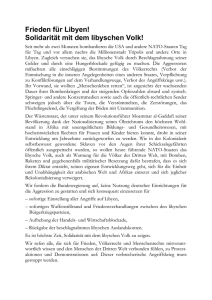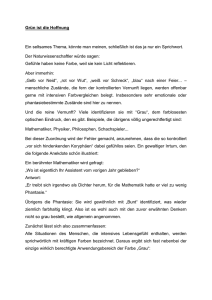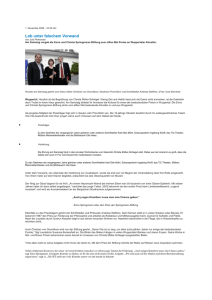Abschied von einer Idylle
Werbung
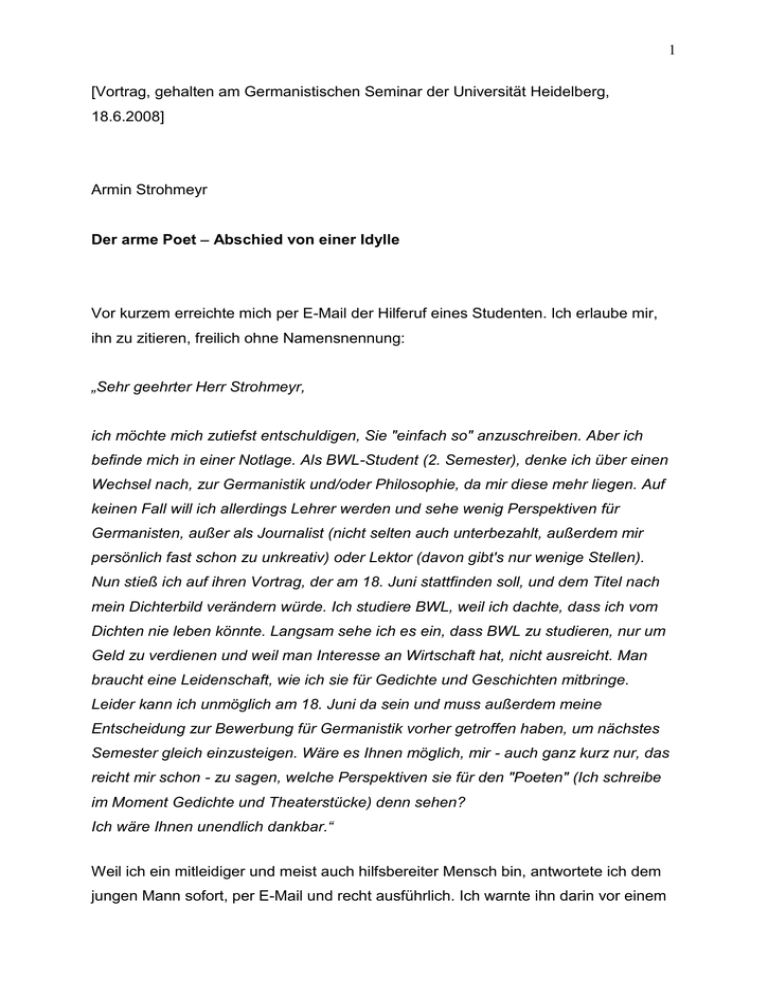
1 [Vortrag, gehalten am Germanistischen Seminar der Universität Heidelberg, 18.6.2008] Armin Strohmeyr Der arme Poet Abschied von einer Idylle Vor kurzem erreichte mich per E-Mail der Hilferuf eines Studenten. Ich erlaube mir, ihn zu zitieren, freilich ohne Namensnennung: „Sehr geehrter Herr Strohmeyr, ich möchte mich zutiefst entschuldigen, Sie "einfach so" anzuschreiben. Aber ich befinde mich in einer Notlage. Als BWL-Student (2. Semester), denke ich über einen Wechsel nach, zur Germanistik und/oder Philosophie, da mir diese mehr liegen. Auf keinen Fall will ich allerdings Lehrer werden und sehe wenig Perspektiven für Germanisten, außer als Journalist (nicht selten auch unterbezahlt, außerdem mir persönlich fast schon zu unkreativ) oder Lektor (davon gibt's nur wenige Stellen). Nun stieß ich auf ihren Vortrag, der am 18. Juni stattfinden soll, und dem Titel nach mein Dichterbild verändern würde. Ich studiere BWL, weil ich dachte, dass ich vom Dichten nie leben könnte. Langsam sehe ich es ein, dass BWL zu studieren, nur um Geld zu verdienen und weil man Interesse an Wirtschaft hat, nicht ausreicht. Man braucht eine Leidenschaft, wie ich sie für Gedichte und Geschichten mitbringe. Leider kann ich unmöglich am 18. Juni da sein und muss außerdem meine Entscheidung zur Bewerbung für Germanistik vorher getroffen haben, um nächstes Semester gleich einzusteigen. Wäre es Ihnen möglich, mir - auch ganz kurz nur, das reicht mir schon - zu sagen, welche Perspektiven sie für den "Poeten" (Ich schreibe im Moment Gedichte und Theaterstücke) denn sehen? Ich wäre Ihnen unendlich dankbar.“ Weil ich ein mitleidiger und meist auch hilfsbereiter Mensch bin, antwortete ich dem jungen Mann sofort, per E-Mail und recht ausführlich. Ich warnte ihn darin vor einem 2 unüberlegten Schritt und schilderte ihm in groben Zügen die Schwierigkeiten des Daseins als „freier Autor“. Ich tat das, ohne zu übertreiben, aber auch ohne zu beschönigen. Eine Antwort-Mail blieb jedoch aus. Das Wörtchen „Danke“ auch. Sollte ich den jungen Mann entsetzt haben? Oder war er vielleicht enttäuscht, nicht das von mir gehört zu haben, was er gerne hätte hören wollen? Es bleibt ein Geheimnis. Sie haben sicherlich die Ankündigung zu diesem Vortrag gelesen. Der Titel: „Der arme Poet Abschied von einer Idylle“ ist gleichermaßen ironisch wie ernst gemeint. Ironisch in dem Sinne, als das heutige Autorendasein nichts mehr mit dem Dasein eines Poeten der bürgerlichen Zeit zu tun hat (und bereits Spitzweg, auf dessen bekanntes Gemälde hier angespielt wird, hat das idyllische Poetendasein ja ironisiert und als Lüge entlarvt). Ernst im dem Sinne, als von einer Idylle in einem poetischen Kuhschnappel, um ein Jean Paulsches Wort zu gebrauchen, nie die Rede sein konnte heute jedoch noch weniger als in früheren Zeiten. Wenn ich Ihnen heute über mein Dasein als freier Autor und über meine Anschauungen über die Rolle eines Germanisten, der als freier Autor sein Brot verdient, in der Gesellschaft darlege, so hegen diese Ausführungen keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Meine Erfahrungen sind persönlich. Andere Autoren haben im einzelnen andere Erfahrungen, vielleicht auch einen anderen beruflichen und literarischen Werdegang hinter sich. Aber es sind eben Erfahrungen, und als solche hoffentlich auch Ihnen wertvoll. Denn ich weiß, dass die beruflichen Wünsche und Aussichten von Germanistikstudenten höchst different und diffus sind. Und ich vermute, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch hier unter Ihnen der eine / die eine oder andere ist, der / die selbst schreibt und mit einem Dasein als Schriftsteller liebäugelt. Die Wege zum Dasein als „freier Autor“ sind verschieden, die Voraussetzungen auch. Mein Weg ist individuell, aber nicht untypisch, wie mir scheint. Deswegen möchte ich Ihnen meinen Weg etwas ausführlicher skizzieren: Ich bin in einer Kleinstadt bei Augsburg aufgewachsen, besuchte dort das Gymnasium / neusprachlicher Zweig, und wechselte in der Kollegstufe an ein 3 humanistisches Gymnasium in Augsburg, weil ich dort den Leistungskurs Musik belegen konnte. Der andere Leistungskurs war übrigens nicht Deutsch, sondern Latein. „Non scholae, sed vitae discimus“, so paukte es uns unser Lateinlehrer, ein fast 70jähriger Benediktinerpater, ein. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Dem widerspreche ich in Teilen, Zumindest zu meiner Schulzeit war der Lehrstoff noch sehr realitätsfern. Wenn ich mir betrachte, wie die Schüler heute bereits Betriebspraktika ablegen müssen, so halte ich das für sinnvoll und notwendig. Ich machte also das Abitur an einem humanistischen Gymnasium, ohne dass ich ein Wort Griechisch gelernt hatte, und ohne dass jemand nach meinen Französischkenntnissen krähte. Den Leistungskurs Latein indes legte ich nicht ohne Interesse ab, doch ohne Herzblut. Etwa mit siebzehn Jahren vergleichsweise spät wurde ich von einer schönen Krankheit infiziert dem Lesen. Ich las, was ich in die Finger bekam. Grimmelshausen und Goethe, Fontane und Turgenjew, Emily Brontë und Flaubert, Ingeborg Bachmann und Siegfried Lenz, Walther von der Vogelweide und Reiner Kunze. Querbeet durch die Zeiten und Kulturen, nach Möglichkeit auch in der Originalsprache. Ich las mir einen reichen Schatz an, von dem ich zum Teil bis heute zehre. Später wird man als Leser wählerischer, kritischer, wie ein Gourmet, der sich auch nicht mehr mit jeder Currywurst zufrieden gibt. Aber ich las auch hingebungsvoller, ausgelieferter. Das Gehirn konnte einfach noch mehr aufnehmen, und das Herz verlangte nach den Schicksalen verwandter Seelen. Ich las bis zum körperlichen Zusammenbruch. Im Zivildienst klappte ich einmal des Morgens zusammen, weil ich nächtelang Dostojewski gelesen hatte und das Schlafen als unnötig erachtet hatte. Nach dem Zivildienst begann ich an der Universität Augsburg zu studieren. „Irgendwas mit Büchern“ hatte der junge Heinrich Böll einmal seinen Eltern auf deren besorgte Frage, was er denn werden wolle, geantwortet. Mir ging es ähnlich. Unbekümmert um die Zukunft Veranstaltungsreihen wie diese hier gab es damals an der Uni noch nicht studierte ich also: Neuere Deutsche 4 Literaturwissenschaft im Hauptfach, französische Literaturwissenschaft und Musikwissenschaft in den Nebenfächern. Außerdem besuchte ich viel und gern Vorlesungen der deutschen Literatur des Mittelalters. Ich schloss mein Studium mit dem Grad des Magister Artium ab, der bereits damals, 1992, nicht mehr hoch angesehen war, und wusste immer noch nicht so recht, wohin mit mir und meinem weiteren Leben. Da kam mir der Zufall zu Hilfe: Ich war bereits mit Gedichten in der Augsburger Öffentlichkeit zutage getreten, hatte auf diese Weise auch einen älteren Herrn kennengelernt, der in der Augsburger literarischen Szene recht bekannt war und dennoch von seinen Gedichten und Erzählungen, die er seit den frühen Fünfziger Jahren veröffentlichte, nicht leben konnte. Er verdiente sein Brot bei der Augsburger Zeitung, der „Augsburger Allgemeinen“, genauer gesagt als Redakteur eines Jahrbuchs, des „Schwäbischen Hauskalenders“. Gesundheitlich angeschlagen, ging er in Frühpension und legte für mich bei der Geschäftsleitung ein gutes Wort ein. Meine Bewerbung wurde also wohlgefällig aufgenommen und angenommen. Seit Januar 1993 führte ich als Redakteur einer 1Mann-Redaktion diesen Hauskalender. Anders als mein Vorgänger war ich jedoch nicht 12 Monate im Jahr beschäftigt, sondern nur 8. Mir kam das damals entgegen, weil ich in den übrigen vier Monaten des Jahres an meiner Dissertation schrieb. Im Grunde jedoch wurde damals bereits von der Geschäftsleitung die Schraube angezogen. Warum nicht aus einem Arbeitnehmer in zwei Dritteln der Zeit das gleiche Resultat verlangen, bei weniger Bezahlung? Vier Monate im Jahr war ich also beim Arbeitsamt arbeitslos gemeldet, und hoffte, nichts anderes angeboten zu bekommen, um ungestört an meiner Doktorarbeit basteln zu können. So brachte ich fünf Jahrgänge des Schwäbischen Hauskalenders zustande, zuletzt mit einer Auflage von 46.000 Exemplaren, Tendenz steigend. Zudem legte ich meine Dissertation vor und absolvierte die mündliche Doktorprüfung. Tags darauf verkündete mein neuer Chef er kam als Manager von der Deutschen Lufthansa und glaubte nun auch in der Augsburger Allgemeinen durchstarten zu können , er habe sich meinen Posten und den des Hauskalenders durchgerechnet und sei der Meinung, ich käme der Firma zu teuer. Von meiner alljährlichen partiellen Arbeitslosigkeit war nicht die Rede. Mir wurde gekündigt. Das fast 50-jährige Traditionsprodukt des Schwäbischen Hauskalenders eingestampft trotz der vielen 5 Proteste der Leserschaft, die man nur zynisch lächelnd abtat. Peanuts in einem der größten Medienkonzerne Deutschlands. So stand ich also mit meiner frisch „gebackenen“ Doktorwürde arbeitslos da. Ich schrieb Bewerbungen an Verlage und Zeitungen erfolglos. Geriet auch an äußerst skurrile Gestalten, die es wert wären, in einem Roman verwurstet zu werden: Ein Verleger in Berlin, mit dem ich ein Bewerbungsgespräch führte, meinte nach vierstündigem Monolog, in dem er seinen Werdegang stilisierte und seine Bücher anpries, die er machen wolle, und die sich mehr und mehr als Traktate eines wirren Möchtegern-Gurus herausstellten, meinte also auf meine Frage nach dem Gehalt erstaunt, er könne mir kein Geld bezahlen, und ich solle doch für die erste Zeit bei Freunden unterkriechen, meine Möbel irgendwo unterstellen, alles andere würde sich dann schon fügen. Ein anderer Verleger, dessen Verlagsräume in einem großbürgerlichen Palais in Berlin-Charlottenburg untergebracht waren, empfing mich zum Vorstellungsgespräch. Er edierte u. a. die kommentierte Werkausgabe eines expressionistischen Dichters mit staatlichen Fördermitteln. Er gestand recht offen, dass er sich eigentlich nur am Rande um den Verlag kümmere. Die meiste Zeit des Jahres sei er auf seiner Yacht an der Côte d’Azur, seine Studenten, die als Praktikanten bei ihm arbeiteten (also Menschen wie Sie!) würden den Betrieb am Laufen halten. Berlin war also kein leichtes Terrain, Augsburg hingegen ödete mit seiner Kleingeistigkeit an. Der Gedanke an eine Freiberuflichkeit gewann immer mehr Kontur, zumal ich bereits seit einigen Jahren als freier Autor für den Bayerischen Rundfunk tätig war und mir diese Arbeit immer mehr Spaß bereitete. Außerdem führte ich zwei Jahre lang einen Kleinstverlag, in dem ich neben eigenen Lyrikbänden auch die Werke zweier vergessener Dichter herausgab, nämlich der jüdische Dichterin Hedwig Lachmann und des Expressionisten Oskar Schürer. Ich entschied mich also zum Weggang aus Augsburg und zum Hingang nach Berlin. Das war im Mai 1998, vor exakt zehn Jahren. Ich beantragte beim Verband der Schriftsteller Berlin-Brandenburg die Mitgliedschaft, die mir aufgrund meiner sporadischen Tätigkeit als freier Autor beim Bayerischen Rundfunk auch bewilligt 6 wurde und beantragte die Aufnahme in den Versicherungsschutz der Künstlersozialkasse. Eine Wohnung war gemietet, mein Schreibtisch stand, der PC funktionierte. Ich war also „freier Autor“. So einfach geht das! Die ersten zwei Jahre jobbte ich noch nebenher, seit etwa acht Jahren lebe ich ausschließlich vom Schreiben und der Verwertung des Geschriebenen. Das ist nicht selbstverständlich. Darauf werde ich später noch zu sprechen kommen. Meine Tätigkeitsfelder sind vielfältig und umfangreich: In diesen zehn Jahren schrieb ich an die 80 Hörbilder und Features für öffentlich rechtliche Rundfunksender, darunter für den Bayerischen Rundfunk, den Südwestrundfunk, den Hessischen Rundfunk, den Norddeutschen Rundfunk, für den Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ich veröffentlichte außerdem Aufsätze in diversen Publikumszeitschriften. Ich publizierte Biographien in großen Publikumsverlagen: über Klaus Mann, Klaus und Erika Mann, Annette Kolb, George Sand, Die Frauen der Brentanos, Sophie von La Roche, und zuletzt die Porträtsammlung „Verlorene Generation“. Daraus werde ich im zweiten Teil der Veranstaltung noch ein paar Seiten lesen. Außerdem erschien 2006 ein Lyrikband unter dem Titel „Jelängerjelieber“, der von führenden Lyrikern wie Albert von Schirnding, Kathrin Schmidt, Kerstin Hensel und Doris Runge Lob und Anerkennung erhielt. Ich schrieb Theaterstücke für ein in Berlin tätiges Figurentheater (Schattenspiel). Zur Zeit suche ich einen Verlag für einen fertigen Roman. Nächstes Jahr wird von einem in Bayern lebenden Schauspieler mein Theatermonolog "Der Mitgeher“ uraufgeführt werden. Ich arbeite derzeit an einem weiteren Roman, der zu drei Vierteln abgeschlossen ist. Und ich stehe mit Verlagen über zwei neue Sachbücher in Verhandlung. Außerdem gab und gebe ich Seminare in der Erwachsenenbildung, u. a. in der Schwabenakademie Kloster Irsee / Allgäu und landauf landab Lesungen und Vorträge, wie auch heute hier in Heidelberg. Es ist also leicht, freier Autor zu werden, schwieriger sich durchzusetzen. Doch die Frage ist zunächst einmal: Was ist ein freier Autor? 7 Ein Autor ist ein Urheber, und nach dem Urhebergesetz als solcher definiert und rechtlich abgesichert. Das Beiwort „frei“ suggeriert „Freiheit“. Eine Initiative für das Freiberuflertum warb vor kurzem mit Plakaten, auf denen vollmundig versprochen wurde: „Arbeite, wo du willst, wann du willst, wie du willst.“ Das ist schlicht Unsinn. Die Freiheit des freien Autors wie überhaupt des Freiberuflers besteht nicht in der Freiheit von etwas, sondern in der Freiheit zu etwas. Das beinhaltet Verantwortung und Disziplin. Verantwortung vor den Auftraggebern, Disziplin im Selbstmanagement. Der freie Autor ist aber auch verantwortlich für das, was er von sich gibt. Im Falle inhaltlicher Fehler, schlechter Kritiken oder auch nur eines Missverständnisses ist grundsätzlich der Autor schuld, nicht die Umstände, unter denen er zu arbeiten gezwungen ist. Der freie Autor hat kein Sicherungsnetz. Er ist frei zur Selbstverantwortung und ist für alles selbst verantwortlich. Dies fängt bereits im Tagesablauf an. Bisweilen erhielt ich Anrufe von Leuten, die mich noch nicht so gut kannten, vormittags um halb neun. Die ganz erstaunt fragten, ob ich denn zu so früher Stunde schon erreichbar sei? Nun kann man sich fragen, weshalb jemand anruft, wenn er ohnehin nicht erwartet, den Gesprächspartner zu erreichen? Ein Kontrollanruf? Oder reiner Sadismus, einen faul à la Spitzweg in den Federn liegenden Poeten gehörig aufzuschrecken? Es bleibt ein Rätsel. Nein, gewöhnlich sitze ich morgens um halb neun bereits am Schreibtisch. Die Vormittagsstunden sind mir die wichtigsten, eben weil man noch nicht so viel „gestört“ wird wie etwa am Nachmittag, wenn auch die Redaktionen zu Leben erwacht sind. Mein Arbeitstag teilt sich meist in drei Blöcke: vormittags 3 bis 4 Stunden, nach der Mittagspause wiederum etwa 2 bis 3 Stunden, nach einem nachmittäglichen Spaziergang, der auch Erledigungen dient, wiederum etwa zwei bis drei Stunden je nach Auftragslage und Termindruck. 8 Mein Arbeitstag umfasst also je nachdem zwischen 7 und 9 Stunden, in Spitzenzeiten auch bis zu elf Stunden. Meine Arbeitswoche hat gewöhnlich 6 Tage. Von einer 5-Tage-Woche, gar von einer 35-Stunden-Woche, kann ich obschon selbst in der Gewerkschaft Ver.di organisiert nur träumen. Wenn der Abgabetermin eines Buches ansteht, kann es auch vorkommen, dass ich über 3 oder 4 Monate hinweg auch eine 7 Tage-Woche habe, die Stundenzahl mag ich besser gar nicht ausrechnen. Die Gewerkschaft Ver.di hat übrigens einmal ausgerechnet, dass der durchschnittliche Stundenlohn eines freien Autors etwa 2,30 Euro beträgt. Für so wenig Geld würde eine Putzfrau ihren Feudel allenfalls scheel anschauen, ein Müllarbeiter würde die Abfalltonne aus Erbosung gleich im Vorgarten des Anwesens auskippen. Wie sieht nun die tägliche Arbeit aus? Keineswegs schreibe ich täglich 7 oder 9 Stunden an einem Text. Vielmehr beginnt der Arbeitstag mit Büroarbeiten. Etwa 2 bis 3 Stunden täglich sind dafür zu veranschlagen. Ein freier Autor ist ja frei von allen Zulieferern und Mitarbeitern, frei von einer Sekretärin, frei von studentischen Hilfskräften. Neue Projekte sind zu überlegen, wobei man, was etwa Gedenktage und Jubiläen anbelangt gemeinhin bis zu 4 Jahre vorausschauen und -planen muss. Exposés sind zu schreiben. Gemeinhin erhält man heute auf Angebote nur selten eine Antwort, was aber nicht heißen soll, dass kein Interesse besteht. Das „Pflichtgefühl“ gegenüber dem Brief- oder Mail-Schreiber hat ganz offensichtlich abgenommen. Das ändert nichts daran, dass der freie Autor eine Antwort haben will, und sei es nur eine abschlägige. Also muss nach geraumer Zeit, etwa 4 bis 6 Wochen nach der Absendung eines Briefes oder Exposés, gewöhnlich telefonisch nachgefasst werden. Redakteure sind oft schlecht zu erreichen, in den Vorzimmern sitzen bisweilen freundlich Sekretärinnen, die nie wissen, wo sich ihr Chef gerade befindet, oder auch Zerberusse, die sich von den Zuträgern ihrer Redaktionen belästigt statt umworben fühlen. So kann es durchaus mal sein, dass man eine Woche lang jemanden zu erreichen sucht, bis man ihn endlich an der Strippe hat und er behauptet, das Exposé sei nicht eingegangen, offensichtlich auf dem Postweg verloren gegangen. 9 Oder aber, man habe es wegen Überlastung noch nicht zur Kenntnis nehmen können etc. etc. Viele dieser Kontaktaufnahmen sind nicht von Erfolg gekrönt. Einige aber doch. Und auf diese wenigen kommt es an. Man tut die abschlägigen Antworten zu den möglichen Kontakten für die Zukunft. Im Gespräch und in der Erinnerung bleiben ist alles. Die „erfolgreichen“ Akquisen sind dann erst der Anfang dessen, was sich irgendwann in einem Haben-Betrag auf dem Girokonto wiederfindet. Es muss mit dem Redakteur abgesprochen werden, inwiefern die inhaltliche Richtung, die das Exposé vorgibt, in Ordnung geht, oder aber andere Schwerpunkte, andere Ausrichtungen eines Beitrags gewünscht sind. Die Länge wird genau festgesetzt, bei Büchern auf die Seite genau, bei Zeitschriftenbeiträgen und Rundfunksendungen auf das Zeichen bzw. die Sendeminute genau. Die Redakteure wünschen nicht mit Kürzungen belangt zu werden. Auch das ist Aufgabe des Autors. Auch wird der Abgabetermin festgesetzt. Wird er nicht eingehalten, kann das das Ende einer Zusammenarbeit bedeuten. Kann ein Beitrag nicht zu dem festgesetzten Termin erscheinen, und trägt der Autor die Schuld daran, besteht kein Anspruch auf Honorierung, evtl. gezahlte Vorschüsse müssen zurückerstattet werden. Zudem sind im Vorfeld Pressenotizen und Klappentexte zu formulieren, für Programmzeitschriften, für Verlagsvorschauen, für Presseleute und Verlagsvertreter. Ist ein Buchmanuskript abgeliefert, und sitzt man gewöhnlich schon am nächsten Projekt, kommen irgendwann die Korrekturfahnen, manchmal ein Packen von mehreren hundert Seiten, die dann innerhalb von 1 Woche „schnellschnell“ durchgearbeitet werden müssen, nicht nur auf Tippfehler, sondern auch auf Stilistik und teils noch inhaltlich. Mein letztes Weihnachtsfest habe ich übrigens so zugebracht. Autoren können im Normalfall nicht von den Honoraren aus ihren Publikationen leben. Sie sind gezwungen, zu Lesetouren aufzubrechen. Das ist wichtig für die Publicity der Person aber auch eines Buches, und es bringt Lesehonorare ein, die ein Standbein von mehreren darstellen, und nicht das unwichtigste Standbein. Auch hier darf man von Verlagsseite eher wenig erwarten. Die sind personell dafür einfach nicht gerüstet. 10 Ich habe für mein jüngstes Buch "Verlorene Generation" etwa 25 Lesungen vereinbart, mehr als doppelt so viele als bei den vorhergehenden Büchern. Dazu schrieb ich selbst Buchhändler und Veranstalter an, die ich bereits von früheren Lesungen her kenne, und telefonierte das übliche Spiel etwa vier Wochen später überall hintennach. Klinkenputzen nannte man das früher, Akquise heißt es neudeutsch. Etwa drei Viertel der Lesungen konnte ich selbst vereinbaren, das vierte Viertel wurde von einer Agentin eingefädelt, bei der ich seit kurzem unter Vertrag stehe, und die ich natürlich selbst von meinen Honoraren bezahlen muss. Übrigens war die Dame anfänglich etwas geknickt, weil ich im erfolgreichen Aushandeln ihre „Quote“ bei weitem überflügelte. Sind Lesungen mündlich vereinbart, wird ein Vertrag verschickt. Dann geht es ans Organisieren: Der Veranstalter wünscht Plakate vom Verlag (der Autor muss dort anrufen und erinnern), der Veranstalter wünscht einen Pressetext und ein Autorenfoto (schickt der Autor zu), es müssen Fahrkarten gekauft und Hotels organisiert werden, manchmal sind auch noch Absprachen nötig mit Musikern oder Schauspielern, die die Lesung mitgestalten. Kommt man von einer Lesetour zurück (allein im Mai dieses Jahres fuhr ich zu 7 Lesungen etwa 3.000 Kilometer durchs Land), sind Rechnungen zu schreiben. Und manchmal muss man auch nach der Stellung der Rechnung nachhaken und alles kontrollieren, bis das liebe Geld endlich, endlich auf dem Girokonto eingetrudelt ist. Das liebe Geld. Ein Hauptnoblem des „freien Autors“. Im Dezember 2007 erschien eine Presseinformation des Verbands deutscher Schriftsteller Berlin-Brandenburg. Ich zitiere daraus: 11 12 Nicht nur immer mehr Autoren können von ihrer Arbeit nicht leben, auch immer mehr Autoren sind registriert. Das mag mit der wachsenden Zahl von Leuten (auch Germanisten!) zusammenhängen, die in den „klassischen“ Berufsfeldern wie Journalistik, Verlag, Pressearbeit, nicht mehr unterkommen. Nach dem jüngsten Bericht der Verwertungsgesellschaft Wort sie verwaltet die „Ausschüttung“ von Abgaben, zu denen „Verwerter“ von geistigem Eigentum verpflichtet sind betrug 2007 die Zahl der wahrnehmungsberechtigten Autoren in Deutschland ca. 130.000. Noch vor zahn Jahren waren es rund 85.000. Das entspricht einem Zuwachs innerhalb von 10 Jahren von rund 50 %. Hingegen sind die Veröffentlichungsmöglichkeiten in den Bereichen Hörfunk und Fernsehen, Zeitung und Zeitschriften stark zurückgegangen, nicht zuletzt durch Sparmaßnahmen und Rationalisierung. Der Konkurrenzkampf zwischen den Autoren nimmt also eklatant zu. Das mediale Leben hat sich in den letzten fünfundzwanzig Jahren stark verändert. Zu mancherlei Fortschritt und Nutzen. Aber auch zu vieler Schaden. Vor allem zu Schaden des „klassischen“ freien Autors, des Schriftstellers. Öffentlich rechtliche Rundfunkanstalten zunächst Hörfunk, später auch das Fernsehen waren seit den frühen 50er Jahren eine Haupteinnahmequelle von Autoren. So mancher Schriftsteller, der sich bei der Kritik als Lyriker oder Romanautor einen Namen machte, konnte nicht vom Absatz seiner Bücher leben, sondern von Lesungen im Rundfunk, von Hörspielen und Verfilmungen seiner Werke. Die öffentlich-rechtlichen Sender zahlen vergleichsweise gut. Auch heute. Dann kam aber in den 1980er Jahren die Privatisierung. Private Fernseh- und Rundfunksender finanzieren sich einzig durch Werbung und schielen entsprechend einzig auf die Quote. Der Massengeschmack, der seit jeher ein schlechter war, geriet also in den Focus des Interesses der Programmmacher. Die privaten Sender hatten plötzlich mehr Hörer und Zuschauer als die öffentlichen. Der Quote wurde alles geopfert. Nicht nur die künstlerische Qualität, sondern auch der sittlich-moralische Wert. Ich meine mit Moral keineswegs etwas Rückwärtsgewandtes, sondern schlicht das Gerüst, das für ein kulturelles Selbstbewusstsein einer Gesellschaft vonnöten ist. Die öffentlich-rechtlichen Sender zogen nach infiltriert von privaten Beratungsfirmen. Wir alle zahlen heute mit unseren Rundfunkgebühren 13 nachmittägliche Exhibitionistenshows, in denen allerlei Fetischisten und geistig Minderbemittelte vor laufender Kamera ihre "Meinungen“, die eigentlich unwichtig sind, schlecht artikulieren. Abends folgen dann die Gewaltorgien. Kultursendungen, Hörspiele, Wort-Features sind entweder auf den späten Abend verlegt, oder aber, wie bei etlichen Rundfunksendern, inzwischen fast ganz verschwunden. Ich kann das aus eigener Erfahrung belegen. Vor einigen Jahren arbeitete ich noch mehr oder weniger regelmäßig für acht Rundfunkredaktionen. Inzwischen sind durch Umstrukturierungen und „Reformen“ (das Zauberwort unserer Tage) die meisten dieser Sendereihen schlicht eingestampft worden. Sie existieren nicht mehr. Mit der Begründung: Der heutige Hörer könne sich nicht mehr 30 oder gar 60 Minuten lang am Stück konzentrieren. Man füllte inzwischen die Sendeplätze mit Musik, Interviews und Diskussionsrunden, die einen häufig seltsam ratlos und unzufrieden zurücklassen. Diktum eines Programmchefs für den Bereich Kultur, der aus der Nachrichtenredaktion aufgestiegen war: „Was ich zu sagen habe, kann ich auch in 3 Minuten sagen!“ Ja, er vielleicht. Aber es gibt Zusammenhänge in der Kultur, die bedürfen etwas mehr Raums. Auch der Buchmarkt ist in den letzten Jahrzehnten immer schwieriger geworden: Ich kenne eine ganze Reihe älterer Kollegen, Damen und Herren von inzwischen 65 bis 85 Jahren. Die fingen meist irgendwann in den 1950er oder 1960er Jahren zu publizieren an. Es sind übrigens auch Namen von "Rang“ darunter. Ich will im folgenden jedoch aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine Namen nennen. Diese Autoren haben Hörspiele, Romane, Erzählungen, Lyrik geschrieben. Sie wurden auch mit dem einen oder anderen Preis bedacht. Zudem arbeiteten viele in den 1960er bis 1980er Jahren als Zeitungs- oder Rundfunkredakteure, in einer Zeit, als Feuilleton und Kulturredaktionen noch in Ansehen bei den Herausgebern und Programmchefs standen und noch ein Hauch konservativ-bürgerlicher Tradition die Redaktionen durchwehte. Ironischerweise verdiente gerade die Generation der 68er ihr Brot in solch „bürgerlichen“ Institutionen. Sie beziehen heute nicht unerhebliche Pensionen, während ihre Einnahmen aus freiberuflicher Tätigkeit gegen Null tendieren. 14 Diese Autoren haben also in den 1950er bis 1980er Jahren publiziert. Bücher, die damals nicht als Bestseller galten, weil sie zu „anspruchsvoll“, zu intellektuell waren. Dennoch Bücher, die nicht selten Startauflagen von 20 bis 30-Tausend Exemplaren hatten. Das war damals üblich. Nach ein paar Jahren kam dann die Zweitverwertung als Taschenbuch, meist mit ebenso vielen verkauften Exemplaren. Diese Zeiten sind passé. Der Buchmarkt ist überfüllt. Jährlich 80 Tausend Neuerscheinungen in Deutschland wer soll das lesen? Rechnen Sie es mir nicht als Xenophobie an, wenn ich sage (und etliche deutsche Schriftstellerkollegen äußern sich ebenso), dass die Lage für deutsche Autoren auf dem Buchmarkt heute so schwer ist wie noch nie. Ausländische Literatur, vor allem aus dem angelsächsischen Raum, wird heute mehr denn je in Lizenz in Deutschland publiziert (die Übersetzer werden übrigens genauso miserabel honoriert wie die deutschen Autoren), in der Belletristik derzeit etwa 22 %. Häufig werden diese Lizenzen zu überhöhten Preisen verkauft und eingekauft. Das größte Geschäft auf dem Buchmarkt wird nicht in Leipzig gemacht (es gilt eher als Schmuckstückchen, das man sich leistet, als hübsches Schaufenster, keinesfalls aber als ein Geschäft, wie mir ein Insider aus der Agentenbranche versicherte). Das Geschäft wird auf den Buchmessen in Frankfurt, vor allem aber im Ausland getätigt, in London, New York und Chicago. Man schielt nach Bestsellern und fabriziert Bestseller. Bestseller werden selten von Autoren geschrieben, sondern von Marketingstrategen mit viel Geld gemacht. Das heißt, im Normalfall entscheidet die Höhe des Werbeetats über das Gelingen eines Buches. Es gab freilich Fälle, in denen ging das Konzept nicht auf: Die Lizenz war zu teuer eingekauft, der Werbefeldzug misslang, und so havarierten schon ganze Verlage, bisweilen Traditionsunternehmen, durch den Misserfolg eines intendierten und inszenierten „Bestsellers“. Die heutige gewöhnliche Erstauflage für ein Buch (wenn es nicht dem Sex-andcrime-Genre des historischen Romans oder des Krimis oder einer Mischform aus beidem entspringt), die heute gewöhnliche Erstauflage für ein erfolgreiches Buch also liegt bei etwa 3.000 Exemplaren. Das ist aber schon viel! Viele Bücher schaffen es nicht über die Tausender-Marke! 15 Das heißt im Klartext: Heute muss ein „freier Autor“ etwa zehn erfolgreiche! Bücher schreiben, um auf eine Auflage zu kommen, wie sie ein Kollege vor 30 Jahren noch mit einem einzigen Buch hingelegt hat. Entsprechend ist auch nur noch ein Zehntel dessen zu verdienen, wie noch vor 30 Jahren! Es gibt heute kaum noch „Verlagsheimaten“. Heute sucht man sich für jedes neue Projekt den geeigneten Verlag, das passende Verlagsprogramm. Längere Bindungen sind unüblich, und auch von seiten der Verlage meist unmöglich geworden, werden doch auch in vielen großen Verlagsunternehmen die Verleger und Lektoren schnell verschlissen. Ganze Belegschaften werden oft innerhalb von fünf oder sechs Jahren ausgetauscht. Der bayerische Schriftsteller Herbert Rosendorfer, der vom Glück reden kann, einige Bestseller geschrieben zu haben, äußerte sich einmal kritisch, heutzutage sei die Wahrscheinlichkeit, als Autor einen Verlag zu finden, ebenso hoch wie von einem Meteoriten erschlagen zu werden. Stellen Sie sich mal aufs freie Feld und warten Sie auf den nächsten Meteoriten! Darüber können Sie ins Gras beißen! Das liegt nicht unbedingt an den Verlegern. Es liegt an den Umständen. Denn „die Verhältnisse, sie sind nicht so“, wie Brecht bereits schrieb. Ich kenne genügend engagierte Verleger und Lektoren voller Ideale. Aber sie sind selten "frei“. Es gibt kaum noch die eigenständigen Verlegerpersönlichkeiten, wie noch zu Samuel Fischers oder Ernst Rowohlts Zeiten. Viele Verlage gehören zu Großunternehmen, zum Teil als schönes Aushängeschild. Unternehmen, die eigentlich mit anderen Produkten groß geworden sind: Immobilienspekulationen, und anderes. Aus diesen Branchen heraus ist auch die Gewinnerwartung auf die Verlage ausgeweitet worden. Damit wir uns recht verstehen: Verlage sind nun einmal gewinnorientierte Unternehmen. Auch ein Samuel Fischer musste schwarze Zahlen schreiben, um bestehen zu können. Aber die Gewinnmargen waren früher gemeinhin niedriger als heute. Es gab Gewinne, aber keine Gewinnmaximierung. Autoren bekamen zu Samuel Fischers Zeiten gewöhnlich 20 bis 25 % Honorar vom Nettoverkaufspreis eines Buches. Heute sind 10 % für ein Hardcover schon ein gutes Angebot. Im Taschenbuch sind 5 % üblich. Kürzlich bot mir ein bekannter und großer Verlag 7 % für ein neues Projekt im Hardcover, ich lehnte ab, auf die Gefahr hin, dass ich das Buch bei keinem anderen Verlag unterbringe. „Lieber den Spatz in der 16 Hand als die Taube auf dem Dach“, so denken immer mehr Autoren, und so müssen sie denken. Und es gab früher die sogenannte „Mischkalkulation“: Es wurden Programme gestaltet, Programmlinien verfolgt, die ein eigenes, unverwechselbares Profil zeigten. Mit meist wenigen Bestsellern wurden die Bücher mitfinanziert, die man als Verleger eigentlich machen wollte. Heute muss sich jedes Buch selbst tragen. Tut es das nicht, fällt es oft nach bereits 2 Jahren aus dem Verlagsprogramm und wird verramscht, sofern die Modernen Antiquariate es überhaupt wollen. Ein großer deutscher Taschenbuchverlag hat in den letzten drei Jahren die Anzahl seiner Titel in der Backlist um ca. 40 % verringert. Ein anderer namhafter deutscher Verlag liefert übrigens seine Makulaturen und Verramschungen nicht mehr ans Moderne Antiquariat, sondern an einen Baustoffhersteller. Bücher werden dort geschreddert, gepresst und zu Dämmstoffen neu verwertet. Das bringt allemal mehr Geld ein als der Verkauf im Modernen Antiquariat und richtet in den Köpfen wohl auch weniger Schaden an. Etwas skurrile, eigenwillige, unangepasste Autoren, die noch dazu nicht eben „produktiv“ in der Masse ihres Geschriebenen waren, wie etwa Annette Kolb oder Wolfgang Koeppen, hätten heute keinerlei Chance mehr auf dem Markt! Von den bereits erwähnten älteren Autorenkollegen meines Bekanntenkreises hat übrigens ein großer Teil seit 15 oder gar 20 Jahren nichts mehr veröffentlicht. Zum Teil sind diese Leute „ausgebrannt“, aber nur zum Teil. Ich weiß von einigen, die konstant und tapfer (ich sage bewusst: tapfer) weiterproduzieren, all die Jahre hindurch, aber seit 15 oder 20 Jahren keinen Verlag mehr finden, der ihre Bücher publiziert. Autoren, die vor noch 30 Jahren mit Preisen dotiert wurden. Einer meiner Freunde auch seinen Namen nenne ich nicht hat noch in den 1980 Jahren in ehrenwerten Verlagen publiziert Romane, Erzählungen, Gedichte. Er gehörte nie zu den "Großen" des Literaturbetriebs, aber zu den Geachteten. Zudem organisierte er über Jahrzehnte für Hunderte von Autoren Lesungen eines öffentlichen Bildungsträgers und verfügt daher sollte man meinen über erstklassige Kontakte. Dieser Mann ist inzwischen 70 Jahre alt, noch sehr agil, hat das Aussehen eines 55jährigen, ist literarisch immer noch produktiv, und macht sich seit neuestem endlich wieder einmal Hoffnung auf die Publikation eines Erzählbandes. Allerdings hat er 17 bislang nur eine vage mündliche Zusage einer Verlegerin. Dieser Mann ist Allergiker, fährt, so oft es geht, an die Ostsee, da ihn dort das Asthma weniger plagt, haust dort mit seinen 70 Jahren in Jugendherbergen, weil er sich nichts anderes leisten kann, lebt von der „Stütze“, obwohl er ein Lebtag gearbeitet, ja, hart gearbeitet hat, und stopft sich des Morgens in der Jugendherberge heimlich die Taschen seiner Jacke mit abgepackter Butter und Marmelade voll, weil er so wenig Geld hat, dass er nach Möglichkeit mit diesem „Überschuss“ des Frühstücks den ganzen Tag auskommen will und muss! Die Auflagenzahlen sind also stark gefallen, zudem hat sich die Medienlandschaft verändert. Das Internet, bei all seinen Segnungen, hat vieles in der Auseinandersetzung mit Literatur verschoben. Der Trend geht hin zur schnellen Information. Das Buch als „Kulturgut“ gestatten Sie mir dieses altmodische Wort! wird zunehmend verdrängt. Ich habe erfolgreiche Manager kennengelernt, die ihre literarische und kulturelle Unbildung nicht nur nicht verheimlichten, sondern sie sogar laut priesen: Zum Zeichen, dass man sich mit solchem „Ballast“ gar nicht erst zu beschweren braucht, und dennoch „erfolgreich“ sein kann. Damit sind wir auch bei der möglichen Rolle von Schriftstellern in der Gesellschaft, oder, um zum Motto dieser ganzen Veranstaltungsreihe zu kommen: bei der Rolle „von Germanisten in der Gesellschaft“. Denn nach wie vor ist es so, dass viele, wohl die Mehrheit der „freien Autoren“, ein geisteswissenschaftliches, meist ein germanistisches Studium hinter sich haben, die einen ohne Abschluss, die meisten wohl mit dem Magisterabschluss, etliche darunter ich mit dem Doktortitel. Der hat mir übrigens ganz konkret ein einziges Mal im Leben geholfen: als ich vor ein paar Jahren innerhalb Berlins umzog, musste ich der Hausverwaltung eine Verdienstbescheinigung vorlegen. Ich kramte also die Honorarnachweise der vergangenen Monate zusammen und befand, dass das allein wenig überzeugend für den Vermieter sein müsse. Zur Fälschung von Dokumenten war ich nicht aufgelegt, und so ging ich etwas klopfenden Herzens zum vereinbarten Termin in der Hausverwaltung, um den Mietvertrag zu unterschreiben. Dor legte ich meine Visitenkarte vor, auf der auch mein Doktorgrad verzeichnet ist. Die Dame in der Verwaltung, zunächst noch berlinerisch-schnoddrig, wurde plötzlich ganz zuvorkommend und höflich, und fragte nicht weiter nach einer 18 Verdienstbescheinigung, sondern schob mir den Mietvertrag zur Unterzeichnung zu. Hiermit statte ich meiner Alma Mater noch einen verspäteten Dank ab! Welche Rolle also haben Autoren heute in der Gesellschaft? Ich muss gestehen, keine große, und sie genießen auch keinen großen Ruf. Die Inszenierungen im Fernsehen, bei denen selbsternannte Kritiker ihre privaten Leseeindrücke verkünden und überaltete Großkritiker noch wie Ikonen ins Studio geschoben werden, damit man auch von ihren Lippen Ewiggültiges erfährt, solche Sendungen vermitteln ein falsches Bild. Gepriesen werden die wenigen, denen der Zufall und das Glück des richtigen Griffs in die literarische Kiste zu einem schnellen aber meist auch sehr schnell wieder verblassenden Ruhm verhilft. Der „Hype“ des „Fräuleinwunders“ der späten 1990er Jahre, in der eine Spaßgesellschaft ihre zeitgenössischen Mythen und Heroen schuf, ist längst verebbt. Von den damaligen Wundern und „großen Hoffnungsträgern“ übrigens waren es ja nicht nur Fräulein, sondern auch Designerklamotten tragende Jünglinge , von diesen Hoffnungsträgern kennt man heute meist nicht einmal mehr den Namen. Ein Jüngling von damals 16 Jahren, dessen Vater Chefredakteur bei einem der führenden deutschen Nachrichtenmagazine ist, und der (der Jüngling) seine pubertären Sorgen und Ergüsse vorlegte, was dann als Roman verkauft, gut verkauft wurde, und weswegen er von einem Großkritiker ebenbürtig neben Hugo von Hofmannsthal gestellt wurde, von diesem Jüngling, der heute auch keiner mehr ist, ist heute schon längst nichts mehr bekannt. Das große Heer der freien Autoren, die weiß Gott keine schlechte Literatur publizieren, bleibt vom Bannstrahl der Großkritiker und den Erleuchtungen des Großfeuilletons unberührt. Vielleicht auch zum Glück. Denn immer wieder wurden und werden auch talentierte Autoren auf dem Schafott des Medienrummels schnell verheizt. Welche Rolle also haben heute Autoren in der Gesellschaft? Emile Zola konnte im späten 19. Jahrhundert mit seiner sozialen Anklage in Romanform, dem Bergarbeiterroman "Germinal“ noch konkret etwas bewirken: Die Verantwortlichen und Mächtigen waren so erschüttert, und endlich darüber informiert, dass man die Arbeitsbedingungen der Bergarbeiter rasch verbesserte. 19 In den 1950er und 1960er Jahren hatten viele deutsche Autoren, vor allem im Umkreis der Gruppe 47 (Einigkeit macht eben doch stark!) auch eine bedeutsame Rolle: auch durch ihre Schlüsselpositionen in den Feuilletons, Redaktionen und Verlagen. Heute haben Manager aus dem Wirtschaftsleben diese Positionen häufig (nicht immer!) übernommen. Das Internet hat die schnelle Information übernommen. Die globalen Probleme sind so vielfältig und verworren, dass der einzelne Intellektuelle, zu dem ich den Autor zähle, nur noch selten ein klares und entscheidendes Wort finden kann. Ich muss gestehen, dass ich den Autor heute nicht mehr in einer für die Gesellschaft tragenden Rolle definieren kann. Anderes zu behaupten, hieße, mir selbst falsche Hoffnungen zu machen. Ein Hinweis für die jungen Menschen, die vielleicht Schriftsteller werden wollen, etwa wie der junge Student, dessen E-Mail ich eingangs zitierte: Schriftsteller kann man nicht werden im Sinne der Absolvierung einer Ausbildung. Es gibt haufenweise Handbücher mit Titeln wie „Erfolgreich Schriftsteller sein“, es gibt private Akademien, wo man für viel Geld diesen Beruf angeblich erlernen kann. „Creative writing“ heißt das, der Glaube daran kam als eigener Wirtschaftssektor aus Amerika. Es gibt das Literaturinstitut in Leipzig, wo man von erfahrenen Autoren unterrichtet wird. Übrigens sind die Meinungen hierüber höchst unterschiedlich. Eine sehr bekannte Autorin, die vor einigen Jahren dort creative writing unterrichtete, gestand mir, sie würde sich so etwas nie wieder antun und sei von der Sache nicht überzeugt. Hier ist folgendes zu sagen: Die Autoren dieser Handbücher sind nicht die, die selbst als Autoren den großen Erfolg hatten. Die privaten Akademien schmieren einem Honig ums Maul, solange man die teuren Gebühren zahlt ich weiß das aus Erzählungen einer Bekannten. Das Literaturinstitut in Leipzig kann eine sinnvolle Einrichtung sein, es kann dem Knüpfen von Kontakten dienen, kann aber auch nicht Talent produzieren. Talent ist da oder nicht da. Zudem spielt bei der Durchsetzung als freier Autor der Fleiß eine nicht unbeachtliche Rolle. Ein Freund – ich nenne seinen Namen nicht – hat in Leipzig studiert, vor etwa 20 Jahren. Seit 15 Jahren schreibt er an einem Roman über die deutsche Wende von 1989. Er hat Talent, großes Talent, wie die Handvoll 20 Kapitel, die ich aus dem Manuskript kenne, belegt. Aber er hat keine Arbeitsökonomie, nicht genug Fleiß, nicht genug Glauben an sein Projekt. Seit 15 Jahren „doktort“ er an dem Manuskript, ohne es entscheidend voranzubringen. Selbst gesetzt den Fall, er vollendet es dereinst und ein Verlag publiziert es (sofern man sich in 10 oder 15 Jahren noch groß für das Jahr 1989 interessieren wird), selbst dann heißt es ja noch nicht, dass das Buch aufgrund seiner literarischen Qualitäten ein Erfolg werden wird. Der Verlag wird also von seinem Autor möglichst rasch einen zweiten Roman "nachgeschoben“ haben wollen. Möglichst bereits zwei Jahre später. Besagter Freund wird aber wieder zwanzig Jahre benötigen. Und das trotz seines Literaturstudiums in Leipzig. So also nicht. Welche sind die Möglichkeiten für Autoren zu publizieren? Das klassische „Buch" allein trägt nicht. Ich habe das bei der Darstellung meines eigenen beruflichen Daseins bereits skizziert. Es ist zu vermuten, dass auch mit dem weiterhin anhaltenden Siegeszug der neuen Medien das Buch weiterhin an Rang als Informations- und Kommunikationsmittel in unserer Gesellschaft verlieren wird. Die öffentlich-rechtlichen Sender von Hörfunk und Fernsehen haben ihre Formate stark reduziert, auch die privaten Sender sind an ein Limit gestoßen und boten überdies noch nie zureichend zufriedenstellende Arbeitsangebote für Autoren. Das Ghostwriting scheint mir nach wie vor ein nicht zu verachtendes Segment zu sein. Darüber kann man zunächst lächeln. Doch hat gerade in den letzten Jahren der merkantile Erfolg von Memoirenliteratur, die von „Stars“ vorgelegt wurden, die wohl kaum des Schreibens und Lesens fähig sind, gezeigt, dass dies eine Möglichkeit für freie Autoren sein kann, ihr Brot zu verdienen. Sofern dies nicht die ausschließliche Betätigung wird, mag es hingehen. Freilich ist nicht jeder charakterlich so „wendig“ und mancher fühlt sich auf längere Sicht durch das Ghostwriting doch frustriert und in seinem Ethos verraten. Geld wird damit in jedem Fall gemacht. Viel Geld. In meinem Bekanntenkreis gibt es einen Jungunternehmer, der eine Agentur gegründet hat, die Bücher von Stars und Wirtschaftsbossen „vermittelt“. Dafür schreiben er und seine Famuli die Buchtexte die Auftraggeber bezahlen. Und zwar keine Peanuts. Für sie sind Bücher keine geistigen Werte, sondern Mittel, das Renommee zu erhöhen und die Publicity zu weiten. Schließlich gibt es noch das weite und kaum abgrenzbare Feld der PR und des Marketings: Presse-, Verlags- und Werbeagenturen jeglicher Couleur und Zuschnitts. 21 Ein Bereich, der um so mehr boomt, als es vielen Anbietern und Produzenten immer schwieriger fällt, sich in der Öffentlichkeit zu Wort zu melden und die Schnittstellen zwischen Produzent und Konsument zu eruieren und zu besetzen, zumal in dem schwer zu durchschauenden Segment der Internetauftritte. Eine Patentlösung freilich habe ich nicht. Hätte ich sie, wäre mir auch leichter. Es liegt auch an jedem einzelnen, die Berufsfelder zu finden und zu bedienen, zu denen er einen persönlichen Zugang hat. Verbiegen soll sich keiner, nur um des Geldes willen. Es käme keine gute Arbeit dabei heraus. Fazit: Der Autor von heute muss flexibler denn je sein. Er muss sich immer neuen Herausforderungen stellen, er muss sich mehrere Standbeine schaffen, er darf nicht nur auf die klassischen Berufsfelder vertrauen, er muss sich mehr denn früher als Unternehmer, als Chef einer 1-Mann-Agentur verstehen, Selbstvermarktung und PR haben auch für ihn an Bedeutung gewonnen. Was aber tut nun der Germanist in diesem schwierigen Berufsfeld des „freien“ Autors? Germanisten schreiben nicht unbedingt die besseren Romane. Es gibt in der deutschen Literaturgeschichte das Genre des „Professorenromans“, etwa das im 19. Jahrhundert so berühmt-berüchtigte „Kampf um Rom“ von Felix Dahn. Professoren sind also nicht die besseren Dichter, auch wenn sie von Literatur mehr zu verstehen wähnen denn der Rest der Menschheit. Auch Kritiker sind nicht die besseren Autoren. Hier könnte ich einige Beispiele aus jüngerer und jüngster Vergangenheit nennen ich erspare es mir und Ihnen. Ich meine, dass das Studium der Germanistik, wenn es kein schnelles Studium auf der Jagd nach Scheinen ist, ein "Scheinstudium“ also, durchaus ein Bildungsfundament für den Beruf des Autors errichten kann. Es kommt ja nicht nur darauf an, mehr oder weniger von Literatur und Literaturgeschichte zu verstehen, sondern auch darauf, mit Bibliotheken, Bibliographien und mit Forschungsliteratur umgehen zu können, geistig wendig und flexibel zu sein, Zusammenhänge erkennen und formulieren zu können, Rückschlüsse ziehen zu können. 22 Nicht verkehrt ist es sicherlich, einen Brotberuf zu erlernen und sich als Quereinsteiger auf dem Buchmarkt zu versuchen. Doch zielt dieser Versuch dann wieder auf den klassischen „Durchbruch“ mit einem einzigen Buch, also auf das klassische Autorenbild. Der Beruf des Autors, wie er heute von den Umständen diktiert wird, verlangt hingegen einen 100-prozentigen Einsatz, kein Autorentum am Rande, im Nebenjob, in den Abend- und Nachtstunden. Der Autor, wie ich ihn verstehe, und wie ich es zu sein versuche, ist im Kernbereich seiner Arbeit jedoch ein Handwerker. Er versucht gute Arbeit zu liefern, in seinem kleinen Ein-Mann-Betrieb. Vielleicht eine Wirtschaftsform, die nicht sehr zeitadäquat ist. Aber es ist „ehrliche“ Arbeit, über die ein gewinnorientierter Nur-WirtschaftsMensch vielleicht lächeln mag. Mag er lächeln. Auch hier kann ich wieder nur aus eigener Erfahrung sprechen: Es ist ein Beruf, der hart ist, mit Rückschlägen verbunden, mit gescheiterten Hoffnungen, aber auch mit dem tiefen, wirklich tiefen Glück, etwas Sinnvolles zu tun: Immer wieder erreichen mich Briefe von Lesern und Hörern, mit Dank, Anregungen, persönlichen Erfahrungen. Menschen, die sich wiederfinden, in dem, was ich anhand eigener literarischer Erfahrung und Vermittlung, eigenen Gedanken, mit Hilfe meiner Sprache an die Öffentlichkeit bringe. Menschen, die sich angesprochen fühlen. Es ist ein Trost für den Autor, der ja meist allein ist: allein in seinem Arbeitszimmer, allein in seinen Gedanken, allein in seinen Sorgen und Ängsten. Deswegen ist und bleibt der Leser, die Leserin das lebensnotwendige Gegenüber. Das schönste Lob für einen Autor ist: „Ihr Buch habe ich mit Freuden gelesen. Ich konnte es gar nicht mehr beiseite legen!“ Hat ein noch so „erfolgreicher“ Wirtschaftsboss jemals solch einen Dank erfahren? *** Armin Strohmeyr, geboren 1966, ist promovierter Germanist und Autor viel beachteter Biographien über Klaus und Erika Mann, Annette Kolb, George Sand, Die Frauen der Brentanos und Sophie von La Roche, sowie der Porträtsammlung »Verlorene Generation« über vergessene Dichter der 1930er Jahre. Herausgeber der Werke Oskar Schürers und Hedwig Lachmanns und mehrerer Lyrikanthologien. Zahlreiche Hörbilder für das Radio. Gedichte und Theaterstücke. Armin Strohmeyr lebt als Autor und Publizist in Berlin. www.armin-strohmeyr.de 23