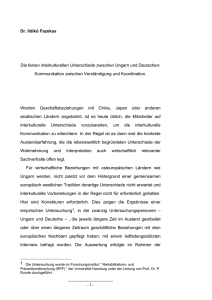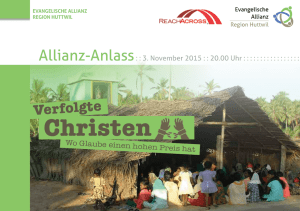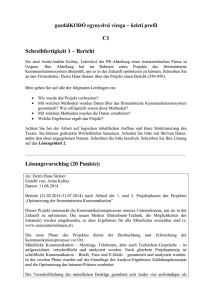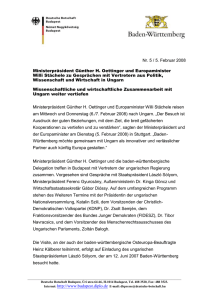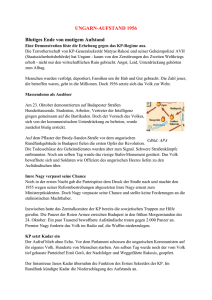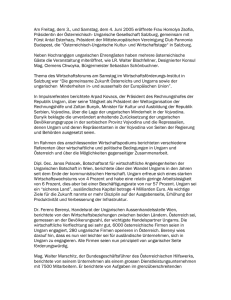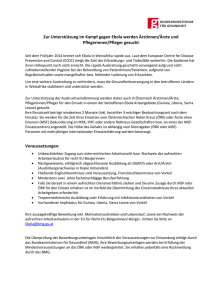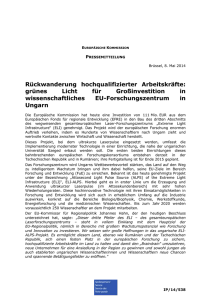Jochen-Christoph Kaiser
Werbung
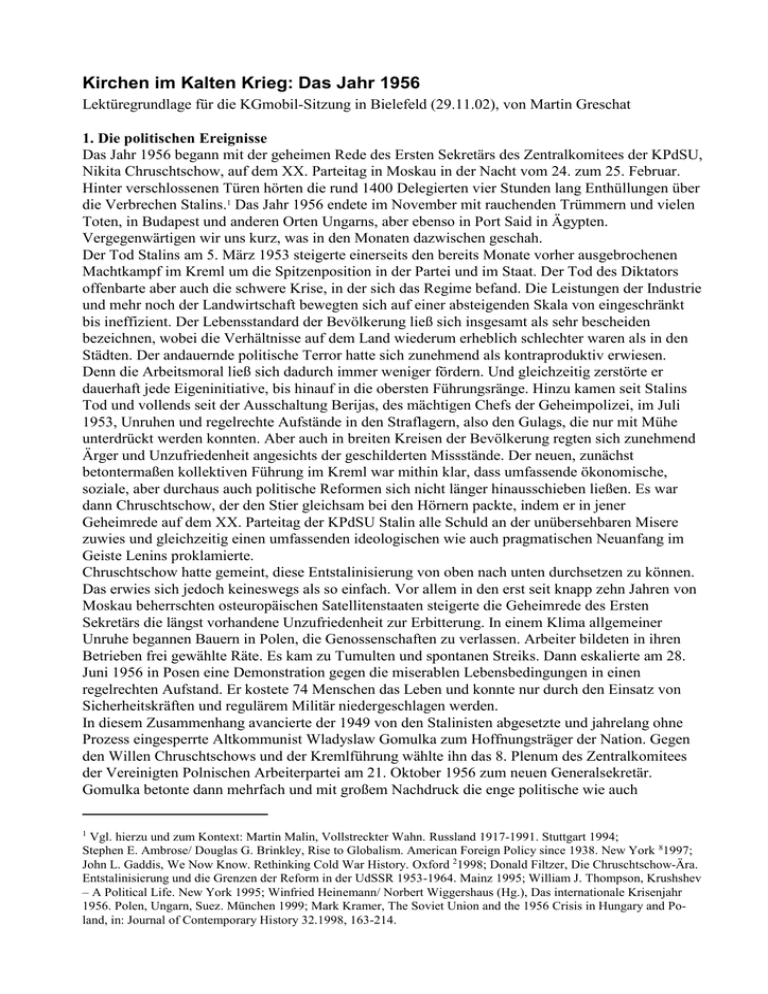
Kirchen im Kalten Krieg: Das Jahr 1956 Lektüregrundlage für die KGmobil-Sitzung in Bielefeld (29.11.02), von Martin Greschat 1. Die politischen Ereignisse Das Jahr 1956 begann mit der geheimen Rede des Ersten Sekretärs des Zentralkomitees der KPdSU, Nikita Chruschtschow, auf dem XX. Parteitag in Moskau in der Nacht vom 24. zum 25. Februar. Hinter verschlossenen Türen hörten die rund 1400 Delegierten vier Stunden lang Enthüllungen über die Verbrechen Stalins.1 Das Jahr 1956 endete im November mit rauchenden Trümmern und vielen Toten, in Budapest und anderen Orten Ungarns, aber ebenso in Port Said in Ägypten. Vergegenwärtigen wir uns kurz, was in den Monaten dazwischen geschah. Der Tod Stalins am 5. März 1953 steigerte einerseits den bereits Monate vorher ausgebrochenen Machtkampf im Kreml um die Spitzenposition in der Partei und im Staat. Der Tod des Diktators offenbarte aber auch die schwere Krise, in der sich das Regime befand. Die Leistungen der Industrie und mehr noch der Landwirtschaft bewegten sich auf einer absteigenden Skala von eingeschränkt bis ineffizient. Der Lebensstandard der Bevölkerung ließ sich insgesamt als sehr bescheiden bezeichnen, wobei die Verhältnisse auf dem Land wiederum erheblich schlechter waren als in den Städten. Der andauernde politische Terror hatte sich zunehmend als kontraproduktiv erwiesen. Denn die Arbeitsmoral ließ sich dadurch immer weniger fördern. Und gleichzeitig zerstörte er dauerhaft jede Eigeninitiative, bis hinauf in die obersten Führungsränge. Hinzu kamen seit Stalins Tod und vollends seit der Ausschaltung Berijas, des mächtigen Chefs der Geheimpolizei, im Juli 1953, Unruhen und regelrechte Aufstände in den Straflagern, also den Gulags, die nur mit Mühe unterdrückt werden konnten. Aber auch in breiten Kreisen der Bevölkerung regten sich zunehmend Ärger und Unzufriedenheit angesichts der geschilderten Missstände. Der neuen, zunächst betontermaßen kollektiven Führung im Kreml war mithin klar, dass umfassende ökonomische, soziale, aber durchaus auch politische Reformen sich nicht länger hinausschieben ließen. Es war dann Chruschtschow, der den Stier gleichsam bei den Hörnern packte, indem er in jener Geheimrede auf dem XX. Parteitag der KPdSU Stalin alle Schuld an der unübersehbaren Misere zuwies und gleichzeitig einen umfassenden ideologischen wie auch pragmatischen Neuanfang im Geiste Lenins proklamierte. Chruschtschow hatte gemeint, diese Entstalinisierung von oben nach unten durchsetzen zu können. Das erwies sich jedoch keineswegs als so einfach. Vor allem in den erst seit knapp zehn Jahren von Moskau beherrschten osteuropäischen Satellitenstaaten steigerte die Geheimrede des Ersten Sekretärs die längst vorhandene Unzufriedenheit zur Erbitterung. In einem Klima allgemeiner Unruhe begannen Bauern in Polen, die Genossenschaften zu verlassen. Arbeiter bildeten in ihren Betrieben frei gewählte Räte. Es kam zu Tumulten und spontanen Streiks. Dann eskalierte am 28. Juni 1956 in Posen eine Demonstration gegen die miserablen Lebensbedingungen in einen regelrechten Aufstand. Er kostete 74 Menschen das Leben und konnte nur durch den Einsatz von Sicherheitskräften und regulärem Militär niedergeschlagen werden. In diesem Zusammenhang avancierte der 1949 von den Stalinisten abgesetzte und jahrelang ohne Prozess eingesperrte Altkommunist Wladyslaw Gomulka zum Hoffnungsträger der Nation. Gegen den Willen Chruschtschows und der Kremlführung wählte ihn das 8. Plenum des Zentralkomitees der Vereinigten Polnischen Arbeiterpartei am 21. Oktober 1956 zum neuen Generalsekretär. Gomulka betonte dann mehrfach und mit großem Nachdruck die enge politische wie auch 1 Vgl. hierzu und zum Kontext: Martin Malin, Vollstreckter Wahn. Russland 1917-1991. Stuttgart 1994; Stephen E. Ambrose/ Douglas G. Brinkley, Rise to Globalism. American Foreign Policy since 1938. New York 81997; John L. Gaddis, We Now Know. Rethinking Cold War History. Oxford 21998; Donald Filtzer, Die Chruschtschow-Ära. Entstalinisierung und die Grenzen der Reform in der UdSSR 1953-1964. Mainz 1995; William J. Thompson, Krushshev – A Political Life. New York 1995; Winfried Heinemann/ Norbert Wiggershaus (Hg.), Das internationale Krisenjahr 1956. Polen, Ungarn, Suez. München 1999; Mark Kramer, The Soviet Union and the 1956 Crisis in Hungary and Poland, in: Journal of Contemporary History 32.1998, 163-214. Seite 2 militärische Verbundenheit Polens mit der Sowjetunion. Gleichzeitig forderte er die Bevölkerung auf, die Massendemonstrationen zugunsten seiner Persönlichkeit und seines Kurses des eigenen polnischen Weges zum Sozialismus zu beenden und die Arbeit wieder aufzunehmen. Es waren insbesondere die Vorgänge in Ungarn, die Chruschtschow bestimmten, diese Entwicklung ebenso wie die Entmachtung stalinistischer Funktionäre hinzunehmen. Mindestens so viel Unzufriedenheit, Verärgerung und Wut wie in Polen hatten sich seit Jahren in Ungarn angestaut. Vor allem die terroristische Willkürherrschaft vom Mátyás Rákosi, an dem Moskau beharrlich festhielt, empörte wachsende Kreise der Bevölkerung. Das Bekanntwerden der Geheimrede Chruschtschows gab dann der oppositionellen Stimmung mächtigen Auftrieb. Und das war erst recht der Fall, als man Einzelheiten über die Vorgänge in Polen erfuhr. In dieser Atmosphäre weitete sich eine Sympathiekundgebung für das Nachbarland in Budapest am 23. Oktober am Denkmal des polnischen Generals Bem schnell zu einer Massendemonstration gegen die Herrschenden aus. Als diese mit Gewehrsalven und Maschinengewehren antworteten, mündeten die Proteste im bewaffneten Aufstand. Eine „chaotische Rebellion“ ohne Führung war die Folge. Denn der neue Ministerpräsident, der Altkommunist Imre Nagy, konnte in dieser aufgeheizten Atmosphäre, die inzwischen das ganze Land erfasst hatte, keine klare politische Linie verfolgen – zumal er, anders als Gomulka, weder in der Partei noch in der Armee einen echten Rückhalt besaß. Nach einigem Zögern schloss sich Nagy der Revolution an. Am 28. Oktober erklärte er, seine Regierung sei bereit, einige Forderungen der Aufständischen zu erfüllen. Doch solche Zugeständnisse kamen jetzt eindeutig zu spät. Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung verlangte nun freie Wahlen, den Abzug der sowjetischen Truppen, den Austritt des Landes aus dem Warschauer Pakt, also dem östlichen Verteidigungsbündnis, sowie die Neutralität Ungarns. Am 1. November machte sich Nagy diese Forderungen zu eigen. Damit war sein Schicksal besiegelt. Denn selbst diejenigen Politiker in Moskau, die dem ungarischen Ministerpräsidenten die Chance geben wollten, den Aufruhr selbst in den Griff zu bekommen, votierten nun für das militärische Eingreifen. Am 4. November begann der Kampf, begleitet von der Proklamation einer neuen ungarischen Regierung unter Kadar. Am 6. November war der Aufstand trotz verzweifelter Gegenwehr niedergeschlagen. Dieser letzte Akt der ungarischen Tragödie wurde von dem militärischen Abenteuer Frankreichs und Großbritanniens in Ägypten weitgehend überlagert. Mit der Revolution in Ungarn hatte dieser Angriff zunächst nichts zu tun. Die beiden europäischen Mächte wollten ihre Kolonialherrschaft im Vorderen Orient sichern und wandten sich deshalb, zusammen mit Israel, gegen Nasser, der den Suez-Kanal verstaatlicht hatte. Am 29. Oktober griff Israel Ägypten auf dem Sinai an. Am 5. November eroberten die Briten Port Said. Aber inzwischen war aus dem regionalen Konflikt eine bedrohliche weltpolitische Krise geworden. Denn die Sowjetunion betrachtete sowohl Syrien als auch Ägypten als Verbündete. Deshalb droht Chruschtschow, London und Paris mit Atomraketen zu attackieren. Im Westen wusste man, dass der UdSSR dazu die technischen Voraussetzungen fehlten. Trotzdem nutzten die USA die durch Chruschtschows Drohung im Westen ausgelöste Beunruhigung, um die eigene Rüstung zu intensivieren. Echte Sorgen bereitete den Amerikanern jedoch der Gedanke einer militärischen Ausweitung des Konflikts in den Raum des Nahen Ostens. Dieses Ausgreifen der UdSSR zu verhindern, erschien deshalb sehr viel wesentlicher, als die Beschäftigung mit dem Aufstand der ungarischen Bevölkerung. Denn die laut verkündete Devise des „roll back“ des Kommunismus in Mittel- und Osteuropa mit Einschluss eines militärischen Eingreifens auch jenseits des Eisernen Vorhangs, bestimmte längst nicht mehr die amerikanische Politik. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt kam hinzu. Sowohl in der Sowjetunion als auch in den USA hatte sich in dieser Zeit die Überzeugung durchgesetzt, dass die entscheidenden Auseinandersetzungen im Kalten Krieg sich nicht länger in Europa, sondern in den Ländern der „Dritten Welt“ abspielen würden. Die Grenzen in Europa schienen fixiert und regelrecht betoniert. In Asien und Afrika dagegen bestand aufgrund des unübersehbar voranschreitenden Prozesses der Seite 3 Auflösung der Kolonialherrschaft der Europäer ein ideologisches und politisches Vakuum, das jede der beiden Supermächte im eigenen Sinn zu füllen versuchte. Deshalb war die Konferenz in Bandung in Indonesien, wo sich 1955 Delegierte aus 29 afroasiatischen Staaten versammelt hatten, um gegen Kolonialismus, Rassendiskriminierung und die Atomwaffen zu protestieren, für die große Politik sowohl der USA als auch der UdSSR erheblich belangreicher als die Revolution in Ungarn. Am Ende des Jahres 1956 wusste im Westen ebenso wie im Osten jeder, der nüchtern dachte oder sich durch das Erlebte hatte ernüchtern lassen, „dass entgegen jeder gegenteilig lautenden Propaganda das System der östlichen und westlichen Interessensphären (System von Jalta), das auf der gegenseitigen Anerkennung des europäischen Status quo von 1945 beruhte, existierte, funktionierte und als besonderer Automatismus das Schicksal der Region Osteuropas bestimmte“.2 Die Sowjetunion hatte ihren Herrschaftsbereich im Verlauf des Jahres 1956 erfolgreich verteidigt. Sicherlich war die begrenzte Zustimmung beträchtlicher Teile der Bevölkerung deutlich zutage getreten. Daraus folgte, dass die alten autoritären Politiker – wie z.B. Ulbricht in der DDR, Gheorghiu-Dej in Rumänien, Zhinkow in Bulgarien oder Novotny in der Tschechoslowakei – weiterhin die stärksten Stützen der sowjetischen Herrschaft bildeten, allen Entstalinisierungsparolen zum Trotz. Die USA hatten zur Kenntnis nehmen müssen, dass ihre enorme wirtschaftliche und militärische Macht sich nicht direkt in politischen Einfluss umsetzen ließ. Sie mussten also gegen ihre Überzeugung und gegen die lauthals erklärte Absicht, den Kommunismus zurückzuwerfen, hinnehmen, was in Ungarn geschah. Das führte zu einem politischen Paradigmenwechsel: An die Stelle der direkten Konfrontation mit dem Osten trat jetzt im Westen zunehmend das langfristig angelegte Bestreben, die reformistischen und emanzipatorischen Veränderungen innerhalb der Volksdemokratien nach Kräften zu unterstützen. 2. Kirchliche Reaktionen Was bedeuteten diese Ereignisse für die Kirchen im Osten und Westen Europas? Ich beschränke mich hier im wesentlichen auf den Protestantismus. In Polen – um damit zu beginnen – verfolgte die kleine Minderheit der Protestanten die Entwicklung mit großer Sorge. Denn die Übereinkunft zwischen Gomulka und dem polnischen Primas, Kardinal Wyszynski, zum Wohl des Landes zu kooperieren, gab der alten Angst mächtigen Auftrieb, erneut macht- und hilflos der geschlossenen Front des mit der katholischen Kirche verbündeten Staates gegenüberzustehen.3 Angesichts dieser Realität sahen die protestantischen Kirchenführer ihre Belange vor allem durch eine möglichst enge und loyale Anlehnung an den Staat gesichert. Dabei leitete sie zugleich die Hoffnung, dass sich diese Einstellung auch deshalb auszahlen müsse, weil der Pakt des kommunistischen Staates mit der katholischen Kirche aufgrund seiner inneren Widersprüche nicht allzu lange bestehen könnte. In Ungarn gehörte etwa ein Drittel der Bevölkerung zur evangelischen Kirche. Neben einer lutherischen Minderheit stand die reformierte Mehrheit. Der Einfluss dieses Protestantismus auf das religiöse und vor allem geistige Leben Ungarns war jedoch traditionell beträchtlich höher, als die statistischen Daten vermuten lassen. Das lag nicht zuletzt an dem vorzüglichen Schulwesen, das die evangelischen Kirchengemeinden seit Jahrhunderten aufgebaut, geführt und finanziert hatten. Diese Schulen enteignete der Staat 1948 zusammen mit dem kirchlichen Grundbesitz. Politischer Druck, neue kirchenleitende Persönlichkeiten sowie eine spezifische Theologie des Dienstes bzw. der Diakonie bewirkten zusammen die völlige Unterstellung der Kirchen unter das kommunistische Regime. Eine Fülle von Repressalien, begleitet von Verhaftungen und Gefängnisstrafen zermürbten und entmutigten die reformierten ebenso wie die lutherischen Bischöfe. Hochangesehene 2 C. Bekes, Die ungarische Revolution von 1956 und die Großmächte. In: W. Heinemann/ N. Wiggershaus (wie Anm.1), 353-374, Zitat 373. 3 Vgl. dazu u.a. Leonid Luks, Katholizismus und politische Macht im kommunistischen Polen 1945-1989. Weimar 1993. Seite 4 Persönlichkeiten wie Lajos Ordass (lutherisch) und Laszlo Ravac (reformiert) mussten zurücktreten. Sie wurden durch Männer ersetzt, die voll und ganz die Linie des Staates vertraten – wie der Lutheraner Lajos Vetö oder die Reformierten Janos Peter und Albert Bereczky. Letzterer war 1948 nicht zuletzt mit der Unterstützung von Karl Barth zum Bischof gewählt worden. Er spielte auch innerhalb der ökumenischen Bewegung eine nicht unwesentliche Rolle und gehörte zu den hauptsächlichen Vertretern jener diakonischen Theologie, welche die theoretische Unterstützung und praktische Förderung des östlichen Sozialismus als die Hauptaufgabe der Kirche begriff. Gegenteilige Auffassungen wurden systematisch unterdrückt. Bezeichnenderweise konnte der Staat dann bisweilen toleranter agieren als die Kirche, weil diese ihm die Aufgabe der Repression der evangelischen Pfarrer und Gemeinden zuverlässig abgenommen hatte. Die Revolution brachte dann den erneuten Umschwung. Die diskreditierten Bischöfe traten zusammen mit einer Reihe von ebenfalls allzu eng mit dem kommunistischen Regime verbundenen Laienvertretern zurück. Die alten Bischöfe wurden wieder eingesetzt. Emphatisch verkündete Ravasz Anfang November 1956: „Die Reformierte Kirche Ungarns zollt Bewunderung und Anerkennung den Helden der nationalen Erhebung: den Studenten, Arbeitern, Soldaten, Männern und Frauen, die mit der Vergießung ihres Blutes den Sieg unserer moralischen Befreiung erkämpft haben […] Wir erkennen in Bußgesinnung, dass die Kirche als irdische Institution sich noch mehr als sie dazu gezwungen war – von Gewalt und List der zu ihr im tödlichen Gegensatz stehenden politischen Macht – fesseln gelassen hat. So hat sie auch ihre eigenen Aufgaben vernachlässigt.“4 Diese eindeutige Zustimmung zur ungarischen Volkserhebung konnte auch die spätere Mitteilung des Bischofs nichts mehr aus der Welt schaffen, in der es hieß: „Diese Bewegung ist keine politische Bewegung. Wir wollen aber betonen, dass wir den sozialistischen Umbau unseres Landes bejahen und befördern. Wir verwerfen alle Gedanken und Versuche der Restauration.“ Höchst verdächtig musste es für die stalinistischen Machthaber auch klingen, wenn Ravasz in seiner Rede die Ökumene und den Reformierten Weltbund „um brüderliche Hilfe und Beistand“ bat. Auf die Rolle der Ökumene komme ich zurück. Sehr viel differenzierter argumentierte in derselben Zeit Laszlo Pap, der Stellvertreter des Bischofs und Theologieprofessor in Budapest. In einer vertraulichen Stellungnahme unterstrich er später, beträchtliche Vorbehalte gegenüber der Wiedereinsetzung von Ravasz gehabt und auch öffentlich ausgesprochen zu haben.5 Pap fuhr fort: „Auch am 23. Oktober und den folgenden Tagen wusste ich genau, dass der politische Aufstand nicht gelingen kann, denn dazu waren keine Voraussetzungen gegeben. Ich hatte aber meinen Kampf für die Kirche unter allen Umständen durchfechten müssen, denn dieser Kampf war nicht politisch bedingt und durfte auch nicht von der politischen Situation abhängen.“ Ganz in diesem Sinn hatte Pap Anfang November 1956 geschrieben: „Wir wollen glauben, dass in unserer Kirche jetzt dieser Prozeß [des Durchbruchs des Evangeliums, MG] in Gang gekommen ist, und die äußeren Kräfte nur geholfen haben, dasselbe mehr radikal und schneller zu vollziehen, was von innen schon lange im Gang gewesen ist.“ Mit dieser Auffassung stand Pap in seiner Kirche nicht allein. Es mag sein, dass die Vorgänge in Polen zu dieser Sicht der Dinge beigetragen haben – wo die Kommunisten, wie berichtet, die Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche suchten und nicht in deren innere Belange eingriffen. Auch die Tatsache, dass das Regime unter Kadar die neu gewählten Kirchenleitungen bis zum Sommer 1957 gewähren ließ, förderte Illusionen. Doch 1958 war der alte Zustand der kirchlichen Unterdrückung wiederhergestellt. Zusammen mit vielen anderen Theologen und Nichttheologen verloren auch Ravasz, Ordass sowie Pap ihre Stellungen, ihre Bewegungsfreiheit sowie ihr Einkommen.6 4 Diese und die folgenden Zitate stammen aus dem von Lukas Vischer gesammelten Material im Nachlaß Vischer, Archiv des ÖRK, Genf, 994.3.50.1. 5 Schreiben vom 20.2.1960 (wie Anm.4). 6 Vgl. dazu Zoltan Balog/ Gerhard Sauter, Mitarbeiter des Zeitgeistes? Frankfurt a.M. 1997, 25-32. Seite 5 Wie verhielt sich der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) in Genf zu diesen Vorgängen? Im Sommer des Jahres, vom 28. Juli bis zum 5. August 1956, fand in Galyatetö in Ungarn die Konferenz des Zentralkomitees des ÖRK statt, d.h. die jährliche Zusammenkunft dieses etwa 90 Mitglieder umfassenden Leitungsgremiums. Weil es sich hierbei um die erste Tagung im Ostblock handelte, sammelte man in Genf intensiv Informationen über die kirchliche Lage.7 Im März war bekannt, dass es in Ungarn zwar eine kirchliche Opposition gebe, die jedoch kaum in den offiziellen ökumenischen Delegationen vertreten sei. Der Informant empfahl daher, möglichst viele Besuche bei einfachen Gemeindegliedern zu machen, deutsch zu predigen – weil das die Menschen ohne die Einschaltung von Dolmetschern verständen – und insgesamt „nicht viele Worte zu erwarten: Lest die Bedeutung im Händedruck und in den Augen!“ Mitte Juni erhielt Visser `t Hooft vom Generalsekretär des Nationalrates der amerikanischen Kirchen (National Council of Churches, NCC) einen anonymen Text mit dem Titel „Bekennende Kirche in Ungarn im Jahre 1956“. Das Dokument bot eine schonungslose Beschreibung der wirklichen Lage in Ungarn: Die Kirchenleitungen bewegten sich voll und ganz auf der Linie der kommunistischen Politik. Diktatorisch verfuhren sie mit den Pfarrern und Gemeinden. Und da sie allein über Verbindungen zur Ökumene verfügten, informierten sie nicht nur einseitig, sondern immer wieder auch bewusst falsch. Es ist kaum anzunehmen, dass Visser `t Hooft aus diesem Bericht viel Neues erfuhr. Was ihn irritierte, war der Vergleich der kirchlichen Situation in Ungarn mit dem Kirchenkampf in Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus. Hiermit ließ sich, urteilte der Generalsekretär des ÖRK, doch nicht vergleichen, was jetzt in Ungarn vor sich ging. Wo sind denn, fragte er, die bekennenden Gemeinden? „Und was ist das für eine Bekennende Kirche, die ihre Überzeugungen nicht offen bekennt?“ Diese Argumentation belegt einmal mehr, in welchem Ausmaß der deutsche evangelische Kirchenkampf für viele Ökumeniker, keineswegs nur für Visser `t Hooft, das Koordinatensystem für die Beurteilung einzelner Vorgänge im Osten und dementsprechend auch für das Verständnis des Ganzen, was da vor sich ging, bildete. Folgerichtig sah Visser `t Hooft in den kirchlichen Opponenten in Ungarn eine Gruppe neben anderen – denen gegenüber er schließlich auch das Verhalten von Bischof Bereczky entschieden verteidigte. Die Konferenz des Zentralausschusses in Galyatetö verlief dann in einer ausgesprochen freundlichen Atmosphäre. In den Gesprächen mit dem Leiter des Staatlichen Amtes für Kirchliche Angelegenheiten wurden Reisen von Theologen und Kirchenführern ins westliche Ausland genehmigt und sogar die Wiedereinsetzung von Bischof Ordass in Aussicht gestellt. In welchem Ausmaß die allgemeine Unruhe im Land und insbesondere die ungeklärte politische Situation auch in Ungarn im Spätsommer 1956 zu solchem Entgegenkommen beigetragen haben, lässt sich nur vermuten. Aber selbstverständlich handelte es sich bei der Konferenz in Galyatetö und den Gesprächen, die im Umkreis dieser Tagung geführt wurden, nicht um Schachzüge zur Vorbereitung der Revolution. Davon kann schon deshalb keine Rede sein, weil der Aufstand, wie berichtet, völlig spontan ausbrach. Dass eine solche Verbindung überhaupt behauptet werden konnte, lag auch an einer ausgesprochen unglücklichen Formulierung von Visser`t Hooft. Am 1. November teilte er der neuen ungarischen Kirchenleitung seine Freude darüber mit, dass jetzt die Zeit der Bedrückungen der Vergangenheit angehöre. Nun könne ein neuer Weg beschritten werden, bei dessen Bewältigung der ÖRK helfen wolle. Und die Konferenz in Galyatetö habe, fuhr er fort, „erheblich geholfen, diesen neuen Weg vorzubereiten“. Man musste kein misstrauischer Kommunist sein, um aus dieser Formulierung eine Mitwirkung des ÖRK bei der ungarischen Revolution herauszuhören sowie die Zustimmung zu ihr und die Bereitschaft, sie nach Kräften zu unterstützen. Visser ´t Hooft hatte selbstverständlich lediglich an 7 Ich beziehe mich im Folgenden u.a. auf die ungedruckte Studie von Eckhard van Herck, Reaktion des Weltkirchenrates und des schweizerischen Protestantismus auf die Revolution in Ungarn. Bern 1989. Seite 6 humanitäre Hilfeleistungen gedacht. Und sein Hinweis auf Galyatetö bezog sich – wie er dem Leiter des ungarischen Staatsamtes für Kirchenfragen dann ausführlich erläuterte – auf die von Ungarn ebenso wie von der Ökumene erhoffte und erwartete Etablierung einer besseren, nämlich geistlicheren kirchlichen Leitung. Mit Politik und erst recht mit der Revolution hätten diese Überlegungen überhaupt nichts zu tun, beteuerte Visser `t Hooft. Aber seinen kommunistischen Gesprächspartner überzeugte er mit diesen Argumenten natürlich nicht. Dieser blieb vielmehr der festen Überzeugung – wie die politische Führung im Ostblock insgesamt – , dass es sich beim ÖRK um eine Organisation handelte, die im Gewand der Religion eine gegen die sozialistischen Staaten gerichtete Politik betrieb. Andererseits lag der ungarischen Parteiführung wenig daran, die Gegensätze zu verschärfen, schon gar nicht unmittelbar nach dem Volksaufstand. Auf der anderen Seite fehlten Visser `t Hooft und dem ÖRK aufgrund jener ungeschickten Äußerung die Unabhängigkeit, um laut gegen das Vorgehen der UdSSR und der ungarischen Kollaborateure zu protestieren. Die Repräsentanten der Ökumene bemühten sich stattdessen, möglichst aus der Schusslinie zu kommen. Die klarsten Stellungnahmen gegen die Niederwerfung der ungarischen Revolution kamen deshalb auch nicht aus Genf, sondern vom Britischen Ökumenischen Rat sowie vom amerikanischen Nationalrat der Kirchen.8 So entstand bald wieder ein relativ freundliches Verhältnis zwischen dem ÖRK und den ungarischen Kirchenführern – zur Enttäuschung und Verbitterung der Opfer der Revolution. Doch Genf handelte 1958 nicht anders als zehn Jahre zuvor, als man auch nach der Absetzung der früheren Kirchenleitungen mit den neuen Bischöfen auf der Basis der nun einmal gegebenen politischen und kirchlichen Verhältnisse Beziehungen aufgebaut hatte. Die im Ostblock verbreitete offizielle Lesart für die Ereignisse lautete: Es handelte sich um den vom Westen angezettelten und massiv unterstützten Versuch reaktionärer und faschistischer Kräfte, den Sozialismus durch eine Konterrevolution zu vernichten. Dieselbe Interpretation proklamierte der international angesehene tschechische Theologe Josef Hromádka. In seinen primär für die Leser im Westen verfassten „Gedanken über die ungarische Krise“ entfaltete er bereits Anfang Dezember 1956 seine theologische und politische Sicht der Ereignisse.9 Als die Wurzel alles Übels bezeichnete Hromádka den Kalten Krieg, der Misstrauen, Feindseligkeit und Hass zwischen den Staaten befördere. Als eine der vordringlichsten Aufgaben der ökumenischen Beziehungen bezeichnete er deshalb, „alle unsere Kräfte auf die Unterdrückung des Kalten Krieges zu konzentrieren“. Wer wollte dem widersprechen? Doch dann behauptete Hromádka, dass insbesondere die antikommunistische und antisowjetische Haltung im Westen den Kalten Krieg befördere. Und daraus wieder leitete er die Gewissheit ab, dass sämtliche Vorgänge des Jahres 1956, von denen hier die Rede war, von jenen Kräften im Westen gesteuert würden. Auch wenn derzeit, wie er unterstrich, noch niemand die internationalen Zusammenhänge in sämtlichen Einzelheiten zu überblicken vermöge, war für Hromádka das Entscheidende klar: „Es besteht aber kein Zweifel darüber, dass die ungarische Explosion sowie die Suezfrage einen Vorwand für den frontalen, propagatorischen [d.h. zu proklamierenden, MG], aber mehr als nur propagatorischen Angriff auf die Machtstellung des Ostblocks gegeben haben.“ Das war, wie wir gesehen haben, ein krasses historisches Fehlurteil, erwachsen aus der ideologischen Fixierung Hromádkas. Für denjenigen, der diese Position bezog, war jedoch alles klar, Differenzierungen störten nur. Exakt diese Einstellung förderte freilich gerade den Kalten Krieg. Hromádka argumentierte strikt weiter nach seinem Muster. Gewiss waren Fehler gemacht worden, bereits beim Aufbau des Sozialismus in der Sowjetunion, erfahren wir, sicherlich auch in Ungarn. Aber das rechtfertigte niemals die schrecklichen Taten der Gegenrevolution, von denen der 8 Zu den Einzelheiten vgl. Archiv des ÖRK, CCIA, Meetings 1956-1958, 428.1.06. Es ist eine durch nichts begründete Unterstellung, wenn Z. Balog (wie Anm. 6, 32) behauptet, der ÖRK habe bewusst zurückhaltend taktiert, um den Boden für die Aufnahme der Russischen Orthodoxen Kirche in den ÖRK vorzubereiten. 9 In: Die Protestantischen Kirchen in der Tschechoslowakei. Sondernummer vom 8.12.1956, 1-8. Seite 7 tschechische Theologe zutiefst überzeugt war. Bereits vor dem Aufstand seien in Ungarn von den kommunistischen Politikern die Weichen für eine bessere Entwicklung gestellt worden. Aber das passte selbstverständlich nicht in die bösartigen Pläne der feindlichen Kräfte. Mehrfach wiederholte der Prager Professor seine Behauptung: „Das ungarische Land war Zeuge furchtbarer konterrevolutionärer Leidenschaften, Morde und Pogrome, bei denen Tausende und Zehntausende nicht nur von Kommunisten, sondern auch von Juden und andern Bürgern zugrunde gingen.“ Hromádka musste solche Unterstellungen aufbieten, um seiner These wenigstens einen Schein des Rechts zu verleihen: dass nämlich der Einmarsch der sowjetischen Truppen dem ungarischen Volk die Freiheit gebracht habe! Wer unvoreingenommen sei, behauptete Hromádka, müsse „gestehen, dass das Eingreifen der sowjetischen Armee am 4. November 1956 Ungarn nicht nur vor furchtbarem Blutvergießen und Zerfall, sondern auch vor der nationalen chauvinistischen und sozialen Reaktion rettete, die von Ungarn aus den ersten Schritt zu einem weiteren Kriegskonflikt in Mitteleuropa und möglicherweise in Europa überhaupt hätte machen können“. Diese Sicht der Ereignisse in Ungarn galt im Ostblock jahrzehntelang als die allein legitime, auch in den evangelischen Kirchen. Doch sie wurde in ähnlicher Weise von „linken“ Kreisen in Westeuropa übernommen und propagiert. Sicherlich argumentierte man hier in der Regel differenzierter. Aber das Grundmuster war dasselbe: Die sozialistischen Kräfte im Osten, die umfassende Reformen in der Gesellschaft und in der Kirche beförderten, erzielten beträchtliche Erfolge. Doch dann kam der Aufstand, der nicht zufällig schnell rechtsgerichtete, restaurative Gruppen an die Macht brachte. Diese stellten nicht zu erfüllende Forderungen, weil sie das Rad der Geschichte zurückdrehen wollten. Eine solche Einstellung lässt sich exemplarisch an der Lagebeurteilung von Pfarrer Hellstern, dem Leiter des Schweizer Evangelischen Hilfswerks, vom 16. November 1956 verdeutlichen.10 Nachdem er tief beeindruckt von den Erleichterungen berichtet hatte, welche den ungarischen Kirchen im Verlauf des Jahres 1956 zugestanden worden waren, beurteilte er die Revolution nicht nur als Abbruch dieser positiven Entwicklung, sondern als die Machtergreifung der Restauration in der Kirche. Dabei erschreckte den Repräsentanten des Schweizer Hilfswerks insbesondere die Mitteilung, „dass die evangelische Kirche gewaltige Mittel brauchen würde, um das gesamte Schulwesen, alle Spitäler und Anstalten auf kirchlicher Basis neu einzurichten“. Und diese Mittel solle die Ökumene bereitstellen! Es ist kaum von ausschlaggebender Bedeutung, ob diese Forderung von den Ungarn erhoben wurde. Fraglos spielten in der ungarischen Revolution auch konservative und sogar restaurative Persönlichkeiten und Tendenzen eine Rolle. Aber eben so unübersehbar ist doch auch, dass sich weder die politische noch die kirchliche Realität jener Wochen in Ungarn mit dieser wiederholten Charakterisierung erfassen lässt. Sympathisanten oder Parteigänger eines wie immer gearteten Sozialismus lebten allerdings auch im Westen in der Überzeugung, dass nur auf diesem Wege eine humane, bessere Gesellschaft geschaffen werden könnte, allen Rückschlägen, Verbiegungen und Verlusten zum Trotz. Und das bedeutete umgekehrt, dass der Widerspruch oder Widerstand gegen jene Vision gleichbedeutend sein musste mit Restauration und Reaktion. Ob man in diesem Umfeld die Worte jenes ungarischen Professors verstanden hätte, der am 2. Januar 1957 an einen Freund im Westen schrieb: „Ein unaussprechlicher Drang nach Wahrheit ist in unsrem Volk aufgebrochen nach der Erfahrung, dass ein lügenhaftes Leben zwecklos und auf die Dauer unaushaltbar ist. Lieber sterben als in Lügen leben: das war die unausgesprochene Maxime der Handlungen. Und die Wahrheit macht frei: frei von Todesfurcht und frei von Menschenfurcht. Das ist der Sinn, der hinter den Ereignissen der letzten Monate steckt“! Was bedeuteten die Vorgänge des Jahres 1956 im Osten und insbesondere in Ungarn für die Menschen, die sie direkt oder indirekt miterlebten, diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs? Welche Auswirkungen hatten diese Ereignisse auf die Kirchenleitungen und Gemeinden, auf 10 Vgl. Anm. 4. Seite 8 einzelne Christen oder auch die Intelligenz? Wenn ich recht sehe, förderten jene Vorgänge im Westen, zumal in kirchlichen Kreisen, zunächst einmal den hier ohnehin verbreiteten Antikommunismus. Im Osten dagegen überwogen, denke ich, Resignation und Hoffnungslosigkeit. Das Lebensgefühl vieler ließ sich wohl so umschreiben: Wir sitzen in der Falle, ausweglos. Wuchs dabei der Antikommunismus? Wuchs überhaupt etwas? Möglicherweise eine andere Kraft? Ihre Berichte und Informationen dazu sind enorm wichtig. Wir wissen faktisch kaum etwas darüber, wie Menschen, wie Christen z.B. in den baltischen Ländern und nun insbesondere hier in Estland, mit dem umgegangen sind, was die große Politik ihnen zumutete. Was bedeuteten also diese Ereignisse für die Kirchen in diesem Land, für die evangelischen Kirchenführer, für einzelne Christen, Gemeinden, Professoren, Studenten und die protestantische Intelligenz insgesamt? Für jeden Hinweis bin ich dankbar. 3. Alternativen So verständlich und naheliegend die Haltung der Verweigerung, des Abscheus, der Resignation, der Hoffnungslosigkeit auch ist: Sie ist auf die Dauer keine – und jedenfalls keine christliche Möglichkeit. Wenn antisowjetische Veränderungen innerhalb des Ostblocks chancenlos waren, weil der Westen nicht militärisch eingreifen konnte und wollte, mussten die Gegner der bestehenden Verhältnisse auf den evolutionären Wandel setzen. Präzise formulierte der französische Philosoph und Publizist Raymond Aron 1957 diesen Sachverhalt: „Die Konsequenz ist klar, die man den Mut haben muss, entschieden zu ziehen. Es liegt im gemeinsamen Interesse der gefangenen Völker wie auch des Westens, dass die Opposition gegen den Kommunismus zunächst im Innern des Regimes bleiben muss. Da der Westen weder intervenieren kann noch will, da die Sowjetunion sowohl über die Mittel als auch die Entschlossenheit verfügt, die nötig sind, um Revolutionen zu vernichten, bleibt als einzige Perspektive […] eine Veränderung der kommunistischen Praxis in der Sowjetunion und in den Satellitenstaaten.“11 Diese politische Linie verfolgten dann in der Tat, wie gesagt, die westlichen Mächte nach 1956. Parallel dazu, jedoch aufgrund eigener kirchlicher und theologischer Überzeugungen und Zielsetzungen, wurden gleichzeitig im Osten Modelle entwickelt, wie man sich als einzelner Christ und als Gemeinde weder von der Hoffnungslosigkeit überwältigen noch von der Verweigerung beherrschen lassen müsste. Das erste Leitbild, von dem hier zu berichten ist, stammt nicht zufällig aus der DDR. Die Ereignisse des Jahres 1956 hatten seitens der kommunistischen Machthaber zu einer intensiven Steigerung der Abgrenzung Ostdeutschlands gegenüber der Bundesrepublik geführt. Dazu gehörte neben einer Politik der Nadelstiche gegenüber einzelnen Christen, Gemeinden und Kirchenleitungen die demonstrative Weigerung, mit Vertretern der damals noch sämtliche deutsche Landeskirchen umfassenden Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zu reden. Nach der Lesart der Kommunisten gab es zwei sich prinzipiell feindlich gegenüberstehende deutsche Staaten. Die EKD stehe dabei im Dienst des Westens, des Klassenfeindes, des kriegslüsternen amerikanischen Imperialismus. Versuche verschiedener Kirchenführer, diese Polarisierung durch größtmögliches Entgegenkommen aufzuweichen, fruchteten nichts. Um angesichts dieser schwierigen Verhältnisse Klarheit über die grundsätzlich gebotene Position sowie den weiteren Weg der evangelischen Kirchen in der DDR zu gewinnen, drängten die Delegierten aus diesem Staat darauf, möglichst bald eine gesamtdeutsche Synode der EKD abzuhalten. Sie tagte dann vom 27. bis zum 29. Juni in Berlin-Spandau. Das Thema lautete: „Raum für das Evangelium in Ost und West“. Das herausragende Ereignis dieser Zusammenkunft bildete das Referat des Generalsuperintendenten Günter Jacob aus Cottbus, aus der DDR also. Im Mittelpunkt seiner Ausführungen stand die These, „dass das Ende des konstantinischen Zeitalters gekommen ist“.12 Jacob ging es nicht um historische Differenzierungen. Mit ziemlich groben 11 12 Zit. bei Pierre Grémion, Intelligence de l`Anticommunisme. Paris 1995, 238. Kirchliches Jahrbuch (KJ) 1956, 9-16. Seite 9 Strichen entwarf er das Bild einer Epoche, in der „Thron und Altar“ zusammengehörten, wo eine „mit allen Privilegien ausgestattete christliche Religion“ über eine eindeutige „Monopolstellung“ in der Gesellschaft verfügte, weil sie „eine den Staat untermauernde und die herrschende Gesellschaftsschicht unterstützende Weltanschauung“ proklamierte. Diese Zeit, fuhr Jacob fort, sei nun unwiderruflich vorbei. Zwei Gründe führte er dafür an. Der eine, für ihn wesentliche, bestand in der Wiederentdeckung des Evangeliums von Jesus Christus durch die dialektische Theologie Karl Barths. Das war die Einsicht, dass es kein Bindestrich-Christentum geben kann, keine natürliche Beziehung zwischen der Offenbarung einerseits und andererseits der Kultur, Nation, des Sozialismus oder des Konservatismus. Der andere, eher äußere Grund für das Ende des „konstantinischen Zeitalters“ lag in der ideologischen und politischen Realität, die jetzt in der DDR dominierte und die nach der Überzeugung von Günter Jacob nur offen legte, was man im Grundsatz, nämlich theologisch, doch schon längst wusste. Das sei deshalb der große Vorzug der Situation in der DDR und im Osten, erfuhren die Synodalen, dass man hier in der Wirklichkeit lebe, statt sich wie im Westen „gefährlichen Illusionen“ hinzugeben und die „wahrhaft alarmierenden Symptome“ der Realität mit fragwürdigen Mitteln zuzudecken versuche. Im Osten dagegen sei „die Luft bereits klar, sauber und offen“. Und deshalb existierten hier auch die besseren Voraussetzungen für die „Frage nach dem Raum für das Evangelium“. Was das bedeutete, erläuterte der Generalsuperintendent am Modell der „alten Christenheit“. So dunkel er zuvor das konstantinische Zeitalter gemalt hatte, so hell und licht erstrahlte in seinen Ausführungen nun das Bild der Urkirche. Diese Christenheit habe keine Verhandlungen geführt, „um sich den Raum zu sichern“. Sie eroberte keine Machtpositionen, veranstaltete keine Protestaktionen. Sie bezeugte stattdessen „einfältig und freimütig“ das Evangelium und begegnete Verfolgungen „im unerbitterten Leiden und in der dienenden Hingabe“. Nach dieser Devise sollten auch die Christen in der DDR leben. „Nach dem Ende der Illusionen über das konstantinische Zeitalter und im Rückgang auf das urchristliche Zeugnis haben wir nicht das Recht, vom Staat Privilegien und Monopole zur Unterstützung des Evangeliums zu fordern. Wir können dem Staat nur sagen, welche Bewegungsfreiheiten die Kirche im Dienst des Evangeliums wahrnehmen wird, weil sie durch den Gehorsam gegen ihren Herrn dazu verpflichtet ist.“ Wenn die Christenheit in der DDR bereit wäre, diesen Weg zu gehen, würde sie wie die Urchristenheit „erfahren, dass sie als Gemeinde Jesu Christi gerade dann das Evangelium verkündigen kann, wenn sie auf alle Selbstsicherheit und Selbstbehauptung verzichtet“. Das war sicherlich eine recht unhistorische Vision. Aber vor dem düsteren Hintergrund alltäglicher Erfahrungen mit einem militanten feindlichen System, dem man sich wehrlos ausgeliefert fühlte, trug und tröstete der von Günter Jacob proklamierte Paradigmenwechsel: Nicht die Situation im Westen, sondern diejenige im Osten ist die normale, an der sich die Christenheit orientieren muß. Eine breitere Wirkung erhielten diese Gedanken durch die 1957 erschienene kleine Broschüre „Christ in der DDR“ von Johannes Hamel.13 Allein die Tatsache, dass diese Schrift es innerhalb eines Jahres auf mehrere Auflagen brachte, belegt das Gewicht, das diese Überlegungen besaßen. Hamel wandte sich an einfache Christen und normale Ortsgemeinden in der DDR. Er beschönigte nichts. Zugleich warnte er vor der Illusion, dass die Lage sich durch ein Entgegenkommen der Kirchenleitungen gegenüber den Forderungen des Staates bessern ließe. „Vorteil von der Kursänderung hätten nur die ‚Funktionäre’ der Kirche. Deren Weg und Ergehen ist aber nur der kleinste Wegteil des Ergehens und des Weges der Christenheit in der DDR.“ Das eigentliche Problem lag für Hamel nicht bei den Kirchenleitungen, sondern tiefer. Warum, fragte er, hören die Gemeinden in der DDR in den kirchlichen Stellungnahmen und Weisungen stets an erster Stelle oder sogar ausschließlich das Nein gegen die Zustände im Osten? Dadurch werde die bei der großen Mehrheit des Kirchenvolkes ohnehin vorhandene Neigung zur „inneren Emigration“ doch nur 13 Berlin 1957. Seite 10 gesteigert oder stabilisiert. Hamel vermisste durchweg, angefangen bei den sonntäglichen Predigten bis hin zu synodalen und bischöflichen Verlautbarungen „das jubelnde Ja zu Gottes Gerechtigkeit an uns, mit uns und durch uns in Jesus Christus“. Und darauf komme es doch entscheidend an. „An diesem Ja erst würde sich aber die Christlichkeit der Christenheit in der DDR erweisen.“ Die Zukunft gehörte nach der festen Überzeugung Hamels nicht mehr der Volkskirche, sondern der kleinen Zahl mutiger, bekennender Christen. Denn nur diese wären in der Lage, anders, d.h. dem Evangelium gemäß, mit den Machthabern in Ostdeutschland umzugehen. Das wäre dann ein anderes Ja zu den Herrschenden, als es gegenwärtig gesprochen würde, urteilte Hamel. „Das ‚Ja’ zu unseren Machthabern ist nicht das Ja der gewünschten Akklamation. Es kann auch nicht jenes ‚Ja’ eines missverstandenen Luthertums sein, das immer ja sagt, wenn es der jeweiligen Macht begegnet. Es kann auch nicht das ‚Ja’ einer rauschhaften Erkenntnis sein, die kraft ‚geheimer Offenbarung’ diese Form der Regierung für zukunftsträchtiger hält als eine andere. Sondern unser, unser geschenktes und abgefordertes Ja zu unsern Verwaltern der Macht wird gelebt und ausgesprochen in der Entsprechung zu dem Ja Gottes, der diese Welt geliebt hat, der diese Welt erhält, der diese Welt seinem Sohn unterworfen hat.“ Wie ließ sich diese Vision in das Leben der Gemeinde und des einzelnen Christen im Alltag der DDR hineintragen? Hamel versuchte es mit der Heranziehung einer anderen theologischen Abstraktion, nämlich dem altkirchlichen Begriff des „dritten Geschlechts“. Die Wendung besagte, dass die in der Antike geläufigen sozialen und politischen Trennwände zwischen Mann und Frau, Freien und Sklaven, Kulturmenschen und Barbaren für die Christen nicht mehr galten, weil sie alle einem anderen Äon angehörten. In der Kriegs- und Nachkriegszeit hatte insbesondere Visser `t Hooft diesen Begriff verwandt, um damit die Realität der Ökumene und die Verbundenheit der Christen über sämtliche nationalen, ideologischen und politischen Gegensätze hinweg zum Ausdruck zu bringen. Allerdings war auch da – wie bereits in der Antike – sehr deutlich zutage getreten, dass die Rede vom „dritten Geschlecht“ gewiss geeignet war, eine grundsätzlich neue, andere Blickrichtung zu eröffnen. Aber einen Ersatz für sozialethische Weisungen oder Richtlinien bot und bietet diese Formulierung gerade nicht. Doch darauf kam es vor dem Hintergrund der umfassenden Erschütterungen des Jahres 1956 offenkundig auch nicht an. Gefragt waren vielmehr, jedenfalls in der DDR, Hilfestellungen für einen Paradigmenwechsel, eine theologische und kirchenpolitische Umorientierung. Es mag sein, dass es sich bei solchen Überlegungen um eine deutsche – oder besser: eine deutschdeutsche – Besonderheit handelte. Doch kann nicht übersehen werden, dass solche theologischen Gedanken später auch innerhalb der Ökumene im Osten eine gewichtige Rolle gespielt haben. Zunächst jedoch sah es hier anders aus. Der Druck des Staates und der kommunistischen Partei lasteten auf sämtlichen Kirchen im Ostblock erheblich schwerer, als auf den evangelischen Kirchen in der DDR. Was konnte man im Westen tun, um diese Not zu lindern? Bereits 1954 hatten einige westdeutsche Kirchenführer, die in der Zeit des Nationalsozialismus zur Bekennenden Kirche gehörten, den Beschluss gefasst, ein gesamteuropäisches Netzwerk aufzubauen, dem kirchliche Gruppen und Kreise aus dem Westen ebenso wie aus dem Osten Europas angehören sollten.14 Zu den Initiatoren dieses Unternehmens gehörten Heinrich Held und Ernst Wilm, die Präsides, d.h. Leiter im Rang eines Bischofs, der Rheinischen sowie der Westfälischen Landeskirche. Wesentliche Unterstützung erhielten sie durch den früheren Oldenburgischen Oberkirchenrat Heinz Kloppenburg. Dieser war von 1947 bis 1950 in der Flüchtlingsarbeit des ÖRK tätig gewesen und besaß dadurch mancherlei persönliche Kontakte nach Genf, die er nun u.a. in der Gestalt von Anregungen, Voten und Gutachten für das geplante Unternehmen nutzte. 14 Vgl. zum Folgenden Martin Greschat, Der Protestantismus und die Entstehung der Europäischen Gemeinschaft. In: M. Greschat/ W. Loth (Hg.), Die Christen und die Entstehung der Europäischen Gemeinschaft. Stuttgart 1994, 25-96, bes. 68ff. Seite 11 Eine unverhoffte Förderung erfuhr das Projekt dann durch die 2. Vollversammlung des ÖRK in Evanston in den USA im August 1954. Denn im Aufruf dieser Versammlung hieß es: „Wir richten an die Vertreter der Kirchen in jenen Ländern, zwischen denen Spannungen bestehen, den Appell zu gegenseitigen Besuchen, damit sie einander und die Länder, in denen sie leben, besser verstehen lernen und auf solche Weise die Bande der Gemeinschaft verstärken und die Versöhnung der Nationen fördern.“15 Die konkreten Ausführungen zum Generalthema – nämlich Ächtung des Krieges und der Atomwaffen, Abrüstung und internationale Rüstungskontrollen sowie insbesondere das Eintreten für Verständigung und Versöhnung über alle ideologischen und politischen Barrieren hinweg – entsprachen exakt den Zielsetzungen, die Kloppenburg und seine Freunde verfolgen wollten. Zuerst gingen sie daran, die bereits bestehenden internationalen kirchlichen Verbindungen zu intensivieren. Es existierten bereits ein Französisch-deutscher Bruderrat, der Nordisch-deutsche Kirchenkonvent sowie eine bis dahin kaum in Erscheinung getretene Verbindung der Rheinischen und Westfälischen Kirche zum Britischen Kirchenrat. Diese Kontakte sollten nun vertieft werden. Das gelang insofern, als man Ende September 1955 in Brüssel eine gemeinsame Konferenz abhalten konnte. Anwesend waren etwa 40 Teilnehmer aus den evangelischen Kirchen Belgiens und der Niederlande, aus dem Rheinland und Westfalen sowie verschiedene Beobachter. Zwei Themen beherrschten die Versammlung. Zum einen ging es darum, aus den bestehenden Kirchenkonventen, die jeweils zwischen Deutschland und einer Kirche in einem anderen Land gebildet worden waren, eine neue Organisation zu schaffen, die sie alle umschloss, also einen Kreis zu bilden anstelle des Sterns, wie Wilm formulierte. Das andere Thema bildeten die Überlegungen, wie man diesen Zusammenschluss für die Förderung der protestantischen Minderheitenkirchen insbesondere im Osten einsetzen könnte. Vor allem um dieses gesamteuropäische Engagement ging es der Versammlung. Die Redner grenzten sich wiederholt nachdrücklich von den gängigen Leitbildern und Aktivitäten hinsichtlich Europas ab. Diese erschienen ihnen ausnahmslos als allzu westlich und deshalb sowohl geographisch als auch politisch und ideologisch schlicht unbrauchbar. Stattdessen sollte es im Geist des Evangeliums um die bedrängten Mitmenschen gehen, den notleidenden Nächsten. Diese Hilfestellung könnten die Kirchen aufgrund ihrer Größe und organisatorischen Struktur kaum leisten, erklärte Niemöller. Sie brauchten daher die Konvente als „Pioniertrupps“. Kist, der Leiter des reformierten Studienzentrums Oud Poelgest, erklärte: „Bisher waren wir in der Familie unseres Volkes. Jetzt gilt es, die Ethik für Europa zu finden.“ Er fuhr fort: „Europa ist nicht eine Idee, sondern ganz nüchtern die Beschreibung unseres geographischen Ortes. Wir leben eben nicht in Asien, sondern hier. Aber gerade von hier wird deutlich: die Aufgabe, die uns Asien stellt, können wir nur von Europa aus richtig angehen.“ Am Ende der Brüsseler Konferenz wurde beschlossen, ein Jahr später, also 1956, eine zweite, größere Tagung europäischer Kirchen abzuhalten. Dazu mussten jedoch Kontakte zur EKD, zu den skandinavischen Lutheranern, zum Lutherischen Weltbund, zu den Anglikanern sowie zum ÖRK geknüpft werden. Das war insofern ein schwieriges Unterfangen, als die meisten dieser Gremien von den Aktivitäten der Brüsseler Konferenz wenig oder nichts hielten. Es war deshalb ein höchst geschickter Schachzug der Initiatoren dieser Konferenz, dass nur wenige Wochen nach der Tagung drei hochgestellte kirchliche Persönlichkeiten aus der Tschechoslowakei, nämlich der Prager Professor Hromádka, der slowakische Generalbischof Chabada sowie Hajek, der Präsident der Synode der Tschechischen Brüderkirche, sich in gleichlautenden Schreiben an Grubb, den Leiter der Kirchlichen Kommission der Ökumene für Internationale Angelegenheiten (CCIA) wandten, an Bischof Lilje als Vorsitzenden der Vereinigten Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) sowie an Boegner, den Präsidenten des französischen Kirchenbundes (FPF) mit der indignierten Anfrage, warum diese kirchlichen Institutionen denn zögerten, die Beschlüsse der Brüsseler Konferenz auszuführen, die auf die Integration der Kirchen in Osteuropa zielten. 15 Evanston spricht. Botschaft und Berichte. Genf 1954, 74. Seite 12 Alles spricht, wie gesagt, dafür, dass es sich bei diesem Vorstoß aus der Tschechoslowakei um eine gezielte und mit den Initiatoren der Brüsseler Konferenz abgesprochene Aktion handelte. Der Plan entstand vielleicht bereits im Frühjahr 1955, als sich Hromádka als Gast der Rheinischen Kirche in Westdeutschland aufhielt. Keines der aus Prag angeschriebenen ökumenischen Gremien hatte bis dahin Verbindungen zur Brüsseler Konferenz gepflegt. Doch jetzt, nachdem Christen aus dem Osten ihr Interesse an Kontakten zum Westen in der Form der Zusammenarbeit mit den Brüsselern anmeldeten, konnte man den Bemühungen der Leute um Wilm, Held und Kloppenburg nicht länger die kalte Schulter zeigen. Die ökumenische Offensive aus der Tschechoslowakei veränderte jedoch erheblich die ursprüngliche Zielsetzung des Brüsseler Kreises. Denn nun ging es nicht mehr um die Begegnung von kleinen Gruppen, um die Kooperation von „Pioniertrupps“, sondern erwünscht waren von Prag Treffen mit offiziellen kirchlichen Delegationen aus beiden Teilen Europas. Und außerdem mussten die orthodoxen Kirchen aus dem Osten – sie traten dem ÖRK bekanntlich erst 1961 bei – hinzugezogen werden. Es ist erstaunlich, wie schnell und selbstverständlich der inzwischen eingesetzte Brüsseler Fortsetzungsausschuß auf diese Forderungen einging. Dadurch gerieten nun allerdings die Vertreter der Genfer Ökumene in Schwierigkeiten. Sie mussten kooperieren, wenn sie nicht hinnehmen wollten, dass die Brüsseler eine eigene Ökumene aufbauten. Aber sie billigten deren Vorgehen darum keineswegs. Der Ratsvorsitzende der EKD, Bischof Dibelius, fragte empört, wie seine westdeutschen Kollegen dazu kämen, die gemeinsame Front der Christen und Kirchen gegenüber dem Kommunismus aufzuweichen. Pragmatischer argumentierte Visser `t Hooft. Am Ende des Jahres 1956 kritisierte er den Generalsekretär der Niederländischen Reformierten Kirche, seinen Landsmann Egbert Emmen, der inzwischen zum Leitungskreis der Brüsseler gehörte: Wie könnten sie zusammen mit den ungarischen Kollaborateuren des Kadar-Regimes und dessen lautem Verteidiger Hromádka zu einer kirchlichen Konferenz einladen? Die Angegriffenen ließen die politische Dimension ihres Projekts ausdrücklich beiseite und konzentrierten sich stattdessen auf die geistliche Zielsetzung. So unterstrich Emmen, dass man jetzt im Blick auf den Osten doch nur fortsetze, was Visser `t Hooft und der entstehende ÖRK in der Zeit des Nationalsozialismus und insbesondere des Zweiten Weltkriegs getan habe, nämlich der Verbundenheit der Christen über alle Grenzen hinweg Ausdruck zu verleihen. Kloppenburg schrieb an Dibelius: „Bestreiten Sie, dass es drüben Christen gibt, die es geistlich nach einer Verbindung mit den Christen des Westens verlangt, die sich über einen Besuch nun auch im rechten Sinn einfach freuen, und denen es eine Stärkung auf ihrem schweren Weg, den sie als Christen zu gehen haben, bedeutet, zu wissen, dass die Christen aus anderen Ländern sie nicht allein lassen? […] Die Christen in den Ostblockstaaten sind doch nicht einfach Objekte unserer Erwägungen und unserer pädagogischen Bemühungen, sondern das sind doch Menschen, die durch Christus mit uns zusammengehören. Und was wäre das noch für eine Kirche, die sich nicht zu dieser vorhandenen Gemeinschaft bekennen würde?“ Diese unterschiedlichen Stellungnahmen bündeln die Probleme. Die darin angelegten Schwierigkeiten begleiteten die Konferenz europäischer Kirchen, die dann Ende Mai 1957 in Liselund in Dänemark tagte, und ebenso das weitere Wirken dieser Gruppe, zu deren Organisation als „Konferenz Europäischer Kirchen“ (KEK) hier in Liselund dann der entscheidende Schritt getan wurde. Ganz wesentlich waren und blieben die Begegnungen von Theologen und Kirchenführern, von Menschen und Christen aus allen Teilen Europas. Eine enorme Bedeutung hatten die Gespräche, die privaten insbesondere, jedoch auch die offiziellen. Sehr viel weniger Gewicht besaßen die vielen Stellungnahmen, Resolutionen und Entschließungen der KEK. Sie blieben durchweg höchst allgemein. Das war der Preis dieser Versammlungen: Man konnte nicht konkret reden, weil dann die real vorhandenen Gegensätze sofort offen zutage getreten wären. Und jeder Teilnehmer der Veranstaltungen der KEK wusste, dass es so war. Seite 13 Weder Hoffnungslosigkeit noch Resignation, weder schroffe Ablehnung noch eine kompromisslos antikommunistische Einstellung konnten den Menschen und Christen in Osteuropa eine tragfähige Antwort bieten. Oder vielleicht doch? Fraglos erforderten die Alternativen, die ich hier skizziert habe, die Bereitschaft und Fähigkeit zur Gratwanderung. Musste sie misslingen? Sicherlich nicht. Weshalb glückte sie hier und dort nicht? Einmal mehr muss ich Sie um Ihre Unterstützung bitten. Wir wissen, zumal im Westen, viel zu wenig über diesen so überaus wichtigen Abschnitt der jüngsten Geschichte des Christentums. Helfen Sie mit, dass das nicht so bleibt! „Erzählt euch eure Biografien. Hört zu, damit ihr einander besser versteht“, heißt es in einem jüngst erschienenen Buch über die Schwierigkeiten von Menschen aus Ost- und Westdeutschland, einander zu verstehen.16 Erzählen und zuhören – genau darum geht es. Darauf kommt es an. 16 Johannes Richter, Gehversuche. Leipzig 1999, 114.