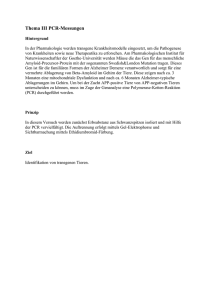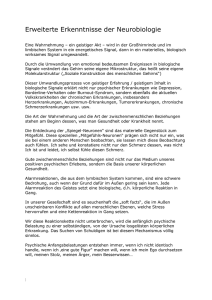erkennen und - Wie die Welt in den Kopf kommt
Werbung
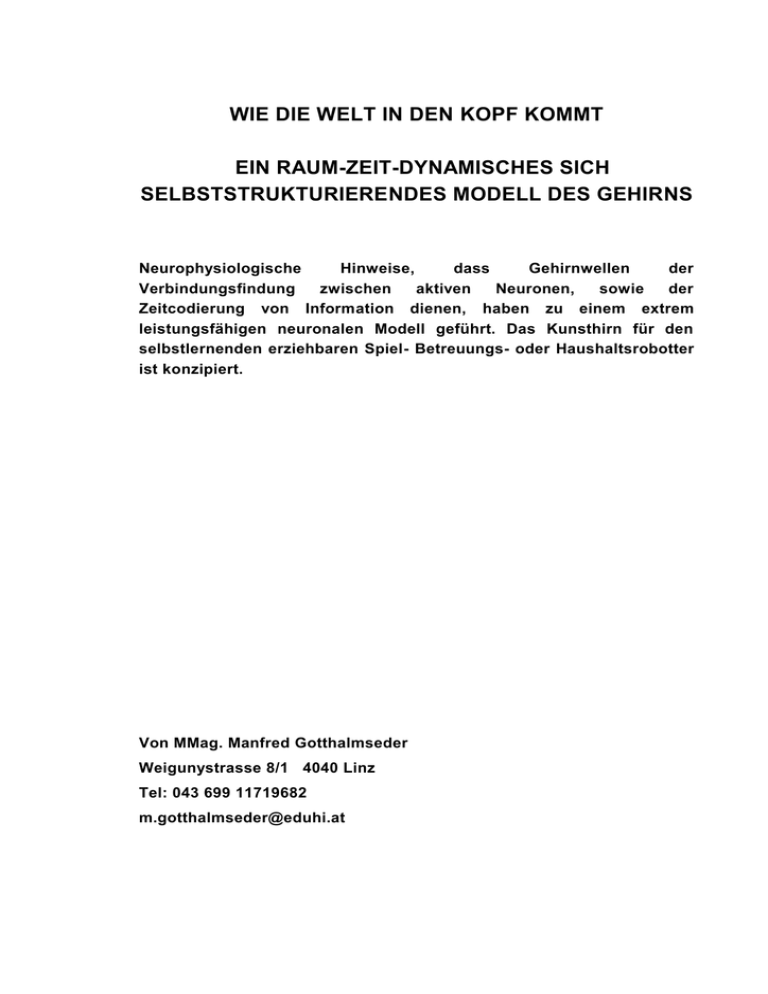
WIE DIE WELT IN DEN KOPF KOMMT EIN RAUM-ZEIT-DYNAMISCHES SICH SELBSTSTRUKTURIERENDES MODELL DES GEHIRNS Neurophysiologische Hinweise, dass Gehirnwellen der Verbindungsfindung zwischen aktiven Neuronen, sowie der Zeitcodierung von Information dienen, haben zu einem extrem leistungsfähigen neuronalen Modell geführt. Das Kunsthirn für den selbstlernenden erziehbaren Spiel- Betreuungs- oder Haushaltsrobotter ist konzipiert. Von MMag. Manfred Gotthalmseder Weigunystrasse 8/1 4040 Linz Tel: 043 699 11719682 [email protected] INHALTSVERZEICHNIS: 1 KURZFASSUNG (ABSTRACT) 2 REDUNDANZKETTEN-FLIEßNETZE 1 Studien am Gehirn, die ein zeitdynamisches Modell notwendig machten 2 Abgrenzung zu anderen Netztypen 3 4 EIN GEHIRNMODELL AUF BASIS DES REDUNDANZKETTEN-SIGNALFLUSSES Die sieben Problemstellungen eines Gehirns 1. Regeln zur Bindungsstärke 2. Regeln zur Verbindungsfindung 3. Regel zur hierarchischen Organisation der Informationen 4. Regeln zum Zusammenfluss der Signale 5. Regeln zur zeitlichen Voraussage 6. Regeln für körperliche Bedürfnisse als Handlungsmotiv 7. Regeln für geistige Bedürfnisse und kreatives Verhalten ZUSAMMENFASSUNG ALLER REGELN 5 EXKURS: ÜBERPRÜFUNG DER REGELN AM VISUELLEN SYSTEM 1. Niedrige Stufen visueller Verarbeitung 2. Höhere Stufen visueller Verarbeitung 3. Höhere Funktionen 6 SCHLUSS Literaturliste Lebenslauf 1 KURZFASSUNG (ABSTRACT) 6 Was ist neu an dem in dieser Arbeit vorgestellten Modell? ............................................. 11 Ziel und Aufbau der Arbeit .............................................................................................. 12 2 REDUNDANZKETTEN-FLIEßNETZE 14 2.1 Neurophysiologische Studien, die ein neues Zeitdynamisches Modell notwendig machten. 14 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10 2.1.11 2.1.12 Axon Pathfinding ............................................................................................. 17 Verbindungsfindung in Lernprozessen. ............................................................ 22 Horizontale Verbindungen ............................................................................... 26 Wellen im ausgereiften Gehirn ........................................................................ 27 Unverbrauchte Reserve-Verbindungen ............................................................ 31 Großflächige Modulation der Synapsen. .......................................................... 32 Rückläufige Signale. ........................................................................................ 32 Kettensignalfluss und Signalfließzeit ................................................................ 34 Chunkzellen..................................................................................................... 37 Regelkreisprinzip. ............................................................................................ 40 Aufmerksamkeitslenkung ................................................................................ 40 Übergang zu seriellem Denken ........................................................................ 43 2.2 Abgrenzung der Signalflussidee zu anderen Netztypen 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 46 Die Vor- und Nachteile klassischer Mehrschichtnetzwerke............................... 46 Vor- und Nachteile statistischer Netze ............................................................. 48 Das Kohonen Netzwerk ................................................................................... 51 Auf Synchronisation beruhende Netze ............................................................. 55 2 2.2.5 3 Redundanzketten-Fließnetze: Die Vorteile dieses neuen Netztypus ................. 58 EIN GEHIRNMODELL AUF BASIS DES REDUNDANZKETTEN-SIGNALFLUSSES Was ist die allgemeine Aufgabe des Gehirns? 65 66 Was ist ein Ereignis oder ein Objekt im Gehirn?............................................................. 67 Zusammenfassung der Grundidee neuronaler Netze ...................................................... 67 Die sieben Problemstellungen eines Gehirns 68 3.1 Regeln zur Bindungsstärke: 69 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 Die Assoziative Konditionierung ....................................................................... 69 Wir treffen Voraussagen aufgrund eines statistischen Lernmechanismus ........ 70 Wann wird eine Verbindung mit welcher Stärke erlernt? .................................. 71 Wie und warum neue Erfahrungen stärker gewichtet werden sollten . ............... 72 Wo Konditionierungslernen von Bayes abweicht .............................................. 74 Über die statistische Gleichbehandlung räumlicher und zeitlicher Distanzen .... 76 Die Darstellung negativer Relationen durch hemmende Verbindungen ............ 76 3.2 Regeln zur Verbindungsfindung 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 77 Das Blitzprinzip ................................................................................................ 78 Die Vereinigung der Vorteile des Mehrschichten und des Bayes-Netzes .......... 79 Das Kurze-Wege-Fließmodell .......................................................................... 79 Wie kann die Verbindungsfindung in einem künstlichen System ablaufen? ...... 82 Ein verbessertes Modell .................................................................................. 84 Die Kontaktfindung .......................................................................................... 86 Die Zweischritt-Scheinlösung ........................................................................... 87 Kontaktfindung durch Kämmlinienvermischung ................................................ 89 3.3 Regel zur hierarchischen Organisation der Informationen: 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Die eine Verknüpfung repräsentierende Zelle .................................................. 94 Generalisierung und Differenzierung .............................................................. 100 Verarbeitungsebenen und das Differenzierungsproblem ................................ 102 3.4 Regeln zum Zusammenfluss der Signale 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.4.8 3.4.9 3.4.10 104 Wann und wie verlassen die Fließsignale eine Redundanzkette? .................. 104 Warum solche räumliche Verbindungen nicht entstehen ................................ 105 Die Abziehbildcodierung ................................................................................ 106 Wie stark sind Signale, die sich verbinden? ................................................... 109 Die notwendige Unterscheidung von Reizstärke und Reizanzahl.................... 110 Konkretisierung der Signalcodierung für die KI-Forschung ............................. 111 Der Abfluss der Signale am Beispiel räumlich getrennter Punkte ................... 111 Warum wir Form und offene Linie unterscheiden ........................................... 114 Wann werden Signale kombiniert, wann überschrieben? ............................... 115 Was haben wir damit erreicht? ...................................................................... 116 3.5 Regeln zur zeitlichen Voraussage 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 94 117 Der Unterschied zwischen Vorstellungen und Wahrnehmungen .................... 117 Zwei Arten zeitlicher Vorankündigung: Mit und ohne Verbindungen ............... 118 Das Uhr-Modell ............................................................................................. 119 Das Pendel-Modell ........................................................................................ 119 Das Sanduhr-Modell ...................................................................................... 121 3 3.5.6 3.5.7 3.5.8 3.5.9 3.5.10 3.5.11 3.5.12 3.5.13 3.5.14 3.5.15 Das Reihenfolge-Modell ................................................................................ 122 Wann, und womit beginnt die Zeiterfassung? ................................................ 124 Wie unterscheiden wir Lautstärke und Tempo? ............................................. 126 Die Ordnung auditiver Verbindungen durch das Prinzip der Blockierung ........ 128 Wie werden Reizverläufe erfasst? ................................................................. 129 Was gilt mehr, Nähe oder Ähnlichkeit? .......................................................... 130 Die Verarbeitung der zeitlich kodierten Signale im visuellen System .............. 131 Die Verarbeitung zeitlicher Signale des auditiven Systems ............................ 132 Die Verbindung nicht zeitgleicher Signale: ..................................................... 134 Zukunftsvorstellungen versus parallele Welt .................................................. 135 3.6 Regeln für körperliche Bedürfnisse als Handlungsmotiv 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 3.6.6 3.6.7 3.6.8 3.6.9 3.6.10 Zwei Gründe gegen Verhaltensverstärkung durch Verbindungsverstärkung ... 139 Die Rolle der rückführenden Signale „aus der Zukunft“ .................................. 141 Die Unterscheidung von Emotion und Gefühl ................................................. 143 Wie Handlungen gestartet werden ................................................................. 143 Exkurs: Ein System für alle Verarbeitungsprozesse ....................................... 144 Erwartungssignale von den Sinnen, zeitgegenläufige vom Triebzentrum ....... 146 Die Verschaltung der Sollwertabweichungssignale zu Bedürfnissen .............. 146 Vorstellung der Zukunft und der Vergangenheit ............................................. 147 Aussagenlogik ............................................................................................... 148 Handlungen automatisieren (unbewusst erledigen) ........................................ 149 3.7 Regeln für geistige Bedürfnisse und kreatives Verhalten 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 3.7.6 4 5 159 Regeln zur Verbindungsstärke: ...................................................................... 159 Regeln zur Verbindungsfindung ..................................................................... 159 Regeln zur hierarchischen Organisation der Verbindungen ............................ 160 Regeln zum Zusammenfluss der Signale ....................................................... 160 Regeln zur zeitlichen Voraussage .................................................................. 161 Regeln für körperliche Bedürfnisse ................................................................ 162 Regeln für geistige Bedürfnisse und kreatives Verhalten ............................... 163 Allgemeine Zusatzregeln: .............................................................................. 163 Ist das Modell damit fertig? ............................................................................ 164 EXKURS: ÜBERPRÜFUNG DER REGELN AM VISUELLEN SYSTEM 5.1 Niedrige Stufen visueller Verarbeitung 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 149 Aufmerksamkeit und das Bindungsproblem ................................................... 149 Trennung von Figur und Grund ...................................................................... 151 Der Lerntrieb bzw. ästhetische Trieb ............................................................. 151 Die Notwendigkeit des Lerntriebes für den Erwerb der Bewegungskontolle ... 153 Kreativität. Ausprobieren neuer Handlungen .................................................. 155 Das Verhältnis von „Außenwelt“ zu „Innenwelt“ .............................................. 157 ZUSAMMENFASSUNG ALLER REGELN 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 137 166 166 Das Projektionsfeld ....................................................................................... 166 Kontur und Farberkennung ............................................................................ 167 Die Reaktion von Gegenfarbenzellen auf Unschärfe und Grauverläufe .......... 172 Die Bewegungzellen und die Objektfixierung ................................................. 174 Die Kontur und Richtungserkennung ............................................................. 176 Die Erkennung von Konturrichtungen............................................................. 177 Abziehbildsignalfluss auf den Richtungsebenen ............................................. 182 4 5.1.8 Die Doppelgegenfarbenzellen ........................................................................ 184 5.2 Höhere Stufen visueller Verarbeitung 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 185 Objektgröße und Anzahl ................................................................................ 185 Was ist Textur, was Form? ............................................................................ 186 Struktur- und Texturbeispiele ......................................................................... 187 Ein Modell der Texturerkennung .................................................................... 204 Formerkennung ............................................................................................. 204 Figur/Grund ................................................................................................... 208 Die Bindung der Sinnesreize .......................................................................... 210 Die Verarbeitung räumlicher Tiefe ................................................................. 211 Raumorientierung .......................................................................................... 212 5.3 Höhere Funktionen 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 6 Wieso das Modell in anderen Systemen funktionieren sollte als im visuellen . 214 Sozialer Kontakt ............................................................................................ 215 Sprache ......................................................................................................... 216 Wille und willentliches Merkvermögen ........................................................... 216 Was ist Bewusstsein? .................................................................................... 219 Bewusste und unbewusste Komponenten der Bewegungskontrolle ............... 220 Verdrängte Erlebnisse ................................................................................... 221 Stress und Depression .................................................................................. 222 SCHLUSS 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 7 214 223 Warum es letztendlich ein philosophisches Werk ist ...................................... 223 Warum gab es ein solches Modell noch nicht? .............................................. 226 Künstliche Wesen, Horrorvorstellung oder Bereicherung? ............................. 228 Wie soll es weitergehen? ............................................................................... 230 LITERATURLISTE 232 5 1 KURZFASSUNG (ABSTRACT) Neue Technologien ermöglichen es der Neurophysiologie die Dynamik des Gehirns im Kurzzeitbereich zu erforschen, und die Ergebnisse werfen bisherige Denkmodelle über den Haufen. Das hier dargestellte Modell fußt auf solchen neuen Studien über Wellen und Signalbewegungen und es zeigt, wie am Beispiel des Gehirns, wesentlich leistungsfähigere neuronale Netze machbar sind. Der Schlüssel dazu lautet: Kontaktfindung und Zeitcodierung. Wenn wir in der Gehirnforschung von „selbstlernend“ sprechen, so bezieht sich dies auf die Lernregeln der Psychologie, die in ihrer elementarsten Form in den Konditionierungsexperimenten zutage treten. Ich behaupte, dass diese Lernregeln noch nie vollständig in einem künstlichen neuronalen Netz umgesetzt wurden. Fehlt nur eine solche elementare Regel, so ist die Leistungsfähigkeit des Systems bereits zerstört. Es ist anzunehmen, dass solche Ausfälle auch in der Natur vorkommen. Die auf unvollständigen Lernregeln aufbauenden Netze der heutigen KI -Forschung könnte man aus meiner Sicht deshalb mit dem Gehirn eines Autisten vergleichen, das dazu taugt das Telefonbuch zu lernen, aber nicht um sich im Leben zurechtzufinden. Da bereits zu Beginn meines Studiums für mich feststand, dass meine Abschlussarbeit dieses Thema behandelt, habe ich über Jahre alle Literatur die mir begegnete nach Erkenntnisregeln durchsichtet und glaube heute das vollständige Regelwerk in ein Modell fassen zu können. Unser Gehirn hat ein übergreifendes Ziel: Es dient dazu die Welt und die zukünftigen Bedürfnisse vorauszusagen, und unser Handeln darauf abzustimmen. Dieses Ziel verfolgen alle Nervensysteme, seit sich in der Evolution die Fernsinne entwickelt haben. Hat ein Tier z.B. Augen, so braucht es ein Gehirn, das es veranlasst zu flüchten wenn es den Feind erspäht, nicht erst wenn es vom Feind berührt wird. Es handelt also aus einer hypothetischen Zukunft. Auch jede sinnvolle geplante Handlung des Menschen bezieht sich auf eine hypothetische Zukunft. Um eine solche Zukunft vorauszusagen, erlernen wir Reizketten. Aber nur wenn sich eine Kette AB häufig wiederholt hat, können wir auch davon ausgehen, dass in Zukunft wieder auf Reiz A Reiz B folgen wird. Deshalb lernen wir, anders als der Speicher eines Computers, erst durch Wiederholung. Das hier dargestellte Modell fußt auf der alten Idee, dass erlernte Reizverbindung en direkt in „gewachsenen“ neuronalen Verbindungen ihre Repräsentation finden. Diese Vorstellung mag in ihrer einfachen Form nicht viel Erklärungswert besitzen, wenn wir in weiterer Folge jedoch die zeitlichen Vorgänge der Signalbewegungen im Gehirn in die Überlegungen mit einschließen, so werden wir ein Modell erhalten, das sehr gut die Ergebnisse der neueren zeitdynamischen Studien der Neurophysiologie erklärt. 6 Der Grundlegende Ansatz ist altbekannt: Der Pawlowsche Hund, dem immer die Glocke zum Futter geläutet wird, verbindet also das Neuron „Glocke“ mit jenem, das Futter repräsentiert. Dieser Verbindung kann ein eigenes Neuron zugeordnet werden, das für den gesamten Fütterungsprozess steht, also für das gesamte Chunk. Der Hund kann dann in weiteren Lernprozessen dieses Neuron verknüpfen und z.B. feststellen, dass Fütterung zwei mal am Tag erfolgt. Lernen wäre sehr einfach zu erklären, gäbe es immer nur zwei Reize, wie Glocke und Futter, die räumlich und zeitlich ident auftreten. Aber das gibt es nicht. Reize nehmen nämlich auch im Gehirn unterschiedliche Orte ein. Es ergeben sich zwei wesentliche Fragen: 1. Was ist, wenn drei oder mehr Reize verbunden werden sollen. 2. Wie finden die Orte zueinander eine Verbindung? Zu 1: Während zwei Reize durch eine Linie verbunden werden können, also durch einen Nerv, und wir uns vorstellen können, dass in der Mitte dieser Verbindung jene Zelle positioniert sein könnte, die die Reizverbindung (Fütterung) repräsentiert, gibt sowohl die Vernetzung, wie auch die Position dieser sogenannten Chunk-Zelle im Fall von mehreren Neuronen ein Rätsel auf. Stellen wir uns ein Lernexperiment mit Punktdarstellungen vor. Eine Drei-PunktAnordnung soll als Begriff gedacht, und von anderen Anordnungen unterschieden werden können. Sie soll in einem Konditionierungsexperiment eine eigene Reaktion auslösen. Dazu muss ihr eine eigene Zelle zugeordnet werden, von der diese Reaktion ausgelöst werden kann. Die Regel dazu klingt simpel: Gleichzeitig räumlich nahe Reize werden verbunden. Jeder Punkt ist ein Reiz. Das bedeutet aber Punkt A wird mit Punkt B verbunden, B mit C, C mit A. Wir erhalten drei Verbindungen, und damit drei Chunkzellen, und nicht eine. Damit stehen wir wieder am Anfang. Das Problem der Bildung eines einzigen Gestaltbegriffs blieb ungelöst. Werden mehr als zwei Reize zugleich im Gehirn aktiv, so ergibt sich also ein Lern-Problem, das ich in der Literatur auf dieser elementaren Ebene nicht behandelt gefunden habe. Jeder Bildpunkt der visuellen Wahrnehmung muss im Ursprung als Einzelreiz verstanden werden, ehe das Gehirn lernt, die Punkte zu größeren Einheiten zu verbinden. Somit werden in der Regel Millionen von Reizen im Gehirn zugleich aktiv. Aber nach welchen Regeln werden mehr als zwei Reize verbunden? Wie erkennen wir solche Reizanordnungen, also Bilder? Die Lösung des Verbindungsproblems: Ich will in dieser Einleitung schon einige Lösungen vorwegnehmen, obwohl ich es hier nur in einer unprofessionellen Kürze tun kann, ohne auf neurophysiologische Beweisführung, technische Details und bereits bekannte technische Lösungen einzugehen. Das alles kommt später. Und es wird sich auch erst später 7 herausstellen, was alles durch die Lösung der hier dargestellten Elementarprobleme hervorgeht, nämlich die Erklärung der gesamten inneren Repräsentation der Welt. Die Antwort auf die Frage danach wie mehrere Reize eine Verbindung bilden können, fand sich gemeinsam mit der Antwort auf Frage 2: Wie finden distanzierte, zugleich aktive Neuronen eine Verbindung zueinander? Konditionierungsexperimente haben gezeigt, dass prinzipiell jede beliebige Reizkombination erlernt werden kann. Aber eine Gehirnzelle hat nicht mit jeder anderen Kontakt, und es gibt prinzipiell mehr verschiedenartige Reize, als eine Gehirnzelle aktive Kontakte haben könnte. Deshalb muss die Verbindung meist über andere Zellen erfolgen. Aber wie kann eine selbstlernende noch nicht verschaltete Struktur diese Verbindungen finden? Axon Pathfinding ist ein wichtiges Problem der gegenwärtigen Neurophysiologie. Was die schnelle Kurzzeitspeicherung betrifft, so scheint es einen analogen Prozess zum Axon Wachstum zu geben, den ich als Signal-Pathfinding bezeichne. Beide Prozesse scheinen von elektrochemischen Gehirnwellen gesteuert. Ich werde die dazugehörigen Studien gleich im Anschluß an diese Einleitung darstellen. Sehr vereinfacht kann man sich vorstellen, dass von den aktiven Neuronen eine Welle ausgeht, die sich strahlenförmig zu allen Seiten hin ausbreitet und die Stru ktur durchkämmt. Die Strahlen sind wie eine Bahn, auf der ein Weg zurück zur Quelle gefunden werden kann. Betrachten wir nun noch einmal unser Beispiel mit den drei Punkten, so ergibt sich ein Ausbreitungsmuster dieser Wellen. Sie laufen an einem zentralen Punkt in der Mitte des Dreiecks zusammen. Damit haben wir einen einzigen Ort für eine Chunk-Zelle (Begriff-Zelle), die dieses Dreieck repräsentiert. Zu diesem Ort hin verbinden sich die drei Punkte. Dies ist die Grundidee zur Lösung des Pfadproblems. Was aber, wenn mehrere Punkte (Reize) in einer Linie hintereinander aufgefädelt positioniert sind? Es scheint als würden sie dann auch nicht mehr als Objekt sondern als Linie, eben hintereinander, gedacht. Wenn wir uns in unserer Vorstellung einer Punktreihe von 8 Punkt 1 zu Punkt 3 begeben, so gelangen wir dort nur über Punkt 2 hin. Unser Vorstellungsdenken ist zeitlich, die Punkte sind räumlich. Diese Punktanordnung wird also in unserem Denken zeitcodiert. In unserem Denken begeben wir uns von den Linienenden die Linie entlang. Es ist anzunehmen, dass dabei auc h die Signale derartig fließen. Aber dazu später mehr. Womit beginnt die Verarbeitung visueller Reize? Um das zu verstehen, bedürfen wir einer Rückbesinnung auf das eigentliche Ziel des Gehirns: Verbindungen dienen der Voraussage. Mit diesem Wissen wollen wir nun die ersten Verarbeitungsschritte der visuellen Wahrnehmung zu interpretieren versuchen: Die Neuronen, welche die Bildpunkte eines Bildes repräsentieren, werden sich mit ihren Nachbarn verbinden, um deren Aktivität vorauszusagen. Meistens wird die Aktivität benachbarter Bildpunkte ähnlich sein, weil ein Bild aus Farbflächen besteht, und immer viel mehr Punkte innerhalb dieser Farbflächen Platz finden, als an deren Konturen. Innerhalb der Flächen sind benachbarte Punkte gleich gereizt, also verbinden sie sich und sagen voraus: Mein Nachbar ist gleich gereizt. Das ist die elementarste räumliche Voraussage. An den Konturen kommt es jedoch zu einem Voraussagefehler, also zu einem Reiz, der auf die nächste Ebene weitergesendet wird. Genauso ist es mit der zeitlichen Folge. Egal wie klein wir eine Zeiteinheit wählen, es wird nicht mit jeder neuen Zeiteinheit das Bild wechseln. Deshalb kann eine Sinneszelle durchschnittlich vorausahnen: In der nächsten Zeiteinheit werde ich wieder gleich gereizt sein. Sinneszellen geben nur Signale weiter, wenn ihre Voraussage nicht stimmt. Da unser Auge immer etwas zittert, wechselt an den Konturen ständig das Bild. Sowohl zeitlich als auch räumlich ist dort immer ein Voraussagebruch. Dieser Voraussagefehler wird auf die nächste Ebene von Neuronen gesendet. Dort landen also nur Konturreize. Konturen verlaufen durchschnittlich geradlinig, weil grundsätzlich viel mehr Neuronen auf einer Linie Platz finden, als auf deren Ecke. Deshalb verbinden sich die Neuronen auf dieser Ebene zu Ketten (Balken) und sagen eine geradlinige Konturfortsetzung voraus. Die Winkel oder Enden solcher Konturlinien begrenzen den voraussagbaren Bereich. Innerhalb der Linie (Reizkette) folgt ein Punkt voraussagbar dem nächsten. Sie bilden eine Einheit. An den Enden der Kette liegt der Voraussagefehler. Ich nehme an, dass ein Reiz vom Gehirn umso stärker wahrgenommen wird, je wen iger er vorausgesagt wird. Ja mehr noch, jeder Reiz ist ein Voraussagefehler! Ist er vollkommen vorausgesagt, ist es kein Reiz mehr. Jemand der dauerhaft neben der Autobahn wohnt, hört die Autos nicht mehr. Sie sind kein Reiz mehr. 9 Kettensignalfuss entlang der Verbindungsbahnen Wenn wir oben davon ausgegangen sind, dass Signale an gereizten Neuronen starten (Voraussagefehlern), und ein Wellensignal in das vorhandene Verbindungsnetz senden, um einander zu finden und eine Chunkzelle zu aktivieren, so sieht dies in den Kettenverbindungen auf der Konturebene folgendermaßen aus: Das Kontur-Ende ist der Voraussagefehler, also der Reiz. Dort starten Signale und laufen die vorhandenen Verbindungen, also die Konturen entlang. Sie treffen an einem Punkt in der Mitte der Linie (Kontur) aufeinander. So haben wir einen Punkt pro Linie, an dem das Signal letztlich landet. An diesem Punkt kann die Chunkzelle liegen, die die Linie repräsentiert. Aber wie kann aus der Reaktion einer solchen Chunkzelle hervorgehen, wie lang die Linie ist? Ganz einfach: Die Signale fließen länger, wenn die Linie länger ist. Ich werde nachher neurophysiologische Ergebnisse präsentieren, die das belegen. Genau das ist auch in unserer bewussten Vorstellung zu beobachten. Wir brauchen länger, um uns eine längere Distanz vorzustellen (Inselexperiment). Freilich kann ich in dieser Kurzfassung nicht weiter ins Detail gehen. In der Arbeit will ich darstellen, dass prinzipiell jedes Bild durch das Signalflussprinzip auf ähnliche Weise zeitcodiert werden kann. Da alle Sinnesdaten in Reaktionsbildern vorliegen, ergibt sich ein allgemeines Modell des Gehirns, denn die Signalfließprozesse taugen somit auch zur Verarbeitung von akustischen Reizen, oder Tast und Geruchsreizen etc. Bewusstsein und Wille Im Bewusstsein wird alles seriell, also zeitlich nacheinander gedacht. Linien werden also zeitlich abgewandert. Es hat eine Umcodierung von zeitlicher Information auf räumliche stattgefunden. Genau an dieser Schwelle kommt es von unbewussten zu bewussten Prozessen der Wahrnehmungsverarbeitung. Das hier vorgestellte Modell soll nicht nur ein Meilenstein in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz darstellen, es dient letztlich der Erforschung des Bewusstseins. Das Ziel des Gehirns liegt nicht nur in der Voraussage zukünftiger Umweltbedingungen und Körperzustände, sondern auch darin die körperlichen Ist Werte sowohl jetzt, als auch in Zukunft möglichst an die Sollwerte heranzuführen. Das ist der Zweck allen Handelns, einschließlich Sicherheitsdenken, Habgier und sozialem Rang. Körperliche Sollwerte eines künstlichen Wesens könnten zum Beispiel geladene Batterien, sowie gesicherte Daten und Vermeidung von Erschütterung und anderen Schäden sein. Will es durch Dienstleistungen selbstständig seinen Strom verdienen, sich also einen Broterwerb suchen, wie der Mensch dies tut, so braucht es viel Einblick in die Welt (viel Voraussage) und es muss sich sozial einbinden, denn der Strom aus der Steckdose fließt nur solange er bezahlt wird. Bereits ein 10 einfaches Bedürfnis kann ein mobiles System, das Voraussage beherrscht, somit schon zu einer Vielfalt an komplexen Verhaltensmustern anregen. Genau das zeichnet den Menschen aus. Das hier dargestellte Modell will zeigen, dass eine selbstlernende Struktur machbar ist, die bei ausreichender Größe prinzipiell solche Leistungen steuern kann und damit über einen Willen verfügt. Was ist neu an dem in dieser Arbeit vorgestellten Modell? Um ein in sich schlüssiges und konsistentes System zu schaffen, war mehr notwendig als nur die Idee der Zeitcodierung durch den Signalfluss. Hier eine Liste der neuen Aspekte des Modells: 1. Das Modell zeigt, wie Verbindungen in beliebiger Richtung zu gleichzeitig aktiven Neuronen, über andere Neuronen hinweg aufgebaut werden können. Es findet d abei (in Anlehnung an den Blitz) den kürzesten Weg und nabelt die Verbindungen ab. Damit ist das Problem kombinatorisch zu zahlreicher Verbindungsmöglichkeiten gelöst, denn es werden Verbindungen erst erschaffen, wenn sie gebraucht werden. 2. Jeder entstandenen Verbindung ist ein Neuron zugeordnet, das diese Verbindung repräsentiert. Mit diesen Neuronen entsteht somit auch eine ideale Lösung der Frage nach der räumlichen Anordnung der Repräsentationen im Netz (visual space). 3. Durch das, aus Konditionierungsexperimenten bekannte Gesetz der Blockierung, wird verhindert, dass zu viele Verbindungen entstehen. 4. Die Auslösung erster Handlungen geschieht durch einen Regelkreis, der unseren Erkenntnisdrang simuliert. Andere Bedürfnisse kann ein Baby ja noch nicht selbst befriedigen (Stangl 2002). Deshalb ist auch nicht vorstellbar, dass sie sein Handeln motivieren, denn ohne Befriedigung findet keine Konditionierung statt. Der Regelkreis, der den Spiel- und Erkenntnistrieb simuliert, ist also für ein selbstlernendes System, das bei Null startet, unumgänglich. Die Impulse dieses Regelkreises starten an Voraussagefehlern. Diese liegen, je nach Lernerfahrung, anderswo im Netz. Das System arbeitet also, anders als gängige Netze, weder Top Down noch Bottom Up. 5. Wir verketten nacheinander oft erlebte Reize, und nützen diese assoziativen Verbindungsketten, wenn wir uns etwas vorstellen (Tritschler 2001). Auch Reizbilder werden durch Verbindungen gespeichert, allerdings sind es nun Ketten von zeitgleichen Signalen, die ich als „Und-Verbindungen“ bezeichne. Es gibt nun keinen Zeitpfeil, der beschreibt in welcher Richtung diese Ketten durchflossen werden sollen. Das Signal könnte darin ewig im Kreis laufen. Das hier dargestellte Modell löst dieses Pro blem durch den Start der Signale beim Voraussagefehler (Erkenntnistrieb). 6. Der Abfluss der Signale aus den Und-Verbindungen, führt zu einer Zeitcodierung visueller Information, die erklärt, warum es für den Menschen optisch ersichtliche und weniger ersichtliche Zusammenhänge in Bildern gibt. Durch diese Zeitcodi erung kommt die Information nacheinander durch eine Leitung (Damit ist das Bindungsproblem gelöst, und auch die synchronisierten Signale, die man fand, passen in dieses M odell (vergl. Held 2002)). So können relativ wenige Leitungen die Forminformation e ines gesamten Objektes vermitteln, und an unzählige erkennende Übereinheiten weitergeben. 7. Es ist meines Wissens nach das erste neuronale Modell, das zeigt, wie es von der parallelen Verarbeitung der Sinne, zur seriellen der Vorstellungen kommt, warum also 11 in Vorstellungen nur eine Sache zu einem Zeitpunkt bewusst gedacht werden ka nn. Es zeigt, wie Vorstellungen unser Handeln beeinflussen, und worin sie sich von Wahrnehmungen unterscheiden. 8. Das Modell beschreibt die „Hardware“ eines Kunsthirns, welches Verhalten aufgrund innerer Vorstellungen kontrolliert, die es durch Erfahrungen erwirbt. Es mus s in ein mobiles System integriert sein, dessen Sensoren Reize aus der Umwelt empfangen, durch die es programmiert wird. Seine Vorstellungen davon, welche Zukunft eintreten wird, sind abhängig von den Konsequenzen, die es auf sein Verhalten erwartet. Man kann das Neuronale Netz erziehen, indem man ihm Konsequenzen für sein Verhalten prophezeit. So ist es für jeden Menschen ohne Vorbildung verwendba r. Ziel und Aufbau der Arbeit 1. Die Grundidee, dass Signalfließzeiten eine Rolle in der Informationsverarbei tung des Gehirns spielen, fußt auf neueren Neurowissenschaftlichen Studien. Eine Übersicht dazu soll den Anfang der Arbeit bilden, da das Modell ohne diese Quellen, nach altem Lehrbuchwissen sehr weit hergeholt wirkt. 2. Im Anschluss daran will ich eine kleine Übersicht über die gängigen künstlichen neuronalen Netze der KI-Forschung geben, um zu zeigen, welch unlösbare Probleme diese aufwerfen. Ich will zeigen, dass das hier dargestellte Modell auf lange Sicht den einzig gangbaren Weg zu künstlicher Intelligenz darstellt. 3. Dann folgt auf ca. 100 Seiten das Modell und endet mit einer Zusammenfassung seiner neuronalen Regeln. 4. Diese werden schließlich, im vierten Teil der Arbeit, zur Überprüfung, auf die elementaren Prozesse des Sehens angewendet, um zu zeigen, dass analoge Strukturen entstehen, wie wir sie im Gehirn finden. Zugegebenermaßen ist das Modell mit heutigen Computern schwer zu simulieren, denn die Speicherung von Wissen erfolgt wie im Gehirn in Verbindungen, und zusätzlich bedarf es auch noch der zeitlichen Bewegung von Signalen in diesen Verbindungen, um zu der dargelegten Zeitcodierung von Reaktionsbildern zu kommen. Das Fernziel dieser Arbeit besteht deshalb darin, als Grundkonzept zur Entwicklung einer eigenen Hardware zu dienen, in der Wissen in Form von Verbindungen abgespeichert wird. In Chips gespeicherte größere Datenmengen sind heute technisch möglich, man denke nur an Digitalkameras. Das Modell bedarf aber eines ganz eigenen Aufbaus solcher Chips, um die Welt in sich „begrifflich“ aufnehmen zu können. Der gesellschaftliche und wirtschaftliche Wandel, den die Entwicklung leistungsfähiger Allzweckroboter mit sich bringen wird, dürfte aus meiner Sicht stärker sein, als jener, der mit der Entwicklung von PCs erfolgte. Man bedenke nur, dass jeder mit diesen künstlichen Wesen umgehen kann, denn sie werden nicht programmiert, sondern erzogen. Sie werden Spielgefährten und Haushaltshilfen sein, oder Behinderten ihre Selbstständigkeit zurückgeben. Sie werden ihren „Geist“ auf gelagerten Datenträgern absichern können, und somit einen Hauch von Unsterblichkeit in sich tragen. 12 Allerdings werde ich, soweit es in meiner Macht liegt, dem Forschungsvorhaben die Auflage erteilen, dass jeder daraus hervorgehende Artikel erst mit zweijähriger Verspätung in Englisch erscheinen darf, um dem mitteleuropäischen Raum einen Vorsprung zu verschaffen, weil ich meiner Heimat einen sinnvolleren Umgang mit einer Technologie von derartiger Sprengkraft zutraue. 13 2 REDUNDANZKETTEN-FLIEßNETZE Der eigentliche Text beginnt erst etwa auf Seite 50. Bevor ich das Modell beschreiben kann, ist aber notwendig zu zeigen warum ein neues Modell notwendig war, und aus welchen Erkenntnissen es hervorging. 2.1 Neurophysiologische Studien, die ein neues Zeitdynamisches Modell notwendig machten. Ich muss mich beim Leser für die Artikelflut in diesem Kapitel entschuldigen. Ohne Vorwegnahme der noch wenig bekannten, zeitdynamischen Forschungsergebnisse der Neurophysiologie, die erst jüngst durch schnellere Bildgebende Verfahren möglich wurden, kann ich nicht fortfahren. Denn aus der Sicht der klassischen Lehrbuch-Neurophysiologie erschiene die Arbeit völlig unplausibel. Deshalb will ich diese neuen Ergebnisse hier vorweg geballt präsentieren. Es ist schon lange bekannt, dass sich vor allem ein junges Gehirn völlig umzustrukturieren vermag, wenn dies notwendig ist. Die folgenden drei Beispiele zeigen, dass das Gehirn durchaus ein sich selbst strukturierendes Organ ist: Völlig umstrukturiert hat sich das Gehirn einer Hydrocephalus-Patientin. Sie wurde im ersten Lebensjahr operiert, so dass das bis dahin heil gebliebene Gewebe gerettet werden konnte, und alle Funktionen übernahm. Sie weist heute (als Jugendliche) keinerlei Beeinträchtigungen auf, hat sogar überdurchschnittlichen Schulerfolg, obwohl nur ein Teile ihres Gehirns arbeiten. Der wissenschaftliche Bericht kann als vier Minutenfilm (1,5MB) von geladen werden. Die folgenden Bilder zeigen die Durchschnittsaktivitätsverteilung in einem gesunden Gehirn (links) und in jenem der Patientin (rechts), das einen großen Hohlraum aufweist (Mitte). http://members.telering.at/manfred.gotthalmseder/Hydrocephalus.html . . Auch sind aus der Medizin Beispiele von Menschen bekannt, an denen man nach deren Ableben feststellte, dass sich bei ihnen eine Gehirnhälfte nicht entwickelt hatte. Auch diese Menschen wiesen im Leben keine Auffälligkeiten auf. Die Plastizität des Gehirns zeigt sich auch an einem Experiment mit neugeborenen 14 Hamstern, denen der Sehnerv an eine andere Stelle der Großhirnrinde chirurgisch angebracht wurde. Das Gehirn entwickelte dort, wo normal das Hörsystem liegt, ein gesundes Sehsystem. http://www.eurekalert.org/pub_releases/2000-09/UoMM-UoMr2009100.php . Fest steht, dass das Gehirn nach den Konditionierungs bzw. Lernregeln arbeitet, und daher Probleme der Kontaktfindung in Raum und Zeit zu lösen hat. Wenn es dabei ähnlich wie das hier dargestellte Modell vorgeht, so sollten man nach folgenden Phänomenen im Gehirn Ausschau halten: 1. Axon-Pathfinding. Gibt es Wegfindung im Gehirn, und basiert diese auf sich ausbreitenden Wellen (Kämmsignalen)? Gibt es chemische Signale dieser Art, die die Axon-Wachstumsrichtung lenken? 2. Verbindungsfindung in Lernprozessen. Hat Wegfindung mit Lernen zu tun? Lernen sollte auch dann möglich sein, wenn die zu verbindenden gleichzeitig aktivierten Neuronen zu weit voneinander entfernt sind, als dass noch ein direkter Kontakt der Neuronen anzunehmen ist. Es sollten auch indirekte Kontakte erlernbar sein, deren Route über andere Neuronen führt. Dabei ergibt sich eine spezielle Form des Pathfinding -Problems. 3. Horizontale Verbindungen. Das Gehirn müsste meinem Modell zufolge auch reich an horizontalen erlernten Verbindungen sein, die sich zu Ebenen verketten können. 4. Wellen im ausgereiften Gehirn. Gibt es neben den chemischen Wellen beim AxonWachstum im jungen Gehirn womöglich auch elektrochemische Wellen, bzw. „Kämmsignale“ innerhalb des Nervengewebes des erwachsenen Gehirns, die auf die Synapsenkontakte wirken, und beim Lernen eine Rolle spielen? 5. Unverbrauchte Reserve-Verbindungen. Wenn neuronale Verbindungen durch Lernen verschaltet werden, dann sollten sich auch noch unverschaltete Verbindungen finden lassen, denen vorerst noch keine Funktion zugeordnet ist. 6. Großflächige Modulation der Synapsen. Es sollte Hinweise geben, dass die Gehirnwellen eine verteilte Modulation von Synapsenänderungen hinterlassen (synaptic spread), wie sie benötigt wird, um die Kämmrichtung festzulegen, an denen die Aktivitätszentren, von denen die Signale gesendet wurden, einen Weg, also eine Verbindung zueinander finden können. 7. Rückläufige Signale. Es sollte eine rückläufiges Signal zwischen den zu verbindenden Neuronen existieren, um die Verbindung abzunabeln und zu verstärken, wie dies für das Langzeitgedächtnis notwendig ist. Da das Ziel in der Verstärkung der Verbindung liegt, und dies im Gehirn einen Umbau der Neurone erfordert, ist weniger von einer elektrischen, als von einem chemischen, bzw. proteingesteuerten Retour -Signal auszugehen, das sich dadurch auszeichnet, dass es Synapsenänderungen hervorbringt. 8. Kettensignalfluss mit Signalfließzeit. Es sollte aus neurophysiologischer Sicht der Idee nichts im Wege stehen, dass räumliche Distanzen durch horizontale Signalfließzeiten zeitcodiert werden. 9. Chunkzellen. In Lernprozessen sollte die Bildung von Chunkzellen nachweisbar sein, die auf eine erlernte Reizkombination ansprechen, nicht auf die Einzelreize. Bereits erlernte, und daher vorausgesagte Verbindungen müssen dann nicht noch einmal erlernt werden. 15 10. Regelkreisprinzip. Ein Signal aus dem Sollwertzentrum (Lustzentrum im limbischen System) des Gehirns sollte genügen, um Handlungen zu verstärken. Die Bedeutung des Signals ergibt sich rein aus dessen Herkunft, dem Sollwertzentrum. 11. Aufmerksamkeitslenkung. Der Hippocampus (im limbischen System) und die vor allem in diesem Gehirnteil ausgelösten Langzeit-Potentiale können dem hier vorgelegten Modell zufolge nicht direkt den Lernvorgang darstellen, sondern lediglich den Ausgangspunkt zur gerichteten Aufmerksamkeit, die Lernen fördert. Gibt es Studien, die eine solche Rolle des Hippocampus zulassen? 12. Übergang zu seriellem Denken. Die Zeitcodierung der Bildinformation müsste zu einem Übergang von paralleler Verarbeitung auf den unteren Stufen der Wahrnehmung hin zu dem seriellem Denken des Bewusstseins führen. Die neuronalen Netze der Informatik kennen einen solchen Übergang nicht. Welche Hinweise für serielles Denken gibt es im Gehirn? Es sieht so aus, als bestünde diese neun Punkte Liste aus Fakten, die sich klar neurophysiologisch bestätigen oder widerlegen lassen. Doch die Neurophysiologie ist heute ein Gebiet, das aus so vielen Spaten besteht, dass widersprüchliche Ergebnisse fast schon an der Tagesordnung sind. Alte Dogmen darüber, wie ein Neuron Signale verarbeitet, werden durch neue Untersuchungen angegriffen. Dedriten können nach aktuellen Studien auch Signale produzieren (Dendritic Spikes), Teile einer Zelle können unterschiedlich aktiviert sein (Golding et.al. 2002), Langzeitspeicherung bedarf, einer neuen Untersuchung zufolge, neuer Zellen, die auch im erwachsenen Gehirn noch entstehen (Spektrum-Ticker 2001.03.20). Das alles galt bisher als ausgeschlossen. Auch sind die Forschungsmethoden der Neurophysiologie so vielfältig geworden, und die meisten Wissenschafter konzentrieren sich auf eine bestimmte Methode, so dass in jeder Spate unterschiedliche Beobachtungen gemacht werden, die sich oft sogar zu widersprechen scheinen. Forscher benennen ihre Beobachtungen unterschiedlich, je nachdem mit welchem Gerät sie gemacht werden. Deshalb geht aus der Literatur nicht klar hervor, ob überhaupt das gleiche Phänomen beobachtet wurde. 16 Die Grafik aus Gazzaniga et.al (1998) zeigt die verschiedenen bildgebenden Verfahren. MEG & ERP sind ereigniskorrelierte electrophysiologische Aufzeichnungen, Pet & MRI: blood-flow based imaging techniques, TMS: Transcranial Magnetic Stimulation. Die Grafik zeigt, dass die neuen spannungsabhängigen Markerstoffe (voltagesensitive oder optical Dyes) einerseits den Überblick über größere Flächen des Gehirngewebes erlauben, und andererseits zeitlich schnelle Abläufe erforschbar machen, wie dies bisher nur EEG und Ableitungen von Neuronen mittels Elektroden (Unit-Recording) ermöglichten. Zeitverlaufs-Studien mit Optical Dyes sind also für ein Modell, das zeitliche Abläufe zwischen Neuronen behandelt, am interessantesten. Da sie noch eine relativ neue Entwicklung darstellen, darf man sich noch nicht all zu konkrete Ergebnisse erwarten. Ich habe die Studien im Folgenden nach der obigen 12 Punkte-Liste geordnet: 2.1.1 Axon Pathfinding Dass das Hauptproblem des Gehirns darin besteht, dass einkommende Signale am richtigen Ort landen, um schließlich einen geeigneten Output zu ergeben, ist unbestritten. Den ersten Schritt dazu stellt die „Verkabelung“ der Neuronen im Embryo dar. Mit chemischen Botenstoffen weisen die Zielzellen den wachsenden Axonen der Quellzellen den Weg (Axon Guidance). Das Pathfinding-Problem ist also zunächst durch chemische „Wellen“ gelöst, die von den Zielzellen zum Growth Cone des Axons gehen. Bartheld et.al 1996 beschreiben ihre Studie dazu folgendermaßen: “Neurotrophins are produced in the target; the signal therefore must be conveyed from the axon terminus to the cell body over a considerable distance. Little is known about internalization of neurotrophins at the axon terminal and mechanisms of transport. We have examined the transport of neurotrophins from the axon terminals to the cell bodies in the ION” 17 Eine weitere Studien stammt von Henkemeyer (2001): "We found molecules that communicate important signals that guide the growing tips of embryonic nerve fibers (the axon growth cone) and, therefore, help form networks of neurons and synapses in the brain in a process called axon pathfinding," Wenn diese chemischen Botenstoffe im extrazellulären Raum irgenwie herumschwimmen, so können sie nicht als Richtungsweiser dienen. Das bedeutet, sie müssen sich in Form einer chemischen Welle ausbreiten, und den Raum auf diese Weise durchkämmen. Tatsächlich wurden derartige Beobachtungen gemacht. Ein Beispiel ist das Wachstum der Nerven-Axone von der Retina der Augen zum Lateral Geniculate Nucleus (LGN) im Gehirn. Auf der Retina des Embryos bilden sich spontane Aktivitätswellen, die nachweislich wesentlich für die Verdrahtung der Axone sind. Dazu Katz et.al. 2002: „Multielectrode recordings and calcium-imaging studies (CA2+) recealed the presence of ’retinal waves’ … Indeed, these waves seem to be crucial for the emergence of segregated retinal projection patterns in the LGN itself.” Weitere Quellen dazu: (Shatz 1993, S.23, Gruber 2000, S.119) Calcium 2+ waves gehen mit elektrischen Feldern einher. Es wird angenommen, dass die Richtung, von der die Signale kommen, vom Growth-Cone des Axons erfasst werden kann. Studien von Penn AA, Shatz CJ. (1999) Stützen diese Annahme. Die folgende Grafik dazu stammt aus Hely T. A. (1998) Spitzer et. al. (2000) bieten eine umfassende Arbeit zur Rolle der CalciumTransients (Ca2+ Waves) für Axon-Guidance und Kontaktfindung. „Like cloudbursts on the developing landscape, Ca2+ transients modulate growth and stimulate differentiation, in a frequency-dependent manner, probably by changes in phosphorylation or proteolysis of regulatory and structural proteins in local regions. We review the mechanisms by which Ca2+ transients are generated and their effects in regulating motility via the cytoskeleton and differentiation via transcription” S. 813: “Growth cone Ca2+ waves regulate axon outgrowth and pathfinding in vivo.” Ihre Studien werden im Spektrum- Ticker (2001.03.14) von Spektrum der Wissenschaft folgendermaßen zusammengefasst: 18 „Die lebenden Zellen markierte das Team von Timothy M. Gomez und Nicholas C. Spitzer mit einem leuchtenden Farbstoff, der das Vorhandensein von Calcium aufzeigt. Unter einem konfokalen Mikroskop konnten sie die Calcium -Wanderung mit Hilfe einer Serie von acht Bildern pro Sekunde verfolgen … Nur dort, wo ein Calciumstrom auch die Wachstumszone der Nervenzelle erreichte, konnte das Team ein gerichtetes Wachstum feststellen.“ Spitzer et.al widmen sich vor allem dem embryonalen Axon-Wachstum. Dass Waves auch im Axon Wachstum des ausgereiften Gehirns eine Rolle spielen, zeigt sich vor allem nach Gehirnschäden (Carmichael & Chesselet 2002): “Chronic tetrodotoxin infusion into the lesion site blocked the synchronous neuronal activity after thermal-ischemic lesions as well as axonal sprouting. Thus, both after different types of lesions and in the blockade experiments axonal sprouting was strongly corr elated with synchronous neuronal activity, suggesting a role for this activity in anatomical reorganization after brain lesion in the adult rat.” Aber taugen denn chemische Wellen überhaupt dazu, das Wegfindungsproblem zu lösen? Steinbock et.al (1995) zeigen, dass der natürliche Prozess des Signalflusses einer chemischen Welle durch ein Labyrinth, das mathematisch aufwendige Problem der Wegfindung einfach und schnell löst, und er deutet an, dass dies auch als Modell für das Gehirn dienen könne. Chemische Wellen sind sogar geeignet, um ein Symmetrieachsenskelett zu einer beliebigen Form zu generieren, wie die folgende Aufnahme einer chemischen Welle aus Adamatzky (1998) zeigt: Dass auch in Zellgeweben das Wegfindungsproblem durch chemische Wellen gelöst wird, zeigt sich am Beispiel der Amöbe. Amöben bewegen sich durch Zellwanderung. Wie die folgende Grafik aus Adamatzky (1998)2 darstellt, sind sie fähig Wegfindungsprobleme zu lösen und z.B. zwischen zwei Futterquellen die attraktivere zu wählen. 19 Aber was spielt sich im inneren der Amöbe ab? Studien zeigen, dass in der Amöbe sogenannte cAMP-Wellen zu beobachten sind (Newell 2000). Diese chemischen Wellen scheinen die für die Zellwanderung notwendigen Verrechnungsprozesse zu bieten. Das folgende Bild zeigt solche Wellen. Sie breiten sich von den Zentren nach außen aus. (Die Spiralen erklären sich vermutlich aus folgender Regel: Die Bildung einer neuen Welle bewegt sich kreisförmig um das Zentrum. Sie startet immer an jener Stelle, wo schon länger keine neue Welle gebildet wurde, wobei die Neubildung gleich den benachbarten Bereich mitreißt. So verläuft die Neubildung immer rundum im Kreis, und trotzdem sich die Wellen vom Zentrum nach außen ausbreiten, sieht es aus als drehe sich die Spirale. Die Bewegung verläuft aber vom Zentrum nach außen, und damit im Grunde nicht a nders als bei den konzentrischen Wellen. Sie ist daher als Richtungsweiser brauchbar und erinnert an die Kämmsignale in meinem Modell.) Auch im Gehirn dürften solche cAMP-Wellen neben den Ca2+ Wellen, von denen weiter oben die Rede war, bei der Axon Guidance eine Rolle spielen. Die chemischen Substanzen dafür sind vorhanden, man scheint aber noch nicht so weit, die Wellen im Gehirn abzubilden. Deshalb sind die Abbildungen des AmöbenGewebes interessant, und wurden auch schon für eine Computersimulation des Wegfindungsproblems im Gehirn herangezogen. Die Idee, die dieser Simulation zugrunde liegt ist eine ähnliche wie in meinem Modell. Die Ausbreitungsrichtung der Wellen gibt dem Axon den Weg vor. Allerdings geht man davon aus, dass es neben anziehenden auch abstoßende chemische Signale gibt. Simulationen dazu finden sich bei Segev, R. & E. BenJakob (2003). Axon Guidance ist ein weltweiter Forschungsbereich der Neurophysiologie. Fest steht, dass dabei viele chemische Prozesse im Spiel sind, deren Vielfalt bei Dickson 20 (2001) nachzulesen ist. Die meisten Studien beziehen sich aber auf embryonales Axon-Wachstum. Erst neuere Studien zeigen, dass Axon-Wachstum auch bei Lernprozessen eine Rolle spielen dürften. Die alte Lehrmeinung, besteht darin dass wir bloß durch Synapsenänderungen lernen. Bei massiveren Lernvorgängen dürfte es jedoch zu einer Modifikation der gesamten axonalen Verbindung kommen. Allerdings nur wenn eine Lernaufgabe mit Synapsenänderungen alleine nicht zu bewältigen ist. Neugeborene Frettchen, deren visuelles System zerstört wurde, um die Sehinformationen in das auditorische System zu linken, entwickeln in diesem Gehirnteil lernbedingt axonale Verschaltungen, wie sie normal im visuellen System zu finden sind. Sharma et.al 2000 zeigen dies in ihrer Studie: “Deafferentation of the auditory thalamus in ferrets at birth induces retinal ax ons to innervate the medial geniculate nucleus (MGN). Visual input is relayed from the retina through the MGN to primary auditory cortex (A1), and visually driven cells are orientation selective.” Die Autoren beweisen mittels Bildgebung durch spannungssensible Marker, dass die Neuronen, die normal auditive Informationen verarbeiten, sich zu den, für das visuelle System typischen Orientation-Maps verschalten, und unterziehen die „Rewired Brains“ ihrer Fretchen einer genauen Untersuchung. Die Darstellung von Orientation-Maps wird uns später noch einmal begegnen, deshalb spare ich mir hier eine genauere Erläuterung. Man beachte vorerst nur die Ähnlichkeit der entstandenen Strukturen. Die Autoren schließen ihren Bericht mit: „Together with the demonstration that the visual projection routed to auditory cortex mediates visual behaviour and hence instructs the perceptual modality of cortex, our findings show that the pattern of early sensory activation can instruct the functional architecture of cortex to a significant extend.” Aber selbst wenn wir solche Studien ignorieren und bei der alten Lehrbuchmeinung bleiben, dass Lernprozesse keine Wachstumsprozesse bei Axonen und Dendriten anregen, sondern nur zu Modulationen der bereits vorhandenen Zellkontakte (Synapsen) führen, (letzteres ist bereits durch Genmarker nachgewiesen WSA 2002.12.18), stolpern wir über das Pathfinding-Problem. Denn auch Lernprozesse, die über bereits vorhandene neuronale Kontakte verlaufen, bedürfen mitunter einer Wegfindung, nämlich dann, wenn zwei Neuronen, die noch keinen direkten Kontakt zueinander haben, nur über indirekte Routen eine Verbindung zueinander aufbauen können. Allerdings suchen wir in diesem Fall nicht mehr nach einem Pfad im extracellulärem Raum (wie beim Axon-Pathfinding), sondern nach einem Signalweg, der im Zellnetz über eine Kette von Neuronen verläuft, so wie bei meinem Modell. 21 Für die Entwicklung eines künstlichen neuronalen Netzes sind die beiden Problemstellungen (Axon Pathfinding und Signal Pathfinding) eigentlic h identisch, denn egal ob ich den extracellulären Raum, oder das noch nicht verschaltete Neuronengewebe simuliere, in beiden Fällen brauche ich ein Netz, in dem Wellen über benachbarte Punkte hinweglaufen können, um die zukünftige Wegrichtung vorher sozusagen durchzukämmen. Um die Weitergabe von Wellen möglich zu machen, müssen die Punkte des Raums mit ihren Nachbarn verbunden sein, wie in jeder Substanz in der Wellen fließen können. Im Vakuum gibt es weder Schall, oder chemische Wellen noch elektrische Ladungen. Erst in einem zusammenhängenden molekularen Netz kann über eine Kette von räumlichen Punkten eine Verbindung erlernt werden. Für die Simulation ist vorerst egal, ob die räumlichen Punkte Moleküle oder bereits Neuronen sind. Es ist in jedem Fall sinnvoll, das räumliche Raster nicht feiner zu wählen, als das Neuronennetz. So spart man sich unnötige mögliche Wege und kann doch jedes Neuron erreichen. Genau dieser Gedankengang liegt meinem Modell zugrunde. 2.1.2 Verbindungsfindung in Lernprozessen. Ich oben die neurophysiologischen Beweise für die Notwendigkeit chemischer Wellen beim Axon-Pathfinding zitiert. Da mein Modell in seiner ursprünglichen Intention eigentlich nicht den extrazellulären Raum simuliert, durch den das Axon seinen Weg findet, sondern das Nervengewebe, wäre interessant, ob es aus neurophysiologischer Sicht im Gehirn auch innerhalb des Nervengewebes ein Wegfindungsproblem gibt. Unter letzterer Annahme simulierten die Kämmsignale meines Modells nicht das Axon-Pathfinding, sondern nur die Synapsenumcodierung. Gibt es solche Wegfindungs-Mechanismen innerhalb des Nervengewebes im Gehirn? Derartige Mechanismen würden nur dann notwendig, wenn das Gehirn fähig wäre, Distant Connections über andere Neuronen hinweg (poly-synaptic) aufzubauen. Dann müssten die Neuronen einander nämlich erst finden. Tatsächlich gibt es genügend Hinweise auf eine solche Fähigkeit. Schon Hebb geht von der Existenz kettenartiger Lernverbindungen aus, siehe Grafik. Hebb (1972): “Now the mechanism of association diagrammed in Figure 29 requires that the axon a must be close to b, so it can help to fire it, before the learning begins. How often would this be so? Not often, surely. And when we talk about an association between two perceptions (e.g., sound and light in the sensory preconditioning experiment), we must suppose that a numberof single-neuron contacts are required – a single neuron a could not reliably excite all the neurons making up the group B. It is not likely that any brain activity has such contacts with any other brain activity, to make direct association possible. But if Ain Figure 29 does not have such potential connections with B, it will have many other connections already formed (the associations of common experience), including one with some process C or Dwhich can connect with B. When a direct A – B connection is impossible, an A – C – B or A – C – D – B connection may be formed instead (Fig. 30). A can excite B, but indirectly.“ 22 Figure 30. Direct and indirect associations. Left: some axons from neurons in group A end close enough to neurons in group B so that a direct A-B connection can be established when the two are active together. Right: no axons from A approach B, but among A's many connections (associations from common experience) is one with C, which is connected with D, whose axons do reach B and thus make a connection A -C-D-B possible. Intrakrinelle Konditionierung: Das Gehirn scheint tatsächlich die Fähigkeit zu besitzen, beliebige Verbindungen herzustellen, und zwar in einer Geschwindigkeit, die zu schnell ist, um Axon-Wachstum als Verbindungsursache anzunehmen. Dies kann durch Koditionierung per Elektrodenreizung im Gehirn gezeigt werden. Dabei wird über eine Elektrode eine Region am offenen lebenden Gehirn des Versuchstiers gereizt, knapp bevor eine andere Region stimuliert wird. Nach einer Lernphase kann schon auf die elektrische Reizung der ersten Region ein „Voraussagesignal“ in der zweiten Region empfangen werden. (Golding et.al 2002, Milgram 2002a). Die assoziative Konditionierung, also eine Verbindung zwischen zwei Stimuli, konnte auch an Meerschnecken nachgewiesen werden (Byrne 2002, Graham 2002, Aplysia 2002). Auch die vielfach zitierten synchronen Signalrythmen (Singer 2002, SpektrumTicker 2000.06.13, Held 2002), die oft auch an entfernten Neuronen zu beobachten sind, lassen sich nur unter der Annahme erklären, dass diese ’Synchron-SpikingNeurons’ irgend eine Art der Verbindung zueinander aufbauen, und dazu müssen sie einander erst einmal finden. Wenn nicht von vorn herein eine direkte Verbi ndung vorgegeben ist, landen wir wieder beim Pathfinding-Problem. Da aus vielen Studien hervorgeht, dass auch Neuronen, die keinen direkten Kontakt zueinander haben, synchron pulsen können, ist damit indirekt belegt, dass das Nervengewebe über einen Pathfinding-Mechanismus verfügt, der eine Verbindung schafft, und damit synchrones Pulsen ermöglicht. Livingstone MS (1996) schreibt: “In the cat and the macaque monkey, cells with similar receptive field properties show correlated firing, even when their receptive fields do not overlap.” Und bei Varela F. et.al (2001) ist zu lesen: “Neurons that belong to a given assembly are linked by selective interactions. These interactions are mediated through direct or indirect (poly-synaptic) connections… …For example, in columns of the primary visual cortex separated by 2-7 mm, which have nonoverlaping receptive fields, neurons that share similar feature properties tend to synchro- 23 nisize… …Coherence has also been observed between LFPs from somatosensory and Primary motor cortex separated by an estimated cortical distance of 2 cm” Später im Text: “We have studied patients implanted with multiple electrodes in preparation for surgical resection for epilepsy… …These intracortical oscillations showed large -scale synchrony between temporal and frontal lobes that appeared only during the execution of the discrimination task.” Wright, JJ et.al. (2001) fassen in ihrem umfassenden Bericht viele Studien zusammen, und kommen zu dem Schluss: “At a scale from fractions of a millimeter to many centimeters of cortex, patches of active cells have been experimentally observed to enter into synchronous oscillation. That is, cross-correlations of pulse density, or of mean local field potential at the separated locii are maximal at zero lag. This phenomena has been widely, although controversially, considered to act as a substrate for association processes in the cortex. (eg, Eckhorn et al 1998; Singer 1994; Singer and Gray 1995; Stryker 1989; Bressler et al 1993; Livingston 1996; Miltner et al 1999; Neuenschwander and Singer 1996; Palm and Wennekers 1997; Steriade et al 1996; Gray and Singer 1989; Gray et al 1989). Such interactions depend particularly upon excitatory cortico- cortical fibres of medium to large scale.” Die Forschergruppe veranschaulicht ihre Beobachtungen mit folgender Grafik mit der daru nter angeführten Beschreibung: 24 The top left panel of figure 1 shows two representative cells within the cerebral cortex one red (an excitatory "pyramidal" cell) and one blue (an inhibitory "stellate" cell). Populations of these cells are linked together densely in the cerebral cortex. Top right panel shows the gamma band local oscillation which emerges when the locale of cells becomes sufficiently excited. The middle panels of figure 1 show how at a larger scale, these foci of excited cortex generate waves of cortical electrical activity spreading into the less excited surrounding cortical tissue (middle left panel). The resulting wave activity can be analysed by crosscorrelation, as shown in the middle right panel. Here the lag time for maximally correlated activity (with reference to the recording site shown in the left middle panel) is displayed for the extended field. It is seen that the foci of activity have entered "synchronous oscillation". The lower panels in figure 1 show the overall brain, and EEG activity as generated in simulations - from low frequency "theta" activity, through the alpha, beta and gamma ranges, to 40Hz. These progressive changes in frequency content reflect the overall level of cortical excitation. At the highest levels of excitation, the self -excited cortical state described in the top panels has been reached. 25 2.1.3 Horizontale Verbindungen Es wird also angenommen, dass Neurone auch über andere Neurone hinweg kettenartig (polysynaptic) Signale weitergeben und eventuell auch derartige Verbindungen aufbauen, also einen Weg zueinander finden. Als nächstes ergibt sich die Frage, ob diese kettenartigen Verbindungen auch in horizontaler Richtung vorliegen, wie es für mein Signalflussmodell des Gehirns notwendig wäre. Wenn es um die Verbindungsanatomie des Gehirns geht, so erfährt man meist, welche Ebenen der Gehirnrinde vertikal zu welchen anderen Ebenen und Arealen senden. Dass innerhalb der Ebenen die Neurone hauptsächlich horizontal zueinander projizieren, wird oft verschwiegen, weil es den Anatomen meist darum geht, zu zeigen in welchen Hirnarealen die Signale letztendlich landen. Die Verarbeitung innerhalb der Areale lassen sie dabei unbeachtet. In der folgenden schematischen Schnittdarstellung der Gehirnrinde sehen wir die horizontalen Verbindungen, wenngleich deren zahlreiche Verzweigungen nicht dargestellt wurden (Aus Fulton 2001). Wie vielverzweigt die horizontalen Verbindungen exakt verlaufen, wurde am Sehsystem bereits erforscht. Es bilden sich, genau wie in meinem Modell, Quasiebenen. Neuronen innerhalb einer Ebene des Gehirns bilden Netze miteinander. Die folgende Studie zeigt, dass sich Neuronen einer Konturrichtungsselektivität (Balkendetektoren) stärker miteinander verbinden, als zu jenen anderer Ausrichtung. Sie bilden also eine Quasiebene innerhalb einer Gehirnebene. Genau dazu wird auch mein Modell führen. (Bosking et.al 1997) “Orientation Map and Lateral Connec tions in Tree Shrews” (color figure). Die Abbildung zeigt die richtungsspezifische Reaktion von Neuronen im Rindenbereich des Gehirns, wo die Seheindrücke weiterverarbeitet werden. Es wurden Streifenmuster angeboten, und mit spannungsabhängigen Markerfarbs toffen wurde die 26 Reaktion auf verschiedene Richtungen abfotografiert. Die Bilder wurden eingefärbt überlagert, so dass die Farben die Richtungssensibilität der Zellen kennzeichnen. Weiters wurden mittels Färbemethoden die Bereiche schwarz markiert, in die die Axone der weiß markierten Neurone wandern. So kann gezeigt werden, dass Neurone gleicher Richtungssensibilität miteinander in Verbindung stehen und einander horrizontal Signale weitergeben. Das entspricht der Quasiebene, die sich in meinem Modell allei n durch die Umsetzung der Konditionierungsregeln bildet, wenn wir einzelne Neuronen bereits als Reize betrachten. Dass der Sinn hinter diesem Assoziationsfeld der Balkendetektoren darin liegen dürfte, längere Konturstücke als eine Einheit zu erkennen, haben andere schon vor mir vermutet. Es gibt sogar bereits Computersimulationen dazu, wie die von Lovel (2002) aus der ich folgende Abbildungen entnommen habe. Die Abbildung links zeigt ein Muster mit einem hervortretenden zusammenhängenden Konturstück. Di e Abbildung rechts erklärt die zugrundeliegenden Verbindungen (bzw fehlenden Verbindungen), durch die ein solches Konturstück als zusammenhängend erkannt werden kann. 2.1.4 Wellen im ausgereiften Gehirn Kehren wir noch einmal zurück zum dem Phänomen der snchron-spiking Neurons im Gehirn. Zweifelsohne brauchen entfernte Neuronen irgend einen Kontakt über eine „polysynaptic Route“ zueinander, um ein identisches Impulsmuster zeigen zu 27 können. Nun ergibt sich die Frage, ob ein solcher Kontakt, wie in meinem Model l, auch im Gehirn durch Kämmsignale entsteht, die sich über größere Bereiche der Gehirnoberfläche rundum ausbreiten, so wie die Ladung des Luftraumes dem Blitz vorangeht? Im Fall der Axon Guidance geht man von Ca2+ Wellen aus. Aber spielen solche Wellen auch eine Rolle im Aufbau von Lernverbindungen des erwachsenen Gehirns innerhalb des Nervennetzes? Die kettenartige Wanderbewegung von Gehirnwellen über den gesamten Kortex, und damit über das horizontale Verbindungsfeld einzelner Neuronen hinaus, ist schon lange bekannt. So schreibt Freeman 1958: “It is now widely accepted that a surface’ positive wave represents an ascending depolarization, whereas a surface’ negative wave represents depolarization moving from the surface to the base. While this analysis is useful for describing the electrical activity of many parts of the nervous system, e.g., peripheral nerve (16) and some central nuclei (17), it does not appear to be valid for the prepyriform evoked potential. This potential is distinct from those systems in that it moves tangentially over the surface without an initially positive wave, until the borders of the cortex are reached. The total distance of spread (up to 14 mm. or more) is greater than the horizontal extension of the indigenous cells.“ Aber erst in jüngster Zeit ist durch spannungsabhängige fluoreszierende Farbstoffe, die es ermöglichen die Aktivität am geöffneten Gehirngewebe in vivo zu beobachten, klar geworden, dass der Eindruck von wellenförmiger Signalausbreitung (Gehirnwellen) nicht bloß durch die Unschärfe der elektroenzephalographischen (EEG) Untersuchung entsteht. Es hat sich gezeigt, dass das EEG viel schärfere Bilder liefert als man annahm (Spektrum-Ticker 2001.07.13), und dass auch in wirklich scharfen, hochauflösenden Abbildungsverfahren mit spannungsabhängigen Markern wellenartige Signale zu beobachten sind, die die Oberfläche der Areale durchlaufen. Gochin et.al. “Our results suggest that input projections are usually restricted to less than 500 micron patches and are then distributed over greater distances by intrinsic connections.” Vor allem in Prechtls Studien an der Taube konnte mittels Voltage Sensitive Dyes wunderbar die wellenartige Signalausbreitung am Gehirn aufgezeichnet werden (Prechtl et.al. 1997). 28 Der Bildbeschreibung ist zu entnehmen, dass die Bildfolge insgesamt einen Zeitraum von etwa einer Sekunde umfasst. Auch mit neueren multielectrode Recordings sichert Prechtl seine Aufzeichnungen zu den Wellenbewegungen ab (Prechtl et.al. 2000). OOyen et.al. (1992) beobachten ebenfalls solche „Long-Lasting Transients“ im EEG, und suchen die Antwort nach der Herkunft dieser langsamen Wellen in Calciumflüssen. Diese Annahme argumentieren sie folgendermaßen: „Since such slow waves can last as long as several hundred millisec onds, their duration cannot be derived from the classical IPSP ((unitary inhibitory input) duration of ca. 100 ms and EPSP (unitary excitatory input) duration of ca. 25 ms, as can be done for EEG fluctuations in the alpha frequency range (Lopes da Silva et. al., 1974). Therefore, the question arises whether slow waves basically emerge from interactions in a network of neurons, are a direct consequence of intrinsic membrane kinetics of single neurons (Steriade et al. 1990). Ion channels with slow kinetics (e.g. a long-lasting (200-500 ms) calcium-mediated potassium conductance (Connors et al., 1982) may be candidates for such intrinsic kinetics.” El-Bab (2001) fast den Einfluss von Calcium Ionen auf die elektrisch messbaren Feldpotentiale wie folgt zusammen: 29 An increase in the influx of positively charged cations, such as sodium or calcium, reduces the membrane potential and thus depolarizes a portion of the post -synaptic membrane. This results in an excitatory post-synaptic potential (EPSP). An influx of negatively charged anions, such as chloride or an efflux of positively charged cations, such as potassium, increases the local membrane potential and thus hyperpolarizes the posts ynaptic membrane. This produces an inhibitory post-synaptic potential (IPSP)…. The transmission of information to the brain involves the flow of ions across the neuronal membrane producing a voltage field around each active neuron. The potential difference between the postsynaptic membrane portion and the other parts of the neuronal membrane causes an electrical current to flow along the cell body and dendrites with a return current in the extracellular space. These electrical potentials summate in the cortex and extend through the coverings of the brain to the scalp. These spontaneou s electrical activities are known as electroencephalogram (EEG) and by using the electroencephal ographic technique we are able to record these voltage changes. Sich ausbreitende Wellen (Propagating Waves) sind Cohen et.al. (2000) zufolge ein allgemeines Phänomen der Gehirnrinde, und somit z.B. auch im olfaktorischen System der Taube zu beobachten. Aufzeichnungen von propagating W aves bieten auch Senseman and Robins (2002). Nenadic und Ghosh (2003) haben die Ausbreitung der Wellen bereits am Computer simuliert. Allerdings war ihnen die Idee, dass diese Wellen dem Pathfinding dienen, nicht bekannt. Ihre Simulation amt somit nur das Wellenmuster nach. “Our model is intended to replicate cortical waves imaged on the ependymal surface of the cortex with an in vitro prepatation.” Die Annahme, dass die Wellen als Förderer (Pathfinder) von Lernverbindungen dienen könnten, überprüften Zhang & Poo (2001) und kommen zu einem positiven Ergebnis. Sie unterscheiden nicht zwischen dem Axon-Pathfinding-Problem und den Lernprozessen im erwachsenen Gehirn, sondern nehmen an, dass beidem der selbe Prozess zugrunde liegen könnte (siehe letzter Satz): „Calcium waves and oscillations are found in many developing neural circuits (Garaschuk et.al 2000, Wong et. al. 1995, Spitzer et.al 2000). These Ca 2+ transients may arise from Ca2+ influx triggered by membrane depolarization or Ca 2+ release from internal stores. The widespread coupling between developing cells by gap junctions allows intercellular spread of Ca2+ and production of Ca2+ waves through regenerative Ca 2+-induced Ca 2+ release from internal stores, independent of plasma membrane depolarization. Moreover, Ca 2+ waves through electrically coupled glial cells may result in secretion of factors that regulate maturation and functions of synaptic connections (Ullian et.al 2001). In developing neurons, Ca 2+ transients modulate nerve growth (Spitzer et.al 2000) and stimulate neuronal differentiation (Ghosh & Greenberg 1995, Zucker 1999) … … However, recent findings have shown that electrical activity may be required for growing thalamic axons to reach their appropriate cortical target area (Catalano & Shatz 1998) and for axons of cortical pyramidal neurons to form layer-specific intracortical connections (Dantzker & Callaway 1998). In these latter studies, it is difficult to determine with certainty whether the activity is involved in axon path finding per se or target selection of the axon after it has reached the target cell. 30 2.1.5 Unverbrauchte Reserve-Verbindungen Wenn wir davon ausgehen, dass die Ca²+ Waves dazu dienen, dass aktive Neuronen zueinander einen Verbindungsweg finden, so müssen wir zwischen den vorübergehenden Verbindungen unterscheiden, die der Weitergabe der Waves, also der Kämmsignale dienen, und jener bleibenden Verbindung, die danach zwischen den aktiven Neuronen hergestellt wird. Es gibt Hinweise auf eine solche Unterscheidung. Atwood & Wojtowic (1999) zeigen, dass das Gehirn voll von Silent Synapsen ist, die scheinbar durch Ca²+ Waves aktiviert werden können. “In several nervous systems, evidence from electrophysiological and optophysiological measurements has established a strong case for the existence of silent synapses and for their emergence as active synapses with appropriate stimulation. During normal development and aging, synapses of individual neurons change in number, and many of these may be functionally silent at certain stages of their developmental trajectory. Changes in their status may contribute to shaping the properties of neural pathways during development, often in response to neural activity… …Regulatory proteins, including synaptota gmin (a putative Ca 2+ receptor) and cysteine string proteins that appear to affect Ca 2+ sensitivity of release processes, modify the rate and calcium sensitivity of release.” Es ist allgemein bekannt, dass im Gehirn beim Lernen Langzeitpotentiale ausgelöst werden. Magarolis Gruppe (2001) zeigt, dass dabei Stille Synapsen aktiviert werden: “It is still unclear whether the changes that take place in long -term potentiation can be accounted for by modulations in the strength of this communication or whether new connections are made. Dr Malgaroli’s group has found evidence that some of these modulations can be explained by the recruitment of non-functional or mute synapses… …In hippocampal neurons around thirty percent of the synaptic terminals seem to be non -functional after stimulation.” Zu dem selben Ergebnis kommen auch Rumpel et. al 1998. “In the developing visual cortex activity-dependent refinement of synaptic connectivity is thought to involve synaptic plasticity processes analogous to long-term potentiation (LTP). The recently described conversion of so-called silent synapses to functional ones might underlie some forms of LTP… …The incidence of silent synapses strongly decreased during early postnatal development… …This conversion of silent synapses to functional ones might play a major role in activity-dependent synaptic refinement during development of the visual cortex.” Außerdem zeigen neuere Experimente mit fluoreszierenden Genmarkern, dass von den etwa 10-tausenden Synapsen einer Nervenzelle nur ein paar Duzend wirklich der Langzeitspeicherung dienen, während der Rest nur für eine mögliche Belegung veranlagt ist (Spektrum-Ticker 1999.11.29). Die Frage ist, wie sollten diese veranlagten Potentiale denn genützt werden, wenn nicht durch einen Pathfinding Prozess, der zu neuen Verbindungen führt? 31 2.1.6 Großflächige Modulation der Synapsen. Wenn eine verteilte Aktivität (das Kämmsignal, bzw. propagating wave) dazu dienen soll, dass zwei (oder mehrere) aktive Neuronen einen Verbindungsweg zueinander finden, so muss die die verteilte Aktivität bereits zu vorübergehenden SynapsenModulationen führen, um die Pfadrichtung vorzugeben. Verteilte (spread) Snapsen Modulationen sind bekannt, wenngleich noch nicht bestätigt werden kann, dass sie für das Pathfinding von Verbindungen dienen, indem sie die Kämmrichtung vorgeben. Heutige Untersuchungsmethoden scheinen ungeeignet eine derart konkrete Theorie zu bestätigen. In ihren Studien zur verteilten Synapsen -Modulation kommen Fitzsimonds et.al (1998) zu folgendem Schluss: “Intra- and Intercellular Spread of Synaptic Modulation: Activity-dependent synaptic modification occurs not only at the active synapse but also affects other nearby synapses. If the spread of synaptic modulation is due to intracellular signals during the induction or expression of the synaptic changes, only synapses associated with the pre- or postsynaptic cells will be affected. However, secreted or membrane-permeant diffusible factors produced by the active synapse may spread through the extracellular space to affect nearby synapses on different populations of cells. Indeed, both intra- and intercellular spread of synaptic modulation has been reported. Such spread directly affects the spec ificity of activity-induced synaptic changes and are likely to be important for developmental and adult synaptic plasticity.” 2.1.7 Rückläufige Signale. Kontaktfindung ist aber meinem Modell zufolge mit der Ausbreitung von Waves, und der damit einhergehenden Synapsenmodulation noch nicht beendet. Diese Prozesse sorgen erst einmal für die Vorgabe der Kämmrichtung. Nun ist aber auch noch eine rückläufige Verbindung vom Empfänger zum Sender notwendig, um einen Kontakt zwischen den Beiden herzustellen. Wenn wir das System mit einem Blitz vergleichen, so ist zuerst die Ladung des Raumes notwendig, und dann erst läuft der Blitz den vorgezeichneten Weg entlang. Rückläufige, retrograde Meldungen von Empfängerneuronen zum Sender, auch Backporpagation genannt, sind, entgegen der Meinung älterer Lehrbücher, durchaus bekannt. Es gibt verschiedene chemische Botenstoffe, die in Frage kommen. Elektrische Signale sind allerdings nicht zu erwarten, denn die Rückmeldungen dienen dem Umbau der synaptischen Kontakte, und ein solcher erfolgt im Gehirn chemisch. Der Blitz ist also in diesem Fall chemischer Natur, und wandert eher langsam zurück. In einem künstlichen System würden wir aber trotzdem elektrische Signale verwenden, um zu einer Kontaktfindung zu kommen. Die künstlichen Neuronen müssten durch eine Verschaltungseinheit simuliert werden, die auf rücklaufende Signale anders reagiert als auf vorwärts gerichtete. Im Gehirn ist das dadurch geregelt, dass es sich um einen ganz anderen Signaltyp handelt, der zurückläuft. Fitzsimonds et. al (1998) veröffentlichten eine umfassende, öffentlich zugängliche, Zusammenfassung mit über 300 zitierten Studien, die 32 Hinweise zur Annahme retrograder chemischer Signale geben. Sie kommen zu folgendem Schluss: “Bidirectional communication between a neuron and its postsynaptic cell is essential for the development, maintenance, and activity-dependent modulation of synaptic connections.” Und weiter: „There are three forms of retrograde signaling at the synapse: 1) signaling by membrane permeant molecules, 2) signaling by secreted factors, and 3) signaling by membrane-bound factors (see Fig.1 and sect. IV, A-C).“ Activation of postsynaptic transmitter receptors results in an influx of Ca2+ (through transmitter receptor channels or voltage-dependent Ca2+ channels) or a release of Ca2+ from internal stores. Elevation of Ca2+ triggers a cascade of events (broken arrowed lines) that eventually leads to 3 forms of retrograde signaling to presynaptic neuron: production of membrane-permeant diffusible factors (e.g., nitric oxide and arachidonic acid) that diffuse from post- to presynaptic neuron (A), exocytic secretion of soluble factors (e.g., neurotrophins) that diffuse across synaptic cleft to activate presynaptic membrane receptors, which may in turn be internalized and transported to nucleus and other parts of neuron (B), and modulation of postsynaptic membrane proteins, which are physically linked to presynaptic membrane receptors either directly or indirectly (via extracellular matrix molecules), resulting in activation of presynaptic receptors (C). All 3 forms of presynaptic actions may lead to modulation of transmitter secretion machinery or production of downstream cytosolic factors (X) for long-range retrograde propagation to nucleus and other parts of neuron. Ich denke die Grafik zeigt bereits die ganze Komplexität des Themas. Es ist nicht zu erwarten, dass in nächster Zeit klar erkannt werden kann, welche Rolle welcher chemische Mechanismus des Gehirns im Rahmen des Erkenntnisgewinns spielt. Aber das Beispiel zeigt, dass die Mechanismen zahlreich sind, und durchaus komplex genug, um die Vielfalt der Funktionen zu übernehmen, die ich aus meinem analytischen Zugang für ein erkenntnisgewinnendes System, wie es das Gehirn ist, für notwendig erachte. Abgesehen von den chemischen Botenstoffen an der Synsapse ergibt sich auch die Frage nach dem Rücktransport durch die Zellen. Bei Fitzsimonds et. al (1998) ist dazu zu lesen: „Long-range retrograde transport of neurotrophins and other ligand-receptor complexes may thus also be viewed as merely an intermediate step in an extensive intercellular exchange and propagation of protein signals within the neuronal network. Another potential mechanism for propagating retrograde signals over long distances is the use of regener ative waves of second messengers in the cytoplasm. These waves can be generated at the local sites of reception of retrograde factors and propagate over long distances across the 33 entire cell, with a speed in the range of 8-100 µm/s (256). The most dramatic example is the Ca2+ wave… Calcium waves can be generated in oocytes by internal release of Ca 2+ by activation of muscarinic receptors or by injection of InsP 3 (46, 209). Calcium waves were also observed in neurons (146, 180) and in large networks of cells coupled by gap junctions, e.g., developing cortex (367), vascular endothelial cells (179, 311), myocytes (340), hepatocytes (308), and astrocytes (74, 88).” (Literaturverweise siehe: http://physrev.physiology.org/cgi/content/full/78/1/143) Eine neuere Studie zu den retrograden Signalen während der Long -Time Potentiation findet sich bei Huizhong W. Tao and Mu-ming Poo (2001). Zur Frage des Transportes rückläufiger Signale findet sich darin folgende zusammenfassende Stellungnahme: „It is possible that a transsynaptic retrograde signal, generated after the induction of synaptic plasticity, triggers another cytosolic signal that propagates throughout the presyna ptic neuron, or the retrograde signal itself serves as the propagating signal… …Regenerative waves of second messenger (e.g., Ca 2+, InsP3, cAMP) can be good candidates, because it is known that these waves can be generated at local sites and prop agate over long distance across the entire cell.” Abgesehen von den chemischen Hinweisen auf rückwirkende Signale, wie sie zur Kontaktfindung zwischen zwei entfernten aktiven Neuronen im Netz notwendig wären, gibt es auch der komplexe Ablauf an elektrischen Impulsen und Wellen, die bei einer fokalen Reizung zweier Punkte in einem Neuronengewebe zustande kommt, Anlass zur Annahme eines Wegfindungsprozesses. Neuronengewebe kann in Nährlösungen gezüchtet werden, und auch Gehirngewebe lässt sich längere Zeit am Leben erhalten. So können ex-vivo Untersuchungen durchgeführt werden, die den Einsatz von technischem Equipment erlauben, der am lebenden Gehirn nicht möglich ist. Marom & Shahaf (2002) fassen die Ergebnisse solcher Studien zusammen. Zum Thema „Response to focal stimulation“ schreiben sie: S.74: “When focal stimulation is applied to a network, for example, by passing current between two adjacent electrodes, or between an electrode and a distand reference point, the network responds by producing a propagating wave of activity. The response is built of three clear components … The early component appear with the same time delay relative to stimulus onset with sub millisecond precision … It is followed by a period with low spike probability … Then comes the late component, a ‘reverberating wave’ that can la st for hundreds of milliseconds.” S. 67: “Potter & DeMarse (2001) developed a technique that allows networks to survive for over a year” 2.1.8 Kettensignalfluss und Signalfließzeit Die spannungsabhängigen Aufnahmen im primären Sehsystem von Bosking et al. (1997), die ich weiter oben zitiert habe, zeigen, dass Balkendetektoren gleicher Ausrichtung sich miteinander Kettenartig verbinden, was ich als Quasiebene bezeichnet habe. In meinem Modell nehme ich an, dass über solche kettenartige Verbindungen Signale fließen, und dass dieser Kettensignalfluss zur Zeitcodierung der Bildinformation führt. Gibt es neurophysiologische Hinweise hierzu? Es müsste doch feststellbar sein, dass eine längere Linie ein längeres Signal sendet, als eine 34 kurze. Dass dies genau so ist, zeigen Kapadia Ableitungsexperimenten. Sie fassen die Ergebnisse mit zusammen: et.al in ihren folgender Grafik Eigentlich prophezeit mein Modell auch eigene Voraussage-Fehler-Signale an Konturwinkeln, denn auf der Ebene der Balkendetektoren wird Geradlinigkeit vorausgesagt. Aniruddha und Gilbert haben solche Signale verzeichnet. Allerdings teile ich nicht ihre Annahme, dass auch in diesem Fall dauerhaft verankerte Verbindungen in Form einer Map entstehen können, was sie auch nicht nachweisen konnten. Dauerhafte Connections sind aufgrund der statistisch geringen Auftrittshäufigkeit eines gleichen Winkels auf der selben Bildposition den Lerngesetzen zufolge unwahrscheinlich. „Neurons in primary visual cortex (V!) respond differently to a simple visual eleme nt presented in isolation from when it is embedded within a complex image… …Here we study the role of short-range connections in this process… …The strength of this contextual influence on a neuron can be predicted from a model of local connections based o n simple overlap with particular features of the orientation map… …This indicates that (for e xample) the parameter of corner processing could also form a functional map over the cortical surface, similar to and closely linked with the familiar maps of orie ntation and space.” Die Idee, dass Signalfließzeiten räumliche Distanzen und zusammenhängende Formen codieren, habe ich auch in einer neurophysiologischen Arbeit untersucht gefunden. Eckhorn R. (2000) kommt zu dem Schluss, dass eine solche Idee plausibel erscheint. Er schreibt: “It starts from the hypothesis that synchronization and decoupling of cortical gamma activities (35-90 Hz Waves) define the relations among visual objects ... Synchronization, 35 measured by spectral coherence, is restricted to few millimeters cortex. Such patches of gamma-synchronization become de-coupled across the representation of an object's contour, and thereby can code figure-ground segregation. … Spike transmission delays, increasing with cortical distance, can explain the restriction of gamma-coherence to patches of few millimeters cortex. … Our results and those of others are supportive for the hypothesis that phase-coupled gamma-signals can code feature grouping and object continuity. Wenn Signalflüsse zu Zeitcodierung führen, so müssten die Signalmuster, die über den Kortex entlangwandern, anderswo verspätet, also Phasenverschoben ankommen. Es wird immer so viel von synchronen Signalen gesprochen, aber sind sie wirklich synchron? Tatsächlich sind sie anscheindend phasenverschoben. Die folgende Studie von Ermentrout et. Al. (2001) bringt dieses Thema auf den Tisch und schlägt drei Möglichkeiten vor, diese Phasenverschiebungen zu erklären: Wenn sich die Autoren dann entschließen, die dritte Möglichkeit zu simulieren, so hat das aus meiner Sicht damit zu tun, dass sie bei der zweiten Möglichkeit nicht viel zu simulieren gehabt hätten, sondern vielmehr eine Erklärung dafür benötigen würden, woher der Signalrhythmus im ersten Neuron kommt. Mein Modell führt zu solchen Rhythmen und bietet eine Erklärung für den Rhythmus im ersten Neuron, also bin ich der Ansicht, dass im Gehirn Fig.b umgesetzt ist. Einig bin ich mir mit den Autoren in Ablehnung der Möglichkeit Fig.a. Sie stellt, so die Autoren, nur eine scheinbare Bewegung von Signalen dar. Dass Signale wirklich horizontal wandern zeigen die Autoren danach mit Untersuchungen am visuellen System. Sie sprechen von „Traveling Waves“. Im visuellen System existieren gar nicht genügend „Long Range Connections“, als dass Fig a als Lösung in Frage käme. Ich habe in meinem Modell das Thema der kettenartigen Signalweitergabe bereits aus psychologischer Sicht behandelt. Wir erinnern uns, dass ich dazu eine ähnliche Grafik gezeigt habe. 36 Ich habe mich auf Experimente zur assoziativen Konditionierung berufen, die die Möglichkeit von einer Verschaltung wie in Fig.a ausschließen. Zu dem Schluss, dass wandernde Signale dem Synchronisationsphänomen zugrunde liegen, kommen auch Funahashi, M. und M. Steward (1998) in Studien an Brain-Slices. „We show that synchronous gamma (40-100 Hz) activity follows population bursts by deep layer retrohippocampal neurons in undrugged slices from rat brain. … These events can be initiated by a propagating population spike.” Von der Retina der Taube wurden bisher die besten Bilder wandernder Wellen aufgezeichnet (siehe oben). Du and Ghosh (2002) haben sich gefragt, ob die Wanderwellen klar genug sind, um damit zum Beispiel die örtliche Position von Lichtpunkten zu bestimmen. Sie nützen dabei die Zeit, die das Signal brauch t um den Raum zu durchwandern, zu Positionsbestimmung. Genau wie in meinem Modell handelt es sich also um eine Zeitcodierung räumlicher Information durch Signalfließzeiten. Sie haben die Idee, dass derartiges im Taubenhirn stattfindet anhand der Bilder von Calcium-Waves am Computer modelliert und bestätigt: „The goal … is, to verify that the position of a spot of light incident on the retina of a trutle is envcoded by the spatiotemporal dynamics of the cortical waves they generate … Extracellular recordings from the visual cortex of freshwater turtles have shown that neurons at each cortical locus are activated by visual stimuli presented at every point in the binocular visual space, although the latency and shape of the response waveforms vary as the stimulus is presented at different loci in the visual space. … A visual stimulus … produces a wave of depolarization that propagates anisotropically across the cortex. This raises the possibility that visual information is coded in the spatiotemporal dynamics of the cortical waves. Subsequentliy, travelling electrical waves have been observed not only in turtle visual cortex, but also across olfactory, visual and visuomotor areas of cortex in a variety of species (Ermentrout, G.B. and D. Kleinfeld 2001).” Zuletzt bleibt noch die Frage, ob das Gehirn überhaupt fähig ist schnelle Abläufe, wie die Wanderbewegungen von Wellen, zeitlich auszuwerten. Laut Hubel (1989, S. 28) fließen Signale im Gehirn O,1 bis zehn Meter pro Sekunde. Das ist langsam, wenn wir bedenken, dass das Gehirn durchaus in der Lage ist, das verspätete Eintreffen des Schalls, beim abgewandten Ohr zur Ortung einer Schallquelle zu nützen (Möckel u.a.1995). Wie das Gehirn dies mit langsamen Bauteilen schaffen könnte zeige ich in meinem Modell zum Hören. 2.1.9 Chunkzellen Lernexperimente bei gleichzeitiger elektrischen Ableitungen von Neuronen der Großhirnrinde haben gezeigt, dass es in Lernprozessen durchaus zur Bildung von Chunkzellen kommt. Als Chunkzelle bezeichne ich ein Neuron, oder eine Neuronengruppe, die nur bei Auftreten einer erlernten Reizverbindung aktiv wird, nicht jedoch auf die einzelnen Reize. Damit Neuronen dies können, müssen sie durch den Lernprozess erst dementsprechend verdrahtet werden. Messinger et.al (2001) zeigen in ihren Studien, dass im Gehirn derartiges passiert. 37 “We recorded neuronal activity in the anterior IT cortex of two monkeys during the learning of visual-visual associations. The monkeys performed a paired-associate task in which one stimulus from a pair (the cue) was presented and the monkey had to select the other stimulus from that pair (the paired associate) to receive a juice reward.” “We found that many neurons in both area TE and perirhinal cortex came to elicit more similar neuronal responses to paired stimuli as learning proceeded. Moreover, these neuronal response changes were learning-dependent and proceeded with an average time course that paralleled learning. This experience-dependent plasticity of sensory representations in the cerebral cortex may underlie the learning of associations between objects.” Für long-term-Memory von Stimulus-Stimulus-Verbindungen Neuronen sprechen bereits Studien von Miyashita Y (1988). durch konkrete Neben zeitlich aufeinanderfolgenden Stimuli, gibt es ja auch Stimuli, die nicht zeitlich sondern nur örtlich getrennt sind. Was oft örtlich nahe aufeinander auftritt wird genauso verbunden, denn örtliche Nähe zählt so viel wie zeitliche. Das erste was aus solchen Lernprozessen hervorgeht, sind Chunks zur Erfassung von oft auftretenden einfachen örtlichen Relationen von Konturen. Wir nennen dies „Formen“. Gibt es eigentlich Neuronen, die auf Grundformen ansprechen? Schmoesky (2003) hat im visuellen System derartige Neuronen gefunden. Er schreibt dazu zusammen mit Leventhal (1998): “ The issue here is how the brain encodes a stimulus boundary (e.g., a square) when the visual cue that defines that boundary (e.g., color, luminance, texture, motion, illusion, etc.) is varied. As Gestalt psychologists would note, the stimulus is very differe nt in each of these cases but the fundamental percept, the square, remains the same. We asked two fundamental questions. First, are there V1 or V2 cells in cat and monkey capable of responding in a similar fashion to a boundary regardless of the cue defini ng it? … Second, if such cells exist are they equally prevalent in V1 and V2? Our results demonstrated that a subpopulation of cells in both regions can respond to a stimulus boundary, such as an oriented bar, in a cue-invariant manner, though this property was rare in V1 while prevalent in V2. Figure 26. Example of a cue-invariant cell in cat area 18. This cell responds with the same degree of orientation bias and to the same preferred orientation regardles s of whether the bar is defined by simple luminance (top), texture (middle) or isoluminant gratings (bottom). From Leventhal et al. (1998). (27 K jpeg image) One conclusion from this work is that cells in the very first stage of cortical processing are already capable of responding to a single stimulus boundary in a complex manner that allows for object detection even as the cues defining the object change, or are partially occluded (Leventhal et al., 1998). 38 Aber sind denn solche Leistungen dem primären visuellen System überhaupt zuzutrauen? Neuere Untersuchungen zeigen, dass auf V1 viel mehr stattfindet, als bisher angenommen. V1 dient zum Beispiel auch als Arbeitsspeicher (Spektrum Ticker 2001.07.10). Trotzdem sei hier darauf hingewiesen, dass eine Leis tung, wie die Erkennung eines Quadrates, auf so niederiger Stufe der visuellen Verarbeitung kaum anders zu erklären ist, als durch mein Modell der Kettensignalfluss Zeitcodierung. Für alles andere sind zu wenige Long-Distance-Connections vorhanden, denn für die Vielzahl möglicher Grundformen und Positionen müssten davon unzählige existieren oder zumindest müsste ein Neuronennetz, das dies leistet, über erheblich mehr Ebenen verfügen. Dass im visuellen System Neuronen gefunden wurden, die auf eine bestimm te Form, wie ein Quadrat ansprechen erinnert etwas an das Modell der „Großmutterzelle“, das in der Gehirnforschung heute nur belächelt wird. Es ist die Idee, dass für jedes Objekt ein Neuron im Gehirn zuständig sei. Sicherlich ist die Idee einer bedeutsamen Zelle lächerlich, denn die Bedeutung kann erst im Netz an Verbindungen entstehen, die zu Zukunftsprognosen führen, Empfindungen (Körpersollwertabweichungen) assozieren lassen und Motorik auslösen. Aber es spricht tatsächlich viel dafür, dass das alles an einem konkreten Ort zusammenläuft, wo dann sozusagen der jeweilige Begriff repräsentiert ist. Wie sonst sollten Begriffe ihrerseits wieder Lernverbindungen miteinander eingehen? Viele Untersuchungen weisen sehr klar darauf hin, dass Neuronen für Begriffskathegorien gibt. Die erste und bekannteste stammt von Penfield (1963), ein Versuch, den man aus ethischen Gründen nicht jederzeit nachstellen kann. El-Bab (2001) fast diese Studie wie folgt zusammen: “Penfield was able to electrically stimulate areas of the cortex of patients who were awake while undergoing surgery for focal epilepsy. He found that the stimulation of temporal lobes led most of these patients to experience very vivid and realistic images. These often involved hearing music, somebody's voice, such as when one person said, " I hear someone talking... I think it was about restaurant or something" Penfield assumed that subjects were in fact recalling past events that had happened to them, and proposed that memories are stored at very precise cor tical locations (as in computer’s memory), and can be stimulating with a small electrode in contact with that location.” Auch neuere Untersuchungen an Tieren sprechen für örtlich relativ konkrete Repräsentationen. So fand Christof Koch sogenannte „face cells“ (Birbaumer 1996, S.405, Bremen 1998, Cross 2000, Recht 2000) und es gibt im Gehirn Neuronen für Eigenschaften wie einen bestimmten Augenabstand (Spektrum-Ticker 2002.01.22), sowie Neuronen für andere Objektkathegorien oder bestimmte Formen (Goldstein 1997, S.104, WSA 2001.10.04, Doerfler Alex 2001). Weiters zeigen Untersuchungen, dass neue Eindrücke neue Nervenzellen verbrauchen, um gespeichert zu werden (Spektrum-Ticker 2001.03.20). Wir dürfen also durchaus annehmen, dass einer neu erlernten Verbindung auch ein Platz zukommt, an dem sie repräsentiert ist. Ein ganz wesentliches Element in 39 meinem Modell ist weiters, dass Verbindungen, die bereits erlernt sind, dadurch zu erkennen sind, dass sie bereits die richtigen Voraussagen liefern. Sie brauchen nicht noch einmal erlernt werden. Das bedeutet, wo richtige Voraussagen getroffen werden, braucht keine Weitergabe der Signale an höhere Voraussageeinheiten stattfinden. Genau diese Idee greifen Legenstein et.al auf, um das Verhalten von Neuronen zu erklären. “Reports from sensors which had already been autonomously predicted by the system, need not be transmitted to higher-level areas, since they provide no new information to the organism. This allows the higher-level areas to focus on the most far-reaching predictions and abstractions.” 2.1.10 Regelkreisprinzip. Ich gehe in meinem Modell davon aus, dass es im Gehirn ein Lust/Unlust -Zentrum gibt, wo körperliche Sollwerte überprüft, und Abweichungen sowie Annäherungen gemeldet werden. Die Abfolge von Reizen der Aussenwelt, und die damit einhergehende Abfolge von Sollwertannäherungen und Abweichungen führen bei wiederholten Vorgängen zu Lernverbindungen, über die solche Abfolgen in Zukunft vorausgesagt werden können. Vom Lust/Unlust Zentrum kann über solche Verbindungen ein Signal von der vorausgesagten Zukunft zur Gegenwart zurückfließen, und je nachdem ob es ein hemmendes oder erregendes Signal ist, kann die vorgestellte Zukunft Handlungen verstärken oder schwächen. Eine Handlung, die zu einem erregenden Signal in diesem Lustzentrum führt, wird beibehalten werden, denn dies besagt, dass sie für die Beibehaltung der Körpersollwerte sorgt. Was aber, wenn wir ein solches Lustsignal künstlich im Gehirn erzeugen? Dann wird das Versuchstier die Handlung beibehalten, die zu dem Signal führt, denn das Signal kommt aus dem Lustzentrum, und damit steht es für die Erreichung von Körpersollwerten. Dass das künstliche Signal keine sinnvolle körperliche Wirkung repräsentiert, kann das Tier nicht wissen. Soweit die Theorie. Aber gibt es wirklich das Phänomen, dass das Pressen einer Taste für das Versuchstier zu einer sinnvollen Handlung wird, nur weil sie ein Signal am richtigen Fleck des Gehirns bewirkt? Tatsächlich ist es so. Shizgal & Conover (1996) befassen sich mit diesem Phänomen. Sie schreiben: “The self-stimulating rat presents a compelling spectacle. Having been trained to press a lever that triggers intense, continously available stimulation of a "hot" site in the medial forebrain bundle, the rat works in a frenzied, insatiable fashion, even at the cost of forgoing its sole daily opportunity to obtain food… … How could a signal meaningful to a rat arise from delivery of synchronous stimulation via a stout wire crudely inserted into the intricate fabric of the brain?… are there …neurons that implement a unidimensional representation of the utility of natural goal objects?” 2.1.11 Aufmerksamkeitslenkung Im limbischen System des Gehirns sitzt nicht nur das Lust/Unlust-Zentrum, sondern auch der Hippocampus. Von Personen, denen dieser Gehirnteil in beiden 40 Hemisphären ausgefallen ist, weiß man, dass dies die Lernfähigkeit beeinträchtigt. Allerdings reift dieser Gehirnteil erst im dritten Lebensjahr aus (Gruber 2000, S.122). Bis dahin hat das Kind Wahrnehmen, Bewegungskontrolle und Sprache gelernt, es kann den Tagesablauf überblicken und sich darauf emotional einstellen. Das alles sind Dinge, die durch viele Wiederholungen erlernt werden. Tier und Mensch merken sich nur dann etwas beim ersten mal, wenn es relevant ist. Bei der „Markierung“ dieser Relevanz dürfte der Hippocampus eine Rolle spielen. Das legt schon sein Sitz im Lust/Unlust-Zentrum, das man auch als Relevanz-Zentrum bezeichnen könnte, nahe. Fällt er bilateral aus, so ist es unmöglich, sich den Namen einer Person, oder einen Termin sofort zu merken, und vor allem Orte wiederzufinden. Es werden überhaupt fast alle Dinge, die man nur einmal erlebt hat, vergessen. Der Mensch verliert seinen Zeitbegriff wie wir vor dem dritten Lebensjahr. Bekannt ist dazu der Fall H.M., beschrieben bei Kolb &Whishaw (1996), S.301. Der Fall ist interessant, da H.M. die Zeit vor seiner Operation komplett erinnert, und allgemein überdurchschnittlich intelligent erscheint. In Anlehnung an den Computer galt der Hippocampus als Arbeitsspeicher bzw. Kurzzeitspeicher, wo die Information landet, bevor sie in den Langzeitspeicher, also in die Gehirnrinde, wandert. Neueren Studien zufolge könnte er aber auch nur der Aufmerksamkeitskontrolle dienen, die für die Lenkung des Gedächtnisses notwendig ist. Wir lenken unsere Aufmerksamkeit auf eine Sache, wie z.B. einen Namen, wenn wir uns dessen zukünftiger Bedeutung bewusst sind. Wiederholte Lebensabläufe müssen bereits erlernt sein, um Zukunft und damit zukünftige Bedeutung zu erahnen. Ich vermute, dass deshalb diese lernorientierte Lenkung der Aufmerksamkeit (bewusste Konzentration) erst ab vier Jahren möglich ist. Davor verschwindet die Vergangenheit im Nichts, weil nur einmal erlebte Dinge (und diese definieren Zeitpunkte) kaum Bedeutung haben und vergessen wurden. Dass der Hippocampus eher mit Aufmerksamkeit als direkt mit Lernen zu tun hat, ist auch der Schluss, zu dem Shors & Matzel (1997) in einer Überblicksstudie zu dem Thema kommen. Sie interessierten sich vor allem für die Zahlreichen Experimente zu Langzeitpotenzierungen, (LTP) die im Hippocampus auftreten. Sind diese eine Art der Informationsspeicherung, oder dienen sie nur der latenten Aufrechterhaltung der Aufmerksamkeit? Sie schreiben: “Other characteristics of LTP, including its rapid induction, pers istence, and correlation with natural brain rhythms, provide circumstantial support for this connection to memory storage. Nonetheless, there is little empirical evidence that directly links LTP to the storage of memories. In this target article we review a range of cellular and behavioral characteristics of LTP and evaluate whether they are consistent with the purported role of hippocampal LTP in memory formation… … As an alternative to serving as a memory storage device, we propose that LTP may serve as a neural equivalent to an arousal or attention device in the brain.” Page 8: “Among the more than 1,000 articles published between 1990 and 1997 that refer specifically to LTP in the title, the vast majority either imply or explicitly state in the abstractor introduction that LTP is a memory storage device… …When the search was extended back to 1974, fewer than 80 among over 1,300 articles with LTP in the title described any behavioral manipulation relevant to the assessment of memory. Given these 41 statistics, one might assume that it had been demonstrated that LTP was "the memory mechanism" and that further studies were unnecessary. In fact, many articles with a b ehavioral manipulation provide evidence to the contrary (see H ippocampus,1993, No. 2; Bannerman et al. 1995; Saucier & Cain 1995).” Die folgende Bemerkung in dem Artikel ist wieder ein Hinweis auf großflächige Signalausbreitungen (spread) im Gehirn, wie sie mein Modell zu Verbindungsfindung braucht: Seite 6: “In addition to the spread of overt potentiation to nearby synapses, changes also accompany the induction of LTP that are not limited to active synapses or even nearby synapses. For example, unilateral tetanization of the perforant pathway induces LTP in the dentate gyrus and an increase in messenger RNA (mRNA) for a presynaptic glutamate receptor on the stimulated (ipsilateral) side 2 hours later (Smirnova et al. 1993).” Neurere Studien bringen Aufmerksamkeit vor allem mit synchronen Signalen in Verbindung. Von Langzeitpotentialen (LTP) ist nicht die Rede. Aber die Studien müssen einander nicht ausschließen. Wahrscheinlich sind synchrone Signale nichts anderes als LTPs, nur bleiben sie nicht so lange aufrecht, wenn nicht ein Lernvorgang damit verbunden ist. Zu Lernvorgängen kommt es nur, wenn ein Zusammenhang sehr wichtig scheint, und die Aufmerksamkeit deshalb länger dabei bleibt. Und was haben synchrone Signale mit Gehirnwellen zu tun? Einer Studie von MCFadden (2002) zufolge handelt es sich auch hierbei um das selbe Phänomen, nur wird die Synchronizität der Impulse im Mikromaßstab der Einzelzellableitung beobachtet, und Gehirnwellen zeigen das Gesamtbild. In engem Zusammenhang mit dem Thema Aufmerksamkeit steht auch die Diskussion um Kurz- und Langzeitspeicherung im Gehirn. Kurzzeitspeicherung entsteht wohl durch Aufrechterhaltung (Langzeitpotenzierung) eines Verbindungszusammenhangs. Dabei ist Interesse im Spiel, und somit das Lust/Unlust-Zentrum, zu dem ich auch den Hippocampus zähle. Es entstehen Verbindungen (Synchronizitäten), die sich bis in verschiedenste Bereiche der Großhirnrinde erstrecken und die Verbindungen abnabeln (Lernen). Wenngleich die Aufmerksamkeit sich nur dem stärksten Zusammenhang widmen kann, (weil scheinbar nur eine Reizkette zu einem Zeitpunkt eine Verbindung zum Lust/UnlustZentrum aufbauen kann), sind andere Verbindungen, die in diesem Rennen nicht den ersten Platz gemacht haben, noch aufrecht (LTP), und die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder zum stärksten Signal werden und ins Bewusstsein treten ist hoch. Ein Zusammenhang über mehr als neun Inhalte ist im Kurzzeitspeicher nicht aufrechtzuerhalten. Vielleicht ist das deshalb so, weil sich das Signal auf die verknüpften Verbindungen aufteilt, und ab einer gewissen Zahl an Inhalten ist es unwahrscheinlich, dass die Signale noch stark genug sind, denn nur stark aktivierte Verbindungsketten siegen im Rennen um das Bewusstsein. 42 2.1.12 Übergang zu seriellem Denken Die durchschnittlich sieben Inhalte des Kurzzeitgedächtnisses versuchen Jensen & Lisman (1998) dadurch zu erklären, dass ein serieller Abruf im Gehirn existiert (siehe Grafik). Wenngleich mir ihre Hypothese etwas zu vereinfacht erscheint, hat sie doch einiges mit den Verbindungsketten und dem Kettensignalfluss gemeinsam, den ich annehme. Die Autoren stützen ihre Ansicht durch eine breite Palette an Studien, die zeigen, dass ein Inhalt des Kurzzeitgedächtnisses durch einen jeweils eigenen Zyklus an Gehirnwellen aufrechterhalten wird. Sind die Wellen weg, ist die Information vergessen. Das passt auch sehr gut in mein Modell. Sie schreiben: We have proposed that a single brain network can separately maintain up to seven memories by a multiplexing mechanism that uses theta and gamma brain oscillations for clocking. Die Autoren beziehen sich mit ihrem seriellen Modell vor allem auf ein psychologisches Experiment von Steinberg (1966). Sein Versuch sah folgendermaßen aus: „A list of items is presented rapidly. A few seconds later, a probe item is presented, and the subject answers as quickly as possible whether the probe wa s on the list. A key finding consistent with serial memory scanning is, that the average reaction time increases linearly with the number of items on the list. … (That applies as well) for “yes” and “no” answers … the answer can apparently not be given until the entire list is scanned.” Die Studie von Jensen & Lisman geht also von einer seriellen Codierung im Kurzzeitgedächtnis aus, wie sie auch ich annehme. Allerdings enthält die Studie keinerlei Idee wie es zu der Zeitcodierung kommt, und wie sie wieder in eine räumliche Form gebracht wird. Denn eines steht fest, die Langzeitspeicherung ist in der Großhirnrinde, das heißt sie liegt in Form eines räumlichen Netzwerkes vor. Es ist also letztlich eine räumliche Speicherung. 43 Mein Modell beinhaltet die fehlende Idee der Umcodierung. Es sind die Fließzeiten im Netz, die von einer räumlichen zu einer Zeitcodierung führen, und umgekehrt. Dass es solche Fließzeiten gibt, belegen weiter oben genannte neurophysiologische Studien. Dass Distanzen tatsächlich in direkter Weise zeitcodiert werden, legt unter anderem folgendes psychologisches Experiment nahe (aus Anderson 1996, S.111): Kosslyn, Ball und Reiser haben 1978 ihre Versuchspersonen eine Karte einer Insel einprägen lassen, auf der verschiedene Objekte eingezeichnet waren. Die Versuchspersonen sollten sich ein Objekt auf der Karte in Erinnerung rufen. Dann wurde ein anderes genannt, und sie sollten einen Knopf drücken, sobald sie sich mental bei dem anderen Objekt befanden. Die zeitliche Reaktionsdistanz entsprach dabei der räumlichen Distanz der Objekte auf der Karte. Synästhesie: Für eine zeitliche Codierung visueller Reize sprechen auch synästhetische Erlebnisse mancher Menschen, die Bilder sozusagen hören (hören = zeitlich), oder Musik sehen können (Spektrum-Ticker 2002.02.28, WSA 2001.03.29). Bis zu einem gewissen Grad kann jeder Mensch Klangliches und Visuelles in Verbindung bringen. So ordneten die meisten Versuchspersonen in Köhlers Experiment der linken Figur den Namen Maluma, und der rechten den Namen Takete zu. Schicken wir ein Signal entlang der Linie, das Krümmungen signalisiert, so kommen wir zu einem, den vorgegebenen Begriffen ähnlichem, Klangeindruck. (aus Nowotny 1969) 44 Aber wenn Bilder tatsächlich im Gehirn zeitcodiert werden, so müsste jedes Bild doch eine kurze Zeit ruhig gestellt werden, bis die Zeitcodierung abgeschlossen ist. Das geschieht tatsächlich, und zwar durch die sakkadische Bewegung unserer Augen und dadurch, dass das Gesehene für einen kurzen Zeitraum im „Arbeitsspeicher“ der Sehrinde behalten wird (Wesenick u.a. 2000). Wir fixieren ein Objekt, und erst nach einer kurzen Verarbeitungszeit können wir die Augen weiterbewegen (Berhill und Stark 1987, S.68). Sie können an ihren Mitme nschen beobachten, dass sie es nicht schaffen, mit den Augen eine fließende Kreisbewegung zu beschreiben. Und wenn doch, so erkennen sie dabei nichts mehr. Ich habe weiter oben bereits Studien angeführt, die zeigen, dass die sogenannten synchronen Signale mit zunehmender Distanz phasenverschoben auftreten, was eine Wanderbewegung in Verbindungsketten nahe legt (Ermentrout et.al. 2001). Ich sehe darin die Quelle der Zeitcodierung der Reaktionsbilder der Gehirnoberfläche. Von einem Code kann aber nur gesprochen werden, wenn das Gehirn für gleiche Wahrnehmungen gleiche Zeitrhythmen verwendet. Tatsächlich gibt es Untersuchungen, die dies bei bestimmten Wahrnehmungen belegen (WSA 2001.08.08, WSA 2002.11.27, Stickgold u.a.2002). Warum nicht alle Untersuchungen zu diesem Ergebnis kommen ist aus dem hier vorgelegten Modell leicht zu erklären. Es sind jeweils nur jene Bereiche und Aspekte einer Wahrnehmung synchronisiert, denen gerade Aufmerksamkeit zukommt (Held 2002, Spektrum-Ticker 2000.03.16, Spektrum-Ticker 2001.11.09). Diese wechselt aber ständig und nimmt immer andere Bezüge innerhalb eines Objektes unter die Lupe. Andere Bezüge gehen einher mit anderen Signalrhythmen. Deshalb darf man sich nicht immer durchgehend das gleiche Signalmuster erwarten. Es ist also davon auszugehen, dass die für die Zeitcodierung notwendigen Kettenverbindungen aufgebaut werden, und aufrecht bleiben, solange sie durch die Aufmerksamkeit aktiv gehalten werden. Dass die in diesen Kettenverbindungen auftretenden synchronen Signale tatsächlich mit Aufmerksamkeit und dem Bindungsproblem von Objekteigenschaften zu tun haben gilt als erwiesen. McFadden (2002) fasst Studien dazu wie folgt zusammen: “Wolf Singer and colleagues demonstrated that neurones in the monkey brain that responded to two independent images of a bar on a screen fired as ynchronously when the bars were moving in different directions but fired synchronously when the same bars moved together (Kreiter and Singer, 1996). It appeared that the monkeys registered each bar as a single pattern of neuronal firing but their awareness that the bars represent two aspects of the same object, was encoded by synchrony of firing. In another experiment that examined interocular rivalry in awake strabismic cats, it was discovered that neurones that responded to the attended image fired in synchrony, whereas the same neurones fired randomly when awareness was lost (Fries et al., 1997). In each of these e xperiments, awareness correlated, not with a pattern of neuronal firing, but with synchrony of firing. Singer, Eckhorn and others have suggested that these 40-80 Hertz synchronous oscillations link distant neurones involved in registering different aspects (colour, shape, movement, etc.) of the same visual perceptions and thereby bind together features of a 45 sensory stimulus (Eckhorn et al., 1988; Singer, 1998). However, if synchronicity is involved in perceptual binding, it is unclear how the brain uses or even detects synchrony.” McFadden stellt in seinem Artikel auch klar, dass die synchronen Signale, die an verschiedensten Stellen des gesamten Cortex gefunden werden können, in Summe das elektrische Feld bilden, das im EEG hervortritt. Da Aufmerksamkeit gen erell mit Bewusstsein gekoppelt ist, sieht er darin den Sitz des Bewusstseins. Das ist nicht so abwegig, denn wie mein Modell zeigt, dient der Kettensignalfluss (synchrone Signale) wahrscheinlich der Zeitcodierung, also dem seriellen Denken. Im Bewusstsein denken wir alles seriell. Wir können zwar sehr schnell zwischen Inhalten hin- und herschalten, aber es ist nie mehr als ein (höchstens 2) Inhalt zugleich im Bewusstsein. Das Gehirn ist also ein neuronales Netz, das räumliche Zusammenhänge zeitcodiert und so zu seriellem Denken findet. Mein Modell ist wahrscheinlich das derzeit einzige neuronale Netz, das dies tut. Warum das Gehirn nur einen Inhalt pro Zeit verfolgt ist leicht zu sagen. Es dient der Handlungskontrolle, und es macht keinen Sinn, zwei Handlungen zugleich auszulösen. Wir können unseren Arm heben oder senken, aber nicht beides zugleich. Ein neuronales Netz, das einen Roboter lenkt, braucht also in seinen inneren Entscheidungen auch nur seriell zu denken, auch wenn nach der Entscheidungsfällung der Handlungsbefehl letztlich wieder auf die Vielzahl von Motoren, oder Muskelfasern aufgeteilt wird. 2.2 Abgrenzung der Signalflussidee zu anderen Netztypen 2.2.1 Die Vor- und Nachteile klassischer Mehrschichtnetzwerke Dieser Netztypus wird in der Literatur am öftesten erwähnt (Hinton 1993, S.98, Tarasov 1993, S.106) und dürfte auch die meisten Anwendungsmöglichkeiten bieten. Mehrschichtennetze bestehen aus einer Eingabe-Schicht, die ihre Signale über ein oder mehrere vermittelnde Schichten auf eine Ausgabeschicht projiziert. 46 Bei jeder Übertragung hat jede Zelle eine Verbindung zu mehreren benachbarten Neuronen, das Signal wird also an eine Zellgruppe weitergegeben. Ein Signal kann so letztlich an jedem Ort der Ausgabeschicht ankommen. Die Grafik veranschaulicht die Idee am Beispiel der Buchstabenerkennung, die mit solchen Netzen bewältigt wurde (Mehr dazu Schaub 2002). Damit die Aktivität so durch das Netzwerk fließt, dass sie in Summe hauptsächlich am richtigen Ort ankommt, also bei dem Neuron, das für den Buchstaben steht, muss das Netz trainiert werden. Dabei werden die Verbindungen unterschiedlich gewichtet (verstärkt). Die schnellste Methode die Gewichtung zu setzen besteht darin sie vom Sollwert (dem Aktivitätsmaximum am erkannten Buchstaben) zurückzurechnen, genannt Backpropagation (Hinton 1993, S.99). Eine naturnähere Variante besteht darin die Gewichtungen durch Mutations-Selektions-Mechanismen von Verbindungsgruppen zu finden (Edelmann 1993, S.28f.) Aber wie auch immer, beeinträchtigt die Veränderung der Gewichte zugunsten der Erkennung eines bestimmten Buchstabens, immer die Erkennung der bereits erlernten anderen Buchstaben zu einem geringen Grad. Die wesentlichen Nachteile dieses Netzwerktypus sind: 1. Das Netzwerk bedarf der Definition eines bestimmten Bildausschnittes, in dem sich das zu erkennende Objekt befindet. In realen Situationen sind Objekte aber immer von verschiedensten Hintergründen umgeben. Da das Netzwerk keine Regel kennt, um die Grenze zwischen Figur und Grund finden zu können, nimmt es den Hintergrund in den Erkennungsprozess mit, und erhält unterschiedliche Ergebnisse, bei gleichen Objekten. 47 2. Das Netzwerk soll, in Anwendung auf das Gehirn, die Verbindung von Reizen mit Reaktionen erklären. Auf den Wahrnehmungsreiz „G“ folgt sozusagen die Reaktion, also der Druck auf die Taste „G“. Aber unser Gehirn verbindet nicht nur Reize mit Reaktionen. Es verbindet auch Reize mit Reizen (Wenn wir uns z.B. Reizfolgen merken, um beim nächsten mal Zukunft vorauszuahnen.). Es verbindet ebenfalls Reaktionen miteinander zu fertigen Handlungsabläufen, und es verbi ndet sogar Reaktionen mit Reizen (Wenn wir zum Beispiel die Wirkung unseres Verhaltens vorausahnen lernen). Das Netz müsste also in alle Richtungen durchlä ssig sein. Ist es aber nicht! 3. Das eigentliche Problem aber ist, dass ein natürliches Gehirn keinen Leh rmeister hat! Ihm wird nicht sofort mitgeteilt welches Ergebnis ideal ist, was also z.B. die Taste für „G“ ist. Mehrschichtennetzwerke brauchen einen Trainer, der das Ziel vorgibt (Hi nton 1993, S.101) Zwar wurden auch Netze konstruiert, deren Ziel eine möglichst datenreduzierte Repräsentation von Information ist, aber auch das ist ein vorgegebenes Ziel. Gehirne hingegen trainiert das Leben. Sie reagieren eher wie statistische Ne tze. 2.2.2 Vor- und Nachteile statistischer Netze Das Lernziel eines Babys besteht vorerst darin, die Zusammenhänge der Welt zu durchschauen. Die Befriedigung seiner Bedürfnisse kann es erst später selbst übernehmen. Jedes Objekt dieser Welt bildet in sich einen Zusammenhang. Seine Bildpunkte und seine Teile gehören zusammen und treten meist gemeinsam auf. Wir treten z.B. immer mit unserem Kopf auf. Bayesianische Netzwerke registrieren solche statistische Häufungen. So könnten sie eventuell dazu taugen das Figur/GrundProblem zu lösen, indem sie Pixelgruppen, die oft gemeinsam auftreten, einer Figur zuordnen, weil die Pixelgruppen eine ähnliche Entfernung, Bewegung, Farbton und Strukturiertheit besitzen, und so eine statistische Häufung darstellen. Der Hintergrund gehört nicht zu der Häufung. Abgesehen von räumlichen Zusammenhängen gibt es auch zeitliche. Dinge fo lgen wiederholt gleichermaßen aufeinander. Das Baby muss all diese Zusammenhänge kennenlernen, es muss Folgewirkungen und Tagesabläufe abschätzen lernen. Solche Aufgaben sind mit bayesianischer Wahrscheinlichkeits-Prognostik möglich. Bayessche Netze orientieren sich an der assoziativen Konditionierung. Wenn oft auf 48 A ein B folgt, dann kann eine Verbindung hergestellt werden, über die in Zukunft ein Signal zu B fließen kann. So wird B schon vorausgeahnt (Brandherm 2000). Ohne solche Vorausahnung wäre kein planendes Handeln vorstellbar. Es wird also erlernt welche Reize etwas miteinander zu tun haben, und welche nicht. Dazu müssen alle Reize mit allen anderen eine potentielle Verbindung besitzen, die dann verstärkt wird oder eben nicht. So könnte ein Hund lernen, dass auf Glocke und Rotlicht Futter folgt. Nun bin ich kein Experte in Bayesschen Netzen, aber ich beobachte, dass in Texten darüber gerne das Kapazitätsproblem behandelt wird (Plach 1999), und es ist einsichtig warum: In der obigen Grafik sind alle möglichen Zweierverbindungen zwischen 10 Neuronen dargestellt, wobei die, durch Erfahrung verstärkten, rot eingezeichnet sind. Aber genaugenommen müssen auch alle höherzahligen Verbindungskombinationen möglich sein, denn Objekte sind nicht durch Zweierverbindungen, sondern erst durch eine Kombination aus vielen Bildpunkten beschreibbar. Selbst wenn wir von höheren Reizen ausgehen, wie dem Rotlicht oder der Glocke, sind Zweierverbindungen nicht ausreichen, denn wir können einem Hund beibringen, dass Futter nur nach einer Kombination von Rotlicht und Glocke auftritt, nicht bei aufeinanderfolgenden Einzelreizen. Wenn das Gehirn keine neuen Verbindungen schafft, sondern nur vorhandene verstärkt, müssten alle Verbindungskombinationen potentiell vorhanden sein, damit sie gegebenenfalls verstärkt werden können. Wie viele Verbindungskombinationen ergeben sich zum Beispiel bei 10 Neuronen? Zählen wir erst einmal die Zweierverbindungen. Jede Zelle kann mit jeder and eren verbunden werden, außer mit sich selbst, also 10 mal 9. (Den Weg zurück ist dabei schon mitgezählt.) Dreierkombinationen ergeben sich, indem ich einer 49 Zweierkombination eine dritte Zahl zugebe. Es gibt also 10*9*8 davon. Aber mit den Dreierkombinationen habe ich auch schon die Siebenerkombinationen berechnet. Denn die nicht in der Kombination enthaltenen 7 Restziffern, waren ja auch kombiniert. Genauso ergeben sich mit den 2er die 8er, mit den 6er die 5er. Und gesamt? Zweierkombinationen 10*9= 90 Achterkombinationen 90 Dreierkombinationen 10*9*8= 720 Siebenerkombinationen 720 Viererkombinationen 10*9*8*7= 5040 Sechserkombinationen 5040 Fünferkombinationen 10*9*8*7*6= 30240 Neunerkombinationen 9 Zehnerkombinationen 1 Summe 43930 Es gibt also 43930 Verbindungskombinationen von nur zehn Zellen! Diese Zahl entspricht also der Anzahl an unterscheidbaren möglichen Bildern bei 10 Bildpunkten. Allerdings mit der Einschränkung, dass es nur schwarze und weiße Bildpunkte gibt. Ansonsten würde sich die Zahl an Kombinationen enorm erhöhen, denn eine Zelle würde nun nicht mehr entweder ein, oder ausgeschaltet, sondern verschieden aktiviert sein. Kann sie zehn verschiedene Graustufen repräsentieren, so wirkt das auf die Kombinationsmöglichkeiten wie eine Verzehnfachung der Zellen. Abfolgen: Eine noch wesentlich größere Erhöhung entstünde dann, wenn das Netzwerk nicht nur auf differenzierbare Reize, sondern auf bestimmte Reizfolgen reagieren können soll. Es handelt sich dann um ein Dynamisches Bayessches Netz (Brandherm 2000) Also auf Rotlicht Glocke, nicht aber auf Glocke Rotlicht. Bleiben wir bei den 10 Neuronen, und den zigtausend möglichen Bildern, so kann sich davon jedes mit beliebig vielen weiteren zu einer Filmsequenz verbinden. Nehmen wir an, wir merken uns nur Sequenzen aus 1 bis 3 Bildern: Anzahl verschiedener Bilder 43930 Zweierkombinationen 43930*43929= 1929800970 Dreierkombinationen 43930*43929*43928= 84772297010160 Summe 84774226855060 50 Es gibt also Milliarden verschiedener Reizkombinationen, bei nur drei aufeinanderfolgenden Reizen von nur 10 binär reagierenden Neuronen! Drei aufeinanderfolgende Reize sind wie ein Film aus drei Bildern. Geschichten kann man sich damit noch nicht merken. Und auch 10 Neuronen zur Bildauflösung sind nicht genug! Ein Auge liefert bereits 1,5 Millionen Bildpunkte, und zwar nicht binär, sondern in sehr fein unterscheidbaren Intensitätsstufen. Dann sind da die Projektionsfelder des Körperempfindens, des Hörens und des Riechens. Mir ist erzählt worden, dass würden wir mit all diesen Neuronen alle kombinatorischen Möglichkeiten durchspielen, eine Zahl an Kombinationsmöglichkeiten entstünde, die über der Zahl der Quanten des Universums liege. Ich bin kein Mathematiker, aber es genügt mir zu wissen, dass die Zahl an Verbindungsmöglichkeiten größer ist, als die Zahl an Verbindungen, die im Gehirn vorveranlagt ist. Das Gehirn kann also nicht alle eventuell einmal benötigten Verbindungen bereits veranlagt haben, und bei Bedarf verstärken. Auch anatomisch ist ersichtlich, dass im Gehirn nicht jedes Neuron mit jedem Kontakt hat. Das Gehirn braucht also die Fähigkeit Verbindungen erst herzustellen, wenn sie benötigt werden, und es braucht Strategien um Daten zu komprimieren und selektieren. Mit der Neuronenanzahl nehmen die kombinatorischen Möglichkeiten unverhältnismäßig stark zu. Da dynamische Bayessche Netze alle Verbindungen durchrechnen, sind auch mit heutigen Großrechnern nur Bayes-Netze mit wenigen hundert Neuronen denkbar (Brandherm 2000). Bayesianische Netze können also, aufgrund eines kombinatorischen Kollaps, nicht erklären, wie das Gehirn die Reize der einzelnen Sinnesrezeptoren zu Begriffen verbindet. Es ist nicht vorstellbar solche Netze für die Verbindung der unzähligen einzelnen Sinnesrezeptoren einzusetzen, sondern man beschränkt sich auf fertige Begriffe, wie bei Pawlow die Glocke und das Futter. In der Psychologie versucht man umgekehrt die assoziative Vernetzung von Begriffen in Lernexperimenten zu erforschen, und in propositionalen (begrifflichen) Netzen aufzuzeichnen (Anderson 1996, S. 147f). Konditionierungsexperimente sind mit Bayes zu simulieren, und Mehrschichtnetze erledigen Buchstaben- bzw. Mustererkennung. Somit mag es so aussehen, als wäre durch deren Kombination alles gelöst. Irrtum! Mehrschichtennetze brauchen einen Trainer, und als Trainer kann das Bayesnetz nicht dienen, denn es ist, sola nge es noch nie einen sinnvollen Input aus dem Mehrschichtennetz bekommen hat, nicht arbeitsfähig, und das Mehrschichtennetz kann nicht ohne Bayesschen Trainer. Dieses Problem scheint durch das Kohonen-Netz lösbar: 2.2.3 Das Kohonen Netzwerk Ein Kohonen-Netz besteht aus einer Projektionsschicht, und einer Kohonen-Schicht (Ausgabeschicht). Es kann lernen Reize differenziert wiederzuerkennen, ohne dabei einen Trainer zu benötigen. Was oft wiederholt eingetreten ist, erobert auf der Kohonen-Schicht einen eigenen Platz. Man kann sagen, auf der Schicht entsteht 51 eine Karte, in der oft Wahrgenommenes mehr Platz einnimmt. Spitzer geht in „Geist im Netz“ auf diesen Netztypus ausführlich ein und erläutert viele Experimente in denen Parallelen zur Organisation der Karten im Gehirn gezeigt werden konnten (S.103-124, S.247-167), vom Hörsystem der Fledermaus bis hin zum assoziativen Denken. Ich will mich hier auf eine kurze Beschreibung dieses Netzt ypus am Beispiel der Buchstabenerkennung beschränken, da es mir ja nur um die Abgrenzung zu meinem Modell geht. Nehmen wir also an, ein Kohonen-Netz soll Buchstaben erkennen. Jedes Neuron der Input-Schicht hat eine Leitung zu jedem Neuron der Kohonen-Schicht (OutputSchicht). Ein Kohonen-Neuron erhält also von jedem Bildpunkt des Buchstabens ein Signal. Ziel ist es nun, dass das Neuron eine Art Schablone entwickelt, die so genau auf einen bestimmten Buchstaben zutrifft, dass er von allen anderen Buchstaben zuverlässig differenziert werden kann. Es darf aber nicht jedes Neuron der Kohonen-Schicht den gleichen Buchstaben erkennen, sondern es soll sich für jeden Buchstaben ein eigenes Neuron entwickeln. Zur Lösung dieses Problems ist es notwendig, dass die Neuronen der Kohonen Schicht seitlich miteinander kommunizieren. Sie tun dies nach dem Zentrum/Umfeld-Prinzip. Erhält ein Neuron einen Input, so vergleicht es diesen zunächst mit seiner Schablone. Sind die Bildpunkte einander durchschnittlich ähnlich, so nähert es die Schablone noch weiter an den Input an. Zusätzlich sendet es nun ein Signal an sein Umfeld, das bewirkt, dass auch die Schablonen direkt umliegender Neuronen an den Input angenähert werden. Auf weiter entfernte Neuronen wirkt dieser seitliche Input jedoch gegengleich, das heißt deren Schablonen werden dem Reiz unähnlicher. Diese Mechanik hat zur Folge, dass entfernte Neuronen nicht den gleichen Buchstaben repräsentieren können. So entsteht ein Reaktionsbild (Karte), in dem ähnliche Buchstaben im Netz nahe nebeneinander repräsentiert sind. Was bedeutet in diesem Zusammenhang eigentlich „Ähnlichkeit“? Ganz einfach: Da die Buchstaben durch ein Pixelbild mit Graustufen dargestellt sind, wird eine Schablone der Vorgabe dann „ähnlicher“, wenn der Grauwert jedes Pixels der Schablone ein wenig an den Grauwert der Vorgabe angenähert wird. Aber mit welchen Schablonen startet das Netz? Es startet mit einem Zufallspunktmuster. Die Zufallspunkt-Schablonen werden manchen Buchstaben ähnlicher, manchen unähnlicher sein. So ist von Anfang an eine Tendenz gewisser Neuronen der Kohonenebene zu bemerken, einen ganz bestimmten Buchstaben zu erkennen. Die guten Schablonen verdrängen unähnliche Schablonen aus ihrer Umgebung, so dass diese Buchstaben anderswo repräsentiert werden. Exakte Schablonen sind nicht notwendig. Das Netz ist bereits dann ideal verschaltet, wenn das Neuron, das von einem Buchstaben am stärksten aktiviert wird, auf keinen anderen Buchstaben stärker anspricht. Es braucht nicht maximal aktiv zu sein. Allerdings ist aus der folgenden Grafik, die die Ergebnisse eines Kohonen-Netzes zeigt, durchaus zu erkennen, dass Buchstaben mit zunehmendem Training von 52 Schablonen repräsentiert werden, ursprünglichen (aus Spitzer S.113). die ihnen ähnlicher werden, als die Das Kohonen-Netz zeigt uns also, wie das Gehirn es schaffen könnte, Repräsentationen für wiederholt wahrgenommene Sinnesreize auszubilden und in Karten nach dem Prinzip der Ähnlichkeit anzuordnen. Kohonen-Netze sind auch fähig neue, ähnliche Reize zu repräsentieren. Schließlich sind zwischen den Neuronen der Kohonen-Schicht, die Buchstaben repräsentieren, noch unbesetzte Neuronen frei. Das Netz kann sozusagen weiterlernen. Der Nachteil dieses Netztypus liegt einerseits im enormen Aufwand an Verbindungen und Berechnungen des „jedes mit jedem-Prinzips“, andererseits gibt es allgemeine Einwände gegen das Prinzip des Schablonenabgleichs. 53 Schablonenabgleich eignet sich vielleicht, um Buchstaben zu differenzieren, aber um Objekte der realen Außenwelt zu erkennen bedarf es mehr. Es genügt nicht, ein Objekt durch eine Verbindung von Bildpunkten darzustellen. Eine Katze kann je nach Entfernung klein oder groß im Bild sein. Sie soll auch erkannt werden wenn ich den Kopf zur Seite neige, oder sie ihre Position im Bild verändert. Und auch wenn der Lichteinfall sich ändert, und sie plötzlich hell vor dunklem Grund erscheint, oder nur teilweise beschattet wird, oder wenn der Hintergrund anders ist. 54 Selbst tausende Bilder pro Objekt würden noch kein sicheres Erkennen garantieren. Abgesehen davon ergibt sich die Frage, welcher Mechanismus all diese Bilder, wenn sie als Schablonen gespeichert wären, einem einzigen Objekt zuordnet? Indem man Kohonen-Netze mehrschichtig organisiert, kann man zwar erst Merkmale ausfiltern, und in einer gröberen Schicht diese zueinanderfügen. Damit reagiert das System weniger sensibel auf die Position eines Objektes, aber eine Drehung oder Größenänderung ist damit noch nicht zu verarbeiten. Und wie wir oben gesehen haben, ist ja die Position nur eines von vielen schwer zu lösenden Problemen bei der Objekterkennung. Auch ist damit nicht zu erklären, warum manche Zellen im Gehirn, ihrem Reaktionsverhalten nach, eher eine Vektorverarbeitung visueller Information nahelegen (Spitzer S. 82). 2.2.4 Auf Synchronisation beruhende Netze Es ist bekannt, dass unser Gehirn Erfahrungen nach den Regeln bayesianischer Statistik gewinnt, denn diese Regeln entsprechen ziemlich genau den, in der Psychologie erforschten Konditionierungs- und Lernregeln (Mischo, C. 2002). Wir haben eine angeborene Fähigkeit, die Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, mit der ein schon öfter erlebter Zusammenhang wieder eintreten wird (Spektrum-Ticker 2002.01.24, Spektrum-Ticker 2002.03.25, WSA 2002.11.29). Ein erster Ansatz, zu klären wie das Gehirn solche Zusammenhänge herstellt, und dabei dem beschriebenen Kapazitätskollaps entgeht, besteht in der Entdeckung synchronisierter Signale. Warum Synchronizität hilft Kapazität zu sparen, will ich anhand des rosenblattschen Bindungsproblems erklären (Gruber 2000, S.94). Stellen wir uns vor, unser Gehirn verfügt über Einheiten, die Merkmale auswerten, wie zum Beispiel den Ort oder die Form eines Objektes. Nehmen wir an, ein Objekt ist dreieckig und in der unteren Bildhälfte. Dann wird die Einheit, welche den Ort verarbeitet „unten“ melden, und die Einheit welche die Form verarbeitet, wird „Dreieck“ melden. o u Was passiert nun, wenn wir oben zusätzlich ein Viereck haben? Dann wird die Einheit, die „oben“ meldet ebenfalls aktiv, und auch die Einheit für „Vie reck“. 55 o o u Neuron ist aktiv u Neuron ist passiv Aber aus der Gesamtinformation ist nicht mehr zu erkennen, ob das Dreieck oder Viereck oben liegt! Das ist das „Rosenblattsche Bindungsproblem“. Das neuron ale Netz müsste jede Objektkonstellation eigens speichern um sie wiederzuerkennen, und könnte nicht auf bekannte Teile zurückgreifen. Wir würden dann hier kein Dreieck zusammen mit einem Viereck erkennen, sondern etwas komplett Neues, ein „Dreiviereck“. Dieses neue Ding hätte aber für uns dann nichts mit Dreiecken und Vierecken zu tun. Und dafür würden endlose Kapazitäten verbraucht, denn eine kleine Verschiebung der Objekte würde wieder etwas komplett Neues erg eben usw. Die synchrone Verarbeitung der Eigenschaften des Vierecks, Phasenverschoben zur ebenso synchronen Verarbeitung der Eigenschaften des Dreiecks, kann hier eine Lösung bringen. Aktionspotentiale o o u u t Die Lösung des Rosenblatt´schen Bindungsproblems durch die Einführung einer Zeitstru ktur. Genauso brauchbar wäre es, die Dinge nacheinander zu verarbeiten, anstatt ihre Informationen Phasenverschoben ineinanderzumischen. Messungen im visuellen Systems des Gehirns zeigen aber synchrone Frequenzmuster. (Singer 2002, Spektrum-Ticker 2000.06.13, Held 2002, WSA 2001.08.08). Die Serialität unseres bewussten Denkens spricht andererseits für ein Nacheinander, da wir zwar oft schnell switchen, aber genaugenommen nie mehr als einen Denkinhalt zugleich denken. Wir sollten uns aber von der relativ neuen Entdeckung synchron feuernder Neuronen nicht zu viel erwarten. Aus dieser Idee ist noch keine Antwort auf sehr wesentliche Aspekte begrifflichen Lernens ableitbar: 1. So ist durch Synchronizität noch lange nicht erklärt, wieso der Erkenntni sprozess vom Generellen zum Differenzierten verläuft, und nicht umgekehrt. Die Entwicklung des Sehens beginnt damit, die Welt grob in Bereiche zu gliedern, und erst später feiner zu differenzieren. So bezeichnet ein Kleinkind, das bisher nur einen Hund kennt, jedes Tier als Wauwau und lernt erst später feiner zu unterscheiden. 2. Das Synchronisationsmodell erklärt nicht ausreichend, wie wir von einer verteilten Repräsentation der Sinneszellen zu begrifflichem Denken kommen. Es zeigt nicht, wie aus einer Konstellation getrennter Objekte ein zusammenhängendes Ereignis im Kopf 56 wird. Wie können Dinge assoziativ verbunden werden, wenn sie im Gehi rn verteilt, also in Stücke zerlegt repräsentiert sind? Müssen dann hunderte Verbindungen hergestellt werden, wenn ein Kind lernt, dass das Ei zum Huhn gehört? 3. Nicht einmal die ersten Stufen der visuellen Verarbeitung sind mit der Idee synchron pulsierender Zellen wirklich erklärbar. So bleibt zum Beispiel immernoch die Frage offen, wieso das visuelle System von einer parallelen Verarbeitung zu einer s eriellen wechselt (Julesz 1987, S.48). Zur Erläuterung dessen, was parallel, also flächendeckend, und was seriell, also fokusierend-nacheinander bedeutet, hier ein grafisches Beispiel: Fig. 1: In diesem Beispiel gelingt die Texturunterscheidung gut. Das bedeutet, die parallele Verarbeitung erkennt einen Unterschied. Die serielle Formerkennung sag t uns hingegen, es handelt sich um die gleiche Form. Fig. 2 Hier erkennen wir in der parallelen Texturverarbeitung keine deutlich hervortretende Fläche, aber die serielle Formverarbeitung lässt uns zwei unterschiedliche Winkel erkennen. 4. Woher kommen die Frequenzmuster? Die folgende Grafik (aus Guber 2000) zeigt schematisch, wie man sich die synchronisierten Signale vorstellen kann. 57 Assemble 1 U Assemble 2 t a) b) Die Zellen der beiden Figuren, hier als Assemble 1 und 2 bezeichnet, senden verschiedene Signalmuster. Innerhalb einer Figur sind diese synchron. Es ergibt sich die Frage: Woher kommen diese Signalmuster? Sind sie beliebig, also zufä llig? Und wie erkennt das System, dass es 2 Figuren sind, wenn diese Kontakt h aben? 2.2.5 Redundanzketten-Fließnetze: Die Vorteile dieses neuen Netztypus Ich will den neuen Typus in Weiterführung der Idee synchronisierter Impulse erklären: Die Idee der synchronisierten Neuronen, die man im Gehirn entdeckte (Singer 2002, Spektrum-Ticker 2000.06.13, Held 2002, WSA 2001.08.08), besteht ja darin, dass gleichgereizte Zellen Kontakt zueinander aufbauen und dann synchron zu schwingen beginnen. Dazu ist seitlicher Kontakt und ein Signalaustausch zwischen den Zellen notwendig, denn wie sonst sollten benachbarte Zellen ihre Schwingung angleichen? Die Existenz synchroner Signale im Gehirn ist nachgewiesen, Der Kontakt dazu dürfte horizontal verlaufen, denn die synchronen Neuronen liegen in der Ebene nebeneinander. Einen zusammenhängenden Bereich gleich gereizter Zellen will ich als „Redundanzbereich„ bezeichnen (Redundanz=Wiederholung). Nun will ich die Idee der synchronen Signale etwas ausbauen. Wie schon gesagt, muss ein seitlicher horizontaler Informationsaustausch zwischen den Zellen einer Ebene stattfinden, sonst könnten sie nicht synchron Feuern. Die einfachste Vorstellung besteht nun meiner Meinung nach darin, dass die Zellen ein Signal einander weitergeben. Da man bei neuen Modellen immer von der einfachsten Annahme ausgehen soll, stelle ich mir also vor, dass über die Redundanzbereiche ein Fließsignal wandert, das die synchronen Signalrhythmen erklärt. Das Fließsignal muss natürlich irgendwo starten. Die einfachste Annahme hierzu ist die, dass es an den Enden des Redundanzbereiches (Voraussagebereiches) startet. Die Zeitlinien dieses Fließsignals sehen im Fall von Flächen gleichgereizter Neuronen, wie dies bei der Verarbeitung von Bildern vorkommen kann, dann so aus: 58 Die synchronen Signalmuster könnten daraus hervorgehen, dass das Signal Zeit zum Durchfließen des Redundanzbereiches braucht, und so eine Signalabfolge, also ein Zeitmuster entsteht. Auch eine Linie kann ein solcher Redundanzbereich bzw. eine Redundanzkette sein. So könnten die oben punktiert dargestellten Achsenskelette letztlich auch in sich zusammenfließen, auf jeweils einen Punkt. Die zeitliche Abfolge an Signalmengen, die an diesem Punkt ankommen, repräsentiert dann die Form des Objektes. Die Forminformation des Objektes ist damit zeitcodiert. Das wesentliche an der Idee zusammenfließender Signale gegenüber der Idee synchron pulsierender getrennter Signale besteht nun darin, dass der Zusammenfluss aller Signale eines Objektes zu einer Mitte hin, verständlich macht, warum der Mensch Objekte als Einheit erlebt. Die Idee einer verteilten Repräsentation durch synchron pulsierende Neuronen bietet dafür keine Erklärung. Von der Retina weiß man, dass sie bei ihrer Verschaltung solch seitliche Fließbewegungen, zeigt, die man als Aktivitätswellen bezeichnet (Shatz 1993, S.23). Man besitzt noch keine geeignete Methode, um flächendeckende Fließbewegungen in der Großhirnrinde zu überprüfen, wenngleich ein neuer Fluoreszenzfarbstoff bald dorthin führen könnte (Ehret 1997). Deshalb fehlen dazu Ergebnisse. Aber die Retina gilt als Teil des Gehirns, und dies legt nahe, dass die Großhirnrinde auch zu solchen Fließbewegungen fähig ist. Die wichtigsten Vorteile des in dieser Arbeit dargestellten Modells werden sein: 1. Kein Lehrmeister: Um Redundanz (Wiederholung) festzustellen braucht es lediglich Statistik. Statistisches Lernen bedarf keines Lehrmeisters. Der Begriff „Redundanz“ bezieht sich im obigen Beispiel auf die gleichartige Reizung aller Neuronen der Fläche des Objektes. Redundanz gibt es aber auch in zeitlichen Rhythmen, die also mit ähnlichen Mechanismen verarbeitet werden können. 59 2. Eine Regel für die gesamte Großhirnrinde: Es mag so scheinen, als wäre der Redundanzketten-Signalfluss eine aus der Luft gegriffene Sache. Genaugenommen gehen aber alle Kognitionsforscher immer schon davon aus, dass Zukunftsvorste llung in Neuronennetzen durch den Fluss von Signalen auf bereits wiederholt aktivierten Verbindungen entstehen, also auf vergangenen Erfahrungen. Es ist sogar nachgewiesen, dass Vorstellungen in den selben Arealen zustandekommen, wo die Informationen gespeichert wurden (Spektrum-Ticker 2001.07.10, WSA 2000.11.16) Voraussage basiert auf wiederholter Erfahrung. Wiederholte gemeinsame Aktivierung von Neuronen ist Redundanz! Es wird also immer schon von Signalfüssen entlang von Redundanzbereichen ausgegangen! Ich nenne diese Vorstellung den „Erwartungssignalfluss“, oder auch „Voraussagesignalfluss“, denn Voraussage ist das Ziel dieser Signalflüsse. Voraussage ist notwendig für zielgerichtetes Verhalten. Die einfachste Form der Redundanz ist eine Fläche mit gleich stark aktivierten Neuronen. Sie feuern über einen gewissen Zeitraum hinweg wiederholt gemeinsam. Bereits hier kann eine Voraussage getroffen werden. Aus der Aktivität eines Neurons kann die der Nachbarneuronen vorausgesagt werden. Also muss durch den Bereich dann ebenfalls ein Redundanzketten-Signalfluss ergehen, denn die statistischen Regeln der Erkenntnis müssen für alle zeitlichen Maßstäbe gelten. Genau das passiert im Beispiel das oben grafisch dargestellt ist! Dass dabei Formen zeitcodiert werden ist eine Nebenerscheinung. 3. Plastizität: Welcher Bereich der Großhirnrinde welche Informationsart übernimmt, hängt lediglich vom Ort des Signalinputs ab, der von den Sinnen kommt. Die Genetische Grundstuktur der gesamten Fläche der Großhirnrinde scheint im Ursprung gle ich zu sein. Allerdings beginnt das Lernen, und damit die Spezialisierung bestimmter Bereiche, schon im Embryo. Doch kann in dieser Zeit noch völlig umgelernt werden. Das ist durch Hydrocephaluspatienten (Wasserkopf) belegt, die den nicht zerdrückten Rest des Gehirns mitunter völlig anders organisieren. Neuerdings zeigen auch Studien, wie eine Sehnervtransplantation an Hamstern, die daraufhin ihr Sehsystem dort entwickelten, wo normal das Hörsystem sitzt (Frost 2000) wie flexibel das Gehirn ist. Weiters ist die Plastizität des Gehirns durch Studien an Gehörlosen (Spektrum -Ticker 1999.01.14), oder an Menschen belegt, die Jahre nach einem Unfall, neue Arme transplantiert bekamen (WSA 2001.07) oder die Besetzung der freigewordenen Areale nach Transplantationen durch andere Aufgaben (Held 1987). Das RedundanzkettenFließmodell, das ich in dieser Arbeit vorstellen will, wird sowohl mit zeitlichen, als auch mit räumlichen Korrelationen arbeiten, und ist damit das einzige, das für alle Informationsarten geeignet ist, und in dieser Hinsicht der Großhirnrinde entspricht. Das heißt, es wird uns zur Erklärung des Hörens genauso dienen, wie dazu, zu erklären, wie wir es schaffen uns eine Zukunft vorzustellen. Zukunftsvorstellungen sind nichts weiter als Signalflüsse, in, durch wiederholte Erfahrungen gebildeten Verbindungen. 4. Berücksichtigung von Signalfließzeiten: Ich werde zeigen, dass es Sinn macht, die Zeiten als Informationsquelle zu nützen, die Signale zum Durchfließen von Redundanzbereichen brauchen. Es ist wichtig, diese Zeiten zu berücksichtigen, da sie die Reihenfolge der Verarbeitung von Signalen bestimmen. Diese Reihenfolge braucht aber nicht kontrolliert zu werden, sondern sie ergibt sich automatisch, und kann sogar genützt werden, um daran Objekte wiederzuerkennen. Dass es für das Gehirn einen Unterschied macht, welches Signal wo zuerst ankommt, zeigt sich ja am Beispiel des Stereo-Hörens. Ein Schall-Signal, das sich links von uns befindet, erreicht das rechte Ohr später, und das Gehirn kann dies erkennen (Möck el u.a.1995). 60 5. Erklärung der im Gehirn entdeckten Zeitmuster: Durch die beim Durchfluss von Redundanzbereichen entstehenden zeitlichen Verschiebungen der Signale, erg eben sich im Modell zeitliche Muster. Damit verfügen wir über eine Idee, woher die in den Experimenten zur Synchronisation gemessenen Zeitmuster kommen könnten, wenn wir nicht annehmen wollen, dass sie zufällig sind. 6. Erklärung des Übergangs von parallelem Sehen zu seriellem begrifflichem Denken: Das Gehirn beherrscht Zeitverarbeitung. Warum sollte es also Formen nicht direkt an gleichen Zeitmustern erkennen? Die Zeitmuster müssen seriell, also nacheinander, betrachtet werden, um nicht durcheinander zu kommen. Das erklärt den Übe rgang von der parallelen Verarbeitung (noch nicht zeitlich) im visuellen System zur seriellen im begrifflichen Sehen. Bewusst können wir die erkannten Objekte nur nachei nander denken, also seriell. Texturen hingegen sehen wir flächendeckend. Bildet ein Element einen Texturbruch, entdecken wir es sofort (Goldstein 1997, S.186, 188). Die drei V inmitten von O’s sind ein Texturbruch. Wir entdecken sie sofort (parall ele Verarbeitung). Die drei R inmitten von Q’s und P’s enthalten Elemente, die in den anderen beiden Buchstaben auch vorkommen, und sind daher kein Textu rbruch. Wir müssen sie mit unserem Blick suchen, also seriell alle Buchstaben betrachten. Kein neuronales Netz konnte bisher diesen Übergang zum bewußten seriellen Denken erklären. Damit visuelle (flächige) Information seriell gedacht werden kann, muss sie zeitlich codiert, also zeitlich nacheinander gesendet werden. Sie wird dadurch der auditiven Information ähnlich. Für Synästhetiker verschwimmt die Grenze zwischen den Informationsarten. Tatsächlich wurde nachgewiesen, dass Synästhesie ein Phänomen ist, das an der Schwelle zum Bewusstsein (also bei der Zeitcodierung) seinen U rsprung hat (WSA 2001.03.29). 7. Eine massive Ersparnis an Verbindungen ergibt sich dadurch, dass die Zeitmuster Orientierungsunabhängig gelten. Wenn wir die Information über die Form eines Objektes erst einmal zeitcodiert haben, so ist egal wo sie sich befindet, sie bleibt in sich identisch. Das bedeutet, es ist dann egal welchen Platz das Objekt im Bild einnimm t, die Information bleibt gleich, und Wiedererkennen kann damit stattfinden. Das Wiedererkennen von schief, oder am Kopf stehenden Objekten verbraucht in diesem Modell also keine neue Verbindungen, weil auch ein schiefes Objekt das gleiche Fließzeitmuster erzeugt. So lässt sich außerdem erklären warum ein leicht verdrehter Winkel im seriellen (zeitcodierten) Denken immernoch als identisch erkannt, im parallelen Sehen eine Struktur aus solchen Winkeln jedoch als etwas Anderes betrachtet wird (siehe Grafikbeispiel oben). Aber dazu im zweiten Teil des Te xtes mehr. 61 8. Vom Abstrakten zum Konkteten, nicht umgekehrt! Ein Kind braucht nicht, wie ein Mehrschichtennetz, tausend verschieden positionierte Hunde gesehen zu haben, um auch einen am Kopf stehenden Hund zu erkennen. Die Zeitcodes an denen (im Modell) Objekte erkannt werden, lassen sich auf eine Weise vereinfachen, an der ich darstellen werde, wie Kinder Abstraktionsleistungen vollbringen, die es erlauben Dinge generell zu erfassen und später erst, wenn notwendig, differenzierter. 9. Optimale Datenkomprimierung: Es wird oft so getan, als hätte das Gehirn ohnehin unerschöpfliche Ressourcen. Studien belegen eher das Gegenteil (Spektrum -Ticker 1999.10.19). Es gilt heute als sicher, dass das Gehirn Wissen in Form von Verbindungen speichert (Spektrum-Ticker 1999.11.29). Diese Speicherungsart ist aufwendig. Wer sich die Zahl von möglichen Kombinationen von Bildpunkten ausrechnet, kommt zu dem Ergebnis, dass Datenkomprimierung unbedingt notwendig ist. Das trifft natürlich nicht nur auf das visuelle System zu. Datenkomprimierung bedeutet, bekannte Bausteine zu verwenden, um Neues zu beschreiben. Genau das tut ein Kind, wenn es in seiner Zeichnung erstmals ein Männchen aus einem Rechteck, einem Kreis, und vier Strichen zusammensetzt. Genau das tun wir auch, wenn wir Objekte erkennen. Wir erkennen „wieder“ einen Baum, obwohl wir diesen Baum noch nie gesehen haben. Das Redundanzketten-Fließnetz basiert auf Signalübertragung zwischen gleichen Bausteinen, und wird uns daher von vorn herein zu optimaler Datenkomprimierung führen, weil es immer vorhandene Bausteine verwendet, um etwas zu erfassen. 10. Die Entzerrung perspektivisch verkürzter Längen kann einfach geleistet werden, indem stereooptisch die Tiefenflucht von Strecken erfasst wird. Die Tiefe nflucht ist hoch wenn die Strecke in den Raum läuft. Dann ist auch ihre Erscheinung verkürzt. Die Länge, in der eine Stecke erscheint, wird in dem Modell durch die Zeit codiert werden, die ein Signal für deren Durchfluss benötigt. Werden diese Zeitdaten nun manip uliert, also mit zunehmender Tiefenflucht immer mehr verlängert, so ist Entzerrung erreicht. Die Zeit-Daten bleiben auch bei perspektivischer Schrägansicht gleich, und das Objekt kann wiedererkannt werden. Da wir keine Ansichten abspeichern, sondern diese “entzerrten“ Datensätze, ist es auch so schwer perspektivisch richtig zeichnen zu lernen. Würden wir Dinge durch das Schablonen-Abgleich-Verfahren erkennen, so müsste für jede jede perspektivische Ansicht eine neue Schablone erstellt werden. Das kann nicht funktionieren. 11. Erklärung der Verbindungsfindung im Gehirn. Da Reize im Leben nicht vorweg in Ursache und Wirkung zu trennen sind, und des einen Ursache oft die Wirkung des andern ist, muss es prinzipiell möglich sein, Neuronen in beliebigen Richtungen miteinander zu verbinden. Es muss also eine Verbindungsfindung in allen Richtungen zwischen beliebigen Neuronen möglich sein. Das Signalflussprinzip wird sich genau für diesen Zweck nützen lassen. Ich will hier eine kurze Überlegung vorwe gnehmen, um später noch einmal genauer darauf zu sprechen kommen. 62 Stellen wir uns ein Netzwerk vor, wie es in der Grafik dargestellt ist. Reiz A und B sind irgendwo repräsentiert. Die Gesetze nach denen die Verbindung zwischen A und B gewichtet wird, sind die Konditionierungsregeln, bzw. bayesianische Statistik: Was häufig in zeitlicher und räumlicher Nähe zueinander auftritt, wird stärker verbunden. Wir haben bei der Besprechung der Bayes-Netze festgestellt, dass unmöglich alle benötigten Verbindungen von vorn herein veranlagt sein können, weil die Kombinationsmöglichkeiten zu zahlreich sind. A kann also von vorn herein keine direkte Verbindung zu B besitzen. Die wesentliche Frage ist also nun: „Wie finden die Reize eine Verbindung zueinander?“ Die Antwort ist: Sie machen es wie der Blitz. Auch er findet den kürzesten Weg zum Boden, ohne Augen zu besitzen. Damit er das kann, muss aber der ganze Raum vorstrukturiert werden. Es müssen sich alle Luftmoleküle ausrichten. Ich nehme also an, von den aktiven Punkten geht ein Signalfluss aus, der das Netz vorstrukturiert, also durchkämmt. Entlang der Kämmlinien verläuft schließlich die Verbindung. Ein solcher Durchkämmungsprozess würde aber vor allem am Anfang der Lernphase zu großer Hirnaktivität führen, was durchaus so ist (Spektrum -Ticker 2001.11.30). 63 Die Geschwindigkeit des Signalflusses sorgt dafür, dass nahe Punkte schneller eine Verbindung finden, als entferntere. Nahes eher zu verbinden entspricht den Konditionierungsregeln. In der folgenden Grafik sind die Zeitlinien der Signalfließbewegung dargestellt. Das beste an der Idee aber ist, dass es sich immer noch um den gleichen Redundanzketten-Signalfluss handelt, der im visuellen System zu den Achsensekeletten geführt hat, wie sie in einer Grafik weiter oben gezeigt wurden. Wir müssen uns die Punkte nur als Löcher in einer Objektfläche vorstellen. 64 3 EIN GEHIRNMODELL AUF BASIS DES REDUNDANZKETTEN-SIGNALFLUSSES Im folgenden will ich die Möglichkeiten, die sich mit der Idee des Redundanzkettensignalflusses eröffnen, genauer durchdenken. Es wird sich zeigen, dass mit dieser Idee die Entwicklung eines selbstständig erkenntnisgewinnenden Kunsthirns für künstliche Wesen machbar wird. Die Botschaft dieser Arbeit lautet: Das fehlende Glied in der Entwicklung künstlichen Erkenntnisgewinns ist mit der Berücksichtigung der Signalfließzeit gefunden. Nun bedarf es nur noch ausreichender finanzieller Mittel, um ein, sich selbst strukturierendes, künstliches Gehirn zu bauen, d.h. eine dementsprechende elektronische Hardware zu entwickeln. Warum gab es diese Idee einer Berücksichtigung der Signalfließzeit nicht schon früher? Es ist wohl so, dass man in der Naturwissenschaft praktische Studien den theoretischen vorzieht. Da es kein Beobachtungsinstrument gibt, das den Signalfluss innerhalb einer Fläche verbundener Neuronen unabhängig von anderen Signalflüssen beobachten könnte, kann eine praktische Studie Signalfließzeiten in ihren Modellen auch nicht berücksichtigen, und somit tut man so als gäbe es sie nicht. Immerhin werden Fortschritte der Beobachtungsmethoden bald zu einer anderen Haltung führen (Spektrum-Ticker 2001.07.13, Ehret 1997). Theoretische Vorreiter, wie ich einer bin, werden nötig sein. Zeigt doch der Siegeszug der Physik, dass erst der theoretische Bereich die Ideen und Motive für zielstrebigere praktische Experimente hervorbringt. Ich gehe davon aus, dass ein erkenntnisgewinnendes System, ähnlich dem G ehirn, machbar ist. Ein solches System, das durch die Umweltreize programmiert wird, muss in einem mobilen Wesen integriert sein, das seine Aufmerksamkeit dorthin lenken kann, wo Erfahrungen zu holen sind. Um ein solches künstliches Gehirn zu schaffen, genügt es nicht die Natur zu beobachten, man muss sie verstehen. Denn das Menschenhirn ist nicht notwendigerweise ein ideales System. Man wird eventuell auf einem viel geradlinigeren Weg zum Ziel finden können. Die Evolution musste immer am Vorhandenen weiterbauen. So bekam der Delphin nie mehr Lungen, und wir aufrechten Wesen bekamen unser Rückgrad nie mehr ins Körperzentrum zurück, wie der Fisch, auch wenn wir dann weniger Wirbelsäulenprobleme hätten. Auch das Hirschgeweih ist eine Fehlentwicklung für ein im Wald lebendes Tier. Biologen könnten noch unzählige andere Beispiele für Irrwege der Natur nennen (Riedl 1989, S.18, S.242). Da das Verhalten von Lebewesen vorerst stark genetisch festgelegt war, hat sich der selbstlernende Teil des Gehirns, die Großhirnrinde, über den genetisch festgelegten gestülpt. Ein ideales selbstlernendes System kommt ohne diese Relikte aus. Es ist meiner Ansicht nach möglich ein erkenntnisgewinnendes 65 Volumen zu schaffen, auf das Projektionsfelder für Sinne und Motorik beliebig angeordnet werden können. Deshalb gehe ich auch kaum auf die Anatomie des Gehirns ein, sondern beschäftige mich mit der Struktur, die das Gewebe haben muss bevor Lernen einsetzt, und mit den Regeln, die es in sich birgt, und nach denen es durch Lernprozesse umstrukturiert wird. Es hat sich gezeigt, dass jedes selbstlernende Gehirn, ob künstlich oder natürlich, Regeln für sieben Problemstellungen in sich bergen muss. Bevor ich zu diesen komme, soll aber noch die Aufgabe des Gehirns allgemein definiert werden. Was ist die allgemeine Aufgabe des Gehirns? Das Gehirn ist das Organ, das uns sagt, was wir tun sollen, und unsere ausführenden Organe (Muskeln und Drüsen) dann dementsprechend aktiviert . Um herauszufinden, was wir tun sollen, bedarf es einer Prognose der Zukunft. Die Zukunftsprognosen kann man sich wie einen Baum vorstellen. Wir befinden uns am Stamm, und streben aufwärts. Es ist noch offen welchen Ast, und dann welchen Zweig die Ereignisse wählen werden, und doch stehen nicht unendlich viele Möglichkeiten zur Verfügung. Zumindest die nahe Zukunft lässt sich meist auf eine kleine Zahl möglicher Wege (Äste) begrenzen. Je ferner, desto dünner und ungewisser wird unsere Voraussicht (Zweige). Oft führen Ereignisse auch wieder zurück zu bereits bekannten Situationen. Zum Beispiel die Situation, dass ein Schüler gerne Englisch lernt, führt dazu, dass er seine Vokabel kann, führt dazu, dass er Erfolg in diesem Fach hat, führt dazu, dass er motiviert ist und gerne Englisch lernt. Damit sind wir wieder am Anfang. Das bedeutet unser Baum der Voraussicht gleicht einer Trauerweide. Die Äste führen oft zurück zum Stamm. Der Stamm in unserem Bild stellt immer die Gegenwart dar, während die Äste die Vorstellung von Zukunft darstellen. Nun gehen wir in der Zeit ein Stück we iter. Eine Voraussage wird Wirklichkeit, sie wird zum Stamm. Der einstige Stamm verschwindet in der Vergangenheit. Stellen wir uns nun unseren Baum als akt iven Bereich in einem großen Netz von Verbindungen vor. Der Stamm kennzeichnet den, durch Wahrnehmung gegenwärtig aktivierten Bereich. Die Äste und Zweige sind der, durch Vorstellung voraktivierte Bereich. Tatsächlich ist im Gehirn eine Voraktivierung wenn wir uns etwas vorstellen nachweisbar, und zwar jeweils im selben Areal, das aktiv wird, wenn wir die vorgestellte Sache real wahrnehmen. Wenn z.B. die Verbindung von der visuellen Wahrnehmung zu dem Areal in dem sie die Gestaltbegriffe speichert, unterbrochen ist, dann können wir die Dinge nicht mehr erkennen, aber es wird von einem Patienten berichtet, bei dem die Verbindungen zur Motorik heil blieben, und der die Dinge durchaus noch zeichnen konnte (Kolb 1996, S.220). Auch die, mit Bewegungsvorstellungen einhergehenden Aktivierungen in der motorischen Hirnrinde bis hin zu leichten Muskelaktivierungen, sind messbar. (Kolb 1996, S.403). Ja es ist sogar so, dass wir länger für die Vorstellung einer längeren Handlung brauchen. So braucht es länger sich 66 vorzustellen man schreibe seinen Namen in großen Lettern an eine Tafel, als man schreibe ihn klein in ein Heft. (Kolb S. 403). Was ist ein Ereignis oder ein Objekt im Gehirn? Jeder Knotenpunkt (Astgabel) unseres „Zukunftsbaums“ steht für etwas Wahrnehmbares in der realen Welt (Ereignis oder Objektklasse). Aber müssen wir dann nicht jeden Knotenpunkt beschriften, damit wir wissen für welches Objekt er steht? Die Antwort ist „nein!“. Was sollte eine solche Beschriftung bringen. Für ein Datenverarbeitendes System ist sie nur eine Buchstabenfolge. Diese taugt bestenfalls dazu, die Knoten auseinanderzuhalten. Das ist aber nicht notwendig, denn sie sind einfach durch ihren Ort im Netzwerk auseinandergehalten. Wie aber kann dann ein solcher Knoten eine Bedeutung haben? Die Antwort ist, dass nicht der Knoten selbst Bedeutung hat, sondern das Netz an Verbindungen, das ihn umgibt. Er hat über andere Knoten hinweg letztlich Kontakt bis hin zu bestimmten Input und Output-Bereichen des Gehirns. Das bedeutet, über ihn werden nicht nur Vorstellungen von weiteren Ereignissen wachgerufen, sondern vor allem auch Vorstellungen von Sinneseindrücken (Input), von Handlungen und Bewegungen (Output), und von Empfindungen. Wobei wir der Einfachheit halber annehmen wollen, dass Empfindungen nichts weiter sind als die Vorstellung von Abweichungen oder Annäherungen der Körpermesswerte an Körpersollwerte (Regelkreisprinzip). Die Bedeutung liegt also nicht im Knoten selbst. Aber er ist doch immerhin der Platz, an dem all die Verbindungen zusammenlaufen, die einen Begriff ausmachen. Dass es solche Plätze gibt, und dass ständig welche erlernt werden, an denen neue Verbindungen zusammenlaufen, ist neurophysiologisch erwiesen (siehe oben). Zusammenfassung der Grundidee neuronaler Netze Neuronale Netze sind im Anfangszustand aus lauter gleichen, miteinander verbundenen Bausteinen zusammengesetzt (leeres Gehirn). Das Verhalten jedes solchen Bausteines beruht auf den Erkenntnis- bzw. Lernregeln. Input erhält das System durch die Rezeptoren der Sinnesorgane und über die körperlichen Sollwertabweichungen. Die motorischen Aktivitäten werden über Gelenkssensoren ebenfalls sensorisch erfasst und es werden Verbindungen hergestellt, zwischen vorausgehenden Aktivitäten und eintretenden Folgen. Über solche Verbindungen kann schließlich erlernt werden, Ereignisse vorauszuahnen (Zukunftsbaum) und Handlungen so zu kontrollieren, dass Körpersollwerte wiedererreicht werden, wenn eine Abweichung eingetreten ist, oder befürchtet werden muss. Die Berücksichtigung der Signalfließzeiten spielt in dem hier dargestellten Modell eine wesentliche Rolle, weil gezeigt werden kann, dass sich durch diese Zeiten in einem Neuronennetz räumliche Information automatisch zeitlich codieren kann. Diese neue Idee bringt dem neuronalen Netz einen enormen Kapazitätsgewinn, macht Wiedererkennen von Objekten in natürlichen Bedingungen überhaupt erst 67 vorstellbar, und erklärt die Serialität bewussten Denkens. Deshalb der Name: "Fließnetz". Die sieben Problemstellungen eines Gehirns 1. Regel zur Bindungsstärke: Ein Gehirnmodell muss angeben, unter welchen Bedingungen neuronale Verbindungen verstärkt, bzw. geschwächt werden, und wann sie ganz verfallen. 2. Regel zur Verbindungsfindung: Die bisherigen künstlichen Netze nehmen Verbindungen einfach als gegeben. Kombinatorische Überlegungen haben uns gezeigt, dass nicht alle Verbindungen, die später einmal gebraucht werden, von vorn herein da sein können. Es wären undurchführbar viele. Also brauchen wir ein Modell der Verbindungsfindung! 3. Regel zur vernetzten Organisation des Wissens: Wissen wird im Gehirn nicht in einer langen Wurst abgespeichert, wie auf einer Festplatte, sondern es ist vernetzt. Wenn wir uns etwas Neues merken, so setzen wir es so weit wie möglich aus bereits bekannten Bausteinen zusammen. Auch das visuelle System ist in hierarchischen Ebenen organisiert. Durch welche Regeln organisiert sich ein Gehirn dera rtig? 4. Regel zum Zusammenfluss der Signale: Was geschieht, wenn mehrere Signale eine Zelle beliefern? Werden sie vermengt, nacheinander behandelt, siegt das Stär kere, oder gibt es noch eine andere Lösung? Welche Lösung macht Sinn? 5. Regel zur zeitlichen Voraussage. Das Gehirn enthält nicht nur statisches Wissen, wie ein Buch, sondern wir vermögen auch, uns auf Tagesabläufe einzustellen und Bewegungen zeitlich exakt zu koordinieren. 6. Regel für Verhalten das körperlichen Bedürfnissen folgt. Alle Aktivität entspringt letztlich irgendwelchen Bedürfnissen. Können sie alle durch Körpersollwertabweichungen definiert werden, die dem System genetisch mitgegeben sind, wie die Körpertemperatur? Wie kommt es zu sinnvollen Handlungen? 7. Regeln für geistige Bedürfnisse und kreatives Verhalten. Ohne Lerntrieb würde ein Baby den ganzen Tag stumm gegen die Wand starren. Es kann noch kein körperl iches Bedürfnis selbst befriedigen, also braucht es eine andere Anregung. Neben der Aufnahme von Wissen, besitzen Lebewesen auch die Fähigkeit kreativ neues Verhalten hervorzubringen. Auch ein künstliches System braucht diese Funktion. Dieses Schriftstück ist nach diesen sieben Regeln gegliedert (siehe Inhaltsverzeichnis). Zur besseren Orientierung im Text versuchen sie doch, sich die sieben Regeln einmal ganz einfach durch folgenden kryptischen sinnlosen Satz zu merken: „Stärke findet Organisation durch Zusammenfluss von Voraussagen, körperlicher und geistiger Art“ Gemessen an diesen sieben Problemstellungen zeigt sich erst wie wenig neuronale Netze bisher erklären konnten. Meist sind sie spezialisiert auf einen bestimmten Problembereich. Auch die neue Idee einer zeitlichen Koordination von Reizen durch 68 Synchronisationsmuster, bietet nur für einen Punkt eine Lösung, nämlich für Punkt 4. Das heißt, es lässt sich damit vielleicht erklären, welche Signale zusammenfließen, und welche nicht. Synchronisationsmuster erklären aber noch nichts zu den anderen 6 Problemstellungen. Oft wird dann so getan, als gäbe es die jeweils anderen Probleme gar nicht. Ich habe nun etwa 7 Jahre an dem hier vorgestellten Modell gearbeitet, und es hat mich in etwa gleich viel Mühe gekostet, bis ich zu jedem dieser 7 Punkte eine klare Regel angeben konnte, die nicht in Widerspruch zu den anderen Regeln steht. Jedes der Probleme ist gleichermaßen bedeutsam. Bleibt ein Punkt ungelöst, so bringt das gesamte Gehirnmodell keine Leistung mehr, die der Natur nahestünde. 3.1 Regeln zur Bindungsstärke: 3.1.1 Die Assoziative Konditionierung Ziel dieser Arbeit ist es, zu zeigen, dass eine erkenntnisgewinnende Struktur, (ähnlich der Großhirnrinde) konzipiert werden kann, die zur Verarbeitung jeder Art von Information taugt. Das heißt, es gibt Erkenntnisregeln, die für die Verbindung der Reizsignale einzelner Netzhautzellen genauso gültig sind, wie für die Verbindung komplexer Reize, wie sie in Konditionierungsexperimenten verwendet werden. Wenn ich die Regeln aus Konditionierungsexperimenten ableite, so hat das den Vorteil, dass die Ergebnisse für jedermann überprüfbar sind, allerdings den Nachteil, dass ich immer schon die Fähigkeit zu einer komplexen Reizdifferenzierung voraussetze, denn in Konditionierungsexperimenten kommen komplexe Reize zum Einsatz, wie Glocke oder Rotlicht. Es wird stillschweigend davon ausgegangen, dass das Wiedererkennen solcher Reize kein Problem darstellt. So einfach ist das aber gar nicht. Deshalb sollen die Erkenntnisregeln, die ich erst einmal anhand der Konditionierung entwickle, nachher auf das visuelle System angewendet werden, um damit schließlich auch zu erklären, wie sich Einzelrezeptoren, also die Reize der Sinne, so verbinden, dass komplexe Reize erkannt werden können, denn auch erkennen muss gelernt werden (Miller 2000). Die einfachste Form der Konditionierung ist die assoziative. Assoziative Konditionierung bedeutet Lernen ohne Verhalten, rein aus Beobachtung. Erlernt werden nicht Stimulus-Response-Verbindungen (Reiz-Reaktionsverbindungen), sondern Stimulus-Stimulus-Verknüpfungen. Dies scheint dem Konditionierungsprinzip zu widersprechen, denn wie könnten wir Lernen beobachten, wenn wir kein Verhalten erfassen? Tatsächlich kann durch eine intelligente Versuchsanordnung einwandfrei auf einen Lernprozess rückgeschlossen werden, der stattgefunden haben muss, bevor überhaupt Verhalten ins Spiel kam. Die folgende Versuchsanordnung beweist, dass Pawlows klassische Konditionierung bereits eine assoziative Konditionierung war. (Mehr dazu bei Zimbardo 1995, S.294). 69 Frage: Wie sieht es in der Black-Box "Gehirn" aus; Welche Art der Verbindung entsteht? Experiment: Phase 1: Im Käfig eines Hundes erscheint mehrmals am Tag rotes Licht und dazu die Glocke. Phase 2: Pawlow: Vor dem Futter kommt immer die Glocke. Phase 3: Kontrolle: Speichelt der Hund auf rotes Licht? In Phase 1 könnte eine Verbindung Rotlicht-Glocke entstanden sein. Eine direkte Verbindung zu R kann nicht entstanden sein. Ergebnis: Hund speichelt. Das beweist, dass Signale in Stimuliketten fließen (= Assoziative Konditionierung, Zimbardo 6. S. 294) In dem im Kasten beschriebenen Versuch kann keine Verbindung zwischen Rotlicht und speicheln entstanden sein, da in der Konditionierungsphase mit dem Rotlicht kein Futter angeboten wurde. Es kann also nur über eine Verbindung von Rotlicht und Glocke dazu kommen, dass der Hund in Phase 3 auf Rotlicht speichelt. Die Stimuliverkettung Rotlicht-Glocke wurde ohne Belohnung rein durch die Beobachtung eines statistisch häufigen Zusammentreffens erworben. Das bedeutet es war noch kein Speicheln, also keine Reaktion im Spiel. Die obere der beiden Grafiken ist also die richtige. Sie zeigt eine Verbindungskette, über die Signale der Realität vorauseilen können. Damit ist bewiesen, dass Signale, über Verbindungsketten fließen. Pawlows Konditionierung dient im realen Leben dazu, eine Voraussicht der Welt zu erwerben. Reaktionen sind dazu nicht notwendig. Erst in Skinners Experimenten zur operanten Konditionierung (Zimbardo 1995, S.305) geht es, wie im Zirkus, um den Erwerb neuen Verhaltens. Pawlow hingegen ist allein mit Statistik zu simulieren. Verhaltensmutation und Selektion finden nicht statt. Bayesianische Netze simulieren also Pawlow. Die assoziative Konditionierung wurde auch mittels Elektroden in Seeschnecken herbeigeführt und am offenen Neuronennetz beobachtet (Byrne 2002, Graham 2002, Birbaumer 1997, S.585). Inzwischen gibt es zahlreiche Hinweise auf Stimuliverkettungen im Gehirn (Tritschler 2001). Der Glaube an reines ReizReaktions-Lernen gehört der Vergangenheit an. Wenn wir uns die Welt vorstellen, so deshalb, weil wir Abfolgen von aneinandergeketteten Stimuli erlernt haben. 3.1.2 Wir treffen Voraussagen aufgrund eines statistischen Lernmechani smus Wenn ein Wissenschafter eine Voraussage über die Zukunft machen will, so bedient er sich statistischer Verfahren. Wir kennen keine anderen Verfahren, um Vorauszusagen zu entwickeln. Tatsächlich gibt es inzwischen viele 70 Untersuchungen, die zeigen, dass auch das Gehirn statistisch arbeitet. (SpektrumTicker 2002.01.24, Spektrum-Ticker 2002.03.25, WSA 2002.11.29) Eigentlich sollte dies schon lange klar sein. Haben sie sich schon einmal gefragt, warum dieser „Supercomputer“ Gehirn nicht in der Lage ist, sich eine größere Menge an Information sofort zu merken? Die Antwort ist: Wir merken uns deshalb Zusammenhänge meist erst nach einigen Wiederholungen, weil das Gehirn sich auf diese Weise davor schützt, Dinge als zusammengehörig zu vermerken, die nur einmal zufällig aufeinander gefolgt sind. Wenn wir uns nur merken, was wiederholt aufeinandergefolgt ist, so werden wir mit der Zeit die Fähigkeit zur Voraussicht der Welt ausbauen. Merken wir uns alles zu leicht, so wird aus uns ein zerstreuter lebensuntüchtiger Professor dessen Rettung darin besteht, dass es in unserer Kultur Bücher gibt, wo überwiegend sinnvolle Zusammenhänge verzeichnet sind. 3.1.3 Wann wird eine Verbindung mit welcher Stärke erlernt? Die folgende Grafik zeigt wie oft zwei Ereignisse A (Kreis) und B (Dreieck) über die Zeit hinweg alleine, und wie oft sie zusammen auftreten. Nach Bayes besteht ein Zusammenhang dann, wenn Ereignisse öfter zusammen auftreten als alleine. Wie stark ist der Zusammenhang in dem dargestellten Beispiel? Dem Reiz A (Kreis) folgt durchschnittlich jedes dritte mal B (Dreieck). Jedes 1 0. mal tritt B alleine auf. Die Wahrscheinlichkeit mit der bei vernommenem A gleich ein B wahrzunehmen sein wird, ist also ein Drittel. Diese Wahrscheinlichkeit ist ausschlaggebend dafür, wie stark unsere Voraussageverbindung von A zu B sein darf, wie sehr wir also nach Auftreten von A mit B rechnen und wie stark das Erwartungssignal ist, das im Gehirn dem Modell zufolge durch die Verbindung zu B gelangt. (Und wie ist das, wenn A genauso häufig alleine auftritt als dass darauf B folgt? Nehmen wir an A trat 100 mal alleine auf, und 100 mal folgte darauf B, A trat also 71 insgesamt 200 mal auf, so ist laut Bayes Gleichstand erreicht: 100:200=0,5. Wir dürfen mit halber Erwartung auf B hoffen, wenn wir A wahrnehmen.) Nun haben wir aber umgekehrt in der obigen Grafik auch erfasst, dass B unter zehn Auftritten nur neunmal zusammen mit A auftritt. Die Wahrscheinlichkeit dass zwischen A und B ein Zusammenhang besteht, ist demnach neun Zehntel, also 0,9 und nicht 1 (Bauer 1991, S.61). Letztere Wahrscheinlichkeit ist ausschlaggebend dafür, als wie sicher ein Zusammenhang betrachtet werden kann, bzw. ob überhaupt von einem Zusammenhang gesprochen werden darf. Auf das Gehirn umgelegt, ob also eine Verbindung aufrecht erhalten werden soll, oder nicht. So viel zur statistischen Berechnung der bedingten Wahrscheinlichkeit nach Bayes. Um seine Verbindungen zu kontrollieren, muss unser künstliches Neuron B also über eine innere Zählmaschine verfügen, die erfasst, wie oft: A insgesamt auftrat A und B zusammenfielen, und B insgesamt auftrat. Um die Stärke der Voraussage zu erfassen, muss im Neuron der zweite Wert durch den ersten dividiert werden. Um zu erfassen ob die Verbindung aufrecht erhalten werden soll, der zweite durch den dritten. Man kann auch sagen der zweite Wert muss durch den dritten geschwächt werden, denn eine Division ist immer eine Schwächung eines Wertes. Zellen dividieren nicht. Sie schwächen und verstärken Verbindungen. Umgekehrt kann natürlich auch die Wahrscheinlichkeit betrachtet werden mit der A auf B folgt. In unserem Beispiel ist A nie auf B gefolgt, die Wahrscheinlichkeit ist also null. Da A immer ohne ein davorliegendes B, sozusagen spontan auftrat, braucht in diese Richtung auch kein Zusammenhang angenommen werden. Das bedeutet, in dieser Richtung braucht keine Verbindung aufgebaut werden. 3.1.4 Wie und warum neue Erfahrungen stärker gewichtet werden sollten. Allgemein gilt für die statistische Überprüfung von Verbindungsstärken (die ja Wahrscheinlichkeitsgrade von Zusammenhängen repräsentieren), dass die Zählergebnisse mit zunehmender Erfahrung immer höher werden. Es stellt sich die Frage, wie lang der Zeitraum sein soll, in dem Ergebnisse noch statistisch erfasst werden sollen. Ist er kürzer als eine Nacht, so müssten im Extremfall, mit jedem mal Schlafen gehen, die Verbindungen verfallen. Das kann nicht sein. Nehmen wir aber als Berechnungszeitraum die gesamte Zeit seit die Zelle existiert an, sozusagen von der Geburt weg, dann fragt sich, wie wir die hohe Zahl an Reizen zählen und verarbeiten sollen. Außerdem würden sich Verbindungen, die über Jahrzehnte nur verstärkt wurden, auch über Jahrzehnte nicht mehr löschen lassen. Nun fragt sich aber: Wie kann dann Gehirngewebe später noch für etwas Neues genützt werden. Wie z.B. könnte dann ein Erblindeter Gehirnbereiche nutzen, die einst dem visuellen Bereich zugeordnet waren? 72 Die Lösung besteht darin, nicht einen bestimmten Zeitraum, sondern eine bestimmte Anzahl an Reizen zu überwachen. Darüber hinaus ist das System einfach voll. Ich will damit sagen, dass wir in einem begrenzten System eine Kapazitätsgrenze festlegen müssen, ab der wir alte Erfahrungen nicht mehr in unsere Wahrscheinlichkeitsrechnung einbeziehen. Ansonsten würden neu hinzukommende Erfahrungen, in Relation zur Summe der bereits gemachten, immer weniger Gewicht bekommen. Das wäre nur dann in Ordnung, wenn die Welt um uns immer gleich bleiben würde. Wenn wir annehmen, dass die Welt sich in einem stetigen Wandel befindet, sollten wir den neuen Erfahrungen mehr Gewicht verleihen. Das können wir, indem wir alte Erfahrungen nach und nach über Bord werfen. Das ist ganz einfach vorzustellen. Die Bayesianische Statistik ist durch Relationen darstellbar. Eine gute visuelle Anschauung gibt uns dazu das Farbenmischen. Stellen wir uns vor, wir beobachten, dass B fünfmal auf A folgt. Diese Folge stellen wir durch fünf Tropfen schwarze Farbe dar, die wir in einen Topf geben. Nun folgt A einmal alleine und B bleibt aus. Das stellen wir durch einen weißen Far btropfen dar, den wir im Topf dazurühren. Es folgen weitere Erfahrungen, und weitere Tropfen Schwarz und Weiß werden zugerührt. Die Wahrscheinlichkeit mit der wir annehmen dürfen, dass jedes B durch A angekündigt wird, ist durch den Graug ehalt der Gesamtfarbe dargestellt. Nehmen wir an, nach 100 Tropfen wird der Topf voll. Mit jedem neuen Tropfen, den wir zufügen, schwappt ein alter Tropfen Farbe aus dem Topf. Ich nehme an, dass unser Gehirn genau so arbeitet. Ab dem Moment wo es voll ist, berücksichtigt es neue Information stärker. Es kann sich auf diese Weise immer relativ schnell an neue Verhältnisse anpassen. Die Anpassung an neue Verhältnisse führt aber dazu, dass alte Erinnerungen umgeformt werden. Was man einst für wahrscheinlich hielt, wird durch neue Erfahrungen plötzlich für unwahrscheinlich gehalten, und umgekehrt. Studien belegen, dass eine solche Umformung stattfindet, denn jedes Mal, wenn das Gehirn Erinnerungen aus dem Langzeitgedächtnis wieder aufgerufen hat, müssen diese 73 erneut durch die Synthese frischer Proteine konsolidiert werden (Spektrum-Ticker 2000.08.17, Spektrum-Ticker 2001.07.30). Wenn wir von einem neuronalen Netz ausgehen, dessen Neuronen Verbindungen darstellen, und somit die für die Wahrscheinlichkeitsrechnungen nötigen Divisi onen und Multiplikationen ausführen sollen, so ist es, als ob jede Zelle einen kleinen Taschenrechner darstellt. Dass eine solche Annahme sinnvoll ist, zeigen Studien, die nahelegen, dass Gehirnzellen durchaus in der Lage sind, Signale multiplik ativ zu verstärken, oder abzuschwächen (Gabbiani u.a. 2002, Spektrum-Ticker 2001.04.19, Spektrum-Ticker 2002.01.24). Ein Umsetzung einer solchen Idee ist digital natürlich aufwendig und kaum durchführbar. Aber wenn wir von der digitalen Lösung abweichen, und auf analog arbeitende Transistoren zurückgreifen, so erscheint die Sache durchaus durchführbar, denn ein analog arbeitender Transistor, wie er im Verstärker einer Stereoanlage vorkommt, tut nichts anderes als die einkommenden Signalstärken zu multiplizieren (und damit die Lautstärke des Outputsignals zu erhöhen), wobei der Multiplikationsfaktor abhängig ist von der Spannung, mit der er versorgt wird. Was nun, wenn diese Spannung nicht konstant ist, sondern ihrerseits ebenfalls ein Signal wechselnder Stärke? Dann erhalten wir die komplizierten Outputergebni sse, die wir für eine Umsetzung der bayesianischen Formel in einem Netzwerk benötigen! Und es sind nur einfache Bauteile notwendig: analoge Transi storen! 3.1.5 Wo Konditionierungslernen von Bayes abweicht Aber was heißt überhaupt Reize treten zusammen auf? Wieviel Zeit darf zwischen zwei Reizen vergehen bevor man sagen kann, sie sind alleine aufgetreten? Diese Frage ist statistisch ungültig. Wichtig für die Voraussage von Reizen ist nämlich nicht die Länge der Zeitdistanz, sondern, dass diese Länge jedesmal gleich war. Statistisch betrachtet können wir die Reize in Fig. C der folgenden Grafik noch genauso gut voraussagen wie in Fig. A, denn das Dreieck folgt genauso zuverlässig immer auf den Kreis, aber eben verspätet, also nicht AB, sondern A.......B. 74 Konditionierungsexperimente zeigen aber, dass der Zusammenhang zwischen A und B nicht mehr erkannt wird, je weiter der Zeitabstand A B die Auftrittshäufigkeit der Reize überschreitet (siehe Fig.C). Kann diese Begrenzung in unserer Wahrnehmung der Welt einen praktischen Grund haben? Wieso sollten nahe Reize einander eher auslösen als ferne? Eine Antwort kann über die Häufigkeit von Reizen gefunden werden. Ein Reiz der mehr als doppelt so häufig auftritt wie ein anderer, kann letzteren niemals zuverlässig ankündigen, weil nur Reize die gleich häufig vorkommen auch immer zusammen vorkommen können. Doppelte Häufigkeit bedeutet, dass die Signale des ersten Reizes durchschnit tlich nur halb so viel Abstand zueinander aufweisen wie die Signale des zweiten. Da das Gehirn immer nach möglichst guten Ankündigungsreizen (A) Ausschau hält, brauchen nur Signale auf eine Korrelation untersucht werden, die durchschnittlich ähnliche Häufigkeit aufweisen. Aber mit welchem der Folgereize sollte eine Verbindung hergestellt werden? Mit dem nächsten, oder dem fünf Reize weiter? Nehmen wir an wir sehen auf eine entfernte Stadt über die ein Gewitter niede rgeht. Auf jeden Blitz folgt in einem gewissen Abstand ein Donner. Werden die Blitze häufiger, so fallen zwischen jenen Blitz, der den Donner den wir hören ausgelöst hat, noch weitere Blitze. Natürlich wäre statistisch immer noch die Korrelation zwischen Blitz und Donner erfassbar, weil der Zeitraum zwischen ihnen noch konstant ist, solange das Gewitter die gleiche Entfernung hat. Unser Gehirn steigt hier wohl deshalb aus, weil es in der Natur kaum solche Beispiele gibt, wo gilt Reiz A verursacht B, aber nicht das folgende, sondern irgendein weiteres B. Das bedeutet, dass unser Gehirn nur den Zeitraum von A zum darauf folgenden A auf ein B absucht, das in einem möglichen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zu A steht. Eine solch sinnvolle Leistungsbeschränkung wollen wir auch in unserem künstlichen System verankern, zumal wir ohnehin den enormen Rechenaufwand reduzieren müssen. Kann ein solches System dann aber überhaupt noch lange Zeitzusammenhänge erfassen? Ja! und zwar durch Chunkbildung! Eine Kette von Ereignissen kann eine Einheit bilden, die wir als Chunk bezeichnen wollen. So ein Chunk könnte zum Beispiel "Frühstücken" lauten. Und dem Frühstücken kann das Chunk "Einkaufen gehen" folgen. Die beiden Chunks haben etwa gleiche Auftrittshäufigkeit Relativ zu dem Zeitraum vom Auftreten zum durchschnittlichen nächsten Auftreten des gleichen Chunks, liegt zwischen den verschiedenen Chunks ein geringer zeitlicher Abstand. Also werden sie verbunden. So erfasst ein Baby Tagesabläufe, und hat es erst einmal den Tagesablauf als Chunk, so kann es den Wochenablauf erfassen usw. Im Prinzip ist jeder Begriff ein Chunk. 75 3.1.6 Über die Distanzen statistische Gleichbehandlung räumlicher und zeitlicher Was wir hier für die zeitliche Distanz von Ereignissen ermittelt haben, gilt gleichermaßen für den Raum. Das zeigt sich auch an der obigen Grafik. Zusammenhänge, die wir zeitlich nicht mehr erkennen, sind auch in ihrer grafischen räumlichen Darstellung nicht augenscheinlich. Nun lässt sich gegen diesen Grundsatz einwenden, dass es durchaus Zusammenhänge gibt, die wir zeitlich verstehen, die aber räumlich dargestellt nicht so gut fassbar sind, z. B. erkennen wir im grafisch dargestellten Frequenzmuster eines Musikstückes einen falschen Ton nicht mehr. Allerdings ist zu bedenken, dass wir von Kindheit an mit Musik konfrontiert sind, und so im auditiven System bereits über geeignete Chunks verfügen, die uns ein Verständnis ermöglichen. Im visuellen System, mit dem wir die Frequenzmuster betrachten, haben wir noch keine geeigneten Chunks für dieses Muster auf Lager. 3.1.7 Die Darstellung negativer Relationen durch hemmende Verbi ndungen Hemmende Verbindungen treten im neuronalen Netz dann auf, wenn eine verkehrtproportionale Relation erfasst werden soll. Stellen wir uns vor, Pawlows Hund bekommt weniger bis gar kein Futter, je heißer der Tag ist. Je stärker die Einheit seines Gehirns anspricht, die die Raumtemperatur repräsentiert, desto schwächer soll die Voraussage für Futter werden. Vom Reiz „Raumtemperatur“ geht eine hemmende Verbindung zum Reiz „Futter“. Positive Relationen sind leichter verständlich als negative. Sie bedürfen keiner hemmenden Verbindungen. Läuten wir dem konditionierten Hund irgendwann die Glocke sehr leise, wird er auf Anhieb nicht sicher sein, ob jetzt auch Futter kommt. Das Erwartungssignal ist sozusagen dann auch leiser (positive Relat ion). Aber stehen hemmende Verbindungen damit nicht in Widerspruch zu der Lerntheorie? Wir sind doch davon ausgegangen, dass sich Zeitgleiches, Nahes und Ähnliches verbindet. „Ähnlich“ bedeutet auf der elementaren Basis der Neuronen „ähnliche Reizstärke“. Hemmende Verbindungen entstehen aber aufgrund der zeitgleichen Unähnlichkeit zweier Reize! Der Widerspruch hebt sich auf, wenn wir begreifen, dass hemmende Verbindungen eigentlich „Antiverbindungen“ sind. Aber um die Hemmung zu übertragen brauchen wir trotzdem eine Verbindung im neuronalen Netz! Die Lösung dieses Problems können wir uns vom Gehirn abschauen. Von gut erforschten Gehirnbereichen, wie der Sehrinde, wissen wir, dass alle Reize in Form eines Gegenreizes noch einmal vorliegen. Zu jeder On/Off-Zelle gibt es eine Off/On-Zelle. Zu jedem Reaktionsbild ein Negativ (Hubel 1989, S.50). Man könnte sich das so vorstellen, dass unter einer Zelle, die auf Glocke positiv anspricht immer die gegenteilige Zelle liegt, die auf Glocke gehemmt wird. Die Beiden bi lden 76 ein Paar. Umso stärker der Reiz, desto mehr Differenz weisen deren Zellreaktionen auf. Wenn wir von dem obigen Beispiel ausgehen, und uns naiv vorstellen, unser Hund hätte eine Zelle für Futter, dann hat er auch eine für „Antifutter“. Das Signal von der Zelle für Raumtemperatur korreliert in unserem Beispiel nun nicht mit „Futter“ sondern eben mit „Antifutter“. Es kann mit der Zelle für Antifutter nach dem G esetz ähnlicher Reizintensität verbunden werden. Wenn wir die bayesianische Statistik nun auf die Zellen und Antizellen anwe nden, so ist klar, dass zwei Paare (jew. Zelle plus Antizelle) nie zugleich eine positive und eine hemmende Verbindung zueinander aufbauen werden. (Bestenfalls abwechselnd, wenn die Bedingungen rhythmisch wechseln), denn es wird sich nur durchsetzen, was häufiger zutrifft, also immer nur eines von Beidem. 3.2 Regeln zur Verbindungsfindung Das Gesetz, dass räumlich und zeitlich Nahes eher verbunden wird, bedarf keiner eigenen Umsetzung in unserem System. Was die zeitliche Nähe betrifft, so ergibt es sich automatisch, dass was zuerst kommt, auch zuerst verbunden wird. Was die räumliche Nähe betrifft, so wird sich nun zeigen, dass die Verbindungsfindung durch den Signalfluss, ganz automatisch das Nahe vor dem Entfernteren verbindet. Es braucht also auch hier kein eigener Mechanismus im System verankert werden. Die Verbindungsfindung zu erklären bedeutet, einen Weg zu finden, um in einem künstlichen System eine Verbindung herzustellen, wo vorher keine war. Da wir die Verbindung schlecht wachsen lassen können, muss wohl vorher schon etwas da sein. Aber die Verbindungen, die vorher da sind, brauchen noch nicht direkt die Punkte verbinden, die später verbunden werden sollen. Stellen wir uns also ein Netz vor, in dem jedes Neuron über 12 Verbindungen mit seinen direkten Nachbarzellen rundum Kontakt hat (6 hin, 6 Retour). Wenn wir, wie oben, davon ausgehen, dass ein Neuron in einem Netzwerk das Zukunftsprognosen leistet, durchschnittlich nur mit vielleicht drei anderen Neuronen eine Voraussageverbindung aufrecht hält (also drei mögliche Zukünfte voraussagt) , so verfügt das Netz mit zwölf Verbindungen pro Neuron bereits über einen Überschuss. Es kann also die Mehrzahl zu reinen Durchläufern umgestalten. Diese Durchläufer können weiter auseinanderliegenden Zellen dazu dienen, sich zu verbinden. Eine Verbindung verläuft also meist über andere Zellen. An diesen durchlaufenden Verbindungen muss ein Neuron, sobald sie einmal hergestellt sind, nichts mehr ändern oder berechnen. Das Signal läuft einfach durch. Diese Vorstellung entspricht dem Gehirn. Auch Neuronen haben eine große Zahl an veranlagten Verbindungen, aber nur wenige davon werden durch Lernvorgänge besetzt (Spektrum-Ticker 1999.11.29, Spektrum-Ticker 1999.11.29). 77 Neue Verbindungen in einem künstlichen Gehirn könnten also dadurch entst ehen, dass sie einfach über andere Zellen hinweglaufen, ohne dass sie diese Zellen aktivieren. Sie müssen dazu im Inneren dieser Zellen abgekoppelt werden. Di eser Abkopplungsprozess wird uns noch näher beschäftigen. Vom natürlichen Gehirn ist anzunehmen, dass es neben der Möglichkeit eines Signalflusses über andere Zellen hinweg (Kettensignalfluss) auch Wachstumsprozesse zur Herstellung von Verbindungen nützt. Vielleicht provozieren Zellen, die voll besetzt sind, weil alle Durchfahrtswege schon genützt werden, den Wachstumsprozess neuer, freier Nachbarzellen. Dass frische Nervenzellen benötigt werden, wenn die vorhandenen alle besetzt sind, zeigen neuere Studien (SpektrumTicker 2001.03.20 , WSA 2002.02.28, Spektrum-Ticker 1999.10.19) 3.2.1 Das Blitzprinzip Wie finden entfernte gleichzeitig aktive Neuronen einen Weg zueinander? Wie findet der Blitz den Weg zum Boden? Das Gesetz der Nähe fordert, dass Neuronen, die häufig innerhalb eines, relativ zur Auftrittshäufigkeit kleinen Zeitraumes, zusammen reagieren, eine Verbindung zueinander herstellen. Es erscheint einfacher die Forderung nach einer Verbindungsfindung für gleichzeitig aktive Neuronen zu erfüllen, als für dieses Nacheinander. Deshalb besteht der erste Schritt zu einer Lösung darin, für eine Nachaktivierung zu sorgen, die bis zur durchschnittlichen nächsten Aktivierung des Neurons abklingt. Wir wollen annehmen, dass das Neuron in dieser Zeit der Nachaktivierung für eine Verbindungsbildung offen ist. Mit dieser ersten Lösung des Zeitproblems, reduziert sich das Problem der Verbindungsfindung vorerst darauf, die räumliche Distanz zwischen zeitgleich aktiven Neuronen zu überbrücken. Wahrnehmungsexperimente haben ergeben, dass Bildelemente, die räumlich nahe sind, eher in Bezug zueinander gesetzt werden (Anderson 1996, S.43). Diese Regel kann direkt auf das Gehirngewebe angewendet werden, auf welches das Bild übertragen wird. Neben dem Problem der Nähe stellt sich auch noch die Frage der Direktheit von Verbindungen. Es sollten möglichst gerade Verbindungswege gefunden werden, die nicht unnötig viele Durchläuferzellen erfordern. Das hier gestellte Problem gleicht dem eines Blitzes. Wie findet er den kürzesten Weg zu Boden? Er kann doch nicht sehen! Was den Blitz betrifft, so liegt die Erklärung in einer Geladenheit des Luftraumes, dessen molekulare Bausteine sich elektrisch ausrichten. Der Blitz braucht dann lediglich diese Ausrichtung entlangzuwandern (Mathelitsch 2002). Auch im Fall unseres neuronalen Netzwerkes wird es nicht ohne eine solche Ausrichtung gehen. Das Netz muss sozusagen gekämmt werden, damit das Signal seinen Weg finden kann. Wenn man das biologische Vorbild heranzieht, so muss man genaugenommen zwischen Nervenwachstum und Verbindungsfreigabe unterscheiden. Im er sten 78 Lebensjahr vermehren die Neuronen massiv die Dendriten, also Verbindungsbahnen (Birbaumer 1997, S.576). Es werden mehr Verbindungen angelegt, als aktiv verwendet werden. (Spektrum-Ticker 1999.11.29). Scheinbar bauen Neuronen immer mehr Verbindungen auf, als nötig, um sie gegebenenfalls aktivieren zu können. Damit kann ein schnellerer Lernprozess stattfinden, als durch Verbindungswachstum. Studien an Seeschnecken zeigen solche Verbindungsprozesse (Byrne H. 2002) Es dürften aber auch im erwachsenen Gehirn noch Nervenwachstumsprozesse stattfinden, wobei sich hier noch deutlicher zeigt, dass Nerven in der Lage sind, den Weg zu finden. Ich erinnere mich an eine TV-Wissenschaftssendung, wo in einer Nährlösung gezeigt wurde, dass zwischen Neuronen, die regelmäßig gleichzeitig stimuliert werden, eine Verbindung wächst. Leider fehlt mir die Quelle, aber ich fand ähnliche Experimente und Studien (Spektrum-Ticker 2001.04.24, WSA 2002.02.28, WSA 2002.12.18). Gehirnzellen finden also sinnvolle Verbindungswege, so wie Wurzeln das Wasser, der Blitz den Boden oder Schleimpilze die Nahrung. Ein Versuch belegt, dass wenn man ein Labyrinth, mit einem Schleimpilz füllt, und an den Eingängen Nahrung auslegt, dieser sich entlang der kürzesten Labyrinthstrecke zurückbildet, hin zur Nahrung (Nakagaki 2002). Ein weiterer Interessanter Versuch zeigt, dass Nanopartikel aus Gold in gelatineartiger Flüssigkeit elektrische Pole spontan durch Gruppierung zu „nassen Drähten“ verbinden. Könnte man diese Verbindungen fixieren, so wäre ein Modell entwickelt, das dem Wachstum von Nervenverbindungen nahe käme (WSA 2001.11.05). Wir können nur annehmen, dass all diesen Wegfindungsprozessen irgendwelche „Kraftlinien“ vorausgehen, die zu einer energetischen Durchkämmung des Raumes führen. 3.2.2 Die Vereinigung der Vorteile des Mehrschichten und des Bayes-Netzes Der Signalfluss, der zur Durchkämmung des Neuronennetzes notwendig ist, der also zu den Kraftlinien führt, muss unterschieden werden, vom eigentlichen Blitz, der die Strecke zwischen den zu verbindenden Neuronen direkt entlangwandert und diese Verbindung abnabelt. Auch in einem Mehrschichtennetz gibt es vorerst so etwas wie Erkundungssignale in der Trainingsphase, und später die Verwendung der verstärkten Verbindungen in der Arbeitsphase. Auch ist im Mehrschichtennetz nicht jedes Neuron direkt mit jedem verbunden, sondern die Verbindung kann bei Bedarf, über Zwischenschichten hergestellt wird (Siehe Grafik zum Kapitel Mehrschichtennetz). Wir wollen diese Idee nun für unser Netz nützen das, im Gegensatz zum Mehrschichtennetz, statistisch lernt und keinen Lehrmeister braucht. Es sollen aber, anders als beim Mehrschichtennetz, Verbindungen in allen Richtungen möglich sein. 3.2.3 Das Kurze-Wege-Fließmodell Die folgende Grafik zeigt, wie sich kämmende Signale von einem Punkt aus innerhalb eines natürlichen Netzwerkes ausbreiten könnten. Für die Ausbreitung 79 von Signalen gilt: Sie können nur eine Zelle treffen, die nicht bereits aktiv ist. Hat eine Zelle ihr Signal weitergegeben, so verschwindet nach kurzer Zeit ihre Aktivität. Der Weg den die Signale gewandert sind bleibt aber offen (Kämmung). Ist ein Ausbreitungsdurchgang vorbei, und sind die Verbindungen gefunden, kann das System zurückgesetzt werden, und der nächste Durchgang kann starten. Dieses Konzept könnte eine mögliche funktionale Erklärung für die Gehirnwellen liefern. Nun benötigen diese Signale im Gehirn auch Zeit sich auszubreiten. In Nerven ohne Myelinschicht legt das Signal nur 0,1 bis 10m/sec. zurück (Hubel 1989). Wenn wir annehmen, dass in einer Schicht Gehirngewebe mehrere Zellen zugleich aktiv sind, die nun zueinander eine Verbindung aufbauen sollen, so ergibt sich ein Kämmmuster, das folgendermaßen aussehen könnte: 80 Die entstehenden Verbindungen im Fall der vorgegebenen Punkte, sind in der Grafik strichliert eingezeichnet. Es lässt sich erkennen, dass das Kämmmuster nicht dazu führte, dass alle Punkte mit allen anderen eine Verbindung eingingen, sondern dass nur Bahnen zu räumlich nächsten Punkten entstanden. Genau solche gedankliche Verknüpfungen wurden mit grafischen Elementen in Wahrnehmungsexperimenten getestet und es zeigte sich eben dieses Phänomen. Entferntes ist nur über den Umweg von Nahem abrufbar; Vorstellungen sind hierarchisch organisiert (Anderson 1996, S.121). Wir nehmen also an, dass die Signale im Gehirngewebe sich ausgehend von aktivierten Bereichen ausbreiten und dabei einen Weg durchfließen, den sie isolieren. Betrachten wir nun nicht das zeitliche Ausbreitungsmuster (die Zeitri nge), sondern den Weg der zurückgelegt wurde (die Strahlen). 81 Während ihrer Fließbewegung legen die Signale eine Weg zurück, den sie isolieren. Bei Kontakt von zwei durchkämmten Bereichen kann der „Blitz“ durch diesen Weg die Punkte verbinden. Die Signale fließen natürlich weiter, um, wenn möglich weitere Verbindungen herzustellen. Nun mag gegen dieses Modell einzuwenden sein, dass es doch rein hypothetischer Natur sei. Aber immerhin lässt sich zeigen, dass kein Modell der Verbindungsfindung vorstellbar ist, ohne Kämmsignale, die den Raum erkunden. Wie sollte ohne solche Vorläufersignale ein Neuron auch wissen, wo sich das andere aktive Neuron befindet? Das Modell mag hypothetischer Natur sein, aber es ist das einzig mögliche! 3.2.4 Wie kann die Verbindungsfindung in einem künstlichen System abla ufen? Nun soll die Sache mit der Verbindungsfindung noch etwas genauer betrachtet werden. Ein Informatiker mag sagen, dass dies doch viel einfacher ginge als mit solchen Fließsignalen, nämlich dann, wenn wir alle Punkte in ein gemeinsames Koordinatensystem eintragen. Eine Hardware zu schaffen, in der Signale W ege durchfließen, dabei Schalter umlegen, und auf diese Weise ihren zurückgele gten Weg notieren, ist sicher enorm aufwendig! Aber diese Hardware soll ja nicht nur zur Lösung des Verbindungsproblems dienen. Sie ist gleichzeitig auch der Speicher des Kunsthirns. Anders als ein Festplattenspeicher hat das Gehirn ständig auf alles Zugriff. Wir brauchen nicht lange in unserem Speicher zu suchen, um ein Ding wiederzuerkennen. Auch befindet sich alles in ständiger Umformung. Wenn unsere Großmutter im Alter vergesslich wird, so tun wir uns schwer ihr gesundes Bild in Erinnerung zu behalten. Es wurde „umgeformt“ (Spektrum-Ticker 2000.08.17 Spektrum-Ticker 2001.07.30). Ein trastisches Beispiel schildert Rosenfield (1996, S. 143) Ein Mann, der in mittlerem Alter erblindete, konnte sich nach Jahren nurmehr 82 jene Personen visuell vorstellen, die er seit der Erblindung nicht mehr gesehen hatte. Sich selbst konnte er sich nicht mehr visuell vorstellen. Um das Gehirn zu simulieren, ist aus meiner Sicht eine eigene Hardware notwendig. Das erste Problem, das uns zur Konzeption einer solchen Hardware führt ist eben das Verbindungsproblem, denn Verbindungsfindung ist die Grundlage allen Lernens! Ein künstliches Netzwerk sollte aus gleich geformten Bauteilen bestehen, die in Serie produziert werden können. Jede Zelle soll mit ihren Nachbarn verbunden sein. Das Netz könnte also so aussehen: Durch die Gleichförmigkeit des Gitters entsteht aber das Problem, dass die Verbindungen zwischen den Zellen nun alle gleich lang sind und in drei Richtungen vorliegen. So ergibt sich ein sechseckiges Ausbreitungsmuster, und der Signa lweg ist auch nicht immer der geradlinigste: Die Fließwege sind dunkel eingezeichnet, die Zeitringe hellblau. Aber es handelt sich aufgrund des Netzwerkes nicht mehr um Ringe sondern um Sechsecke. Damit kann aber als Erstkontakt zwischen zwei aneinanderstoßenden Signalausbreitungen ein breiter Bereich entstehen, und in diesem Fall wäre nicht klar, wo der dire kte Weg liegt. Außerdem habe ich die Verzweigungen der Aststruktur nur auf die Hauptachsen gesetzt, und das führt dazu, dass in vielen Fällen gar nicht der 83 direkteste Weg beschritten wird, sondern ein Umweg, wie dies die gelbe Linie verdeutlicht. 3.2.5 Ein verbessertes Modell Es hat sich gezeigt, dass eine kreisförmige Signalausbreitung in einem halbwegs regelmäßigen Netz ganz einfach dadurch erreicht werden kann, indem eine Zelle ihre Ladung nicht in einem, sondern in mehreren Schritten überträgt. Zwischen den Zellen herrscht sozusagen ein Widerstand, und so kann vorerst nur ein Drittel des Signals zur Nachbarzelle wandern und von dort ein neuntel auf die übernächste Zelle. Erst in einem zweiten Schritt wird die Nebenzelle voll aktiviert und ein Teil des Signals wandert durch den Widerstand weiter voraus. Die Signalausbreitung hat sozusagen eine leicht unscharfe Grenze. Man könnte sagen die Zellen brauchen eine kurze Zeit um in Schwung zu kommen. Das ist für natürliche Vorgänge ein gut vorstellbares Modell. Es lässt sich auch durch einfache Filter in einem Grafikprogramm simulieren. Um die abgebildeten Filter zu verstehen, muss man alle Zahlen durch den unten angeführten Divisor dividieren. So steht in der Mitte 1, daneben ein Drittel und weiter ein Neuntel und in der größeren Version ist auch noch ein Siebenundzwanzigstel durchgerechnet. Das Ergebnis der beiden Filter ist identisch. Der zweite Filter rechnet es nur etwas genauer durch, eben bis zum Siebenundzwanzigstel. Er führt zu einem exakteren, aber rechenintensiveren Ergebnis. Kurzum, man wähle den Filter, der einem besser gefällt. Filtert man einen weißen Bildpunkt auf schwarzem Grund mehrmals mit einem solchen Filter, so beginnt sich ein immer größerer weißer Kreis zu bilden, der die Signalausbreitung veranschaulicht. 84 Bemerkenswert ist dabei, dass auch die Beschädigung, die ich dem Kreis durch Einfügen einer schwarzen Delle verpasst habe, bei weiterer Ausbreitung wieder verschwindet. Das System neigt einfach dazu, wieder die Kreisform anzunehmen. Unscharfer Übergang ist daher auch für ein chaotisches Verschaltungsmuster, wie jenes im Gehirn, geeignet, um eine kreisförmige Durchkämmung zu erreichen, die Verbindungsfindung ermöglicht. Was die Simulation betrifft, so lässt sich, da im Grafikprogramm nicht anders möglich, nur eine quadratrasterförmige Verteilung der Bildpunkte, die für Neuronen stehen, simulieren. Es liegt auf der Hand, dass diese Lösung auch zu einer kreisförmigen Signalausbreitung in anderen neuronalen Netzen taugt, solange sie einigermaßen halbwegs regelmäßig sind. So auch im Wabenmuster. Woher kommt nun diese Kreisform? Würde ich als Filter ein Quadrat von neun Einsern eingeben, so erhielte ich eine quadratische Signalausbreitung, das heißt ein Quadrat mit scharfer Kontur das mit jedem drüberlaufen des Filters im Radius um einen Pixel wächst. Der Kreis entsteht einfach durch die vorauseilenden Graupixel (Unschärfe) im Bild, die Ihr Signal auch an die seitlichen Nachbarn verteilen. Wir können uns vorstellen, dass ein Neuron im Netz durch die unscharfe Ausbreitung unterschiedlich starke Signale von meist zwei Seiten bekommt. Zu jener Seite, die es stärker beliefert, führt letztlich der Ast des Signalflussbaumes (Kämmmusters). So ist das Verzweigungsproblem gleich mitgelöst. Es könnte zum Beispiel ein Verzweigungsmuster wie das folgende entstehen: 85 Die gelbe Linie zeigt, dass ein solches Verzweigungsmuster zu relativ geradlinigen Verbindungen führen wird. 3.2.6 Die Kontaktfindung Ich habe erklärt, wie sich Signale kreisförmig ausbreiten. Was aber passiert ab dem Punkt, wo die Signale aufeinandertreffen? Rufen wir uns noch einmal das schematische Bild des Signalflusses in Erinnerung: Die schwarzen Linien zeigen die bereits durchkämmten Bereiche. In diesen Bereichen ist jetzt nurmehr eine Signalweitergabe in der vorgegebenen Richtung möglich. Das Signal von A nach B (und umgekehrt) fließt also entlang der roten Linie weiter. Was aber ist mit den nahezu gleichzeitig eintreffenden Signalen, die in die grün eingezeichneten Verbindungen hineinfließen? Das Modell ist noch nicht ideal, denn es entstehen mehrere Verbindungen. 86 Es gibt noch ein weiteres Problem: Stellen wir uns nun mehrere Punkte vor, die winkelförmig angeordnet sind. Die folgende Grafik zeigt die Zeitlinien des Signalflusses. Die entstehenden Verbindungen sind rot eingezeichnet. Es zeigt sich, dass das Modell in seiner jetzigen Form in diesem Fall nicht zu direkten, geradlinigen Verbindungen führt. Es ist daher nicht brauchbar, denn die Signalfließzeit soll in unserem Modell die Entfernung von Punkten codieren, und die ist zu lange, wenn nicht der direkte Weg gewählt wird. Ein drittes Problem ergibt sich aus der Frage, wie denn die Signale überhaupt zu den Ausgangszellen zurückkehren sollen. Die strahlenförmige Signalausbreitung ergibt sich nämlich aus der Regel, dass eine Zelle ihr Signal immer nur an eine noch nicht aktivierte Zelle weitergeben kann. Deshalb fließt das Signal vorwärts, nicht zurück. Wenn Signalströme unterschiedlicher Herkunft aufeinandertreffen, so schneiden sie einander den Weg ab. Eigentlich sollte dann gar keine Signalweitergabe mehr möglich sein, denn alle benachbarten Zellen wurden gerade eben aktiviert, und sind im Moment aktivierungsunfähig. Diese drei Probleme scheinen sich auf verschiedene Weise lösen zu lassen. Ich möchte zuerst ein sehr einfaches Modell vorstellen, das aber bei genauerer Betrachtung zu Fehlern führt. Ich habe sehr viele ähnliche Modelle erstellt, weil ich mir eine einfachere Lösung gewünscht hätte, als notwendig ist. Letztlich glaube ich, dass es nur eine einzige Lösung gibt. Diese will ich als nächstes vorstellen. 3.2.7 Die Zweischritt-Scheinlösung Die Idee baut darauf, dass die Verbindungsfindung in zwei Schritten erfolgt. Zunächst fließen die Signale zueinander. In der Mitte zwischen den kontaktsuchenden Zellen kommt dieser Schritt zum Stillstand. Dort treffen die Signale unterschiedlicher Herkunft aufeinander, und es entsteht eine „Kontaktlinie“ aktivierter Zellen, die ihre Signale nicht weitergegeben können. Ich habe diese in der folgenden Grafik strichliert eingezeichnet. Diese Kontaktlinie bildet eigentlich eine Ausnahmesituation, denn nur auf der Kontaktlinie erhalten Zellen gleichzeitig zwei Inputs. Nun nehme ich an, dass das Kunsthirn einen Rhythmus hat, in dem es die Aktivierungsfähigkeit der Zellen wieder herstellt, also so etwas wie Gehir nwellen. 87 Sobald die Aktivierungsfähigkeit wieder hergestellt ist, können die Signale, ausgehend von der Kontaktlinie, zurück zu den Ausgangszellen fließen. Die folgenden Grafiken zeigen die entstehenden Rückflüsse an einem Beispiel mit zwei Ausgangspunkten und einem Beispiel mit winkelförmig angeordneten Ausgangspunkten. Erster Schritt…. Zweiter Schritt Erster Schritt… Zweiter Schritt Es ist zu erkennen, dass der zweite Schritt auch im Beispiel mit dem Winkel zu geraden Verbindungen zwischen den gegenüberliegenden Zellen führt. Das Problem scheint gelöst. Allerdings ergibt sich in den meisten Situationen ein Fehler, der diese Lösung unbrauchbar macht. Die folgende Grafik zeigt vier Punkte, die eine Verbindung aufbauen sollen. 88 Der Signalfluss des ersten Arbeitsschrittes ist als Grauverlauf dargestellt. Um die Ausgangszellen herum entstehen Felder. In einem der Felder habe ich linear die Zeitlinien des zweiten Arbeitsschrittes eingezeichnet. Man sieht, dass sich die Linien von dem Rand des Feldes zur Mitte X hin ausbreiten. Aber die Ausgangszelle liegt nicht in der Mitte des Feldes. Deshalb können die meisten Verbindungen nicht hergestellt werden. Nur die eine dick eingezeichnete Verbindung entsteht. Wir brauchen also ein anderes Modell! 3.2.8 Kontaktfindung durch Kämmlinienvermischung Wenn das Zwei-Schritte-Modell sich als nicht brauchbar erweist, wie könnten die Signale, welche der Kontaktfindung zwischen Zellen dienen, auf andere Art zur jeweils gegenüberliegenden Zelle gelangen, ohne von deren Signalstrom blockiert zu werden? Ich will dazu annehmen, dass sich die Signale auf halbem Weg in einer Zelle treffen, dann für einen kurzen Moment nicht weitergegeben werden können, bis die umliegenden Zellen wieder reaktionsbereit sind. Für diesen Moment bleibt das Signal in der Zelle aufrecht. Danach kann es weiterwandern. Da es nun in bereits durchkämmte Bereiche wandert, müsste es auch die Fließrichtung daran anpassen. Was aber, wenn die durchkämmten Bereiche nicht nur in der Kämmrichtung, sondern bis zu einem gewissen Grad auch in anderen Richtungen durchflossen werden können? Dazu müssen wir uns vorstellen, dass die Kämmsignale nicht nur den Signalweg offen lassen, der gegenläufig zu ihrer Fließrichtung steht, sondern auch ähnliche Richtungen nicht völlig geschlossen werden. Die Fließsignale hätten dann in einem begrenzeten Feld die Möglic hkeit sich so weiter auszubreiten, wie sie es tun würden, wenn sie einander nicht kreuzten. Sie überschreiben einfach die Kämmlinien des gekreuzten Signals. Dieses Modell führt auch zu einer anderen Lösung im Beispiel der winkelförmig angeordneten Punkte. Diesmal verläuft die Verbindung anders, aber es entsteht wieder ein Umweg. Der verläuft jetzt in die Gegenrichtung. 89 Die Frage ist nun, wie schaffen wir es, die beiden Modelle so zu kombinieren, dass sie in diesem Beispiel zu brauchbareren Verbindungen führen, die nicht ein Eck in ihrer Verbindungslinie haben. Die Lösung wäre dann gefunden, wenn an der Stelle, wo die Kämmsignale einander überlagern, ein Mittelweg zwischen den beiden Richtungen gefunden wird. Die Signale könnten übereinander fließen, wie im vorhergehenden Beispiel, aber die Kämmspur, die sie insgesamt hinterlassen, sollte den Mittelweg darstellen. Dazu will ich annehmen, ein Signal, das eine Zelle durchläuft, hinterlässt in ihr keine klare Spur, sondern eine unscharfe. In der Durchlaufrichtung ist sie ohne Widerstand durchfahrbar, in ähnlichen Richtungen mit geringem Widerstand, und in der Richtung quer zur Durchlaufrichtung ist sie nicht mehr befahrbar. Überlagern sich nun zwei Richtungen, so wird ein Mittelwert der beiden Durchläufe gebildet. Wie sieht das nun eigentlich aus, wenn wir nicht von winkelförmig angeordneten aktiven Zellen ausgehen, sondern wieder zurückkehren zum Problem der Kontaktfindung von nur zwei aktiven Zellen? Die folgende Grafik zeigt das Ergebnis. Die bunten Linien zeigen die Kämmlinien, die durch die Fließsignalvermischung zustande kommen. Positiv an dem Modell ist auch, dass nur eine einzige Verbindung zwischen den Zellen entsteht. Die anderen Fließwege verfehlen das Ziel. 90 Dort wo die Signale der Punkte zueinander laufen, ist bei der Überlappung ihrer Fließrichtung eine mittlere Richtung zu erwarten. Wenn sie im rechten Winkel aufeinandertreffen, wird sich ihre Fließrichtung somit aufheben. Das passiert an der kreisförmigen Grenzlinie zwischen Rot und Grün. Deshalb sind dort die Richtungen nur in Pastellfarbe angedeutet. Eigentlich gibt es dort keine klare Richtung, weil sich die Richtungen aufheben. Außerhalb dieser Zone gibt es wieder Signale, die im spitzen Winkel aufeinandertreffen. Die dabei entstehende Richtung ist aber nun um 90° gedreht. Wie ist ein solcher Überlagerungseffekt von Fließrichtungen vorstellbar? Sind dazu nicht aufwendige Rechenvorgänge in den Neuronen notwendig? Ich denke nicht. Mit geeigneten analogen elektronischen Bauteilen könnte die Durchschnitt srichtung dabei ganz ohne Rechenvorgänge auf ähnliche Weise zustandekommen, wie in der folgenden Grafik die horizontale Schattierungsrichtung des dritten Bildchens durch Überblendung der beiden ersten Schattierungsrichtungen zustande kam. + = Aber zurück zur vorhergehenden Grafik mit den Fließrichtungen. So wie der Signalfluss dort dargestellt ist, ergibt sich ein Problem. Die Fließsignale wandern ungehindert über die gesamte Fläche hinweg weiter. Stellen wir uns nun viele gleichzeitig aktive Punkte im Netz vor, und alle Signale fließen übereinander, und bilden gemittelte Kämmrichtungen. Dabei kann nichts Sinnvolles herauskommen. Es wird also wichtig sein, dass die Kämmsignale auch irgendwo ein Ende finden. 91 Dafür gibt es, wenn wir uns die vorherige Grafik ansehen, eigentlich eine naheliegende und einfache Möglichkeit. Stellen wir uns vor, dort wo sich die Kämmlinien in ihrer Richtung aufheben, findet das Fließsignal keine Richtung mehr, in die es weiterfließen kann. Es wird aufgehoben. Die folgende Grafik zeigt den Effekt dieser Regel: In dieser Grafik treten drei Phänomene Verbindungsfindung unbedingt notwendig sind: auf, die für eine sinnvolle 1) Trifft ein Fließstrom auf einen Bereich der in die entgegengesetzte, oder eine nahezu entgegengesetzte Richtung durchflossen wurde, so kann er ihn durchfließen. Die Kämmrichtungen vermischen einander. 2) Trifft ein Fließstrom auf einen Bereich der bereits quer zu seiner Fließrichtung durchkämmt wurde, so kann er nicht weiterfließen, weil der Weg ve rsperrt ist. 3) Geraten Fließsignale aneinander, die fast in der gleichen Richtung unterwegs sin d (grüne Linien), so können sie einander nicht überschreiben. Das liegt daran, dass überschreiben ja nur durch einen Trick möglich ist. Wir haben die R egel aufgestellt, dass ein Signal, das nicht weitergegeben werden kann, kurz aufrecht erhalten wird, bis benachbarte Verbindungen wieder frei werden. Stoßen Signale frontal aufeinander, halten sie also kurz inne, und fließen dann von dieser Stelle aus weiter. Es sieht aus, als flößen sie übereinander hinweg. Wenn zwei fast gleiche Fließrichtungen zusammenlaufen, ist das jedoch anders, denn alle Signale können weitergegeben werden. Also fließen die Signale ab, ohne einander zu überlagern. Punkt 3 führt zu einem interessanten Effekt. Geraten Fließsignale aneinander, die nahezu in die selbe Richtung unterwegs sind, vereinigen sie einander. Dieser Effekt erweist sich nicht als störend, sondern sogar als Notwendigkeit! Das wird deutlich, wenn wir uns vorstellen, dass 12 Punkte, die auf einer Kreislinie regelmäßig angeordnet sind, sich in dessen Zentrum vereinen sollen. Eine Zelle in unserem neuronalen Netz verfügt in der Fläche aber nur über 6 Verbindungen. Also müssen sich die Kämmlinien, im gegebenen Beispiel, schon vorher vereinigen, und das können sie durch diesen Nebeneffekt unserer Signalflussregeln. 92 Stoßen mehr als zwei Fließströme zusammen, so gilt für die Signale das gleiche wie im Fall von nur zwei Fließströmen: Kann ein Signal nicht weiterfließen, so bleibt es aktiv, bis die umliegenden Zellen wieder aufnahmefähig sind. Im Fall der folgenden Grafik passiert dies im Zentrum. Die Signale wandern nun zurück, und mischen dabei ihre Richtung mit den bereits vorhandenen Kämmlinien. Da die vorhandenen Kämmlinien bereits aus einer Kämmlinienmischung hervorgehen, die vorher stattfand, beschreiben sie Kurven. Es entsteht eine Dreierverbindung zum Zentrum der Grafik. Damit sind die Gesetze zur Verbindungsfindung besprochen. Es stellt sich noch die Frage, ob bestimmte Verbindungen Vorrang vor anderen haben, oder ob alle entstehenden Verbindungen aufrecht bleiben sollen. Das Gesetz der Nähe sollte in das Modell inkludiert werden. Es besagt, dass wenn Punkte, nahe beieinander liegen, diese eher als zusammengehörig betrachtet werden, als wenn sie weiter entfernt sind. Kurze Verbindungen sind also zu bevorzugen. Da kurze Verbindungen schneller zustande kommen, kann diese Bevorzugung auch durch die zeitliche Nähe geschehen. Die Vorrangstellung kurzer Verbindungen könnte letztlich d adurch ausgedrückt werden, dass sie einen geringeren Widerstand im Netz besitzen. Die Regeln der Verbindungsfindung, die die obigen vier Anforderungen erfüllen, waren nicht leicht zu finden. Ich habe lange an ihnen geforscht, und vermute, dass die hier dargestellte Lösung den einzigen möglichen Weg darstellt. Deshalb vermute ich, dass im Gehirn etwas analoges stattfindet. Die Richtung der Kämmlinien in diesem Modell erinnert an die Kraftlinien der Gravitation, die sich ergeben würden, wenn unsere Punkte Planeten wären. Gravitation verkörpert ja auch das Gesetz der räumlichen Nähe, denn ihre Stä rke erhöht sich mit der Nähe zu den Planeten. Diese Parallele ist nicht verwunderlich. 93 Gravitation ist die wichtigste strukturierende Kraft der Natur, und unser Gehirn dient u. a. dazu die Natur zu repräsentieren. Deshalb bedarf es einer ähnlichen strukturierenden Kraft. Ob die zuletzt genannten Regeln zur Erstellung der Kämmlinien Sinn machen, kann daran überprüft werden, wie der Mensch flächig angeordnete Reize in Bezug zueinander stellt, und ob das Modell ähnliche Bezüge (Verbindungen) herstellt. Den Ort eines Punktes im Raum definieren wir ja durch seinen Abstand zu anderen Punkten des Raumes. Genauso ist es mit einem Punkt auf einer Grafik. Interessant ist, welche Bezüge wir beim Betrachten einer Grafik als die Wesentlichen erachten. Aus meiner Sicht sind es die Selben Verbindungen, denen auch das Modell den Vorrang einräumt. 3.3 Regel zur hierarchischen Organisation der Informationen: 3.3.1 Die eine Verknüpfung repräsentierende Zelle Mit der Verbindung von Zellen und ist zwar der der schwierigste Teil des Mod ells geschafft, was das visuell-analytische Denken betrifft; der Prozess der Verarbeitung ist aber noch nicht abgeschlossen. Nehmen wir an, dass die beiden nun verbundenen Zellen Reize repräsentieren. Bleiben wir bei Pawlows Hund, dann sind es „Glocke“ und „Futter“. Zusammen ergibt das ein neues Chunk namens „Fütterung“. Welche Zelle repräsentiert jetzt dieses Chunk? Muss es nicht eine Zelle geben, die diese Verknüpfung repräsentiert? Hier stehen wir vor der Frage, ob es im Gehirn überhaupt Zellen für best immte Begriffe geben kann. Eine solche Vorstellung galt aus dem Verständnis neuronaler Netze heraus als verpönt und wurde als die Theorie der „Großmutterzelle“ verspottet. In neuronalen Netzen sind Informationen normalerweise verteilt repräsentiert. Das hier vorgestellte Netz wird aber beide Repräsentationsarten zulassen. Einerseits gibt es die verteilte Information, und zwar nicht nur im Raum, sondern, da das hier konzipierte Netz auch mit zeitlichen Signalmustern arbeitet, gibt es sogar eine zeitliche Verteilung einer Repräsentation. Trotzdem können die Muster letztendlich in einer Zelle münden, die einen Begriff repräsentiert. Genau so scheint dies neueren Studien zufolge auch im Gehirn zu sein. So fand Christof Koch sogenannte „face cells“ (Bremen 1998, Cross 2000, Recht 2000) und es gibt im Gehirn Neuronen für Eigenschaften wie z.B. einen bestimmten Augenabstand (Spektrum-Ticker 2002.01.22), sowie Neuronen für andere Objektkategorien, wie Körperformen und Formzusammenstellungen (Goldstein S.104, WSA 2001.10.04, Doerfler Alex 2001) Es gibt auch Untersuchungen mittels Magnetresonanztomografie, die aber aufgrund der geringen Auflösung, von etwa einem Quadratmillimeter, die Frage nicht beantworten können, was das einzelne Neuron zu repräsentieren vermag. Nachgewiesen wurde auf diese Weise aber die 94 Repräsentation von Objektkathegorien an bestimmten Orten im Gehirn (Spitzer 2000, S.259). Aussagekräftig sind vor allem die Untersuchungen mittels Elektroden am offenen Gehirn, wobei diese beim Menschen nur Nebenerscheinungen einer notwendigen Gehirnoperation sein können. Man zeigt dem Patienten Gegenstände und misst mit Elektroden, ob man ein Neuron findet, das auf einen der Gegenstände reagiert. Warum diese Untersuchungen schwierig sind, will ich am Beispiel von Großmutters Kachelofen erklären. Dieser ist, wie die meisten vertrauten Gegenstände, vor allem örtlich definiert. Man kann ihn bei der Operation nicht herzeigen. Deshalb wird man im Operationssaal nur Neuronen für Überbegriffe finden. Meiner Ansicht nach, gibt es nur wenige Dinge, die uns wirklich als Einzelgegenstand vertraut sind. Auf dem Mietparkplatz vor meiner Wohnung stehen immer die selben Autos. Aber nur der rote Ferrari ist individuell. Alle anderen bilden für meine Wahrnehmung einfach eine Autostruktur, wie es sie auf vielen Plätzen der Stadt gibt. Würde man die Autos der Plätze austauschen, würde ich es nicht merken. An all diesen Autos erkenne ich nur den Überbegriff „Auto“. Daraus folgt: Man müsste die Operation in der vertrauten Umgebung durchführen, wo der Patient vertraue Einzeldinge wahrnehmen kann. Aber selbst dann, hätte man wohl wenig Chance unter Millionen in Frage kommender Zellen, die Elektrode genau in jene zu stechen, zu der man den Gegenstand zeigt, den der Patient gerade bewusst wahrnimmt. Und erst die Wiederholbarkeit würde dies zeigen, denn Zellen weisen auch ein starkes Zufallsrauschen auf. Umgekehrt wäre es auch möglich Zellen zu reizen, und den Patienten zu fragen, was er erlebt. Aber das kann nicht funktionieren, denn es müsste vermutlich ein ganzes Netz an Verzweigungen aktiviert werden, um eine bewusste Wahrnehmung zu erzeugen. Diese aktivierten Zweige müssten stärker sein, als jene aktiven Bereiche, die der Patient gerade durch seine Gedanken und seine Aufmerksamkeit im Gehirn aktiviert hat, und die Aufmerksamkeit kann sich in der ungewohnten Situation auf alles Mögliche beziehen. Vielleicht ist er mit Gedanken in der Z ukunft, hat Sorgen oder Erwartungen. Das Bewusstsein kann sich ja nur einer Sache zu einem Zeitpunkt widmen, und so siegt der stärkere Gedankeninhalt, und der wird nicht von einer einzigen gereizten Zelle ausgehen. Das bedeutet, die Frage nach der Möglichkeit einer Großmutterzelle ist noch nicht klar beantwortbar, und die Ablehnung einer solchen Vorstellung, ist nur aus der verteilten Repräsentation in den derzeit gängigen neuronalen Netzen zu erklären. Aber möglicherweise liegt ja gerade darin die Schwäche dieser Netze, und der Grund dafür, dass sie nicht begrifflich denken und planen können. Deshalb sollten wir uns nicht so sehr an die Informatik und Neurologie klammern, sondern uns an der psychologischen Lernforschung orientieren. Diese zeigt sehr klar, dass erlernte Verbindungen zu Einheiten führen, auf die wir in Zukunft im Stück zugreifen können (Kognition 2000, S.30). Im Allgemeinen können wir also davon ausgehen, dass Begriffe im Gehirn örtlich repräsentiert sind. Es kann uns im Grunde egal sein, ob dies durch ein einzelnes Neuron geschieht, oder durch eine Neuronengruppe. Die Idee, dass Begriffe durch 95 eine Neuronengruppe statt durch ein einzelnes Neuron präsentiert werden, würde in meinem Modell keiner wesentlichen Änderung bedürfen. Ich bräuchte nur annehmen, dass Zellen auch zu entfernteren Nachbarn Verbindungen haben (was ja so ist). Dann treffen die oben beschriebenen Kämmsignale nicht in einer Zelle aufeinander, sondern in einer Zellgruppe. Und es gehen nicht von einer Zelle Kämmsignale aus, sondern von einer Gruppe nebeneinanderliegender Zellen. Das System verbraucht auf diese Weise mehr Zellen und Verbindungen, aber es wird auch weniger anfällig auf Störungen. Das macht Sinn im Fall von unzuverläss igen Bauteilen, wie Neuronen. Es hat aber wenig Sinn für elektronische Bauteile. Die folgende Grafik zeigt, dass die Verbindung zweier Neuronengruppen nicht zu mehr Kontaktpunkten führt als die Verbindung zweier Einzelneuronen, denn die Fließsignale der gruppierten Neuronen verschmelzen. So entgeht das System auch bei hierarchischer Entwicklung immer weiterer Verbindungen einem Verbindungskollaps: Bleiben wir also dabei, dass ein Begriff im Gehirn örtlich repräsentiert ist, egal ob nun durch eine Zellgruppe, oder durch ein einzelnes Neuron. Im Gehirn können etwa sieben solche „Chunks“ gleichzeitig aktiviert werden. Das ist der maximale Lerninhalt, der kurzzeitig behalten werden kann. Ein Beispiel wäre eine Reihe von sieben Buchstaben oder Zahlen. Die Frage ist, wie können wir uns mehr me rken? Folgende Buchstabenfolge ist in 10 Sekunden zu merken: A B A S FU KWA BSR TLO MV Folgende Winkelfolge ist zu merken: Tja, das übersteigt wohl unsere sieben Lerninhalte. Ist es damit unmöglich? Keineswegs. Wenn wir die Information so umstrukturieren, dass wir bereits bekannte Verknüpfungen unseres Gehirns verwenden können, dann genügen die sieben Chunks durchaus. Wie wäre es zum Beispiel damit: A, BASF, UKW, ABS, RTL, OMV Und mit folgender Merkhilfe: „Bilde Zwei-Balken-Gruppen aus NAMA NAMA“ 96 Vergegenwärtigen wir uns noch einmal Pawlows Hund. Weder die Einheit, we lche für Glocke, noch jene welche für Futter steht kann die gesamte Fütterung repräsentieren. Wir benötigen eine neue, noch unbesetzte Zelle. Das bedeutet, dass neues Lernen auch neue Gehirnzellen benötigt. Tatsächlich weisen neue Studien nach, dass im Gehirn ständig neue Zellen nachwachsen (Kuhn 2001, Spektrum-Ticker 1999.10.21, Spektrum-Ticker 1999.11.08, WSA 2002.02.28). Gehirnzellen scheinen sich sogar transplantieren zu lassen (WSA 2001.03). Wichtiger für das Modell scheint aber eine Studie, wonach ohne neu entstehende Zellen, keine Erinnerungen mehr gespeichert werden (Spektrum-Ticker 2001.03.20). Allerdings dürften viele Zellen, vor allem im jungen Gehirn noch unbelegt sein, und, wenn am richtigen Ort gelegen, zur Speicherung neuer Inhalte herangezogen werden (Spektrum-Ticker 1999.11.29). Jedenfalls muss die neu belegte Zelle sich mit anderen ebenso neuen Zellen nach den bayesianischen Regeln ungehindert verknüpfen können, denn wir sind ja fähig einmal erlernte Chunks miteinander zu verknüpfen. Deshalb soll sie ihr Output Signal auf eine neue Ebene senden. Als Platz wollen wir den Kontaktpunkt zwischen den beiden Ausgangszellen annehmen, also die Mitte zwischen ihnen. Diese Annahme gründet sich auf Beobachtungen der räumlichen Organisation im menschlichen Gehirn. Jede Funktion hat ihren Platz in der Mitte zwischen den sensorischen und/oder motorischen Feldern, die sie beliefern. So sind die Sprachzentren rund um das Hörzentrum angeordnet, aber das Sprachverstehen mehr hin zum visuellen System mit dem wir die Welt wahrnehmen, das Sprechen mehr hin zum motorischen Feld. Daneben die Kontrolle des Mundes und weiter weg die Kontrolle anderer Körperbereiche. Der Gehirnbereich zwischen Sprachverstehen und Sehen beinhaltet eine non-sprachliche Repräsentation wahrnehmbarer Dinge. Sozusagen die Vorstufe hin zum Sprechen. Zwischen dem sensorischen (tastenden) Projektionsfeld und dem Sehzentrum liegen die Bereiche für Raumorientierung. Das Stirnhirn verbindet den sprachlich bewussten Bereich mit dem motorischen, und erhält Input aus dem limbischen System, wo Bedürfnisse und Triebe ihren Ursprung haben. Im Stirnhirn werden Zukunftsvorstellungen und gegenwärtige Bedürfnisse abgewogen und Pläne verfolgt, sowie die Pläne and erer Menschen erkannt (Spektrum-Ticker 2002.03.25, WSA 2001.02.01). Auch bei Stirnhirnverletzten Tieren ist eine deutliche Veränderung des Verhaltens bemerkbar, und im Umgang mit ihnen fällt erst auf, dass auch Tiere normalerweise Ziele ansteuern, wenn auch kurzfristigere als der Mensch. Eben das können Tiere mit Stirnhirnschäden nicht mehr. Ihr Verhalten ist chaotisch und beliebig (Hernegger 1995, S.169). Da moralisches Verhalten meist das Ziel hat negative zukünftige 97 Empfindungen, wie z.B. soziale Ausgrenzung zu verhindern, sitzt auch die Moral im Stirnhirn (Spektrum-Ticker 1999.10.21). Die folgende grobe Skizze veranschaulicht die funktionellen Aufgabenbereiche im Gehirn. Ich habe sie in der handschriftlichen Form belassen, um ihre Skizzenhaftigkeit zu betonen. Gut erläutert wird die funktionale Gehirnanatomie in Kolb/Whishaw 1996. Das meiste Wissen über die Funktionsbereiche der Gehirnareale erhält man durch Studien an Menschen, bei denen durch Unfälle, Tumore oder Hirnblutungen u.ä. ein bestimmter Bereich des Gehirns zerstört wurde. Oliver Sacks schildert in spannender Erzählform Patienten, die an solchen Veränderungen leiden. Sein Buch gibt ein Bild davon, wie sehr das Gehirn unsere Person bestimmt (Sacks 1990). Was aus der örtlichen Verteilung der Funktionsbereiche hervorgeht ist, dass der notwendige Input für eine bestimmte Leistung immer aus benachbarten Arealen 98 kommt liegt. Die Verarbeitung zweier Eingänge scheint immer in der Mitte zwischen den Quellen (Projektionszentren) stattzufinden. Deshalb wollen wir davon ausgehen, dass die Zelle, welche eine Verbindung (Chunk) repräsentiert, ebenfalls in der Mitte ihrer Zulieferer liegt. Es wird der möglichst direkte Weg zwischen den beiden Zellen gefunden, und in der Mitte dieses Weges, also am Kontaktpunkt der Fließsignale bildet sich die neue Chunk-Zelle (Verarbeitungseinheit) aus. So folgt aus dem Modell der Verbindungsfindung ein Modell der örtlichen Selbstorganisat ion im Gehirn. Dieses Modell erklärt auch, warum bei einem Hydrocephaluskind, wo die Signale tote (zerquetschte) Gehirnbereiche umwandern müssen, die Verarbeitungszentren letztlich anderswo im Gehirn zu liegen kommen, und warum neugeborene Hamster mit transplantiertem Sehnerv ihr Sehzentrum dort entwickeln, wo dieser Nerv hinoperiert wurde (Frost 2000). Die Verarbeitungsbereiche scheinen nicht genetisch fixiert zu sein, sondern alles findet seinen Platz nach dem Prinzip der Verbindungsmitte. Das Prinzip der Mitte findet sich auch in der Natur der Zelle selbst. Man hat festgestellt, dass auch innerhalb von Zellen Fließprozesse stattfinden müssen, damit die, für die Zellteilung nötige Mitte gefunden werden kann (WSA 2002.01.02). Aus meiner Sicht wird die Plastizität des Gehirns heute immer noch unterschätzt, weil sich die Forscher nicht zu dem Glauben durchringen können, dass eine Struktur so verschiedenartigen Leistungen zugrunde liegen kann. Dabei sollte dies schon seit den frühen 80er Jahren bekannt sein. In einer Fernsehdokumentation aus dieser Zeit (Heminway) wird eine Hydrocephalus (Wasserkopf) Patientin vorgestellt, deren Gehirn im Embionalstadium deformiert wurde, wie es die folgende PET-Scanner-Aufnahme zeigt. Normales Gehirn Sharons Gehirn Die Verbindungen zu den Sinnen blieben erhalten, und die junge Frau führt ein normales Leben, und bringt in der Schule sogar überdurchschnittliche Leistungen. Durch Einatmen von Xenon 133 konnten schon damals die aktiven Bereiche des Gehirns bildgebend dargestellt werden. Hier zeigt sich, dass die Frau nur Teile nützt. Ihr Gehirn hat sich also durch die räumliche Deformation völlig anders organisiert. 99 Normales Gehirn Sharons Gehirn Wir wollen davon ausgehen, dass das Prinzip der Verbindungsmitte dafür sorgt, dass jeder Gedächtnisinhalt seinen Platz im neuronalen Netz findet. Ist das Netz durch einen Hohlraum oder durch defektes Gewebe deformiert, so führt der kürzest mögliche Weg zwischen zwei Punkten um diesen Bereich herum. Das Netz organisiert sich anders. Dies scheint aber nur bei einem Embryo in dem gezeigten Ausmaß möglich. 3.3.2 Generalisierung und Differenzierung Aber nicht immer macht es Sinn, für eine Verbindung zweier Reize gleich eine Chunkzelle zu günden, die die Kombination dieser Reize darstellt. Nehmen wir uns als Beispiel das Erlernen des ABC. Die folgende Grafik veranschaulicht links, wie viele Verbindung en auftreten würden, wenn wir für jede Zweierverbindung eine eigene Chunkzelle gründeten. Zusätzlich müssen wir noch bedenken, dass die Zellen im Gehirn nicht, wie hier dargestellt, so ordentlich nebeneinanderliegen, sondern jede Verbindung über viele Zwischenzellen führt. Multiplizieren wir die Zahl an dargestellten Verbindungen also noch einmal mit etwa hundert Zwischenzellen. An eine Umsetzung des Modells wäre so nicht mehr zu denken. Durch Kettenbildung können die 625 Verbindungen auf eine überschaubar e Zahl von etwa 30 vermindert werden. Durch Experimente mit dem Sprachrhythmus und der Abrufbarkeit habe ich versucht herauszufinden, wie das ABC in meinem G ehirn organisiert ist, und bin auf die rechts dargestellte Reihung gekommen. Ich kann einen Anfangs, einen Mittelteil, und einen Endteil aufrufen. X,Y,Z sind dann noch wie ein Anhang dran. Wahrscheinlich habe ich das ABC in der Volksschule bereits in dieser Teilung erlernt. Auch Experimente mit meinem 7 jährigen Neffen legen nahe, dass die Buchstabenfolge des Alphabets im Gehirn eher so organisiert ist, wie rechts dargestellt. Frage ich ihn welcher Buchstabe nach J kommt, so hat er keinen direkten Zugriff, sondern muss bei A beginnen, und plappern bis er beim K landet. Verbindungsketten können jederzeit abgerufen werden. Wir starten bei einem Begriff, und lassen die Versuchsperson dazu frei assoziieren (Anderson1996, S.180). 100 Verbindungsketten sind also die normale und vorrangige Verbindungsform. Aber wann zerfallen sie in Teile und bilden eine Verbindungspyramide aus? Wann wird für eine Verbindungskette im Gehirn eine eigene Chunkzelle gegründet? Diese Frage ist identisch mit jener danach, wo eine Verbindungskette beginnt, und e ndet. Es gibt darauf nur eine sinnvolle Antwort: „Verbindungsketten beginnen und enden dort, wo ein Voraussagefehler auftritt.“ Der Hund lernt Rotlicht, Glocke, Futter. Vor dieser Kette war auch immer ein Ereignis (weil das Leben eine Aneinanderkettung von Ereignissen ist), aber eben immer ein anderes. Es gehört also nicht zur Voraussagekette. Der Voraussagefehler ist also auch der Auslöser für die Abgrenzung der Kette und der Zuordnung einer Verbindungszelle (Chunk). Das bedeutet umgekehrt, dass innerhalb jenes Bereiches, wo kein Voraussagefehler eintritt, auch keine weiteren Verbindungen entstehen. Es kommt also zu Verbindungsketten, wie in der Grafik rechts dargestellt, und nicht zur Unzahl an Verbindungen, wie links dargestellt. Die Verbindungskette erbringt alle nötigen Voraussagen, und so bleiben weitere Lernvorgänge aus. Diese Annahme ist auch 101 überprüft worden, und unter dem Begriff „Blockierung“ bekannt. Es konnte in Konditionierungsexperimenten gezeigt werden, dass wenn erlernt wurde ein Ereignis durch einen Vorankündigungsreiz vorauszuahnen, kein weiterer Vorankündigungsreiz erlernbar ist, solange der erste nicht ausbleibt oder versagt. Die richtige Voraussage verhindert also weitere Verbindungen (Zimbardo 1995, S.308 Mischo 2002, Macho 1999). Wie lässt sich Reizverkettung mit den bayesianischen Regeln in Verbindung bringen? Dort ist doch immer nur von zwei Reizen die Rede! Wir haben festg estellt, dass die Verbindung AB zerfällt, wenn B öfter alleine vorkommt als mit in der Kombination. Die Ankündigung durch A funktioniert dann nicht. Nehmen wir nun als Beispiel die Kette A-B-C-D-E-F-G, so kommt doch B in der Sprache viel öfter vor, als nur in dieser Verbindung, wo es durch A angekündigt wird. Muss die Kette also zerfallen? Die Antwort ist Ja! denn in einem leeren Netz, das die Teile noch nicht erlernt hat, müssen erst einmal diese erworben werden. So lernt ein Baby erst einmal die einzelnen Laute kennen, bevor es sie zu Silben vereint, und dann vereint es diese zu Wörtern und weiter zu Sätzen. Das ABC als Reihe wird erst erworben, wenn es in einem Lebenszusammenhang steht, zum Beispiel als Aufgabe in der Volksschule. In diesem Lebenszusammenhang eingebettet, ist es dann als Ganzes enthalten. In diesem Lebenszusammenhang kommt es immer in dieser Reihenfolge vor, ist daher voraussagbar, wird keine Voraussagefehler aufwerf en und somit auch nicht mehr zerfallen. Es bleibt als Kette bestehen, mit einer eigenen Chunkzelle, die wir als „ABC“ bezeichnen können. Nur haben wir mit diesem Beispiel zu hoch gegriffen. Wir können die Verschaltungskomplexität, die das Gehirn bis zur Volksschule erreicht hat, nicht mehr überblicken. Es werden uns bei der Behandlung des visuellen Systems aber Voraussageketten begegnen, wie zum Beispiel die Voraussage der weiteren Bewegung eines vorbeiziehenden Objektes, die wir noch vollständig überblick en können. 3.3.3 Verarbeitungsebenen und das Differenzierungsproblem Wir können uns diese Voraussageketten als Verbindungen vorstellen, die mit Widerständen versehen sind. Je nach der bayesianischen Wahrscheinlichkeit, mit der ein Ereignis erwartet werden darf, ist der Widerstand gering, oder eben groß. Nach einigen solchen Widerständen verliert sich das Signal in der Kette. Ereignisse die wahrgenommen werden, aber nicht, oder kaum erwartet (vorhersignalisiert) wurden, sind Voraussagefehler und werden als solche auf die nächst höhere Ebene des Netzwerkes weitervermittelt, wo sie untereinander Verbindungen eingehen können. Dabei können möglicherweise wieder Voraussagbarkeiten entdeckt werden, oder es entstehen wieder Voraussagefehler, die auf eine noch höhere Ebene übertragen werden. Von Ebene zu Ebene steigt die Komplexität des Systems. 102 Mit der Bildung einer neuen Verbindungszelle im Falle eines Voraussagefehlers ist auch ein bekanntes Problem propositionaler Netze gelöst, das Differenzierungsproblem (Herkner 1991, S.163). Wenn zum Beispiel erkannt wird, dass Eva große Augen hat, dann entsteht zunächst eine Verbindung von Eva zu Augen, und dann noch zu groß. Und wenn Karl blaue Augen hat, entsteht eine Verbindung von Karl zu Augen. Von dort liegt aber bereits eine Verbindung zu groß vor. Das darf nicht sein. Da entsteht ein Voraussagefehler. Karls Augen sind nicht groß. Die Voraussagekette muss also getrennt werden. Der Voraussagefehler provoziert die Bildung einer neuen Verbindungszelle (Chunk), und so kommen wir zur unteren Darstellung, wo das Problem einer Verwechslung nicht mehr gegeben ist. Die Kettenverbindung Eva hat große Augen ist ebenfalls erhalten g eblieben. Die Regel lautet also: „Sobald ein Voraussagefehler auftritt, wird das Signal an neue, noch freie Zellen weitergegeben.“ Wie aber geht das System mit nur teilweise zutreffenden Voraussagen um? Die Antwort ist einfach: „Es wird immer jener Teil des Signals an neue Zellen weitergegeben, der nicht vorausgesagt wurde.“ Diese Regel will ich vorerst einfach so stehen lassen. Später werden wir sehen, dass auch die Verschaltung des visuellen Systems im Gehirn, soweit sie bekannt ist, eine solche Regel nahelegt. Die Vorstellung besteht also darin, dass bereits die Reize der einzelnen Sinnesrezeptoren einander vorauszusagen versuchen, also Voraussageverbindungen zueinander eingehen. Von Ebene zu Ebene der Verarbeitung werden immer komplexere Voraussageverbindungen gelernt. So ergibt sich die Frage, ob dieser Lernvorgang des Gehirns auch anatomisch sichtbar ist. Tatsächlich werden fertige Verbindungen mit einer Myelinschicht ummantelt, die sie isoliert, und den Signalfluss in ihnen beschleunigt. Und es ist, wie erwartet, zu beobachten, dass die Myelinisierung des Gehirns bei den Projektionsfeldern der 103 Sinne beginnt, und bis in die Pubertät voranschreitet. Erst dann wird z.B. auch der Frontallappen voll „erobert“ (Spitzer 2000, S.196). 3.4 Regeln zum Zusammenfluss der Signale Im letzten Kapitel, das ich der hierarchischen Organisation des Wissens gewidmet habe, wurden nur Beispiele angeführt, die einen zeitlichen Ablauf darstellen. Das Alphabet ist ein nacheinander an Buchstaben, also ein zeitlicher Ablauf. Das Gehirn legt eine innere Repräsentation der Welt in Form von Verbindungen an. Bei zeitlichen Abläufen ist klar, dass diese Verbindungen auch dieses zeitliche Nacheinander wiederspiegeln. Werden sie abgerufen, so durchwandern wir in unserer Vorstellung wieder den zeitlichen Ablauf. Wir können den Film nicht verkehrt ablaufen lassen. Wir sehen niemanden rückwärts gehen, wenn wir an die Vergangenheit denken. Allerdings ist der Film, da er an Voraussageenden ze rfällt, in einzelne Ereignisse (Cunks) gegliedert, die wir durchaus in verkehrter Reihenfolge erinnern können. Visuelle Informationen sind in dem örtlichen Zueinander neuronaler Aktivität festgelegt. Wie kann dieses örtliche Zueinander durch Verbindungen abgespeichert werden? Um diese Frage zu beantworten, müssen einige Hürden überwunden werden, die über das hinausgehen, was die heutige Gehirnforschung nachweisen könnte. Das folgende Kapitel ist also dem Ziel entsprungen, ein funktionstüchtiges Modell zu schaffen, wie es die KI-Forschung braucht. Allerdings ist das Modell nicht aus der Luft gegriffen. Es lässt sich schlüssig argumentieren, dass auch das Gehi rn bestimmten Problemstellungen nicht entgehen kann, zum Beispiel dem Problem, eine zeitliche Reihenfolge der Verarbeitungsschritte festzulegen. 3.4.1 Wann und wie verlassen die Fließsignale eine Redundanzkette? Während die Zeit in einer linearen Verkettung von Verbindungen beschrieben werden kann, kommen wir bei der Abspeicherung visueller Informationen nicht daran vorbei, auch sternförmige Verbindungen zuzulassen, denn Bilder bestehen aus Flächen und in Flächen gibt es Verbindungen in alle Richtungen, nicht nur in eine. Tatsächlich gibt es sternförmige Verbindungen im Gehirn. Die Zentrum/Umfeld Zellen verbinden zum Beispiel benachbarte Zellen sternförmig miteinander (Hubel 1989, S.185). Benachbarte Zellen des Netzhautbildes fallen meistens in die gle iche Farbfläche eines Projektionsbildes. Sie sind also oft gleich gereizt. Die Konditionierungsregeln besagen, dass gleichartige Reize verbunden werden, wenn sie häufig räumlich und zeitlich nahe aufeinandertreffen. Also müssen die Zellen auf unterster Stufe der visuellen Wahrnehmung alle mit ihren Nachbarn eine sternförmige Verbindung aufbauen, und so ist es. 104 Diese Voraussagekette (in unserem Fall eigentlich eine Voraussagefläche) findet ihr Ende dort, wo ein Voraussagefehler auftritt. Bei der Betrachtung einer weißen Wand ist nirgends im Bild ein Voraussagefehler. Wohl aber bei der Betrachtung von Formen. Dabei kommt es an der Kontur zu Voraussagefehlern, da benachbarte Zellen dort unterschiedlich aktiviert sind. Die Voraussagefehler führen zur Gründung von Chunkzellen. Alle diese Chunkzellen liegen auf den Konturen. Nehmen wir nun an, dass diese Konturzellen auf eine neue Ebene übertragen werden, und dort ihrerseits wieder versuchen Verbindungen aufzubauen. Es starten also, ausgehend von den Konturen, Fließsignale, die der Verbindungsfindung dienen: Die Mittelpunkte der gefundenen Verbindungen ergeben nun, wie die Grafik zeigt, das Symmetrieachsenskelett von Formen. Diese Mittelpunkte können sich ihrerseits verketten und Chunkzellen beliefern. Die einer solchen Kette zugeordnete Chunkzelle spricht dann nur an, wenn das Objekt zu sehen ist. Sie erkennt das Objekt. 3.4.2 Warum solche räumliche Verbindungen nicht entstehen Die Grafik vermittelt den Eindruck, dass, wenn das Gehirn alle Informationen in Form von Verbindungen darstellt, etwas derartiges im Gehirn vorgehen müsste. Aber eigentlich kann dies nicht so sein. Die Verbindungen zum Objektzentrum hin werden sich nicht bilden, denn es gilt das Gesetz der Nähe. Konturzellen werden sich also miteinander zu Linien verketten, aber nicht die weite Strecke zu einer anderen Kontur überbrücken. Werden sich dauerhafte Verbindungen bilden? Wenn wir die statistischen Regeln auf die Sache anwenden, so kommen wir zu dem Ergebnis, dass sich kaum dauerhafte Verbindungen bilden werden. Dort hieß es nämlich, dass die Verbindung 105 „auf A folgt B“ nur dann beibehalten werden darf, wenn B meist von A angekündigt wird, und selten alleine auftritt. Die Zellen, die sich im obigen Beispiel miteinander verbunden haben, sind aber sowohl in der Vergangenheit, als auch in der Zukunft, meist in anderen Kombinationen aktiviert worden. Das heißt sie werden nur äußerst selten genau in dieser Verbindungskombination auftreten. Die unter ste Ebene, die der Konturfindung dient, mag ihre Verbindungen halten können, denn auch in anderen Bildern werden benachbarte Zellen häufig gleich gereizt sein. Die Verbindungen, welche zum Symmetrieachsenskelett führen, und alle übergeordneten Verbindungen werden jedoch schon von der nächsten Wahrnehmung wieder überschrieben werden. Das heißt Formen können so nicht dauerhaft erinnert werden. An unserem Modell stimmt also momentan etwas nicht. Die Statistik ist aber unanfechtbar. Also müssen wir damit leben, dass örtliche, bzw. räumliche Bezüge höherer Ordnung nicht dauerhaft durch örtlich fixe Verbindungen gespeichert werden können. Tatsächlich findet man im visuellen System des Säugetierhirns ja auch nur niedrige Verarbeitungsstufen, wie sie zum Herausfiltern von Helligkeitsgrenzen, Farbgrenzen, Bewegungskonturen, Tiefenverarbeitung und Richtungserkennung notwendig sind, durch örtliche Verbindungen repräsentiert (Hubel 1989). All diese Faktoren kommen aber in jedem Bild vor, und können sich deshalb statistisch dauerhaft behaupten. Außerdem birgt die Idee, Formen durch dauerhafte räumliche Verbindungen zu speichern auch noch andere Detailprobleme, wie zum Beispiel die große Anzahl an Verbindungen, die nötig wäre, um eine Form zu erfassen. Auch würde die Form in dem Moment nicht mehr erkannt, wo sie verschoben wird, bzw. es müssten wieder neue Verbindungen gegründet werden. Das Selbe gilt, wenn die Form verdreht, verkleinert, oder anders beleuchtet erscheint. Und der Gipfel des Übels besteht darin, dass wir letztlich keine Regel kennen, die die Vielzahl an Verbindungen vereinen könnte, die dann ein und die selbe Form in verschiedenen Situationen repräsentieren. 3.4.3 Die Abziehbildcodierung Wenn nun die Verbindungen, welche zum Symmetrieachsenskelett führen, nic ht aufrecht erhalten werden, so ergibt sich die Frage, wie dann Wiedererkennen von Formen möglich ist. Das bisherige Modell arbeitet doch mit derartigen Fließsignalen. Warum sollten sie hier plötzlich keinen Sinn mehr ergeben? Faktisch ist es so, dass die Fließsignale durchaus noch immer Sinn ergeben. Nur dienen sie nun nicht mehr der Verbindungsfindung, sondern der Verbindungsnutzung. Verbindungen sind ja da. Jede Zelle ist mit ihren Nachbarn verbunden worden. Nur die höheren Verbindungen, zu den Symmetrieachsenskeletten entstehen nicht. Die Frage ist, wozu sind überhaupt Verbindungen gut, wenn nicht dazu, dass darin Signale fließen. Stellen wir uns also ein Verbindungsnetz vor, in dem jed e Zelle mit 106 ihren Nachbarn verbunden ist. Wie sollen denn darin Signale fließen? Wo und wann sollen denn solche Signale entstehen? Es macht keinen Sinn Verbindungen aufzubauen, wenn darin keine Signale fließen. Aber wozu könnte ein solcher Signalfluss gut sein? Wir wissen, dass auf der primären Sehrinde die Seheindrücke als flächiges Reaktionsbild vorliegen. Dieses Reaktionsbild wird auf Ebenen aufgeteilt, die für Farbe, Struktur, Bewegung, Tiefenzuordnung usw. stehen. Danach geschieht mit all diesen flächigen Reaktionsbildern irgendeine Transformation, und einen Schritt weiter, sind im Schläfenlappen auf einmal Formen und Objekte erkannt (Damasio 1993, S.51). Aus meiner Sicht kann das, was an dieser Stelle des Säugetiergehirns passiert, nichts anderes sein, als eine Codierung der flächigen Informationen auf Zeit, denn Information muss grundsätzlich entweder Zeit oder Raum in Anspruch nehmen, um existent zu bleiben. Entweder ich schicke sie durch viele räumlich nebeneinanderliegende Leitungen in einem Stück, oder ich schicke sie durch wenige Leitungen nacheinander, also zeitcodiert, wie die Zeilen des Fer nsehbildes. Wie könnte eine solche Zeitcodierung aussehen? Die Antwort ist ganz einfach. Wir lassen durch die Verbindungen Signale fließen, und die Zeitspanne, die der Signalfluss anhält, beschreibt die räumlichen Distanzen, die durchflossen werden. Aber wo können die Signale starten? Natürlich von den Voraussageenden, also von dort, wo die derzeitige Verbindung ihre Gültigkeit verliert. Das sind in unserem obigen Beispiel die Konturen. Der entstehende Signalfluss entspricht dann genau den Zeitlinien, mit denen die Objekte der Grafik gefüllt sind. Tatsächlich legen Studien Nahe, dass im Gehirn zum Beispiel Farbinformationen von den Konturen in die Objektflächen wandern (Spillmann u.a. 2000). Wie kann nun die Zeitdauer des Durchflusses weitervermittelt werden? Nehmen wir uns als anschauliches Beispiel ein Abziehbild. Wir ziehen das Bild nun von den Voraussageenden, also den Konturen, her ab. Die abgezogene Fläche wandert dabei zur Mitte, so wie in der Grafik dargestellt: 107 Ich fand auch noch zwei ähnliche Möglichkeiten mit dem gleichen Effekt, a uf die ich hier nicht näher eingehen will. Wichtig ist, dass wenn nun auch noch mitvermittelt werden kann, wie viele Signale zu einem Zeitpunkt jeweils zusammenfließen (Reizanzahl), dass dann auf diese Weise die ganze Forminformation zeitc odiert aus der Ebene tritt. Auf das Problem der Auswertung zeitlicher Information werde ich im übernächsten Kapitel Antwort geben. Wieso aber führt der Signalfluss nun aus der Ebene, und bleibt nicht in der Eb ene, wie bei den Kämmsignalen. Die Antwort ist einfach: Die Kämmsignale treten bei der Verbindung entfernter Reize auf einer nicht gereizten Fläche auf. Hier aber erhält die ganze Fläche einen Reizinput. Die Signale können also nicht retour wandern, weil Zellen die gereizt sind nicht aufnahmefähig sind. Außerdem sind die Verbindungen ja schon gefunden. Wie oben erwähnt ist jede Zelle mit ihren Nachbarn verbunden. Es geht hier also genaugenommen gar nicht mehr um Verbindungsfindung, sondern um Verbindungsnutzung, also um den Signala bfluss. Wieso werden die vorhandenen Verbindungen an den Objektgrenzen, wo benachbarte Zellen unterschiedlich gereizt sind, nicht wieder getrennt? Weil die momentane Erfahrung, den Bayes-Regeln zufolge, nicht sofort die Unzahl von vergangenen wiederholten Erfahrungen überschreiben kann, wo benachbarte Zellen gleich gereizt waren. So wird die Kontur nur als Ausnahme, d.h. als Voraussagefehler wirksam. Wir befinden uns also bereits eine Verarbeitungsstufe über der Verbindungsfindung, bei der Frage, wie Signale durch die Verbindungen fließen. Tatsächlich ist diese Frage nur bei zeitgleich entstandenen Verbindungen durch den Abziehbildsignalfluss zu beantworten. Solche Und-Verbindungen haben nämlich, anders als zeitliche Verbindungen (Dann-Verbindungen), keine vorgeschriebene Richtung, und würden wir keine Regeln für den Signalfluss festlegen, so könnten die Signale innerhalb zeitgleicher Und-Verbindungen bis in alle Ewigkeit im Kreis 108 herumwandern. Jedes sinnvolle neuronale Modell kommt also um die Festlegung einer Signalflussrichtung in Und-Verbindungen nicht umhin! Allerdings bieten alle neuronalen Netze, die ich kenne, dazu nicht mehr an, als Fließrichtungen von den Sinnen nach oben (Bottom-Up) oder von einer Zieldefinition nach unten (Top-Down) vorzuschreiben. Nach 10 jähriger unfruchtbarer Diskussion, was der richtige Weg sei, sollte eigentlich allen klar sein, dass es nicht nur diese zwei Wege geben kann. Der Start des Signalflusses beim Voraussagefehler bietet ein völlig neues Ko nzept, dessen überragende Leistungsfähigkeit ich mit dieser Arbeit darstellen möchte. Genaugenommen fließen die Signale innerhalb von Und-Verbindungen in meinem Modell vorerst gar nicht, weil ein Signal nicht weitergeben werden kann, so lange alle verbundenen Zellen gleiche Reizintensität haben. Wir erinnern uns: Eine gereizte Zelle kann kein Signal empfangen, also kann auch keine Zelle einer gleichgereizten Gruppe ein Signal an ihre Nachbarzelle abgeben. Nur wenn diese schwächer gereizt ist, als die sendende Zelle, kann ein Signalfluss zustande kommen. Es muss also an den Rändern der Fläche, wo die Voraussagefehler auftreten, zu einem verstärkten Impuls kommen, der dazu führt, dass ein Signalfluss zustandekommt. Tatsächlich hat uns die Theorie des eigenen Impulses beim Auftreten eines Voraussagefehlers, ja bereits bei der Gründung von Chunkzellen als Regel gedient. Im weiteren wird sie uns zu einem schlüssigen Modell der Aufmerksamkeitslenkung führen. Ziehen doch unerwartete Ereignisse (Voraussagefehler) immer unsere Aufmerksamkeit auf sich (Goldstein 1997, S.33). 3.4.4 Wie stark sind Signale, die sich verbinden? Verbinden können sich nur Signale, die zeitgleich am selben Ort zusammenla ufen. Angeblich wird Signalstärke im Gehirn durch Signaldichte repräsentiert (Hubel 1989, S.23). Also kann nur dann eine gute Verbindung zustande kommen, wenn ähnliche Dichte vorliegt, denn nur dann findet sich für jeden Einzelimpuls zeitgleich ein Gegenimpuls. Nach den bayesianischen Regeln muss in diesem Fall eine Verbindung zustande kommen. Da der Begriff „Signalstärke“ aber anschaulicher ist, werde ich ihn weiter verwenden. Dann gilt also: Es können nur Signale gleicher Stärke miteinander verbunden werden. Wie stark können überhaupt zusammenfließende Signale sein? Dies ist abhängig davon, wie die Ebene, auf der die Signale zusammenfließen, verschaltet ist. Sind die Zellen der Ebene mit allen ihren unmittelbaren Nachbarn verbunden, so ergeben sich pro Zelle in unserem künstlichen System maximal sechs Signale, die zusammenfließen können. Dies stellt dann den maximalen Input dar. Als Adaption wird die Fähigkeit der Sinne verstanden, sich an verschiedene Reizintensitäten anzupassen. Es ist bekannt, dass Zellen ihre Sensitivität den Bedingungen anpassen, so dass ihr Reizumfang voll ausgeschöpft werden kann. Dies ist natürlich ein zeitlicher Effekt, der nur Sinn hat, wenn er nicht die zeitlichen 109 Inputs aufhebt. Das bedeutet, Adaptionsprozesse müssen deutlich langsamer ablaufen, als die durchschnittliche Aktivierungshäufigkeit. Die Adaption müsste nach einiger Zeit dazu führen, dass die Zellen einer Ebene, in der jede Zelle mit all ihren Nachbarn verbunden ist, nur dann maximal reagieren, wenn von all ihren Nachbarn ein maximaler Reiz eintrifft, denn das ist der maximale Input, den sie auf dieser Ebene erhalten können. Auf einer Ebene, wo jede Zelle nur mit zwei Nachbarzellen verbunden ist, ist der maximale Input dann gegeben, wenn diese Beiden maximal senden. Auf einer Ebene, wo jede Zelle mit sechs Nachbarzellen verbunden ist, sind sechs Signale nötig, um sie maximal zu aktivieren. 3.4.5 Die notwendige Unterscheidung von Reizstärke und Reizanzahl Das Gehirn zeigt uns, dass nicht nur Verbindungen von zwei, sondern von beliebig vielen Signalen möglich sind. Es wird ja zeitlich und räumlich Nahes verbunden. Es gibt durchaus Situationen wo mehr als zwei Neuronen wiederholt mit der gleichen zeitlichen und räumlichen Distanz zueinander aktiviert werden, und somit alle zu einer Verbindung zählen. Die Zentrum/Umfeld-Zellen im Sehsystem sind ein solches Beispiel einer sternförmigen Verbindungsgruppe. Wenn wir vom Modell des Abziehbildsignalflusses ausgehen, so zeigt die folgende Grafik Ausgangspunkte, die so verteilt sind, dass ihre Signale zeitgleich am se lben Ort zusammenlaufen. Dort sollte also eine Verbindung von mehr als zwei Si gnalen zustande kommen. Bei diesem Zusammenfluss soll es aber nicht zu einer Vermischung zwischen 1. der Stärke (Dichte) der zusammenfließenden Signale und 2. ihrer Anzahl kommen. Aber wie können diese beiden Informationen im Gehirn erhalten bleiben? Würde die Trennung von Stärke und Anzahl nicht aufrechterhalten, so käme es in folgendem Fall zu einer Verwechslung: Wenn die verbundenen Zellen nur mit halber Kraft senden, dann kommt es nur zu halber Aktivierung der Gesamtverbindung. Zu halber Aktivierung kommt es aber auch, wenn nur die Hälfte der Zellen senden, denn dann ist ebenfalls nur der halbe Input da. Es stellt sich also die Frage, wie diese Situation von der ersteren unterschieden werden kann. 110 Die Antwort liegt in den Antizellen, die wir schon bei der Darstellung hemmender Verbindungen kennengelernt haben. Ist ein Signal nur halb aktiv, so ist ja auch die Antizelle noch halb aktiv, denn ihre Reizung ist immer negativ zu der der Zelle (Man bedenke, dass das Negativ von Grau ebenfalls Grau ist). Also fließt auch dort ein Signal halber Stärke zusammen, wenn alle Zellen mit halber Kraft senden. Senden hingegen nur die Hälfte der Zellen mit voller Kraft, so senden die Antizellen gar nicht, also kommt es dort zu gar keinem Signal. Die beiden Situationen können also unterschieden werden. 3.4.6 Konkretisierung der Signalcodierung für die KI-Forschung Die Idee, dass visuelle Information durch Fließzeiten zeitcodiert werden kön nte, wird neue Experimente in der Neurophysiologie provozieren. Es ist, nachdem man die synchron pulsenden Neuronen entdeckt hat, bereits abzusehen, dass Zeitcodierung das Forschungsgebiet der Zukunft in der Neurophysiologie darstellt. Die Idee der Zeitcodierung stellt aber auch ein neues Konzept für die KI -Forschung dar. Wenn die Form eines Objektes auf einen einfachen zeitlichen Code reduziert werden kann, unabhängig von deren Lage und Größe, dann ist visuelles Wiedererkennen kein Problem mehr, denn die zeitlichen Codes brauchen wenig Speicher und können somit jederzeit mit den gegenwärtig eintreffenden Sinnesreizen verglichen werden. Damit das funktioniert, muss allerdings sichergestellt werden, dass jede differenzierbare Form auch ihren eigenen Zeitcode erhält. Auch muss jede Art von Grafik zeitcodierbar sein. Ich habe mich lange mit dem Thema beschäftigt, und glaube, die dafür nötigen Regeln zu kennen. Wichtig ist, dass diese Regeln allesamt darin festgelegt werden müssen, wie Neuronen miteinander kommunizieren bzw. interagieren. Abgesehen vom Neuron soll das Modell keines übergeordneten Steuerungssystems bedürfen. Die folgenden Überlegungen sind also an den Praktiker gerichtet, der ein solches System umsetzen will, und Regeln dazu braucht. Er wird nicht warten, bis die Neurologie so weit ist, diese Regeln zu überprüfen, für ihn ist nur wichtig funktionstüchtige Regeln zu kennen. Andere Leser mögen die folgenden fünf Textseiten einfach überspringen. 3.4.7 Der Abfluss der Signale am Beispiel räumlich getrennter Punkte Wir wissen, dass das Gehirn alle Informationen durch Verbindungen beschreibt. Würde es alle erdenkbaren räumlichen Bezüge durch Verbindungen abspeichern, für jede abgespeicherte Verbindung ein Neuron gründen das diese Verbindung repräsentiert, und dann den räumlichen Bezug solcher Neuronen durch weitere Verbindungen abspeichern, denen wieder Neuronen zugeordnet werden usw., dann käme es an kein Ende. Die folgende Grafik beweist, dass ausgehend von drei Ausgangspunkten, bereits ein unendlicher Verbindungsprozess in Gang k äme, zumindest wenn die Feinheit der Auflösung unendlich wäre. 111 Tatsächlich führt das bisher besprochene Signalflussmodell, wenn es richtig verstanden wird, nicht zu der hier dargestellten Verbindungsflut. Um zu verstehen warum nicht, vergegenwärtigen wir uns doch noch einmal die Grafik mit den Symmetrieachsenskeletten. Wir sind dort davon ausgegangen, dass auf unterster Ebene der visuellen Verarbeitung, alle Zellen mit ihren Nachbarn verbunden sind. Sie sagen voraus, dass der benachbarte Bildpunkt meist gleich gereizt ist. An den Konturen kommt es zum Voraussagefehler. Von dort startet das Fließsignal. Es durchwandert die Verbindungskette (Verbindungsfäche), die aus einer Unsumme von Verbindungen besteht, und bündelt die gesamte Information in deren Zen trum. Dort kann sie nicht mehr weiterfließen und tritt aus der Ebene. Die Verbindungskette im obigen Beispiel besteht demgegenüber nicht aus einer Unsumme von Verbindungen, sondern aus genau 6. Die Verbindungen werden im visuellen System keinen dauerhaften Bestand haben, aber vorerst werden sie geknüpft und bleiben zumindest lange genug aufrecht, damit die Information zeitcodiert werden kann. Es bleiben 6 Verbindungen, auch wenn sie über andere Zellen hinweg geknüpft wurden! Sie ergeben eine vorläufig vorhandene Verbindungskette, der ein Chunkneuron zugeordnet werden könnte, aber nur eines, nicht 4. Wollen wir nun ein Signal von den Voraussageenden durch die Verbindungskette fließen lassen, so stoßen wir auf das Problem, dass alle drei Ausgangspunkte nicht voraussagbar sind. Also soll von allen drei aktiven Neuronen ein Signal starten. Ein Neuron kann 112 aber nur dann ein Signal eines anderen aufnehmen, wenn dieses stärker ist als sein eigenes. Ansonsten kommt es zu einem Gleichgewicht der Kräfte. Deshalb können die Signale nirgends anderes hinfließen, als in das Zentrum des Dreiecks. Im Zentrum tritt also die gesamte Information zeitcodiert aus der Ebene. (Eigentlich sollte auch in Gleichgewichtssitutationen, wie zum Beispiel bei einer einzigen Verbindung von zwei Ausgangspunkten, ein Abfluss des Signals möglich sein. Welche Zelle dann an welche ihr Signal weitergibt, entscheidet der Zufall. Aber eine Zufallsentscheidung ist ja im obigen Fall nicht nötig. Es gibt ja ein O bjektzentrum, in dem die Signale zusammenfließen können.) Wie kann eigentlich die gesamte Information über die örtliche Verteilung der Punkte in diesem einen Signal enthalten sein, das nun die Ebene verlässt? Ganz ei nfach. In der Signallänge ist die Länge der Verbindungen, in der Reaktionskonstell ation von Zelle zu Antizelle die Zahl an zusammenfließenden Reizen, und die Reizstärke codiert. Nun bleibt nur noch die Frage, wie eine regelmäßige von einer unregelmäßigen Punktanordnung unterschieden werden kann. Die folgende Grafik zeigt 4 Punkte, die unregelmäßig auf einer Kreisbahn verteilt wurden. Keiner der Punkte kann vorausgesagt werden. Sogesehen gibt es keinen stärkeren Voraussagefehler, von dem aus die Fließsignale starten könnten. Aber es besteht trotzdem ein Ungleichgewicht innerhalb der Kreisbahn. Nach dem Gesetz der Nähe, sind nahe Verbindungen stärker. Neuron 3 wird seine Aktivität nahezu in gleicher Stärke auf 2 und 4 aufteilen wollen, da die Verbindungen dorthin n ahezu gleich kurz sind. 2 und 4 bevorzugen es, einen Großteil ihrer Aktivität zu Neuron 3 zu schicken, weil zu Neuron 1 ein großer Abstand zu überwinden wäre. Siegen wird Neuron 4, weil es näher zu 3 ist als Neuron 2. Dort wird also das Signal der Kreiskette zu fließen beginnen (rot). Die anderen Signale folgen. Abgesehen davon wird wohl jedes Neuron auch einen Teil seiner Signalstärke in das Objektzentrum schicken. Vorerst entstehen also zwei Fließsignale (Zeitcodierungen), die aber auf höherer Verarbeitungsebene ihrerseits zusammenfließen können. Das Gesamtsignal repräsentiert dann die Punktverteilung. Im Endeffekt ist das Merken und Wiedererkennen von Punktanordnungen wie der hier gezeigten, schon äußerst aufwendig, und zwar nicht nur für unser künstliches 113 System, sondern auch für das menschliche Gehirn. Das zeigt sich, wenn wir sie in einem Fragebogen verdreht präsentieren, und ähnliche Punktanordnungen zum Vergleich anbieten. Das menschliche Gehirn ist einer solchen Aufgabe verblü ffend wenig gewachsen. Formen, die im Fließprozess zu deutlich unterscheidbaren Symmetrieachsenskeletten führen, sind hingegen viel leichter zu erinnern. Die meisten Naturformen sind solche Formen. 3.4.8 Warum wir Form und offene Linie unterscheiden Wenn die Punkte zu sehr auf eine Seite der Form gedrängt werden, wie in der folgenden Grafik, so werden sie nicht mehr als Elemente einer Form gedacht, sondern als gekrümmte Linie. Wieso eigentlich? Es ergibt sich kein Zentrum, wo die, für die Verbindungsentstehung notwendige Situation entstünde, dass die Signale nicht mehr weitergegeben werden können, und somit zurückfließen. Es kommt in diesem Fall, an der Stelle wo sich die Signale treffen, zu einer Verschmelzung und einer Weitergabe der Signale, aber nicht zu einem Rückfluss, der für die Entstehung einer Verbindung notwendig wäre. Das bedeutet, es können nur Zweierverbindungen zwischen benachbarten Punkten entstehen. Sie ordnen sich in unserem Denken nicht zu einer geschlossenen Form, sondern nur zu einer Kette von Zweierverbindungen, also zu einer offenen Linie. Die Linie kann dann von ihren Enden her durchflossen werden. Im Rahmen des hier dargestellten Hirnmodells, fallen sowohl Formen als auch Linien unter den Überbegriff „Redundanzketten“. Auch zeitliche Abläufe sind Redundanzketten, aber sie enthalten zusätzlich eine Zeitinformation, und haben, anders als zeitgleiche Verbindungen (Und-Verbindungen), damit eine klare Fließrichtung. In den hier besprochenen Und-Verbindungen muss erst eine Fließrichtung gefunden werden. Wir haben angenommen, der Signalfluss startet an den Voraussageenden. Formen und Linien unterscheiden sich am Ort ihrer Voraussageenden. Eine Form beginnt an ihren Außengrenzen, eine Linie hingegen 114 an ihren beiden Enden. Eine gekrümmte Linie wird an der veränderten Richtung der Verbindungen erkannt. Interessanter Weise bedarf es zur Erkennung der Richtung einer Verbindung keiner neuen Regeln. Ich werde im Anschluss an das Model zeigen, dass die vorhandenen Regeln ganz automatisch zu Ebenen führen, die richtungsspezifisch reagieren. Da sich diese Ebenen alle auf der selben Stufe der Verarbeitungshierarchie entwickeln, sind sie im Gehirn auf einer Fläche ineinander verwoben, und ich spreche von Quasiebenen, weil sie optisch nicht als Ebene erscheinen, es von ihrer Verbindungsstruktur her aber sind. Die richtungssensiblen Zellen werden Balkendetektoren genannt, und sind im Gehirn nachgewiesen. Aber dazu mehr im Kapitel „Anwendung des Modells“. 3.4.9 Wann werden Signale kombiniert, wann überschrieben? In diesem Modell steht die Zeit, die ein Signal braucht, um eine Strecke eines Reaktionsbildes zu durchfließen, für deren Länge. Dadurch werden visuelle Informationen zeitcodiert. Als kleinste Einheit in unserem künstlichen System könnte die Zeit dienen, die ein Signal benötigt, um eine Zelle zu überbrücken. Es handelt sich dabei um einen unvorstellbar kleinen Zeitraum, wie er für Schaltvorgänge in der Zelle benötigt wird. Mit der räumlichen Distanz zwischen zwei Punkten A und B, steigt auch die Zahl der Zellen, die überbrückt werden müssen, und damit die Zeitspanne. Die kleinste Einheit der Zeit, ist in unserem Fall der Schaltvorgang in der Zelle. Damit ist klar, wie lange die „Gleichzeitigkeit“ andauert. Die kleinste Einheit des Raumes, ist die Zelle. Sie ist der Bildpunkt des visuellen Systems. Wir werden im Rahmen der Konturrichtungserkennung sehen, dass durch gewisse Tricks sogar noch Wahrnehmungen unter diesen räumlichen und zeitlichen Grenzen möglich sind. Aber dazu später. Nehmen wir nun an, die Zellen eines Bereiches haben in der Vergangenheit mit ihren Nachbarn eine Verbindung aufgebaut, und diese Verbindungen werden nun durch eintretende Reize aktiviert. Es kommt zu einem Kettensignalfluss. Aber welche Regeln gelten, wenn mehrere Signale gleichzeitig aufeinandertreffen? Vermischen sich die Signale, siegt das Stärkere, oder werden sie irgendwie miteinander verrechnet? Wie kommt es dazu, dass unser Bewusstsein nur einem Inhalt zu einem Zeitpunkt folgen kann? Dass es im Gehirn eine solche Regel geben muss, zeigt sich erst in aller Deutlichkeit bei den zeitlichen Redundanzketten, durch die Ereignisse im Gehirn repräsentiert werden. Wenn wir zum Beispiel entscheiden sollen, welche von zwei Zukunftsvorstellungen die wahrscheinlichere ist, so fließen dabei Signale durch Verbindungen, und die stärkeren Signale siegen und repräsentieren die größere Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Vorstellung. Gerade bei Vorstellungen zeigt sich, dass es keinen Sinn macht, aufeinandertreffende verschiedenartige Signale zu vermischen. Eine Mischvorstellung ist Unsinn. Wir können uns verschiedene Ereignisse nur nacheinander vorstellen, nicht gleichzeitig vermischt. Auch könnte 115 aus dem Gemisch nie mehr auf die Originaldaten rückgeschlossen werden. Ein Gemisch würde zu Datenverlusten führen. Der einzige Fall, wo ein Zusammenfluss der Signale zu keinen Datenverlusten führt, ist wenn die Signale zur gleichen Zeit am gleichen Ort mit gleicher Stärke eintreffen, also gleichartig sind. Allerdings muss dann, wie wir am Beispiel mit den Vieleck-Punktverteilungen gesehen haben, auch die Information mitgeliefert werden, wie viele Signale kombiniert wurden. Das geschieht in Sternverbindungen, wie schon besprochen, über die Reaktion der Antizelle. Unsere Regeln für den Zusammenfluss lauten also: „Beim Zusammenfluss unterschiedlich starker Signale siegt das stärkere. Gleich starke Signale können hingegen kombiniert werden.“ „Die Antizelle errechnet die Kombination aus den negativierten Reizinputs aller Zulieferer, und das führt nicht immer zum komplementären Ergebnis im Vergleich zur Zelle. In einem solchen Fall muss das Signal der Antizelle extra weiterverarbeitet werden. An diesem Zusatzsignal ist zu erkennen, ob mehrere starke oder wenige schwache Signale zum Gesamtoutput geführt haben.“ Möglich ist eine sternförmige Verbindung dann, wenn eine Zelle immer zeitgleich von umliegenden Zellen das gleiche Signal erhält. Sie kann dann zu allen auf einmal eine Verbindung halten, wobei für diese Verbindungen der gleiche statistische Wahrscheinlichkeitswert (Bayes) gilt. In diesem Fall sind also mehrere Signale auf einmal verarbeitbar, da für sie alle die gleichen statistischen Werte gelten. Das führt zu einer effizienten Verarbeitung. Wir haben ja oben die Regel aufgestellt, dass gleiche Signale zusammenfließen dürfen. Sternverbindu ngen sind Orte eines solchen Zusammenflusses. Damit haben wir den abstraktesten, und somit komplizierten Teil des Modells abgeschlossen. Für alles Weitere werden sich lebensnähere Beispiele finden, was die Sache wesentlich verständlicher macht. 3.4.10 Was haben wir damit erreicht? Der Signalfluss entlang der Redundanzketten führt zu maximaler Komprimierung der Bilddaten. Außerdem entsteht der gleiche Output, auch wenn das Objekt rotiert wird. Das ist für das Wiedererkennen wichtig. Zwar genügt es nicht eine einzige Leitung auf der Bildfläche anzubringen, um die Bilddaten dort hindurchzusenden, denn es ist ja im vorhinein nicht klar, an welcher Stelle der Bildfläche die Mittelpunkte von Formen liegen werden. Die Information tritt ja immer an den Mittelpunkten von Formen aus der Fläche. Auch entstehen vorerst so viele Signale wie Formen. Also muss von jeder Zelle eine Output-Leitung vorliegen. Aber die Signalströme, welche die Fläche verlassen, können sich ja danach Kontakte zu Einheiten suchen, die auf bestimmte Signalrhythmen ansprechen, und die damit die Formen erkennen. Wir brauchen keine fest vorgegebene Output-Leitung. Das besondere an dem hier dargestellten Modell ist ja, dass es in der Lage ist, Kontakte nach Bedarf herzustellen. Der Ort eines Objekts ist also egal. Wenn die Zellen, 116 welche die Signalrhythmen erkennen, die in ihnen enthaltenen Zeitabschnitte relativ zueinander verarbeiten, so erkennen sie die Formen auch unabhängig von deren Größe. Aber ist es nicht eine Ausnahme, die nur auf das visuelle System zutrifft, dass sich Zeitsignale so elegant nutzen lassen? Nein! denn es ist prinzipiell für das Erkennen egal, wie der Code aussieht, der ein Objekt repräsentiert. Nichts im Gehirn gleicht der Welt. Es kommt nur darauf an, dass Gleiches wieder zu gleichen Codes führt, und die Differenzierung der Codes so geschieht, wie wir die Welt erleben. Auch der Tastsinn oder der Geruch könnte mit zeitcodierten Signalen arbeiten, beim Geruch ist dies sogar schon nachgewiesen (WSA 2001.08.08). Die Art der Codes ist kein Kriterium, denn es gibt keinen Code, der dem Objekt der Welt gleicht. Dies zu verlangen ist genauso unsinnig, wie dass die Gehirnzellen, welche die Banane repräsentieren, bananenförmig geformt oder angeordnet sein müssten. Dass das System die Welt so unterteilt, wie wir sie gegliedert erleben, ist jedoch durchaus wichtig. Wir würden die Welt nicht in Objekte zerlegt erleben, wenn das Gehirn die Information nicht auf diese Weise zerlegen würde! Das bedeutet umgekehrt, dass unsere Begriffsgrenzen auch als Beweis für das hier dargestellte Modell herangezogen werden können. Der Begriff „Linie“ ist einfach eine komprimierte Form zu sagen „da ist ein Punkt, und daneben noch ein Punkt, und in der gleichen Richtung daneben noch ein Punkt und noch einer und...“ Über Begriffe wie „Linie“ oder „Kurve“ könnten wir nicht verfügen, wenn unser Gehirn nicht fähig wäre, die Punkte zur Linie zu vereinen, das heißt zu einer Reizkette. Nehmen wir an, eine Linie läuft quer über die gesamte Netzhaut. Die beteiligten Bildpunkte können nun auf zwei Arten vereint werden. Entweder sie beliefern über eigens vorhandene Leitungen alle eine Zelle. Dies ist ausgeschlossen, da sich das Rezeptionsfeld von Zellen dieses Typs dann über die ganze Netzhaut erstrecken würde. Solche Zellen gibt es aber nicht, denn die Axone von Neuronen sind in den Schichten des visuellen Systems nicht so lang (Hubel 1989). Oder es findet ein Kettensignalfluss über andere Zellen hinweg statt, wie es dieses Modell annimmt. Es beweist also nicht nur die assoziative Konditionierung die Existenz von Kettensignalflüssen (Beispiel Rotlicht, Glocke, Futter), sondern auch die Länge der Axone im Gehirns. Es existieren im Gehirn gar nicht die nötigen Verbindungen, um ohne Kettensignalflüsse auszukommen. 3.5 Regeln zur zeitlichen Voraussage 3.5.1 Der Unterschied zwischen Vorstellungen und Wahrnehmungen Vorstellungen dienen dem Gehirn vor allem, um planendes Handeln zu ermöglichen. Planendes Handeln ist deshalb so schwer zu erklären, weil es Voraussagen erfordert. David Loye schreibt: „Wer den modus operandi der 117 Voraussage schlüssig erklären kann, würde eine geistige Transformation auslösen, die noch weit über die Konsequenzen der kopernikanischen, newtonschen, einsteinschen und freudschen Revolution hinausreicht.“ (Holler 1996, S.328). Na das sollte ja Motivation genug sein, für die nächsten Seiten! Ein wesentlicher Unterschied zwischen Vorstellungen und Wahrnehmungen ist, dass in Vorstellungen Zeitabläufe schneller durchdacht werden. Das liegt vor allem daran, dass Wiederholungen nicht seriell gedacht werden müssen. So bleibt unsere Vorstellung von einer Bergwanderung an ein paar markanten Punkten hängen, wo wir das Gehen unterbrachen, für eine Jause, ein Foto, einen Blick über die Landschaft. Wir brauchen uns nicht jeden Schritt nacheinander vorzustellen. „Gehen“ ist uns ja bereits ein Begriff. So ist unsere Vorstellung einer Tageswanderung nach einer Minute abgeschlossen. Die Zeiterwartung ist demgegenüber eine andere Sache. Wir erwarten nicht in einer Minute am Berg zu sein. Alles Handeln muss im richtigen zeitlichen Ablauf erfolgen, sonst wird das Verhalten fehlschlagen. Das bedeutet die Knoten in unserem Verbindungsnetz müssen zeitsensibel sein. Manche Ereignisse, wie zum Beispiel ein Musikstück, b estehen sogar nur aus Zeitmustern. Es sind immer Schalldruckverschiebungen, aber deren zeitliche Frequenzänderungen ergeben die Melodie. 3.5.2 Zwei Arten zeitlicher Vorankündigung: Mit und ohne Verbindungen Voraussagen müssen nur dann über Verbindungen getroffen werden, wenn ein Reiz durch einen anderen angekündigt wird. Es gibt aber auch Dinge, die ohne Ankündigungsreiz eintreten. Zum Beispiel das Geräusch eines weinenden Babys, das aus der Nebenwohnung durch die Mauer dringt. Trotzdem kann eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber solchen Reizen eingenommen werden, die sich aus der Häufigkeit ihres Auftretens ergibt. Dies könnte durch eine höhere oder niedrigere Grundgereiztheit der Zellen repräsentiert sein. Die Grundgereiztheit des Neurons für Erdbeben ist z.B. höher, wenn unser künstliches Wesen in San Francisco wohnt, als in Österreich. Dieser Erwartungs-Grundreiz kann auch in einer Frequenz schwanken. Zum Beispiel erwarte ich zu jeder vollen Stunde die Glocke der Kirchturmuhr. Dazu brauche ich kein Vorankündigungssignal von einem anderen Reiz. Die Zeit gibt den Impuls. Damit Neuronen ihren Erwartungsgrundreiz schwanken lassen können, müssen sie an einer inneren Uhr teilhaben oder selbst Zeit speichern, zum Beispiel indem sie Reizlängen aufnehmen wie ein Kondensator den Strom. Eine Speicherung von Zeit ist eigentlich für jede zeitliche Voraussage notwendig. Es gibt mehrere Möglichkeiten Zeit zu verarbeiten. Aus meiner Sicht liefern a ber bestimmte Fähigkeiten und Schwächen des Menschen, was seine Zeiteinschätzung betrifft, ein klares Bild davon, wie das Gehirn Zeit verarbeitet, bzw. wie nicht. Auch der Aufbau des Gehirns liefert einen Hinweis. Ich will im Folgenden darauf näher eingehen. 118 3.5.3 Das Uhr-Modell Es ergibt sich die Frage, ob es im Gehirn eine Uhr gibt, die für die allgemeine Verarbeitung zeitgebundener Information zuständig ist. Es scheint, als wäre dies nicht der Fall. Zwar ist bekannt, dass der Hirnstamm, den Schlafrhythmus, de n Nahrungsrhythmus, sowie den sexuellen Rhythmus regelt (Kolb, Wishaw 1996, S.41), aber dieses genetische Programm hat wohl wenig mit der Verarbeitung zeitgebundener Information, wie der Musik zu tun. Eine Uhr besteht aus einem Pendel und einer Zähleinheit, die eine genormte Zeitspanne abzählt. Es gibt keinen Hinweis auf eine Zeiteinheit im G ehirn. Weiters gibt es keinen Hinweis auf einen Zählbeginn. Wo und wann sollte die Uhr zu zählen beginnen? Gegen eine Uhr spricht auch, dass wir Zeiträume mit zunehmender Länge immer ungenauer erfassen. Wir erinnern uns an Feste, von denen wir nicht einmal mehr das Jahr angeben können, andererseits kann ein Schlagzeuger eine Genauigkeit des Taktes erfassen, der ihm sogar ermöglicht ein gutes und ein schlechte Metronom zu unterscheiden, obwohl die Fehler bei diesen Geräten im Bereich unter tausendstel Sekunden liegen. Zeitlängen mit zunehmender Präzision zu erfassen umso kleiner sie sind, käme einer logarithmischen Skala gleich. So könnte man Zeitlängen als Teil eines Ja hres erfassen, wobei man nur folgende Teile verwendet: 1, ½, 1/3, ¼, 1/6, 1/8, 1/12, 1/16, 1/24, 1/32, 1/48, 1/64, 1/96, 1/128, 1/192, 1/256, 1/512, 1/768, 1/1024… Setzen wir diese Serie 64 Schritte fort, so kommen wir auf ein 6442450944-tel des Jahres, das ist etwa eine 500stel Sekunde. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass jede Zelle über einen 64 Bit Speicher verfügt, um Zeit zu erfassen. Eine Uhr bildet Zeit in Form einer linearen Skala ab, die einen fixen Startpunkt (Christus Geburt) kennt. Wenn das Ziel des Gehirns letztlich darin besteht Zeitlängen durch eine logarithmische Skala zu erfassen, muss es einen direkteren Weg geben, als erst Ereignisse mit Uhrzeit zu versehen, und dann die Abstände umzurechnen. Es wurde auch noch kein Ort im Gehirn gefunden, der einer solchen Umrechnung für alle zeitlichen Ereignisse dienen könnte. Weiters sprechen die starken Schwankungen des subjektiven Zeitempfindens gegen eine Uhr im Kopf. Wenn wir im Krankenhaus liegen und unter Langeweile und Schmerzen auf den Besuch warten, dauert eine Stunde wesentlich länger, als bei guter Stimmung auf einer Party. 3.5.4 Das Pendel-Modell Wenn es schon keine ganze Uhr im Kopf gibt, weil kein absolutes Zeitmaß festgelegt werden kann, so ergibt sich die Frage, ob nicht vielleicht jedes einzelne Neuron seine eigene innere Frequenz darstellen kann. Die Fourieranalyse von Tönen zeigt, dass jedes beliebige Geräusch aus einer Summe verschiedener übereinandergelagerter Sinuskurven dargestellt werden 119 kann, also als Frequenzspektrum (Goldstein 1997, S.201). Auch die Rezeptoren im Ohr liefern an das Gehirn die Töne in einzelne Frequenzen zerlegt. Man hat auch schon versucht, die Fourieranalyse auf die Codierung von Bildern anzuwenden (Fergus u.a. 1987). Allerdings stellt sich die Frage, wozu das gut sein soll. Tatsächlich erhält das Gehirn die Klanginformtionen vom Ohr in Frequenzen zerlegt (Müsseler, Prinz 2002). Aber es würde auch im auditiven System nirgends hin führen, bei dieser Art der Verarbeitung zu bleiben. An Stelle eines Kanals müsste es nun eine Vielzahl von Kanälen abspeichern. Ein Musikstück zerfällt für unsere Ohren in einzelne Instrumente. Die Wellen des Frequenzspektrums sind aber durchaus nicht einzelnen Instrumenten zuzuordnen, denn jedes Instrument beinhaltet eine ganze Palette von Wellen (Möckel u.a. 1995), die sich mit denen anderer Instrumente decken. Wie sollte die zersplitterte Information wieder in die einzelnen Instrumente getrennt werden? Das Gehirn muss also die Fr equenzen, die im Ohr getrennt vorliegen, auf höherer Ebene auch wieder zueinander bringen, um sie zum Beispiel einem Instrument zuzuordnen. Noch ein weiterer Hinweis spricht dafür, dass die Frequenzanalyse nur eine Funktion der Rezeptoren des Ohres ist, nicht ein Verarbeitungsmechanismus des Gehirns. Sinuswellen, die nur einen Halbton auseinanderliegen, erscheinen als disharmonisch. Überlagern wir hingegen Frequenzen, die jedes zweite oder dritte mal gemeinsam schwingen, so entsteht eine Harmonie. Im Fall einer Frequenzanalyse müsste sich der Halbton genauso leicht darstellen und abspeichern lassen, wie die Harmonie, denn beides besteht nur aus zwei Wellenlängen. Für das Gehirn sieht das anders aus. Es verarbeitet die Sache wohl so ähnlich wie die folgenden zwei Muster. Das „harmonische“ Muster hat den kleineren Rapport. Das ist entscheidend für die leichte Abspeicherung und Fortsetzung (WSA 2001.04.23). Disharmonie Harmonie Das bedeutet, das Gehirn will nicht mehrere Wellenlängen parallel denken, sondern es will den Gesamteindruck zu einer Sache vereinen. Dass in höheren Arealen des Hörsystems Zellen auf bestimmte Periodizitäten ansprechen kann als Beweis für dieses Modell gesehen werden (Langer 1998). Das passt auch gut zum genannten Ziel des Gehirns, denn wenn dieses darin besteht, die wahrscheinlichst e Zukunft vorauszuahnen, dann ist damit eine Zukunft, und nicht mehrere parallele Zukünfte 120 gemeint. Natürlich laufen in der Welt immer viele Ereignisse parallel ab, aber wir müssen deren Zusammenspiel kennen, um zu wissen, wie wir handeln sollen. Wir dürfen sie nicht als dauerhaft getrennt betrachten, denn unsere Handlungen sollen an die wahrscheinlichste der möglichen Zukünfte ausgerichtet werden. Ich behandle die Problematik der Frequenzanalsyse hier unter der Überschrift Pendel-Modell. Die Art der Zeitverarbeitung, die ich als „Pendel-Modell“ bezeichne ist ident mit der Idee, Frequenzen als Zeitmessfaktor zu verwenden. Gegen das Pendel-Modell spricht die Begrenztheit der Gültigkeit von Pendeln oder Frequenzen. In der Welt treten viele Dinge in serieller Regelmäßigkeit auf. Zum Beispiel beginnt ein Hund zu bellen, und es lässt sich voraussagen, dass er noch eine Weile weiterbellt. Aber dann hört er auf, und das Pendel im Gehirn produziert einen Voraussagefehler nach dem anderen. Nach einigen solchen Fehlern würde die Voraussage wieder verlernt, und die gesamte Erfahrung gelöscht. Noch etwas spricht gegen das Pendel-Modell. Was sollte denn diesem Modell zufolge abgespeichert werden, wenn nicht die Pendel-Frequenz? Diese müsste äußerst exakt abgespeichert werden, denn eine geringfügig andere Frequenz würde im Zusammenspiel mit den gleichzeitig ablaufenden restlichen Frequenzen, die abgespeichert werden, nicht mehr übereinstimmen. Die Erfahrung zeigt, dass wir keine exakten Wiederholfrequenzen abspeichern. So ist es zum Beispiel sehr schwierig, das Tempo eines Musikstückes absolut zu erinnern. Viel leichter ist es hingegen, das Tempo, das der Dirigent einzählt, fortzusetzen. Genauso verhält es sich mit Frequenzen. Wir können eine bekannte Melodie relativ zu einem vorgegebenen Ton fortsetzen, aber nur wenige können die Melodie immer in der gleichen Höhe anstimmen, haben also ein absolutes Gehör (WSA 2002.02.21). Durch das Pendel-Modell ist dieses Phänomen nicht zu erklären. Würden Ereignisse in Form von überlagernden Frequenzen (Pendellängen) abgespeichert, so müssten diese Längen exakt vermerkt werden, sonst hat ihre Überlag erung nichts mehr mit dem ursprünglichen Ereignis gemein. 3.5.5 Das Sanduhr-Modell Anders als das Pendel, erfasst die Sanduhr eine Zeitlänge, nicht eine Frequenz. Die Sanduhr startet nach ihrem Ablaufen also nicht automatisch mit dem nächsten Durchgang. Es wird nicht erwartet, dass der Hund in unserem obigen Beispiel ewig weiterbellt. Auch muss die Sanduhr durch irgendetwas gestartet werden. Das kann ein anderes Ereignis sein. Wir erleben die Welt als eine Verkettung von Ereignissen, die einander auslösen. Eine Sanduhr funktioniert nach dem Prinzip des Füllens und Umfüllens. Das ist ein Prinzip, das auch für Neuronen vorstellbar ist. In der Elek tronik könnten Kondensatorähnliche Bauteile diese Aufgabe übernehmen. Die Füllmenge der Sanduhr muss nicht vorgegeben sein, sondern könnte von einem davor 121 ablaufenden Ereignis übertragen werden. Das würde erklären, wie wir es vermögen, den Takt fortzusetzen, den der Dirigent vorgibt. Abgespeichert würden dann nicht direkt die Füllmengen, sondern Relationen bzw. Differenzen von Füllmengen. Es würde durch Verbindungen festgelegt, welche Ereignisse miteinander in Bezug stehen und eine Zusatzinformation, die „Füllmenge“ würde die Zeitlängen der Ereignisse relativ zueinander beschreiben. Wenn wir nun erkannt haben, dass Füllmengen ausreichen, um Zeit zu repräsentieren, dann ist auch klar, dass wir als Zeiteinheit etwas brauchen, das wir als Füllstoff verwenden können, wie die Sandkörner der Sanduhr. Wenn wir diese Idee auf das Gehirn umlegen, so ist es das Signal des Neurons, das als Füllei nheit dienen kann. Ist ein Neuron für eine gewisse Zeitspanne aktiv, so sendet es innerhalb dieser Zeit eine Anzahl an Impulsen. Sie sind die Füllmenge, die die Zeit repräsentiert, in der das Neuron aktiv war. Tatsächlich gibt es aus der Neurophysiologie einen klaren Hinweis auf dieses Prinzip. Bei der Erforschung der neuronalen Reaktionen im auditiven System, ist man darauf gestossen, dass oft die Zeiteinheit von 0,4 ms auftritt, bzw. deren Vielfache. 0,4 ms ist die maximale Impusrate der Neuronen (Bleeck 1996). Nun ergibt sich noch die Frage, wie das Gehirn dann Frequenzen verarbeiten kann, die weit schneller schwingen als dieses Maß. Zur Beantwortung dieser Frage will ich an das Frequenzspektrum erinnern, in das der Schall bereits im Ohr zerlegt wird. Die Tonale Anwendung wird bis auf die Hirnrinde übertragen. Klang präsentiert sich dort also als Klangbild (Ehret 1997, Seifert 2002, S.40). Die Maximale Verarbeitungsrate dieser Klangbilder ist 0,4 ms. Die Bildinformation lässt aber erkennen, welche hohen Frequenzen vorliegen. 3.5.6 Das Reihenfolge-Modell Das Sanduhr-Modell hat uns darauf gebracht, die Zeitlänge eines Signals als Menge an Impulsen zu definieren, die eine Zelle in dieser Zeit sendet. Woran erkennen wir nun, dass diese Zeitlänge zu Ende ist? Die Zelle sendet irgen dwann nicht mehr. Irgendwann wird sie wieder senden. Woran erkennen wir die Lücke dazwischen? Bei der Verarbeitung visueller Reize, haben wir uns der „Antizellen“ bedient, die immer negativ zu einer Zelle arbeiten. Das heißt sie senden dann, wenn die Zelle pausiert. Wenn wir dort solche Zellen angenommen haben, warum dann nicht auch hier. Die Aktivität der Antizelle repräsentierte dann die Lücke. Ein Rhythmus von Impulsen stellt sich dann als Folge von Signalen und Lücken dar. Zeitlich Nahes wird bekanntlich eher verbunden, als Entferntes. Also werden auf unterster Ebene erst einmal Verbindungen zwischen benachbarten Impulsen entstehen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die Folge 1,0, und die Folge 1,1 sowie jeweils deren Negativ (Antizellenreaktion). Die Folge 1,1 spricht natürlich auch während längerer Signale ständig an. So spricht sie auf vier Impulse zweimal an. Das bedeutet, im Gehirn sollten auch 122 selbstproduzierte Periodizitäten auftreten, die nicht direkt den akustischen Reizen entspechen, sondern die sich aus der maximalen Impusfrequenz erklären. Genau solche wurden gemessen (Langer 1998). Nun ergibt sich noch die Frage, ob die beiden Einser der Folge 1,1 von der selben Zelle repräsentiert werden, oder von zweien. Grundsätzlich gilt im Gehirn durchaus die Regel, dass ein gleichartiger Stimulus wieder von der selben Zelle repräsentiert wird. Ein Beispiel sind die Balkendetektoren im Sehsystem. Allerdings scheint auch die Regel zu gelten, dass eine Zelle, die gerade erst aktiv war, eine kurze Pause benötigt (Coolspot), bis sie wieder aktiv werden kann (Ehret 1997). Diese Regel haben wir auch benützt, um das Vorwärtsfließen der Kämmsignale zu erklären. Außerdem sind wir davon ausgegangen, dass wenn ein Reiz nicht aufgenommen werden kann, eine neue Verbindung entsteht. Aus all dem ergibt sich folgendes: Der erste Impuls 1 wird von der nächstgelegenen Zelle aufgenommen, die in Zukunft diese 1 repräsentiert. Die zweite 1 kann sie nicht aufnehmen, weil sie eine Pause braucht. Also wird eine weitere Verbindung zu einer Nachbarzelle gegründet. Hält das Signal noch länger an, so ist die erste Zelle wieder aufnahmebereit. Abgesehen davon könnten die 1er Zellen auch zueinander eine Voraussageverbindung aufbauen, weil sie ja oft nacheinander aktiviert sind. Der Widerstand dieser Voraussageverbindung würde die Durchschnittstonlänge repräsentieren. Zu einer solchen Voraussageverbindung könnte sich auch eine eigene Chunkzelle ausbilden, die dann die Folge 1,1 repräsentiert. Des weiteren könnte eine übergeordnete Einheit die zweimal hintereinander eintretende Aktivierung dieser Zelle erfassen. Sie erfasst dann die Signallänge 1,1,1,1. Es sind auch übergeordnete Einheiten vorstellbar, die 8, 16, 32 und mehr Impulse erfassen. Das bedeutet, es würden Neuronenverbände entstehen, die sozusagen zählen können. Tatsächlich sind zählende Neuronen im Hörsystem entdeckt worden, wenngleic h als Versuchstier der Frosch diente (Standard 2002.09.02). Am Affen hat Neuronen für das Zählen von Objekten entdeckt (WSA 2002.09.11). Das bedeutet, eine einzelne Zelle braucht nicht die Fähigkeit besitzen, eine bestimmte Füllmenge an Signalen zu repräsentieren. Eigentlich hat das hier dargestellte System gar keine neuen Fähigkeiten verlangt. Allein die Erholpause der Zelle hat zur Zeiterfassung geführt. Interessant ist auch, dass automatisch eine logarithmische Skala (2, 4, 8, 16, 32…) entstand. Zeit wird also mit zunehmender Länge immer gröber erfasst. Dies entspricht unserem Denken. Was in der räumlichen Verarbeitung die Verbindung ist, ist in der zeitlichen Verarbeitung die Folge bzw. Reihenfolge. Es wird sich zeigen, dass die statistischen Regeln zur Verbindungsfindung und jene zur Speicherung von Folgen viele Parallelen aufweisen. Folgen werden, so wie Verbindungen, sich nur dann dauerhaft im Gehirn verankern können, wenn sie wiederholt auftreten, also öfter bestätigt, als widerlegt werden. Nehmen wir an, das Bellen eines Hundes stellt sich als Folge von Reizen und Lücken dar. Es erfolgen einige Wiederholungen. Dann erfolgt eine längere Lücke, bis zum nächsten Tag, wenn wir den Hund wieder bellen hören. Die längere Lücke wird aber nicht die wiederholt aufgetretenen kurzen 123 Lücken überschreiben, denn sie tritt nur einmal auf, und hat daher weniger Kraft. Anders als beim Pendel-Modell, kann also im Reihenfolge-Modell die Erfahrung im Gehirn durchaus dauerhaft abgespeichert werden. 3.5.7 Wann, und womit beginnt die Zeiterfassung? Sicher ist, dass auch im Rahmen der Zeiterfassung Verbindungen (Folgen) so lange aufgelöst und durch neue überschrieben werden, so lange sie eine zu geringe Wiederholungsrate besitzen. Das heißt, Voraussagen, die öfter widerlegt we rden als bestätigt, zerfallen. Aber gibt es denn Ereignisse (Folgen), die diesen harten Regeln zufolge überhaupt bestehen bleiben können? Welche Folgen könnten das sein? Welche Informationen machen den Anfang? Um diese Frage zu beantworten, will ich anhand eines kurzen Rückblicks auf das Modell der visuellen Verarbeitung, eine allgemeine Theorie des Erkenntnise rwerbs entwickeln, die wir dann auch auf die Zeitverarbeitung übertragen kö nnen. Es scheint so, als lernten Kinder zuerst die Überbegriffe, bevor sie feiner zu differenzieren vermögen. Das bedeutet, wenn sie einmal ein vierbeiniges Tier gesehen haben, erkennen sie das nächste wieder als vierbeiniges Tier. Erst später lernen sie Hund, Katze und Hase zu unterscheiden. In der Kinderzeichnung fand ich ein ideales Beispiel, um zu zeigen, dass das Allgemeine wirklich den Anfang bildet. So könnte man behaupten, in den folgenden Zeichnungen sei erst einmal das Ding, dann der Mensch, dann die Geschlechterdifferenz, dann der Erwachsene Mann und die Frau, und schließlich zwei bestimmte Personen dargestellt. Die Kinderzeichnung schreitet also in ihrer Entwicklung vom Allgemeinen zum Differenzierten. (Aus Fleisch 1988, S.13). Das Kind entwickelt zuerst recht allgemeine Formen, die es in vielen Dingen wiederfindet, wie den Kreis, den Strich, das Quadrat und das Dreieck (Edelmann 1998). Komplexe Formen, wie die mit 12 Jahren gezeichneten Fig uren, setzt es aus den bereits bekannten Formen zusammen. 124 Dass das Wahrnehmungslernen ebenfalls diesen Verlauf nimmt, kann man an bestimmten Beispielen auch noch als Erwachsener erfahren. Wenn nach China übersiedeln, lernen wir die asiatischen Gesichtszüge besser differenzieren. Wenn uns Autos interessieren, lernen wir die Marken besser unterscheiden. Wahrne hmen lernen heißt also differenzieren lernen. Ich nehme an, Differenzieren beruht im auditiven System, genauso wie im visuellen, auf dem Prinzip, dass Voraussagefehler, an übergeordnete Einheiten weitergegeben werden. Sobald die übergeordneten Einheiten lernen, den unvoraussagbaren Rest vorauszusagen, wird die Wahrnehmung konkreter. Das Differenzierungsvermögen steigt. So können wir z.B. lernen zwischen dem rhythmischen Rauschen der Brandung, dem Brasseln des Regens, oder dem pfeifenden Rauschen des Windes im Wald zu unterscheiden. Diffuse Eindrücke, wie Rauschen, zeichnen sich ja generell dadurch aus, dass sie Bereiche darstellen, in denen viele erkennende Einheiten ansprechen, aber alle nur in geringem Ausmaß, ohne regelmäßige Wiederholung. Auch aus der neurophysiologische Erforschung des visuellen Systems kann man erkennen, dass Wahrnehmung vom allgemeinen zum Differenzierten voranschreitet. Die ersten Ebenen, die sich im visuellen System verschalten, dienen der Trennung der Seheindrücke in ganz allgemeine Eigenschaften, in die jeder Seheindruck zerlegt werden kann, wie Farbe, Größe, Bewegung (Hubel 1989) und Flächengliederung. Was einmal gespeichert ist, muss nicht noch einmal gespeichert werden, und ist einmal alles Wiederholte und Allgemeine erfasst, so ist damit ein Rahmen geschaffen, in dem sich auch weniger oft wiederholte, also konkretere Dinge im Gehirn halten können. Sie fußen auf den allgemeinen Eigenschaften, und stellen spezielle Kombinationen solcher dar. 125 Die genannten Eigenschaften entsprechen den Begriffen, die wir verwenden, um Seheindrücke sprachlich zu schildern. Deshalb ist anzunehmen, dass sich auch in den untersten Stufen des auditiven Areals Repräsentationen von Eigenschaften finden, mit denen wir Höreindrücke beschreiben. Solche Eigenschaften sind Lautstärke, Tonhöhe (was dem Rapport in Klangwellen entspricht), Tonlänge, Klangfarbe. Mit dem letzten Begriff geht es Analytikern so ähnlich wie mit dem Begriff „Form“ im visuellen Bereich. Er ist unkonkret. Immerhin gibt es die Begriffe hell-dumpf, harmonisch-unharmonisch. 3.5.8 Wie unterscheiden wir Lautstärke und Tempo? Was die Lautstärke einer auditiven Wahrnehmung betrifft, so ist es wohl die Impulsdichte der Rezeptoren, die diese kennzeichnet. Aber wie unterscheiden wir dieses Impulsdichte von der Frequenz? Dies können wir bei hohen Tönen durch die spezifische Reaktion der Hörrezeptoren des Ohres auf einzelne Frequenzbereiche erklären. Tatsächlich ist dieser spezifische Reaktionsbereich bei tieferen T önen nicht mehr gegeben (Bleeck 1996). So stellt sich die Frage dort von neuem: Wie unterscheiden wir eine Serie von Einzelreizen von einem durchgehenden schwachen Reiz? Die Lösung liegt vermutlich in der Antizelle. Sie ist aktiv, wenn nichts zu hören ist, und gehemmt wenn die Zelle, mit der sie verbunden ist, arbeitet. Leise Töne mögen einen Sinnesrezeptor nur zu einer sehr geringen Impulsrate anregen, aber seine Antizelle reagiert gar nicht, während sie zwischen einzelnen lauten Tönen in der selben Impulsrate „Antiimpulse“ sendet, um die Lücken zu kennzeichnen. (In einer elektronisch erfassten Tonkurve ist Stille, wo keine Amplitude herrscht. Zwar wandert die Welle ständig auch durch den Nullpunkt, aber dieser genaugenommen unendlich kurze Zeitraum gilt nicht als Lücke.) Die Antizelle ist nicht so umfangreich verschalten wie die Zelle, denn Lücken zeichnen sich gegenüber Reizen darin aus, dass sie nur eine einzige Eigenschaft besitzen. Das ist ihre zeitliche Länge. Es gibt keine halben Lücken, denn so lange ein Reiz noch hörbar ist, ist es ein Reiz. Auch hat die Antizelle keine direkte Verbindung zu den Sinnen, sondern wird nur über jene Zelle aktiv, deren ausbleibende Reaktion sie signalisiert. Sie kann aber mit jeder anderen Zelle ganz normal eine Voraussageverbindung eingehen. Was das Erkennen betrifft, so stellt eine andere Lautstärke oder ein anderes Tempo für unser derzeit konzipiertes System ein Problem dar, das anhand einer Musikaufnahme leicht zu beschreiben ist. Stellen wir uns vor, wir spielen die Aufnahme lauter ab. Die Rezeptoren unseres auditiven Systems werden stärker ansprechen, und in der gleichen Zeit mehr Impulse liefern. Nun stellen wir uns vor, wir drehen nicht nur die Lautstärke zurück, sondern reduzieren elektronisch auch die Geschwindigkeit. Die Rezeptoren pulsen nun seltener, weil leiser, aber dafür 126 sind die Töne auch länger geworden, so dass im Endeffekt die gleiche Anzahl an Impulsen bei gleich langen Tönen entsteht. Das einzige, woran unser System erkennen kann, dass sich etwas verändert hat, ist die Reaktion der Antizellen. Diese reagieren nicht auf Lautstärke, denn Reizlücken haben keine Lautstärke. Sie pulsieren noch mit ihrer üblichen Frequenz. So sind es möglicherweise die Lücken, die die Zeit in das System bringen. Kein Wu nder also, dass für unser subjektives Empfinden die Zeit in einer reizarmen Umgebung langsamer fließt. Wie erkennen wir eigentlich Melodien, wenn sie in einer anderen Höhe abgespielt werden? Dann sind alle Frequenzen zeitlich verändert. Meine erste Idee dazu, bestand in der Vermutung, dass wir nicht Zeiten und Zeitdifferenzen erfassen, sondern Zeitrelationen. Doch müsste auch diesen eine Zeitmessung zugrunde liegen, denn wovon sollte die Relation gebildet werden. Das Problem mit den Relationen bestünde aber darin, dass wir auf diese Weise überhaupt keine Zeiterinnerung hätten. So ist das ja nicht. Wir stimmen ein Lied durchaus in einem passenden Tempo an. Unserer Zeiterinnerung fehlt es lediglich an Exaktheit. Es gibt noch einen triftigeren Grund, der gegen eine rein relationale Erfassung von Zeit spricht. Anscheinend ist für jedes Baby ein absolutes Hörvermögen erlernbar (WSA 2002.02.21). Also steht die absolute Zeiterfassung am Anfang, und wird verlernt, weil etwas anderes gebraucht wird. Mein zweiter Lösungsversuch lehnte sich an das Phänomen der Adaption an. Unsere Sinnesorgane adaptieren an Reizstärken, so dass sie immer ein möglichst optimales Ergebnis liefern. Warum sollte unser erkennendes System nicht auch zeitlich adaptieren. Wenn ein Musikstück langsamer gespielt wird, bräuchte das Gehirn lediglich die maximale Impulsrate der Neuronen etwas zu reduzieren, und die Zeitwahrnehmung würde wieder zum selben Ergebnis kommen, wie bei der schneller gespielten Version. Der neueste, dritte Lösungsversuch besteht darin, zu zeigen, dass wir gar keine eigene Lösung brauchen. Die findet das System von selbst. In der Umwelt kommen Reize nämlich sehr oft in verschiedenen Tempi vor. Oft beschleunigt etwas seine Bewegung, Töne werden höher abgespielt, oder Rhythmen beschleunigen sich. Dabei macht das Gehirn die Erfahrung, dass ähnliche Zeitmuster oft in beschleunigter oder verlangsamter Form aufeinanderfolgen. Zwischen den langsamen und schnelleren Mustern werden sich also ganz automatisch Verbindungen entwickeln, da Aufeinanderfolgendes verbunden wird. Die Verbindungen werden auf unterster Stufe der Verarbeitung entstehen. Dort befinden sich die Teile, aus denen sich alles Höhere zusammensetzt. Wenn dort die Erfahrung gemacht wird, dass eine Gruppe von kürzeren Teilen mit einer Gruppe von längeren Teilen auf proportionale Weise verbunden werden kann, so ist für alle höheren Einheiten der Wiedererkennungsprozesse gelöst. Wir erkennen dann Musikstücke auch, wenn sie in einer anderen Höhe und Geschwindigkeit abgespielt werden, wir verlieren das absolute Gehör. Da dann in den höheren Einheiten keine 127 Voraussagefehler mehr entstehen, weil Erkennen geleistet wird, kommt es dort auch zu keinen weiteren unnötigen Verbindungen. Eine Verbindungsflut bleibt aus. In diesem Modell werden Zeitlängen durch verschiedene Neuronen verkörpert. Es gibt keine einheitliche Uhr. Dieses Konzept hat sich auch ein neues neuronales Modell zur Spracherkennung zueigen gemacht. Mit Erfolg! Es erkennt durch die flexible Zeiterfassung Sprache so gut wie der Mensch (Spektrum-Ticker 1999.10.04). 3.5.9 Die Ordnung auditiver Verbindungen durch das Prinzip der Blockierung Wenn wir eine Reizlänge wirklich an der Anzahl der aufeinandergefolgten Impu lse erkennen sollten, und sich große Zeitlängen aus kleineren bereits bekannten Zeitlängen zusammenaddieren lassen, dann stehen wir vor dem Problem, dass sich eine große Zeiteinheit auf viele verschiedene Arten aus kleineren zusammensetzen ließe. Stellen sie sich vor, aus wie vielen verschiedenen kleineren Zahlen zum Beispiel eine 8 zusammengesetzt werden kann. Aus 5+3, aus 4+4, aus 6+2, aus 4+2+2 usw. Wie viele Möglichkeiten gibt es dann erst bei wirklich großen Za hlen! Wenn jede dieser Möglichkeiten auch umgesetzt wird, so könnten in diesem Spiel alle Neuronen und Verbindungen des Gehirns verbraucht werden, denn die Zahlenreihe ist unendlich. Was also begrenzt diesen Prozess? Ist zum Beispiel die Folge 11 vorhanden, und es folgt ein längerer Reiz, z.B. 11111111, dann ist dieser nicht in einem Lernschritt zur Gänze erfassbar, weil ja ein Neuron in diesem Modell immer nur eine Folge aus zwei nacheinander erscheinenden Inputs aufnehmen kann. Es wird also zuerst die zweimal nacheinander erfolgte Aktivierung der 11 an eine neue Chunkzelle weitergeg eben (also 1111) und eine Stufe höher wird deren Wiederholung repräsentiert (also 11111111). Dass zwischen der wiederholten Aktivierung der Zellen höherer Verarbeitungsebenen ein größerer zeitlicher Abstand liegt, als bei Zellen der unteren Ebenen ist irrelevant. Eine Zelle spricht in diesem Modell auf die Reihenfolge an, nicht auf die Zeit. Andernfalls stünden wir ja wieder am Anfang unserer Überlegungen, weil dann die Zelle eine innere Uhr bräuchte. Wir haben beschlossen, dass sich die Zeit in diesem Modell indirekt abbildet. Wichtig ist hier nur folgende Feststellung: Jede andere Form, eine Folge von 8 Reizen darzustellen, z.B. 2+3+3, hätte mehr als zwei Lernschritte benötigt. So kommt die Verschaltungshierarchie 248 allen anderen zuvor, weil sie schneller erlernt wird. Sie stellt den schnellsten Weg dar, die hohen Zahlen zu erobern. Wenn zum Beispiel die 8er-Serie einmal erlernt ist, und erkannt werden kann, so nehmen diese Neuronen die ankommenden Signale auf. Die Signale gelangen zu keinen anderen Neuronen mehr. Deshalb bilden sich auch keine anderen Verbindungen mehr aus. Das Prinzip besteht also darin, dass der Verbindungszuwachs dadurch begrenzt wird, dass bereits vorhandene Verbindungen die Reize aufnehmen. Damit ist eine Voraussage gelungen, und so werden weitere Lernvorgänge blockiert. Das Prinzip der Blockierung ist durch eine Unzahl an Konditionierungsexperimenten nachgewiesen (Zimbardo 1995, S.308, Macho 1999, Mischo 2002). 128 Warum aber wird die Erfassung von Mengen und Zeiten mit deren Länge unexakter? Wie kommt es zu dem Eindruck einer logarithmischen Skala? Die Antwort darauf sollte nun nicht mehr schwer fallen. Wenn sich manche große Zahlen, wie 8, 16, 32, 64 durch sehr wenige Lernschritte erfassen lassen, so werden sie sich zuerst ausbilden, denn sie werden immer auch dann mitaktiviert, wenn eine noch größere Menge auftritt. Solange diese grobe Erfassung genügt, erfolgen keine ausreichend starken Voraussagefehler um weitere Lernvorgänge auszulösen. Aber was soll das heißen, „keine ausreichend starken Voraussagefehler“? Die Antwort darauf werden wir im Zusammenhang mit der Lenkung der Aufmerksamkeit kennen lernen. Die Aufmerksamkeit wird immer dem stärksten Voraussag efehler zugewandt (wenn nicht gerade etwas trieblich relevantes das System beschäftigt) (Sperling 1998). Dinge sind so lange „genügend“ erfasst, um nicht weiter verarb eitet zu werden, solange es stärkere Anziehungspunkte für die Aufmerksamkeit gibt, deren Verarbeitung im Moment Vorrang hat. Einen Hinweis auf die bevorzugte Strukturierung von Zeiträumen durch das Prinzip der Verdopplung (2, 4, 8, 16) liefert die Musik. Wir können in den Takt eines Metronoms auch einen halb so langsamen Takt hineinhören. Jeder zweite oder vierte Schlag klingt dann für uns irgendwie anders (Holler 1996, S. 290). Das ist wahrscheinlich deshalb so, weil eben jeder zweite Schlag von einer übergeordneteren Zelle erfasst wird. Um Voraussagefehler dem jeweils stärksten Reiz zuwenden zu können, müssen diese moduliert signalisiert werden, also schwächer oder stärker, je nach Entsprechung. Nur so ist eine Aufmerksamkeitslenkung zum stärksten Voraussagefehler hin vorstellbar. So darf zum Beispiel ein langes Ereignis, das durch einen extrem kurzen Aussetzer unterbrochen wird, nicht sofort in zwei Ereignisse zerfallen, es soll weiterhin als langes Ereignis erkannt werden. In der Palette möglicher Repräsentationen siegt dann jene, die am stärksten anspricht. Wenn die Unterbrechung zu lange anhält, erkennen wir zwei getrennte Ereignisse, wenn sie kurz ist, betrachten wir es als ein Ereignis mit einer Störung. 3.5.10 Wie werden Reizverläufe erfasst? Reize treten nicht immer schlagartig ein, dauern an, und enden dann schlagartig, sondern es kommt oft zu fließenden Übergängen. Nehmen wir zum Beispiel das Geräusch eines herannahenden Autos. Es fährt vorbei und verschwindet wieder. Wie kann ein solcher Verlauf als ein einziger Reiz erkannt werden? Die Lösung für dieses Problem habe ich mir vom visuellen System abgeschaut. Wie erkennen wir Grauverläufe? Ganz einfach. Wir vergleichen benachbarte Bildpunkte und erfassen deren Unterschied. Nehmen wir an, die folgende Graf ik stellt einen auf und abschwellenden Sirenenton dar. Ich überblende nun das Verlaufsmuster mit seiner negativen Kopie. Die Bilder werden einander aufheben, so dass Grau 129 entsteht. Nun verschiebe ich die Kopie um ein wenig, so dass zeitlich benachbarte Einheiten übereinander zu liegen kommen. Das Ergebnis ist darunter abgebildet. Die Verläufe stellen sich nun als durchgehende helle und dunkle Flächen dar. Je stärker der Verlauf, desto mehr wird sich die Tönung vom Durchschnittsgrau entfernen. Je nach Verlaufsrichtung (abnehmende oder zunehmende Amplitude) wird in der Überblendung ein heller, oder ein dunkler Grauton entstehen. Der Grauton kennzeichnet also die Verlaufsstärke, und die Verlaufsrichtung. Dadurch, dass der Verlauf auf dieser Verarbeitungsebene eine durchgehende Reizstärke (Grauton) erhält, kann er im Weiteren als ein einheitlicher Reiz verarbeitet werden. Auf die Zeit umgelegt bedeutet das, dass auf dieser Verarbeitungsebene ein zeitlich anhaltendes Signal entsteht, dessen Länge und Stärke den Verlauf darstellt. Ich bin überzeugt, dass man im Hörsystem einmal Neuronen entdecken wird, die auf Verläufe ansprechen, weil es sich um eine elementare Eigenschaft von Klängen handelt. 3.5.11 Was gilt mehr, Nähe oder Ähnlichkeit? Konditionierungsexperimente zeigen nicht nur, dass Nahes eher in Verbindung gebracht wird als Entferntes, sondern auch dass Ähnliches eher verbunden wird als Unähnliches. In einem neuronalen Netz ist ein Reiz im elementarsten Fall einfach ein gereiztes Neuron. Ähnlichkeit wäre damit nur durch die Reizintensität darstellbar. Aber was ist Intensität anderes als Impulse pro Zeiteinheit? (In einem elektrischen System sind es Elektronen pro Zeit). Die Frage reduziert sich also auf jene: Was soll eher verbunden werden, etwas, das eine ähnliche Signalhäufigkeit besitzt, oder etwas das zeitlich und räumlich nahe zueinander auftritt? Aber diese Frage stellt sich nicht, den die Signalhäufigkeit ist ja in unserem Sy stem schon immer mit einberechnet. Der bayesianischen Regel zufolge wird etwas nur dann eine starke Verbindung zueinander aufbauen, wenn es möglichst immer zusammen auftritt. Wenn Reiz A doppelt so häufig auftritt wie B, so kann die Verbindung gar nicht all zu stark sein. Signalhäufigkeit ist also aus statistischer Hinsicht gleichzusetzen mit Signalstärke. Diese hat Einfluss auf die Stärke einer Verbindung, während die Nähe von Signalen dafür entscheidend ist, ob ein Zusammenhang erkannt wird, ob also eine Verbindung überhaupt zustandekommt. Ist nämlich die Entfernung zu groß, so werden nähere Ereignisse der entfernteren Verbindung den Weg verstellen. Wenn Signalstärke und Signalhäufigkeit eigentlich ein und die selbe Sache sind, dann kann auch beides im Gehirn durch das gleiche neuronale Verhalten dargestellt 130 werden, nämlich durch die Impulsdichte. Nicht mit Reizstärken, sondern mit Impulsdichten zu arbeiten, hat einen Vorteil. Wenn ein Signal über viele Zellen hinweg weitergegeben wird, so könnte sich seine Signalstärke dabei leicht wandeln, wie die Kopie einer Kopie einer Kopie einer analogen Musikaufnahme. Wird Signalstärke hingegen durch Impulsdichte repräsentiert, so kann nichts passieren. Die Impulsanzahl bleibt gleich, egal wie oft sie kopiert wurde. Dass das Gehirn mit Impulsdichten arbeitet, ist bekannt (Hubel 1989, S.23). Aber die Impulsdichte hat auch einen Nachteil. Sie braucht Zeit. Deshalb muss das Gehirn alle schnellen Abläufe, wie die Unterscheidung von Schallfrequenzen, oder die Wahrnehmung von Bewegungskonturen eigenen Rezeptoren überlassen. Trotz dieser Überlegungen ist es natürlich immer noch praktischer, sich bei der Konzeption eines Hirnmodells, Signale als unterschiedlich stark vorzustellen, weil Impulsdichte kein so anschaulicher Bergriff ist. 3.5.12 Die Verarbeitung der zeitlich kodierten Signale im visuellen System Nach all diesen allgemeinen Überlegungen zur zeitlichen Verarbeitung können wir uns nun ein Bild davon machen, wie die zeitlich codierten Signale des visuellen Systems weiter verarbeitet werden. Wenn die visuellen Signale innerhalb der Objektflächen durch den „Abziehbildsignalfluss“ zusammengeflossen sind, entsteht, je nach Objektgröße, ein anhaltendes Signal unterschiedlicher Dauer. Der Ort an dem dieses Signal entsteht, ist das Objektzentrum. Es ist also irgendein Ort innerhalb der Bildfläche. An diesem Ort beginnt nun die Zeitverarbeitung. Das heißt, dass sich auf dieser Verarbeitungsebene Neuronen bilden werden, die auf Reizfolgen reagieren. Nun ergibt sich die Frage, warum, den Bayesianischen Regeln zufolge, nicht schon auf allen anderen Schichten des visuellen Systems zeitaktive Neuronen entstanden sind. Meine Antwort ist einfach: Solange ein Neuronen eine Verbindung zu einem gleichzeitig aktiven Nachbarneuron eingehen kann, wird es diese Verbindung vorziehen, denn Gleichzeitigkeit bedeutet maximale zeitliche Nähe. Es gilt ja, dass zeitlich Nahes eher verbunden wird, als zeitlich Entferntes. Aber zurück zu der Ebene, wo die zeitcodierten Signale ankommen. Vordringliche Aufgabe wird es nun sein, deren Länge, und damit die Objektgröße zu erfassen. Dazu wird sich eine Hierarchie an Reizfolgen entwickeln, wie wir sie weiter oben besprochen haben. Das heißt, Zweierserien werden sich zu Vierer, diese zu 16er Serien verbinden. In der zehnten Stufe kann somit ein Neuron entstehen, das bereits eine Reizlänge von 1024 Impulsen repräsentiert. Eine Gruppe aus 10 Neuronen ist also fähig eine breite Palette von Zeiteinheiten zu erkennen. Solche Gruppen werden sich überall auf der Ebene ausbilden, denn verschiedene visue lle Eindrücke werden zu immer neuen Objektzentren führen. Wenn nun ein zeitcodiertes Signal auf dieser Ebene ankommt, und sich in seinem Umfeld bereits ein Neuron befindet, das seine Reizlänge repräsentiert, und somit sein Signal aufzunehmen vermag, dann wird das Signal an dieses Neuron 131 weitergeben. Das bedeutet, dass sich in dieser Gegend kein zweites Neuron der selben Sorte ausbilden kann. Die Neuronengruppen treten also in eine räumliche Konkurrenz, bis jede einen Fleck für sich erobert hat. Auf einer übergeordneten Ebene können die zeitaktiven Neuronen ihrerseits Verbindungen zueinander aufbauen. Diese Verbindungen repräsentieren den Abstand der erkannten Objektflächen oder Konturlängen zueinander. Auch dieser Abstand wird sich nicht durch dauerhafte Verbindungen darstellen lassen, weil er, genau wie die Objektformen, durch ständig neue Wahrnehmungen überschrieben wird. Aber der Abstand kann seinerseits über den Abziehbildsignalfluss zeitcodiert werden, und durch eine weitere zeitaktive Ebene können diese Abstände daue rhaft erfasst werden. Die Neuronen dieser Ebenen sprechen nun bereits auf Signalfolgen an, die extrem selten vorkommen, Signalfolgen, die nur bei einer ganz bestimmten räumlichen Konstellation visueller Reize auftreten. Wenn ein Neuron nur auf einen bestimmten Reiz anspricht, der ansonsten im Alltag nicht vorkommt, dann wird es auch nicht ständig in einer neuen Situation aktiv. Es wird nicht ständig neue Verbindungen eingehen. Das heißt seine Verschaltung wird nicht durch ständig neue Situ ationen überschrieben. Es erkennt also dauerhaft eine bestimmte räumliche Konstellation. Es erkennt zum Beispiel ein Objekt. Man kann auch sagen, es repräsentiert dieses Objekt im Gehirn. Damit haben wir eine Vorstellung, wie visuelle Objekterkennung ablaufen kann. Aber ein kleines Problem ist noch offen: Wenn visuelle Eindrücke durch Zeitcodierung erkannt werden, so braucht es natürlich auch eine kurze Zeit, um sie auszuwerten. Für diesen kurzen Zeitraum muss das Bild fixiert werden. Dies geschieht einerseits durch die sakkadische Augenbewegung (Berhill und Stark 1987, S.68), andererseits dadurch, dass das Bild zwischengespeichert wird (Wesenick u.a. 2000). Wenn sie jemanden bitten, mit seinen Augen einen Kreis zu ziehen, so können sie beobachten, dass sein Auge nicht regelmäßig im Kreis wandert, sondern dazwischen immer wieder stecken bleibt und sprunghaft weiterwandert. Wir fixieren einen Eindruck, bis er ausgewertet ist, und wandern dann erst mit dem Auge weiter. 3.5.13 Die Verarbeitung zeitlicher Signale des auditiven Systems Was das Hören betrifft, so ist im Gegensatz zum Auge, eine fließende Verarbeitung der Information möglich. Die Verarbeitung beruht auf den selben Regeln, wie die Auswertung der zeitcodierten visuellen Information, sonst wäre es nicht mö glich, dass ein neugeborener Hamster, dem der Sehnerv ins auditive System verpflanzt wird, mit diesem System normal zu sehen lernt (Frost 2000), oder Gehörlose obere Areale des Hörsystems für andere Leistungen nutzen (Spektrum-Ticker 1999.01.14). Die Grundstruktur der Gehirnrinde muss im Ursprung durchg ehend von ähnlicher Beschaffenheit sein. Welche Verschaltungen sich dann ausbilden, hängt davon ab, was darauf an Reizen projiziert wird, und wie diese Pr ojektion aussieht. 132 Einen weiteren Hinweis für die Ähnlichkeit der Verarbeitung auditiver und visueller Information, liefern die Gestaltprinzipien, also die bekannten Regeln, nach denen sich etwas zu einer Gestalt abgrenzen lässt, wie Nähe, Ähnlichkeit, gute Fortsetzung usw. Sie gelten für beide Informationsarten gleich (Holle 1997, Purwins u.a.2000). Was das Hören betrifft, so sind im Ohr eigene Rezeptoren für verschiedene Frequenzbereiche nebeneinander angeordnet. Genau auf diese Weise projizieren sie ihre Reize über Zwischenstationen auf die Gehirnrinde (Kolb 1996, S.96). Benachbarte Frequenzbereiche sind in Alltagsgeräuschen meist gleichzeitig aktiv, also werden sich stabile nachbarschaftliche Verbindungen bilden. Diese bilden dann einen Voraussagefehler, wenn die gleichzeitige Aktivierung nicht gegeben ist. So wird eine erste Verarbeitung entstehen, die einer besseren Trennung der Frequenzbereiche dient (ähnlich der ersten Verarbeitung im visuellen System, die dem Hervorheben von Konturen dient). So viel ist auch schon Neurophysiologisch bestätigt (Kolb 1996, S.96/97). Nun ergibt sich die Frage, ob ein Neuron auch in der Frequenz senden muss, die es repräsentiert. Die Antwort ist, dass es das weder muss, noch kann. Wir hören nämlich Frequenzen weit oberhalb der maximalen Impulsrate von Neur onen. Das Neuron repräsentiert die Frequenz durch seine Position am Projektionsfeld. Das genügt. Die Stärke (Impulsrate) mit der ein solches Neuron sendet, repräsentiert nicht die Frequenz, sondern steht diese für die Lautstärke, in der die Frequenz relativ zu anderen Frequenzen gerade zu hören ist. Ziel des auditiven Syst ems ist es nun, an den zeitlichen Auftrittsmustern verschiedener Frequenzen zu erkennen, was gerade zu hören ist. Tatsächlich sind für das Gehirn die Auftrittsmuster relevant, und nicht das vorhandene Frequenzspektrum (Ehret 1997). Ein Ton eines natürlichen Instrumentes besteht nicht aus einer Frequenz, sondern aus einem Spektrum an Frequenzen. Wir erkennen aber das Muster, in dem diese Frequenzen ein gemeinsames Vielfaches bilden. Dieses Wiederholungsmuster macht die Tonhöhe aus (Langer 1998). Der Ton braucht nicht einmal eine Frequenz zu enthalten, die der Tonhöhe entspricht. Es zählt nur die Wiederholungsrate des Gesamtmusters aller enthaltenen Frequenzen. (Bleeck 1996, Seifert 2002, S.47) Dass im Ohr Töne in ein Frequenzspektrum zerlegt werden, stellt lediglich einen Weg dar, Information verarbeiten zu können, die schneller ablaufen, als die maximale Frequenzrate der Neuronen. Die zeitlich nicht mehr repräsentierbare Information wird dem Gehirn als ein Reaktionsbild geliefert, also ör tlich codiert. Das ist der Sinn des Frequenzspektrums. Das Spektrum wird auf einen länglichen Bereich der Gehirnrinde projiziert. Was damit weiter geschieht ist erst heute, durch einen neuen Fluoreszenzfarbstoff erforschbar, der bei geöffneter Schädeldecke auf die Gehirnoberfläche aufgetragen, dann aufleuchtet, wenn ein nahegelegenes Neuron elektrisch aktiv wird (Ehret 1997). Es ist nun anzunehmen, dass als erstes erfasst wird, wann und wie lange ein Neuron an einem Platz des Spektrums aktiv ist. Es werden sich Neuronen bilde n, 133 die für bestimmte Signallängen stehen. Außerdem werden sich solche Neuronen mit benachbarten Neuronen verschalten, die die Länge eines anderen Frequenzbereiches erfassen, weil diese oft zeitgleich aktiv sein werden. Es wird zu Voraussagefehlern kommen, wenn diese nicht zeitgleich aktiv sind. Diese Voraussagefehler werden ihrerseits Verbindungen eingehen, und somit spezifischere Signalkonstellationen verkörpern. Ich bin der Überzeugung, dass auf diese Weise eine Hierarchie an Verschaltungen entsteht, deren höhere Einheiten auf ganz bestimmte Reizkonstellationen ansprechen, zum Beispiel auf einen Klavierton. Um einen Klang zu erkennen, ist nicht nur ein Frequenzmuster notwendig, sondern vor allem spielt auch der Klangverlauf eine Rolle (Müsseler, Prinz 2002). Für all das bedarf es aus meiner Sicht keiner eigenen Regeln. Die Lösungen, die ich weiter oben zum Erkennen von Reizlängen und Reizfolgen erarbeitet h abe, sollten auch hier greifen. Das Problem der Zeiterfassung ist eine Sache, die s owohl im Bereich kleiner Zeiträume, wie der Töne eines Musikstückes, wie auch an größeren Zeiträumen abgehandelt werden kann, wie es die Ereignisfolgen eines gewöhnlichen Wochentages sind. Man wird immer auf die selben Regeln stoßen, weil Statistik in allen Größenbereichen gilt! Egal in welchem Zeitmaßstab wir denken, es wird immer Zeitfolgen geben, die häufiger auftreten, und die sich deshalb als erste in einer dauerhaften Form abbilden können, also nicht mehr überschrieben werden. Aber im Zeitmaß eines Tages ist dies leichter zu erkennen, als in den Zeitmaßstäben der Musik. So können wir an Kleinkindern beobachten, dass sie schon früh bestimmte Tagesabläufe kennenlernen, wie zum Beispiel der Wechsel von Tag und Nacht, das Erscheinen der Mutter, wenn man schreit, das Ritual des Windelwechselns, des Fläschchenwärmens, des Schlafengehens, des Kinderwagenfahrens. Ich kann mich erinnern, wie verwundert sich mein kleiner Neffe beschwert hat, als er des Nachts mit dem Kinderwagen am Flughafen herumgeführt wurde. Das war nicht das übliche Ritual! 3.5.14 Die Verbindung nicht zeitgleicher Signale: Genaugenommen ist ein wichtiges Problem der Zeitverbindungen noch ungelöst geblieben. Zeitverbindungen bestehen zwischen Zellen, die nicht zeitgleich, sondern nacheinander aktiv werden. Aber wie lange sollen sie verbindungsfähig bleiben? Antwort: Sie dürfen eigentlich immer Verbindungen empfangen und durch ein Rücklaufsignal beantworten. Die Bayesianische Statistik verhindert ohnehin, dass Verbindungen zwischen Zellen bestehen bleiben, die ungleich häufig aktiv sind. Bei Zellen die gleich häufig aktiv sind, ergibt sich automatisch immer eine Verbi ndung zum zeitlich nächstliegenden Reiz. Kämmsignale zur Verbindungsfindung sollten Zellen prinzipiell nur zum Zeitpunkt ihrer Aktivierung aussenden, und zwar nur dann, wenn es noch keine Verbindung gibt, an die das Signal weitergegeben werden kann. Das garantiert die 134 Funktionstüchtigkeit des Prinzips der Blockierung. Die Kämmsignale breiten sich aus, bis sie eine verbindungsfähige Zelle finden. Im Fall eines Zeitunterschiedes liegt die Aktivierung der Zelle schon zurück. Sie hat daher jetzt kein Kämmsignal ausgesandt. Deshalb stelle ich mir vor, dass das Rücklaufsignal nicht in der Verbindungsmitte entsteht (wie bei zeitgleichen Verbindungen), sondern dire kt bei der kontaktierten Zelle (grün). Es entsteht also eine einseitige Verbindung, die den Zeitpfeil repräsentiert. (Zeit verläuft nur in eine Richtung. Das nennt man den „Zeitpfeil“). Es ist ja auch nicht relevant, die zeitliche Mitte eines Tones in einem Musikstück vorauszusagen, sondern seinen Anfang. Zeitketten werden in der Erinnerung von Anfang zum Ende durchflossen. Deshalb ist es gut, wenn bereits die Verknüpfungsbildung von Zeitketten etwas anderes abläuft. Die Chunkzelle entsteht dann einfach dort, wo später die Vorstellungssignale starten sollen. Vorstellungen und die damit verbundenen Voraussagefehler sind natürlich auch in der zeitlichen Verarbeitung das wichtigste Prinzip zur Organisation von Information. Zellen erwarten ein Signal. Trifft dieses nicht wie erwartet ein, so senden sie eine Fehlermeldung nach oben (positiver Voraussagefehler), wo neue Chunkzellen, und neue Verschaltungen entstehen. 3.5.15 Zukunftsvorstellungen versus parallele Welt Wenn wir Erfahrungen machen, so entstehen Verbindungen im Gehirn. Diese Verbindungen sind nicht nur räumlicher, sondern, wie wir jetzt gesehen h aben, auch zeitlicher Natur. Genau diese Verbindungen werden auch aktiv, wenn wir die Dinge noch einmal in der Vorstellung oder im Traum durchleben (Spektrum-Ticker 2001.07.10, WSA 2000.11.16, Stickgold u.a. 2002). Aber Vorstellungen müssen noch in zwei Arten getrennt werden, denn es gibt zwei Arten von Zeiterwartung. Einerseits die Reihenfolge. Sie ist die einzige Art der Zeiterwartung, die auch in unseren Vorstellungen noch vorhanden ist. Wir können uns in unseren Vorstellungen an den Zeitpunkt begeben, wo das Haus, das wir gerade zu bauen begonnen haben, schon fertig ist. Aber auch in unseren Vorstellungen gibt es eine Reihenfolge von Dingen, die nacheinander eintreten. Wir wissen durchaus, dass vor 135 der Fertigstellung der Reihe nach viele Dinge erledigt werden müssen, und dass wir noch viele Nächte unruhig schlafen werden, bevor es soweit ist. Die andere Art der Zeiterwartung bezeichne ich als die „parallele Welt“. Um Wahrnehmungen im richtigen Tempo vorauszusagen, und Handlungen im richt igen Tempo durchführen zu können, braucht es eine Signalweitergabe mit an die Welt angepasstem Tempo, also eine langsamere Art von Signal, als jenes unserer Vorstellungen, ein Signal, das die Zeitabläufe so langsam durchwandert, wie sie in der Welt vorkommen. Es ist nicht so, dass wir alles was wir erleben wirklich wahrnehmen. Das Meiste ist vorausgesagt, und wird nurmehr teilweise nachgeprüft. Es gibt lustige Experimente, die dies zeigen. So wurden zum Beispiel Leute auf der Strasse nach dem Weg gefragt. Während der Unterhaltung marschierten Träger mit einer Tür zwischen den Gesprächspartnern durch. Dabei wurde der Wegsuche nde durch eine andere Person ersetzt. Die Veränderung blieb meist unbemerkt (WSA 2000.11.17). Nicht nur Zeitpunkt, sondern auch Ort sind Basis unserer Voraussagen. Voraussagen entstehen über die assoziativen Verknüpfungen. So wurde Personen ein Dia einer Küchensituation gezeigt, und danach kur zzeitig Bilder eines Brotes, eines Briefkastens oder einer Trommel angeboten. Das Brot konnte durch das vorherige Dia deutlich besser erkannt werden (Goldstein 1997, S.24) Wenn die Voraussagen in Echtzeit stattfinden, spreche ich von Zeiterwartung. Da Zeitlängen durch eine Hierarchie von Verschaltungen auf die maximale Impulsrate der Neuronen zurückgeführt werden, muss das Erwartungssignal auch diese gesamte Verschaltungshierarchie durchwandern. Wir erwarten zum Beispiel, dass ein Auto eine gewisse Zeit braucht um vorbeizufahren. Der Unterschied zwischen der Zeiterwartung, die parallel zur wahrgenommenen Welt stattfindet und Vorstellungen ist der, dass in Vorstellungen wiederholte Reize nicht wiederholt gedacht werden müssen. Wenn wir daran denken auf einen Berg zu gehen, so brauchen wir nicht jeden Schritt zu denken. Ich nehme an, dass das Gehirn zu jedem Reiz auch seine häufig auftretende Länge zu erfassen versucht. Nehmen wir als Wahrnehmungsbeispiel ein Motorengeräusch. Wir erwarten, dass es von einem vorbeifahrenden Auto stammt, und nach einer kurzen Zeit wieder ausklingt. Reißt es schlagartig ab, so en tspricht dies einer Unterschreitung unserer Erwartung, die im Gehirn zu einem hemmenden Signal führen könnte. Demgegenüber könnte sich eine Überschreitung der Zeiterwartung, wenn also das Motorgeräusch nicht ausklingt, durch ein aktivierendes Signal vermitteln. Höhere Verarbeitungsebenen können dann Voraussagen für diese besonderen Wahrnehmungen bilden. So könnten wir zum Beispiel bereits erahnen, dass dieses anhaltende Motorengeräusch vom Wagen des Briefträgers kommt, der jeden Morgen eine Weile stehen bleibt, ohne den Motor abzustellen. Wir haben also zuerst die Ausnahme erkannt, und dann über den größeren Zusammenhang eines vollen Tages, wieder eine Regel entdeckt, die die Ausnahme voraussagbar macht. So funktioniert Erkenntniserwerb. 136 Wenn das Gehirn alle vorangekündigten Reize unterdrückt, gehen dann nicht all diese Daten verloren? Nein, was hier stattfindet ist lediglich Datenkompr imierung. Wenn jemand an der Autobahn wohnt, hört er die Fahrgeräusche irgendwann kaum mehr. Seine Aufmerksamkeit widmet sich weniger voraussagbaren Ereignissen, die in seinem Leben von Bedeutung sein können. Das Autobahngeräusch gehört offensichtlich nicht dazu. Es sind immer die Veränderungen in der Umwelt, oder auch in uns, die uns zum Handeln zwingen. Deshalb ist das Gehirn so organisiert, dass es das Gleichbleibende ausfiltert, und die Veränderung signalisiert. Wir brauchen während einer Tageswanderung nicht unentwegt daran erinnert werden, dass Licht da ist. Wichtig ist nur, dass es uns auffällt, wenn es zu dämmern beginnt. Diese Veränderung ist ein Signal für uns, uns einen Unterschlupf zu suchen. 3.6 Regeln für körperliche Bedürfnisse als Handlungsmotiv Mit diesem letzten Beispiel ist nun eine Überleitung zum vorletzen Kapitel des Hirnmodells gefunden. Der Anwendung der Reizinformationen zur Steuerung des Verhaltens. Der Wanderer sucht bei Dämmerung Unterschlupf. Es ist aber nicht direkt die Dämmerung, die die Herbergssuche notwendig macht. Könnten wir mit beliebiger Körpertemperatur leben, so wäre es nicht notwendig, sich in der kü hlen Nacht eine wärmende Bleibe zu suchen. Es sind also unsere zukünftigen Bedürfnisse, auf die letztlich alles Verhalten zurückgeht. Zukünftig insofern, als dem Wanderer ja gegenwärtig noch warm ist, aber er bereits erahnen kann, dass das nicht so bliebe, würde er im Freien übernachten. Ich unterscheide zwei Arten von Bedürfnissen. Körperliche Bedürfnisse (nach Nahrung, Wärme, Schutz vor Schäden, Schutz durch soziale Einbettung) und geistige Bedürfnisse (Lern- und Spieltrieb, Wissensdurst, ästhetisches Empfinden für räumliche und zeitliche Muster, Informationsgewinn durch sozialen Kontakt). Die geistigen Bedürfnisse dienen der Erweiterung unseres Wissens über die Welt. Sie sprechen auf Muster an, weil wir durch die, in Mustern enthaltene Wiederholung, die Welt vorauszusagen lernen. Dieses Vermögen nutzen wir um die körperlichen Bedürfnisse besser zu stillen. Was ich bisher beschrieben habe, ist ein erkenntnisgewinnendes System, das die Welt vorauszusagen versucht. Nun stellt sich die Frage, wie die dabei entstandenen Verbindungen genutzt werden, um unser Verhalten bedürfnisorientiert zu organisieren. Zuerst will ich auf die körperlichen Bedürfnisse eingehen. Der Deckung von Bedürfnissen liegt meiner Ansicht nach nicht ein einfacher ReizReaktions-Regelkreis zugrunde. Vielmehr fließt unsere Prognose der Zukunft in unser Verhalten mit ein. Es gilt nun festzustellen, wie diese Zukunft sprognose, einschließlich der Prognose zukünftiger Bedürfnisse das Verhalten beeinflusst. Beginnen wir unsere Überlegungen mit einem einfachen Reiz/Reaktions-Modell. Die Bedürfnisse, zum Beispiel der Bedarf nach einer bestimmten Körpertemperatur, 137 genügend Flüssigkeit und Blutzucker, möglichst wenig Lärm und Erschütterung, keine Schmerzen usw. sind durch genetisch vorgegebene Sollwerte festg elegt. Weichen die über die Sinne wahrgenommenen Istwerte zu gravierend von den Sollwerten ab, so wird Alarm geschlagen. Genaugenommen ist das eine stark vereinfachte Darstellung. Milgram erläutert zum Beispiel die Regelkontrolle der Flüssigkeitsaufnahme, und es ist zu erkennen, dass dies viel komplizierter abläuft (Milgram 2002b). Aber für ein künstliches System genügt ein einfacher Regelkreis. Diesen Bedürfnis-Alarm (Sollwertabweichung) wollen wir nun als einen Reiz unter anderen betrachten, und überlegen, ob er genauso wie andere Reize verarbeitet werden darf, oder ob er in irgend einer Weise gesondert behandelt werden muss. Die folgende Grafik zeigt eine Situation, dargestellt durch die Reize A, B und den Bedürfnisreiz X. Wir können uns vorstellen, dass in einer bestimmten Situation, bestimmte Handlungen gefordert sind. X, A und B beschreiben die Situation. Die die Handlungen auslösende Einheit H, spricht also an, wenn sie gleichzeitig Signale von X, A, und B erhält. Wie aber haben wir diese Verschaltung erlernt? Die klassische Antwort auf diese Frage sieht folgendermaßen aus: „Einst muss es in der Situation X,A,B zu der Handlung H gekommen sein, und wir müssen daraufhin registriert haben, dass sich die Situation bessert, dass also die Sollwertabweichung X geringer wird oder verschwindet. Daraufhin haben sich die Verbindungen verstärkt.“ Ich will im Folgenden zeigen, dass die Sache nicht so einfach ist. Der Mensch ist keine reine Reiz/Reaktions-Maschine. Er reagiert nicht einfach auf eine gegenwärtige Situation, sondern plant die erwartete Zukunft mit ein. Um ein realistisches Modell des Erwerbs von Handlungen zu entwickeln, müssen wir also die Sache in ihrer zeitlichen Abfolge betrachten. Im Folgenden ist dies grafisch dargestellt. 138 Wir können erkennen, dass die Belohnung für das Verhalten, die Sollwertannäherung X1, im Nachhinein erfolgt. Genauso ist es mit Verhaltensweisen, die wir uns abgewöhnen, weil sie schlechte Konsequenzen haben. Auch da erfolgt die Beurteilung im Nachhinein. Haben wir die Zusammenhänge erst einmal kennengelernt, so können wir das nächste Mal die Konsequenzen unserer Handlung vorausahnen. Die Zukunftsvorstellung beeinflusst dann unser Verhalten. Es muss also ein Signal gegen den Zeitpfeil aus der vorgestellten Zukunft zurücklaufen, damit die prognostizierten Sollwerte das Handeln beeinflussen können, das ja davor stattfindet. Es fließt von den Zielen in die Gegenwart zurück. Dass unser Handeln aus Zukunftsvorstellungen gelenkt wird, zeigt sehr schön ein Wegfindungsspiel von Marken (2000). Nahezu all unser Verhalten ist Zielorie ntiert, auch wenn uns das meist nicht bewusst ist (WSA 2001.06.20). Und die dazu notwendigen rückführenden Signale scheint es selbst bei Seeschnecken zu geben (Kandl 1993, Byrne 2002). Die Frage ist: Dient dieses Rücklaufsignal der Verbindungsverstärkung, wie bi sher angenommen, ist es direkt ein Handlungsauslöser, oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ich will nun zeigen, dass es nur eine Möglichkeit gibt, was dieses Signal sein kann, und dass es notwendig ist, das klassische Reiz-Reaktionsmodell abzuwandeln. 3.6.1 Zwei Gründe gegen Verhaltensverstärkung durch Verbindungsverstä rkung Der erste wichtige Grund, warum Verhalten nicht einfach durch Verbindungsverstärkung und Schwächung gesteuert werden kann, ist der, dass die Verbindungsstärke in unserem Modell bereits etwas anderes darstellt. Sie verkörpert die Wahrscheinlichkeit, mit der wir einen Zusammenhang vermuten. Die Wahrscheinlichkeit also, mit der wir erwarten, dass die vorgestellte Zukunft auch eintritt. 139 Natürlich hat auch diese Erwartung einen Einfluss auf unser Verhalten. Auf das Verhalten bezogen müssen wir aber eine Unterscheidung beibehalten, zwisc hen der Wahrscheinlichkeit mit der unser Verhalten Gewinn verspricht, und der Höhe des Gewinns. Gelderwerb durch redliche Arbeit verspricht weniger Gewinn, als Gelderwerb durch Lotto-Spielen. Aber die Wahrscheinlichkeit auf Gewinn, ist im ersten Fall höher. Da wir diese beiden Handlungsmotive getrennt zu denken vermögen, dürfen sie auch in unserem Modell nicht verschmolzen werden. Das Modell würde sonst immer jene Zukunft für die wahrscheinlichste halten, die am meisten Gewinn verspricht. Es würde jegliche Objektivität verlieren. Es gibt aber noch einen wesentlicheren Einwand gegen die Verhaltenssteuerung durch die Justierung der Verbindung vom Reiz zur Reaktion. Der Mensch vermag in der gleichen Situation verschieden zu entscheiden, je nachdem, welche Z ukunft er sich gerade erwartet. Wir werden nicht automatisch immer beginnen einzuheizen, wenn uns kalt ist (X), und Heizmaterial (A) sowie eine Heizmöglichkeit (B) vorhanden ist. Es kann sein, dass wir in 10 Minuten vor haben das Haus zu verlassen, es kann sein, dass wir unseren Brennmaterialvorrat zur Neige gehen sehen und aufsparen wollen, es kann sein, dass wir uns nicht in der eigenen Wohnung befinden, und einen Konflikt mit dem Eigentümer vermuten, wenn wir einzuheizen beginnen usw. Es ist also die vorgestellte Zukunft, die auf die Gegenwart rückwirkt und unser Verhalten verändert. Deshalb ist anzunehmen, dass die Auslösesignale für durchdachtes, bewusst gesetztes Verhalten, aus dieser vorgestellten Zukunft kommen. Nur bei unbewussten bereits automatisierten Reaktionen, ist ein direkter Weg vom Reiz zur Reaktion möglich. Nicht aber bei geplanten Handlungen. Erst die Idee, dass das Auslösesignal gegen den Zeitpfeil läuft, macht das erworbene Wissen über die Vorgänge in der Welt für sinnvolles Verhalten nut zbar. Wir können, wie Popper es formuliert, Vorstellungen an unserer Stelle sterben lassen (Störig 1995, S.689). Wenn unsere Vorstellung uns prophezeit, dass uns eine Handlung ins Verderben bringt, so führen wir diese Handlung einfach nicht aus. Wir können also auch ohne zu Handeln, durch reine Beobachtung, etwas lernen, das wir später nützen, um uns sinnvoll zu verhalten! Das einfache Reiz/Reaktions-Modell kann das nicht erklären. Außerdem macht uns die Zukunftsvorstellung erziehbar. Denn Erzieher tun nic hts anderes, als gegenwärtige und zukünftige Bedürfnisse gegeneinander auszuspielen. Da heißt es „Wenn du nicht aufhörst umzufetzen, dann gibt es nachher nicht die übliche Eiscreme.“ Nun ändert sich im Kind plötzlich seine Zukunftsvorstellung. Die Erfüllung eines zukünftigen Bedürfnisses ist bedroht. Also passt es sein gegenwärtiges Verhalten an, um der Bedrohung zu entgehen. Zukünftige Bedürfnisse bewirken gegenwärtiges Verhalten. Auch künstliche Intelligenz wird man erziehen können, wenn sie nach dem hier dargestellten Modell aufgebaut ist. Jeder wird damit umgehen können, denn für das Erziehen haben wir alle eine gewisse Gabe! 140 Natürlich sind es nicht alleine die zukünftigen Lebensbedingungen, die vorausgesagt werden müssen. Auch zukünftige Bedürfnisse müssen vorstellbar und fühlbar sein. Im Stirnhirn werden Sinneseindrücke bereits so langfristig kombiniert, dass Zukunftsvorstellungen möglich werden. Zu diesen Vorstellungen werden die mit den Erlebnissen einhergehenden Gefühle aus dem limbischen System (Lust/Unlust-Zentrum) kombiniert. Es führt also ein Nervenstrang vom Lustzentrum ins Stirnhirn. Wird dieser unterbrochen, dann ist das moralische Handeln gestört (Damasio 1995, Spektrum-Ticker 1999.10.21). 3.6.2 Die Rolle der rückführenden Signale „aus der Zukunft“ Eines der ersten Probleme, die ich in diesem Hirnmodell behandelt habe, war die Frage, wie zwei räumlich entfernte aktive Neuronen eine Verbindung zueinander aufbauen können. Ich habe angenommen, dass sich dazu Kämmsignale nach allen Richtungen kreisförmig ausbreiten. Beim Aufeinandertreffen wird ein Signal die Fließrichtung zurück geschickt, und so eine Verbindung abgenabelt. Das Problem, das uns jetzt begegnet, kann weitgehend auf die gleichen Mechanismen zurückgreifen. Wieder breitet sich von den aktiven Sinnesreizen ausgehend, ein Signal aus. Es ist das Signal, das die möglichen Zukünfte voraktiviert. Die Bahnen, über die es verläuft, sind bereits durch vergangene Erfahrungen verschalten. Sie sind also weitläufig verstreut, während bei der Verbindungsfindung ja jede (noch zur Verfügung stehende) Bahn verwendet wurde. Nun ist das Netz bereits strukturiert, aber es laufen darin immernoch die selben Prozesse ab. Meist werden es zeitlich gerichtete Verbindungen sein, die entstehen, wenn Reize oft aufeinander folgen. Das heißt, das Signal fließt von den gegenwärtigen Reizen in die vorgestellte Zukunft. Es verzweigt sich dabei, denn oft sind mehrere Zukünfte möglich. Da die Verbindungen Wahrscheinlichkeiten darstellen, sind sie nicht vollkommen durchlässig. So wird das Signal geschwächt und verliert sich schließlich. Den gesamten voraktivierten Bereich nenne ich „Zukunftsbaum“. Diesen Begriff habe ich auch schon am Beginn des Textes erläutert. Der Zukunftsbaum wird ständig den neuen Ereignissen der Welt angepasst. Bedürfnisse sitzen wie andere Reize an bestimmten Stellen dieses Zukunftsbaumes. An manchen Zweigen dieser Zukunft, wird also die Erfüllung eines Bedürfnisses vorausgesagt. Von diesen Stellen soll nun ein Signal zurück, gegen den Zeitpfeil ergehen. Dieses Signal hat die gleiche Rolle, wie die rückführenden Signale im Rahmen der Verbindungsfindung. Es nabelt einen Weg ab. Das stärkste zurücklaufende Signal wird alle anderen überrennen, und so bleibt nur eine angestrebte Zukunft über. Der Weg in diese Zukunft wird isoliert (abgenabelt). Natürlich kann sich diese Zukunft ändern, wenn aufgrund neuer Erfahru ngen der Zukunftsbaum seine Gestalt ändert. Manche seiner Äste werden plötzlich zuverlässiger erscheinen, (weniger Widerstand aufweisen) und man wird lieber den Weg wählen, der über diese führt. Aber es wird nie mehr als ein Weg zu einem Zeitpunkt isoliert werden. 141 Wieso nur ein Weg? Ganz einfach: Wir können nur eine Handlung zu einem Zeitpunkt verfolgen. Es macht keinen Sinn, wenn an unseren Körper zug leich das Signal ergeht, den Arm nach links und nach rechts zu bewegen. Wenn wir mehr ere Dinge zugleich tun, so tun wir sie zwar zeitlich eng ineinandergeschachtelt, aber doch hintereinander. Unser Bewusstsein startet immer nur eine Handlung zu einem Zeitpunkt. Wenn Fuß und Arm können wir nur dann zugleich heben, wenn wir diese Kombination als eine Handlung zu denken gelernt haben. Wenn wir zugleich Essen und Gehen, so haben wir zuerst das Gehen bewusst gestartet, und es läuft als routinierte Handlung nun unbewusst weiter, so dass unser Bewusstsein frei ist, das Essen zu starten. Die Serialität des Denkens spiegelt sich auch in unseren Vorstellungen, denn der Weg, den unser Handeln wählt ist begleitet von Vorstellungen. So kann sich auch unser bewusstes Vorstellungsvermögen nie mit mehr als einem Weg zu einem Zeitpunkt befassen. Da der „Zukunftsbaum“ aber ständig aktualisiert wird, erscheinen auch immer wieder neue Vorstellungen in unserem Bewusstsein, aber nie mehr als eine pro Zeitpunkt. Wenn das stärkste Rücklaufsignal siegt, und den Weg isoliert, so ergibt sich als nächstes die Frage, woraus sich die Stärke des Rücklaufsignals begründet? Antwort: Zum einen aus der Stärke der Erwartung der Zukunft. Voraussagen, die eher unwahrscheinlich sind, sind mit mehr Widerstand versehen. Das bedeutet, es wird nur ein schwaches Signal in solche Zukünfte gelangen, weil die Verbindungen schwach sind. Zum anderen ist aber der erwartete Gewinn ausschlagg ebend. Verspricht eine unwahrscheinliche Zukunft großen Gewinn, so ist ihre Gesamtstärke vielleicht doch anderen Zukünften überlegen, und sie wird angestrebt, trotzdem sie unwahrscheinlich ist. Der erwartete Gewinn ist abhängig von vergangenen Erfahrungen in ähnlichen Situationen. Er ist aber auch abhängig von der derzeiti gen Abweichung vom Sollwert. Für den Hungernden ist auch ein trockenes Stück Brot ein Gewinn. Je nach erwarteter Gewinnhöhe ergeht vom Lustzentrum mehr oder weniger Aktivität. Diese wird nun in Relation zur Zukunftserwartung gesetzt. Das kann technisch gesehen ein analoger Transistor übernehmen, der die Stärke des einen Signals durch die Stärke des anderen modifiziert. Das erhaltene Res tsignal läuft nun den Zukunftsbaum zurück. Auch aus anderen erwarteten Zukünften, also aus anderen Ästen des Zukunftsbaumes, kommen Rücklaufsignale. Aber nur das Stärkste kann seinen Weg hinab bis zum Stamm isolieren. Auch die Länge der Verzweigungen bis zu der erwarteten Zukunft spielen eine Rolle, weil sie je nach Eintrittswahrscheinlichkeit mit Widerstand belegt sind. Je näher wir der angestrebten Zukunft kommen, desto weniger Zeit, und desto weniger Verzweigungen trennen uns vom Lustsignal. Deswegen wird der Lustgewinn auch immer größer, je näher wir seiner Erfüllung entgegengehen. (Harald Schaub nennt in seiner Arbeit als Auslöser für eine Handlung vier Faktoren: Wichtigkeit, die Einschätzung der eigenen Kompetenz zu Zielerreichung und dass Umstände und Zeitfenster eine Zielerreichung zulassen (Schaub 2002). All diese 142 Faktoren fanden sich unter einer technischeren Begrifflichkeit auch in dem hier dargestellten Modell.) 3.6.3 Die Unterscheidung von Emotion und Gefühl Bei der Unterscheidung von gegenwärtigen, oder zukünftigen Bedürfnissen würde ich die Unterscheidung von Emotion und Gefühl ansiedeln. Gefühle sind Sollwertabweichungen oder Erreichungen. Emotion ist die zukünftige Erwartung von Gefühlen. So ist die Angst, die wir haben, wenn wir an einem schlechten Seil in der Felswand hängen eine Emotion. Der Schmerz, den wir erleben, wenn das Seil reißt und wir am Boden aufprallen ist ein Gefühl. Freilich werden die Begriffe in der Alltagssprache nicht exakt verwendet. Die stirnhirngeschädigten Patienten von Damasio machen deutlich, dass eine solche begriffliche Trennung notwendig ist. Bei ihnen sind scheinbar die erlernten Verbindungen zu den Sollwertabweichungen, also zum Lust/Unlust-System durch den Gehirnschaden durchtrennt worden. Das heißt sie können zwar noch die Zukunft vorausahnen, empfinden ihr gegenüber aber nichts. So haben sie auch kein Motiv das aus der Zukunft wirkt, und ihr Wille entspringt nur den jeweils gegenwärtigen Gefühlen, im glücklichsten Fall entspringt ihr Handeln alten Gewohnheiten. Das bedeutet ihr Handeln weist Mängel auf, weil es nicht mehr zukunftsorientiert ist, und das bedeutet es ist weniger planvoll, und weniger moralisch (Damasio 1995). Trotz normaler Intelligenz verlieren diese Menschen ihren Platz in der Gesellschaft. Man könnte sagen es fehlt ihnen die emotionale Intelligenz. Die veraltete Vorstellung, wir könnten ohne Emotion rein aus Vernunft sinnvoller handeln ist damit widerlegt (Churchland 1996). Es gibt natürlich auch Menschen, die ganz ohne Stirnhirnschaden solche Schwächen aufweisen, weil sie in diesem Gehirnbereich wenig lernfähig sind. 3.6.4 Wie Handlungen gestartet werden Der Leser wird vielleicht bemerkt haben, dass die neurophysiologischen Zitate immer seltener werden, je höher die Funktionen sind, die das Modell behandelt. Tatsächlich ist der aktivierte Bereich, der Zukunftsbaum, nicht in der Weise neurophysiologisch beobachtbar, wie das zu wünschen wäre. So bleiben all diese Modelle hypothetischer Natur. Ihre Funktionstüchtigkeit kann aber vermutlich schon bald dadurch gezeigt werden, dass man künstliche Wesen konstruiert, und deren Verhalten beobachtet. Deshalb macht es Sinn weiterzudenken. Die nächste Frage, die ich stellen will, ist die nach dem Auslöser für eine Handlung. Wo kommt dieser her? Fest steht, dass er durch den Zweig des Zukunft sbaumes zurückfließt, der zum stärksten Bedürfnis führt. Wir setzen nur Handlungen, die entlang dieses stärksten Weges liegen. Wir folgen immer dem stärksten Motiv. Jede Handlung stellt eine Zukunftsverzweigung dar. Wir kommen in eine andere Zukunft, je nachdem ob wir sie ausführen oder unterlassen. Der isolierte Weg, der uns zur Bedürfniserfüllung führt, bestimmt also, an welchen Verzweigungen des 143 Zukunftsbaumes wir eine Handlung ausführen müssen, um am Weg zu bleiben, und an welchen nicht. Wann, zu welchem Zeitpunkt also, wir eine Handlung genau zu starten haben, wird aber durch die Zeiterwartung bestimmt. Ich habe sie weiter oben als „parallele Welt“ bezeichnet. Von den aktiven Reizen ausgehend, starten nicht nur die schnellen Signale unserer Zukunftsvorstellungen, sondern auch die langsamen, welche parallel zu den Ereignissen der Welt, den exakten Zeitpunkt der erwarteten Ereignisse ankündigen. Diese zeitkontrollierte Signalweitergabe ist auch für ein sinnvolles Handeln notwendig. Diese Signale fließen, in der Geschwindigkeit der realen Welt, jenen Weg entlang, der aus dem Zukunftsbaum isoliert wurde. Sie aktivieren zeitgerecht die Handlungen, die notwendig sind, um auf dem Weg zu bleiben. Dieser zeitgerechte Ablauf von Handlungen ist eine absolute Notwendigkeit, und beweist damit auch die Existenz von Signalen, die in ihrer Geschwindigkeit exakt so langsam weitergegeben werden, dass sie parallel zu den Ereignissen der Welt verlaufen können. 3.6.5 Exkurs: Ein System für alle Verarbeitungsprozesse Bemerkenswert ist dazu, dass auch die Zeitcodierung räumlicher Formen, die ich unter dem Begriff „Abziehbildsignalfluss“ behandelt habe, zwei Fließgeschwindigkeiten von Signalen verlangt. Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die Grafik, um dies zu verstehen: Wir brauchen ein Signal, das das eigentliche Signal auf den Weg schickt. Das eigentliche Signal hingegen ist doppelt so schnell. Es ist schon im Zentrum der Fläche angekommen, während erst die Hälfte der Zellen der Fläche von jenem Signal erfasst wurden, das die Signale auf den Weg schickt (siehe Mitte der Grafik). 144 Das Beispiel hat auf den ersten Blick überhaupt nicht viel mit dem jetzigen Problem der zeitgerechten Auslösung von Verhalten zu tun. Schließlich haben wir es jetzt mit zeitdefinierten Verbindungen zu tun, im obigen Fall hingegen mit zeitgle ichen UndVerbindungen. Solche Verbindungen von zeitgleich auftretenden Reizen, würden an sich überhaupt keine Unterscheidung von Vorstellungszeit und Erwartungszeit erfordern. Sie sollten immer mit maximaler Geschwindigkeit durchflossen werden, weil ja in der realen Welt kein Zeitabstand zwischen ihrer Reizung existiert. Wir können das System der zwei verschieden schnellen Signalflüsse aber hier für den geregelten Durchfluss der Und-Verbindungen nützen, indem wir einfach festlegen, dass Erwartungssignale maximal mit halbem Tempo vorankommen. Erwartungen müssen ja immer erst mit den realen Sinneswerten verglichen werden, um den Voraussagefehler zu ermitteln. Das könnte deren langsames Maximaltempo erklären. Die Vorstellungssignale hingegen brauchen sich einfach nur über das vorhandene Netz hinweg auszubreiten, ohne weiter verarbeitet zu werden, und fließen daher doppelt so schnell. Genaugenommen sollte ich die schnellen Signale im Fall von Und-Verbindungen nicht als Vorstellungssignale bezeichnen. Vorstellungen zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie aus der Gegenwart in Bereiche fließen, die durch die Sinne erst in Zukunft aktiviert werden (Zukunftsbaum). Beim Abziehbildsignalfluss durchfli eßen die schnellen Signale jedoch, genau wie die langsameren Erwartungssign ale, die derzeit aktive Fläche, und es entstehen W ahrnehmungen und nicht Vorstellungen. Also sprechen wir lieber von den „schnellen Signalen“ als von Vorstellungssignalen. Immerhin zeigt das Beispiel, dass es nicht nur in Dann-Verbindungen, sondern auch in Und-Verbindungen zwei Signalgeschwindigkeiten geben dürfte. Der Abziehbildsignalfluss, und die damit entstehende Zeitcodierung räumlicher Information ist also letztlich eine vorteilhafte Nebenerscheinung der zwei Fließgeschwindigkeiten, von der ich annehme, dass sie die Natur auf die selbe Weise „zufällig“ zu nützen gelernt hat, wie sie in diesem Modell beschrieben ist. Hinweise für eine solche Annahme, werde ich später darstellen, wenn wir das Modell anwenden, um das Erkennen von Strukturen zu erklären. Wie wir uns erinnern, ist die Annahme einer Regel zum Signalfließverhalten in UndVerbindungen eine absolute Notwendigkeit, denn ohne eine Regel, würden die Signale darin ewig kreisen, denn sie könnten immer in jede beliebige Richtung weiterfließen. Der Kämmsignalfluss, welchen wir zur Verbindungsfindung benötigt haben, hat sich auch nach den Regeln der Und-Verbindung ausgebreitet. Es handelt sich also immer um das gleiche Prinzip auf verschiedenen Stufen der Verarbeitungshierarchie. Der Leser irrt also nicht, wenn ihm vieles im Text schon bekannt vorkommt. Ich will zeigen, dass wir verschiedene Verarbeitungsschritte durch ein und das selbe System erklären können. 145 3.6.6 Erwartungssignale von den Sinnen, zeitgegenläufige vom Triebzentrum Das Lustzentrum gehört nicht zur Großhirnrinde, und hat andere Gesetze. So ergehen zum Beispiel, anders als von Sinnesreizen, vom Lustzentrum keine Signal in die vorgestellte Zukunft, sondern in die Vergangenheit. Es macht keinen Sinn zu fragen, was aus einer Bedürfnisbefriedigung zukünftig hervorgeht. Vielmehr macht es Sinn, zu fragen, ob eine davor ablaufende Handlung ein Bedürfnis befriedigt hat. Es ist also nur das Davor relevant. Aus Handlungen gehen Bedürfnisbefriedigu ngen hervor und nicht umgekehrt. Stellen wir uns zeitliche Verbindungen prinzipiell gedreht vor, wie einen G ewehrlauf. (Das ist natürlich nur eine Denkhilfe, um sich die Gesetze der Reizübertr agung im Modell besser vorstellen zu können) In die Zukunft sind sie rechtsdrehend, in die Vergangenheit dementsprechend linksdrehend. Signale von den Sinnen sind wie Projektile, die bereits einen Rechtsdrall haben. Sie laufen daher in den Verbindungen immer in die vorgestellte Zukunft. Sollwertabweichungen (Bedürfnisse) liefern Signale, die genauso miteinander verarbeitet werden, wie die Signale von den Sinnen, aber die Signale sind linksdrehend. Treffen sie auf Verbindungen, die von Sinnesreizen ausgehend geknüpft wurden, so laufen sie diese zurück statt vorwärts. Sie laufen den Zukunftsbaum zurück in die Gegenwart. Vorausgesagte Bedürfnisbefriedigungen senden aktivierende, vorausgesagte Sollwertabweichungen senden hemmende Signale zurück in die Gegenwart. Es gibt also nicht nur Vorstellungssignale von den gegenwärtigen Sinnesreizen in die Zukunft, sondern auch die Bedürfnisreize, welche den Zeitpfeil zurücklaufen, zu den Zellen, die gegenwärtig aktiv sind (Byrne 2002). Das ist nur möglich, weil die Zellen in der Vergangenheit auch schon aktiv waren, und Verbindungen e rlernt wurden. Durch Überlappung dieser Signale aus beiden Richtungen wird der Weg abgenabelt, der uns zeigt, welche Handlungen uns zur befriedigendsten Zukunft führen. Es siegt nicht unbedingt der kürzeste, sondern der stärkste Weg, der sich aus der Stärke der Verbindungen ergibt, die ja Wahrscheinlichkeitsgrade von Zukunft repräsentiert. 3.6.7 Die Verschaltung der Sollwertabweichungssignale zu Bedürfnissen Wie verschalten sich nun die Bedürfnisse. Eines steht fest, die Sollwertabwe ichung kann noch nicht direkt als das Ereignis definiert werden, das als Verstärker oder Verminderer für Handlungen fungiert. Eine Sollwertabweichung kann ganz langsam immer größer werden, ohne dass dafür irgend ein Verhalten zuständig wäre. Zum Beispiel wird das Energiedefizit eines Systems ohne weiteres zutun immer größer. Als Schlüsselreiz für die Anbindung einer Handlung dient aber nicht dieser Wert, sondern die plötzliche positive Veränderung der Energiebilanz, wenn eine Umweltsituation, durch die wieder Energie zugeführt wird, auf ein Verha lten folgt. Das bedeutet, unser System lernt zuerst, eine Voraussage über den häufigsten Verlauf von Bedürfniskurven zu treffen, den Verlauf, den sie ohne Fremdeinfluss 146 haben. Diese Voraussage schlägt dort fehl, wo Fremdeinfluss auftritt. Das entstehende Fehlersignal kann nun mit diesem Außeneinfluss, z.B. der Nahrungsaufnahme, eine gültige Verbindung eingehen. Durch diese Verbindung läuft das Signal, das letztlich die nötigen Wege abnabelt, die zu bedürfnisgerechten Handlungen führen. Da die Grundlage zur Verschaltung der Bedürfnisse wieder deren Voraussagbarkeit ist, gibt es auch Adaptionsprozesse bei Bedürfnissen. Abweichungsmaxima erleben wir als unbefriedigend, Annäherungsmaxima als befriedigend. Dazwischen liegt ein vorausgesagter Normalzustand, den wir eigentlich gefühlsmäßig gar nicht erleben. Dieser Normalzustand ist insofern interessant, als er offensichtlich die durchschnittliche Abweichung verkörpert. Dieser Durchschnitt verschiebt sich natürlich mit den Verhältnissen. Leben wir in guten Verhältnissen, so we rden wir anspruchsvoller, und uns kann nicht mehr zufrieden stellen, was einen Menschen aus armen Verhältnissen noch glücklich macht. Durchschnittlich sind wir nicht zufriedener oder unzufriedener als dieser. Für das Gehirn ist es nur wichtig, dass wir in Entscheidungssituationen den besseren Weg wählen. Es ist nicht notwendig, dass wir, wenn wir in schlechten Verhältnissen leben, rund um die Uhr leiden. Wichtig ist nur, dass wir die Chance ergreifen unsere Situation zu verbe ssern, wenn sie sich bietet. Dieses Regulativ kann am ehesten erreicht werden, indem das Gehirn alle Werte über längere Zeit hinweg am Durchschnitt adaptiert. Dazu braucht es keine neuen Regeln. Adaption haben wir bereits kennengelernt. Ich möchte an dieser Stelle nur darauf hinweisen, dass sie auch im Bereich der Bedürfnisreize gilt. Sie sorgt dafür, dass immer die volle Skala der Aktivierung und der Hemmung zur Steuerung genützt wird. 3.6.8 Vorstellung der Zukunft und der Vergangenheit Unsere Vorstellungen können in die Zukunft, aber auch in die Vergangenheit schweifen. Was diese beiden Richtungen unterscheidet ist meines Erachtens zunächst einmal die Quelle. Bedürfnisse wecken, wie eben besprochen, vergangene Erinnerungen, Sinnesreize wecken Zukunftsvorstellungen. Allerdings ist das nicht ganz so klar, denn unser Bewusstsein hat gar keine klare Definition von der Zeit einer Vorstellung. Die Zeit einer Vorstellung ergibt sich aus deren Anbindung an andere Vorstellungen. Zukunft und Vergangenheit trennen somit meines Erachtens nichts weiter als Details. Wenn ich an einen bestimmten Arbeitstag aus der Vergangenheit denke, dann ist er durch Vorfälle gekennzeichnet, die an anderen Arbeitstagen nicht stattfanden. Denke ich an den morgigen Arbeitstag, so kennzeichnen ihn die gerade laufenden Projekte. Denke ich an einen Arbeitstag vor einem Jahr, oder in einem Jahr, so fehlen mir die Detailinformationen, und mein Bild von diesen Tagen ist exakt gleich. Es ist eigentlich nichts zeitliches in der Vorstellung, das diese Bilder unterscheidbar machen würde. Datenkomprimierung im Gehirn entsteht dadurch, dass räumlich oder zeitlich Wiederholtes durch Mehrfachverwendung der gleichen gespeicherten Information 147 dargestellt wird. Ich greife also in beiden Fällen auf die gleiche Vorstellung z urück. Nur wenn ich etwas als zukünftig erreichbares Ziel erlebe, rutscht die Vo rstellung auf einmal von der Vergangenheit in die Zukunft. 3.6.9 Aussagenlogik Um alle Zusammenhänge der Welt repräsentieren zu können, muss der Zukunftsbaum verschiedene Verbindungen zulassen. Die Aussagenlogik, ein Teilbereich der Philosophie, hat eine Liste von fünf Verbindungsarten hervorgebracht, um jeden beliebigen logischen Zusammenhang darstellen zu können (Liessmann, Zenaty 1992, S.45) Und Wenn dann nicht zeitdefinierte Verbindung Zeitdefinierte Verbindung (Nacheinander) Nicht Hemmende Verbindung Oder auch Ich kann so, oder auch so Handeln (Verzweigung) Entweder oder Es kann diese oder jene Zukunft eintreten (Verzweigung) Genaugenommen muss also zwischen den beiden Arten von Oder-Verzweigungen unterschieden werden. Zukunftsverzweigungen, die auf unser Verhalten zurückgehen, sind entweder-oder-Verzweigungen. Dort siegt das stärkere Rücklaufsignal. Das stärkere und nähere Bedürfnis macht das Rennen. Ich muss durch Denkprozesse entscheiden, ob ich entweder so, oder so handeln will. Demgegenüber sind oder-auch-Verzweigungen solche, die zwei mögliche Zukünfte repräsentieren, die ohne mein Zutun alternativ eintreten könnten. Dabei wird ein Durchschnitt der Rücklaufsignale gebildet, denn ich habe nicht die Macht bestimmen zu können, welche der Zukünfte mich erwartet, also wird ein Durchschnitt beider Zukünfte mein Verhalten bestimmen. Läuft an einer solchen Verzweigung ein hemmendes Signal mit einem aktiven zusammen, so hebt es dessen Aktivität auf. Es wird dann wenig Motivation geben, an diese Verzweigung des Zukunftsbaumes zu gelangen, obwohl ein starkes Signal beteiligt war; denn das hemmende beteiligte Signal besagt, dass mich diese Zukunft genauso gut ins Verderben führen kann. Allerdings können solche Verzweigungen in einer Richtung stärker ausfallen, wir erwarten dann eher die eine, als die andere Zukunft. Dann muss auch das Gewicht der rücklaufenden Signale unterschiedlich stark zählen. Klarer ausgedrückt: An Verzweigungen des Zukunftsbaumes wo wir durch unser Handeln über unsere Zukunft entscheiden können (entweder oder) siegt das stärkere Rücklaufsignal. An Verzweigungen wo wir dies nicht können, und nicht genau wissen welche der beiden möglichen Zukünfte uns erwartet (oder auch), wird ein Durchschnitt der beiden Rücklaufsignale gebildet, und beide Wege bleiben offen, bis neue Wahrnehmungen uns zeigen welchen Weg die Dinge gehen werden. 148 3.6.10 Handlungen automatisieren (unbewusst erledigen) Verzweigungen von Zukunftsprognosen wurden nicht zu einem Zeitpunkt erlernt, sondern nacheinander, erst der eine Weg, dann der zweite Weg. Das heißt, erst wurde eine bestimmte Erfahrung gemacht, doch ein andermal hat die Sache zwar gleich begonnen, aber anders geendet. Ein Voraussagefehler entstand, eine Chunkzelle wurde gegründet, und eine Abzweigung zur neuen Situation angel egt. Was aber, wenn eine Verzweigung verfällt, weil immer der eine, nie der andere Weg gewählt wird? Dann ist keine bewusste Entscheidungsfindung mehr von Nöten, weil es ohnehin nur einen möglichen Weg gibt. So entsteht eine automatisierte Handlung, die wir unbewusst durchzuführen vermögen. Unser Bewusstsein brauchen wir nämlich nur, wo Entscheidungen zu fällen sind, die aus Zielvorstellungen hervorgehen. 3.7 Regeln für geistige Bedürfnisse und kreatives Verhalten Damit komme ich zum letzten Kapitel des Modells. Ziel dieser Arbeit ist es ja, zu zeigen, dass in allen Bereichen des Erkenntnisgewinns die selben Regeln gelten, und es möglich ist, eine Gehirnstruktur zu schaffen, die lernen kann Verschiedenstes zu verarbeiten. Dem Phänomen der Aufmerksamkeit kommt dabei besondere Bedeutung zu. 3.7.1 Aufmerksamkeit und das Bindungsproblem Geistige Aufmerksamkeit versus Abwesenheit ist ein Phänomen, das es in allen Bereichen des Erkenntnisgewinns gibt. Um es zu verstehen, müssen wir nun begreifen, dass die verschiedenen Prozesse, die ich bisher besprochen habe (Verbindungsfindung, Abziehbildsignalflusses, Zeiterwartung und Verhaltenskontrolle) alle auf dem gleichen Prinzip beruhen. Überall gab es einen Sollwert = Voraussage, und eine Abweichung = falsche Voraussage. Immer ging von dieser Abweichung ein Signal aus. Aber was geschah nun auf einen solchen Voraussagefehler? Da war die Rede vom Signalrückfluss zum Zwecke der Verbindungsabnabelung, aber auch von der Weitergabe nach oben und der Bildung einer Chunkzelle. Unter dem Stichwort „Abziehbildsignalfluss“ war die Rede vom Abfluss der Signale, beginnend beim Voraussagefehler. Bei der Zeitwahrnehmung war die Rede von der Unterdr ückung vorausgesagter Signale. Die Frage ist also: Wie erhalten wir ein einheitliches Modell? Was ist nun die Reaktion auf den Voraussagefehler? Es ist naheliegend, dass wenn wir die Reaktion auf Voraussagefehler definieren können, damit auch die Aufmerksamkeit definiert ist, denn nichts erregt uns ere Aufmerksamkeit mehr, als das Unerwartete (Sperling 1998, Stangl 2002). Aufmerksamkeit ist die Grundlage seriellen Denkens. Wir denken alles 149 nacheinander, in der Reihenfolge, in der es unsere Aufmerksamkeit erregt. Um zu erklären, wie es zur Serialität des Denkens kommt, hat das Modell angenommen, dass von den Vorstellungen jene stärkste siegt, die abgenabelt werden kann. In der visuellen Wahrnehmung gibt es auch Aufmerksamkeit. Bei der Zeitcodierung der örtlichen Position von Punktanordnungen haben wir auch besprochen welche Verbindungen sich durchsetzen. Aber von einer Serialität kann man da noch nicht sprechen. Wie wir an uns selbst beobachten können, können wir unsere Aufmerksamkeit nur auf ein Objekt zu einem Zeitpunkt lenken. Wie kommt es zu dieser Serialität in der visuellen Wahrnehmung? Es scheint unmöglich, ein solches Nacheinander zu modellieren, wenn wir annehmen, dass jeder Voraussagefehler sowohl zu einer Weitergabe des Signals an die nächste Ebene, als auch zu einem Rückfluss der Signale innerhalb der Ebene, durch den Abziehbildsignalfluss führt. Bei jedem Voraussagefehler würden sich die Signale verzweigen und so nie zu einem Strang verschmelzen, wie es das serielle Denken verlangt. Aber genaugenommen sind Signale, welche auf der nächsten Ebene miteinander verbunden, und auf diese Weise vorausgesagt werden können, ja gar keine Voraussagefehler!! Sie dürfen daher auch auf der vorhergehenden Ebene nicht zum Abziehbildsignalfluss führen, zumindest vorläufig noch nicht! Vielmehr werden sie von Ebene zu Ebene weitergegeben, bis ein Teil von ihnen in der Hierarchie der Verschaltungen so weit nach oben gelangt ist, dass keine Voraussage mehr möglich ist. Dort erst, wo noch keine geeignete Chunkzelle gebildet ist, bzw. diese noch nicht verschalten werden konnte, dort erst entsteht der Voraussagefehler. Dort entspringt der Impuls unserer Aufmerksamkeit. Nun fließt das Signal über alle Ebenen zurück. Erst jetzt kommt es auf den Ebenen zum Abziehbildsignalfluss. Wenn es an derzeit aktiven Sinneszellen anlangt, aktiviert es diese. Die Wirkung der Aufmerksamkeit bis hinab auf die primäre Sehrinde ist bereist durch Experimente belegt (Spektrum-Ticker 1999.05.07, Spektrum-Ticker 2001.02.26). Ein Objekt führt zu Redundanzketten in seiner Fläche, es führt aber eine Ebene höher auch zu Redundanzketten entlang seiner Konturen. Es gibt eine stärkere Verbindung zwischen Konturen gleicher Farbe, gleicher Bewegung, gleicher Entfernung. All diese Ketten bilden eigene Ebenen (Quasiebenen), aber all diese Ebenen stehen auch miteinander in Verbindung, da sie alle, wenn auc h über Umwege, von den Zellen der Netzhaut gespeist werden. Die rückfließenden Signale durchsteigen alle diese Ebenen. Der Abziehbildsignalfluss führt dazu, dass die Signale auf allen Ebenen fast gleichzeitig im Objektzentrum ankommen. Alle Signale verlaufen also synchron. Das Modell erklärt damit wie es dazu kommen kann, dass Neuronen, die zum Reaktionsbild eines Objektes gehören, dem wir Aufmerksamkeit schenken, alle synchron zu pulsen beginnen. (Studie auf Spektrum-Ticker 2000.03.16) Die Länge der Fließsignale und ihr Ort, das heißt die Ebene, auf der sie sich bilden, beschreiben die visuellen Eigenschaften des Objektes. Diese werden nun zeitlich verarbeitet. Ist das Objekt schon länger im Blickfeld, so sind die zeitlichen Codes, 150 die es vermittelt bekannt, und es ergeht ein hemmendes Signal durch das gesamte Netz der Redundanzketten zurück. Das Objekt ist damit deaktiviert. Kommt jedoch ein neues Objekt in unser Blickfeld, z.B eine herbeilaufende Ka tze, so erregt sie unsere Aufmerksamkeit, weil sie zu neuen Redundanzketten und neuen Zeitcodes führt, also zu Voraussagefehlern. Das Neue kann isoliert betrachtet werden, da das Alte bereits deaktiviert ist. Das bedeutet, es funkt keine fremde Information dazwischen. Damit führt uns das Modell der Aufmerksamk eit zur Lösung des nächsten Problems: 3.7.2 Trennung von Figur und Grund Das Modell der Aufmerksamkeit bietet aber nicht nur eine Erklärung dafür, wie durch Redundanzketten alle Reize, die ein Objekt ausmachen, zusammengeha lten werden können (Bindungsproblem Spektrum-Ticker 2000.06.13, Hardcastle 2002), es bietet damit auch eine Erklärung für die Trennung von Figur und Grund. Eine Figur bildet einen Redundanzbereich, der durchflossen werden kann. Ist die Figur abgeschaltet, so kann der Grund ungehindert durchflossen werden. Die Figur steht dem Signalfluss nicht mehr im Weg. Die Signale können nun den gesamten Grund durchfließen. Die abgeschalteten Flächen, wo einst die vordergründige Figur aktiv war, gelten nun einfach als Lücken zwischen aktiven Bereichen des Hintergrundes. Es sind Lücken, die selbst keine Aktivität haben, also nichts Sichtbares vermi tteln. Durch den Signalfluss über diese Lücken hinweg, werden die Formen des Hintergrundes ungehindert verarbeitet. Nun ist dessen Form erkennbar. Oft wird der Grund in sich auch wieder eine Figur bilden. So können auch Überschneidungen von Objekten verarbeitet werden. Eine weitere Hilfe zur Trennung von Figur und Grund, bietet die Entfernungswahrnehmung. Auch hier gilt: Nahes wird zuerst behandelt. Ist es erkannt, und abgeschaltet, so kann der Hintergrund verarbeitet werden. 3.7.3 Der Lerntrieb bzw. ästhetische Trieb Die Aufmerksamkeit wird also immer auf den am stärksten komprimierbaren Aspekt gelenkt, weil von dort die stärksten Signale ausgehen, wie im obigen Beisp iel der Kreis. Letztlich werden aber die unerwartetsten Aspekte innerhalb einer Wahrnehmung am längsten verarbeitet, weil sie nicht abgeschaltet werden können. Die Voraussagefehler führen also zu aktivierenden, die Voraussagen zu deaktivierenden Rückflusssignalen. Die aktivierenden Rückflüsse der Voraussagefehler gleichen dem Rückflusssignal, welches im Zukunftsbaum den Weg isolierte, der dann unser Handeln lenkte. Aber wenn es sich dort um die selbe Art von Signalen handelt, müssen dann nicht auch die hier entstehenden Rückflusssignale einen Weg isolieren, der sobald motorische Zellen dem Weg liegen, eine Handlungsanweisung darstellt? Zwar entspringt das 151 Rückflusssignal in diesem Fall nicht dem Lustzentrum, aber es bleibt doch ein Rückflusssignal. Welchen Ursprung hat es nun eigentlich? Es entsteht an den Voraussageenden, dort also, wo nach neuen Lernverbindungen gesucht wird. Tatsächlich haben wir, wie ich im Folgenden zeigen werde, damit schon den Lerntrieb definiert. Das Rückflusssignal, welches zur Verbindungsfindung notwendig ist, kann, wenn es über die Startzellen in ältere Ebenen vordringt, also die Verbindungen zeitlich zurückläuft, einen Verhaltensweg isolieren, also als Bedürfnis wirken. Was ich hier annehme ist also eine enge Verwandtschaft zwischen den Mechanismen, die Aufmerksamkeit auslösen, und jenen, die Handlungen verursachen. Der Unterschied liegt nur darin, dass bei zweiteren motorische Neuronen beteiligt sind. Ich bin nicht der erste, der eine solche Gleichartigkeit der Mechanismen annimmt (Siehe Artikel von Balkenius 2000). Um mich verständlich zu machen, will ich mit den Überlegungen noch einmal e twas weiter vorne beginnen: Erinnern wir uns an das grafisch dargestellte Beispiel mit Evas blauen und Karls großen Augen. Wir haben festgestellt, dass neue Verbindungen nur gebildet werden, wenn Voraussagen fehlschlagen, denn solange alles vorausgesagt werden kann, ist Lernen blockiert (Macho 1999). Verläuft also alles um uns herum wie gewohnt, so werden die Erwartungen, die in unserem Gehirn entstehen, immer bestätigt. Erst wenn eine Erwartung nicht bestätigt wird, wird eine neue Chunkzelle gebildet, die die neue Situation repräsentiert. Da diese neue Situation ja in Zukunft auch vorausgesagt werden soll, versucht diese neue Chunkzelle Verbindungen zu knüpfen. Sie sendet Kämmsignale aus und nimmt mit anderen aktiven Zellen Kontakt auf. Von dem Kontaktpunkt ausg ehend fließt ein Signal zurück, um die Verbindung abzunabeln. Bei der Besprechung des Phänomens „Aufmerksamkeit“ sind wir davon ausgegangen, dass dieses Rücklaufsignal nicht nur bis zur Chunkzelle fließt, sondern weiter, über bereits vorhandene Verbindungen, auch auf tiefere Ebenen zurückfließt, und dort Aufmerksamkeit bewirkt. Was ist aber, wenn die Redundanzketten zeitlicher Natur sind? Dann fließt das Signal gegen den Zeitstrom, bis es sich durch Verbindungswiderstände verliert, oder aber über Umwege wieder bei gegenwärtig aktiven Sinneszellen landet. In diesem Fall kann von der gegenwärtigen Reizsituation ein Weg in eine Zukunft angestrebt werden, die wieder zu den erkannten Zusammenhängen führen müsste. Die Zusammenhänge können dann in dieser Zukunft noch einmal erlebt, und somit überprüft we rden. Wenn das Rücklaufsignal von den gegenwärtigen Sinnesreizen in die Vergangenheit laufen kann, bis es sich aufgrund der Wiederstände der Leitungen verliert, was unterscheidet dann noch Wahrnehmung von Vorstellung. Antwort: Wahrnehmung bedarf, genauso wie motorische Aktivität, zusätzlich noch des Echtzeit-Erwartungssignals. Dieses ist nur bei gegenwärtig vorhandenen Reizen gegeben. Was ist nun der Effekt von einem Rücklaufsignal über die Gegenwart hinaus in die Vergangenheit? Diese Rücklaufsignal wird, sofern es nicht von einem stärk eren 152 überschrieben wird, unsere Aufmerksamkeit und unser Verhalten dahin lenken, dass wir noch einmal die neue Situation betrachten, bzw die davor vollfüh rten Handlungen noch einmal setzen. Die Handlungen bringen uns also wieder in die eben erlebte Situation, und dabei können die neu entstandenen Verbindungen gleich überprüft werden. Bestätigen sie sich nicht, so entsteht wieder ein Voraussagefehler, wieder eine Chunkzelle, die wieder neue Verbindungen aufbaut, wobei wieder Rücklaufsignale entstehen. Der Prozess startet so oft von vorne, bis entweder ein gültiger neuer Zusammenhang erkannt ist, oder Adaptionsprozesse die Reizschwelle der beteiligten Zellen so weit hinaufgesetzt haben, dass die Lernversuche zum Stillstand kommen. An Kleinkindern ist die Tendenz zum Lernen durch Wiederholung gut zu beobachten. Man denke nur an das Spiel: Dose auf, Ding hinein, Dose zu. Dann wieder auf, Ding heraus, Dose zu, und alles von vorne… Die Vermutung, dass Aufmerksamkeit und der Erwerb von Körperkontrolle dem selben Mechanismus entspringt, dass ihnen also ein allgemeiner Lernt rieb zugrundeliegt, ist relativ neu (Balkenius 2002). Aber was mag der Lerntrieb mit Ästhetik zu tun haben? Nach psychologischer Lehrbuchmeinung begründet sich das ästhetische Empfinden, das uns bestimmte Dinge, wie Kunst- und Designgegenstände vermitteln, aus einer erlernten Verbindung zu einem Grundbedürfnis. Das passt auch ganz gut zu den klassischen Bildthemen der Malerei: Der Akt ist sexuell motiviert, das Portrait sozial (Erinnerung an jemanden), das Landschaftsbild territorial, und das Stilleben ging aus Nahrungsmitteldarstellungen hervor. Alles fußt auf Grundbedürfnissen. Aber was ist mit der abstrakten Ästhetik eines Musikstückes, eines Musters, eines Versreimes, eines Tanzes, oder abstrakter Malerei? Warum hat die Evolution uns solch ein Bedürfnis mitgegeben? Welchen Zweck mag es haben? Die Antwort: All diese Dinge enthalten Rhythmen, also Wiederholungen! Nur wo die Welt sich wiederholt, kann sie der Mensch voraussagen, und nur wo er das kann, kann er das Ergebnis seines Handelns erahnen, und nur wenn er das kann, kann er sinnvoll handeln. Deshalb interessieren uns Bereiche der Welt, wo sich etwas wiederholt. Der Lerntrieb und die von ihm ausgelöste Empfindung von Neugier oder Ästhetik ist sozusagen ein eigens veranlagtes Bedürfnis (Stangl 2002). 3.7.4 Die Notwendigkeit des Lerntriebes für den Erwerb der Bewegungsko ntolle Es ist gewiss so, dass ein Baby noch kaum eines seiner körperlichen Bedürfnisse selbst erfüllen kann. Deshalb kommen diese für seine Aktivitäten als Auslöser nicht in Frage. Der Hauptauslöser liegt somit beim Lerntrieb. Erst wenn das Baby genug Einblick in die Welt erworben hat, und Voraussageverbindungen zu den körperlichen Sollwerten entstanden sind, können diese wirksam werden. Damit es soweit kommt, muss erst einmal der Lerntrieb in Kraft treten (vgl. WSA 2002.11.29). 153 Genaugenommen dürfte das Lernen durch Wiederholung schon beim Embryo beginnen, also schon zu einer Zeit, wo sich das Gehirn entwickelt. Es ist anzunehmen, dass bereits ein Embryo lernt, seine Bewegungen ein wenig zu kontrollieren. Der Prozess beginnt damit, dass Verbindungen geschaffen we rden, wenn Reize oftmals zeitgleich aktiv sind. Zum Beispiel die motorischen Ze llen, die ein Bein bewegen, und die Gelenkssensoren, die die Bewegung des Beines rückmelden. Nehmen wir an, die Verbindung startet bei abgewinkeltem Gelenk und vollem Signal des Gelenksensors, und führt zu einem Ausstrecken des Beines und damit verstummen des Gelenksensors. Die Regel lautet also: Je mehr Aktivität zu den Muskeln kommt, desto weniger meldet der Gelenksensor. Die motorische Zelle wird mit der „Anti-Gelenksensorzelle“ eine Verbindung eingehen. (Wir erinnern uns, dass es im System zu jeder Zelle eine Anti-Zelle gibt, die verkehrt herum reagiert) Wenn es irgendwann wieder zu einem abgewinkelten Bein kommt, ist die Ausgangsbedingung da, um die Bewegung wiederholen zu können. Heißt das, das System muss warten, bis es zufällig wieder zur Ausgangssituation kommt? Nein! Nicht wenn es schon über ausreichende Erfahrung verfügt. Dann kann das beschriebene Rücklaufsignal von der neuen Lernerfahrung über die Verknüpfungen zurücklaufen, bis es auf eine Situation stößt, die der Gegenwart (nach der Lernerfahrung) entspricht. Von dort können Handlungen gesetzt werden, die wieder in die Situation führen, die vor der Lernerfahrung geherrscht hat. Dann kann die Lernerfahrung wiederholt werden. In unserem Fall könnte also das Bein wieder abgewinkelt werden. Ist sowohl das Abwinkeln als auch das Strecken des Beines ansatzweise erlernt, so wird der Embryo zu strampeln beginnen, bis beide Bewegungen im Gehirn richtig stabil verknüpft sind, und jeweils eine eigene Chunkzelle gebildet haben. Auf diese Weise erlernt er Bewegungskontro lle. Ausgangspunkt war also das Rücklaufsignal, das bei der Verbindungsfindung entsteht. Es ist nicht durch eine Sollwertabweichung eines Bedürfnisses gebildet, sondern es ist ein, für Lernprozesse notwendiges Rücklaufsignal. Aber es kann als Handlungsauslöser fungieren. Dann sprechen wir vom Spiel- bzw. Lerntrieb. Allerdings ist dieser nicht so stark wie die körperlichen Bedürfnisse. Kommen die stärkeren Rücklaufsignale aus dem Lustzentrum dazwischen, so werden die schwächeren des Lerntriebes überschrieben. Das freie Spiel, mit dem Kinder die Welt kennenlernen, ist also am ehesten zu beobachten, wenn es ihnen gerade sonst an nichts fehlt, also kein körperliches Bedürfnis zu aktiv ist. Der Lerntrieb dient also dazu, das Gehirn anzuhalten, erst einmal möglichst viele Informationen über die Welt zu sammeln, in der Hoffnung, diese Wissen später einsetzen zu können, um Bedürfnisse zielgerichtet befriedigen zu können. Aber nach welchen Kriterien können die Informationen gesammelt werden, solange noch keine Bedürfnisse im Spiel sind? Zunächst nach dem Kriterium der Komprimierbarkeit, denn es kann eine größere Menge an Information abgespeichert werden, wenn sie komprimiert in den Speicher kommt. Zweitens nach der Wiederholbarkeit, also Gültigkeit. Mit einer Information, die ich gleich überprüfen kann, passiert es mir nicht, dass sie lange Zeit wertvollen Speicherplatz besetzt, und sich letztlich als falsch herausstellt. 154 Beide Kriterien sind im Lerntrieb automatisch inkludiert. Die Komprimierung aller Informationen entsteht durch die Verknüpfungshierarchie bereits vorhand ener Chunks, und die Überprüfung neuer Informationen entsteht durch die Tendenz zur Wiederholung, da das Rücklaufsignal, welches beim Voraussagefehler startet, die davor aufgetretenen Handlungen noch einmal aktiviert, bis Voraussage erlernt wird. 3.7.5 Kreativität. Ausprobieren neuer Handlungen Der Leser wird vielleicht verblüfft sein, wenn ich nun, da das Modell fast fertig ist, feststelle, dass es in seiner jetzigen Form noch überhaupt nichts leisten würde. Ein Baby kann nämlich keine Handlungen erwerben ohne Ausprobieren. Das blieb bisher ungelöst. Unser System beobachtet also die Abläufe der Welt, und versucht sie vorauszusagen. Auch die Kontrolle des Verhaltens erfolgt auf diese Weise. Es beobachtet, welche Bewegungen aus der Aktivität bestimmter motorischer Zellen (die ihre Signale an die Muskeln leiten) hervorgehen, und versucht diese Bewegungen vorauszusagen. Auch die Konsequenzen der Bewegungen werden vorausgesagt, und so kann das System in Zukunft zielgerichtete Handlungen setzen. Aber damit es lernen kann vorauszusagen, welche motorische Zellgruppe welche Bewegung auslöst, muss die Bewegung erst einmal beobachtet werden. Es müssen Bewegungen ausprobiert werden. Nur durch Versuch und Auswahl können die ersten Schritte des Bewegungslernens erworben werden. Mutation und Selektion wurden von vielen Wissenschaftern als die Prinzipien schlechthin dargestellt, die der Entwicklung des Gehirns zugrundeliegen (Edelmann 1993 S.28f, Calvin 1993). Aber inzwischen hat sich gezeigt, dass ohne statistische Prinzipien, die zu einer inneren Welt mit Voraussicht führen, nicht viel erreichbar ist. Die Differenz zwischen den beiden Methoden hat Marken (2000) sehr schön mit einem Wegfindungsspiel veranschaulicht. Aber woher kommt nun der nötige Impuls für die ersten Bewegungen? Da ja noch kein Ziel da ist, kann der dazu nötige Impuls nur nach dem Zufallsprinzip gesetzt werden. Unser System muss sich also erst einmal chaotisch verhalten, bevor Kontrolle erlernt werden kann. Das ist ja auch an den chaotischen Bewegungen eines Embryos zu beobachten. Woher kommt nun der nötige Zufall. Aus meiner Sicht gibt es dafür eine klare Quelle. Er kommt aus dem, jedem System eigenen, Hintergrundrauschen. Ich stelle mir vor, die Zellen sind im Ursprung zufallsaktiv, wobei die Durchschnittliche Aktivität sich ähnlich verhält wie das Rauschen eines Fernsehers ohne Empfang, oder eines lautgedrehten Verstärkers ohne Input. Dazu braucht es keine neue Regel. Adaption sorgt dafür, dass Zellen in ihrer Sensitivität maximal „lautgestellt“ sind, solange sie noch keine Reizerfahrungen gemacht haben. Dieses „graue“ Rauschen, wird mit zunehmender Lernerfahrung gehemmt oder aktiviert, so 155 dass sich, nach den Konditionierungsregeln, die erhöhte oder verminderte Bereitschaft der Zellen ergibt, zu Feuern. Das Rauschen hat noch eine Funktion. Zellen können zu einem Zeitpunkt ja nur entweder feuern oder schweigen. Das Rauschen dient, wie ein Raster dazu, di eses Entweder- Oder aufzuteilen in ein Mehr, oder Weniger. Rauschen vermindert also nicht die Leistung des Systems, sondern erhöht sie sogar. Dies will ich mit folgender Grafik verständlich machen: Stellen wir uns einen ganz kurzen Zeitpunkt vor. Zellen der Netzhaut können innerhalb dieses Zeitraums nur zwei Zustände einnehmen. Entweder sie senden gerade einen Impuls, oder eben nicht. Ein dazwischen gibt es nichts. Das Bild von mir, würde dann so dargestellt, wie wenn ich es mit einem Schwellenwert behandle. Stellen wir uns nun vor, das Originalbild ist stark verrauscht, und führen wir dann noch einmal den Schwellenwert durch. Wir sehen, dass in diesem Fall durch das Rauschen ein viel informationsreicheres Endergebnis entstanden ist. Dass Signalrauschen die Wahrnehmung unterstützt, legen auch neurologische Studien nahe (WSA 2002.05.24). Was das Zusammenspiel von Zelle und Antizelle betrifft, so kann man sich das mit dem Zufallsrauschen folgendermaßen vorstellen: Eine nicht verschaltete Zelle weist Zufallsrauschen auf. Grundlage des Rauschens ist die maximale Taktfrequenz. Das Rauschen weist mittleres Grau auf, also durchschnittlich halbe Taktfrequenz. Rauschen ist für die bayesianische Statistik durchschnittlich nicht von Bedeutung, weil zwischen rauschenden Zellen ebensooft Löschungen wie Verbindungen 156 gebildet werden. Die Antizelle rauscht mit, aber sie reagiert jeweils negativ zur Zelle. Eine Aktivierung entsteht, indem Aktivität von der Antizelle in die Zelle verlagert wird. Aktivität wird also nicht gebildet, sondern nur verschoben. Ich vermute, dass ein System machbar ist, in dem das, Rauschen, also die ungeordnete Energieform, keinen Energieverbrauch kostet. Die Verlagerung würde dann aber sehr wohl etwas Energie kosten, denn es entsteht ja ein Mehr an Ordnung, und Ordnung kostet Energie. Die hier dargestellte Idee, dass dem Gehirn das Hintergrundrauschen als Kreativitätspotential dienen könnte, gilt inzwischen fast schon als bestätigt. Dopamin und Noradrenalin werden im Gehirn ausgeschüttet werden, um das Signal/Rauschverhältnis sinnvoll zu modulieren (Spitzer S. 289-315). Entspannung, und damit einhergehendes höheres Rauschen, führt zu mehr kreativem Potential. 3.7.6 Das Verhältnis von „Außenwelt“ zu „Innenwelt“ Es mag so scheinen, als wäre dieses Herumprobieren, das unserem Bewegungslernen zugrundeliegt, ein äußerst uneffektives Verfahren, um Erkenntnisse zu gewinnen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir kaum eine neue Handlung setzen können, ohne etwas Wesentliches zu lernen, denn jeder neue Umgang mit Objekten bringt neue Objekteigenschaften zutage. Was immer wir mit einem Objekt machen, offenbart Informationen, an denen wir später Objekte erkennen können. Werfen wir ein Ding in das Wasser, so erfahren wir etwas über seine Löslichkeit. Stoßen wir Dinge aneinander, so hören wir ihren Klang. Schmeißen wir sie, so erfahren wir deren Zerbrechlichkeit. Durch weit ere Handlungen können Eigenschaften wie Wärmeleitfähigkeit, Verklebbarkeit, Fettlöslichkeit, elektrische Leitfähigkeit, Durchlässigkeit für verschiedene elektromagnetische Wellen usw. erfahren werden. Die ganze Wissenschaft baut darauf auf, ständig neue Handlungen zu erfinden, deren Ausgang im vorhinein noch nicht klar sein kann. Ohne solche Spielerei hätten wir nicht viel Wissen über die Welt. Neue Eigenschaften sind immer Grundlage für neue Entwicklungen, vom Klebstoff bis zum Röntgengerät. Jeder Qualität, die wir von einem Objekt kennen, liegt ein Verfahren zugrunde, das wir spielerisch erfunden haben. Die Qualit äten sind sogesehen unsere Erfindung. Natürlich gibt es auch einige Eigenschaften, wie zum Beispiel die Lichtrefflexionsfähigkeit von Objekten, auf die wir die Objekte mit unseren angeborenen Sinnen untersuchen, in dem Fall dem Auge. Aber auch diese Sinne sind „spielerisch“ durch Zufall, also durch Mutationen erlernt worden, allerdings nicht von uns, sondern evolutionsgeschichtlich von unseren tierischen Vorgängern. Auch die phylogenetische Entwicklung unterliegt den Gesetzen des Erkenntniserwerbs. Eigenschaften bestehen immer aus den zwei Komponenten Qualität und Quant ität. Ich kenne keinen Philosophen, der erklärt hätte, wie sie zustande kommen, weil sie eben nicht logisch zu erklären sind. Es ist unser spielerisches Zutun, das die 157 Qualität erfindet. Die Natur vermittelt uns nur die Quantität in der eine Qualität auf ein Objekt zutrifft. In der Außenwelt, jenseits von uns, gibt es sogesehen nur Quantiäten, also Quanten. Ich will die Sache mit dem Zufall, dem Rauschen, der Mutation bzw. der Spielerei (wie immer wir es nennen wollen) damit abschließen. Es sind ja bereits neuronale Netze bekannt, die auf Zufall und Auswahl (Mutation und Selektion) beruhen (Edelmann 1993, S.387). Die letzten Ausführungen sollten nur zeigen, dass diese Idee durchaus, ohne wesentliche Schwierigkeiten, mit dem hier dargestellten Modell vereinbar ist, ja sogar vereint werden muss, um kreatives Verhalten zu erkl ären. Damit sind alle mir bekannten Problemstellungen eines selbstlernenden Systems ansatzweise gelöst. Das Modell ist im Prinzip fertig! Es folgt eine Zusammenfassung der Regeln und die Anwendung auf die Sehrinde. 158 4 ZUSAMMENFASSUNG ALLER REGELN Der folgende Regelhaufen mag erschreckend wirken. Andererseits ist jeder Satz, den ich in einer Hilfeanleitung zu einem gewöhnlichen Computerprogramm wie Word finde, eigentlich eine Regel des Programms. Sogesehen ist ein Programm wie Word viel komplizierter als das hier dargestellte Modell, das mit den folgenden 36 Sätzen beschrieben werden kann. Ich nehme an, die meisten bereits verwirklichten KI-Systeme sind komplizierter, wenn auch einfacher umzusetzen. 4.1.1 Regeln zur Verbindungsstärke: 1. Zur Festlegung der Verbindungsstärke muss erfasst werden, wie oft: A insgesamt auftrat, A und B zusammenfielen, und B insgesamt auftrat. Um die Stärke der Voraussage zu erfassen, muss im Neuron der zweite Wert durch den ersten dividiert werden. 2. Verbindungsverfall: Um zu erfassen ob die Verbindung aufrecht erhalten werden soll, muss die Zahl wo A und B zusammenfiel durch die Zahl allein auftretender B dividiert werden. Vorrang neuer Information: Die nötige Mehrgewichtung neuer Verbindungen (Adaption an die neuen Bedingungen) wurde durch das Prinzip des Farbenmischens veranschaulicht. Weiße Farbtropfen repräsentierten die Reizkombination AB, schwarze den Reiz A. Die Mischung repräsentiert die Wahrscheinlichkeit, dass auf A B folgt. Ist der Mischtopf voll, tritt Adaption in Kraft, das heißt, es wird Mischfarbe verworfen damit neue Farbe Platz hat. 3. Gesetz der Nähe: Nahes wird eher verbunden als Entferntes. Das ergibt sich aber im Signalfließnetz automatisch. 4. Hemmung: Jeder Zelle ist eine Antizelle zugeordnet, die auf die Inputsignale negativ reagiert. Über sie werden daher hemmende Verbindungen entstehen. 4.1.2 Regeln zur Verbindungsfindung 5. Kreisförmige Ausbreitung: Die Signale müssen innerhalb der Ebenen in einem unscharfen Verlauf weitergegeben werden, weil gezeigt werden konnte, dass sie sich dadurch kreisförmig, also nach allen Richtungen gleich schnell ausbre iten. 6. Vorwärtsfluss: Die Signale fließen vorwärts, nicht zurück, da eine Zelle, die gerade ein Signal abgegeben hat, keines empfangen kann. Diese vorläufige Blockade ist auch für die Zeiterfassung ausschlaggebend. 7. Bevorzugung jeweils eigener Zellen zur Signalweitergabe. Ein Signal wird nur dann an eine Zelle weitergegeben, die auch von einer anderen Quelle b eliefert wird, wenn keine freie Zelle vorhanden ist. 159 8. Rückfluss: Treffen die Signale auf der Ebene aufeinander, und ist kein Platz, um Signale weiterzugeben, werden die Signale so lange aufbewahrt, bis die benachbarten Zellen wieder aufnahmefähig sind. 9. Kämmsignale: Kämmwege dienen der Verbindungsfindung. Der Signalflüsse, welche zu den Kämmlinien führen, überschreiben einander. Die entstehende Kämmrichtung beschreibt den Mittelweg der sich überschreibenden Richtungen. 10. Ende des Kämmsignalflusses: Trifft ein Signal auf einen Bereich, der bereits Quer zu seiner Fließrichtung durchkämmt wurde, kann es nicht mehr weiterfließen, weil der Mittelweg zweier entgegengesetzter Wege einer Löschung gleic hkommt. 4.1.3 Regeln zur hierarchischen Organisation der Verbindungen 11. Die Bildung einer neuen Chunkzelle: Verbindungen entstehen zwischen gleichzeitig gereizten Zellen. Die Aktivierung der Zelle (durch die Sinne) kann durch die Verbindung zur anderen Zelle fließen, und von dort weiter zur näch sten. Ist eine Zelle der Kette nicht wie erwartet aktiviert, so entsteht ein Voraussage fehler. Das Signal wird in die nächste Ebene weitergegeben. Dort bildet sich die Chunkzelle. Sie wird jedes mal wieder aktiviert werden, wenn dieser Voraussagefehler en tsteht. 12. Wieviel Signal wird weitergegeben? Es wird immer nur jener Teil des Signals weitergegeben, der nicht vorausgesagt werden konnte. Wenn auf höherer Ebene festgestellt werden muss, dass die Enden der Kette nicht vorausgesagt werden können, fließt ein Signal die ganze Kette zurück (Abziehbildsignalfluss). Solange jedoch Voraussagen möglich sind, bleiben solche Signale aus (Lernblockierung). 13. Verschaltung der Chunkzellen: Eigentlich ist jede Zelle, die aus einer Abzweigung einer Verbindungskette hervorgeht, eine Chunkzelle. Neue Chunkzellen gehen miteinander Verbindungen nach den üblichen Regeln der Verbindungsfindung ein. Man könnte sagen, an jeder Astgabelung des Zukunftsbaumes sitzt eine Chunkzelle. Dadurch entsteht die Hierarchie im De nken. 14. Platz der Chunkzelle: In Und-Verbindungen, wo Voraussagesignale von den Enden einfließen, entsteht die Chunkzelle in der Mitte der Verbindung, dort wo der Abziehbildsignalfluss austritt. Demgegenüber gibt es in zeitlichen Verbindungen eine klare Fließrichtung, die dazu führt, dass die Chunkzelle am Anfang der Verbindung entsteht. 4.1.4 Regeln zum Zusammenfluss der Signale 15. Kombination versus Serialität: Gleiche Signale können zusammen in eine Leitung fließen: Unterschiedliche Signalstärken können nicht vermischt we rden. Es siegt das stärkere Signal. Ist dieses verarbeitet, und damit abg estellt, kommt das schwächere zum Zug (Serialität der Aufmerksamkeit). 16. Zahl und Stärke beim Zusammenfluss: Beim Zusammenfluss mehrerer Signale entsteht in der Antizelle die Summe ihrer Negativa. Die Gesamtreizung der 160 Antizelle muss dann nicht immer das Negativ zum Gesamt der Zelle darstellen. So kann Zahl und Stärke der zusammengeflossenen Signale unterschieden werden. 17. Stärke der Verbindungen: Beim Abfluss bzw. Zusammenfluss der Signale siegen kurze Verbindungen vor längeren. 18. Universalität der Regeln: Die entstehenden Verbindungen führen in Summe zu einem neuen Netz, in dem aber immernoch die gleichen Regeln gelten. Im visuellen System entstehen Quasiebenen (flächendeckende Verbindungsketten), wie jene der Balkendetektoren. 19. Abziehbildcodierung/Start: In Und-Verbindungen kommt es unter gleich gereizten Zellen zu keinem Signalaustausch. Der Abfluss der Signale beginnt an den endgültigen Voraussageenden. Die befinden sich in den obersten bisher verschalteten Ebenen. Innerhalb der Unterebenen führt er dann zur Abziehbildcodierung. Der Startzeitpunkt wird durch die, in Und-Verbindungen halb so schnell fließenden Erwartungssignale festgelegt. Das Abziehbild ergibt sich durch die doppelt so schnellen Vorstellungssignale. 20. Abziehbildcodierung/Abfluss: Der Abfluss aus der Ebene ergibt sich bei der Abziehbildcodierung an der Stelle, wo die Signale nicht mehr weitergegeben werden können, also z.B. in der Mitte einer Fläche gleichgereizter Zellen. Dort wird das Signal aus der Ebene an neue Zellen weitergegeben, wo es vor allem zeitliche Verarbeitung auslöst. 21. Warum kehrt das Signal nicht um, wie bei der Verbindungsfindung? Weil es sich um Zellen handelt, die alle durch die Wahrnehmung aktiviert sind und bereits verschalten sind. 4.1.5 Regeln zur zeitlichen Voraussage 22. Vorstellungssignale und Erwartungssignale: Es muss zwei Arten von Signalflüssen geben. Die schnellen Vorstellungssignale, die ohne Zeitverlust die Verbindungen entlanglaufen, und die Erwartungssignale, die die erlernten zeitlichen Distanzen zwischen Reizen repräsentieren, indem sie immer erst weitergegeben werden, wenn die Voraussage überprüft ist. Dadurch laufen sie parallel zur Ech tzeit der Welt. 23. Der zeitliche Voraussagefehler entsteht, wenn die weitergegebenen Erwartungssignale nicht mit einem erwarteten Reiz zusammentreffen 24. Adaption: auszuschöpfen. ist notwendig um das volle Reizpotential von Neuronen 25. Unterscheidung von Reizstärke und Reizlänge: Dies geschieht, wie schon im visuellen System, durch die Zusatzinformation der Antizelle. Ihre Reizstärke in Relation zur Reizstärke der Zelle ist entscheidend. 26. Zeiterfassung: Erwartungssignale sollen mit der Realwelt übereinstimmen (parallele Welt). Da Zeitlängen durch eine Hierarchie von Verschaltungen auf die maximale Impulsrate der Neuronen zurückgeführt werden, muss das 161 Erwartungssignal lediglich diese gesamte Verschaltungshierarchie durchwandern, um durch die Impulsrate so abgebremst zu werden, dass es mit der Realzeit übereinstimmt. 27. Die Verbindung nicht zeitgleicher Signale: Zellen bleiben kontaktfähig, solange sie nicht vorausgesagt wurden, und auch nicht durch Adaption verstummen. Im Fall eines Zeitunterschiedes liegt die Aktivierung der ersten Zelle schon zurück. Sie hat daher jetzt kein Kämmsignal ausgesandt, wird aber vom Kämmsignal der neu aktivierten Zelle erfasst, und antwortet mit Signalrücklauf. Das Rücklaufsignal entsteht also nicht in der Verbindungsmitte, sondern direkt bei der kontaktierten Zelle. 4.1.6 Regeln für körperliche Bedürfnisse 28. Sollwertabweichungen: Körperliche Bedürfnisse werden durch Signale (und deren Verknüpfungen) repräsentiert, die entstehen, wenn ein Messwert nicht dem genetisch vorgegebenen Sollwert entspricht. 29. Rückfließende Signale: Die Signale der Sollwertabweichungen (Bedürfnisse) verbinden sich untereinander nach den bisherigen Regeln, haben aber die Fähigkeit Verbindungen von Sinnesreizen gegen den Zeitpfeil zu durchwandern. Man kann sich vorstellen, zeitliche Verbindungen seien gedreht wie ein Gewehrlauf, und Bedürfnisreize hätten ihren Spinn in die andere Richtung. 30. Weg abnabeln: Durch die Überlagerung der rückfließenden Signalströme vom Lustzentrum und den vorwärtsfließenden von den Sinnen (Zukunftsvorstellungen), wird ein Pfad isoliert, der zu einer bedürfnisgerechten Zukunft führt. Die stärkste Zukunft siegt. Handlungen sitzen an Verzweigungsstellen der prognostizierten Zukunft. Wir können jeweils eine Zukunft voraussagen, zu der uns die Handlung führt, und eine andere Zukunft, zu der es ohne Handeln käme. Es siegt der Weg, der für die Bedürfnissollwerte mehr bringt. 31. „Entweder oder“ versus „oder auch“: An Verzweigungen des Zukunftsbaumes wo wir durch unser Handeln über unsere Zukunft entscheiden können (entweder oder) siegt das stärkere Rücklaufsignal. An Verzweigungen wo wir dies nicht können, und nicht genau wissen welche der beiden möglichen Zukünfte uns erwartet (oder auch), wird ein Durchschnitt der beiden Rücklaufsignale gebildet, der dann unsere Zielmotivation repräsentiert. Solche Verzweigungen sind sozusagen undefiniert. 32. Zeitpunkt der Handlung: Der abgenabelte Weg löst noch keine Bewegung aus. Dazu muss erst das Erwartungssignal, welches zeitlich parallel zur Welt verläuft, die Zelle erfassen. Erwartungssignale folgen dem abgenabelten Weg in der Realzeit (parallele Welt) und aktivieren zeitgerecht die Motorik. 162 4.1.7 Regeln für geistige Bedürfnisse und kreatives Verhalten Keine neuen Regeln. Aufmerksamkeit, Lerntrieb und ästhetischer Trieb bedürfen keiner einzigen neuen Regel. Sie entstehen einfach durch die rücklauf enden Signale, die beim Erlernen neuer Verbindungen zwischen noch nicht vorausgesagten Reizen entstehen, sich im Netz verteilen und dabei Wege abnabeln. 33. Gegenläufiger Spinn: Die Möglichkeit des Rückflusses wurde durch die Geschraubtheit zeitlicher Verbindungen veranschaulicht, und durch den Gegenläufigen Spinn der Signale von den Bedürfnissen. Sind die Signale, die von Zellen ohne gültige Voraussage, zum Zwecke der Verbindungsfindung ausgesendet werden, auch gegenläufig gedreht, wirken sie, wie Bedürfnissignale, als Wegbereiter für Handlungen. =Lerntrieb. 34. Kreativität und neues Verhalten: Zellen, deren Sensitivität noch nie durch einen Adaptionsprozess eingeschränkt wurde, sind so „laut adaptiert“, dass sie Zufallsrauschen aufweisen. Zufällige Häufungen in diesem Rauschen führen zu Zufallsverbindungen, über die Zufallsverhalten entsteht. Wieso daraus sinnvolle Verbindungen hervorgehen: Zufallsrauschen führt aber nicht direkt zu bleibenden Verbindungen, weil die nächste umgekehrte Häufung die Verbindung statistisch wieder aufhebt. Das Zufallsverhalten kann aber Folgen für Körpersollwerte haben, die nicht zufällig sind, und dann wird sinnvolles Verha lten selektiert und somit erlernt. 4.1.8 Allgemeine Zusatzregeln: Aus der Anwendung des Modells am Beispiel des visuellen Systems wird sich die Notwendigkeit für zwei Regeln ergeben, die ich erst dort behandle. Die Regeln will ich der Vollständigkeit halber trotzdem hier auflisten: 35. Ab wann gelten zwei Reize als Gleich: Dieses Problem fällt unter die „Schwellenwert-Probleme. Es hat sich folgende Regel als brauchbar erwiesen: Signale gelten demnach dann als gleich, wenn ihre Differenz zueinander geringer ist, als die Differenz, die sich im Durchschnitt zum Eigensignal der Em pfängerzelle ergibt. 36. Berechnung des Voraussagefehlers bei Sternzellen: Um den Voraussagefehler zu ermitteln müssen bei einer sternförmigen Verbindung mehrere Signale mit dem Eigensignal der Zelle verglichen werden. Dabei wird nicht sofort ein Durchschnitt der eintreffenden Signale gebildet und dieser dem Eigensignal der Zelle gegenübergestellt, sondern jedes Signal wird einzeln mit dem Eigensignal der Zelle verglichen, und erst danach wird ein Durchschnitt der gesammelten Abweichungen gebildet. Dieser stellt den gesamten Voraussagefehler dar. 163 36 Regeln erscheinen viel, zumal die meisten davon direkt das Verhalten eines einzelnen Neurons beschreiben. Aber eine Zelle ist ein ungeheuer komplexes Ding. Am Beispiel der Einzeller sehen wir, dass eine Zelle sogar für sich lebensfähig sein kann. Ich halte es durchaus für möglich, dass ein Neuron wesentlich mehr ist, als ein Schalter. Abgesehen davon bleibt natürlich zu hoffen, dass sich der Regelhaufen noch auf wenigere Gesetzmäßigkeiten vereinfachen lässt. Während der Entwicklung dieses Modells waren die Regeln zeitweise schon viel zahlreicher und ließen sich dann immer weiter reduzieren. 4.1.9 Ist das Modell damit fertig? Ich würde sagen Ja. So wie es jetzt ist, ist es aus meiner Sicht das erste tec hnisch konkrete Modell, das die Fähigkeit des Gehirns sich selbst zu strukturieren erklären kann, und die Grundphänomene des Erkenntnisgewinns ausreichend behandelt. Das Gehirn weist auch Phänomene auf, die für ein Modell des selbs tlernenden Erkenntnisgewinns nicht wichtig erscheinen. Die unterschiedliche Nutzung der Gehirnhälften zum Beispiel. Es dürfte eine Gehirnhälfte im Entscheidungsfall zeitliche, die andere räumliche Verbindungen bevorzugen (Holler 1996, S.286) ). Dieser Faktor scheint aber nicht so wesentlich, denn auch ein Mensch, der nur mit einer funktionstüchtigen Gehirnhälfte auf die Welt kommt, entwickelt ein normales Verhalten. Auch diverse genetische Grundprogramme, die uns helfen schneller Fortschritte beim Erlernen des Greifens, Gehens, oder des Erkennens von Stimmen und Gesichtern zu machen, werden im Modell nicht berücksichtigt, weil das System diese Dinge auch ohne diese genetischen Hilfen bewältigen kann, wenn auch langsamer, und weil ein möglichst objektives selbstlernendes System entwickelt werden soll, also ein ideales erkenntnisgewinnendes System, möglichst ohne Vorurteile und vorgefertigte Programme. Die Komplexität der Anatomie des Gehirns ergibt sich aus meiner Sicht aus seiner evolutionären Abstammung von Tiergehirnen, die weitgehend genetisch vorprogrammiert waren. Die Evolution kennt ihr Ziel nicht, und findet den Weg tappend. Wir können ihn geradliniger verwirklichen. Zugegeben, das Modell ist aufgrund der 36 Regeln, die für das Verbindungsverhalten jedes einzelnen Neurons gelten, nicht einfach zu verst ehen, da die Regeln aber in der einzelnen Zelle liegen, genügt es eine Zelle technisch zu verwirklichen. Diese braucht dann nur vervielfältigt zu werden. Deshalb ist eine Umsetzung durchaus denkbar. Der Kostenaufwand für die Entwicklung einer solchen künstlichen Intelligenz ist abhängig von ihrer Kapazität, wobei ich annehme, dass ein Bruchteil der Neuronen nötig wäre, um das gleiche zu leisten wie das menschliche Gehirn. Die Neuronen im Gehirn scheinen unexakt zu arbeiten, und nur in Summe zu exakten Ergebnissen zu finden (Fischbach 1993, S.13). Ich halte es also für möglich die Leistungskapazität des menschlichen Gehirns annähernd zu erreichen, allerdings wird es aufwendig sein, wie der Mondflug für die Techn ologie der 60er Jahre. Es muss das Interesse eines Volkes sein, um verwirklicht zu werden. Aber es wäre diesen Aufwand doch Wert? Man bedenke nur, wie sehr ein 164 solches künstliches Wesen das Selbstverständnis erweitern würde, das der Mensch von sich hat. Anders als er, könnte es ewig leben, indem es sein Wissen sichert, und wenn es zerstört wird, dieses Backup in einen neuen Körper eing espielt wird. 165 5 EXKURS: ÜBERPRÜFUNG DER REGELN AM VISUELLEN SYSTEM Die folgenden Beispiele mögen eine Umsetzung noch komplizierter erscheinen lassen. Sie sollten aber unseren Glauben an die Machbarkeit nicht beeinflussen, denn nichts von dem im folgenden Beschriebenen braucht von Menschen programmiert zu werden. Beschrieben wird das Verhalten des Systems auf Umweltreize. Erschaffen brauchen wir ja nur das leere Gehirn. Programmiert wird es durch die Umwelt. Niemand sonst hätte die Fähigkeit es zu programmieren. Was die ersten, grundlegendsten Verarbeitungsmechanismen betrifft, so will ich im Folgenden zeigen, dass sich durchaus erahnen lässt, was die Umwelt in das Wesen hineinprogrammieren wird. Hohe Stufen der Entwicklung wird der Mensch vielleicht nie begreifen können, selbst dann nicht, wenn er einmal ein solches Wesen geschaffen hat. 5.1 Niedrige Stufen visueller Verarbeitung 5.1.1 Das Projektionsfeld Im Prinzip ist ein Projektionsfeld nichts anderes, als ein Bereich der Gehirnfläche, auf den die Reize eines Sinnesorgans übertragen werden. So wird zum Beispiel das Bild der Netzhaut der Augen in Form eines Reaktionsbildes auf das Gehirn übertragen. Die Reize werden dabei auf eine größere Fläche verteilt , um Platz für deren Verarbeitung zu haben. 166 Farbrezeptoren der Kamera Deren Projektionsbereiche im neuronalen Netz Natürlich könnte die Projektion auch noch weiter verteilt werden. An den folgenden Beschreibungen wird man abwägen können, wieviele Zellen man auf einer Ebene benötigt. 5.1.2 Kontur und Farberkennung Das erste was die Lichtrezeptoren des Auges nach unseren Verbindungsregeln tun werden, ist Kontakte zu ihren Nachbarn herzustellen. Die Nachbarzelle wird häufig eine ähnliche Reizintensität aufweisen, und zwar selbst dann, wenn sie auf einen anderen Spektralbereich reagiert, denn die meisten Objekte reflektieren Licht über einen sehr breiten Bereich des Spektrums. Der Grund warum benachbarte Zellen oft gleich gereizt sein werden ist einfach der, dass generell in einem Bild mehr Punkte innerhalb von Farbflächen zu liegen kommen, als an Konturen und innerhalb von Farbflächen sind benachbarte Bildpunkte gleich gereizt. Die Voraussage, die diese Verbindungen bringen, lautet also: „Die Nachbarzelle weist mit einer Wahrscheinlichkeit x eine gleiche Reizung auf“. Wo das Bild Konturen aufweist wird jedoch diese Voraussage nicht stimmen. Es wird zu Fehlermeldungen kommen. Damit haben wir Konturen erkannt. Nun soll die Sache etwas genauer in Hinsicht auf die Farbe betrachtet werden. Zuerst gehen wir von einem Zwei-Rezeptoren-System aus. Beachten wir also erst einmal nur die Rot- und Grünrezeptoren. Jeder Rotrezeptor bildet eine Verbindung zu den grünen Nachbarzellen aus, denn Grün ist im Lichtspektrum dem Rot näher als Blau, und rote direkte Nachbarzellen sind nicht da. Es gibt nicht nur eine, sondern drei grüne Nachbarn. Da sie meist die gleiche Reizung aufweisen, können sie alle mitverbunden werden (siehe benachbarte Zellen in der Grafik des 167 Projektionsfeldes). Umgekehrt verbindet sich jeder Grünrezeptor zu den drei roten Nachbarzellen hin. Es entstehen Verbindungen in beide Richtungen, genau so, wie man sie im Gehirn findet (Hubel 1989, S.192). Zusammen bilden diese Verbindungen sternförmige Verbindungsketten nach allen Richtungen, oder besser gesagt ein Verbindungsnetz, über das sich Signale in alle Richtungen au sbreiten können. Dieses System ist relativ leicht simulierbar. Ich nehme an, die Signale sollen die Eigenreizung der Nachbarzelle voraussagen, und sie, soweit die Voraussage zutrifft, aufheben. Wenn die Voraussage nicht zutrifft, werden sie geschwächt und breiten sich nicht mehr viel weiter in der Verbindungskette aus. Das Ausbreiten der Voraussagesignale ist also nichts anderes als ein Ineinanderschwimmen der Signale, also Unschärfe. Die Größe der Unschärfe kann ich nur schätzen. Als Testbild will ich das folgende verwenden: Der Vergleich von Voraussage und Eigenreiz ist nun so vorzustellen: Jede Zelle repräsentiert ihre Gereiztheit nicht nur in einem positiven, sondern auch in einer negativen Ladung. Wenn zwei Zellen zueinander einen Kontakt herstellen, fließt Strom von deren positiven zu deren negativen Kontakten. Weisen die Zellen gleiche Ladungsintensität auf, so können negative und positive Ladungen einander vollständig aufheben. Wenn nicht, so bleibt ein Rest. Dieser Rest ist der Voraussagefehler. Ich versehe also den roten Farbkanal mit Unschärfe, um den Signalfluss zu den Nachbarzellen zu simulieren. Die Unschärfe stellt dar, wie weit die Signale ineinanderfließen. Indem ich dieses Bild nun mit dem scharfen grünen Farbkanal überblende, das ich vorher invertiert (negativ gemacht) habe, simuliere ich, wie sich Voraussage- und Eigenreiz gegenseitig aufheben. So komme ich zu folgendem Ergebnis: + = 168 Wir erkennen, dass die Helligkeitsunterschiede verschwunden sind. Sie treten nur noch in Form der Konturen hervor. Das ist so, weil innerhalb der Flächen die Gereiztheit der Nachbarzelle richtig vorausgesagt werden konnte. Wo sind die Signale hin? In diesem Modell gehen sie nicht verloren, sondern fließen in Form des Abziehbildsignalflusses ab. Dieser Signalfluss beginnt an den Voraussageenden. Das sind die Konturen, die ja noch zu sehen sind. Der Abziehbildsignalfluss se lbst ist nicht dargestellt. Genaugenommen zeigt die rechte Darstellung ja b ereits die nächste Verarbeitungsebene, wo die Signale, die abfließen konnten, fehlen. Bestimmte Signale sind aber geblieben. Der Farbunterschied zwischen Rot und Grün ist noch durch den Grauverlauf im Dreieck gekennzeichnet, weil rote Zellen immer grüne Nachbarn haben, und diese Nachbarn nur im Fall einer grauen Fläche, nicht jedoch bei Farblicht gleiche Reizung aufweisen. Das bedeutet, unser System verarbeitet Farbton anders als Helligkeit. Das hat natürlich einen Vorteil, denn wir können mit einem solchen System die Eigenfarbe eines Objektes unabhängig von Licht und Schatten, die darüber fallen (Helligkeit), beschreiben. Betrachten sie das Ergebnis aus größerer Entfernung, so sind die Helligkeitskonturen nicht mehr sichtbar, und nur die Farbinformation bleibt. Wie verschalten sich nun die Blaurezeptoren? Im Gehirn verschalten sich die Blaurezeptoren sowohl mit Rot als auch mit Grünrezeptoren gleichzeitig zu Blau-Gelb-Gegenfarbenzellen (Hubel 1989, S.192). Die additive Mischung von Rot und Grün ergibt Gelb. Die Rot- und GrünZapfen werden erst einmal zu Gelb verbunden, und dann mit Blau zu den Gegenfarbenzellen. Ich behaupte, man kann dieses Phänomen mit meinem Modell vollkommen aus der Bayesianischen Statistik und den Konditionierungsregeln ableiten. Um das zu verstehen ist zuerst der Empfindlichkeitsbereich der drei Zapfentypen zu beachten: In der Grafik zeigt sich, dass Rot und Grün einen viel ähnlicheren Reaktionsbereich haben als Blau. Ihre Empfindlichkeitskurven überlappen sich in einem viel weiteren Bereich. Offensichtlich führt dies dazu, dass sie vom Gehirn in der ersten, groben Verschaltung als gleich behandelt werden. Erst im nächsten Schritt, wenn bei dieser Methode zu viele Voraussagefehler entstehen, wird eine genauere Differenzierung vorgenommen. 169 Wir brauchen also eine Schwellenwert-Formel, eine Formel, die angibt, bis wann Signale noch als gleich gelten. Ich habe nur zwei Bereiche des visuellen Systems gefunden, die so weit erforscht sind, dass man aus deren Verschaltung auf eine solche Formel schließen könnte. Es ist dies die Farbwahrnehmung und die Konturrichtungserkennung. Es hat sich gezeigt, dass der Schwellenwert in Relation zum Eigensignal der Zelle beschrieben werden kann. Ich kam auf folgende Formel: Signale gelten dann als gleich, wenn ihre Differenz zueinander geringer ist, als die Differenz, die sich im Durchschnitt zum Eigensignal der Empfängerzelle ergibt. In Relation zu dem Reaktionsverhalten der Blaurezeptoren wird das Reaktionsverhalten von Rot- und Grünrezeptoren sehr ähnlich erscheinen, weil der Empfindlichkeitsbereich von Rot-und Grünrezeptoren sehr ähnlich ist, während Blau im Spektrum weiter abseits liegt. Das bedeutet aus der Sicht des „blauen“ Neurons erscheinen seine Rot- und Grünnachbarn gleich, und es stellt zu Beiden eine Verbindung her. Die gegenpoligen Gelb/Blau-Zellen werden eventuell aufgrund räumlicher Probleme zuerst noch aus zwei Gruppen bestehen (siehe Dreiecke in der Grafik) und erst auf der nächsten Verarbeitungsstufe beide zusammen die selbe Doppelgegenfarbenzelle beliefern, für die sie als gleich gelten. So entsteht das Blau-Gelb Verbindungsnetz, das verantwortlich ist für die Reaktionsweise der B/GGegenfarbenzellen in unserem Gehirn. Um sie zu simulieren überblende ich also ein Kombinationsbild aus Rot- und Grünkanal mit dem unscharfen invertierten Blaukanal. 170 + = Wir können erkennen, dass sich im Dreieck nun ein horizontaler Graustufenve rlauf ergibt, wo es bei dem Reaktionsbild der Rot-Grün-Gegenfarbenzellen ein vertikaler Verlauf war. Wir verfügen also über einen vertikalen und einen horizontalen Verlaufsbalken, und so ist jede Farbe des Dreiecks durch die Reaktionswerte exakt definiert. Diese beiden Verlaufsbalken beschreiben also Farbe ohne ihren Helligkeitswert. Die Helligkeit benachbarter Zellen wurde hingegen bereits richtig vorausgesagt, ist also erkannt. Wir können uns vorstellen, dass diese Information bereits in Form des Abziehbildsignalflusses komprimiert und zeitcodiert an höhere Verarbeitungseinheiten abgegeben wurde. Nur mehr die Konturen sind stehen geblieben. Wir können also Objektfarbton und Sättigung weiter verarbeiten, ohne von Licht und Schatten irritiert zu sein. Die Erkennung von Objektfarben unabhängig von Schatten und Licht, fällt aus der Sicht der Psychologie unter die „Konstanzleistungen“. Die meisten Konstanzleistungen basieren auf folgendem Prinzip: Es werden im Gehirn nicht einfach die Messwerte, also die Reaktonsintensitäten der Sinneszellen verzeichnet, sondern Sinnesdaten, die der gleichen Inkonstanz erliegen, werden durch Konditionierung verbunden und im Verhältnis zueinander erfaßt. Am Beispiel von Licht und Schatten konnte nun gezeigt werden, warum dies zu konstanten Farbdaten bei wechs elnder Beleuchtungshelligkeit führt. Was es bringt Daten in Relation zu erfassen, kann am Beispiel der Farbverarbeitung auch mit Zahlen leicht erklärt werden: Wenn in einem hellen Bereich eines bläulichen Objektes die Reaktion des blauen Zapfens 12, die de s roten 3 und die des grünen 6 ist, und im schattigen Bereich des Objekts reagiert der blaue mit 8, der rote mit 2 und der grüne Zapfen mit 4, so ist doch in beiden Fällen das Reaktionsverhältnis der Zapfen zueinander 4:1:2. Dieses Verhältnis beschreibt somit den Farbwert unabhängig von dessen Helligkeit. Aber genaugenommen haben wir ja mit unserer Methode Differenzen und nicht Relationen erfasst. Was ist der Unterschied? Beides beschreibt die Abstände zwischen den Reizen. Die Größe der Zahlenwerte in einer Relation ist aber davon abhängig, wie weit sich die Bruchzahlen kürzen lassen. Die Größe der Differenz ist hingegen direkt auf den Signalstärkenunterschied der Reize zurückzuführen. Das ist für unser Modell wahrscheinlich brauchbarer. 171 5.1.3 Die Reaktion von Gegenfarbenzellen auf Unschärfe und Grauverläufe Was das letzte Testbild betrifft, so ist unser Modell zu guten klaren Ergebnissen gekommen weil scharfe Konturen vorhanden waren. Das folgende Testbild zeigt ein problematischeres Ergebnis. Das Problem der Farbverarbeitung will ich im Folgenden beiseite lassen, deshalb wähle ich ein Schwarz-Weiß-Bild und trenne die Kanäle nicht: Innerhalb von breiteren Helligkeitsverläufen reagieren die Voraussagezellen (Zentrum/Umfeld-Zellen) genauso wie innerhalb von regelmäßigen Flächen, nämlich gar nicht, was grau dargestellt ist. Das würde aber bedeuten, dass wir beides nicht unterscheiden können. Auch würde es innerhalb einer unscharfen Kontur, die ja nichts anderes ist als ein Grauverlauf zu einem Bereich führen, in dem die Zellen abschalten, wie er in der Grafik auftritt. So entstünden Doppelkonturen. Richtig auffällig wird das erst, wenn ich die schwarz dargestellten gehemmten Bereiche auch weiß kennzeichne (und den ungereizten Hintergrund zur besseren Sichtbarkeit schwarz). Wir enthalten Doppelkonturen. Unsere Simulation ist also falsch. 172 Das Problem lässt sich lösen, wenn wir die Zusammenführung der Signale der drei Zellen, mit der die zentrale Zelle sich verbunden hat, mit deren Eigensignal anders gestalten. Zwar muss die Regel erhalten bleiben, dass wenn die umliegenden Zellen anders gereizt sind als die Eigenreizung der Zelle, ein Voraussag efehler, und damit eine Reaktion auftritt, aber bildet man, so wie in unserer Simulation, zuerst einen Durchschnittswert aus den umliegenden Zellen (was in der Simulation durch das Unscharfbild geschieht), und vergleicht diesen dann mit dem Eigenwert, dann kommt es in Grauverläufen eben zu keiner Differenz mehr. Die Lösung besteht nun darin, dass die Reaktion jeder umli egenden Zelle extra mit dem Eigensignal verglichen wird. So entstehen in Grauverläufen Differenzen, da ja die Nachbarzellen verschieden gereizt sind. Nehmen wir an, die Eigenreaktion der Zelle ist 4 und im Grauverlauf ist die Zelle rechts daneben in der Stärke 3 gereizt, die links daneben in der Stärke 5, dann ist die Durchschnittsreizung der Nachbarn 4, und daher gleich der Eigenreizung. Vergleichen wir jedoch jede einzeln mit der Eigenreizung der Zelle, so ergibt sich in beiden Fällen eine Differenz von 1, also signalisiert unsere Zelle einen Voraussagefehler, wenn auch ohne definiertes Vorzeichen. Diese Reaktion innerhalb des Grauverlaufs führt nun nicht nur dazu, dass unser künstliches Gehirn Grauverläufe von Flächen unterscheiden kann, sondern dass auch in der Mitte des Grauverlaufs einer unscharfen Kontur die Zentrum/Umfeld Zellen reagieren. Das Konturbild sieht also folgendermaßen aus: 173 Sind deshalb unsere einfachen Simulationsbilder zu den Gegenfarbenzellen auch grundlegend falsch? Nein! Da dort keine Grauverläufe auftreten, würde sich an dem Ergebnis nichts augenfälliges ändern. Die linke, scharf dargestellte Figur hat sich hier ja auch nicht verändert. Trotzdem gehört die gängige Theorie der Zentrum-Umfeld-Zelle konkretisiert. Ich denke bei genauer Betrachtung wird sich das zuletzt dargestellte Reaktionsbild als Gesamtreaktion der Z/U-Zellen zeigen, und nicht die Doppelkonturen. Die hätte man nämlich schon längst entdeckt. Es wird sich zeigen, dass die Zellen innerhalb von Helligkeitsverläufen nicht völlig stumm bleiben. 5.1.4 Die Bewegungzellen und die Objektfixierung Auf Bewegung reagierende Zellen werden erst auf der Ebene entstehen, die Konturen erhält, weil Bewegung nur an Konturverschiebungen erkannt werden kann (innerhalb von Farbflächen verändert eine Verschiebung nichts). Ein Neugeborenes ist noch nicht in der Lage Dinge mit den Augen zu fixieren. Wenn es den Kopf dreht bleiben die Augen ruhig. Das bedeutet, das ganze Netzhautbild wird sich verschieben. Konturen wandern also quer über die ganze Netzhaut. Diese Wanderung wird dazu führen, dass benachbarten Zellen entlang der Bewegungsrichtung auf der nächsten Ebene, die diese Kontursignale erhält, zu einer Kette verschalten werden, denn sie werden wiederholt unmittelbar nacheinander aktiviert. Da eine Zelle in unserer Netzwerkstruktur nur in drei Richtungen einen unmittelbaren Nachbarn hat, wird dies dazu führen, dass in drei Richtungen und noch in deren drei Gegenrichtungen solche Ketten vorliegen. Wenn nun ein Punkt in der Mitte einer weißen Fläche eines Monitors erscheint, so sollte doch jede dieser drei Ketten voraussagen, dass er sich im nächsten Moment in einer anderen Richtung verschiebt. Aber diese Voraussagen würden sich widersprechen. Natürlich hat unser System diese Regel auch bemerk t. Wenn sich ein Punkt in eine Richtung bewegt, so bewegt er sich nie gleichzeitig in die andere Richtung. Also werden Verbindungen von der Anti-Linkszelle zur nächsten 174 Rechtszelle entstehen. (Zur Erinnerung: Die Anti-Linkszelle ist der für hemmende Verbindungen zuständige Teil der Linkszelle, und immer mit ihr gemeinsam aktiv.) Über diese Verbindung wird die rechtsvoraussagende Zelle gehemmt, wenn eine Linksvoraussage stattfindet. Da im Moment alle Voraussagen möglich sind, hemmen sich alle gegenseitig. Bewegt sich der Punkt nun nach links, so entsteht ein Voraussagefehler bei der links hemmenden Verbindung. Ihre Voraussage lautet: „Dieser Punkt wird sich nicht nach links bewegen“, und dies ist nun widerlegt. Der Voraussagefehler ergeht an die nächst höhere Ebene. Auf dieser Ebene erscheint also nur dann ein Signal, wenn an einem Ort wirklich eine Bewegung nach links stattfindet. Wa ndert der Punkt ein Stück weiter nach links, so erscheint daneben wieder ein solches Signal, und wieder und wieder. Die Signale auf dieser Ebene werden wieder Ketten bilden. Das sind nun die eigentlichen Bewegungszellen. Sie signalisieren stärker, je mehr Bewegung stattfindet. Das kann zum Beispiel zur Entfernungseinschätzung genutzt werden. Wenn wir uns seitlich bewegen, so verschiebt sich Nahes im Perspektivebild stärker als Entferntes. Daran kann Entfernung erkannt werden. Tauben nützen diesen Effekt zum dreidimensionalen Sehen, und bewegen deshalb ständig den Kopf vor und zurück. Zu einer solchen bewegungssensiblen Verschaltung kommt es aber nicht nur bei Kontursignalen, sondern auch bei den Signalen, die sich durch den Abziehbildsignalfluss in den Zentren der Objekte sammeln. Diese bewegen sich genau so schnell weiter, wie die Objekte. Die Bewegung dieser Gesamtsignale könnte das System nützen, um die Augenmuskel so zu aktivieren, dass das Objekt fixiert ist. Aber welchen Augenmuskel wie stark? Wandert ein Punkt in eine andere als die drei von der Zellstruktur vorgegebene Richtung, zum Beispiel nicht ganz vertilal, so wird er hauptsächlich vertikal benachbarte Zellen aktivieren, alle paar Übertragungen aber auch über einen horrizontalen Nachbarn rutschen. Das bedeutet, er wird eine schwache Voraussage in den horrizontalen, und eine stärkere in den vertikalen Bewegungszellen auslösen. Stellen wir uns vor, die drei Richtungs-Typen von Bewegungszellen sind mit drei Muskeln sinnvoll verbunden, die das Auge bewegen. So wird ein Muskel stärker, der andere schwächer aktiviert. Diese Aktivierungen bewegen das Auge in die Richtung, in die sich auch der Punkt bewegt. So kann Objektfixierung geleistet werden. Wie aber könnte sich ein solches System selbstlernend entwickeln? Die Projektionsfelder der Augenmuskeln müssen genetisch vorgegeben sein, und sie sollten im visuellen System liegen, und zwar auf der Ebene über dem Abziehbildsignalfluss, wo es also schon einen zentralen Punkt für jedes Objekt gibt. Die Art und Stärke der Verbindungen zu den Augenmuskeln kann erlernt werden. Allerdings ist die Sache komplizierter, als man annehmen sollte. Als Antrieb kommt nur der Lerntrieb in Frage. Starten müssen wir den Lernprozess wie immer, wenn neues Verhalten erworben werden soll, mit Zufallsverhalten. Dieses entspringt dem Hintergrundrauschen. Eine Zelle ohne Fremdeinfluss weist Zufallsrauschen mittlerer 175 Dichte auf. Starten wir unsere Überlegungen im motorischen Bereich: Kopfdrehungen führen zum Vorbeiziehen der visuell wahrgenommenen Objekte. Nun soll gelernt werden, wie das zentrale Objekt trotzdem fixiert werden kann. Die irgendwann zufällige Bewegung der Augen gegen die Drehrichtung, könnte zur Hemmung der wahrgenommenen Bildbewegung führen, was wiederum die Aktivierung der Antizelle für „Bildbewegung“ zur Folge hat. Dies ist ein Voraussagefehler, denn das Kind hat gelernt, dass Eigenbewegung zu Bildbewegung führt. Der Voraussagefehler kann dann mit mit der derzeit aktiven motorischen Zelle, die den Augenmuskel ansteuert, eine Verbindung eingehen. Über diese Verbindung ist in Zukunft, in dieser Situation Bildfixierung anstrebbar. Sie können an sich selbst testen, dass nur das Objekt, welches dem Bildzentrum am nächsten ist, mit den Augen verfolgt werden kann. Die Augen parallel zu einem vorbeiziehenden Objekt zu bewegen, das sich am Bildrand befindet, so dass es an diesem Ort im Bild fixiert bleibt, ist uns nicht möglich. Der Grund könnte mit der erhöhten Zelldichte im Bildzentrum zu tun haben. Dort ist nicht nur die Auflösung feiner, sondern auch die Signaldichte höher, und damit eine Verbindung wahrscheinlicher. Ich vermute, dass die Verbindungen zu den Augenmuskeln deshalb dort entstanden sind. 5.1.5 Die Kontur und Richtungserkennung Die Konturen, die wir durch die Fließnetze erhalten haben, sind relativ breit. Man könnte sagen, wir haben eher einen Graustufenverlauf zur Kontur hin erhalten, als eine klare Linie. So ergibt sich die Frage, wie das Gehirn in einem so breiten Verlauf eine Richtung erkennen kann. Natürlich weisen diese Verläufe eine Richtung auf. In der Querrichtung zur Kontur kommt es zu starken Reizveränderungen, längs dazu sind benachbarte Zellen gleich gereizt. Also entstehen den Konditionierungsregeln zufolge Verbindungen zwischen diesen benachbarten Zellen, nicht aber quer dazu. Wir erhalten also eine Kette aus Verbindungen gleicher Ausrichtung. Ein anderes mal, wenn die Kontur in eine andere Richtung verläuft, entstehen Verbindungen in einer anderen Ausrichtung. Die durchschnittliche Länge, in der sich Konturen verschiedenster Bilder zufällig überlagern, ist nicht all zu lang. Konturen können ja Krümmungen in alle möglichen Richtungen aufweisen. Durchschnittlich wird also eine Kontur nur ein kleines Stückchen gerade weiterlaufen. Wir können uns das so vorstellen, wie dies in der folgenden Grafik dargestellt ist. Es erscheinen immer wieder neue Bilder auf der Netzhaut, deren Konturen in alle möglichen Richtungen verlaufen. Hin und wieder verläuft ein Konturstück in eine Richtung, die zuvor schon von einer Kontur beschritten wurde. Dann werden erlernte Verbindungen bestätigt. 176 Da die Konditionierungsregeln auch verlangen, dass Nahes dem Entfernteren vorzuziehen ist, und in unserem 6eck-Netzwerk eine Zelle nur in drei Richtungen einen unmittelbar nahen Nachbarn hat, werden vorerst überhaupt nur Verbindungen in diesen drei Richtungen entstehen. Nun haben wir also solche Zweierverbindungen in drei Ausrichtungen. Alarm gibt eine Zellgruppe nicht, wenn ein Reiz ihr entspricht, denn dann ist dieser kleine Teil der Welt vorausgesagt, und lernen ist nicht notwendig. Alarmiert wird vielmehr, wenn die Voraussage, dass die benachbarte Zelle gleich aktiv sein wird, nicht zutrifft. Wenn wir von drei Verbindungsrichtungen ausgehen, dann ist ausgeschlossen, dass eine Kontur bei allen dreien gleichzeitig zu einer optimalen Voraussage führt, denn eine Kontur kann ja nur in eine Richtung verlaufen. Wenn die Richtung nicht exakt einer der drei Verbindungsrichtungen entspricht, werden sogar alle drei Verbindungszelltypen einen Voraussagefehler melden. Wichtig ist, dass in der unterschiedlichen Stärke dieser Voraussagefehler die Konturrichtung beschrieben ist. Jede Konturrichtung wird zu einer anderen Signalstärkerelation der drei Richtungszelltypen führen. Daher ist jede Richtung exakt erkannt. Diese Idee soll aber nun genauer betrachtet werden, weil es vorerst so scheinen mag, als sei sie mit den, im Gehirn vorgefundenen Balkentedetoren unvereinbar. 5.1.6 Die Erkennung von Konturrichtungen Die Erkennung von Kontur- und Schattierungsrichtungen ist ein und die selbe Sache. Von den Zentrum-Umfeld-Gegenfarbenzellen erhält das System bereits ein Konturbild. Ich werde wieder das bereits bekannte Testbild verwenden: 177 Was geschieht nun weiter mit diesem Bild? Wenn wir ein Bild mit sich selbst überlagern und die Differenz errechnen, so erhalten wir eine schwarze Fläche, da keine Differenz vorliegt. Verschieben wir nun eines der Bilder vertikal um ein bis zwei Pixel, so ist damit eine vertikale Verbindung zu benachbarten Zellen sim uliert, die dann reagieren, wenn sich ihr Signalinput unterscheidet. Dieser Unte rschied tritt auf, woimmer vertikal benachbarte Bildpunkte unterschiedliche Reizung aufweisen, zum Beispiel an horrizontalen Konturen, nicht aber an vertikalen. Differenz kann in zwei Richtungen auftreten. Die benachbarte Zelle kann mehr, oder sie kann weniger gereizt sein als die Eigenreizung. Ich verwende deshal b einen grauen Untergrund und stelle positive Differenz weiß, negative schwarz dar. Es entsteht also folgendes Reaktionsbild: Unser Auge tendiert dazu dieses Bild dreidimensional zu interpretieren. Aber diese Interpretation würde nur dann auftreten, wenn wir dieses Reaktionsbild zurück auf die Netzhaut senden würden, was ja im Gehirn nicht passiert. Wichtig ist vielmehr, dass in diesem Bild exakt vertikale Konturen zu keinen Reaktionen führen (grau), während die Reaktion umso stärker ist, je mehr sich eine Kontur der horrizontalen Richtung nähert. Wir haben also eine Richtungsreaktion, wie wir sie im Gehirn bei den sogenannten Balkendetektoren feststellen! 178 Genaugenommen wollten wir ja die Voraussage simulieren: „Meine vertikale Nachbarzelle ist gleich aktiviert wie ich“. Da wir angenommen haben, dass Voraussagen in Ketten weitergegeben werden, entsteht automatisch auch eine Voraussage für den vertikal übernächsten Nachbarn. Irgendwann verliert sich das Voraussagesignal, weil die Verbindungen einen Widerstand aufweisen, der die Wahrscheinlichkeit x repräsentiert, mit der die Voraussage zutrifft. Nehmen wir an, die Wahrscheinlichkeit ist ein Drittel, dann ist der vertikale Voraussagefluss mit folgendem Filter zu simulieren: Wer ein Pixelgrafikprogramm im Computer hat, kann sich davon überzeugen, dass dieser Filter einer fließenden Verschiebung des Bildes gleichkommt. Nachdem wir nun Zellen erhalten haben, die sensitiv auf Querkonturen ansprechen, ist klar wie wir Zellen erhalten, die auf Vertikale ansprechen. Dazu gehen wir von benachbarten Zellen aus, deren Verbindung horrizontal verläuft. Färbe ich letzteres Reaktionsbild rot und lege es über das erste, welches ich blau einfärbe, dann erhalte ich ein Bild, das die Gesamtreaktion der Richtungszellen verans chaulicht. Jeder Konturausrichtung sind nun eigene Farbwerte zugeordnet. Dabei hat diese Form der Konturrichtungserkennung über ein vertikales und ein horrizontales Fließnetz kaum Verbindungen bedurft. Konturrichtungsspezifisch reagierende Zellen sind in der visuellen Sehrinde nachgewiesen, die sogenannten Balkenrezeptoren. Man hat auch eine hypothetische Verschaltung dieser Zellen ersonnen, wobei man davon ausging, dass ein Balkenrezeptor mit einem 179 blakenförmig angeordneten Steifen von Rezeptoren der Netzhaut verbunden ist. Diese Annahme ist unserem Modell zufolge falsch, weil sie sich schlecht über Konditionierungsprozesse erklären lässt. Hubel 1989, S.83 schreibt: „Selbst nach 20 Jahren wissen wir noch immer nicht, wie die Eingänge zu den corticalen Balkendedektoren verschaltet sind, damit diese das beobachtete Verhalten zeigen.“ Trotzdem Hubel die hypothetische Natur seiner vorgeschlagenen Verschaltung damals eingestand, ist sie von vielen Lehrbüchern übernommen worden. Natürlich ist Hubels Forschung damit nicht hinfällig. Die Reaktionsweise der Zellen, die er messen konnte, stimmt ja. Auch die rezeptiven Felder zweifle ich nicht an. Falsch dürfte allerdings sein, dass zu jeder Zelle eines solchen Feldes eine eigene Verbindung gegeben sein muss. Das würde zu einer Unmenge an Verbindungen führen, die nicht nötig sind. Meinem Modell zufolge kann das System auf den Großteil dieser Verbindungen verzichten, weil das Gehirn zu Kettensignalflüssen fähig ist. Da die Konturen auf Projektionsbildern nie scharf sind, sondern immer schmale Schattierungen darstellen, bietet das von mir dargestellte System einen idealen Mechanismus einer Richtungserkennung für ein praxisnahes System. Das folgende Testbild soll die Richtungsreaktion anhand eines fotografischen Beispiels veranschaulichen. Ich habe in diesem Fall sowohl negative, als auch positive Differen zen zwischen benachbarten Zellen gleichermaßen hell auf dunklem Grund dargestellt, um die Gesamtreakton der Richtungszellen klarer zu verdeutlichen. 180 Auch habe ich drei, statt zwei Verschiebungsrichtungen verwendet und in den drei additiven Grundfarben eingefärbt und übereinandergelegt um ein möglichst buntes Ergebnis zu erhalten. Wir sehen, dass jede Richtung eine eigene Farbe erhält. Wenn wir davon ausgehen, dass die oben dargestellte einfache Verschaltung mit den unmittelbaren seitlichen Nachbarzellen bereits Richtungserkennung leisten kann, und wenn weiters dargestellt werden kann, dass eine solche Verschaltung aus den Konditionierungsregeln hervorgeht, ist sehr wahrscheinlich, dass auch im Gehirn der Signalfluss innerhalb der Ebene zur Richtungsreaktion führt, und die Idee der Balkenverschaltung falsch ist. Balkendedektoren gibt es natürlich, nur sind sie anders verschalten als man glaubte. Die direkte Verschaltung zu Balken könnte auch die enorme Feinheit der Auflösung der Richtungserkennung nicht erklären (Spektrum-Ticker 2001.05.28). Das hier dargestellte Modell bietet hingegen eine Erklärung, und es kann meiner Ansicht nach auch das bisher ungelöste Rätsel d er wechselweisen Enthemmung von Balkendetektoren gegenteiliger Ausrichtung in Nachbildversuchen klären (Eysel u.a. 1999). Wenn wir die klassische Vorstellung der Balkenverschaltung zugunsten dieses effektiveren, und aus den Lernregeln ableitbaren Modells verwerfen, so ergibt sich allerdings die Frage, wie es dann sein kann, dass Dedektoren für so viele, fein voneinander abgestufte Richtungen nebeneinander auf der Gehirnrinde vorkommen, wenn doch unser Modell besagt, dass sich nur für drei Grundrichtungen (ähnlich wie drei Grundfarben) Detektortypen entwickeln sollten, weil im Netz die nächstgelegenen Neuronen immer in drei Grundrichtungen liegen. Die Antwort liegt einfach in der nicht exakt wabenförmigen Anordnung der Zellen in natürlichen Systemen. Die Verwerfungen in der Anordnung führen dazu, dass die unmittelbaren drei Nachbarzellen einer Zelle nicht immer in den gleichen drei Richtungen vorliegen. Die Verbindungen werden daher von Zelle zu Zelle immer weiter von der Ursprungsrichtung abweichen, wie dies an der roten Linie zu beobachten ist, die ich in der Abbildung einer Affen-Netzhaut eingezeichnet habe. Für die weitere Verarbeitung in einem selbstlernenden System macht das keinen Unterschied, da die statistischen Regeln schon dafür sorgen, dass die weiteren Verbindungen stimmen und es zum richtigen Ergebnis kommt, auch wenn sich die Verschiebungsrichtung dauernd dreht und wendet. Die verworfenen Verbindungen leisten also was sie sollen, sind allerdings nicht so anschaulich und verständlich wie in unserem künstlichen neuronalen Netz, wo über die ganze Fläche hinweg die selben drei Verbindungsrichtungen vorkommen. 181 5.1.7 Abziehbildsignalfluss auf den Richtungsebenen Lassen wir das Detail der Verwerfung der Konturrichtungen einmal außer Acht, und bleiben wir bei unserem idealisierten künstlichen Modell, in dem es Zellen für drei „Grundrichtungen“ gibt, aus deren Reaktionsweise, ähnlich wie bei den Grundfarben bei der Farberkennung, alle anderen Richtungen erkannt werden. An einem geradlinigen Konturstück werden gleiche Richtungszellen nebeneinander ansprechen. Da die meisten Bildpunkte einer Kontur auf geraden Konturst ücken zu liegen kommen, und nur wenige auf einem Konturwinkel Platz finden, werden benachbarte Richtungszellen gleicher Ausrichtung häufig gleichzeitig aktiv werden. Daher werden Richtungszellen gleicher Ausrichtung zueinander eine stärkere Verbindung aufbauen, als zu denen mit anderer Ausrichtung. Ein weiteres statistisch relevantes Argument, warum sich Richtungszellen gle icher Ausrichtung zueinander stärker verschalten werden, ist die häufige gerichtete Strukturierung unserer Umwelt. Ob Holzmaserung, Dachschindeln, Gräser, Textilien…, in Texturen kommt es meist zu einem Streif. Das bedeutet eine Richtung ist stärker vertreten. Die Richtungszellen (Balkendetektoren) bilden sich alle in der selben Schicht der visuellen Sehrinde im Gehirn, weil sie auf der gleichen Stufe der Verschaltungshierarchie entstehen. Doch sie können innerhalb dieser Schicht trotzdem zu ihresgleichen stärkere Verbindungen herstellen, als zu anders 182 ausgerichteten. So entstehen in dieser Schicht Ebenen. Ich nenne sie „Quasiebenen“, weil sie ja anatomisch nicht übereinander liegen, sondern ineinander verwoben sind. Dass dies noch nicht entdeckt wurde ist leicht zu erklären. Es fehlt an Beobachtungsmethoden für Verbindungen. Zu erkennen ist nur das Verhalten von Neuronen. Und selbst wenn wir Verbindungen sehen, geht es uns wie mit der folgenden Grafik. Es sind hier genau zwei voneinander völlig unabhängige Quasiebenen dargestellt. Das ist aber schwer zu erkennen, weil sie nicht übereinander liegen, sondern ineinander verwoben sind. Die Verbindungen der Quasiebenen der Richtungszellen sagen voraus, dass eine Kontur einer bestimmten Ausrichtung auch in dieser Richtung weiter verlaufen wird. Die Verbindungen sind auch für den Abziehbildsignalfluss wesentlich. Auch dieser wird hauptsächlich auf der jeweiligen Quasiebene bleiben, weil nur wenige Verbindungen zu anderen Ebenen führen, und wenn, dann mit größerem Widerstand. Verläuft eine Kontur in einer Mischrichtung zwischen zwei Quasiebenen, so reagieren Richtungszellen beider Ebenen halb. Auch wird auf beiden Quasiebenen ein Abziehbildsignalfluss stattfinden, und der Signaloutput beider Ebenen kennzeichnet dann die Richtung der Kontur. Es ist also die Quelle, durch welche schließlich die Konturrichtung kennzeichnet wird. Es kommt darauf an welche Quasiebene sendet. Was die Konturlänge betrifft, so ist sie, genau wie bei der Objektgröße, durch die Dauer des Signalflusses gekennzeichnet, der benötigt wird, bis die Signale von den Voraussageenden (Konturenden) zur Mitte der Kontur zusammenfließen. Eine gebogene Kontur wird auf verschiedenen Streckenabschnitten zu stärkeren Signalen auf der einen, oder anderen Ebene führen. Auch hier wird die Gesamtstrecke durch ein anhaltendes Fließsignal codiert, allerdings wird dieses Signal erst stärker aus der einen Quasiebene, gegen Ende stärker aus der anderen Quasiebene „ertönen“. Darin ist die Krümmung der Kontur codiert. Eine strichlierte Linie wird eventuell durch ein pulsierendes Signal codiert. Es ist ja wichtig nicht nur die Elemente zu codieren, sondern auch den Abstand zwischen 183 ihnen. Dabei sollte es genügen, wenn das Kettenflusssignal für eine bestimmte Zeit aussetzt, so dass sich Elemente und deren Abstand wie Töne und Zwischenräume in der Musik verhalten. Genauer kann dieser Prozess aber erst durch eine Simulation des Signalflusses studiert werden. Wichtig ist, dass dabei jeder unterscheidbarer Reiz auch einen unterscheidbaren zeitcodierten Output bringt. 5.1.8 Die Doppelgegenfarbenzellen Im Gehirn sind Zellen vorhanden, die Farbgrenzen konturieren (Hubel 1989, S.192). Die bisher besprochenen Gegenfarbenzellen haben eigentlich nur die Trennung von Farbe und Helligkeit hervorgebracht, und sie haben uns dazu gedient Helligkeitsgrenzen zu konturieren. Diese Konturen haben wir nun der Konturrichtungsauswertung zugeführt. Wir sind aber auch fähig Farbgrenzen zu erfassen. Wie können die dazu notwendigen Zellen verschalten sein? Die sogenannten Doppelgegenfarbenzellen schaffen Konturen wo Farben gleicher Helligkeit, aber unterschiedlicher Tönung vorliegen. Sie entstehen, wenn ein Gegenfarben-Reaktionsbild mit benachbarten Zellen desselben Reaktionsbildes eine Zentrum/Umfeld-Verschaltung eingeht, und sich die Signale aufheben. Ich simuliere dies wieder durch die Überblendung mit dem unscharfen Negativ (Wenngleich wir festgestellt haben, dass dies eine etwas zu vereinfachte Simulation ist). Als Testbild dient uns das Ergebnis der Gegenfarben-Zellen. Um ein verwirrendes Ergebnis zu vermeiden, habe ich die Helligkeitswechsel im Testbild weggelassen, deshalb fehlen die kreisförmigen Konturen am GegenfarbenReaktonsbild. Die Unschärfe bestimmt sich ja aus der Wahrscheinlichkeit einer Gleichgereiztheit der Nachbarzellen. Diese Wahrscheinlichkeit wird bei diesen Farbauszügen ziemlich groß sein. Man bedenke, dass ein ganzer Wald ohne Licht und Schatten zu einer einzigen grünen Fläche wird. Oftmals gleichgereizte Nachbarn führen zu durchlässigeren Voraussageverbindungen, weil ja ein größerer Voraussagebereich möglich ist. Die Signale können sich also weiter ausbreiten, was ich durch größere Unschärfe simuliere. + = So entstehen in der Simulation des Doppelgegenfarbenzellen-Reaktionsbildes an den Konturen keine Linien mehr, sondern breite Verläufe. Das mag der Grund sein, warum es im Anschluß daran im Gehirn zu keiner eigenen Richtungsauswertung mehr kommt. Dass eine solche Richtungsauswertung von Farbgrenzen ausbleibt, ist 184 nicht nur durch das Fehlen von Farbrichtungszellen nachgewiesen. Es wird sich auch bei den Texturbespielen später zeigen, dass wir die Richtung von Farbkonturen nicht flächendeckend parallel über das ganze Bild hinweg zu verarbeiten mögen. Wohl aber seriell, nacheinander. Aber nicht nur die Breite der Verläufe, sondern auch der mangelnde Platz im visuellen System mag verantwortlich sein dafür, dass eine Richtungsauswertung der Farbgrenzen nicht mehr stattfindet. Die Doppelgegenfarbenzellen entstehen in der Verarbeitungshierarchie auf der selben Stufe wie die Balkendetektoren. Sie verarbeiten, genau wie diese, das Signal aus den Gegenfarbenzellen. Dadurch befinden sie sich in der selben Schicht des Gehirns, zu sogenannten Blobbs zusammengedrängt zwischen den Balkendetektoren (Hubel 1989, S.190). Die räumliche Situation wird somit etwas durcheinandergebracht, und es können nachher keine exakten räumlichen Verbindungen, wie sie zur Richtungsauswertung notwendig wären, mehr gefunden werden. Natürlich werden benachbarte Blobbs zueinander Verbindungen halten, denn sie reagieren ja oft ähnlich, weil sie meist die selbe Farbfläche repräsentieren, aber es werden sternförmige Verbindungen zu allen Seiten hin sein, nicht Richtungsspezifische. Auch dieses Netz an Verbindungen stellt eine Quasieben e dar, über die ein Abziehbildsignalfluss stattfinden kann, der notwendig ist, um die Informationen der vielen einzelnen Farbrezeptoren zu Objektflächen zu vereinen. 5.2 Höhere Stufen visueller Verarbeitung 5.2.1 Objektgröße und Anzahl Das beim Abziehbildsignalfluss zusammengeflossene Signal wird an eine neue Ebene weitergegeben, weil es in seiner Stärke und seinem Ort nicht vorausgesagt werden konnte. Der Leser wird sich sicher noch an die Grafik dazu erinnern. Die Signale fließen in der Objektmitte zusammen. Dieser Zusammenfluss wird natürlich umso schneller erfolgen, je kleiner ein Objekt ist, denn dann muss weniger Weg zurückgelegt werden. Ein kleineres Objekt fließt schneller auf einen Punkt zusammen, und sein Fließsignal hält daher kürzer an. Außerdem erscheint das Fließsignal früher. Stellen wir uns nun vor, die Zellen der Ebene an die die Fließsignale ergehen, reagieren auf Signallängen. Durch Adaption haben sie sich so eingestellt, dass sie auf Objekte mittlerer Größe auch mittelmäßig ansprechen. Auf kleine weniger, auf große mehr. (Voraussagefehler gibt es, was die erwartete Signallänge betrifft wahrscheinlich kaum, da alle möglichen Signallängen gleichermaßen häufig auftreten werden.) Signale gleicher Intensität können zueinander eine gute Verbindung aufbauen, und über diese Verbindung abfließen. So können viele gleich 185 große Elemente zusammenfließen. Ihr Gesamtsignal ergibt dann ein Muster, eine Textur. Es handelt sich um ein intensiveres Gesamtsignal, wenn die Elemente groß sind, denn dann senden die Zellen, welche auf Größe reagieren, stärker, und deren Antizellen senden weniger. Wenn die Elemente über eine Fläche verteilt sind, so haben sie nicht alle den gleichen Abstand zu einem Punkt, und können nur nacheinander eintreffen. Dann hält das Signal länger an. So kann die Größe der Form erkannt werden, mit der die Textur gefüllt ist. Texturen mit unterschiedlich großen Objekten und unterschiedlicher Anzahl an Objekten können unserem Modell zufolge leicht unterschieden werden. Aber können sie das auch in Wirklichkeit? An welchen Eigenschaften unterscheiden wir Texturen, und an welchen nicht? 5.2.2 Was ist Textur, was Form? Nachdem wir nun über Zellen verfügen, die unterschiedlich auf Konturrichtungen reagieren, und andere, die Objektgrößen erkennen, soll eine Erklärung auf selbstlernender Basis für die Texturabgrenzung gefunden werden. Das Thema Texturerkennung ist deshalb so schön zu behandeln, weil hier sehr viel durch Beobachtungsbeispiele belegt werden kann. Was unterscheidet Textur- und Formerkennung? Texturen können flächendeckend gleichzeitig (parallel) abgegrenzt werden, während eine exaktere Formerkennung nur mehr durch fokussierte Aufmerksamkeit und serielle Verarbeitung geleistet werden kann. Das bedeutet, wir können immer nur eine Form zu einem Zeitpunkt bewusst betrachten (wobei wir natürlich unsere Aufmerksamkeit sehr schnell von Objekt zu Objekt springen lassen können, aber eben nur nacheinander). So sehen wir im folgenden Bild immer nur entweder die Vase oder die Gesichter, aber nie beides gleichzeitig. Das ist ein Phänomen seriellen Denkens. Anders als in diesem Beispiel können die Elemente einer Textur alle gleichzeitig flächendeckend erfasst werden. Texturen werden, also großteils parallel verarbeitet. Wiederholtes kann als ein Stück gedacht werden, es wird zu einem Chunk verbunden. Das ist ein Prozess, den wir bereits kennen, allerdings sprachen wir bisher meist von zeitlichen, nicht von räumlichen Wiederholungen. 186 Der Übergang von paralleler zu serieller Verarbeitung ist also gleichzusetzen mit dem Übergang von den unbewussten Vorstufen der Auswertung von Seheindrücken zu bewusstem Erkennen. Das macht diesen Übergang so interessant. Die Idee diesen mit Hilfe von Texturbeispielen zu erforschen habe ich mir von Bela Julez abgeschaut (Julez 1987, S.48). Die Beispiele der folgenden Seiten, und die daraus folgenden Schlussfolgerungen stammen aber aus eigener Forschungstätigkeit. 5.2.3 Struktur- und Texturbeispiele Was das Gehirn noch parallel zu verarbeiten mag, und was nicht mehr, ist durch die Betrachtung ähnlich strukturierter Flächen erforschbar. Ich will dazu zunächst eine Vielzahl an Beispielen bringen, um dem Leser eine Vorstellung von Strukturdifferenzierung zu geben, bevor ich beschreibe, warum ich glaube, dass das in dieser Arbeit vorgestellte Gehirnmodell zu einer analogen Unterscheidungsfähigkeit führen sollte. Wieso ist diese Thema eigentlich so interessant? Ganz einfach: Es gibt unterschiedliche Texturen, die wir nicht voneinander unterscheiden können, zumindest nicht sofort, bei seriellem Abtasten gelingt uns dies doch. Nun ist serielles Sehen immer mit Aufmerksamkeit und Bewußtsein verbunden. Diese Texturbeispiele weisen also Unterschiede auf, die erst durch serielles Sehen, also erst nach der Zeitcodierung der visuellen Information verarbeitet werden können. Gelingt hingegen eine Texturabgrenzung sofort flächendeckend, so bedarf dies keiner bewussten gerichteten Aufmerksamkeit. Gängige neuronale Netze besitzen keine Zeitcodierung und werden daher die seriellen Denkprozesse der Aufmerksamkeit, die mit Bewusstsein einhergehen, nie erklären können. Das Redundanzkettenfließnetz bietet demgegenüber einen Erklärungsansatz. Die meisten Strukturen können auf Anhieb flächendeckend unterschieden we rden. Wir erkennen die Kontur eines quergestreiften Quadrates auf längsgestreiftem Grund sofort. Sicher ist, dass Texturen unterschieden werden, wenn sie unterschiedlich große Flächen beinhalten, wenn sie sich durchschnittlich in der Farbe unterscheiden, oder wenn sie verschieden große Anteile an Konturrichtungen enthalten. Das alles sind statistisch leicht erfassbare Daten. Die folgenden zwei zusammengefügten Texturen unterscheiden sich aber in keinem dieser Punkte und deren Unterschied ist trotzdem sofort erkennbar, und zwar an der Richtung der Anordnung der Balken in der jeweiligen Textur. Es zählt also auch wie die Elemente zueinander positioniert sind. Erfasst wird dabei ein Streif. (Wenn sie das Dokument digital im Word-Format betrachten, gehen sie auf Ansicht 100%) 187 Ist der Steif in beiden Texturen gleich, so ist keine augenblickliche Unterscheidung der Texturbereiche mehr möglich, wie sich dies hier zeigt: Und auch die nächstfolgende Textur, die ein abstrahiertes Gewebe in Schrägansicht darstellt, dessen Kett und Schussfäden unterschiedlich gedreht sind, kann von der Textur rundum, deren Kett und Schussfäden andersrum gedreht sind, bei starrem Blick nicht unterschieden werden, weil kein unterschiedlicher Streif vorliegt. 188 Oben sind die Überkreuzungsstellen der Fäden durchsichtig dargestellt. Die folgende Abbildung zeigt ein richtiges Gewebe. Allerdings lässt sich ein solches Muster nicht so schön mit seinem Spiegelbild verbinden, so dass der Strukturwechsel an der Kontur auffallen würde. Deshalb sind im folgenden Bild mehrere Versionen der Textur dargestellt, wobei sich eine unterscheidet. Die Muster sollten mit starrem (nicht wanderndem Auge) betrachtet werden. Würde die Strukturdifferenzierung des Gehins ansprechen, so sollte die abweichende Version sofort herausstechen. Das tut sie aber nicht. Verbreitern wir aber die Kettfäden, so enthalten die Texturen eine unterschiedl iche Menge an horizontalen und vertikalen Linien pro Flächeneinheit. Jetzt ist auch mit starrem Auge (nicht serielle Betrachtung) eine Unterscheidung möglich. Der Grun d für die Unterscheidbarkeit liegt in der relativ ungleichen Menge an horizontalen und 189 vertikalen Linien pro Flächeneinheit, die das Gehirn zu erfassen vermag. In den Texturen sprechen unterschiedlich viele Richtungszellen eines Typs an. Wenn wir die Kett und Schussfäden unterschiedlich färben, und deren Farbe im Untergrund austauschen, ist interessanterweise ebenfalls keine sofortige Unterscheidung möglich. Das bedeutet, dass die Richtungsverarbeitung sich allgemein auf Konturen bezieht, die Farbgrenzen jedoch nicht getrennt nach Richtung verarbeitet werden. Dies konnten wir bereits aus neurophysiologischer Sicht, und durch das Gehirnmodell erklären. Es entstehen auf der selben Stufe der Verschaltungshierarchie sowohl die Balkenzellen als auch die Gegenfarbenzellen. Da Platzmangel aufkommt, drängeln sich die Gegenfarbenzellen zu Blobs zusammen. Damit ist die räumliche Exaktheit der Anordnung nicht mehr gegeben, die nötig wäre, um Farbgrenzen nachher auch noch auf ihre Richtung hin auszuwerten. Deshalb sehen wir in diesen Texturen keinen Unterschied, obwohl die Farbgrenzen sich deutlich in ihrer Richtung unterscheiden. 190 Das nächste Muster stellt eine Ableitung der hier dargestellten dar. Es enthält wieder Farbbalken in zwei Richtungen, die in der umgebenden Textur ausgetauscht wurden. Und auch hier ist keine sofortige Texturbereichsabgrenzung möglich. 191 Anders jedoch wenn sich die Balken in der Helligkeit unterscheiden. Dann hebt sich der dunklere Balken besser vom Untergrund ab als der helle. Seine stärker hervortretenden Konturen geben der Textur eine Richtung. In der umgebenden Textur tritt jedoch nun die andere Richtung hervor. Spontane Texturbereichsabgrenzung ist damit möglich. Das gleiche gilt für das folgende Graustufenbild des Gewebemusters. Unterscheiden sich Kett und Schussfäden nämlich in der Helligkeit, so erhält das Muster einen dominierenden Streifen, der im unteren Muster anders verläuft. Nun ist eine spontane Texturunterscheidung möglich. 192 Was aber, wenn keine Richtung in der Textur dominierend ist, weil der Untergrund grau, die Balken schwarz und weiß sind, und sich so beide Richtungen gleich gut vom Untergrund abheben? Die folgenden zwei Muster beweisen, dass die Texturunterscheidbarkeit dann wieder abnimmt. Die Erklärung hierfür liefern die Konturbilder der Grafiken. Die Konturintensität dieses Musters lässt keine Unterscheidung zu, die des vor-vorhergehenden schon. Hier also das Ergebnis eines Konturfilters. Wir sehen, die Texturen werden identisch: 193 Der Leser wird sich nun fragen, warum ich bei den vorhergehenden Texturbeispielen einige schräggestellt habe. Der Grund ist einfach. Die Balken waren dadurch in diagonalen Richtungen angeordnet. Im allgemeinen meide ich die vertikale Richtung in Texturabgrenzungsbeispielen, weil sie für den Menschen eine besondere Bedeutung hat. Er braucht sie, um über optische Reize das Gleichgewicht halten zu können. Es darf angenommen werden, dass der Mensch diese Richtung sensibler wahrnimmt. Dadurch können sich Texturunterscheidungen ergeben, weil gleich starke Konturreize der Abbildung nun nicht mehr gleich stark wirken. Die geradegedrehten Texturen zeigen diesen Effekt. Nun ist auch in den ersten beiden Bildern eine leichte Texturabgrenzung möglich: 194 Worum es bei diesen vielen Studien letztlich geht, ist der Unterschied in der Verarbeitung von Formen und Texturen. Dieser wird besonders bei folgendem Beispiel deutlich: 195 Obwohl die Dreiecke eines der Strukturfelder für die Formerkennung deutlich gespiegelt sind, ist dies nur durch serielles, nacheinander Betrachten der Felder, ersichtlich. Natürlich lässt sich einwenden, dass die mangelnde Unterscheidba rkeit noch nichts mit mangelnder Formerkennung zu tun habe, denn die Form des Dreiecks war ja gleich, nur dessen Ausrichtung wurde verändert. Die einfachste Form ist die Linie und deren Länge, die zweiteinfachste Form ist ein Winkel aus zwei Linien. Die folgenden Bildbeispiele zeigen, dass die Texturverarbeitung weder Linienlängen noch Winkelgrößen zu erfassen vermag. Differenziert können Linien-Streumuster jedoch dann werden, wenn sie eine deutlich unterschiedliche Zahl an Linienenden oder an Linienrichtungen aufweisen. Beides erfordert eine, nur auf wenige Bildpunkte begrenzte Merkmalserfassung, während Winkelgrößen und Linienlängen eine großflächigere Auswertung benötigen würden. 196 197 Kehren wir mit dem inzwischen erworbenen Wissen nun noch einmal zurück zur anfangs gezeigten Abbildung, bei der sich eine gute Texturunterscheidung ergab, weil die Texturgrenzen einen Streif ergaben: Genauer betrachtet besteht dieses Muster ja aus ineinandergestapelten Zickzacklinien. Erhöhen wir den Abstand dieser Stapel, so ist das Muster plötzlich in die andere Richtung gestreift. Wieder ist eine klare Unterscheidung zum gegengleich gestreiften Untergrund möglich. 198 Was aber, wenn der Abstand der Zickzacklinien so gewählt ist, dass sich Quer und Längsstreif die Wage halten? Es zeigt sich, dass die Texturfelder dann kaum mehr unterscheidbar sind, solange man das Bild ruhig fixiert. Ich habe in der folgenden Grafik, die dies zeigt, aber wieder die Darstellung mit den vier Feldern gewählt, da sonst die Unruhe an der Grenze des Texturwechsels eine Texturabgrenzung ermöglicht, wie dies das bunte Exemplar daneben verdeutlicht. Der Schluss, den man aus diesem Ergebnis ziehen kann ist, dass neben der statistischen Mengenerfassung von Farbwerten, Konturausrichtung und Menge, sowie Flächengrößen der Elemente in der Texturverarbeitung vor allem auch noch eine Anordnungsrichtung erfasst wird. Das heißt es wird erfasst ob ein Streif vorliegt, und ob die Elemente in dieser Richtung regelmäßig oder unregelmäßigen Abständen angeordnet sind. 199 Auch in den folgenden beiden Bildern, wo den Zickzacklinien durch runde Ecken ihre Richtungsdominanz genommen wurde, ist (bis auf kleine Störungen an Konturbereichen) keine klare Unterscheidung von Figur und Grund zu erkennen. Die Zentren der Halbkreise, aus denen das Muster zusammengesetzt ist, sind in Figur und Grundmuster gleich verteilt. Deshalb kann kein klarer Streif entstehen. Da ein Halbkreis alle Linienrichtungen enthält, ist auch in beiden Texturabwandlungen gleich viel Linienlänge jeder Ausrichtung vorhanden. Die Unterscheidbarkeit des Zickzack spiegelverkehrter Ausrichtung lässt sich auch durch irritierende Elemente schnell zunichte machen. Im folgenden Bild wirken die Texturbereiche daher gleich. 200 Nun ergibt sich die Frage, ob Strukturdifferenzierung möglich ist, wenn Strukt uren mehrere verschiedene Richtungen enthalten, aber sich in der dominanten Richtung gleichen. Die folgende Struktur enthält zum Beispiel einen dominanten vert ikalen Streif, der sich auch bei ihrer Spiegelung nicht ändert. Verändert haben sich jedoch die weniger dominanten schrägen Streifen. Es zeigt sich dass, solang e man die Textur ruhig fixiert und sich auf den vertikalen Streif konzentriert, keine ordentliche Texturdifferenzierung möglich ist. Das legt nahe, dass das Gehirn wirklich nur eine Streifrichtung zu einem Zeitpunkt zu erfassen vermag. Sobald man das Auge in schräger Richtung darübergleiten lässt, tritt aber Texturdifferenzierung ein. Dies kann daraus erklärt werden, dass durch die Bewegungsrichtung bestimmte Konturen stärker verschwimmen als andere. Es entsteht eventuell ein ähnlicher Effekt wie in der folgenden verwischten Version des Musters. Strukturdifferenzierung wird dadurch möglich. 201 Eine weiteres Phänomen betrifft die Erfassung von Anordnungen und die Auflösungsgrenzen des Auges. Die folgenden drei Texturen mit den Dreiecken sind je nach Entfernung (und damit variierender Größe auf der Netzhaut) unterschiedlich gut zu unterscheiden. Struktur 1 und 2 ist von der Nähe, 2 und 3 hingegen von der Entfernung gut zu unterscheiden. Warum? Weil von der Nähe erkennt man die Ausrichtung der Seitenkanten der Dreiecke sehr genau. Von der Entfernung hingegen springt vor allem die Anordnung der Elemente ins Auge. Dieses Phänomen ist einfach daraus zu erklären, dass auch das Auge eine Auflösungsgrenze hat, und dadurch die kleinen Richtungsunterschiede in den Seitenkanten der Dreiecke von der Entfernung nicht mehr zu bemerken sind. Wichtig erscheint mir, dass die Texturverarbeitung fähig ist, spontan den Unterschied zwischen einer gestreuten Anordnung von Dreiecken, oder einer regelmäßigen rasterartigen Verteilung zu erkennen, wenn sich gute geradlinige Verbindungslinien (Streif) ergeben. Ich habe oben festgestellt, dass Winkel und Linienlängen wohl deshalb nicht sofort erkannt werden, weil dies mit einer lokalen Verarbeitung nicht möglich ist. Aber daraus würde folgen, dass auch diese Anordnung nicht erkennbar sein sollte, denn das Erkennen von Anordnungsmustern 202 erfordert eindeutig ebenfalls eine, über den lokalen Bildpunkt und seine unmittelbaren Nachbarn hinausgehende Verarbeitung! Es kann sogar gezeigt werden, dass die gedachten Linien, welche die Elemente einer Textur miteinander verbinden, fast genauso wirksam zur Texturdifferenzierung beitragen, wie real eingezeichnete Linien. So ist in den folgenden beiden Beispielen das verdrehte Texturstück gleichermaßen leicht bzw. schwer zu erkennen, obwohl nur im zweiten Beispiel reale Konturlinien da sind, auf die die Richtungsdetektoren reagieren können: 203 5.2.4 Ein Modell der Texturerkennung Dass die Farbe und Größe und Zahl der Elemente, sowie die Menge an Konture n gleicher Ausrichtung in zwei Texturen pro Flächeninhalt gleich sein muss, um sie als identisch zu erleben ist einleuchtend. Dies sind Informationen, die mit wenig Aufwand flächendeckend erfasst werden können. Dass die Anordnungsrichtung nicht verdreht werden darf, ist jedoch bemerkenswert. Wie erfasst das Gehirn die Anordnung der Elemente zueinander? Zunächst natürlich durch die Flächen dazwischen. Aber bei einer verdrehten Struktur sind auch diese gleich. Allerdings haben wir gesehen, dass der Abziehbildsignalfluss auf den Quasiebenen der Richtungszellen ebenfalls gerichtet stattfindet. Das bedeutet, eine Stru ktur, die viele horizontale Konturen beinhaltet, wird hauptsächlich auch der horizo ntalen Quasiebene zu einem Abziehbildsignalfluss führen. Daran kann ihre Ausrichtung erkannt werden. 5.2.5 Formerkennung Die obigen Wahrnehmungsexperimente beweisen auch, dass wir abgesehen von der parallelen visuellen Erfassung auch über eine serielle Auseinandersetzung mit Formen verfügen, die uns dann weiterhilft, wenn die parallele Erfassung zu wenig ist. Mit dieser Art der Verarbeitung gelingt es uns auch in jenen Abbildungen den Unterschied von Figur und Grund zu erkennen, wo er nicht unmittelbar auffällt. Die untere Darstellung, die wir bereits kennen, zeigt diesen Unterschied sehr schön auf: Die Form des O ist durch ihre Vielzahl an Konturrichtungen so anders als die Vs, dass auch die einfache parallele Auswertung, die wir im Rahmen der Texturwahrnehmung kennen gelernt haben, genügt, um es zu erkennen. Das R unter den P und Q erkennen wir jedoch nur durch bewusstes Hinsehen und Formerfassen. Das bedeutet wir müssen seriell jedes Element einzeln betrac hten (Goldstein 1997, S.186, 188). Das Übergangsfeld zwischen Texturerkennung und Formwahrnehmung ist auch das Übergangsfeld zwischen paralleler Verarbeitung von Signalen, und der nachfolgenden seriellen. Serielle Erkenntnisprozesse, sind von bewusster Aufmerksamkeit begleitet, und zeichnen sich dadurch aus, dass nie mehr als ein Objekte gleichzeitig Denkinhalt sein kann, „seriell“ eben. Dieser Prozess kann nur verstanden werden, wenn wir begreifen, wo die parallele Verarbeitung endet, und 204 wieso. Da letztlich alle Denkinhalte von der parallelen Verarbeitung der Sinne zur seriellen des Bewusstseins wechseln, ist dieser Übergangsbereich grundlegend für das Verständnis des Gehirns. Die Zeitcodierung, mit der wir uns nun so intensiv beschäftigt haben, stellt den Übergang von der parallelen zur seriellen Verarbeitung dar. Ich will die beiden Extreme am Beispiel eines Bildes von einem Hund veranschaulichen. Ohne jegliche Zeitcodierung könnte der Hund nicht wiedererkannt werden, denn er wird nie wieder die selben Bildpunkte einnehmen und schon gar nicht vor dem selben Hintergrund. Er wird das nächste mal anderswo im Bild sitzen, seine Körperhaltung verändern, perspektivisch weiter weg und damit kleiner sein, anders beleuchtet sein, vielleicht haben wir unseren Kopf verdreht und er liegt schief im Bild usw. Deshalb ist es wertlos die Bildinformation räumlich als Bildpunkte so abzuspeichern wie sie vorliegt. Abgespeichert muss vielmehr eine Beschreibung werden, eine Abstraktion von Hund, so ähnlich wie eine Kinderzeichnung: „Da ist ein Ding mit etwa quaderförmigem Zentrum, das auf vier stabförmigen senkrechten Teilen steht. An einem Ende sitzt ein etwa kugelförmiges Teil, dessen Volumen etwa ein viertel des Quaders beträgt. Das Ding kann sich bewegen...usw.“ Diese Beschreibung, die natürlich nicht wörtlich vorliegt, sondern in den Zeitcodes der Fließsignale, gilt in allen oben genannten Fällen, d.h. der Hund wird immer erkannt, zumindest als Tier. Auf der höchsten Ebene der Formbeschreibung verwenden wir also Grundformen „shapes“, die wir in vielen Dingen wiederfinden (Edelmann 1998). Wie die Zeilen unserer Schrift ist auch die Formbeschreibung durch Zeitcodes seriell, also zeitcodierte Information, und entspricht daher dem seriellen bewus sten Denken, das nur einen Inhalt pro Zeit zu verfolgen vermag. Kinder geben uns in ihren Zeichnungen solche Beschreibungen der Welt. Sie setzen die Dinge aus einfachen Grundformen zusammen. Mit zunehmendem Alter verwenden sie immer 205 mehr dieser Grundformen, und so wird das Bild detaillierter, das haben wir weiter oben am Beispiel der Männchenzeichnung beobachtet. Den Schlüssel zur Erforschung der Zeitcodierung boten die Redundanzketten. Das Gehirn verbindet die Elemente, aufgrund von wiederholt eintretender naher Aktiviertheit, zu Ketten. Diesen Ketten entlang wandern die seriellen Signale. Redundanzketten brauchen nicht immer geradlinig zu verlaufen. Die folgende Textur führt zu einer Verkettung ihrer Elemente zu Kreisen. Da ein Element j eweils mehreren Kreisen zugeordnet werden kann, beginnt das Muster zu brodeln. Das Gehirn scheint, sobald eine Lösung gefunden und verarbeitet ist, nach einer weiteren gleichwertigen Lösung zu suchen, und die findet es hier. Ich vermute, dass die weißen Zwischenflächen der Schlüssel zum Verständnis dessen sind, was beim Betrachten dieser Textur im Gehirn passiert. Die größten durchgängigen weißen Flächen bilden sich rund um die mittelgroßen Punkte. Sie siegen in der Signalverarbeitung. Diese Flächen sind im Kreis angeordnet, und so ineinander verzahnt, dass fast jede Fläche mehreren Kreisen zugeordnet we rden kann. Ordnet das Auge die Flächen zu einem Kreis, so unterbricht es damit einen anderen Kreis. Nun ist es so, dass wir mehrere gleiche Objekte als eine Einheit sehen können. Wir können sie gemeinsam als ein Objekt denken, als ein Muster. Aber sobald sich hier einige Kreise zur Einheit vereinen wollen, bemerken wir, dass einige von ihnen gar keine Kreise mehr sind. Sie sind schon durch die anderen zerstört. So ordnen wir das Muster ständig um. 206 Aber bieten nicht auch viel banalere Bespiele die Möglichkeit verschieden geordnet zu werden? Die erste der folgenden Anordnungen von Punkten können wir uns anhand einer vorgestellten Verbindung in Form einer vertikalen und horizontalen Geraden merken. Fügen wir einen Punkt dazu, so kommen wir auf die Darstellung rechts, die wir uns nicht als zwei Teile, sondern als durchgehende Kurve merken. Wie der Mensch eine Darstellung auffasst, ist durch seine Wiedergabe, und die dabei entstehenden Zeichenfehler überprüfbar. Es zeigt sich, dass der Mensch eine geschlossene Form im Denken nicht aufbricht, sondern als Objekt denkt, auch wenn es manchmal bei der Wiedergabe anders von Vorteil wäre. So ließe sich ein Wabenmuster ganz einfach durch parallele Zickzacklinien erzeugen, die man verbindet (Fig.d). Darauf kam aber keiner der Erwachsenen Personen, die aufgefordert wurden ein Wabenmuster zu zeichnen (aus Arnheim 1978, S. 221). Die folgende Grafik merken wir uns als Rest einer Torte, nachdem wir einige Stücke herausgeschnitten haben. Die daneben als Bohne. Den Tortenkreis sehen wir in ihr nicht mehr, obwohl sie der rechten Grafik, bis auf die stärker abgestumpften Ecken, genau gleicht. Die Zentren in der folgenden optischen Täuschung erhalten die Signale von den Konturen der Balkenenden. Diese laufen auf einen Punkt zusammen. Das erzeugt 207 den Kreiseindruck. Ein Quadrat unterscheidet sich vom Kreis dadurch, dass die Signale nicht ganz gleichzeitig ankommen, weil sie einen unterschiedlich langen Weg zum Objektzentrum durchlaufen. Das ist hier in einem sehr geringen Ausmaß auch der Fall. Wenn ich nun das Wort „Quadrat“ unter der Zeichnung lese, so entsteht zusätzlich eine Aktivierung des Gestaltbegriffs „Quadrat“ über die Sprache. Dann sehe ich auch eher Quadrate als Kreise. Ich kann auch Achtecke sehen. Aber da Achtecke eine seltene Form sind, rechnet mein Gehirn weniger mit deren Erscheinung. Es ist bekannt, dass solche „Scheinkonturen“ bereits auf V2 der Sehrinde verarbeitet werden (Birbaumer 1996, S.396). Vielleicht ist das Bild dort zum Teil schon Zeitcodiert. Non-existing cirles or sqares Was bringen solche Beispiele? Nun, vielleicht mag sich der Leser fragen, wie ich auf dieses Gehirnmodell gekommen bin. Dazu kann ich nur sagen: Die wichtigste Quelle waren eine Vielzahl solcher Beispiele, und an die hundert Texturbeispiele. Zeichnen und betrachten, das war meine Form der Forschungstätigkeit. Es stellte sich mir die Frage, warum ich mir in einem Fall das Objekt aus zwei Informationen denke, nämlich aus einem Kreis, mit einem fehlenden Teil. Informationen, die ich nur seriell hintereinander denken kann. Im anderen Fall interpretiere ich die Zeichnung als ein gekrümmtes Oval, also als Bohne. Die Antwort war schließlich der Signalfluss und die zeitliche Codierung. Beim Oval führt der Abziehbildsignalfluss erst einmal zu einer gebogenen Symmetrieachse, deren Krümmung und Länge ich auf der nächsten Ebene verarbeite. Da die Signalfließprozesse auch eine Erklärung für so viele andere Phänomene des Denkens boten, ist schließlich mehr daraus geworden, als nur ein Modell des Sehens. 5.2.6 Figur/Grund Das Figur/Grund-Problem findet eine Lösung im Abziehbildsignalfluss, denn dieser schafft nämlich einen Zusammenhalt innerhalb einer gleichgereizten Fläche. Die 208 Regeln zur Figur/Grund-Trennung werden besonders dort deutlich, wo wir Figuren sehen, die nicht da sind. Eigentlich bin ich auf dieses Problem bereits eingegangen. Ich möchte aber hier, nachdem wir nun das Sehsystem etwas genauer unter die Lupe genommen haben, noch einmal darauf zurückkommen. Eine Parallele findet sich bei der Verarbeitung von auditiven Signalen. Auch bei diesen ist nicht immer ohneweiters klar, was Figur und Grund ist. Man kann Töne als Figuren betrachten, die sich von den Pausen zwischen ihnen abheben. Was Pause ist, hängt aber wesentlich davon ab, was wir womit in Verbindung bringen. Hören wir zum Beispiel ein Saxophonsolo und dahinter die die regelmäßigen Schläge einer Bassdrum, dann erkennen wir die Pausen zwischen diesen Schlägen als Ganzes, obwohl eigentlich Töne des Saxophons diese Pausen unterbrochen haben. Das ist so, weil Gleiches eher miteinander in Verbindung gebracht wird, und wir somit Bassdrumschläge und Saxophontöne zu einer jeweils eigenen Kette verbinden. Es gelingt außerdem, weil Töne im Gehirn als Reaktionsbild da rgestellt werden, und das Saxophon Reaktionen an einem anderen Ort in diesem Reaktionsbild auslöst, als die Bassdrum. So können die Signale aneinander vorbeifinden. Bei der Betrachtung eines Musters ist das ähnlich. Der Streif in einem Muster entsteht einfach dadurch, dass in dieser Richtung eine Kettenverbindung entsteht. Es ist die Richtung mit der engsten Wiederholungsrate, also mit der größten Redundanz. Man kann also von Redundanzketten sprechen. Eine Redundanzkette besteht aus Figuren, die einen bestimmten Bereich belegen. Wie aber gelingt es uns, den Grund als etwas Durchgehendes zu erkennen, das sich hinter den Figuren befindet? Die Erklärung habe ich bereits geliefert. Sie liegt in den rücklaufenden Signalen. Diese dienen nicht nur der Aufmerksamkeit, also der Aktivierung, sondern umgekehrt werden Signale sobald sie erkannt sind auch wieder abgeschaltet. Dazu nun ein Beispiel: Stellen wir uns ein Muster aus regelmäßigen Kreisen vor. Die Kreise werden erkannt und verlieren an Aktivität. Nun ist der Platz frei für den Abziehbildsignalfluss des Grundes. Die Signale brauchen nicht mehr die Kreiskonturen umfließen, was zu einer komplizierten Form führt, sondern sie können, sobald die Aktivität der Kreisflächen verschwunden ist, einfach flächendeckend zusammenfließen, zu einem durchgehenden Hintergrund, der im folgenden Beispiel rechteckig ist. Der selbe Prozess ist auch verantwortlich für unsere Fähigkeit verdeckte oder halb sichtbare Formen zu ergänzen. Erst wird die vordere Form erfasst. Wenn ihre Konturen abgeschalten sind, dann können die hinteren Formen als Ganzes gesehen werden. Es ist also eine gerichtete Aufmerksamkeit nötig. Kiefer, Neumann u, Spitzer (2000) beschäftigen sich mit der Fähigkeit zur Ergänzung von Objektflächen. 209 Aber wieso werden in dem Beispiel die Kreise als etwas Bekanntes erkannt, und nicht die komplizierte Form des Hintergrundes. Ganz einfach deshalb, weil annähernd Kreisförmiges in unserer Umgebung oft vorkommt, und deshalb bekannt ist. Die Hintergründe, die im Bild solche kreisförmigen Objekte umschließen, haben ständig neue, sehr komplizierte Formen, die sich nicht so oft wiederholen. Außerdem ist zur Abspeicherung solch komplexer Formen eine wesentlich aufwendigere Verschaltung von Zellen notwendig, die sich nicht so schnell ausbildet, und komplexere Formen sind nicht so gut komprimierbar. Also wird die Hintergrundform nicht erkannt, bevor nicht der Kreis erkannt ist. Aus der Gestaltpsychologie kennt man die Regel, dass die sogenannten „guten Gestalten“ eher als Figur gesehen werden (Arnheim 1978). Jetzt kennen wir die Begründung dazu. Große Komprimierung entsteht aufgrund der Regel, dass was zeitgleich am selben Ort zusammenfließt und gleiche Aktivität aufweist, sich zu einem Gesamtsi gnal vereint. Dieses Gesamtsignal ist umso stärker, je mehr zusammenfließen konnte, je mehr also komprimiert wurde. Starke Signale siegen. Kreise sind durch den Abziehbildsignalfluss im Zentrum maximal komprimierbar. Deshalb werden Kreise sofort erkannt. Sind sie aber erst einmal verarbeitet und deaktiviert, so sind die überbleibenden Formen auch leichter zu erfassen. 5.2.7 Die Bindung der Sinnesreize Das Bindungsproblem ist letztendlich durch die Konditionierung zu lösen. Da das hier dargestellte Modell ja fähig ist, Kontakte zwischen Zellen herzustellen, die an beliebigen Orten positioniert sein können, wenn diese nur oft genug gleichzeitig aktiv werden, ist naheliegend, dass auch zwischen den Sinnen irgendwann Verbindungen entstehen. Objekte tragen ihre Eigenschaften immer bei sich, und so sind in zeitlicher Nähe zu den visuellen Eigenschaften eines Objektes immer auch andere Eigenschaften, wie bestimmte Geräusche, Gerüche, Geschmack oder Ertastetes wahrnehmbar. Alle diese Eigenschaften werden aufgrund der zeitlichen Auftrittsnähe Verbindungen eingehen, und die Chunkzelle für diese Verbindung repräsentiert letztlich das Objekt. Eine wichtige Eigenschaft ist auch der Auftrittsort des Objekts. Wichtig ist, dass zu einem Zeitpunkt meist nur ein kleiner Teil aller bekannten Eigenschaften des Objektes wahrnehmbar sind. Trotzdem ist an der spezifischen Zusammenstellung 210 von Eigenschaften klar, um welches Objekt es sich handeln muss. Studien zum Zusammenspiel der Sinne zeigen, dass Objekte oft allein am Auftrittsort e rkannt werden, auch wenn die Sichtbarkeit nur zu einem geringen Teil gegeben ist (Heinecke 2000, WSA 2000.10.20, WSA 2000.11.17, WSA 2001.03.29). Umgekehrt werden Objekte schlechter erkannt, wenn man sie in Bildern an Orte versetzt, wo sie nicht hingehören (Goldstein S.189). 5.2.8 Die Verarbeitung räumlicher Tiefe Die Stereooptik führt zu seitlichen Verschiebungen zwischen den Konturen von Objekten auf den beiden Netzhautbildern (Gotthalmseder 1998, S.61f, S.117). Diese sogenannte Querdisperation variiert aber auch mit der Fokussierung der Augen. Nehmen wir an die Augen sind gerade auf Objekte einer bestimmten Entfernung fokussiert, dann sind die beiden Netzhautbilder für diese Entfernung deckungsgleich ausgerichtet. Konturen anderer Entfernung erscheinen in den beiden Bildern jedoch verschoben. Liegt an einer Kontur eine Verschiebung zwischen linkem und rechtem Netzhautbild nach links vor, so befindet sich diese Kontur näher bei uns als die derzeitige Fokusierungsentfernung des Auges. Liegt eine Verschiebung nach rechts vor, so ist die Kontur weiter von uns weg als die derzeitige Fokusierungsentfernung. Die Neuronen, welche dies auswerten liegen in Schicht IV der visuellen Sehrinde, und sind in okulären Dominanzsäulen angeordnet (Kolb 1996, S.138, Hubel 1989, S.113). Das Stereooptische Sehen erlernen Kinder mit etwa dreieinhalb Monaten. (Studien dazu bei Goldstein 1997, S.258). Eine Strecke erscheint perspektivisch dann verkürzt, wenn sie in den Raum hineinläuft. Das bedeutet, die seitliche Verschiebung ihrer Kontur, in den zwei Netzhautbildern, wechselt entlang der Strecke kontinuierlich von wenig zu stark. Die seitliche Verschiebung kann im Signalflussmodell durch die Zeitspanne erkannt werden, die Signale brauchen um zueinanderzufinden. Diese Information liegt entlang der Kontur vor. Das Gehirn des Säuglings, der Objekte vor sich dreht, registriert die Veränderung der Längen ihrer Konturen. Gleichzeitig ändern sich auch immer die stereooptischen Informationen entlang der Konturen, wobei die Verkürzungen besonders stark sind, wenn die beschriebenen Verschiebungen entlang der Konturen stark wechseln. Das wird natürlich registriert, und in Zukunft vorausgesagt. Eine längere Kontur wird mit einer verkürzt erscheinenden der selben Länge in Verbindung gebracht, weil diese Erscheinungen bei der Rotation von Objekten immer nacheinander auftreten. Die Verkürzung wird mit der mangelnden Deckungsgleichheit in den Netzhautbildern in Verbindung gebracht, und somit vorausgesagt. Es wird also nur dann ein neues Neuron ansprechen, wenn die Voraussage nicht stimmt. Nur dann haben wir es mit einem neuen Objekt zu tun. Umgekehrt kann, da es sich um Und-Verbindungen handelt, auch aus der mangelnden Deckungsgleichheit in Zukunft auf die Originallänge der wahrgenommenen Gegenstände rückgeschlossen werden. Wir sehen, dass die 211 Konditionierungsregeln durchaus auch elementare Verbindungsprozesse im Gehirn erklären. 5.2.9 Raumorientierung Alles bisher Besprochene diente der Erkennung von Objekten in Bildern. Im re alen Leben befinden sich Objekte aber an bestimmten Plätzen des Raumes, der uns umgibt. Wenn wir auch Wände oder den Erdboden als Objekte bezeichnen, so könnte man sagen, der Raum ist definiert, durch die Orte an denen sich bestimmte Objekte befinden. Umgekehrt kann man auch sagen, wenn uns der Platz, an dem sich ein Objekt befindet, bekannt ist, und wir auf diesen Ort blicken, haben wir damit automatisch das Objekt erkannt, und alle seine Eigenschaften sind automatisch zueinander gebunden (Heinecke, Armin 2000). Bewegen wir uns, oder unsere Augen, so erhalten wir ständig neue Sinneseindrücke. Um diese sinnvoll zu einem gesamten Raum aneinanderzufügen bedarf es komplizierter Verarbeitungsprozesse. Unter anderem bedient sich das Gehirn dafür des Gleichgewichtsorgans im Ohr. Dieses dient nicht nur als Lot, und gibt uns damit die Lage des Horizontes vor, sondern es ist auch sensibel auf Drehbewegungen, und gibt uns den Winkel an, in dem wir den Kopf gedreht haben. Allerdings gerät es durcheinander, wenn wir uns länger im Kreis drehen, weil es das Trägheitsmoment nützt, das bei der Beschleunigung des Kopfes entsteht. (Kolb 1996, S.97). Dieses Trägheitsmoment tritt jedoch nur am Anfang einer Drehbewegung auf. Ein künstliches System könnte man mit einem stabileren Orientierungsorgan ausstatten. Man könnte einen Kompass einbauen. Direkt über das Reaktionsbild des visuellen Systems, könnten die Orientierungsdaten gelegt werden. Es scheint aber nicht das primäre visuelle Reaktionsbild ideal, sondern eher die letzten Ebenen der visuellen Verarbeitung, in denen das Bild noch in seiner flächigen Form vorliegt, aber bereits Formen erkannt werden. Das Orientierungsorgan würde man in einem künstlichen System nicht im Kopf, sondern direkt am Auge (Kamera) anbringen. Das erspart einige Umrechnungsvorgänge. Nehmen wir an, das künstliche Orientierungsorgan besteht aus einer Kugel, die ihre Orientierung im Raum nicht ändert, weil sie magnetisch ist, und unten schwerer, wie die Kugel eines Flugzeugkompass. Die Kugel schwimmt in einem Umraum, der auf einer Seite, ein rezeptives Feld enthält, das der Größe des mit den Augen wahrnehmbaren Umfeldes entspricht. Nehmen wir weiters an, die Kugel ist mit zwei Sorten von Signalgebern besetzt. Die eine Sorte sendet auf der Oberseite der Kugel stark, nach unten hin jedoch immer schwächer. Die andere sendet an einem Punkt des Umfangs stark, um den Umfang herum jedoch immer schwächer. Im rezeptiven Feld des Orientierungsorgans werden die Signale der beiden Sorten von Signalgebern erfasst, und an das visuelle System geleitet, wo sie über das visuelle Reaktionsbild gelegt werden. Damit werden jedem visuellen Eindruck Orientierungsdaten zugefügt. Diese können mit den bekannten Regeln des Erkenntnisgewinns verarbeitet werden. 212 Das Orientierungsproblem ist damit natürlich noch nicht vollständig gelöst. Sola nge der Betrachter (das künstliche Wesen) seine Position nicht ändert, wird die gleiche Blickrichtung das gleiche Bild ergeben. Aber was, wenn er dies tut? Was wir erfasst haben, ist die Position der Objekte in Relation zum Betrachter. Diese ist wichtig, um sich im Raum bewegen, und mit Objekten hantieren zu können. Aber für das Wiedererkennen von Räumen und Objekten bringt sie wenig. Hier wäre eher die Position von Objekten in Relation zueinander von Wert, denn diese Daten bleiben konstant, egal wo der Betrachter steht. Wären alle Objekte in ihrer Position zueinander exakt definiert, so bräuchten wir nur ein Objekt erkennen, und die anderen Objekte wären, allein durch ihre Position, bereits miterkannt. Die relative Position, die zwei Objekte zueinander einnehmen, wird erfasst indem so getan wird, als wenn beide Objekte Teile eines Gebildes wären. Dazu müssen sie so betrachtet werden, dass sie sich gemeinsam in einem Bild befinden. Nun wird versucht, die visuell erkennbaren Redundanzketten so fortzusetzen, dass die Konturen oder das Achsenskelett der beiden Objekte verbunden werden können. Dies funktioniert besonders gut, wenn die Objekte gleiche Ausrichtung besitzen. Deshalb neigt der Mensch dazu, Dinge zu schlichten. Dabei werden sie in ihrer Ausrichtung gleichgerichtet, und erscheinen somit übersichtlich, wie ein einziges Objekt. Man kann sagen, die Objekte ergeben zusammen ein Überobjekt. So ergeben Sessel, Bank und Tisch zusammen die Sitzecke. Wir sind derart gewohnt, diese zusammen zu sehen, dass wir möglicherweise nicht einmal recht wissen, wo der Sessel her ist, wenn wir ihn an einem fremden Platz, wie dem Keller vorfi nden. Natürlich ist die Problematik der Raumorientierung damit nur ganz grob abgehandelt. Es ist noch überhaupt nicht besprochen, wie die Projektionsfelder der motorischen Zellen dazustoßen. Schließlich muss es hier eine Verbindung geben, sonst könnten wir den Körper nicht sinnvoll im Raum bewegen. Aber nicht nur das visuelle System ermöglicht Raumorientierung. Auch ein Blinder kann sich orientieren. Sein Tastsinn, das Richtungshören, und vor allem sein Merkvermögen für Bewegungsabläufe helfen ihm dabei. Was die Position unserer Körperteile zueinander betrifft, so kommen wir aber durchaus ohne Orientierungsorgan zurecht. Um uns z.B. an einer bestimmten Körperstelle zu kratzen, müssen wir nur die nötigen Gelenksstellungen kennen, um unsere Hand zielgerichtet dorthin führen zu können, wo wir sie ja dann spüren. Der Tastsinn ist also ebenso wichtig für die Raumorientierung, wie der Sehsinn. Er führt ja auch zu einem flächigen Projektionsbild im Gehirn. Wir können ertasten, wo sich unser Raum begrenzt. Die Ergebnisse der Sinne bestätigen sich somit gegense itig. 213 5.3 Höhere Funktionen Natürlich könnte ich jetzt versuchen, das Modell auf alle anderen Sinne anzuwenden, die viel weniger erforscht sind als das visuelle System. Aber was brächte es, wenn ich eine hypothetische Verschaltung beschreibe, die sich dort ausbilden könnte. Das Modell hat klare Regeln. Es kann simuliert werden, und dann wird man wissen, welche Verschaltung sich ergibt. Dass es eine sinnvolle Verschaltung sein wird, und sich ein solcher Versuch lohnen sollte, habe ich so gut wie möglich zu belegen versucht, indem ich gezeigt habe, dass sich das visuelle System weitgehend durch das Modell erklären lässt. 5.3.1 Wieso das Modell in anderen Systemen funktionieren sollte als im visuellen Wieso dürfen wir darauf hoffen, dass das Modell auch für andere Erkenntnisbereiche gilt? Ganz einfach deshalb, weil es aus den Konditionierungsregeln entwickelt wurde. Diese sind statistischer Natur, und Statistik gilt in allen Erkenntnisbereichen. Aber wieso sollte die zeitliche Codierung räumlicher Information etwas für andere Bereiche bringen? Nun, der Abziehbildsignalfluss tritt ja überall dort auf, wo Und Verbindungen vorliegen. In diesen Bereichen fließt das Signal nach dem Schema des Abziehbildes ab. Natürlich kann so etwas auch in anderen Gehirnbereichen vorkommen, denn der Tastm Hör und Geschmackssinn werden auch auf Projektionsfelder im Gehirn übertragen und liefert daher auch ein Reaktionsbild, auf dem ebenfalls Und-Verbindungen entstehen werden. Das Modell führt aber nicht überall zu einer Zeitcodierung, sondern nur dort, wo eine andere Vorankündigung der Reize ausbleibt. Gibt es eine allgemeine Definition, wann Zeitcodierung Sinn macht, und was sie bringt? Ich würde sagen, zeitliche Codierung macht es möglich Reize in Relation zueinander zu erfassen, unabhängig von der räumlichen Relation, in der sie zu uns als Betrachter stehen. Da sich die räumliche Position des Betrachters ständig ändert, zum Wiedererkennen von Dingen jedoch konstante Daten erforderlich sind, ist die Zeitcodierung räumlicher Information oft der einzige Weg, um übe rhaupt etwas Wiedererkennen zu können. Da auch taktile Informationen räumlicher Natur sind, werden sie wohl auch zeitcodiert werden, wenn sie dem Wiedererkennen von Objekten dienen sollen. Bemerkenswert ist, dass umgekehrt die zeitliche Information des auditiven Systems räumlich codiert wird. Zeitliche Ereignisse werden durch bestimmte Neur onen im Netz repräsentiert, erhalten also eine klare räumliche Zuordenbarkeit. Sie können dadurch zeitunabhängig (also zu einem beliebigen Zeitpunkt) wiedererkannt werden. Wir können also sagen: Zeitcodierung macht räumliche Information raumunabhängig wiedererkennbar, räumliche Codierung macht zeitliche Information zeitunabhängig wiedererkennbar. 214 Eigentlich ist es ein Widerspruch in sich, zeitliche Information zeitunabhängig abzuspeichern. Die Information besteht ja darin, dass etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfindet. Aber wäre eine Information durch ihren Zeitpunkt als etwas einzigartiges gekennzeichnet, so gäbe es kein Wiedererkennen. Deshalb setzt unser Gehirn den Zeitpunkt nicht fix fest, sondern in Relation zu den benachba rten Zeitpunkten. Es erhält dadurch Maße, die in der Welt immer wieder vorkommen. Wir finden also die erhaltenen Zeitrelationen in der Welt öfter als das eine mal. Einen fixen Zeitpunkt hingegen gibt es nur einmal. Er kann also gar nicht wieder auftreten, also auch nicht wiedererkannt werden. Wiedererkennen basiert also auf zeitunabhängiger, also relationaler Zeiterfassung und raumunabhängiger, also relationaler Raumerfassung. Wenn wir bedenken, dass bereits eine Signalstärke, also eine zeitliche Signaldichte, eine zeitliche Information ist, und eine Zelle, die nur auf diese bestimmte Signalstärke anspricht, bereits eine räumliche Codierung dieser Information darstellt, so werden wir entdecken, dass die Verarbeitung im Gehirn regelrecht auf dem Prinzip beruht, ständig zeitliches räumlich zu codieren und wieder retour. Es ist also durchaus davon auszugehen, dass ein Modell, das die zeitliche Codierung räumlicher Information beinhaltet, auch für andere Sinnesdaten gilt, nicht nur für visuelle. 5.3.2 Sozialer Kontakt Das Modell wurde vor allem konzipiert, um zu erklären, wie die Welt in unseren Kopf kommt, und woraus sich unser Verhalten in der Welt erklärt. Wir reagieren jedoch nicht nur auf die leblose Welt, sondern wir interagieren auch miteinander. Menschen lernen voneinander. Sie profitieren von den Erfahrungen Anderer, sprechen miteinander. Durch Lernprozesse kann das System auch feststellen, dass die Wiedererreichung seiner Grundbedürfnisse oft mit der Anwesenheit einer Person korreliert, die es betreut. Selbstlernende Systeme werden genau wie kleine Kinder in ihrer Lernzeit Betreuung brauchen, um z. B. aus einer Zimmerecke wieder herauszufinden, in die sie sich manövriert haben, oder um nicht über die Stiegen zu fallen, oder auch nur, um zu lernen die Steckdose wiederzufinden, und ihr Stromkabel dort einzustecken. Die Anwesenheit des Betreuers ist kein Grundbedürfnis, sondern ein erlerntes Bedürfnis, also eine Emotion, und somit viel komplexer. Es lässt sich aber erahnen, dass die Signale, welche die Wiedererreichung der Sollwerte signalisieren, oft mit der Anwesenheit des Betreuers korrelieren, und somit mit der inneren Repräsentation des Betreuers verbunden werden. Dadurch entsteht eine positive Bewertung des Betreuers, denn Werte werden von den Bedürfnissen auf andere Wahrnehmungen übertragen, das weiß auch die Werbepsychologie. Ich denke „Liebe“ beim Menschen ist so komplex, dass sie nie wirklich erklärt werden kann. Aber sie hat sicherlich auch etwas mit all den Bedürfnissen zu tun, deren Erfüllung in der vorgestellten Zukunft immer gemeinsam mit dem Partner geschieht. Verliert man den Partner, bricht die die ganze vorgestellte Zukunft 215 zusammen, und man erlebt eine ungeheure Orientierungslosigkeit und Leere. Zumindest dieser Aspekt der Liebe hat nichts magisches, sondern ist durchaus erklärbar, und wird vielleicht in ferner Zukunft auch von künstlichen Wesen e rlebt. Faszinierend ist auch die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können. Sie gehört zu den komplexesten Voraussichten der Welt, da ja das G ehirn des Anderen ein Teil der erlebten Welt ist. Wie alle komplexen Zukunftsvorstellungen, an denen alle Sinneserfahrungen beteiligt sind, spielt sich diese Leistung im Stirnhirn ab (Spektrum-Ticker 2001.04.30, WSA 2001.02.01, WSA 2001.05). 5.3.3 Sprache Dass ein Wesen, das über eine innere Repräsentation der Welt verfügt, bis zu einem gewissen Grad auch Sprache erlernen wird, ist einleuchtend. Eine Mutter begleitet die Handlungen ihres Kindes sprachlich. So verwendet sie öfter das Wort Bagger, wenn das Kind mit dem Bagger spielt. Diese statistische Häufung fällt zusammen mit der statistischen häufigeren Wahrnehmung des Baggers, und somit wird der visuelle Eindruck mit dem auditiven Eindruck des Wortes „Bagger“ verbunden. Dass die Sache sich wirklich so einfach verhält und wirklich aus d er assoziativen Konditionierung zu erklären ist, legen Untersuchungen nahe, die zeigen, dass früheste Erinnerungen von Kindern später immer noch in der Kleinkindersprache von damals erzählt werden (Spektrum-Ticker 2002.05.08), und dass Erinnerungen von Personen, die in ihrem Leben die Sprache gewechselt haben, in der alten Sprache gedacht werden (WSA 2001.03.08). Sprache hat auch etwas damit zu tun, sich in ein fremdes Gehirn zu versetzen. Sie führt zu einer Angleichung der Denkinhalte mit einer anderen Person. Ob ein Modell des Spracherwerbs durch Konditionierung hingegen ausreicht, um das Verständnis für abstrakte Begriffe zu erklären, oder grammatikalisch richtig sprechen zu lernen, kann man nicht beurteilen, ohne dieses Gehirnmodell zu verwirklichen. Ich glaube jedenfalls daran, dass der Erwerb eines ordentlichen Sprechvermögens nur eine Frage der Gehirnkapazität ist. Immerhin soll inzwischen Software entwickelt worden sein, die gesprochene Wörter so gut erkennt wie der Mensch (Berger 2002), aber natürlich ohne die Bedeutung dahinter zu kennen. 5.3.4 Wille und willentliches Merkvermögen Dadurch, dass das Gehirn uns auch eine Hypothese über die Zukunft verschafft, und diese Voraussage natürlich auch unseren Körper einschließt, können wir auch zukünftige Triebe und Bedürfnisse prognostizieren, und in unserem Tun berücksichtigen. Wir sind somit keine reinen Reiz-Reaktionsmaschinen, denn wir sind nicht nur von der äußeren Welt gelenkt, sondern auch durch unsere innere, die auch falsch sein kann. Insofern ist unser W ille frei von der realen Welt. 216 Schoppenhauer sagt: Wir können tun was wir wollen, aber nicht wollen was wir wollen. Kurz, wir suchen uns nicht unseren Willen aus, sondern nur unser Tun. Der Wille hat Ursachen, die nicht frei sind. Wären sie frei, wären es ja keine Ursachen, sondern es wäre Zufall. Und einen zufälligen Willen können wir ja auch nicht brauchen. Aufmerksamkeit ist die einfachste Willenshandlung. Es handelt sich dabei bereits um eine Top-Down Aktivität und sie ist, zumindest beim Menschen, von Bewusstsein begleitet. Die aus meiner Sicht interessanteste Handlung, die ein Mensch setzen kann, bezieht sich auf das kognitive System selbst. Ein Mensch kann prognostizieren, dass es gut wäre, über eine Information (wie z. B. den Namen eines Menschen) in Zukunft noch zu verfügen, und er kann dann bewusst einen Lernprozess in Gang setzen. Ohne dieses bewusste Einschalten des Gehirns würde er sich den Namen vielleicht erst nach der zehnten Begegnung merken, denn Lernen basiert ja auf Wiederholung. Der Auslöser dieses bewussten Lernens ist klar. Er liegt in der Erkenntnis, dass man dieses Wissen in der Zukunft brauchen wird. Der Einfluss, den diese Erkenntnis auf das Lernsystem hat, entspricht circa dem einer starken Emotion. Diese führt ja auch zu gesteigertem Merkvermögen und dauerhafterer Speicherung. Es muss also einen Einfluss vom Limbischen System, über das die Triebe, Bedürfnisse und Emotionen an das Gehirn vermittelt werden, auf das Lernvermögen geben. Der dazu in Frage kommende Teil des Limbischen Systems ist der Hippocampus. Er ist nachweislich für das bewusste Lernvermögen verantwortlich (Karl C. Mayer 2002). Die Fähigkeit unser Merkvermögen bewusst zu kontrollieren, dürfte erst mit der Ausreifung des Hippocampus im dritten Lebensjahr möglich sein Von diesem Zeitpunkt an können wir auch willentlich Erinnerungen wachrufen. Von der Zeit davor wissen die meisten Menschen nur aus Erzählungen (Gruber, Werner 2000). Erst dann können Kinder ihre Konzentration kontrolliert auf eine Sache lenken. Drei Jahre später können sie das dann gut genug, um als schulreif zu gelten. Natürlich könnten wir unserem Kunsthirn auch die Möglichkeit geben, sein Merkvermögen zielgerichtet zu kontrollieren. Das hat aber erst Sinn, wenn das Kunsthirn so viel Voraussicht hat, dass es weiß wozu es sich etwas merken will. Die Repräsentation der Welt, und der Blick in die Zukunft, müssen dazu schon weit entwickelt sein. Vielleicht muss es auch erst einmal vier Jahre die Welt kennenlernen, bevor eine solche Funktion Sinn macht. Wir können dem künstlichen Wesen ab dieser Reife einen Schalter zur Steigerung seines Merkvermögens in die Hand geben, und wenn er mit Energieverlust kombiniert ist, dann wird das System ihn nur dann nü tzen, wenn seine Zukunftsvoraussicht ihm sagt, dass die zu merkende Information irgendwann wichtig sein wird. Kinder werden in der Schule darauf trainiert ihr Merkvermögen bewusst einzuschalten. Wer das nicht erlernt wird im Schulsystem nicht weit kommen. Das Merkvermögen darf aber nicht dauerhaft eingeschalten sein, denn das Gehirn erlernt ja deshalb alles erst nach einigen Wiederholungen, um unsinnige Zusammenhänge, die sich nicht wiederholen lassen, auszusortieren. Trotzdem muss das Gehirn die Fähigkeit besitzen die Merkfähigkeit zu variieren. Das Kind 217 wird nun manchmal für seine Merkfähigkeit belohnt, z.B. durch Anerkennung durch den Lehrer, manchmal bestraft, z.B. indem sich erlernte Zusammenhänge als falsch erweisen. So kann es lernen Merkfähigkeit gezielt dann einzusetzen, wenn es mit verlässlichen Quellen konfrontiert ist, oder mit Informationen, von denen es glaubt sie noch zu brauchen. Ich denke Bewusstsein ist ganz stark mit der Fähigkeit verbunden, Informationen auf deren Wert für die Zukunft zu überprüfen. Die Meta-Funktion, seine Merkfähigkeit einigermaßen zu kontrollieren, könnte den Menschen über die Tiere stellen, und seinen Siegeszug ausgelöst haben. Einem künstlich intelligenten Wesen würde ich diesen Schalter, der das Merkvermögen erhöht, außen montieren, so dass ich, als sein Erzieher, ihn bei bedarf auch selbst drücken kann. Es scheint als würden die Signale im Hippocampus in Form einer Langzeitpotenzierung aufrecht erhalten, bis in der Großhirnrinde die nötigen Verbindungen verschalten sind (Spitzer S.220). Es ist vorstellbar, dass diese Langzeitpotenzierung dazu dient Signalimpulse zu wiederholen, bis die Verbindungen entstehen, wenngleich es auch Studien gibt, wonach Lernen nicht mit den gemessenen Langzeitpotenzierungen zusammenhängt. (Spektrum-Ticker 1997.10.27, Spektrum-Ticker 1999.03.26, Spektrum-Ticker 1999.06.16). Die Ungereimtheiten in den Untersuchungen dürften darauf beruhen, dass der Hippocampus für das Erlernen von Fähigkeiten nicht notwendig ist. So konnte der bekannte Patient H.M. durchaus noch das Schreiben in Spiegelschrift erler nen. Es handelt sich dabei ja auch nicht um einen einmaligen bewusst gesetzten Merkprozess, sondern um ein Einüben (Spitzer S.216). Aber damit der Hippocampus Verbindungen in der Großhirnrinde trainieren kan n, müssten die Signale ja irgendwie genau zu diesen Zellen finden, oder durch einen bestimmten zeitlichen Code genau diese Zellen anregen. Da nicht bekannt ist, dass jede Zelle eine eigene Verbindung zum Hippocampus hat, müssten die notwendigen Signale über andere Zellen hinweg zu ihrem Zielort gelangen. Diese gesamte Bahn müsste über Langzeitpotenzierung aufrechterhalten werden. Vorstellbar ist das durchaus. Mein Modell der Aufmerksamkeit arbeitet ja ähnlich. Der aufrechterhaltene Signalweg braucht ja nicht der aller stärkste sein. Er darf ruhig aus der bewussten Aufmerksamkeit verschwinden und doch wirksam bleiben. Im übrigen startet ja auch die Aufmerksamkeit oft im Lust/Unlust-Zentrum des Gehirns. Diesem Limbischen System gehört auch der Hippocampus an (Karl C. Mayer 2002). In einem künstlichen System wird man auch ein Lust-Zentrum benötigen, wo die Istwerte mit den Sollwerten verglichen werden, aber es werden wahrscheinlich keine Langzeitimpulse nötig sein, um Informationen zu fixieren. Die Verwandtschaft der bewusst gesetzten Merkvorgänge mit dem T hema Aufmerksamkeit zeigt sich auch an Messungen synchronisierter Signale beim Merkvorgang, die eine vorübergehende Verbindung zwischen Großhirnrinde und Hippocampus belegen. (Spektrum-Ticker 2001.11.09). Genau eine solche vorübergehende Verbindung von Gehirnbereichen durch Aktivierung ist uns ja auch im Modell zur Aufmerksamkeit begegnet. Synchronisierung durch Aufmerksamkeit 218 ist ebenfalls bereits am lebenden Gehirn bestätigt (Spektrum-Ticker 2001.02.26, Spektrum-Ticker 2000.03.16). Wahrscheinlich basieren bewusste Merkvorgänge auf dem selben Prozess, wie die Aufmerksamkeit. Es ist sogesehen nicht wahrscheinlich, dass im Hippocampus Information zwischengespeichert wird, wie das Frankland u. Kollegen annehmen (SpektrumTicker 2001.05.23) Ihnen widersprechen auch andere (Crost u.a. 2002). Der Hippocampus ist unserem Modell zufolge lediglich Aktivitätsgeber um eine Verbindungskette im Cortex aktiv und somit im Arbeitsgedächtnis zu halten. Sie bleibt im Idealfall aktiv bis sie langzeitgespeichert ist. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch Elger anhand neurophysiologischer Studien (Spektrum-Ticker 1999.09.07). Die Aufrechterhaltung der Aktivität bestimmter Verbindungswege verschafft dem Gehirn die Möglichkeit, auch im Schlaf noch weiterzulernen. Was am Tag nicht ins Langzeitgedächtnis wandern konnte, kann dies Nachts tun. Dazu wurden bereits sehr aussagekräftige Studien gemacht (Spektrum-Ticker 2000.07.20, Stickgold, Mathew 2002, WSA 2002.01.19, WSA 2001.07) Unser künstliches System wird allerdings keinen Schlaf brauchen. 5.3.5 Was ist Bewusstsein? Im übrigen soll hier nicht der Eindruck entstehen, alles Lernen wäre mit Bewusstsein verbunden. Wahrnehmungslernen, motorisches Lernen, und überhaupt alle Lernvorgänge, die sich durch Wiederholung einprägen, verlaufen meist völlig unbewusst (Spektrum-Ticker 2001.10.30). Schon eher mit Bewusstsein gekoppelt scheinen die top-down aktivierten Bahnen der Aufmerksamkeit und Vorstellung (Held 2002). Birbaumer zählt Denkprozesse auf, die wir nicht ohne Bewusstsein durchführen können: Schelle Lernprozesse, Urteile, Wahlentscheidungen, Pläne, die Reaktion auf Neues, Gefährliches, bei der Überwindung von Gewohnheiten (Bierbaumer 1997, S.514). All diese Dinge sind mit Aufmerksamkeit gekoppelt und spielen sich im Arbeitsgedächtnis ab, also im derzeit aktivierten Teil des „Zukunftsbaumes“. Es sind Denkprozesse, die auf Erfahrungen zurückgreifen. Sie besitzen eine gewisse „Abgenabeltheit“ von der G egenwart, denn Vorstellungen lösen in uns Handlungen aus, die aus der Gegenwärtigen Außenwelt gar nicht erklärt werden können. Wir sind sogesehen keine Reiz/ReaktionsMaschinen. Meine Vermutung ist, dass aus diesem schöpferischen Prozess, der im Gehirn stattfindet, Bewusstsein hervorgeht. Der Ursprung dieser Aktivitäten dürfte unserem Modell zufolge meist im Lust/Unlust-Zentrum liegen. Auch Thomas Metzinger betont das Körpergefühl als Quelle des Bewusstseins (Metzinger 2002). Zu nennen ist hier auch noch Gerhard Roth (2001). Er nennt in seiner Arbeit Untereinheiten des „Ich“, die ich hier gerne zitieren will: >Das „Ich“ besteht aus Untereinheiten: (1) das Körper-Ich (dies ist mein Körper), (2) das Verortungs-Ich (ich befinde mich gerade an dem und dem Ort), (3) das Ich als Zentrum individuellen Verhaltens und Erlebens (perspektivisches Ich), (4) das Ich als Subjekt perzeptiver, kognitiver und emotionaler Leistungen und Zustände ( ich habe diese 219 Wahrnehmungen, Ideen, Gefühle), (5) das Handlungs-Ich (ich tue gerade das und das), (6) das Autorschafts- bzw. Zurechnungs-Ich (ich bin Verursacher und Kontrolleur meiner Gedanken und Handlungen), (7) das autobiographische Ich (ich bin derjenige, der ich gestern/früher war), (8) das sprachliche Ich (Reden über sich selbst als überdauernde Einheit), (9) das (selbst-)reflexive Ich (Nachdenken über sich selbst), und (10) das ethische Ich bzw. das Gewissen. Man unterscheidet diese verschiedenen Ich- und Bewusstseinszustände vor allem deshalb, weil sie "dissoziieren", d. h. unabhängig voneinander beeinträchtigt sein können. Es gibt entsprechend Patienten, d ie ein normales Ich-Bewusstsein besitzen, aber nicht wissen, wer sie sind; andere wiederum behaupten, der sie umgebende Körper bzw. einzelne Körperteile gehörten nicht zu ihnen (vgl. Sacks, 1987; Lurija, 1991). Auch kann eine Leugnung der Autorschaft eigener Ideen und Handlungen auftreten, und zwar aufgrund neurologischer oder psychischer Erkrankungen ("Ich werde gedacht" usw.).< Aber ich will dieses Modell hier nicht weiter ausbauen. Meine naturwissenschaftliche Orientierung hält mich dazu an, mich auf beobachtbare oder funktionale Arg umente zu beschränken. So gesehen, kann ich über Bewusstsein nicht viel sagen, das nicht schon besser gesagt wurde. Wichtig für eine Definition dürfte es vor allem sein, die anderen Zustände zu analysieren, wie den Schlaf, die Bewusstlosigkeit, den Scheintod, Drogenzustände oder Zustände von Gehirnverletzten. Diesen Ansatz verfolgt Alfred Babene (1997). Der interessanteste Zustand ist wohl der Schlaf, weil hier sowohl Input, als auch Output des Gehirns außer Kraft gesetzt sind. Die Beobachtung des Gehirns zeigt jedoch, dass die höheren Areale der Sinnesverarbeitung und des Denkens genauso aktiv sind wie im Wachzustand. Die dabei ablaufenden Träume sind dem Träumer in diesem Moment ja auch genauso bewusst. Nur überwinden sie oft nicht den Anschluss an die Wachphase, das bedeutet, wir erinnern uns meist nicht an uns ere Träume (Crick 1997, S.277). 5.3.6 Bewusste und unbewusste Komponenten der Bewegungskontrolle Ein bewusst gesetztes Lachen, ein zu sehr bewusst kontrollierter Schwung beim Schifahren, eine bewusst kontrollierte Kontaktaufnahme mit einem Menschen... das alles wirkt immer eckig im Vergleich zu den fließenden Bewegungen, die wir zustandebringen, wenn wir nicht darüber nachdenken. Der Grund liegt darin, dass unser Bewusstsein immer nur einen Gedanken pro Zeit fassen kann, und deshalb die Bewegung aus lauter einzelnen bekannten Stücken zusammensetzen muss. Wenn ein Baby mit seinem Körper experimentiert und dabei Bewegungsabläufe einlernt, so ist daran immer der ganze Körper beteiligt. Alles ist gleichzeitig in Bewegung. Es sind fließende Bewegungen. Wiederholte Abläufe werden g emerkt. Beim bewusst kontrollierten Aneinanderfügen solcher Bewegungen, entsteht anscheinend das Problem, dass die erworbenen Versatzstücke nicht hundertprozentig aneinanderpassen. Der Körper beendet die letzte Bewegung nicht mit der exakten Ausgangsposition, die die nächste Bewegung verlangen würde. So entstehen möglicherweise die Ecken. Warum wir bewusst nur eine Bewegung 220 kontrollieren können ist klar. Es hat keinen Sinn einem Körper mehrere unterschiedliche Anweisungen zugleich zu geben. 5.3.7 Verdrängte Erlebnisse Kann es in einem künstlichen System so etwas geben, wie aus dem Bewusstsein verdrängte Erlebnisse? Nachdem wir Bewusstsein nicht klar definieren konnten, sollten wir die Frage vielleicht anders stellen: Kann es Informationen aus vergangenen Erlebnissen geben, auf die ein künstliches System keinen Zugriff mehr hat, weil sie damals nicht bewältigt werden konnten? Ich denke, dass auch ein künstliches Gehirn in Situationen kommen kann, die einerseits starke Aktivität auslösen, weil sie trieblich äußerst relevant sind, und andererseits keine Lösung zulassen. Auch ein künstliches Wesen könnte gegen seinen Willen behandelt und beherrscht werden, ohne einen Ausweg aus dieser Situation zu finden. Seine unerfüllten Bedürfnisse werden zu einer Aktivität in seinem Gehirn führen, die sich dann immer wieder in die gleichen Bahnen ergießt. Es wird immer wieder die selben Vorstellungen durchleben, aber zu keiner Lösung finden, genau wie der Mensch in solchen Situationen. Wenn es stimmen sollte, dass die stärksten Signale im Gehirn die anderen überrennen, also immer nur der stärkste Gedanke siegt, und im Bewusstsein somit immer nur ein Gedanke pro Zeitpunkt vorliegen kann, dann blockiert eine Situat ion, die gedanklich nicht gelöst werden kann, dauerhaft unser Denkvermögen. Deshalb muss das System durch den Adaptionsmechanismus fähig sein, oft Aktiviertes zu hemmen. Damit wird die unlösbare Situation gedanklich verdrängt. Natürlich ist damit auch ein Teil der persönlichen Erfahrungen verdrängt worden, was in ähnlichen Lebenssituationen von Nachteil sein kann, und immer wieder zum Scheitern führen muss. Ein Beispiel wären Probleme von einst sexuell misshandelten Kindern in späteren Partnerschaften. Die Idee von Sigmund Freud, die als Kind unbewältigbaren Probleme durch Psychoanalyse dem Erwachsenen wieder bewusst zu machen, hat durchaus Sinn, denn dieser ist nun in einer anderen Lebenssituation, in der er ein solches Pro blem durchaus bewältigen kann. Es wäre doch amüsant, wenn die künstlichen Syst eme der Zukunft auch der Psychoanalyse bedürften, um Lebensprobleme zu bewältigen. Da die meisten Verdrängungsvorgänge nicht sonderlich bewusst ablaufen, wird oft behauptet, unser Gehirn verdränge überhaupt nichts, sondern vergesse es. Dem widerspricht die Erfahrung, dass man etwas wissen kann, aber in der Situation, wo er das Wissen bräuchte, es nicht aufzurufen vermag. Dieser Zustand ist dem verdrängten Wissen sehr ähnlich. Auch gibt es bereits Studien, die zeigen, dass bewusstes Vergessen möglich ist (Spektrum-Ticker 2001.03.19). 221 5.3.8 Stress und Depression Neben Verdrängungen und den damit einhergehenden blockierten Bewältigungsmöglichkeiten von Alltagssituationen dürfte wohl Stress zu den psychischen Hauptleiden des „normalen“ Menschen gehören. Die Frage ist: Erklärt das hier beschriebene Modell auch dieses Phänomen? Es gibt Studien, die zeigen, dass Stress nur dann in Depression übergeht, wenn die stressenden belastenden Erlebnisse als unkontrollierbar empfunden werden. So sollten in einem Experiment Versuchspersonen schwierige Aufgaben vor lautem Hintergrundlärm lösen. In einer Versuchsgruppe wurde den Vp. ein Schalter gegeben, mit dem sie den Lärm abstellen konnten. Eigenartigerweise benützte diesen niemand. Aber diese Gruppe löste fünfmal so viele Rätsel und fühlte sich kaum gestresst (Holler 1996, S.103). Das Wissen um die Kontrollmöglichkeit genügt. Das heißt: Solange ein Verhalten bekannt ist, das von den Unlust-Erlebnissen wieder zurück ins Gleichgewicht führt, können diese sinnvoll verarbeitet werden, und schaden nicht. Selbst die exakte Voraussage stressender Erlebnisse hilft, denn das Gehirn hat damit seine Arbeit getan, und braucht sich nicht mehr weiter mit dem Stimulus zu beschäftigen. So weisen Ratten denen Elektroshocks in zufälliger Anordnung gegeben werden, viel mehr Stresssymtome auf, als Ratten, denen die gleiche Anzahl in voraussagbarer Regelmäßigkeit verabreicht wird. Hilflosigkeit kann auch erlernt werden, wobei das Wesen es dann generell aufgibt, nach einer Bewältigung der Lebensprobleme zu suchen. Die erlernte Hilflosigkeit dient als Tiermodell für depressive Erkrankungen (Hüther 2001). Wenn Stress und Depression aus Lernvorgängen zu erklären sind, können sie möglicherweise auch einmal in künstlichen Gehirnen auftreten. Dass die Reizüberflutung der heutigen Medienkultur unser Gehirn stresst, kann an Studien zur Veränderung der sinnlichen Wahrnehmung erschlossen werden. In Deutschland werden im Abstand von 5 Jahren jeweils 4000 Probanten auf deren Sinnesleistungen untersucht. Dabei ist eine ständige Desensibilisierung zu beobachten. Vor 15 Jahren konnte der Durchschnittsdeutsche z.B. noch 300 000 Klänge unterscheiden. Heute nurmehr 180 000. Ähnliches ist bei anderen Sinnen zu verzeichnen (Holler 1996, S.279). 222 6 SCHLUSS 6.1.1 Warum es letztendlich ein philosophisches Werk ist Kant betitelt das dritte Kapitel seiner Einleitung zur „Kritik der reinen Vernunft“ folgendermaßen (Kant, S.48): „Die Philosophie bedarf einer Wissenschaft, welche die Möglichkeit, die Prinzipien und den Umfang aller Erkenntnisse A Priori bestimme.“ Ziel seines Werkes ist es also, zu zeigen, was vorausgesetzt werden muss, damit Erkenntnisgewinn möglich ist. Genau das ist auch mein Ziel. Die Philosophie arbeitet in der Sprache. Sie definiert Begriffe. Die ideale Definit ion eines Gegenstandes besteht darin, einen Überbegriff zu nennen, und eine Eigenschaft beizufügen, die es ermöglicht ihn von den anderen Gegenständen, die auch dem Überbegriff untergeordnet sind, zu unterscheiden. Zum Beispiel: „Ein Lipizzaner ist ein weißes Pferd mit kurzen Haaren.“ Da jede Definition ihre rseits Begriffe verlangt, müsste man nun definieren was der Überbegriff Pferd ist, und was die Eigenschaften „weiß“ und „kurz“ sind. „Ein Pferd ist ein Tier mit langen Beinen, das Gras frisst.“ Aber wie definiert man Eigenschaften wie „weiß“ oder „kurz“? Außerdem ergibt sich die Frage, woher der Mensch den Begriff „Tier“ hat, wenn man doch immer nur ein bestimmtes Tier wahrnehmen kann, nie jedoch den Überbegriff an sich. Sowohl Eigenschaften als auch Überbegriffe kann man als Ideen bezeichnen, weil sie vielen Dingen zukommen. Die Frage ist, wo kommen sie her? Schon Platon ist über die Frage gestolpert, und meinte, dass wir die Ideen in einem vorherigen Leben schon geschaut haben müssen, dass sie uns also mitg egeben sind. Er erläutert dies am Beispiel der Idee des „Schönen“ (Platon 1994, S.135, S.162). Nach der Antike hat das Christentum eine Weiterentwicklung der Erkenntnisthe orie gebremst, da man in Gott die Erklärung für Alles sah, und nicht weiter hinterfragt e. Mit dem Aufkommen der Naturwissenschaft und Technik, entsteht am Beginn der Neuzeit der englische Empirismus, als dessen konsequentesten Vertreter ich David Hume nennen will. Ihm zufolge entsteht Erkenntnis durch Verbindungen, die wir nach drei Grundprinzipen treffen, nach dem Gesetz der Ähnlichkeit, dem der räumlichen und zeitlichen Nachbarschaft und dem Gesetz der kausalen Verbindung, das er schließlich zu einem Gesetz der Wiederholung umformt. Denn Hume erkennt etwa um 1740 folgendes: „Wenn ich mich streng darauf beschränke, was ich wahrnehme, so sehe ich nicht mehr, als dass auf den Vorgang A der Vorgang B folgt. Die Wahrnehmung zeigt mir stets nur ein Nacheinander, nie ein Wegeneinander.“ So ist alle Erkenntnis für Hume bloße Gewöhnung (Störig 1990, S.359). Damit nimmt er das Konditionierungsprinzip vorweg. 223 Genau der Glaube an das „Wegeneinander“ ist es, was Kant bewog 1781 ein Gegenkonzept zu entwerfen (Kant 1992, S.133). Deshalb beginnt er auch seine Einleitung zur „Kritik d.r. Vernunft“ mit dem Titel „Von dem Unterschiede der reinen und empirischen Erkenntnis.“ Er schreibt „Wenngleich alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfängt, so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung.“ Kant hat erkannt, dass ein System „dahinter“ liegen muss, das Erfahrung ermöglicht. Wir würden heute sagen, das System dahinter ist das Gehirn, und dieses ist aus der phylogenetischen Erfahrung entsprungen, also aus der Evolution. Es muss aber nach Kant noch fast ein Jahrhundert vergehen, bis dies denkbar wird, denn erst 1874 veröffentlicht Darwin „Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl“ (Störig 1990, S.483). Kant vermutet also etwas anderes „hinter“ dem System der Erfahrung. Er sieht dort ein „reines“ System der Vernunft, das nicht bloß statistischer Natur ist, so ndern durch Logik echte, wahre und nicht bloß wahrscheinliche Erkenntnisse ermöglicht. Meiner persönlichen Ansicht nach ist dieses Projekt gescheitert. Logik scheint nur der Wissensübertragung zu dienen, nicht jedoch dazu neues Wissen zu erzeugen. Wenn nur Männer Bärte haben, und Lilli hat einen Bart, dann geht logisch hervor: Lilli ist ein Mann. Wenn aber die empirische Erkenntnis, dass nur Männer Bärte haben falsch ist, dann haben wir den Fehler mittles der Logik auch auf Lilli übertragen. Logik schützt also auch nicht vor Fehlurteilen. Mathematik ist ein Abkömmling der Logik, und dient daher ebenfalls auch nur der Wissensübertragung. Vor und hinter dem Istgleichzeichen steht also immer dasselbe. Wenngleich es eine bittere Erkenntnis sein mag, dass es nichts gibt, worüber wir absolute Gewissheit haben könnten, so zeigt die Wahrscheinlichkeitsrechnung doch, dass die Naturwissenschaft Erkenntnisse hervorbringen kann, die nicht anzuzweifeln sind. Rupert Riedl schreibt zur Wahrscheinlichkeit in biologischen Untersuchungen: „Die Zufallswahrscheinlichkeit, dass zehn Münzen auch bei zehn Würfen den Adler zeigten, wäre (1/2) hoch 100, also eine Zahl hinter 31 Nullen; eine Unmöglichkeit für den Zufall. Genauso operiert das Empfinden des Morphologen. Als Simultan -Ereignisse gelten ihm die vergleichbaren Lage- und Strukturmerkmale eines Homologons (z.B.ein Skelett)… …Als Sukzedan-Ereignisse gilt ihm die Anzahl der darin repräsentativ vergleichbaren Arten. Räumt man jedem Homologon auch nur eine einzige Altern ative ein, dann betrüge die Zufallswahrscheinlichkeit eines Organs, das wie der zweite Halswirbel auch nur in zehn Homologa auch nur in zehn Arten untersucht wäre nur mehr ein Quintillionstel, in dreißig Arten erhalten wir eine Zahl hinter mehr als 100 Nullen. Dererlei auch nur einmal durch den Zufall zu erwürfeln verlangt mehr Experimente als Quanten in diesem Kosmos existieren.“ (Riedl 1989, S.182). Deshalb ist anzunehmen, dass die Arten voneinander abstammen. Kant war kein Naturwissenschafter wie Riedl. Sein Mittel der Analyse war nicht die Beobachtung sondern die Sprache. Er untersuchte den Erkenntniserwerb durch logisches Argumentieren. Heute erwarten wir uns auf die Frage nach dem Erkenntniserwerb eine funktional-technische Beschreibung des Gehirns, so wie es 224 diese Arbeit ist. Funktionelle Dinge entspringen nicht dem sprachlichen, sondern dem visuellen Verstand. Wenn ich über ein erkenntnistheoretisches Problem nachdenke, stelle ich mir ein Modell vor in dem Signale fließen, aufeinanderstoßen und miteinander reagieren. Auch der visuelle Verstand hat eine Logik . So kann ich zum Beispiel argumentieren, dass Neuronen, die immer synchron zu schwingen beginnen, einer Verbindung bedürfen, da sonst keine Informationsübertragung vorstellbar ist, die sie synchronisiert. So gesehen ist mein Werk zwar vis uell erdacht, aber doch ein analytisches, und deshalb finde ich, es ist Philosophie! Ich würde meine Methode als „analytische Visualisierung“ bezeichnen. Mir ist natürlich klar, dass Philosophie sprachlastig ist. Wittgenstein sagt „Der Gedanke ist der sinnvolle Satz.“ Das heißt, die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen des Denkens. Leonardo da Vinci wäre sogesehen kein Denker. Wittgenstein hat aber in seinem Spätwerk diesen Ansatz kritisiert (Störig 1992, S.656). Die Methode der analytischen Visualisierung stellt eine Alternative zum Sprachdenken dar. Die Kategorien, von denen Kant annimmt, dass sie A prioi vorhanden sein müssen, damit Erkenntnis möglich ist, sind: Quantität, Qualität, Relation und Modal ität, wobei er dem letzten Begriff folgende Untereinheiten gibt: möglich/unmöglich, da/nicht, und notwendig/zufällig (Kant S. 119). Außerdem nennt er Raum und Zeit als notwendig existent. Das System, das ich hier entwickle, kann funktionieren, ohne auf all dies näher einzugehen, denn die Existenz all dieser Kategorien ist einfach in der Materie, bzw. in den Bausteinen des Systems erhalten. Lichtrezeptoren liefern die Qualität „Helligkeit“. Ich muss mir keine Gedanken darüber m achen, warum es Qualitäten geben kann. Das ist Aufgabe der Grundlagenphysik. So g esehen sind Kants Kategorien eigentlich Bedingungen des Seienden, nicht bloß der Erkenntnis. Das ist nicht verwunderlich, denn bei Kant verschwimmen diese beiden Begriffe ineinander. Er argumentiert, dass alles was wir als „Seiend“ erleben, identisch ist mit allem was wir Erkennen. Zur Entwicklung eines künstlichen erkennenden Systems muss ich, anders als Kant, diese Begriffe auseinanderhalten. Es gibt das Seiende, und den Teil des Seienden, den das System aufnimmt. Ich werde zeigen, wie ein solches System zu konzipieren ist. Meiner Ansicht nach, wird die bloß sprachanalytische Form der Erkenntnistheorie in dem Moment der Philosophiegeschichte angehören, wo ein künstliches Wesen erschaffen ist, das die Welt in sich aufzunehmen vermag. Dann ist der alte Traum der Philosophie, den Erkenntniserwerb zu verstehen, Wirklichkeit geworden. Dieses Werk ist der erste Schritt dazu. Ich bin überzeugt, in 20 Jahren bewundern wir bereits die Intelligenz der Kunst-Wesen. Die wichtigsten Teilbereiche der Philosophie sind neben Erkenntnistheorie (zu der ich auch die Logik zähle) noch die Ästhetik und die Ethik. Es geht immer um Werte. Logik unterscheidet Wahr von Falsch, Ästhetik unterscheidet Schön und Hässlich oder Langweilig und Ethik unterscheidet Gut von Böse. 225 Das hier dargestellte Hirnmodell fußt auf einer Theorie der Ästhetik, denn es benötigt eine gerichtete Aufmerksamkeit um zu lernen. Und es führt zu einer Theorie des Willens, die Grundlage der Ethik ist. Oft wird behauptet, ohne freien Willen erübrige sich die Frage nach Gut und Böse. Ich behaupte hingegen, dass gerade erst durch die Beeinflussbarkeit unseres Willens Erziehung und die Diskussion um das Sollen einen Sinn hat. 6.1.2 Warum gab es ein solches Modell noch nicht? Die Arbeit gibt eine Vorstellung davon, was ein neuronales Netzwerk, wie es das Gehirn ist, leisten muss. Diese stark vereinfachte Vorstellung lässt bereits erkennen, dass kein Mensch jemals in der Lage sein kann, ein fertiges Gehirn zu programmieren. Das bedeutet aber nicht, dass ein künstliches Gehirn ein Ding der Unmöglichkeit darstellt! Auch die Natur schafft es nicht uns ein fertig programmiertes Gehirn einzubauen. Vielmehr kommen wir mit einem Volumen auf die Welt, das überwiegend erst durch die Natur programmiert wird. Es sind also auf lange Sicht nur selbstlernende Modelle von Wert, wie eben das hier beschriebene. Warum gab es ein solches Modell noch nicht? Ganz einfach deshalb, weil die Psychologie, und Neurophysiologie als empirische Wissenschaften einen solch theoretischen Zugang ablehnen und nicht fördern. Umgekehrt lehnt die Philosophie es ab, als Diener der Naturwissenschaften deren Unordnung einen Sinn zu verleihen. Auch mit der Technik will sich die Erkenntnisphilosophie ungern verbinden, denn man glaubt nicht, dass eine theoretische Lösung von Datenverarbeitungsproblemen uns etwas darüber sagen kann, wie wir Erkenntnisse gewinnen und wie die Welt in unseren Kopf kommt. Viel eher glaubt man, dass eine Erforschung des Gehirns Ideen für die Informatik bringt als umgekehrt. Ich hingegen denke, dass es nur einen idealen Weg gibt, um ein System mit einer künstlichen inneren Repräsentation der Welt zu entwickeln, und wenn wir diesen kennen, werden wir entdecken, dass das Gehirn einen ganz ähnlichen Weg gegangen ist. Vielleicht gibt mir die zukünftige Gehirnforschung ja Recht, und man entdeckt im Gehirn jene Prozesse, die hier noch Hypothesen sind. Vieles ist ja schon entdeckt. Obwohl viele Forscher nach Lösungen für Probleme suchen, die hier gelöst wurden, rechne ich damit, dass die Arbeit schwer Leser findet. Die meisten Forscher glauben nicht an eine allgemeine Lösung des Erkenntnisproblems, und ignorieren Arbeiten wie diese, um sich weiter in ihre Detailprobleme zu verstricken. Auch fehlt vielerorts der Glaube an die Machbarkeit eines menschenähnlichen Kunsthirns. Dazu kann ich nur sagen: „Ohne den dementsprechenden Glauben, die Willenskraft und die finanziellen Mittel, wäre auch der Mondflug nicht möglich gewesen.“ Das einzige, das wir in Europa von den Amerikanern lernen sollten, ist der Glaube an das eigene Vermögen. Über dem Teich ist man schon dabei, elektronische Hardware zu entwickeln, die so arbeiten soll wie die Sehrinde (Hawkins u.a. 2001) und nach meiner Einschätzung ist es dann nur noch ein kleiner Schritt zu einer 226 Hardware des gesamten Gehirns. Die Japaner haben das verstanden. Dort werden zehn Milliarden US-Dollar in die Neuroforschung investiert (http://www.heise.de/ kiosk/archiv/ct/97/04/132/). Warum? Natürlich weil hier der Markt der Zukunft liegt. Und Europa? Europa glaubt, hier sei nichts zu holen, weil das Gehirn sowieso nie als Ganzes verstanden werden kann. Als ich die groben Grundzüge meiner Arbeit vor zwei Jahren einigen deutschen Professoren vorstellte, um jemanden für die Doktoratsbetreuung zu finden, sagte man mir, meine Ziele seien schlichtweg unerreichbar. Sie waren nicht einmal interessiert das bereits vorhandene Schriftstück zu lesen. Ich hätte diese Arbeit gar nicht begonnen, wenn ich diesen Glauben teilte. Wer hätte zum Beispiel vor zwei Jahren gedacht, dass Computer-Spracherkennung einmal mit dem Menschen mithalten wird, und heute ist es schon soweit (Berger 2002). Und wie ist es dazu gekommen? Ganz einfach durch eine theoretische Abstraktion der Vorgänge im Gehirn. Und genau etwas derartiges habe ich mit meiner Arbeit geleistet. Was den heutigen Stand der Künstlichen-Intelligenz-Forschung betrifft, so arbeitet sie aus meiner Sicht, zumindest in Europa, an einer Gesamtlösung vorbei, weil immer davon ausgegangen wird, eine bestimmte abgrenzbare Aufgabe zu bewerkstelligen. Das hier dargestellte Modell funktioniert demgegenüber gerade deshalb, weil es keine Aufgabengrenzen kennt. So kann es alle Bausteine für alle Zwecke verwenden, und aus allen Situationen etwas lernen. Gerade das macht die Effizienz aus. Besonders problematisch finde ich es, Übersetzungsprogramme für Computer zu entwickeln, ohne auf eine Repräsentation der Welt zurückgreifen zu können. Das System, das ich konzipiert habe, kann zu Spracherwerb fähig sein, vorausgesetzt die Kapazität reicht aus. Es braucht ja nur noch Laute an die vorhandenen Gestaltbegriffe binden, und lernen diese Laute auch situationsgerecht zu produzieren. Mag sein, dass zur Umsetzung dieses Modells eine eigene Hardware notwendig ist, oder das mobile Wesen mit einem Großrechner verbunden sein müsste. Verfügen wir aber einmal über eine selbsterlernte Verschaltung, so kann diese ja kopiert werden. Neues dazuzulernen ist für ein „kopiertes Wesen“ dann nicht mehr in großem Ausmaß notwendig. Es kann den Großteil seines kopierten Wissens in einer starren Verschaltung gespeichert haben, deren Produktion ungleich weniger aufwendig ist. Wenn die kopierten Wesen nur über einen kleinen Teil an selbstlernender Struktur verfügen müssen, dann sind sie vielleicht schon bald günstig herzustellen und bevölkern in 20 Jahren unsere Haushalte, als Spielgefährten und Haushaltshilfen. Meine Vorstellung ist ein leises Wesen, das mit Hydraulik funktioniert, wobei durch Schaumstoff auch das Zischen der Luft gedämpft werden sollte. Ich stelle mir vor es arbeitet mit Luftdruckflaschen. Es wäre kein Problem, wenn diese bei starker Aktivität alle 10 Minuten leer sind, denn es könnte sie selbstständig wec hseln, und die Flaschen ließen sich über einen hauseigenen Druckluftschlauch ohne 227 Lärmbelästigung nachfüllen. Ich stelle mir weiche, kuschelige Wesen vor, die ungeschickt wie Kleinkinder die Welt erforschen. Mit den Robottern aus ScienceFiction hat meine Vorstellung wenig gemein. Unsere westliche Kultur lebt vom Wandel. Aber die Entwicklung gerät derzeit ins Stocken. Die Informationsflut führt dazu, dass die Menschen keine Information mehr wollen. Unser Gehirn ist überfordert und kann in der Summe von Informationen das Wertvolle nicht mehr herausfiltern. Wir brauchen eine Technologie, die uns entlastet, und nicht immer weitere Belastungen bringt. Künstliche Gehirne bieten also einen Schritt in die richtige Richtung. 6.1.3 Künstliche Wesen, Horrorvorstellung oder Bereicherung? Wenn ich Menschen von meiner Vision künstlicher Wesen erzähle, so denken die Meisten sofort an die Kampfmaschinen aus den Science-Fiction-Filmen oder an ihren persönlichen alltäglichen Kampf mit dem Computer. Ich glaube nicht, dass aus dem hier dargestellten Modell jemals eine Kampfmaschine hervorgehen könnte. Die motorischen Fähigkeiten, die die Natur über Millionen von Jahren in uns verankert hat, kann ein solches „Kunstwesen“ wohl nie erreichen. Ich halte es eher für möglich, dass es in den kognitiven Fähigkeiten einmal dem Menschen gleicht, als dass es dessen Geschicklichkeit erwirbt. Wenn es ungeschickt wie ein Klei nkind bleibt, ist es als Kampfmaschine nicht brauchbar. Was ich eher für möglich halte, ist, dass künstliche Gefährten in etwa 30 Jahren Behinderten wieder zu Selbstständigkeit verhelfen werden, ein Bereich, in dem die Gehirnforschung schon heute ihre größten Erfolge feiert. So ist es zum Be ispiel inzwischen möglich durch Einpflanzung von Elektroden im Gehirn, einem gänzlich gelähmten Menschen die Kontrolle über eine Computermaus zu geben (WSA 2002.03.18). Künstliche Wesen könnten uns gesundheitsschädliche Aufg aben abnehmen. Sie werden aus unserer Welt genauso wenig wegzudenken sein wie heute der PC. Sie werden Sprache verstehen und als erziehbare Wesen für jedermann bedienbar sein, sogar von Menschen, die weder lesen noch schreiben können. Sie werden manch einsamem alten Menschen wichtiger sein als sein Fernseher. Aber viel wesentlicher ist: Künstliche Wesen werden das Bild grundlegend verändern, das der Mensch von sich selbst hat, denn wir werden sie in vielen Dingen als uns ähnlich erleben. Sie werden uns einen Schritt näher bringen, zu begreifen was wir sind, bzw. nicht sind. Tatsächlich hat der Mensch eine Eigenschaft, deren Zweck ich bis heute nicht verstehe, und die künstliche Wesen wohl nicht haben werden. Er sucht in seinem Leben nach einem Sinn. Ich beobachte, dass Menschen in der Mitte ihres L ebens in eine Depression verfallen, wenn sie sich als Individuum nicht irgendwo unersetzbar fühlen können. Individuell unersetzbar kann man für seinen Partner sein, oder für seine Kinder, aber man kann auch eine Arbeit verfolgen, von der man glaubt, dass sie sonst niemand in der Qualität machen könnte oder machen wol lte. 228 Auch künstliche Wesen werden individuell verschiedene Eigenheiten entwickeln, wenn sie selbstlernend sind. Aber werden sie in dieser Individualität auch eine Qualität sehen? Für uns Menschen wird darin jedenfalls eine Qualität liegen. Man könnte ihre Individualität unterstreichen, indem man ihr Äußeres von Künstlern gestalten lässt. Es ist schön etwas zu besitzen, das es auf der Welt nur einmal gibt. Ich glaube man wird sie lieben können, wenn sie durch ihre Individualität etwas Lebendiges ausstrahlen. Außerdem werden sie unsere Erziehungsmaßst äbe übernehmen, und so auch etwas von unseren Eigenheiten in sich tragen. Stichwort „Lebendiges“. Die Definition von Leben beruht auf dem Begriff der „Selbstreproduktion“. Werden künstliche Wesen einmal intelligent genug, um die Menschen im Produktionsprozess ersetzen zu können, dann können sie sich theoretisch selbst reproduzieren, und sind damit Lebewesen. Ihre Art des Lebens kennt dann aber nicht die Begrenztheiten des unseren. Sie könnten jeden Abend ihre tagsüber erworbenen Kenntnisse in einem Computer sichern. Werden sie z. B. überfahren, so schickt die Lebensversicherung einen neuen Körper und spielt das Wissen wieder in ihn hinein. Der Körper könnte nach dem neuesten Stand der Technik, zusätzliches Gehirnvolumen beinhalten, so dass eine Weiterentwicklung möglich ist. Die Wesen wären also unsterblich. Bei der Entwicklung neuer Wesen, wären völlig neue Konstruktionen möglich. Wenn für einen Beruf noch ein zusätzlicher Arm von Vorteil ist, dann kommt er dran. Die Wesen bräuchten sich auch nicht vor all den biologischen Krankheiten zu fürchten. Sie würden mit dem Menschen nicht um Ressourcen streiten, weil sie andere Bedürfnisse hätten, und in der Wüste oder im Weltraum genug Energie und Platz vorfänden um zu leben. Genaugenommen hätten sie ohne Fortpflanzungstrieb nicht einmal einen Bedarf nach immer mehr Lebensraum. Deshalb würden sie aus meiner Sicht das tun, was andere Systeme in der Natur auch tun, wenn sie sich nicht um Ressourcen streiten. Sie würden eine Symbiose mit dem Menschen bilden. Sie könnten eingesetzt werden, um in unwirtlichen Gebieten Arbeiten zu verrichten, die notwendig sind diese Gebiete wieder zu begrünen und für den Menschen vorzubereiten. Meine Vision einer Welt mit künstlichen Wesen gleicht dem Idealbild, das wir von der griechischen Antike in uns tragen. Natürlich vergessen wir bei diesem Bild gerne, dass die Freiheiten des Bürgers damals nur aufgrund der Sklaven gegeben waren, die ihm die Arbeit abnahmen. Heute ist unsere begrenzte Lebenszeit so vollgefüllt mit Arbeit, dass wir kaum mehr Zeit finden für das Miteinander, für Freunde, Familie, Hobbys und Interessensgruppen. Der Geist ist so besetzt von dem Zwang in dieser komplizierten Welt zu funktionieren, dass kaum noch Platz ist für Gedanken über das Phänomen unserer Existenz und des Bewusstseins. Kaum jemand hat die Muße von einer idealeren Welt zu träumen. Wir zwingen unsere Kinder in ein Schulsystem, das sie immer voller stopft mit Fertigkeiten, weil wir Angst haben, sie könnten ohne vollgestopftes Gehirn in dieser Welt nicht funktionieren. Die Anforderungen sind so hoch geworden, dass in ihnen keine Energie mehr bleibt, Eigeninteressen zu entwickeln. Sie wissen nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen. Das ist der Punkt an dem sie der Konsumkultur 229 verfallen, die sie über die Medien steuert, und uns suggeriert, dass wir ohne ständiges Wirtschaftswachstum nicht leben könnten. In Wahrheit können sie die erworbenen Freizeitartikel gar nicht nutzen, weil ihnen die geistige Anpassung an die engstirnige Funktionsweise von Computerprogrammen die Freizeit und den Schlaf raubt. Leben kennen sie nur aus dem Fernseher. Nach Schulabschluss vereinsamen sie und tätigen die meiste Kommunikation nurmehr über Internet. Deshalb brauchen wir künstliche Wesen, die sich geistig an uns anpassen können, die für uns selbstständig Aufgaben erledigen, die wir nicht tun wollen, und die uns unsere Lebenszeit zurückgeben für unsere Interessen, und unsere zwischenmenschlichen Kontakte. Wesen, die wir verstehen können, weil sie in ihrer Grundstruktur so einfach sind, wie sie diese Arbeit in 36 Regeln beschreibt. Wenn Menschen wieder Zeit haben, und das Vertrauen in ihnen wächst, dass das L eben eine leicht zu bewältigende Sache ist, mit dienenden Wesen an ihrer Seite, dann brauchen sie ihre Kinder auch nicht mehr in ein Massenausbildungssystem stecken, sondern können ihnen in kleinen betreuten Interessensgruppen die Welt erobern lassen. Das ist die Zeit, in der mein Beruf „Lehrer“ eine schöne Sache sein wird. Noch etwas erhoffe ich mir. Ich denke, dass das Schreiben eines Buches eine sehr unflexible Form ist, Wissen weiterzugeben. Würde ich mein Wissen einem künstlichen Wesen vermitteln können, dessen geistige Existenz vervielfältigbar und langlebig ist, wie die eines Buches, so hätte dieses Wesen als Wissensvermittler den Vorteil, dass es den Inhalt in Form von Gesprächen weitergeben kann. Der Zuhörer kann fragen und bekommt Antworten. Antworten auf Fragen, die wir gestellt haben, merken wir uns auch. Der Unterschied ist in etwa der, wie wenn ich eine Betriebsanleitung lese, oder mir jemand die Funktion meines Gerätes zeigt. Im zweiten Fall komme ich schneller zum Ziel. Außerdem kann das Wissen in dem künstlichen Wesen weiterwachsen. Bisher ist der Mensch das einzige Wesen, das seine Vorstellungen mitteilen kann. Das macht ihn einsam. Seine Antwort auf diese Einsamkeit ist aus meiner Sicht die Religion. Vielleicht wird er in ferner Zukunft in einer Symbiose mit einer Lebensform leben, die diese Einsamkeit vertreibt. Ich stelle es mir sehr spannend vor, mich mit einer derart fremden Lebensform zu unterhalten, einer Lebensform, die vielleicht die Zukunft der Evolution darstellt. Bisher konnte die Evolution immer nur an dem weiterbauen, was vorhanden war. Diese neue Lebensform hingegen wird sich selbst jederzeit umkonstruieren können, und neue Modelle herausbringen. Ich bin sicher, dass die Zeit kommen wird, wo Menschen diese Lebensform erschaffen. Eine kleine Gruppe von Vorkämpfern werkt bereits daran, während der Rest der Menschheit einen solchen Schritt nicht einmal für möglich hält. Die erfolgreichsten Konzepte werden wohl einmal in die Geschichte eingehen. 6.1.4 Wie soll es weitergehen? Inzwischen sollte klar sein, dass ich das Modell vor allem für eine praktische Umsetzung konzipiert habe. Aber wie soll es dazu kommen? Als Einzelperson kann ich eine solche Umsetzung natürlich weder finanzieren noch leisten. 230 Zunächst muss der Text von jemandem gelesen werden, der, von seiner technischen Ausbildung her, mehr vorweisen kann als ich, ein Universitätsprofessor zum Beispiel. Seine positive Kritik kann mir dazu verhelfen, dass sich weitere solche Leser finden, und weitere positive Kritiken geben, die ich mit dem Text verschicken kann. Ich könnte so die Möglichkeit erhalten, da oder dort einen Vortrag zu halten, oder Artikel zu schreiben. Vielleicht findet sich dann ein Verleger, der bereit ist das Werk in Buchform herauszubringen. Mit genügend Kontakten und positiven Kritiken kann man daran denken, eine Interessensgruppe für erste Experimente zum Modell zu finden. Die Hauptaufgabe bestünde aus meiner Sicht in der Entwicklung einer funktionstüchtigen elektronischen Umsetzung eines Neurons, das die beschriebenen Regeln befolgt. Mit einigen solcher Neuronen sollten erste Simulationen von Teilbereichen des Modells möglich sein. So ließe sich abschätzen, was es leisten kann, wenn man es in größerer Dimension umsetzt. Nun könnte man eine Kosten – und Leistungseinschätzung anstellen, die einem möglichen Investor sagt, wieviel er investieren muss, bis eine marktreife Hardware, also ein künstliches Gehirn entwickelt ist. Der Aufwand rechnet sich auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob in fünf Jahren oder in zwanzig. Aber ab dem Moment wo Firmen in diese Zukunftsvision investieren, geht alles seinen Weg. Nur wie kommt es bis dorthin? Meiner Ansicht nach kann bereits jetzt jeder Leser etwas dazu beitragen, indem er den Text an technisch talentierte Menschen weiterempfiehlt. Ein begeisterter Technik-Student, der z.B. für sein Diplom den Signalfluss simuliert, kann entscheidend sein, und plötzlich kommt die Sache ins Rollen. Gute und schlechte Zeiten einer Kultur gehen immer konform mit dem Glauben an eine gute oder schlechte Zukunft. Optimismus führt eine Kultur aus der Krise, weil er dazu führt, dass die Menschen unternehmungslustig werden. Genauso ist es mit der Umsetzung eines solchen Modells. Am Anfang muss der Glaube und das Wollen stehen. Das ist Grundbedingung, damit die Gedanken zu planen beginnen. Dann ergibt sich der Weg wie von selbst. Das gilt auch für die Finanzierung. Nur wenn der Glaube da ist, wird jemand Geld in ein solches Projekt stecken. Überwiegt Zukunftsangst, so ist jeder Weg blockiert. Kein erfolgreicher Mensch hat je aus Zukunftsangst irgendetwas vollbracht! Impft euren Kindern also nie Zukunftsangst ein! Für mich ist die künstliche Intelligenz ein Weg, um das Gehirn und auch den menschlichen Geist auf eine neue Weise verstehen zu lernen. Ich habe nicht die Sorge, dass der Mensch dadurch „entweiht“ würde, denn umso tiefer man in dieses Wissen vordringt, umso mehr Rätsel tauchen auf. Mag sein, dass sich zum Beispiel die Frage nach dem menschlichen Bewusstsein in Zukunft aus einer neuen Perspektive stellt, aber das Wunder wird dadurch doch nur noch gr ößer werden. 231 7 LITERATURLISTE Adamatzky (1998)2 „Computation with graphs“ S.122 http://bookmarkphysics.iop.org/fullbooks/075030751x/adamatzkych03.pdf Anderson, John R. (1996): Kognitive Psychologie. 2. Auflage. Heidelberg: Spek trum Verlag. Anderson S.311 – 339 Menschen liegen in ihrer Einschätzung von zu Erwartendem weitgehend konform mit der Bayesianischen Statistik. Anderson: http://www.informatik.unifreiburg.de/~noelle/studium/_Anderson.html Aniruddha Das & C.D. Gilbert “Topography of contextual modulations mediated by short range interactions in primary visual cortex http://phy.ucsf.edu/~idl/pdf_articles/Nature1999_Das_Gilbert.pdf Aplysia (2002) “Learning in the Nervous System” http://www.cs.stir.ac.uk/courses/31YF/Notes/Notes_PL.html 6.6: Neurons in the Brain of the marine snail Aplysia where stimulated by electrodes. Results: Long-Term-Potentiation (learning) is an associative phenomenon requiring pre and post-synaptic activity.. ..weak stimulus with postsynaptic depolarizing current via an intracellular elec trode will produce LTP. Arnheim, Rudolf (1978): Kunst und Sehen. Leibach: de Gruyter. Atwood, Harold L., and J. Martin Wojtowic (1999) “Silent Synapses in Neural Plasticity: Current Evidence” Vol. 6, No. 6, pp. 542-571, November/December 1999 Aus Gazzaniga, M.S,, R.B. Ivry and G.R. Mangun (1998) „Cognitive Neuroscience – the biology of the mind”, W.W. Norton & Company, New York. Bahill, A. Tercy und Lawrence STARK (1987): Sakkadische Augenbewegungen. In Wahrnehmung und visuelles System. Spektrum der Wissenschaft: Verständliche Forsch ung. Heidelberg. Bahill, Terry und Lawrence Stark (1987) „Sakkadische Augenbewegungen“, Artikel aus „Wahrnehmung und visuelles System“, ISBN 3-922508-36-7, SpektrumVerlag – Heidelberg. Balkenius, Christian (2000) Attention, Habituation and Conditioning: Toward a Computational Model http://cognition.iig.uni-freiburg.de/csq/CSQvol1.html (Lund University, Sweden) pp. 171-204 Is attention a purely perceptual process or is it in any way related to motor control? The aim of this article is to show that attention puts sim ilar demands on a cognitive system as motor control and present evidence supporting the view that similar mechanisms operate in the two processes. A computational model of attention is presented that uses habituation as well as classical and instrumental conditioning to explain a number of attentional processes. Evidence from neurophysi-ology is reviewed that suggest that attention is controlled in a way similar to actions. This view makes it possible to adapt traditional learning theoretical mechanisms to the control of attention. Computer simulations are prese nted that illustrate the operation of the model. 232 Balkenius, Christian (2002) (Lund University, Sweden) „Is attention a purely perceptual process or is it in any way related to motor control?” http://cognition.iig.unifreiburg.de/csq/CSQvol1.html Ballabene, Alfred (1997): “Bewußtseinszustände“ http://mailbox.univie.ac.at/%7ea8424mae/bewphys.htm [email protected] Barlow, Horace and Tony Gardner-Medwin (1998) “Limitations of learning with distributed representations” http://itb.biologie.hu-berlin.de/events/ninf98_abstr.html Bartheld, Christopher S., Reg Williams, Frances Lefcort, Douglas O. Clary, Lou is F. Reichardt,and Mark Bothwell (1996) “Retrograde Transport of Neurotrophins from the Eye to the Brain in Chick Embryos: Roles of the p75 NTR and trkB Receptors” http://www.jneurosci.org/cgi/content/full/16/9/2995 Bauer, Heinz (1991) „Wahrscheinlichkeitstheorie“ ISBN 3-11-012191-3, De Gruyter, Berlin New York. Berger, Theodore W. (2002) “Machine Demonstrates Superhuman Speech Recognition Abilities” http://www.usc.edu/ext-relations/news_service/releases/stories/36013.html “University of Southern California biomedical engineers have created the world's first machine system that can recognize spoken words better than humans can.. ..Neurons process information structured in time," he explained. "They communicate with one another in a 'la nguage' whereby the 'meaning' imparted to the receiving neuron is coded into the signal's timing. A pair of pulses separated by a certain time interval excites a certain neuron, while a pair of pulses separated by a shorter or longer interval inhibits it... ..The way a computer is clocked, in beats of unvarying duration. But in living cells, the temporal dime nsion, both in the exciting signal and in the response, is as important as the intensity."… Dies beweist die Effektivität von Zeitcodierung!!! Birbaumer Niels, Schmidt Robert (1996) „Biologische Psychologie“ ISBN 3 -540-59427-2, Springer Verlag. Bleeck, Stefan (1996) „Psychophysikalische Untersuchung von spektralen und zeitlichen Mechanismen des auditorischen Systems anhand Amplitudenmodulationen“ http://www.tonhoehe.de/ Zur Tonhöhenerkennung bei fehlender Grundfrequenz siehe: http://www.tonhoehe.de/diplom-node12.html#SECTION00133000000000000000 Zur Zeiteinheit von 0,4ms siehe: http://www.tonhoehe.de/diplomnode15.html#SECTION00150000000000000000 Bosking, W.H., Y. Zhang, B. Schofield and D. Fitzpatrick (1997) “Orientation sele ctivity and the arrangement of horizontal connections in tree shrew striate cortex . Journal of Neuroscience, 17(6):2112-2127. Brandherm, Boris (2000) „Rollup-Verfahren für komplexe dynamische Bayessche Netze“ http://w5.cs.uni-sb.de/~borisbra/publications/Diplom-Brandherm.pdf Dynamische Bayessche Netze sind eine Erweiterung von Bayesschen Netzen und ermöglichen die Modellierung zeitabhängiger Prozesse, indem über die Zeit sogenannte Zeitscheiben (das sind Bayessche Netze, die durch Kanten mit dem alten Netz verbunden werden) an das bestehende Netz 233 angehängt werden können. Dabei wächst das Netz, und.. ..der Arbeitsspeicherbedarf wird immer umfangreicher. Bremen (19.06.1998): Bericht über die diesjährige Konferenz der Association of Scientific Studies of Consciousness (ASSC) „Ebenso sorgte der dynamische Christof Koch mit seiner jüngsten Entdeckung von optischen Gesichtszellen im präfrontalen Cortex für eine kleine Renaissance der Suche nach der "Großmutterzelle". http://people.freenet.de/soleil7/ncc.htm Bressler, S.L., Coppola, R., Nakamura, R. 1993. Episodic multiregional cortical coherence at multiple frequencies during visual task performance. Nature 366,153 -156. Byrne, John H. (2002) “Reward Learning” http://www.uthouston.edu/forMedia/newsreleases/nr2002/byrne.html A successful bite that secures food sends a reward signal to the brain via a nerve in the marine snail s esophagus. By wiring an electrode to this nerve, the animal was conditioned without any real food. Calvin, William H. (1993) "The unitary hypothesis: A common neural circuitry for novel manipulations, language, plan-ahead, and throwing?" http://www.williamcalvin.com/1990s/1993Unitary.htm Calvin verdritt den darwinistischen Ansatz. Campbell, Fergus W. und Lamberto Maffei (1987) „Kontrast und Raumfrequenz“ Artikel aus „Wahrnehmung und visuelles System“, ISBN 3-922508-36-7, SpektrumVerlag – Heidelberg. Carmichael, T. Thomas & Marie-Francoise Chesselet (2002) „Synchronous Neuronal Activity Is a Signal for Axonal Sprouting after Cortical Lesions in the Adult“. http://tonto.stanford.edu/~kevin/carmichaelChesselet2002TTXsprouting.pdf Catalano, S. M. & Shatz, C. J. (1998) “Activity-dependent cortical target selection by thalamic axons.” Science 281, 559-562 (1998). | Article | PubMed | ISI | ChemPort | Churchland, S. Patricia (1996): Vernunft braucht Gefühle. In: Die Technik auf dem Weg zur Seele, Hrsg. Christa Maar. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag. Cohen, Larry, Ying-wan Lam, Michal Zochowski and Matt Wachowiak (2000) “Oscillations in the Turtle Olfactory Bulb” J. Neurosci. 20:749-762. Connors B, Gutnick MJ, Prince DA (1982) “Electrophysiological properties of ne ocortical neurons in vitro.” J Neurophysiol 48: 1302-1320. Crick, Francis (1997): Was die Seele wirklich ist; Die naturwissenschaftliche Erfo rschung des Bewußtseins. ISBN 3-499-60257-0, Hamburg: Rowolt Taschenbuch. Cross, Charles G. (2000) "Coding for visual cathegories in the human brain": http://www.cns.caltech.edu/~gabriel/academia/media/categories_news_and_views.pdf. ... so wurden zum Beispiel Zellen im Temporallappen gefunden, die spezifisch auf Ge sichter ansprechen, die sogenannten “face cells“. 234 Crost, Nicolas & Caroline Kornek & Wolfgang Rauch (2002) Universitätsscript zur Gehirnanatomie. http://wt.fb3.uni-wuppertal.de/fachschaft/psychologie/studi_hilfen/files/ Grundstudium/Physiologische_Psychologie/physio-thompson-das_gehirn-frankfurt-GS26S..DOC „Der Hippocampus scheint der Ort zu sein, an dem episodische und semantische Erinnerungen ins Gedächtnis übertragen werden, aber sie werden dort nicht gespeichert.“ Damasio, Antonio R. und Hanna Damasio (1993) „Sprache und Gehirn“ Aritkel aus Spektrum der Wissenschaft Spezial: Gehirn und Geist, ISSN 0943-7096, SpektrumVerlag - Heidelberg. Damasio; Antonio R. (1995): Descartes´ Irrtum. Aus dem Englischen von Hainer Kober. München: Paul List Verlag. Dantzker, J. L. & Callaway, E. M. (1998) „The development of local, layer -specific visual cortical axons in the absence of extrinsic influences and intrinsic activity. ” J. Neurosci. 18, 4145-4154 (1998). | PubMed | ISI | ChemPort | Dickson, Barry J., Hollis Cline, Franck Polleux & Anirvan Ghosh (2001) „Making connections” http://www.nature.com/cgi-taf/DynaPage.taf?file=/embor/journal/v2/n3/full/embor458.html Doerfler Alex (2001) „Die Rolle des unteren Temporallappens bei der Objekterke nnung“ http://www-lehre.inf.uos.de/~adoerfle/service/psychologie/Objekterkennung.html#3.3 „Die Signale des ventralen Pfades der Sehinformation gehen von V1 über V2, V3 und V4 bis zu TEO, wo Muster erkannt werden, und von da weiter zu TE, wo Objekte rkennung stattfindet. Der dorsale Pfad dient hingegen hauptsächlich der Lokalisierung. Dabei wurde festgestellt.. ..dass tatsächlich komplexe Eigenschaften oder ganze Objekte, wie den Umriß einer Hand, Farbe, Kontrast und Struktur usw. durch die Reaktion einzelner Zellen repr äsentiert werden. In TE wirkt sich die Position der Stimuli vor der Retina nicht auf die Rea ktion aus.“ Du, Xiuxia and Bijoy Ghosh (2002) „Decoding the position of a visual stimulus from the cortical waves of turtles.“ http://www.cbcis.wustl.edu/pubs/turtle/cns_2002.pdf Eckhorn R. (2000) “Neural mechanisms of visual feature grouping” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=109627 35&dopt=Abstract Eckhorn, R., Bauer, B., Jordon, W., Brosch, M., Kruse, W., Munk, M., Reitboeck, H.J. 1988. Coherent oscillation: a mechanism of feature linking in visual cortex? Biol. Cybern. 60,121130. Eckhorn,R., Bauer,R., Jordan,W., Brosch,M., Kruse,W., Munk,M., and Rei tboeck,H.J. (1988). Coherent oscillations: a mechanism of feature linking in the visual cortex? Multiple electrode and correlation analyses in the cat. Biol Cybern 60, 121-130. Edelman, Gerald M. (1993): Unser Gehirn ein dynamisches System. Die Theorie des neuronalen Darwinismus und die biologischen Grundlagen der Wahrnehmung. München: Piper. Edelmann, Shimon (1998) “Representation is Representation of Similarit ies” “A shape is represented internally by the responses of a small number of tuned mod ules, each broadly 235 selective for some reference shape, whose similarity to the stim ulus it measures.” [email protected] Cambridge USA, Center for Biological and Computational Learning, Dept. of Brain and Cognitive Sciences: http://www.ai.mit.edu/~edelman Ehret, Günter (1997) Universität Ulm http://www.uni-ulm.de/uui/1997/int1197.htm#2 Auszug: Jedem Schallmuster entspricht ein räumliches Verteilungsmuster von Hotspots im auditorischen Cortex. Mit Hilfe von spannungsempfindlichen Fluore szenzfarbstoffen lässt sich eine hohe zeitliche Auflösung erzielen. Die Farbstoffe werden auf die Gehirnoberfläche aufgetragen. Wenn durch Schallsignale an einer bestimmten Stelle im Gehirn neuronale Aktivität ausgelöst und die Spannung verändert werden, verändert sich dementsprechend die Fluoreszenz des Farbstoffs. Mittels dieser Methode wurde am primären Hörfeld des Meerschweinchens eine wichtige Entdeckung gemacht: daß auf eine Erregung an einer bestimmten Stelle eine Hemmung folgt, auf einen »Hotspot« ein »Coolspot«. Für ein und denselben Laut ist der zunächst aktive Bereich eine bestimmte Zeitlang nicht mehr erregbar, wohl aber für andere Laute, durch die ein neues Aktivitätsmuster aufgebaut werden kann. Die Wissenschaftler schließen daraus, daß bei der Schallwahrnehmung in der Hörrinde ein Rhythmus in der Verteilung von Hotspots und Coolspots entsteht, in dem sich der Zeitverlauf des Signals abbildet. Mit Hilfe von Aktivitätsdarstellungen des Gehirns gelang es auch zu zeigen, daß die neuronalen Reaktionen auf akustische Reize variieren k önnen. Wenn ein Tier bestimmte Schallmuster hören lernt, ergeben sich im Lauf der Zeit Veränd erungen im Erregungsmuster des primären Hörfeldes. Wiederholtes aufmerksames Zuhören verändert die neuronale Verarbeitung, die Erregungsmuster zeigen eine erfahrun gsabhängige Dynamik. El-Bab, Mohamed Fath (2001) “Cognitive event related potentials during a learning Task” http://www.ecs.soton.ac.uk/~harnad/Papers/Harnad/Fathelbab/new_thesis/introduction.html Ermentrout, G. Bard & David Kleinfeld (2001) „Traveling Electrical Waves in Co rtex“ http://physics.ucsd.edu/neurophysics/publications/ermentrout_neuron_2001.pdf Eysel, Ulf - Peter Buzas – Zoltan Kisvarday (1999) „Optische Gedächtnisspur im Gehirn entdeckt. Unsichtbares wird nach Enthemmung wieder sichtbar.“ Der Ve rsuch legt nahe, dass längsgerichtete Balkendetektoren quergerichtete hemmen, und umgekehrt. http://www.ruhr-uni-bochum.de/pressemitteilungen-1999/msg00124.html Finke, Ronald A. (1987): Bildhaftes Vorstellen und visuelle Wahrneh mung. In: Wahrnehmung und visuelles System. Spektrum der Wissenschaft: VerständIiche Forschung. Heidelberg: Spektrum Verlag. Fischbach, Gerald D. (1996) “Gehirn und Geist” Aritkel aus Spektrum der Wisse nschaft Spezial: Gehirn und Geist, ISSN 0943-7096, SpektrumVerlag - Heidelberg. Fitzsimonds, Reiko Maki and Mu-Ming Poo (1998) “Retrograde Signaling in the Development and Modification of Synapses” http://physrev.physiology.org/cgi/content/full/78/1/143 Fleisch, August (1988): Entwicklungspsychologie und Erziehungslehre. Wien: Deuticke. Freeman, Walter J. (1958) „Ditribution in time and space of prepyriform electrical activity“ http://cogprints.ecs.soton.ac.uk/archive/00000044/00/distribution_20.html 236 Freeman, Walter J. (2001) “Making Sense of Brain Waves: The Most Baffling Frontier in Neuroscience” http://sulcus.berkeley.edu/wjf/AG.EEG21stCentury.pdf Fries,P., Roelfsema,P.R., Engel,A.K., König,P., and Singer,W. (1997). Synchronization of oscillatory responses in visual cortex correlates with perception in i nterocular rivalry. Proc Natl Acad Sci U S A 94, 12699-12704. Gluckman,B.J., Neel,E.J., Netoff,T.I., Ditto,W.L., Spano,M.L., and Schiff,S.J. (1996). Electric field suppression of epileptiform activity in hippocampal slices. J Neurophysiol 76, 4202-4205. Gray,C.M. (1994). Synchronous oscillations in neuronal systems: mechanisms and functions. J Comput Neurosci 1, 11-38. Gray,C.M., König,P., Engel,A.K., and Singer,W. (1989). Oscillatory responses in cat visual cortex exhibit inter-columnar synchronization which reflects global stimulus properties. Nature 338, 334337. Green,J.D. and Petsche,H. (1961). Hippocampal electrical a ctivity IV. Abnormal electrical activity. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 13, 879 Frost, Douglas O. (2000) “University of Maryland researchers create a new pathway for sight by 'rewiring' the brain in animal study” http://www.eurekalert.org/pub_releases/200009/UoMM-UoMr-2009100.php Inhalt: Der Sehnerv wurde neugeborenen Hamstern am auditiven System angebracht. Resultat: Sie lernten mit diesem Gehirnteil sehen. Funahashi, M. und M. Steward (1998) „Properties of gamma-frequency oscillations initiated by propagating population bursts in retrohippocampal regions of rat bra in slices.“ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=962587 7&dopt=Abstract Gabbiani, Fabrizio & Holger G. Krapp & Christof Koch & Gilles Laurent (2002): „Multiplicative computation in a visual neuron sensitive to looming.” SUMMARY: Multiplicative operations are important in sensory processing, but their biophysical implementation remains largely unknown. We investigated an identified neuron. Nature 420, 320 - 324 (21 Nov 2002) Letters to Nature http://www.uni-ulm.de/uui/1997/int1197.htm#2 Garaschuk, O., Linn, J., Eilers, J. & Konnerth, A. (2000) „Large-scale oscillatory calcium waves in the immature cortex.“ Nat. Neurosci. 3, 452-459 (2000). | Article | PubMed | ISI | Geschwind, Norman (1987): Aufgabenteilung in der Großhirnrinde. In Wahrnehmung und visuelles System. Spektrum der Wissenschaft: Verständliche Forschung. Heidelberg: Spektrum Verlag. Ghosh, A. & Greenberg, M. E. (1995) “Calcium signaling in neurons: molecular mechanisms and cellular consequences.” Science 268, 239-247 (1995). | PubMed | ISI | Gochin PM, Miller EK, Gross CG, Gerstein GL. „Functional interactions among neurons in inferior temporal cortex of the awake macaque.” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=186432 2&dopt=Abstract Golding NL, Staff NP, Spruston N. (2002) “Dendritic spikes as a mechanism for cooperative long-term potentiation.” “Learning Dendritic Connections.” Department of Neurobiology and Physiology, Institute for Neuroscience, Northwestern University, Evanston, IL 60208-3520, 237 USA. file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/Manfred/Eigene%20Dateien/learning_dedrtic_ connetions.html Golding, Nace L. & Nathan P. Staff & Nelson Spruston (2002) “Dendritic spikes as a mechanism for cooperative long-term potentiation.” Versuch die exakten Lernregeln durch Stimulation mittels Elektroden im Gehirn zu finden. Aus Letters to nature, http://homepage.psy.utexas.edu/homepage/class/Psy394U/Seidemann/GoldingNature02.pdf. Goldmanrakic, Patricia S. (1993): Das Arbeitsgedächtnis. In Gehirn und Geist. Spektrum der Wissenschaft, Spezial l, 1993 - Heidelberg: Spektrum Verlag. Goldstein, E. Bruce (1997) „Wahrnehmungspsychologie: eine Einführung“, ISBN 3-82740189-5Dt. Übers. hrsg. von Manfred Ritter. Aus dem Amerikan. übers. Von Gabriele Herbst. Heidelberg; Berlin; Oxford - Spektrum Verlag. Gotthalmseder, Manfred (1998) „Visuelles Erkennen und Bildschaffen“ Diploma rbeit an der Universität Wien, Grund- und integrativwissenschaftliche Fakultät. www.kopcom.com/mg Graham, Bruce (2002) “Computing and the brain” http://www.cs.stir.ac.uk/courses/31YF/Notes/Notes_PL.html Beschreibt ein Experiment mit sea snail Alypsia, in deren Gehirn mittels Elektrodenstimulation ein Lernprozess ausgelöst wurde: “…weak stimulus with postsynaptic depolarizing current via an intracellular electrode will produce Long Term Potentiation.” Gray, C.M., Konig, P., Engel, A.K., Singer, W. 1989. Oscillatory responses in cat visual cortex exhibit intercolumnar synchronisation which reflects global stimulus properties. Nature 388, 334-337. Gray, C.M., Singer, W. 1989. Stimulus-specific neuronal oscillations in orientation columns of cat visual cortex. Proc. Natn. Acad. Sci. 86, 1698-1702. Gruber, Werner (2000) „Brain Modelling1, Teil 2“ http://brain.exp.univie.ac.at/YUnterlagen.html Textauszug aus a2 S.122: Die Entwicklung des menschlichen Gehirns ist erst nach der Pupertät abgeschlossen. Ma nche Gebiete werden erst sehr spät in das Netzwerk Gehirn integriert. Zum Beispiel der Hippoca mpus. Diese Struktur ist für unser deklaratives Lernen verantwortlich. Die meisten Menschen erinnern sich praktisch kaum an erlebte Fakten vor dem 3. Lebensjahr – Die Myelinisierung des Hippocampus wird erst zu diesem Zeitpunkt “angeschlossen”. Seite 94, das Rosenblattsche Bindungsproblem. Hardcastle, Valerie Gray (2002) [email protected] - Betreuerin der Seite für Studies of Consciousnes. Sichwort Bindungsproblem: http://server.phil.vt.edu/ASSC/esem3.html Hawkins, Harold & Leif H. Finkel (2001) „Computersimulation ahmt Gehirnfunktion nach Künstliches Gehirn soll Bildgebungsverfahren und Mikroelektroden erse tzen“ http://www.pressetext.de/pte.mc?pte=011220016 238 Hebb, Donald O., McGill University (1972) A Textbook of Psychology W. B. Sau nders Co., http://homepage.smc.edu/russell_richard/Psych2/Lecture%20Outlines/Hebb%20Reprint/Heb b%20Reprint.htm Heinecke, Armin (2000) „Unbewusste Wahrnehmung“ http://www.biblio.tubs.de/ediss/data/20000605a/20000605a.pdf S.11 Bindung durch Ort im Raum Held, Richard (1987): Plastizität sensorisch-motorischer Systeme. In: Wahrnehmung und visuelles System. Spektrum der Wissenschaft: Verständliche Forschung. Heidelberg: Spektrum Verlag. Held, Werner (2002) „Bindungsprozesse im Gehirn (Temporal Binding) - besteht ein Zusammenhang mit dem Bewußtsein? http://people.freenet.de/soleil7/Binding.htm „Neurone, die den dominanten Stimulus repräsentieren (auf den die Aufmerksamkeit gerichtet ist), verstärken ihre Synchronisation“ Heminway, John „The Brain“ TV-Dokumentation in 8 Teilen. Produzent: John Hemingway, Reporter: George Page. Gegen Ende des Teil 1 “The Enlighting Machine” wird die Hydrocephalus-Patientin Sharon vorgestellt. Videoausschnitt auf: http://members.telering.at/manfred.gotthalmseder/hydrocephalus Henkemeyer (2001) “How Neurons Communicate To Wire Developing Brain” http://www.sciencedaily.com/releases/2001/09/010914074135.htm Herkner, Werner (1991): Lehrbuch Sozialpsychologie. 5. Auflage. Bern – Stuttgart – Toronto, Verlag Hans Huber. Hernegger, Rudolf (1995) „Wahrnehmung und Bewußtsein; ein Diskussionsbeitrag zu den Neurowissenschaften“ ISBN 3-86025-288-7, Spektrum Verlag – Heidelberg. Hinton, Geoffrey.E. (1993) „Wie neutonale Netze aus Erfahrung lernen“ Aritkel aus Spektrum der Wissenschaft Spezial: Gehirn und Geist, ISSN 0943-7096, SpektrumVerlag - Heidelberg. Holle, Henning (1997) „Ein Skript nach ’Wahrnehmungspsychologie’ von E. Bruce Goldstein“ http://www.psychologie.uni-trier.de/fachschaft/skripte/wahrnehmung.pdf Behandelt auch das auditive System ausführlich. S.52 Gestaltprinzipien des Hörens Holler, Johannes (1996) „Das neue Gehirn“, ISBN 3-87387-311-7, Fuldaer Verlagsanstalt GmbH – Fulda. Hubel, David H. und Torsten N. Wiesel (1987): Die Verarbeitung visueller Informationen. In: Wahrnehmung und visuelles System. Spektrum der Wissenschaft: Verständliche Forschung. Heidelherg: Spektrum Verlag. Hubel, David H., (1989): Auge und Gehirn. Neurobiologie des Sehens. Spektrum der Wissenschaft - Heidelberg: Spektrum Verlag. Huizhong W. Tao and Mu-ming Poo (2001) “Retrograde signaling at central synapses” http://www.pubmedcentral.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=11572961 239 Hüther, Gerald (2001) “Was ist Stress” http://www.lptw.de/vortraege2001/g_huether.html Zu langanhaltenden Aktivierungen der HPA-Achse und zu langfristigen Erhöhungen zirkulierender Glucocorticoidspiegel kommt es immer dann, wenn die Streßbelastung sich als unkontrollierbar erweist, d. h. wenn keine der vorhandenen Verhaltens - (incl. Verdrängungs-) strategien auch nur ansatzweise geeignet ist, das ursprüngliche Gleichgewicht wiederherzustellen. Bei Versuchstieren tritt unter diesen Bedingungen "behavioural inhibition" auf. Diese "learned helplessness" dient als Tiermodell für depressive Erkrankungen. Gegenüber solch unkontollierbaren Streßbelastungen ze ichnen sich kontrollierbare Belastungen dadurch aus, dass zwar Strategien zur Ve rmeidung oder Beseitigung des Stressors verfügbar sind, die Effizienz der vorhandenen Kompensations und Regelmechanismen jedoch (noch) nicht ausreicht, um die Aktivierung eine r neuroendokrinen Stressreaktion zu verhindern. Unter diesen Bedingungen kommt es (wenn überhaupt) nur zu einer kurzzeitigen Stimulation der HPA-Achse. Jensen, Ole & John E. Lisman (1998) “An Oscillatory Short-Term Memory Buffer Model Can Account for Data on the Sternberg Task” http://oase.uci.kun.nl/~olejen/jns98.pdf JJ Wright, PA Robinson, CJ Rennie, E Gordon, PD Bourke, CL Chapman, N Hawthorn, GJ Lees, D Alexander (2001) Toward an Integrated Continuum Model of Cerebral Dynamics: The Cerebral Rhythms, Synchronous Oscillation and Cortical Stability. BioSystems 63 (2001) 71-88 http://astronomy.swin.edu.au/~pbourke/papers/paper24/ Julesz, Bella (1987) „Texturwahrnehmung“, Artikel aus „Wahrnehmung und visuelles System“, ISBN 3-922508-36-7, SpektrumVerlag – Heidelberg. Kandl, Eric & Hawkins Robert (1993) „Molekulare Grundlagen des Lernens“, aus „Gehirn und Geist“. Spektrum der Wissenschaft, Spezial l, 1993 - Heidelberg: Spektrum Verlag. Kant, Immanuel (1781/1992): Kritik der reinen Vernunft l. ISBN 3 -518-09243-X Frankfurt: Suhrkamp Taschenbuch 1992. Kapadia, M. K., M. Ito, C.D. Gilbert and G. W estheimer (1995) Improvement in visual sensietivity by changes in local context: parallel studies in human observers and in V1 od alert monkeys. Neuron 15(4):843-856. Karl C. Mayer (2002) „Glossar Psychiatrie/Psychosomatik/ Psychotherapie/Neurologie/Neuropsychologie“ http://www.neuro24.de/glossarh.htm Unter dem Stichwort Hippocampus: Die Speicherung des Wissens findet nicht im Hippoca mpus und im EPPC selbst statt, sondern modalitäts- und funktionsspezifisch in den verschiedenen Rindenarealen. Katz, Lawrence C. and Justin C. Crowley (2002) “Development of Cortical Circuits: Lessons from Ocular Dominance Columns” http://156.145.51.19/pdfs/katz.pdf Kiefer, Markus & H. Neumann & M. Spitzer (2000) „Zeitlicher Verlauf von Hirnaktivieru ngen bei der Ergänzung von Objektoberflächen“ www.twk.tuebingen.mpg.de/twk00/TWK.pdf. [email protected] In der Studie wurde untersucht, ob und zu welchem 240 Zeitpunkt der Objektwahrnehmung Information über partiell verdeckte Objektoberflächen aus dem visuellen Input extrahiert wird. Kognition (2000) „Einführung in die Kognitionswissenschaften“ http://ls1-www.cs.unidortmund.de/Lehre/Sonstige/MMKS.pdf Seite 30: Chunks Kolb, Bryan und Ian Q. Whishaw (1996): Neuropsychologie. 2. Auflage. Heidelberg; Berlin; Oxford: Spektrum Verlag. Kreiter,A.K. and Singer,W. (1996). Stimulus-dependent synchronization of neuronal responses in the visual cortex of the awake macaque monkey. J Neurosci 16, 2381-2396. Kuhn, Hans-Georg (2001) „Neuronenquelle im Gehirn“ http://www.biologe.de/news/archiv01/2001-24.html [email protected] Langer, Gerald (7.5.98) „Anatomische und funktionelle Grundlagen der Verarbeitung akustischer Signale im auditorischen Mittelhirn“ http://www.uni-frankfurt.de/SFB269/c2.htm Das Projekt hat u.a. gezeigt, daß im Colliculus inferior verschiedene Nervenzellen besonders deutlich verschiedene Periodizitäten bevorzugen. Tonhöhe kann so auch bei fehlendem Grundton erkannt werden. Weiters wurde auch eine selbstproduzierte Periodizität festgestellt. Legenstein, R., W.Maass and H. Markram. “Input Prediction and Autonomous Movement Analysis in Recurrent Circuits of Spiking Neurons” http://www.lsm.tugraz.at/papers/lsmvision-140.pdf Leopold, David A. (2000) “Neural mechanisms of visual awareness” http://www.twk.tuebingen.mpg.de/twk00/TWK.pdf [email protected] The results suggest that the activity of a subset of neurons throughout the visual cortex is directly related to the subjective perception of a visual stimulus. Aufmerksamkeit wirkt also bis auf die Sehrinde zurück! Leventhal, AG, Wang, Y-C, Schmolesky, MT, Zhou, Y (1998) „Neural correlates of boundary perception.” Visual Neuroscience 15: 1107-1118. Liessmann Konrad und Gerhard ZENATY, (1990): Vom Denken. Einführung in die Philosophie. Wien: Baumüller. Livingstone MS. (1996) Oscillatory firing and interneuronal correlations in squirrel mo nkey striate cortex. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=879375 7&dopt=Abstract: Livingstone, M.S. 1996. Oscillatory firing and interneuronal correlations in squirrel monkey striate cortex. J. Neurophysiol. 75, 2467-2485. Lopes da Silva FH, Hoek A, Smits H, Zetterberg LH (1974) “Model of brain rhythmic activity. The alpha-rhythm of the thalamus.“ Kybernetik 15:27-37. 241 Lovell, Paul George (2002) „Human Contour Integration: Evaluating The Associ ation Field Theory Using Psychological and Computational Methods.” http://www.stir.ac.uk/postgrads/psychology/pgl1/downloads/PhDThesis/Thesis_MaxCompres sion.pdf Maar, Christa, Ernst Pöppel, Thomas Christaller (1996), Die Technik auf dem Weg zur Seele, Reinbeck bei Hamburg: Rowolt Taschenbuch Verlag GmbH. Macho (1999) Modelle des Lernens: Neuronale Netze http://www.unifr.ch/spc/UF/93mai/macho.html Beschrieben wird unter anderem ein Psychologischer Versuch zur Blockierung. Die ersterlernten Verbin dungen verhindern spätere Zusammenhänge zu erkennen. Das ist ein Hinweis, dass erst bei Voraussagefehlern neues Lernen stattfindet. Malgaroli, Antonio (2001) “Analysis of Silent Synapses in CA3-CA1 Hyppocampal culture” Letzter Artikel aus: http://www.hms.harvard.edu/armenise/symposia/public4_2001/changing_brain.pdf Marken, Richard S. (2000) „Selection of Consequences” http://home.earthlink.net/~rmarken/ControlDemo/Select.html Unser Handeln ist nicht zufallsmotiviert, sondern durch Voraussicht. Die Seite zeigt ein Spiel, das die beiden Lernmodelle verdeutlicht. Marom, Shimon & Goded Shahaf (2002) „Development, learning and memory in large random networks of cortical neurons: lessons beyond anatomy“ http://brc.technion.ac.il/QRB.pdf Marr, David (1982): Vision: A Computoral Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Invormation. W.H. Freeman and Company, New York, 1982. Mathelitsch (2002) „Natur und Phyisk“ „Ein Blitz beruht nicht auf einer einmaligen Entladung, sondern er ergibt sich aus einem mehrstufigen Prozess.Die erste sichtbare Phase ist der sogenannte Stufenleitblitz (man vermutet sogar, dass bereits vorher ein unsichtbarer"Pilotblitz" Bahn geschaffen hat)…“ http://www.oebvhpt.at/physik/compact/nablitz.htm McFadden (2002) „Evidence for an Electromagnetic Field Theory of Consciou sness” http://www.mngm.nl/McFadden.html Messinger, Adam , Larry R. Squire, Stuart M. Zola, and Thomas D. Albright (2001) “Neuronal representations of stimulus associations develop in the temporal lobe during learning” http://www.pubmedcentral.gov/articlerender.fcgi?tool=pmcentrez&artid=59829 Metzinger, Thomas (2002) „Ganzheit, Homogenität und Zeitkodierung“ http://www.unigiessen.de/~gm1001/texte/tm-d.htm Das Körpergefühl ist durch ein neuronales Aktivitätsmuster gegeben. Dieses „erzeugt ein kontinuierliches repräsentationales Fundament für das körperliche Selbstmodell und verankert es auf diese Weise im Gehirn. Immer dann, wenn es überhaupt phänomenales Bewußtsein gibt, gibt es auch diese unspezifische, interne Inputquelle.“ 242 Milgram, N. W. (2002a) „Neurobiology of Learning and Motivation“ Chapter 18, Cellular Mechanisms of learning and Memory www.utsc.utoronto.ca/~milgram/nroc61/learn2.doc S.17: Conditioning per electrode Milgram, N. W. (2002b) „Neurobiology of Learning and Motivation“ Chapter 11: Regulatory Motivations, H2>Behavioral Regulation: Thirst and Drinking. http://www.utsc.utoronto.ca/~milgram/nroc61/Chap12.htm Miller - Rainer (2000) “Teaching the brain to see” http://www.ai.mit.edu/people/ekm/NVRainer_and_Miller_2000.pdf Miltner, W.H., Braun, C., Arnold, M,, Witte, H., Taube, E. 1999. Coherence of gamma-band EEG activity as a basis for associative learning. Nature 397, 434-436. Mischo, C. (2002) Handout zum Thema Klassisches Konditionieren (Dr. C. Mischo, Seminar: Vom Lernen zum Wissen (WS02/03) http://www.ew2.unimannheim.de/mischolernen/upload/Hands3.doc Beispiel: Blockierung Miyashita Y (1988) Neuronal correlate of visual associative long -term memory in the primate temporal cortex. Nature 1988 Oct 27;335(6193):817-20 http://chemport.cas.org/cgibin/sdcgi?APP=ftslink&action=reflink&origin=npg&version=1.0&coi=1:STN:280:BiaD2c%2Fh slc%3D&pissn=1097-6256&pyear=1998&md5=5a3b1089d03ecbcf60d7fd35a214678e Möckel W. - J. Ammermüller - Michael Uhlemann (1995) „Psychophysik des Hörens“ http://www.infodrom.north.de/ ~muh/Dokumente/Psychologie/Hoeren/hoeren.html Richtungshören: Angenommen der Kopfdurchmesser beträge ca. 17 cm, die Richtungsgenauigkeit 3°. Die Laufzeitdifferenz zum linken und rechten Ohr beträgt dann ca 30µs. Ein Nervenimpuls etwa 100mal länger.“ Müsseler, Jochen & Wolfgang Prinz (2002) „Lehrbuch Allgemeine Psychologie“ Spektrum Verlag, Heidelberg. http://www.uni-leipzig.de/cognition/lehrbuch/Kapitel1b_kurz2.doc 1bS.50: Für den Laien ist es zunächst überraschend, dass neben der spektralen Zusammensetzung vor allem der Zeitverlauf wichtig für die Klangempfindung ist. Klänge mit einem charakteristischen Zeitverlauf wie z.B. der Klavierton werden meistens nicht "am Klang" erkannt, wenn sie zeitverkehrt abgespielt werden. Nakagaki, Toshiyuki (2002) „Wussten Sie schon, dass einige Schleimpilze sich fortbewegen können, indem sie sich zu einer Art Organismus schließen?“ http://www.science-athome.de/index1.htm?/referate/schleimpilz.htm Nenadic, Z., and B. K. Ghosh (gesichtet 2003) “Propagating Waves and Fast Osciallations in Visual Cortex: A Large Scale Model of Turtle Visual Cortex” http://cortex.cs.utsa.edu/turtle/publications/visual_cortex_paperModelDescription.pdf Neuenschwander S., Singer, W. 1996. Long range synchronisation of oscillatory ligh t responses in the cat retina and lateral geniculate nucleus. Nature 379, 728 -733. Newell, P.C. (2000) http://www2.bioch.ox.ac.uk/~newell/index.html 243 Ooyen, A. van, J. van Pelt, M.A. Corner & F. H. Lopes da Silva (1992) „The Emergence of Long-Lasting Transients of Activity in Simple Neural Networks“ http://www.anc.ed.ac.uk/~arjen/papers/transients_net.pdf Palm, G., Wennekers, T. 1997. Synchronicity and its use in the brain. Behavioral and Brain Sciences 20, 695-696. Penfield, Wilder and Phanor Perot, (1963) "The Brain's Record of Auditory and Visual Experience: A Final Summary and Discussion," Brain, vol. 86, part 4 (December 1963), p. 685. Penn AA, Shatz CJ. (1999) „Brain waves and brain wiring: the role of endogenous and sensory-driven neural activity in development.” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?holding=npg&cmd=Retrieve&db=PubMed&list_ uids=10203134&dopt=Abstract Plach, Marcus (1999) „Bayessche Netze als Modelle der Repräsentation von Ka usalwissen“ http://www.gmd.de/publications/report/0060/Text.pdf S. 32 „Ein Bayesianisches Netz repräsentiert die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung der Variablen in einem Wahrscheinlichkeitsmodell... ...dieser Weg würde jedoch das Speichern von exponentiell vielen Wahrscheinlichkeiten erfordern... ...in einem BN wird meist ausgenützt, dass Variablen vorkommen, die von anderen unabhängig sind... ...Dies bedeutet ganz konkret für eine Domäne sinnvoller Größe, bei n=10 wären ohne die Annahme bedingter Unabhängigkeiten 1024, bei k=3 dagegen nur 80 Wahrscheinlichkeiten zu speichern. [email protected] Platon (400vuZ./1994) Band 2 aus: Sämtliche Werke (in 4 Bänden), aus der Reihe R owohlts Klassiker, neu herausgegeben von Ursula Wolf 1994. ISBN 3-499-55562X, Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch. Potter, S.M. & DeMarse, T.B. (2001). A new approach to neural cell culture for long-term studies. J.Neurosci.Meth. 110, 17-24. Prechtl, J.C. & L.B. Cohen & B. Pesaran & P.P. Mitra & D.Kleinfeld (1997) „Visual stimuli induce waves of electrical activity in turtle cortex“ http://physics.ucsd.edu/neurophysics/publications/prechtl_proceed_nat_acad_sci_1997.pdf Prechtl, J.C. & T.H. Bullock & D. Kleinfeld (2000) „Direct evidence for local oscill atory current sources and intracortical phase gradients in turtle visual cortex (Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97, 877-882. Purwins, Hendrik & Benjamin Blankertz & KlausObermayer (2000): „Modelle der Musikwahrnehmung zwischen au-ditorischer Neurophysiologie und Psychoakustik“. Hier werden unter anderem viele Experimente zu Gestaltgesetzen der auditiven Wahrnehmung zitiert. http://www.ni.cs.tuberlin.de/~hendrik/publications/pur01a_KlangF_MusikNeuroPsych.ps.gz. Recht, Markus (2000) "Gehirn und Gedächtnis" http://home.tonline.de/home/marcus.recht/hirn.htm Kapitel III.2 Im visuellen System vom Affen hat man in 244 der unteren Furche der Schläfenlappen (dem Sulcus temporalis inferior) sogenannte Gesichtszellen gefunden: sie arbeiten auf der wohl höchsten bislang entdeckten Abstraktionsstufe und reagieren ausschliesslich auf Gesichter. Riedl, Rupert (1984): Die Strategie der Genesis, 7, Auflage 1989. München: Verlag Piper,. Rosenfield, Israel (1996) „Kein Erkennen ohne Gedächtnis“ aus „Die Technik auf dem Weg zur Seele“, Reinbeck bei Hamburg: Rowolt Taschenbuch Verlag GmbH. Roth, Gerhard (2001) “Wie das Gehirn die Seele macht“ http://www.lptw.de/vortraege2001/g_roth.html Das „Ich“ besteht aus Untereinheiten. Rumpel S, Hatt H, Gottmann K. (1998) “Silent synapses in the developing rat visual cortex: evidence for postsynaptic expression of synaptic plasticity.” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?holding=npg&cmd=Retrieve&db=PubMed&list_ uids=9786992&dopt=Abstract Sacks, Oliver (1990) „Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte“ ISBN 3-49918780-9, Hamburg: Rowohlt-Verlag. Schaub, Harald (2002) „Selbstorganisation in Konnektionistischen und Hybriden Modellen von Wahrnehmung und Handeln“ http://home.de.netscape.com/de/bookmark/4_05/ ptconnections.html Wahrnehmen am Beispiel der Buchstabenerkennung. Handeln ausgelöst durch Absicht deren Stärke durch Wichtigkeit, Kompetenz, Zeitfenster und Umstände definiert ist. Schmoesky, Matthew (2003) „The Primary Visual Cortex“ http://webvision.med.utah.edu/VisualCortex.html Segev, R. & E. Ben-Jakob (2003) „From Neurons to Brain: Adaptiv Self-Wiring of Neurons” http://arxiv.org/PS_cache/cond-mat/pdf/9806/9806113.pdf Seifert, Jan (2002) „Wahrnehmungspsychologie“ eeglab.uni-trier.de/~seifert/Skripte/ Originale/Wahrnehmungspsychologie.pdf S. 47: Tonhöhenerkennung trotz fehlenden Grundtons. Senseman and Robins (2002) “High-speed VSD imaging of visually evoked cortical waves: Decomposition into intra-and intercortical wave motions, j: Neurophysiol.,87:1499-1514.) Sharma, Jitendra & Allessandra Angelucci & Mriganka Sur (2000) “Induction of visual orientation modules in auditory cortex” Nature Vol 404 20.April 2000. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=107867 84&dopt=Abstract&holding=f1000 Shatz, Carla J. (1993) „Das sich entwickelnde Gehirn“, Aritkel aus Spektrum der Wissenschaft Spezial: Gehirn und Geist, ISSN 0943-7096, SpektrumVerlag - Heidelberg. 245 Shizgal, Peter and Kent Conover (1996) “On the neural computation of utility” Concordia University, Montréal http://cogprints.ecs.soton.ac.uk/archive/00000058/01/CD_V51_eprint.htm Shors T. J., and L.D. Matzel (1997) “Long-term potentiation: What's learning got to do with it?” http://nba19.med.uth.tmc.edu/homepage/erich/bbs97.pdf Singer, W. 1994. Putative functions of temporal correlations in neocortical proces sing. In: Koch C. and Davis JL (Eds.) Large Scale Neuronal Theories of the B rain. MIT Press, Cambridge Mass., London. Singer, W., Gray, C.M. 1995. Visual feature integration and the temporal correlation hypothesis. Annu. Rev. Neurosci. 18, 555-586. Singer, Wolf (1987): Hirnentwicklung und Umwelt. In: Wahrnehmung und visuelles Syst em. Spektrum der Wissenschaft: Verständliche Forschung. Heidelberg: Spek trum Verlag. Singer, Wolf (2002) „Untersuchungen zur Ausbildung und Organisation neuronaler Repräsentationen im visuellen Kortex.“ http://www.mpih-frankfurt.mpg.de „Unsere neueren psychophysischen Untersuchungen im Sehsystem belegen, daß kortikale Neuronenpopulationen durchaus in der Lage sind, mit hoher Sensitivität zwischen koinzidenten und asynchronen retinalen Signalen zu unterscheiden und diese Information für die Szenensegmentation nutzbar zu machen: Signale von gleichzeitig dargebotenen Reizen werden zu einer Figur gebunden.“ Der Artikel ist reich an weiterführender Literatur. [email protected] Singer,W. (1998). Consciousness and the structure of neuronal representations. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 353, 1829-1840. Spektrum-Ticker (2001.07.10) „Schlauer als angenommen“ http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/575655 Der visuelle Cortex dient wahrscheinlich auch als Arbeitsgedächtnis für das Gesehene. Spektrum-Ticker (2002.09.10) „Sogar Neurone haben Lieblingszahlen“ http://www.wissenschaft-online.de/abo/ticker/604196 Bringt man Rhesusaffen das Zählen bei, dann können sie durchaus fünf Kreise von nur zweien unterscheiden. Auch die an diesem Prozess beteiligten Nervenzellen scheinen dies zu tun, denn ihre Reaktion ist bei ihrer speziellen Lieblingszahl am stärksten. Spektrum-Ticker 1997.10.27 „Pavlovsche Schnecken“ http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. An Seeschnecken konnte Geoffrey Murphy mittels Elektroden den Lernvorgang von Neuronen beobachten. Wurde der für die Langzeitpotenzierung nötige Calciumfluss chemisch unterbunden, blieb das Lernen aus. Spektrum-Ticker 1999.01.14 „Sehen wie Hören“ http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Studien an Gehörlosen zeigen, dass diese die höheren Hörareale für die Verarbeitung anderer Informationen nutzen. 246 Spektrum-Ticker 1999.03.26 „Der Schalter für das Langzeitgedächtnis“ http://www.wissenschaft-online.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. In Versuchen an Ratten haben von Christina Alberini von der Brown University in Providence und ihren Kollegen festgestellt, daß im Gehirn ein bestimmtes Protein verändert, das die Kontrolle über mehrere Gene hat. Erst dann bleibt das Erlernte für lange Zeit im Geächtnis gespeichert. Spektrum-Ticker 1999.05.07 „Das Auge des Gehirns – Aufmerksamkeit“ http://www.wissenschaft-online.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Dem Artikel zufolge kann die Wirkung der Top-Down-Signale der Aufmerksamkeit bis hinab auf das Primäre Sehzentrum nachgewiesen werden. Spektrum-Ticker 1999.06.16 „Wieder was gelernt“ http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Wissenschaftler des Max-PlanckInstituts konnten ein Schlüsselmolekyl ausfindig machen, mit dem sie die Langzeitpotenzierung unterdrückten. Überraschender Weise beeinträchtigte dies nicht das Lernvermögen der Ratten. Spektrum-Ticker 1999.09.07 „Das Gedächtnis bei der Arbeit“ http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. …das heißt, die Erregung wird in den entorhinalen Kortex geleitet und dort nach einem noch unbekannten Prinzip in "merkenswert" und "nicht merkenswert" sortiert. Das als "merkenswert" Eing estufte wird im nächsten Schritt an den Hippocampus weitergeleitet. "Erst wenn diese Strukturen in einem bestimmten Muster erregt werden, wird das Wort irgendwo im Gehirn abgespeichert", sagt Christian Elger von der Bonner Neuroklinik.. Spektrum-Ticker 1999.10.04 http://www.spektrum.de/ticker/spektrum -ticker.html. „Ein neuronales Netz mit spitzen Ohren.“ „Es wurde ein System entwickelt, das.. ..sogar besser als der Mensch hören kann. Diesen Erfolg erzielten Wissenschafter, indem sie die einzelnen 'Neuronen' des neuronalen Netzes mit variablen Zeittakten arbe iten ließen.“ Spektrum-Ticker 1999.10.19 „Nachschub für die Großhirnrinde“ http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Elizabeth Gould und Charles Gross von der Princeton University konnten durch ein spezielles Markierungsve rfahren am Affen zeigen, dass sich neue Nervenzellen in der Oberflächenschicht der sogenannten Hirnventrikel bilden und dann zu den verschiedenen Regionen in der Großhirnrinde wandern. Spektrum-Ticker 1999.10.21 „Kein Gefühl mehr für Moral“ http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Die Studie zeigt moralische Defizite bei Stirnhirngeschädigten auf. Spektrum-Ticker 1999.11.08 „Neue Zellen für neuen Lebensmut“ http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Viele Medikamente gegen Depressionen wirken oft erst nach Wochen Barry Jacobs und Casimir Fornal von der Princeton University zeigen, dass diese Substanzen das Wachstum neuer Nervenzellen anregen, und das braucht eben seine Zeit. Spektrum-Ticker 1999.11.29 „Gedächtnis-Entstehung erstmals 'fotografiert'“ http://www.wissenschaft-online.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Dominique 247 Muller u.a. vom Institut für Neuropharmakologie der Universität Genf konnten mit Aufnahmen des elektronenmikroskops zeigen, dass das Langzeitgedächtnis auf der Bildung neuer Synapsen zwischen Nervenzellen beruht, die über den Umweg der Langzeitpotenzierung entstehen. Sie kommen zu dem Schluss, dass jeder der im Gehirn vorhandenen rund 100 Milliarden Neuronen rund 10000 solcher Verbindungsstellen Synapsen - mit anderen Nervenzellen herstellen kann. Aber nur einige Dutzend dieser Synapsen sind als Langzeit-Gedächtnis-Nervenleitungen ausgebildet. Spektrum-Ticker 2000.03.16 „Synchronizität erweckt Aufmerksamkeit” http://www.wissenschaft-online.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Wissenschafter vom Krieger Mind-Brain Institute messen Synchronizität bei Konzentrationsaufgaben am Affengehirn. Spektrum-Ticker 2000.06.13 „Wie im Kopf zusammenkommt, was zusammen gehört“ http://www.wissenschaft-online.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Synchronisationsforschung am Max-Planck-Institut. Spektrum-Ticker 2000.07.20 „Lehrreicher Schlaf“ http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Wie Axel Cleermann von der Université Libre de Bruxelles vermutet, sorgen diese Wiederholungen von neuronalen Erregungsmustern dafür, dass neue Erlebnisse schließlich dauerhaft gespeichert werden. Spektrum-Ticker 2000.08.17 „Auch das Langzeitgedächtnis kann sich irren, denn Erinnerungen machen Verbindungen wieder lernfähig“ http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Der Neurologe Karim Nader und seine Mitarbeiter vom Center for Neural Science der New York University fa nden an Ratten heraus, dass jedes Mal, wenn das Gehirn Erinnerungen aus dem Lan gzeitgedächtnis wieder aufgerufen hat, diese erneut durch die Synthese frischer Proteine konsolidiert werden müssen. Spektrum-Ticker 2000.09.27 „Lebendige Erinnerungen“ http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Randy L. Buckner, Mark E. Wheeler und Steven E.Petersen von der Washington University zeigen, dass Eri nnerungen und Vorstellungen finden in den selben Gehirnarealen stattfinden, alle rdings nur in den oberen Arealen der Wahrnehmungsverarbeitung. Spektrum-Ticker 2001.02.26 „Synchrones Feuern für die Aufmerksamkeit“ http://www.wissenschaft-online.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Studien des National Institute of Mental Health zufolge tritt die spontane Synchronisation der Signale der Sehrinde nur auf, wenn dem Sinneseindruck auch die Aufmer ksamkeit gewidmet wird. Spektrum-Ticker 2001.03.19 „Bewusstes Vergessen“ http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Michael Anderson und Collin Green von der University of Oregon zeigen an einem Experiment, dass Erinneru ngen beeinträchtigt werden, sobald sie absichtlich aus dem Bewusstsein gedrängt werden, und belegen damit die Möglichkeit Freudscher Verdrängung. Spektrum-Ticker 2001.03.20 „Der Stoff, aus dem Erinnerungen sind“ http://www.wissenschaft-online.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Tracey Shors 248 und ihre Kollegen von der Rutgers University in New Jersey zeigen durch Studien, dass neue Erinnerungen neue Nervenzellen verbrauchen. Spektrum-Ticker 2001.04.19 „Mathematisch begabte Nervenzellen“ http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Neuronen im Hörsystem der Schleiereule können multiplizieren. Spektrum-Ticker 2001.04.24 „Spannung ist gut für die Nerven“ http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/572955 Spektrum d. W. Meldungen. Über das Weg-findungsvermögen beim Nervenwachstum. Spektrum-Ticker 2001.04.30 „Wo die soziale Intelligenz sitzt“ http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Die Studie zeigt spezifische Aktivitäten im frontalen Cortex, wenn wir uns geistig in die Rolle eines anderen versetzen. Spektrum-Ticker 2001.05.23 „Für immer gespeichert“ http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Nur kurzfristig zu Merkendes lagert das Gehirn im Hippocampus. Wandelt das Gehirn die Information jedoch in etwas Langfristiges um, agiert der Hippocampus mit der Großhirnrinde. Zu diesem Schluss kommen Paul Frankland und seine Kollegen von der University of Calif ornia in Los Angeles durch gentechnisch veränderte Mäuse, bei denen die Verlagerung ins Langzeitgedächtnis nicht funktioniert. Spektrum-Ticker 2001.05.28 „Sehen heißt nicht wahrnehmen“ http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Die beschriebene Studie zeigt, dass die Auflösung der Texturverarbeitung gröber ist, als die der Balkendetektoren. Spektrum-Ticker 2001.07.10 „Schlauer als angenommen“ http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Die Sehrinde dient den angeführten Studien zufolge auch als Arbeitsgedächtnis. Spektrum-Ticker 2001.07.13 „Kombinierter Scharfblick auf Gehirnfunktionen“ http://www.wissenschaft-online.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Tübinger Wissenschaftlern gelang eine Kombination zweier Meßtechniken. Nikos Logothetis: Die Elektroden haben eine gute räumliche und zeitliche Auflösung, doch ihre Reichweite ist sehr begrenzt. Hingegen liefert der Magnetresonanztomographie wichtige Informationen in einem viel größeren räumlichen und zeitlichen Maßstab. Spektrum-Ticker 2001.07.30 „Erkannt und Erinnert“ http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Warum sucht man eigentlich jeden Morgen erneut nach dem Hausschlüssel? Und andererseits findet man in einer unbekannten Stadt nach Stunden noch sein Auto auf dem großen Parkplatz wieder. David Melcher von der Rutgers University und seine Kollegen konnten zeigen, wie neue Erinnerungen sich mit alten statistisch vermischen, und welche typischen Alltagssituationen daraus zu erklären sind. Spektrum-Ticker 2001.10.30 „Bleibende Eindrücke“ http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Takeo Watanabe von der University of 249 Boston zeigt, dass auch Eindrücke unterhalb der bewussten Wahrnehmungsschwellen Lernenprozesse verursachen. Spektrum-Ticker 2001.11.09 „Erinnerst Du Dich?“ http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. An Epilepsiepatienten konnten während der Gehirnoperation in einem Lernexperiment mittels Elektroden im G ehirn folgendes beobachtet werden. Waren rhinaler Cortex und Hippokampus wä hrend des Merkvorgangs synchronisiert, so konnte das Wort später erinnert werden. Jürgen Fell und seine Kollegen von der Universität Bonn. Spektrum-Ticker 2001.11.30 „Beim Lernen zugeschaut“ http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/583971 Spektrum d. W. Meldungen. Die Aktivität des Gehirns schwindet mit fortschreitendem Lernprozess. Spektrum-Ticker 2002.01.22 „Einzelneuronen als Wahrnehmungsspeicher“ http://www.wissenschaft-online.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Forschergruppe am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik konnten an Elek trodenMessungen im Gehirn trainierter Affen zeigen, dass spezialisierte Neuronen auf gan z bestimmte Kathegorien einer Wahrnehmung (z.B. Augenabstand) ansprechen, während sie auf andere nicht reagieren. Spektrum-Ticker 2002.01.24 „Die Mathematik der Sinne“ http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. …Marc Ernst vom Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik hat jetzt zusammen mit seinem Kollegen Martin Banks von der University of California herausgefunden, dass unser Gehirn bei der Verrechnung der visuellen und haptischen Sinneseindrücke eindeutig nach statistisch optimalen Maßstäben vorgeht. Mithilfe eines trickreichen Versuchsaufbaus, bei dem die Testobjekte virtuell am Computer erzeugt werden, war es den Forschern möglich, das visuell wahrnehmbare und das zu ertastende Objekt unabhängig voneinander zu manipulieren. Spektrum-Ticker 2002.02.28 „Wenn sieben blau ist“http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. Julia Nunn vom Londoner Goldsmiths College stellte u.a. fest, dass das Farbzentrum von Synästhetikern wird aktiv wird, wenn sie ein bestimmtes Wort hören. Spektrum-Ticker 2002.03.25 „Gefühlte Schnellschüsse“ http://www.wissenschaftonline.de/abo/ticker/ Der Spektrum d. W. Newsletter. William Gehring und Adrian Willoughby von der Michigan University stellten fest, dass der so genannte mediale frontale Cortex (MFC) des Gehirns offenbar zwischen Sieg und Niederlage entscheidet: Innerhalb einer Viertelsekunde nach einer Spielniederlage sendete diese Region stets ein Neurosignal … …Das Gehirn nimmt an, dass sich alles ausgleicht. Spektrum-Ticker 2002.05.08 „Es fehlen die Worte.“ www.Wissenschaft-online.de/abo/ticker Spektrum d. W. Meldungen. Die zitierte Studie zeigt, dass frühkindliche Erinneru ngen im Kopf sind, es gelingt uns offenbar nur wie schon damals nicht, sie in Worte zu fas sen. Spektum-Ticker (2001.03.14) „Ein Fingerzeig in die Wachstumsrichtung“ http://www.wissenschaft-online.de/abo/ticker/571414 250 Sperling, Daniela 16.09.1998 „Visuelle Aufmerksamkeit“ http://www.unimannheim.de/fakul/psycho/irtel/lehre/seminararbeiten/s98/Aufmerksamkeit/ Aufmerksamkeit.htm Bei Untersuchungen an Säuglingen wurde deutlich, daß die visuelle Exploration eine aktive und gezielte Informationssuche darstellt, die erstaunlich enge Beziehungen zur späteren kognitiven Leistungsfähigkeit des Kindes aufweist… …Ein in bekannter Umgebung repräsentierter neuer Stimulus erregt Aufmerksamkeit, bis er seinerseits zu bekannt wird. Spillmann, Lothar & B. Pinna & G. Brelstaff (2000) “Farbausbreitung von der Ko ntur auf die Fläche”http://www.twk.tuebingen.mpg.de/twk00/TWK.pdf. [email protected] Die beschriebenen Wahrnehmungsexperimente legen nahe, dass die Zuordnung von Farbe zu einer Fläche an der Kontur beginnt und zur Mitte hin voranschreitet. Spitzer, Manfred (2000) „Geist im Netz, Modelle für Lernen, Denken und Handeln“, ISBN 38274-0572-6, SpektrumVerlag - Heidelberg. Spitzer, N. C., Lautermilch, N. J., Smith, R. D. & Gomez, T. M. (2000) „Coding of neuronal differentiation by calcium transients.” Bioessays 22, 811-817 (2000). | Article | PubMed | ISI | Spitzer, Nicholas C., Nathan J. Lautermilch, Raymond D. Smith and Timothy M. Gomez (2000) “Coding of neuronal differentiation by calcium transiensts” http://ntp.neuroscience.wisc.edu/faculty/Fac-art/Gomez22.pdf Standard 2002.09.02: http://www.derstandard.net/?id=1058349 „Frösche können zählen Bestimmte Neuronen reagieren empfindlich auf Anzahl und zeitliche Abfolge von Tönen“ Studien von Biologen der University of Utah in Salt Lake City ( http://www.utah.edu/) zufolge reagieren die zählenden Neuronen erst, wenn sie eine bestimmte Anzahl von Tönen registriert haben. Stangl, Werner (Linz 2002) „Neugier - ein spezielles Motiv“ www.stangltaller.at/arbeitsblaetter/motivation/Neugier.shtml „Zeigt man wenige Wochen alten Säuglingen mehrmals hintereinander dasselbe Bild von einem Gesicht, so schwindet ihr anfängliches Interesse allmählich, was zunächst als Ermüdung gedeutet werden könnte. Ersetzt man das bekannte Bild jedoch durch ein neues unbekanntes Muster, so wenden sie ihre Aufmerksamkeit dem neuen Bild wieder vermehrt zu, was für die Fähigkeit zur Unterscheidung von bekannten und unbekannten Reizen spricht.“ Steinbock, O., A. Toth, and K. Showalter (1995) Science 267, 868-871 „Pathfinding made easier by chemical waves“. http://heracles.chem.wvu.edu/new/p8.asp Steriade M, Gloor P, Llina Rp, Lopes da Silva FH, Mesulam MM (1990)“Basic mechanisms of cerebral rhythmic activities. Electoenceph. clin Neurophysiol 76: 481 -508. Steriade, M., Gloor, P., Llinas, R.R., Lopes da Silva, F.H., Mesulam, M.M. 1990. Basic mechanisms of cerebral rhythmic activities. Electroenceph. clin. neurophysiol. 76, 481-508. Sternberg S (1966) “High speed scanning in human memory. Science 153:652-654. 251 Stickgold Robert, Mathew Wilson (2002) "Unbewusste Lernleistungen lassen sich über Nacht deutlich steigern“ http://www.zeit.de/2002/48/Lernen-Schlaf. Robert Stickgold von der Harvard-Universität ließ seine Versuchspersonen in einem regelmäßigen Strichmuster auf einem Bildschirm Unregelmäßigkeiten entdecken. Ergebnis: Wenn die Patienten anschließend eine Nacht lang schlafen, dann ist am nächsten Morgen ihre Leistung sprunghaft angestiegen. …Mathew Wilson am MIT fand in Elektroden -Ableitungen aus dem Hippocampus von Ratten bei Labyrinthexperimenten ein charakteristisches Muster, das so konsistent war, „dass man tatsächlich allein durch einen Blick darauf den Aufenthaltsort der Ratte im Labyrinth bestimmen kann“. Dann leiteten die Forscher die Hirnströme der Ratten im Schlaf ab. Dort entdeckten sie in der Traum -Phase (REM) dieselben Muster wie am Tag. Störig, Hans Joachim (1995) „Kleine Weltgeschichte der Philosophie“ ISBN 3 -596-11142-0, Verlag W. Kohlhammer – Stuttgart. Strube (2001) Einführung in die Kognitionswissenschaft“ http://cognition.iig.unifreiburg.de/team/members/strube/wbkw.pdf Stryker, M.P. 1989. Is grandmother an oscillation? Nature 388, 297-298. Tarasov, Lev V. (1993) „Wie der Zufall will – vom Wesen der Wahrscheinlichkeit“, ISBN 386025-306-9, Spektrum-Verlag, Heidelberg. Timothy Alasdair Hely (1998) „Computational Models of Developing Neural Systems“http://www.anc.ed.ac.uk/~tim/thesis.ps.gz Tritschler, Yvonne (2001) Allgemeine Psychologie II http://psyfb013.unimuenster.de/fachschaft/allg2.doc S.19: Zahlreiche Beweise für die Möglichkeit von Stimulus Stimulus-Ketten. Ullian, E. M., Sapperstein, S. K., Christopherson, K. S. & Barres, B. A. (2001) „Co ntrol of synapse number by glia.” Science 291, 657-661 (2001) . | Article | PubMed | ISI | Varela, F., J.P. Lachaux, E. Rodriguez, J. Martinerie (2001) “The Brainweb : Phase Synchronization and Large-Scale Integration” http://neuro.caltech.edu/cns286/varela_etal01.pdf Wahrnehmung und visuelles System 1(1987) mit einer Einführung von Manfred Richter: Spektrum der Wissenschaft: Verständliche Forschung. Heidelberg: Spektrum Verlag. Wesenick Maria-Barbara & W. X. Schneider & H. Deubel (2000) „Retention and r etrieval of information in visual working-memory” www.twk.tuebingen.mpg.de/twk00/TWK.pdf. [email protected] The remaining information is kept in visual short-term memory up to 8 seconds without substantial loss. 2. Increasing reaction times with increasing set size is evidence for a serial retrieval process. An explanation for the effect in the cueexperiments is that due to the cue serial memory search for retrieval is no longer ne cessary. Wong, R. O., Chernjavsky, A., Smith, S. J. & Shatz, C. J. (1995) „Early fu nctional neural networks in the developing retina.” Nature 374, 716-718 (1995). | PubMed | ISI | 252 WSA 2000.10.20 „Gegenstände, die klingen, sieht man besser“ Wissenschaft smeldungen von www.wissenschaft-aktuell.de Ein Beitrag zum Zusammenspiel der Sinne bei der Objekterkennung. Doris Marszk. WSA 2000.11.16 „Wie das geistige Auge arbeitet“ Wissenschaftsmeldungen von www.wissenschaft-aktuell.de Doris Marszk zitiert Itzhak Fried von der University of California. Bei Anblick und Vorstellung feuern die gleichen Zellen. WSA 2000.11.17 „Wir sehen erheblich weniger als wir glauben“ Wissenschaft smeldungen von www.wissenschaft-aktuell.de Das Experiment mit der Holztür und dem ausgetauschten Wegsuchenden, u.a. - Doris Marszk WSA 2001.02.01 „Was den Menschen zum Menschen macht“ Wissenschaftsme ldungen von www.wissenschaft-aktuell.de Der Stirnlappen ermöglicht es uns des anderen Intentionen zu erfassen und Ironie zu erkennen. Doris Marszk WSA 2001.03 „Erstmals erfolgreich frische Gehirnzellen transplantiert“ Wissenschaftsmeldungen von www.wissenschaft-aktuell.de Doris Marszk WSA 2001.03.08 „Die Erinnerung zweisprachiger Menschen ist einsprachig“ Wissenschaftsmeldungen von www.wissenschaft-aktuell.de Die Erinnerung liegt in der Sprache vor, die sie zur Zeit des erinnerten Ereignisses sprachen. Doris Marszk WSA 2001.03.29 „Wie das Hirn Farben, Gestalten und Bedeutungen sortiert“ Wissenschaftsmeldungen von www.wissenschaft-aktuell.de Die Studie zeigt, dass Synästhesie kein vorbewußtes Phänomen ist, sondern am Übergang von unb ewußter zu bewußter Wahrnehmungsverarbeitung zustandekommt. Doris Marszk. WSA 2001.04.23 „Das Gehirn verarbeitet Musik wie Sprache“ Wissenschaftsm eldungen von www.wissenschaft-aktuell.de Das Broca Areal dient nicht nur der Bildung gramatikalisch richtiger Sätze, sondern auch der Unterscheidung harmonischer und disharmonischer Akkorde. Doris Marszk WSA 2001.05 „Im prämotorischen Cortex können wir Helden sein“ Wissenschaftsmeldungen von www.wissenschaft-aktuell.de Über die Fähigkeit sich in andere Menschen zu versetzen. Doris Marszk WSA 2001.06.20 „Unbewusste Ziele können die Laune verderben“ Wissenschaftsmeldungen von www.wissenschaft-aktuell.de "Die ganze Zeit erfüllen wir unbewusste Ziele oder scheitern an ihnen", sagt Chartrand, Psychologin an der Ohio State University. Doris Marszk WSA 2001.07 „Das Gehirn stellt sich auch auf transplantierte Arme ein.“ Wissenschaftsmeldungen von www.wissenschaft-aktuell.de Doris Marszk. WSA 2001.07 „Schlaf ist notwendig für die Entwicklung des Gehirns“ Wissenschaftsmeldungen von www.wissenschaft-aktuell.de Doris Marszk. WSA 2001.08.08 „Geruchssinn als Vorbild für effektive Computer -Netzwerke“ Wissenschaftsmeldungen von www.wissenschaft-aktuell.de "Jeder Reiz ist charakterisiert 253 durch eine spezifische und reproduzierbare Sequenz von Signalen, die von ausgewählten Neuronen abgegeben und geleitet werden", beschreibt M. Rabinovich die Grundlage seiner Analyse des Geruchssinns von Fischen und Insekten. Jan Oliver Löfken WSA 2001.10.04 „Gehirn reserviert eine Region allein für menschliche Körperfo rmen“ Wissenschaftsmeldungen von www.wissenschaft-aktuell.de, Doris Marszk. WSA 2001.10.25 „Unbewusstes Lernen ist möglich“ Wissenschaftsmeldungen von www.wissenschaft-aktuell.de Die Studie beweist Lernvorgänge unterhalb von Wahrnehmungsschwellen. Doris Marszk. WSA 2001.11.05 „Winzige Goldteilchen bilden spontan nasse Drähte" Wissenschaftsmeldungen von www.wissenschaft-aktuell.de Jan Oliver Löfken. WSA 2002.01.02 „Wo ist die Mitte?“ Wissenschaftsmeldungen von www.wissenschaftaktuell.de Damit eine Zelle weiß, wo sie sich teilen muss, oszilieren Proteine ständig von einer zur anderen Seite der Zelle, um die Mitte „auszumessen“. WSA 2002.01.19 „Schlaf nagelt Gelerntes fest“ Wissenschaftsmeldungen von www.wissenschaft-aktuell.de Doris Marszk. WSA 2002.02.21 „Das absolute Gehör – angeboren aber bald wieder verloren“ Wissenschaftsmeldungen von www.wissenschaft-aktuell.de Doris Marszk zitiert Studien von Jenny Saffran von der University of Wisconsin. WSA 2002.02.28 „Aus neu gebildeten Hirnzellen entstehen funktionsfähige Neuronen“ Wissenschaftsmeldungen von www.wissenschaft-aktuell.de Durch ein Markierungsverfahren, das ausschließlich auf Zellen wirkt, die sich teilen, konnte die Neubildung von Neuronen vor allem im Hippocampus nachgewiesen werden. WSA 2002.03.18 „Mit dem Gehirn als Cursor im Internet surfen“ Wissenschaftsmeldungen von www.wissenschaft-aktuell.de Doris Marszk. WSA 2002.05.24 „Signalrauschen unterstützt Wahrnehmung im Hirn“ Wissenschaftsmeldungen von www.wissenschaft-aktuell.de Jan Oliver Löfken WSA 2002.09.11 „Hirnzellen von Affen zählen mit“ Wissenschaftsmeldungen von www.wissenschaft-aktuell.de Andreas Wawrzinek. WSA 2002.11.27 „Babys machen entscheidenden Erkenntnisfortschritt zwischen dem 6. und 8. Lebensmonat“ Wissenschaftsmeldungen von www.wissenschaft-aktuell.de Studie unter Gergely Csibra vom Birkbeck College in London, wonach bei der Betrachtung des KanizsaDreiecks im Gehirn eine so genannte Gamma-Oszillation auszumachen ist, sobald der Betrachter erkennt, wie das Bild zusammengesetzt ist. Doris Marszk. WSA 2002.11.29 „Wie Babies sich mit Statistik ihr Wissen von der Welt aufbauen“ Wissenschaftsmeldungen von www.wissenschaft-aktuell.de Doris Marszk. 254 WSA 2002.12.18 „Blick ins Hirn erwachsener Mäuse: Wie Nervenzellen neue Kontakte bilden“ Wissenschaftsmeldungen von www.wissenschaft-aktuell.de Joachim Czichos. WSA 2002.12.18 „Blick ins Hirn erwachsener Mäuse: Wie Nervenzellen neue Kontakte bilden“ www.wissenschaft-aktuell.de Zeki, Semir M. (1993): Das geistige Abbild der Welt. In: Gehirn und Geist. Spek trum der Wissenschaft, Spezial 1, 1993. Heidelberg: Spektrum Verlag. Zhang, Li I. & Mu-ming Poo (2001) “Electrical activity and development of neural circuits.” http://www.nature.com/cgi-taf/DynaPage.taf?file=/neuro/journal/v4/n11s/full/nn753.html Zimbardo, Phillip G. (1995): Psychologie. 6. Auflage. Berlin; Heidelberg; New York: Springer Verlag. Adamatzky, A. (1998) „Subdivision of Space“ http://bookmarkphysics.iop.org/fullbooks/075030751x/adamatzkych02.pdf Zucker, R. S. (1999) „Calcium- and activity-dependent synaptic plasticity.” Curr. Opin. Neurobiol. 9, 305-313 (1999). | Article | PubMed | ISI | 255