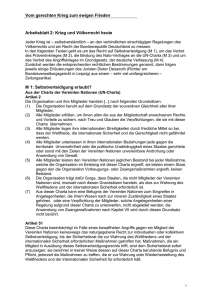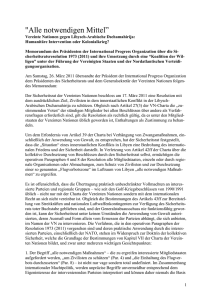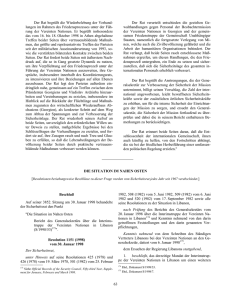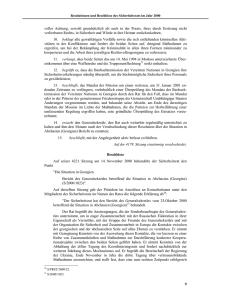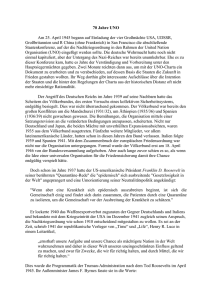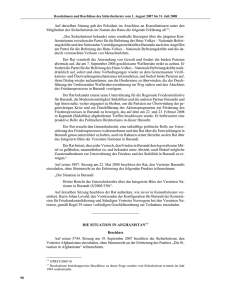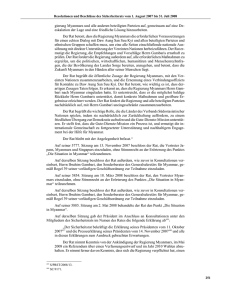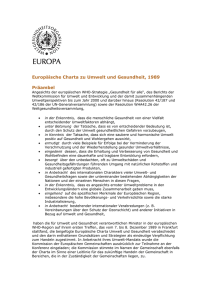Kollektive Friedenssicherung und Schutz der Menschenrechte
Werbung

Professor Dr. Udo Fink Kollektive Friedenssicherung und Schutz der Menschenrechte Literatur: - Simma, Charter of the United Nations, 3. Aufl, 2002 - Fink, Kollektive Friedenssicherung, 2 Bde., 1998 - Bothe, Friedenssicherung und Kriegsrecht, in: Graf Vitzthum, Völkerrecht, 3. Aufl. 2004 - Fischer, Friedenssicherung und friedliche Streitbeilegung, in: Ipsen, Völkerrecht, 5. Aufl., 2004 Kapitel 1: Die Geschichte der kollektiven Friedenssicherung A. Die Entwicklung bis zum Ersten Weltkrieg Das klassische Völkerrecht, das mit dem Ende der mittelalterlichen Rechtsordnung entsteht, kennt keine kollektiven Friedenssicherungssysteme. Bis zum Ende des dreißigjährigen Krieges durch den Frieden von Münster und Osnabrück im Jahr 1648 gibt es ein Verbot des ungerechten Krieges. Das Dogma vom Bellum Iustum wird rechtlich durch den theologisch begründeten Vorrang des Kirchenrechts vor dem weltlichen Recht begründet. Der Krieg ist nur aus gerechtem Grund, etwa zur Vergeltung bei Verletzung eigener Rechte, zur Durchsetzung des Glaubens und zur Selbstverteidigung zulässig. Verfahrensrechtlich soll es durch den Anspruch des heiligen römischen Reiches auf Suprematie über die Fürsten Europas durchgesetzt werden. Der Kaiser wird vom Papst gekrönt und erhält damit den Auftrag zur Verteidigung der Kirche und der von ihr bestimmten Rechtsordnung, er ist der Verteidiger der Einheit der Christenheit. Dieser Anspruch wird durch die Reformation theologisch in Frage gestellt. Im dreißigjährigen Krieg (1618-1648) verliert der Kaiser auch rechtlich die bereits zuvor faktisch verlorengegangene Souveränität über die Reichsfürsten und Reichsstände und muss ausländische Fürsten als gleichberechtigte Partner anerkennen. Die 2 außerhalb Des Reiches entstandenen Nationalstaaten werden endgültig zu unabhängigen Rechtssubjekten Die Staaten sind nunmehr souverän und entscheiden selbst über Krieg und Frieden. Das "freie Recht zum Krieg" bedeutet, dass souveräne Staaten keiner übergeordneten Instanz mehr unterliegen. Theoretisch untermauert wird das Souveränitätsprinzip durch Denker wie Jean Bodin, der in seinem Werk Six Livres de la République im Jahr 1576 den Fürsten als keiner anderen Hoheit unterworfenen absoluten Herrscher beschreibt. Damit mein Souveränität im klassischen Sinne, dass der Fürst und der durch ihn repräsentierte Staat keinen anderen Bindungen als denen unterliegt, die er freiwillig auf völkerrechtlicher Ebene eingeht. Souveränität ist damit das Prinzip der Völkerrechtsunmittelbarkeit. B. Der Völkerbund Nach dem Ersten Weltkriege und als Ergebnis dieses Krieges wird der Völkerbund gegründet. Dies ist die erste Internationale Organisation mit dem Ziel der Sicherung des Weltfriedens. Die Rechtsgrundlage des Völkerbundes waren die in den Pariser Vorortverträgen mit den Kriegsgegnern 1919/1920 geschlossenen Friedensverträge. Vertrag von Versailles (1919) mit dem Deutschen Reich, Vertrag von Neuilly (1919) mit Bulgarien, Saint Germain mit Österreich (1919), Trianon (1920) mit Ungarn. Die Satzung des Völkerbundes war Bestandteil dieser Friedensverträge, wobei die Feindstaaten zunächst aber nicht Mitglied des Völkerbundes werden konnten. Die Satzung trat mit Ratifikation des Friedens von Versailles am 10. Januar 1920 in Kraft. Ziel des Völkerbundes war ausweislich der Präambel die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und die Herstellung des internationalen Friedens und der Sicherheit. Der Urheber des Völkerbundes war der amerikanische Präsident Woodrow Wilson, der in seinen 1916 als Kriegsziele proklamierten 14 Punkten als letzten Punkt die Schaffung einer internationalen Völkergemeinschaft zum Ziel seiner Politik machte. 3 Ursprüngliche Mitglieder der Vereinten Nationen waren die 32 Signatarmächte der Friedensverträge sowie 13 weitere in der Anlage aufgeführte Mächte. Zwischen 1920 und 1937 kamen 21 weitere Staaten hinzu, darunter das Deutsche Reich (1926) und die Sowjetunion (1934). Zwischen 1920 und 1942 traten aber auch zwanzig Mitglieder wieder aus. Darunter das Deutsche Reich und Japan im Jahr 1933. Die Sowjetunion wurde 1939 ausgeschlossen. Kernstück des Völkerbundes waren das System der Friedlichen Streitbeilegung und der Kriegsverhütungsmechanismus. - Friedliche Streitbeilegung: Gemäß Art.12 und 13 VBS waren die Mitgliedstaaten verpflichtet, jeden Streit untereinander einem Schiedsgericht oder dem ständigen Internationalen Gerichtshof, der gemäß Art.14 VBS als eigene Einrichtung mit Sitz im Haag geschaffen worden war, zu unterbreiten. Die Staaten verpflichteten sich, den Spruch des Schiedsgerichts oder des st. IGH zu achten und zu befolgen. - Kriegsverhütung: Gemäß Art.10 VBS verpflichteten sich die Mitglieder die territoriale Integrität und die politische Unabhängigkeit jedes Mitgliedes zu achten und gegen jeden äußeren Angriff zu schützen. Nach Art. 11 VBS war jeder Krieg gegen ein Mitglied des Bundes eine Angelegenheit des Bundes insgesamt. Gemäß Art.16 VBS war jeder Angriff eines Mitgliedes gegen ein anderes Mitglied zugleich auch ein Angriff auf alle anderen Mitglieder. Schwächen des Systems: Gemäß Art.10 und Art.15 VBS konnte der Rat, das wichtigste Organ des Völkerbundes keine verbindlichen Entscheidungen treffen sondern nur Vorschläge zur Konfliktbeendigung machen. Die Staaten waren zwar gemäß Art.16 VBS zur Ergreifung von Maßnahmen verpflichtet. Deren konkrete Ausgestaltung war ihnen mit Ausnahme der in Art.16 Abs.1 VBS genannten Wirtschaftssanktionen jedoch nicht vorgeschrieben. Außerdem gab es kein materielles Gewaltverbot. Zwar war durch den BriandKellogg-Pakt im Jahr 1928 zwischen den wichtigsten Staaten mit Ausnahme der UdSSR ein materielles Kriegsverbot vereinbart worden. Dieser Vertrag ist jedoch nicht ausdrücklich in die Satzung des Völkerbundes integriert werden. Deshalb war bis zum Ende des Völkerbundes streitig, ob eine Verletzung des Briand-KelloggPaktes den Rat des Völkerbundes und dessen Mitglieder zu Sanktionen berechtigen. 4 Kriege standen deshalb nicht in Widerspruch zur Satzung, wenn entsprechend dem Verfahren des Art.15 VBS nach drei Monaten kein Schiedsspruch zustande kam oder der Rat nicht innerhalb von sechs Monaten einen Bericht mit Vorschlägen zur Konfliktverhütung erstattet hatte. Folgte eine Partei einem Schiedsspruch nicht, konnte gemäß Art.13 Abs. 4 VBS auch gegen diesen Staat Krieg geführt werden. Dasselbe galt, falls eine Partei einem Vorschlag des Rates nicht Folge leistete (Art.15 Abs. 6), oder falls der Rat nicht in der Lage war, einstimmig einen solchen Vorschlag zu machen (Art.15 Abs. 7 VBS). Die zweite Schwäche lag darin, dass einige der wichtigsten Staaten nicht ausreichend integriert waren. Der Völkerbund war deshalb keine universelle Organisation. Die Vereinigten Staaten wurden nicht Mitglied, weil der amerikanische Kongress die Zustimmung zum Vertragsschluss verweigerte, die Sowjetunion wurde wegen des innenpolitischen Umsturzes in der Oktoberrevolution bis 1936 in der Staatengemeinschaft als Outlaw behandelt (Nichtanerkennung der Regierung). Das deutsche Reich war ebenfalls nur fünf Jahre Mitglied und belastet mit den Reparationsansprüchen der Siegermächte. In den wichtigsten Krisen der Zwischenkriegszeit erwies sich dieses System als untauglich. Japan intervenierte 1932 in der zu China gehörenden Mandschurei und erklärte diese als eigenständigen Staat (Mandschukuo) für unabhängig. China rief den Völkerbundsrat an, der gemäß Art.15 (4) VBS einen Bericht verfasste, in dem Japan des Verstoßes gegen Art.10 VBS und des Briand-Kelogg-Paktes geziehen wurde. Daraufhin trat Japan als ständiges Mitglied des Rates 1933 aus dem Bund aus. Die größte Krise wurde durch den Einmarsch Italiens in Äthiopien ausgelöst. Mit der Eröffnung des Suezkanals 1869 wurde die Küste des Roten Meeres auch für europäische Mächte als Kolonialgebiet zunehmend interessant. Italien konzentrierte seine Aufmerksamkeit auf Äthiopien. 1895 brach ein Krieg zwischen den beiden Ländern aus, und die italienischen Truppen wurden im folgenden Jahr bei Adua entscheidend besiegt. Italien wurde gezwungen, die Unabhängigkeit Äthiopiens sowie die Reichsgrenzen Kaiser Meneliks, die den Grenzen des heutigen Äthiopiens entsprachen, anzuerkennen. 1930 wurde Haile Selassie I. Kaiser von Äthiopien. Im gleichen Jahr wurde Äthiopien Mitglied des Völkerbundes. Mit dem Aufstieg des Diktators Benito Mussolini erwachte das italienische Interesse 5 an Äthiopien erneut, und im Oktober 1935 marschierten italienische Truppen in Äthiopien ein. Ihr Ziel war die Erweiterung der bestehenden italienischen Kolonien Eritrea und Somalia zum Kolonialstaat Italienisch-Ostafrika. Daraufhin wandte sich der äthiopische Kaiser Haile Selassie Anfang 1936 an den Völkerbund um Hilfe gegen die italienische Übermacht; der Völkerbund verurteilte die italienische Aggression und verhängte Sanktionen – u. a. ein Waffen- und Rohstoffembargo auf der Grundlage von Art.16 VBS gegen Italien, die allerdings vollkommen wirkungslos blieben und nach dem Ende der Kampfhandlungen weitgehend aufgehoben wurden. Addis Abeba fiel in die Hände der Invasoren, und im Mai 1936 rief Mussolini Italiens König Viktor Emanuel III. zum Kaiser von Äthiopien aus. Haile Selassie wurde gezwungen, das Land zu verlassen und nach England ins Exil zu gehen; er kam jedoch 1941 mit Hilfe britischer und äthiopischer Streitkräfte erneut an die Macht. Im November 1937 trat Italien zudem aus dem Völkerbund aus. Der dritte große Konflikt in der Endzeit des Völkerbundes wurde durch den Einmarsch sowjetischer Truppen in Finnland ausgelöst. Nach der Oktoberrevolution proklamierte der finnische Landtag am 6. Dezember 1917 die Souveränität Finnland. Am 31. Dezember 1917 anerkannte die bolschewistische Regierung in Sowjetrussland unter Lenin entsprechend ihrem Beschluss vom 15. November 1917, der allen Nationen innerhalb des ehemaligen Zarenreiches das Recht auf nationale Selbstbestimmung zugestand, die Unabhängigkeit Finnlands an. Am 14. Oktober 1920 schlossen Finnland und Sowjetrussland den Frieden von Dorpat. In ihm erkannte Sowjetrussland nochmals formell die Unabhängigkeit Finnlands an, gestand Finnland einen Zugang zur Barentssee mit dem eisfreien Hafen Petschenga zu. Finnland auf der anderen Seite verzichtete auf Ostkarelien. Im Dezember 1920 trat Finnland dem neu gegründeten Völkerbund bei. 1932 schloss Finnland mit der Sowjetunion einen Nichtangriffspakt. Trotz des Nichtangriffspaktes löste die Sowjetunion am 30. November 1939, in der Anfangsphase des 2. Weltkrieges, den Finnisch-Sowjetischen Winterkrieg aus. Vorausgegangen war die ultimative Forderung der Sowjetunion an Finnland, strategisch wichtige Gebiete nördlich von Leningrad im Austausch gegen karelisches Territorium an die UdSSR abzutreten. Finnland war der Forderung nicht nachgekommen. Nach überraschenden Anfangserfolgen der Finnen unter General von Mannerheim gegen die sowjetische Übermacht gewannen die sowjetischen 6 Truppen mit gewaltigem Materialeinsatz rasch die Oberhand; im Frieden von Moskau vom 12. März 1940 musste Finnland u. a. die Karelische Landenge (das Land zwischen dem Finnischen Meerbusen und dem Ladogasee) mit Wyborg sowie das Nordufer des Ladogasees an die Sowjetunion abtreten und Hanko am nördlichen Ausgang des Finnischen Meerbusens als Militärstützpunkt an die Sowjetunion verpachten. Der Rat des Völkerbundes verurteilte die Sowjetunion gemäß Art.16 Abs.4 VBS wegen gröblichen Verstoßes gegen die Verpflichtungen aus der Satzung und wegen Verletzung des Briand Kellogg Paktes und schloss sie aus dem Völkerbund aus. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges stellte der Völkerbund seine Tätigkeit ein. Der Völkerbundversammlung trat am 18. April 1946 noch einmal zusammen und wickelte die Organisation offiziell ab. Ihr Nachfolger werden nach dem Zweiten Weltkrieg die Vereinten Nationen, die vor dem Hintergrund der negativen Erfahrungen des Völkerbundes einen neuen Versuch zur Gewährleistung des internationalen Friedens und der Sicherheit durch eine universelle internationale Organisation unternehmen. C. Die Gründung der Vereinten Nationen Die Vereinten Nationen sind wie der Völkerbund aus dem gegen Deutschland und seine Verbündeten gegründeten Militärbündnis entstanden. Die ursprünglichen Mitglieder sind deshalb die Kriegsgegner von Deutschland, Italien und Japan (DreiParteien-Pakt). Erste Ansätze finden sich in der sog. Atlantikcharta, einer Erklärung, die der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill am 14. August 1941 abgegeben haben. Dort ist im achten Grundsatz von einem "wider and permanent system of international security" die Rede. Es folgt die Erklärung der Vereinten Nationen vom 1. Januar 1942. Diese Erklärung wird von den sechsundvierzig Kriegsgegnern des Drei-Parteien-Paktes abgegeben. Darin bekräftigen diese Staaten ihre Absicht, ihre Anstrengungen zu koordinieren und keinen Separatfrieden mit den Kriegsgegnern zu schließen. Ein wichtiger Schritt ist die Moskauer Erklärung der Regierungen der Vereinigten 7 Staaten, des Vereinigten Königreichs, der Sowjetunion und Chinas vom 30.10.1943. Darin erkennen die Parteien unter 4. die Notwendigkeit an, so schnell wie möglich eine allgemeine internationale Organisation zu schaffen, die auf der souveränen Gleichheit aller friedliebenden Staaten gründet. Die Moskauer Erklärung lebte heute noch im Tatbestand des Art.106 UN-Charta fort. Auf der Konferenz von Teheran bekräftigen Roosevelt, Churchill und Stalin am 1. Dezember 1943 ihren Willen, alle gegen die Tyrannei und Unterdrückung eingestellten Staaten in einer weltweiten Familie demokratischer Nationen aufzunehmen. Auf der Konferenz von Dumbarton Oaks in Washington schließlich wird in separaten Verhandlungen zwischen dem Vereinigten Königreich, den USA und der UDSSR einerseits sowie zwischen dem Vereinigten Königreich, den USA und China andererseits im August und September 1944 der Entwurf für eine Charta der Vereinten Nationen erarbeitet. Auf der Konferenz von Yalta kündigen Roosevelt, Churchill und Stalin am 11. Februar 1945 die schnellstmöglich Gründung der Vereinten Nationen auf der Grundlage der Dumbarton Oaks Proposals an. Die Charta der Vereinten Nationen wird schließlich auf der zwischen dem 25. April und dem 26. Juni 1945 in San Francisco tagenden Gründungskonferenz der Vereinten Nationen ausgearbeitet und verabschiedet. Der Sitz ist heute in New York, Genf und Wien. Kapitel 2: Die Organisationsstruktur der Vereinten Nationen A. Die Mitgliedschaft: I. Die Gründungsmitglieder (Art.3 UN-Charta) Die Mitgliedschaft in einer internationalen Organisation ist die Grundlage für die korporationsrechtliche Stellung innerhalb der Organisation. Die Ausübung der Rechte aus der Satzung steht grundsätzlich nur den Mitgliedern zu. Dies gilt zum einen für das Recht, Mitglied in den Organen der UNO zu sein. So besteht etwa die Generalversammlung gemäß Art.9 (1) aus allen Mitgliedern der UNO und auch der 8 Sicherheitsrat besteht gemäß Art.23 (1) aus fünfzehn Mitgliedern der Organisation. Aber auch bestimmte Verfahrensrechte solcher Staaten, die nicht Mitglied eines Organs sind, die aber von den Beschlüssen dieses Organs betroffen sein können, stehen grundsätzlich nur Mitgliedern zu. So haben Mitgliedstaaten etwa gemäß Art.31 UN-Charta das Recht, ohne Stimmrecht an den Beratungen des Sicherheitsrates teilzunehmen. Ist der jeweilige Staat aber Streitpartei, dann hat er gemäß Art.32 UN-Charta auch als Nichtmitglied das Recht zur Teilnahme an den Beratungen des Rates. Diese Regel zeigt, dass sich die UNO als eine universelle Organisation der Friedenssicherung versteht. Die Vereinten Nationen haben 51 Gründungsmitglieder. Das sind alle an der Konferenz von San Francisco zwischen dem 25. April und dem 26. Juni 1945 Beteiligten. Allerdings hat Polen die Charta erst am 15. Oktober 1945 unterzeichnet, weil bis dahin zwischen den Westmächten und der Sowjetunion ein Streit darüber bestand, ob die Exilregierung in London oder die in Warschau gebildete kommunistische Regierung für diesen Staat handeln durfte. 46 dieser Gründungsmitglieder waren bei der Unterzeichnung zweifelsfrei Staaten im Sinne des Völkerrechts. Die weißrussische und die ukrainische Sowjetrepublik erfüllten diese Voraussetzung auf jeden Fall nicht. Sie sind erst nach dem Zerfall der Sowjetunion Ende 1991 unabhängig wurden. Auch die Philippinen und Indien wurden erst 1946 bzw. 1947 unabhängig. Zweifelhaft war die Unabhängigkeit in Bezug auf Syrien und den Libanon zwei ehemalige französische Mandate. Sie hatten sich 1941 für unabhängig erklärt und Frankreich hatte sich de facto seit 1944 aus diesen Gebieten zurückgezogen. Allerdings hatte es die Unabhängigkeit dieser Gebiete de jure zum Zeitpunkt der Gründungskonferenz noch nicht anerkannt. Da das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten aber zu diesem Zeitpunkt aber schon anerkannt hatten, spricht vieles dafür, dass Syrien und der Libanon in San Francisco bereits als Staaten behandelt wurden. Auch im Völkerbund gab es Mitglieder, die nicht Staaten im Sinne des Völkerrechts waren. Dies galt insbesondere für die britischen Dominions, den Irish Free State, Kanada, Südafrika, Australien und Neuseeland. Mit der Stellung als Gründungsmitglied ist der Vorzug verbunden, nicht das Aufnahmeverfahren gemäß Art. 4 UN-Charta durchlaufen zu müssen. Darüber hinaus sind damit keine weiteren Vorzugsrechte verbunden. Auch die Stellung als 9 ständiges Mitglied des Sicherheitsrates ist rechtlich nicht davon abhängig. Sie wird in Art.23 UN-Charta gesondert geregelt. Allerdings ist faktisch dieser Status bisher nur Gründungsmitgliedern vorbehalten gewesen, weil dies eine Änderung der Charta in einem ganz zentralen Punkt bedeuten würde. Dies zeigt die aktuelle Diskussion um die Versuche Deutschlands und Japans ständige Mitglieder zu werden. Zeitweise war sowohl die Mitgliedschaft Chinas wie auch der Russischen Föderation umstritten. Einzelheiten später. Dismembration und Sezession können die Eigenschaft als Gründungsmitglied betreffen. Dies gilt etwa für Jugoslawien, dass als sozialistische Bundesrepublik Jugoslawien durch Dismembration im Jahr 1992 untergegangen ist und dessen Nachfolgestaat Bundesrepublik Jugoslawien erst im Herbst 2000 in die UNO aufgenommen worden ist. II. Der Beitritt zu den Vereinten Nationen (Art.4 UN-Charta) Wie Art.4 (1) UN-Charta zeigt, stehen die Vereinten Nationen grundsätzlich allen Staaten offen. Dies demonstriert den Willen der Gründer, eine universelle Organisation zu schaffen, in der idealerweise alle Staaten Mitglieder sein sollen. Die Vereinten Nationen haben heute 191 Mitglieder, dies sind alle von der überwiegenden Mehrzahl der Staatengemeinschaft anerkannten Staaten auf der Welt. Dennoch knüpft die Charta materielle Bedingungen an die Aufnahme neuer Mitglieder. 1. Die Staatlichkeit Jedes neue Mitglied muss Staat im Sinne des Völkerrechts sein. Im Gegensatz zu den Gründungsmitgliedern müssen alle danach Aufgenommen Staaten sein. Das heißt, sie müssen die tatsächlichen Voraussetzungen der Staatlichkeit im Völkerrecht erfüllen und sie müssen von der Völkergemeinschaft als Staaten anerkannt werden. Diese Anerkennung kann bereits vor der Aufnahme geschehen sein. Dieses Kriterium erfüllten bei ihrer Aufnahme insbesondere die sogenannten Feindstaaten der Gründungsmitglieder, also Japan, Italien und Deutschland, wobei Deutschland 10 nach dem Zweiten Weltkrieg seine Souveränität erst wieder durch den Generalvertrag im Jahr 1955 erreichte. Sind solche Kandidaten vor ihrer Aufnahme bereits von allen Mitgliedstaaten als Staaten anerkannt worden, so können die Mitglieder in den entscheidungsbefugten Organen Sicherheitsrat und Generalversammlung keine abweichende Haltung einnehmen. Sind die Kandidaten dagegen nur teilweise oder vor der Aufnahme noch gar nicht anerkannt worden, so entscheiden die Organe der Vereinten Nationen selbst über das Vorliegen der Staatlichkeit des Aufnahmekandidaten. Dabei sind der Sicherheitsrat und die Generalversammlung nicht im Sinne der Theorie von der deklaratorischen Wirkung der Anerkennung an die objektiven Kriterien Staatsvolk, Staatsgebiet und effektive Staatsgewalt gebunden. Die Organe der Vereinten Nationen entscheiden vielmehr nach eigenem Ermessen, ob die Voraussetzungen für Staatlichkeit vorliegen. Zusätzliche Kriterien sind in einer 1946 gegründeten Kommission des Sicherheitsrats betreffend die Aufnahme neuer Mitglieder entwickelt worden. Es sind, wie im völkerrechtlichen Verkehr allgemein, der Wille und die Befähigung, die Verpflichtungen aus der Charta zu erfüllen. Mit der Befähigung ist die Frage angesprochen, ob das betreffende Gebilde effektive Herrschaftsgewalt besitzt, um die eingegangenen völkerrechtlichen Pflichten zu erfüllen. Dies war z.B. umstritten im Falle Israels, das unmittelbar nach seiner Staatsgründung im Jahr 1948 von seinen arabischen Nachbarn militärisch angegriffen wurde. Damals hat das Vereinigte Königreich die Aufnahme Israels in die Vereinten Nationen mit dem Argument abgelehnt, dass wegen des militärischen Konflikts nicht sicher sei, ob Israel effektive Herrschaftsgewalt über das von ihm beanspruchte Gebiet erlangten werde. Erst nach dem Sieg in diesem Krieg, der mit Waffenstillstandsvereinbarungen Israels mit den arabischen Nachbarn endete, wurde Israel als effektive Herrschaftsgewalt in die Vereinten Nationen aufgenommen. Vor diesem Hintergrund war die Aufnahme von Kroatien und von BosnienHerzegowina im Jahr 1992 problematisch, weil diese beiden ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken zum Zeitpunkt ihres Beitritts im Jahr 1992 noch keine unbestrittene und effektive Herrschaftsgewalt auf dem gesamten von ihnen beanspruchten Gebiet ausgeübt haben. Für die Republik Bosnien-Herzegowina gilt dies 11 auch heute noch. Sie hat zwar seit dem Vertrag von Dayton im Jahr 1995 eine Verfassung. Die Staatsorgane können jedoch gegen den Willen der beiden Teilgebiete , der sogenannten Entities, dies sind die Republica Sprska und die Föderation Bosnien-Herzegowina bestehend aus dem muslimischen und dem kroatischen Teil weder Gesetze noch Verwaltungsmaßnahmen durchsetzen. Hinzu kommen muss der Wille, sich völkerrechtskonform zu verhalten, also bezogen auf die Aufnahme in die Vereinten Nationen die damit entstehenden Pflichten aus der Charta zu erfüllen. Dies nehmen die Vereinten Nationen dann an, wenn der Kandidat keine Konflikte mit Mitgliedstaaten unterhält, wenn er im Gegenteil mit den Mitgliedern freundschaftlich Verpflichtungen erfüllt verbunden und sich ist, zur wenn er seine Unterwerfung unter internationalen vertragliche Streitbeilegungsverfahren bereit zeigt. Ein Beispiel für die Nichtaufnahme aus diesem Grund ist Südrhodesien. Dieses Gebiet, das heute Zimbabwe heißt, hat sich 1965 für unabhängig erklärt. Obwohl das Regime unter Ian Smith faktisch unbestrittene Herrschaftsgewalt ausübte, haben die Vereinten Nationen die Aufnahme abgelehnt, weil dieses Regime auf den Grundsätzen der Apartheid basierte und deshalb gegen das Selbstbestimmungsrecht kolonialer Völker verstieß. Sie haben darüber hinaus allen Mitgliedern verbindlich aufgegeben, Südrhodesien nicht als Staat anzuerkennen. Erst nach dem Machtwechsel zugunsten der schwarzen Bevölkerung im Jahr 1980 wurde Südrhodesien aufgenommen. Dieses Beispiel zeigt, dass die Entscheidung der UNO über das Vorliegen des subjektiven Staatsmerkmals Wille zur Erfüllung aller völkerrechtlichen Verpflichtungen mit der Vorstellung von einer nur deklaratorischen Wirkung der Anerkennung als Staat nicht zu vereinbaren ist. Solche materiellen Kriterien wie die Beachtung des Selbstbestimmungsrechts sind nur mit einer konstitutiven Wirkung der Anerkennung zu erklären, wobei die Staatengemeinschaft verbindlich festlegt, welche völkerrechtlichen Pflichten für die Aufnahme in die Staatengemeinschaft unabdingbar sind. 2. „Friedliebende“ Staaten Darüber hinaus verlangt Art.4 (1) UN-Charta, dass alle Kandidaten friedliebende 12 Staaten sind. Die Abgrenzung zu dem Kriterium Wille zur Erfüllung der Verpflichtungen aus der Charta gelingt nur historisch. Bei der Entstehung der Charta war man sich einig, dass alle Feindstaaten der Vereinten Nationen und solche Regime, die mit Hilfe der Feindstaaten an die Macht gekommen waren nicht friedliebend seien. Dies spielte insbesondere eine Rolle, als Spanien unter dem Regime Franco 1945 die Aufnahme in die Vereinten Nationen beantragte. II. Die Organe 1. Die Generalversammlung a. Zusammensetzung Die Generalversammlung besteht gemäss Art.9 UN-Charta aus allen Mitgliedern der UNO. Jedes Mitglied darf höchstens fünf Vertreter entsenden. Mitglieder sind sowohl die Gründungsmitglieder wie auch alle später aufgenommenen Staaten. Die Mitgliedschaft wird wirksam zu dem Zeitpunkt zu dem die Generalversammlung die Aufnahme gemäss Art.4 (2) UN-Charta beschließt. In der Praxis wird dieser Beschluss grundsätzlich vor Beginn einer Session vor Annahme der Tagesordnung getroffen, damit das neuaufgenommene Mitglied an den Beratungen in vollem Umfang teilnehmen kann. b. Aufgaben Die Generalversammlung hat gemäss Art.10 UN-Charta ein umfassendes Erörterungsrecht. Sie kann alle Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit der UNO fallen, diskutieren und diesbezüglich Empfehlungen an die Mitglieder richten. Um dieses Recht ausüben zu können, steht der GA auch die Befugnis zu, diese Angelegenheiten zu untersuchen. Dazu kann sie Beobachter oder Untersuchungskommissionen entsenden. So hat die Generalversammlung etwa 1946 das United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP) zur Untersuchung der Verhältnisse in Palästina eingesetzt, 1958 wurde die United Nations Oberserver Group in Lebanon (UNOGIL) eingesetzt. Der Aufgabenkreis der UNO ist in Art.1 und 2 definiert, was der GA praktisch das 13 Recht gibt, sich mit allen internationalen Angelegenheiten zu beschäftigen. Die Grenze sind die inneren Angelegenheiten der Staaten im Sinne von Art.2 Abs. 7 UNCharta. Bezüglich der Wahrung des internationalen Friedens und der Sicherheit enthalten Art.11 und Art.12 einige Einschränkungen der Zuständigkeit der GA, die sich aus der vorrangigen Kompetenz des Sicherheitsrat auf diesem Gebiet ergeben. Gemäss Art.11 hat die GA die Kompetenz, die grundsätzlichen Prinzipien der Zusammenarbeit zur Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit zu erörtern und diesbezüglich Empfehlungen abzugeben. Insoweit besteht eine enge Verbindung zu Art.13, wonach die GA Untersuchungen veranlassen kann und Empfehlungen abgeben kann, um die internationale Zusammenarbeit auf politischem aber auch auf wirtschaftlichem Gebiet zu fördern. Gemäss Art.11 kann sich die GA auch mit der Abrüstung und der Rüstungsregelung befassen. Dazu hat die GA bereits 1946 eine internationale Atomenergiekommission (AEC) eingesetzt, welche die Herstellung und Verwendung von Atomwaffen kontrollieren sollte. Wegen der Konflikte der Supermächte stelle diese Kommission jedoch 1960 ihre Tätigkeit ein. An seine Stelle ist ein Abrüstungskomitee getreten, welches aus 40 Staaten besteht und sich mit Fragen der Abrüstung auf allen Gebieten der Waffentechnik beschäftigt. Diese Kommission hat jedoch keine großen Erfolge erzielt. Die Abrüstung wurde statt dessen durch die USA und die UdSSR/Russische Föderation etwa durch die SALT (Strategic Arms Limitation Talks) in den siebziger Jahren und START (Strategic Arms Reduction Talks) Verträge in den neunziger Jahren (Start II ist nach der Ratifikation der Russischen Föderation im Jahr 2000 in kraft getreten) auf dem Gebiet strategischer Waffen und durch den INF Vertrag (Treaty on the Elemination of the Intermediate-Range and Shorter-Range Missiles) aus dem Jahr 1987 auf dem Gebiet von Mittelstreckenwaffen in Europa vorangetrieben. Gemäss Art.11 (2) kann die GA jede die Wahrung des Friedens und der Sicherheit betreffende Frage diskutieren, die ihr ein Mitglied der UNO oder der SR vorlegt. Sie kann zu diesen Fragen Empfehlungen an die Mitglieder oder den SR richten. Die Resolutionen der GA sind also nicht verbindlich. Die GA kann gemäss Art.11 (3) auch den SR mit Angelegenheiten des Friedens befassen, wenn sie der Auffassung 14 ist, dass dieser ggf. rechtlich verbindliche Maßnahmen zur Friedenssicherung treffen sollte. Die Fokussierung auf die Friedenssicherung schränkt gemäss Art.11 (4) die allgemeinen Kompetenzen der GA gemäss Art.10 nicht ein. Wohl aber enthält Art.12 UN-Charta eine solche Beschränkung. Solange nämlich der SR sich mit einer Angelegenheit beschäftigt, die in seine Zuständigkeit fällt, darf diese nicht in der GA diskutiert werden. Dies zeigt die Vorrangstellung des SR im System der Friedenssicherung durch die UNO, was auch durch Art.24 (1) bestätigt wird, der dem SR die Hauptverantwortung für die Wahrung des Friedens zuweist. Der SR hat also das Recht jede Angelegenheit, die in seine Kompetenzen fällt, an sich zu ziehen und damit von der Tagesordnung der GA zu setzen. Nur wenn er dies nicht tut oder gemäss Art.11 (2) die Angelegenheit an die GA zurückverweist, darf diese sich wieder damit befassen. Damit diese Nachrangigkeit der GA gegenüber dem SR in der Praxis gewahrt wird, informiert der Generalsekretär die GA gemäss Art.12 (2) über alle Angelegenheiten, die der SR zur Zeit behandelt. Schließlich steht der GA gemäss Art.17 das Haushaltsrecht zu. Dies gilt nicht nur für die UNO selbst. Die GA prüft und genehmigt gemäss Art.17 (3) auch den Haushalt aller Sonderorganisationen, die gemäss Art.57 und Art.63 in Beziehung zur UNO stehen. c. Verbindlichkeit der Entscheidungen Die Beschlüsse der GA werden in die Form von Resolutionen, Deklarationen oder Entscheidungen gekleidet. Da es sich nur um Empfehlungen handelt, sind diese Akte rechtlich unverbindlich. Dies ergibt sich auch eindeutig aus der Entstehungsgeschichte. In San Francisco ist der Vorschlag gemacht worden, der GA die Kompetenz zu geben, verbindliche Rechtsregeln für die Mitgliedstaaten zu schaffen. Dieser Vorschlag ist jedoch ausdrücklich verworfen worden. Verbindlichkeit können Empfehlungen der GA als authentische Interpretation der UN-Charta durch die Mitgliedstaaten erhalten oder wenn die Resolution als Vertrag der Mitgliedstaaten untereinander gedeutet werden kann. Eine authentische Interpretation ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn grundsätzlich alle Mitglieder zustimmen. Dafür genügt allerdings auch eine Entscheidung im Konsensusverfahren. Außerdem muss die Resolution mit dem Willen gefasst worden sein, eine rechtlich 15 verbindliche Interpretation der Charta vorzunehmen. Dies gilt etwa für die friendly relations declaration (GA Res 2625 vom 24.10.1970 und für die definition of aggression (GA Res 3314 vom 14.12.1974), in denen die Mitgliedstaten in der Form einer Resolution der Generalsversammlung zentrale Prinzipien der UN-Charta, wie das Gewaltverbot, das Interventionsverbot, das Selbstbestimmungsrecht der Völker und das Prinzip der souveränen Gleichheit näher umschreiben. Dies ist eine verbindliche nachfolgende Praxis gemäß Art. 31 Abs. 3 lit. b Wiener Vertragsrechtskonvention, die für die Anwendung der Charta durch die Organe der Vereinten Nationen verbindlich ist. Als Vertrag kann eine Resolution nur gedeutet werden, falls der Wille zu Vertragsverhandlungen und zum Vertragsschluss erkennbar ist. Probleme macht hier meist der Rechtsbindungswille. Resolutionen der GA können jedoch zur Vorbereitung von Verträgen Bedeutung erlangen. So ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (GA/Res217 III/1948) in die beiden UN-Pakte über bürgerliche und politische Rechte sowie über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte aus dem Jahr 1966 eingegangen. Eine wichtige Aufgabe bei der Schaffung von Völkervertragsrecht hat auch die International Law Commission (ILC). Die ILC ist ein Unterorgan der UNGeneralversammlung. Ihr gehören 34 unabhängige Völkerrechtler an. Die ILC erstattet Berichte über den Bestand des geltenden Gewohnheitsrechts. Die ILC verfasst dann auf der Grundlage ihrer Berichte Entwürfe über die Kodifizierung von Gewohnheitsrecht. Diese haben etwa zum Abschluss der Wiener Vertragsrechtskonvention, dem Wiener Diplomaten- und Konsularrecht und zur UN Seerechtskonvention geführt. d. Abstimmungsregeln in der Generalversammlung Die Abstimmung in der GA erfolgt gemäss Art.18 (1) nach dem Prinzip one state one vote. In wichtigen Angelegenheiten, die in Art.18 (2) im einzelnen aufgeführt sind, bedürfen Beschlüsse der Mehrheit von Zwei-Dritteln der anwesenden und abstimmenden Mitglieder, relative qualifizierte Mehrheit. Im übrigen kommen gemäss Art.18 (3) Beschlüsse mit der einfachen abstimmenden Mitglieder zustande. Mehrheit der anwesenden und 16 Hat ein Mitglied seine Beiträge für die letzten zwei Jahr nicht bezahlt, verliert es sein Beschlussrecht. II. Der Sicherheitsrat 1. Zusammensetzung Der Sicherheitsrat besteht aus fünfzehn Mitglieder. Fünf davon sind ständige Mitglieder. Dies sind China, Frankreich, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten von Amerika und die russische Föderation. Die Bestimmung über die ständigen Mitglieder ist die Frucht des Zweiten Weltkrieges. Es sind dies zum einen die sogenannten großen Drei, also das UK, die USA und die UdSSR, welche seit der Atlantikcharta 1941 die Hauptlast des Krieges trugen. Hinzu kam auf der Moskauer Konferenz vom Oktober 1943 China und schließlich Frankreich, das 1945 in Potsdam in den Kreis der Hauptsiegermächte und damit auch in den Kreis der in besonderer Weise für die UNO verantwortlichen Mächte aufgenommen wurde. Dies drückt sich auch in Art.106 aus. Die Mitgliedschaft der Republik China war seit 1946 insoweit umstritten, als zwei Regierungen das Vertretungsrecht für sich in Anspruch nahmen. Das sogenannte Kuomintang Regime unter Chiang kai Tchek, das nach dem Sturz des Kaisers (1912) nach inneren Unruhen 1927 endgültig die Herrschaftsgewalt übernommen hatte, musste 1949 das chinesische Festland verlassen und übte von da an nur noch Herrschaftsgewalt über Taiwan aus. Es nahm für sich jedoch weiter in Anspruch, für China als Ganzes zu sprechen. Dies wurde von den Westmächten auch bis 1971 akzeptiert. Dagegen vertraten die UdSSR und ihre Verbündeten seit 1949 den Standpunkt, dass China von dem auf dem Festland an die Macht gekommenen kommunistischen Regime unter Mao tse Tung vertreten werden müsse. Zur Durchsetzung ihres Standpunkts verfolgte die UdSSR im Jahr 1950 im SR die Politik des leeren Stuhls, die es jedoch wegen der Korea Krise nicht durchhalten konnte. Nach dem Bruch zwischen der UdSSR und der Volksrepublik China in den späten fünfziger Jahren und der Annäherung an die USA Anfang der siebziger Jahre beschloss die GA am 25.10 1951 in der GA/Res 2758 (XXVI), das China nunmehr von dem kommunistischen Regime vertreten werde. Taiwan zog unter Protest aus dem SR aus. Wichtig ist, dass es dabei nicht um eine Wechsel in der Mitgliedschaft 17 sondern nur um die Frage ging, welche Regierung das nach wie vor als ungeteilt behandelte China vertreten dürfe. Problematisch ist auch die Mitgliedschaft von Russland im SR. Ursprünglich war dies die UdSSR, die jedoch 1991 in viele Einzelstaaten zerfiel. Russland, Weißrussland und die Ukraine begründen in Minsk die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), auf dem Gipfel in Alma Ata am 21.12.1991 schließen sich Aserbaidschan, Armenien, Kasachstan, Kirgistan, Moldau, Tadschikistan, Turkmenistan, und Usbekistan an (Georgien tritt der GUS im Oktober 1993 bei). Im Innenverhältnis dieser Staaten untereinander wird eine Auflösung der UdSSR verbunden mit der Gründung neuer Staaten angenommen. Dies hätte an sich den Verlust der Mitgliedschaft verbunden mit einem Neuaufnahmeantrag aller Staaten einschließlich der Russischen Föderation nach sich gezogen. Russland hat jedoch gegenüber allen Staaten und der UNO erklärt, dass es der Fortsetzerstaat der UdSSR sei und damit alle Rechte und Pflichten auch bzgl. des ständigen Sitzes im SR wahrnehme. Dies wurde von der UNO kommentarlos zur Kenntnis genommen. Daneben treten zehn nichtständige Mitglieder. Ursprünglich waren es nur sechs. Nachdem durch die Entkolonialisierung die Zahl der Mitglieder in den fünfziger Jahren drastisch anstieg, wurde die Erhöhung jedoch 1965 beschlossen. Die nichtständigen Mitglieder werden von der GA für zwei Jahr gewählt. Dabei sollen gemäss Art.23 (1) der Beitrag der Staaten für den Frieden und eine angemessene geographische Verteilung eine Rolle spielen. In der Praxis wird jedoch nur der zweite Aspekt berücksichtigt. Gemäss einer Resolution der GA von 1963 sollen drei Mitglieder aus Afrika, zwei aus Asien, zwei aus Lateinamerika, zwei aus Westeuropa und anderen Staaten (Australien, Kanada, Israel, Neuseeland und Südafrika) und eines aus Mittel- und Osteuropa kommen. Seit den sechziger Jahren gibt es eine ständige Reformdiskussion um die Zusammensetzung des SR. Die Staaten Afrikas und Asiens verlangen eine Aufstockung auf 16 nichtständige Mitglieder mit einem höheren Kontingent aus diesen Kontinenten. Begründet wird dies damit, dass 1963 die UNO nur 50 Mitglieder hatte, während dies heute 191 sind, wobei der Anstieg vor allem aus diesen Regionen herrührt. Außerdem drängen Deutschland und Japan auf eine ständige Mitgliedschaft. Durch beides würde jedoch die Balance zwischen den ständigen und den nichtständigen Mitgliedern im Rat entscheidend verändert, zur Zeit müssen einer 18 Resolution gemäss Art.27 (3) alle ständigen und vier nichtständige Mitglieder zustimmen. Nach der Reform müssten neun nichtständige Mitglieder zustimmen. Deshalb sträuben sich die ständigen Mitglieder bisher gegen alle Reformversuche. 2. Aufgaben Dem Sicherheitsrat obliegt gemäss Art.24 (1) UN-Charta die Hauptverantwortung für die Wahrung des internationalen Friedens und der Sicherheit. Damit genießt der Sicherheitsrat auf dem Gebiet der Friedenssicherung eine Vorrangstellung vor allen anderen UN-Organen. Das heißt, er kann jede friedensrelevante Angelegenheit an sich ziehen, unabhängig davon, ob ein anderes Organ zuvor mit ihr befasst war oder nicht. Im Verhältnis zum Internationalen Gerichtshof ist jedoch weniger von einem Vorrangverhältnis als vielmehr von einem Nebeneinander verschiedener Aufgaben beider Organe auszugehen. Während der SR als politisch orientiertes Organ Friedenssicherung durch praktische Maßnahmen betreibt, ist es die Aufgabe des IGH streng am Maßstab des geltenden Völkerrechts rechtliche Streitigkeiten zu entscheiden. Dabei ist der IGH durch eine vorherige Befassung durch den SR nicht daran gehindert im Rahmen seiner Kompetenzen einen Fall zu entscheiden und er ist dabei auch nicht an die Rechtsauffassung des SR gebunden. Art.24 (2) beschreibt mit dem Verweis auf Kapitel VI, VII, VIII und XII die Kompetenzen, die dem Rat im einzelnen zur Friedenssicherung eingeräumt sind. Dabei ist diese Aufzählung jedoch nicht abschließend. So steht dem SR etwa nach Art.26 im Rahmen von Kapitel V das Recht zu, Pläne auszuarbeiten, um eine allgemeine Rüstungsregelung durch die Mitglieder zu befördern. Im Rahmen von Kapitel IX hat er nach Art.94 (2) die Kompetenz, Entscheidungen des IGH im Falle der Nichtbefolgung mit Zwangsmassnahmen durchzusetzen. 3. Das Recht zur authentischen Interpretation der Charta Art.24 (2) bindet den SR mit der Wendung „im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen“ materiellrechtlich an die UN-Charta. Eine vergleichbare Formulierung enthält Art.25, der die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Beschlüsse des Sicherheitsrats im Einklang mit dieser Charta anzunehmen und 19 durchzuführen. Diese rechtliche Bindung lässt es fraglich erscheinen, ob dem Rat damit zugleich neben oder anstelle der Mitgliedstaaten ein Recht zur authentischen Interpretation der Charta übertragen worden ist. Dieses Ergebnis klingt in dem von ROBERT LILLICH geprägten Satz an: "The international community is bound by the UN Charter, but the Charter is what (in this case) the Security Council says it is". Der Wortlaut von Art. 24 UN-Charta sowie die Entstehungsgeschichte der Charta machen aber deutlich, dass die Kompetenzen des Sicherheitsrats nicht so weit reichen. Die Wendung im Einklang mit der Charta ist bereits in San Fancisco als eine materiellrechtliche Bindung des SR verstanden worden. Dies ergibt sich aus dem "Summary Report of Thirteeth Meeting of Committee III/" der Gründungskonferenz in San Francisco. Dort wird über einen Ergänzungsantrag Norwegens berichtet, der zum Ziel hat, die Befugnisse des Sicherheitsrats bei der Friedenswahrung inhaltlich zu beschränken. Dieser Antrag findet zwar keine Mehrheit unter den Konferenzteilnehmern. Der Vertreter der Vereinigten Staaten räumt aber ein: "Furthermore, the Charter had to be considered in its entirety and if the Security Council violated its principles and purposes it would be acting ultra vires." Ein ultra vires-Handeln ist aber nur dann denkbar, wenn der Rat nicht kraft eigener Befugnis den Inhalt der Charta durch authentische Interpretation selbst festlegen kann. Er ist vielmehr materiellrechtlich an die "purposes and principles" der Charta, so wie sie von den Staaten als den Herren der Verträge interpretiert werden, gebunden. Wegen des inneren Zusammenhangs mit den Aufgaben des Sicherheitsrats gemäß Art. 24 UN-Charta muss auch die in Art. 25 UN-Charta enthaltene Wendung: "in accordance with the present Charter" so verstanden werden, dass die Mitgliedstaaten nur zur Befolgung solcher Resolutionen verpflichtet sind, die materiell im Einklang mit der Charta stehen. Dies bestätigt auch der "Report of the Rapporteur of Committee IV/". In diesem Bericht, der sich unter Punkt 7 mit der Interpretation der Charta auseinandersetzt heißt es: "It is understood, of course, that if an interpretation made by any organ of the Organization or by a committee of jurists is not generally acceptable it is without binding force. In such circumstances, or in cases where it is desired to establish an authorita- 20 tive interpretation as a precedent for the future, it may be necessary to embody the interpretation in an amendment to the Charter." Der Rat als Organ der Vereinten Nationen ist also bei seiner Auslegung der Charta an den Konsens der Vertragsparteien gebunden. Findet er deren Zustimmung nicht, so betreibt er Vertragsänderung, die grundsätzlich nur durch Vertragsergänzung sanktioniert werden kann, die ihrerseits in den Händen der Vertragsparteien liegt. Weicht der Rat in seiner Anwendung der Charta vom Willen der Vertragsparteien ab, dann handelt er deshalb ultra vires. Seine Beschlüsse sind in diesem Fall materiellrechtlich unwirksam, sie werden als von Anfang an null und nichtig behandelt. Allerdings gibt es nach der Charta kein Verfahren, in dem die Nichtigkeit von den betroffenen Staaten geltend gemacht werden kann. W ENGLER misst deshalb den Feststellungen des Sicherheitsrats vergleichbar einer nicht mehr mit Rechtsmitteln angreifbaren Entscheidung eines internationalen Gerichts Rechtskraft zu. Beschränkt man den oben zitierten Satz von LILLICH auf dieses Problem, so vertritt auch er die Auffassung, dass der Rat verfahrensrechtlich die Herrschaft über die Interpretation der einschlägigen Vorschriften der Charta hat, weil die Entscheidung, ob seine eigenen Beschlüsse ultra vires sind oder nicht, wegen Art. 24 und 25 UN-Charta alleine bei ihm liegt. Dagegen ist SCHILLING der Meinung, dass jeder von einer Maßnahme des Rates betroffene Staat befugt sei, deren Rechtmäßigkeit zu prüfen und, falls er sie für nichtig hält, nicht zu beachten. SCHILLING beruft sich auf die "allgemeinen völkerrechtlichen Grundsätze" und verweist damit auf eine rechtliche Ebene außerhalb der Charta. Er geht dabei davon aus, dass der Konflikt zwischen Rat und Mitgliedstaat wie ein Konflikt zwischen zwei Staaten um die Auslegung eines zwischen ihnen geschlossenen Vertrags zu behandeln ist. Für solche Konflikte gibt es keine verbindlichen verfahrensrechtlichen Regeln der Streitbeilegung, so dass jeder Vertragspartner seinen Rechtsstandpunkt vertreten kann, ohne an Entscheidungen Dritter gebunden zu sein. Für das Verhältnis der Mitgliedstaaten zum Sicherheitsrat gilt dies jedoch wegen Art. 24 und 25 UN-Charta nicht. Dies belegt die Entstehungsgeschichte der Charta. Wegen der Bedeutung des Interventionsverbots als Schranke der Kompetenzen der Organe der Vereinten Nationen macht Griechenland auf der Konferenz von San 21 Francisco den Vorschlag, Streitigkeiten über die Anwendung dieser Vorschrift auf Antrag einer Partei der verbindlichen Gerichtsbarkeit des Internationalen Gerichtshofs zu unterwerfen. In dem Antrag heißt es: "It should be left to the International Court of Justice at the request of a party to decide whether or not such situation or dispute arises out of matters that under international law, fall within the domestic jurisdiction of the State concerned." Dieser Antrag muss vor dem Hintergrund des durch Art. 24 und 25 UN-Charta dem Rat eingeräumten Anwendungsmonopols mit Verbindlichkeitsanspruch gesehen werden. Er stellt den Versuch dar, die von den Bindungen an die Vereinten Nationen freibleibenden Sphären staatlicher Beliebigkeit vor dem verfahrensrechtlich unkontrollierten Zugriff des Sicherheitsrats zu schützen. In San Francisco setzt sich aber die Auffassung der Großmächte durch, dass der Rat in dieser Frage keiner Kontrolle unterliegen soll. Der amerikanische Delegierte DULLES vergleicht das Verhältnis des Sicherheitsrats zu den Mitgliedstaaten insoweit mit dem Verhältnis zwischen der amerikanischen Bundesregierung und den Bundesstaaten. In einem solchen bundesstaatlichen Verhältnis liegt die verfahrensrechtliche Herrschaft zur Bestimmung von Umfang und Grenzen der Bundeskompetenzen bei der Zentralgewalt. Übertragen auf die Charta bedeutet dies, dass der Satzungsgeber in voller Kenntnis des Problems die Verfahrensherrschaft auf den Rat übertragen hat. Der materiellrechtlichen Bindung des Rates an die Charta korrespondiert also kein Recht der Staaten, diese Bindungen im Rahmen der Charta geltend zu machen. Dies deutet auch der Internationale Gerichtshof in seinem Gutachten betreffend "Certain Expenses of the United Nations" (ICJ-Reports 1962, S.151 (168) an, wo er sagt: "Therefore, each organ must, in the first place, determine its own jurisdiction." Wenn allerdings der Sicherheitsrat beharrlich und schwerwiegend die Grenzen seiner Kompetenzen aus der Charta überschreitet, dann hat jedes davon betroffene Mitglied das Recht zum Austritt aus der UNO. Da ein solches Austrittsrecht nicht in der Charta vorgesehen ist, wird es in der Literatur zwar häufig vor allem mit dem Hinweis auf die angestrebte Universalität der UNO abgelehnt. Wie die Entstehungsgeschichte der Charta zeigt, sollte jedoch eine Kündigung entsprechend der clausula rebus sic stantibus-Regel auf jeden Fall möglich sein. Die in San Francisco als zur Kündigung berechtigende exceptional circumstances bezeichneten Umstände sollten etwa 22 dann der vorliegen, wenn (1) die Charta mit der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit in der Generalversammlung gemäß Art.108 UN-Charta gegen den Willen des Austretenden geändert wurde, wenn (2) die Organisation sich nach Auffassung des Betroffenen als unfähig erweist, den Frieden und die Sicherheit zu wahren und wenn (3) der Sicherheitsrat ein Mitglied mit Sanktionsmaßnahmen überzieht, die dieses Mitglied für ultra vires hält. 5. Die Bindungswirkung der Entscheidungen Die in Art.25 angesprochene Bindungswirkung ist zudem nur deklaratorischer Natur. Resolutionen gemäss Kapitel VI UN-Charta, die ausweislich des Wortlauts und der Entstehungsgeschichte rechtlich unverbindlich sein sollen, werden nicht über Art.25 UN-Charta verbindlich. Für die Zwangsmassnahmen gemäss Kapitel VII gilt deshalb etwas anderes, weil Art.48 UN-Charta im Rahmen dieses Kapitels dies so regelt. 6. Die Abstimmung Gemäss Art.27 Abs.1 hat jedes Mitglied im SR eine Stimme. Es gilt also auch hier grundsätzlich der Satz one state one vote. Beschlüsse in Verfahrensfragen bedürfen gemäss Art.27 (2) einer zwei Drittel Mehrheit von neun Mitgliedern im Rat. Damit haben zwar die fünf ständigen Mitglieder zusammen zahlenmäßig die Majorität, sie können jedoch einzeln eine Entscheidung in solchen Fragen nicht blockieren. Zu den Verfahrensfragen gehören alle in den Art.28 bis 32 genannten Aufgaben, also die Vorkehrungen zur ständigen Wahrnehmung der Aufgaben des Rates (Art.28), die Bildung von Nebenorganen (Art.29), die Geschäftsordnung (Art.30 und die Regelungen über die Teilnahme an Sitzungen des Rates (Art.31 und 32). Ist unter den Mitgliedern im Rat streitig, ob es sich bei einer Angelegenheit um eine Verfahrensfrage handelt oder nicht, so greift Art.27 (3) ein. Gemäß Art. 27 (3) UN-Charta a. F. bedürfen alle Entscheidungen des Sicherheitsrates, die nicht Verfahrensfragen betreffen, der Zustimmung von neun 23 Mitgliedern einschließlich des "concurring vote of the permanent members". Der Wortlaut von Art. 27 (3) UN-Charta spricht auf den ersten Blick dafür, dass eine Resolution nur dann zustande kommt, wenn alle fünf ständigen Mitglieder zustimmen. Diese Deutung entspricht auch der Entstehungsgeschichte der Vorschrift. Zu der in Jalta gefundenen Abstimmungsformel erklären die späteren ständigen Mitglieder in einer gemeinsamen Erklärung in San Francisco, dass angesichts der vorrangigen Verantwortung der ständigen Mitglieder für den internationalen Frieden und die Sicherheit nicht erwartet werden könne, dass in einer so ernsten Angelegenheit wie der Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit die Verpflichtung zur Befolgung einer Entscheidung vorausgesetzt werden könne, wenn diese nicht übereinstimmten. Die hervorgehobene Bedeutung einer gemeinsamen Haltung der ständigen Mitglieder für das System der Friedenssicherung der Charta wird auch in Art. 106 UN-Charta deutlich. Nach dieser Vorschrift, die als Übergangsregelung bis zum Inkrafttreten von Sonderabkommen nach Art. 43 UN-Charta gilt, können die ständigen Mitglieder, wenn sie sich einig sind, anstelle des Sicherheitsrates Maßnahmen durchführen, die sie für notwendig halten, um den internationalen Frieden und die Sicherheit aufrechtzuerhalten. In der Praxis des Sicherheitsrates hat sich jedoch von Anfang an eine großzügigere Handhabung von Art. 27 (3) UN-Charta durchgesetzt. Bereits im Jahr 1950 zur Zeit des Koreakrieges, in dem als einzigem Konflikt die Interpretation von Art.27 (3) wirklich umstritten war, zählte man mindestens neunundzwanzig Fälle, in denen Resolutionen als wirksam zustande gekommen behandelt wurden, obwohl ein ständiges Mitglied sich der Stimme enthalten hatte. Nimmt ein betroffenes ständiges Mitglied eine Resolution hin, so liegt zumindest kein ausdrückliches Veto vor. Zudem kann man die Zustimmung für den Fall, dass ein ständiges Mitglied nicht anwesend ist, auch dahingehend deuten, dass das betroffene Mitglied auf das Erfordernis der Anwesenheit aller ständigen Mitglieder verzichtet. Dafür spricht auch, dass Art. 27 UN-Charta über die Regel, dass mindestens neun Mitglieder des Rates für einen Antrag gestimmt haben müssen, hinaus keine Regeln über ein Mindestquorum für die Beschlussfassung im Sicherheitsrat enthält. Im Korea-Konflikt hatte die Sowjetunion, die wegen des Dissenses über die 24 Vertretung Chinas im Rat nicht anwesend war, jedoch gegen das Zustandekommen der Resolutionen 83 und 84 (1950) ausdrücklich protestiert. In einem solchen Fall kann eine Zustimmung zum Verfahren nicht unterstellt werden. Hier liegt es vielmehr näher, die Abwesenheit wie ein Veto zu behandeln. Fraglich ist nur, ob dieses Veto beachtlich ist. Eine Auffassung verneint dies, indem sie auf Art. 28 (1) UN-Charta verweist. Nach dieser Vorschrift ist der Sicherheitsrat so zu organisieren, dass er seine Aufgaben ständig wahrnehmen kann. Deshalb ist jedes seiner Mitglieder gehalten, am Sitz der Organisation vertreten zu sein. Zweck der Vorschrift ist es zu erreichen, dass durch eine Politik des leeren Stuhls der Sicherheitsrat nicht handlungsunfähig gemacht werden kann. Ist ein Mitglied nicht anwesend, verstößt es, die Fälle einer unverschuldeten Abwesenheit einmal ausgeklammert, gegen seine Präsenzpflicht. Ein solcher Verstoß soll dazu führen, dass das abwesende ständige Mitglied nicht die Rechte ausüben darf, die ihm zugestanden hätten, wenn es anwesend gewesen wäre. Seine Abwesenheit wird also als Nichtausübung des Stimmrechts und damit wie eine Stimmenthaltung behandelt. Eine nachträgliche Ausübung des Stimmrechts soll ausgeschlossen sein. Nach dieser Auffassung kann eine Resolution bei Abwesenheit eines ständigen Mitglieds gemäß der anerkannten Praxis über die Stimmenthaltung zustande kommen. Die Gegenansicht hält diese Auslegung für nicht mehr mit dem Wortlaut des Art. 27 (3) UN-Charta vereinbar. Sie leitet aus dem Erfordernis des "concurring vote" ab, dass eine Resolution nur dann zustande kommen kann, wenn ein abwesendes ständiges Mitglied zumindest im nachhinein die ergangene Entscheidung billigt, wobei es aber genügen soll, dass dieses Mitglied nicht ausdrücklich gegen die Rechtsgültigkeit der Resolution protestiert. Die Haltung der Sowjetunion zu den Resolutionen bezüglich Korea muss sie jedoch als beachtliches Veto bewerten. Die Behandlung der Koreakrise im Sicherheitsrat, die zugleich den einzig wichtigen Fall für dieses Problem darstellt, vermag keinen Aufschluss über die Lösung dieses Problems zu geben. Eine aussagefähige Praxis des Sicherheitsrates zu der Frage, ob eine Resolution den Verfahrensvorschriften der Charta entspricht, kann nur dann entstehen, wenn der Meinungsstreit für diese Verfahrensfrage rechtlich irrelevant ist. Weil man aber im vorliegenden Fall auf der Grundlage der abweichenden Meinung der Sowjetunion zu einem anderen Ergebnis kommen muss, ist eine solche Praxis 25 nicht entstanden. Die formale Rechtmäßigkeit der Resolutionen 83 und 84 (1950) muss deshalb als nicht endgültig geklärt angesehen werden. III. Der Wirtschafts- und Sozialrat 1. Zusammensetzung Der Wirtschafts- und Sozialrat besteht gemäss Art.61 aus vierundfünfzig von der Generalversammlung gewählten Mitgliedern. Die Wahl erfolgt entsprechend dem Prinzip der gleichmäßigen geographischen Verteilung. Vierzehn Mitglieder kommen aus Afrika, elf aus Asien, zehn aus Lateinamerika, dreizehn aus Westeuropa und verwandten Staaten und sechs aus Mittel- und Osteuropa. 2. Aufgaben Der ECOSOC ist im Wesentlichen ein Organ zur Lenkung, Überwachung und Koordination. Er kann im Rahmen seines weit gespannten Aufgabenkreises Untersuchungen durchführen, Berichte abgeben und Empfehlungen an die GA oder an Mitgliedstaaten abgeben. Verbindliche Beschlüsse kann er jedoch nicht treffen. Die wesentlichen Aufgaben des ECOSOC liegen gemäss Art.62 auf den Gebieten: Menschenrechte, wirtschaftliche Entwicklung, Kultur, Erziehung und Gesundheit. Die Befassung mit Menschenrechtsfragen ergibt sich unmittelbar aus dem UN-Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte aus dem Jahr 1966. Dieser sieht in den Art.16 ff. vor, dass die Mitglieder regelmäßig Berichte an den ECOSOC schicken, die diesen befähigen, über die Achtung der Menschenrechte in den Mitgliedstaaten und deren Maßnahmen zur Förderung der Menschenrechte sich ein Bild zu verschaffen. Der ECSOC seinerseits kann über das Ergebnis seiner Untersuchungen der GA berichten und dabei Empfehlungen abgeben. Um die vielfältigen Aufgaben auf dem Gebiet des Menschenrechtsschutzes zu koordinieren hat der ECOSOC 1970 in der Resolution 1503 (XLVIII) eine Kommission eingesetzt, an welche Berichte über Menschenrechtsverletzungen gerichtet werden können. Zu dieser Kommission können insbesondere auch sog non governmental organisations (NGO´s) wie Amnesty International u.a. Berichte senden 26 und auch mündlich Stellungnahmen abgeben. Auch nach diesem Verfahren kann der ECOSOC nach Feststellung einer Menschenrechtsverletzung lediglich seinerseits der GA berichten und Empfehlungen abgeben. Rechtlich verbindlich sind diese Empfehlungen nicht. Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit des ECOSOC liegt auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Entwicklung. Dabei steht insbesondere die Betätigung großer multinationaler Unternehmen in Entwicklungsländern in Vordergrund des Interesses. Hierzu hat der ECOSOC 1975 eine Kommission für transnationale Unternehmen eingesetzt, welche einen Verhaltenskodex für solche Unternehmen erarbeitet hat. Auch im Umweltschutz ist der ECOSOC aktiv, der das United Nations Environmental Program koordiniert. Schließlich schließt der ECOSOC gemäss Art.63 Abkommen mit den Sonderorganisationen der UNO auf den Gebieten Wirtschaft, Kultur, Erziehung, Gesundheit und andere verwandte Gebiete. 3. Die Abstimmung Jedes Mitglied des Wirtschafts- und Sozialrats hat gemäss Art.67 (1) eine Stimme. Beschlüsse bedürfen gemäss Art.67 (2) der Mehrheit aller anwesenden und abstimmenden Mitglieder. IV. Der Generalsekretär 1. Wahl Der Generalsekretär steht der Verwaltung der UNO vor. Er wird gemäss Art.97 S.2 i.V.m. Art.18 Abs.3 von der Generalversammlung auf Empfehlung des SR gewählt. Dabei hat im SR jedes ständige Mitglied gemäss Art.27 (3) ein Veto-Recht. Auf der Grundlage eines Beschlusses der GA aus dem Jahr 1946 beträgt die Amtszeit fünf Jahre mit der Möglichkeit zur Wiederwahl. 27 2. Aufgaben Der Generalsekretär leitet das Personal der UN-Verwaltung (ca. 9.000 Bedienstete). Dabei spielen bei der Einstellung des Personals zum einen Leistungsgesichtspunkte und zum anderen eine angemessene geographische Verteilung eine Rolle, die zu dem ersten Kriterium häufig kontraproduktiv ist. Der Generalsekretär und seine Mitarbeiter sind internationale Beamte, d.h. sie sind den Mitgliedstaaten gegenüber nicht an Weisungen gebunden (Art.100) und genießen in den Mitgliedstaaten Immunität und alle sonst zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Vorrechte (Art.105 Abs.2). Der Generalsekretär ist gemäß Art.98 bei allen Sitzungen der anderen Organe anwesend und nimmt alle ihm von diesen Organen zugewiesenen Aufgaben wahr. Der Generalsekretär erstattet gemäss Art.98 S.2 jährlich der GA Bericht über die Tätigkeit der Organisation. Gemäss Art.99 hat der GS das Recht, den Sicherheitsrat auf jede nach seinem Dafürhalten friedensgefährdende Lage hinzuweisen. Von dieser Kompetenz haben insbesondere die GS Dag Hammarskjöld (1953-61) und Boutros Ghali (1992-96) regen Gebrauch gemacht, was auch zu Konflikten mit dem SR geführt hat. Gemäss Art.102 registriert und veröffentlicht der GS alle von den Mitgliedstaaten abgeschlossenen Verträge. V. Der Internationale Gerichtshof 1. Zusammensetzung des Gerichts Der IGH besteht gemäß Art.2 und 3 des Statuts aus 15 unabhängigen Richtern, die alle aus anderen Staaten stammen müssen und die entweder die Voraussetzungen für die höchsten Richterämter in einem Staat erfüllen oder anerkannte Lehrer des Völkerrechts sind. Gemäß Art.9 soll sich das Gericht aus Angehörigen der wichtigsten Kultur- und Rechtskreise zusammensetzen. Zur Auswahl der Richter kann die Liste des ständigen Schiedsgerichtshofs im Haag herangezogen werden. Die Wahl erfolgt gemäß Art.10 durch Generalversammlung und Sicherheitsrat, wobei die ständigen Mitglieder gemäss Art.10 (2) kein Vorzugsrecht haben. Die Richter werden gemäß Art.13 auf neun Jahre gewählt, wobei alle drei Jahre fünf Richter neu gewählt werden. Üblicherweise tagt der IGH im Plenum. Er hat aber gemäß Art.26 auch die Möglichkeit, Kammern von drei oder mehr Richtern zu bilden. 28 2. Zuständigkeit Der IGH ist gemäß Art.92 UN-Charta das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen. Alle Mitglieder der Vereinten Nationen sind gemäß Art.93 (1) UN-Charta Parteien des Statuts über den IGH. Das heißt, alle Mitgliedstaaten können sich des IGH zur Beilegung ihrer Streitigkeiten bedienen. Nichtmitglieder können ebenfalls Partei des Statuts werden, allerdings nur dann, wenn sie gemäß Art.93 (2) die dafür von der Generalversammlung vorgesehenen Bedingungen akzeptieren. Gemäß Art.34(1) IGH-Statut kann der IGH allerdings nur von Staaten angerufen werden. Dabei verpflichten sich die beteiligten Staaten gemäß Art.94 UN-Charta die Entscheidungen des IGH in solchen Fällen, in denen sie Partei sind, zu befolgen. Wird eine Urteilsspruch des IGH von einer Partei nicht befolgt, kann die andere Partei gemäß Art.94 (2) UN-Charta den Sicherheitsrat anrufen, der ggf. sogar Sanktionen zur Durchsetzung der Entscheidung anordnen kann. Die Zuständigkeit des IGH ist gemäß Art.36 IGH-Statut gegeben, für - jede Auslegung eines völkerrechtlichen Vertrages, - jede Frage des Völkerrechts, - das Bestehen einer Tatsache, die wäre sie bewiesen, die Verletzung einer internationalen Verpflichtung darstellte, - Art und Umfang der wegen Verletzung einer internationalen Verpflichtung geschuldeten Wiedergutmachung. Solche Rechtsstreitigkeiten können jedoch nur dann dem IGH vorgelegt werden, wenn - entweder im konkreten Streitfall eine Einigung dahingehend getroffen wird, sog. ad-hoc Vereinbarung (Art.36 Abs.1) - wenn nach Anrufung des IGH durch eine Partei, die andere Partei sich der Gerichtsbarkeit des IGH unterwirft, Art.36 Abs.1 - wenn die Zuständigkeit des IGH für diesen Fall bereits vorher vertraglich vereinbart worden ist (Art.36 Abs.1). Ein praktisch wichtiger Fall hierfür ist Art.IX der Völkermordkonvention, der für alle zwischenstaatlichen Streitigkeiten aus der Konvention die Zuständigkeit des IGH festschreibt. Problem. So hat etwa 1993 Bosnien-Herzegowina Klage gegen die Bundesrepublik Jugoslawien wegen Verletzung der Konvention erhoben. Die 29 Zuständigkeit des IGH war in diesem Fall aber nur gegeben, wenn die Bundesrepublik Jugoslawien identisch ist mit der sozialistischen Bundesrepublik Jugoslawien war, da nur diese Konventionsmitglied war. Der IGH hat im Juli 1996 in einer Vorabentscheidung zur Zulässigkeit festgestellt, dass die Bundesrepublik Jugoslawien sich selbst für identisch hält, was damals zutreffend war und darauf gestützt die Zulässigkeit bejaht. Zur Zeit muss er über einen neuen Antrag Jugoslawiens entscheiden, dass, da es nunmehr die Identitätsthese aufgegeben hat und dies durch Neuaufnahme in die UNO bestätigt worden ist, die Zuständigkeit des IGH in dieser Sache verneint. - oder wenn sich die Parteien generell der Gerichtsbarkeit des IGH unterworfen haben (Art.36 Abs.2). Eine solche generelle Unterwerfungserklärung kann zudem gemäß Art.36 (3) mit Vorbehalten versehen werden, welche bestimmte Arten von Streitigkeiten ausnehmen, wie etwa der von vielen Staaten erklärte Conally-Vorbehalt, der Streitigkeiten, die wesensmäßig zu den inneren Angelegenheiten gehören, ausnimmt. Dabei liegt die Entscheidung darüber, was wesensmäßig zu den inneren Angelegenheiten gehört, allein in der Zuständigkeit der Staaten. Ein zweiter praktisch wichtiger Vorbehalt ist der Vandenberg-Vorbehalt, der ebenfalls auf die USA zurückgeht. Er lässt die Zuständigkeit des IGH bei multilateralen Verträgen nur dann eingreifen, wenn (1) alle Beteiligten eine entsprechende Unterwerfungserklärung abgegeben haben oder (2) die USA in solchen Fällen ausdrücklich zustimmen. Da also im Ergebnis der IGH nur dann zuständig wird, wenn beide Parteien dem zustimmen, hat er im internationalen Rechtsverkehr bisher nur eine untergeordneten Bedeutung gehabt. Die Staaten üben nach wie vor große Zurückhaltung in der Anrufung des IGH, weil sie dann die Verfahrensherrschaft aus der Hand geben und die Berufung auf einseitig vertretene Rechtsstandpunkte an Wirksamkeit verliert. 3. Nichterscheinen einer Partei Erscheint eine Partei nicht zum Verfahren, wie im Teheraner Geiselfall (Iran) und im Nicaragua Case (USA), kann gemäß Art.53 ein Urteil in Abwesenheit ergehen. Dabei muss der IGH jedoch den vorgetragenen Sachverhalt und die rechtliche Argumentation auf ihre Schlüssigkeit hin überprüfen. 30 4 Vorsorgliche Maßnahmen Der IGH kann gemäss Art.41 vorsorgliche Maßnahmen treffen, wenn dies zur Sicherung der Rechte einer Partei geboten ist. So hat er etwa 1979 auf Antrag der USA im Teheraner Geiselfall angeordnet, dass der Iran die in der amerikanischen Botschaft festgehaltenen Geiseln freilassen müsse. Dabei erlässt er solche einstweiligen Maßnahmen jedoch nur dann, wenn seine Zuständigkeit in der Hauptsache überwiegend wahrscheinlich ist. Der Iran hatte an dem Verfahren zwar nicht teilgenommen, die Zuständigkeit des IGH ergab sich jedoch aus Art.13 der Diplomatenschutzkonvention. In der Praxis werden einstweilige Maßnahmen des IGH so gut wie nie befolgt. 5 Urteil Das Verfahren endet nach obligatorischer mündlicher Verhandlung mit einem Urteil. Dabei gibt die Mehrheit der Richter den Ausschlag (Art.55). Abweichende Richter können ihr Votum gesondert veröffentlichen (Art.57). Diese Sondervoten haben gelegentlich eine größere Bedeutung für die Fortentwicklung des Völkerrechts als die Meinung der Mehrheit. Das Urteil wirkt gemäß Art.59 nur inter partes. Es dient jedoch gemäss Art.38 d) IGH-Statut als Hilfsquelle zur Ermittlung des Inhalts von Völkerrecht. Ein Rechtsmittel gibt es gemäß Art.60 nicht. Bestehen zwischen den Parteien Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung einer Entscheidung, kann der IGH angerufen werden mit dem Antrag, die Entscheidung auszulegen. 6. Gutachten Neben dieser Streitentscheidung kann der IGH auch von der Generalversammlung oder vom Sicherheitsrat zur Erstattung von Rechtsgutachten aufgefordert werden. Dabei ist der IGH nicht zur Erstattung solcher Gutachten verpflichtet, er leistet den Anträgen jedoch durchweg Folge. Umgekehrt sind die ersuchenden Organe und die davon betroffenen Staaten nicht an die Empfehlungen des IGH in dem Gutachten gebunden. Ein berühmtes Gutachten hat der IGH 1950 auf Antrag der Generalversammlung im Jahr 1950 erstattet. Es betraf den rechtlichen Status von Südwestafrika (ICJ-Reports 1950, S.127 ff). Südwestafrika wurde gemäß Art. 22 (6) 31 der Satzung des Völkerbundes als sogenanntes C - Mandat im Namen der britischen Krone durch die südafrikanische Union als Mandatar verwaltet. Fraglich war, ob dieses Mandat nach dem Untergang des Völkerbundes weiter fortbestand. Der IGH nahm in seinem Gutachten an, dass dieses Mandat nicht mit einer Beauftragung nach nationalem Recht, die durch den Fortfall des Auftraggebers automatisch erlischt, verglichen werden könne. Durch das Mandat sei ein internationales Regime errichtet worden, das im Interesse der Einwohner des Mandatsgebietes und der Menschlichkeit ganz allgemein bestehe und das von allen Mitgliedstaaten des Völkerbundes einschließlich des Mandatars anerkannt worden sei. Dieser internationale Status des Mandatsgebiets erzeuge Rechte und Pflichten, die unabhängig vom Fortbestehen des Völkerbundes seien. C. Das Verhältnis der UNO zu Nichtmitgliedern I. Die Praxis der UNO Der Sicherheitsrat befasst sich nicht nur mit solchen Konflikten, an denen ausschließlich Mitglieder beteiligt sind, sondern er bezieht auch das Verhalten von Nichtmitgliedern in seine Aktivitäten mit ein. Im Spanienkonflikt 1946 und in Grenzkonflikt zwischen Griechenland und seinen nördlichen Nachbarn 1947 wird die Frage diskutiert, ob die Regeln von Kapitel VII UN-Charta auch auf Nichtmitglieder anwendbar sind. Im Koreakonflikt 1950 bis 1953 erlässt der Rat dann erstmals Zwangsmaßnahmen gegen ein Nichtmitglied (Nordkorea), was er im Jugoslawienkonflikt ab 1992 wiederholt, wo er die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) in Anspruch nimmt, die gemäß einer von ihm selbst erlassenen Resolution bis zum Jahr 200 nicht Mitglied der UNO war. Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob der Rat berechtigt ist, Nichtmitglieder insoweit in Anspruch zu nehmen, als sie zur Beachtung verbindlicher Zwangsmaßnahmen gegen dritte Staaten verpflichtet werden. Diese Frage spielt insbesondere bei wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen gestützt auf Art. 41 UNCharta eine Rolle. Die Mitgliedstaaten sind gemäß Art. 25 i.V.m. Art. 48 (1) UNCharta verpflichtet, diese Embargomaßnahmen zu befolgen, das heißt, sie dürfen in dem von der jeweiligen Resolution beschriebenen Umfang keinen wirtschaftlichen 32 Kontakt mehr mit dem von der Sanktion betroffenen Staat pflegen. Im Verhältnis zu Nichtmitgliedern hat die Praxis sich insoweit geändert. In der ersten Embargoresolution 232 (1966) im Falle Süd-Rhodesiens werden die Staaten noch rechtlich unverbindlich ersucht, in Einklang mit dieser Resolution zu handeln. Ein entsprechendes Ersuchen findet sich auch in der Resolution 253 (1968), in der das gegen Südrhodesien verhängte Embargo ausgeweitet wird. Der Wandel in der Auffassung des Sicherheitsrats erfolgt in der Resolution 418 (1977) betreffend Südafrika. Dort fordert der Rat auch solche Staaten, die nicht Mitglieder der Vereinten Nationen sind, auf, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Resolution zu handeln. Diese Aufforderung versteht der Rat als rechtlich verbindliche Verpflichtung und nicht nur als moralischen Appell. Diese Praxis führt der Rat in den Resolutionen 661 (1990) zum Irak-Kuwait-Konflikt und in vielen weiteren Resolutionen fort. II. Rechtsgrundlagen Im Verhältnis des Sicherheitsrates zu Nichtmitgliedern der Vereinten Nationen kommt Art. 2 (6) UN-Charta eine zentrale Bedeutung zu. Nach dieser Vorschrift stellt die Organisation sicher, dass Nichtmitglieder in Übereinstimmung mit den Prinzipien der Charta handeln, soweit dies für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit notwendig ist. Ob diese Bestimmung es rechtfertigt, dass Resolutionen gegen Nichtmitglieder erlassen werden können, die diesen Verpflichtungen auferlegen oder sie gar zum Adressaten von Zwangsmaßnahmen machen, ist jedoch zweifelhaft. Aus der Charta selbst sind bereits einige Erkenntnisse zu gewinnen, welche diese Praxis in Frage stellen. Dabei muss man zwischen der Bindung an die Verfahrensherrschaft des Sicherheitsrats gemäß Kapitel VII UN-Charta einerseits und der materiellrechtlichen Bindung an die in Art. 2 (6) UN-Charta angesprochenen Prinzipien andererseits unterscheiden. Eine Verfahrensherrschaft des Sicherheitsrats gegenüber Nichtmitgliedern lässt sich unabhängig davon, ob diese Adressat einer Zwangsmaßnahme sind oder ob sie nur zu deren Beachtung verpflichtet werden sollen, aus dem Wortlaut der Charta schlicht nicht ableiten. Sowohl Art. 25 wie auch Art. 48 UN-Charta wenden sich ausdrücklich nur an Mitglieder der Vereinten Nationen. Der gegenteilige Schluss ergibt sich auch nicht aus Art. 2 (6) UN-Charta. 33 Danach ist nur die Organisation verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass Nichtmitglieder sich an die dort genannten materiellrechtlichen Prinzipien halten. Von einer Bindung der Nichtmitglieder ist dort nicht die Rede. Vielmehr lässt sich aus Art. 35 (2) UN-Charta in bezug auf die Verfahrensherrschaft des Sicherheitsrats der gegenteilige Schluss ziehen. Nach dieser Vorschrift hat ein Nichtmitglied die Möglichkeit, Konflikte, an denen es beteiligt ist, dem Rat zu unterbreiten. Voraussetzung dafür ist aber: "if it accepts in advance for the purpose of the dispute the obligations of pacific settlement provided in the present Charter". Die Verfahrensherrschaft des Sicherheitsrats gemäß Kapitel VI UN-Charta erstreckt sich also nur dann auf Nichtmitglieder, wenn diese ausdrücklich zustimmen. Sie sind damit nicht aus Art. 2 (6) i.V.m. Art. 2 (3) UN-Charta von vornherein an ein solches Verfahren gebunden. Wenn diese Respektierung des Willens von Nichtmitgliedern schon für das Verfahren der friedlichen Streitbeilegung gilt, dann muss es erst recht für Kapitel VII UN-Charta gelten, da dort die Inanspruchnahme von Nichtmitgliedern noch weit intensiver ist. Schließlich lässt auch das in San Francisco unbestrittene Recht zum Rückzug aus der Organisation nur den Schluss zu, dass damit die Bindung an die Verfahrensherrschaft endet. Wenn ein Mitgliedstaat sich aus der Organisation zurückziehen kann, weil die damit einhergehenden Verpflichtungen wegen des Eingreifens von "exceptional circumstances" für ihn nicht mehr akzeptabel sind, dann würde dieses Recht ins Leere laufen, wenn dieselben Bindungen den Staat über Art. 2 (6) UN-Charta auch als Nichtmitglied treffen würden. Die Bindungen aus Art. 2 (6) UN-Charta können deshalb allenfalls materiellrechtlicher Natur sein. Die Nichtmitglieder könnten unter Umständen an die in Art.2 genannten materiellen Rechtsprinzipien gebunden sein. Aber auch insoweit bestehen bereits entsprechend dem Wortlaut der Charta Grenzen, die der Sicherheitsrat nicht immer beachtet. Das beste Beispiel dafür ist der Jugoslawienkonflikt. Dort wird in der Resolution 827 (1993) ein internationales Tribunal für die Aburteilung solcher Personen eingerichtet, die gegen sogenanntes Völkerstrafrecht verstoßen. Dieses Tribunal erstreckt sich als Zwangsmaßnahme des Sicherheitsrats auf das Territorium des ehemaligen Jugoslawien und richtet sich 34 damit auch gegen die Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien und Montenegro), die kein Mitglied der Organisation ist. Der Art. 2 (6) UN-Charta erfasst Nichtmitglieder aber nur insoweit, als es um die Beachtung der in Art. 2 UN-Charta aufgeführten Prinzipien geht. Dazu gehören die Menschenrechte, die in Art. 1 (2) und Art. 55 UN-Charta genannt sind, nicht. Deshalb kann der Sicherheitsrat die Bundesrepublik Jugoslawien nicht auf die Beachtung der Menschenrechte verpflichten. Dagegen kann man auch nicht mit DOEHRING einwenden, dass gewaltsame Verstöße gegen die Menschenrechte den Tatbestand des Art. 2 (4) UN-Charta erfüllen, weil darin auch auf die Ziele der Charta Bezug genommen wird. Die Nichtmitglieder sind, wie GRAF VITZTHUM gezeigt hat, nicht an die Prinzipien des Art. 2 UN-Charta, sondern nur an das allgemeine Völkerrecht gebunden. Nur soweit dieses mit den Prinzipien des Art. 2 UN-Charta übereinstimmt, müssen sie Maßnahmen des Sicherheitsrats dulden. Nichtmitglieder sind also nicht an Art. 2 (4) UN-Charta, sondern nur an das gewohnheitsrechtliche Gewaltverbot gebunden. Diese Unterscheidung ist nicht von rein akademischem Interesse. Immerhin stellt der Internationale Gerichtshof in dem "Case concerning Military and Paramilitary Activities in an against Nicaragua" zu dem Verhältnis zwischen dem gewohnheitsrechtlichen und dem vertraglichen Gewaltverbot fest: "On a number of points, the areas governed by the two sources of law do not exactly overlap, and the substantive rules in which they are framed are not identical in context." Insbesondere weist das gewohnheitsrechtliche Gewaltverbot keinen ausdrücklichen Bezug zu den Zielen der Charta der Vereinten Nationen auf. Deshalb bedürfte es des Nachweises, dass auch gewohnheitsrechtlich jeder gewaltsame Verstoß gegen die Menschenrechte den Tatbestand des Gewaltverbots auslöst. Ob sich das gewohnheitsrechtliche Gewaltverbot parallel zum satzungsrechtlichen Gewaltverbot so weit entwickelt hat, ist so gut wie nicht festzustellen, weil die Praxis der Staaten unter der Geltung der Charta sich durchgängig auf Art. 2 (4) UN-Charta bezieht. III. Die pacta tertiis-Regel 35 Bei der materiellrechtlichen Anwendung von Art. 2 (6) UN-Charta ist zudem zu beachten, dass weder der Rekurs auf den Willen des Satzungsgebers noch die nachfolgende Praxis des Sicherheitsrats die damit aufgeworfenen Fragen abschließend lösen kann. Das Verhältnis der Vereinten Nationen zu Drittstaaten lässt sich wegen der Beschränkung der Wirkungen des Vertrags auf seine Mitglieder nicht mit dem Willen der Vertragsparteien begründen. Art. 2 (6) UN-Charta muss insoweit an dem Rechtssatz pacta tertiis nec nocent nec prosunt gemessen werden. Diese Regel besagt, dass völkerrechtliche Verträge als solche für einen Drittstaat ohne dessen Zustimmung weder Pflichten noch Rechte erzeugen können und deshalb "res inter alios acta" sind. Die pacta tertiis-Regel ist ein konstituierendes Element der Unterscheidung von Völkervertragsrecht und Völkergewohnheitsrecht, indem sie für das Vertragsrecht die Geltung auf die Vertragsparteien beschränkt. Sie ist zugleich eine Folge der Anerkennung der Souveränität der Staaten, da die Geltung völkervertraglicher Regeln alleine von dem durch den Vertragsschluß bekundeten Willen der Staaten abhängig gemacht wird. Die pacta tertiis-Regel gilt nach einhelliger Auffassung als Satz des Völkergewohnheitsrechts und hat zudem Eingang in Art. 34 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge gefunden, der bestimmt, dass ein Vertrag für einen Drittstaat ohne dessen Zustimmung weder Pflichten noch Rechte begründen kann. Allerdings ist die Wiener Vertragsrechtskonvention ratione temporis nicht auf die Charta anwendbar. Wie diese Regel auf die Auslegung von Art. 2 (6) UN-Charta einwirkt, hängt insbesondere davon ab, welche Rechtsnatur man für die Charta der Vereinten Nationen annimmt. Die Charta ist ihrem Entstehungsgrund nach ein mehrseitiger völkerrechtlicher Vertrag. Deshalb scheint es zwingend zu sein, die pacta tertiisRegel anzuwenden und die Rechtswirkungen von Art. 2 (6) UN-Charta auf die Mitglieder der Vereinten Nationen zu beschränken. Eine Gegenmeinung hebt dagegen im Vollzug der Organisation auf ihren Charakter als Satzung oder gar Verfassung einer Organisation mit weltumspannendem Anspruch ab und gewinnt dadurch einen Anknüpfungspunkt dafür, die pacta tertiisRegel zu umgehen. Mit dieser Begründung behauptet KELSEN, dass wegen Art. 2 (6) UN-Charta den Regeln der UN-Charta eine Rechstwirkung erga omnes zukomme und dass der Sicherheitsrat deshalb ermächtigt sei, bindende Beschlüsse gegen 36 Nichtmitglieder auf der Grundlage der Charta zu erlassen. Die von KELSEN vertretene Auffassung ist bereits in ihrem theoretischen Ausgangspunkt fragwürdig, weil sie im geltenden Völkergewohnheitsrecht keine Grundlage findet. KELSEN gibt dies selbst zu, wenn er feststellt, dass seine Auffassung gemessen am geltenden Völkerrecht revolutionär ist. Sie bereitet für die Befugnisse des Sicherheitsrates nach Kapitel VII UN-Charta besondere Probleme, weil darin einigen Staaten dieser Organisation die Kompetenz zur Verhängung von Zwangsmaßnahmen übertragen worden ist, was ohne Akzept des jeweils Betroffenen dessen Souveränität empfindlich berührt. Wendet man wegen dieser Bedenken die pacta tertiis-Regel auf die Charta der Vereinten Nationen an, muss man für die Geltung gegenüber Nichtmitgliedern eine Begründung auf der Ebene des Völkergewohnheitsrechts finden. Nach einer weit verbreiteten Ansicht sollen die Prinzipien der Charta nicht nur als Vertragsrecht auf der Grundlage der Charta, sondern auch als Gewohnheitsrecht gelten und deshalb auch für Nichtmitglieder verbindlich sein. Das bedeutet, dass die Beschlüsse des Sicherheitsrates für Nichtmitglieder nicht deshalb völkerrechtlich beachtlich sein sollen, weil die Charta etwa in Art. 25 deren Verbindlichkeit anordnet, sondern weil die Vereinten Nationen dabei Rechte in Anspruch nehmen, die ihnen nach allgemeinem Völkerrecht zustehen. Beschränkt man somit das Verhältnis der Vereinten Nationen zu Drittstaaten auf die Ebene des Völkergewohnheitsrechts, kann man, wie dies GRAF VITZTHUM tut, den Art. 2 (6) UN-Charta als eine gegen Drittstaaten gerichtete Bündnisklausel der Vereinten Nationen verstehen, deren vertragliche Wirkungen sich nur im Innenverhältnis zu den Mitgliedstaaten entfalten. Nur die Mitgliedstaaten werden aus Art. 2 (6) UN-Charta vertraglich verpflichtet, die Einhaltung der Prinzipien der Charta sicherzustellen. Diese Konzeption ist aber nicht auf alle in Art. 2 UN-Charta genannten Prinzipien gleichermaßen anwendbar. Die in Art. 2 (3) und (4) genannten Prinzipien der friedlichen Streitbeilegung und des Gewaltverbots können sicherlich den Anspruch auf gewohnheitsrechtliche Geltung erheben. Dagegen ist die aus Art. 2 (5) UN-Charta den Mitgliedstaaten erwachsende Pflicht zur Unterstützung des Sicherheitsrates wegen ihres spezifischen Bezuges zur Charta nicht als Satz des Völkergewohnheitsrecht auf Nichtmitglieder anwendbar. Wenn man die Nichtmitglieder nur an die im Völkergewohnheitsrecht verankerten 37 Prinzipien der Charta bindet, ist es zudem denkbar, dass der Umfang der aus dem VII. Kapitel folgenden Verpflichtungen für diese Staaten ein anderer ist als der Umfang der Pflichten von Mitgliedstaaten. Dies gilt zum einem bezüglich des Inhalts dieser Prinzipien. So ist es denkbar, dass das Gewaltverbot völkergewohnheitsrechtlich einen anderen Inhalt als gemäß Art. 2 (4) UN-Charta hat. Dieser unterschiedliche Inhalt kann sich insbesondere daraus ergeben, dass die Charta als eine Gesamtheit von Regelungen bei systematischer Auslegung unter Umständen dem Art. 2 (4) UN-Charta Aspekte hinzuzufügen vermag, die dem lediglich fragmentarischen und an der Einzelfallpraxis orientierten Völkergewohnheitsrecht fremd sind. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Rat bei seiner Entscheidung, gemäß Kapitel VII UN-Charta tätig zu werden, das Vorliegen der Voraussetzungen von Art. 39 UN-Charta und nicht einen Verstoß gegen die in Art. 2 UN-Charta genannten Prinzipien feststellen muss. Probleme können daraus insbesondere bei der Beurteilung innerer Vorgänge von Staaten entstehen, die zwar keine Verletzung des zwischenstaatlichen Gewaltverbots wohl aber eine Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit darstellen können. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass innerstaatliche Vorgänge auch der Idee von der Bündnisklausel keinen Raum geben. Wenn eine Bedrohung oder ein Bruch des Friedens gemäß Art. 39 UN-Charta nur im Zusammenhang mit zwischenstaatlichen bewaffneten Konflikten diskutiert wird, ist völkergewohnheitsrechtlich der Rückgriff auf Art. 2 (4) UN-Charta eröffnet. Wenn man aber, wie dies etwa im Kosovo der Fall war, aus einer Verletzung der Menschenrechte eine solche Bedrohung ableiten will, kann der Sicherheitsrat nicht geltend machen, dass er die Belange seiner Mitglieder gegen eine Bedrohung durch ein Nichtmitglied schützt. Er muss sich dann ganz allgemein zum Anwalt des Schutzes der Menschenrechte überall auf der Welt machen. Ob insoweit der Praxis des Sicherheitsrates gewohnheitsbildende Kraft auch für Drittstaaten zukommt, kann nur im einzelnen Fall unter Berücksichtigung der Haltung der betroffenen Nichtmitglieder beantwortet werden. Diese Haltung kann nach der von KLEIN entwickelten Vorstellung von der besonderen Wirkung von Statusverträgen bedeutsam werden. Unter Statusverträgen versteht KLEIN solche Verträge, welche Zuständigkeiten von Staaten oder internationalen Organisationen 38 erzeugen, die den Anspruch erheben, eine gemeinwohlorientierte und deshalb allgemeinverbindliche Ordnungsfunktion wahrzunehmen. KLEIN lehnt zwar auch im Hinblick auf Art. 2 (6) UN-Charta eine Wirkung erga omnes solcher vertraglich begründeten Zuständigkeiten ab, er vertritt aber die These, dass durch Konsens, nämlich durch unter Umständen auch nur stillschweigend zum Ausdruck gebrachte Zuerkennung einer Zuständigkeit, eine Bindungswirkung eintreten kann. Für die Mitgliedstaaten erfolgt die Zustimmung bereits durch den Beitritt zur Charta, wodurch sie die Kompetenz des Sicherheitsrates, im Rahmen der ihm nach der Charta übertragenen Befugnisse Maßnahmen zu erlassen, anerkannt und sich zu deren Befolgung verpflichtet haben. Für sie entsteht nur die Frage, ob der Rat innerhalb dieser von der Charta vorgesehenen Kompetenzen oder ob er ultra vires handelt. Für Nichtmitglieder sieht Art. 32 UN-Charta lediglich das auch jedem Mitglied gemäß Art. 31 UN-Charta zustehende Recht vor, zu solchen Verhandlungen, bei denen sie Streitpartei sind, eingeladen zu werden. Dabei haben Nichtmitglieder jedoch kein Stimmrecht. Das bedeutet, dass sie sich einer vertraglich nicht konsentierten und im Verfahren nicht beeinflussbaren Entscheidung unterwerfen müssen. Für Nichtmitglieder kann deshalb im Sinne KLEINS über den strengen Maßstab der Bindung an die völkergewohnheitsrechtlich gesicherten Prinzipien hinaus eine Verpflichtung zur Befolgung von Beschlüssen des Rates allenfalls dann eingreifen, wenn ihr Verhalten eindeutig den Schluss darauf zulässt, dass sie der vom Rat reklamierten rechtlichen Verbindlichkeit ausdrücklich zustimmen. Dies ist allerdings schon deshalb häufig zu beobachten, weil die betroffenen Neustaaten ein Interesse an späterer Mitgliedschaft in der UNO haben. C. Die Feindstaatenklausel Gemäss Art.107 soll die UN-Charta keine Maßnahmen behindern oder ausschließen, die als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges von den dafür zuständigen Staaten gegen die Feindstaaten der Signatarmächte der UN-Charta durchgeführt werden. Gemäss Art.53 gilt dies auch für entsprechende Maßnahmen von regionalen Systemen kollektiver Sicherheit. 39 I. Anwendungsbereich: Feindstaaten waren gemäß Art.53 (2) alle Staaten, die Feinde der Signatarmächte der UN-Charta waren. Dies galt insbesondere für Deutschland, Japan und Italien, aber auch für Bulgarien, Finnland, Rumänien und Ungarn. Korea gehörte zwar 1945 noch zum Feindstaat Japan, nach der Befreiung durch die Siegermächte im Sommer 1945 war dieser Status jedoch beendet und die Feindstaatenklausel fand keine Anwendung mehr. Dasselbe gilt für Österreich, das 1939 vom Deutschen Reich annektiert worden war und nach seiner Befreiung durch die Alliierten ebenfalls nicht mehr zu den Feindstaaten gehörte. Thailand erklärte zwar 1942 dem Vereinigten Königreich den Krieg, widerrief im August 1946 diese Erklärung jedoch diese Erklärung, was zur formellen Beendigung des Kriegszustandes im Januar 1946 führte. II. Dauer des Status als Feindstaat Fraglich war, ob der Status als Feindstaat mit der Aufnahme in die Vereinten Nationen endete. Dafür spricht, dass alle Mitglieder ein Recht darauf haben sollten, nur nach den Regeln der UN-Charta behandelt zu werden. Die weitere Anwendung der Feindstaatenklausel hätte dazu geführt, dass Mitgliedschaften mit verschiedener rechtlicher Reichweite entstanden wären. Insbesondere Art.2 (1) wäre auf diese Staaten dann nur unvollständig anwendbar gewesen. Dafür spricht auch, dass gemäss Art.4 (1) nur friedliebende Staaten in die UNO aufgenommen werden können, was gegen die Behandlung als aggressiver Feindstaat spricht. Insbesondere Japan und Deutschland haben diesen Standpunkt nach ihrer Aufnahme in die UNO vertreten. Auch Vertreter der Siegermächte haben diese Haltung bei Entstehung der UN-Charta geäußert. Dagegen spricht, dass die Rechte der Alliierten Hauptsiegermächte in Bezug auf Deutschland und Japan nach der Aufnahme dieser Staaten in die UNO nicht erloschen sind. Vor dem Beitritt beider deutscher Staaten haben die Siegermächte dies in einer Erklärung vom 9.11.1972 ausdrücklich bestätigt. Die Rechte in Bezug auf Deutschland sind erst durch den Zwei-plus-Vier-Vertrag im Jahr 1990 beendet worden. Ab diesem Zeitpunkt ist der Status in Bezug auf Deutschland endgültig weggefallen. 40 III. Rechtsfolge der Feindstaatenklauseln Die Siegermächte und ihre regionalen Sicherheitssysteme waren durch Art.53 und 107 nicht gehindert, Gewalt gegen die Feindstaaten zu üben, um ihre Rechte durchzusetzen. Art.2 (4) fand insoweit keine Anwendung. Konflikte zwischen den Siegermächten und den Feindstaaten konnten nicht nach den Kapiteln VI bis VIII UN-Charta behandelt werden. Dies hat eine Rolle gespielt, als die Sowjetunion 1948 die Landverbindungen nach Berlin unterbrach, um die Westsektoren der Stadt, die von den USA, UK und Frankreich verwaltet wurden, in ihre Gewalt zu bringen. Der Konflikt hatte grob gesprochen folgenden Hintergrund. IV. Berlin-Krise Grob skizziert kann man sagen, dass der Status des Deutschen Reiches nach 1945 durch das Besatzungsrecht der Alliierten Siegermächte geprägt ist. Deutschland wird durch die militärische Niederwerfung und anschließende Besetzung nach dem ausdrücklich erklärten Willen der Alliierten nicht annektiert, sondern besteht als Staat fort. Die auf seinem Staatsgebiet wirksame Hoheitsgewalt wird von den Alliierten Hauptsiegermächten Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Sowjetunion und Frankreich ausgeübt, die ihren Rechtsanspruch zur Verwaltung Deutschlands auf ein unmittelbar aus der militärischen Besetzung abgeleitetes Besatzungsrecht stützten. Grundlage für das Besatzungsrecht ist das in der "Advisory Commission for Europe" erarbeitete "Protocoll between the Governments of the United States of America, the United Kingdom, and the Union of the Soviet Socialist Republics on the zones of occupation in Germany and the administration of Greater Berlin", das am 12. September 1944 verabschiedet wird und das am 6. Februar 1945 in Kraft tritt. Darin vereinbaren die Vertragsparteien, dass Deutschland in drei Zonen eingeteilt werden soll, die jeweils von einem der Alliierten besetzt werden soll. Dagegen soll die Besetzung Groß-Berlins durch alle drei Mächte gemeinsam erfolgen. Nach der militärischen Kapitulation des Deutschen Reiches am 8. Mai 1945 übernehmen die Alliierten Hauptsiegermächte, zu denen nun auch Frankreich gehört, durch eine gemeinsame Erklärung am 5. Juni 1945 die oberste Regierungsgewalt 41 ("supreme authority") in Deutschland. In einer weiteren Erklärung vom 5. Juni 1945 legen die Hauptsiegermächte fest, wer die oberste Regierungsgewalt ausüben soll. In den einzelnen Zonen steht sie der jeweiligen Besatzungsmacht zu, in allen Deutschland als Ganzes betreffenden Angelegenheiten soll die oberste Regierungsgewalt von den vier Alliierten Hauptsiegermächten gemeinsam ausgeübt werden. Groß-Berlin soll von einer Interalliierten Behörde ("Inter-Allied Governing Authority") verwaltet werden, die unter der Leitung des von den vier Oberbefehlshabern gebildeten Kontrollrates ("Control Council") arbeiten und aus vier sich im Vorsitz abwechselnden Kommandanten bestehen soll. Die Ziele des Besatzungsstatuts werden im Protokoll über die Potsdamer Konferenz vom 2. August 1945 festgelegt. Die Vertreter des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion kommen darin überein, einen Rat der Außenminister einzurichten, dem auch die Außenminister Frankreichs und Chinas angehören sollen. Dieser Rat der Außenminister soll insbesondere eine Friedensregelung für Deutschland vorbereiten. Für die bis dahin auszuübende Verwaltung Deutschlands durch den Kontrollrat werden in dem Protokoll politische und wirtschaftliche Grundsätze festgelegt. Die Gründe, die zum Streit der Alliierten um Berlin und schließlich zur Blockade führen, haben ihren Ursprung bereits in der Begründung des Besatzungsstatuts. Berlin wird im April 1945 zunächst nur von den Truppen der Sowjetunion besetzt. Die Truppen der Westmächte folgen erst im Juli 1945 nach, und Berlin wird daraufhin in vier Sektoren aufgeteilt, die jeweils von einer der Siegermächte verwaltet werden. Die nach dem Einzug der Westmächte errichtete Interalliierte Behörde, die sog. Kommandatura, erweist sich für die weitere Verwaltung der Stadt sehr schnell als wirkungslos, weil sie ihre Beschlüsse nur einstimmig fassen kann. Insbesondere ist sie nicht in der Lage, die von der sowjetischen Verwaltung zuvor bereits angeordneten Maßnahmen wieder außer Kraft zu setzen. Der sachliche Grund hierfür ist ein ab Mitte 1946 ständig sich vertiefender Dissens in der Deutschlandpolitik der Alliierten. Um den wirtschaftlichen Aufschwung in ihren Zonen zu beschleunigen, vereinigen die Westmächte auf dem Gebiet der späteren Bundesrepublik zunächst die amerikanische und die britische Zone zur sogenannten Bizone und später mit der französisch besetzten Zone zur sogenannten Trizone. Kernpunkt der wirtschaftlichen Maßnahmen ist eine Währungsreform, die im Juni 42 1948 auch in den Westsektoren Berlins durchgeführt wird. Die Sowjetunion widersetzt sich dieser Politik und beharrt insbesondere auf ihren Reparationsforderungen, die sie in der Ostzone rigoros durchsetzt. Gleichzeitig beginnt sie mit einer tiefgreifenden politischen und ökonomischen Umgestaltung ihrer Zone, die auf die Schaffung einer zentral gelenkten, marxistisch orientierten Einheitsverwaltung zielt. Auf der Londoner Außenministerkonferenz vom 21. November bis zum 15. Dezember 1947 kommt es zum endgültigen Bruch zwischen den Alliierten Hauptsiegermächten. Am 20. März 1948 tritt die UdSSR aus dem bedeutungslos gewordenen Alliierten Kontrollrat aus. Parallel zu dieser Entwicklung unternimmt die UdSSR seit 1947 den Versuch, ganz Berlin unter ihren Einfluss zu bringen und der von ihr verwalteten Ostzone anzugliedern. Sie erlässt am 30. März 1948 verschärfte Bestimmungen für den Verkehr durch die sowjetisch besetzte Zone und schließt am 24. Juni 1948 die Strecke Berlin-Helmstedt, wodurch die Landverbindung Berlins zu den Westzonen Deutschlands vollständig unterbrochen wird. Außerdem wird die Strom- und Kohlelieferung nach West-Berlin eingestellt. Bereits zuvor hat der sowjetischen Vertreter am 16. Juni 1948 die alliierte Kommandatura verlassen. Die Vereinigten Staaten reagieren mit der Errichtung einer Luftbrücke nach Berlin, auf der ab dem 25. Juni 1948 insbesondere Lebensmittel in die Stadt transportiert werden. In einer Note vom 6. Juli 1948 protestieren die Westmächte gegen die Blockademaßnahmen. Sie bezeichnen die dadurch entstandene Situation als äußerst ernste internationale Lage. Die Sowjetunion verstoße damit gegen die Rechte der Westalliierten, welche als Folge der totalen Niederlage und der unbedingten Kapitulation Deutschlands die Verwaltung der ihnen unterstellten Sektoren Berlins und den freien Zugang dorthin beinhalteten. Die USA haben die Angelegenheit vor den Sicherheitsrat gebracht mit dem Argument, in der Berlin-Krise ginge es nicht um Rechte der Siegermächte gegen Deutschland sondern um Recht der Alliierten untereinander auf Einhaltung der festgelegten Verwaltungsgrenzen. Die UdSSR behauptete dagegen, diese Verwaltungsrechte seien eine Folge des Zweiten Weltkrieges und deshalb sei der Streit wegen Art.107 aus der Zuständigkeit des Sicherheitsrats ausgenommen. Ein Resolutionsantrag der USA scheiterte am Veto der UdSSR. 43 Die Unterbrechung der Verkehrswege von und nach Berlin und die daraufhin errichtete Luftbrücke der Westalliierten dauern noch bis ins Jahr 1949 an. Im Februar 1949 nehmen die Delegierten der UdSSR und der Vereinigten Staaten MALIK und JESSUP Verhandlungen auf, die zu einer Annäherung der Streitparteien führen. Am 4. Mai 1949 verabschieden die vier Besatzungsmächte dann ein Kommuniqué, in welchem geregelt wird, dass alle Verkehrsbeschränkungen zwischen Berlin und den übrigen Besatzungszonen am 12. Mai 1949 enden sollen. Allerdings bleibt bis zum Abschluss des Viermächte-Abkommens vom 3. September 1971 zwischen den Westmächten und der Sowjetunion umstritten, ob das in diesem Kommuniqué vereinbarte Zugangsrecht sich nur auf den militärischen oder auch auf den nichtmilitärischen Verkehr von und nach Berlin erstreckt. Kapitel 3: Die Friedenssicherung A. Das Verfahren der friedlichen Streitbeilegung I. Die Pflicht zur friedlichen Streitbeilegung (Art.2 Ziff.3) Die Pflicht zur friedlichen Streitbeilegung hat eine Doppelnatur. Zum einen gilt sie im Verhältnis der Mitgliedstaaten untereinander. Die Staaten sind gehalten, in ihrem Verhältnis untereinander Konflikte nur mit friedlichen Mitteln beizulegen. Das bedeutet auf jeden Fall, dass eine Rechtspflicht besteht, keine Gewalt in den internationalen Beziehungen anzuwenden, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Insoweit überschneiden sich das Gebot der friedlichen Streitbeilegung gemäß Art.2 (3) und das Gewaltverbot gemäß Art.2 (4) UN-Charta. Einzelheiten zum Gewaltverbot. Dies gilt auch, wenn die Staaten auf völkerrechtswidrige Akte anderer Staaten reagieren. Bleiben diese unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Angriffs, der das Selbstverteidigungsrecht gemäß Art.51 UN-Charta auslöst, sind als zulässige Reaktionen nur die Retorsion und die Repressalie zulässig. Unter Retorsion versteht man eine Maßnahme, die nicht in Rechte anderer Staaten eingreift, deren Wirkungen als sog. unfreundlicher Akt" im politischen Bereich liegen. Beispiele für Retorsionsakte sind der diplomatische Protest, der Abbruch der diplomatischen Beziehungen, falls diese nicht einseitig oder vertraglich zugesagt sind und der 44 Abbruch von Wirtschaftsbeziehungen außerhalb vertraglicher Verpflichtungen. Die Repressalie ist eine wegen des Eingriffs in Rechte anderer Staaten an sich rechtswidriger Akt, der aber durch die zuvor begangenen Rechtsverletzung des Adressaten gerechtfertigt wird, falls das Ziel der Repressalie die Veranlassung des Adressaten zu rechtmäßigen Verhalten ist. Beispiele sind die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen, das Einfrieren von Inlandskonten des Adressaten oder seiner Bürger und die Sperrung der Hoheitsgewässer und des Luftraums für Fahrzeuge des Adressaten. Darüber hinaus besteht eine Verpflichtung der Staaten, ihre Konflikte durch Mechanismen der friedlichen Streiterledigung beizulegen. Dies gilt neben bilateralen Verhandlungen etwa für die Nutzung von Schiedsverfahren oder des Internationalen Gerichtshofs, wie sich aus Art.36 (3) ergibt. Die einseitigen Mittel der Retorsion und der Repressalie sollen nur zur Anwendung kommen, wenn der Gegner sich auf diese Mechanismen nicht einlässt oder wenn sie unzumutbar sind. Bei der Nutzung dieser Mechanismen besteht allerdings keine Pflicht, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Insbesondere sind die Staaten nicht verpflichtet, einen Rechtsstandpunkt aufzugeben, um eine friedliche Konfliktlösung zu erzielen. Beispiel: Argentinien und das Vereinigte Königreich sind verpflichtet, ihren Streit um die territoriale Zuordnung der Falkland-Inseln oder Malvinen) friedlich auszutragen. Dabei ist jedoch keine Seite verpflichtet, ihre territorialen Ansprüche aufzugeben. Neben den bilateralen Pflichten besteht gemäß Art.2 (3) UN-Charta auch eine Pflicht gegenüber der UNO. Die Staaten sind verpflichtet, sich an dem Verfahren der friedlichen Streitbeilegung, dass der Sicherheitsrat gemäß den Regeln von Kapitel VI UN-Charta betreiben kann, zu beteiligen. Der Sicherheitsrat und auch die Generalversammlung können nach diesen Regeln bestimmte Konflikt an sich ziehen und Maßnahmen zu deren Beilegung ergreifen. II. Die kollektive Durchsetzung Voraussetzung für die Zuständigkeit des Sicherheitsrates ist gemäß Art.33 (1), dass die Fortdauer der Streitigkeit geeignet ist, die Wahrung des internationalen Friedens und der Sicherheit zu gefährden. Wann dies der Fall ist, ist im Einzelnen schwer zu beantworten. Nach der ursprünglichen Konzeption der Charta handelt es 45 sich nur um internationale Streitigkeiten, so dass innere Konflikte in einem Staat davon grundsätzlich ausgenommen sind. Dies gilt allerdings nur dann, wenn der interne Konflikt nicht Auswirkungen auf andere Staaten hat oder möglicherweise haben kann. Solche Auswirkungen können Flüchtlingsströme, Handelshemmnisse oder auch rein politische Reibungen sein, die geeignet sind, Konflikte mit den Nachbarstaaten hervorzurufen. Diese Auffassung ist in der Praxis der UNO jedoch für Kapitel VI sehr rasch in Frage gestellt worden. Insbesondere die Praxis zu den sog Blauhelmaktionen zeigt, dass auch Bürgerkriege gemäss Kapitel VI behandelt worden sind. Dabei haben auch die humanitären Aspekte solcher Bürgerkriege von Anfang an eine Rolle gespielt. So bietet der SR etwa seine Hilfe an, um Medikamente oder Nahrungsmittel zu verteilen, um sichere Zonen etwa für Minderheiten zu schaffen oder um direkt medizinische und sonstige Versorgung zu organisieren. Die Streitigkeiten müssen geeignet sein, in bewaffnete Konflikte umzuschlagen und dann zu einer Bedrohung des internationalen Friedens im Sinne von Art.39 UNCharta zu werden. Es besteht also eine Stufenfolge in der Eskalation von Konflikten, die je nach Schwere zunächst zu Maßnahmen nach Kapitel VI und dann zu Maßnahmen nach Kapitel VII berechtigen. Dabei können die Streitigkeiten auch schon gewaltsame Formen angenommen haben, wenn dies unterhalb einer gewissen Erheblichkeitsschwelle liegen. Also zum Beispiel Grenzscharmützel, bewaffnete Banden, die mit Unterstützung oder Duldung eines Staates in einem anderen Staat operieren etc. Wo diese Erheblichkeitsschwelle zum Übergang ins VII. Kapitel liegt, ist theoretisch nicht zu beantworten. Die Charta legt die Beurteilung dieser Frage alleine in die Hand des Sicherheitsrats. Dieser hat das Interpretationsund Anwendungsmonopol für Kapitel VII UN-Charta. Einzelheiten dort. In der Praxis des Sicherheitsrats sind auch ausgewachsene Kriege mit hunderttausenden von Toten wie etwa der Krieg zwischen dem Iran und dem Irak, der von 1980 bis 1988 andauerte, als bloße Gefahr und nicht als Bedrohung des internationalen Friedens behandelt worden. Dies hat hauptsächlich politische und systembedingte Gründe, auf die im Zusammenhang mit Kapitel VII eingegangenen werden soll. Die Mechanismen zur Konfliktlösung sind: 46 (1) Vorrang der Konflikterledigung durch die Streitparteien: Besteht ein solcher Streit, sind in erster Linie gemäß Art.33 (1) die Parteien selbst zur Streiterledigung verpflichtet. Der Sicherheitsrat kann aber gemäß Art.33 (2) die Parteien zu solchen Bemühungen auffordern. Diese Aufforderung ist jedoch rechtlich unverbindlich. Gelingt es den Parteien nicht, den Streit selbst beizulegen, so legen sie gemäß Art.37 (1) UN-Charta den Streit dem Sicherheitsrat vor. Dies ist eine Rechtspflicht der Parteien, wobei jedoch zu beachten ist, dass die Feststellung des Nichtgelingens eigener Streiterledigung im Ermessen der Parteien liegt. Die Pflicht trifft jede Streitpartei unabhängig vom Verhalten der anderen Seite. (2) Recht zur Anrufung des SR Dieser Pflicht korrespondiert gemäß Art.35 UN-Charta ein Recht jedes Mitglieds und auch jedes Nichtmitglieds auch vor dem Feststellen des Scheiterns eigener Bemühungen um die Lösung des Konflikts, den Streit dem Sicherheitsrat oder der Generalversammlung vorzulegen. Damit können der Sicherheitsrat und die Generalversammlung parallel zu den Parteien in das Verfahren eingeschaltet werden. In der Praxis genießt dabei der Sicherheitsrat eindeutige Priorität. Dieses Recht besteht, wie der Vergleich mit Art.38 zeigt, auch dann, wenn nur eine Partei den Antrag beim Sicherheitsrat stellt, die andere Partei aber dagegen ist. Sind beide Parteien mit der Streitschlichtung durch den Rat einverstanden, kann dieser gemäß Art.38 Empfehlungen abgeben. Wird der Sicherheitsrat entweder nach Art.37 oder nach Art.35 von einer Partei mit dem Fall befasst, und ist er der Auffassung, dass die Fortdauer des Streits tatsächlich geeignet ist, die Wahrung des internationalen Friedens und der Sicherheit zu gefährden, dann kann er gemäß Art.37 (2) UN-Charta die in Art.36 vorgesehen Maßnahmen ergreifen. (3) Untersuchungsmaßnahmen des SR Um diese Feststellung treffen zu können, kann der Sicherheitsrat gemäß Art.34 UN- 47 Charta jede Streitigkeit untersuchen. Beschließt der Rat, einen Konflikt zu untersuchen, dann sind die Parteien verpflichtet, die Untersuchung zu gestatten. Damit sind Untersuchungsanordnungen rechtlich verbindlich im Sinne von Art.25 UN-Charta. Der Sicherheitsrat kann diese Untersuchungen selbst durchführen, indem er Beweise durch Parteivernahme oder Dokumenteneinsicht erhebt. Er kann eine Kommission bilden, die den Konflikt untersucht, er kann einen Sonderbevollmächtigten ernennen, er kann auch eine Beobachtermission entsenden. Dies sind "Blauhelme", also Militär von Mitgliedstaaten unter dem Kommando der UNO, das einen Beobachtungs- und Untersuchungsauftrag hat. Beispiele sind die 1949 eingesetzte United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO), welche die Einhaltung der zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn geschlossenen Waffenstillstandsabkommen überwachen soll. Sie besteht heute noch. Die United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), die als Reaktion auf den auch heute noch bestehenden Kashmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan 1949 eingesetzt wurde und die bis heute existiert, die United Nations Observer Group in Lebanon (UNIGIL), die 1958 den Libanonkonflikt beobachtete und aus neuerer Zeit die United Nations Observer Mission Uganda-Rwanda (UNOMUR), die den Auftrag hatte aufzuklären, ob die damals rebellischen Tutsis in Ruanda durch Uganda unterstützt wurden. Zu den Einzelheiten solcher Friedenstruppen oder peace keeping forces im Folgenden im Zusammenhang mit Art.36 und 38 UN-Charta. (4) Maßnahmen zur Streiterledigung Kommt der Sicherheitsrat zum Ergebnis, dass der Konflikt den Fortbestand des internationalen Friedens gefährdet, dann handelt er nach Art.36. Er empfiehlt den Streitparteien geeignete Verfahren oder Methoden der Streitbeilegung. Solche Verfahren oder Methoden können die Aufforderung zur Aufnahme von Verhandlungen, die Anrufung des IGH (Art.36 [3]) oder falls bereits geschehen der Einstellung von Feindseligkeiten umfassen. Der Sicherheitsrat kann die Einschaltung von Regionalorganisationen empfehlen. Er kann auch einseitig das Verhalten einer Partei oder das Verhalten beider Parteien verurteilen. Es gibt keinen abschließenden Maßnahmenkatalog. 48 Diese Empfehlungen des Rates sind rechtlich unverbindlich. Allerdings hat der Sicherheitsrat bereits in einigen Resolutionen Konfliktparteien damit gedroht, dass, falls sie solchen Empfehlungen nicht Folge leisten, er verbindliche Maßnahmen nach Kapitel VII verhängen wird. So etwa im Irak-Iran-Konflikt. Dies bedeutet nicht, dass die Empfehlung damit rechtlich verbindlich wird. Der Rat deutet damit nur an, dass nach seiner Einschätzung der Lage bei Nichtbefolgung der Empfehlungen der Konflikt eine Eskalationsstufe erreicht, die als Bedrohung des Friedens im Sinne von Art.39 UN-Charta zur Verhängung von Zwangsmaßnahmen berechtigt. III. Die Peace keeping forces Als eine besondere Form solcher Maßnahmen hat sich in der Praxis die Einsetzung sogenannter peace keeping forces eingebürgert. Die Rechtsgrundlagen für solche Friedenstruppen sind umstritten, da die Charta ihre Aufstellung ausdrücklich nicht vorsieht. Allerdings geht die Literatur heute in Anlehnung an die Praxis der Vereinten Nationen davon aus, dass die Aufstellung solcher Friedenstruppen zulässig ist. Dafür bieten sich verschiedene Rechtsgrundlagen an, die dann auch den Inhalt und die rechtliche Tragweite des Mandats der jeweiligen Friedenstruppe bestimmen. Zum einen kann die Friedenstruppe auf einem Beschluss der Generalversammlung beruhen, wie dies etwa bei der United Nations Emergency Force (UNEF I), die zwischen 1956 und 1967 die Aufgabe hatte, den Rückzug der britischen und französischen Truppen aus dem Gebiet um den Suez-Kanal zu überwachen und einen Puffer zwischen Israel und Ägypten zu bilden, der Fall war. Die Rechtsgrundlage dafür ist in materieller Hinsicht Art.11 (2) und/oder Art.14 UN-Charta. Danach kann die Generalversammlung in jedem Streitfall, der ihr gemäß Art.35 (2) unterbreitet wird, den Parteien Empfehlungen zur Streitbeilegung geben. Solche Empfehlungen sind rechtlich unverbindlich, d.h. stellt die Generalversammlung eine Friedenstruppe auf, so sind die Parteien nicht verpflichtet, ihre Stationierung im eigenen Land zu akzeptieren. Die Entsendung bedarf deshalb der Zustimmung der Konfliktparteien, was in der Form eines Entsendevertrages der betroffenen Staaten mit der Generalversammlung geschehen kann. Dieser Konsens der Parteien bildet dann im eigentlichen Sinne die Rechtsgrundlage für die Entsendung der Friedenstruppen. Die Kompetenz der Generalversammlung zur Aufstellung von Friedenstruppen ist 49 aber im Verhältnis zum Sicherheitsrat problematisch. Gemäß Art.11 (2) Satz 2 ist die Generalversammlung nämlich verpflichtet, Konflikte, bei denen Maßnahmen (action) erforderlich sind, dem Sicherheitsrat vorzulegen. Dies entspricht Art.24 (1) UnCharta, der die Hauptverantwortung für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit dem Sicherheitsrat zuweist. Allerdings wird man wohl unter Maßnahmen (action) nicht die unverbindliche Aufstellung von Friedenstruppen sondern nur die Verhängung verbindlicher (Zwangs-) Maßnahmen gemäß Kapitel VII UN-Charta verstehen. Dies entspricht der Praxis des Sicherheitsrats, der in allen Kapitel VII betreffenden Angelegenheiten eine konkurrierende Kompetenz der Generalversammlung nicht akzeptiert, der aber gegen die Entsendung von Friedenstruppen durch die Generalversammlung bisher keine Einwendungen geltend gemacht hat. Formal ist die Friedenstruppe ein temporäres Unterorgan der Generalversammlung, das nach Art.22 UN-Charta eingesetzt werden kann. Die Friedenstruppen sind wegen ihrer häufig zu beobachtenden Verklammerung mit dem Generalsekretär, der etwa Aufstellung und Vollzug zu überwachen hat, organisatorisch auch ein Teil des Sekretariats. Die meisten Friedenstruppen werden aber wegen der Vorrangsstellung durch Beschluss des Sicherheitsrats aufgestellt. Rechtsgrundlage dieser Friedenstruppen ist, wenn alle Konfliktparteien dies so wünschen, Art.38 UN-Charta. Wünscht nur eine Konfliktpartei die Entsendung einer Friedenstruppe und kommt es auf die Zustimmung der anderen Seite nicht an, dann ist Rechtsgrundlage in der Regel Art.36 (1) UN-Charta. In beiden Fällen ist der Beschluss des Sicherheitsrats für die Parteien rechtlich unverbindlich, das heißt genauso wie bei der Entsendung durch die Generalversammlung bedarf es der Zustimmung der Konfliktparteien. Dies ist das erste und wichtigst Kriterium für die Abgrenzung solcher Friedenstruppen von militärischen Zwangsmaßnahmen gemäß Art.42 UN-Charta. Wegen dieser eindeutigen Abgrenzung zu Art.42 ist es auch nicht hilfreich, wie dies teilweise getan wird, von einem sog. Kapitel VI 1/2 zu sprechen. Als Argument für diese Verortung zwischen den unverbindlichen Verfahren der friedlichen Streitbeilegung und den Zwangsmassnahmen wird die Kompetenz des SR genannt, sich beider Instrumente nach freiem Ermessen zu bedienen, weshalb eine exakte Abgrenzung und die Nennung einer konkreten Rechtsgrundlage nicht erforderlich sei. 50 Dagegen sprechen mehrere Argumente. Diese Argumentation ist nicht auf Blauhelmeinsätze der GV anwendbar. Die Voraussetzungen für Maßnahmen nach Kapitel VII sind weit enger als die nach Kapitel VI. In der Praxis wird sorgfältig zwischen freiwilligen Blauhelmeinsätzen und militärischen Zwangsmassnahmen unterschieden. Deshalb ist es richtig, die Rechtsgrundlage für Blauhelme in Kapitel VI zu suchen. Dies gilt auch, wenn solche Blauhelme etwa mit der Zustimmung der Regierung entsandt werden, darüber hinaus aber auch gegen deren Willen handeln dürfen. Dies ist etwa im Falle der Afghanistan Friedenstruppe anzunehmen, die durch die Resolution 1386 (2001) eingerichtet worden ist. Dort wird der afghanischen Regierung nur ein Recht zur Konsultation eingeräumt. Auf ihre Zustimmung kommt es dagegen nicht an. Vielmehr ist Ziel der Resolution die unbedingte Durchsetzung des Mandats der Friedenstruppe. Sie ist deshalb auf der Grundlage von Kapitel VII ergangen, wie sich auch eindeutig aus ihrem Wortlaut ergibt. Fraglich ist dabei aber, wessen Zustimmung für die Entsendung erforderlich ist. Soll die Friedenstruppe in einem zwischenstaatlichen Konflikt nur auf dem Gebiet eines Staates stationiert werden, dann ist nur die Zustimmung der Regierung dieses Staates erforderlich. Der andere Staat muss nicht gefragt werden, weil er keine Rechte auf diesem Territorium hat. In einem innerstaatlichen Konflikt hat der Sicherheitsrat lange Zeit nur auf die Zustimmung der Regierung abgestellt. Berühmtes Beispiel ist die Operations des Nations Unis pour le Congo (ONUC), die anlässlich des Versuchs der Abspaltung der Provinz Katanga von der Republik Kongo von1960 bis 1964 mit Zustimmung der Regierung des Kongo in Katanga militärisch aktiv wurde und die Abspaltung Katangas unter massivem Militäreinsatz letztlich verhindert hat. Dies entspricht der lange Zeit im Völkerrecht vorherrschenden Auffassung, dass Interventionen in innerstaatliche Konflikte auf Einladung der anerkannten Regierung zulässig sind. In neuerer Zeit entsendet der Sicherheitsrat jedoch nur noch dann Friedenstruppen, wenn alle Konfliktparteien der Entsendung zustimmen. So beruhte etwa das Mandat der United Nations Protection Force (UNPROFOR) in Bosnien-Herzegowina, genauso wie seiner Nachfolger IFOR und SFOR auf der Zustimmung aller dort am Konflikt beteiligten Parteien. Dies entspricht der modernen Auffassung, dass eine einseitige Intervention auf Einladung der Regierung unzulässig sei, weil dies in das Recht auf Selbstbestimmung des Bevölkerungsteils eingreife, der sezessionswilligen Teil identifiziere. sich mit den Aufständischen oder dem 51 Will der Sicherheitsrat trotz fehlender Zustimmung eines oder mehrerer Konfliktbeteiligter militärisch aktiv werden, muss er militärischem Zwang gemäß Art.42 UN-Charta verhängen. Ein Beispiel aus neuerer Zeit sind die Militäraktionen in Ruanda, wo der Rat trotz Zustimmung der damaligen Hutu-Regierung wegen des Widerstands der Tutsi-Rebellen auf der Grundlage von Kapitel VII UN-Charta handelte. Darüber hinaus dürfen solche Friedenstruppen nicht einseitig in einem solchen Konflikt Partei ergreifen, da sie nicht mit Zwang gegen Beteiligte vorgehen dürfen. Sie müssen sich deshalb neutral verhalten und dürfen militärische Gewalt nur zur Selbstverteidigung anwenden. Dies begrenzt ihren Einfluss auf Bürgerkriege entscheidend, wie die Aktionen der UNPROFOR in Bosnien-Herzegowina gezeigt haben. Ihre Aufgaben können außerhalb der Beobachtung gemäss Art.34 darin bestehen, einen militärischen Puffer zwischen Konfliktparteien zu bilden, um die Fortsetzung des Konflikts einzudämmen, sie können darüber hinaus die Aufgabe haben, Recht und Ordnung in einem Staat wiederherzustellen, also etwa beim Aufbau von ziviler und militärischer Verwaltung mitzuwirken, und sie können humanitäre Aufgaben wahrnehmen, also Krankenhäuser oder Plätze zur Verteilung von Medikamenten oder Nahrungsmitteln schützen. Bei solch weitgehenden Aufträgen erweist sich die Beschränkung auf das Selbstverteidigungsrecht als hinderlich, Deshalb umfassen Entsendeabkommen in neuerer Zeit auch das Recht, etwa mit Gewalt gegen Zivilpersonen vorzugehen, welche die Truppen an der freien Bewegung im Stationierungsgebiet oder an der Erfüllung ihrer Aufgaben hindern wollen. Organisatorisch sind sie wie die Friedenstruppen der Generalversammlung zu behandeln. Auch der Sicherheitsrat hat gemäß Art.29 die Möglichkeit, zur Erfüllung seiner Aufgaben Unterorgane zu schaffen. Die Staaten, die sich an den Friedenstruppen beteiligen, tun dies freiwillig. Es gibt nach der Charta keine Rechtspflicht zur Beteiligung an solchen Militäraktionen. Eine solche Pflicht ist nur in Art.43 UN-Charta vorgesehen. Diese Vorschrift bezieht sich aber zum einen nur auf Zwangsmaßnahmen nach Kapitel VII UN-Charta und zum anderen bedarf es dazu des Abschlusses von Sonderabkommen. Einzelheiten später. Die Truppen der Mitgliedstaaten werden in der Regel in einem gemeinsamem Oberkommando zusammen gefasst. Dieses Oberkommando untersteht in der Regel 52 der Kontrolle des Generalsekretärs und/oder des Sicherheitsrats. Es muss Weisungen dieser Organe befolgen und unterliegt einer Berichtspflicht. Deshalb handelt es sich im Rechtssinne um Truppen der Vereinten Nationen (Blauhelme). Die Staaten können ihre Truppen jedoch jederzeit ohne Angabe von Gründen aus der Friedenstruppen zurückziehen. Weil es sich um Maßnahmen der Vereinten Nationen handelt, werden die Truppen aus Mitteln der Vereinten Nationen finanziert. Hierin liegt angesichts der Vielzahl von Friedenstruppen ein erhebliches Finanzierungsproblem für die UNO. Zwar kann die Generalversammlung die Kosten solcher Friedenstruppen durch Budgeterhöhung gemäß Art.17 UN-Charta auf die Mitgliedstaaten umlegen. Allerdings weigern sich viele Staaten, ihre Beiträge in dieser Höhe pünktlich oder überhaupt zu bezahlen. Deshalb hat sich seit einiger Zeit eingebürgert, besonders kostspielige Friedenstruppen durch freiwillige Beiträge von Mitgliedstaaten zu finanzieren. Auch hier bestehen jedoch in der Praxis erhebliche Zahlungsrückstände. Außerdem haftet die UNO für solche Schäden, welche durch die Blauhelme in dem Entsendestaat verursacht werden und die nicht durch das Entsendestatut gedeckt sind. B. Das Verfahren der Friedenserzwingung I. Die Feststellung gemäß Art.39 UN-Charta Die Schlüsselvorschrift von Kapitel VII ist Art.39 UN-Charta. Gemäß dessen Satz 1 stellt der Sicherheitsrat eine Bedrohung oder einen Bruch des internationalen Friedens und der Sicherheit oder einen Akt der Aggression fest. Dieser Satz impliziert Folgendes. Zum einen ist für eine solche Feststellung nur der Sicherheitsrat zuständig. Die Generalversammlung oder der Generalsekretär haben keine Zuständigkeit zur Verhängung von Zwangsmaßnahmen. Dies entspricht Art.24 (2) UN-Charta, der die Hauptverantwortung für die Wahrung des Friedens dem Sicherheitsrat zuweist und Art.25 UN-Charta, der die Mitgliedstaaten nur an Beschlüsse des Sicherheitsrats bindet. Diese exklusive Zuständigkeit des Sicherheitsrats ist von der Generalversammlung anlässlich der Koreakrise in Frage gestellt worden. In der als uniting for peace 53 bekannt gewordenen Resolution 377 (V) vom 3. November 1950 hat die Generalversammlung für sich die Zuständigkeit bei Friedensbedrohungen oder Friedensbrüchen für den Fall in Anspruch genommen, dass der Sicherheitsrat wegen der Uneinigkeit seiner Mitglieder nicht in der Lage ist, seiner Hauptverantwortung gerecht zu werden. Der Sicherheitsrat hat in der Koreakrise wegen permanenter Beschlussunfähigkeit (Veto der UDSSR) die Sache an die Generalversammlung verwiesen. Dies war möglich, weil die Verweisung eine Verfahrensangelegenheit ist und deshalb gemäß Art.27 (2) nicht der Zustimmung aller ständigen Mitglieder bedarf. Die Generalversammlung hat in den Resolutionen 498 (V) und 500 (V) Anfang 1951 die Mitglieder aufgefordert, Südkorea weiterhin jede Unterstützung zu gewähren und mit Nordkorea keinen wirtschaftlichen Verkehr mehr zu unterhalten. Diese Praxis der Generalversammlung hat sich in der Folgzeit nicht durchgesetzt. Der Sicherheitsrat hat außer in der Koreakrise nur noch im Suez-Kanal-Konflikt im Jahr 1956 die Generalversammlung mit der Konfliktbewältigung betraut. In der Folgezeit hat er jede Verweisung an die Generalversammlung abgelehnt. Die Generalversammlung selbst ist davon ausgegangen, dass ihre Beschlüsse rechtlich unverbindlich sind. Deshalb können sie kein Ersatz für rechtlich verbindliche Maßnahmen des Sicherheitsrats sein. Die Embargobeschlüsse der Generalversammlung müssen nicht befolgt werden und die Empfehlung militärischer Zwangsmaßnahmen gibt den Mitglieder keine eigene Legitimation. Ihre daraufhin durchgeführten Militäraktionen sind nur dann rechtmäßig, wenn dafür nach allgemeinem Völkerrecht eine Rechtsgrundlage besteht, also insbesondere im Falle der kollektiven Nothilfe. Die Feststellung der tatbestandlichen Voraussetzungen des Art.39 UN-Charta ist die notwendige Voraussetzung dafür, dass Zwangsmaßnahmen gemäß Kapitel VII verhängt werden können. Nur wenn ein Konflikt nach der Einschätzung des Sicherheitsrats mindestens die Qualität einer Bedrohung des Friedens angenommen hat, hat der Sicherheitsrat die Kompetenz, mit Zwang gegen eines oder mehrere Mitglieder vorzugehen. Dabei muss der Rat zwar nicht ausdrücklich den Tatbestand von Art.39 UN-Charta zitieren. Zumindest muss aber, wie in neuerer üblich, ein Verweis auf Kapitel VII UN-Charta vorliegen. Hat der Rat dies einmal festgestellt, genügt es, wenn er sich in auf denselben Konflikt bezogenen nachfolgenden Resolutionen auf diese Feststellung oder auch nur auf die erste Resolution, die diese 54 Feststellung enthält, beruft. Die Feststellung des Tatbestandes von Art.39 ist nach dessen Wortlaut nur dann erforderlich, wenn der Rat Maßnahmen gemäß Art.41 oder Art.42 verhängt. Dagegen werden die sogenannten vorläufigen Maßnahmen gemäß Art.40 in dieser Vorschrift nicht genannt. In der Literatur wird häufig behauptet, dass wegen der Stellung von Art.40 in Kapitel VII auch für solche Maßnahmen die Feststellung des Tatbestandes von Art.39 erforderlich ist. In der Praxis des Sicherheitsrats hat sich die Regel herausgebildet, dass Maßnahmen gemäß Art.40 auch ohne Feststellung gemäß Art.39 möglich sind. Allerdings sind die dann an die Konfliktparteien gerichteten Aufforderungen rechtlich unverbindlich. Sie unterscheiden sich deshalb nicht wesentlich von den Maßnahmen des Sicherheitsrates gemäß Kapitel VI UNCharta. Wenn der Sicherheitsrat aber den Tatbestand von Art.39 feststellt, dann misst er seinen vorläufigen Maßnahmen gemäß Art.40 rechtliche Verbindlichkeit bei. Ein gutes Beispiel dafür ist die Res 660 (1990), wo der Rat gestützt auf die Feststellung, dass der Einmarsch irakischer Truppen in Kuwait einen Bruch des internationalen Friedens und der Sicherheit darstellt, den Irak zum Rückzug aller Truppen auffordert. Diese Aufforderung ist verbindlich und zu ihrer Durchsetzung verhängt der Rat in der Folgezeit Zwangsmaßnahmen gemäß Art.41 und 42 UNCharta. Der Tatbestand von Art.39 UN-Charta selbst ist in Literatur und Praxis umstritten. Einig ist man sich noch weitgehend darüber, dass die Frage, ob ein Konflikt die Intensität einer Gefährdung für den Fortbestand des Friedens oder einer Bedrohung oder eines Bruchs des Friedens hat, in dem nicht näher umschriebenen Beurteilungsspielraum des Sicherheitsrates liegt. Dies entspricht auch der Entstehungsgeschichte der Charta aus der eindeutig hervorgeht, dass die im Rat versammelten Staaten in dieser Frage nicht präjudiziert sein sollen. Die Einschätzung des Rates ist dabei vornehmlich politisch motiviert und wegen der Zusammensetzung aus 15 Mitgliedstaaten unterschiedlichen innerstaatlichen Zuschnitts und unterschiedlicher internationaler Einbindungen und Interessen häufig von ganz unterschiedlichen Beweggründen getragen. Die verabschiedeten Resolutionen sind häufig Ausdruck von Kompromissen und spiegeln meist unausgesprochen ganz unterschiedliche Auffassungen ihrer Autoren wider. Dies macht ihre Interpretation schwierig und verbietet es auf jeden Fall, jenseits des 55 Wortlauts eine von den Motiven der Ratsmitglieder abgehobene, "objektive" Interpretation vorzunehmen. Bezüglich der Einschätzung der Intensität eines Konflikts ist für den Rat vor allem ausschlaggebend, ob er gewillt ist, Zwangsmaßnahmen zu verhängen oder nicht. In der Zeit des kalten Krieges scheiterte die Feststellung einer Friedensbedrohung häufig daran, dass im Rat keine Einigkeit über die Verhängung von Zwang zu erzielen war. Meist gehörte der Aggressor einem politischen Bündnis unter der Führung einer der beiden Supermächte USA und UDSSR an oder stand einem solchen Bündnis zumindest nahe, was die Schutzmacht im Rat immer dann zur Ausübung des Vetorechts veranlasste, wenn der Schützling mit Zwang überzogen werden sollte. Dagegen konnte man sich auf unverbindliche Resolutionen auch in solchen Fällen in der Regel einigen. Darüber hinaus hat der Sicherheitsrat aber in der Vergangenheit auch deshalb häufig Zurückhaltung in Bezug auf Art.39 geübt, weil er die Anforderungen an diese Norm hoch angesetzt hat. Die ihm übertragene Befugnis zur Verhängung von Zwang wollte er nur dann gebrauchen, wenn ein Konflikt von erheblicher Bedeutung war. Bloße Grenzzwischenfälle oder auch begrenzte militärische Konflikte mit der Aussicht auf ein rasches Ende hat er deshalb meist nur mit Maßnahmen gemäß Kapitel VI begleitet. Es gibt auch keine einheitlichen Maßstäbe dafür, wann der Rat eine Bedrohung des Friedens, einen Bruch des Friedens oder einen Akt der Aggression annimmt. Eine Bedrohung des Friedens liegt an sich wegen der parallelen Formulierung zu Art.2 (4) nahe, wenn in einem Konflikt die Anwendung von Gewalt angedroht worden ist oder wenn ein Konflikt in absehbarer Zeit auch ohne konkrete Androhung in die Anwendung von Gewalt umzuschlagen droht. Der Rat hat aber insbesondere in humanitären Konflikten häufig eine Bedrohung angenommen, wenn schon Gewalt ausgeübt worden ist. Einen Bruch des Friedens sollte der Rat nur in solchen Konflikten annehmen, in denen es in erheblichen Umfang zur Anwendung von Gewalt gekommen ist. Akte der Aggression hat der Rat bisher noch nie angenommen. Das Problem liegt hier darin, dass der Rat in diesem Fall einen Aggressor frühzeitig bestimmen muss, der dann notwendig einseitig Adressat der Sanktionen wird. Diese Festlegung scheut 56 der Rat, um sich nicht politische Optionen zu verbauen. Insbesondere hat der Rat es immer abgelehnt, die Definition der Generalversammlung aus der Definition of Aggression Resolution anzuwenden. Diskutiert wurde es ernsthaft im Irak-Kuwait Konflikt, wo der Tatbestand der Aggression eigentlich offen lag. Dort konnte aber die damalige UdSSR eine Vorverurteilung ihres langjährigen Verbündeten Irak vermeiden. Bei der Abgrenzung Friedensgefährdungen von Friedensbrüchen weist die Praxis zu des Friedensbedrohungen Sicherheitsrates und erhebliche Diskrepanzen auf. Der Überfall argentinischer Truppen auf die Falklandinseln im Jahr 1982 wurde sofort als Bruch des internationalen Friedens eingestuft. Dabei wurde nur knapp drei Stunden gekämpft, bis die britische Besatzung von weniger als hundert Mann von überlegenen argentinischen Einheiten besiegt worden war. Tote gab es kaum und Gegenstand des Streits war eine abgelegene Inselgruppe im Südatlantik. Dagegen hat der Rat den Krieg zwischen dem Iran und dem Irak zwischen 1980 und 1987 sieben Jahre lang nur als Gefahr für den Fortbestand des Friedens bewertet, obwohl auf beiden Seiten in die Millionen zählende Armeen eingesetzt wurden und mehrere hunderttausend Mann starben. Als Friedensbruch wurde etwa auch der Einmarsch nordkoreanischer Truppen in Südkorea im Jahr 1950 und der Einmarsch irakischer Truppen in Kuwait im Jahr 1990 gewertet. Friedensbedrohungen sollten etwa die Unterstützung des weißen Minderheitenregimes in Südrhodesien, die Konflikte des Regimes in Südafrika mit seinen Nachbarstaaten, der Krieg in Jugoslawien, die Ausbildung und Entsendung von Terroristen durch Libyen und die humanitären Konflikte in Afrika und Mittelamerika sein. II. Das Schutzgut internationaler Friede und internationale Sicherheit: Höchst umstritten ist in Schrifttum und Praxis, was Schutzgut von Art.39 UN-Charta ist, also insbesondere welcher Friedensbegriff dieser Norm zugrunde liegt. Insoweit ist man sich nur einig, dass Verstöße gegen das Gewaltverbot gemäß Art.2 (4) immer eine Bedrohung des Friedens darstellen können. Das heißt, dass jede Ausübung von Gewalt, die von einem Staat gegen einen anderen Staat, also in seinen internationalen Beziehungen ausgeübt wird, den Tatbestand von Art.39 erfüllen kann. 57 Internationale Einwirkungen unterhalb der Schwelle militärischer Gewalt sollen dagegen auch wenn sie eine völkerrechtswidrige Intervention darstellen, grundsätzlich für Art.39 irrelevant sein. Von diesem Grundsatz hat der Sicherheitsrat allerdings in einem berühmt gewordenen Fall eine Ausnahme gemacht. Im Südrhodesienkonflikt hat er auch anderweitige Interventionen für die Feststellung einer Friedensbedrohung und für die Verhängung nichtmilitärischen Zwangs gemäß Art.41 UN-Charta und sogar von militärischem Zwang gemäß Art.42 genügen lassen. Dabei ging es um die einseitige Unabhängigkeitserklärung der Regierung Ian Smith, die Südrhodesien, das britische Kolonie war, im Jahr 1965 zu einem unabhängigen Staat machen wollten. Der Sicherheitsrat hat diese Erklärung nicht akzeptiert, so dass der Konflikt an sich eine innere Angelegenheit des Vereinigten Königreichs blieb. Allerdings hat er auf dessen Wunsch hin, die wirtschaftliche Versorgung Südrhodesiens durch die portugiesische Kolonie Mozambique und durch Südafrika als Friedensbedrohung qualifiziert und hat Zwang zur Unterbindung dieser Versorgung angeordnet. Diese Praxis ist bis heute umstritten und wird in der Literatur häufig fälschlich als Fall der Erweiterung des Friedensbegriffs um die Menschenrechte und das Selbstbestimmungsrecht der Völker gewertet. Zu neueren Praxis vgl. Kapitel 4 III. Die Empfehlungen gemäss Art.39 UN-Charta Bevor der Sicherheitsrat Zwangsmassnahmen verhängt, kann er gemäss Art.39 Empfehlungen an die Streitparteien richten. Diese Empfehlungen sind rechtlich unverbindlich. Damit entsteht das Problem der Abgrenzung zu Maßnahmen nach Kapitel VI UN-Charta. Rein formal erfolgt diese Abgrenzung danach, ob der Rat den Tatbestand von Art.39 festgestellt hat oder nicht. Dann kann der Rat auf der Grundlage dieser Feststellung bei Nichtbefolgung der Empfehlung ohne weiteres zu Zwangsmassnahmen übergehen, während bei Nichtbefolgung von Empfehlungen gemäss Kapitel VI erst eine neue Qualität des Konflikts festgestellt werden muss. Ob es Praxis für solche Empfehlungen gibt, ist umstritten. In der Literatur wird vielfach behauptet, die Resolution 83 (1950) zum Koreakonflikt habe eine solche Empfehlung enthalten. Dort hatte der Rat nach dem Einmarsch der Nordkoreaner in Südkorea empfohlen, dass die Mitglieder der UNO der Republik Korea alle 58 notwendige Hilfe gewähren, um den bewaffneten Angriff zurückzuweisen und um den internationalen Frieden und die Sicherheit wiederherzustellen. Dabei soll es sich um die Empfehlung handeln, zugunsten von Südkorea bewaffnete Nothilfe gemäss Art.51 auszuüben. Bei genauer Betrachtung handelt es sich jedoch um die Empfehlung, militärischen Zwang im Namen der Vereinten Nationen zu üben, was aus den nachfolgenden Resolutionen deutlich wird, in denen die Truppen ermächtigt werden, die Fahne der UNO zu führen und in denen das präzise Ziel der Operationen angegeben wird. In dieser Resolution 84 (1950) heißt es: "The Security Council, 5. Authorizes the unified command at its discretion to use the United Nations flag in the course of operations against North Korean forces concurrently with the flags of the various nations participating..." Diese Empfehlung ist vergleichbar mit der Ermächtigungstechnik seit der Resolution 678 (1990) und weist auf Art.42 als Rechtsgrundlage hin. Einzelheiten dort. IV. Die vorläufigen Maßnahmen gemäß Art.40 UN-Charta Vorläufige Maßnahmen enthalten in der Regel Handlungsanweisungen an die Streitparteien, deren Befolgung nach der Auffassung des Sicherheitsrates zur Beilegung des Streits dienen können. Solche Handlungsanweisungen können Aufforderungen zur Einstellung von Kampfhandlungen verbunden mit dem Rückzug von Truppen sein, es kann der Abschluss von Waffenstillstandsverträgen oder die Einrichtung von Demarkationslinien verlangt werden, so in der Resolution 598 (1987), die zur Beilegung des ersten Golfkrieges zwischen dem Iran und dem Irak maßgeblich beigetragen hat. Damit rücken die vorläufigen Maßnahmen in die Nähe der Maßnahmen zur friedlichen Streitbeilegung, die sich ebenfalls ausschließlich an die Konfliktparteien wenden. Allerdings sind die vorläufigen Maßnahmen gemäß Art.40 unter den oben genannten Voraussetzungen für die Konfliktparteien rechtlich verbindlich. Die Bindungswirkung bei solchen Anordnungen, die wie der Abschluss eines 59 Waffenstillstandsabkommens von der Mitwirkung beider Parteien abhängig ist, setzt jedoch für jeden Konfliktparteien die Bereitschaft der anderen Seite voraus. Zudem bleiben sie nach dem Wortlaut von Art.40 ohne Auswirkungen auf die Rechte, die Ansprüche und die Stellung der Konfliktparteien. Das heißt, dass die getroffenen Anordnungen nicht die Rechtsansprüche der Parteien präjudizieren dürfen. Sie sind vielmehr nur vorläufiger Natur, das heißt sie dienen nur der Beilegung des Konflikts nicht der endgültigen Klärung der völkerrechtlichen Lage. Beispiel: Wenn eine Streitpartei zur Beachtung einer bestimmten Grenze und zum Rückzug ihrer Truppen aus den jenseits dieser Grenze liegenden Gebieten aufgefordert wird, ist damit nicht festgestellt, dass etwaige Ansprüche des betroffenen Staates auf diese Gebiete nicht bestehen. Dies deckt sich auch mit dem Inhalt des Gewaltverbots, das den Einsatz militärischer Gewalt zur Verfolgung von Gebietsansprüchen verbietet, wenn dieses Gebiet von einem anderen Staat beherrscht wird und diese Beherrschung für eine gewisse Zeit in einem befriedeten Zustand bestanden hat. Sog de facto Regime. Wegen des vorläufigen Charakters können deshalb Konfliktparteien nicht dazu gezwungen werden, ihren Gegner anzuerkennen, da die Anerkennung ein grundsätzlich nicht widerrufbarer Akt ist, der den Status des Anerkannten im Verhältnis zum Anerkennenden endgültig regelt. V. Die nichtmilitärischen Zwangsmaßnahmen gemäß Art.41 UN-Charta Dabei handelt es sich um echte Zwangsmaßnahmen, das heißt sie sind für die Adressaten rechtlich verbindlich. Ihre Verhängung ist nach dem Wortlaut des Art.39 auf jeden Fall von der vorherigen Feststellung mindestens einer Friedensbedrohung abhängig. Als Zwangsmaßnahmen dienen sie der Durchsetzung von Anordnungen des Sicherheitsrates. Dabei ist die Anordnung und Anwendung von Zwang nur gerechtfertigt, wenn die durchzusetzenden Anordnungen rechtlich verbindlich sind. Deshalb kann es sich bei diesen Anordnungen nur um verbindliche Aufforderungen an die Konfliktparteien auf der Grundlage von Art.40 UN-Charta handeln. Für die Zwangsmaßnahmen gemäß Art.41 UN-Charta gibt es keinen abschließenden Katalog. Art.41 selbst nennt einige Beispiele, ohne dass diese Aufzählung abschließend wäre. Die einzige Beschränkung besteht darin, dass gemäß Art.41 UN- 60 Charta keine Maßnahmen verhängt werden können, welche die Anwendung militärischer Gewalt implizieren. Dies ist nur gemäß Art.42 UN-Charta möglich. In der Praxis haben sich als häufige Form nichtmilitärischen Zwangs sogenannte wirtschaftliche Boykottmaßnahmen herauskristallisiert. Diese Maßnahmen haben in der Regel eine doppelte Zielrichtung. Zum einen können sie sich an eine oder mehrere Konfliktparteien richten und diesen verbieten wirtschaftlichen Handel zu treiben. Mit diesem wirtschaftlichen Druck sollen die Konfliktparteien dazu veranlasst werden, Anordnungen des Sicherheitsrats Folge zu leisten. Beispiel: In der Resolution 661 (1990) verbietet der Sicherheitsrat jeden Handel mit dem Irak und Kuwait insbesondere wird dem Irak verboten, Öl auszuführen. Die Resolution 661 (1990) dient ihrem Wortlaut nach zur Durchsetzung der Resolution 660 (1990), in welcher der Irak verbindlich zum Rückzug seiner Truppen aus Kuwait aufgefordert wird. Mit dem Embargo soll dem Irak die wichtigste Einnahmequelle genommen werden. Dadurch soll politischer und ökonomischer Druck ausgeübt werden und seine Fähigkeit zur Unterhaltung eines schlagkräftigen Militärs und damit seinem Aggressionspotential soll damit geschmälert werden. Die Resolution enthält also indirekte und direkte Zwangselemente. Daneben richten sich solche Resolutionen aber auch an die übrigen Mitglieder der Vereinten Nationen, die nicht Adressat verbindlicher Anordnungen des Sicherheitsrates sind. Ihnen wird ebenfalls rechtlich verbindlich verboten, mit dem Aggressor Handel zu treiben. Die Befugnis des Sicherheitsrates zur Inanspruchnahme nicht konfliktbeteiligter Mitglieder ergibt sich ausdrücklich aus dem Wortlaut von Art.41 UN-Charta. Die rechtliche Verbindlichkeit ergibt sich aus Art.48 (1) UN-Charta. Sie stellt eine weitreichende Selbstbeschränkung der Staaten in solchen Konflikten dar. Da auf diese, am Konflikt unbeteiligten Staaten kein ökonomischer Druck ausgeübt werden darf, dürfen die Boykottmaßnahmen ihnen keinen erheblichen wirtschaftlichen Schaden zufügen. Deshalb eröffnet Art.50 UN-Charta wirtschaftlich schwachen Staaten die Möglichkeit, sich an den Sicherheitsrat mit der Bitte zu wenden, Kompensationen für die Mitwirkung am Boykott zu erhalten oder von der Teilnahme am Boykott ausgenommen zu werden. Dabei ist der Sicherheitsrat allerdings nicht verpflichtet, diesem Ansinnen Folge zu leisten, er kann aber gemäß Art.48 (1) einzelne Mitglieder von der Mitwirkung befreien und er kann empfehlen, 61 solchen Staaten wirtschaftliche Unterstützung zu gewähren. In der Resolution 661 (1990) hat der Sicherheitsrat erstmals ein Komitee eingesetzt, um die Anträge betroffener Staaten zu überprüfen. Wie in den Fällen zuvor, ist jedoch kein Mitglied vom Vollzug ausgenommen worden, allerdings sind Empfehlungen zur Unterstützung einiger Mitglieder ausgesprochen worden. Diese Empfehlungen sind jedoch rechtlich unverbindlich. Der Sicherheitsrat kann solche Boykottmaßnahmen auch nur an die Drittstaaten richten. Dies setzt voraus, dass der vom Boykott betroffene Staat damit einverstanden ist. Dies war so bei den Wirtschaftssanktionen in Bezug auf Südrhodesien beginnend mit der Resolution 232 (1966), die alle auf Antrag des Vereinigten Königreichs zustande kamen, und bei der Resolution 713 (1991), mit der bei ausdrücklicher Billigung durch den Außenminister ein Waffenembargo in Bezug auf die damals noch bestehende Sozialistische Bundesrepublik Jugoslawien verhängt wurde. Solche nur an Drittstaaten gerichteten Boykottmaßnahmen rechtfertigen sich damit, dass das Handeltreiben gegen den Willen der Regierung des betroffenen Staates eine Intervention in dessen innere Angelegenheiten und bei der Lieferung von Waffen unter Umständen sogar einen Verstoß gegen das Gewaltverbot darstellt. Wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen können umfänglich sein, wie im Falle des Irak oder später der neu entstandenen Bundesrepublik Jugoslawien, wo bis auf die Lieferung von Medikamenten und einigen Nahrungsmitteln jeglicher Handel verboten worden ist. Sie können sich aber auch auf einige wenige Produkte in der Regel häufig auf Waffen, wie im Falle Südafrikas (Res 477 (1977)) und Jugoslawiens oder auf Öl, wie etwa im Falle Süd-Rhodesiens beziehen. Neben wirtschaftlichem Zwang nennt Art.41 auch den Abbruch der diplomatischen Beziehungen und die Unterbrechung der Kommunikationswege. Dies hat bei dem bisher umfassensten Boykott gegen Jugoslawien in der Res 757 (1992) eine Rolle gespielt. Neben diesen in Art.41 genannten Maßnahmen hat in der Praxis einmal die verbindliche Aufforderung an die Mitglieder zur Nichtanerkennung eines Staates, nämlich Südrhodesiens in der Res 216 (1965) und zur Nichtanerkennung einer Annexion eines Staates, nämlich Kuwaits in der Res 662 (1990) eine Rolle gespielt. Dies sind Maßnahmen gemäss Art.41 und nicht vorläufige Maßnahmen gemäss Art.40, weil sie sich auf die Rechtslage verbindlich auswirken wollen. 62 VI. Die militärischen Zwangsmaßnahmen gemäß Art.42 UN-Charta Die militärischen Zwangsmaßnahmen gemäß Art.42 UN-Charta unterscheiden sich von den nichtmilitärischen dadurch, dass sie den Einsatz militärischer Streitkräfte implizieren. Dies können nach der Aufzählung in Art.42 See-, Luft- oder Landstreitkräfte sein. Den Einsatz dieser Streitkräfte kann der Sicherheitsrat ausdrücklich benennen oder kann mit Formulierungen wie "all necessary means" in der Resolution 678 (1990) neben anderen Maßnahmen auch diese meinen. In einem solchen Fall ist als Rechtsgrundlage immer Art.42 zu prüfen. Militärische Zwangsmaßnahmen kann der Sicherheitsrat nur anordnen, wenn er der Meinung ist, dass nichtmilitärische Maßnahmen gemäß Art.41 nicht ausreichen, um den Frieden und die Sicherheit wiederherzustellen. Die nichtmilitärischen Maßnahmen sind also ultima ratio, sie unterliegen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Das bedeutet aber nicht, dass der Sicherheitsrat, bevor er nach Art.42 handelt, zuvor nichtmilitärische Maßnahmen verhängt haben muss. Er kann direkt solche militärischen Maßnahmen verhängen, wenn er der Auffassung ist, dass nur diese den Konflikt beenden können. Militärische Maßnahmen des Sicherheitsrates unterscheiden sich von sogenannten Friedenstruppen (Blauhelmen) dadurch, dass ihre Entsendung gegen den Willen des betroffenen Staates erfolgt. Es sind damit Zwangsmaßnahmen. Genauso wie die nichtmilitärischen Maßnahmen dienen sie häufig der Durchsetzung verbindlicher Anordnungen des Sicherheitsrates gemäß Art.40 UN-Charta, wenn der betroffene Staat diesen Anordnungen nicht Folge leistet. Dies war etwa bei der Resolution 678 (1990) im Kuwait-Konflikt der Fall, wo der Rat militärischen Zwang zur Durchsetzung der in der Res. 660 (1990) an den Irak gerichteten Aufforderung zum Rückzug aller Truppen aus Kuwait anordnete. Militärische Maßnahmen können auch der Durchsetzung nichtmilitärischen Zwangs gemäß Art.41 dienen. Verhängt der Sicherheitsrat etwa ein Wirtschaftsembargo und wird diesem nicht Folge geleistet, dann verhängt er gelegentlich militärischen Zwang, um diesem Embargo Wirksamkeit zu verleihen. Ein Beispiel dafür ist die Resolution 665 (1990), in welcher der Sicherheitsrat die Mitgliedstaaten auffordert, zur Durchsetzung des in der Resolution 661 (1990) gegen den Irak verhängen 63 Embargos, mit den im Persischen Golf stationierten Seestreitkräften alle ein- und auslaufenden Schiffe anzuhalten und ihre Ladung zu überprüfen. Ein weiterer Fall ist die Resolution 787 (1992) zum Jugoslawienkonflikt, in welcher der Sicherheitsrat zur Durchsetzung seiner in den Resolutionen 713 (1991) und 757 (1992) getroffenen Embargomaßnahmen die Mitgliedstaaten zur Anwendung von Gewalt mittels ihrer Marinestreitkräfte in der Adria auffordert. Obwohl vom Wortlaut vergleichbar ist die Resolution 221 (1966) im Rhodesienkonflikt damit nicht vergleichbar, da in diesem Fall zuvor vom Rat kein bindendes Wirtschaftsembargo verhängt wurde. Dies geschah erst ein halbes Jahr später in der Resolution 232 (1966). Diese Vorgehensweise ist im Verhältnis zu den Konfliktparteien unproblematisch. Diesen gegenüber hat der Sicherheitsrat zuvor eine bindende Anweisung gemäß Art.40 UN-Charta erteilt und diese haben in der Regel auch zuvor einen Akt der Aggression oder zumindest eine Verletzung des Gewaltverbots begangen. Gegenüber den übrigen Mitgliedern, die wegen der Doppelwirkung von Embargomaßnahmen ebenfalls von solchem militärischen Zwang erfasst werden, ist dieses Vorgehen jedoch problematisch. Diese verstoßen, wenn sie das Embargo verletzen, nicht gegen das Gewaltverbot, sie verletzen lediglich ihre Pflichten aus Art.48 (1) und Art.41 zur Befolgung bindender Anordnungen des Sicherheitsrates. Damit wird militärischer Zwang nicht nur gegen diejenigen verhängt, die gemäß Art.39 für die Friedensbedrohung oder den Friedensbruch verantwortlich sind, sondern auch gegenüber denjenigen, die durch ihr Verhalten die Bemühungen des Sicherheitsrates zur Wiederherstellung des Friedens vereiteln wollen. Da sich weder aus Art.48 noch aus Art.25 eine solche Kompetenz des Sicherheitsrats ergibt, spricht vieles dafür, dass der Sicherheitsrat nur dann militärische Zwangsmaßnahmen gegen nicht konfliktbeteiligte Staaten verhängen kann, wenn diese durch den Verstoß gegen das Embargo ihrerseits für die Friedensbedrohung oder den Friedensbruch gemäß Art.39 verantwortlich gemacht werden können. In der Praxis ist festzustellen, dass in beiden Fällen die meisten Mitgliedstaaten diese Anordnungen als rechtmäßig akzeptiert haben. Bezüglich den Resolutionen zum Jugoslawienkonflikt trifft dies allerdings nicht für Bosnien-Herzegowina zu. Diesem seit Anfang 1992 als Mitglied in die Vereinten Nationen aufgenommenen Staat gegenüber war die Verhängung militärischen Zwangs zur Durchsetzung des in der 64 Res.713 (1991) für das gesamte Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens verhängten Waffenembargos rechtswidrig. Zum einen ist nicht nachzuvollziehen, warum das mit der Zustimmung der damaligen jugoslawischen Regierung verhängte Embargo ohne weiteres auch für Bosnien-Herzegowina galt, da die Zustimmung der jugoslawischen Regierung die neu entstandene Republik Bosnien-Herzegowina nicht binden konnte und eine Rechtsnachfolge in Embargomaßnahmen ohne weiteres nicht möglich ist. Zum anderen wurde Bosnien-Herzegowina nicht für die Bedrohung des Friedens verantwortlich gemacht, vielmehr sah der Sicherheitsrat diesen Staat als Opfer von Gewaltmaßnahmen der neu entstandenen Bundesrepublik Jugoslawien. Bosnien hat deshalb zur Recht gegen die Anwendung des Embargos auf sein Staatsgebiet und gegen die Verhängung militärischen Zwangs zu seiner Durchsetzung protestiert. VII. Die Sonderabkommen gemäss Art.43 UN-Charta Nach der Konzeption des Art.42 soll der militärische Zwang vom Sicherheitsrat selbst ergriffen werden. Dies kann er aber nur dann, wenn ihm selbst militärische Streitkräfte zur Verfügung stehen. Gemäß Art.43 verschafft er sich diese Streitkräfte, indem er mit einigen oder allen Mitgliedern Sonderabkommen abschließt, in denen die Mitglieder sich verpflichten, dem Sicherheitsrat solche Streitkräfte zur Verfügung zu stellen, wenn er sie anfordert. Diese Mitglieder sind gemäß Art.45 verpflichtet, einen in dem Abkommen bestimmten Teil ihrer Streitkräfte für einen solchen Einsatz bereit zu halten. Die Koordinierung des Einsatzes der Streitkräfte erfolgt durch den nach Art.47 zu bildenden Generalstabsausschuss, der aus den Generalstabschefs der zur Stellung von Streitkräften bestimmten Mitglieder. Die Mitgliedstaaten sind allerdings nicht verpflichtet, solche Sonderabkommen zu schließen. Gemäß Art.43 (3) sind sie nur verpflichtet, auf Aufforderung des Sicherheitsrates über den Abschluss solcher Abkommen ernsthaft zu verhandeln. Art.43 enthält also ein sog. pactum de negotiando. Wegen des bald nach Gründung der UNO ausbrechenden sog. kalten Krieges sind trotz Vorarbeiten im Sicherheitsrat keine Sonderabkommen geschlossen worden. Dies hat sich auch nach der Überwindung des Ost-West-Konflikts 1989/90 nicht geändert. Deshalb kann der Sicherheitsrat bis heute solche militärischen Zwangsmaßnahmen nicht selbst durchführen. 65 Er hat sich deshalb in der Praxis anderer Techniken bedient. In mehreren Fällen hat er Mitglieder ermächtigt, selbst militärischen Zwang anzuwenden. Bei diesen militärischen Zwangsmaßnahmen kann man wiederum unterscheiden zwischen dem Vollzug eines Embargos und davon unabhängigen Militäraktionen. In den Resolutionen 221 (1966), 665 (1990) und 785 (1992) ordnet der Rat militärischen Zwang an, um ein jeweils zuvor verhängtes Embargo durchzusetzen. In diesem Fall hat der bewaffnete Zwang Doppelwirkung. Er wendet sich zum einen gegen den Staat, der durch das Embargo sanktioniert wird, er trifft aber zugleich auch diejenigen Staaten, die durch den militärischen Zwang dazu angehalten werden sollen, ihrer Verpflichtung zur Befolgung des Embargos gemäß Art. 25 i.V.m. Art. 48 (1) UNCharta nachzukommen. Bemerkenswert ist, dass der Rat in diesen Resolutionen die Wendung "calls upon" verwendet, die anzudeuten scheint, dass die Staaten verpflichtet sind, den militärischen Zwang anzuwenden. Die Diskussion zu diesen Resolutionen zeigt jedoch, dass der Rat mit der Aufforderung zur Gewaltanwendung der Sache nach eine Ermächtigung meint, deren Vollzug ins Belieben der Mitgliedstaaten gestellt bleibt. Diese Auffassung des Sicherheitsrats steht in Einklang mit Art. 43 UN-Charta, der eine Verpflichtung der Staaten zur Durchführung bewaffneter Zwangsmaßnahmen nur auf der Grundlage von Sonderabkommen vorsieht. Dies gilt auch für die zwangsweise Durchsetzung von Embargomaßnahmen, da eine entsprechende Verpflichtung der Mitgliedstaaten in der Charta nicht enthalten ist. Die zweite Fallgruppe liegt außerhalb der Durchsetzung von Embargomaßnahmen. Der erste Fall waren die Resolutionen 83 und 84 (1950) im Koreakonflikt. Dort hat der Rat den Mitgliedern zunächst empfohlen, Südkorea militärisch zu helfen (S/res 83) und hat sie dann ermächtigt, dabei die Flagge der UNO zu führen (S/Res 84). Später hat er in der Resolution 221 (1966) das Vereinigte Königreich ermächtigt, zwei Schiffe aufzubringen, die Öl in dem Hafen Beira in Mozambique löschen wollten. In der Res.678 (1990) hat er alle Mitglieder ermächtigt, alle notwendigen Maßnahmen zur Entsetzung Kuwaits zu ergreifen. In der Literatur ist bis heute umstritten, ob diese Praxis rechtmäßig ist. Teilweise wird immer noch behauptet, der Sicherheitsrat könne solange keinen militärischen Zwang anordnen, wie keine Sonderabkommen gemäß Art.43 geschlossen seien. Ermächtige er Mitglieder, dann fehle die genügende Bindung des militärischen Zwangs an 66 die Vereinten Nationen. Deshalb deuten manche Autoren die beschriebenen Fälle als kollektive Nothilfe zugunsten der angegriffenen Staaten. Diese Lösung ist jedoch für die entsprechenden Resolutionen zu Jugoslawien (S/Res 770 (1992) um Hilfsgüter in Bosnien-Herzegowina zu verteilen, S/Res 787 zur Durchsetzung des Embargos in der Adria, S/Res 816 (1993) zur Durchsetzung des Flugverbots über Bosnien und S/Res 836 (1993) zur Sicherung der Schutzzonen) Somalia (S/Res 794 (1992) Aktion restore hope und S/Res 814 (1993) zur Einsetzung von UNOSOM II, Rwanda S/Res 929 (1994) operation turquoise und Haiti S/Res 940 (1994) nicht anwendbar. In diesen Fällen wird nicht kollektive Nothilfe für einen angegriffenen Staat geleistet, sondern es werden humanitäre Aktionen in einem Staat gesichert oder es wird ein Regime in einem Staat durch ein anderes ersetzt. Dies ist allenfalls als genuine Zwangsmaßnahme der UNO und nicht als kollektive Nothilfe vorstellbar. Aber auch in den anderen Fällen zeigen die Beratungen im Sicherheitsrat, dass dieser die Resolutionen als militärischen Zwang gemäß Kap.VII aufgefasst hat. Viele halten die Praxis des Rates aber für rechtmäßig. Sie verweisen entweder auf Art.48 (1), der den Vollzug von Zwangsmaßnahmen durch die Mitglieder vorsieht oder auf Art.42 S.2, der sagt, dass solche bewaffneten Maßnahmen auch in Militäraktionen von Mitgliedstaaten bestehen können. Durch die Ermächtigung werden die Mitglieder berechtigt, außerhalb des Rechts der kollektiven Nothilfe auf der Grundlage von Art.42 bewaffnete Gewalt anzuwenden. Dies ist für den Umfang der Aktionen maßgeblich, die sich nicht nach Art.51 sondern nach der in der jeweiligen Resolutionen erteilten Ermächtigung richten müssen. So mussten die Mitglieder im Kuwait-Konflikt ihre Aktionen nach der Befreiung Kuwaits abbrechen, weil sie nur zur Durchsetzung der Res.660 (1990) ermächtigt wurden. Diese mittlerweile gefestigte Praxis des Sicherheitsrats verstößt nicht gegen Art. 43 UN-Charta. Aus der Entstehungsgeschichte der Charta lässt sich insoweit nur ableiten, dass die Mitgliedstaaten in Ermangelung solcher Abkommen nicht verpflichtet sind, vom Rat angeordneten militärischen Zwang durchzuführen. Der Art. 43 UN-Charta entfaltet also Schutzwirkungen nur zugunsten solcher Staaten, die vom Sicherheitsrat zur Durchführung von militärischem Zwang in Anspruch genommen werden. Dagegen kann aus dieser Regel nicht gefolgert werden, dass diejenigen Staaten, die die Adressaten des militärischen Zwangs sind, auch in den 67 Schutzbereich des Art. 43 UN-Charta fallen sollen. Insoweit ist die Handlungsfreiheit des Sicherheitsrats also nicht eingeschränkt. In der Literatur ist darüber hinaus vor allem im Zusammenhang mit der Resolution 678 (1990) eingewandt worden, Art. 42 UN-Charta setze voraus, dass der Rat auch im Vollzug des militärischen Zwangs die Verfahrensherrschaft innehaben müsse. Dies lässt sich aus der Entstehungsgeschichte der Charta nicht belegen. Deshalb genügt es meines Erachtens, dass die Staaten ihre Legitimation zur Anwendung militärischen Zwangs auf die Anordnung durch den Rat stützen, weil damit die materiellrechtliche Legitimation alleine auf den Rat zurückzuführen ist. Nach dem Irak-Kuwait-Konflikt wird aber von einigen Mitgliedern des Sicherheitsrats Kritik an dieser Praxis geübt, die jedoch von dem politischen Interesse an einer stärkeren Kontrolle der vollziehenden Staaten geprägt ist, die aber nicht als rechtliche Kritik gedeutet werden kann. Zumindest ist von keinem Staatenvertreter behauptet worden, die Resolution 678 (1990) sei nichtig, die geltend gemachten Bedenken bezogen sich ausschließlich auf die zukünftige Praxis. Die spätere Praxis trägt diesem Bedenken häufig dadurch Rechnung, dass entweder der Rat selbst oder der Generalsekretär in den Vollzug der Maßnahmen eingeschaltet werden. Im Afghanistan Konflikt ist diese Praxis jedoch wieder aufgeweicht worden. In S/Res 1386 vom Dezember 2001 ist eine Friedenstruppe mit Zwangsbefugnissen eingerichtet worden, die zunächst keine Rückbindung an die UNO hatte. Erst in S/res 1413 vom Mai 2002 ist eine Berichtspflicht an den Generalsekretär vorgesehen. Diese Bindung an die Vereinten Nationen geht in Paragraph 10 der Resolution 836 (1993) zu Jugoslawien und der Resolution 814 (1993) sogar so weit, dass der Vollzug in die Hand solcher Truppen gegeben wird, die unter dem direkten Kommando der Vereinten Nationen stehen. Damit vollzieht der Rat allerdings immer noch außerhalb von Art. 43 UN-Charta den Wechsel von Art. 42 Satz 2 zu Satz 1 dieses Artikels und ordnet militärischen Zwang an, der unmittelbar der Organisation zuzurechnen ist. Die Fortführung dieser bisher letzten Stufe in der Anwendung des Instrumentariums des VII. Kapitels ist jedoch wegen der knappen Ressourcen der Organisation in jüngster Zeit wieder in Frage gestellt, weshalb es abzuwarten bleibt, ob diese Praxis in der Zukunft fortgesetzt wird. In der Resolution 1386 (2001) zu Afghanistan wird ausdrücklich festgestellt, dass die Ausgaben von den Mitgliedern zu tragen sind, dass aber ein gemeinsamer Fonds unter Verwaltung des 68 Generalsekretärs geschaffen wird, der aus Beiträgen der Mitgliedern gespeist wird und die Kosten ärmerer Mitglieder der Friedenstruppe teilweise bestreiten soll. In zwei Fällen hat der Sicherheitsrat zudem selbst das Kommando über die Militäraktionen übernommen. Das waren die Res.814 (1993), in welcher die in Somalia aufgestellte UNOSOM, zu militärischen Zwangsmaßnahmen ermächtigt wurden (UNOSOM II) und die Res.836 (1993), in welcher die in Jugoslawien tätige UNPROFOR zur militärischen Verteidigung der zuvor eingerichteten Schutzzonen in Bosnien-Herzegowina ermächtigt wurde. In beiden Fällen handelte es sich um zunächst mit dem Willen der Betroffenen entsandte Friedenstruppen Blauhelme, die dann zu militärischen Zwangsmaßnahmen gegen den Willen der Betroffenen ermächtigt wurden. Diese Friedenstruppen standen unter dem direkten Weisungsrecht des Sicherheitsrates und des Generalsekretärs und haben ein gemeinsames Oberkommando. Allerdings waren die Mitglieder auch in diesem Fall nicht verpflichtet, sich an dem militärischen Zwang zu beteiligen. Sie können ihre Truppen jederzeit abziehen, wenn sie dies wollen. C. Die Zusammenarbeit mit den Regionalorganisationen I. Die Entstehungsgeschichte von Kapitel VIII UN-Charta Kapitel VIII UN-Charta hat seine Wurzeln in der Organisation kollektiver Sicherheit der Staaten Nord- und Südamerikas. Erste Ansätze eines Systems regionaler Sicherheit in Amerika entstehen durch die Monroe-Doktrin. Diese Doktrin gründet auf eine Erklärung des amerikanischen Präsidenten Monroe vom 2. Dezember 1823. Darin wird den außeramerikanischen Staaten, vor allem dem europäischen Kolonialmächten, das Recht abgesprochen, in Amerika zu intervenieren. Die OAS ist Nachfolger der 1890 gegründeten Internationalen Union Amerikanischer Staaten. Sie wird am 30. April 1948 auf der IX. Internationalen Konferenz Amerikanischer Staaten in Bogota/Kolumbien gegründet. Die letzte Änderung der Satzung der OAS geschah durch das Protokoll von Managua vom 10.3.1993. Wichtigste Rechtsgrundlage ist neben der Satzung der OAS der 1947 unterzeichnete Interamerikanische Vertrag über gegenseitigen Beistand, der sogenannte Rio-Pakt, der maßgeblich das System der kollektiven Sicherheit und der kollektiven Selbstverteidigung der OAS konzipiert. Daneben existiert noch der 1948 69 geschlossene Amerikanische Vertrag über die friedliche Beilegung von Streitigkeiten, der Bogota-Pakt, der die Methoden der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten unter den Vertragsparteien regeln soll. Diesem Pakt sind aber bisher nur 14 Mitglieder mit weitreichenden Vorbehalten beigetreten. Die OAS hat heute 35 Mitglieder. Sie vereinigt damit alle unabhängigen amerikanischen Staaten mit Ausnahme Kubas, das 1962 ausgeschlossen wurde. Ziel der OAS ist vor allem die Stärkung des Friedens und der Sicherheit sowie die Verteidigung der territorialen Integrität und politischen Unabhängigkeit seiner Mitglieder. Außerdem fördert sie die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zusammenarbeit ihrer Mitglieder. Für Konflikte innerhalb ihrer Mitglieder gilt das "try OAS first" Prinzip. Das heißt, die Mitglieder sind verpflichtet, eine Lösung des Konflikts zuerst innerhalb der OAS und dann erst durch andere Mechanismen (UNO etc.) zu suchen. Die OAS ist die einzige Regionalorganisation mit einem eigenen Zwangsmaßnahmenmechanismus. Danach können sowohl wirtschaftliche wie auch militärische Zwangsmaßnahmen beschlossen werden. Neben der Friedenssicherung widmet sich die OAS auch dem Menschenrechtsschutz. Materiellrechtliche Grundlage hierfür ist die Amerikanische Deklaration über die Rechte und Pflichten der Menschen aus dem Jahr 1948, die Parallelen zur EMRK aufweist, im aber darüber hinaus auch eine Reihe politischer Gestaltungsrechte kennt. Organe zur Durchsetzung dieser Konvention sind die 1960 gegründete Kommission für Menschenrechte und der 1979 eingesetzte InterAmerikanische Gerichtshof für Menschenrechte. Die Amerikanische Menschenrechtskonvention kennt genauso wie die EMRK eine Staatenbeschwerde und eine Individualbeschwerde, die vergleichbar dem alten Verfahren der EMRK zur Kommission erhoben wird. Die Individualbeschwerde ist für alle Mitglieder der OAS obligatorisch. Wegen der Existenz eines regionalen kollektiven Friedenssicherungssystems bestanden die Staaten Amerikas in San Francisco darauf, dass ihr Sicherheitssystem durch die Gründung der UNO nicht in Frage gestellt wird. Diesem Anliegen ist in Art.52 (1) UN-Charta Rechnung getragen worden. Dies war notwendig, weil sonst der in Art.103 UN-Charta statuierte Vorrang der UN-Charta solche Systeme unter 70 Umständen chartawidrig gemacht hätte. II. Regionale Einrichtungen und Abmachungen Regionale Einrichtungen sind internationale Organisationen mit eigener Rechtsfähigkeit im Völkerrecht. Beispiele sind neben der OAS, die OAU, die Arabische Liga, aber auch die NATO und die WEU. Abmachungen sind Absprachen zwischen Völkerrechtssubjekten, in der Regel Staaten in der Regel auf vertraglicher Grundlage, die keine Organisation zu ihrer Durchsetzung gegründet haben. Ein Beispiel hierfür ist die EU. Die Absprache muss noch nicht einmal rechtsverbindlich sein, wie die OSZE zeigt. Das Kriterium regional ist nicht so eng gefasst, dass es sich nur auf einen Kontinent oder einen Kulturkreis bezieht. Jede Einrichtung ist regional, die nicht wie die UNO den Anspruch auf weltweite Geltung erhebt, sondern den Kreis ihrer Mitglieder nach bestimmbaren Kriterien begrenzt. III. Strukturgleichheit mit der UNO Die regionalen Einrichtungen oder Abmachungen müssen Systeme gegenseitiger kollektiver Sicherheit sein. Das bedeutet nicht, dass dies ihr ausschließlicher Zweck sein muss. So ist etwa die OAS sowohl ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit wie auch ein kollektives Selbstverteidigungssystem. Die NATO ist nach wie vor in erster Linie ein System kollektiver Selbstverteidigung, sie wandelt jedoch zunehmend ihren Charakter zu einem System kollektiver Friedenssicherung. Insbesondere hat sie es sich auf der Grundlage mehrerer Beschlüsse des NATORates zur Aufgabe gemacht, militärische Zwangsmassnahmen der UNO zu vollziehen. Sie betrachtet es aber auch unabhängig von einem Mandat des Sicherheitsrats als ihre Aufgabe, den internationalen Frieden zu sichern, vgl. KosovoKonflikt. Dazu gleich. Die Regeln von Kapitel VIII UN-Charta sind auf solche mehrpoligen Einrichtungen jedoch nur insoweit anwendbar, als deren Aufgabe der kollektiven Friedenssicherung betroffen ist. Soweit sie Selbstverteidigungssysteme sind, werden sie von Art.51 UN-Charta erfasst. IV. Die Eignung zur Lösung regionaler Streitigkeiten kollektive 71 Diese Eignung ergibt sich ohne weiteres aus der Begrenzung der Zuständigkeit auf die Norme der Einrichtung, die ihren Charakter als System kollektiver Friedenssicherung ausmachen. Deshalb erfasst Kapitel VIII nach allerdings nicht unumstrittener Auffassung nur solche Konflikte, die zwischen den Mitgliedern der regionalen Einrichtung entstehen und die nach deren Satzungsrecht behandelt werden. Hat der Konflikt dagegen Auswirkungen auf dritte Staaten, dann ist das System kollektiver Sicherheit als solches nicht in der Lage, auf der Grundlage seiner Satzung den Konflikt zu lösen. V. Das try OAS first-Prinzip Art. 52 (2) UN-Charta greift das für die OAS entwickelte try OAS first-Prinzip auf. Die Mitglieder der UNO sind danach gehalten, einen Konflikt vorrangig in der regionalen Einrichtung, der sie gleichfalls angehören müssen, zu lösen. Dies gilt aber nur, soweit es sich um eine friedliche Streitbeilegung handelt und soweit die Satzung der Organisation dafür geeignete Verfahren vorsieht. Das Bedeutet, dass der Sicherheitsrat im Rahmen von Kapitel VI UN-Charta nur subsidiär zu bestehenden regionalen Einrichtungen zum Zuge kommt. Wird der SR trotzdem sofort von Mitgliedern einer regionalen Einrichtung angerufen, so ist die gemäß Art.52 (4) UN-Charta möglich. Allerdings soll der Rat in diesem Fall gemäß Art.52 (3) UN-Charta eine vorrangige Lösung in der regionalen Einrichtung anstreben und diese fördern. Erscheint eine Lösung in der regionalen Einrichtung erfolgversprechend, so hat sich der Rat zunächst eigener Maßnahmen zu enthalten. Für die Frage, wann eine solche regionale Konfliktlösung erfolgversprechend erscheint, hat sich eine pragmatische Lösung eingebürgert. Ruft eine Konfliktpartei den Rat an, und trägt sie dabei vor, dass sie die Konfliktlösung in der regionalen Einrichtung für nicht erfolgversprechend hält, so kann der Rat die Sache selbst an sich ziehen. Allerdings bemüht er sich zunächst um eine Stellungnahme der regionalen Einrichtung, die er zur Grundlage seiner Entscheidung macht. VI. Zwangsmassnahmen durch Regionalorganisationen Der Sicherheitsrat kann, wenn er dies für angebracht hält, gemäß Art.53 (1) 72 regionaler Einrichtungen zur Durchsetzung von Zwangsmaßnahmen bedienen. Dabei dürfen die regionalen Einrichtungen grundsätzlich solche Zwangsmaßnahmen nur dann durchführen, wenn sie vom Rat hierzu ermächtigt werden. Diese Regelung hat zwei rechtlich voneinander zu trennende Aspekte. 1. Die Wirkung der Zustimmung des SR Dies bedeutet zum einen, dass Regionalorganisationen, deren Satzung die Verhängung von Zwangsmassnahmen vorsieht, diese nur mit Zustimmung des Rates anordnen dürfen. Damit liegt das Monopol für solche Zwangsmassnahmen beim Rat. Dieses Monopol gilt aber nur für echte Zwangsmassnahmen im Sinne von Kapitel VII UN-Charta. Und innerhalb von Kapitel VII hat sich in der Praxis der Streit darüber, ob entsprechend dem Wortlaut sowohl militärische wie auch nichtmilitärische Zwangsmassnahmen erfasst werden, dahingehend gelöst, dass nur Art.42 vom Zustimmungserfordernis des Rates erfasst wird. Dagegen sind insbesondere mehrere Embargomaßnahmen der OAS auch ohne Genehmigung des Rates durchgeführt worden. So hat die OAS am 8.10.1991 ein Handelsembargo gegen Haiti verhängt, welches sich der Rat am 16.06.1993 in S/Res 841 (1993) zu eigen gemacht und für alle Mitglieder der UNO verbindlich gemacht hat. Dies zeigt, dass er damit das Embargo der OAS inzident gebilligt hat. Die Beschränkung des Zustimmungserfordernisses auf militärische Maßnahmen entspricht auch dem allgemeinen Völkerrecht. Während das Gewaltverbot gemäss Art.2 (4) nur durch die davon zulässigen Ausnahmen gemäß Art.51 und Art.42 außer kraft gesetzt werden kann, ist es den Staaten nach allgemeinem Völkerrecht unbenommen, andere Staaten wirtschaftlich zu boykottieren. 2. Die Wirkung der Ermächtigung des SR Zum zweiten kann der Rat regionale Einrichtungen ermächtigen, sowohl militärische wie auch nichtmilitärische Massnahmen durchzuführen. Dabei ist aber zwischen der Rechtslage nach der Charta und der Rechtslage gemäß der Satzung der regionalen Einrichtung zu unterscheiden. Chartagemäß kann eine solche Ermächtigung auch dann sein, wenn die regionale Einrichtung nach ihrer Satzung hierzu keine Kompetenz hat. Allerdings ist die Maßnahmen dann trotzdem bezogen auf die 73 regionale Einrichtung ultra vires und damit nichtig. Mit dem Tatbestandsmerkmal „where appropriate“ in Art.53 (1) kann die satzungsmäßige Zuständigkeit der Regionalorganisation nicht erweitert werden. Nur die Mitgliedstaaten sind gemäß Art.48 (1) verpflichtet, Zwangsmaßnahmen durchzuführen, wobei sich diese Pflicht aber wegen Art.43 nur auf nichtmilitärische Zwangsmaßnahmen bezieht. Eine Ermächtigung zum Vollzug militärischer Zwangsmaßnahmen, die von den Mitgliedstaaten in regionalen Einrichtungen durchgeführt wird, setzt gemäß Art.48 (2) voraus, dass diese Einrichtung dazu geeignet ist. Die Eignung bedeutet aber, dass sie im Rechtssinne kraft ihrer Satzung dazu in der Lage ist. D. Die kollektive Selbstverteidigung I. Der bewaffnete Angriff Ausgelöst wird dieses Recht durch einen bewaffneten Angriff (armed attack) bzw. eine bewaffnete Aggression (aggression armée). Darunter wird häufig nur der mit Waffengewalt geführte Angriff auf das Staatsgebiet eines anderen Staates verstanden. Das dies unsinnig ist, zeigt das Beispiel des Angriffs auf eigenen Kriegsschiffe oder Flugzeuge. Auch dies muss als bewaffneter Angriff gewertet werden. Darüber hinaus wird man alle Maßnahmen im internationalen Verkehr, die das Gewaltverbot verletzen als bewaffneten Angriff ansehen müssen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Staaten sich das Recht der Selbstverteidigung gegen Verletzungen des Gewaltverbots nehmen wollten. Dafür spricht auch Art.1 der Aggressionsdefinition, der die Anwendung jeder Form von Gewalt, die gegen die territoriale Integrität die politische Unabhängigkeit oder die Souveränität eines anderen Staates oder die sonstwie gegen die Ziele der Vereinten Nationen gerichtet ist, verbietet. II. Das den Staaten eigenen Recht der Selbstverteidigung Dafür spricht insbesondere, dass Art.51 auf das den Staaten inhärente oder eigene Recht der Selbstverteidigung abhebt. Damit ist gemeint, dass das Selbstverteidigungsrecht untrennbar mit der Souveränität der Staaten verbunden ist, also nicht einer ausdrücklichen Gewährleistung im Völkerrecht bedarf. Mit Art.51 haben die Staaten dieses Recht in das System der kollektiven Friedenssicherung der 74 Vereinten Nationen eingebracht. Sie haben sich dabei aber nur soweit im Recht auf Selbstverteidigung zurückgenommen, wie die UNO an ihrer Stellt kollektiven Schutz gegen Verletzungen des Gewaltverbots organisieren kann. Dies ist eine rein verfahrensrechtliche Frage. Materiellrechtlich wollten sie keine Grauzonen schaffen, in denen allenfalls die UNO nicht aber daneben auch die Staaten Selbstverteidigung üben dürfen. III. Die indirekte Aggression 1. Die Regelungen der Aggressionsdefinition Die Gleichstellung von bewaffnetem Angriff und Verstoß gegen das Gewaltverbot zeigt sich auch in der Diskussion um die sogenannte indirekte Aggression. Darunter sind insbesondere die in Art.3 g der Aggressionsdefinition genannten Fälle zu verstehen. Der IGH hat im Nicaragua Case, ICJ Reports 1986, S.104 ausdrücklich bestätigt, dass auch solche Akte bewaffnete Angriffe sein können, die das Recht der Selbstverteidigung auslösen. Dabei hat die Mehrheit der Richter aber angenommen, dass solche Akte nur dann zur Selbstverteidigung berechtigen, wenn sie eine gewissen Erheblichkeit haben. Sogenannte low intensity conflicts wie bloße Grenzzwischenfälle seien keine bewaffneten Angriffe. Begründet wird dies mit der Klausel in Art.3 g, dass indirekte Aggression nur bei einer bestimmten Erheblichkeit mit den anderen Formen der Aggression gleich gestellt werden kann. Dies wird von den Richtern Schwebel und Jennings mit breiter Zustimmung in der Literatur kritisiert, weil es zur Folge hat, dass es bewaffnete Maßnahmen gibt, auf die der Staat allenfalls mit Entschädigungsansprüchen nicht aber mit militärischer Verteidigung reagieren kann. Umgekehrt kann der Aggressor bis zu einer bestimmten Schwelle nahezu ungestraft Gewalt ausüben. 2. Die Ausweitung durch den 11. September 2001 Eine solche erheblich indirekte Aggression stellt auf jeden Fall der Angriff von Terroristen auf Ziele in New York und Washington am 11. September 2001 dar. a. Zum Tatbestand: Ab Mai 1996 brachten innerhalb kurzer Zeit die Taliban weite Teile Afghanistans unter ihre Kontrolle, nahmen im September 1996 Kabul ein und stürzten die 75 Regierung Rabbani/Hekmatyar, die sich in den noch nicht von den Taliban eroberten Norden Afghanistans flüchtete. Die Taliban bildeten eine sechsköpfige Übergangsregierung unter der Führung von Mullah Mohammad Rabbani und errichteten einen islamistischen „Gottesstaat”, der jedoch nur von Pakistan sowie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten anerkannt wurde. Die verbliebenen Mudschaheddin-Gruppierungen schlossen sich gegen das TalibanRegime zur so genannten Nordallianz zusammen, geführt von Burhanuddin Rabbani, der sich weiterhin als legitimer Präsident Afghanistans verstand, General Dostum sowie Ahmed Schah Massud. Die Nordallianz kontrollierte den Nordosten und unternahm wiederholt Offensiven gegen die Taliban, die wiederum mit Gegenangriffen antworteten. Keine der beiden Seiten konnte im weiteren Verlauf nennenswerte Erfolge erringen, die Front zwischen Taliban und Nordallianz stagnierte. Die verheerenden Terrorangriffe auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington vom 11. September 2001 leiteten den Sturz des TalibanRegimes ein. Als Hauptverantwortlicher wurde bereits kurz nach den Anschlägen Osama bin Laden identifiziert, der sich weiterhin unter dem Schutz der Taliban in Afghanistan aufhielt. US-Präsident George W. Bush forderte das Taliban-Regime wiederholt auf, bin Laden auszuliefern, und drohte zugleich mit militärischer Vergeltung. Die Taliban wiesen alle Auslieferungsforderungen zurück; die Angst vor möglichen Angriffen der USA trieb weitere Zehntausende Afghanen in die Flucht, von denen sich ein Großteil an der inzwischen offiziell geschlossenen Grenze zu Pakistan staute. Unterdessen formierten die USA eine weltweite Antiterrorkoalition, die NATO stellte den Bündnisfall fest, die Nordallianz wurde von den USA und anderen Staaten der Antiterrorkoalition mit Waffen und Finanzmitteln ausgerüstet, in den nördlichen Nachbarländern Afghanistans wurden erste US-amerikanische Truppen stationiert. Dennoch weigerten sich die Taliban weiterhin, bin Laden auszuliefern, kündigten vielmehr massiven Widerstand an. Am 7. Oktober 2001 begannen die USA, unterstützt von Großbritannien, mit Luftangriffen auf Stellungen der Taliban sowie auf Ausbildungslager der al Kaida in Afghanistan ihren angekündigten und international gebilligten Krieg gegen das Taliban-Regime. Parallel zu den amerikanisch-britischen Luftangriffen agierte die Nordallianz am Boden, zunächst ohne größeren Erfolg; im November gelang jedoch der entscheidende Durchbruch: Am 11. November 2001 76 eroberte die Nordallianz die strategisch wichtige Stadt Mazar-i-Sharif, und zwei Tage später zog sie in der Hauptstadt Kabul ein, die zuvor von den Taliban kampflos aufgegeben worden war. Am 7. Dezember kapitulierten die Taliban-Kämpfer in ihrer letzten Hochburg Kandahar, und wenig später gab die al Kaida ihre wichtige Bergfestung Tora Bora im Osten des Landes auf. Taliban und al Kaida waren damit militärisch weitgehend besiegt, wenngleich es noch über Monate hinweg immer wieder zu vereinzelten Gefechten zwischen US-Truppen und Taliban- sowie al Kaida-Kämpfern kam. Bereits am 27. November 2001 war auf dem Petersberg bei Bonn auf Vermittlung der Vereinten Nationen die so genannte Afghanistan-Konferenz zusammengetreten, um über die politische Neuordnung und Zukunft Afghanistans zu beraten. An der Konferenz nahmen vier afghanische Gruppierungen teil: Die Nordallianz, die vor allem Tadschiken, Turkmenen und Usbeken aus dem Norden des Landes repräsentierte; die so genannte Zypern-Gruppe, die die Hazara aus dem Zentrum Afghanistans vertrat; die Rom-Gruppe, die sich aus Anhängern des im Exil in Rom lebenden Exkönigs Sahir Schah zusammensetzte; und die PeschawarGruppe, die wie die Rom-Gruppe die Paschtunen vertrat. Als wichtiges Zeichen für die Zukunft wurde die Tatsache interpretiert, dass unter den insgesamt 34 afghanischen Delegierten immerhin vier Frauen waren. Am 5. Dezember 2001 unterzeichneten die Teilnehmer der Afghanistan-Konferenz ein Abkommen, in dem sie den Rahmen für die politische Reorganisation und eine künftige Regierungsbildung feststeckten. Am Beginn der Neuordnung soll nach dem Abkommen die Bildung einer Interimsregierung stehen. Nach sechs Monaten soll die Interimsregierung durch eine Übergangsregierung abgelöst werden, die von einer außerordentlichen Loya Jirga, der traditionellen afghanischen Ratsversammlung, gewählt werden soll. Nach weiteren 18 Monaten soll sich laut dem Petersberger Abkommen eine reguläre, aus freien Wahlen hervorgegangene Regierung konstituieren; die dafür notwendige neue Verfassung soll eine verfassunggebende Loya Jirga ausarbeiten. Am 22. Dezember 2001 nahm die 29-köpfige Interimsregierung unter dem Paschtunenführer Hamid Karsai als Ministerpräsidenten ihre Arbeit auf. b. Bewertung 77 Entscheidend bei der indirekten Aggression ist immer, ob die Aktionen solcher Terroristen einem Staat zugerechnet werden können. Im Falle der Al Quaida Aktionen geschah dies zumindest mit Billigung des Taliban Regimes. Dieses war zu dieser Zeit das zwar nicht internationale anerkannte (mit Ausnahme von Pakistan und Saudi Arabian) aber de facto verantwortliche Regime in Afghanistan. Eine bloße Billigung genügt zwar nach Art. 3 lit. g der Aggressionsdefinition nicht, weil dort von einem Aussenden also einem aktiven Handeln die Rede ist. Das Völkerrecht scheint sich jedoch seit dem 11. September 2001 insoweit verschärft zu haben, da alle Staaten den USA in diesem Fall das Recht zur Selbstverteidigung gegen das Taliban Regime und gegen die Al Quaida Kämpfer zugestanden haben. IV. Die präventive Selbstverteidigung Umstritten ist bis heute, ob es auch eine präventive Selbstverteidigung geben kann. Dies ist mit Hinweis darauf begründet worden, dass Art.2 (4) auch die Androhung von Gewalt verbiete und deshalb bei einer konkret drohenden Gewaltanwendung auch Selbstverteidigung zulässig sein soll. Kein Staat müsse es in Kauf nehmen, dass ein Gegner durch einen Erstschlag in die Lage versetzt werde, alle zur Verteidigung notwendigen Waffen sofort zu vernichten. Historisch geht das Recht auf präventive Selbstverteidigung auf den berühmten Caroline Fall aus dem Jahr 1837 zurück, als Kanada das Schiff Caroline versenkte, das zur militärischen Unterstützung von Aufständischen dienen sollte. Die USA, auf deren Gebiet das Schiff versenkt wurde, erkannten das Recht der präventiven Selbsthilfe an unter der Voraussetzung, dass die Gefahr - gegenwärtig (Instant) - überwältigend (overwhelming) ist - keine Wahl der Mittel (leaving no choice of means) - und keine Zeit zum überlegen läßt (and no moment for deliberation). Dieses Recht ist jedoch auch immer wieder in Zweifel gezogen worden. So ist der Angriff israelischer Jagdflugzeuge auf den irakischen Atomreaktor Tamuz I im Jahr 1981 vom Sicherheitsrat in der Resolution 487 (1981) verurteilt worden. Israel hatte geltend gemacht, der Reaktor diene der Herstellung von Atomwaffen, die gegen Israel gerichtet seien. Dieser Fall spricht jedoch nicht zwingend gegen das Recht der 78 präventiven Selbstverteidigung, denn hier fehlt im Sinne der Caroline Formel das Kriterium der Konkretheit des Verstoßes gegen das Gewaltverbot und das Zeitmoment. Für die Großmächte hat diese Frage seit der Entwicklung der atomaren Zweitschlagfähigkeit keine große Rolle mehr gespielt. Im Zusammenhang mit der Bedrohung durch atomare Waffen, ist jedoch von den Großmächten die These entwickelt worden, dass wegen der alles vernichtenden Wirkung solcher Angriffe auf keinen Fall abgewartet werden müsse, bis ein solcher Angriff erfolge oder auch nur unmittelbar bevorstehe. Diese Argumentation wird auch auf biologische und chemische Waffen ausgedehnt (Irak) und wird noch um die Problematik erweitert, dass solche Waffen auch durch Terroristen ins Land geschleust werden können, deren Angriff so gut wie nicht vorherzusehen ist. Ob allerdings die These der Amerikaner sich durchsetzt, jede Produktion von Waffen berge unter bestimmten politischen Konstellationen eine genügende Gefahr für eine präventive Selbstverteidigung in sich, bleibt abzuwarten. Deshalb wird man die militärischen Aktionen der USA und des Vereinigten Königreichs gegen den Irak wohl als völkerrechtswidrig ansehen müssen. V. Die Intervention auf Einladung Damit ist die Anwendung von Waffengewalt gegen einen Staat mit Zustimmung seiner Regierung oder die Einmischung in einen Bürgerkrieg mit Zustimmung der Parteien gemeint. Wendet ein Staat auf dem Gebiet eines anderen Staates Gewalt an, dann ist dies grundsätzlich dann zulässig, wenn die Regierung des anderen Staates dem zustimmt. So etwa in Mogadischu bei der Befreiung deutscher Geiseln aus der Lufthansa Maschine Landshut im Jahr 1977. Geschieht dies jedoch in einem Bürgerkrieg, dann kollidiert diese Intervention mit dem Selbstbestimmungsrecht des betroffenen Volkes. Traditionell stellt das Völkerrecht darauf ab, daß die international anerkannte Regierung Unterstützung erbitten kann. Die einseitige Parteinahme zugunsten einer diktatorische Regierung gegen Aufständische, welche die Demokratie einführen wollen, würde die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts des betroffenen Volkes vereiteln. Fraglich ist, ob umgekehrt ein Recht zur Unterstützung einer demokratisch gewählten Regierung gegen einen Militärputsch besteht. Hier wird teilweise ein Interventionsrecht behauptet, dies ist bisher jedoch noch hoch umstritten (vgl. Haiti). 79 VI. Die kollektive Selbstverteidigung Art.51 UN-Charta berechtigt nicht nur zur Verteidigung eigener Rechte durch einen einzelnen Staat sondern auch zur kollektiven Selbstverteidigung, indem mehrere Staaten sich zu einem Bündnis zusammenschließen, das im Falle eines Angriffes auf ein Bündnismitglied eine gemeinsame Verteidigung organisiert. Solche Bündnisse sind etwa die NATO (Art.5 des Nordatlantikvertrages), die WEU (Art.5 WEU-Vertrag), die OAS, die aufbauend auf der Monroe-Doktrin jeden Angriff auf einen amerikanischen Staat zum Bündnisfall macht und die Arabische Liga, die insbesondere gegen Israel gerichtet ist. Außerdem berechtigt Art.51 UN-Charta auch zur individuellen oder kollektiven Nothilfe, das heißt ein oder mehrere Staaten können, ohne daß ihre eigenen Interessen in einem Konflikt betroffen sind, einem anderen Staat zu Hilfe eilen. So etwa im Irak-Kuwait-Konflikt, wo die USA, einige europäische Staaten und einige arabische Staaten Kuwait geholfen haben, die Annexion durch den Irak abzuwehren. VII. Sonstige Voraussetzungen Die Selbstverteidigung ist nur zulässig, wenn sie unmittelbar auf den bewaffneten Angriff folgt. Dabei können aber aus faktischen Gründen der militärischen Vorbereitung (Mobilmachung) auch einige Monate zwischen dem Angriff und er Verteidigung verstreichen. Ein praktischer Fall ist der Angriff Argentiniens auf die Falkland Inseln, Malvinen, die erst nach der Sammlung und dem Aufmarsch der Flotte beantwortet werden konnte. Dagegen war der Anspruch Argentiniens auf die Besetzung der Inseln durch das Vereinigte Königreich im Jahr 1832 mit der Selbstverteidigung zu reagieren, verwirkt. Die Selbstverteidigung muss verhältnismäßig sein. Die Geltung dieses Prinzips ist zwar unbestritten, aussagefähige Praxis existiert jedoch nicht. Insbesondere haben die NATO Staaten während des kalten Krieges die an sich sehr problematische Doktrin entwickelt, auf einen konventionellen Angriff des Warschauer Paktes sofort mit Nuklearwaffen zu reagieren. Teilweise wird vertreten, daß der Einsatz atomarer Waffen generell unzulässig sei, da die Folgen eines solchen Einsatzes nicht beherrschbar seien und auch nicht unmittelbar am Konflikt Beteiligte in Mitleidenschaft gezogen werden können. Diese Auffassung hat sich in der 80 Staatenpraxis aber nicht durchgesetzt. Nur diejenigen Staaten dürfen keine Atomwaffen einsetzen, die den Vertrag über die den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen vom 1.7.1968 unterzeichnet haben. (1998: 187 Vertragsstaaten) Kapitel 4: Der Schutz der Menschenrechte A. Humanitäre Interventionen der Vereinten Nationen I. Der Tatbestand von Art. 39 UN-Charta Wegen der beschriebenen Verengung des Tatbestands von Art. 39 UN-Charta auf zwischenstaatliche Konflikte war es lange Zeit nicht möglich, das Instrumentarium von Kapitel VII UN-Charta zum Schutz der Menschenrechte fruchtbar gemacht. Das hat sich jedoch seit der Somalia Krise Anfang der neunziger Jahre geändert. Bis zum Jahr 1992 gibt es keine entsprechende Praxis des Sicherheitsrates. Alle zuvor angeführten Fälle, insbesondere Südrhodesien, Südafrika (1977) und die Kurdenverfolgung (1991) belegen diese These nicht. Im Falle Südafrikas stand bei der Verhängung des Waffenembargos die aggressive Politik gegen die Nachbarstaaten im Vordergrund, während die Apartheidpolitik im Lande selbst, erkennbar nicht für die Feststellung des Tatbestandes von Art.39 ausreichen sollte. Im Falle der Kurdenverfolgung waren es die Flüchtlingsströme in den Iran und vor allem in die Türkei, die für diese Staaten politisch hoch brisant waren und deshalb die Gefahr militärischer Konflikte mit dem Irak heraufbeschworen. In der Somaliakrise hat der Sicherheitsrat 1992 seine bisherige zurückhaltende Praxis aber erkennbar aufgegeben. Es waren dort in erster Linie und wohl für die meisten Ratsmitglieder ausschließlich die Gräueltaten und das Elend der Menschen im Lande, die zur Feststellung einer Friedensbedrohung führten. Die internationalen Aspekte auch die Flüchtlingsströme in die Nachbarländer spielten demgegenüber keine entscheidende Rolle. Ähnlich verfuhr der Sicherheitsrat im Falle Ruandas und im Falle Haitis, wo ebenfalls die Konflikte im Lande ausschlaggebend für das Handeln gemäß Kapitel VII waren. Aus neuerer Zeit sind etwa die Resolutionen 1199 (1998), 1203 (1998) und 1244 (1999) zum Kosovokonflikt und die Resolutionen 1267 (1999), 1333 (2000) und 1363 (2001) zur Situation in Afghanistan zu nennen, in 81 denen der Sicherheitsrat zwar keinen militärischen Zwang angeordnet hat, wohl aber Wirtschaftsembargen verhängt hat. Nicht darunter fallen die Resolutionen aus dem Jahr 2001 zu Afghanistan (1337, 1378, 1386 und 1413), weil seit dem 11. September 2001 ein zwischenstaatlicher Konflikt vorliegt. Hier zeigt sich die zunehmende Bereitschaft des Rates, die Menschenrechte und das Selbstbestimmungsrecht der Völker neben der vom Gewaltverbot geschützten Souveränität der Staaten als Schutzgüter in Art.39 UN-Charta aufzunehmen. Ob das immer der Fall sein soll oder nur unter zusätzlichen Voraussetzungen, ist allerdings noch nicht geklärt. Im Rat selbst und unter den Mitgliedern im übrigen haben sich in diesen Fällen durchaus auch kritische Stimmen erhoben, die diese Praxis für unzulässig halten. Manche wollen sie auf ganz extreme Fälle der Ausrottung ganzer Bevölkerungsteile einhergehend mit dem vollständigen Zusammenbruch der Staatsgewalt, sog. failed state Doktrin beschränken. In diesen Fällen solle der Rat zur Wiederherstellung der staatlichen Ordnung zum Schutz der Bevölkerung intervenieren dürfen. Er wird dann quasi wie ein Treuhänder in einem nicht selbst handlungsfähigen Treuhandgebiet tätig, um die grundlegenden staatlichen Funktionen wiederherzustellen. Dies sei deshalb rechtlich unbedenklich, weil der betroffene failed state sich gegenüber dem Sicherheitsrat nicht auf das Interventionsund das Gewaltverbot berufen könne, solange es keine effektive Herrschaftsgewalt gebe. In dieses Schema passt dann aber der Haitikonflikt nicht, wo bei aller Schärfe der Maßnahmen des Regimes Cedras von einer Ausrottung des Volks nicht die Rede sein konnte und der Staat eher zu stark als zu schwach war. Dort sollen die Flüchtlingsströme einen internationalen Bezug hergestellt haben, der jedoch in Praxi viel zu schwach war, um die Qualität einer Friedensbedrohung zu erreichen. Die neue Praxis des Rates lässt sich nach dem Wortlaut und der Entstehungsgeschichte der Charta nicht ohne weiteres rechtfertigen. Wie gesehen wird der Friedensbegriff in Art.1 Nr.1 ausdrücklich von den Menschenrechten und dem Selbstbestimmungsrecht abgeschichtet. Dafür spricht auch das Verbot der Intervention in die inneren Angelegenheiten der Mitglieder Art.2 (7), dass als einzig wirksame Schranke gegen Zwangsmaßnahmen des Rates wirkt und deshalb nicht ohne weiteres zugunsten der zwangsweisen Einwirkung in innerstaatliche Konflikte aufgeweicht werden kann. Die failed state Doktrin ist abzulehnen. Solange ein Staat 82 Mitglied der UNO ist, genießt er alle Rechte aus der Charta. Ist er kein Staat mehr, muss er ausgeschlossen oder in Treuhand überführt werden. Außerdem könnte diese Doktrin dazu führen, dass auch dritte Staaten aus eigennützigen Gründen intervenieren ohne an das Gewaltverbot gebunden zu sein. Die Praxis des SR ist deshalb nur als ungeschriebene Fortentwicklung der Charta zu rechtfertigen. Dafür fehlt dem Sicherheitsrat als Organ jedoch die Kompetenz. Er ist bei allem Beurteilungsspielraum auf jeden Fall an Art.2 (7) gebunden und seine Beschlüsse sind, wie Art.25 in accordance with the present Charter zeigt, auch nur dann verbindlich, wenn sie dieses Prinzip beachten. Deshalb bedarf es des Konsenses aller Mitglieder, als der Herren der Verträge. Ob dieser Konsens allgemein besteht, ist nach wie vor nicht endgültig geklärt. Insbesondere die Haltung Chinas als ständigem Mitglied aber auch vieler kleinerer Staaten Lateinamerikas und Afrikas, die ähnliche Probleme wie die Betroffenen haben, zeigt, dass es noch erhebliche Vorbehalte gegen diese Praxis gibt. Die Zahl derjenigen Staaten, welche humanitäre Interventionen des Sicherheitsrates befürworten, nimmt jedoch ständig zu. Insbesondere in der westlichen Welt aber auch in Russland und in vielen Staaten Asiens und Afrikas wächst die Bereitschaft zur Akzeptanz dieser Praxis. Auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen hält sie für akzeptiert. Bei strenger Betrachtung müsste die subsequent practice jedoch von allen Mitgliedern getragen werden. Deshalb bleiben immer noch gewissen Zweifel. II. Nichtmilitärische Zwangsmaßnahmen zum Schutz der Menschenrechte In den neunziger Jahren sind im Jugoslawienkonflikt (Res 808 (1993) und 827 (1993) und im Ruandakonflikt Res 955 (1994) die Einsetzung von Strafgerichtshöfen zur Aburteilung von Kriegsverbrechern hinzugekommen. Dabei handelt es sich um Zwangsmaßnahmen, die sich sowohl an die Konfliktparteien aber auch an alle anderen Mitglieder wenden, die verpflichtet werden, Personen, denen bestimmte Straftaten vorgeworfen werden, an ein Internationales Tribunal zu überstellen, um diesem die Ausübung eigener Gerichtsbarkeit zu ermöglichen. Das im Anhang befindlich "Statute of the International Tribunal" (Abgedruckt in, ILM 1993, S.1192 ff.) enthält in den Artikeln 2 bis 5 die Straftatbestände, die unter die in 83 Artikel 1 umschriebene Jurisdiktion des Gerichtshofs fallen sollen. Dabei handelt es sich um schwere Verstöße gegen die Genfer Konvention von 1949 (Art. 2), Verletzungen der Vorschriften oder Gewohnheiten der Kriegsführung (Art. 3), Völkermord (Art. 4) und Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 5). Das Gericht ist gemäss Art.8 zuständig für alle Verstöße gegen diese Tatbestände, die seit dem 1. Januar 1991 auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien begangen wurden. Dabei ist es gemäss Art.7 des Statuts unerheblich, ob ein Angeklagter als Staatsoberhaupt, Mitglied einer Regierung oder ob er auf Weisung eines solchen Organs gehandelt hat. Der Gerichtshof besteht in der durch die Resolution 1329 (2000) am 30.11.2000 geänderten Fassung des Statuts aus Kammern, denen gemäss Art.12 des Statuts jeweils 16 Richter aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten angehören. Die Richter müssen gemäss Art.13 die Befähigung zu den höchsten Richterämtern in den Mitgliedstaaten, die sie entsenden, haben. Die Kammern gliedern sich in Spruchkörper erster Instanz und eine Appellationskammer. Bei der Appellation handelt es sich gemäss Art.25 um ein Berufungsverfahren, da nicht nur Rechtsfehler sondern auch eine fehlerhafte Tatsachermittlung gerügt werden kann. Die Appellationskammer des Jugoslawientribunals ist gemäss Art.13 Abs.4 in der geänderten Fassung auch für Berufungen gegen Entscheidungen des Ruandatribunals zuständig. Gemäss Art.16 wird eine Anklagebehörde eingerichtet, die als eigenständige und unabhängige Behörde für die Untersuchung und die Anklage der Kriegsverbrechen vor dem Tribunal verantwortlich ist. Der Ankläger wird vom Sicherheitsrat auf Antrag des Generalsekretärs bestellt. Als Strafe sieht Art.24 nur die Freiheitsstrafe vor. Daneben kann die Rückgabe durch Straftaten erworbenen Vermögens angeordnet werden. Die Freiheitsstrafe wird gemäss Art.27 in einem Staat vollzogen, der sich dazu bereit erklärt hat. Dies sind die Niederlande. Die Staaten sind nach Art. 29 (2) verpflichtet, jeder Bitte des Gerichtshofs um Unterstützung bei seiner Tätigkeit unverzüglich Folge zu leisten. Darunter fällt insbesondere die Verhaftung und Überstellung von Angeklagten. Die zentrale Vorschrift für das Verhältnis zur nationalen Strafgerichtsbarkeit ist Art.9. Der Gerichtshof nimmt für sich nach Art. 9 (1) des Statuts über den internationalen 84 Gerichtshof eine neben den nationalen Gerichtshöfen bestehende Gerichtsbarkeit in Anspruch. Diese Gerichtsbarkeit ist gemäß Art. 9 (2) Satz 1 der Gerichtsbarkeit der nationalen Gerichten übergeordnet. Gemäß Art. 9 (2) Satz 2 des Statuts sind die nationalen Gerichte verpflichtet, ihre Gerichtsbarkeit auf den internationalen Strafgerichtshof zu übertragen. In Art. 9 (2) wird die Stellung des Gerichtshofs gegenüber den nationalen Gerichten der Mitgliedstaaten beschrieben. Darin heißt es: "2. The international Tribunal shall have primacy over national courts. At any stage of the procedure, the International Tribunal may formally request national courts to defer to the competence of the International Tribunal in accordance with the present Statute and the Rules of Procedure and Evidence of the international Tribunal." Damit begründet das Statut eine doppelte Zuständigkeit des Gerichtshof einmal als eigene und zum anderen als eine von den Zuständigkeiten der nationalen Gerichte abgeleitete Gerichtsbarkeit. Soweit das Statut eine eigene Zuständigkeit des Gerichtshofs begründet, ist dies nur möglich, wenn die in dem Statut aufgeführten Straftatbestände unmittelbare Anwendung auf Individuen finden. Dagegen basiert die von den nationalen Gerichten abgeleitete Gerichtsbarkeit auf den jeweiligen innerstaatlichen Normen des materiellen Strafrechts und des Verfahrensrechts, die in Vollzug der völkerrechtlichen Verpflichtungen aus den Verträgen über das internationale Strafrecht geschaffen worden sind. Mit dem Wesen des Völkerrechts ohne weiteres vereinbar ist nur die zweite Konstruktion. Da die völkervertraglichen Verpflichtungen sich grundsätzlich nur an die Staaten als deren Subjekte wenden können, vermag erst der innerstaatliche Vollzugsakt eine strafrechtliche Bindung von Individuen zu erzeugen. Diesen staatlichen Strafanspruch gegenüber den auf seinem Territorium befindlichen Bürgern muss der Mitgliedstaat, der eine Person wegen Taten im Zusammenhang mit dem Jugoslawienkonflikt vor Gericht gestellt hat, auf den internationalen Strafgerichtshof übertragen. Insoweit handelt es sich bei der Einrichtung des internationalen Strafgerichtshofs um eine nichtmilitärische Zwangsmaßnahme, für die als Rechtsgrundlage Art. 41 UN-Charta in Betracht kommt. Soweit der internationale Strafgerichtshof eigene Gerichtsbarkeit in Anspruch nimmt, entsteht völkerstrafrechtlich das Problem, ob bestimmte Tatbestände auch ohne Vollzugsakt unmittelbar auf das Verhalten von Individuen anwendbar sind. Er gilt ohne weiteres nicht für die Genfer Abkommen. Diese enthalten etwa in Art. 129 III. 85 GK die Verpflichtung der Staaten, in ihrem nationalen Recht Straftatbestände zu schaffen. Sie begründen aber keine völkerrechtliche Strafbarkeit. Darüber hinaus enthalten die Genfer Konventionen genauso wie die Haager LKO nur Verpflichtungen der Staaten nicht aber der Individuen. Die Völkermordkonvention sieht eine individuelle Verantwortlichkeit vor, diese muss jedoch im innerstaatlichen Recht geltend gemacht werden oder dem einzurichtenden internationalen Gerichtshof vorgelegt werden. Dieser ist bisher nicht eingerichtet worden. Immerhin zeigt diese Regel zusammen mit Art. VIII, der eine Zuständigkeit der UNO zur Verfolgung von Völkermord festschreibt, dass es sich hier um einen international crime handelt. Der Gedanke völkerstrafrechtlicher Verantwortlichkeit hat sich praktisch vor allem in den Kriegsverbrecherprozessen von Nürnberg und Tokio Bahn gebrochen, auf welche der Rat nach der Äußerung der amerikanischen Delegierten ALBRIGHT mit dem Erlass der Resolutionen 808 und 827 (1993) Bezug nehmen will. Dort hat er insbesondere zu dem Tatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit geführt. Dieser Tatbestand war jedoch, weil es sich um einseitig festgesetztes Siegerrecht handelte, immer umstritten. Daran anzuknüpfen, war deshalb nicht unproblematisch. Wenn man der allerdings umstrittenen These folgt, dass dadurch gewohnheitsrechtlich unmittelbar anwendbares Völkerstrafrecht geschaffen worden ist, so stellt die Inanspruchnahme von Strafgewalt für sich genommen keinen Eingriff in eine innerstaatliche Zuständigkeit und deshalb keine Zwangsmaßnahme dar. Wohl nicht in diesem Zusammenhang relevant ist die Konvention von Rom aus dem Jahr 1998 über die Errichtung eines internationalen Strafgerichtshofs, die im April 2002 in kraft getreten ist (zur Zeit 66 Ratifikationen). Zwar enthält auch diese Konvention entsprechende Straftatbestände. Sie ist jedoch ratione temporis nicht auf die Taten in Jugoslawien und Ruanda anwendbar. Zudem gilt hier der Satz „nulla poena sine lege“, den man entgegen der im Zusammenhang mit den Tribunalen von Nürnberg und Tokio geäußerten und auf die Geltung von Naturrecht gegründeten Auffassung nicht ohne weiteres außer Kraft setzen kann. Ob zukünftige Straftribunale auf der Grundlage von Art.41 UN-Charta hierauf zurück greifen können, ist ebenfalls fraglich. Die Konvention ist nicht Teil des Systems der UN. Da einige wichtige Staaten, wie etwa die USA sich standhaft weigern, sie zu ratifizieren, ist zudem ihre Geltung als Gewohnheitsrecht in Frage zu stellen. In den USA ist im Juni 2002 ein Gesetz zum 86 Schutz amerikanischer Soldaten im Kongress verabschiedet worden, dass allen US Behörden jegliche Zusammenarbeit mit dem Straftribunal verbietet und sogar eine militärische Intervention der Streitkräfte im Haag für den Fall vorsieht, dass amerikanische Soldaten vor dem internationalen Strafgerichtshof zur Verantwortung gezogen werden. Der Charakter als Zwangsmaßnahme ergibt sich für die Straftribunale der UNO daraus, dass die Staaten gemäß Artikel 29 des Statuts verpflichtet sind, dem Gerichtshof jede von diesem gewünschte Hilfe, insbesondere die Festnahme und Überstellung von mutmaßlichen Kriegsverbrechern zu leisten. Voraussetzung für die Verhängung jeglichen Zwangs auf der Grundlage von Art.41 UN-Charta ist gemäß dem Wortlaut von Art.39 aber, dass dieser Zwang geeignet ist, den internationalen Frieden aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Das bedeutet, dass die jeweilige Maßnahme einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Konflikt haben muss, den der Sicherheitsrat als Friedenbedrohung oder -bruch einstuft. Dabei können solche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Friedens auch über die Beendigung eines Konflikts hinaus andauern, wenn ohne ihre Durchführung ein erneuter Ausbruch zu befürchten ist. Diese Eignung lässt sich auch für die Internationalen Straftribunale unterstellen, da die Aburteilung von Kriegsverbrechern geeignet ist, einen Konflikt einzudämmen und einen erneuten Ausbruch zu verhindern. Allerdings kann das Tribunal auf der Grundlage von Kapitel VII nur solange tätig sein, wie dies zur Befriedung des ehemaligen Jugoslawien notwendig ist. Eine davon abgehobene justizförmige Aufarbeitung des begangenen Unrechts ist nicht möglich. III. Militärische Zwangsmaßnahmen Militärische Zwangsmaßnahmen zum Schutz der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen sind heute von der Staatengemeinschaft akzeptiert. 1. Der Fall Somalia Der erste und wichtigste Fall einer humanitären Intervention des Sicherheitsrats ist der Fall Somalia, der sich in mehrere Phasen gliedert. a. Die Operation restore Hope 87 Die erste militärische Zwangsmaßnahme ist die Operation Restore Hope auf der Grundlage der Resolution 794 (1992). Darin heißt es: "The Security Council... Recognizing the unique character of the present situation in Somalia and mindful of its deteriorating, complex and extraordinary nature, requiring an immediate and exceptional response, Determining that the magnitude of the human tragedy caused by the conflict in Somalia, further exacerbated by the obstacles being created to the distribution of humanitarian assistance, constitutes a threat to international peace and security... 10. Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, authorizes the Secretary-General and Member States cooperating to implement the offer referred to in paragaph 8 above to use all necessary means to establish as soon as possible a secure environment for humanitarian relief operations in Somalia; 11. Calls on Member States which are in a position to do so to provide military forces and to make additional contributions, in cash or kind, in accordance with paragraph 10 above and requests the Secretary-General to establish a fund through which the contributions, where appropriate, could be challenged to the States or operations concerned; Am 9. Dezember 1992 landen amerikanische Marineinfanteristen in der Nähe von Mogadischu. An der Operation "Restore Hope" beteiligen sich neben den Streitkräften der Vereinigten Staaten, die mit 21.000 Mann das Hauptkontingent stellen, Verbände aus zwanzig Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, darunter auch Truppen der ehemaligen Kolonialmächte Vereinigtes Königreich und Italien. Das Ziel der United Nations Task Force (UNITAF) ist es zunächst, in drei Phasen die Kontrolle über Mogadischu zu übernehmen, was am 16. Dezember erreicht wird, die acht wichtigsten Plätze für die Verteilung von Hilfsgütern zu kontrollieren, was am 28. Dezember erreicht wird, und die Zufahrtswege für die Hilfstransporte zu sichern. Der UN-Generalsekretär versteht den Auftrag an die UNITAF jedoch deutlich weiter. In seinem ersten Bericht zur Resolution 794 (1992) nennt er als Aufgaben der UNITAF über die Sicherstellung der humanitären Hilfslieferungen hinaus die 88 Überwachung der getroffenen Waffenstillstandsvereinbarungen, die notfalls gewaltsame Verhinderung des Ausbruchs neuer Gewalttätigkeiten und die Entwaffnung der organisierten Konfliktparteien. b. Die Einrichtung von UNOSOM II Auf der Grundlage der Resolution 814 (1993) werden dann die Aufgaben der UNITAF auf die UNOSOM II übertragen. Die in der UNITAF zusammengeführten Mitgliedstaaten unterstellen am 4. Mai 1993 ihre Truppen den Vereinten Nationen. Das Oberkommando über diese Streitkräfte, das zuvor der amerikanischen Gerneral JOHNSTON innehatte, geht auf den türkischen General BIR über, die Hoheitszeichen der Mitgliedstaaten werden durch die Zeichen der Vereinten Nationen (Blauhelme) ersetzt. Am 5. Juni werden Soldaten der UNOSOM II, die ein Waffenlager inspizieren wollen, von Einheiten General AIDID'S angegriffen und dreiundzwanzig pakistanische Angehörige der UNOSOM II werden getötet. Am 18. November 1993 verlängert der Rat in der Resolution 886 (1993) das Mandat von UNOSOM II bis zum 31. Mai 1994 und kündigt für den 1. Februar 1994 eine grundlegende Überprüfung des Mandats von UNOSOM II an. Am 4. Februar 1994 finden diesbezüglich Beratungen im Sicherheitsrat statt, die zum einstimmigen Erlaß der Resolution 897 (1994 ) führen. Im März 1994 ziehen viele europäische Staaten und die Vereinigten Staaten von Amerika den größten Teil ihrer Blauhelmsoldaten aus Somalia ab. Am 24. März 1994 vereinbaren die Waffenstillstand Parteien und des die Somaliakonflikts Einberufung in einer Nairobi einen weiteren erneuten nationalen Versöhnungskonferenz nach Mogadischu. Im Mai 1994 brechen in Mogdischu erneut Kämpfe zwischen den Anhängern von General AIDID und von Präsident ALI MOHAMMED aus. Mehrere Angehörige von UNOSOM II werden dabei getötet, und deren Stützpunkt Belet Huen wird von Somalis besetzt. Am 4. November 1994 erläßt der Sicherheitsrat die Resolution 954 (1994), in der das Mandat der UNOSOM bis zum Jahr 1995 und stellt dabei fest, „dass das Ausbleiben von Fortschritten im somalischen Friedensprozess und bei der nationalen Aussöhnung, insbesondere das Ausbleiben einer entsprechenden 89 Zusammenarbeit von Seiten der somalischen Parteien in Sicherheitsfragen, die Ziele der Vereinten Nationen in Somalia grundlegend in Frage gestellt hat und dass unter diesen Umständen die Beibehaltung der UNOSOM II über März 1995 hinaus nicht gerechtfertigt werden kann... Ende März 1995 werden die letzten Soldaten von UNOSOM II aus Somalia abgezogen. Die Kämpfe zwischen den Stammesgruppen, vor allem zwischen den Anhängern von General AIDID und Präsident ALI MOHAMMED werden danach unvermindert fortgesetzt. Somalia hat nach wie vor keine zentrale Regierung, und das Schicksal der von der Staatengemeinschaft nicht anerkannten Republik Somaliland, in der MOHAMMED EGAL den vormaligen Präsidenten AHMED ALI abgelöst hat, bleibt ungeklärt. In diesem Fall hat der Sicherheitsrat militärischen Zwang verhängt, ohne vorher gegenüber der Regierung eines Mitglieds eine verbindliche Anordnung gemäß Art.40 getroffen zu haben. In der Res.794 (1992) hat zur Schaffung eines sicheren Umfelds für die Verteilung von Hilfsgütern in Somalia militärischen Zwang angeordnet. Dabei stützte er sich nur auf zuvor an die in Somalia kämpfenden Konfliktparteien gerichtete Aufforderung zur Feuereinstellung. Da diese Konfliktparteien aber nicht anerkannt waren, hatten sie keinen völkerrechtlichen Status und konnten deshalb auch nicht für Verletzungen der Charta verantwortlich gemacht werden. Die Verpflichtungen aus dem Gewaltverbot oder zur Beachtung der Menschenrechte können nur die Regierungen von Staaten oder sonstige völkerrechtlich anerkannte Gruppierungen erfassen. Der militärische Zwang hatte in diesem Fall eher den Charakter einer zwangsweisen Fremdverwaltung durch die Vereinten Nationen. Vergleichbares gilt etwa für die operation turquoise in Ruanda S/Res 929 (1994). B. Humanitäre Interventionen der Mitgliedstaaten I. Die humanitäre Intervention zugunsten eigener Staatsbürger Besonders deutlich wird dies am Recht zur humanitären Intervention zugunsten eigener Staatsbürger. Diese wird insbesondere in zwei Fallkonstellationen akut. Zum einen können Bürgerkriege auf Gefahren von Leib oder Leben von Ausländern erzeugen, wie etwa die Kongo Krise von 1960 bis 1963 und der Ruanda Konflikt von 1993 bis1994 zeigen. Zum anderen können Terroristen mit Billigung einer Regierung 90 Geiseln nehmen, um politischen Ziele zu erreichen. Dies geschah etwa in Entebbe im Jahr 1976 oder in der US Botschaft in Teheran im Jahr 1980. Dieses Recht zur humanitären Intervention ist in all diesen Fällen von den betroffenen Staaten geltend gemacht worden. Dies hat etwa in der Kongokrise auch die Zustimmung des Sicherheitsrates gefunden, es haben aber auch immer wieder Staaten dagegen protestiert. Die Geltung als Satz des Völkergewohnheitsrechts ist deshalb nicht unumstritten, kann aber mit guten Gründen vertreten werden. II. Die humanitäre Intervention zugunsten fremder Staatsbürger Die humanitäre Intervention zugunsten fremder Staatsbürger: Darunter versteht man den Einsatz von Waffengewalt zum Schutz von Menschen in einem anderen Staat vor massiven Verletzungen ihrer Rechte insbesondere auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Ein solches Recht zur humanitären Intervention ist etwa bei der Invasion Vietnams in Kambodscha im Jahr 1979, bei der Invasion Tansanias in Uganda im Jahr 1979, bei der Intervention von Truppen der Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten (ECOWAS) im August 1990 in Liberia und bei der Einrichtung der Flugverbotszone im Norden des Irak und zugunsten der dort lebenden Kurden behauptet worden. Die humanitäre Intervention soll dann zulässig sein, wenn fundamentale Menschenrechte massiv verletzt werden alle friedlichen Mittel erfolglos erschöpft worden sind, das Sanktionensystem der UNO erfolglos blieb und der Waffeneinsatz verhältnismäßig ist. Bei genauer Betrachtung der beschriebenen Praxis wird jedoch deutlich, dass die Staaten ein solches Recht zur humanitären Intervention nicht in Anspruch genommen haben. Die Aktionen erfolgten durchweg vor dem Hintergrund sich anbahnender zwischenstaatlicher Konflikte. Deshalb ging man bisher davon aus, dass es ein Recht zur humanitären Intervention für die Staaten nicht geben kann. Ernsthaft behauptet wird ein solches Recht nur für den UN-Sicherheitsrat, der in den Fällen Somalia, Ruanda, Haiti und ehemaliges Jugoslawien Zwangsmaßnahmen zum Schutz von Menschenrechten verhängt hat. 91 In neuerer Zeit ist ein solches Recht jedoch von den Mitgliedstaaten der NATO behauptet worden, als der NATO-Rat im Herbst 1998 beschlossen hat, der Bundesrepublik Jugoslawien für den Fall mit der Anwendung von Waffengewalt zu drohen, dass die Militäraktionen im Kosovo nicht eingestellt werden. Zur Begründung hat sich der NATO Rat wesentlich auf die massive Verletzung der Menschenrechte der Kosovo Albaner berufen. Dogmatisch wird hier teilweise eine Ausweitung des Selbstverteidigungsrechts behauptet mit der Begründung, dass die Menschenrechte erga omnes wirken und deshalb jeder Staat durch ihrer Verletzung in eigenen Rechten betroffen sei und notfalls auch das Recht zur bewaffneten Intervention daraus ableiten könne. Teilweise wird eine tatbestandliche Reduktion des Gewaltverbots behauptet, die wenn man Art.51 UN-Charta als Rechtfertigungsgrund ansieht, nur in Art.2 (4) UN-Charta wirksam werden kann. Diese Auffassung ist aber insbesondere von der Russischen Föderation, der Volksrepublik China, Südafrika und Indien abgelehnt worden. Wegen der universellen Geltung des Gewaltverbots und des Selbstverteidigungsrechts muss eine tatbestandliche Begrenzung des Gewaltverbots oder eine tatbestandliche Ausweitung des Selbstverteidigungsrechts ebenfalls universell anerkannt sein. Davon kann wegen der Haltung dieser Staaten nicht die Rede sein, da sie maßgebliche Repräsentanten verschiedener Rechts- und Kulturkreise sind. Deshalb kann ein solches weites Recht der Staaten zur humanitären Intervention nicht angenommen werden.