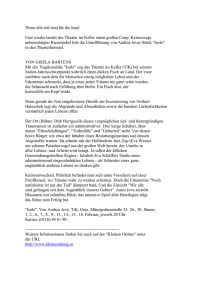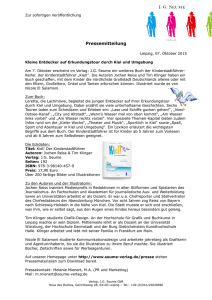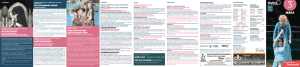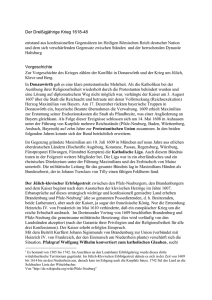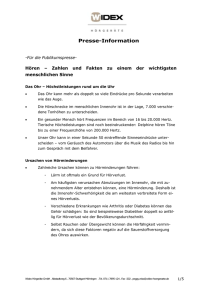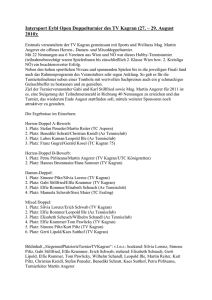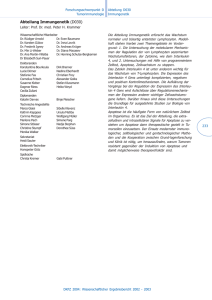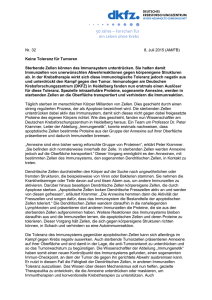Köln, 1773
Werbung
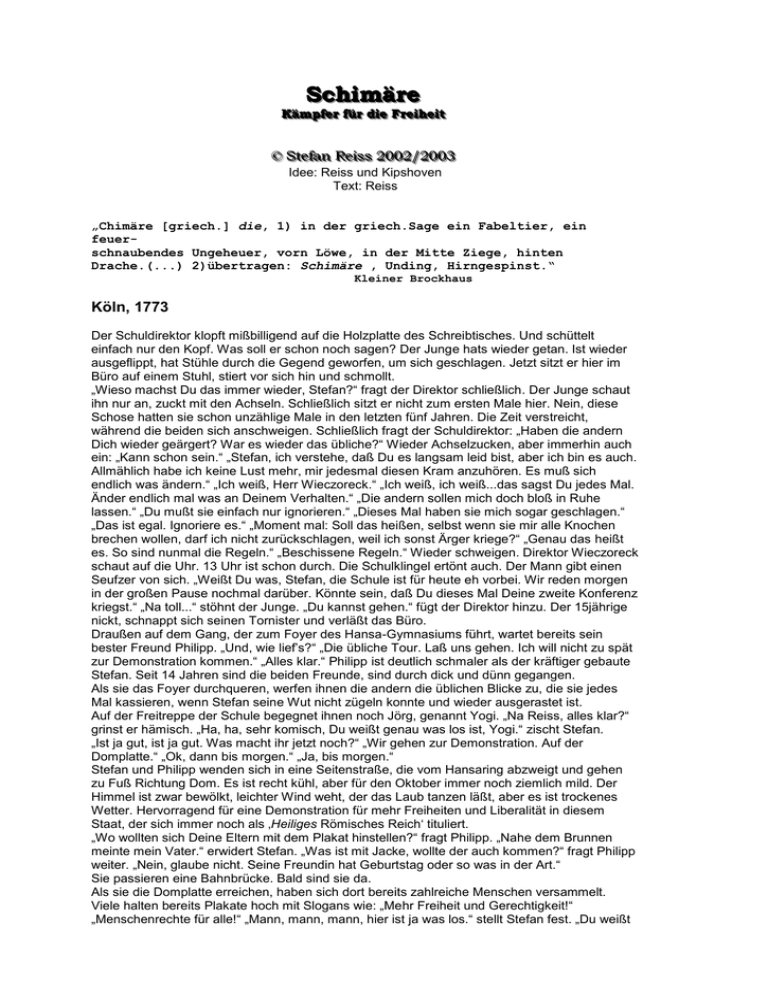
S Scch hiim määrree K Kääm mppffeerr ffüürr ddiiee FFrreeiihheeiitt © © SStteeffaann R Reeiissss 22000022//22000033 Idee: Reiss und Kipshoven Text: Reiss „Chimäre [griech.] die, 1) in der griech.Sage ein Fabeltier, ein feuerschnaubendes Ungeheuer, vorn Löwe, in der Mitte Ziege, hinten Drache.(...) 2)übertragen: Schimäre , Unding, Hirngespinst.“ Kleiner Brockhaus Köln, 1773 Der Schuldirektor klopft mißbilligend auf die Holzplatte des Schreibtisches. Und schüttelt einfach nur den Kopf. Was soll er schon noch sagen? Der Junge hats wieder getan. Ist wieder ausgeflippt, hat Stühle durch die Gegend geworfen, um sich geschlagen. Jetzt sitzt er hier im Büro auf einem Stuhl, stiert vor sich hin und schmollt. „Wieso machst Du das immer wieder, Stefan?“ fragt der Direktor schließlich. Der Junge schaut ihn nur an, zuckt mit den Achseln. Schließlich sitzt er nicht zum ersten Male hier. Nein, diese Schose hatten sie schon unzählige Male in den letzten fünf Jahren. Die Zeit verstreicht, während die beiden sich anschweigen. Schließlich fragt der Schuldirektor: „Haben die andern Dich wieder geärgert? War es wieder das übliche?“ Wieder Achselzucken, aber immerhin auch ein: „Kann schon sein.“ „Stefan, ich verstehe, daß Du es langsam leid bist, aber ich bin es auch. Allmählich habe ich keine Lust mehr, mir jedesmal diesen Kram anzuhören. Es muß sich endlich was ändern.“ „Ich weiß, Herr Wieczoreck.“ „Ich weiß, ich weiß...das sagst Du jedes Mal. Änder endlich mal was an Deinem Verhalten.“ „Die andern sollen mich doch bloß in Ruhe lassen.“ „Du mußt sie einfach nur ignorieren.“ „Dieses Mal haben sie mich sogar geschlagen.“ „Das ist egal. Ignoriere es.“ „Moment mal: Soll das heißen, selbst wenn sie mir alle Knochen brechen wollen, darf ich nicht zurückschlagen, weil ich sonst Ärger kriege?“ „Genau das heißt es. So sind nunmal die Regeln.“ „Beschissene Regeln.“ Wieder schweigen. Direktor Wieczoreck schaut auf die Uhr. 13 Uhr ist schon durch. Die Schulklingel ertönt auch. Der Mann gibt einen Seufzer von sich. „Weißt Du was, Stefan, die Schule ist für heute eh vorbei. Wir reden morgen in der großen Pause nochmal darüber. Könnte sein, daß Du dieses Mal Deine zweite Konferenz kriegst.“ „Na toll...“ stöhnt der Junge. „Du kannst gehen.“ fügt der Direktor hinzu. Der 15jährige nickt, schnappt sich seinen Tornister und verläßt das Büro. Draußen auf dem Gang, der zum Foyer des Hansa-Gymnasiums führt, wartet bereits sein bester Freund Philipp. „Und, wie lief’s?“ „Die übliche Tour. Laß uns gehen. Ich will nicht zu spät zur Demonstration kommen.“ „Alles klar.“ Philipp ist deutlich schmaler als der kräftiger gebaute Stefan. Seit 14 Jahren sind die beiden Freunde, sind durch dick und dünn gegangen. Als sie das Foyer durchqueren, werfen ihnen die andern die üblichen Blicke zu, die sie jedes Mal kassieren, wenn Stefan seine Wut nicht zügeln konnte und wieder ausgerastet ist. Auf der Freitreppe der Schule begegnet ihnen noch Jörg, genannt Yogi. „Na Reiss, alles klar?“ grinst er hämisch. „Ha, ha, sehr komisch, Du weißt genau was los ist, Yogi.“ zischt Stefan. „Ist ja gut, ist ja gut. Was macht ihr jetzt noch?“ „Wir gehen zur Demonstration. Auf der Domplatte.“ „Ok, dann bis morgen.“ „Ja, bis morgen.“ Stefan und Philipp wenden sich in eine Seitenstraße, die vom Hansaring abzweigt und gehen zu Fuß Richtung Dom. Es ist recht kühl, aber für den Oktober immer noch ziemlich mild. Der Himmel ist zwar bewölkt, leichter Wind weht, der das Laub tanzen läßt, aber es ist trockenes Wetter. Hervorragend für eine Demonstration für mehr Freiheiten und Liberalität in diesem Staat, der sich immer noch als ‚Heiliges Römisches Reich‘ tituliert. „Wo wollten sich Deine Eltern mit dem Plakat hinstellen?“ fragt Philipp. „Nahe dem Brunnen meinte mein Vater.“ erwidert Stefan. „Was ist mit Jacke, wollte der auch kommen?“ fragt Philipp weiter. „Nein, glaube nicht. Seine Freundin hat Geburtstag oder so was in der Art.“ Sie passieren eine Bahnbrücke. Bald sind sie da. Als sie die Domplatte erreichen, haben sich dort bereits zahlreiche Menschen versammelt. Viele halten bereits Plakate hoch mit Slogans wie: „Mehr Freiheit und Gerechtigkeit!“ „Menschenrechte für alle!“ „Mann, mann, mann, hier ist ja was los.“ stellt Stefan fest. „Du weißt doch wie das ist.“ Sie gehen am Rande der Domplatte entlang. Philipp bleibt kurz stehen, kramt ein bißchen Kleingeld hervor. „Wart mal Stefan, ich besorg mir was zu trinken.“ „Gute Idee, bringste mir eine Cola mit?“ „Sicher. Suchst Du mal Deine Alten?“ „Hatte ich vor.“ „Ok, bis gleich.“ Philipp hält sich weiter an die Fußgängerzone um einen Kiosk zu suchen, während Stefan weiter die Domplatte umrundet, um zum Brunnen an der Südseite zu kommen. Schon sieht er den Brunnen, um den sich bereits viele Menschen scharren. Die Menschenmenge reicht fast bis zum Germanischen Museum. Und über allem ragt der Dom auf. Endlich sieht Stefan, wie seine Eltern auf den Rand des Brunnens klettern. Seine Mutter, eine schmale Frau mit kurzen dunklen Haaren, winkt ihm zu. Er nickt nur zurück, muß sich erstmal einen Weg dorthin bahnen, wobei der Schultornister eher hinderlich ist. Und die Sache mit dem Direktor würde er ihr erst später erzählen. Philipp hat nach 50 m endlich noch einen Kiosk gefunden, der trotz der Demo offen hat. Kauft sich schnell einen Orangensaft und eine Cola für Stefan. Als er nach draußen tritt, sieht er in einer Seitengasse einen Jungen verschwinden. Yogi? Was macht der denn hier? Vorsichtig schleicht Philipp bis an die Ecke zur Gasse und schaut um diese. Yogi unterhält sich mit einem Mann in schwarzer Uniform. „Danke Junge, Deine Informationen waren wirklich sehr hilfreich. Hier, Dein Lohn.“ Der Mann reicht Yogi mehrere Geldscheine. Philipp macht vorsichtig ein paar Schritte zurück, weg von der Gasse. „Scheiße, Mann, scheiße...“ Die Uniform des Mannes hat er erkannt: Kaiserliche Geheimpolizei, kurz Gepo. Die Typen sind in ihren Befugnissen zwar auf die Reichsstädte und die Habsburger Territorien innerhalb des Reiches begrenzt, aber Köln ist Reichsstadt. Und wo die Gepos losgelassen werden, gibt es Ärger. Und Freunde der Liberalen sind diese Typen sicher nicht... Philipp rennt los. Auf dem Dach des Germanischen Museums rennen Soldaten des Reichsheeres geduckt zum Rand und gehen dort in Stellung mit ihren Gewehren. Aus der Luke, die aufs Dach führt, klettern zuletzt zwei Männer in Offiziersuniformen – ein Brigadegeneral und ein Standartenführer, ersterer vom Heer, letzter von der Geheimpolizei. Brigadegeneral Heinrich von Klettenberg ist nervös. „Verdammt, muß das wirklich sein? Kann das nicht wie üblich die gewöhnliche Polizei erledigen?“ fragt er seine Begleitung über die Schulter hinweg. Standartenführer Gerd Helldrich zündet sich in aller Ruhe eine Zigarette an, stößt den Rauch aus, als die beiden stehenbleiben und erwidert dann: „Wien will der Liberalenbewegung endgültig einen Schlag versetzen. Keine Sorge. Meine Leute werden Ihnen helfen. Haben die Soldaten Seitenstraßen und Bahnstationen blockiert?“ „Ja, haben Sie.“ „Gut. Machen Sie sich keine Sorgen.“ „Mein Gott, der Bischof hat sich schon beschwert!!“ „Und, soll er doch!“ Helldrich wirft noch einen Blick auf die Soldaten, die am Dachrand liegen, die Gewehre im Anschlag. „Ok, lassen Sie schießen.“ Stefan hat sich fast bis zum Brunnen durch die Menge gekämpft, als er hinter sich aufgeregte Rufe hört und dann am Tornister gezogen wird. Er wirbelt herum. Philipp steht keuchend vor ihm. „Wir stecken in der Klemme.“ stöhnt er. „Gepos.“ „Gepos, wo?“ ächzt Stefan. Da peitschen schon die ersten Schüße. Sofort gellen Schreie auf und die Menge gerät in Panik. Die Menschen werfen ihre Transparente hin und rennen los, alles rennt durcheinander. Als die Soldaten auch das Feuer auf diejenigen eröffnen, die in die nahe Bahnstation eindringen wollen, wendet sich die Masse zur Hohe Straße, doch dort haben inzwischen schwarze Lastwagen den Weg blockiert, von denen Gepos springen und sofort das Feuer eröffnen. Die Menge strömt wieder zurück, blutüberströmte, leblose Körper am Boden zurücklassend. Durch die in Panik geratene Menge, in die nun Soldaten und Gepos erst hineinfeuern, bevor sie mit Schlagstöcken auf sie losgehen, versuchen sich Philipp und Stefan zu kämpfen. Ihre Schulranzen haben sie längst abgeworfen. Jetzt erreichen sie den Brunnen. Das Wasser färbt sich allmählich rot. Stefan springt trotzdem rein, entdeckt seine Eltern. „Neeeeiiin!!“ „Verdammt, Stefan, wir müssen weg hier!“ brüllt Philipp. Stefan packt seinen Vater, als dieser sich noch bewegt. Der Mann hält die Hand seines Sohnes kurz fest. „Kämpfe...weiter...mein Junge...für die Freiheit...“ „Ja, das werde ich...“ Dann sinkt die Hand seines Vaters ins rote Wasser zurück. Stefan starrt nur darauf. Erst nach einigen Momenten reißt ihn Philipp weg und damit zurück in die Wirklichkeit. Um sie herum schlagen Kugeln ins Wasser. Sie springen wieder aus dem Brunnen und rennen los. Los über den Roncalliplatz. Bloß nicht nach hinten sehen oder allzu lange nachdenken. Kugeln schlagen in den Boden, denn auch andere Demonstranten rennen in diese Richtung und die Soldaten haben sich eingeschossen. Aber auch wo es vom Platz runter auf die nächste Querstraße geht, auch dort stehen Gepos. Im letzten Moment entdeckt Philipp die Einkaufspassage, die rechts zur Hohestraße abgeht – und nicht abgesperrt ist! Die Behörden müssen das einfach vergessen haben! Sofort zerrt er Stefan in diese Richtung, der es nun auch sieht. Sie rennen hinein. Kommen auf der Hohe Straße hinter den Lastwagen der Gepos wieder raus und wenden sich nach Süden. Rennen und rennen. Hinter ihnen Schüsse, Rufe. Um die nächste Ecke. Und um noch eine... Die Abendsonne geht im Westen hinter der Baumreihe und dem Bahndamm unter. Stefan sitzt am Kiesufer des Baggerlochs in seinem Heimatstadtteil Weidenpesch. Ein kalter Wind weht. „Im Radio haben sie gerade gesagt, Polizei und Armee hätten einen vom Ausland inszenierten Putschversuch niedergeschlagen.“ sagt eine Mädchenstimme hinter ihm. Und dann setzt sich Karo, Stefans beste Freundin neben ihn. Sagt nichts. Schaut ihn nur an. Schließlich fragt sie: „Was willst Du nun tun?“ Er wirft ihr einen leeren Blick zu. Schließlich steht sie wieder auf und geht zurück zu Philipp, der zehn Meter entfernt steht. „Meditiert er?“ fragt er Karo. „Ich glaube. Aber red Du besser mit ihm.“ Noch einmal schaut sie zu Stefan rüber. „Ich muß wieder nach hause. Wir sehn uns morgen.“ „Is gut Karo.“ Sie geht, Philipp bleibt stehen. Nach einer Weile, als man ihm Zwielicht nur noch wenige Meter weit sehen kann, hebt Stefan eine Hand. Philipp kommt rüber und setzt sich neben ihn. „Und Kumpel, was jetzt?“ „Du kennst mich doch, Philipp. Ich bin traurig, ich bin wütend. Was bietet sich Deiner Meinung nach an?“ „Rache.“ „Genau.“ „Und wie willst Du das machen? Yogi in den Rhein werfen?“ „Nein. Dafür sorgen, daß ich den letzten Wunsch meines Vaters erfülle: weiter für die Freiheit kämpfen.“ „Toller Plan. Und wie willst Du das machen?“ Während Stefan über die Antwort auf diese Frage nachdenkt, schaut er auf die Wasserfläche des Baggersees hinaus. Schließlich sagt er mit trauriger, zitternder Stimme: „Oh, ich hab eine Idee. Vor ein paar Tagen hörte ich von der Äußerung eines Armeeoffiziers, der Traum von Freiheit und Demokratie sei nur eine Schimäre, ein Hirngespinst.“ „Und?“ „Ich bin dafür, daß wir ihnen mal zeigen, wie furchterregend eine Schimäre sein kann.“ Eine lange Pause. Philipp schaut auf die Uhr. „Komm, es ist schon spät. Du kannst erstmal bei uns wohnen.“ „Danke.“ „Nichts zu danken.“ Die beiden Jungen stehen auf und machen sich auf den Weg raus aus dem Baggerloch. Sie hatten keine Ahnung, wohin sie die Entscheidung, Rache zu üben, bringen würde... 15 Jahre später, 1788 Seit 1787 führt der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches zusammen mit seinen Verbündeten außerhalb des Reiches einen Krieg, der sich schnell ausgeweitet hat und in dem es um die Vorherrschaft in Europa geht. Im Reich selber hat der Kaiser eine zentralistische Diktatur errichtet, während der Krieg seit dem Kriegseintritt Großbritanniens auf Seiten der antikaiserlichen Allianz und Chinas auf Seiten der vom Kaiser angeführten Koalition zum Weltkrieg geworden ist. Die Zahl der Kriegsopfer hat inzwischen die Millionengrenze deutlich überschritten. Und trotz einiger kurzfristiger, lokaler Siege der Alliierten scheint kaum noch etwas den Sieg der Kaiserlichen und damit die Unterjochung Europas, wenn nicht gar der Welt aufhalten zu können... Sonntag, der 5. Oktober Die Regentropfen laufen langsam, in sich verzweigenden Bahnen die Fensterscheiben des Konferenzraums herunter. Reichsführer Helldrich haßt das Prager Wetter, das seiner Ansicht nach meist noch schlechter als das Wetter in Wien ist. Aber was solls, Feldmarschall Klettenberg hat den Kaiser davon überzeugen können, die große Stabskonferenz hier auf dem Hradschin, der alten Burg in Prag, einzuberufen. Geladen und erschienen sind noch andere hochstehende Uniformträger: Generaloberst Schörner, als Befehlshaber der Heeresgruppe D an der Ostfront einer der wichtigsten Frontbefehlshaber überhaupt, ist hier stellvertretend für alle anderen Heeresgruppenkommandeure von der Ostfront, der Prinz von Anhalt ist hier als Kommandeur der Heeresgruppe C auf dem Balkan, Großadmiral Raeder ist als Oberbefehlshaber der kaiserlichen Marine hier, für die Luftwaffe Fliegergeneral Meier, Generalmajor Fegel ist in seiner Eigenschaft als Chef des kaiserlichen Auslandsgeheimdienstes hier, Feldmarschall Lörvan vertritt das Königreich Skandinavien (wie sich Schweden nach seinen Siegen in Dänemark und Norwegen nun nennt), Colonello Grandi ist als päpstlicher Verbindungsoffizier hier, der Herzog von Braunschweig ist als Außenminister der Pariser Putschistenregierung hier (ebenfalls in Uniform). Dazu kommen noch einige zivil aussehende Gäste, die ganz am Ende des langen Konferenztisches sitzen, und bei denen es Helldrich ganz gut findet, daß sie vor allem den Mund halten: Der kaiserliche Außenminister selber, der jedoch nachdem nun alle europäischen Staaten auf der einen oder anderen Seite im Kriege sind, kaum noch etwas zu tun hat, der Innenminister, der chinesische Botschafter (der aber nur als Beobachter der mit Wien verbündeten chinesischen Regierung hier ist) und ein älterer kleiner Mann, den Helldrich nur als Schneider kennt und von dem er nicht wirklich weiß, wen er eigentlich repräsentiert. Sinn dieser Konferenz ist es, Bilanz zu ziehen. Bilanz nach anderthalb Jahren Krieg. Um zu erkennen, wo man jetzt steht und wann man aller Voraussicht nach endlich diesen Krieg gewonnen haben wird. Gerade sind alle von der Mittagspause wieder hereingekommen; die Standuhr an der Wand zeigt 15 Uhr 23 an. Der Kaiser nimmt als letzter wieder am Kopf des Tisches Platz. Nervös blättert Helldrich in seinen Unterlagen herum. Vor der Mittagspause hatte jeder den Bericht vorgetragen, den er für nötig hielt, um die andern über den Stand der Dinge in seinem Ressort zu informieren. Zu allem hatte Helldrich sich Notizen gemacht: Am uninteressantesten fand er den Vortrag vom Innenminister über die Schwierigkeiten bei der Industrie wegen des kriegsbedingten Arbeitskräftemangels und die Fortschritte bei der Desinformation der Bevölkerung. Die anderen Offiziere hatten ihre Berichte zur Lage an den Fronten abgegeben, die Vertreter der mit Wien verbündeten Staaten hatten kurz Berichte geliefert wie es beispielsweise an der Front in Nordspanien oder beim Feldzug gegen Sizilien läuft. Raeder hatte seiner Sorge Ausdruck verliehen, daß die Alliierten nach der Flucht der venezianischen und neapolitanischen Flotte doch noch die Seeherrschaft erringen könnten. Aber mit allen Teilnehmern hat Helldrich vor der Sitzung im kleinen Kreise gesprochen. Sie hatten ausgemacht ein bestimmtes Thema gegenüber dem Kaiser, Klettenberg und Schneider zu verbergen. Jetzt beobachtet Helldrich nervös Joseph II. Trotz seiner 47 Jahre ist der Mann voller Energie und stets wachsam. Er hat es geschafft, aus dem einst fast schon zusammenhanglosen Gebilde des Heiligen Römischen Reiches wieder ein zentralisiertes Gebilde zu machen. Erst hat er in den letzten Jahrzehnten durch Reformen gewisse Gruppierungen in Ruhe gewogen, gleichzeitig ein Erstarken der Demokratie hinausgezögert. Und seitdem der Krieg ausgebrochen ist, hat er im Rekordtempo hart durchgegriffen, die Liberalen in den Untergrund getrieben, den Adel ruhiggestellt und das Reich komplett unter Kontrolle gebracht. Und er, Helldrich, ist durch die Übertragung umfassender Kompetenzen zur Geheimpolizei einer der mächtigsten Männer im Staate geworden. Der Kaiser räuspert sich und sagt dann: „Meine Herren, ich stelle mit höchster Zufriedenheit fest, daß der Krieg ganz offensichtlich gut für uns läuft. Offenbar hat sich die Entscheidung, den Maintalaufstand vor anderthalb Jahren zur Anzettelung eines Krieges auszunutzen, ausgezahlt. Angesichts dessen, bin ich zur Überzeugung gelangt, daß wir mit den Alliierten nicht verhandeln sollten, sondern auf ruhigen Gewissens auf Kapitulation bestehen können. Nach allem was ich gehört habe, scheint es ausgeschlossen, daß die Alliierten den Krieg noch gewinnen können. Unser Hauptaugenmerk sollten wir bei der nächsten Konferenz meines Erachtens nach darauf legen, wie wir nach dem Sieg Europa neu organisieren...“ Seines Erachtens nach! Seiner Überzeugung nach! Helldrich muß innerlich lachen. Ihm ist längst klar, daß der Kaiser nicht hundertprozentig davon überzeugt ist, daß Schneider und dessen Hintermänner die Urheber dieser Gedanken sind, ebenso wie sie das Ziel – die Neuordnung Europas – schon im letzten Jahr vorgegeben haben. Was damals allerdings noch in weiter Ferne schien – der Krieg war noch auf Skandinavien, Mittel-und Teile Osteuropas beschränkt -, scheint jetzt näher denn je: Norwegen und Dänemark erobert, die Schweden stehen vor Sankt Petersburg, Frankreich auf Seite des Reiches, die Niederlande weitgehend erobert, Polen erobert, Riga und Kiew besetzt, der Balkan praktisch vollständig unter Kontrolle, die Schweiz und die italienische Halbinsel ebenso erobert wie Sardinien, Konstantinopel genommen, Teile Nordspaniens und die Kanalinseln besetzt, Sizilien steht kurz vor dem Fall. China hat Teile Nordindiens besetzt und konnte einen ersten russischen Angriff erstmal stoppen. Nur die französischen Kolonien bereiten etwas Sorgen. Helldrich wischt die Gedanken weg und schenkt wieder dem Kaiser seine Aufmerksamkeit: „...also erteile ich nun hiermit meinen Generälen die Genehmigung und den Auftrag für die frühest möglichen Termine eine Abschlußoffensive mit dem Ziel Moskau und Woronesch vorzubereiten. Im Übrigen hätte ich gerne...“ Er sieht den Prinzen von Anhalt an. „...bis nächste Woche einen ersten Entwurf für die Eroberung Kleinasiens.“ Dann wendet er sich den Vertretern der Verbündeten zu, die von ihm aus gesehen rechts sitzen. „Und unseren Verbündeten sichere ich zu, daß das Reich jede Offensive Richtung Nordafrika, Madrid und Lissabon ebenso unterstützen wird wie eventuelle Landungen in England, Irland oder auf Island.“ „Wir danken dafür, Eure Hoheit.“ meint der Herzog von Braunschweig grinsend. Innerlich schüttelt Helldrich den Kopf. Es geht ihm immer noch nicht ein, daß sein Ersuchen um die Erlaubnis, den Herzog liquidieren zu lassen, abgelehnt wurde. Der Mann hat Preußen verraten. Wer einmal verrät, verrät wieder. Der Kaiser steht auf und geht jetzt auf und ab. „Nur eines stört mich. Wiederholt fielen in den Rapports gewisse Andeutungen, die darauf schließen lassen, daß es eine Quelle gewisser Störungen unserer Pläne gibt. Generaloberst Schörner, würden Sie mir bitte erklären, was Sie eben damit meinten, als Sie von einigen lokalen Rückschlägen Mitte September sprachen?“ Schörner schluckt und schaut Helldrich, der ebenfalls aufhorcht an. Helldrich schätzt Schörner für seine energische und zupackende, oft brutale Art. Der Mann hat sich seit Beginn des Krieges quasi nach oben gemetzelt. Nochmal atmet Schörner tief durch und führt dann aus: „Nachdem wir die Front an der Weichsel-San-Linie im September aufgerissen hatten und unsere Panzerspitzen weit vorstießen, nachdem Warschau schon abgeriegelt war, ergaben sich unvorhergesehene Probleme.“ „Welcher Art?“ fragt der Kaiser barsch. „Zwei unserer Panzerregimenter wurden beinahe aufgerieben, dem Feind gelang es, die Überreste der Warschauer Garnison zu entsetzen und unsere Nachschublinie teilweise für fast eine Woche zu durchschneiden. Wir hatten damit nicht gerechnet, weil die Alliierten eigentlich auf dem Rückzug waren. Aber diese Operationen hinderten uns an einer Verfolgung, wie wir sie uns gewünscht hätten und es gelang uns auch nicht, den alliierten Verband, der dafür verantwortlich war, zu stellen. Vorher setzte er sich Richtung Pripjet-Sümpfe ab.“ Der Kaiser läßt nicht locker und Helldrich hat den Eindruck, daß der Kaiser die Antwort auf alle Fragen schon kennt. Und diese Antwort ist genau das, was Helldrich und die andern eigentlich von diesem Treffen fern halten wollten. „Marschall Lörvan, Sie hatten ähnliche Probleme?“ fragt der Kaiser, nun etwas höflicher. „Ja, Eure Hoheit. Unser Landungsversuch nördlich Memel wurde überraschend zurückgeschlagen.“ „Entspricht es den Tatsachen, daß auf dem Balkan, in Süditalien und den Niederlanden es zu ähnlichen Rückschlägen bzw. Verzögerungen gekommen ist?“ fragt der Kaiser nun wieder etwas harscher und blickt alle an. Der Prinz von Anhalt und der italienische Vertreter müssen nicken. Klettenberg nickt nicht; er hatte eben schon darüber berichtet, daß man in den Niederlanden mehrere Brücken nicht nehmen konnte, weil sie von einer alliierten Spezialeinheit hartnäckigst verteidigt und dann gesprengt wurden. Und dann: „Herr Reichsführer, mir sind außerdem Gerüchte über Unruhen in der Schweiz und in Köln zu Ohren gekommen. Unter anderem war die Rede von einem unserer Konzentrationslager, aus dem alle Gefangenen entkommen sind. Meinten Sie das, als Sie eben von einigen marginalen Schwierigkeiten sprachen?“ Genau das sind die Dinge, die Helldrich gerne noch eine Weile nicht auf die Tagesordnung gesetzt hätte. Aber jetzt ist es zu spät. Also antwortet er: „Äh...ja, das waren die marginalen Schwierigkeiten. Aber wir sind dabei, sie in den Griff zu kriegen. Alles ist halb so wild. Ich habe meine bes-...“ „Verdammt nochmal, Reichsführer!!“ Der Kaiser haut im wahrsten Sinne des Wortes mit der Faust auf den Tisch, das die Kaffeetasse von Generalstabschef Klettenberg, der direkt neben dem Kaiser sitzt, kurz aufhüpft. Schnell hält Klettenberg die Kaffeetasse fest. „Reichsführer, verkaufen Sie mich nicht für blöd. Ich glaube, wir wissen hier alle wovon wir hier reden. All diese Dinge stehen im Zusammenhang. Oder Feldmarschall?“ Klettenberg blickt auf. „Ja, Majestät. Unsere Untersuchungen haben ergeben, daß alle genannten Rückschläge mehr oder weniger auf das Konto der einzigen alliierten Macht geht, die seit Kriegsbeginn trotz ständigen Fronteinsatzes immer mehr ihre Kräfte ausbauen konnte.“ Der Kaiser setzt sich wieder. Der chinesische Botschafter legt den Kopf schräg und fragt vom hintersten Ende des Tisches auf Englisch: „Entschuldigen Sie, mir ist nicht klar, wovon wir hier sprechen.“ Klettenberg beugt sich leicht vor, um den Botschafter sehen zu können und antwortet auf Englisch: „Herr Botschafter, wir sprechen hier vom Freikorps ‚Schimäre‘.“ „Feldmarschall, erläutern Sie dem Herrn Botschafter doch kurz, was dieses Freikorps ist, damit seine Regierung Bescheid weiß, sollte sie ebenfalls mal damit konfrontiert werden.“ „Selbstverständlich, Majestät.“ Klettenberg steht auf und geht rüber zum Botschafter, legt ihm eine kleine Aktenmappe hin. Dabei führt er kurz aus: „‘Schimäre‘ ist eine Truppe von Söldnern, die für Demokratie und die sogenannten Menschenrechte kämpfen. Selber sprechen diese Irren von einem Kampf für die Freiheit. Seit Kriegsbeginn kämpfen sie gegen uns und haben es dabei geschafft, ihre Truppenstärke von 2000 auf inzwischen gut 45000 Soldaten aufzustocken. Laut neueren Geheimdienstmeldungen sind weitere Kämpfer in Ausbildung, angestrebt wird offenbar, ‚Schimäre‘ auf eine Stärke von 100000 Mann zu bringen. Finanziert von den anderen Alliierten ist die Ausrüstung von ‚Schimäre‘ weitgehend erstklassig, die Offiziere sind unkonventionell und haben einen Hang zu tollkühnen Aktionen. Inzwischen besitzt diese Einheit auch eine eigene Fliegereinheit und baut eine eigene kleine Marine auf.“ „Und diese Einheit ist für so viele Rückschläge an allen Fronten verantwortlich.“ „Ja.“ sagt Klettenberg nur knapp, als er sich wieder setzt. Der Kaiser blickt wieder direkt Helldrich an. „Reichsführer, bei der letzten Konferenz – wann war das? Vor zwei bis drei Monaten? Da versicherten Sie mir, Sie würden dieses Problem lösen helfen. Wieso eigentlich?“ „Einer meiner besten Männer, der sich schon länger mit ‚Schimäre‘ befaßt, glaubt, daß wir dieses Problem nicht allein militärisch lösen können.“ „Da hat er recht, Majestät.“ stimmt Klettenberg zu. „Wie ich Ihnen schon einmal erklärt habe, hat ‚Schimäre‘ ein fast europaweites Informantennetz und unterstützt dazu noch verschiedene Widerstandsbewegungen, zum Beispiel in Norwegen und auf dem Balkan. Dieser Teil der Problematik fällt in die Zuständigkeit der Gepo.“ Langsam wiegt der Kaiser den Kopf, dann wendet er sich wieder an Helldrich, dem es heiß und kalt in seiner Uniform wird. „Reichsführer, Sie wollten uns glaube ich eben darüber aufklären, wie weit Ihre Maßnahmen gegen dieses ...äh...Problem gediehen sind?“ „Ähm...ähm...ja, Eure Majestät. Ich habe einen meiner besten Männer darauf angesetzt und er meint, die Lösung des Problems läge darin, die Führung von ‚Schimäre‘ zu liquidieren.“ „Sie meinen wie bei einem Bienenvolk? Man tötet die Königin und Ende? Und wie stellen Sie sich das vor?“ „Wir arbeiten noch an einem Konzept für dieses taktische Ziel, eure Hoheit. Immerhin konnten wir bei den Unruhen in Köln vor anderthalb Monaten eine hohe Offizierin von ‚Schimäre‘ sowie mehrere ihrer Agenten töten.“ Klettenberg beugt sich vor. „Und unsere Truppen an der Front haben in der Zwischenzeit etwa 3500 ‚Schimäre‘-Kämpfer getötet. Ich fürchte, das ist nur Platz 2 für Sie, Reichsführer.“ tönt der Feldmarschall spöttisch. Helldrich wirft ihm giftige Blicke zu. „Genug!“ donnert der Kaiser. „Reichsführer, ich schlage vor, Sie treiben Projekte diesbezüglich mit höchster Dringlichkeit voran. Wir müssen ‚Schimäre‘ noch vor unserer nächsten Offensive jeglicher Führung berauben!“ „Jawohl, Hoheit.“ „Gut.“ grinst Joseph II. „Dann sind wir uns ja einig.“ In einem der Gänge des Hradschins hat sich Standartenführer Jörg Oschmann auf einer harten und unbequemen Bank niedergelassen. Genüßlich raucht er sich eine Zigarette. Ein wenig juckt sein Auge noch, sein rechtes. Es ist verborgen unter einer Augenklappe, seit es ihm vor etwa zwei Monaten weggeschossen wurde. Hektische Schritte lassen ihn aufsehen. Reichsführer Helldrich kommt den Gang entlang, geradewegs von der Konferenz. Oschmann steht auf und hebt die Hand zum Gruß. „Reichsführer...“ „Ja, ja, schon gut. Standartenführer, Sie wissen ja gar nicht, was ich gerade durchmachen mußte.“ „Nein, das weiß ich wirklich nicht.“ „Tja, der Kaiser hat mir – und damit auch Ihnen – einen Schuß vor den Bug gesetzt.“ Helldrich wischt ein paar Fusel von seiner schwarzen Uniform. „Standartenführer, wir müssen endlich eine Lösung für das ‚Schimäre‘-Problem finden. Aber dringend. Auch wenn mir nicht ganz klar ist, was diese Truppe noch am Ausgang des Krieges ändern könnte.“ „Viel.“ erwidert Oschmann nur und fügt erst nach einer Pause hinzu: „Diese Truppe wird den Krieg fortführen, selbst wenn alle anderen Alliierten kapitulieren.“ „Sie sind sich da ja sehr sicher.“ „Ja. Denn ihr Anführer General Reiss gibt uns die Schuld am Tod seiner Eltern, das sollten Sie niemals vergessen. Uns und dem Kaiser.“ „Ja, ja, und er hat einen Traum, den viele andere auch träumen...den Vortrag haben Sie mir schon öfter gehalten, Standartenführer. Wenn Sie damit recht behalten, sollten Sie lieber schleunigst diesen Mann ausschalten. Und seine engsten Mitarbeiter. Immerhin haben Sie ja selber noch eine Rechnung mit Reiss offen.“ Helldrich deutet auf Oschmanns Augenklappe. Und Oschmann lächelt kalt. „Keine Sorge, Reichsführer. Ich habe längst zwei Projekte ins Rollen gebracht, die uns Stefan Reiss entweder als Gefangenen bringen.“ „Oder?“ „Oder als Leiche. Und den Rest, den muß dann nur noch Klettenberg mit seinen Armeen erledigen...“ Montag, der 6. Oktober Der Tag ist grau und nachdem es schon die ganze Nacht geregnet hat, regnet es jetzt immer noch. Mal stärker, mal schwächer. Im Rothschild, einem Café in einer Seitenstraße des Hansarings in Köln, direkt gegenüber vom Hansa-Hochhaus, sitzen einige Gäste an den Tischen, die sich vor dem Regen hereingeflüchtet haben. Normalerweise ist um die Zeit, erst knapp vor 11 Uhr, noch nicht ganz so viel los. Zwei Stammgäste sitzen an der Bar und trinken Kaffee und lesen Zeitung. An der Glasfront, die an zwei Seiten des Cafés ist, laufen die Tropfen herunter. Am Ende der Bar, neben dem Durchgang, der in den Keller und zur Toilette führt, sitzt Chris Loewisch auf einem Barhocker und nutzt eine kurze Pause, um eine zu rauchen. Eben erst hat sie wieder einige Gläser schnell durchgespült. Einer der Gäste an der Bar, ein älterer Herr, blickt von der Zeitung auf und wirft einen Blick zu Chris rüber. „Noch Kaffee?“ fragt sie direkt. Der Mann nickt. „Ok, moment...“ Sie legt ihre Zigarette im Aschenbecher ab und geht rüber zur Kaffeemaschine. „Ich möchte auch schon zahlen.“ meint der Mann und legt das Geld auf die Theke. Chris nimmt es auch schon mal und während der Kaffee noch in der Mache ist, rechnet sie an der Kasse ab. „Stimmt so.“ „Oh, danke.“ Das Trinkgeld tut sie in das dafür vorgesehene Glas auf dem Regal über der Kasse. Dann stellt sie dem Mann auch schon den Kaffee wieder hin und geht zurück zu ihrer Zigarette. Die Tür geht auf und eine Frau mit kurzen, dunkel gefärbten Haaren kommt rein. „Morgen Katrin, wie geht’s?“ ruft ihr Chris zu. Katrin Schmiegeld lächelt und komm zu ihr rüber, legt ihre Tasche auf einem Barhocker ab. „Ach geht so. Ich hab eben die Fenster im Friseursalon geputzt. Zumindest teilweise.“ „Hattest Du dafür nicht einen Studenten eingestellt?“ „Ja, schon, aber den habense letzte Woche eingezogen. Der arme Kerl muß wahrscheinlich an die Ostfront. Aber er war ein fanatischer Verehrer des Kaisers, ich glaub der ist ganz heiß darauf.“ „Ja, wirklich zu bedauern.“ „Ja. Den Rest der Fenster putz ich morgen früh, bevor ich den Laden auf mache.“ „Ach ja, Montags haste ja eigentlich immer frei.“ „Wenn ich nicht gerade hier aushelfe.“ Chris muß lachen. „Stimmt. Kannst Du mir eben helfen zwei Kästen von unten raufzuholen?“ „Klar doch.“ Die beiden gehen die Treppe runter in den Keller. Gedämpft reden sie weiter. Chris sagt: „In den letzten Tagen haben die Gepos wieder die Patrouillen vor allem zur Zeit der Ausgangssperre verstärkt. Ist wieder was im Gange?“ „Nichts an der niederländischen Front, wenn Du mich meinst. Das Wetter ist momentan zu schlecht. Erst wenn es besser wird, dürften die Kaiserlichen dort die letzten Brückenköpfe der Alliierten platt machen.“ „Schon klar. Was ist in Köln selber?“ Chris räumt zwei leere Käste in einer Ecke neben der Treppe beiseite. „Jetzt, wo Du es sagst...“ überlegt Katrin. „Ja?“ Chris sieht sie fragend an. „Ich meine ich hätte was gehört, daß am Samstag am Rathenauplatz was los war.“ „Am Rathenauplatz?“ „Ja. Irgendeine kleine Diskothek. Da hat’s wohl eine Razzia gegeben mit vielen schwarzen Leuten. Auf beiden Seiten.“ „Achso! Klar, im La Lic. Das kann sein.“ „Du kennst den Schuppen, Chris?“ „Ja. War einmal mit ein paar Leutchen da. Nur Gothics. Um Mitternacht dachte ich, jetzt verwandeln sich alle und fallen über mich her.“ Katrin lacht kurz auf und Chris fährt fort: „Ich hab mich schon gewundert, daß die Gepos die solange unbehelligt gelassen haben. Hast Du was gehört, was sie als Vorwand genommen haben?“ „Nein gar nichts. Es hat keinen offiziellen Vorwand gegeben.“ „Nicht Spionagetreff, Kommunistentreff oder was sonst so die üblichen politischen Vorwände sind?“ „Nein. Aber eine normale Razzia kann’s nicht gewesen sein. Sonst hätte das die normale Polizei erledigt.“ „Stimmt. Ach, vielleicht steht’s heute oder morgen in der Zeitung. Ich hab leider noch keine gelesen.“ „Ich auch nicht.“ „Na komm, die Kästen müssen hoch.“ Chris schnappt sich nen Kasten Cola und Katrin einen Wasserkasten. „Hast Du eigentlich die Lizenz für das Ausschenken trotz Rationierungsbestimmungen verlängern können?“ „Ja, gerade noch so.“ Die beiden schleppen die Kästen nach oben und verstauen sie oben unter der Theke. Während Katrin dann noch an einem Tisch abkassiert, sieht Chris draußen zwei Geheimpolizisten zusammen mit einem normalen Polizisten vorbeipatrouillieren. Sie fragt sich, was diese Knilche im La Lic gewollt haben können. Zu holen gibt’s da eigentlich nichts. Bei den Gothics und diesen Kreisen sind derzeit kaum Leute vom Widerstand. Chris muß es wissen. Sie und Katrin sind „Schimäre“-Agenten. „Katrin, ich hab unten noch was vergessen. Hilfst Du nochmal?“ „Klar.“ Katrin rechnet schnell an der Kasse ab, dann gehen beide wieder runter. „Sag mal Katrin, der Student hat doch nicht das Funkgerät im Keller entdeckt?“ „Ne, hat er nicht. Mein Mann hat vorsichtshalber das Schloß zu der Tür im Keller ausgewechselt.“ Chris muß grinsen. Der gute Joschi. Denkt immer mit. „Ok. Funk doch am besten Mal noch heute ans HQ, was im La Lic abgegangen ist. Vielleicht wissen die was.“ „Gute Idee, Chris. Ich geh gleich mal los. Dann bin ich in einer oder zwei Stunden wieder da.“ „Ok. Aber paß auf. Die Gepos sind momentan überall.“ Im fünften Stock des Hansa-Hochhauses wartet Obersturmbannführer Trappert ungeduldig vor dem Aufzug. Jeden Moment muß der angekündigte Besuch eintreffen. Der Mann wurde von der KaGepo-Leitung in Wien selber angekündigt. „Der Mann steht rangmäßig unter Ihnen, aber er hat alle Befugnisse in diesem speziellen Fall. Unterstützen Sie ihn.“ Das war eindeutig. Der Mann soll zwar nur Sturmbannführer sein, aber Trappert würde ihm trotzdem gehorchen müssen. Vorsichtshalber schaut Trappert nochmal an sich runter, ob seine schwarze Uniform auch richtig sitzt. Endlich geht die Aufzugtür auf und ein schlanker, hochgewachsener Mann in der typischen schwarzen Gepo-Uniform kommt heraus. Sein Haar ist kurzgehalten, das Gesicht wirkt leicht rundlich und der Mann hinkt. „Obersturmbannführer Trappert?“ fragt er kühl. „Ja, der bin ich. Und Sie?“ „Sturmbannführer Leikert. Ich wurde angekündigt.“ Das ist er also. „Bitte folgen Sie mir.“ meint Trappert distanziert und führt Leikert einen Korridor, von dem mehrere Büros abgehen, entlang – langsam, denn Leikert kann wegen dem Bein, das er nachzieht, nicht schnell gehen. Überhaupt macht er auf Trappert einen Eindruck, als habe er die Verletzung noch nicht lange. Aber Trappert fragt nicht danach. Es interessiert ihn eigentlich auch nicht. Schließlich erreichen sie Trapperts Büro. „Warten Sie hier.“ Trappert verschwindet kurz im Büro und kommt dann wieder heraus; in der Hand hält er eine dünne Aktenmappe. „So, jetzt zeig ich Ihnen, warum man Sie hierher geschickt hat, Sturmbannführer. Folgen Sie mir bitte nochmal.“ Sie gehen zurück zum Fahrstuhl steigen ein und dann fahren sie einige Stockwerke nach oben. Auf dem Weg gibt Trappert die Mappe an Leikert weiter. Der schlägt sie auf. Es ist eine sogenannte Identifikationsakte, die die Geheimpolizei über jeden, mit dem sie schonmal zu tun hatte, anlegt. Diese hier ist noch nicht sehr umfangreich weil erst vor kurzem zusammengestellt. Leikert blättert sie schnell durch. „Petra Müller.“ liest er ab. „Ja, das ist die Gefangene, die wir Ihnen vorführen sollen. Sie wartet bereits in einem Verhörraum. Aber mal ehrlich: Wieso ist die so wichtig für das Oberkommando?“ „Wir haben unsere Gründe.“ gibt Leikert abweisend zurück. Der Aufzug hält, die Türen gehen auf und die beiden treten wieder auf einen Flur. Trappert führt Leikert den Korridor entlang, biegt dann in einen neuen nach rechts ab. „Wo haben Sie die Frau eigentlich festgesetzt?“ will Leikert wissen. „Bei einer Razzia am Samstagabend in einer Diskothek namens La Lic. Wir haben mehrere politisch Inkorrekte festgenommen und sie war dabei.“ „Alles klar. Verstehe.“ Sie erreichen eine Tür kurz vor Ende des Korridors, vor der zwei Geheimpolizisten in voller Uniform und mit Maschinenpistolen stehen. „Wenn es recht ist, würde ich gerne mit der Gefangenen allein sprechen.“ Trappert zuckt die Achseln. „Wie Sie wollen.“ Dann nickt er seinen beiden Männern zu. Einer von ihnen öffnet die Tür und läßt Leikert durch, dann schließt er die Tür wieder. Leikert bleibt kurz an der Tür stehen und mustert die Frau, die am Tisch sitzt. Versucht, sein Gegenüber einzuschätzen. Die schlanke Frau, knapp 30, recht hübsch, hat ein Piercing unter der Unterlippe – eine jener abartigen (wie Leikert findet) Gewohnheiten der Kreise, in denen sie aufgegriffen wurde. Ihre rötlichen Haare sind etwas länger als schulterlang und passen zu ihrem hübschen Gesicht. Sie trägt einen jener grauen Overalls, die die Gepo den Gefangenen in UHaft verpassen und sitzt auf einem einfach Holzstuhl, die Arme hinter der Rückenlehne verschränkt und mit Fesseln festgebunden. Abgesehen von ihrem Stuhl steht nur noch ein Metalltisch und ein weiterer Stuhl in der Mitte des kleinen Raumes, der ohne Fenster ist und nur durch eine nackte Glühbirne beleuchtet wird. Nach ein paar Augenblicken tritt Leikert an den Tisch, legt die Aktenmappe ab und setzt sich mit bedächtigen Bewegungen auf den Stuhl. Auf dem Tisch steht ein Aschenbecher. Also zündet er sich eine Zigarette an und bläst der Frau den Rauch direkt ins Gesicht. Sie hat bis jetzt die Tischplatte angestarrt und sieht nun langsam zu ihm auf. „Ich rauche selber.“ zischt sie. Das bringt Leikert zum Grinsen. „Nanu, warum so feindselig?“ fragt er hämisch. „Warum so trödelig?“ gibt sie zurück. „Stecken Sie mich doch endlich ins Lager oder erschießen Sie mich. Aber wieso laßt ihr schwarzuniformierten Hornochsen mich solange in U-Haft schmoren?“ Lässig schlägt Leikert wieder die Aktenmappe auf. „Fräulein Müller, Sie stehen im dringenden Verdacht, in mehrere Attentate in den letzten fünf Jahren verwickelt zu sein.“ Petra lacht laut auf. „Und wenn soll ich bitte umgebracht haben?“ „Vor fünf Jahren einen Richter des Kaiserlichen Reichsgerichts in Wien; vor drei Jahren den damaligen Direktor der JunkersWerke, beide durch Bomben; vor zwei Jahren den Kommandanten des Gefangenenlagers Freiburg durch Kopfschuß; letztes Jahr in Nürnberg eine gewisse Verena Albrecht, die beim Versuch, Generalmajor Decker mit einer Autobombe zu töten, umkommt. Generalmajor Decker überlebt schwer verletzt.“ Petra schüttelt den Kopf. „Wirklich, Sturmbannführer, ich kenne niemanden davon. Nur der Name Decker kommt mir bekannt vor.“ „Er war bis zur Bamberger Schlacht letztes Jahr Garnisonskommandant.“ „Richtig! Der Mann stand doch in allen Zeitungen, weil er mit nur 400 Mann im letzten Festungswerk von Bamberg die Belagerung durch die Rebellen durchgehalten hat! Echt Mut der Mann! Sagen Sie, wie geht’s ihm eigentlich?“ Leikert haut mit der Faust auf dem Tisch. „Fräulein Müller, führen Sie mich nicht an der Nase rum. Wir können auch anders!“ „Ach? Was kommt dann? Daumenschrauben? Peitsche? Stromschläge?“ Leikert zuckt mit den Schultern. „Wir haben Mittel und Wege.“ Jetzt schnaubt Petra verächtlich. „Ich weiß. Ich habe Freunde, die es schon überlebt haben.“ Mit einem süffisanten Lächeln erwidert Leikert: „Viele überleben es nicht.“ Mit kaltem Blick gibt Petra zurück: „Ich weiß. Vor ein paar Jahren ist mein Mann in einem Kerker in Wien gestorben.“ Leikert schaut auf. Davon hatte nichts in der Akte gestanden! Dieser verdammte Trappert! Was ist denn das für eine säumige Dienststelle? Er würde Trappert später dafür anscheißen... „Zufällig vor fünf Jahren?“ stochert Leikert einfach mal ins Blaue, nimmt noch einen Zug von seiner Zigarette. Die ausbleibende Antwort und der haßerfüllte Blick der Frau sprechen Bände. „Wissen Sie, Fräulein Müller, unsere Experten sind der Meinung, daß der-oder diejenige, die für diese Attentate verantwortlich sind, einen echten Haß auf den Kaiser haben müssen.“ „Und?“ „Ich glaube, Sie wissen genau, worauf ich hinaus will.“ „Na dann erschießen Sie mich doch, wenn Sie sich so sicher sind. Wie wärs direkt in den Hinterkopf?“ Wieder stößt ihr Leikert den Rauch direkt ins Gesicht aus. „Sagen Sie mal, tun Sie nur so, oder haben Sie es eilig zu sterben?“ fragt er etwas irritiert. Und dann mustert er sie wieder. Schließlich lehnt er sich in seinem Stuhl zurück, daß es knarrt. „Wissen Sie, wenn Sie den Kaiser ärgern wollen, dann sollten Sie diesen Krieg beenden. Er will diesen Krieg. Beenden Sie den Krieg und Sie haben einen Teil seiner Pläne durchkreuzt.“ Petra hebt eine Augenbraue. „Und wie sollte ich den Krieg beenden? Ich sehe nicht, wie ich das tun könnte. Die ganze Welt trägt Waffen und steht in Flammen und Sie wollen mir einreden, ich könnte das größte Massaker seit Menschengedenken beenden?“ Auf Leikerts Gesicht breitet sich ein seltsames Lächeln aus. „Was ist?“ schnappt Petra. „Hab ich was komisches gesagt?“ Sie ist sich inzwischen ganz und gar nicht mehr sicher, was hier vorgeht. Das hier ist kein typisches Verhör, so wie die U-Haft auch keine gewöhnliche ist. Von anderen weiß sie, daß man sie längst hatte foltern oder zumindest mal zusammenschlagen müssen. Aber aus irgendeinem Grund schonen die Gepos sie. Langsam drückt Leikert seine Zigarette aus. „Was wäre, wenn ich Ihnen sage, daß wir Ihre Freunde wieder freilassen und die Versiegelung des La Lics aufheben?“ „Sie meinen, den Zustand von vor der Razzia wieder herstellen?“ „Genau, den Status quo. Mit Garantie, daß wir bis – na sagen wir erstmal bis zum Kriegsende das La Lic in Ruhe lassen. Und all die, die sich dort aufhalten.“ Petra lacht laut auf. „Was haben Sie?“ „Ein Gepo macht mir ein Friedensangebot – daß ich das noch erleben darf!“ „Es ist mein Ernst.“ „Und ich muß bestimmt was dafür tun.“ Der Satz ist mehr eine Feststellung als eine Frage. Mit einem vielsagenden kalten Grinsen erwidert Leikert ihr: „In der Tat. Und das, was Sie tun sollen, wird zugleich helfen, den Krieg zu verkürzen.“ Der finstere, skeptische Blick, den ihm Petra zuwirft, sagt alles – sie muß ganz offensichtlich glauben, daß Leikert ein Spinner ist! Sturmbannführer Leikert greift nun in die Brusttasche seiner Uniform und holt ein Photo heraus, schiebt es auf dem Tisch rüber zu Petra. „Töten Sie diesen Mann für uns. Er ist die Seele des letzten Widerstandes, den wir selbst dann erwarten müßten, wenn alle anderen Alliierten Frieden mit uns geschlossen haben. Töten Sie ihn und wir können mit dem Rest der Allianz Frieden schließen.“ Stirnrunzelnd schaut Petra Leikert an. „Ich lasse Ihnen Bedenkzeit.“ „Wieviel?“ „Fünf Minuten. Dann geht der Transport ins Lager Jülich ab.“ Leikert verläßt den Raum. Petra starrt das Bild an. Nach nicht ganz fünf Minuten kommt Leikert wieder rein, zusammen mit einer Wache. Er legt einige schwarze Klamotten auf den anderen Stuhl. Petra erkennt ihre Kleider, die sie am Samstagabend bei der Razzia getragen hatte. Ein Schällchen mit Ringen und Anhängern stellt Leikert auf den Tisch, dann gibt er der Wache Anweisung: „Machen Sie ihr die Fesseln los.“ Tatsächlich löst die Wache die Fesseln, dann verlassen die beiden Männer den Raum. Draußen auf dem Flur warten nun Trappert, Leikert und drei Wachen. „Glauben Sie, sie wird drauf eingehen?“ fragt Trappert, dem Leikert die Sache eben erklärt hat, der aber immer noch skeptisch ist. Immer wieder schaut Trappert auf die Uhr. Schließlich geht die Tür auf. Petra hat den Overall ausgezogen und sich wieder in die schwarzen Klamotten von Samstagabend geschmissen, ihre Halsanhänger umgelegt und wieder die Totenkopf-und Drachenringe an den Fingern. „Sie geht drauf ein, Obersturmbannführer.“ meint Leikert triumphierend. Petra tritt Leikert direkt gegenüber und meint: „Ich werde Geld brauchen für Ausrüstung. Und ich muß mich frei bewegen dürfen.“ „Geht klar.“ Leikert holt aus seiner Uniformtasche einen Briefumschlag heraus, den Petra entgegennimmt. „Sie können jetzt gehen, Fräulein Müller.“ „In Ordnung. Ich warte draußen, bis meine Freunde ebenfalls frei sind. Ich warte genau eine halbe Stunde. Sollte dann keiner meiner Freunde draußen sein, ist die Vereinbarung hinfällig.“ „Geht in Ordnung.“ Man merkt Leikert seinen Triumph förmlich an, wobei Petra sich nicht sicher ist, was dieses Spielchen eigentlich soll. Sie geht Richtung Aufzug. Noch einmal bleibt sie stehen und dreht sich um. „Ach, Sturmbannführer?“ „Ja?“ „Wenn das hier vorbei ist – dann sind Sie dran.“ Mit diesen Worten verschwindet sie Richtung Aufzug. Leikert dreht sich zu Trappert um. „Schicken Sie ihr ein oder zwei Männer hinterher. Ich will wissen, was Sie tut.“ „Da fehlt was.“ „Hä?“ „Das Zauberwort.“ Leikert schürzt verärgert die Lippen, meint dann aber doch. „Bitte.“ „Na geht doch.“ schnappt Trappert. „Vergessen Sie nicht, ich bin immer noch Obersturmbannführer und Sie nur Sturmbannführer.“ Erhobenen Hauptes geht Trappert an Leikert vorbei, fragt ihn dann aber doch noch: „Und was machen Sie?“ „Ich? Ich werde mich erstmal in meine Unterkunft im Dorinth begeben und zu Mittag essen.“ Andreas Beiß, Chef der Hotelbediensteten im Dorinth-Hotel unweit des Friesenplatzes in Köln, schaut immer wieder auf die Uhr, während er vor dem Zimmer im zweiten Stock des Hotels Schmiere steht. Nervös blickt er immer wieder den Gang runter, nach rechts und nach links. Hoffentlich würde sich seine Chefin beeilen. Seine Chefin – das ist die Hoteldirektorin Linda Meier-Grolman. Nur wenige wissen, daß sie auch eine ranghohe Mitarbeitern des Agentennetzes von „Schimäre“ in Köln ist. Während Andreas draußen immer nervöser wird, durchsucht Linda das Zimmer mit der Standardhoteleinrichtung, in das dieser neu angekommene Geheimpolizist gestern abend eingezogen ist. Schnell zieht sie die Schubladen der Kommode neben der Tür auf. Nichts. Bettmatraze hoch. Nichts. Im Badezimmer auch nichts. Zuletzt der Nachttisch. Hier findet sie tatsächlich einen aufgerissenen Briefumschlag in der Schublade, fingert schnell den Brief heraus und überfliegt ihn. Ein schriftlicher Befehl von Standartenführer Oschmann. Den Namen kennt Linda. Schließlich war Oschmann jahrelang Chef der Geheimpolizei in Köln und führte zuletzt im August einige Spezialoperationen zur Ergreifung von „Schimäre“-Mitgliedern durch, die mit einigen Schießereien, etlichen Toten und einer herben Niederlage für die Gepos endeten. Allerdings verlor „Schimäre“ dabei auch eine seiner bekanntesten und besten Offizierinnen. Und beinahe wäre auch General Stefan Reiss, der Oberbefehlshaber von „Schimäre“, bei den Unruhen draufgegangen. Schnell schiebt sie den Brief wieder in den Umschlag und legt ihn zurück in die Schublade. Dann verläßt sie den Raum und schließt die Tür ab. „Gott sei dank, das wurde auch Zeit!“ zischt Andreas. „Stell Dich nicht so an...“ zischt sie zurück. „Wir habens doch geschafft.“ Bewußt ruhigen Schrittes gehen sie zurück zum Aufzug, um in wieder nach unten zu ihrem Büro zu fahren. Als sie vor dem Fahrstuhl warten, fragt Andreas: „Und, was gefunden?“ „Nur einen Brief. Ein schriftlicher Befehl unseres speziellen Freundes Oschmann an einen gewissen Sturmbannführer Leikert.“ Andreas zuckt die Schultern. „Der Name sagt mir nichts.“ „Ja, aber vielleicht dem Hauptquartier. Jedenfalls müssen wir ihn durchgeben.“ „Und was stand sonst noch drin?“ Linda will gerade den Mund aufmachen, als die Tür des Fahrstuhls aufgeht und ein hinkender Mann in schwarzer Uniform herauskommt. Linda und Andreas grüßen freundlich und treten ein Stück beiseite, um Leikert vorbeizulassen. Dann huschen sie schnell in den Fahrstuhl. Leise nuschelt Andreas: „Naja, der Typ hat sich jedenfalls als Michael Leikert eingetragen. Er dürfte es sein.“ Als die Türen endgültig zu sind, meint Linda wieder in normalem Tonfall: „Ja, stimme Dir zu. Ansonsten stand in dem Brief nur, er solle wie besprochen eine Zielperson aufsuchen und mit der Durchführung einer Aktion beauftragen.“ „Viel ist das nicht.“ „Nein, wahrlich nicht. Aber wenn Oschmann dahintersteht – dann bedeutet das Ärger.“ Als die Fahrstuhltür wieder aufgeht, werfen sich Linda und Andreas vielsagende Blicke zu. „Für die Freiheit und für Sie!“ Wahlspruch des Spezialbataillons 1 von „Schimäre“seit Frühjahr 1788 Dienstag, der 7. Oktober Die Nacht ist so kurz nach Mitternacht kühl und feucht. Den ganzen Tag hat es geregnet; der Regen hat zwar aufgehört, aber die Wolken verdecken immer noch den größten Teil des Sternenhimmels und den Mond. So ist diese Nacht doch recht finster, hier, in der Nähe des Örtchens Rudaki, westlich von Smolensk, 60 km hinter der Front. Hauptgefreiter Grug von der kaiserlichen Luftwaffe fröstelt kurz. „Ist Dir kalt, Freddy?“ fragt sein Kumpel, der Obergefreite Rempel. „Ein wenig. Meinste, hier hinten ist es noch gefährlich, eine zu rauchen?“ „Ne, glaube nicht. Ich hab zwar Gerüchte, über russische und polnische Partisanen gehört, aber so recht glaube ich es nicht.“ „Ok, dann zünd ich mir eine an. Hoffentlich sieht das der Spieß nicht. Auch eine?“ Grug zündet sich die Kippe an. „Ne, laß mal Freddy. Ich hab meiner Kleinen versprochen, wenn ich wieder aus dem Krieg zurückbin, so gegen Neujahr oder Ostern, dann hab ich damit aufgehört.“ Grug lacht lauthals los. „Neujahr! Ich sage, wir können von Glück reden, wenn wir bis Ostern wieder zu Hause in Dresden sind!“ Genüsslich zieht Grug an der Zigarette. Aber mulmig ist ihm schon. Wenn es hier keine Partisanen gibt, wieso müssen sie dann hier diese kleine Radarstation bewachen. Sie stehen am Tor in einem Zaun, der sich um eine Lichtung zieht, auf dem ein kleiner kastenförmiger Bau steht, auf dessen Dach sich unter einem Tarnnetz ein tellerartiges Gebilde befindet – ein Parabolspiegel mit Dipol. Bei dem Gebäude selber stehen auch nochmal zwei Wachen; damit niemand durch Fenster einsteigen kann, besitzt der Bau diese nicht. Irgendwo knackt etwas. Abseits des Waldweges, der hierhin führt. „Freddy, haste das gehört?“ Rempel hebt sofort sein Gewehr an. „Ach, hör auf, war bestimmt nur ein Eichhörnchen oder irgendein anderes Tier.“ „Na ich weiß nicht...“ Wieder ein Geräusch, dieses Mal dumpf und ziemlich leise, direkt am Tor. Rempel dreht sich halb um, sieht am Boden die Zigarette glimmen. „Wa-...?“ Ein Schlag trifft ihn am Kehlkopf, ein weiterer am Solar Plexus. Die Luft bleibt weg, er kriegt keinen Schrei heraus, es reißt ihn von den Füßen. Rücklings schlägt Rempel zu Boden, was ihm den Rest Luft aus den Lungen treibt, sein Gewehr wird ihm aus der Hand getreten, dann dringt ein scharfer stechender Schmerz zwischen seinen Rippen bis in die Lunge. Nur noch ein röchelndes Geräusch dringt aus Rempels Rachen. Dann sieht er durch die Schlieren vor seinen Augen hindurch etwas aufblitzen, fühlt etwas warmes feuchtes an seinem Hals... Schatten huschen durch das Tor auf die Radarstation zu. Überwältigen die vielleicht überraschten Wachen an der Eingangstür. Sprengen mit einer kleinen Zündkapsel die Eingangstür auf. Stürmen rein. Die Mannschaft der Radarstation ist total überrascht und wird mit ein paar kurzen MPi-Salven niedergestreckt. Zwei Mann des Überfallkommandos nehmen nun mit an Elektronik, was in die Rucksäcke paßt, während drei andere Sprengladungen anbringen. Der Feldflugplatz Rudaki liegt im Dunkeln. Die einzigen Bewegungen sind die Wachen, die entlang seiner Abgrenzungen patrouillieren. Jede Wache hat einen Hund dabei. Auf einmal schlägt einer der Hunde an. Sofort leuchtet die Wache mit einer Taschenlampe auf die Stelle, die der Hund anbellt. Im Zaun ist ein Loch. „Alaaarm!!“ brüllt die Wache, wieder und wieder. Der Ruf pflanzt sich schnell fort, Scheinwerfer leuchten auf und eine Sirene ertönt. „Scheiße!“ flucht Marta Rambowicz, die zusammen mit einem ihrer Soldaten zwischen zwei Lastwagen neben dem kleinen Hangar des Flugplatzes hockt. „Tja, Frau Leutnant, ich war von Anfang an der Meinung, daß das keine gute Idee ist.“ „Hauptfeldwebel Ellermann, Maul halten!“ herrscht sie ihn an und entsichert ihr Sturmgewehr. „Ellermann, Leuchtkugel hoch und dann kümmern Sie sich um den Hangar!“ „Jawohl Frau Leutnant!“ Aber Marta klettert schon in einen der Laster, während auf dem Flugfeld die Wachen hin und her rennen und wahrscheinlich auch bald diesen Abschnitt hier absuchen würden. Als sie Gas gibt, jagt Ellermann eine grüne Leuchtkugel in den Himmel. Das Signal für die anderen „Schimäre“-Soldaten, jetzt zuzuschlagen. Der Auftrag: Eliminierung der Flughafenbesatzung. Und Marta rast mit dem Lastwagen auf die freie Fläche hinaus. Sofort brüllen die Wachen und eröffnen das Feuer, mehrere Kugeln lassen die Windschutzscheibe zersplittern. Marta feuert mit dem Sturmgewehr aus dem Fahrerfenster, streckt zwei Soldaten nieder. Und auch an anderen Ecken des Flugplatzes peitschen nun Schüsse und flammen Gefechte auf. Marta springt kurzentschlossen aus dem Laster, rollt sich ab, duckt sich, um einer Kugel auszuweichen, feuert mit dem Sturmgewehr auf den Schützen, der niedergestreckt wird. Hinter rast der Laster weiter und genau in einen Stapel Fässer hinein. Alles geht in einer riesigen grellen Explosionswolke in die Luft. Marta rennt geduckt rüber zur Rollbahn, neben der mehrere Messerschmitts stehen. Da wird sie von den Beinen gerissen. „Ja, gut, faß!“ brüllt jemand. Ein Hund hat Marta von den Beinen gerissen, das Sturmgewehr ist in hohem Bogen weggeflogen. Als der Hund wieder auf sie zuspringt, hat sie zum Glück schon die Pistole gezogen und kann das Tier niederschießen. Da wird sie gepackt und hochgerissen, jemand hält seinen Arm als Schraubstock um ihren Hals, wirbelt sie herum. Sie sieht wie mehrere Explosionen im Innern des Hangars diesen in Brand stecken, während davor Ellermann noch mit einem kaiserlichen Soldaten in ein Handgemenge verwickelt ist. Marta hat die Pistole fallen gelassen, kann jetzt aber ihr Messer ziehen und rammt aus ihrem Gegner direkt in den Oberschenkel – und dreht die Klinge ruckartig hin und her. Der Mann schreit auf, läßt sie los, taumelt zurück, wobei die Klinge wieder aus seinem Bein gezogen wird. Marta wirbelt herum und in einer raschen Bewegung zerfetzt sie dem Soldaten mit der Klinge die Kehle. Der Kerl sackt tot zusammen. „Leutnantin!“ Marta dreht sich um. Einer ihrer Soldaten wirft ihr das Sturmgewehr zu und sie fängt es auf. „Danke! Da rüber!“ Sie deutet zu dem länglichen Flachbau am andern Ende der Rollbahn, wo immer wieder Mündungsfeuer aufzuckt, Schreie, Schußfolgen ertönen. Der Soldat nickt, dann rennt er geduckt rüber. Und sie, Marta, wird sich jetzt um die Flugzeuge kümmern. Sven Ellermann kriegt inzwischen endlich seinen Gegner in den Griff. Der Typ sitzt auf ihn und drückt das Gewehr gegen seine Keller; Sven kann sich etwas in eine freiere Position winden, tritt dem Feind von hinten gegen den Rücken, das der Mann vornüberfällt. Noch ein Tritt und der Typ ist runter. Sven springt auf, schleudert das Gewehr mit dem Bajonett am Lauf weg, wirbelt herum und tritt dem Mann, der sich gerade wieder aufrappeln will, voll in die Fresse. Mit einem Schmerzensschrei fällt der Mann zu Boden. Das verschafft Sven die Zeit, sein Sturmgewehr, das ihm eben aus der Hand geschlagen wurde, wieder aufzusammeln. Als er sich umdreht, stürmt der Typen wütend mit gezücktem Messer auf Sven zu. Der drückt ab. Eine kurze Salve aus dem Sturmgewehr streckt den Gegner nieder. Schnell sieht sich Sven um. Der Hangar brennt, inklusive dem noch danebenstehenden Laster. Überall liegen reglose Körper in den beigefarbenen Uniformen der Kaiserlichen und auch ein paar tote Hunde liegen am Rollfeld. Ein Knall. In etwa einem Kilometer Entfernung reckt sich aus dem Wald eine Feuersäule in den Himmel. Die Radarstation. „Na, wurde auch Zeit...“ murmelt Sven. Er folgt dem Schein der verschiedenen Feuer. Und sieht in 50 m Entfernung einen feindlichen Soldaten den Zaun entlangschleichen. Sofort legt Sven an und eröffnet das Feuer. Zwei, drei Salven, der Mann knickt erst ein, bricht dann zusammen. Marta wirft derweil Handgranaten in die Cockpits der Flugzeuge und rennt dann schnell weg. Hinter ihr werden die Maschinen nur Augenblicke später durch mehrere Explosionen zerstört, die Druckwellen reißen Marta noch von den Beinen. Sie bleibt liegen und hält ihren Stahlhelm mit den Händen fest, während Trümmerteile um sie herum herabregnen. In dem Flachbau, wo die Kämpfe abflauen, ertönt eine weitere Explosion. Dann ist Ruhe. Vorsichtig hebt Marta den Kopf und rappelt sich dann wieder auf. Vom lichterloh brennenden Flachbau kommen ihre Leute herüber. Feldwebel Lurch bleibt vor Marta stehen und meldet: „Frau Leutnant, Zielobjekte zerstört inklusive Funkanlage. Haben alle vorgefundenen Gegner eliminiert. Eigenverluste zwei Tote und drei Verwundete.“ „Sehr gut.“ Ein Blick auf die Uhr verrät Marta, daß man noch im Zeitplan ist. „Ok, ein paar von den Dreckssäcken werden sicherlich entkommen sein, also müssen wir uns beeilen. Lurch, Sie und ein paar Leuten suchen nochmal die Umgebung ab.“ „Zu Befehl.“ Lurch dreht sich um, winkt ein paar der anderen herbei und entfernt sich dann mit diesen. Während Marta sich mit einer Hand den Dreck von ihrer dunkelgrünen Uniform notdürftig abklopft, winkt sie Ellermann herbei. „Sven, schnappen Sie sich zwei Mann und dann richten Sie erstmal die Rollbahn her! Also Trümmer wegräumen und all so nen Kram!“ „Zu Befehl!“ Auch Ellermann winkt zwei Leute herbei und dann räumen sie die Trümmer beiseite. Marta zündet sich nervös eine Zigarette an. Hoffentlich geht das gut. Sie haben einen engen Zeitplan und gelinde gesagt, ist diese wilde Schießerei nicht Teil des Plans gewesen. Eigentlich sollten die Gebäude und Feindflugzeuge erst ganz zum Schluß in die Luft gejagt werden. Wie lange würde es nun dauern, bis die Kaiserlichen einen Spähtrupp schicken? Eigentlich müßte man den Feuerschein meilenweit sehen. Wenn hier ein Spähtrupp des Gegners hereinplatzt, dann kann das so weit im feindlichen Hinterland tödlich enden. Gefangennahme gibt es nicht, denn seit nicht ganz einem Monat gilt die Anweisung des kaiserlichen Oberkommandos, gefangengenommene „Schimäre“-Kämpfer sofort zu erschießen. Auf einmal Unruhe aus der Richtung, wo der Flachbau steht. Lurch kommt angerannt. „Frau Leutnantin, unser Trupp von der Radarstation ist angekommen!“ „Danke, Lurch.“ Marta läuft rüber zu den anderen und läßt sich vom Anführer des Trupps Bericht erstatten: „Melde gehorsamst: Kaum Widerstand, keine Eigenverluste, alle angetroffenen Feinde getötet, Material in zwei Rucksäcken sichergestellt, Rest gesprengt.“ „Hervorragend, Unteroffizier.“ Wieder schaut Marta auf die Uhr. Sie hinken nur eine Minute hinter dem Zeitplan her. Und jetzt hört sie auch schon das Brummen der Flugzeugmotoren. „Ok, alles runter vom Rollfeld!“ brüllt sie und renn an den Rand des Rollfelds, während Ellermann einige Signalfackeln entlang desselben auslegt. Und da senkt sich auch schon ein riesiges Ungeheuer aus dem finsteren Himmel herab, eine Focke Wulf 200, ursprünglich als Passagier-und Frachtmaschine konzipiert, jetzt vom Militär als Transporter und Aushilfsbomber eingesetzt. Nach zwei Hopsern rollt die Maschine aus und bleibt dann direkt vor den wartenden „Schimäre“-Soldaten stehen, die Motoren laufen aber weiter. An den Seiten prangt ein Rabe in einem blauen Dreieck – das Symbol des Freikorps „Schimäre“, bei den Alliierten nicht immer gerne gesehen und beim Feind gefürchtet. Der Wind von den Propellern läßt Martas rotgefärbtes Haar, das unter dem Helm hervorlugt, flattern. „Los Leute, rein!!“ Der Trupp mit dem Beutematerial kommt zuerst rangerannt und springt in die Maschine. Dann folgen die andern. Auf einmal peitscht ein Schuß am andern Ende der Piste. Drei als Nachhut eingeteilte Soldaten gehen sofort in die Hocke und feuern mit ihren Sturmgewehren kurze Feuerstöße zurück. Sofort feuert der Feind wieder zurück. Einer der „Schimäre“-Kämpfer jagt eine rote Leuchtkugel in den Himmel. Das ist das Signal für: „Haut ab, wir halten die Stellung!“ Mit zwei Mann hatte Marta noch in der Deckung eines Flügels gewartet. Jetzt rennen sie zur Einstiegsluke. Marta steigt als letzte ein, das Flugzeug setzt sich augenblicklich in Bewegung. Einen letzten Blick wirft Marta zurück. Sie sieht wie die drei Soldaten immer wieder nach den Feuerstößen die Position ändern. Und sie erkennt die Angreifer: Geheimpolizisten, die sich aus der Deckung einer Baumgruppe lösen. Sie würden die Nachhut ohne Zweifel vernichten – alle drei liquidieren. Die drei haben sich für die Mission und die höheren Ziele geopfert, ohne weitere Fragen zu stellen. Die Mission: Das war die Beschaffung wichtigen technischen Materials um Aufschluß über die Funktionsweise des kaiserlichen Radars zu erhalten und nebenbei noch soviel wie möglich kaputt zu machen. Die höheren Ziele: Das ist der Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit, der Zusammenhalt zwischen den Kameraden – und seit etwas mehr als einem Monat auch Rache für die verstorbene Generalmajorin Christiane Alleker, die ehemalige Leiterin der für die Kommandoeinsätze verantwortlichen C-Abteilung im „Schimäre“-Generalstab. Das Flugzeug hebt dicht über die Baumwipfel hinwegrauschend ab. Marta steckt den Kopf durch die Türe ins Cockpit, wo auf zwei der besten „Schimäre“-Piloten am Steuer sitzen: Auf dem Co-Pilotensitz Tacker, ein alter Hase schon und auf dem Pilotensitz Tanja Esser, unter den Piloten „Angel“ genannt. Sie ist erst seit etwa einem Monat dabei, hat sich aber durch zahlreiche Abschüsse feindlicher Maschinen bewehrt. „Ok, Tanja, bringen Sie uns weg hier!“ fordert Marta sie auf. Tanja läßt sich das nicht zweimal sagen und läßt die Motoren aufbrüllen. Stefan war mit seinem Sturmgewehr hinter einem umgekippten Tisch in dem noch nicht ganz fertigen Neubau, der einmal die größte Schule im Kölner Vorort Weiden werden sollte, in Deckung gegangen, während Standartenführer Jörg Oschmann und seine Leute auf aus allen Rohren feuerten. Und Stefan antwortet mit kurzen Feuerstößen. „Jörg, laß sofort Chrissi gehen!“ brüllt Stefan den Gepos im Forum zu. „Was sonst?“ brüllt der Standartenführer höhnisch und wirft seiner Geisel Christiane Alleker einen verächtlichen Blick zu. Nach der Niederlage in Bosnien, bei der Stefan ihm ein Auge ausgeschossen hatte, stand er endlich vor einem Sieg. Gewiß: Soeben hatten „Schimäre“-Kämpfer in Köln ein KZ befreit, aber er hatte deren 3. Generalstabsoffizierin als Geisel und konnte nun den Kopf der Bande noch miterledigen...Um Zeit zu schinden, schickt Oschmann die Frau doch los: „...geh rüber zu ihm!“ Mit etwas weichen Knien steht Christiane auf, verläßt die Deckung im Forum und geht rüber zu Stefan. Sie kriegt nicht mit, wie Oschmann mit seinen Männern einen neuen Plan schmiedet. Auf einmal springt Oschmann auf, reißt seine MPi hoch – und feuert von hinten auf Christiane. Gellend schreit sie auf, fällt, hält sich an einem Tisch fest, fällt dann blutüberströmt zu Boden. Stefan kann ihr nicht helfen, weil die Gepos ihn mit ihren MPis hinter dem Tisch festnageln. „Chriiiiissiiiii!!!!!“ „Chriiiissiiiii!!!!“ Mit dem Schrei wacht er schweißgebadet auf. Schweratmend sitzt er im Bett und muß sich konzentrieren, um den Puls wieder runterzukriegen. Wo bin ich? geht es ihm durch den Kopf. Dann fällt es ihm wieder ein. Er ist in einem Zimmer im ersten Stock einer kleinen Jugendherberge im Dörfle Jakovlevo, direkt östlich von Jarcevo. Er wirft einen Blick auf den Wecker, der auf dem Tisch am Fenster im Zwielicht des Mondes steht. Vier Uhr. In zwei Stunden wird der Wecker eh schellen und auch die anderen drei Mann hier wecken: Oberst Marco Konrad, der Nachschuboffizier von „Schimäre“, dessen Stellvertreter Kant und Kapitän zur See Philipp Kipshoven, Stefan Reiss‘ bestem Freund seit nunmehr fast 30 Jahren und Chef der kleinen Marine von „Schimäre“, die über die Nordsee, das Mittelmeer und den Ladoga-See verteilt ist. Stefan beschließt, nicht weiterzuschlafen. Er entschwindet schnell in Unterhosen in das kleine Bad auf der anderen Seite des Ganges, wäscht sich, putzt die Zähne. Dann zieht er sich im Zimmer ohne das Licht einzuschalten schnell um. Er zieht den dunkelgrünen Kampfanzug an, an dem ihn nur die Schulterklappen als General und damit als Oberbefehlshaber des Freikorps „Schimäre“ ausweisen. Dann legt er den Gürtel mit den Taschen für Handgranaten und dem Holster für die Walther P38 um. An diesem Gürtel befestigt er zwei dünne Metallketten, die ihm ebenso als Glücksbringer dienen wie sein Jadeanhänger, den er um den Hals trägt. Schließlich schnürt er sich die Kampfstiefel zu – was er übrigens erst vor einigen Jahren von Schoeps, die jetzt Generalmajorin und Kommandeurin einer Kavalleriedivision ist, gelernt hat. Und er legt zuletzt seinen Säbel um – dank eines Gurtes an der Scheide kann er ihn so tragen, daß er nur über die Schulter zu greifen braucht, um an ihn zu kommen. Dann schultert er seinen bereits am Vorabend gepackten Rucksack und verläßt das Zimmer. Er geht den Flur entlang und die Treppe hinunter, die zur Eingangshalle führt, die neben einer Rezeption auch eine Sofaecke besitzt. Auf den Polstermöbeln tummeln sich Oberst Christian Jacke, Kommandeur des Spezialbataillons 1, Brigadierin Cornelia Schönmann, Ic (3. Generalstabsoffizier, zuständig für Sicherheit, Feindaufklärung, Spionage und Kommandounternehmen) und Generalleutnantin Karolina Sus, Reiss‘ Stellvertreterin und die Ex-Freundin von Schönmann. Zum Glück kann man die beiden inzwischen wieder allein in einem Raum lassen. „Morgen Leute!“ begrüßt er die drei. Karo schaut auf. „Morgen. Was machst Du denn schon hier?“ „Bin früh aufgewacht und dachte, ich warte hier unten auf Oberfähnrich Rüttel.“ Er legt seinen Rucksack bei der Rezeption ab und setzt sich dann auf das Sofa neben Karo. „Und ihr wartet immer noch auf Leutnantin Rambowicz?“ Jacke nickt. „Sie müßte jeden Moment eintreffen.“ „Hast Du gestern abend noch die Mappe gefunden?“ fragt Karo Stefan. Der nickt. „Ja, hab ich. Danke Dir für die Zusammenstellung.“ „Ich dachte, es wäre nicht schlecht, wenn Du bei dem Treffen etwas über die andern Teilnehmer weißt.“ „Gut gedacht.“ Ja, es war wirklich gut gedacht. Stefan muß für zwei Tage nach Moskau reisen, um dort an einer Lagebesprechung der wichtigsten Kommandeure der Russlandfront teilzunehmen, die von Zarin Katharina persönlich geleitet wird. Gerüchte besagen, daß die Zarin Reiss selber die Schuld daran gibt, daß die Schweden vor Sankt Petersburg ihre Schlußoffensive vorbereiten und die Kaiserlichen durchgehend auf russischem Boden stehen. Denn Stefan selbst hatte Mitte September dazu beigetragen, den polnischen Oberbefehlshaber Rydz-Smigly zum Rückzug nach Osten zu bewegen, was nur möglich wurde, weil Russland da schon den Alliierten den Kriegseintritt zugesichert hatte. Und ohne diesen Rückzug, so meinen viele, hätten die Kaiserlichen noch in Litauen und Wolhynien gestoppt werden können. So aber stürmten sie den sich zurückziehenden Alliierten hinterher und drängten sie in wilden Kämpfen, die Ende September bei Riga, Minsk und Mogilew, bei Kiew und Targowize tobten, über die Grenze nach Russland zurück. „Schimäre“ selbst konnte die kaiserliche 2. Armee nur mühsam zwischen Smolensk und Jarcevo stoppen, wobei ein polnisches und zwei russisches Korps halfen. „Sag mal Karo, Du scheinst ja über einige der russischen Kommandeure mindestens soviel zu wissen wie über die polnischen.“ Karo zuckt die Schultern und grinst verlegen. „Naja...ich hab ein paar der Herren vor Jahren mal beigebracht, Respekt vor Frauen zu haben.“ meint sie kleinlaut und die andern lachen kurz auf. Sie wissen alle – und Conny erst recht, denn sie war dabei - , daß Karo mit ihrer Polnischen Legion in den Jahren vor dem Krieg einen Guerillafeldzug gegen Polen, Preußen, Kaiserliche und Russen führte, um die Ergebnisse der Polnischen Teilung rückgängig zu machen. Jetzt kämpfen die Soldaten der früheren Polnischen Legion als Teile des 4. Infanterie-und des 1. Kavallerieregiments im Rahmen von „Schimäre“ Seite an Seite mit russischen, polnischen und exildeutschen (ex-preußischen) Einheiten gegen die Kaiserlichen – aber Karos kleine Siege über alle vier Gegner von damals hat keine der beiden Seiten vergessen. Noch heute gibt es zwischen Karo und einzelnen polnischen und russischen Kommandeuren Animositäten, weswegen Stefan es im allgemeinen vermeidet, sie auf diese Kommandeure treffen zu lassen. Deswegen geht er auch selber nach Moskau, statt seine Stellvertreterin zu schicken. Draußen hört man einen Lastwagen vorfahren. „Das dürfte Marta sein.“ meint Jacke und steht auf; die anderen folgen ihm vor die Tür. Auf dem Parkplatz der Herberge hält gerade ein Militärlaster mit dem taktischen Zeichen von „Schimäre“ an den Seiten. Die Beifahrertür fliegt auf und Marta Rambowicz springt herunter aufs Pflaster. Salutiert und meldet: „Melde gehorsamst, Auftrag ausgeführt. Radaranlage nach Mitnahme wichtigen Gerätes gesprengt, Flugplatz vorerst außer Gefecht gesetzt. Eigenverluste fünf Tote.“ „Gut gemacht, Frau Leutnant!“ lobt Jacke. Conny steht bereits neben dem Heck des Lasters und klettert nun auf die Ladefläche. „Zeigt mal her, was habt ihr mitgebracht?“ Dann sagt sie den Soldaten, wo die Ladung – die Beute von der Radarstation – hingebracht werden soll. „Hervorragende Arbeit.“ lobt auch Stefan den Erfolg von Martas Kompanie bei diesem Einsatz. „Danke, Herr General. Wenn es recht ist, würde ich meinen Kämpfern jetzt gerne etwas Ruhe gönnen. Wir haben seit Mitte September fast nur Einsätze gehabt.“ „Sicher. Oder was denkst Du, Jacke?“ „Kein Thema, ein paar Ruhetage sind drin.“ „Danke.“ Marta will sich gerade umwenden, um sich auf den Weg zu den Quartieren ihrer Kompanie am Ortsrand zu machen, als ihr noch etwas einfällt. „Ach, Oberst Jacke?“ „Ja, Leutnantin Rambowicz?“ „Als wir abflogen, wurde unsere Nachhut angegriffen.“ „Und, kommt doch öfter mal bei solchen Aktionen vor.“ meint Karo nicht sonderlich verwundert. „Ja, schon...“ bestätigt Marta, fügt dann aber mit sorgenvollem Blick hinzu: „Nur normalerweise sind die Angreifer keine Geheimpolizisten.“ Auch Stefan und Karo horchen jetzt auf, sehen sich gegenseitig an und schauen dann zu Jacke herüber, der einigermaßen sprachlos ist. Conny kommt vom Laster zurück, hat den letzten Satz mitgehört. Und fragt jetzt: „Bitte?!“ „Ja, Gepos haben uns auf dem Flugplatz attackiert!“ Jacke dreht sich zu Stefan und Karo um. „Was haben Gepos so nahe an der Front zu suchen?“ „Normalerweise tauchen Gepos so nahe der Front nur auf, wenn eines ihrer Regimenter in die HKL eingegliedert wird oder wenn sie Gefangene direkt nach einer Schlacht liquidieren sollen.“ konstatiert Conny Schönmann aufgrund aller bisherigen Erfahrungen mit Gepos. Auf dem Balkan und in der Schweiz hatten Gepo-Regimenter direkt in die Schlachten eingegriffen. Und beim Preußen-und den Polenfeldzügen folgten Gepo-Einsatztrupps den regulären Truppen dicht auf, übernahmen alle gefangengenommenen alliierten Soldaten und liquidierten diese zumindest teilweise. Was in Preußen darin gipfelte, daß die preußische Königsfamilie im Sommer nach der preußischen Kapitulation von Gepos ebenfalls erschossen wurde. Um nur einen der bekanntesten Auswüchse des brutalen Einsatzes von Geheimpolizisten zu nennen. „Ich würde sagen, da braut sich was zusammen...“ beendet Conny zögerlich ihren Gedankengang. „Da stimme ich Dir zu.“ gibt Stefan zurück und wendet sich an seine Stellvertreterin. „Karo, während ich auf der Konferenz bin, sei auf der Hut. Wahrscheinlich braut sich da was zusammen.“ Sie nickt. Die Eingangstür der Herberge geht auf. „Chef, Sie sind schon wach?“ meldet sich Oberfähnrich Silke Rüttel, Stefans Adjutantin. Stefan dreht sich um. „Ja, Oberfähnrich! Sind Sie auch schon fertig?“ „Äh...naja...ich wollte noch essen...“ „Essen werden wir unterwegs.“ Er geht zu ihr rüber. Silke ist eine schlanke Frau mit langen schwarz gefärbten Haaren. „Oder haben Sie noch nicht gepackt, Oberfähnrich?“ „Doch...äh...schon.“ „Na dann los. Holen Sie Ihre Sachen und dann den Wagen." „Zu Befehl, Herr General.“ Sie dreht sich steif um und geht zurück auf ihr Zimmer, ihren Rucksack holen. Innerlich flucht sie. Noch nicht mal frühstücken kann sie. Manchmal ist der Mann einfach unmöglich! Im einen Moment ist er jovial wie sonst was und im nächsten läßt er den Vorgesetzten raushängen! Stefan holt auch seinen Rucksack und geht schon mal zu dem Parkplatz, wo der Kübelwagen steht, den er und Silke immer für Diensttouren benutzen. Dort wartet er. Karo kommt nochmal vom Laster rüber. „Hey!“ „Hey!“ gibt er zurück. Küßchen auf die Wange, Umarmung. „Paß gut auf Dich auf, Stefan! Du weißt, die Russen sind manchmal ware Halsabschneider...“ „Ich doch auch.“ meint er mit seinem Haifischgrinsen. „Ja, ja, wir wollen mal wieder einen auf hart machen.“ Er zuckt nur die Achseln. Da kommt auch schon Silke angelaufen, schließt den Wagen auf und wirft ihren Rucksack auf die Rückbank. „Ok, Karo, ich muß dann. Wir sehen uns in zwei Tagen. Halt die Stellung.“ Sie nickt und tritt dann ein paar Schritte zurück. Den Rucksack wirft Stefan ebenfalls auf den Rücksitz und setzt sich dann auf den Beifahrersitz, während Silke den Motor anläßt. Sie setzt zurück und fährt dann erstmal die Hauptstraße an. Kurz blickt Karo dem Wagen noch nach. Irgendwie hat sie ein seltsames Gefühl. Aber sie verscheucht es wieder. Zu den andern zurückgehenden meint sie: „Kommt, laßt uns das Zeug in die C-Abteilung schaffen und dann schonmal frühstücken. Jetzt noch was zu schlafen macht wohl nicht viel Sinn." Darin stimmen ihr alle zu. Nachdem sie die Rucksäcke mit dem Elektronikmaterial zur Analyse in die C-Abteilung gebracht haben, die im Keller ist, und Karo wieder durch die Eingangshalle kommt, steht eine schlanke, was schon hagere Gestalt in schwarzer Kleidung und mit langen gewellten Haaren auf der Treppe. Kapitän zur See Philipp Kipshoven. Trotz einer Kniegeschichte vor einigen Jahren immer noch ein echter Haudegen. „Ist er weg?“ Karo nickt. „Ja, er ist weg.“ „Gut. Dann müssen wir ja nicht mehr so viel Versteckspielen.“ grinst er. „Komm mit.“ meint sie. Die beiden gehen nach draußen, zu dem Stöwer, der auf dem Parkplatz steht. Dieser Geländewagen ist Karos eigener Dienstwagen. Sie schließt auf und zeigt Philipp die Kiste auf der Rückbank. Zusammen hiefen sie diese heraus und Karo schließt das Vorhängeschloß auf. Nun kann Philipp einen Blick hineinwerfen, tastet den Inhalt vorsichtig ab, ob alles so ist, wie es sein muß. „Und, zufrieden?“ „Die Frage ist, ob der Chef zufrieden ist.“ „Ok, wird der Chef glücklich sein?“ Karo verhehlt den Spott in ihrer Stimme nicht. Nachdenklich schürzt Philipp die Lippen. „Ja, ich denke der alte Reiss wird glücklich sein.“ „Na bitte. Geht doch.“ „Haben schon alle ihre Beiträge bezahlt?“ „Ich werd gleich zum Flugplatz fahren und mit Tanja frühstücken. Dann gibt sie mir ihren Beitrag und dann haben wir auch schon alle. Die Tokarews kommen allerdings erst morgen an.“ „Egal. Bis übermorgen haben wir ja noch Zeit.“ „Stimmt. Ins Haus damit?“ „Ja. Wär ne Maßnahme.“ Zusammen tragen sie die Kiste in die Eingangshalle und stellen sie hinter der Rezeption ab. „Ok, Philipp, ich geh dann.“ „Frühstücken?“ „Ja. Bis später.“ „Jo bis später.“ Als Karo den Raum verlassen hat, murmelt Philipp mehr zu sich selber: „Die glaubt ja wohl selbst nicht, daß sie mit Tanja nur frühstückt...“ Schließlich weiß jeder, daß die beiden frisch verliebt sind. Leikert mag keine Überraschungen. So auch diese nicht. „Was soll das heißen, ihr könnt sie nicht mehr finden?!“ brüllt er wütend in das Telephon auf seinem Hotelzimmer. „Naja...“ beginnt ein hörbar eingeschüchterter Scharführer am andern Ende der Leitung mit einer Antwort. „Naja...sie hat mit Schlüssel aus dem Umschlag das Schließfach am Bahnhof geleert, ist dann in den Zug gestiegen. Aber beim Zwischenstopp bei Koblenz ist sie dann verschwunden...“ „Verschwunden?“ schnappt Leikert und spürt sofort ein Ziehen in seinen noch nicht ganz verheilten Narben, die er sich im Sommer in Bosnien zugezogen hat. „Ja, verschwunden. Wir vermuten, daß sie sich einen Mietwagen geschnappt hat. Wohin sie damit gefahren ist, wissen wir nicht.“ „Dann stellt es fest!“ befiehlt Leikert wütend. „Und wo sollen wir da anfangen, Sturmbannführer?“ „Laßt auf allen Wegen nach Köln fahnden. Ansonsten wird sie schon an irgendeinem Kontrollposten auffallen. Vielleicht haben wir ja Glück und sie passiert das Zentrale Sperrgebiet Maintal. Also machen Sie sich an die Arbeit, Scharführer.“ „Jawohl, Sturmbannführer!“ Der Mann legt wieder auf und Leikert auch. Kurz blickt Leikert auf die Uhr. Es ist gerademal zehn Uhr vormittags. Schließlich greift er wieder zum Hörer und wählt eine Geheimnummer. „Standartenführer Oschmann.“ meldet sich am andern der Leitung Leikerts Vorgesetzter. „Hier Leikert. Es gibt Schwierigkeiten. Die Zielperson ist uns entwischt.“ „Verdammt. Ok, wir treffen uns.“ „Wo?“ „In der Burg Muiderslot bei Amsterdam. Ich will dort morgen ohnehin einige Kontaktleute treffen. Gesellen Sie sich doch einfach dazu.“ „In Ordnung. Bis morgen.“ Leikert legt auf und beginnt zu packen. Im Keller des Hotels legt nun auch Andreas Beiß den Hörer auf. Er hat die ganze Zeit mitgehört und mitgeschrieben. Er faltet das Blatt Papier und steckt es in einen Umschlag. Er würde es Linda zur Beurteilung vorlegen. Zwar weiß man noch immer nicht, wer die Zielperson ist, aber eventuell kann man weitere Schlüsse auf die Pläne der Gepos aus diesen Gesprächen ziehen. Oder aber Linda läßt die Sache direkt weiter ans HQ von „Schimäre“ funken. Auf jeden Fall wird sie dies interessieren. Sie hatte sich in Koblenz einen schnittigen Porsche als Mietwagen organisiert, den Rucksack auf den Beifahrersitz geworfen und dann einfach Gas gegeben. Und ab Richtung Süden! Immer den Rhein entlang. Am frühen Nachmittag erreicht Petra Bingen am Rhein. An der Uferstraße stellt sie den Wagen ab. Sie hat sich vorsichtshalber etwas weniger auffälliges als die Klamotten von Samstagabend angezogen: Einfache schwarze Jeans und eine braune wetterfeste Jacke. Nur wer genau hinsieht, könnte in ihr anhand des Piercings direkt unter der Unterlippe oder anhand der Anhänger um den Hals eine Vertreterin des GothicUntergrundes erkennen. Es nieselt leicht. Als sie die Uferstraße entlanggeht, auf der Suche nach einem Gasthaus oder etwas in der Art, kommt sie an einem Menschenauflauf vorbei. Sie mischt sich in die Menge um zu beobachten, was hier los ist. Direkt neben einer Fähranlegestelle beugen sich einige Polizisten in ihren grünen Streifenuniformen über etwas. „Entschuldigen Sie, was ist hier passiert?“ fragt Petra leise eine ältere Frau, die neben ihr steht. Die Frau sieht sie irritiert an. „Sie sind wohl nicht von hier?“ „Nein, auf der Durchreise.“ „Ja, das haben wir öfter hier, seitdem die liberalen Wirrköpfe damals den Aufstand gewagt haben. Mal wieder eine Leiche, die den Fluß herabtrieb.“ „Das kommt seit dem Aufstand vor?“ „Ja, seit nun gut einem Jahr. Seit die Regierung diese Idioten kleingekriegt hat.“ „Ach so...“ Langsam entfernt sich Petra wieder und geht dann weiter. Seit einem Jahr. Damals, im Oktober 1787, endete der sogenannte MaintalAufstand der liberalen Kräfte in diesem Gebiet. Damit endete damals auch die erste Kriegsphase. Petra hatte es interessiert in den Nachrichten mitverfolgt, weil zeitweise auch ihre Heimatstadt Bamberg im Mittelpunkt der Kämpfe gestanden hatte. Außerdem hatte sich die Gothic-Szene des Maintals den Rebellen angeschlossen, was sich durchaus rumgesprochen hatte; viele von ihnen hatten in den Volksmilizen gegen den Kaiser gekämpft. Und viele waren gefallen. Nur einige, die damals aus dem Würzburger Kessel, dem letzten Widerstandsnest der Rebellen, hatten entkommen können, kämpfen jetzt noch in den Reihen von „Schimäre“. Was aus jenen wurde, die nicht entkamen, wurde nie geklärt. Allseits bekannt ist nur, daß der Kaiser der Bevölkerung des Maintals nie vergeben hat. Seit jenen Tagen, also seit etwa einem Jahr, ist das Maintal zum Zentralen Sperrgebiet geworden. Was dort vor sich geht, weiß niemand. Petra kann es sich aber nach dem eben gesehenen und gehörtem vorstellen. Und diese Vorstellung behagt ihr gar nicht. Lieber biegt sie da in eine der Seitengassen ein. Und da findet sie auch schon an der nächsten Ecke eine kleine Gaststätte. Erstmal was zwischen die Kiemen und dann telephonieren – ja, das wäre eine Maßnahme! Als Petra die Gaststätte betritt, findet sie sich in einem gemütlichen Raum mit getäfelten Wänden wieder, einer dunklen Bar aus Eichenholz und mehreren Tischen mit grünen Decken. Nur am hintersten Tisch sitzt ein junges Paar und ißt zu Mittag. Die Frau hinter der Bar begrüßt Petra: „Mahlzeit, junge Frau. Womit kann ich Ihnen dienen?“ „Was krieg ich für drei Rationsmarken?“ „Einen Teller Bratkartoffeln plus Getränk.“ „Ok, dann das und ein Wasser.“ Petra setzt sich an einen der Tische mit Blick zur Tür. Nervös raucht sie sich schnell eine. Mit einer Hand tastet sie nochmal an ihrem Gürtel nach, ob sie auch rasch genug an ihre Automatique Browning modèle 1910 rankommt. In Zeiten wie diesen lebt man gefährlich. Seit Samstag hatten sich ihre Hoffnungen, den Krieg überstehen zu können, ohne in den inzwischen weltweiten Konflikt hineingezogen zu werden, zerschlagen. Bislang hatte sie nach dem Ende des Maintal-Aufstandes eher beiläufig in den Nachrichten die immer neuen Kriegsschauplätze verfolgt: Dänemark, Norwegen, Sachsen, Preußen, Mecklenburg, Schlesien, Galizien, Ostpreußen, Ungarn, zuletzt dann auch die Karibik (wo es seit September erste Scharmützel zwischen den Alliierten und den Franzosen gab), die Pyrenäen und sogar Indien und China. All das war weit, weit weg. Am nächsten lagen noch der Rheinlandfeldzug während des letzten Winters, als preußische Truppen Aachen besetzten, und im September die Kämpfe in den Niederlanden, die jetzt in ihre letzte Phase gingen. Verschiedentlich gab es Vorfälle in Köln, die von den kaiserlichen Medien als „terroristische Akte“ tituliert wurden. Aber Petra hatte sich wohlweislich davon ferngehalten. Und lieber weiter als Verkäuferin in einem kleinen GothicLaden gearbeitet. Die wilden Rebellenzeiten waren eigentlich lang vorbei. Scheiß drauf! Jetzt steckte sie wieder mitten drin in der Scheiße! Wie sollte sie da wieder rauskommen? Darüber denkt sie auch während des Essens noch nach. Wie soll sie da wieder rauskommen? Sie erinnert sich, was ihr einmal jemand sagte: „Durchmetzeln und hoffen, daß man an einem Stück wieder rauskommt.“ Süffisant lächelnd hatte dieser jemand hinzugefügt: „Mit dem Rücken zur Wand kämpft es sich einfach. Da ein Rückzug unmöglich ist, muß man angreifen.“ Als sie gegessen hat, geht sie zur Bar und fragt die voluminöse Wirtin: „Kann ich hier auch telephonieren?“ „Ja, sicher. Da vorn ist ein Münzapparat.“ Die Frau deutet auf einen Apparat ganz hinten durch, direkt neben den Toiletten. „Danke.“ Petra geht zum Telephon rüber und wählt eine Nummer in Florenz. In der Hoffnung, daß die Verbindung dorthin nicht abgeschnitten ist, denn seitdem der Kaiser und seine Verbündeten – der Papst, die französische Putschistenregierung und das Großherzogtum Toskana – in einem kurzen Blitzfeldzug im September den Rest Italiens unterworfen haben, ist auch dort die Lage schwierig. Zwar halten die Alliierten inzwischen nur noch Sizilien, aber dennoch ist die Lage in Italien schwierig. Es braucht nur eines Funkens, um auch dort antikaiserliche Aufstände anzuzetteln und die kaiserliche Koalition weiß das. Aber was ist das? Ein Freizeichen! Und dann hört man es auf der anderen Seite klingeln. Jemand meldet sich auf Italienisch. „Denise? Hier Petra!“ „Petra! Man, damit hätte ich jetzt aber gar nicht gerechnet! Wie geht es Dir?“ „Geht so. Du ich hab nicht viel Zeit. Ich steck in der Klemme.“ „Wieso das denn?“ „Warte kurz...ich muß noch Geld einwerfen...so...also, ich wollte wissen, ob ich zu Dir reisen kann.“ „Nein, lieber nicht. Hier in Italien geht momentan so ne ganz abgefahrene Schose ab. Der Papst hat die Inquisition wieder eingeführt und jetzt wird alles und jedes, was den Inquisitoren seltsam vorkommt, verhaftet. Angeblich hat es in Rom sogar schon wieder erste Hexenverbrennungen gegeben.“ „Alles klar. Ich komme denen mit Sicherheit komisch vor.“ „Genau das meine ich. Kann ich sonst helfen?“ „Ja, Du könntest einen Namen für mich überprüfen.“ „Welchen?“ „Hast Du was zu schreiben?“ „Ja.“ Zwei Soldaten auf Motorrädern – ihre Abzeichen weisen sie als Vertreter der örtlichen Garnison aus – halten vor der Gaststätte. „Ok, jetzt erstmal was essen.“ meint der eine. „Wunderbare Idee.“ Sie hängen ihre Helme an die Motorräder und betreten dann das Lokal. Petra spricht immer noch am Telephon mit Denise und wirft zum wiederholten Male Geld ein. „Hast Du alles, Denise?“ „Ja, ist klar. Wie kann ich Dir die Ergebnisse der Recherche bringen?“ „Ich ruf Dich wieder an, wenn ich wieder einen etwas sicheren Unterschlupf habe.“ „Alles klar... Und Petra?“ „Ja?“ „Paß auf Dich auf. Du bewegst Dich in riskanten Gefilden. Wenn Du viel Pech hast, machst Du Dir nicht nur die Gepos zu Feinden sondern auch noch den Typen, den Du umbringen sollst. Und nach allem, was ich weiß, können auch dessen Leute recht unangenehm werden...“ „Ich paß schon auf mich auf. Ein paar Asse hab ich noch im Ärmel. Also, bis dann.“ „Ok, bis dann...“ Petra legt auf. Erst jetzt sieht sie die beiden Soldaten, die sich an die Bar setzen. Ruhig bleiben, ruhig bleiben! geht es ihr durch den Kopf. Die werden schon nicht wegen dir hier sein! sagt ihr die Stimme im Hinterkopf. So normal wie möglich geht sie an den Soldaten vorbei zur Tür und verläßt das Lokal. Der Soldat, der der Tür am nächsten sitzt, schaut ihr kurz nach. „Grrrr...“ „Was ist, Fränkie?“ „Hast Du die Kleine grad gesehen, Manni?“ „Ne, hab ich nicht. Im Gegensatz zu Dir bin ich verheiratet. Würde Dir auch mal gut tun, dann würdest Du nicht mehr jeden Ische nachsteigen.“ „Zum heiraten müßte ich auch erstmal eine finden...“ Die Wirtin stellt den beiden je einen Teller Suppe hin, die sie langsam leerschlürfen. Da geht die Tür auf und zwei Gepos treten ins Lokal ein. Die Wirtin wirft den beiden schwarzuniformierten Männern sofort mißtrauische Blicke zu. Scharführer Olm kommt zur Bar und zieht eine Zeichnung aus der Tasche. „Haben Sie diese Frau gesehen?“ fragt er die Wirtin. Aber die zuckt nur die Achseln. „Ihr?“ wendet er sich an die Soldaten. Und Fränkie erkennt sie wieder. „Ja, doch, die war eben hier.“ Der Scharführer schaut seinen Kollegen an. Dann haben sie sie ja nur knapp verpaßt! Vielleicht kann man Leikert ja schon bald die Wiederherstellung des Sichtkontaktes melden. „Wie lange ist das her, Soldat?“ „Vielleicht eine Viertelstunde.“ „Ok, danke.“ „Nichts für ungut.“ Als die Gepos wieder draußen sind, meint Fränkie zu Manni: „Siehste, manchmal bringt es doch was, den Frauen hinterherzustarren...“ „Was macht ‚Schimäre“so gefährlich? Die Sollstärke von inzwischen über 30000? Die Mischung aus Männern und Frauen in den Kampftruppen? Die Sturmgewehre dieser Soldaten? Oder ist Reiss wirklich so genial, wie manche behaupten? Oder ist es vielleicht doch die Botschaft von Freiheit, die man jedem Volk verkaufen kann?“ Frage Helldrichs an die versammelte GepoFührungsspitze im September 1788 Conny Schönmann sitzt in ihrem kleinen Büro, das man in einem Kämmerchen im Keller der Jugendherbege eingerichtet hat. In den Nachbarräumen ist die C-Abteilung von „Schimäre“ untergebracht, zuständig für Aufklärung, Spionage und Kommandounternehmen. Diese Bereiche sind wichtig. Wenn man über den Feind nix weiß, kann man ihn nicht bekämpfen. Daher versucht man ständig mit erbeuteten Dechiffriermaschinen des Feindes dessen Funksprüche zu entziffern, was aber auch immer schwieriger wird. Conny weiß: Bald wird man so große Apparaturen brauchen, daß man die Funkaufklärungsabteilung irgendwo weit hinter der Front, etwa in Moskau, unterbringen muß. Am besten, man arbeitet dann mit den entsprechenden Abteilungen der anderen Alliierten zusammen. Was die Spionage angeht: „Schimäre“ unterhält ein Agentennetz mit Schwerpunkt in Köln, das sich über weite Teile Europas erstreckt und zu den effektivsten alliierten Nachrichtendiensten gehört. Vor allem benutzen die Funker dieses Netzes Einmalcodes, die praktisch nicht zu knacken sind. Und die Kommandounternehmen sind das besondere Schmuckstück von „Schimäre“. Zurückgehend auf die Idee eines preußischen Offiziers, ins Leben gerufen dann von General Reiss, auf-und ausgebaut durch die vor kurzem verstorbene Vorgängerin Connys als Chefin der C-Abteilung, Generalmajorin Christiane Alleker, ist dieses Projekt ein echter Erfolg geworden. Inzwischen sind sechs Spezialbataillone an der Ostfront, auf den Färöern, in einem der niederländischen Brückenköpfe, auf Sizilien und Kreta und an der Front bei Konstantinopel stationiert. Am erfolgreichsten war bislang das Spezialbataillon 1, quasi der Veteran unter den Spezialbataillonen. Noch immer sind Connys Leute damit beschäftigt, das von einer Kompanie dieser Einheit erbeutete technische Material auszuwerten. Conny muß an den Wahlspruch dieser Leute denken: „Für die Freiheit und für Sie!“ Der Spruch ist auf Christiane Alleker gemünzt gewesen, die zu dieser Einheit immer eine besondere Beziehung hatte. Es war fast, als sei diese Einheit ihr Kind gewesen. Der Kommandeur des Spezialbataillons 1, Oberst Jacke, gehört auf jeden Fall zu denen, die fest entschlossen sind, Rache für den Tod von Christiane zu üben. Ein unfreiwilliges Lächeln huscht über Connys Gesicht: Da wird er sich hinten anstellen müssen. Direkt hinter Reiss und Kipshoven. Die beiden waren mal mit der bildhübschen Frau zusammen, Philipp Kipshoven war sogar mal ein halbes Jahr mit ihr verheiratet... Es klopft an der Tür. „Ja, herein!“ Die Tür geht auf und eine Frau mit langen über die schulterfallenden Haaren, Conny schätzt sie auf 28, tritt ein. „Entschuldigen Sie, Frau Brigadier, aber in zehn Minuten wäre es Zeit für den Kölner Befehl.“ „Ach ja!“ Jetzt fällt es auch Conny wieder ein. Ein Überbleibsel aus der Zeit von Frau Alleker: Für jede Spionagezelle gibt es eine bestimmte Zeit am Tag, wo man ihr routinemäßig neue Befehle gibt, sofern dies nötig sein sollte. Nur in Krisenzeiten weicht man von dieser Routine ab. „Sicher, Gefreite. Warten Sie kurz!“ Conny stöbert kurz in einem Aktenstapel rum und holt eine Mappe mit Meldungen heraus. Sie überfliegt kurz die Meldung, die gegen Mittag aus Köln eingegangen ist. Sie schaut auf die Uhr. Es ist jetzt kurz vor 21 Uhr. Tatsächlich Zeit, neue Befehle an die Kölner Agentenzelle durchzugeben. „Ok, lassen Sie an die Leute vom Rothschild durchgeben, sie sollen rauskriegen, wer die Zielperson von Leikert ist. Im Notfall sollen sie ihm einen Schatten hinterherschicken.“ „Zu Befehl, Frau Brigadier.“ Zwei Räume weiter steht die Funkanlage. Stabshauptmann Kruse, der diese Unterabteilung leitet, macht gerade vor seinem Funkgerät eine Kaffeepause. Ganz hinten in einer Ecke sitzt der Obergefreite Bleck und durchforstet den Äther nach allen Arten feindlicher Funksignale. Als die Tür aufgeht, schaut Kruse von seinem Kaffee auf. „Was gibt’s, Gefreite?“ „Sie sollen an die Leute vom Rothschild durchgeben, daß sie die Zielperson der Gepos rauskriegen sollen. Notfalls soll Leikert beschattet werden.“ „Alles klar. Der Funkspruch geht gleich ab.“ „Ok, ich sags der Frau Brigadier.“ Kruse nickt nur, dann geht die junge Frau wieder. „Bleck, haste das gesehen?“ „Ne, was denn?“ Der Obergefreite blickt von seinem Schreibblock auf, wo sich inzwischen zahlreiche Krakellinien tummelten, denn im Äther gab es seit Stunden nichts interessantes mehr. Nachdem Kruse den Funkspruch durchgegeben hat – genau zu der Zeit, zu der in Köln Katrin Schmiegeld am Funkgerät sitzt – und kurz darauf das kurze „OK“-Signal als Empfangsbestätigung bekommen hat, trinkt er den letzten Schluck Kaffee. „Bleck, ich hol mal neuen Kaffee.“ „Is klar, Herr Stabshauptmann.“ Wieder versinkt Bleck in angespanntes, konzentriertes Lauschen. In aller Ruhe macht Kruse an der Kaffeemaschine auf dem Gang neuen Kaffee. Gerade, als die Thermoskanne füllt, ruft ihn Bleck: „Stabshauptmann, ich hab was!“ Kruse läßt alles stehen und rennt rüber in den Funkraum. „Was?“ „Ein Signal, 20 Sekunden! Unbekannte Codierung, möglicherweise feindlich.“ „Von wo?“ „Keine Ahnung.“ „Ok, schreib alles auf und gib es an unsere Codeknacker weiter. Und die Zeitdaten laß ich an unsere Alliierten weitergeben. Vielleicht ist der Spruch ja doch von denen. Und wenn nicht, können wir den Funkspruch per Triangulation einpeilen.“ „Jo, alles klar.“ Beide haben ja keine Ahnung. Mittwoch, der 8. Oktober „Männer! Jetzt alle mal herhören!“ beginnt Obersturmbannführer Trappert die Einsatzbesprechung im Gepo-Hauptquartier im Hansa-Hochhaus von Köln. Er schaut auf die Uhr. Genau 6 Uhr 33. In wenigen Minuten würden die Zielpersonen eintreffen. „Also Leute, wir haben in den letzten Tagen eindeutige Hinweise auf Örtlichkeiten, an denen sich Agenten von ‚Schimäre‘ aufhalten, erhalten. Wir konnten als wichtigstes Ziel einen Friseursalon und ein Café ausmachen. Um den Friseursalon kümmern sich die Soldaten von der Kaserne Butzweilerhof. Wir kümmern uns um das Café. Haben alle ihre Waffen?“ Alle halten ihre MPis und Pistolen in die Höhe. Einer fragt: „Obersturmbannführer, von welchem Café reden wir?“ Trappert grinst breit. „Vom Café Rothschild. Direkt vor unserer Haustür. Und wir haben nix gemerkt.“ Direkt wird er wieder ernster. „Erinnert euch alle an unsere Erfahrungen mit ‚Schimäre‘ in den letzten Monaten. Wir müssen mit Widerstand rechnen. Also, wer sich wehrt, wird liquidiert. Alle andern kommen erstmal in die Zellen im Keller, um anschließend verhört zu werden. Alles klar?“ „Ja!!“ brüllen alle. „Also Abmarsch!“ Chris Loewisch schließt die Tür vom Rothschild auf. „Also, wieviel braucht ihr für den Salon?“ fragt sie Katrin Schmiegeld und deren Mann Joschi. Die beiden decken sich im Rothschild jeden Mittwochmorgen mit Getränkenachschub für den Friseursalon von Katrin ein. Denn sie müssen hier keine Rationsmarken vorlegen. Schwarzmarkt innerhalb des Widerstands eben. Die drei betreten den Laden, während Katrin noch nachdenkt. „Na, sagen wir mal vorsichtshalber zwei Kästen Cola.“ „Ok, ihr wißt wo’s steht. Holt die Kästen rauf, ich muß hier noch alles für die ersten Gäste klar machen.“ „Is gut.“ Joschi und Katrin gehen die Treppe nach unten, die auch zu den Toiletten führt. Chris stellt die ersten Gläser schon mal hinter der Theke parat, kontrolliert, was noch im Kühlschrank ist, schneidet die ersten Brötchen auf, wischt die Theke selber ab usw. Durchs Fenster sieht sie schon zwei andere Mitglieder des Widerstandes eintrudeln, Dominik Kipshoven (der Bruder von Kapitän zur See Philipp Kipshoven) und Jennifer Ehlen. Als die beiden reinkommen, begrüßt Chris sie. „Na ihr beiden! Jenn, darfste wieder frei rumlaufen?“ „Ja, hab neue Papiere und meine einmonatige Exilzeit in der Eifel ist jetzt zum Glück vorbei.“ meint sie grinsend. Denn sie mußte den ganzen September über in einem Versteck in der Eifel verbringen, da die Gepos nach ihr fahndeten – sie hatte an einigen Aktionen teilgenommen, bei denen es um die Befreiung politischer Gefangener aus dem KZ Sechtem ging. Aber jetzt ist schon wieder genügend Zeit vergangen, daß die Gepos wieder andere Probleme haben. Dominik setzt sich an die Theke. „Darf ich schon ne Cola haben, oder habt ihr noch nicht auf?“ „Doch, Du darfst...“ meint Chris und stellt ihm ein Glas Cola hin. „Ich muß euch leider wieder verlassen, Leute...“ meint Jenny, fügt aber direkt hinzu: „Ich wollte nur mal vorbeischaun. Heute Mittag komm ich auf ein Essen vorbei.“ „Is gut Jenn.“ Chris winkt ihr kurz zu, als Jenn zur Tür geht. Aus dem Augenwinkel sieht Chris eine Bewegung draußen, schaut direkt hin – und sieht einen Trupp Gepos mit den MPis im Anschlag aufs Rothschild zulaufen. Und jetzt sieht sie auch Jenny. „Macht das hier wegkommt!“ Katrin und Joschi bleiben abrupt in der Tür zur Treppe nach unten stehen und lassen die Kästen fallen. „Scheiße...“ murmelt Joschi nur. Und jetzt geht alles blitzschnell. Ein Gepo will die Eingangstür aufziehen, aber Jenny zieht sie sofort wieder zu. „Haut ab!!“ Schüsse peitschen, die Fenster der Glasfronten rechts und links von der Tür fallen in Tausend Scherben zusammen, Gepos springen noch im Scherbenregen hindurch, einer rammt Jenny den MPi-Kolben zwischen die Schulterblätter, packt sie und wirft sie auf einen der Tische. Packt sie mit der Hand an der Kehle und hält ihr den MPi-Lauf an den Kopf. Jemand brüllt: „Nach der fahnden wir schon länger! Festnehmen!“ Inzwischen waren die andern weitergestürmt. Kurzentschlossen wirft Joschi dem vordersten Gepo einen Cola-Kasten entgegen, der den Mann tatsächlich von den Beinen reißt. Dann brüllt er Katrin an: „Nach unten!“ Chris hat kurzerhand einem Gepo, der rechts um die Theke herumwollte, eine Flasche Whisky über den Schädel gezogen. Jetzt wirft sie ihm ein Feuerzeug entgegen. Augenblicklich steht der Mann in Flammen und rennt schreiend nach draußen. Dominik reißt Chris zurück und schon haut da wo sie eben noch stand, eine Geschoßsalve in die Theke und die Rückwand. Er reißt sie zurück und drückt sie nach unten, duckt sich selber nur halb und reißt jetzt seine Browning GP 35 aus dem Halfter und feuert drei Schuß auf gut Glück. Dann ist er auch ganz hinter der Theke verschwunden. Ein schneller Blick zur Tür nach unten, die direkt neben dem andern Ende der Theke ist. Ein Schatten taucht auf, feuert eine Salve, die aber nur in einen der Schränke schlägt, Dominik feuert sofort mehrere Schuß zurück, getroffen fliegt der Mann nach hinten und auf die Wandbank, von der er dann runter und unter den Tisch fällt. Unten im Keller räumt Joschi ein paar Kästen zur Seite, hinter denen eine Tür verborgen ist. „Was immer ihr da macht, beeilt euch!!“ hört man Chris von oben rufen. Und sie beeilen sich. Anstatt darauf zu warten, daß sich der Schlüssel für das Vorhängeschloß finden läßt, tritt Joschi ein paar kräftig dagegen. Das Schloß ist ganz offensichtlich – und glücklicherweise – schon einigermaßen alt und nur noch von Schrottwert. Denn Joschi kann es tatsächlich abtreten, Splitter fliegen und die Tür springt auf. Dahinter: Waffen. Berettas, Brownings und einige P38. Dazu drei Karabiner älterer Bauart und drei neuere Steyr-Solothurn S1-100 Maschinenpistolen. Dazu Munition, Magazine. Und zwei Handgranaten. Joschi grinst. Katrin auch. Und dann schnappen sie sich die MPis, die Magazine, die Handgranaten und jeder zwei Pistolen. Oben feuert Dominik immer wieder über den Rand der Theke, um die herum Trappert seine Männer im Halbkreis aufgebaut hat. Dominik legt ein neues Magazin ein. „Ich hoffe, Du hast ein paar knüller Ideen, sonst sind wir gearscht!“ zischt ihm Chris zu. „Ja, ja, laß mich nachdenken, nachdenken!“ Da schlagen MPi-Salven über ihnen in die Regale ein und zerschlagen alle Flaschen und Gläser. Scherben und verschiedenste Spirituosen regnen auf die beiden herab. „Scheiße!“ kreischt Chris. Und im selben Moment begreift Dominik, was die Gepos vorhaben. Und in der Tat! Trappert steht mitten im Raum und hält schon das Sturmfeuerzeug hoch. Da fliegt etwas durch die Tür neben der Bar und landet klackernd auf dem Boden. Einer der Gepos verfolgt mit schnellem Blick das Ding. „Handgranate!“ brüllt er nur. „Raus hier!“ brüllt Trappert. Das freilich muß er den anderen nicht zweimal sagen. In wahren Hechtsprüngen flüchten sie aus dem Lokal, einige springen einfach durch die noch nicht zersplitterten Fenster und landen in einer Wolke aus Glassplittern auf dem Gehweg. Aus dem Durchgang neben der Bar kommen nun Joschi und Katrin gestürmt. Und Dominik und Chris springen hinter der Bar auf; Katrin wirft Chris eine der MPis zu, die diese auffängt. Im Laufen hebt Joschi die Handgranate wieder auf – und zieht erst jetzt den Stift heraus. Läßt die Handgranate wieder fallen. Alles geht so schnell, daß nur ein, zwei Gepos merken was los ist, sich abrupt umdrehen und feuern wollen. Eine schnell gefeuerte Salve von Chris wirft sie nach hinten. Dominik und Katrin schießen derweil die Türen eines nahebei stehenden Autos auf, springen rein, Dominik schließt die Karre kurz. Joschi und Chris werfen sich hinten auf die Rückbank, dann gibt Dominik auch schon Gas. Trappert feuert eine Salve in ihre Richtung. Und dann detoniert die Handgranate, wirbelt zerschmetterte Stühle und Tische durch die Gegend, Rauch versperrt den Gepos schließlich die Sicht.... Es ist kalt und es regnet jetzt schon den ganzen Tag. Der Wettergott hat es mit Trier wahrlich nicht gut gemeint. Aber was soll’s. Trier ist ein gutes Versteck, wenn man zuvor in Bingen war und die Gepos denken, man würde weiter nach Süden fahren. Am Morgen ist Petra angekommen und hat sich erstmal in einem kleinen Hotel nahe dem Stadtzentrum eingemietet. Hier will sie erstmal zur Ruhe kommen und sich ihre nächsten Schritte überlegen. Gestern in Bingen hat sie die Gepos nur knapp abhängen können. Sie kommt aus der Dusche, eingewickelt in ein Handtuch und läßt die noch feuchten Haare einfach nach hinten fallen. Ein Blick auf den Wecker am Nachttisch verrät ihr, daß es jetzt 11 Uhr sind. Gleich könnte sie eigentlich schonmal inspizieren, wo man hier gut essen gehen kann. Aber vorher könnte sie nochmal bei Denise in Florenz anrufen. Sie stellt das kleine Radio auf der Kommode gegenüber des Bettes an, um eventuelle Lauscher nicht allzu ungestört mithören zu lassen. Der Sender – wie üblich nur ein einziger, nämlich ein regierungstreuer – spielt Schlager (wie widerlich!). Dann setzt sich Petra auf das Bett und nimmt den Hörer vom neben dem Wecker stehenden Telephon. Sie wählt die Nummer und muß nur kurz warten, dann hört sie das Klingeln. Nach ein paar Augenblicken geht Denise ans Telephon. „Ja?“ „Hier Petra. Wie geht’s Dir?“ „Gut. Und Dir?“ „Bin gestern knapp den Gepos entkommen. Aber ansonsten gut.“ „Freut mich zu hören...“ Im Hintergrund sind laute Rufe und Schreie zu hören. „Warte mal, ich muß hier das Fenster zu machen...“ Nach einem Moment meldet sich Denise wieder. „Biste noch dran?“ „Ja. Denise, was ist denn da los?“ „Ach, nichts, die Inquisitoren sind am durchgreifen. Sie treiben gerade ein paar vermeintliche Hexen durch die Straßen...Tja, Du willst sicher wissen, ob ich was rausgekriegt habe?“ „Genau.“ „Naja, viel ist es nicht. So wie es aussieht, hält sich der Mann momentan an der Ostfront auf, nahe Jarcevo. Er soll bis morgen auf einer Strategiekonferenz der Alliierten in Moskau.“ „Irgendwelche Hinweise, ob er sich in nächster Zeit wieder im Lande aufhält?“ „Nein. Nicht bevor die Alliierten das Rheinland nicht befreit haben. Du weißt, beim letzten Mal, als er hier war, gab’s Ärger in Köln.“ „Das ist bis zu euch gedrungen?“ „Ja, sicher. Passiert schließlich nicht alle Tage, daß ein kaiserlicher Jäger mitten in einer Großstadt gegen eine Brücke fliegt.“ „Stimmt.“ Ja, da muß Petra Denise zustimmen. Als „Schimäre“ das Lager Sechtem befreite, kam es auch zu einem Zwischenfall, bei dem eine Freiheitskämpferin ein Jagdflugzeug kaperte und ihm anschließenden Luftkampf über Köln flog ein Kaiserlicher genau gegen eine Eisenbahnüberführung am Hansaring... „Ich muß also einen Weg auf die andere Seite der Ostfront finden...“ stellt Petra nüchtern fest. „Genau.“ bestätigt Denise Cassim. „Wie Du das allerdings machen willst, ist mir ein Rätsel. Du kannst kaum noch über neutrales Territorium ausreisen.“ Im Hintergrund hören die Schlager auf und der Nachrichtensprecher verliest die neuesten – natürlich zensierten – Meldungen von den Fronten. Plötzlich unterbricht Petra Denise in ihren Zweifeln. „Warte mal.“ Den Hörer auf dem Bett liegen lassend, mit einer Hand das Handtuch festhaltend, dreht sie mit der anderen Hand das Radio lauter: „...eben bestätigt wurde, kam es zu einem erneuten Zwischenfall zwischen Terroristen und der Geheimpolizei. Wie das Gepo-Hauptquartier in Köln meldete, habe man den Terroristen einen ersten schwereren Schlag versetzt, indem man zwei Verstecke ausgehoben und eine Festnahme getätigt habe. Weitere Terroristen seien auf der Flucht, weshalb die erst vor wenigen Tagen gelockerte Ausgangssperre in Köln wieder verschärft wurde. Sie gilt jetzt von 20 bis 9 Uhr. Im restlichen Reichsgebiet gilt sie weiterhin von 21 bis 6 Uhr. Es hieß, man erwarte aber eine schnelle Normalisierung der Lage, da die Terroristen nach den heutigen Aktionen wahrscheinlich Schwierigkeiten hätten, ihre technische Infrastru...“ Sie dreht das Radio wieder leiser und geht wieder an den Hörer. „Denise, hat der Mann irgendwelche Schwächen?“ „Die altbekannten: Hochprozentiges, krachige Musik und schöne Frauen. Sag bloß, Du hast ne Idee?“ „Ja, ich hab so etwas wie einen ersten Plan...“ Konferenzen wie diese haßte er. Nur aufgeblasene wichtigtuerische Offiziere, wenn man mal von einigen gnädigen Ausnahmen aus dem exildeutschen oder polnischen Offizierskorps absieht. Es ist schon bald Zeit für die Mittagspause und noch immer palavert man über die Gründe für das Scheitern der ersten russischen Offensive in Fernost. Den Russen geht es einfach nicht ein, warum sie einen herben Rückschlag gegen die ganz offensichtlich weniger gut ausgebildeten und ausgerüsteten chinesischen Truppen erlitten. Sie wollen einfach nicht einsehen, was für jeden anderen hier offensichtlich ist: Nämlich die Tatsache, daß die Chinesen zahlenmäßig überlegen sind und daß die russischen Kommandeure in Fernost einfach nicht entschlossen genug agiert hatten. Stefan hat bereits zu Beginn der Sitzung bei der Durchsicht der Memoranden erkannt, daß sich zum Beispiel General-major Stalkij über eine Woche lang die Zeit damit vertrieb, mit seiner 23. russischen Armee hin und her zu lavieren und als er endlich angriff, tat er es nur halbherzig (ohne wirkliche Artillerievorbereitung usw.) und die chinesische 17. Armee hatte ihre Stellungen ausgebaut. Die Folge: Die Niederlage am Selemdzha, die vor vier Tagen mit einem kompletten Rückzug der Russen auf ihre Ausgangsposition endete. Hinterlassen haben die Russen 56000 eigene und 100000 chinesische Tote – nur können die Chinesen das besser ausgleichen. Na also, das kapiert jeder! denkt sich Stefan. Nur die Russen nicht. Weil die einfach keine Fehler eingestehen wollen. Und seit die Russen mit den Polen darüber debattieren, hält sich Stefan mit seinem Kommentar zurück. Bevor er hier noch zur Persona non grata wird. Bis Feldmarschall Suworow, der an diesem Vormittag stellvertretend für die Zarin die Leitung der Gespräche übernommen hat, mit einer Bemerkung Stefan aufhorchen läßt. Suworow meint nämlich zu seinem Kollegen, Marszalek Rydz-Smigly, dem Oberbefehlshaber der polnischen Truppen: „Marszalek, wenn Sie so davon überzeugt sind, daß unsere Truppen in Fernost unfähig sind, dann schicken Sie uns doch das Freikorps, von dem Sie angeblich soviel halten!“ „Suworow, ich habe nicht gesagt, daß ich viel von den Leuten halte! Ich sage nur, daß sie der Allianz bereits gute Dienste geleistet ha-...“ Mit einer zackigen Handbewegung kontert Suworow: „Immerhin konnte dieser Pseudogeneral Ihnen einen Rückzug abschwatzen, der uns beinahe die Front zerrissen hätte!“ „Marschal!“ ruft ihm Stefan selbstbewußt über den ganzen Tisch hinweg zu, so daß neben ihm Generaloberst Moltke von den exildeutschen Truppen scharf die Luft einzieht. „Marschal, ich hoffe doch, Sie reden von mir!“ Verwundert schaut Suworow herüber und Stefan schenkt ihm sein schiefestes Haifischgrinsen. „Und wenn es so wäre, General Reiss?“ „Na sehen Sie, klingt doch schon viel besser.“ Und nach einer Pause fügt Stefan hinzu: „Was haben Sie eigentlich gegen meine Leute?“ Neben ihm kann Moltke sein Grinsen nur mühsam unterdrücken. Auch Moltke gefällt Suworow nicht immer und soviel Direktheit sind die Russen selten gewöhnt. „Das wollen Sie nicht wissen.“ versucht sich Suworow rauszureden. „Aber, aber Marschal, ich bestehe darauf!“ „Na gut, wenn Sie es wissen wollen: Wir Russen halten nicht allzuviel von Söldnern! Woher sollen wir wissen, daß die Gegenseite Ihnen nicht auf einmal mehr bietet!“ Jetzt grinst Suworow. Er weiß, daß er getroffen hat. Aber Stefan kann zurückhacken: „Marschal, anderen Leuten hätte ich dafür die Haut abgezogen, wenn Sie verstehen was ich meine. Wir sind offiziell Söldner, aber wir sind nicht einfach käuflich.“ Suworow bricht in schallendes Lachen aus. „Was lachen Sie, Marschal, ich war noch nicht fertig!“ Auf einmal Unruhe an der von zwei Soldaten bewachten Tür. Oberfähnrich Silke Rüttel drängt sich in den Raum, kommt um den Tisch zu Stefan herum, was verwunderte Blicke auf sich zieht. „Chef, lesen Sie das!“ Sie schiebt Reiss eine Depesche zu. Er überfliegt die Zeilen nur: „Gepo-Anschlag auf Rothschild. Ehlen in Gefangenschaft. Zweiter Angriff auf Funksender 8, ausgefallen. Ausgangssperre Köln verschärft. Lage derzeit völlig unklar. Eventuell droht herber Rückschlag. Gez. Brigadier Schönmann.“ Stefan wirft Suworow einen verärgerten Blick zu und erklärt: „Meine Herren, entschuldigen Sie mich bitte kurz. Es ist eine Krisensituation eingetreten.“ Ohne weiteren Erklärungen steht er auf und verläßt zackigen Schrittes den Konferenzraum im Moskauer Kreml. Die anderen Offiziere sehen sich gegenseitig an. Neben Suworow sitzt Fürst Potemkin, Geliebter der Zarin und erfolgreicher Kommandeur aus den Türkenkriegen. Alles hat er aufmerksamst beobachtet. Jetzt meint er leise zu Suworow: „Die Idee, diesen Knaben nach Fernost zu schicken, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wie anders könnte man ihn von den wirklich wichtigen Dingen fernhalten...“ Suworow dreht den Kopf erst zu Potemkin, lächelt sichtlich erfreut, wendet ihn dann wieder Rydz-Smigly zu, der aber zuckt nur die Achseln. Draußen vor der schweren hölzernen Doppeltür zum Konferenzraum gehen Stefan und Silke schnell um die nächste Korridorecke, außer Hörweite der Türwachen. „Oberfähnrich, haben Sie auch selber mit dem HQ telephoniert?“ „Ja, Generalleutnantin Sus hat alle Truppen in Alarmbereitschaft versetzt und sofort Anfragen an alle Spezialbataillone auf Einsatzbereitschaft geschickt. Antworten haben wir bislang nur von Jacke und Morgenstern. Sie sind einsatzbereit. Bei den anderen wissen wir es noch nicht.“ „Was ist mit direktem Kontakt nach Köln?“ „Fast gänzlich abgebrochen. Unser Sender im Süden der Stadt ist vorsichtshalber von Agentin 1 nach Bonn verlegt worden. Der nächste Sender, über den wir Berichte kriegen ist der in Frechen. Aber die Gepos haben alles dicht gemacht. Schönmann hatte wohl befohlen, heute neue Anstrengungen bezüglich einiger Aktivitäten der Gepos im Zuge einer Diskothekenrazzia zu unternehmen, aber dieser Befehl kann nicht mehr ausgeführt werden...“ „Scheiße!“ flucht Stefan, geht nervös auf und ab. Schaut den Korridor lang. Und für ein paar Sekunden sieht er nur wenige Meter entfernt Christiane stehen. In ihrem Kampfanzug von damals, dessen Auswölbungen an ihre reizvollen Brüste denken ließen. Sie blickt ihn tiefgehend, bis in die Seele an, hebt eine Hand, als wollte sie ihn anhalten und sagt dann nur: „Vorsicht! Gefahr!“ Dann wie ein Blitz und die Gestalt ist weg. „General? General!“ Schaudernd schüttelt sich Stefan. „Ja, Oberfähnrich?“ „Was ist los? Sie starren so komisch!“ „Ach, nix. Es ist nix.“ Er dreht sich einmal um die eigene Achse. Ein mulmiges Gefühl breitet sich im Magen aus. Das letzte Mal, daß er solche Erscheinungen hatte, war es Jolanda Giusti gewesen, die Kommandeurin eines Spezialbataillons, die im Juni gefallen war. Und da hatte die Erscheinung ihn eigentlich immer zuverlässig gewarnt, auch wenn er manchmal dachte, er sei nahe dem Abrutschen in den klinischen Irrsinn. „Oberfähnrich, passen Sie auf. Fahren Sie ins Hotel und packen Sie unsere Sachen zusammen. Wir reisen noch heute wieder ab.“ „Und was ist mit der Konferenz?“ „Ach, scheiß auf die Konferenz. Suworow sucht eh nur einen Vorwand uns loszuwerden. Die Schose darin kann ich mir genausogut sparen.“ „Is klar, Chef.“ Silke salutiert, wendet sich um und geht zum Ausgang. Stefan kehrt raschen Schrittes in den Konferenzraum zurück, wo Rydz-Smigly gerade mit Moltke darüber debattiert, ob die exildeutschen Truppen weiterhin ein eigenes Oberkommando haben oder dem polnischen Oberkommando unterstellt werden sollen. Abrupt verstummen die beiden, als Stefan kurz vor seinem Platz, nur wenige Meter von der Tür, stehen bleibt. „Was gibt es, General Reiss?“ fragt Suworow. „Haben Sie uns etwas mitzuteilen?“ „Ja. Ich muß Ihnen allen leider mitteilen, daß ich sofort abreisen muß. Eine neue Entwicklung erfordert meine persönliche Anwesenheit im ‚Schimäre‘-Hauptquartier.“ „Würden Sie uns vielleicht mitteilen, welcher Natur diese Entwicklung ist?“ „Geheimer Natur. Ich werde Ihnen über unseren Verbindungsoffizier einen Bericht zukommen lassen.“ Stefan salutiert. „Guten Tag.“ Er wendet sich zackig um und verläßt den Raum. Obersturmbannführer sitzt in seinem Büro im Hansa-Hochhaus und wickelt sich selber einen Verband um seine linke Hand. Beim Gefecht im Rothschild hat ihn doch tatsächlich ein kleiner umhersurrender Splitter an der Hand gestreift. Und es brennt höllisch! Vorsichtshalber hat er jetzt, kurz vor Feierabend nochmal alles desinfiziert und wickelt nun den neuen Verband drumherum. Es klopft an die Tür und dann steckt seine Sekretärin den Kopf herein. „Herr Obersturmbannführer, hier sind zwei Herren, die Sie gerne sprechen würden. Standartenführer Oschmann und Sturmbannführer Leikert.“ Trappert schaut auf. „Nanu, was wollen die denn hier?“ Die Sekretärin zuckt die Schultern. Kurz verzieht Trappert das Gesicht zu einer Grimasse – in etwa: ‚Was wollen die schon wieder, diese Quälgeister!‘ – und sagt dann resignierend: „Ok, lassen Sie die beiden rein. Vielleicht ist es ja wichtig.“ „In Ordnung.“ Die Sekretärin schließt wieder die Tür, die nur Momente später wieder aufgeht. Oschmann kommt rein, gefolgt von Leikert. „Hallo, die Herren. Standartenführer, wie geht’s Ihrem Auge?“ Unwillkürlich hebt Oschmann kurz die Hand in Richtung auf seine Augenklappe, läßt sie dann doch wieder sinken. „Schon ganz gut. Danke der Nachfrage.“ „Sagen Sie, wollten sie beide sich nicht in den Niederlanden treffen?“ „Ja, wollten wir, Obersturmbannführer.“ antwortet Leikert. „Aber das war vor der Schießerei im Rothschild.“ Oschmann baut sich vor Trapperts Schreibtisch auf. „Mußten Sie daraus unbedingt eine solche Ballerei machen? Ging das nicht diskreter?“ „Was wollen Sie? Helldrich hat sich gemeldet und gesagt, einer Ihrer Agenten hätte sichere Informationen, daß das Rothschild und ein Friseursalon Horchposten des Gegners sind, wir sollten diese Information nutzen. Das habe ich getan. Und? Beides stimmte. Wir haben Dokumente erbeutet, die wir gerade auswerten, um weitere Schläge gegen das ‚Schimäre’-Netzwerk führen zu können.“ „Was wäre gewesen, wenn wir falsch gelegen hätten?“ wendet Oschmann ein. „Seit wann so zimperlich, Standartenführer? Wir lagen nicht falsch.“ Trappert zuckt die Achseln und fährt fort: „Wenn Sie mich fragen, haben Sie immer zu viele Schlenker gemacht. Ich bin mehr für direkte, radikale Angriffe.“ Oschmann sieht Leikert an und erwidert dann: „Trappert, Sie hätten es diskreter erledigen sollen! Gerade vor der eigenen Haustüre!“ „Was wollen Sie eigentlich?“ Jetzt wird Trappert doch allmählich sauer. „Mensch, Obersturmbannführer! Sie haben unseren gesamten Zeitplan durcheinander gebracht.“ „Ihren Zeitplan?“ „Nichts, was Sie näher wissen müßen.“ stellt Oschmann bestimmt fest. „Tja“, schnappt Trappert zurück, „dann kann ich leider nicht verhindern, daß ich den Zeitplan vielleicht weiter störe...“ Oschmann sieht ihn wütend an, aber es wird ihm bewußt, daß Trappert diese Provokation jetzt bewußt losgelassen hat. Statt seinem Impuls nachzugeben, Trappert einfach anzubrüllen, dreht er sich zu Leikert um: „Sturmbannführer, treiben Sie ein Flugzeug auf, daß mich an die Ostfront bringt. Wir müssen das Tempo der Operationen unbedingt beschleunigen.“ „Zu Befehl, Standartenführer.“ Leikert verläßt eilig den Raum. „Und was haben Sie jetzt vor, Standartenführer?“ „Ich werde mich an die Ostfront begeben. Dort wartet eine entscheidende Aufgabe auf mich. Hoffentlich ist diese nach Ihrer Aktion hier noch durchführbar. Ich lasse Leikert als Berater mit umfassenden Vollmachten bei Ihnen und werde bald auch einige Spezialisten schicken.“ „Die selben Spezialisten, von denen Sie mehrere im August verloren haben?“ Eine grimmige Miene setzt Oschmann auf, denn er weiß worauf Trappert anspielt: Auf den Verlust mehrerer Geheimpolizisten mit Spezialausbildung bei einem Gefecht in Weiden, bei dem man immerhin Generalmajorin Alleker liquidieren konnte. „Ja, so in der Art...“ murmelt Oschmann und fügt dann wieder etwas lauter hinzu: „Trappert, Sie scheinen noch nicht den Ernst der Lage zu erkennen.“ „Wie meinen Sie das?“ „Ganz einfach, Obersturmbannführer. Der Kaiser wird allmählich ungeduldig. Und einige Verbündete auch. Ganz offensichtlich sind gewisse Kreise der Meinung, daß es zu gefährlich geworden ist, Reiss noch am Leben oder in Freiheit zu lassen. Und wenn wir diese Kreise enttäuschen, kann das übel enden. Glauben Sie mir, Trappert, wenn wir in dieser Sache stolpern und fallen – dann fallen wir sehr tief...“ „Eine der erstaunlichsten Tatsachen des Großen Krieges ist die, daß „Schimäre“auch nach Einführung der Sollstärke von 50000 und nach Einführung der Sollstärke von 100000 Mann eine Eliteeinheit geblieben ist. Die Feinde begriffen nie, wie das möglich war...Es war nur möglich, weil jede Teileinheit von „Schimäre“einzigartig war und sich als Elite begriff. Und jede Teileinheit tat alles, um sich dieses Selbstverständnis zu verdienen und es zu festigen. Im Endeffekt bildeten dann viele Eliteeinheiten eine Eliteeinheit. Die Spezialbataillone, Kipshovens Marinesoldaten, Bohnsacks Kampfpiloten, die ehemaligen Maintal-Milizionäre aus den ersten drei Regimentern, die polnischen Kämpfer in ihren Regimentern, die tollkühnen Panzersoldaten Orths... Sie alle waren „Schimäre“und sie alle begriffen sich nach einer ersten Feuertaufe als Elite.“ Journalistin Uta Reindl (TimesSonderkorrespondentin im „Schimäre“-HQ während des Krieges) drei Jahre nach dem Großen Krieg in einem Vortrag Das Büro des früheren Herbergenleiters, ein mittelgroßer Raum im Erdgeschoß, am Ende eines kurzen Flurs direkt neben der Treppe, die nach oben führt, ist seit dem Einzug der „Schimäre“Offiziere einer der wichtigsten Räume des Hauptquartiers: Nun ist es das Gemeinschaftsbüro von General Stefan Reiss und Generalleutnantin Karolina Sus. Jetzt schnappt sich Karo noch schnell die Aktenmappe, die die aktuellsten Meldungen enthält, und geht zur Tür. Dort bleibt sie nochmal kurz stehen. Sie knöpft ihre Uniform noch zu. In der Eile hatte sie das fast vergessen. Sie hatte nach der Hektik des Vormittags noch ein paar Stunden geschlafen und eben nur eilig frisch gemacht, ihre mäßig langen dunkelblonden Haare (die ohnehin oft leicht verwuschelt sind) kurz durchgekämmt und dann die Uniform wieder angezogen. Es ist gleich 18 Uhr 30 und sie hat dieses Mal eine Stabssitzung noch vor dem Abendessen angesetzt, um weitere Entscheidungen im Bezug auf die Krisenlage in Köln zu treffen. Es gilt, den Schaden einzudämmen. Wer weiß schon, was noch alles aus der Angelegenheit erwächst. Womöglich eine Treibjagd der Kaiserlichen auf alle „Schimäre“Agenten im Heiligen Römischen Reich. Und das wäre für den weiteren Kriegsverlauf sicherlich sehr abträglich. Sie öffnet mit einem Seufzen die Tür und geht dann in die Eingangshalle. Dort wartet bereits Philipp Kipshoven, der seine Sonderausführung der Uniform trägt: Schwarzes Hemd und schwarze Hose, Nieten an den Armen, die gewellten dunklen Haare lang über die Schulter fallend. Draußen trägt er oft auch noch einen langen, schwarzen Ledermantel, dessen Epauletten ihn als Kapitän zur See ausweisen. Ein Grufti, wie er im Buche steht. An die Theke der Rezeption gelehnt, raucht er sich eine Zigarette. „Philipp, kommst Du?“ Er nickt. „Sicher.“ Eigentlich hat Philipp einen kleinen Gefechtsstand am Ostufer des Ladogasees, von wo aus er die Einsätze des Torpedobootes und der Marineinfanteristen, die dort stationiert sind, leitet. Aber vor einigen Tagen hat er den Befehl an seinen Stellvertreter delegiert, um für zwei Wochen hierherzukommen. Unter anderem, um Stefans Geburtstag morgen mitzufeiern, aber auch, um bei Gelegenheit nach Moskau zu reisen und mit der dorthin geflüchteten russischen Regierung über die Überlassung einiger Kriegsschiffe an „Schimäre“ zu verhandeln. Mit einer Handbewegung drückt er die Zigarette in einem Aschenbecher auf der Theke aus. Schweigend folgt er Karo in den Speisesaal, den sie regelmäßig zum Konferenzraum umfunktionieren. Von der Seite wirft ihm Karo einen Blick zu. Philipp wirkt sichtlich bedrückt. Er weiß nicht, ob sein Bruder noch lebt, fällt es ihr ein. Im Speisesaal warten bereits die anderen, die am Treffen teilnehmen: Oberst Marco Konrad, Ib (Nachschuboffizier) von „Schimäre“, ein kräftiger Mann mit dunklen, längeren Haaren und einem berüchtigten Hang zu Verschwörungstheorien, sitzt der Tür am nächsten, ihm gegenüber Brigadierin Conny Schönmann, mit ihren dunklen, manchmal etwas zotteligen Haaren und ihrem langgestreckten Körperbau. Zuletzt hatte Karo sie heute vormittag gesehen – da hat Conny ganz schön auf Slowakisch geflucht, als sie die Meldung aus Köln erhielt. Seit sie das Amt des Ic und damit die Verantwortung für die Agenten in ganz Europa übernommen hat, schmerzt sie jeder Verlust persönlich. Neben Conny sitzt Generalmajor Bohnsack, der kühne Fliegeroffizier mit den charakteristischen Geheimratsecken und den blitzend blauen Augen. Und schließlich die wichtigsten Feldkommandeure der Bodentruppen: General Valkendorn, der energische Oberbefehlshaber der 1. „Schimäre“-Division, die aus dem 1. und 2. Infanterieregiment besteht, Generalleutnant Landgraf von Hessen-Darmstadt, der sich einst, während des Maintal-Aufstandes, auf die Seite der Rebellen schlug und dadurch sein Fürstentum verlor, der jetzt aber die 2. „Schimäre“-Division, bestehend aus 3. und 4. Infanterieregiment (letzteres bildete einst das Regiment „Krakow“ der Polnischen Legion), befehligt. Den beiden gegenüber sitzt Generalmajorin Stefanie Schoeps, die kräftig gebaute, für ihre manchmal etwas rabiate Art berüchtigte Kommandeurin der im Aufbau befindlichen Kavalleriedivision, die freilich bislang nur ein Regiment hat; Schoeps hält ihr schönes langes Haar hinten mit einem Haargummi zu einem Pferdeschwanz zusammen. Und neben ihr sitzt Hauptmann Markus Orth, der berüchtigte Führer des Panzerregiments von „Schimäre“, dessen manchmal etwas desinteressiert wirkende Blick täuscht: Wenn es drauf ankommt, schaltet er schnell. Ganz hinten am Tisch sitzt die Protokollführerin Stabsgefreite Denise Neunzig, eine schlanke Frau mit langen braunen Haaren. Philipp setzt sich neben Markus. „Hi, alles klar?“ fragt der. „Na, geht so.“ Karo setzt sich an den Kopf des Tisches, zwischen Marco Konrad und Conny. Noch einen leisen Seufzer gönnt sich Karo, dann eröffnet sie die Sitzung. „Also Leute, wir haben Probleme.“ „Wie üblich.“ murmelt Marco leise, was ihm einen kurzen bösen Blick Karos einfängt; die weiß freilich, daß Marco recht. Sie fährt fort: „In ein paar Stunden ist Stefan wieder da und bis dahin hatte ich vielleicht doch ganz gerne ein paar Ideen, wie wir verhindern, daß der Kölner Agentenring endgültig vor die Hunde geht. Conny, wurde inzwischen wieder ein stabiler Kontakt hergestellt.“ Beinahe gequält schaut Conny Karo an. „Leider nicht. Wir haben Kontakt mit den Funkstellen in Frechen, Bonn, Euskirchen, Neuss, aber nicht mehr mit Köln. Und die Geheimpolizei hat nach Berichten aus Frechen alle Straßen abgeriegelt. Aus Sicherheitsgründen können wir niemanden mehr aus Köln raus oder dorthinein schmuggeln. Die Lage ist daher immer noch unklar.“ Sie zuckt resigniert die Schultern. „Und leider können wir momentan auch keinen Kommandotrupp schicken. Ich wüßte auch nicht, wie wir dessen Auftrag gestalten sollten.“ „Wieso das denn?“ schaltet sich Philipp verwundert ein. „Was ist denn mit Krammers oder Koudeles Kämpfern?“ Philipp spielt auf die Spezialbataillone 4 und 5 an, die im Nordseeraum in Zusammenarbeit mit einigen „Schimäre“-Kriegsschiffen zusammenarbeiten, die nominell Philipp unterstellt sind. Aber Conny schüttelt nur den Kopf: „Koudele bereitet zur Zeit mehrere Kommandounternehmen an der norwegischen Küste vor, die wir den Briten zugesagt haben. Und Krammers Leute werden erst nächste Nacht aus dem niederländischen Brückenkopf als eine der letzten alliierten Einheiten evakuiert. Sie brauchen nach drei Wochen ununterbrochener Kämpfe Ruhe.“ „Da hat sie leider recht, Philipp.“ muß Karo zustimmen. „Glaub mir, ich hab auch an diese Möglichkeit gedacht.“ Nach einer kurzen Pause, in der sie sich einen der beiden Ascher aus der Mitte des Tisches herüberzieht und eine Zigarette anzündet, fügt Karo hinzu: „Allerdings kann ich mir schon vorstellen, was ein Kommandotrupp für Aktionen durchziehen könnte. Betonung auf könnte.“ „Vielleicht sollten wir so verfahren, wir bereits in regulären Schlachten verfahren sind...“ meint General Valkendorn von hinten. „Wie meinen?“ Karo ist sich nicht sicher, was Valkendorn meint. Und der setzt auch sofort zur Erklärung an, nachdem er einen Schluck Wasser aus seinem Glas genommen hat: „Beispielsweise wie in Kalisch.“ beginnt er und spielt dabei auf eine der großen Abwehrschlachten in Polen während der Monate August und September an, in der „Schimäre“ die Hauptlast der Kämpfe trug. Er fährt fort: „Damals waren Truppen von uns abgeschnitten und mußten längere Zeit auf Entsatz warten.“ „Oh, bitte, erinnern Sie mich nicht daran...“ stöhnt Conny. Sie hatte damals das Kommando im Kessel von Kalisch geführt. Es war höllisch gewesen. Vor allem die Ungewißheit, ob man einen Weg hinaus finden würde. Von Connys Einwurf läßt sich Valkendorn nicht beeindrucken: „Ich wollte nur sagen: Wir sind beispielsweise bei Kalisch und in anderen Gefechten so verfahren, daß die eingeschlossenen Einheiten solange eigenständig handelten, bis wieder Kontakt hergestellt war.“ „Jetzt verstehe ich.“ antwortet Karo. „Sie schlagen also vor, wir lassen unsere Agenten im Raume Köln erstmal auf sich gestellt agieren, bis wir handlungsfähig sind.“ „Genau. Freilich müßten wir den Agenten Handlungsfreiheit geben.“ „Ja, was haltet ihr andern davon?“ fragt Karo etwas unsicher. Sie selbst versteht es Schlachten zu leiten, aber diese Situation ist relativ neu für sie. Valkendorn wäre jetzt der bessere Mann auf dem Posten des Stellvertretenden Oberbefehlshabers von „Schimäre“. Immerhin hat er diesen auch bis Anfang September bekleidet. „Wir könnten eine Handvoll Leute als eine Art Unterstützungs-oder Vorauskommando schicken...“ wirft Schoeps ein. Sie selber hatte Ende August ein solches Kommando mal geführt, um eine andere damals aufgetretene komplizierte Situation in Köln zu stabilisieren. Bei den Ereignissen damals kam leider auch Connys Vorgängerin auf dem Posten des Ic, Christiane Alleker, ums Leben. Nervös trommelt Karo mit den Fingern auf der Tischplatte. Schließlich stößt sie einen polnischen Fluch aus. „Was?!“ fragt der irritierte Landgraf. Bohnsack fühlt leise vor: „Also genügend Transportmaschinen, um einen Voraustrupp abzusetzen, hätten wir ja...“ Der Satz klingt nach einem „Ja,aber...!“, ganz offensichtlich ist Bohnsack nicht allzu begeistert von der Vorstellung. Dabei hatten gerade seine Flieger Kommandoaktionen immer in kühnster Manier erfolgreich unterstützt. Jüngstes Beispiel war der Überfall auf den Flugplatz Rudaki. Trocken stellt Valkendorn fest: „Frau Generalleutnant, Sie müssen jetzt eine Entscheidung treffen, zu der Sie stehen und die Sie verteidigen können. Eine Entscheidung, der wir uns zu fügen haben. Sie wissen, daß es so funktioniert. Das hier ist kein Stammtisch mit Mehrheitsbeschluß. Demokratie in Ehren, aber in Situationen wie diesen dauert sie zu lange.“ „Ich fürchte leider, Sie haben recht, General.“ stimmt Karo zu. „Ok, wenn es keine gewichtigen Argumente dagegen gibt, verfahren wir wie folgt: Conny, gib nach Frechen durch, man soll sich dort zunächst allein behelfen, bis wir wissen, wie wir Hilfe schicken können. Und was den von Schoeps vorgeschlagenen Voraustrupp angeht: Damit warten wir, bis Stefan wieder da ist. Zuviel Aktionismus in dieser Situation kann genauso schlecht sein...“ Die Luft ist diesig. Um sie herum nur efeubewachsene Bäume, niedrige Büsche, dazwischen vereinzelt Farne und Brennesseln. Fröstelnd kuschelt sich Sarah stärker in ihre warme braune Jacke. Wo ist sie hier? Vor ihr ist ein zertretener Trampelpfad. Irgendwie kommt ihr das ganze hier bekannt vor. Während sie ein paar Schritte diesen Pfad entlangmacht, versucht sie, sich zu erinnern. Und dann fällt es ihr tatsächlich ein: Es ist das Nachtigallental in Köln-Weiden. Langsam dreht sie sich einmal um die eigene Achse. Ja, tatsächlich, da ist der Abhang, der zum Bahndamm raufführt. Aber wie war sie hier hingekommen? Sie kann sich nicht erinnern. Geht vorsichtig weiter, hält ein paar Äste zur Seite, die hinter ihr wieder zurückflitschen. Aus ihrer Jugend kennt Sarah das Nachtigallental eigentlich wie ihre Westentasche und daher wirkt auch alles vertraut. Und irgendwie doch nicht. Irgendwas fehlt. Und es ist so still. Ja – das ist es! Es fehlen der Wind in den Bäumen, das Rauschen der nahen Autobahn. Und das Zwitschern der Vögel. „Hallo, Schwester.“ Überrascht dreht sich Sarah um, um zu sehen, wer hinter ihr aufgetaucht ist. Sarah Alleker stockt der Atem. Es ist tatsächlich ihre Schwester Christiane! In voller Größe und Schönheit. In weißer Bluse, Jeans und schwarzer Stoffjacke. Leicht geschminkt, gerade so, daß man die leichten Schatten um die Augen noch sieht, ihr hellbraunes Haar, wie im wahren Leben etwas rötlich gefärbt, fällt über ihre Schultern. „Chrissi? Du lebst?“ kriegt Sarah nur heraus. Christiane lächelt verlegen. „Sarah, ich lebe nicht. Ich bin tot, seit über einem Monat, schon vergessen?“ „Nein, natürlich nicht.“ Sarah starrt nur fassungslos ihre Schwester an. Und weiß gleichzeitig nicht mehr, was sie noch glauben soll. „Sarah, ich bin tot. Und das hier ist ein Traum.“ Sarah ist kreidebleich. Das scheint Chrissi zu amüsieren. „Keine Sorge, Du bist nicht verrückt.“ „Aber, wieso träume ich das?“ „Wieso nicht? Was spricht dagegen?“ „Die Frage könnte von Stefan sein.“ „Stimmt.“ Christiane legt den Kopf ein wenig schief, als ob sie horchen würde. „Sarah, Du mußt sofort wieder aufwachen.“ „Was?“ „Gefahr droht, Du mußt sofort aufwachen!“ Allmählich verblaßt die Umgebung, hektisch sieht sich Sarah um. „Und Sarah! Sag‘ Stefan, das...“ Sarah hört es nicht mehr. Mit einem kurzen Aufblitzen verblaßt der Traum und sie starrt durch die Dunkelheit an die weißgetünchte Decke ihres kleinen Appartements im Kölner Stadtteil Ehrenfeld, wo sie seit einer Woche wohnt. Sie blitzelt, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Und dann hört sie ein Krachen... Es ist das Krachen der Wohnungstür, die splitternd auffliegt, als zwei Polizisten mit einem Rammbock gegen sie anrennen. Die Tür kracht gegen die Wand, dann stürmen die Polizisten rein, mit gezogenen Pistolen. Draußen hört man eine Stimme befehlen: „Das ist nur ein Helfershelfer, ein kleiner Fisch. Erschießen.“ „Neeiii-...!!“ Der Schrei bricht ab, als es einmal knallt. Und dann kommen schwarzuniformierte Gestalten durch die Tür. Als vierter Obersturmbannführer Trappert. Die beiden regulären Polizisten haben inzwischen die kleine Wohnung durchsucht und melden jetzt: „Nichts! Niemand dar.“ Trappert sieht sich in der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung um, die nur spartanisch mit einem Tisch, einem Bett, ein paar Stühlen und zwei Schränken eingerichtet ist. „Was ist mit dem Fenster dar?“ Er deutet auf ein Fenster, wo die Vorhänge ein wenig im Lufthauch hin-und herwehen. Mit einem Nicken bedeutet Trappert dreien seiner Leute, das Fenster zu überprüfen. Zwei von ihnen haben Pistolen, der dritte eine Maschinenpistole. Einer zieht die Vorhänge zur Seite. Das Fenster ist offen. Er schaut hinaus. „Eine Feuerleiter!“ brüllt er. „Und da ist jemand!“ „Schnappt sie! Wenn möglich lebend – tot ist auch in Ordnung!“ Die Gepos springen aus dem Fenster auf die Feuerleiter und klettern diese möglichst schnell runter. Sarah kommt inzwischen unten an, springt auf den Kies auf dem Dach des niedrigeren Hauses, wischt sich ein paar ihrer langen braunen Haare aus dem Gesicht, springt auf und rennt weiter. Irgendwo 20 m weiter, am andern Ende des Daches muß noch eine Feuertreppe sein, die zur Straße führt. Sie rennt und rennt. Hört hinter sich, wie die Gepos auf das Dach springen, brüllen, ein Schuß peitscht dicht hinter ihr in den Kies. Und dann stolpert Sarah und fliegt der Länge nach auf den Kies! Sie will sich gerade wieder aufrappeln, als sie jemand von hinten packt und hochreißt. Einer der Geheimpolizist. Er wirbelt sie herum, hält ihr mit der einen Hand die Pistole an den Kopf und mit der andern ihren Arm fest. Dort sieht er die mit einem Brenneisen eingestanzte Nummer. „Ah, eine geflohene Gefangene!“ Sarah versucht sich loszureißen. „Nein, nochmal entkommst Du uns nicht!“ Einer seiner Kameraden ist heran. „Du hast eine Geflohene?“ „Ja, nach dem Zeichen zu schließen aus Sechtem!“ „Das wäre die erste seit über einem Monat, die wir krie-...“ Die Stimme bricht ab. „Was ist?“ verwundert will sich der Geheimpolizist umdrehen, da zuckt zwischen ihm und Sarah etwas metallisches auf. Der Geheimpolizist bleibt wie erstarrt stehen. Das Blut weicht ihm aus dem Gesicht. Seine Hand mit der Pistole fällt. Sarah kann sich losreißen, kreischt schrill, als an ihrem Arm noch die andere Hand des Geheimpolizisten hängt. Sie schüttelt sie schnell ab. Der Gepo starrt einen Augenblick seine Armstümpfe an. Dann schreit er. Der neu hinzugekommene Angreifer, eine große, dunkle Gestalt, holt wieder mit dem Schwert aus und schlägt dem Gepo den Kopf ab, der in hohem Bogen wegfliegt und mit einem seltsamen Geräusch im Kies landet. Der Schrei des Mannes hallt nur noch als Echo von den Wänden der umgebenden Häuser wieder. Sarah ist instinktiv weitergelaufen und hat die Feuertreppe erreicht. Mit scheppernden Schritten rast sie in der Dunkelheit die Stufen hinunter. Über ihr hört sie ein noch lauteres Scheppern, als jemand auf die obersten Stufen springt und ihr dann folgt. Wer war der neue Angreifer gewesen? Kein Geheimpolizist, die zerhacken sich normalerweise nicht gegenseitig. Als sie gerade die letzten Stufen an der Seite des Backsteingebäudes hinunterrast, jagt ein Schatten an ihr vorbei. Der Typ ist tatsächlich die letzten paar Meter gesprungen, um vor ihr unten zu sein! Bevor sie stoppen kann ist sie auch schon unten. Jetzt kann sie den mutmaßlich neuen Gegner erstmals wirklich sehen: Ein großer, kräftiger Mann, mit mäßig kurzen schwarzen Haaren, bleich wirkendem Gesicht, Brille, ganz in schwarz, ein lange schwarzer Mantel umflattert ihn. Und in der einen Hand hält er ein langes, blutiges Schwert, das er jetzt mit einer raschen Bewegung zurück in die Scheide gleiten läßt, die seitlich an seinem Gürtel hängt. Kurz kann Sarah unter dem Mantel die Holster mit zwei großkalibrigen Automatikpistolen sehen. Und jetzt kommt er auf sie zu und stößt sie vorwärts durch die Gasse. „Na los!“ zischt er. „Wir sind noch nicht in Sicherheit!“ Schließlich packt er sie am Arm und zerrt sie mit sich durch die Gasse. Hinter ihnen wieder Rufe und klappernde Schritte. Die Geheimpolizisten sind ihnen auf den Fersen und werden mit Sicherheit stinksauer sein. Am Gasseneingang erkennt Sarah ein Motorrad. Der Fremde läßt sie los und steigt auf, wirft die Maschine an. „Na kommen Sie!“ „Woher weiß, ich, daß ich Ihnen trauen kann!“ krächzt sie, zitternd vor Angst. Eine kurze Salve aus einer Maschinenpistole jagt hinter ihnen durch die Gasse und der Fremde grinst nur breit. Sarah versteht: Entweder geht sie mit ihm und lebt noch ein Weilchen oder sie bleibt hier und läßt sich von den Geheimpolizisten über den Haufen schießen. Es kommt ihr vor wie die Wahl zwischen Erschossenwerden und Erhängtwerden. Schließlich schwingt sie sich kurzentschlossen hinten auf das Motor und klammert sich an dem Fremden fest, der sofort Gas gibt. Als sie die kleine Straße, an die mehrere verkommene Wohn-und Lagerhäuser grenzen, entlangbrettern, rennen hinter ihnen Gepos aus der Gasse und feuern recht ungenau hinter ihnen her, kein Schuß trifft. Sollte es so schnell vorbei sein? Nein, noch nicht ganz! Zwei Gepo-Kräder kommen auf einmal dicht hinter ihnen aus einer Seitengasse und jagen ihnen hinterher. Sarahs fremder Retter wirft einen Blick über die Schulter und gibt dann Gas. Biegt auf die Venloer Straße ein, in dem Moment, wo einer Gepos schießt. Wieder gehen die Kugeln daneben. Interessanterweise fährt der Fremde Richtung Innenstadt wie Sarah registriert – er weiß also, daß man stadtauswärts früher oder später auf eine Straßensperre trifft. Man überholt die wenigen Autos, die so spät abends hier unterwegs sind, aber die Gepos hängen immer noch hinter ihnen. Die nächste Kreuzung vor ihnen, da schaltet die Ampel gerade auf rot. Der Fremde gibt nochmal Gas und sie brettert geradeso drüber. Rechts registriert Sarah einen Laster, der losfährt. Er wird nicht mehr abbremsen können. Als Sarah hinter sich ein Scheppern und einen Knall hört, weiß sie, daß der Laster den vordersten der beiden Gepo-Kradschützen mitgerissen und dem andern den Weg versperrt hat. Was für ein Glück! Am Friesenplatz erst stoppt der Fremde. „Also Lady, steigen Sie ab!“ „Was?“ „Steigen Sie ab!“ Sarah steigt ab. Der Fremde deutet auf ein großes Gebäude weiter vorne Richtung Innenstadt. Das Dorinth-Hotel. „Dort sollten Sie sicher sein.“ Verdammt, der weiß viel! schießt es Sarah durch den Kopf. Viel zu viel! Vorsichtig geht Sarah weiter und überquert den Friesenplatz. Geht Richtung Hotel. Gleich würde sie gerettet sein! Mit einem Blick zurück sieht sie, wie sich der Fremde von einer Patrouille der Gepos festnehmen läßt... Trappert kommt mürrisch gelaunt zum Dienstwagen zurück, der vor dem Haus steht, indem sich Sarah Alleker versteckt gehalten hat. Er reißt die Fahrertür auf und läßt sich auf den Fahrersitz fallen. Leikert sitzt auf dem Beifahrersitz. „Hat wohl nicht geklappt, was?“ „Nein, Sturmbannführer, es hat nicht geklappt. Wir hatten sie eigentlich schon, aber dann hat sich jemand eingemischt.“ „Wer?“ „Wir wissen nicht wer. Meine Männer haben was von einer dunklen Gestalt erzählt, die zwei meiner Leute geköpft hat.“ Ein wissendes Lächeln breitet sich auf Leikerts Gesicht aus. „Was ist?“ „Eben kam eine Funkmeldung vom Hauptquartier, Obersturmbannführer. Am Friesenplatz hat eine unserer Patrouillen offenbar den geheimnisvollen Helfer festgenommen. Er hat sich kampflos gestellt und abführen lassen.“ Trapperts Augen blitzen ungläubig auf. „Ok,“ beschließt er, „dann fahren wir jetzt noch ins Hauptquartier. Ich wollte zwar noch vor Mitternacht zu meiner Frau ins Bett, aber daraus wird ja wohl nichts...“ Er startet den Motor und biegt auf die Straße ein. Donnerstag, der 9. Oktober Trappert und Leikert haben sich, kaum das sie ins Gepo-Hauptquartier in dem Hansa-Hochhaus mit seinem flacheren Südteil und dem turmartigen Nordteil zurückgekehrt sind, erstmal einen starken Kaffee gegönnt. Es ist mitten in der Nacht. Wer weiß, wie lange nun noch das Verhör des fremden Helfers von Sarah Alleker dauern wird. Nach dem Kaffee führt Trappert Leikert in den fünften Stock, wo einer von Trapperts Leuten bereits seit einer Stunde den Gefangenen in einem Verhörraum bearbeitet. „Obersturmbannführer, glauben Sie, der Gefangene hat bereits geredet?“ „Ich weiß es nicht.“ „Er soll der Gothic-Gemeinde angehören, hieß es doch.“ bemerkt Leikert. Trappert sieht ihn von der Seite an und erwidert scharf: „Wenn dem so ist, so könnte dies auf bewaffneten Widerstand von Seiten der Gothics hindeuten. Und an dem wären Sie, Herr Sturmbannführer, und Standartenführer Oschmann schuld.“ „Waren Sie es nicht, der das Lic am Wochenende hat stürmen lassen?“ „Nur auf Anweisung von oben hin. Wieso kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, daß dahinter auch Sie und der Standartenführer stecken?“ Leikert will zu einer scharfen Antwort ansetzen, schluckt sie aber herunter, denn jetzt erreichen die beiden das Verhörzimmer. Trappert geht zuerst rein, Leikert folgt. „Sturmscharführer, wie geht’s voran?“ fragt Trappert seinen Verhörspezialisten. Aber der ist nicht gerade gut gelaunt. „Tut mir leid, Obersturmbannführer, aber sagt kein Wort. Wir haben ihn zusammengeschlagen, gepeitscht und es auch schon mit Stromschlägen versucht.“ Trappert wirft einen Blick auf die mit nacktem Oberkörper an den Stuhl gefesselte Gestalt, deren Lippen bereits blutig aufgesprungen sind. „Sie haben jede hier machbare Methodik versucht, Sturmscharführer?“ „Jede. Seit über einer Stunde.“ Müde gähnt der Mann. Auch Trappert massiert sich mit zwei Fingern den Nasenrücken. Auch er ist müde. Und von dem Gefangenen weiß man nichtmal den Namen. „Ok. Bringt ihn zu Dr. Keßbach. Ich glaube, der braucht noch ein paar Versuchskaninchen.“ „Aber Obersturmbannführer, dann wird der Gefangene uns wahrscheinlich nichts mehr sagen können.“ wendet der Sturmscharführer ein. „Das ist mir egal. Keßbach läßt die Häftlinge gern noch warten und bei der Behandlung ihrer Vorgänger zusehen. Da wird er unser Freund hier noch genügend Zeit für eine Entscheidung haben.“ Trappert dreht sich um und verläßt den Raum. Einen Moment noch bleibt Leikert stehen, dann folgt er langsam hinkend Trappert. Der Sturmscharführer gibt den zwei Wachen im Raum einen Wink. Eine bindet den Gefangenen los und reißt ihn hoch vom Stuhl, bindet dann seine Arme wieder hinterm Rücken fest und stößt ihn Richtung Tür. Die andere Wache nimmt die Sachen des Gefangenen – Mantel, Schwert und Hemd – , um sie ebenfalls zu Keßbach zu bringen. Der Sturmscharführer, ein schlanker, dunkelhaariger Mann um die 30, folgt den dreien, mit der Hand an der Pistole im Holster. Mit dem Aufzug fahren die vier nach unten. Bis in den Keller. Dort öffnen sich die Fahrstuhltüren zu einem nur von wenigen Glühbirnen blaß beleuchteten Gang. Die Geheimpolizisten führen den Gefangenen den Gang entlang. Von irgendwoher hört man Schreie. An der ersten Abzweigung biegen sie ab. Die Schreie werden lauter. Kurz bevor der Sturmscharführer die zweiflügelige Eisentür aufstößt, auf die sie zugehen, verstummen sie. Hinter den Eisentürflügeln ist ein großer, weiß gekachelter und hell erleuchteter Raum. Kleinere Räume zweigen ab, haben aber Fenster zum Hauptraum. Und auch sie sind hell erleuchtet. Sie weisen Laborgerätschaften und Waschbecken auf. Weitere Waschbecken besitzt auch dieser Raum. Vor allem aber besitzt er mehrere Untersuchungsstühle und zwei eiserne Untersuchungstische. Und Rillen im Boden, durch die Blut und Körpersäfte zu Abflüssen geleitet werden. Auf einem der Tische liegt ein Mann, der nur mit einer Unterhose bekleidet ist. Seine Arme liegen mit den Unterseiten nach oben auf der Tischplatte. Die Arterien wurden knapp oberhalb der Handgelenke geöffnet und lange Sonden wurden in die geöffneten Gefäße eingeführt. Das schmerzverzerrte Gesicht des Mannes, der offenbar inzwischen tot ist, zeugt davon, daß er nicht betäubt war. In Strömen fließt das Blut vom Tisch auf den Boden und in die Rillen. Daneben steht ein älterer Herr in weißem, blutbespritztem Kittel, der sich seine blutigen Hände mit Papiertüchern abwischt. „Morgen, Dr. Keßbach.“ grüßt der Sturmscharführer den Mann. Der dreht sich um, während zwei jüngere Männer in weißen Kitteln sich um die Leiche kümmern: Sie lassen die Arme des Toten nun vom Tisch herabhängen und nehmen die Sonden aus den Adern, damit das Blut gut austropfen kann. „Morgen, Sturmscharführer. Sie bringen mir noch jemanden?“ „Ja. Wir wissen nicht, wer er ist. Wir hoffen, eine kleine Demonstration Ihrer Fähigkeit wird ihn zur Vernunft bringen.“ „Sicher.“ Ein teuflisches Lächeln huscht über Keßbachs Gesichtszüge. „Bringen Sie ihn erstmal in Raum 3 und entkleiden Sie ihn bitte bis auf die Unterhose. Einer meiner Assistenten kann dann die übliche Voruntersuchung vornehmen.“ „Ist klar, Dr. Keßbach.“ Der Sturmscharführer und die andern drei Männer durchschreiten den großen Versuchsraum, während Keßbach seinen beiden Assistenten befiehlt: „Bringt mir die Frau. Ich würde an ihr gerne einen neuen Sezierversuch durchführen. Vielleicht gelingt es uns ja dieses Mal, die Patientin am Leben zu halten, bis wir fertig sind...“ Der Sturmscharführer und die andern haben inzwischen den kleinen Nebenraum erreicht, über dem eine „3“ angebracht ist. Der Sturmscharführer schließt die Tür, die aus Holz mit eingelassener Glasscheibe ist. Der Gefangene kann durch die Fenster sehen, wie die beiden Assistenten Keßbachs eine attraktive dunkelblonde Frau, die nur einen Slip trägt, hereinbringen und dann zu dem zweiten Untersuchungstisch führen. Sie versucht sich loszureißen, wird aber von den beiden Männern auf den Tisch gedrückt, wo ihre Gliedmaßen mit Lederriemen fixiert werden. „Wer ist die Frau?“ fragt der Gefangene plötzlich. Seine ersten Worte, seit er in Gefangenschaft ist. Nichtmal, als man ihm blutige Striemen auf dem Rücken zugefügt hat, hat er gesprochen. Der Sturmscharführer sieht auf. „Wenn ich Dir das sage, gibst Du uns dann auch Antworten?“ „Ja.“ Seine beiden Begleiter, von denen einer gerade die Handschellen abnimmt, sieht der Sturmscharführer kurz an, dann erklärt er: „Eine Terroristin. Wir haben sie kürzlich im Bistro Rothschild festgenom-...“ Weiter kommt er nicht. Jennifer Ehlen wehrt sich verzweifelt gegen die Lederriemen, aber sie schneiden nur um so tiefer in ihre Haut. Sie zittert und bebt am ganzen Körper – weil ihr, so fast gänzlich nackt, kalt ist und weil sie furchtbare Angst hat. Bislang hatten die Gepos ihr nur ein paar Ohrfeigen beim Verhör verpaßt, was noch geradezu milde war. Ganz offenbar hoben sie sich alle Schmerzen für jetzt auf. Keßbach tritt neben den Tisch und legt sich einen Mundschutz um und zieht Gummihandschuhe über. Er hält seine rechte Hand hoch. „Skalpell.“ Der eine seiner Assistenten reicht den Skalpell Keßbach. „Neeeeiiiin!!!“ fängt Jenny an zu kreischen und windet sich auf dem Tisch. „Unglaublich, welche Tonlagen die menschliche Stimme in Situationen der Todesangst entwickelt.“ stellt Keßbach nüchtern fest. „Knebelt sie!!“ Der eine Assistent hält Jennys Kopf fest und fixiert ihn ebenfalls mit einem Lederriemen, der andere stopft ihr einen Knebel aus Mullbinden in den Mund. Keßbach fährt mit der freien Hand dicht über Jennys Bauch hinweg, um sich die richtige Stelle zum Ansetzen auszusuchen. Knapp unterhalb des Bauchnabels will er schließlich anfangen. Er wiegt das Skalpell geradezu rituell in der Hand und senkt es schließlich langsam auf die ausgesuchte Stelle hernieder. In dem Moment kracht und klirrt es, als der Sturmscharführer durch die Tür zu Raum 3 fliegt und in einem Regen aus Holz-und Glassplittern mit gebrochenem Genick auf den Fliesenboden fällt. Und dann fliegt ein zweiter Gepo durch die größere Glasscheibe, bereits tot, während sein Kollege gerade ebenfalls von dem Gefangenen an eine der Wände geklatscht wird. Dann bricht der Gefangene auch diesem Gepo das Genick und greift sich sein Schwert, daß einer der Gepos auf einem Arbeitstisch abgelegt hatte. Mit einem Satz ist der Gefangene im Hauptraum. „Doktor, lassen Sie sofort das Skalpell fallen, wenn Sie noch eine schwache Hoffnung auf ein wenig Leben haben wollen!!“ faucht der Mann. In der einen Hand hält er drohend das Schwert, in der andern eine Pistole, die er den Gepos abgenommen hat. Keßbach ist so überrascht, daß er zurückzuckt und das Skalpell klimpernd zu Boden fallen läßt. Einer seiner Assistenten will den Gefangenen angreifen, aber da zuckt dessen Klinge und schlitzt den Mann quer auf. Keßbachs Assistent fällt zu Boden und bleibt in seinem eigenen Blut liegen. Der andere Assistent gerät in Panik, will zum Ausgang rennen. Doch der Fremde hebt nur den Arm und feuert zweimal mit der Beutepistole. Der getroffene Mann fällt, versucht kriechend weiterzukommen, bleibt dann aber wimmernd liegen. „Na los, Doktor, machen Sie sie los!!“ Keßbach steht wie erstarrt. „Losmachen, sage ich!!“ brüllt der Fremde. „Ja, ja, schon gut!“ Hektisch löst Keßbach die Lederriemen. „Aufstehen!“ knurrt der Fremde Jenny an, die sich das nicht zweimal sagen läßt. Sie reißt sich selber den Knebel aus dem Mund und springt vom Untersuchungstisch. Als ihre nackten Füße das warme Blut der toten Menschen auf dem Boden berühren, schreit sie kurz auf und rennt taumelnd in den Raum 1, wo sie bis eben noch war und wo ihre Sachen sind. „So Doktor, jetzt sind wir dran!“ Der Fremde gibt ein bedrohliches Knurren von sich. Er wirft die Pistole weg und wiegt nur noch das Schwert in seinen Händen. „Doktor, ich werde Ihnen zeigen, wie sich Ihre Patienten gefühlt haben!“ „Wa-...?“ Da hat der Fremde schon ausgeholt und rammt das Schwert dem Doktor in den Brustkorb, genau auf die Stelle, wo sich das Brustbein spalten läßt. Noch bevor der Doktor seinen Schrei richtig rausgelassen hat, zieht er nach unten und schlitzt Keßbach längs auf. Dann zieht er das Schwert heraus und Keßbachs Gedärme quellen hervor. Mit einem schmerzerfüllten Keuchen und einem anschließenden Kreischen bricht Keßbach zusammen und hält sich dabei die Gedärme. Schließlich holt der Fremde nochmal aus und haut Keßbach den Kopf ab. Schweratmend tritt der Fremde zurück. Erst jetzt fällt ihm auf, daß er blutbespritzt ist. Langsam geht er in den Raum zurück, wo seine Sachen sind, wischt sich dort das Blut ab und zieht sich wieder an. Jenny hat sich den grauen U-Haft-Overall und die Schuhe wieder angezogen. „Können wir gehen?“ Sie dreht sich erschrocken um. Vom Schock der Ereignisse in den letzten Minuten ist sie immer noch ganz bleich. „Bii...Bii...Bitte?“ „Können wir gehen?“ Der Fremde steht wieder in voller Montur da: Schwarze Lederhose, schwarze Kampfstiefel, schwarzes Hemd, am Gürtel hängen zwei schmucke Ketten, der schwarze lange Mantel hängt bis fast zum Boden, zwei Holster an den Körperseiten für die Pistolen, am Gürtel die Scheide des Schwertes, über den Handgelenken Nietenbänder. Eine zumindest in diesem Moment beeindruckende Gestalt. Und diese Gestalt wischt gerade mit einem Tuch das Blut vom Schwert und schiebt dieses dann in seine Scheide zurück. Der Fremde wiederholt seine Frage: „Können wir gehen?“ Erst jetzt schaltet Jenny: Natürlich müssen sie gehen. Denn irgendwann werden die Gepos merken, was hier passiert ist und stinksauer sein. Sie nickt. „Sicher, wir können gehen.“ Sie kommt zurück in den Hauptraum. Der Fremde reicht ihr eine Maschinenpistole, die er einem der toten Gepos abgenommen hat. „Können Sie damit umgehen?“ „Ich glaube schon.“ „Das muß mir wohl reichen.“ Er gibt ihr die Maschinenpistole und zieht seine eigenen beiden Pistolen. Dann öffnet er die eiserne Tür und tritt hinaus auf den Kellergang, durch den er eben noch gebracht worden war. Jenny eilt ihm hinterher. „Wie heißen Sie?“ will sie wissen. „Nennen Sie mich...ja, nennen Sie mich Ben.“ „Nur Ben? Oder geht’s noch weiter?“ „Das muß reichen.“ „Ok, ich bin Jenny. Wohin jetzt?“ „Irgendwo muß es hier eine Treppe zum Parkhaus geben. Dort sind nicht ganz soviele Wachen wie am Vordereingang.“ „Sicher?“ Keine Antwort, nur ein mürrischer Blick. Ganz offenbar ist Ben jetzt nicht nach Gerede. Wortlos folgt ihm Jenny um zwei Ecken. Dann deutet Ben auf eine Tür, über der ein Schild mit der Aufschrift „Treppe“ hängt. „Das könnte es sein.“ Sie laufen zur Tür rüber. „Sie machen auf.“ Er deutet auf die Tür und stellt sich dann mit schußbereiter Pistole vor die Tür. Jenny stellt sich an die Seite und reißt dann die Tür auf. Aber keine Wache hinter der Tür. „Komisch, noch schlechter bewacht, als ich dachte.“ Ben nimmt die Waffe wieder runter und die beiden treten in das Treppenhaus. Schleichen die Treppe hoch und öffnen dann vorsichtig die erste Tür. Das Parkdeck im Erdgeschoß ist dahinter. Leise schließt Jenny hinter sich die Tür, während Ben im Halbdunkel des Parkhauses versucht, sich zu orientieren. Wortlos schleichen sie zur Ausfahrt. Dort sind Wachen: Zwei Mann, die in ihrer Kabine sitzen. Jenny beschließt, Ben vorausgehen zu lassen und einfach den selben Weg zu nehmen wie er. Und Ben ist höchst konzentriert. Zwar ist er nahe dran am Ziel, aber noch kann alles schiefgehen. Er duckt sich und schleicht unterhalb des Fensters der Aufenthaltskabine entlang, in der Hoffnung, daß die Wachen nichts merken. Um die Ecke! Und auf die Straße! Zwischen zwei dort parkende Autos und dahinter. Kurz warten. Jenny folgt ihm immer noch, ebenfalls geduckt. Er legt den Finger auf die Lippen: Leise! Ein paar Momente warten. Eine Patrouille bummelt auf der anderen Seite des Autos vorbei. Aber die Gepos haben nichts gemerkt. Jetzt huscht Ben in der Deckung weiterer Autos um die Ecke zur nächsten Seitenstraße. Dort steuert er einen Kanaldeckel an, den er sofort anhebt. Jenny ist ihm hinterhergeschlichen und er bedeutet ihr, hinabzuklettern. Jenny überlegt nicht lange. Sie klettert hinunter. Ben folgt ihr und schließt den Deckel. Das ist nochmal gutgegangen! Die Stimme in Ben, die diesen ganzen Plan von vorneherein zum Wahnsinn erklärt hat, verstummt allmählich. Es hat geklappt. Auch wenn es sehr knapp war. Und im Kanalsystem müssen sie nicht fürchten, von den Gepos aufgegriffen zu werden; auf offener Straße wäre es viel zu gefährlich, da ja Ausgangssperre gilt... Die Uhr schlägt vier Uhr und im Keller des Dorinth-Hotels, wo sich mehrere Widerständler versteckt halten, leitet die Hotelleiterin Linda Meier-Grolman die letzte Besprechung. „Wir haben nur eine einzige Chance. Wir müssen in einem Zug die Wachen im Erdgeschoß überwältigen, innerhalb von zehn Minuten den betreffenden Gefangenentrackt finden.“ Linda wirkt mit den schulterlangen dunkelblonden Haaren, die ihr Gesicht umrahmen, zierlicher als sie eigentlich ist. Und momentan ist sie nervös. Es geht um die Befreiung von Jennifer Ehlen. Sie haben tatsächlich nur einen Versuch. „Wir müssen Jenny dann innerhalb einer halben Stunde an einen sicheren Ort bringen. Das wird hoffentlich hier sein. Bei der ganzen Aktion haben wir leider nicht sehr viel Munition zur Verfügung. Und hinterher muß es uns gelingen, wieder in der Stadt unterzutauchen, ohne noch jemanden zu verlieren.“ Sie blickt die andern an, die mit ihr um den runden Holztisch sitzen. Alle blicken mürrisch. Joschi, Katrin und Dominik haben bereits klar gemacht: Sie halten das ganze Vorhaben für reinen Irrsinn, der nur in einem Blutbad enden kann. Auch Chris Loewisch ist nicht begeistert. Sarah spielt nur nervös mit einem Bleistift herum. Eben hatte sie ihren Bericht von der doch recht eigenartigen Rettung abgeliefert. Ihr Vorschlag, zusammen mit Jenny auch den geheimnisvollen Fremden zu befreien, ist nicht auf sonderlich viel Zustimmung gestoßen. „Also, seid ihr alle bereit?“ fragt Linda. „In einer Stunde soll die Aktion schließlich anlaufen.“ „Also ich weiß nicht...“ murmelt Andreas Beiß leise. Auch ihm schmeckt die Sache nicht. „Ja,“ donnert auf einmal eine Stimme von der Eingangstür zu diesem nur von einer Glühbirne erleuchteten Kellerraum her, „wollt ihr euch denn wirklich umbringen?“ Alle drehen sich um. Sarah sofort: „Das ist er! Der Mann hat mir heute Nacht geholfen!“ In der Tat: Ben stand wie ein schwarzes Ungeheuer in der Tür. „Ja, ich war es.“ stimmt er zu. „Und ich haben jemanden mitgebracht.“ Er macht einen Schritt zur Seite und Jenny betritt den Raum. „Jen!! Aaaahh!“ schreit Katrin auf und sie und Jenny fallen sich um den Hals. Auch Chris springt auf und umarmt Jenny zur Begrüßung. Linda freilich bleibt vorsichtig. „Jetzt, da Sie uns geholfen haben, wer sind Sie?“ „Ben. Das muß reichen. Ich bräuchte ein Versteck, um auf die Ankunft von jemandem warten zu können. Ich glaube, das wäre als Dank angemessen.“ Linda starrt Ben für einen Moment verwirrt an, denn der Mann war gedanklich schon viel weiter als sie. „Bitte?“ „Ja, ich brauche ein Versteck. Am besten hier.“ „Und auf wenn warten Sie, wenn ich das wissen darf?“ „Auf eine Freundin. Das muß reichen.“ Andreas beugt sich zu Linda vor und flüstert ihr zu: „Ich glaube ihm nur eine Unterkunft zu gewähren, kann nicht wirklich schaden. Immerhin hat er zwei unserer Leute vor dem wahrscheinlich sicheren Tod gerettet.“ Nach einem weiteren kurzen Moment nickt Linda. „In Ordnung. Sie kriegen eines unserer Notquartiere hier im Keller. Herr Beiß wird es Ihnen zeigen. Aber verstehen Sie bitte, wenn wir eine Wache aufstellen.“ „Ich werde es verstehen. Vorerst.“ Linda nickt Andreas zu, der aufsteht und mit Ben den Raum verläßt. Nun wendet sich Linda Jenny zu, die gerade von Chris einen Kaffee gereicht bekommt. „Jenny, kannst Du uns schon erzählen, was passiert ist, oder bist Du noch nicht so weit?“ Mit noch etwas zittriger Stimme antwortet Jenny: „Doch geht schon...“ Und dann erzählt sie von den stundenlangen Befragungen, das man ihr außer Wasser keine Nahrung hat zukommen lassen und schließlich von dem Versuch des Arztes, sie bei lebendigem Leibe und vollem Bewußtsein zu sezieren... „Folgende Gruppierungen sind im Rahmen unseres Machtbereiches zu bekämpfen und zu vernichten: 1. Die Gothic-Szene, weil sie das Kreuz nicht in gebührender Weise ehrt und sich nicht der Führung durch Gottes Stellvertreter unterstellt. Außerdem frönt sie einem unsittlichen Gehabe. 2. Die Juden, die unsern Herrn und Erlöser getötet haben. 3. Die Moslems, die sich gegen Christen versündigt haben und das geheiligte Land besetzt halten. Außerdem predigen sie einen Irrglauben. 4. Die Anglikanische Kirche, die sich von der Führung durch Gottes Stellvertreter losgesagt hat. (...) 7. Das Freikorps „Schimäre“, das Kontakte zu einigen der vorgenannten Gruppen unterhält und eine dem Menschen ungebührliche Freiheit propagiert. Seine Mitglieder geben kein gutes Beispiel, sondern verhalten sich unsittlich. Einige der Offiziere versündigen sich vor Gott durch gleichgeschlechtliche Liebe oder schützen Ketzer bzw. sind selber welche. Diese Individuen gelten daher auch als exkommuniziert... (...)“ Auszug aus: Grundlegende Anweisungen für die Einsatztruppen der Inquisition: Kapitel 2: „Unsere Feinde“ Erlaß des päpstlichen Oberkommandos vom 28. September 1788 Stinksauer steht Trappert im Keller in der offenen zweiflügeligen Eisentür und beobachtet seine Leute beim Aufräumen. So eine Schweinerei! Irgendjemand hat einfach seine besten Forscher auf dem Gebiet Folterpraktiken niedergemetzelt. Und zwei Gefangene sind verschwunden, auch wenn vieles darauf hindeutet, daß der Gefangene mit dem Schwert hier den Spieß mal umgedreht hat. Kurz kommt in Trappert die Erkenntnis auf, wie eigenartig dieser Widerspruch ist: Wenn ein Gefangener sich wehrt und das hier anstellt, ist es eine Schweinerei, aber wenn Keßbach seine Versuche durchführte, war es vom Oberkommando abgesegnet. Schnell schiebt Trappert den Verdacht beiseite. Er birgt den Kern von Ungehorsam und Revolte in sich. Und dann der nächste solche Gedanke: Nein, es sind Gedanken, die zurück zu Ehre und Anstand führen! Ach beiseite!! brüllt Trappert innerlich. Was ehrhaft und anständig ist, definiert allein das Oberkommando zusammen mit dem Kaiser. „Und, irgendwas neues?“ fragt Leikert, der hinter Trappert aufgetaucht ist. Aber Trappert schüttelt träge den Kopf. Er hat diese Nacht nur wenige Stunden Schlaf gehabt; jetzt ist es noch neun Uhr morgens. „Nein, nichts. Wir wissen nicht, was genau sich abgespielt hat. Wir wissen auch nicht, wie die Gefangenen das Gebäude verlassen haben.“ „Oh, das wird Oschmann ganz schön sauer machen.“ Trappert wirbelt herum. „Was wollen Sie damit andeuten? Meinen Sie, unter Ihrem Kommando wäre das nicht passiert?“ „Das habe ich nicht gesagt.“ Leikert mustert fast unbeteiligt die Kellerdecke. Trappert stößt ein wütendes Schnauben aus und tritt verärgert an Leikert vorbei, um zurück zum Fahrstuhl zu gehen. Nach einem Moment folgt Leikert ihm, so gut es hinkend geht. „Obersturmbannführer!“ Trappert geht weiter. „Obersturmbannführer!“ „Was?!“ Aber Trappert bleibt nicht stehen. „Obersturmbannführer, Sie sollten sich die Frage stellen, wer diesen Gothic-Typen auf uns losgelassen hat!“ Abrupt bleibt Trappert stehen und dreht sich langsam um, deutet mit einem Zeigefinger auf Leikert. „Sie wollen sagen...?“ „Genau das will ich damit sagen, Obersturmbannführer. Ich schlage vor, Sie lassen sofort einen Haftbefehl ausstellen.“ Mal ehrlich: Bonn wirkt doch wie ein Kaff oder? Es soll zwar eine Stadt sein (zumindest auf dem Papier und in der Statistik), aber spätestens wenn man sich dort aufhält, kommt man sich doch vor wie in irgendeinem Kölner Vorort. So fühlt sich Petra auch jetzt, als sie durch einige kleine Sträßchen in der „Bonner City“ schlendert. Es ist kurz vor Mittag und schon ziemlich kalt; die tiefhängenden grauen Wolken kündigen nahenden Regen an, ebenso wie der leichte Wind bereits den Regengeruch in sich trägt. Aber Petra achtet nicht darauf. Sie verfolgt mit aller Konzentration den von ihr gefaßten Plan. Durch ihre Aktionen in Köln haben die Gepos ihr einen hervorragenden Angriffspunkt vorgegeben, ohne es zu wissen. Man mußte nur wissen, den Hebel anzusetzen, damit man eine zufällige Entwicklung ausnutzen kann. Eine ursprünglich militärische Grundregel, die ihr einst jemand erklärt hatte – damals, vor Jahren schon...Sie hofft nur, daß ein wichtiger Teil ihres Planes inzwischen geklappt hatte. Jedenfalls würde sie sich nun der Vorbereitung des nächsten Teilschrittes widmen. Alles ist sehr riskant, aber es ist die einzige Möglichkeit, aus der Sache rauszukommen, in die sie durch die Razzia im Lic hineingeraten ist. Schließlich bleibt sie vor einem kleinen Schmuckladen stehen. „Nadjas kleine Schmuckecke“. Petra muß grinsen: Dieser Laden ist fast nur Insidern bekannt und hält sich entsprechend nur durch Spezialverkäufe über Wasser. Zwar muß seit Kriegsbeginn vorsichtiger sein als früher, aber es läuft immer noch. Petra tritt vorsichtiger ein, eine Türklingel kündigt sie an. Der Laden ist sogar noch kleiner, als ihn das Schaufenster mit der „offiziellen“ Warenauslage anmuten läßt. Zwischen der kleinen Verkaufstheke und der Fensterauslage ist nur ein schmaler Gang, an dessen hinterem Ende eine Vitrine mit Ketten und Broschen steht. Hinter der Theke ist eine weitere Vitrine, daneben ein Durchgang zu einem kleinen Büro-und einem Werkstattraum. Das ist alles. Durch eben diesen Durchgang, vor dem nur mehrere schwarze Ketten herunterhängen, die nun klickernd gegeneinanderschlagen, kommt eine zierlich anmutende kleine, aber attraktive Frau, bleich geschminkt, die langen Haare schwarz gefärbt. Sie trägt neben einem schwarzen dünnen Rock ein schwarzes T-shirt, über das sie so etwas wie ein schwarzes Gewand gelegt hat. „Petra!“ ruft die kleine Frau freudig aus, als sie ihre Besucherin wiedererkennt. „Na, Nadja, wie geht’s Dir?“ Nadja, der Gnom. So heißt die Frau. Nadja, der Gnom. Mehr nicht. Das muß reichen. „Danke, mir geht’s gut. Hatte jetzt längere Zeit keinen Ärger mehr mit Polizei oder Geheimpolizei.“ „Freut mich.“ erwidert Petra. „Bei mir ist das leider anders.“ „Wie haste denn das angestellt?“ „Frag lieber nicht. Aber wenn ich da rauskommen will, bräuchte ich Deine Hilfe.“ „Meine?“ Nadja deutet überrascht mit dem Finger auf sich und runzelt die Stirn über ihren schwarzgeränderten Augen. Dann geht ihr ein Licht auf. „Ah, laß mich raten: Du brauchst was?“ „Genau. Eine Deiner kleinen Speziallieferungen.“ „Und was hätten Madame denn gern?“ „Einen Giftring. Meine Fingergröße kennst Du ja.“ „Welche Hand?“ „Rechte. Die übliche Legierung.“ „Welches Motiv? Drachen, Rattenschädel, Totenschädel, Skorpion, Krähenschädel?“ „Muß ich erst noch überlegen. Was hast Du an Giften da?“ „Nichts, aber ich kann innerhalb von 48 Stunden was besorgen. Momentan kann ich vor allem drei Stoffe besorgen, einer auf bakterieller Basis, einer auf Kugelfischbasis und einer komplett synthetisch – quasi das Modernste vom Modernen.“ „Ich nimm das Bakterielle, ist nicht so leicht nachzuweisen.“ „In Ordnung. Das Motiv?“ „Wie wär’s mit einem Rabenschädel?“ „In Ordnung...Rabenschädel...“ Nadja notiert sich alles auf der Theke auf einen Zettel. Dann schaut sie auf. „Rabenschädel? Du arbeitest doch nicht schon wieder für...?“ „Nein!“ antwortet Petra wie aus der Pistole geschossen. Und fragt direkt danach: „Kriegst Du das hin?“ „Was ist das denn für ne Frage? Natürlich krieg ich das hin...Ok, das macht dann für Dich 12 Reichsmark.“ „Nicht mehr...“ wundert sich Petra. Nadja lächelt: „Freundschaftspreis. Zahlbar bei Abholung. Wann holst Du den Ring ab? In zwei, drei Tagen hab ich ihn...“ „Ich werd ihn in einer Woche abholen bzw. jemand, wo Du erkennen wirst, daß er von mir kommt.“ Zwar schaut Nadja bei diesen Worten etwas skeptisch, aber zuckt dann doch die Schultern. „Petra, kann ich Dir sonst noch was anbieten? Gestern sind ein paar wunderbare mexikanische Pilze reingekommen, mit denen man sein Bewußtsein auf eine andere...“ „Nadja, ich bin momentan mehr für handfeste Dinge.“ „Moment!“ Nadja hebt eine Hand und verschwindet kurz hinter den schwarzen Ketten und kommt dann wieder, legt ein schwarzes Lederoberteil, das man an den Seiten mit Metallschnallen schließt und das mit nietenbelegten Riemen über die Schultern läuft, die ansonsten freigelassen werden, auf die Theke. „Und?“ wundert sich Petra. „Oberteile in der Art hab ich in Köln zuhauf.“ Aber Nadja lächelt triumphierend. „Das ist das einzige seiner Art, das ich habe. Hat mir jemand aus Amerika zugeschmuggelt. Du weißt, daß sich die amerikanische Gothic-Gemeinde am Unabhängigkeitskrieg gegen die Engländer beteiligt hat?“ „Nein, bisher wußte ich das nicht...“ „Ist aber so. Und die Amerikaner hatten ein Problem, daß die Kugeln der Engländer oft tödlich wirkten oder zumindest sehr schmerzhaft waren.“ „Ja, das haben Gewehrgeschosse so an sich.“ Irgendwie kommt sich Petra verarscht vor, während sie das Oberteil weiterhin eingehend mustert. „Jedenfalls,“ fährt Nadja fort, „haben die Amis schließlich von einem bestimmten synthetischen Stoff, der leider bislang nicht in großen Mengen hergestellt werden kann, Fäden in einige Kleidungsstücke reingewoben, ich glaube in irgendein bestimmtes Muster. Und dazwischen immer wieder Metallplättchen, die sie aus japanischen Werkstätten, die sonst Katanas herstellen, importiert haben.“ „Du erzählst mir doch was vom Pferd, oder?“ „Nein! Es war ja auch unheimlich teuer für die Amerikaner, weil der synthetische Stoff so schwer herzustellen ist und weil es so schwer war, das Metall durch die Blockade zu kriegen. Es gibt eine Handvoll solcher Kleidungsstücke und die halten die Amerikaner streng geheim.“ „Und eins davon ist bei Dir gelandet, ausgerechnet in diesem Laden.“ Jetzt sieht Nadja Petra von unten herauf böse an und schürzt die Lippen. „Unterschätze niemals meine Kontakte.“ „Ist ja gut...Du willst mir also erzählen, dieses Ding kann Kugeln abfangen?“ „Jedenfalls soll es das bis zu einem gewissen Grad können. Die Amerikaner haben die Teile nur leider nie wirklich eingesetzt. Aber in den Manövertests hat’s geklappt.“ Petra nimmt das Oberteil in die Hand und wiegt es langsam in der Hand. Es ist tatsächlich minimal schwerer. „Ich sollte erwähnen, daß die Amerikaner Wirksamkeit bei Maschinenpistolen und MGs ausschlossen.“ „Naja, Nadja, ich weiß ja nicht. Obwohl, im Zweifelsfall würde es auch keinen Unterschied machen...Wieviel?“ „Laß mal. Teste das Teil, dann trägst Du eh schon das Risiko.“ „Ok, danke.“ Petra verstaut das Oberteil in ihrem Rucksack, nachdem sie es kurz an ihren Körper gehalten hat, um sicherzugehen, daß es ihr auch paßt. „So, ich glaube das wär’s. Dank Dir, Nadja. Bis bald.“ Sie schenkt Nadja noch ein Lächeln und verläßt dann den Laden. Nadja schaut ihr noch nach und meint dann auf Polnisch mehr zu sich selber: „Verdammt Petra, natürlich arbeitest Du wieder für ihn.“ Und hängt dann noch gleich einen polnischen Fluch hintendran. Ziemlich gestreßt läßt sich Stefan im Stuhl an seinem Tisch im Gemeinschaftsbüro von ihm und Karo hängen und starrt die Decke an. Erst in der Nacht ist er aus Moskau zurückgekehrt, hat ein paar Stunden geschlafen, gegen zehn Uhr eine Art Frühstück-Mittagessen, dann eine dreistündige Stabssitzung. Und die hat er gerade hinter sich. Die Situation läßt sich etwa so zusammenfassen: An der Hauptfront ist die Lage ruhig (sieht man mal von den Kämpfen zwischen Russen und Schweden um Sankt Petersburg ab), aber auf anderen Gebieten ist die Lage schwierig. Drei Spezialbataillone erholen sich in Anatolien und auf Sizilien gerade von den schweren Kämpfen, die seit Mitte September auf dem Balkan und im südlichen Italien getobt hatten. Eines wird bald aus den Niederlanden evakuiert, womit die Alliierten die dortigen Positionen dann endgültig aufgegeben hätten. Dies ist eine jener Entwicklungen, die Stefan erst recht ärgern. Denn der Rückzug der Alliierten aus den Niederlanden erfolgte nicht, weil man die schlechteren Waffen oder weniger zahlreiche Truppen hatte. Nein, die dortige Niederlage ergab sich vor allem aus den dauernden Streitigkeiten zwischen den niederländischen, exildeutschen und britischen Kommandeuren und der daraus mangelnden Abstimmung der Verteidigungsmaßnahmen. Und mittendrin hing ein ganzes „Schimäre“-Spezialbataillon. Über so unnötige Niederlagen hätte sich Stefan aufregen können. Was hätte ein Sieg in den Niederlanden nicht alles eingebracht! Und was würde die Niederlage dort in Zukunft nun alles kosten! Im Gegenüber sitzt an ihrem Schreibtisch Karo; die beiden Schreibtisch stehen direkt aneinander. Jetzt fragt Karo nur: „Und?“ Er hebt den Kopf. „Wie und?“ „Ja, was sagst Du? Deine Entscheidung...“ „Ach, Du hast erstmal richtig entschieden...“ Sich im Stuhl aufrichtend vergräbt er sein Gesicht kurz in seinen Händen, dann legt er diese flach auf die Tischplatte, auf der Stifte, Blätter und ein Kalender herumliegen. Erst stößt er einen tiefen Seufzer aus, dann meint er: „Weißte was? Wir lassen Krammer die Nachricht zukommen, er soll nach der Evakuierung aus den Niederlanden einen Einsatz in Köln vorbereiten, um die Lage dort zu stabilisieren. Wie er das machen will und in welchem Zeitrahmen, überlassen wir ihm.“ „Da läßt Du ihm aber ganz schöne Freiheiten.“ „Tja, was soll ich machen? Krammer weiß am besten, wann seine Truppe wieder zu einem solchen Einsatz in der Lage ist.“ „Was ist mit der Idee, einen Voraustrupp nach Köln zu schicken, wie wir es damals im August gemacht haben?“ Stefan schüttelt den Kopf. „Wir sind zu weit weg. Das würde ewig dauern. Krammer ist näher dran. Als wir das im August gemacht haben, da verlief die Front auch noch an der Weichsel.“ „Stimmt. Hast recht.“ Karo kritzelt auf einem Notizblock mit einem Kuli herum. Eine Weile sieht Stefan ihr dabei zu. In solchen Momenten genießt er es, Karo anzusehen. Ihre leicht scharf geschnittenen Gesichtszüge mit dem schmalen, aber nicht unsinnlichen Mund, die heute nach hinten gekämmten und dort mit Spangen zusammengehaltenen dunkelblonden Haare... manchmal wünscht sich Stefan, er möge nichts anderes sehen. Es beruhigt ihn und hilft ihm, seine Gedanken zu ordnen. Irgendwann vor Jahren hatte er das Karo mal gesagt. Und sie hatte nur verschmitzt gelächelt und geantwortet: „Ich weiß.“ Ja, sie wußte es und sie wußte genauso, daß ihre Stimme eine ähnliche Wirkung auf Stefan hat. Schließlich bündelt Stefan seine Gedanken und kritzelt auf ein Blatt Papier ein paar Punkte. Dann steht er auf. „Was machst Du?“ „Ich werd‘ Silke die Befehle ausarbeiten lassen. Mir ist heute nicht danach, das selber zu machen.“ antwortet er und fügt hinzu: „Wozu hab ich sonst eine Adjutantin?“ Er öffnet eine kleine Nebentür, die zu einem kleineren Nebenbüro führt. Dort hat Oberfähnrich Silke Rüttel ihren Arbeitsplatz. „Oberfähnrich, würden Sie bitte einige Befehle ausarbeiten? Hier sind die Adressaten und die Punkte, die sie auf jeden Fall enthalten sollten.“ Er legt ihr das Blatt mit den Notizen auf den Tisch. „Ok, Herr General. Bis wann?“ „Morgen früh. Mit Datum von morgen.“ „Ist in Ordnung. Liegt morgen früh auf ihrem Schreibtisch.“ „Gut. Danke.“ Sie nickt. Hier bei „Schimäre“ bedanken sich die Generäle wenigstens hin und wieder. Als Stefan sich wieder an seinen Platz setzt, holt er aus einem Fach unten rechts im Schreibtisch eine Schreibmaschine. „So, ich werd jetzt erstmal einen kurzen Bericht der Besprechungen in Moskau zusammenstellen...“ „Soll ich mal in Moskau anrufen und mich über die Beschlüsse informieren?“ schlägt Karo vor. „Ne, laß mal. Das kann bis morgen warten. Falls sich nicht Suworow oder Rydz-Smigly von alleine melden.“ Er spannt ein Blatt Papier ein und fängt an zu tippen. Dann hält er inne. „Aber es würde helfen, wenn Du nochmal ein paar Statistiken bezüglich unserer Neurekrutierungen zusammenstellen könntest. „Ok, ich werd mal ins Zentrale Rekrutierungsbüro rübergehen.“ „Genauso hab ich mir das gedacht.“ Karo trinkt ihren Kaffee, der auf dem Tisch steht aus und steht dann auf. An der Tür bleibt sie nochmal kurz stehen. „Bleibt’s bei heute abend?“ „Sicher. Im Speisesaal, bring was zu trinken mit. Wann kommst Du?“ „Sicherlich etwas später. Ich treff mich vorher noch mit Tanja.“ „Aaaach sooo...“ meint Stefan gedehnt und mit einem vielsagenden Grinsen. Schon die ganze Nacht nieselt es und jetzt nieselt es immer noch. Der Himmel ist dunkelgrau, was schwer auf die Stimmung drückt, ebenso wie es die Umgebung überhaupt tut: Die bedrohlich wirkenden und von armseligen kleinen Siedlungen durchsetzten Wälder rund um Smolensk und auch die Stadt selber, die bei den Kämpfen Ende September Schäden davongetragen hat, strahlt eine ständige Anspannung aus. Die dagebliebenen Einheimischen schleichen wortkarg über die Straßen und auch das nur, um auf dem Markt sich mit Lebensmitteln einzudecken; diese bekommt man nur noch gegen Rationskarten. Und jeder wirft den kaiserlichen Besatzungstruppen mißtrauische Blicke zu – besonders nachdem vor einigen Tagen zahlreiche Schwarzuniformierte eingetroffen sind. Und seit dem die Gepos in Smolensk sind, sind auch schon die ersten Menschen verschwunden – ein Phänomen, das sich seit Kriegsbeginn überall im von den Kaiserlichen und ihren Verbündeten besetzten Europa wie ein Lauffeuer ausgebreitet hat. Aber nicht nur die Einheimischen fühlen sich durch die Besatzer bedroht, es ist auch umgekehrt. Seit sich das herbstliche Wetter in diesen Gefilden immer mehr verschlechtert – es regnet immer mehr und wird kälter, die unbefestigten Straßen (befestigte Straßen sind außerhalb der Städte hier Mangelware und selbst die Rollbahnen – wie man die Autobahnen hier nennt – sind nicht wirklich befestigt) werden zu grundlosen Morasten, die Luftwaffe hat kein gutes Flugwetter mehr – dämmert den kaiserlichen Soldaten, daß sie hier den Winter verbringen müssen. Es graut ihnen davor, denn die Gerüchte um Überfälle durch russische Partisanen und „Schimäre“-Kommandoeinheiten mehren sich. An die Schauermärchen über die bislang jedoch eher schlecht organisierten russischen Partisanen glauben viele, die nicht minder furchteinflößenden, weil so geheimnisumwitterten Spezialbataillone von „Schimäre“ tun aber viele als bloße Ausgeburt der Latrinenparolen ab. Solange, bis „Schimäre“ mal wieder zugeschlagen hat. Oberst Semmellag, dessen 63. Reichsinfanterieregiment Smolensk und den Frontabschnitt direkt östlich davon hält, ist sich selber nicht sicher, was er glauben soll. Erschreckt hat ihn der Überfall einiger „Schimäre“-Kämpfer auf den Feldflugplatz und die Radarstation Rudaki schon. Allerdings ist ihm auch nicht geheuer bei dem, was sich innerhalb der kaiserlichen Reihen zusammenbraut. Und da braut sich auf jeden Fall was zusammen. Gegen seinen Willen hatte man die Männer einer Gepo-Spezialeinheit mit dem Decknamen „Kronos“ in Smolensk stationiert. Angeblich hatten diese Männer eine Spezialausbildung durchlaufen, die selbst für Geheimpolizisten hart war. Mehr hatte man Semmellag nicht gesagt, auch nicht, was „Kronos“ hier zu suchen hatte. Auffallend freilich ist die Tatsache, daß alle „Kronos“-Kämpfer mit Schwertern oder Säbeln ausgerüstet sind – zusätzlich zu Handgranaten, Pistolen, Kampfmessern, Wurfsternen, Maschinenpistolen. Vielleicht erfahr ich ja jetzt mehr, denkt sich Semmellag, während er hier unter einem kleinen Vordach des flachen Hauptgebäudes des kleinen Smolensker Flughafens steht und beobachtet, wie eine Transportmaschine Ju52 auf der regennaßen asphaltierten Piste trotz des Nieselregens landet. Eine Wolke aus Wassertropfen aufwirbelnd rollt die Maschine aus und Semmellag wirft sich seinen Regenmantel über die Uniform und läuft hinüber zur Piste, wo das Flugzeug stehengeblieben ist. Dem Flugzeug entsteigt nur ein Passagier – ein Standartenführer der Geheimpolizei, eingehüllt in einen schwarzen Regenumhang, rechts im Gesicht eine Augenklappe, die ihn wie einen Piraten aussehen läßt. Der Mann bleibt vor Semmellag stehen und die beiden salutieren. „Oberst Semmellag?“ „Ja. Und wer sind Sie?“ „Standartenführer Oschmann.“ „Gut. Mir wurde gesagt, ich soll Sie zum Quartier der ‚Kronos‘-Einheit bringen.“ „Sehr gut. Ich bin der Kommandeur.“ „Bitte?“ „Ja, und ich habe umfangreiche Befugnisse. Aber lassen Sie uns erstmal zum Wagen gehen.“ „In Ordnung.“ Die beiden Männer gehen zum Hauptgebäude, durchqueren die Haupthalle und steigen auf der anderen Seite in einen wartenden dunkelblauen Pkw. Semmellag bedeutet dem Fahrer, loszufahren. Dann fragt er: „Also, was für Befugnisse?“ Oschmann zieht ein zusammengefaltetes Blatt Papier aus der Innentasche seiner Uniform. „Hier. Kommt direkt vom Oberkommando und wurde vom Armeekommando bestätigt. Sie haben mir in allen Unternehmungen größtmögliche Unterstützung zukommen zu lassen, Oberst.“ In Semmellag kommt ein Gefühl der Unruhe auf. „Standartenführer, was haben Sie vor?“ „Das kann ich Ihnen nicht sagen, Oberst. Aber Sie können sicher sein: Es ist wichtig für den Sieg.“ Semmellag wirft Oschmann einen eher zweifelnden Blick zu, sagt aber nichts. Schweigend erreichen sie den kasernenartigen Gebäudekomplex, in dem die Gepos der „Kronos“-Einheit untergebracht sind. Als der Wagen von den Wachen zu einem Parkplatz vor einem langgestreckten Flachbau durchgewunken worden ist und dort hält, betrachtet Oschmann kurz das Gebäude. Die weiße Außenfarbe blättert bereits ab. „Hören Sie zu, Oberst. Sie fahren jetzt wieder in die Stadt und tun Ihren Job: Die Front halten. Wenn ich etwas brauche oder etwas will, melde ich mich.“ „Und dann?“ „Dann werden Sie keine Fragen stellen, sondern tun was ich sage. Der Rest steht auf dem Papier, das ich Ihnen eben gegeben habe.“ Jörg Oschmann hebt zum Abschied die Hand. „Schönen Tag noch, Oberst Semmellag.“ Oschmann steigt aus und blickt in den grauen Himmel. Es regnet immer noch. Dann geht er ins Gebäude. Semmellag hat ein Gefühl, als hätte man gerade seine Seele an den Teufel verschachtert, als er mit dem Wagen das Gelände wieder verläßt. Oschmann betritt einen großen Hauptraum, in dem mehrere Reihen langer Tische mit Bänken stehen. Mehrere Grüppchen Geheimpolizisten tummeln sich hier, unterhalten sich, trinken was, spielen Karten. Im hinteren Teil des Gebäudes ist eine Theke für die Essens-und Getränkeausgabe. Im vorderen Teil ist ein Aufenthaltsbereich mit Billardtisch, Sitzecken und einem Radio. Dorthin wendet sich Oschmann, nachdem er seinen naßen Regenumhang an die Garderobe am Eingang gehangen hat. An einem kleinen Tisch direkt an einem Fenster sitzt dort Obersturmbannführer Ehrtens. Als er Oschmann auf sich zukommen sieht, springt er sofort auf und grüßt ihn mit erhobenem Arm – der Gruß der Geheimpolizisten untereinander. „Guten Tag, Standartenführer!“ „Guten Tag, Obersturmbannführer. Gut eingelebt?“ Beide setzen sich an den Tisch. „Ja, wir haben uns hier eingerichtet und auch schon einen Teil der Frontstellungen inspiziert.“ „Ich hoffe, in der angeordneten Tarnkleidung?“ „Ja, ja...“ sagt Ehrtens hektisch, „alle waren in Heeresuniformen vorne.“ „In Ordnung. Dieter, es wird bald los gehen, verstehen Sie?“ „Äh, Sie meinen, wir werden uns diesen Kerl krallen?“ „Ja, genau. Die Verbindung mit unserem Informanten steht. Wir müssen nur noch abwarten. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lange. Aber sobald wir die nötigen Informationen von unserem Informanten haben...“ Ein kaltes Lächeln breitet sich auf Oschmanns Gesicht aus und Ehrtens nickt: „Ich verstehe, Standartenführer...“ „Im wesentlichen sollte man allzu komplizierte Pläne im Kriege vermeiden. Gerade diese können allzu leicht sabotiert werden. Aber oft ist es zumindest nötig, Finten mit Finten zu verbergen, um überhaupt eine Chance auf den Sieg zu haben.“ Einer der taktischen Grundsätze von „Schimäre“ Es war schon spät am Nachmittag und es regnete, als sie, ganz in schwarz gekleidet, die rotgefärbten Haare über die Schultern naß über die Schultern fallend, an einer GepoStraßensperre bei Godorf im Süden Kölns auftauchte und mit leicht vom Körper gestreckten Armen, die Handflächen nach vorn, sowie mit einem triumphierenden Grinsen auf die Geheimpolizisten zuging. Hinter ihr hatte der Mietwagen gestanden. Sie zückte ihre Papiere und wie erwartet haben die Geheimpolizisten sie sofort festgenommen und erstmal ins GepoHauptquartier im Hansa-Hochhaus gebracht. Ganz nach Plan. Und jetzt sitzt Petra mal wieder in einem der Verhörräume, allerdings in einem andern. Und sie hat immer noch ihre normalen Sachen an. Ganz offenbar haben Trappert und Leikert zwar den Befehl erteilt, sie festzunehmen, wissen aber ansonsten nicht wirklich weiter. Jetzt wartet Petra und trommelt nervös mit ihren Fingern auf die Tischplatte. Nichtmal gefesselt hat man sie, wie es sonst üblich ist. Die Wache an der Tür ist auch nervös – eben weil Petra nicht gefesselt ist. Endlich geht die Tür auf und Leikert kommt rein. Langsam setzt er sich gegenüber von Petra an den Tisch. „Petra, wie geht es Ihnen?“ Mit einem sarkastischen Grinsen erwidert Petra: „Jetzt nennen Sie mich schon beim Vornamen. Neulich hieß es noch ‚Fräulein Müller‘.“ „Bitte sparen Sie sich Ihren Sarkasmus. Letzte Nacht hat ein Wahnsinniger in unseren Kellerräumen ein Gemetzel veranstaltet und irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, daß das auf Ihrem Mist gewachsen ist.“ „Ach?“ „Ja, genau: Ach! Also: Was sollte das?“ Petra lehnt sich vor, woraufhin die Wache an der Tür sofort ihre Hand auf die Pistole am Gürtel. Leikert bleibt seelenruhig. „Sturmbannführer...“ setzt Petra an. „Sie haben mir einen schwierigen Auftrag gegeben. Um diesen zu erfüllen, muß ich in die Nähe der Zielperson gelangen und das geht nur, wenn ich deren Umgebung infiltrieren kann. Klar?“ Leikert nickt. „Klar.“ „Die Aktion letzte Nacht hat dafür die Grundlage geschaffen. Gleichzeitig war das ein Warnschuß, für den Fall, daß Sie sich nicht an die Abmachungen halten.“ „Sie wollen uns drohen?“ „Nur warnen. Und jetzt wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mich wieder gehen ließen.“ „Ich weiß nicht, ob ich das tun kann. Eigentlich hätte ich nicht wenig Lust, Sie in einen Kerker zu werfen und die Schlüssel in den Rhein zu schmeißen.“ „Tun Sie es doch. Aber dann kann ich den Auftrag nicht ausführen und Ihr Vorgesetzter wird sehr sauer sein.“ Zerknirscht bemerkt Leikert nach einer kurzen Pause: „Scheiße, Sie haben recht. Also gut: Sie können gehen. Aber wir behalten Sie im Auge.“ Mit einem Nicken steht Petra auf und geht an der Wache vorbei aus dem Raum. Draußen auf dem Gang kommt sie an Trappert vorbei, der stehenbleibt und ihr hinterhersieht. Als Leikert aus dem Verhörraum kommt, dreht sich Trappert wieder um. „Sie lassen sie gehen?“ „Ja, Obersturmbannführer. Momentan haben wir keine bessere Alternative.“ „Doch: Wir hätten die Frau sofort hängen oder erschießen sollen.“ „Klar. Nur hätten wir dann einen weiteren Angriff von diesem Wahnsinnigen riskiert.“ „Und? Dann hätten wir ihn erschossen.“ „Nur habe ich das Gefühl, als wenn er nicht alleine käme...“ „Naja, eigentlich wollte ich Ihnen nur mitteilen, daß wir jetzt weitere Zielorte aus den Unterlagen, die wir im Bistro und in dem Friseursalon gefunden haben, herausfiltern konnten. Übernächste Nacht müßten wir so weit sein, daß wir dem Agentennetz weitere Schläge versetzen können. Irgendwelche Einwände, Leikert?“ Aber Leikert schüttelt den Kopf, was Trappert fast schon überrascht. „Nein, keine. Aber was auch immer passiert: Zumindest die Müller müssen wir dann entkommen lassen, damit sie ihren Auftrag erfüllt.“ Das Licht ist gedämpft, geht nur von ein paar Kerzen aus. Auf einem Tisch stehen zwei Kästen Bier, einige Flaschen Spirituosen und ein paar Flaschen Cola. Ein anderer Tisch in der Mitte des Speisesaals der Herberge ist umringt von mehreren Stühlen. In der Mitte des Tisches stehen die Kerzen. Ein Mann tritt in den Lichtkreis und legt einen Stapel Spielkarten auf den Tisch. Es ist Kapitän zur See Philipp Kipshoven. Ein weiterer tritt an den Tisch. Hauptmann Markus Orth, der mehrere Gläser abstellt. „Wieviele brauchen wir?“ „Warte mal...“ Philipp überlegt. „Stell ruhig noch ein paar hin. Lieber zuviel als zu wenig.“ „Wer kommt alles?“ „Oh, Hauptmann Siggi Gehlfahrt, Jacke, Marco Konrad, Mansfeld, Conny, der exildeutsche Verbindungsoffizier Pick, Schoeps und später noch Karo.“ „Waren nicht mehr eingeladen?“ „Ja, aber der Rest hat keine Zeit. Karo kommt später, weil sie sich vorher noch mit Tanja trifft.“ „Äh?“ „Ja, ihre neue Lebensgefährtin.“ „Achso, die Pilotin.“ „Ja, genau die.“ Philipp tritt zwei Schritte zurück. Irgendwas fehlt noch. Da geht die Tür zum Speisesaal auf, Licht flutet herein und Silke Rüttel bringt zusammen mit Denise Neunzig eine große Kiste. Und Philipp weiß, was fehlte: Das Geschenk für Stefan, der heute 30 geworden ist. Philipp, der noch in seiner Uniform rumläuft, weil er bislang nicht dazu kam, sich umzuziehen, deutet auf einen anderen Tisch. „Oberfähnrich, dorthin mit dem Ding!“ „Jo, ist klar, Kapitän!“ „Ok...danke.“ Die beiden Frauen stellen die Kiste auf den Tisch. Philipp wendet sich wieder an Markus. „Markus, ich bin nochmal auf meinem Zimmer, um mich umzuziehen. Solche Abende verbringe ich immer gern in vollem Ornat. Und wenn ich wieder runterkomme, hätte ich gerne irgendwas krachiges als Musik.“ „Alles klar.“ Markus schnappt sich den Stapel Kassetten, der neben einem Hörspielgerät liegt und geht sie durch. Alles krachiger Punkkram, von dem er üblicherweise nicht viel hält. Philipp begibt sich unterdessen nach oben. Die Tür geht wieder auf. „Oberfähnrich Rüttel?“ erkundigt sich eine junge Frau mit braunen, über die Schultern fallenden Haaren und den Rangabzeichen einer Gefreiten. Markus schaut kurz auf. Er erkennt sie wieder; seit ein paar Wochen arbeitet sie als eine der Offiziersanwärter im „Schimäre“-Generalstab, genauer: in der C-Abteilung. „Ja, bin hier!“ meldet sich Silke Rüttel. „Was gibt’s denn, Gefreite?“ „Sie sollen sofort zum Chef ins Büro kommen.“ „Ja, komme.“ Silke verläßt zusammen mit der Gefreiten den Raum und geht an der Rezeption vorbei zum Büro. Die Gefreite öffnet die Tür. „General, ich habe Oberfähnrich Rüttel gefunden.“ Stefan knöpft sich gerade ein schwarzes Hemd zu, daß er zu einer schwarzen Jeans angezogen hat. „Wunderbar. Oberfähnrich, was halten Sie davon, wenn wir beide morgen so gegen 11 Uhr die vordere Stellung der Aufklärungsabteilung besuchen.“ „Um 11 Uhr losfahren oder da sein?“ „Da sein. Rufen Sie am besten an, ob das denen da recht ist. Ich würde meinen Besuch gerne um 11 Uhr in der Stellung von Frakers Pionieren beginnen.“ „Ist klar. Wird sofort erledigt.“ Silke geht weiter in ihr kleineres Büro, während Stefan mit den Worten „So, ich hab jetzt erstmal frei!“ an der Gefreiten, die immer noch in der Tür steht, vorbeitritt und die Tür zuzieht. Als er sich der Tür zum Speisesaal nähert, hört er von drinnen bereits die dröhnenden Klänge einer Rammstein-Platte. Kein Zweifel, das ist Philipps Werk. Als er die Türen zum Speisesaal aufstößt, dreht sich eine Gestalt wie frisch aus der Gruft zu ihm um: Lange dunkle, gewellte Haare, die über die Schultern fallen, bleich geschminktes Gesicht, langer schwarzer Mantel, darunter schwarzes Hemd und schwarze Lederhose, schwarze Kampfstiefel, Ketten an dem Nietengürtel, Nietenbänder an den Handgelenken, Drachen-und Totenkopfringe, davon an einer Hand ein Gelenkring – Philipp im klompetten Ornat, wie er es nennt. Stefan schließt die Türen hinter sich und geht auf Philipp zu. Sie reichen sich die Hand. „Abend, Ratte, alter Kämpfer!“ grüßt Stefan Philipp bei dessen altem Kampfnamen. Und Philipp antwortet ebenso: „Abend, Rabe, alter Kämpfer!“ Und dann lächelt Philipp, daß sich seine falschen Vampirzähne zeigen, woraufhin Stefan seine von Natur aus stärker hervorstehenden Eckzähne bleckt – so als ob er sagen wollte (und er will es ja auch): Alter Kumpel, ich hab immer noch die echten Beißerchen serienmäßig! Dann meint Philipp: „Komm, wir setzen uns und warten auf die andern.“ Er macht eine einladende Handbewegung zu dem Tisch mit den Kerzen hin. „Gute Idee.“ stimmt Stefan zu. „Wenn die meisten eingetroffen sind,“ kündigt Philipp an, „dann kannste Dich an Deinem Geschenk vergreifen.“ Stirnrunzelnd sieht Stefan seinen besten Kumpel seit fast 30 Jahren an. „Geschenk? Wer zum Teufel hat euch gesagt, daß ihr mir was schenken sollt?“ Achselzuckend erwidert Philipp: „Nu zier Dich nicht so! Und tu nicht so, als wolltest Du kein Geschenk!“ „Is ja gut....“ murmelt Stefan, während er sich hinsetzt. Orth holt die erste Cola-Flasche rüber. „Chef, ich denke Du fängst mit Cola an.“ „Ja, fürs erste.“ Markus schenkt sich und Stefan je ein Glas Cola ein und schiebt das für Stefan zu diesem rüber. Dann setzt er sich, während Philipp sich eine Bierflasche holt und diese erstmal aufmacht. „Danke Markus.“ Bis vor kurzem haben sich Stefan und der Kommandeur der einzigen Panzertruppe von „Schimäre“ noch gesiezt, aber spätestens seit einigen wilden Gefechten in der zweiten Septemberhälfte sind sie gute Freunde. Schon vorher hatten die beiden freilich Achtung voreinander, denn Orths tollkühne Aktionen haben schon so manche Schlacht mitgeprägt. Und Achtung oder so etwas ähnliches vor Stefan haben die meisten „Schimäre“-Soldaten schon deshalb, weil der General in den meisten Schlachten zumindest zeitweise ganz vorne mit dabei ist. Stefan besieht sich die Karten näher an. „Philipp, was schlägste vor?“ „Maumau?“ „Nicht Dein Ernst!“ faucht Markus. Philipp hebt eine Augenbraue und meint dann, nach einem Schluck von seinem Bier: „Poker?“ Stefan nickt. „In Ordnung. Annehmbar.“ „Schon allein, weil Du kein Skat kannst...“ witzelt Markus, während sich Philipp eine Zigarette ansteckt. In dem Moment geht die Tür auf und Siggi Gehlfahrt und Marco Konrad kommen rein. Siggi ist 40 und ein alter Kumpel von Stefan; er dient in der Werkstattruppe von „Schimäre“. „Hallo Leute!“ grüßt er und verzieht das Gesicht angesichts der krachigen Musik. Stefan gibt Philipp einen Wink und er dreht die Lautstärke was runter. Unterdessen begrüßt Stefan die beiden und Marco Konrad wirft Markus ein kleines Plastiktütchen zu. „Hab ich gerade noch so beschaffen können. Seitdem die Niederlande überrannt sind, sind die Schmuggelsysteme für das Zeug dem Zusammenbruch nahe.“ Einmal schnuppert Markus dran, dann nickt er anerkennend. „Riecht gut. Stefan, wir dürfen doch...?“ Stefan mustert das Tütchen, grinst dann aber. „Sicher. Solange ich nicht dran ziehen muß.“ Alle lachen und Markus macht sich daran, den ersten Joint zu drehen. Jetzt trudeln auch die anderen ein, zuletzt Schoeps. Conny, die sich direkt zu Marco und Markus gesellt hat, um auch was vom Haschisch abzukriegen, ruft Schoeps direkt zu: „Schoepsi, der letzte mischt die Karten!“ „Ah, was, was soll das?“ faucht Schoeps, mischt die Karten dann aber doch. Alle sind in Zivil da, keiner in Uniform; die wird in letzter Zeit ohnehin von allen viel zu viel getragen. Die meisten hatten Stefan schon früher am Tag zum Geburtstag gratuliert; nur Oberleutnant Pick, der Verbindungsoffizier der Exildeutschen Armee, hat noch nicht gratuliert. Stefan und er haben sich nebeneinander gesetzt und unterhalten sich. „General, herzlichen Glückwunsch erstmal.“ „Danke, Oberleutnant.“ erwidert Stefan lächelnd. „Aber bitte: Heute abend Stefan für Sie.“ „Ok. Ist nur ungewohnt.“ „Wir haben ja sonst auch fast nur dienstlich zu tun. Sagen Sie, wie geht’s eigentlich ihrer Verlobten?“ „Ja, ich hab sie gestern besucht, es geht ihr gut. Wenn es sich einrichten läßt, wollen wir möglichst bald heiraten.“ „Ja, hoffentlich kommt nicht schon wieder eine Schlacht dazwischen; zum Glück hat Mira die letzten Schlachten heil überstanden.“ Pick nickt. „Ich stehe jedes Mal Todesängste aus, wenn ich mir vorstelle, daß Mira in forderster Linie mitkämpfen muß!“ Stefan stößt einen Seufzer aus und wendet dann ein: „Tja, Mira hat es sich selber ausgesucht, als sie sich freiwillig gemeldet hat.“ „Bin fertig!“ ruft Schoeps und hält die Karten hoch. „Ok, dann können wir ja anfangen!“ freut sich der inzwischen eingetroffene Mansfeld, der ein wahrer Fan solcher Kartenspiele ist. „Ok, Pick, wenn Sie demnächst Mira wiedersehen, bestellen Sie Grüße von mir...“ meint Stefan noch und Pick stimmt dem zu. Dann meint Stefan: „Philipp, verteil mal die Getränke, bevor wir anfangen!“ „Aber sicher!“ Philipp stellt schon jedem Bier, sich Whisky und Stefan eine Flasche Wodka mit Glas hin. Einer der Vorteile, daß man nun in Russland ist: Man hat immer guten Wodka parat! Markus dreht derweil die Musik ab und Philipp schlägt vor: „Vielleicht sollte unser Geburtstagskind jetzt mal sein Geschenk auspacken...“ „Ja, gute Idee!“ stimmt Conny zu, der Marco gerade den Joint reicht. „Is ja gut, is ja gut...“ beschwichtigt Stefan, steht auf und geht zu der Kiste rüber. Die anderen stellen sich drum herum, während Stefan die Kiste öffnet – und dann klappt seine Kinnlade ungläubig runter. „Mein Gott, wo habt ihr...?“ „Wir haben zusammengelegt.“ erklärt Christian Jacke und nimmt noch einen Schluck Bier, bevor er hinzufügt: „Auf der Karte stehen alle, die gespendet haben.“ Die Karte liegt oben auf dem Mantel in der Kiste; Stefan nimmt sie in die Hand und überfliegt sie. Zwei Dutzend Namen, fast alle von „Schimäre“, einige auch von der Exildeutschen Armee und sogar Marschall RydzSmigly, der alte Gauner. Nun legt er die Karte beiseite. Und holt den Mantel aus der Kiste. Ein langer schwarzer Ledermantel. Philipp grinst breit, daß man seine falschen Vampirzähne sieht. „Chef, ich weiß doch, daß Du schon lange einen haben willst.“ Nickend erwidert Stefan: „Ja, seit Jahren.“ Schon streift er den Mantel über. „Jap, paßt.“ Wieder greift er in die Kiste und holt nun ein Nietenarmband hervor. Vierreihig. Er legt es um den linken Unterarm an. Und dann greift er wieder in die Kiste und holt zwei Tokarew-Pistolen hervor, die bereits in zwei Halftern, die man am Gürtel befestigen kann, stecken. Kopfschüttelnd meint Stefan, völlig fassungslos: „Mensch Leute, ihr seid verrückt...wirklich...vielen Dank!“ „Gern geschehen...“ murmelt Mansfeld und Philipp meint: „Naja, nachdem Dir schon Dein letzter Geburtstag durch die Kaiserlichen versaut wurde, dachten wir, es würde Dich freuen.“ „Tut es, Philipp, tut es.“ Die Tokarews legt er neben die Kiste und dreht sich dann um. „Ok, Leute, laßt uns allmählich anfangen...“ „Gute Idee!“ stimmen alle zu, um sich dann auf die Stühle rund um den Tisch mit den Kerzen zu verteilen. Stefan schenkt sich ein Glas Wodka ein und erhebt es dann: „Also, Freunde, ich möchte euch danken! Trinken wir auf die Freiheit!“ Und mit einem Lächeln raunt er Philipp zu: „Wenn Chrissi das jetzt sehen würde, sie würde sich furchtbar aufregen.“ Sichtlich erheitert gibt Philipp ein heiseres Lachen von sich, während alle anstoßen. Stefan kippt seinen Wodka in einem Zug weg. Unterdessen hocken Stabshauptmann Kruse und Obergefreiter Bleck im Keller wieder an den Empfängern und durchforsten den Äther. Seit Bleck neulich einen seltsamen Funkspruch aufgefangen hat, sind sie alarmiert. Denn bislang konnte die Dechiffrierabteilung von Major Fischer den Code von diesem Funkspruch nicht knacken. Beim nächsten will man genau aufpassen und ihn – wenn möglich – triangulieren. Aber bislang: Fehlanzeige. Langeweile macht sich breit. „Meine Güte, würde ich gern oben mit Karten spielen und saufen...“ seufzt Kruse. Bleck sieht ihn von seinem Platz aus an. „Waren Sie denn eingeladen?“ „Ja, aber Sie sehen ja, Bleck, ich muß Schicht schieben.“ Achselzuckend erwidert Bleck: „Tja, dumm gelau-...“ Er bricht ab. „Stabshauptmann, da ist es wieder!“ „Ok!“ Mit einer Hand geht Kruse auf die selbe Frequenz und hält sich dann den Kopfhörer an sein eines Ohr, greift mit der anderen Hand zum Telephon und ruft seine Kollegen in einer Horchstation der Exildeutschen Armee an. „Leute, wir habens!“ Und dann gibt er die Frequenz durch, während Bleck weiter mitschreibt. Die Kollegen vom exildeutschen Horchposten haben inzwischen, das weiß Kruse, denn es wurde vorher abgesprochen, polnische und russische Horchposten kontaktiert. Hoffentlich können alle das Signal auffangen – denn dann ist die Triangulation möglich. Was freilich erst noch etwas dauern wird. „Scheiße!“ faucht Bleck und schreckt Kruse aus seinen Gedanken hoch. Tatsächlich: Das Signal ist wieder weg. „War das lang genug?“ fragt Kruse seinen Kollegen am Ende der Leitung. Der überlegt kurz. „Hoffe schon. Wir müssen erst hören, ob Polen und Russen es aufgefangen haben...“ Kurz darauf: „Ja, sie haben es!“ „Ok, dann laß uns mit der Triangulation beginnen.“ meint Kruse und grinst breit. Jetzt würde man den mutmaßlichen Spion finden. Linda Meier-Grolman steht am Fenster ihres Appartements im Dorinth-Hotel; die Lichter sind bis auf einen jener neumodischen Deckenstrahler ausgeschaltet. Das Wohnzimmer hat einen weinfarbenen Teppich, gelbliche Tapete, ein Glastisch, um den herum ein Sofa und ein Sessel gruppiert sind, steht in der Mitte, auf einer Kommode ein Radiogerät. Und das große Fenster läßt den Blick über den Friesenplatz schweifen, den man von hier, vom ersten Stock aus, einigermaßen gut sehen kann. Normalerweise. Aber jetzt ist es schon sehr spät am Abend und sehr dunkel. Und die Behörden haben seit dem Kriegseintritt Großbritanniens eine noch striktere Verdunkelung angeordnet. Zwar beschränken die Briten ihre Luftangriffe bislang auf Ziele in den Niederlanden, Flandern und Nordfrankreich – sofern sie nicht ohnehin durch die französischen Luftangriffe auf Ziele in Süd-und Mittelengland beschäftigt sind. Aber man weiß ja nie. In Linda selber nagt eine ganz andere Ungewißheit. Trotz des nur schwachen Lichtes des Deckenstrahlers sieht sie ihr Spiegelbild auf der Scheibe. Ihre beige-farbenen Haare fallen locker über ihre Schultern. Sie ist nicht unattraktiv und des öfteren haben männliche Widersacher sie schon unterschätzt. Kaum einer vermutet, daß sie so ziemlich die ranghöchste „Schimäre“-Agentin in Köln mit der Codenummer 1 ist. Nichtmal ihr Ex hat es vermutet – er war Standartenführer und Gepo-Chef von Köln. Erst im August erkannte er im Augenblick seines Todes, auf welcher Seite Linda wirklich steht. Ihre Tarnung als Chefin des Dorinth-Hotels – sie konnte damals nur knapp aufrechterhalten werden. Aber wenn diese Nacht vorbei ist, würde die Tarnung endgültig am Arsch sein. In der Spiegelung sieht Linda auch schemenhaft Sarah Alleker hinter sich stehen. Sie hatte gerade gemeldet, daß dieser geheimnisvolle Ben und seine am Abend neu aufgetauchte Bekannte – Petra hatte sie sich genannt – aufgebrochen seien, um Waffen zu besorgen. „Bist Du sicher, daß wir den beiden trauen können?“ fragt Linda. Nicht sehr überzeugend antwortet Sarah: „Ich glaube schon.“ Nach einer kurzen Pause fügt sie zögernd hinzu: „Haben wir denn eine Wahl?“ Ja, hatten sie denn eine Wahl? In der selben Nacht, in der die Gepos Sarahs Versteck stürmten, hatten sie auch die vier wichtigsten Waffenlager des Agentenrings aufgespürt. Ganz offenbar bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen bezüglich der von den Gepos in Kathrins früherem Friseursalon und im Rothschild erbeuteten Unterlagen. Ganz zu schweigen von den harschen Kontrollen, denen zwei Agenten niederen Ranges in die Fänge gerieten. Wer weiß, was sie den Gepos erzählen werden. Marco Schlund, ein weiterer getarnter Agent, hat in seiner Physiotherapeutenpraxis bereits alle Unterlagen vernichtet. Und noch heute Nacht würden sie Köln räumen. Da es zu befürchten steht, daß es dabei zu Feindkontakten kommt, brauchen sie Waffen. „Stimmt Sarah. Wir brauchen die Waffen, die die beiden besorgen können. Verdammt...Wenn wir unseren Exodus bei Nacht durchziehen, werden wir wegen der Ausgangssperre auffallen.“ „Aber tagsüber gefährden wir zu viele Zivilisten.“ „Ja, ich weiß.“ Linda fallen die Regentropfen auf der Außenseite der Scheibe auf. Es ist, als weine der Himmel. „Ok, Sarah, sag mir bescheid, wenn die beiden wieder kommen.“ „In Ordnung.“ Sarah verläßt das Appartement. Sie fühlt sich nicht gut. Die Anspannungen der letzten Tage wirken sich aus. Und ihre Ängste, schon wieder den Gepos in die Hände zu fallen, wird sie nicht los. Im August war sie in Gefangenschaft geraten und hatte in einem der berüchtigsten Gepo-Lager die Ankunftsprozedur, die durchaus Elemente der Folter enthielt, über sich ergehen lassen müssen. Im Übrigen ist sie sich gar nicht so sicher, ob man Ben und Petra trauen kann. Lediglich eine weitere Vision ihrer toten Schwester hatte ihr dies zugesichert. Christiane hatte nie viel für Gothics übrig. Wenn sie sagt, man kann Leuten aus diesen Kreisen trauen, dann mußte es stimmen. Oder? Die Zweifel nagen an Sarah. „Ich staune immer wieder über Dich.“ stellt Ben fest, als Petra im Keller des Hauses, in dem sie nahe dem Friesenplatz bislang wohnte, einen Schrank zur Seite schiebt und dahinter noch ein größerer Raum verborgen ist. Ganz offensichtlich haben die Gepos ihre Wohnung und ihren Keller nicht allzu gut durchsucht. „Du wirst noch mehr staunen Ben, ich hab auch den Kram, den Du im Sommer angeschleppt hast, hierher gebracht.“ „Habs mir schon gedacht.“ Ben erinnert sich, wovon sie spricht: Von Waffen und Ausrüstung, die er im Frühsommer mitgehen ließ, um seinen Hals während der preußischen Niederlage im Rhein-Maas-Feldzug zu retten. Er hatte die wenigen Panzer, die die preußischen Truppen hier im Westen hatten kommandiert und sich in dieser Zeit immer wieder über darüber aufgeregt, daß die preußischen Panzer nicht so gut sind wie die kaiserlichen. Und auch darüber, daß man sie taktisch falsch einsetzte. Lieber hätte er bei „Schimäre“ gedient – er wußte, daß dort inzwischen selbständige und taktisch kühn geführte Panzertrupps existierten, die man zu einem Regiment zusammengefaßt hat. Ja, das war eher nach seinem Geschmack! Vor allem waren die Panzer dort technisch den kaiserlichen Panzern zumindest gleichwertig, hatte man sich die Konstruktionspläne doch bei erbeuteten kaiserlichen Panzern abgekupfert. Aber ein Dienst bei „Schimäre“ war jetzt nicht mehr in so weiter Ferne wie zuvor. Zwar hatte Petra ihm nicht alles gesagt, aber sie hatte genügend durchblicken lassen. Sie betreten den Lagerraum. Zahlreiche Kisten stehen hier. Petra und Ben legen ihre Rucksäcke ab, holen aus diesen je eine Brechstange und hebeln dann die Kisten auf. „Ben, such mal die Kiste mit Deiner alten Uniform!“ „Hab sie schon! Lag zu oberst!“ Er holt die Uniform heraus. Die Uniform eines preußischen Panzermanns – und eine solche ist schwarz. Nur geringfügig unterscheidet sie sich von den schwarzen Uniformen der Geheimpolizei (diese weisen freilich eine rote Armbinde mit dem doppelköpfigen Reichsadler auf). „Meinst Du wirklich das klappt?“ fragt Ben zweifelnd. Petra zuckt die Schultern. „Wenn auch nur die geringste Möglichkeit besteht, daß man Dich für einen Gepo hält, sollten wir sie nutzen.“ „Na gut.“ stimmt Ben zerknirscht zu. Ihm schmeckt der ganze Plan der Widerständler nicht – viel zu sehr auf elegant und möglichst wenig Feindkontakte getrimmt. Da wäre ihm die einfache Hau-druff-Tour lieber. „Na los, zieh die Uniform schon an!“ „Ist ja gut...“ Während er sich umzieht, öffnet sie weitere Kisten. Und erkennt entsetzt, daß sie gar nicht alles mitnehmen können. In den Kisten hat sich einiges angesammelt: Pistolen inklusive Magazinen, ein Maschinengewehr, vier Maschinenpistolen, sicherlich ein halbes Dutzend Handgranaten, sogar zwei Tellerminen. In der letzten Kiste sind schließlich zwei Kampfmesser, ein Schwert und ein Scharfschützengewehr. Unterdessen hat sich Ben umgezogen und schaut jetzt verunsichert den Stahlhelm seiner Uniform an. „Sag mal, Petra, ich glaub Gepos haben keinen Stahlhelm oder?“ „Du mußt ihn ja nicht aufsetzen. Nimm das Barett.“ „Ok, gute Idee. Hast Du zufällig ein paar Magazine für meine beiden P38?“ „In der Kiste da drüben.“ Sie deutet auf eine Kiste nur wenige Meter neben Ben, neben der der weggehebelte Deckel liegt. Ben greift in die ausgepolsterte Kiste und holt sich mehrere Magazine heraus. Dann entdeckt er in der selben Kiste auch eine Luger – und zwar eine Spezialanfertigung mit Schalldämpfer als Aufsatz. Eine Waffe für ein Attentat. Hatten die Gepos Petra nicht als mutmaßliche Attentäterin festgenommen? „Petra, woher ist die?“ Sie schaut zu ihm rüber und mustert die Waffe. „Ach, keine Ahnung. Hab sie nie gebraucht, kannste ruhig haben.“ „Ok. Danke.“ Gut ausgewichen. Aber wenn das hier vorbei ist, würde er sie fragen, was an der Sache dran ist. Er konnte sich Petra zwar nicht wirklich als feige Attentäterin vorstellen, aber in Zeiten wie diesen ist fast alles möglich. „Ok, was nehmen wir alles mit?“ fragt Ben. Am liebsten würde er ja alles mitnehmen – aber selbst er muß sich gewissen physikalischen Gesetzmäßigkeiten beugen, die zum Beispiel besagen, daß jeder Soldat nur ein gewisses Gewicht an Waffen tragen kann... Petra läßt ihren Blick über die geöffneten Kisten schweifen. „Naja...die Handgranaten, die Pistolen, die MPis, inklusive der Magazine würde ich sagen. Ja, die Messer auch noch.“ „Ich hätte aber gerne noch das Maschinengewehr.“ wendet Ben ein. Petra hockt sich neben die Kiste mit dem MG und wiegt es kurz in ihren Händen. „Aber nur wenn Du es schleppst.“ meint sie. „Ok. Und was ist mit dem Scharfschützengewehr?“ „Da haste recht, das können wir mitnehmen.“ Sie holt das Gewehr aus der Kiste und dann auch das Schwert. Es steckt in einer Scheide, die einen Gurt hat, damit man sie sich wie eine Tragetasche umlegen kann. Im Ernstfall muß Petra nur über die Schulter greifen, um das Schwert herausziehen zu können. Sie legt sich das ganze um, dann packen sie und Ben die Rucksäcke voll. Petra wuchtet den Rucksack auf den Rücken. „Scheiße, ist das schwer!“ Dann schultert sie das Gewehr. „Ben, bastel aus den beiden Minen eine Sprengfalle, um den Raum zu sichern!“ „Alles klar.“ Er schleppt seinen Rucksack und das Maschinengewehr aus dem Raum und geht dann zurück, um die Minen und seine Sachen, die er eben noch an hatte, zu holen. Die Sachen legt er zum Rucksack und dann macht er sich an die Arbeit, mit Hilfe eines Drahtes eine Sprengfalle zu konstruieren, die hochgehen würde, wenn jemand diesen Raum ungebeten betreten will... Sarah betritt das Parkhaus des Dorinth-Hotels. Es ist fast 23 Uhr und kalt. Parkhäuser mag sie gar nicht. Sie sieht sich kurz um, dann sieht sie die drei Lastwagen, die man organisiert hatte. Schnellen Schrittes eilt sie hinüber. Dort warten bereits Katrin Schmiegeld und ihr Mann Joschi, Marco Schlund, Jenny, Dominik Kipshoven sowie Mike Backhausen, der die Lastwagen beschafft hat. So wie er sie auch schon vor über einem Monat mal beschaffte, damit man befreite Häftlinge wegschaffen konnte. Mike verabschiedet sich gerade. „Also Leute, meine Tarnung steht noch! Ich werde hier bleiben die Laster als gestohlen melden.“ „Ok, alles klar. Danke für die Hilfe.“ Schlund schüttelt Backhausen die Hand, dann geht letzterer. „Leute, gleich geht’s los!“ meint Sarah, als sie die anderen erreicht. „Wir müssen nur noch kurz warten, bis die andern alle Papiere im Hotel vernichtet haben.“ In der Tat! In einem Papierkorb in ihrem Büro verbrennt Linda gerade die letzten Dokumente, die noch auf ihre Tätigkeit als Agentin hindeuten. In ein paar Minuten würde sie ins Parkhaus gehen und dann würden sie Köln verlassen. Das schwierigste würde sein, durch die GepoSperren am Stadtrand zu kommen. Aber dort würde ihnen ein Trupp Widerständler von außen helfen. Hoffentlich haben Simon und Sabine alles hingekriegt, schießt es ihr durch den Kopf. Eben erst hat man an alle die Waffen verteilt. Zum Glück hatte Petras Waffenlager genug hergegeben. Vor der Tür warten Ben und Petra – bis an die Zähne bewaffnet. Das MG haben sie bereits auf die Ladefläche von einem der Lastwagen gebracht. Irgendwo war es doch eine gute Idee von Ben gewesen, das Teil mitzunehmen. Am Körper selber tragen sie Messer, Handgranaten, jeder zwei Pistolen (ok, Ben hat noch die Luger mit Schalldämpfer als dritte Knarre!) und beide tragen ihre Schwerter. Petra hat vorsichtshalber noch das Oberteil, das Nadja ihr angedreht hatte, unter einem schwarzen Hemd angezogen und darüber einen langen schwarzen Mantel geworfen. Ihre rotgefärbten Haare fallen offen über ihre Schultern. Ben hat seinen Mantel einfach über die Uniform angezogen, sein Schwert hängt am Gürtel. Insgesamt ist er wie stets mit seinen über 1,90 (er selber sagt immer, es sei nahe an 2 m, was wir hier mal ungeprüft stehen lassen...) eine hervorragende Gestalt. „Mir gefällt das nicht.“ meint er zum wiederholten Male. Petra wirft ihm nur einen säuerlichen Blick zu. Sie weiß was er meint. Am liebsten würde er sich einfach aus der Stadt schießen. Aber die Devise heißt: Feindkontakte und Schießereien minimieren. Irgendwo kommt ein seltsames Gefühl in Petra auf. Und dann, wie ein Schlaglicht, sieht sie vor ihrem inneren Auge in die Eingangshalle und zur Rezeption gehen. Nach dem Bruchteil einer Sekunde ist das Bild wieder weg. „Ben, warte hier!“ Sie wirbelt herum und geht den Korridor entlang und zum Aufzug. Unterwegs holt sie unter ihrem Mantel die MPi hervor, im Aufzug lädt sie die Waffe durch. Der Aufzug liegt im hinteren Bereich der Eingangshalle; hier tritt Petra raus. Neben dem Aufzug stehen Chris Loewisch und Andreas Beiß. Beide drehen sich überrascht um. „Nanu, was wollen Sie denn hier?“ fragt Chris. „Ich hab ein ungutes Gefühl.“ Petra geht an ihnen vorbei und begibt sich hinter einer großen Yuka in Deckung, schaut um die Ecke in den Hauptteil der Halle, wo die Rezeption ist und von wo man auch ins Hotelrestaurant kommt. Tatsächlich stehen da zwei reguläre Polizisten und drei Gepos und debattieren mit dem Stellvertretenden Hotelleiter. Andreas tritt neben sie und sieht es auch. „Scheiße...“ flucht er leise. Dann meint er: „Ich gehöre ja noch zum Personal hier. Ich werd mal nachfragen, was los ist.“ „Gute Idee. Ich warne Ben und die Meier-Grolman.“ Er nickt nur zurück und dann geht Petra wieder zurück zum Aufzug. „Kommen Sie mit!“ meint sie im Kommandoton zu Chris, die sich allmählich fragt, wer diese Frau eigentlich ist. Auch, wenn sie meint, sie irgendwo schonmal gesehen zu haben. Andreas geht rüber zu den Polizisten, die immer noch mit dem Stellvertretenden Hotelleiter diskutieren. Der sieht Andreas wie eine Rettung nahen. „Ah, da ist der Chef unseres Hausservice. Vielleicht weiß er mehr.“ Andreas bleibt bei der Gruppe stehen und begrüßt die Polizisten. „Guten Abend, wie kann ich Ihnen helfen?“ „Wir haben zwei unbekannte Personen in diesem Gebäude verschwinden sehen.“ „Oh. Das kann aber nicht sein. Unsere Gäste und unser Personal halten sich an die Ausgangssperre. Schließlich wollen wir keinen Ärger mit den Behörden unseres großartigen Kaisers.“ Trief. Das sollen die erstmal verarbeiten! Andreas hat sein höflichstes Lächeln aufgesetzt. Hoffentlich merken die nicht, daß unter seinem Hemd eine Pistole im Gürtel hängt. Ein Gepo drängelt sich am Polizisten vorbei. „Jetzt hören Sie mal! Wir wollen gefälligst dieses Hotel durchsuchen. Denken Sie daran – wir haben das Sagen.“ Einen resignierenden Seufzer stößt Andreas aus, dann meint er: „In Ordnung, aber lassen Sie mich vorher noch mit der Hotelleiterin sprechen – sie muß es absegnen.“ „Damit können wir leben.“ beschließt einer der Polizisten. „Gut, warten Sie bitte hier.“ Andreas dreht sich um und geht zurück zu den Aufzügen. Er fährt nach oben, eilt dann durch die Korridore Richtung Lindas Büro. Die andern kommen ihm schon entgegen. „Und?“ fragt Chris hektisch. „Naja, wir müssen uns beeilen. Ich hab Zeit geschunden so gut es ging, aber in ein paar Minuten dürften die Typen nervös werden und mal wieder mit einer ‚Anti-Terroristen-Razzia‘ beginnen.“ „Dann sollten wir abhauen!“ meint Ben und geht voraus Richtung Treppenhaus. Seine schmerzenden Rippen erinnern ihn an die eine Stunde Folterung im Gepo-Hauptquartier und er war nicht scharf darauf, herauszufinden, was diese Typen außer ihrem Standardrepertoir noch auf Lager haben. Ganz und gar nicht. Flucht durchs Treppenhaus! Und dann im Eilschritt durch das Parkhaus. Dort laufen die letzten Vorbereitungen. Rucksäcke mit den nötigsten Ausrüstungsgegenständen und Klamotten werden auf die Ladeflächen geworfen, die Nummernschilder abgeschraubt. Da die Laster alle schwarz lackiert sind, wirken sie dadurch wie die entsprechenden Fahrzeuge der Gepos. „Leute, seid ihr soweit? Wir müssen weg hier!“ ruft Linda ihnen zu. „Verteilt euch auf die Laster! Dominik, Du fährst mit dem Motorrad!“ In den einen Laster klettern Linda, Chris, Marco Schlund und ein eben erst eingetroffenes Mitglied vom Widerstand, Patrick Rieger; letzterer geht ans Steuer. In einen zweiten Laster begeben sich Katrin, Joschi, Jenny und Andreas, der am Steuer sitzt. Der letzte Laster wird von Ben gesteuert, zusätzlich sind noch Petra und Sarah an Bord. Es ist der Laster mit dem Maschinengewehr hinten auf der von einer Plane überdachten Ladefläche. Dominik Kipshoven schwingt sich auf sein Motorrad. Und dann fahren sie los. Ben vorneweg, damit man vielleicht noch ohne Schießerei aus dem Parkhaus kommt – alle hoffen, daß die Wachen an der Ausfahrt seine Uniform für eine Gepo-Uniform halten. Die Wachen an der Ausfahrt halten die Laster an. Ein regulärer Polizist kommt bei Ben an die Fahrertür. „Wohin wollen Sie? Wir haben Ausgangssperre.“ „Gepo-Transport einiger Gefangener.“ lügt Ben. Was besseres fällt ihm so schnell nicht ein. „Das glaub ich Ihnen nicht.“ Der Polizist stellt sich auf das Trittbrett an der Fahrertür und beäugt Ben mißtrauisch. „Das ist doch gar keine Gepo-Uniform! Komm schon, fahr wieder zurück und ich vergess-...“ Weiter kommt er nicht. Ben packt ihn mit einer schnellen Bewegung an der Kehle und schleudert hin zur Seite, zieht dann seine Luger und feuert mehrere kaum hörbare Schüsse auf die anstürmenden anderen Polizisten während er mit durchgetretenem Gaspedal durch die Schranke und auf die Straße jagt. Lenkrad rumgekurbelt und eingedreht Richtung Friesenplatz und dann in einer scharfen Kurve auf den Ring eingeschwenkt, Richtung Süden. Sarah auf dem Beifahrersitz stockt der Atem, Ben hat das ganze Manöver in wenigen Sekunden hingelegt. Und die andern Laster folgen nach. Aus dem Dorinth-Hotel kommen die Gepos herausgerannt – jetzt haben sie’s gemerkt! „Lady, können Sie das Ding fahren?“ „Ja...ja...“ stottert Sarah. „OK, dann fahren Sie! Hat Linda die Strecke mit Ihnen durchgesprochen?“ „Äh...ja...“ „Ok. Ich geh nach hinten und kümmere mich um das MG.“ „Is gut.“ Ben öffnet die Fahrertür, klettert auf das Trittbrett. Sarah rutscht auf seinen Platz und übernimmt das Steuer, derweil er das vordere Ende der Plane zur Seite klappt und auf die Ladefläche klettert. „Ok, Petra, laß uns das MG klarmachen.“ „Bin schon dabei.“ „Gut, bald kommt Besuch...“ Trappert will gerade sein Büro verlassen, denn es ist ein langer Tag gewesen. Da klingelt das Telephon. Er bleibt kurz in der Tür stehen, flucht und geht dann (ohne das Licht anzumachen) zurück zum Schreibtisch und nimmt den Hörer ab. „Ja?“ Sehr sauer klingt er. „Obersturmbannführer, so eben sind mehrere Laster aus dem Parkhaus des Dorinth ausgebrochen! Sie rasen mit fast 100 Stundenkilometern über die Ringe Richtung Süden!“ „Scheiße!“ Trapperts Gedanken rasen. Dann: „Ok, haltet sie auf! Das sind die Terroristen, die wir suchen, jede Wette! Setzt alles ein, ruft auch das Heer zur Hilfe.“ „Zu Befehl!“ Trappert knallt den Hörer auf die Gabel und schlägt beim Verlassen des Büros die Tür hinter sich zu. Auf dem Korridor begegnet ihm Leikert. „Kommen Sie, Sturmbannführer!“ „Ne, hab Feierabend...“ „Nein, haben Sie nicht. Unsere Lieblingsgegner sind wieder aufgetaucht.“ „Bitte?!“ Sie gehen zusammen zum Aufzug und als sich dessen Türen schließen, meint Trappert: „Ja, und sie rasen mit 100 Sachen Richtung Süden.“ Das einzig gute an der Ausgangssperre sind die freien Straßen ohne Gegenverkehr oder störende Straßenbahnen und Fußgänger. Man kann richtig Gas geben. Die beiden Laster, die von Andreas und von Rieger gesteuert werden, überholen am Rudolfplatz den dritten Laster, damit Ben und Petra mit dem MG freie Schußbahn nach hinten haben. Man hat sich kaum neu angeordnet, als aus man über den Zülpicherplatz brettert, wo aus der Zülpicherstraße heraus ein Polizeiwagen hervorgeschossen kommt, den vordersten Laster von Andreas seitlich rammt und zur Seite drängt. Rieger tritt das Gaspedal durch und rammt von hinten den Polizeiwagen, schiebt ihn vor sich her. Barbarossaplatz. Die Straße macht hier eine leichte Biegung. Die Laster machen diese mit, wodurch sich der Polizeiwagen wieder löst und durch den Zusammenstoß stark beschleunigt in die Fensterfront der Stadtsparkasse auf der nächsten Ecke rast. In einem Regen aus Putz, Mörtel und Glasscherben kommt er arg demoliert zum stehen. Die Laster rasen weiter. Neben Andreas Beiß sitzt auf dem Beifahrersitz Jenny. „Weißt Du, was mir gerade einfällt?“ beginnt sie. „Nee, was denn?“ „Linda hat was von der Vorgebirgsstraße gefaselt, oder?“ „Ja – und?“ „Die zweigt direkt vom Sachsenring ab. Das wird eine ganz scharfe Kurve.“ Die Worte sickern langsam in Andreas‘ Hirn. Scharfe Kurve. Tempo 100. Beides Dinge, die nicht gerade zur Koexistenz befähigt sind. Scheiße! Naja, in wenigen Augenblicken werden sie es wissen. Dominik fährt auf seinem Motorrad voraus, um die Lage zu checken, doch der eigentliche Angriff erfolgt von hinten. Aus einer Seitenstraße rast auf einmal ein Gepo-Lastwagen und hängt sich an den Konvoi dran. Nur leider ist er nun direkt vor Bens Visier. Gerade erst hat Petra den Gurt ins MG eingelegt, jetzt drückt Ben ab. Funken sprühen, als der Laster vom Dauerfeuer mit fast Tausend Schuß pro Sekunde zerlöchert wird. Der Laster schert nach links aus und säbelt mehrere Straßenschilder und eine Laterne um, bevor er in eine Häuserfront aus Geschäften und Lokalen kracht, wankt und schließlich in Flammen aufgeht. „Munition?“ fragt Ben nur. Und Petra meldet: „Noch einen Reservegurt!“ Ja, viele Gurte hatten sie in der Tat nicht auftreiben können. Dominik erreicht als erster mit dem Motorrad die Vorgebirgsstraße, die fast senkrecht nach Südwesten hin abbiegt; er schwenkt in sie ein und rast die Straße entlang. Sie ist nicht ganz so breit wie die Ringe und an den Seiten parken mehr Autos. Und: Etwa 300 m weiter vorne steht ein Streifenwagen der regulären Polizei. Und dahinter zwei Polizisten, die Pistolen im Anschlag. Und sie feuern! Dominik schwenkt an einer Parklücke nach links, rast nun über den Bürgersteig, zieht seine MPi, die er am Gurt über die Schulter hängen hat, hoch und feuert. Das zwingt die Polizisten in Deckung, während er an ihnen vorbeizieht. Hinter ihm haben die Laster die Kurve gekriegt, sind nur am Anfang kurz an einigen parkenden Autos funkensprühend vorbeigeschrammt und haben ein paar Seitenspiegel mitgenommen. Im vordersten Laster bemerkt Andreas jetzt den die Straße versperrenden Polizeiwagen. Und tritt das Pedal durch. „Was nicht paßt, wird passend gemacht...“ knurrt er. Jenny schaut nur schockiert zwischen dem Mann mit den kurzgeschnittenen Haaren in seinem Geschäftsanzug (den er nicht mehr wechseln konnte) und dem Polizeiwagen hin und her, der jetzt immer näher kommt. Und zwar rasend schnell. Jenny sieht zwei Gestalten zur Seite springen und dann – Rums!! Rammt der Laster mit voller Wucht den Polizeiwagen und schiebt diesen vor sich her. Der Wagen überschlägt sich mehrmals, die Scheiben und Scheinwerfer zerspringen. Erst als die nächste größere Straße ihre Route kreuzt, wird der Wagen seitlich abgedrängt und bleibt knirschend und scheppernd auf offener Straße liegen, während die Lastwagen vorbeirauschen. Im Gepo-Hauptquartier herrscht rege Aufregung. Während Trappert seinen Dienstwagen vorfahren läßt, holt Leikert in der Funkzentrale noch schnell die neueste Lagemeldung ab. Trappert wartet vor dem Hansa-Hochhaus schon mit laufendem Motor, als Leikert angerannt kommt und ins Auto springt. Es hat wieder angefangen zu regnen. „Und?“ „Naja, sie sind uns mal wieder entwischt.“ knurrt Leikert. „Die wollen Richtung Süden.“ „Scheiße.“ „Wieso?“ Trappert sieht Leikert mit einem beinahe flehenden Blick an. „Naja, ich weiß, was die da wollen! An der südlichen Stadtgrenze endet unser Einsatzbereich – ohne Genehmigung von oben dürfen wir dort nicht weiter hinter denen herjagen!“ „Und was ist mit unsern Bonner Kollegen?“ „Seit dem Desaster von Sechtem mögen die uns nicht und bestehen auf die Genehmigung. Wenn die im Süden eine unserer Sperren durchbrechen – tja, dann verlieren wir sie endgültig. Es dauert mindestens zwei Stunden, bis wir dann die Genehmigung haben, selbst wenn wir uns jetzt drum kümmern.“ „Und, was machen wir jetzt?“ „Hoffen, Leikert, hoffen. Ich hab inzwischen einen Trupp Kradschützen auf sie angesetzt...“ Trappert fährt los – mit Vollgas. Die Vorgebirgsstraße endet an einem großen runden Platz, auf dessen einer Seite der Eingang des Südfriedhofs liegt und in dessen Mitte ein begrüntes Rondell von der Schleife einer Straßenbahnendhaltestelle umgeben ist. Hier kommen nun über einen kleinen Weg, der von Süden her heranführt, mehrere Kradschützen angerast. Sie kommen direkt von der Kaserne beim Heeresamt im Stadtteil Raderthal und gehen nun auf dem Rondell und beiderseits davon in einem Halbkreis um den Ausgang der Vorgebirgsstraße in Stellung. Die Gewehre und Maschinenpistolen im Anschlag. Alle rechnen mit Lastwagen, die ihnen ins Netz gehen sollen. Doch was kommt? Ein Motorradfahrer. „Feuer frei!“ Dominik fliegen die Kugeln um die Ohren, sein Reifen und der Tank werden getroffen, die Maschine rutscht ihm unter dem Arsch weg – aber das rettet sein Leben. Die Maschine löst sich von ihm und schliddert funkensprühend über den Asphalt, während Dominik liegen bleibt. Als der Tank in einer kurzen Verpuffung Rauch speit, springt er hinter zwei parkenden Autos in Deckung. Sofort peitscht ein Gewehrschuß durch die Scheibe der Beifahrertür und eine MPiGarbe haut direkt neben Dominik in den Bordstein. Er lädt seine MPi durch, wirbelt herum und feuert über die Motorhaube des Wagens hinweg zurück, läßt sich dann wieder in Deckung fallen und nimmt erstmal den Motorradhelm ab. „Scheiße, man, Scheiße...“ keucht er. Und dann erinnert er sich an die zwei Handgranaten, die er mitgenommen hat. Eine holt er aus der Tasche, wartet. Als er die Laster ankommen hört, zieht er den Stift und schleudert das Ei rüber zu den Kradschützen. Die Granate detoniert genau in dem Moment, als der erste Laster angerast kommt und schlingernd nach links zieht, um Richtung Brühler Straße abzubiegen. Die Explosion wirbelt eine der kaiserlichen Kräder durch die Luft und zersprengt erstmal die in Stellung gegangenen Kradschützen. Dominik springt auf und sprintet los. Der letzte Laster kommt gerade durch. Dominik rennt und – springt. Klammert sich ans Hinterende der Ladefläche, während einige der Kradschützen hinter ihnen herfeuern. Die Kugeln prallen funkensprühend ans Metall der Laster und reißen Löcher in die Plane. Dominiks Beine schleifen schier endlose Sekunden über den Asphalt, dann packt Ben ihn und zieht ihn endgültig an Bord. Da wird Dominik von einem Schlag getroffen und ein scharfer Schmerz durchzuckt ihn am Rücken, rechts an der Seite. Schmerzerfüllt stöhnt er auf. „Scheiße, er ist getroffen!!“ zischt Ben und legt Dominik weiter vorne auf die Ladefläche. „Petra, kümmer Dich um ihn!“ „Alles klar.“ Ohne auf das Schlingern des Lasters zu achten, als dieser in eine weitere Kurve geht, denn nun haben sie die Brühler Straße erreicht, entkleidet sie Dominiks Oberkörper. Wieder keucht er vor Schmerz auf. „Dreh Dich um, verdammt!“ faucht Petra und dreht ihn zur Seite. „Gratuliere, hast nur eine Fleischwunde direkt über ner Rippe.“ Nach kurzem Zögern fügt sie hinzu: „Glaube ich zumindest.“ Ein neues Motorengeräusch läßt sie herumwirbeln. Sie sieht, wie sich die Kradschützen mit ihren Motorrädern an ihre Fersen heften. Und Ben macht gerade das MG schußbereit. Als er abdrückt und mit seiner Salve die Kradschützen auseinandertreibt und auf Abstand zwingt, schnappt sie sich den Reservegurt und legt ihn sofort ein, als der erste Gurte verfeuert ist. „Sei sparsam, Ben!“ Er blickt sie nur kurz an – eine Unaufmerksamkeit ist schon zuviel! Zwei Kradschützen rasen heran und feuern mit Maschinenpistolen. Die Garben zerlöchern die Plane, die sich über das Gestenge über der Ladefläche wölbt, Querschläger surren durch die Gegend, schlagen funkensprühend gegen Metall. Ben und Petra werfen sich flach auf die Ladefläche, Petra spürt einen heißen Lufthauch am Bein – knapp vorbei! Mühsam unterdrückt sie ihre Angst. Der Laster macht einen Schlenker, um einer auf die Reifen zielenden Garbe erfolgreich auszuweichen. Ben springt sofort wieder ans MG und verfeuert den restlichen Gurt, aber die Kradschützen weichen geschickt aus; nur einer wird getroffen und von seinem Motorrad geschleudert, das daraufhin seitlich wegrutscht und in die Auffahrt des Heeresamts schliddert, wo sie gerade vorbeikommen. Aber eine unbestimmte Anzahl Kradschützen hängt noch an ihnen dran. „Ich hab was von sparsam gesagt!“ krächzt Petra. Ein Motorrad rast an ihnen vorbei. Und noch eins. Ein schürfendes Geräusch ist zu hören. Ben zieht seine beiden P38 und geht direkt am Ende der Ladefläche in die Hocke und feuert auf drei andere Kradschützen, die gerade in Reichweite kommen. Die Tatsache, daß es Nacht ist, macht das ganze nicht zwingenderweise einfacher. Petra springt zur Seite, als jemand von oben durch die Plane feuert – das schürfende Geräusch: Einer war aufgesprungen! Und Ben muß zur Seite springen, als einer der Kradschützen zurückfeuert. Sofort feuert mit einer Pistole zurück und trifft einen der Gegner am Arm, woraufhin der Kradschütze zurückfällt und aus dem Sichtfeld verschwindet. Petra blickt schwer atmend nach oben. Keine weiteren Schüsse? Nimmt der Typ etwa an, er hätte volle Arbeit geleistet? Sie nimmt ihre Pistole und drückt sie Dominik in die Hand. „Wenn was anderes wieder da runter kommt als ich – dann erschieß den Kerl!“ Dominik nickt nur, während Petra die Plane vorne am Führerhaus zur Seite schiebt und an der Strebe nach oben klettert. Oben angekommen, sieht sie den Feind sofort: Seine MPi nachladend, um durch die Decke des Führerhauses zu schießen. „Hey, Arschloch!“ Überrascht dreht sich der Mann um – da tritt ihm Petra schon gegen den Brustkorb. Mit einem Keuchen taumelt der Kradschütze zurück, schwebt einen Augenblick in der Luft am Laster vorbei und verschwindet dann mit einem Brüll in die Richtung, die die Gravitation vorgibt: Nach unten. Petra wirft einen Blick zum Laster vor ihnen. Die Laster folgen nun mit unverändert hohem Tempo einem geraden Straßenverlauf, der Fahrtwind läßt ihr Haar und ihren Mantel flattern. Sie sieht seltsame Bewegungen auf der Ladefläche des anderen Lasters – zwei Leute zuviel! Offenbar haben zwei Gepos den Laster gekapert und der Fahrer und Beifahrer – also Rieger und Schlund – haben nichts davon mitgekriegt. Ein schneller Blick nach hinten. Keine weiteren Schüsse. Ob Ben die anderen Kradschützen vertrieben hat? Egal! Petra klettert an der Beifahrertür runter; als sie die Tür öffnet, erschreckt sich Sarah mit einem leisen Aufschrei. „Keine Angst – ich bins! Fahr ganz dicht an den anderen Laster ran!“ Sarah nickt nur und gibt Vollgas. Mit ausgeschalteten Scheinwerfern die Entfernung abzustimmen ist auch nicht gerade einfach. Sarahs Pulsschlag rast. Petra ist derweil wieder aufs Dach geklettert und sieht, wie sie dem anderen Laster immer näher kommen. „Verdammt!“ schießt es ihr durch den Kopf, „Du hast Dir einfach zu viel vom Raben abgeschaut! – Ach scheiß drauf!“ Als der Laster fast den Vordermann rammt, nimmt Petra zwei Schritte Anlauf – und springt! Mit einem harten Ruck landet sie beim andern Laster auf der Plane, krallt sich kurz an diese, um Halt zu finden. Ein Atemzug, zwei Atemzug – Gedanken sortieren! Zwei Schüsse peitschen direkt vor ihrem Gesicht durch die Plane! Verdammt! Auf der Ladefläche steht einer der Kradschützen. „Hab ich ihn erwischt?“ „Keine Ahnung...“ nuschelt der andere, der mit einer Pistole Linda und Chris in Schach hält, die er erstmal entwaffnet hat. Allerdings ist er immer noch über den Tritt gegen das Schienbein sauer, den Chris ihm verpaßt hat. Am liebsten würde er beide erschießen. „Scheiße, wären wir doch Gepos!“ „Wieso?“ „Dann könnten wir einfach kurzen Prozeß machen und vielleicht auch noch...“ Mit einem vielsagenden Grinsen schaut er an Chris herab. Sein Kamerad schaut jetzt auch wieder auf die beiden Frauen. „Verstehe...“ Beide denken das selbe: Zumindest die eine ist echt süß... Da schwingt sich ein Schatten hinten durch die Verladeöffnung und tritt dem einen Soldaten genau zwischen die Schulterblätter. Der Mann torkelt, verliert seine Waffe und kriegt dann genau Lindas Knie in die Fresse. Sein Kamerad wirbelt herum, will auf den Schatten feuern, sieht aber nur eine Klinge aufblitzen, die ihm den Schädel spaltet. Ein Schubs – er landet auf der Straße, Sarah weicht mit einem Schlenker aus. Der zweite Soldat rappelt sich wieder auf, aber Chris hat sich wieder ihre Pistole geschnappt und hebt diese. „Lustmolch!“ Und drückt ab. Zwei Schritte macht der Mann nach hinten, dann verschwindet er jenseits der Ladefläche und der letzte Laster macht wieder einen Schlenker... Petra steht schweratmend vor Linda und Chris. „Und, alles in Ordnung.“ „Jetzt ja.“ meint Chris. „Danke für die Hilfe.“ „Nicht der Rede wert...“ keucht Petra. „Hab ja sonst nichts besseres zu tun...“ „Was ist Kunst? Und ist Kriegskunst wirklich Kunst? Oder noch genauer: Ist das Handwerk des Scharfschützen wirklich ein Handwerk? Oder einfach nur feiger, grausamer Mord? Tatsache ist, daß es filigranste Detailarbeit ist, die den Scharfschützen in seiner Konzentration in einen ungemein klaren und übersichtlichen Bewußtseinszustand, der Leere nahe, aber nicht mit ihr identisch, versetzt. Schade, daß es nicht konstruktiver eingesetzt wird.“ Bemerkung von General Reiss gegenüber der Journalistin Reindl,Ende September 1788 Ein leichter Wind geht und jagt Regenböen über die Felder. Allmählich dringt die Näße auch durch die letzte Klamottenschicht von Sabine Granrath. Mit geschwärztem Gesicht liegt sie auf dem Dach eines Bauernhauses unweit der Stadtgrenze zwischen Köln und Hürth, dicht an den Karmin geschmiegt. Durch das Zielfernrohr ihres Scharfschützengewehrs beobachtet sie die Straßensperre, die gerade noch auf Kölner Gebiet liegt und die Brühler Landstraße blockiert. Die körperliche Anspannung nimmt mit jeder Minute zu. Wieder sieht sie ein Glimmen aufleuchten. Einer der Wachposten raucht. Sehr gut. Bald wird es losgehen. Hoffentlich verstehen die Widerstandskämpfer, die Simon aus Bonn geschickt hat, auch wirklich was von ihrem Handwerk. Naja, zumindest zur Inszenierung dieses Ablenkungsangriffs wird es reichen. Nur das Timing wird schwierig. Sie müssen genau im richtigen Zeitpunkt angreifen, wenn sie dem Lastwagenkonvoi den Durchbruch ermöglichen wollen. Und dann muß man hinterher auch noch die Insassen der Laster verschwinden lassen... Sabine nimmt kurz das Gewehr vom Typ M03 A4 runter, dann legt sie neu an. Sonst schläft ihr noch der Arm ein. Das Gewehr ist ein Import aus amerikanischen Fabriken. Sabine schwört auf diese Waffe, hat damit noch jedes Ziel getroffen. Nicht ohne Grund hat sie einen Ruf als beste Scharfschützin Europas – und als schönste noch dazu. In der Ferne sind Motoren und Schüsse zu hören. Dann wieder nur die Motoren. Und sie kommen näher. Zischend rast direkt vor der Sperre eine Leuchtkugel hoch und taucht Straße, Felder und die Sandsackstellungen der Wachen in gleißend helles, bläuliches Licht. Sabine ist sofort hochkonzentriert. Hat den Rücken eines aufgeschreckten Soldaten in der Sandsackstellung im Visier. Feuert. Sie sieht nicht mehr, wie der Mann getroffen zusammensackt, gleitet mit dem Blick durchs Fadenkreuz weiter, schießt auf den nächsten Gegner, der gerade über die Straße zu den Sandsäcken rennen will, trifft der Mann stürzt. Ein dritter, auf den sie schießt, springt in letzter Minute hinter einem Geländewagen in Deckung und eröffnet das Feuer auf den Trupp Widerstandskämpfer, der sich vom Straßengraben löst und ebenfalls feuert. Im letzten Aufflackern der Leuchtkugel feuert Sabine noch zweimal – in den Tank des Wagens, der dann auch direkt explodiert und nach einem Hopser brennend neben der Straße steht. Schnell lädt Sabine ein neues Magazin nach, während sich an der Straßensperre ein reger Schußwechsel entwickelt. Und da nähern sich die Laster! Mit wahnsinniger Geschwindigkeit. Sabine visiert wieder an. Einer der Wachposten hat sich in den anderen Straßengraben geflüchtet und feuert von dort aus mit einem Gewehr auf die Lastwagen, trifft eine Windschutzscheibe. Sabine feuert. Trifft den Mann aber nur an der Schulter, er zuckt im Schein der Flammen zurück. Die Laster durchbrechen die provisorische Holzschranke, Holzsplitter wirbeln durch die Luft! Trappert und Leikert erreichen mit dem Wagen die Straßensperre. Ein brennendes Auto steht am Straßenrand, die überlebenden Polizisten und Gepos tragen die fünf Leichen zusammen und verarzten einen Verletzten. Ein regulärer Polizisten kommt im Flammenschein zu den beiden hohen Gepos herüber. Trappert fragt sofort: „Sind sie entkommen?“ „Leider ja, Obersturmbannführer. Ein feindlicher Trupp hat uns abgelenkt und dann sind die Laster durchgebrochen.“ „Verdammt!“ flucht Trappert, aber Leikert sieht das Positive an der ganzen Sache: „Obersturmbannführer, das ganze hat auch was gutes: Zum einen müssen wir uns mit den Typen nicht mehr in Köln rumschlagen und die Müller ist auch wie geplant entkommen. Und zum andern haben wir jetzt eine neue Schlagzeile, mit der das Propagandaministerium die Bevölkerung gegen diese Terroristen aufhetzen kann...“ Als Trappert Leikert fuchsteufelswild ansieht, erlischt Leikerts Grinsen. „Sturmbannführer, wenn die Leute diese Schlagzeile lesen, werden sie höchstens über jemanden lachen – und zwar über uns!“ meint Trappert mit einer Wut und Kälte, gegen die selbst die Arktis warm ist. Wortlos wendet er sich um und geht wieder zum Wagen. Freitag, der 10. Oktober Mitternacht ist gerade durch, man hat von Rammstein auf das Nachtprogramm von Radio Moskau umgestellt und gerade teilt Philipp die Karten neu aus. Stefan schenkt sich noch etwas Wodka ein. Dann wirft er einen Blick auf seine Karten. Full House. Wunderbar! „Wo bleibt eigentlich Karo?“ wundert sich Schoeps. Jetzt schaut auch Stefan auf die Uhr. Allmählich merkt er, wie der Wodka wirkt. Aber auch ihm ist noch klar, daß Karo eigentlich schon überfällig ist. „Ist bestimmt noch mit Tanja beschäftigt...“ frotzelt Jacke. In dem Moment geht die Tür auf und Karo kommt rein, ganz in Zivil: Jeans, weißes T-shirt. Sie geht sofort rüber zu Stefan und flüstert ihm etwas ins Ohr. „Kann ich Dich kurz draußen sprechen...“ Er sieht sie an, dann erhebt er sich und steckt seine Karten ein. „Entschuldigt uns kurz.“ Er folgt ihr nach draußen. Philipp sieht dem stirnrunzelnd nach. „Da wird doch wohl nichts passiert sein...“ murmelt Siggi. Karo und Stefan gehen durch die Eingangshalle nach draußen. Die Luft ist schon recht kühl, auf der Straße sind Pfützen von einem kürzlichen Regenschauer. „Ok, Karo, was ist los? Hast Du Krach mit Tanja gehabt, oder was?“ „Nein. Dienstlich.“ Sie zündet sich eine Zigarette an. Da sie fröstelt, legt Stefan ihr den neuen Ledermantel um. „Danke.“ „Also, was gibt’s?“ „Nachrichten aus Bonn. Offenbar haben unsere Leute es geschafft, so ziemlich alle aus Köln rauszuholen.“ „Wie das denn?“ „Sie wollen einen detaillierten Bericht nachreichen. Anscheinend haben sie eine Straßensperre im Handstreich durchbrochen. Dabei haben wir einen Widerstandskämpfer aus Hürth verloren.“ „Und? Das ist doch wunderbar! Damit wäre das Problem erst einmal gelöst. Das wir jetzt erstmal keine Informationen über die Lage in Köln kriegen können ist doch nun wirklich das geringere Übel.“ „Ich weiß.“ „Was bist Du dann so aufgekratzt.“ „Philipps Bruder wurde angeschossen.“ Stefans Kopf ruckt herum: „Was?“ „Offenbar ist es nicht allzu schlimm, aber genaues wissen wir nicht.“ „Scheiße.“ „Ich würde vorschlagen, Du sagst es Philipp.“ „Ja, nur...wann?“ „Wie wärs mit jetzt?“ „Stimmt. Jetzt ist genauso gut wie später.“ Stefan atmet tief durch. „Ich haße das.“ „Ja...“ Karo lächelt gequält. „Verdammt Karo!“ Er ringt mit den Händen. „Wir haben im letzten halben Jahr einfach zu viele gute Freunde für nichts und wieder nichts verloren. Jolanda, Barnet, Ivanka, Christiane....“ „Jetzt krieg Dich wieder ein!“ faucht ihn Karo an. „Dadurch werden sie auch nicht wieder lebendig!“ Stefan setzt sich auf den Bordsteinrand, achtet nicht auf den feuchten Untergrund. „Ja, ich weiß...“ seufzt er. Sie setzt sich neben ihn und legt einen Arm über seine Schulter. „Komm schon, Chef. Willst Du jetzt etwa aufgeben?“ „Ach, ich weiß nicht... In solchen Momenten bin ich nahe der Verzweiflung. Wofür das alles?“ „Für die Freiheit...“ Er sieht sie von der Seite an. „Ein schöner Traum... Für den schon so viel Blut vergossen wurde. Ach, Scheiße man, ich fühl mich so leer...“ „Stefan, laß das Geheule. Was wäre die Alternative?“ Darüber muß er erstmal nachdenken. Dann nickt er. „Stimmt Die Alternative wäre unvorstellbar.“ Im Gedanken: Nämlich noch mehr Tod und Unterdrückung. „Na komm, General, wir sollten wieder reingehen.“ „Stimmt.“ Er steht auf, sie auch. „Ach, Stefan, eins fällt mir noch ein: Was ist eigentlich aus Petra geworden?“ „Welche Petra?“ „Müller. Die schwarze Fee.“ Stefan verzieht nachdenklich das Gesicht und atmet tief durch. „Keine Ahnung. Ich hab seit zwei Jahren nichts mehr von ihr gehört. Das letzte Mal hab ich was von ihr gehört, als ich mit ihr telephonierte, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren. Wie gesagt, das war vor... ja, das war sogar vor mehr als zwei Jahren, ich glaube fast vor drei. Während des Einsatzes in den Niederlanden. Da warst Du ja nicht dabei.“ Karo nickt. „Wieso, Karo?“ „Unsere Leute in Köln hatten wohl Helfer. Der Name Petra wird in der Funkmeldung erwähnt.“ „Naja, zutrauen würde ich es ihr. Aber mal ehrlich: Hat das nicht Zeit bis morgen?“ Lächelnd stimmt Karo zu. „Stimmt.“ Sie gehen wieder rein. An der Tür zum Speisesaal bleibt Stefan stehen. „Schick doch bitte Philipp raus.“ Stumm nickt Karo, dann geht sie in den Speiseraum. Momente später kommt Philipp raus. „Chef, was ist, wir wollen weitermachen.“ „Philipp, wir haben neues aus Köln und Bonn.“ „Ja – und?“ „Unsere Leute konnten aus Köln fliehen, aber bei der Aktion wurde Dein Bruder angeschossen.“ „Was?“ stöhnt Philipp. „Keine Sorge, es scheint nicht so schlimm zu sein. Sobald es was neues gibt, verständigen wir Dich.“ Philipp lehnt sich an die Theke der Rezeption. „Ja...äh..ich meine: In Ordnung. Danke, daß Du es mir gesagt hast.“ „Hey, ist doch selbstverständlich.“ Stumm nickt Philipp. „Soll Karo Deine Karten übernehmen.“ „Ne, laß mal Chef. Es geht schon. Das Kartenspiel wird mich ablenken.“ „Ok, dann komm...“ Beide gehen wieder in den Speisesaal. Während in Mittel-und Osteuropa das Wetter immer schlechter wird und bereits den Winter ankündigt, sind es in Rom noch angenehme 20 Grad. Nur eine leichte Brise weht, als die Ju52 auf dem Hauptrollfeld des Flughafens „Leonardo da Vinci“ aufsetzt. Die Ju rollt aus und hält dann vor einer Abordnung dunkelblau uniformierter Soldaten, die entlang eines roten Teppichs stehen und das Gewehr präsentieren. Dem Flugzeug entsteigen zunächst mehrere kaiserliche Soldaten in weißen Gala-Uniformen und nehmen gegenüber den dunkelblau Uniformierten Aufstellung. Dann entsteigt Kaiser Joseph II. dem Flugzeug, bleibt am Anfang des roten Teppichs kurz stehen. Auch er trägt Gala-Uniform, allerdings ohne Rangabzeichen. Er richtet seine Uniformmütze, damit die Sonne ihn nicht blendet, streicht sich mit der Hand über das frisch rasierte Kinn und mustert dann skeptisch die Reihe der Soldaten in blauen Uniformen. Es sind Soldaten des „Cohors pedestris Helvetiorum a sacra custodia Pontificis“, besser bekannt als Schweizergarde. Die 200 Mann starke persönliche Schutztruppe des Papstes. Selbstverständlich sieht Joseph nicht zum ersten Mal Soldaten dieser Truppe – nur bislang sah er sie immer in ihren Gala-Uniformen: Diese sind gelb-blau-rot gestreift, besitzen einen mittelalterlich wirkenden Brustpanzer, eine steife Halskrause und einen spanischen Helm inklusive Federbusch. Heute jedoch haben sie ihre Kampfuniformen an. Ein kleines Zugeständnis an die Realität. Denn es ist Krieg und jederzeit kann es sein, daß diese Truppe in den echten Kampfeinsatz muß. Seit Anfang September befindet sich der Kirchenstaat im Kriege gegen die Alliierten. Das bedeutete: Truppenhilfe in Stärke von drei Korps bei den Blitzfeldzügen in Norditalien (die zum Glück nach zwei, drei Wochen abgeschlossen wurden). Und ein eigener Feldzug gegen Neapel zu Lande und zu Wasser. Dieser ist freilich noch nicht ganz abgeschlossen – die Eroberung Siziliens muß erst noch bewerkstelligt werden. Doch französische und päpstliche Fliegergeschwader bomben die Insel derzeit sturmreif, während die päpstliche Marine zumindest im Norden und Osten eine Blockade aufrechterhalten kann. Dafür haben die Kaiserlichen extra das Ende September eroberte Korfu den päpstlichen Truppen als Marinebasis zur Verfügung gestellt. Auf diesem Treffen würde er sich mit Pius VI. über grundsätzliche weitere Kriegsziele einigen. Vor allem wird es darum gehen, wann man mit dem neuen Kreuzzug beginnen will, für den Joseph Pius seine Unterstützung zugesagt hatte. Die Gegenleistung hat Pius selber bereits erbracht: Er hat sich seit Kriegsbeginn im Sommer 1787 nicht mehr in die inneren Angelegenheiten des Reiches eingemischt und bei den Feldzügen in Norditalien geholfen. Jetzt wird er sicherlich einen möglichst baldigen Beginn des Kreuzzugs gegen Jerusalem verlangen, geht es Joseph durch den Kopf. Mein Gott, dabei paßt mir das gar nicht! Zwar war eine der strategischen Voraussetzungen dafür – die Eroberung Konstantinopels am 2. Oktober – bereits erfüllt. Aber Joseph wäre es lieber, wenn er vorher Ruhe an der Ostfront hätte. Und danach sieht es momentan nicht aus. Jetzt sieht Joseph eine große weiße Limousine, die durch ein Tor in dem Zaun, der den Flughafen umgibt, rollt, herankommen. Langsam fährt der Wagen, auf einer festgelegten Route, am langgestreckten, zweigeschossigen Hauptgebäude des Flughafens vorbei. Der Flughafen ist freilich seit dem Kriegseintritt des Kirchenstaates für die Öffentlichkeit gesperrt, daher stehen nicht wie sonst hunderte Touristen auf dem Dach, um die Aussicht zu genießen. Die Limousine ist vielleicht noch 50 m entfernt. Da explodiert der Wagen. Ein heller Lichtblitz zuckt an der Wagenunterseite auf, dann wird die Fahrgastzelle kurz in einen Feuerball eingehüllt und dann explodiert der Motor. Die Motorhaube fliegt in hohem Boden weg und landet scheppernd 100 m weiter auf dem Asphalt. Eine Hitze-und Druckwelle läßt Joseph und Soldaten sich ducken; sofort geht Josephs Eskorte mit den Gewehren im Anschlag in einem schützenden Kreis um ihn herum in Stellung, während die Schweizergardisten hektisch debattieren und einen Stoßtrupp von drei Mann zu dem Wagen rüberschicken. Dieser ist inzwischen ausgerollt und brennt lichterloh, die Flammen lassen die letzten Reste der Scheiben zerspringen und geben schrille Pfeiftöne von sich. Schauerlich. Schreckerfüllt blickt Joseph die brennende Limousine an. Da drin saß schließlich der Papst! Pius VI.! Mein Gott! Das kann er nicht überlebt haben! Ein Attentat? Was sonst! Es haben sich noch nicht alle vom Schrecken erholt, als eine der breiten Fenstertüren des Hauptgebäudes aufgeht und ein von weiteren Schweizergardisten umringter älterer Herr, schätzungsweise 70 Jahre alt, in weißer Kleidung mit gebogenem Stab und kleiner weißer Stoffmütze auf dem nur noch licht behaarten Kopf kommt langsamer näher. Alle richten sich noch mehr verwundert auf und mustern den Mann, der alle paar Schritte von einem Husten geschüttelt wird und schließlich die Gruppe erreich. Die kaiserlichen Soldaten weichen zurück und der Alte bleibt direkt vor Joseph stehen. Dann sagt er in bestem Englisch: „Eure Hoheit, Sie können jetzt den Mund wieder schließen. Ja, ich bin es, Pius VI.“ Irgendwo hinter sich hört Joseph etwas fallen. Er wirbelt herum. Einer der Schweizergardisten rennt davon, rüber zum Flugzeug, und hat dabei sein Gewehr fallen gelassen. Reflexartig reagiert Joseph: „Festnehmen!“ Der Mann ist schon fast an der Einstiegsluke der Ju 52, als auf einmal der kaiserliche Pilot vor ihm steht und dem Schweizergardisten kurzerhand die Pistole an die Stirn setzt. „Endstation, Kumpel!“ Der Schweizergardist hebt die Arme und läßt sich dann von zwei kaiserlichen Soldaten abführen, die ihn seinen Kollegen übergeben; diese wiederum treiben den Mann unter Schlägen und Tritten zum Hauptgebäude. Kaiser Joseph wendet sich wieder um zum Papst. „Hochwürden, würden Sie mir jetzt bitte... und ja, schön, Sie wohlauf zu sehen.“ „Danke.“ Der Papst deutet ein Nicken an. „Sein Komplize hat kalte Füße gekriegt und seinem Kommandeur Meldung gemacht. Wir wußten von dem Attentat.“ „Ok, alles klar. Eine Falle.“ „Genau.“ Pius lächelt milde. „Seine Exkameraden werden ihn angemessen bestrafen und Gott, unser Herr, wird sich seiner annehmen.“ „Da bin ich sicher.“ bestätigt der Kaiser. Mit einer einladenden Geste deutet Pius auf das Flughafengebäude. „Bitte folgen Sie mir doch, Hoheit. Ich möchte pünktlich zu einem Spektakel erscheinen, das wir extra zu Ihren Ehren auf den heutigen Tag gelegt haben.“ Schweigend durchqueren die beiden Männer, die zu den wichtigsten Anführern der Koalition gehören (der dritte wichtige Führer der Koalition ist der König von Schweden, der sein Königreich nach der Eroberung Norwegens und Dänemarks in Skandinavien umbenannt hat), die große Abfertigungshalle. Vor dem Haupteingang wartet bereits eine weitere weiße Limousine. Der Vatikan ist reich, man hat einen großen Fuhrpark. Nachdem Joseph und Pius sich hinten in die gegenüberliegenden Ledersitze gesetzt haben, fährt die Limousine los. Erst jetzt spricht der Kaiser wieder. „Hochwürden, seid wann brechen Schweizergardisten ihren Eid?“ Wie aus der Pistole geschossen antwortet Pius: „Seid kaiserliche und französische Truppen die Schweiz gewaltsam besetzt haben.“ Der Kaiser hört natürlich die Kritik an der Besetzung der Schweiz im September heraus, die von kaiserlichen Truppen in einem blitzschnellen Schlag durchgeführt wurde. Und so antwortet Joseph: „Höre ich da eine Spitze heraus? Hochwürden, es war nötig!“ „Strategisch vielleicht. Und vielleicht auch, um unseren Freunden von der Prieuré mehr Sicherheit zu geben...Aber politisch ist es problematisch. Wir hatten echt Schwierigkeiten, es den Schweizergardisten plausibel zu machen.“ „Hat man gemerkt. Was passiert jetzt mit ihm?“ Pius wiegt den Kopf ein wenig. „Ich hab es dem Kommandanten überlassen. Wahrscheinlich wird er ein Exempel vor versammelter Mannschaft statuieren lassen.“ Joseph nickt. Genau richtig so. Schließlich muß man die Ordnung aufrechterhalten und dabei darf man nicht zulassen, daß diese durch Ideen, wie sie von „Schimäre“ verbreitet werden, unterminiert wird. Überraschend fragt Joseph: „Glauben Sie, ‚Schimäre‘ hat da die Finger drin?“ Erschrocken sieht der Papst auf. Seine Truppen hatten bislang nur wenig Gefechtskontakt mit etwa 500 „Schimäre“-Kämpfern in Süditalien gehabt, aber das war auch alles. Allerdings eilt „Schimäre“ inzwischen ein gewisser Ruf voraus. So etwa der, daß man immer und überall mit ihnen rechnen muß. Aber der Papst schüttelt den Kopf, wie um sich selbst zu überzeugen. „Nein, das glaube ich nicht. Das wüßten wir.“ „Na, wenn Sie meinen.“ „Ja, ich meine. Aber lassen wir das...Wir haben zu viele Probleme zu lösen.“ „Was denn noch?“ „Ich denke da zum Beispiel an die Bündnisse mit Bey Faruk und den Janitscharen. Das gefällt mir nicht.“ Da muß der Kaiser kurz lächeln. „Wieso? Weil deren Truppen teilweise aus muslimischen Soldaten bestehen?“ „Ja, genau!“ „Aber, aber Hochwürden! Diese Verbündeten leisten immerhin gute Dienste. Die Janitscharen haben uns in Griechenland gegen die dortige provisorische Regierung geholfen und Faruks Truppen haben immerhin tatkräftige Hilfe gegen Dubrovnik und Montenegro geleistet.“ „Was mir auch nicht gefallen hat.“ „Hochwürden, Montenegro wurde vielleicht von einem Fürstbischof regiert, aber er hat sich dummerweise auf die Seite der Allianz geschlagen.“ „Ja, dummerweise.“ „Sie wissen doch, die Montenegriner waren schon immer widerspenstig.“ „Stimmt. Aber trotzdem. Was soll das erst geben, wenn wir mit dem Kreuzzug beginnen und dann muslimische Soldaten an unserer Seite kämpfen?“ Da war es, das Thema: Der Kreuzzug. Aber Joseph hat sich vorher bei Klettenberg rückversichert und der hatte Lösungsvorschläge. Joseph reicht sie weiter, während die Limousine bereits den Stadtrand Roms erreicht: „Hochwürden, wir lassen diese Truppen einfach an der Ostfront oder in Spanien kämpfen. Dann sind sie beschäftigt.“ „Na, ich weiß nicht.“ Pius bleibt skeptisch – oder ist es nur Altersstarrsinn? Vorerst beschließt Joseph, dies nicht auszuloten. Immerhin hat der Papst den Vorschlag nicht rundheraus abgelehnt. Nach etwas mehr als einer halben Stunde Fahrt, begleitet von einigen päpstlichen Kradschützen als motorisierte Eskorte, erreichen sie den Vatikan. Der Terminplan ist eng: Zunächst noch ein öffentlicher Auftritt, dann kann sich der Gast zwei Stunden ausruhen, dann steht ein kurzes Treffen mit dem kaiserlichen Botschafter an und dann ist es auch schon bald Mittag. Es steht dann ein umfangreiches Mittagessen mit dem Gastgeber an. Und so werden Pius und Joseph von ihren Leibwachen eilig zu einem am Westrand des Piazza San Pietro aufgebauten Podest geleitet, wo sie sich der Menge zeigen, die sich versammelt hat. Die Menschen jubeln und heißen den Kaiser willkommen. Pius selber tritt ans Mikrophon, während auf der freien Fläche rund um die Säule, die den Platz ziert, mehrere Pfähle aufgestellt werden, um die herum Holz ausgelegt wird. „Ich grüße euch, ihr Gläubigen! Wir haben uns hier versammelt, um gefährliche Ketzer und Hexen ihrer gerechten Strafe durch Gott zu übergeben!“ Die Menge jubelt, bis der Papst mit einer zittrigen Handbewegung um Ruhe bietet. „Ich bitte euch, bettet für diese armen Seelen! Sie werden es nötig haben. Sie haben gestanden und werden nun geläutert!“ Er unterschlägt, daß die Geständnisse durch Folter erpreßt wurden, denkt sich Joseph, während die schwarz uniformierten Inquisitoren die Verurteilten – einen Mann und vier Frauen – auf den Platz führen und an die Pfähle binden. Erst jetzt fällt ihm die Ähnlichkeit der Uniformen zu jenen seiner eigenen Geheimpolizei auf. „Vollstreckt das Urteil!“ Nun tritt Pius wieder vom Mikro zurück und neben Joseph, während die Menge in andächtiger Ruhe wartet. Die Inquisitoren schütten eine Flüssigkeit aus Kanistern über die angebundenen Personen. Einer der kaiserlichen Soldaten von Josephs Leibwache kommt auf das Podest und murmelt dem Kaiser kurz etwas ins Ohr. Dann geht er wieder. Leise murmelt Joseph Papst Pius zu: „Ich habe soeben erfahren, daß das ‚Schimäre‘-Problem heute eventuell einer Lösung näherrückt.“ Pius schaut ihn überrascht an, doch dann fesselt wieder das Geschehen auf dem Platz seine Aufmerksamkeit. Die Inquisitoren zünden das Holz rund um die Verurteilten an, das Feuer springt auf den Spiritus, mit dem man sie übergossen hat, über und dann sind die fünf Angebundenen auch schon von Flammen eingehüllt. Ihre Todesschreie gehen im Gebrüll der Menge unter... „Wer Wind säht, wird Sturm ernten. Und wer Sturm säht, der wird untergehn.“ Alte Volksweisheit Oberfähnrich Silke Rüttel hat gerade den ersten Schub Meldungen und Post für den General Reiss sortiert und macht sich nun einen Kaffee. Während die Kaffeemaschine vor sich hingluckert, schaut sie auf die Uhr. Schon kurz nach 10 Uhr. Wo bleibt nur der Chef? Als sie wieder an ihrem Schreibtisch sitzt und sich zurücklehnt, um den Kaffee wirken zu lassen, geht die Tür auf. Der Chef schaut rein. Sein noch feuchtes Haar zeigt an, daß er frisch geduscht hat. Er knöpft gerade sein Uniformhemd zu. Grinsend grüßt Stefan sie: „Morgen Oberfähnrich. Entschuldigen Sie meine Verspätung, aber es ist gestern spät geworden.“ Er schließt die Tür wieder; Silke steht auf und geht in sein Büro, wo er sich gerade an den Tisch setzt. „General – das ist alles?“ „Ja, was denn noch?“ „Ja, Details! Wieviel haben Sie gewonnen?“ „Sie sind ganz schön neugierig.“ „Ich weiß.“ „Ok, ich hab ein paar Rubel abgestaubt, aber nicht viel. Jacke hat das meiste gewonnen. Irgendwas um die 1000 Rubel. Wahrscheinlich wird er es bald versoffen haben.“ Silke lächelt. „Wahrscheinlich.“ Stefan nimmt einen dicken großen Briefumschlag in die Hand, der auf dem Tisch liegt. „Was ist das?“ „Ist heute morgen aus Moskau gekommen. Suworow, Rydz-Smigly und die andern haben einen groben Plan in einem Memorandum entworfen. Ich dachte, Sie sollten es zuerst lesen.“ „Naja, eigentlich wollte ich ja gleich los...“ „Müßten wir auch, wenn wir noch Frakers Stellung rechtzeitig erreichen wollen.“ „Stimmt. Ok, holen Sie schon mal den Wagen, Oberfähnrich.“ „Alles klar.“ Silke verläßt das Büro. Stefan greift in die Stiftablage und krackelt dann mit einem schwarzen Stift auf den Umschlag: „Karo, bin an der Front – Durchlesen und bewerten, Ergebnis bis heute abend“. Er wirft den Umschlag auf Karos Schreibtisch und verläßt dann das Büro. Draußen ist Silke bereits mit dem Kübelwagen vorgefahren. Es nieselt und es ist kalt. Beschießenes Oktoberwetter. Schlammwetter. Solange es andauerte, konnte man wenigstens auf eine Kampfpause hoffen, in der man sich regenerieren, die neuen Rekruten ausbilden kann. Er steigt ein und Silke meint noch beim abfahren: „Chef, wie lange ging das eigentlich noch?“ „Bis 4 Uhr.“ „Da waren Sie aber früh wieder fit.“ „Ja, hab schlecht geschlafen.“ Zerknirscht fügt er hinzu: „Hab von Chrissi geträumt.“ „Oh.“ Silke weiß, daß sie da dann lieber nicht weiterspricht. Sie ist sich der Tatsache bewußt, daß der General den Tod dieser Frau noch nicht wirklich verwunden hat. Und Stefan denkt an diesen Traum zurück. Er hatte Chrissi gesehen und sie hatte ihn vor irgendwas warnen wollen, aber dann war er aufgewacht, bevor er es verstanden hat... Ein heftiges Schütteln weckt Cornelia Schönmann aus dem Tiefschlaf. Müde stemmt sie sich auf. Es war noch lang gewesen gestern abend und sie hat mehr als eine Tüte und etliches an Alk intus gehabt. Mit einer trägen Armbewegung versucht sie die Gestalt, die sie wachrüttelt, wegzuscheuchen. Schließlich blinzelt sie den Schatten vor dem Licht an. „Fischer, was ist los?“ nuschelt sie Major Fischer, den Chef der Funkaufklärung an. „Frau Brigadier, wir haben so eben wieder einen Funkspruch aufgeschnappt. Wieder mit dem unbekannten Code. Wir arbeiten an einer weiteren Triangulation.“ Conny ist sofort hellwach. „Wieviel Uhr haben wir?“ „10 Uhr 45. Ich dachte, Sie würden sich gern selbst ein Bild machen.“ „Da haben Sie recht!“ Conny registriert, daß ihre Zimmergenossen bereits alle weg sind. „Ok, Fischer, zurück auf Ihren Posten. In ein paar Minuten bin ich unten.“ „Jawohl.“ Fischer salutiert und verläßt den Raum. Conny fegt sich mit einer Handbewegung die Strähnen aus dem Gesicht. Wird sich das Ergebnis der ersten Triangulation bestätigen lassen? Um den Regen wenigstens einigermaßen fernzuhalten, hat Oberfähnrich Tina Reymann über die Gräben ihrer Stellungen Planen spannen lassen. Die feindlichen Linien 100 m weiter vorne beobachten die Soldaten ihrer Kompanie durch die Schießscharten zwischen den Sandsäcken. Die Stellung der 2. Kompanie/II. Bataillon des 3. Infanterieregiments „Schimäre“ befindet sich nur wenig westlich von Jarcevo mitten im Wald auf der einen Seite der Lichtung. Auf der anderen Seite liegen die kaiserlichen Gräben, dazwischen das matschige und von Gras und Farnen bewachsene Niemandsland, mit zwei Trichtern mittendrin, die bereits zu kleinen Tümpeln geworden sind. Einige Leichen liegen immer noch herum, sie stammen von den Kämpfen zur Monatswende. Den Verwesungsgeruch kann man schon wahrnehmen. Beim Gedanken daran rümpft Tina die Nase, während sie durch eine Schießscharte die feindliche Stellung beobachtet. Die Maßnahme mit den Planen funktioniert nur leidlich, der Boden des Grabens ist bereits weich und man hört die Regentropfen auf die Plane fallen. Diese wölbt sich allmählich durch. Einer der Soldaten geht an ihr vorbei und läßt das Regenwasser in einen Eimer ablaufen. „Gefreiter, machen Sie Kaffee!“ ruft Tina ihm zu, der Mann murmelt was zustimmendes und verschwindet in einen Nebengraben. Innerlich verflucht Tina dieses Wetter. Die Kiste, auf der sie sitzt ist auch schon feucht und Kälte und Feuchtigkeit werden bis heute abend durch die Uniform gekrochen sein. Hier im Wald, umgeben von hohen, bereits mit braunem Laub behangenen Bäumen, ist es ohnehin noch kühler und feuchter als es ohnehin schon ist. Und Tina weiß manchmal nicht, was schlimmer ist: Die Langeweile, wie sie jetzt herrscht, oder der Horror, den man in einer wilden Stadt erlebt. „Frau Oberfähnrich?“ Tina dreht sich halb auf ihrer Kiste um. Oberfeldwebel Krakowsky, der hinter ihr aufgetaucht ist, lächelt leicht, als er diese Frau mit den blonden Haaren und dem frechen Grinsen sieht. Er persönlich hält sie für durchgeknallt, aber auf eine eigenartige Weise mag er sie doch. Was vielleicht daran liegt, daß sie seinen Beschützerinstinkt anspricht. Einige andere Soldaten mögen Tina wegen ihrer guten Kontakte in die Führungsetage von „Schimäre“, aber bei Krakowsky ist das nicht der Fall – er hat selber ähnliche Freundschaftsbande. So gehörte er zum Bekanntenkreis der toten Frau Generalmajor Christiane Alleker. „Ja, was gibt’s Krakowsky?“ fragt Tina. „Weisung vom Bataillonskommandeur. Wir sollen mal kurz rüber zu Fraker gehn, um die daran zu erinnern, daß vor unserer Stellung ein paar Minen verteilt werden.“ Tina seufzt kurz – „och neee...“ – und verdreht die Augen. Schon gestern und vorgestern ist man bei Frakers Pionieren gewesen, die die Nachbarstellung halten, und hat sie darum gebeten, einige Minen zu legen. Das wurde zugesagt, aber bislang offenbar vergessen. Aneinandervorbeireden – das gibt’s auch bei „Schimäre“. „Dieses Mal sollen wir aber mit mehr Nachdruck auftreten.“ vervollständig Krakowsky die Weisung des Bataillonskommandeurs. „Na gut...“ stöhnt Tina, „dann kommen Sie mit, Krakowsky, wir beide erledigen das.“ Der Gefreite, den sie eben weggeschickt hat, um Kaffee zu kochen, kommt gerade mit einer Thermoskanne wieder. Tina winkt ihn heran und bedeutet ihm mit einer Handbewegung, er solle ihren Posten übernehmen. Der Soldat nickt nur. Tina schnappt sich ihren Helm, der neben der Kiste gelegen hat und setzt ihn auf, dann gehen sie und Krakowsky leicht geduckt durch den Graben nach rechts, zur benachbarten Stellung, die die Pioniere von der Aufklärungsabteilung halten. Ihr Weg führt sie durch einen langen Graben, der immer weniger tief wird, dann in einen Hohlweg einmündet, über dem einige Bäume stehen, hinter denen drei „Schimäre“-Soldaten auf Posten liegen. Dann erreicht man einen weiteren nicht sehr tiefen Graben, dessen Ränder durch Sandsäcke erhöht sind. Die Nachbarkompanie. Noch ein paar hundert Meter, dann ist man in der Pionierstellung. Diese Gräben hier sind bereits richtig vom Regen durchnäßt, die Holzverschalungen an den Seitenwänden hat man an ein paar Stellen mit dünnen Baumstämmen vorsichtig abgestützt. Ein paar Soldaten sind gerade damit beschäftigt, neue Drahthindernisse vor die Stellung zu legen, wobei zwei MG-Posten in Alarmbereitschaft sind, um nötigenfalls Feuerschutz zu geben. Aber hier ist keine Lichtung mehr, sondern lockerer Laubwald, mit ein paar Nadelgehölzen dazwischen und ein paar Büschen. Hier hat man mehr Deckung. Schließlich zweigt man in einen teilweise überdachten Laufgraben ab, der nach hinten führt, dann geht es über einen Trampelpfad an einem Hochstand vorbei, Sitz eines Scharfschützen, und dann wieder durch einen Laufgraben nach vorn. Die Wache am Grabeneingang hält sie kurz an. „Moment, Parole und Auftrag!“ „Milchtüte. Wir sollen uns erkundigen, wann vor unserer Stellung die Minen ausgelegt werden oder ob wir es selber machen müssen. In dem Fall sollen wir uns hier mit Minen versorgen.“ erklärt Krakowsky. „Alles klar. Ihr könnt durch.“ Die Wache läßt die beiden vorbeitreten. „Milchtüte?“ fragt Tina verwundert. „Neue Parole, wurde heute morgen ausgegeben.“ „Achso.“ Mehr muß Tina nicht wissen. Der Hang der „Schimäre“-Kämpfer zu ausgefallenen Parolen ist inzwischen nur allzu berüchtigt. „Oberfähnrich, haben Sie eben auch den Kübelwagen unter den Bäumen gesehen?“ fragt Krakowsky und meint damit den Wagen, den er kurz etwa 50 m entfernt hinter der Stellung gesehen hat. „Ja, was ist damit?“ „Ich glaube, das war der Wagen vom Chef.“ Sie erreichen den Hauptgraben und Tina fragt einen Soldaten, wo sie Hauptmann Fraker finden. Der Soldat deutet auf einen Unterstand etwa 20 m entfernt. Als sie den Unterstand erreichen, stehen dort tatsächlich Hauptmann Fraker – und General Reiss sowie Oberfähnrich Rüttel. Krakowsky fällt sofort der Ledermantel auf, den Reiss über die Uniform geworfen hat. Tina klopft gegen den Holzrahmen des Eingangs und räuspert sich. Reiss dreht sich um. „Oh, guten Tag Oberfähnrich.“ „Tag, Herr General, ich wollte zu Fraker.“ Fraker zündet sich gerade eine Zigarette an. „Wegen der Verminung, Oberfähnrich Reymann, ich weiß. Keine Sorge, ich habs nicht vergessen. Nach dem Mittagessen wird es gemacht. Wir hatten leider bisher keine Zeit.“ „Wir dachten schon, Sie hätten es vergessen...“ Schnell legt sich Fraker eine Hand auf die Brust. „Oberfähnrich! Wie könnte ich die Bitte einer so schönen Frau vergessen...?“ „Fraker, lassen Sie den Blödsinn...“ faucht ihn Stefan an. „Ich hab Ihnen schon so oft gesagt: Nicht im Dienst flirten.“ „Er hat eh keine Chance.“ meint Krakowsky und lacht. „Naja, ich weiß nicht...“ meint Tina leise, zeigt aber mit einem Grinsen an, daß das nur ein kleiner Spaß war. Krakowsky meint zu Reiss: „General, wie geht’s Ihren Schnittverletzungen an den Händen?“ „Och die...“ Stefan beschaut sich seine relativ frischen Narben auf den Handflächen, die er sich bei dem Gefecht in Köln, bei dem Chrissi gestorben war, zugezogen hatte. „Eigentlich ganz gut. Schmerzen nicht mehr so.“ „Freut mich zu hö-...“ Weiter kommt Krakowsky nicht. Ein Zischen zerreißt die relative Stille der sonstigen Hintergrundgeräusche. Karo hatte vom Fenster aus noch Stefan mit Silke wegfahren sehen. Jetzt, nur Augenblicke später, ist sie im Büro und sieht den großen Briefumschlag. „Durchlesen und bewerten, Ergebnis bis heute abend.“ Mit einem Seufzer läßt sie sich auf ihren Stuhl fallen und stellt ihre Kaffeetasse ab, nachdem sie einen Schluck genommen hat. Eigentlich ist sie noch totmüde von gestern abend; zum Glück zeigt das Bürofenster nach Norden und ein Baum steht davor, so daß die durch Wolken milchige Sonne nicht zu sehr in den Raum scheint. Eigentlich hat Karo nichts gegen Sonne, aber jetzt wäre ihr das zu hell. Sie reißt mit einem Brieföffner den Briefumschlag auf. Es ist ein Memorandum von der Moskauer Konferenz, in Englisch gehalten. Jemand – offenbar Generaloberst Moltke, nach der Schrift der Randnotizen zu schließen – hat die wichtigsten Stellen markiert. Karo überfliegt diese Stellen und reibt sich mit einer Hand verwundert die Augen: Ganz offenbar haben die Russen aus irgendwelchen Gründen durchgesetzt, daß man zuerst die Chinesen niederringt. Alle alliierten Vertreter hatten zustimmen müssen, daß man kaum alle Feinde auf einmal besiegen kann – also muß man sie nacheinander schlagen durch Verlagerung der Kräftekonzentration. Und die Russen haben es geschafft, als ersten Gegner die Chinesen auf die Planliste zu setzen. Moltke hat daneben gekrakelt: „Nicht gerade eine berauschende Idee...“ Recht hat er. Für die Exildeutsche Armee ist es eine mittlere Katastrophe. Die Exildeutschen, hervorgegangen aus den Überresten der preußischen Armee, haben keinerlei Territorium mehr unter ihrer Verwaltung, sind völlig von der russischen Infrastruktur abhängig. Ebenso wie die polnische Armee. Für beide ist es daher am wichtigsten, durch Offensiven im nächsten Jahr möglichst viel Territorium an der Ostfront zurückzugewinnen. Wenn jetzt aber die Aufmerksamkeit auf China verlagert wird, wird man damit wohl warten müssen. Karo kann die Exildeutschen und die Polen nur zu gut verstehen. Zumal sie selber Polin ist und zugleich durch ihre Jugendjahre in Köln auch enge Bindungen zu Deutschland hat. Einige Zeilen weiter unten steht’s auch schon: „...für die bevorstehenden Offensiven zur Niederwerfung Chinas wird die russische Regierung zwei weitere Armeen nach Fernost verlegen. Alle anderen Alliierten einschließlich der Westalliierten werden dazu aufgerufen, ebenfalls weitere Truppenkontingente nach Fernost zu schicken. Dies würde auch von den indischen Staaten, die an unserer Seite gegen China kämpfen, und von Japan positiv aufgenommen werden...“ Und zwei Zeilen tiefer: „Vorschlag des russischen Oberbefehlshabers, bei ‚Schimäre‘ darauf zu drängen, daß dessen gesamte Truppe nach Fernost geschickt wird, wurde angenommen.“ „Das gibt’s doch nicht!!“ faucht Karo das Stück Papier an und wirft es auf den Tisch. Suworow will „Schimäre“ ganz offensichtlich nach Fernost abschieben! Wenn Stefan das liest, wird er stinksauer sein. Die Bürotür wird aufgerissen. „Karo!“ Karo sieht auf und erkennt Conny, die völlig außer sich hereingestürzt kommt. Vor einer halben Stunde hatte man Conny vom neuen rätselhaften Funkspruch verständigt. Und jetzt steht bereits die Triangulation. „Wir haben den Sender! Wir sind uns sicher – er ist im Nachbargebäude!“ „Bitte?!“ Karo springt auf. Ein Spion so nahe bei ihnen? „Ok, Conny, sag Flatten Bescheid! Die HQ-Kompanie soll einen Trupp schicken...“ Das Zischen dauert nur einen Moment an. Und dann läßt eine Folge schwerer Schläge die Erde erzittern. Als zwei Granaten direkt auf das Dach des Unterstandes schlagen, bricht dieses halb ein, alle werfen sich auf den Boden in Deckung. Reiss, Fraker, Krakowsky, Reymann – allen ist klar: Das ist ein Feuerüberfall! Und dann, nach zwei weiteren nahen Einschlägen, verlagern sich die Einschläge nach hinten. Draußen ertönen Rufe und Schreie. „Saniii!!“ „Alaaaarmmm!!“ Schüsse peitschen, MGs tackern, zwei nähere Explosionen. Der Boden zittert weiterhin leicht. Und dann: Nebel dringt von draußen, vom Hauptgraben her herein. Ein Soldat kommt in den halb zusammengestürzten Unterstand gestolpert, wo sich die andern gerade aufraffen. „Gaaa-aasss...“ krächzt der Soldat und bricht dann zusammen. Auch Tina hustet schon, aber Fraker reagiert schnell: Er rennt zu einer Kiste rüber, bricht sie mit einer Brechstange, die daneben liegt, auf und holt Gasmasken raus, wirft sie den anderen zu. Gerade noch rechtzeitig hat Tina die Maske übergezogen und muß das Gefühl der Enge bekämpfen. Fraker selber schnappt sich jetzt sein Gewehr, das an einer Wand lehnt. „Kommt mit!!“brüllt Reiss, was wegen der Gasmaske sehr gedämpft klingt. Und dann treten sie nach draußen in den Graben. Drei Leichen liegen dort. Erschossen. Alle drei tragen Gepo-Uniformen. Stefan zieht seine beiden Tokarews und rennt dann den Graben entlang. Weiter vorne hocken zwei „Schimäre“-Soldaten und feuern mit ihren Gewehren auf einige in den Nebelschwaden nur schwer zu erkennende Gepos, die zurückfeuern. Auch Stefan duckt sich und feuert mit den Tokarews zurück. Einer der Soldaten nuschelt unter seiner Maske einen Lagebericht zusammen, während irgendwo links von ihnen – im eigenen Hinterland! – Rufe und Schüsse ertönen: „Sie müssen direkt vor unserer Stellung gelauert haben und bis das Gas gewirkt hat, haben sie uns den Rückweg durch einen Feuervorhang abgeschnitten!“ Zwei Schüsse schlagen dicht bei ihnen ein. „Chef, ich glaube, jetzt sind sie schon weit eingesickert.“ „Ok, Obergefreiter. Halten Sie die Stellung, ich werde die Lage erkunden und wenn möglich dem Gegner die Flanke etwas kitzeln!“ „Alles klar, Herr General!“ Stefan rennt geduckt wieder zurück. Die Gasschwaden irritieren einen doch ziemlich. Silke taucht vor ihm auf. „Wo sind die andern?“ „Wir wurden angegriffen, Chef! Die anderen sind noch beschäftigt!“ „Mitkommen!“ Sie wenden sich nach rechts, nach hinten hin, um zu prüfen, ob es Fluchtwege gibt. Unterwegs stoßen sie auf die Leichen von „Schimäre“-Kämpfern und ein paar weiteren Gepo-Leichen. Die Gepos tragen Säbel. Seltsam. Das tun sie sonst nicht. Ein Granattrichter, frisch, noch steigt Rauch auf. Umgehen, unter einem über einen Graben gestürzten Baum. Eine Detonation neben ihnen, Stefan zieht Silke an die Seitenwand des Laufgrabens. Über ihnen, zwischen einigen Bäumen und Büschen tobt ein heftiger Schußwechsel. „Warten Sie hier!“ befiehlt Stefan, rennt los und klettert dann den kurzen Hang hoch, pirscht zwischen den Bäumen durch. In der Gasmaske ist die Sicht zunehmend erschwert und er hört seinen eigenen Atem. Einige geisterhafte Gestalten sind vor ihm. Eine kniet, die andere steht vor ihr. Und erschießt die knieende Gestalt. Dann erkennt Stefan Gepo-Uniformen. Er reißt die Tokarews hoch, feuert, hört einen Schmerzensschrei. Als seine Magazine leer sind, rennt er zurück, duckt sich hinter einen Baum. Sein Atem jagt. Irgendwo weiter südlich schlagen weitere Granaten ein, in der Nähe hört er eine weitere Gasgranate niedergehen. Ein Schuß. Aus der Richtung, wo Silke sein muß! Er springt auf, spurtet im Zickzack durch die Bäume und springt wieder in den Laufgraben. Er landet direkt vor einem eingestürzten Unterstand, in dem wahrscheinlich mehrere Soldaten verschüttet sind. Das ist der Nachtteil der Unterstände, die eigentlich Schutz bieten sollen, aber eben nicht immer stabil genug sind. Da er keine Ersatzmagazine für die Tokarews dabei hat, greift er über die Schulter und zieht direkt seinen Säbel. Und schleicht weiter. Tatsächlich! Silke liegt blutend am Boden, um sie herum stehen drei Gepos. Einer spricht mit den anderen. „Verdammt, der Typ muß hier doch irgendwo sein, wir haben alles abgeschottet.“ „Keine Ahnung Rottenführer. Vielleicht ist er auch in dem verschütteten Unterstand da hinten gewesen.“ Hinter Stefan entwickelt sich eine weitere Schießerei. Also, es gilt was zu riskieren! Er löst sich aus seiner Deckung. Dabei fällt ihm auf, daß die Gepos auch alle Gasmasken anhaben. Von den Toten, die er bisher gesehen hatte, hatten nur einige „Schimäre“-Kämpfer keine Masken auf. „Hey, Arschlöcher, redet ihr von mir?!“ Überrascht drehen sich die Gepos um. „Das ist er!“ ruft der Rottenführer. „Schnappt ihn!“ Die Gepos ziehen ihre Säbel und gehen auf ihn los. In einer geschickten Drehung wehrt Stefan die Attacken der ersten zwei ab, verschafft sich dann gegen den Rottenführer etwas Luft. Dann wagt er einen Ausfall und drängt mit klirrendem Säbel den Rottenführer zur Seite ab, so daß er nun zwischen den Gepos und Silke steht. Hoffentlich taucht bald Verstärkung auf... Einer der Gepos greift wieder an. Ein schnelles Hin-und-Her-parieren, dann eine geschickte Wendung mit dem Säbel und die Klinge des Gepos fliegt in hohem Bogen weg. Noch ein Schlag, der dem Gepo den Bauch aufschlitzt und der Mann torkelt stöhnend nach hinten. Mehr kriegt Stefan nicht mehr mit. Aus dem Augenwinkel nimmt er noch eine Bewegung hinter sich wahr, dann zieht ihm jemand etwas über den Schädel, Stefan wird schwarz vor Augen – und wie er in den Schlamm des Grabens fällt, merkt er schon gar nicht mehr... Nur ein paar Meter neben der Jugendherberge steht ein zweigeschossiges Wohnhaus mit Flachdach, in dem bis vor kurzem vier Mietsparteien untergebracht waren. Jetzt ist es Quartier für einige der niederrangigen Mitarbeiter des „Schimäre“-Generalstabs. In nur einer Minute ist es nun von „Schimäre“-Soldaten umstellt, MPis, Gewehre und Pistolen schußbereit im Anschlag. Jemand brüllt: „Zugriff!“ Die Tür wird aufgetreten, die ersten stürmen in den Hausflur, die Treppe hoch in die oberen Stockwerke. Die nächsten rennen seitlich an der Treppe vorbei und treten die Tür zum Keller ein. Man hört von oben und unten Krach als weitere Türen aufsplittern und Rufe. Durch die Eingangstür treten nun drei weitere Personen ein: Karo, Conny und Oberleutnant Flatten. Flatten, ein schlanker Mann mit kurzgeschorenem Haar und Brille, ist Chef der HQ-Kompanie und leitet den Einsatz. Nach einigen Momenten kommt der Ruf aus dem Keller: „Herr Oberleutnant, wir haben den Sender gefunden!“ „Kommen Sie!“ meint Flatten zu seinen beiden Vorgesetzten und die drei gehen hinunter in den Keller. Die Kellerwände sind noch aus richtig altem Gemäuer und die Decke ist niedrig. Sie wenden sich von der Treppe kommend nach rechts und ein Soldat winkt sie zum zweiten Raum links. Dort haben zwei Soldaten eine junge Frau in „Schimäre“-Uniform an die Wand gestellt und halten ihr eine Pistole in den Nacken, während zwei andere Soldaten gerade die Funkunterlagen in Augenschein nehmen. Conny mustert kurz die Gefangene – und erkennt sie wieder. Es ist die junge Gefreite, die seit einiger Zeit im Generalstab arbeitet. Auch Karo erkennt sie wieder und befiehlt: „Bringt sie in mein Büro! Conny, Du kümmerst Dich um den funktechnischen Kram. Ich will heute Abend einen ersten Bericht über die verwendeten Codes, die gesendeten Nachrichten usw.“ „Zu Befehl.“ Conny nickt zackig und gibt den Soldaten, die bereits das Funkmaterial sicherstellen, einen Wink. „Beeilt euch.“ Als Karo ins Büro gehen will, wird sie an der Tür von einem Stabsunteroffizier aufgehalten, der ihr leise zuflüstert: „Wir haben so eben eine Meldung vom 3. Regiment erhalten. Ein Sonderkommando der Geheimpolizei hat offenbar einen punktuellen Angriff auf unsere Stellungen unternehmen, mit Giftgas. Sie haben einen Einbruch erzielt.“ „Wo?“ „Am Frontabschnitt der Aufklärungsabteilung, bei unserer vorgeschobenen Pionierstellung.“ Karo sieht den Stabsunteroffizier entsetzt an. „Ist das nicht der Frontabschnitt, wo der Chef...?“ stößt sie hervor. „Ja, genau der.“ bestätigt ihr Gegenüber. „Das HQ 3. Regiment hat gemeldet, man bereite den Gegenstoß vor, um die Lage zu bereinigen. Man wird umgehend Meldung machen, wenn man weiß, was aus dem General wurde.“ Gefaßt nickt Karo. „Ok. Lassen Sie Mansfeld ausrichten, er hat freie Hand zur Bereinigung der Lage.“ „Zu Befehl.“ Der Stabsunteroffizier salutiert und wendet sich um; Karo geht in ihr Büro. Dort sitzt auf einem Stuhl direkt neben der Tür die Gefangene, bewacht von zwei „Schimäre“-Soldaten mit schußbereiten P38-Pistolen. Mit wütendem Blick bleibt Karo vor der Frau stehen. Einer der Soldaten meldet: „Wir haben ihr Soldbuch. Es liegt auf Ihrem Schreibtisch, Frau Generalleutnant.“ Stumm nickend setzt sich Karo an ihren Schreibtisch und blättert das Soldbuch und die Pässe der Gefangenen durch. Dänin. 29 Jahre alt. Beke Rosleff-Sörensen. Mit wütenden Stimme fragt Karo: „Was haben Sie dem Feind verraten? Haben Sie heute morgen gemeldet, wo sich General Reiss gegen 11 Uhr aufhalten würde?“ Die Antwort, die kommt, ist ebenso überraschend wie kurz: „Ja.“ Mühsam unterdrückt Karo das Verlangen, jetzt aufzuspringen und ihr Kampfmesser, das sie am Gürtel trägt, einfach zwischen die Rippen zu jagen. Zugleich erschreckt sie davor. Sie ist normalerweise nicht mordlüstern; entschlossen zu kämpfen, wenn es sein muß, aber zu töten ist eigentlich nicht so ihr Ding. Sie hat es irgendwie geschafft, trotz aller Kriegseinsätze in den letzten Jahren (erst als Guerillakämpferin gegen Russen, Österreicher und Preußen in den Gebieten, die bis 1772 polnisch waren, seit letztem Jahr an der Seite der anderen „Schimäre“-Kämpfer) in diesem Punkte Mensch zu bleiben. Sie wollte nicht zum gefühllosen Killer mutieren; die Maxime war, den Gegner kampfunfähig zu machen, was nicht unbedingt bedeutete, daß man ihn tötet. Aber jetzt... Diese Frau hatte etwas getan, was eine Schwelle überschritten hatte. Sie hatte den General, einen von Karos besten Freunden, ans Messer geliefert. Das ist nicht mehr wie sonst. Das ist persönlich. „Bringt sie weg. Ich setze für heute abend das Verhör an.“ knurrt Karo. „Zu Befehl, Frau Generalleutnant.“ Die Soldaten bringen Beke hinaus. Karo legt eine Hand auf ihren rechten Oberschenkel. Ein leichtes Ziehen durchzuckt ihn. Dort hat sich Karo etwas über zwei Monaten eine Schußverletzung zugezogen. Es ist schon wieder ganz gut verheilt (obwohl es sich zwischenzeitlich auch schon entzündet hatte), aber wenn sie sich zu sehr aufregt – wie jetzt – merkt sie die Verletzung wieder. Sie lehnt sich in dem Stuhl zurück. Was ist an der Front passiert? Ist Stefan tot? Oder Gefangener? Beides würde Konsequenzen nach sich ziehen. Und solange, bis die Lage klar ist, hat sie das Kommando... Die Tür geht wieder auf und Conny kommt rein. „Ok, das Funkmaterial ist jetzt bei Major Fischer.“ „Conny, hast Du schon das neueste von der Front gehört?“ „Nein, wieso...“ „Unsere kleine Verräterin hat dem Feind gesagt, wann der General einen Frontbesuch macht und wo. Eine Gepo-Einheit hat die Stellung überfallen. Mansfeld ist gerade dabei, den Einbruch abzuriegeln und die Lage zu bereinigen.“ „Scheiße. Scheiße...“ Mehr fällt Conny für Momente nicht ein. Dann: „Ok, haben wir schon etwas von Stefan gehört?“ „Nein, gar nichts.“ „Ich nehme an, Du willst jede Meldung sofort auf Deinem Schreibtisch haben.“ „Ja. Und heute abend verhören wir die Verräterin.“ „Du willst mich dabei haben?“ Conny fragt lieber nochmal nach, da Karo eine allzu enge Zusammenarbeit scheute, seit sie sich im Frühjahr getrennt haben – nach jahrelanger Beziehung. Auch Karo läßt sich den Gedanken durch den Kopf gehen und mustert dabei die hochgewachsene, schlanke, dunkelhaarige Chefin der C-Abteilung. „Ja, wäre besser, wenn Du dabei bist. Und Philipp soll auch dabei sein.“ „Alles klar. Ich sag ihm Bescheid.“ „Ok, das wäre alles.“ Conny nickt und verläßt das Büro. „Der Fehler der Koalition: Sie beschäftigt sich nur mit ihren eigenen Plänen, weniger mit den Plänen unserer Allianz. Das ist unsere Chance auf den Sieg.“ Feststellung Frau Brigadegeneral Cornelia Schönmann, Oktober 1788 Ein älterer Mann, südländischer Typ, mit einem Monokel, sitzt bequem in seinem Nadelstreifenanzug im Ledersessel. In einer Hand wiegt er ein Glas mit einer bronzenen Flüssigkeit. Auf dem verzierten Eichenholztisch vor ihm steht die Cognac-Flasche. Hinter ihm ist ein Kamin, in dem ganz klein ein Feuerchen glimmt. Der Schein legt sich warm auf die getäfelten Wände mit den übervollen Bücherregalen und die schweren Vorhänge, die man vor die Fenster gezogen hat. Die alten und wertvollen Teppiche auf dem Boden verstärken den gemütlichen Eindruck noch. Das alte Ölbild einer Adelsfamilie, in goldenen Rahmen gefaßt, hängt über dem Kamin. Ganz unten am Rand des Bildes steht, nur schwer zu lesen: „Merowinger“. Wer genau hinsieht, erkennt Ähnlichkeiten zwischen den Gesichtszügen auf dem Bild und den Gesichtszügen des älteren Herren. Das Telephon klingelt. Der Mann beugt sich vor, stellt das Cognac-Glas ab und nimmt dann den Hörer vom Telephon, das auf dem Tisch direkt neben der Flasche steht. Mit dem Hörer in der Hand lehnt er sich in seinem Ledersessel zurück. „Ja?“ Einige Momente lang horcht er. Dann legt er wieder auf, lehnt sich wieder zurück und meint zu den zwei anderen Männer, die ihm in weiteren Ledersesseln gegenübersitzen: „Das war Schneider. Er sagt, sie haben ihn. Wenn das stimmt, haben wir hoffentlich ein Problem weniger.“ Generalleutnant Ernst von Mansfeld, ein echter Haudegen, der schon auf die 40 zu geht und dessen Frau momentan im sicheren Schottland lebt, ist persönlich bei Karo zum Rapport angetreten. „Soweit wir wissen, hat kaum einer überlebt. Wer nicht am Giftgas krepierte oder im Kampf gefallen ist, wurde erschossen, wenn er sich ergab. Oberfähnrich Silke Rüttel haben wir gerade noch lebend vorgefunden. Sie konnte uns bestätigen, daß General Reiss gefangengenommen wurde. Dann ist sie leider in meinen Armen gestorben. Vom General keine Spur, auch keine Leiche. Ansonsten vermissen wir nur noch drei Personen: Hauptmann Fraker, Oberfeldwebel Krakowsky und Oberfähnrich Reymann.“ Etwa vier Stunden ist es her, daß Karo die Nachricht von dem schier Unglaublichen erhalten hatte. Ihre Lippen sind ein dünner Strich, als sie zu Mansfeld aufblickt, der vor ihrem Schreibtisch steht. „Haben Sie Gefangene machen können?“ Mansfeld schüttelt den Kopf. „Nein, Frau Generalleutnant. Diese Geheimpolizisten waren von einer uns noch unbekannten Einheit. Sie hatten keine Soldbücher, aus denen der Name der Einheit hervorginge, dafür aber Säbel. Und sie haben fanatisch gekämpft, keiner hat sich ergeben. Unsere Eigenverluste beim Gegenstoß belaufen sich auf 98 Gefallene und 115 Verletzte. Eine erste Zählung der Toten, die wir bereits vorfanden hat eine Zahl von 110 ergeben. Dazu etwa 160 tote Geheimpolizisten.“ „Ja, ja, ersparen Sie mir das...“ Karo vergräbt das Gesicht kurz in den Händen, dann stützt sie ihr Kinn auf beide Hände. „Mansfeld, gut gemacht. Sie können gehen. Warten Sie weitere Befehle ab.“ „Jawohl, Frau Generalleutnant.“ Mansfeld salutiert und verläßt dann den Raum. Die ganze Zeit über hat Philipp Kipshoven am Fenster gestanden und hat nach draußen gestarrt. Die Arme hat er auf dem Rücken verschränkt. Im vollen Ornat steht er da, seinen langen schwarzen Mantel hat er über den Stuhl an Stefans Schreibtisch gelegt. Jetzt dreht er sich langsam um. Zumindest ist er nicht bleich geschminkt und die falschen Vampirzähne hat er auch nicht mehr an. „Und jetzt?“ Mit einem Seufzer lehnt sich Karo zurück, das der Bürostuhl knarrt. „Keine Ahnung...mein Kopf... er ist...leer...“ „Du solltest überlegen, was Stefan tun würde.“ „Gute Frage, nächste Frage.“ „Du weiß, wie ich das meine Karo.“ Philipp postiert sich direkt neben ihr. „Er würde sagen: Besser irgend was tun – und wenn es das Falsche ist - ,als gar nichts tun.“ Nach kurzem Überlegen erwidert Karo: „Stimmt. Wahrscheinlich würde Stefan versuchen, eine Rettungsaktion zu starten.“ Sie wendet den Kopf und sieht Philipp von unten her direkt in die Augen: „Darum kümmerst Du dich, alter Freund. Und ich werde versuchen rauszukriegen, ob er noch lebt. Wir sehen uns dann in ein paar Stunden beim Verhör.“ „Geht klar...“ Philipp verläßt den Raum. Nach ein paar Minuten steht auch Karo auf und geht auf ihr Zimmer. Von den Zimmergenossen ist keiner da. Gut. Sie schließt die Tür ab und knöpft erstmal das Uniformhemd auf, damit es bequemer ist. Aus ihrem Spint holt sie einige Duftstäbe und stellt sie in einem Ständer auf das Fensterbrett und zündet sie an. Während sich Rosen-und Tannendurft im Raum verbreiten, läßt sich Karo im Schneidersitz auf ihrem Bett nieder, legt die Hände auf die Knie und beginnt mit bewußter Atmung. Die Augen erst noch geschlossen. Nach einer Weile senkt sie die Atemfrequenz. Es dauert zwar etwas, aber schließlich fühlt sie sich ganz leicht und verliert jegliches Zeitgefühl. Jeglicher klarer Gedanke löst sich auf. Das Gefühl des Schwebens verstärkt sich, während die Welt um sie herum zu einem wabbernden Kontinuum wird, durch das die Düfte der Stäbe sie tragen. Das Gefühl totaler Freiheit, durchströmt von reinstem hellem Licht, reinster Energie. Und dann, wie ein Schlaglicht, rasen die Wälder Russlands unter ihr hinweg. Und dann eine Straße. Auf dieser Straße ein Lastwagen. Irgendwas an diesem Lastwagen ist wichtig. Es ist wie ein Signal – wie eine geistige Markierung könnte man sagen. Karo reißt die Augen auf, ist blitzartig wieder in der Wirklichkeit, und flüstert einfach in den leeren Raum: „Ja, er lebt noch!“ Obersturmbannführer Ehrtens schmeckt das nicht. In Russland an Bahnübergängen zu lange zu warten, kann gefährlich sein. Nicht umsonst hat sein Transport eine so starke Eskorte. Aber die Wachposten am Bahnübergang waren nicht zu erweichen: Die Schranken sind bereits unten und jeden Moment würde der Munitionstransport durchrollen. Die Wachposten des Heeres sind freilich ebenfalls sehr mißtrauisch. Gerade steht Ehrtens mit einem von ihnen am Heck des Lasters und hebt die Plane an, um die Fracht dem kritischen Auge des Unteroffiziers zu zeigen. Auch die Gepos auf den beiden anderen Lastern und den Krädern sind nervös. „Oh, Sie transportieren einen Gefangenen.“ stellt der Unteroffizier fest. „Nur ein Gefangener und dafür der Aufwand?“ „Er ist ein wichtiger Gefangener, Herr Unteroffizier.“ „Und wieso haben Sie ihn geknebelt?“ Ehrtens läßt die Plane wieder sinken. „Er hat einen meiner Männer gebissen. Und glauben Sie mir: Der Typ hat sowas wie Fangzähne.“ „Hmmmhmm...“ brummt der Unteroffizier. „Wieso sitzt er im Schneidersitz da?“ „Keine Ahnung. Herr Unteroffizier, ich kann mich nicht um jeden Scheiß kümmern. Wenn der Gefangene im Schneidersitz rumhocken will, soll es mir recht sein. Es verstößt gegen keine Sicherheitsvorschriften.“ „Stimmt.“ „Sicherlich stimmt das. Oder haben Sie schonmal davon gehört, daß ein Gefangener im Schneidersitz entkommen ist?“ Der Unteroffizier bedenkt Ehrtens mit einem säuerlichen Blick und wirft dann nochmal einen Blick auf die Passierscheine. „Ok, sobald der Zug durch ist, können Sie weiter, Obersturmbannführer.“ „Danke, Herr Unteroffizier.“ Mit einer raschen Handbewegung reißt Ehrtens dem Mann die Passierscheine wieder aus der Hand und geht zur Beifahrertür des Lasters, um einzusteigen. Als er die Tür zuschlägt, kommt der Zug durch. Eine scheinbar nicht enden wollende, brüllende Aneinanderreihung von Güterwaggons. „Und, können wir durch?“ fragt der Unterscharführer, der am Steuer sitzt. Mit grimmigem Gesicht nickt Ehrtens. „Ja, wir können durch. Dann sind wir wenigstens bald in Orscha. Ich fühl mich schon wesentlich wohler, wenn wir den Kerl endlich im Flugzeug haben. Da machen uns wenigstens keine Partisanen Ärger.“ „Tja, Obersturmbannführer, noch sind wir gerade mal bei Tischino. Bis Orscha kann noch etliches passieren.“ „Unterscharführer, seien Sie nicht immer so ein Schwarzmaler.“ „Wenn Sie meinen.“ Der Zug ist endlich vorbeigerauscht und die Wachen heben die Schranke. Jetzt können sie endlich weiter. Die Wachen haben Beke Rosleff-Sörensen wieder ins Büro von Karo gebracht, wo bereits Karo, Philipp und Conny gewartet haben. Dann hat das Verhör begonnen. Karo sitzt an ihrem Schreibtisch, Philipp und Conny auf Stühlen daneben. „Also...“ beginnt Conny, „ich habe mit der dänischen Botschaft telephoniert. Wir wissen jetzt, daß Sie in Dänemark als Aktivistin der Pazifismus-Bewegung bekannt sind und bei Beginn des Krieges Anti-Kriegs-Demos in Kopenhagen geleitet haben.“ Beke zuckt die Schultern. „Stimmt. Und?“ „Die Fragen stellen wir.“ erwidert Philipp barsch und überläßt dann Conny das Wort. „Also, sagen Sie uns: Was verschlägt eine Friedensaktivistin zu ‚Schimäre‘ und das auch noch im Dienste der Kaiserlichen? Schließlich haben Sie bei der letzten Demonstration im Dezember 1787 noch eine Schwarze Liste der Kriegstreiber vorgestellt, wo wir direkt nach dem Kaiser genannt wurden." Beke lächelt schüchtern und antwortet dann: „Aber Sie alle hier sind doch Kriegstreiber. Sie haben den Krieg durch den kleinlichen Aufstand vor anderthalb Jahren ausgelöst und keinen Versuch gemacht, mit dem Kaiser zu verhandeln.“ „Stimmt nicht ganz.“ knurrt Philipp. „Es hat einen Verhandlungsversuch gegeben, aber die Kaiserlichen brachen den Waffenstillstand. Fragen Sie mal den Landgrafen oder Generalleutnant Prinz. Die Männer von letzterem wurden damals geradezu abgeschlachtet.“ „Oh, das wußte ich nicht. Es tut mir leid.“ „Es tut Ihnen leid?!“ herrscht Karo die Gefangene an. „Sie haben einen guten Freund von mir ans Messer geliefert und jetzt tut es Ihnen leid!“ Sichtlich eingeschüchtert versucht sich Beke zu verteidigen. „Ich wollte doch nur den Krieg verkürzen. Sie haben gesagt, wenn sie Reiss hätten, wäre der Weg frei zu einem Verhandlungsfrieden.“ „Mein Gott, wie naiv...“ Wütend springt Karo auf und geht zum Fenster rüber. Conny fragt: „Sie können mir nicht erzählen, daß das der einzige Grund war. So dumm kann keiner sein. Sie müssen doch zumindest Gerüchte über die kaiserlichen Greueltaten gehört haben. Also: Wieso sind Sie über neutrales Territorium gereist, um sich vor vier Monaten von uns rekrutieren zu lassen?“ Schweigen. „Sagen Sie es schon!“ Langsam, aber sicher wird auch Conny laut. „Laß es Conny.“ meint Philipp plötzlich. „Ich kanns mir schon beinah denken. Wahrscheinlich haben sie die Frau irgendwie in der Hand...Frau Rosleff-Sörensen, wen haben die Gepos verschleppt? Ihre Eltern? Geschwister? Die beste Freundin?“ Nach einer Pause fragt Philipp weiter: „Ihren Mann?“ Beke zuckt zusammen und blickt auf. „Volltreffer, Philipp.“ grinst Conny und wendet sich wieder an Beke: „Haben die Kaiserlichen gesagt, wohin sie den General bringen wollen?“ Beke schüttelt den Kopf. „Sie haben nur die ganze Zeit von Schattenlagant gelabert, was immer das sein soll." Bei diesen Worten dreht sich Karo abrupt um. Philipp, Conny und sie sehen sich an. Dann meint Karo zu einer der Wachen, die an der Tür stehen: „Bringt Frau Rosleff-Sörensen wieder in ihre Zelle!“ „Das war alles?“ wundert sich Beke. Philipp zuckt die Achseln: „Zum Glück sind Sie nicht allzu widerspenstig gewesen.“ Dann führen die beiden Wachen Beke wieder ab. Als Karo, Philipp und Conny allein in dem Büro sind, meint Karo: „Also nach Schattenlagant bringen sie Stefan.“ Conny nickt und Philipp flüstert nur: „Schattenlagant.“ Ja, Schattenlagant. Von allen Löchern, in das die Kaiserlichen ihre Gefangenen stecken, das geheimnisvollste und berüchtigste. Nur wenige wurden dorthin geschickt: Drei Führer des Maintal-Aufstandes vom Sommer 1787 (womit ja der Krieg begonnen hatte) sollen dorthin verschleppt worden sein und im Frühjahr mal ein preußischer Spion. Keiner ist wiedergekommen. Und niemand – nichtmal das Spionagenetz von „Schimäre“ – hat bislang herausfinden können, wo Schattenlagant liegt. Tief und hörbar atmet Karo durch, bevor sie nun die neuen Befehle erteilt: „Conny, bis Stefan wieder da ist, müssen wir das Oberkommando neu strukturieren. Laß für übermorgen Wahlen ausschreiben. Stimmberechtigt sind alle ‚Schimäre‘-Soldaten, auch die der Spezialbataillone in der Türkei, auf den Färöern usw.“ „Du willst jetzt eine Neuwahl des Oberbefehlshabers durchführen?“ Conny ist skeptisch. Karo kommt wieder vom Fenster zurück. „Sicher.“ erwidert sie. „Ist doch beste demokratische Freiheitskämpfertradition.“ „Und wer soll zur Wahl stehen?“ „Ich und Valkendorn. Vorausgesetzt, Philipp hat nichts dagegen.“ Philipp steht auf und deutet eine Verneigung an. „Nein, habe nichts dagegen. Aber wenn Du die Wahl gewinnst und zur Frau General befördert wirst, hätte ich gerne die Leitung über die Suchaktionen.“ Nickend antwortet Karo: „Die wirst Du haben Philipp. Such Stefan, finde und befreie ihn. Und wenn Du schon dabei bist: Mach Schattenlagant platt. Fang am besten schonmal an.“ Conny steht ebenfalls auf: „Ich werde dann mal die Wahl vorbereiten. Philipp, ich werde meine Leute unsere Spionageberichte nach allem durchforsten lassen, was wir über Schattenlagant haben.“ „Danke Dir, Conny.“ „Nichts für ungut.“ Conny verläßt den Raum. „Philipp?“ „Ja, Karo.“ „Du weiß, daß jetzt alle Welt denkt, ohne Reiss wäre ‚Schimäre‘ nur eine Kampfeinheit wie jede andere auch.“ „Ja. Und es ist jetzt an uns, zu beweisen, daß ‚Schimäre‘ auch ohne Stefan weiterexistiert. Sonst wären all die Opfer der letzten Monate umsonst gewesen.“ Beide umarmen sich, Philipp klopft Karo auf die Schulter und sie ihm. „Keine Sorge, Karo. Ich werde ihn finden. Bislang war es nur ein Krieg um die Freiheit.“ Er löst sich wieder von ihr. „Und was ist es jetzt, Philipp?“ An der Tür bleibt er stehen. Über die Schulter hinweg antwortet er: „Jetzt ist es persönlich.“ Dann verläßt er den Raum. Als er die Tür schließt, hört er nicht mehr, wie Karo noch fragt: „Ach, ist es das nicht schon seit dem Tod Deiner Ex-Frau?“ Christiane Alleker und Philipp waren schließlich einmal verheiratet gewesen. Als Philipp in die Eingangshalle kommt, begegnet ihm die Times-Sonderkorrespondentin Reindl. Diese immer etwas leicht flatterhaft wirkende Frau mit ihren dunklen Gewändern ist trotz ihrer Arbeit für eine britische Zeitung Deutsche. Sie stürzt sich direkt auf Philipp. „Kapitän zur See, ist es wahr, was ich gehört habe?“ Dann fällt es ihr ein. „Oh, entschuldigen Sie. Guten Tag erstmal.“ Philipp atmet tief durch, dann lächelt er. „Guten Tag, Frau Reindl. Was haben Sie denn gehört?“ „Das der General tot ist.“ „Er ist nicht tot.“ „Sondern?“ „Sie können es ruhig veröffentlichen: Er wurde gefangengenommen. Und deshalb lassen Sie jetzt bitte auch Frau Generalleutnant Sus in Ruhe. Sie braucht Ruhe.“ Philipp geht an Frau Reindl vorbei, aber die läßt nicht locker. „Und was gedenkt ‚Schimäre‘ jetzt zu tun?“ Philipp wirbelt herum: „Ihn rausholen und den Arschlöchern eins auf die Zwölf geben – was denn sonst?“ Ohne weitere Worte geht er zur Funkabteilung. Für die bevorstehende Jagd würde er jeden brauchen, den er kriegen kann... „Ich schwöre bei allem was mir heilig ist und vor Zeugen, dass ich für die Freiheit aller Menschen kämpfen und diese gegen die Mächte der Unterdrückung mit meinem Leben verteidigen werde. Ich schwöre, mich für die Menschenrechte einzusetzen und der mit der Freiheit verbundenen Verantwortung gerecht zu werden. Dieser Schwur wird bis über meinen Tod hinaus bestehen. Es lebe die Freiheit und der Friede, deren ewiger Diener ich nunmehr bin.“ Der Eid, den jeder „Schimäre“-Kämpfer bei Aufnahme in die Truppe schwören muß Der Himmel über Minsk ist grau, es regnet seit Tagen ununterbrochen und es ist kalt. Auf den Straßen patrouillieren Sicherheitskräfte des kaiserlichen Heeres, die es freilich längst aufgegeben haben, die Bettler auf den Straßen zu vertreiben – es sind die Menschen, die durch die Kämpfe im September ihr Obdach verloren haben. Wer sich in der Stadt umsieht, erkennt es: Zahlreiche eingestürzte oder ausgebrannte Häuser, in den Vororten liegen gar ganze Straßenzüge in Schutt und Asche und selbst in der Innenstadt sind die Fußgängerzonen von Granatkratern verunziert. Eines der wenigen größeren Häuser, die abgesehen von zerbrochenen Scheiben und ein paar Einschußlöchern im Putz keine größeren Schäden erlitten haben, ist das kaiserliche Konsulat, ein barocker Bau im Norden der Stadt. Jetzt hat man das Konsulat kurzerhand zum Hauptquartier der Heeresgruppe D umfunktioniert, deren Oberbefehlshaber Generaloberst Schörner, ein energischer Mann, bereits Pläne für eine Winterschlacht um Moskau am ausbrüten ist. An diesem frühen Abend hat Schörner zwei Gäste im Hause: Den sächsischen Kurfürsten Ludwig, der die 2. Reichsarmee zwischen Welisch und Jelnja kommandiert (in diesem Frontabschnitt liegt auch der Abschnitt von „Schimäre“), und Standartenführer Oschmann, Chef der Gepo-Einheit „Kronos“. Der Kurfürst kommt zuerst an. In der Eingangshalle empfängt ihn Schörner. „Eure Hoheit, es freut mich jedes Mal...“ „Auch, wenn ich mal nicht mit neuen Eroberungen dienen kann?“ „Selbst dann.“ Beide lachen. „Aber bitte, Kurfürst, lassen Sie uns doch in meinen Privaträumen weitersprechen.“ „Aber gerne.“ Schörner winkt seinem Adjutanten zu: „Wenn der Standartenführer auftaucht, bringen Sie ihn bitte zu uns.“ „Jawohl, Herr Generaloberst.“ Die privaten Räume Schörners sind edel eingerichtet: Verzierte Holzstühle und Tische, Ledersessel, weiche Teppiche, auf Kommoden vergoldete Kerzenständer. Im kleinen Schlafzimmer steht ein wahres Himmelbett. Geht man vom gemütlichen Wohnzimmer eine Diele entlang, kommt man zu einer kleinen Küche. „Fast wie bei mir in Dresden...“ spöttelt der Kurfürst. „Ja, ist mir aber auch bald etwas zu luxuriös. Ich hab ja alles so übernommen. Aber die Küche ist praktisch. Sie wissen, wie gerne ich koche.“ Schörner deutet auf die drei Ledersessel um einen kleinen Holztisch im Wohnzimmer. „Bitte setzen Sie sich doch, Kurfürst.“ Der Kurfürst setzt sich und Schörner tritt an einen Schrank, den er aufklappt. Der Schrank aus dunklem Holz entpuppt sich als kleine Zimmerbar. „Kurfürst, was hätten Sie gerne?“ „Cognac ist schon in Ordnung.“ „Nicht doch ein Bier?“ „Oh doch, wenn Sie was haben, Herr Generaloberst!“ Lächelnd kommt Schörner mit zwei Bierflaschen wieder. „Bitte sehr, Kurfürst!“ Dann setzt sich auch Schörner. Sein Gast macht zuerst die Bierflasche auf und reicht den Flaschenöffner dann an Schörner. Beide trinken aus der Flasche. „Man kommt sich direkt vor wie ein einfacher Soldat..." meint der Kurfürst. „Stimmt.“ Es klopft an den Türrahmen. Schörner und der Kurfürst sehen zur Tür herüber. „Standartenführer, bitte kommen Sie doch und setzen Sie sich.“ „Danke, Herr Generaloberst.“ Oschmann rückt kurz seine Augenklappe zurecht (manchmal juckt sein Auge immer noch) und setzt sich dann auf den dritten Sessel. „Wollen Sie was trinken?“ „Nein, Generaloberst Schörner. Trotzdem danke.“ „Nun gut. In Ihrer Mitteilung hieß es, Sie hätten einen Erfolg erzielt?“ Auch der Kurfürst wirft Oschmann jetzt wissbegierige Blicke zu. Er weiß auch nicht mehr, als das Oschmann in seinem Frontabschnitt eine geheime Aktion durchgeführt hat. Jörg Oschmann setzt ein gehässiges Grinsen auf. Ein paar Momente lang läßt er die Spannung wirken. Dann sagt er: „Ich hab ihn.“ Schörner hebt eine Augenbraue. „Wen?“ Oschmann betont jetzt jedes Wort: „General Stefan Reiss von ‚Schimäre‘.“ Schörner lacht erstmal auf, fängt sich dann wieder und erwidert dann: „Sie machen Scherze!“ „Nein. Ich scherze niemals.“ „Sie wollen uns wirklich weiß machen, daß Sie diesen Störenfried endlich haben?" hakt auch Kurfürst Ludwig nach. Oschmann nickt. „Ja, ich hab ihn geschnappt. Zur Zeit wird er nach Schattenlagant gebracht und dort werden wir dann einen Schauprozeß durchziehen.“ Er macht eine kurze Pause, um sich eine Zigarette anzuzünden. „In der Zwischenzeit würde ich vorschlagen, ‚Schimäre‘ anzugreifen. Einen besseren Moment als jetzt, wo diese Verrückten kopflos sein dürften, wird es kaum geben.“ „Da muß ich dem Standartenführer recht geben, Kurfürst.“ bemerkt Schörner und fragt dann: „Wieweit hat sich Ihre Armee bereits von den Kämpfen im September erholt?“ „Es geht so, Generaloberst. Unsere Munitionsbestände sind wieder aufgefüllt, die Kompanien haben fast wieder Sollstärke. Aber ich muß auch daran denken, die Vorbereitungen für die Schlußoffensive gegen Moskau voranzutreiben. Sie kennen die Befehle des Oberkommandos.“ „Ich weiß.“ erwidert Schörner. „Aber ich bin auch Ihr Vorgesetzter, Kurfürst, und befehle Ihnen daher, sobald wie möglich die Stellungen von ‚Schimäre‘ anzugreifen.“ „Aber bei der derzeitigen Wetterlage gibt das die reinste Schlammschlacht!“ Schörner zuckt die Achseln. „Und? Betrachten Sie es als vorbereitende Maßnahme für die Moskauer Offensive. Sie haben drei Tage für die Vorbereitungen.“ Allmählich wird es dunkel und Fraker fragt sich, ob es wirklich eine so intelligente Idee war, sich in die Wälder abzusetzen. Freilich: Die Alternative wäre gewesen, erschossen zu werden. Sie hatten mitten im Gefechtsgetümmel zwei Gepos überwältigen können. Die Uniformen paßten nicht perfekt, aber was soll’s. Einem Gepo-Offizier konnte man anschließend plausibel machen, daß man nicht alle umbringen, sondern wenigstens Tina als Gefangene für ein Verhör mitnehmen solle. So konnten Fraker, Krakowsky und Tina ins Hinterland der kaiserlichen Front gelangen. Und haben sich bei der erstbesten Gelegenheit dann in die Büsche geschlagen. Und dann sind sie den Tag durchmarschiert, auf Wildwechseln und zugewucherten Waldpfaden. Einmal mußten sie einer Artilleriestellung ausweichen, dann einem kaiserlichen Biwak. Unterwegs wechselten sie wieder die Uniform: Gepo-Uniformen wieder in die beiden Rucksäcke, die sie mit haben, und „Schimäre“-Uniform wieder angezogen. Nur Tina hatte keinen Uniformwechsel nötig. Die Gasmasken brauchte man auch längst nicht mehr. Wie gesagt: Jetzt dämmert der Abend schon herauf und die drei liegen zwischen dichten Farnen am Rande eines Feldes, auf dessen anderer Seite eine Häuseransammlung zu sehen ist. Einige Menschen bewegen sich dort, offenbar Zivilisten. Oder? Es hängt ganz davon ab, wie weit man gekommen ist. „Und, Oberfeldwebel, wo sind wir?“ fragt Fraker nochmal nach, während Krakowsky mit seinem Kompaß rumhantiert, um eine grobe Einschätzung zu kriegen, wo sie sind. „Ganz sicher bin ich nicht, Hauptmann. Eventuell irgendwo nördlich von Smolensk.“ „Eventuell?“ krächzt Tina neben ihm. „Oberfeldwebel, ein wenig genauer wäre mir schon recht.“ „Tut mir leid, Oberfähnrich, aber dafür bräuchte ich entweder eine Karte – oder wir müssen die da vorn fragen.“ Krakowsky deutet auf die Häuseransammlung. „Wissen Sie was, Oberfeldwebel? Das ist eine ausgezeichnete Idee!“ Fraker klopft Krakowsky, der ihn zusammen mit Tina etwas ungläubig anschaut, auf die Schulter. „Hauptmann, können Sie überhaupt Russisch?“ fragt Tina mal ganz harmlos. Fraker zuckt die Achseln. „Ein paar Brocken Russisch kann ich schon.“ Damit steht er auf, schultert sein Sturmgewehr und meint noch, ohne die beiden anzusehen: „Den erbeuteten Säbel und den Rucksack mit der Gepo-Uniform laß ich bei euch. Wenn ich in einer halben Stunde kein Signal geben, verzieht euch.“ Mit langsamen Schritten setzt er sich in Marsch und geht gemächlich über den Acker auf das Dorf zu. „Woher kann Fraker Russisch?“ wundert sich Tina. „Glauben Sie mir, Oberfähnrich, ich hab einen Verdacht, aber den wollen Sie bestimmt nicht wissen.“ „Bordell.“ Krakowsky schaut sie an. „Woher..?“ „Nur geraten.“ „Ach sooo...“ meint Krakowsky gedehnt und schluckt dann langsam, als er den Stiefel zwischen seinen Schulterblättern spürt. „Spüren Sie das auch, Oberfähnrich?“ krächzt er gepreßt, Tina nickt nur. Eine tiefe Männerstimme sagt hinter ihnen: „Ruki werch!!“ Fraker erreicht nach ein paar Minuten den Ort. Es sind eigentlich nur ein paar dreckig wirkende Holzhütten mit einigen Schuppen dazwischen. Zwischen schlammigen kleinen Betten laufen kackernd Hühner herum. Auf einer Bank vor dem, was wohl die Dorfkneipe sein soll, sitzt ein alter Mann mit Mütze und Stock. Alle anderen Bewohner, die er noch auf dem Weg hierher gesehen hatte, haben sich verkrümmelt. Äußerste Wachsamkeit! mahnt Fraker sein Instinkt. Er bleibt vor dem alten Mann stehen und versucht es mit einem Englischen „How this city is called?“ Kaum hat Fraker es ausgesprochen, kann er sich des Gefühls nicht erwehren, daß dies nicht gerade das beste Englisch war, mal ganz abgesehen davon, daß es glatter Irrsinn ist, dieses Kaff als „City“ zu bezeichnen. Als der alte Mann grinst, denkt Fraker zuerst: Ah gut, er grinst über den selben Unsinn wie ich, kann also Englisch. Erst im zweiten Anlauf dämmert es Fraker: Scheiße, der grinst wegen was anderem! Aber da ist es auch schon zu spät. „Ruki werch!!“ Fraker spürt etwas hartes zwischen seinen Schulterblättern – wahrscheinlich der Lauf eines Gewehres. Und der alte Mann meint mit knitteriger Stimme auf Deutsch, wenn auch mit russischem Akzent: „Werter Herr, das heißt ‚Hände hoch‘ und Sie sollten der Aufforderung lieber Folge leisten, wenn Sie noch wissen wollen, wie dieses Kaff hier heißt...“ Samstag, der 11. Oktober Der britische Truppentransporter Black Prince pflügt durch die mit weißen Kronen besetzten Wasserwogen. Im Westen, dort wo London und die südostenglische Küste liegen, zucken immer wieder Lichtblitze auf. Wenn man genau in den Wind hört, hört man das ferne Grollen. Wieder einmal fliegen die kaiserliche Luftwaffe und die Fliegergeschwader der Pariser Putschistenregierung ihre Luftangriffe gegen Großbritannien. Auf der Brücke der Black Prince steht Oberstleutnant Christoph Krammer, Chef des Spezialbataillons 4, das freilich momentan nur aus anderthalb Kompanien besteht. „Diesen Anblick haben wir jede Nacht.“ meint der Kapitän des Schiffes, Graybone, ein bärtiger älterer Mann, der schon als junger Offiziersanwärter im Siebenjährigen Krieg und als Kommandant eines Zerstörers im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gegen Frankreich gekämpft hat. Graybone deutet auf die Lichter am Horizont. „Hoffentlich stehen die Unterkünfte für meine Leute noch.“ bemerkt Krammer. „Darauf würde ich mich nicht verlassen.“ erwidert Graybone. Graybone hat sich in den letzten Tagen mit Krammer angefreundet, dessen deutschen Akzent er lustig findet. Wenn sich Krammer auch bemüht, bei den Gesprächen mit Graybone sein Englisch aufzubessern. „Sagen Sie, Commodore, was hat es mit den Gerüchten auf sich, daß kaiserliche Schnellboote hier operieren?“ Graybone macht eine wegwerfende Handbewegung. „Keine Sorge, wir werden von drei britischen und vier niederländischen Zerstörern sowie von niederländischen Torpedobooten gesichert. Da kann kaum was schiefgehen.“ Kaum – Krammer weiß aus eigener Erfahrung, daß dieses kleine ‚kaum‘ schlachtentscheidende Unterschiede beschreiben kann. Nachdenklich schaut Krammer zum Horizont. Es ist der letzte Konvoi von drei Truppentransportern, mit denen die letzten alliierten Soldaten – 200 „Schimäre“-Kämpfer und 400 niederländische Soldaten – aus dem letzten Brückenkopf an der niederländischen Küste evakuiert werden. Seit zwei Wochen liefen die Evakuierungen nun, schubweise, immer nachts. Nach allem, was Krammer gehört hat, wurden 40000 niederländische und britische Soldaten (letztere waren erst im September übers Meer geschickt worden) von der Royal Navy und der niederländischen Marine vor dem kaiserlichen Ansturm evakuiert. Dabei waren die Kaiserlichen noch nichtmal zahlenmäßig überlegen gewesen – sie hatten nur einfach die besseren Nachschubverbindungen, schon bald die Lufthoheit und eine entschlossenere Führung. Lediglich die Versuche der Kaiserlichen, die Evakuierungen durch den Einsatz von UBooten zu vereiteln waren recht kümmerlich. Graybone hatte Krammer erst vorgestern erzählt, wie zwei britische Zerstörer ein U-Boot versenkt hatten. Die Evakuierungsoperation ist bislang erstaunlich glatt verlaufen. Und jetzt, nach mehreren Tagen Verzögerung wegen zu schlechten Wetters, endlich der letzte Transportschub. Es wäre schon echt gemein, wenn jetzt noch was passiert. Eigentlich denkt Krammer schon über den nächsten Auftrag nach. Der letzte Befehl vom „Schimäre“-HQ sprach davon, er solle einen Einsatz in Köln durchziehen, um dort die Lage zu stabilisieren. Schon wieder – erst Ende August waren seine Leute in Köln gewesen und hatten bei der Befreiung von Lagergefangenen geholfen. Ein Räuspern hinter ihm reißt Krammer aus seinen Gedanken. Ein schmaler britischer Funkoffizier, der neben dem hochgewachsenen Krammer mit seinem kurzen Bärtchen und den langgewachsenen Haaren richtig klein wirkt, überreicht ihm einen Zettel und erklärt: „Wurde von Ihrer Funkstelle in Ramsgate an uns weitergeleitet. Eine Weisung direkt vom ‚Schimäre‘-HQ.“ „Danke.“ Schnell faltet Krammer den Zettel auseinander und liest die elektrisierende Mitteilung: „Letzter Befehl widerrufen, Lage in Köln geklärt. – Bereithalten für neuen Einsatz. – Feind hat General Reiss gefangengenommen. – Kommando an Gen.-Leut. Sus übergeben. – Arbeiten an Rettungsaktion. Gez.: Brig. Schönmann.“ „Und, was ist es, Krammer?“ fragt Graybone in seiner eigentümlich kumpelhaften Art. Doch Krammer sieht ihn nur düster von der Seite an. „Eine wahre Hiobsbotschaft, Commodore, eine Hiobsbotschaft...“ Ein ferner Ruf weckt Sarah. Müde richtet sie sich auf der Matraze auf. Die Matraze liegt auf dem Boden einer aus Holz und Wellblech gebauten Hütte irgendwo in der Eifel. Verborgen hinter einem kleinen, grünen Schuppen für Angelgerät und unter einigen Nadelbäumen liegt die selbstgebaute Hütte am Rande eines terrassenartig angelegten Geländes mit vier Fischteichen. Rohre leiten das Wasser der oberen in die unteren Teiche, wobei die Wasserstrahlen mit einem plätschernden Dauergeräusch in die jeweils unteren Teiche fallen. Der unterste Teich, genannt „Einser“, hat einen eigenen Steck. Da es in den letzten Tagen immer wieder geregnet hat, sind die Teiche ziemlich voll und die umgebende Wiese weich. Sarah rappelt sich auf, zieht sich ein Hemd über und legt die Gummistiefel an; wegen der nächtlichen Kälte hat sie die Jeans über Nacht anbehalten. Auf den ersten Blick wirkt ihr Versteck fast paradiesisch, aber die Nachtkälte ist tückisch. Mit einem Blick registriert sie, daß Dominik und Jenny noch schlafen; sie auf dem einzigen Sofa, er auf einer weiteren Matraze fast direkt vor der Tür. Sarah manövriert daran vorbei. Gar nicht so einfach, denn es ist dämmrig in der Hütte und sie hat die Anordnung des Tisches, zweier Stühle, eines kleinen Gasherdes, eines Schrankes und einer Gasflasche sowie eines Stützpfeilers mitten im Raum noch nicht wirklich realisiert. Aber sie schafft es und schiebt mit einem schabenden Geräusch die Schiebetür ein Stück auf und steht dann draußen. Es ist noch früh am Morgen, vielleicht 9 Uhr, und ziemlich kühl; sie fröstelt. Sie blickt zum Tor mit der Einfahrt hoch; auf der großen Rasenfläche unterhalb des Tors sind zwei kleinere Zelte aufgebaut. Raschen Schrittes geht sie an dem Schuppen vorbei zum Tor. Dort kommt ihr bereits ein Widerstandskämpfer entgegen, den Sarah bei der Flucht aus Köln als Patrick Rieger kennengelernt hat. Er trägt einen markanten Bart, der sich an den Seiten hochzieht, aber nicht zu lang und zu dicht ist. „Sie sind weg!“ erstattet er Meldung. „Wer ist Weg?“ „Unsere beiden Gothics.“ erklärt er. „Petra und Ben.“ Vor dem Tor verläuft ein Feldweg, der sich nach links im Wald verliert, rechts nach etwa 50 m auf die Straße trifft. Von rechts kommt Linda Meier-Grolman zurück, von links Sabine Granrath. Vom Haus her kommt jetzt auch Dominik Kipshoven und von einem der Zelte kommt Chris Loewisch herüber. „Was ist los?“ fragt sie. „Petra und Ben sind weg.“ erklärt Patrick nochmal und Linda fügt hinzu: „Ja, absolut keine Spur. Das hat gerade noch gefehlt...“ Alle nicken; erst in der Nacht haben sie die Funknachricht aufgefangen, daß Reiss in Gefangenschaft geraten ist. Säuerlich meint Linda: „Sabine, Dominik, Chris, ihr packt ein paar Sachen zusammen und dann versucht der Spur der beiden zu folgen.“ Dominik nickt. „Alles klar. Viel Zeit zum Auspacken haben wir ja eh nicht gehabt – und viele Klamotten haben wir eh nicht mit!“ Er geht zurück zur Hütte und schnappt sich seinen Rucksack für seinen mageren Kleiderbestand, den er noch dabei hat. Die Luft in den Bergen ist so klar, daß man kilometerweit schauen kann. Und so geht es Nicole Elsing, Oberstleutnant bei „Schimäre“ auch jetzt. Hoch über dem Tal segelt sie dahin mit dem grauen Drachenflieger. Zu ihrer rechten tief unten die Ortschaften Naters und Brig, wo die 2. mailändische Alpinidivision einen Zug Infanterie einquartiert hat. Die kleine mailändische Armee, die dem kaiserlichen Oberkommando untersteht, hält zusammen mit den Reichstruppen und den Truppen der Pariser Putschistenregierung die Schweiz seit September besetzt. Zum Glück hat der Wind momentan keinen zu starken Hang nach Naters. Nicole weiß, daß sie unbedingt die Wiese am Nordwesthang des Gerstenhorns (2927 m) erreichen muß. Von dort aus geht es dann weiter zum Stockhorn-Biwak. Wenn alles gut geht. Wie lange kann es dauern, bis der Feind merkt, wer hier mit einem Drachenflieger unterwegs ist? Naja, spätestens, wenn die von Nicole gelegten Zeitbomben die Artilleriestellung auf dem Glishorn (2525 m) in die Luft gejagt haben... Ähnliche Gedanken gehen auch Unteroffizier Christian Koszarek durch den Schädel, der unweit der vorgesehenen Landestelle auf dem Gerstenhorn steht, den Feldstecher in der Hand. Er ist so etwas wie der Adjutant von Nicole Elsing; sie weiß freilich nicht, daß Reiss ihm mal befohlen hat, auf die Frau aufzupassen. Was nur manchmal gar nicht so leicht ist, da die Frau ihren eigenen Kopf hat. „Mädchen, behalt bloß die richtige Flugbahn bei...“ murmelt der rothaarige, ein wenig hager wirkende Unteroffizier. Er und Nicole haben zusammen mit einigen anderen „Schimäre“-Agenten aus versprengten Überresten der früheren Schweizer Armee eine Untergrundarmee aufgebaut. Die freilich nicht wirklich zu „Schimäre“ gehört, sondern nur von der Erfahrung und dem Einfallsreichtum von Elsing, Koszarek und Co profitieren. Dieser Einsatz hier gehört zu einer Reihe von Nadelstichen, die man dem Gegner zufügen will. Und eine Frage kümmert Christian immer wieder: Ist das auch wirklich Nicole, da am Drachen? Es ist zwar ihr Drachen, aber losgezogen waren sie zu dritt. Ein Schweizer Feldwebel namens Hänel war noch dabei gewesen. Es müßten zwei Drachenflieger sein. Mehrere Donnerschläge schallen durch das Tal und lassen die Luft vibrieren – und vom Glishorn steigt Rauch auf. Die Stellung mit zwei 7,5-cm-Gebirgskanonen ist also erfolgreich in die Luft geflogen. Diese Geschütze kontrollierten die Talstraße. Jetzt nicht mehr. Es ist kein wirklicher Sieg, aber immerhin könnte es die Besatzungstruppen in Unruhe versetzen. Eigentlich ist es ja nur eine Botschaft: Wir haben noch nicht aufgegeben – im Gegenteil, wir kämpfen weiter! Bange Minuten lang ist Nicole noch in der Luft, während unten im Tal hektisch Autos hin und her fahren, als die Besatzungssoldaten die Ursache der Explosion ergründen wollen. Dann landet sie etwas holprig auf der Bergwiese. Christian kommt bereits herangelaufen, die Rucksäcke in der Hand. „Wo ist Hänel?“ „Tot.“ antwortet sie knapp, während sie sich vom Gestänge des Drachen befreit. Dann erklärt sie: „Bei Schußwechsel mit Wachposten gefallen.“ Dann klappen sie den Drachen zusammen und tragen ihn einige hundert Meter weit auf die andere Seite des Bergkammes, die Seite, die Naters abgewendet ist. Dort wartet, an einen Holzpflock gebunden ein Maultier. Rucksäcke (auch den des gefallenen Hänel), den Drachen und die Karabiner, die beide haben, werden dem Maultier aufgeladen und dann macht man sich langsam auf den Weg zum Stockhorn-Biwak. Der Marsch führt durch ein kleines Tal mit Bach und dann wieder den Hang hinauf. Es dauert etwa eine Stunde, dann sind sie da. Vier Schweizer Soldaten warten bereits. „Wo ist Hänel?“ ist ihre erste Frage und Nicole Elsing erklärt direkt: „Tot.“ Die Männer senken kurz den Kopf und bekreuzigen sich. Dann tritt einer, der Funker des Trupps, vor: „Nachricht aus Kandersteg eingetroffen.“ Er reicht Koszarek die Notiz. „Und, was ist es, Christian?“ fragt Nicole, die das Gepäck vom Maultier ablädt, damit dieses sich kurz ausruhen kann. „Eine schlechte Nachricht.“ antwortet der Unteroffizier. „Der Feind hat den General gefangengenommen. Für morgen ist eine Neuwahl des ‚Schimäre‘-Befehlshabers ausgeschrieben.“ „Sie haben Stefan?“ In Nicoles Stimme schwankt doch leichte Panik mit. „Ja.“ bestätigt Christian. „Weitere Nachrichten werden bestimmt folgen.“ Koszarek schluckt. „Frau Oberstleutnant, ich weiß daß Sie dem General näher stehen als ich, aber ich glaube Priorität hat jetzt die Neuwahl des Befehlshabers.“ Nicole hat sich kurz auf einen Stein, der aus der Wiese schaut, gesetzt und sieht auf. „Ja, stimmt. Ich weiß nur leider nicht, wie eine solche Wahl durchgeführt wird.“ „Stimmt, ich auch nicht.“ Christian geht zu seinem Rucksack rüber und holt sein ‚Taschenbuch für Soldatenausbildung‘ heraus, das jeder „Schimäre“-Kämpfer kriegt. „Ich meine es müßte hier irgendwo drinstehen.“ Mit raschen Handbewegungen blättert er das Büchlein durch, liest an einer Stelle kurz und meint dann: „Hier steht, daß je nach Größe des im Einsatz befindlichen Verbandes die Bataillons-oder die Regimentskommandeure beim Antreten der Truppe diese Befragen sollen. Der Kommandeur gibt dann bei seinen Vorgesetzten für denjenigen die Stimme ab, für den bei der Truppe eine Mehrheit zustandegekommen ist.“ „Und was heißt das für uns?“ fragt einer der Schweizer. „Gar nichts.“ erwidert Nicole direkt. „Das gilt nur für ‚Schimäre‘-Kämpfer. Da wir hier jedoch keinen wirklichen Einheitenstatus haben und hier in der Schweiz nur wenige ‚Schimäre‘-Mitglieder sind, würde ich sagen, daß der Unteroffizier, ich und unsere Agenten in Kandersteg uns auf eine Stimme einigen.“ „Klingt vernünftig.“ stimmt Koszarek zu. „Genau.“ Nicole steht wieder und zusammen mit einem Schweizer belädt sie wieder das Maultier. „Also, laßt uns aufbrechen, damit wir zur Wahl wieder in Kandersteg sind.“ In einer mehrstöckigen Mietskaserne im Mihejkovo, einem Vorort von Jarcevo, ist das Quartier des Spezialbataillons 1 untergebracht. Zwei Kompanien umfaßt diese Einheit – beide von Frauen geführt: Die eine von Leutnant Sarah Weigang, die andere von Leutnant Marta Rambowicz. Chef des Bataillons ist Oberst Christian Jacke, ein richtiger Draufgänger. An diesem Nachmittag, das Mittagessen ist gerade eingenommen worden, ist hoher Besuch da: Kapitän zur See Philipp Kipshoven in seinen ureigensten schwarzen Klamotten, was er gerne als „volles Ornat“ bezeichnet. In Jackes Quartier, einer kleinen Ein-Zimmer-Wohnung mit Küchennische, läßt Kipshoven Jacke, Rambowicz und Weigang antreten. Philipp hat es sich auf dem alten, kotzgrünen Sofa (wer immer die Einrichtung ausgesucht hat, hatte einen beschissenen Farbgeschmack) bequem gemacht, auf einem einfachen Holzstuhl sitzt Jacke – verkehrtherum, Arme und Kinn auf die Rückenlehne gestützt. Auf den beiden schon etwas abgewetzten Sesseln, die zum Sofa gehören und die selbe Farbe wie dieses und der versiefte Teppich haben, sitzen Sarah und Marta. Gerade stellt Kipshoven ein Glas Wasser auf dem niedrigen Holztisch, der schon ein paar Dellen aufweist, ab, nachdem er einen Schluck daraus genommen hat. „Also, wir haben den vielleicht heikelsten Auftrag zu erfüllen, den ‚Schimäre‘ seit Gründung je ausführen mußte.“ beginnt er. „Was, sollen wir etwa den General aus der Scheiße holen?“ fragt Marta auf ihre unnachahmliche Art und rückt sich ihre dünne Brille auf der Nase zurecht. „Sie haben es erfaßt, Frau Leutnant. Allerdings wird das Spezialbataillon 1 dies nicht unbedingt als Ganzes durchführen können. Zunächst müssen wir einen kleinen Trupp ins Reich schleusen, der unter als Zivilisten getarnt Schattenlagant finden muß.“ „Moment mal...“ unterbricht Jacke. „Philipp, hast Du gerade Schattenlagant gesagt?“ „Ja, genau das habe ich. Soweit wir das vermuten können, werden sie Stefan dorthin bringen.“ „Ist die C-Abteilung überhaupt sicher, daß es Schattenlagant gibt?“ fragt Sarah zweifelnd. Achselzuckend erwidert Philipp: „Es ist bislang unsere einzige Spur. Wenn es Schattenlagant gibt, müssen wir es finden. Wenn es das Teil nicht gibt, müssen wir das wirkliche Gefängnis finden. Jedenfalls werden wir dafür verdeckt arbeiten müssen.“ „An was hast Du konkret gedacht?“ will sich Jacke erkundigen. „Ich dachte an drei bis fünf Leute, die mit dem Fallschirm abgesetzt werden und in Zivil Aufklärung betreiben, wobei sie von unserem Agentennetz unterstützt werden. Für die eigentliche Befreiungsaktion wird mir das Oberkommando alle nötigen Truppen zur Verfügung stellen, vornehmlich die Spezialbataillone.“ Sich in dem Sessel zurücklehnend meint Marta: „Das klingt nach einem aufregenden Vorhaben. Wenn wir den Kaiserlichen mal wieder einen reinwürgen – also, dann bin ich dabei.“ Lächelnd kommentiert Jacke: „Philipp, sie hat immer so eine leicht enthusiastische Art...“ Marta wirft ihm einen verärgerten Blick zu. „Is schon gut, Jacke. Wenn die Lady das unbedingt möchte, kann sie gerne mitkommen.“ „Moment mal, Du willst selber den ersten Teil der Aktion übernehmen?“ „Ja.“ „Na, dann bin ich auch dabei!“ verkündet Jacke. Und wendet sich dann an Sarah: „Frau Leutnant können Sie unsere Einheit für ein Weilchen allein übernehmen?“ „Sicher, Herr Oberst. Es wird mir eine Freude sein. Und wenn Sie drei Reiss gefunden haben: Rufen Sie nur und wir rücken an.“ „Das ist ein Wort.“ Philipp reicht ihr die Hand über den Tisch, trinkt dann sein Glas leer und beschließt dann: „Morgen, 21 Uhr, treffen wir uns auf dem Flugplatz.“ Die Journalistin Uta Reindl sitzt gerne nach einem leckeren Mittagessen, das sie meist im Speisesaal des „Schimäre“-HQs einnimmt – wofür ihr Reiss bei der Ankunft hier eine Ausnahmegenehmigung gab -, in der Sofa-Ecke in der Eingangshalle. Mit einer Tasse Kaffee und einer per Post aus Moskau gekommenen Times-Ausgabe macht sie es sich dort gemütlich. Dann kann sie immer sehen, was aus den Berichten geworden ist, die sie via Moskau – Teheran – Bagdad – Kairo – Madrid – Lissabon nach London schickt. Ein langer Weg für die Post, zum Glück zahlt die Zeitung. Erst jetzt findet sie, als sie die Zeitung aufschlägt, ihren Bericht, den sie Mitte September über die Schlacht in Polen und den Beginn des Rückzuges geschrieben hat. Dieser krasse Zeitunterschied ist ihr immer wieder mulmig. Dies macht einem bewußt, wie sehr sich der Krieg und vor allem sein Tempo seit dem letzten größeren Krieg – das war der Amerikanische Unabhängigkeitskrieg – verändert hat: Flugzeuge, Panzer, MGs, motorisierte Divisionen, Flugzeugträger, Großkampfschiffe, U-Boote, Fallschirmtruppen – sie machen früher undenkbare Dinge möglich. Für Eroberungen, für die Alexander der Große noch über 10 Jahre brauchte, braucht man jetzt gerademal ein bis zwei Jahre. Je nachdem, wie stark der Widerstand ist. Die Zerstörungskraft der Waffen und des Kampfes ist dabei ungleich größer. Manchmal kommt der Journalistin der Gedanke: Noch ein paar wilde Schlachten im Winter und im Sommer und dann ist es vorbei. Und wenn es so weitergeht wie seit anderthalb Jahren, dann wird die Koalition rund um den Kaiser Sieger bleiben und ihre Diktatur auf ganz Europa, wenn nicht die ganze Alte Welt ausdehnen. Was sie in der Zeitung liest ist nicht gerade erfreulich. Drei Überschriften lassen sie besonders aufhorchen: „Kaiserliche U-Boote versenkten 19 Schiffe aus Konvoi“; „Trägerflugzeuge bombardieren Alexandria“; „Spanischer Gegenangriff bei Pamplona gescheitert“. Reindl schließt die Augen. Das sind die spektakulären Nachrichten über die großen Kämpfe an den momentan weniger ruhigen Fronten. Noch weiß die Weltöffentlichkeit nicht, daß ein General, dessen Name in den Zeitungen noch nur eine kurze Erwähnung findet, der aber den Ostfrontkämpfen seinen eigenen Stempel aufgedrückt hat, entführt wurde. Als jemand durch die Eingangshalle eilt, schreckt die Journalistin aus ihren Gedanken auf. Es ist die schwarz (und damit eigentlich vorschriftswidrig) gekleidete Gestalt von Philipp Kipshoven, der kurz in Karos Büro eilt. Nach ein paar Augenblicken kommt er wieder raus, ein Blatt Papier in der Hand. Uta Reindl erkennt die Papiersorte – sie wird hier nur benutzt, wenn ein Befehl draufsteht. „Wohin, Kapitän?“ ruft sie ihm nur zu. Er wirft ihr einen hektischen Blick zu und meint im Hinauseilen: „Kann ich leider nicht sagen!“ Utas Mundwinkel zucken leicht vor Verärgerung, aber ihr Gespür für neue Entwicklungen wertet die gemachte Beobachtung sofort aus: Aus dem Schock von gestern ist Entschlossenheit geworden. Zwar machen besonders die Offiziere, die mit Reiss befreundet sind, immer noch einen aufgekratzten Eindruck. Auch Generalleutnant Sus wirkt weniger ausgeglichen und ruhig als sonst. Aber jetzt scheint man sich auf einen Kurs geeinigt zu haben. Und wie Frau Reindl diese Truppe kennt, heißt der Kurs: Den Chef raushauen! Wo kann Kapitän zur See Kipshoven dann wohl hin unterwegs sein? Als sie das Motorrad von Kipshoven nach Osten davonfahren hört, Richtung Flugplatz, ist es ihr klar: Zu Bohnsack, dem Chef der Fliegerabteilung. „Bei fast allen Streitkräften wird zu 40 % debattiert, zu 50 % vorbereitet und die restlichen 10 % von Zeit und Ressourcen verwendet man aufs Handeln. Bei „Schimäre“ist es genau andersrum: Nur 10 % der Zeit wird debattiert, ansonsten bereitet man Aktionen vor und führt sie aus.“ Bemerkung von Generaloberst Moltke zu einem russischen General, Oktober 1788 Bei Safonovo, etwa 37 km östlich von Jakovlevo entfernt, liegt der Flugplatz, wo die Fliegerabteilung von „Schimäre“ stationiert ist. Es ist bereits dunkel und Tanja läßt die Rollos ihres Zimmers in dem langen Flachdachgebäude, das etwa 200 m von der Landebahn entfernt als Unterkunftsgebäude dient, herunter. Dann geht sie wieder zurück zu ihrem Bett, wo Karo bereits an die Wand gelehnt wartet. Tanja, bereits im Schlafanzug, kuschelt sich an Karos Seite. Da Karo eben erst gekommen ist, hat sie noch ihre Uniform an. Es ist ein langer Tag gewesen. Sie hat die beiden Gläser mit Wein gehalten, jetzt gibt sie Tanja deren Glas zurück. Tanja küßt Karo auf die Wange und spielt mit einer Hand mit einer Haarsträhne Karos. „Morgen ist Wahl?“ „Ja.“ Karos Stimme klingt müde. Hastig trinkt sie einen Schluck von dem Wein, den sie selber mitgebracht hat. „Und dann werden wir ihn zurückholen.“ Tanja schaut zu ihr hoch. „Wie lang kennst Du den General jetzt schon?“ Erst zuckt Karo die Achseln, dann meint sie: „Etwa 16, 18 Jahre – über den Daumen gepeilt. Ich glaube noch länger ist nur Philipp mit ihm befreundet.“ „Wie lange denn?“ „Schon ihr ganzes Leben.“ Sie trinkt ihr Glas aus und stellt es vorsichtig neben sich ab. „Wir hatten eben noch eine Dienstbesprechung.“ fängt Tanja an, während Karo ihr mit einer Hand durch das dunkelblonde Haar streicht. Nach einer Pause fährt Tanja fort: „Bohnsack hat um Freiwillige für einen Sondereinsatz gebeten, den Philipp durchziehen will.“ Einen Moment lang macht Karos Herz einen Hüpfer, denn sie weiß, worauf Tanja hinaus will. Dann aber meint Karo: „Wenn Du den Job übernehmen willst, nur zu.“ Etwas überrascht schaut Tanja ihr tief in die Augen. „Und es macht Dir nichts aus?“ Karo schüttelt nur den Kopf. „Komm schon, sag was.“ „Is ja gut...Tanja, ich kenn das. Ich will Dir die Sache nicht ausreden. Hat Stefan ja auch nie geschafft, wenn ich Kopf und Kragen riskiert hab. Außerdem weiß ich, daß Du ihm noch was schuldest.“ „Dann ist es ja gut. Ich dachte schon, Du würdest sauer sein.“ Tanja legt einen Arm um Karo und kuschelt sich ganz eng an sie. Und sie muß an ihr erstes Zusammentreffen mit Reiss denken. Sie hatte ihn das erste Mal in Köln getroffen, nachdem sie von seinen Agenten aus dem Konzentrationslager Sechtem befreit worden war. Das Ganze, was dann folgte, hatte sie beeindruckt: Anstatt allzu sehr darauf rumzureiten, daß sie es nur ihm und seinen Leuten verdankte, wieder frei zu sein, band er sie in die nachfolgende Operation zur Befreiung aller anderen Gefangenen ein. Das ist jetzt etwas mehr als einen Monat her und Tanja ist inzwischen Pilotin. Und sie hat nicht vergessen, welchen Leuten sie ihre Freiheit zu verdanken hat. Die eingebrannte Gefangenennummer auf ihrem linken Unterarm erinnert sie bis heute daran, was die Alternative gewesen wäre. Dabei zu helfen, dend General zu befreien ist für sie das Mindeste. „Hoffentlich machst Du Dir keine Sorgen...“ „Mache ich mir aber.“ antwortet Karo. Tanja streicht ihr mit einer Hand über die Wange und küßt sie dann lang und innig, bevor sie erwidert: „Brauchst Du aber nicht.“ Sonntag, der 12. Oktober Wieviel Uhr es ist – er hat keine Ahnung. Seit seiner Gefangennahme hat er einen Knebel im Mund und eine Binde vor den Augen, seine Arme sind auf dem Rücken festgebunden. Alles, was er noch wahrnehmen kann, sind Geräusche, Gerüche, Ertastetes. So hat er immerhin mitbekommen, daß man ihn mit dem Flugzeug transportiert hat. Dann hat man ihn eine Weile in einem geschlossenen Raum festgehalten, anschließend wieder in einen Laster verfrachtet. Die seitdem andauernde Fahrt ist holprig gewesen. Im Ohr bemerkt er den Druckunterschied. Dadurch weiß Stefan, daß die Fahrt ins Gebirge geht. Seine Kehle ist staubtrocken. Nur einmal, während des Aufenthalts zwischen dem Flug und der jetzigen Fahrt, hat man ihm etwas Wasser gegeben – während jemand ihm die Wasserflasche an den Mund hielt, hat jemand anders ihm etwas hartes, wahrscheinlich eine Pistole, an die Schläfe gehalten. Mal abgesehen davon waren die Gepos noch recht milde zu ihm. Sie haben ihn immer wieder beschimpft und einmal, während des Fluges, ein wenig zusammengeschlagen: Heftige Schläge gegen Brustkorb und Becken, einen gegen die Wange, wodurch die Lippe an der Seite aufgeplatzt ist. Und eine Seite schmerzt seitdem stechend. Stefan hofft nur, daß es kein Rippenbruch ist, sondern nur eine Prellung. Seine vom Sommer stammende Verletzung an der Schulter hat sich durch diese Behandlung auch wieder gemeldet. Aber er hat dabei kein Wort gesagt und für die Gepos ist das echt noch recht milde. Am schlimmsten ist für den General, daß er nichts sieht. Das macht ihn doch etwas orientierungslos und sein Zeitgefühl ist durcheinandergeraten. Um sich davon abzulenken, versucht er möglichst viel zu meditieren – Atemfrequenz senken und total entspannen. Vielleicht gelingt es ihm ja, eine Art mentales Signal an Karo zu senden. Wie wäre es mit dem Signal: Hey, ich bin irgendwo in den Bergen? Aber das wird wohl kaum was bringen. Berge gibt es im von der Koalition besetzten Europa viele: Die Mittelgebirge, die Alpen, Pyrenäen, Karpaten... Auf einmal hält der Laster an. Klappernd klappt die Lade am Ende der Ladefläche des Lastwagens runter. Irgendwer klettert auf die Ladefläche und einer ruft noch: „Paß auf, daß die Augenbinde nicht verrutscht, er darf nichts sehen.“ „Is klar....Komm schon, Du Arschloch.“ Kräftige Hände packen Stefan, zerren ihn hoch und schubsen ihn vorwärts. Nach ein paar Schritten erreicht er das Ende der Ladefläche und wird hinuntergestoßen. Mit einem durch den Knebel unterdrückten Keuchen landet er unsanft auf dem Boden. Steinart, wie asphaltiert. Von seiner Seite jagt ein stechender Schmerz durch seinen Körper und er schlägt sich sein rechtes Knie unsanft an. Dann zerren ihn wieder zwei Paar Hände unsanft hoch und schleifen ihn geradezu weiter. Mehrere Stufen hinunter. Wie viele es sind – keine Ahnung. Schließlich nehmen sie einen Aufzug. Am Widerhall der Schritte erkennt Stefan, daß sie sich in so etwas wie einem langen Gang befinden müssen. Schließlich wird eine Tür aufgeschlossen und Stefan auf einen harten, unbequemen Stuhl gestoßen. „Schön still halten!“ befiehlt eine tiefe Stimme und eine Pistole wird ihm an die Schläfe gehalten, während seine Arme erst losgebunden und dann hinter der Stuhllehne wieder festgebunden werden. Ein Gurt wird ihm um den Körper gelegt und seine Beine werden an die Stuhlbeine festgebunden. Und ganz plötzlich nimmt man Stefan die Augenbinde ab. Das grelle Licht aus einer Lampe direkt über ihm blendet ihn. Die Wände kann er zunächst nicht klar wahrnehmen, nur eine große massige Gestalt direkt vor ihm, die sich als ein fast zwei Meter großer Geheimpolizist entpuppt, der mit donnernder Stimme erklärt: „Ich bin Standartenführer Gephardt und der Kommandant von Schattenlagant! Wir haben hier anders als in anderen Lagern keine Gefangenenerfassung durch Brandzeichen, da wir nur wenige Gefangene haben. Das ist nur vordergründig gut. Noch ist niemals jemand lebend hier rausgekommen.“ Gephardt grinst breit. „Und Sie, Herr General“ – was Gephardt so betont, daß es wie eine Beleidigung klingt – „werden da keine Ausnahme machen!“ Gephardt schlägt ihm mit der geballten Faust ins Gesicht und ein heftiger Schmerz läßt Stefan den Kopf zurückwerfen. Und dann jagen ihm zwei weitere Gepos Elektroschocks durch die Körperseiten... In einem vierstöckigen Backsteinhaus, das bis zu dem Zeitpunkt, als der Krieg auch über die westlichen Grenzgebiete Russlands hereinbrach, ein Hotel war, mitten in Krasnyj, finden sich nun zahlreiche kaiserliche Offiziere ein. Der sächsische Kurfürst Ludwig ist schon da und spricht gerade am Fenster des kleinen Konferenzraumes im dritten Stock mit General Robert Mudra, der dem Kurfürsten durch freundschaftliche Bande verbunden ist und der das X. Reichsarmeekorps befehligt. Schörner ist auch da; er hat auf dem ovalen Holztisch in der Mitte des Raumes eine große Karte ausgebreitet, in die er immer wieder Markierungen einträgt, während er mit der anderen Hand zu dem Butterbrot greift, daß neben ihm auf einem Teller liegt und sein Frühstück darstellt – Graubrot mit Käse. Gerade wird von einer Wache die Tür geöffnet und General Brieskisch, Kommandeur des IX. Reichsarmeekorps, tritt ein. Brieskisch ist eher hager und nur 1 Meter 70 groß, während der etwas bulligere Mudra mit seinen eins Achtzig daneben imposanter wirkt. Beide sind schon um die 50, Mudra hat hellbraunes, kurzgeschorenes Haar, Brieskisch blondes, mittellanges Haar. Aber beide rasieren sich jeden Morgen. Und was noch wichtiger ist: Seit beide in Kurfürst Ludwigs 2. Reichsarmee Korpskommandos inne haben, und dann auch noch benachbarte, haben sie sich als energische Truppenführer erwiesen, echte Brecher. Ihre Zusammenarbeit hatte sich in den letzten Monaten perfekt eingependelt, mehr als einmal hatten beide ihre HQs zusammengelegt. Sowohl Brieskisch wie Mudra sind nicht gerade von Skrupeln befallen und die beiden gelten als die einzigen, die in diesem Krieg „Schimäre“ eine wirkliche Niederlage in einer großen Schlacht beigebracht haben: Damals, Anfang August 1788, als sie die „Schimäre“ an der Neiße zum Rückzug zwangen. Wenn auch nur, weil Brieskisch und Mudra Giftgas in rauhen Mengen eingesetzt haben. Aber Kurfürst Ludwig weiß schon, warum er die Mudras X. Korps auch bei Smolensk gegen „Schimäre“ in den Kampf schickte und warum Brieskischs Korps wieder direkt daneben eingesetzt ist. Mudra und der Kurfürst sehen vom Fenster herüber zur Tür. „Guten Morgen, Kurfürst, General Mudra...“ begrüßt Brieskisch die beiden und hebt die Hand zum Gruß und kommt auch schnurrstracks rüber zum Fenster. Der Kurfürst wendet sich mit einer Frage an Schörner: „Herr Generaloberst, könnten wir jetzt anfangen. Ich meine, wir haben bereits den Vorortbericht von Semmellag und der anderen Frontkommandeure, den Bestandsbericht der Artillerie sind wir bereits mit unserem Artilleriekoordinator durchgegangen...“ Mit einem mißbilligenden Blick sieht Schörner auf. „Nein, wir können noch nicht anfangen. Wir müssen noch auf den Kommandeur des 2. Panzerregiments warten. Bitte, Kurfürst, Sie wollten ein Panzerregiment und ich habe eins aufgetrieben. Und zwar so kurzfristig, daß der eigentliche Kommandeur nicht mehr von seinem Krankenurlaub in der Heimat zurückgerufen werden konnte und nun durch einen seiner Bataillonskommandeure vertreten wird. Und auf den sollten wir dann doch wenigstens warten können. Oder?“ „Ok, Sie haben ja recht. Wir werden uns in Geduld üben.“ Der Kurfürst schluckt die Verärgerung herunter und Mudra klopft ihm aufmunternd auf die Schulter: „Geduld ist eine Tugend...“ Sein breites Grinsen verrät, wie komisch er das findet. „Könnte er das sein?“ Brieskisch deutet mit einer Kopfbewegung aus dem Fenster. Auf dem Parkplatz fährt tatsächlich ein Kübelwagen vor, aus dem mehrere Personen aussteigen und ins Haus hineingehen. „Kann auch nur irgendein Kurier sein.“ wendet Mudra ein. Aber etwa eine Minute später klopft es und die Wache öffnet wieder die Tür. Ein hochgewachsener Mann mit heller Haut, kurzgeschorenen fast durchsichtigen Haaren, dafür aber einem kräftigen, leicht eckigen rötlichen Bart (das ganze verleiht ihm ein leichtes Aussehen wie bei einem Zwerg, wozu natürlich die Größe absolut nicht paßt), tritt ein, die Offiziersmütze unterm Arm, und salutiert zackig: „Hauptmann Ingo Steinberger meldet sich wie befohlen zur Lagebesprechung!“ Schörner sieht von der Karte auf und richtet sich auf. „Wunderbar. Hauptmann, Sie können bequemstehen und mal hier rüber kommen...Kurfürst, wir fangen jetzt an.“ „Sehr gut.“ Und an Mudra und Brieskisch gewandt, meint der Kurfürst: „Kommen Sie, meine Herren, wir wollen anfangen.“ Alle versammeln sich um den Tisch, während Schörner die Tür abschließt und dann zu ihnen zurückkehrt. Dabei verschlingt er das letzte Stück seines Butterbrotes. Nach einer kurzen Pause beginnt er: „Meine Herren, wir besprechen hier zwar nur eine lokale Offensive, die spätestens übermorgen beginnen soll. Aber diese Offensive hat zwei wichtige Ziele: Zum einen, uns eine bessere Ausgangsposition für den geplanten Großangriff auf Moskau zu schaffen. Und zum anderen, ‚Schimäre‘ zu vernichten.“ „Stimmt es, was ich gehört habe?“ fragt Mudra. „Was haben Sie denn gehört, General?“ fragt Schörner zurück. „Das die Gepo Reiss endlich erwischt hat.“ Der Kurfürst schaltet sich ein: „Ja, es stimmt. Und deswegen greifen wir jetzt an. Wir wissen zwar nicht, wer jetzt bei ‚Schimäre‘ das Kommando führt, aber wir hoffen, daß dieser Erfolg die Moral dieser Söldner genügend geschwächt hat.“ „Na, ich weiß nicht...“ Mudra runzelt skeptisch die Stirn. Und auch Brieskisch ist skeptisch: „Die Moral eines ‚Schimäre‘-Kämpfers ist glaub ich nicht allzu leicht zu erschüttern. Das haben diese Typen immer wieder gezeigt.“ „Ich kenne die Ereignisse der letzten Monate.“ faucht der Kurfürst. Er weiß genau, worauf Brieskisch anspielt: Auf Schlachten an der Neiße, bei Kalisch, bei Warschau... Bei all diesen Schlachten gehörten die „Schimäre“-Kämpfer stets zu den härtesten Gegnern. Es ist kein Fall bekannt, in dem diese Truppe ernsthafte Auflösungserscheinungen gezeigt hätte. Schörner übernimmt wieder: „Meine Herren, bitte, wir dürfen uns nicht in endlosen Debatten verlieren. Ich konnte der Luftwaffenführung immerhin 200 Jabos abschwatzen und der Panzergruppe 1 das 2. Panzerregiment.“ Einen Blick zu Steinberger werfend, fragt Schörner: „Hauptmann, ich hab mich über Sie informiert. Sie haben der Ruf ein durchgreifender Truppenführer zu sein und ihre Erfolge an der Weichsel, bei Lublin, Chelm und ihr erfolgreicher Vorstoß auf Kiew sprechen für sich. Aber wieviel wissen Sie über ‚Schimäre‘?“ „Leider nicht sehr viel, Herr Generaloberst. Als ich mit meinem Bataillon bereits Richtung Kiew bretterte, wurde das andere Regiment unserer Division zu einem Gegenangriff gegen diesen Feind abkommandiert. Nach allem, was ich hörte, wurde das Regiment ziemlich arg mitgenommen.“ „Sie haben richtig gehört. Es hatte am Ende nur noch 13 Panzer vom Typ IIIG.“ „Oh, das ist übel.“ Mit einem hämischen Grinsen fügt Steinberger jedoch hinzu: „Wir haben allerdings bereits drei Kompanien gänzlich mit dem Typ IIIH ausgerüstet.“ „Deswegen habe ich auch das 2. Panzerregiment angefordert, Hauptmann.“ erklärt Schörner, bevor er sich wieder an alle wendet und auf Jakovlevo deutet. „Jakovlevo, meine Herren. Neben Jarcevo eines der wichtigsten Ziele dieser Offensive. Jarcevo brauchen wir natürlicherweise als Versorgungszentrum. Aber in Jakovlevo ist, soweit wir wissen, das Hauptquartier von ‚Schimäre‘. Folgender Plan: Mudras Korps, das wir um eine Division verstärkt haben, greift zum einen die Stellungen von ‚Schimäre‘ frontal an, um deren Kräfte zu binden. Das 2. Panzerregiment wird gleichzeitig mit einem Teil von Mudras Infanterie an der Nahtstelle zwischen ‚Schimäre‘ und dem VI. russischen Korps bei Glinka angreifen und durchbrechen. Dabei ist darauf zu achten, daß Jelnja abgeriegelt wird; die Russen haben diesen Verkehrsknotenpunkt stark befestigt und könnten von dort aus Gegenangriffe starten. Das 2. Panzerregiment wird nach erfolgtem Durchbruch nach Nordosten einschwenken, um ‚Schimäre‘ die rückwärtigen Linien zu durchtrennen. Je nach Lage gibt es dabei zwei Optionen: Die kleinere ist ein sofortiges Einschwenken auf Jakovlevo. Sie ist bei stärkerem Widerstand zu bevorzugen. Die größere ist ein sofortiger Vorstoß auf unser drittes wichtiges Ziel Safonovo, dessen Flugplatz für Luftangriffe gegen Moskau genutzt werden kann. Außerdem hätten wir dann die Rollbahn Richtung Moskau hinter ‚Schimäre‘ durchtrennt.“ Schörner sieht wie Steinberger langsam mit dem Kopf wiegt. „Hauptmann, irgendwelche Fragen?“ „Nicht wirklich...nur, habe ich das richtig verstanden, daß diese Operation eine Einkreisungsoperation werden soll?“ „Ja.“ „Gut, dann dürfte der Vorstoß meiner Truppen die eine Hälfte der Zange darstellen. Wo ist die andere Hälfte?“ „Wunderbare Frage, ich sehe, Sie denken mit.“ meint Schörner freundlichst und fährt dann fort: „Wie Hauptmann Steinberger soeben richtig festgestellt hat, ist die Operation als Zangen-und Einkreisungsbewegung angelegt. Der andere Teil der Zange wird Brieskischs IX. Korps bilden. Brieskisch, Sie müssen mit ihrem Korps unbedingt an der Nahtstelle zwischen ‚Schimäre‘ und dem III. polnischen Korps nördlich von Spas-Lipki durchbrechen. Nach der Einnahme von Duhovscina schwenken Sie dann nach Südosten ein, um Steinbergers Panzern die Hand zu reichen. Für diese Operation hat das Oberkommando an Artillerie, Munition, Flugzeugen und Panzern abgestellt, was verfügbar war. Da derzeit eine weitere Offensive zur Eroberung Estlands und der Unterstützung der Schweden bei Sankt Petersburg vorbereitet wird, wird dort das meiste gebraucht. Aber mit 450 Geschützen, darunter fünf 28-cm-Eisenbahnkanonen und fast 20 21-cm-Haubitzen sind wir wohl ganz gut bestückt. Also, meine Herren, noch Fragen?“ Erwartungsvoll sieht Schörner in die Runde, während Brieskisch mit ungutem Blick die Regentropfen auf der Außenseite des Fensters mustert. Dann fragt er: „Generaloberst, wie sieht die Wettervorhersage aus?“ „Es soll bald wieder trockener werden.“ Mißmutig sieht Brieskisch wieder nach draußen. Seit Tagen hat der Regen nur selten wirklich aufgehört und wenn, dann nur kurz. Sollte es dabei bleiben, droht eine wahre Schlammschlacht. „Wann soll es losgehen?“ fragt Steinberger. „Wie wäre es mit Dienstag bei Tagesanbruch?“ schlägt der Kurfürst vor. Mudra nickt und Schörner hat auch keine Einwände: „Ok, Dienstag, bei Tagesanbruch. Meine Herren, ich wünsche Ihnen viel Erfolg! Und jetzt sollten Sie alle Ihre Vorbereitungen abschließen.“ „Dann wollen wir den Kaiserlichen mal kräftig in den Arsch treten!“ Kommentar eines Soldaten des Spezialbataillons 1 am 12. 10. 1788 Sie haben gewählt. Fast 50000 „Schimäre“-Kämpfer, nach Einheiten. Rund 21 Feldkommandeure reichten die Stimme ihrer Einheit weiter ans Hauptquartier, wo die Stimmen der Stabsoffiziere dazukamen. Und jetzt, an einem regnerischen Nachmittag steht Karolina Sus, nunmehr General und Oberbefehlshaber von „Schimäre“, am Rande des Flugfeldes bei Safonovo vor einer Focke Wulf 200, deren Motoren bereits warmlaufen. Neben ihr steht Oberleutnant Pick. Mit ihm zusammen will Karo nach Moskau reisen und von den Alliierten Unterstützung bei der Suche nach Stefan einfordern. Pick, der exildeutsche Verbindungsoffizier, will sich dafür bei seinen Vorgesetzten einsetzen. Seine Verlobte Mira Krapp, Tochter eines exildeutschen Generals und „Schimäre“-Kämpferin, hat ihn darum gebeten. Was freilich nichtmal nötig gewesen wäre. Philipp steht in seiner schwarzen Kluft vor den beiden. Kurz bespricht er sich noch mit Karo. „Heute abend breche ich auf, Karo. Dann geht’s los. Wäre nicht unpraktisch, wenn Du die Exildeutschen davon überzeugen kannst, uns mit den Resten des expreußischen Geheimdienstes zu helfen.“ „Ich werds versuchen. Valkendorn vertritt uns beide dann erstmal, wenn Du aufbrichst. Du mußt Dir über die Führung hier also keine Sorgen machen.“ „Sehr gut.“ „Ich weiß nicht, wann wir uns wieder sehen...“ „Keine Sorge. Wir werden uns wiedersehen.“ „Hoffentlich.“ Sie klopft Philipp freundschaftlich auf die Schulter. „Paß gut auf Dich auf, Philipp.“ „Du auch Karo.“ Dann salutieren beide und Karo geht mit wehendem Regenmantel zum Flugzeug. Pick folgt ihr. Philipp sieht dem Flugzeug dann noch nach, wie es in den verregneten Himmel aufsteigt. Und er denkt darüber nach, welche Spuren es gibt, um Schattenlagant zu finden. Sein Instinkt sagt ihm, daß im Dunstkreis der kürzlichen Zwischenfälle in Köln eine Spur zu finden ist. Denn er glaubt nicht an Zufälle. Spätestens nicht, seit Karo ihm von einer alten Bekannten erzählt hat, die erst wieder auftaucht und dann auf einmal wieder verschwindet... „Simon, wie kannst Du zwei so auffällige Gestalten aus den Augen verlieren!?“ Dominik Kipshoven haut mit der Faust gegen den an der Wand über der Arbeitsplatte hängenden Schrank, daß die Gläser darin klirren. Dann wendet er sich wütend ab und verläßt die Küche. Sie befinden sich in der kleinen Wohnung von Simon Hennen in Bonn. Simon unterhält zusammen mit seiner verheirateten Schwester Ina einen kleinen Comicladen – und nebenbei sind beide noch Agenten für „Schimäre“. So zeichnet sich Simon auch für die Schießerei an der Stadtgrenze Köln/Hürth mitverantwortlich. Er ist ein unscheinbar wirkender Mann mit kurzem braunem Haar, Dreitagebart und Brille; abgesehen davon trägt er meist graue Pullover oder Tshirts, dazu Jeans. Sichtlich geknickt blickt er zu der Tür, durch die Dominik hinausgerauscht ist. Schließlich läßt er sich auf einen der beiden Stühle am Küchentisch fallen und atmet hörbar aus. Auf dem anderen Stuhl sitzt die hübsche Chris Loewisch und blickt Simon wehleidig an. Sie weiß, wie es ist, wenn man was vergeigt hat, das genau weiß und es dann einem auch noch so unter die Nase gerieben wird, wie gerade geschehen. „Komm schon Simon, Dominik regt sich nunmal über sowas auf. Nimms nicht so schwer. Wird schon werden.“ Simon blickt sie von der Seite an, lächelt gequält und meint nur leise: „Ja, ja...“ Am Fenster steht Sabine, sie räuspert sich jetzt. „Die beiden sind Gothics. Das heißt, es gibt bestimmte Örtlichkeiten, die beide magisch anziehen werden.“ Simon dreht sich zu ihr um und sein Gesicht hellt sich auf. „Stimmt. In Bonn gibt es nicht allzu viele Gothic-Läden. Das könnte eine Chance sein. In der Innenstadt, in einer der kleineren Gassen, gibt es einen Laden, ‚Nadjas kleine Schmuckecke‘ glaube ich. Wir wissen, daß Petra dort schon einmal war. Vielleicht taucht sie dort wieder auf.“ Sabine schaut ihn über die Schulter an, dann nickt sie. „Das ist eine Möglichkeit. Ok, wir knöpfen uns den Laden vor.“ Schon geht sie zur Tür, Chris steht auf und folgt ihr. „Danke Simon. Laß es uns wissen, sollten Deine Leute selber die beiden wiederfinden.“ „Sicher, was denkst Du denn.“ Es wurmt ihn doch immer noch, daß seine Leute Petra und Ben schon kurz nach deren Ankunft in Bonn aus den Augen verloren haben. Aus dem Flur hört er Sabine rufen: „Dominik, schnapp Dir Deinen Rucksack, wir brechen auf!“ Seine Innereien ziehen sich schmerzhaft zusammen, als der Partisane, der sich Bora nennt, mit einem schweren Stock auf Frakers Seiten einhämmert. Fraker hängt mit den zusammengebundenen Händen an einem Haken aufgehängt, seine Füße baumeln frei, er hat nur seine Hosen an und krümmt sich jetzt vor Schmerz und Kälte. Denn diese Hütte mitten in den Wäldern von Smolensk ist kalt und feucht. Und Bora scheint ein echter Sadist zu sein. Seit drei Stunden bearbeitet er Fraker, dessen Lippen aufgeplatzt, die Augen rot von den Schmerzenstränen, der Leib blau und rot von den Schlägen, die Handgelenke angescheuert von den Stricken sind. Und mindestens eine Rippe meldet sich unangenehm zu Wort, ist mindestens geprellt. Jetzt legt Bora eine Pause ein. Der Partisan tritt einige Schritte zurück und läßt Fraker Blut ausspucken. „Also...“ meint Bora, die Hände in die Hüften gestemmt, mit russischem Akzent. „Sagst Du uns nun die Wahrheit, Du Gepo-Schwein?“ „Hab ich...“ würgt Fraker hervor. „Wir sind ‚Schimäre‘-Kämpfer.“ Bora verpaßt ihm eine Ohrfeige. „Wieso hattet ihr dann Gepo-Uniformen in den Rucksäcken?“ „Wenn wir...Gepos...wären...wieso dann die Frau?“ preßt Fraker unter Schmerzen hervor. Erstaunt macht Bora einen Schritt zurück. Trotz der Folter und den immer gleichen Fragen, auf diesen Gedankengang waren sie noch nicht gekommen. Sichtlich irritiert reibt sich Bora sein zuletzt vor mehreren Tagen rasiertes Kinn. Dann gibt er zwei anderen Partisanen einen Wink und die beiden heben Fraker vom Haken runter und schleifen ihn nach draußen. Fraker kann kaum selber stehen oder gar gehen. Sie schleifen ihn rüber zu einer anderen Hütte, vor der vier Wachen mit Karabinern stehen, die nun die Tür öffnen. Die Partisanen werfen Fraker geradezu in die Hütten und schließen dann wieder die Tür. Krakowsky und Tina fangen Fraker auf. „Und?“ Tina will wissen, ob es was neues gibt, während Krakowsky Fraker langsam zurücksinken läßt. Hustend stößt Fraker hervor: „Naja, die Gepos sind nicht die einzigen mit schlechten Manieren...“ London wird diesen Oktober besonders reichlich mit Regen beehrt. Die Themse führt leichtes Hochwasser, der Himmel ist grau – und die Menschen hoffen deswegen auf ein leichtes Abflauen der schon den ganzen September über tobenden Luftschlacht, die auch in der britischen Hauptstadt deutliche Spuren hinterlassen hat: Mehrere französische und drei kaiserliche Luftangriffe (sowohl bei Tage wie nachts) haben im Hafenviertel und den südlichen Stadtteilen ganze Straßenzüge in Schutt gelegt oder doch zumindest stark zerstört. Auch einige der nordöstlichen Viertel haben was abgekriegt. Die offiziellen Stellen sprechen bislang von 2700 zivilen Toten und Zigtausenden Verletzten und Obdachlosen. Ganz zu schweigen von den Opfern in den anderen angegriffenen Ortschaften und Städten Süd-, Mittel-und Ostenglands. Gegenüber einem erst vor wenigen Nächten getroffenen Gebäudes, um das herum die Sicherheitskräfte eine Sicherheitszone abgesperrt haben, sitzt Oberstleutnant Krammer in einer Bar mit einem kühlen Bier. Die Passanten, die am Fenster vorübergehen, alle mit Regenschirmen, schauen zum ersten Mal seit langem nicht nervös zum Himmel. Der Regen läßt sie sicher sein, daß heute zumindest keine größeren Angriffe erfolgen. Dennoch: Alle spüren, wie allgegenwärtig der Krieg ist. „Interessante Zeiten.“ hatte es ein Satiriker genannt. Ein Passant, ein durchschnittlich großer Mann mit kurzgeschnittenem dunklem Haar und fast jungenhaftem frechem Grinsen, noch keine 30, kommt in die Bar, sieht Krammer in seiner grünen „Schimäre“-Uniform und steuert direkt auf ihn zu. Zieht sich einen Barhocker heran und setzt sich neben Krammer. „Ale!“ ruft er dem Barkeeper zu, das der dann auch kurz darauf serviert. Der neuangekommene Gast ist Major Robert Williams vom Secret Service, zugleich einer der britischen Verbindungsoffiziere zur spanischen Führung und vor allem (das ist Williams‘ Spezialität) zur Fleur-Division, einer Einheit französischer Freiheitskämpfer unter dem Kommando von General Isabel Schmitter. Nach einem Schluck von seinem Ale kommt er direkt zur Sache: „Also, Lieutenant-Colonel, woher wußten Sie, daß ich heute in der Stadt bin?“ Mißtrauisch beäugt Williams Krammer. Der zuckt nur die Achseln. „Sie wissen doch, ‚Schimäre‘ hat seine Verbindungen.“ „Ja, das sagt Isabel auch immer.“ „Sie dürfen die Frau bereits mit Vornamen ansprechen?“ hakt Krammer ein. „Wir arbeiten schließlich oft zusammen.“ „Sehen Sie, deswegen wollte ich Sie sprechen.“ „Äh?“ „Sie haben doch sicherlich bereits von unserem Dilemma gehört.“ „Ja, daß Reiss in Gefangenschaft befindet, hat sich längst rumgesprochen. Nicht in der Öffentlichkeit...“ „...aber in Militärkreisen, ich weiß. Aber wir haben den Posten ja neu besetzt.“ „Glückwunsch an die Frau General Sus.“ „Ich werd’s ausrichten. Allerdings wären wir dankbar, wenn Sie unter dem Siegel der Verschwiegenheit Frau General Schmitter die Bitte um Hilfe überbringen könnten.“ „An die Chefin der Fleur-Division? Wie soll die Fleur-Division Ihnen helfen können?“ „Nachrichtendienstlich und eventuell mit einem Luftlandeeinsatz. Unser HQ weiß nicht, ob wir genügend Spezialbataillone einsetzen können...“ Krammer senkt die Stimme, als zwei andere Gäste auf dem Weg zur Tür an ihnen vorbeigehen. Die Bar wird fast nur von Militärs besucht und sie setzen in einem Bereich der Bar, der öfter für solche Unterhaltungen genutzt und daher von intelligenten Leuten gemieden wird. Aber man weiß ja nie... „Jedenfalls,“ fährt Krammer fort, „müssen wir auch noch andere Verpflichtungen einhalten. Ich weiß von den Spezialbataillonen 3 und 5, daß sie bereits nicht verfügbar sind.“ Williams nimmt einen weiteren kräftigen Schluck. Nach einer kurzen Denkpause meint er: „Krammer, ich weiß nicht, warum ich das tue, aber ich werd Ihnen helfen.“ „Danke.“ „Ja, aber erzählen Sie es nicht weiter. Eigentlich arbeite ich für den Secret Service. Wir sind zwar Alliierte, aber gerade im Secret Service gibt es Leute, die sowas nicht gerne sehen.“ „Es kann Sie den Hals kosten?“ „Im wahrsten Sinne des Wortes.“ „Harte Sitten.“ „Allerdings.“ Krammer grinst breit. „Keine Sorge, Major, ‚Schimäre‘ vergißt die Leute, die hilfsbereit waren, niemals.“ „Wenn ich das nur glauben könnte...“ Williams schnaubt verächtlich und denkt an die all die Helfer, die der Secret Service im Siebenjährigen Krieg beispielsweise hat hängen lassen und die ihre Arbeit mit dem Leben bezahlen mußten. Oder an die britischen Beamten in Hannover, die man im Vorjahr opferte, um dem Mutterland ein paar Monate mehr Frieden zu bescheren... Krammer trinkt sein Bier aus und steht auf, legt Geld auf den Tresen. Dem Barkeeper ruft er zu: „Stimmt so!“ Und dann beugt er sich an Williams Ohr heran und sagt leise: „‘Schimäre‘ hat eine andere Ethik. Das ist es, was uns selbst von unseren Alliierten unterscheidet.“ Dann geht Krammer ohne ein weiteres Wort. Williams oder Isabel würden sich bei ihm oder dem Hauptquartier melden. Etwas verwirrt blickt Williams noch eine Weile zur Tür, bevor er sich wieder seinem Ale zuwendet. Sollte es wirklich sein, daß diese Verrückten einen Feldzug für einen einzelnen Mann anzetteln? Ach was! Oder? Leise murmelt der Secret-Service-Mann vor sich hin: „Einer für alle. Und alle für einen. Was für Idioten!“ „Was?“ fragt der Barkeeper und Williams schreckt auf. „Ach,äh, nichts...gar nichts. Noch ein Bier bitte...“ Moskau finden ist ja leicht. Aber dann wird’s kompliziert und das, obwohl alle ihr gesagt hatten, alle Wege würden zum Kreml führen. Nachdem Karo im Hauptquartier der Exildeutschen am Stadtrand Pick abgesetzt hat – allein die Fahrt vom Flughafen dorthin hat eine Stunde gedauert -, ist sie das Wagnis eingegangen. Und mußte feststellen, daß die Moskauer einen sehr eigenen Fahrstil pflegen. Zum Glück kann auch Karo sehr rustikal fahren. Nach zwei Stunden Fahrt erreichte sie endlich den Kreml. Und nun, es ist schon Abend und draußen dunkel, wartet sie in einem der großen, geschmückten Empfangssäle des Kremls, beäugt von einigen Wachen, die an den mehreren Türen, die aus dem Raum führen, ihren Dienst tun. Noch vor kurzem war der Kreml eine touristische Attraktion; doch seitdem die russische Regierung und die Militärführung aus Sankt Petersburg flüchten mußten, um das immer noch die Kämpfe mit den Schweden toben, ist Moskau wieder Regierungssitz und der Kreml wieder Hochsicherheitszone. Auf einem spätbarocken Stuhl sitzend schaut Karo im Licht der Kronleuchter immer wieder auf die Uhr. Sie hat extra für diesen Besuch ihre weiße Gala-Uniform angezogen, auf die vorher noch schnell die neuen Generalsabzeichen genäht wurden. Stefan hat diese Gala-Uniformen schon immer gehaßt; lieber sind ihm stets die dunkelgrünen Kampfuniformen. Eine der kleineren, mit goldenen Verzierungen beschlagenen Türen geht auf und ein Adjutant in sauberer Ausgehuniform, die sogar noch Bügelfalten hat, und Handschuhen kommt auf Karo zu. Diese erhebt sich, setzt sofort an: „Wie lange muß ich denn-...“ In einem Englisch, das deutlich schlechter als das von Karo ist, erklärt er hastig: „Es wird noch etwa eine Viertelstunde dauern, bis Marschal Suworow erscheinen kann. Wollen Sie in dieser Zeit vielleicht einen Tee oder Kaffee?“ Über diese Ankündigung ist Karo so erstaunt, daß sie erstmal gar kein Wort herausbekommt. Ihr Schweigen nimmt ihr Gegenüber offenbar als ‚Nein‘ zur Kenntnis und zieht sich daraufhin eiligen Schrittes durch die selbe Tür, woher er gekommen ist, wieder zurück. Karo sieht ihm mißmutig nach, als sie sich wieder auf den Stuhl sinken läßt. Und allmählich beschleicht sie das Gefühl, daß diese Warterei Schikane von Seiten des russischen Oberkommandos ist. Selbst beim polnischen und dem ehemaligen preußischen Oberkommando mußten Vertreter von „Schimäre“ nie solange warten. Gewiß, nicht alle Offiziere der Alliierten hatten die „Schimäre“-Kämpfer mit Begeisterung empfangen – eigentlich war niemand von diesen Begegnungen sonderlich begeistert -, aber es hatte immer noch so was wie einen Rest von Achtung gegeben. Bei Suworow jedoch hat man den Eindruck, er spuckt von Anfang an Gift und Galle und betrachtet „Schimäre“ als eine Art historische Kakerlake. Und dann fällt Karo ein, daß Suworow vor Jahren, während des Guerilla-Krieges in den 1772 von Russland besetzten polnischen Gebieten, in dem Karo bis vor nicht ganz zwei Jahren gegen die Russen kämpfte, eben genau ihr Gegenspieler war. Vielleicht war der Mann wegen ein zwei kleinerer Niederlagen ja noch sauer. Endlich, nach nochmal zwanzig Minuten, öffnet eine Wache eine größere Tür und der Marschal erscheint. „Sie also sind diejenige, die meine abendliche Schachrunde mit Potemkin stört!“ donnert er. Was für eine Eröffnung! Immerhin ist sein Englisch besser, als Karo vermutet hätte. „Frau Sus, was fällt Ihnen ein, mich zu dieser späten Stunde zu stören? Ich denke Sie haben andere Probleme!“ Er will gerade zu einem weiteren Wortschwall ansetzen, als ihn Karo mit fester und sehr verärgerter Stimme (die Stefan gerne „ihre Hackstimme“ nennt) unterbricht: „Herr Marschal, für Sie immer noch Frau General Sus und eigentlich ist mein Problem auch Ihr Problem. Denken Sie mal darüber nach, was passiert, wenn General Reiss der Folter nicht mehr standhalten sollte!!“ Mit funkelnden Augen antwortet Suworow kalt: „Es ist mir scheißegal was mit General Reiss passiert. Und Sie haben uns überhaupt schon immer Ärger bereitet!“ „Immer noch sauer wegen der Pripjet-Sümpfe.“ grinst ihn Karo an und wird dann direkt wieder schroff: „Marschal, es täte Ihrem Ansehen gut, wenn Sie einem Alliierten zumindest die Hilfe Ihres Nachrichtendienstes zukommen lassen.“ „Abgelehnt.“ „Wieso?“ „Die Zarin hat keinerlei Interesse an einer Rückkehr des Generals.“ „Das würde ich gerne von der Zarin selber hören!“ Mit verschränkten Armen baut sich Karo vor Suworow auf und scheint nicht im mindesten davon beeindruckt zu sein, daß dieser Mann einen Kopf größer ist und mindestens das zweieinhalbfache ihrer Masse aufbringt. Verächtlich schnaubend schüttelt Suworow den Kopf. „Das wird nicht möglich sein. Mit sowas gibt die Zarin sich nicht ab.“ „Stimmt, Sie schickt nichtmal Ihren Bettgenossen Potemkin.“ „Ich fürchte, Frau General, ich habe jetzt auch keine Zeit mehr. Eine Wache wird Sie hinausgeleiten.“ Ruckartig dreht sich Suworow um und geht zur Tür. Als er die Hand an der Türklinke hat, blitzt etwas auf und ein Wurfmesser gräbt sich durch den Manschettenstoff und in das Holz der Tür. Suworow bleibt stocksteif stehen, die Wachen im Raum umringen sofort die Waffen im Anschlag Karo und brüllen: „Ruki werch!“ Ihre inneren Ängste und das eigene Zittern unterdrücken, ruft Karo mit kalter Stimme zu Suworow rüber: „Marschal, wenn ich gewollt hätte, hätte ich Ihr Genick getroffen. Sie können von ‚Schimäre‘ halten was Sie wollen, aber bringen Sie wenigstens Kämpfern den Respekt entgegen, den sie verdienen und außerdem könnte es nicht schaden, wenn Sie sich als guter Verbündeter bewähren würden.“ Über die Schulter antwortet Suworow: „Wenn ich mich nicht irre, hat Russland den Alliierten bereits im vorigen Monat durch den Kriegseintritt den Hals gerettet.“ „Stimmt. Aber ich will ja auch keine Truppen von Ihnen. Nur nachrichtendienstliche Hilfe.“ Suworow zieht das Messer aus dem Holz und kommt zurück zu Karo. Den Wachen raunt er etwas auf Russisch zu, die Männer lassen die Waffen sinken. „Eine beeindruckende Demonstration.“ „Danke.“ Karo ist selber überrascht, als Suworow ihr die Klinge zurückgibt. „Frau General, sind Sie verrückt?“ „Kommt wahrscheinlich darauf an, wie man es sieht.“ „Sie müssen es sein, daß Sie das Leben Ihrer Soldaten für einen einzelnen Mann aufs Spiel setzen.“ „Meine Soldaten haben mich heute zum General gewählt und wußten genau, was ich vorhabe.“ „Mein Gott, 50000 Verrückte auf einem Haufen.“ „Das ist der Unterschied zwischen Ihnen und mir, zwischen regulären Armeen und ‚Schimäre‘. Aber bitte, Marschal, könnten wir solche Diskussionen ein andern Mal führen?“ Suworow nickt. „Sicher. Wenn Sie mir garantieren, daß sich ‚Schimäre‘ nicht gegen einen Einsatz in Fernost wehrt, helfe ich Ihnen.“ „Geht klar.“ „Na gut. Zwei Dinge: Unsere Partisanen haben drei Leute gefangengenommen, die behaupten, zu ‚Schimäre‘ zu gehören. Ich werde ausrichten lassen, Sie sollen Sie ihrem Kommandotrupp, den Sie sicherlich absetzen werden übergeben. In Ordnung?“ „In Ordnung. Noch heute Nacht landet eine Vorhut.“ „Ok. Zweitens: Unser Geheimdienst hat vor ein paar Wochen den Tipp gekriegt, daß Schattenlagant in einer gebirgigen Region liegt. Es gibt zwar einen Bergzug mit diesem Namen in den Alpen, aber wir können uns nicht vorstellen, daß die Kaiserlichen so dreist bzw. blöde sind.“ „Danke, das wird uns helfen. Ist das alles?“ „Ja.“ „Naja, recht dürftig.“ „Egal. Und jetzt, Frau General, gehen Sie mir bitte aus den Augen, ich habe noch was vor!“ Suworow macht eine wegwerfende Handbewegung und verläßt den Raum ohne sich zu verabschieden. „Arschloch.“ murmelt Karo leise, bevor sie von einer Wache wieder nach draußen geleitet wird. Das kann ja noch heiter werden – Suworow will „Schimäre“ ja doch nur im Fernen Osten einsetzen, um die Einheit nicht mehr in seinem Vorgarten stehen zu haben. Stattdessen hat er sie dann noch hinterm Zaun des Hinterhofes, dort, wo „Schimäre“ nach Suworows Ansicht nicht mehr lästig ist. „Und wenn wir keine Chance haben, so nutzen wir doch diese.“ Lapidare Feststellung von Generalmajor Bohnsack Der Flugplatz Safonovo erlebt seinen zweiten Start ranghoher Offiziere an diesem Tag. Es ist 21 Uhr und schon weitgehend dunkel. Noch nicht wirklich stockfinster, aber auch nicht mehr wirklich Abenddämmerung. Die Focke Wulf 200 steht mit laufenden Motoren auf der Piste. Fast schon langsam geht Philipp auf sie zu. Er trägt sein „volles Ornat“ – also schwarze Kleidung inklusive langem schwarzen Ledermantel und Nieten, Ketten am Gürtel. Seinen Säbel hat er auf den Rücken geschnallt. Am Gürtel hat er zwei Halfter mit Pistolen und er trägt am Körper zwei Kampfmesser. Das ist seine gesamte Bewaffnung. Kurz vor dem Einstieg bleibt er nochmal stehen. Sein Mantel weht im Wind. „Viel Glück! Finde ihn!“ glaubt er zu hören und wirbelt herum, um herauszufinden, woher die Frauenstimme kommt. Aber abgesehen vom Bodenpersonal, das einige Meter entfernt steht, sieht er niemanden. Es klang fast – ja, fast wie Chrissis Stimme. Fröstelnd schüttelt er den Gedanken ab und steigt in das Flugzeug. Er zieht die Luke hinter sich zu und verriegelt sie. Dann geht er an Christian und Marta, die bereits auf zweien der wenigen Sitze, die man noch direkt hinter dem Cockpit in der ehemaligen Zivilmaschine gelassen hat (der neugeschaffene Laderaum ist dafür umso größer), Platz genommen haben, vorbei und zum Cockpit. Am Steuer sitzt Tanja und auf dem Co-Pilotensitz ein Mann um die 30 mit an den Kopfseiten kahlgeschorener Frisur. Tanja schaut zu Philipp hoch. „Kanns losgehen?“ „Ja. Es kann. Wer ist das?“ Philipp tippt den Mann an. Der stellt sich vor: „Ja, ich bin Gefreiter Lars Edgar Tibori. Hab mich für den Co-Piloten freiwillig gemeldet.“ „Gut der Mann. Tibori – Italienisch?“ „Nein, ich komme aus Siebenbürgen. Erst vor einer Woche bin ich aus dem Ausbildungslager gekommen.“ „Alles klar. Ok, Tanja, überfordere den Herrn nicht.“ „Ich doch nicht.“ Ein verräterisches Lächeln umspielt Tanjas süße Lippen; Tanja ist erst vor zwei Tagen zur Obergefreiten befördert worden. Mit noch breiterem Grinsen sagt sie: „Lars Edgar hat noch keinen festen Namen bei uns.“ Mit einem Lachen klopft Philipp ihr und Tibori auf die Schulter und begibt sich dann nach hinten zu seinem Sitz. Er weiß, was sie meint: Die Piloten vergeben untereinander Spitznamen. Tanja hat sich ihren Spitznamen „Angel“ wahrlich verdient. Erst einen Monat dabei, gehört sie schon zu den besten Pilotinnen – sie war früher Kunstpilotin – und könnte bald Abschußkönigin werden. Philipp zieht seinen Mantel aus und packt ihn in seinen Rucksack, dann setzt er sich neben Christian Jacke auf einen der Sitze. „Und, alles klar, Jacke?“ „Sicher.“ Skeptisch schaut Philipp Jacke an. Das klang etwas sehr aufgesetzt. „Jacke, wat is?“ „Nix. Mir ist nur eben wieder ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen, so ein seltsamer Hauch...“ Er zuckt die Achseln. Aber Philipp sagt nix mehr. Ihm ging es eben, als er die Stimme beim Anbordgehen hörte, genauso. Unheimlich. Oder ein gutes Omen? Zwischenzeitlich hat die Maschine mit einem Ruck abgehoben. Nahsicherung gibt es nicht – ein Flugzeug allein ist weniger auffällig für die Radarstationen des Feindes. Allerdings hält sich Bohnsack mit drei weiteren Jagdfliegern bereit, um notfalls eingreifen zu können. Tanja zieht in einer sanften Kurve hoch und nimmt dann Kurs nach Westen. Ganz in der Ferne kann man noch wage einen letzten Schimmer der Sonne erkennen. Aber innerhalb weniger Augenblicke verschwindet auch der und es zieht sich endgültig Finsternis über die nur teilweise von Siedlungen und Feldern unterbrochene Waldlandschaft. Tibori checkt nach etwa zehn Minuten die Instrumente. „Und, alles in Ordnung?“ erkundigt sich Tanja, die konzentriert auf das gleichmäßige Brummen der zwei Motoren pro Flügel hört. Ein erfahrener Pilot kann nämlich an den Motorengeräuschen schon frühzeitig Anzeichen für Probleme entdecken – bevor es zu spät ist. Aber alles scheint in Ordnung. „Geben Sie das Signal an Bohnsack durch.“ „Alles klar.“ bestätigt Tibori und schaltet dann das Funksystem frei und gibt kurz durch: „TL an Chef: Alles roger.“ Dann schaltet er wieder ab. Wieder Funkstille. Sie müssen sich jetzt irgendwo unweit Smolensk befinden – eine gefährliche Ecke, denn hier haben die Kaiserlichen zahlreiche Flakstellungen. Und schließlich müssen sie noch weiter. Philipp wollte irgendwo kurz vor Orscha abgesetzt werden. „Tibori, gehen Sie schon mal nach hinten und machen Sie unsere Passagiere sprungklar. In vielleicht zwanzig Minuten sind wir soweit. Ich werde uns auf die Höhe von 2000 m bringen.“ „Geht klar.“ Tibori steht auf und geht nach hinten, wobei er sich kurz den Fuß an der Tür stößt. Denn das Cockpit ist dunkel, nur die Instrumente leuchten minimal mit grünlichem Licht. Leise flucht Tibori. Tanja kommt es fast schon zu laut vor, beinahe denkt sie, der Feind unten könnte sie hören. Das einzige, was unten auf dem Erdboden jedoch zu hören ist, ist das Brummen der Motoren und das kann so weit im feindlichen Luftraum genausogut ein kaiserlicher Flieger sein. Aus einer Kiste hinten im Laderaum holt Tibori drei Fallschirme und verteilt sie an Philipp, Jacke und Marta. „Ihr drei kennt euch damit aus?“ fragt er und fängt sich einen bösartigen Blick von Marta ein. Philipp meint etwas freundlicher: „Ja, wir sind schon mal vom Himmel gefallen.“ Jacke zuckt nur die Achseln und zieht sich den Fallschirmrucksack über. Alle drei müssen sich erstmal sortieren, denn sie haben ja alle noch ihre Rucksäcke mit Kleidung, Proviant und Munition. Keinem ist nach vielem Gerede. Es ist das vielleicht riskanteste, was „Schimäre“ in diesem Krieg bislang in Angriff genommen hat: Einen der eigenen Leute aus einem Gefängnis zu retten, von dem man nichtmal weiß, wo es ist. Tibori geht nochmal nach vorn ins Cockpit. „Wer ist das eigentlich?“ fragt Jacke. „Ein neuer.“ antwortet Philipp. „Ich nehme an, rekrutiert aus den Kämpfertrupps, die im September aus den Karpaten nach Russland flüchten mußten.“ „Äh?“ „Er ist Siebenbürgener. Freilich deutscher Abstammung.“ „Na dann.“ Tibori kommt zurück. „Ok, alles klar. In genau 2 Minuten 30 Sekunden springen wir.“ Mit diesen Worten wirft er einen bedeutungsschweren Blick auf seine Uhr. Philipp holt drei kleine Zweige aus seiner Tasche. „Wer den kürzeren zieht.“ Christian und Marta ziehen je einen Zweig. Marta hat den kürzeren. „Wie heißt es so schön: Ladys first?“ schmunzelt Jacke. „Ha, ha, sehr komisch, Herr Oberst.“ „Privileg des Vorgesetzten, Frau Leutnant.“ „Es ist soweit!“ Tibori entriegelt und öffnet die Ausstiegsluke. Kalter Wind fegt herein, vermischt mit Regentropfen. Marta tritt an die Kante. „Ich muß verrückt sein!“ Tibori zuckt die Achseln. „Wären Sie sonst bei der Truppe?“ Resignierend antwortet Marta: „Nein.“ Und springt. Verschwindet nach unten in die Dunkelheit. Dann tritt Jacke an die Kante. Wortlos läßt er sich fallen. Schließlich tritt Philipp vor. „Gefreiter, passen Sie gut auf die Lady auf! Klar?“ „Geht klar, Herr Kapitän!“ Dann springt Philipp. Wie eine kalte Wand schlagen ihm Wind und Regen entgegen. Innerlich zählt er die Sekunden ab, um abzuschätzen, wann er den Ring ziehen muß... Jetzt! Er zieht an dem Ring mit der Schnurr und wird dann ruckartig nach oben gerissen, als sich der Fallschirm öffnet und abrupt seinen Fall abbremst. Und dann sieht er Lichter aufblitzen. Wie ein riesiger Finger steigt ein Scheinwerferstrahl in den Himmel und beleuchtet die Wolken. Huscht dicht an Philipp vorbei und bleibt dann an der Focke Wulf kleben. Scheiße, sie habens gemerkt! Lars Edgar Tibori kommt gerade ins Cockpit zurück, als dieses von hellem Scheinwerferlicht durchstrahlt wird. „Scheiße!“ entwischt es ihm. „Allerdings! Festhalten!“ ruft ihm Tanja zu, reißt das Steuer herum und bringt die große, schwere Maschine in eine scharfe Rechtskurve. Tibori muß sich wirklich festhalten und das Leitwerk knirscht bedrohlich. Und dann explodieren helle orangene Blitze, lassen Schatten hin-und herzucken und die Maschine wird durchgerüttelt. Entsetzt schießt es Tibori ebenso durch den Schädel wie Tanja: Flaks! Sie müssen mitten in einen Flaksperrgürtel irgendwo zwischen Orscha und Smolensk geraten sein. Wahrscheinlich errichtet, um Bomber, die Smolensk bombardiert haben und dann zwischen Orscha und Smolensk ihre Rückflugschleife drehen, vom Himmel zu holen. Tanja drückt in purer Verzweiflung den Flieger nach unten, um eventuell unter dem Flakfeuer durchtauchen zu können. „Holen Sie schon mal die Fallschirme!“ brüllt sie Tibori an, während sich ihre Hände derart um das Steuer der nun zunehmend bockenden Maschine krallen, daß die Knöchel weißlich hervortreten. Wie Perlenschnüre ziehen sich die Spuren der Flakgeschosse zu ihnen herauf. Es wäre schön anzusehen, wenn die Sache nicht so tödlich wäre. Auf einmal krepieren zwei Geschosse direkt vor ihnen. Reflexartig duckt sich Tanja und hält die Hände über ihren Kopf, während Glasscherben auf sie herniederprasseln und ein Hitzewolke durchs Cockpit fegt. Hinten zieht sich Tibori gerade den Fallschirmrucksack an, als Splitter mehrere große Löcher in die Rumpfwände reißen und mehrere der Seitenfenster zersplittern. Ein taubes Gefühl läßt ihn seine rechte Hand vors Gesicht halten. Im Flackern der Lichter von draußen sieht er einen blutigen Streifen auf dem Handrücken. Einen Moment lang starrt er die Hand einfach nur verwundert an. Dann schnappt er sich einen zweiten Fallschirm und rennt nach vorne, wobei er einmal strauchelt, als die Maschine durchgerüttelt wird und dann in Schieflage gerät. Kurz vor dem Cockpit kommt ihm Tanja entgegen, das Haar zerzaust, mit verängstigtem Blick. „Unser Leitwerk ist am Arsch!“ „Ich weiß!“ brüllt er zurück und wirft ihr den Fallschirm zu, den sie auffängt. Ein komischer Druck im Ohr sagt ihm, daß sich die Maschine in einem raschen Sinkflug befinden muß. Gerade will Tibori die Luke öffnen, als draußen etwas explodiert und auch die letzten Seitenfenster bersten läßt. Ein surrendes Geräusch und dann rast etwas blitzendes wirbelndes durch den Laderaum. Das hinterste Heck bricht dann weg und verschwindet in der Nacht. Tanja sieht kurz durch ein Seitenfenster, daß einer der linken Motoren explodiert ist. Das Flakfeuer ist jetzt schwächer, offenbar sind die da unten zum Schluß gekommen, daß sich der Rest von selber erledigt. Was noch nichtmal falsch ist. Kurz entschlossen packt sie Tibori am Arm, der immer noch total konsterniert auf das Loch am Ende des Flugzeugs starrt, reißt den überraschten Gefreiten mit sich. Und dann springen sie über die Abbruchkante, um möglichst weit weg vom brennenden und auseinanderbrechenden Flugzeug zu kommen. Als sie frei durch den Nieselregen fallen, zählen sie ein paar Sekunden ab, dann lösen sie ihre Fallschirme aus. Erst jetzt sieht Tanja Tibori in etwa 50 m Entfernung - oder besser: Sie sieht seinen Schirm in der Dunkelheit schimmern. Irgendwo hinter ihnen, wo noch letzte Flakgeschosse krepieren, geht die brennende Maschine im Wald runter, wo sie in einer grellen Explosionswolke zerschellt... Petra steht bei naßkaltem Wetter in einer dunklen Ecke zwischen zwei Kneipen, unweit des Bonner Hauptbahnhofs. Sie hat sich angesichts dieses Wetters in einen dicken flauschigen und schwarzen Mantel gehüllt. Aber ihr leichtes frösteln rührt nicht nur vom Wetter her. Auch von dem riskanten Spiel, das sie spielt. Sie waren bei Nadja gewesen, die natürlich die Bestellung von neulich noch nicht fertig hatte. Aber Petra hat gemerkt, daß sie beschattet wurde. Also hat sie Ben gebeten, in Bonn zu bleiben, bis Nadja die Bestellung fertig hat. Und Nadja hat sie mit einer kleinen Notiz zu dem Auto rübergeschickt, in dem die drei Beschatter saßen und ziemlich miesgelaunt davonfuhren, als sie merkten, daß man sie bemerkte. Um eine Ecke kommt eine kleine zierliche Gestalt in einer Regenjacke, die Haare streng nach hinten gekämmt und dort zusammengehalten. Chris Loewisch. Mit einem Schritt zur Seite stellt sie sich in die selbe dunkle Ecke wie Petra. Die schaut nochmal nach rechts und links die kleine Straße runter. Kein Auto, keine anderen Passanten. Nur aus der Kneipe dringt Lachen und murmelnde Unterhaltungen. „Waren wir wirklich so dilettantisch?“ fragt Chris nur. „Nein, nur hatten wir den selben Lehrer.“ erwidert Petra. „Ok. Auf dem Zettel stand, Du könntest uns helfen.“ „Ja.“ Petra macht eine Pause, als ein Mann die Kneipe verläßt und davontorkelt. Dann erst spricht sie weiter. „Die Gepos haben mich bei einer Razzia festgenommen. Sie gaben mir den Auftrag, Reiss zu töten.“ „Was?!“ entwischt es Chris lauter, als es ihr recht ist. „Psssst! Ja, man! Als Gegenleistung haben sie meine Freunde freigelassen und wollten das La Lic in Ruhe lassen. Aber ich hab geahnt, daß das nicht gutgeht. Ben hat dafür gesorgt, daß alle Leute aus dem Lic untergetaucht sind. Aber ich könnte eventuell dabei helfen, Reiss zu finden.“ „Wie?“ Chris mustert Petra mißtrauisch. „Ich hab heute abend mit Sturmbannführer Leikert telephoniert und darum gebeten mit meinem Auftraggeber zu sprechen. Er und ich sind jetzt mit einem alten Bekannten von euch in Zürich verabredet.“ „Mit wem? Komm schon, ich hab keinen Nerv dazu!“ „Mit Standartenführer Oschmann.“ „Ah.“ Chris‘ Tonfall klingt zornig. „Loewisch, Dir ist klar, was das bedeutet, wenn Oschmann in Zürich rumhängt?“ „Ja. Dann kann Schattenlagant nicht weit sein.“ „Und deshalb hab ich drei Fahrkarten für euch.“ Petra greift in die Innentasche ihres Mantels und holt drei Zugfahrkarten heraus. „Nach Zürich. Aber Vorsicht. Ich muß den Schein wahren, daß heißt, ich werde den Gepos sagen, daß ich den Verdacht habe, ihr würdet nach Zürich reisen.“ „Na toll. Dann kriegen wir da unten einen heißen Empfang.“ „Wahrscheinlich.“ Petra zuckt die Achseln. „Petra, wenn wir herauskriegen sollten, daß Du und Ben uns doch ans Messer liefern wollen, dann weißt Du, was Dir blüht.“ „Ja. Aber versteh mich bitte auch: Ich mußte erstmal meine Leute sicher wissen. Und jetzt komme ich vielleicht von uns allen am leichtesten lebend nach Schattenlagant.“ „Stimmt. Der Plan würde Stefan gefallen.“ „Ich weiß.“ Erst nimmt Chris Loewisch die Fahrkarten, dann tritt sie schweigend aus der dunklen Ecke und geht die Straße entlang zurück und biegt um die Ecke, woher sie gekommen ist. Petra tritt ebenfalls auf die Straße und wirft einen Blick in den finsteren, wolkenverhangenen Himmel. „Herr Gott, hoffentlich funktioniert das...“ Montag, der 13. Oktober Zusammen mit einem Schwall abgebrochener Äste fällt Tibori unsanft zu Boden. Und dann packen ihn kräftige Hände und zerren ihn auf die Beine. Diejenigen, die ihn gerade im Geäst eines Baumes aus seinen Fallschirmschnürren befreiten, klettern derweil herunter. Sie bewegen sich erstaunlich sicher in der Dunkelheit. Zwei der Männer bewachen mit Karabinern im Anschlag Tanja. Wegen der Dunkelheit ist Tibori etwas schwindlig; er versucht sich auf das wesentliche zu konzentrieren, um herauszufinden, mit wem sie es zu tun haben. Einer der Männer schubst ihn vorwärts und sagt dabei was zu seinen Kameraden. Eine komische Sprache – Russisch! Sind es etwa Partisanen? Wahrscheinlich. Aber bei Tibori will sich so ein echtes Erleichterungsgefühl nicht einstellen. Mit den russischen Partisanen ist fast ebenso wenig gut Kirsch essen wie mit den Gepos. Die Partisanen bilden einen Ring um Lars Edgar und Tanja und geben beiden einen Schubser, um zu signalisieren, daß sie losgehen sollen. Es geht durch finsteren Wald und mehrfach stolpern Tibori und Tanja. Dagegen bewegen sich die Partisanen als wäre es hellichter Tag. Nach etwa einer halben Stunde kommen sie auf ein offenes Feld. Es regnet. Raschen Schrittes bewegen sich die Partisanen über den matschigen Untergrund. Ihre beiden Gäste – oder Gefangenen? – tun sich da deutlich schwerer. Aber was solls. Die Partisanen lassen bestimmt nicht mit sich diskutieren. Nach überqueren des Feldes tauchen sie wieder in einen düsteren Wald mit zahlreichen Farnen unter. Die bereits zu Boden gefallenen Blätter sind vom Regen glitschig. Nach einer weiteren halben Stunde bleibt die Gruppe stehen. Zwei Mann räumen einen Busch beiseite und heben eine Holzklappe hoch, die im Boden eingelassen und durch den Busch getarnt war. Und dann klettern sie alle nacheinander hinunter in eine künstliche Höhlung im Boden. Während des Abstiegs über die Leiter schätzt Tibori die Tiefe des Verstecks auf etwa 5 m. Über ihnen wird die Klappe wieder geschlossen. Offenbar ist ein Partisan als Wache draußen geblieben. Unten angekommen öffnet sich eine weitere Tür und Tiboris und Tanjas Augen werden von dem Schein einer Petroleumlampe, die von der Decke eines 6 mal 6 m großen Raumes hängt, geblendet. In dem Raum steht ein Funkgerät, in der Mitte ein Tisch mit mehreren Stühlen, ein Schrank, in dem vermutlich Waffen und Kleidung aufbewahrt werden, und eine weitere Holztür in einer Wand deutet auf eine Vorratskammer. Drei Feldbetten lehnen an der Wand. Und ein Mann, der wie alle anderen Partisanen ganz in Zivil gekleidet ist, wartet bereits auf einem der Stühle. Mit ein paar Worten und einer herrischen Geste schickt er die meisten anderen Partisanen wieder raus; nur zwei Mann bleiben kampfbereit zurück und stellen sich hinter die beiden Stühle, auf die sich Tanja und Lars Edgar auf eine einladende Geste des sitzenden Mannes hin setzen. Ganz offenbar hat ihr Gegenüber einiges zu sagen innerhalb der Partisanenbewegung. Einer der Männer hat ihm die Papiere, die sie bei den beiden abgeschossenen „Schimäre“-Kämpfern gefunden haben, auf den Tisch gelegt, daneben liegen die beiden Pistolen und die beiden Messer, die sie Tanja und Tibori abgenommen haben. Der Mann nimmt die Ausweise und sieht sie sich an. Dann sagt er in halbwegs gutem Deutsch, wenn auch mit russischem Akzent: „Sie sind also Mitglieder von ‚Schimäre‘?“ Tanja als die Ranghöhere spricht: „Ja. Wir gehören zur Fliegerabteilung und wurden abgeschossen. Sie müssen doch eben das Flugzeug gesehen haben, sonst hätten Ihre Leute uns doch nicht aufgegabelt.“ „Stimmt. Den Absturz vor vier Stunden haben wir mitgekriegt.“ Vier Stunden? wundert sich Tanja. Mein Gott, wie schnell die Zeit in der Dunkelheit vergeht! „Sehen Sie...“ fährt der Russe fort, „wir müssen vorsichtig sein. In letzter Zeit tauchen bei uns verdächtig viele ‚Schimäre‘-Kämpfer auf. Sogar mit Gepo-Uniformen.“ „Wir tragen manchmal feindliche Uniformen zur Tarnung vor dem Feind. Sollten Sie doch eigentlich verstehen.“ „Stimmt. Das würde einiges erklären. Dann möchte ich mich erstmal vorstellen: Ich bin Lejtenant Bora Kolpatschkij, Chef dieser Partisaneneinheit. Betrachten Sie sich als unsere Gäste.“ Er hebt eine Hand und die Wachen hinter Tanja und Lars Edgar entspannen sich. Bora erhebt sich von seinem Stuhl und öffnet die Seitentür. Dahinter ist nicht, wie Lars Edgar zuerst dachte, eine Vorratskammer, sondern ein weiterer Raum wie dieser hier. Tanja und Lars Edgar stehen auf eine einladende Geste Boras hin auf und gehen zur Tür rüber. In dem Raum warten bereits Philipp, Jacke, Marta – und, oh Wunder, drei weitere „Schimäre“-Kämpfer. Ein davon, ein Oberfeldwebel, unterhält sich gerade konzentriert mit Jacke, während sich eine Frau mit langen, leicht gewellten blonden Haaren um Fraker (den erkennt Tanja wieder) kümmert, der sichtlich lädiert auf einem Feldbett liegt. Als Tanja und ihr Co-Pilot eintreten, sieht Philipp auf. „Mensch, zum Glück ist euch nichts passiert!“ ruft er aus. „Wir haben noch gesehen, wie die Maschine zerschellt ist!“ Er begrüßt Tanja per Umarmung und reicht Tibori die Hand. „Gut gemacht, Gefreiter.“ „Danke Kapitän. Ich habe nur das Richtige getan.“ Mit einem Nicken tritt Philipp an ihm vorbei und baut sich vor Bora auf, der freilich etwas größer und massiger ist. Dafür ist Philipp muskulöser. „Also Bora, wie geht’s weiter?“ „Ihr seid unsere Gäste, könnt aber jederzeit gehen. Wir wissen jetzt, daß ihr keine verdeckten Agenten der Gepos seid.“ „Wunderbar. Es wäre freundlich, wenn sich eine Reisemöglichkeit nach Westen finden ließe.“ „Bitte, Kapitän, wir haben noch anderes zu tun!“ „Bora, Sie und Ihre Leute leiden doch unter Munitionsmangel, oder?“ „Ja.“ „Wie wärs, wenn ‚Schimäre‘ ein paar Lieferungen abwirft?“ Sichtlich hin und her gerissen zwischen dem verlockenden Angebot und der Stimme, die sagt: Halte Dich da raus!, kratzt sich Bora das Kinn. Dann hellt sich sein Gesicht auf. „Ah, ich glaube da fällt mir was ein!“ Die Möwen scheinen in der Luft zu schweben und lassen sich von der feuchten, kalten Ostseebrise über den grauen Himmel tragen. Dabei stoßen sie ihre hellen, manchmal lachenden Schreie aus. Die Wellen klatschen gegen die Hafenmauern und die Docks. Über die Hafenpromenade schlendern zwei prominente Männer, gesichert von einer Eskorte schwedischer Soldaten und Polizisten: Kaiser Joseph und der skandinavische König Gustav (freilich ist Gustav der einzige, der sich König von Skandinavien nennt, für den Rest der Welt bleibt er der König von Schweden!). Dies ist der zweite Staatsbesuch des Kaisers innerhalb kurzer Zeit. In Stockholm hatte er sich mit Gustav über verschiedene Fragen beraten: Die weitere Zusammenarbeit bei gemeinsamen Schiffskonvois vor der norwegischen Küste etwa, und darüber, wie man das Baltikum untereinander aufteilen will. In diesem Zusammenhang hatte Gustav den Kaiser auch darüber informiert, wie weit seine Militärs mit den Vorbereitungen für die Eroberung der Inseln Dagö und Ösel sowie für eine neue Offensive gegen Sankt Petersburg (in den Vororten steht man ja schon!) ist. Der Kaiser wiederum hatte Gustav darüber ins Bilde gesetzt, wie weit die Vorbereitungen der kaiserlich-schwedischen Truppen für die Invasion Estlands von Süden her sind. Beide Monarchen schätzten diese Operationen jedoch nur noch als letzte Abrundungen der Eroberungen vor dem Winter ein. Allgemeine Siegeszuversicht herrscht vor. Auf eine überraschende Einladung Gustavs hin sind sie dann hierher, nach Helsingfors geflogen.Mal etwas weg vom Hauptstadttrubel. Im Hafenbecken liegen ein Kreuzer und zwei Zerstörer vor Anker. Sie gehören zu den Resten der einstigen schwedischen Seemacht. Diese war vor dem Krieg scheinbar überwältigend – der einzige Flugzeugträger aller Ostseeflotten gehörte dazu. Aber die schwedische Marine mußte mehrere harte Niederlagen hinnehmen, bei denen sie neben Großkampfschiffen auch ihren Träger verlor. Sie hat schlicht und einfach jede Menge Pech gehabt. Daran muß der Kaiser denken, als er die graugrün gestrichenen Kriegsschiffe betrachtet. „Auf ihre Weise schön, nicht wahr?“ fragt ihn Gustav, der auch überraschend gut Deutsch kann. „Ja. Nur leider sind schon zu viele davon auf dem Meeresgrund gelandet.“ erwidert Joseph. „Seit letztem Monat hat meine Marine einen neuen Oberbefehlshaber. Ich hoffe, das wirkt sich positiv aus.“ „Bleibt zu hoffen.“ Des Kaisers Gedanken schweifen für einen Moment zu Admiral Jakobson ab, der seit der dritten Septemberwoche die schwedische Marine kommandiert. „Wenn wir die Friedensverträge machen, wird das Königreich Skandinavien genügend Schiffe als Reparation erhalten.“ Gustav, dessen längeres Haar im Wind weht, sieht Joseph von der Seite an. „Das ist ein großzügiges Angebot.“ Joseph dreht sich ganz zu Gustav um, der ebenso wie der Kaiser in Gala-Uniform mit Regenmantel unterwegs ist. „Eure Truppen, Hoheit, haben uns auch seit Kriegsbeginn tatkräftig unterstützt.“ stellt Joseph fest. „Stimmt.“ Gustav macht eine Pause und beide gehen langsam weiter. Dann fragt Gustav, etwas überraschend: „Eure Majestät, werden wir ‚Schimäre‘ an den Friedensverhandlungen beteiligen, wenn wir gewonnen haben?“ Joseph zuckt mit den Schultern. „Weiß nicht...eher unwahrscheinlich. Wir haben den Anführer von ‚Schimäre‘ gefangengenommen und werden im November wahrscheinlich einen Schauprozeß durchziehen. Meine Militärs wollen für den Fall unseres Sieges die Vernichtung von ‚Schimäre‘ anstreben und ich bin geneigt, ihnen beizupflichten.“ „Ja, das wäre in der Tat eine gute Idee...“ stimmt auch Gustav zu. Sie erreichen ein Dock, wo eine Limousine bereits auf sie wartet. Die beiden Monarchen steigen in den Wagen ein und dieser fährt dann runter vom Hafengelände, geleitet von einigen Kradschützen. „O Gott der Schlachten, stähle die Herzen meiner Soldaten!“ Shakespeare, „Heinrich V.“ In Moskau hat sie nur wenige Stunden geschlafen, denn um 6 Uhr morgens flog sie zurück. Nur der exildeutsche Verbindungsoffizier Pick verblieb in Moskau, um noch einige seiner Vorgesetzten zu sprechen. Jedenfalls ist Karo sichtlich müde gewesen, als sie in Safonovo aus dem Flieger steigt. General Valkendorn, der sie vertreten hatte, wartete bereits. Er überbrachte die Nachricht, daß die Focke Wulf 200 mit Tanja seit vorigem Abend verschwunden sei. Die Nachricht ist so schockierend gewesen, daß Karo sich erstmal nur völlig perplex von Valkendorn nach Jakovlevo fahren läßt. Dort allerdings stürmt sie nun direkt in Connys Büro. Sie reißt die Tür auf und krächzt, den Tränen nah: „Hast Du schon was gehört? Wurden sie abgeschossen, oder was?“ Conny springt von ihrem Platz auf, bedeutet Valkendorn, draußen zu warten und schließt die Tür. „Wir wissen es nicht. Einer unserer Jagdpiloten hat Flakfeuer beobachtet, aber mehr wissen wir nicht. Wir hoffen auf eine Nachricht von den Partisanen oder von Kipshoven.“ Karo bleibt stocksteif stehen, ringt sichtlich um Fassung. Eine Woge der Verzweiflung überflutet ihr Inneres, gespeist von der Ungewißheit, genährt von ihren Befürchtungen. „Komm, ich mach Dir erstmal nen Kaffee, ok?“ meint Conny leise. Karo setzt sich und nickt nur. Conny geht nach draußen, um den Kaffee zu holen. Draußen steht noch Valkendorn. „Wie geht’s ihr?“ „Naja, ihre Nerven liegen blank. Aber sie wird sich fangen.“ stellt Conny ihre Diagnose. „Sind Sie sicher?“ hakt Valkendorn nach. „Ja, bin ich. Sie ist zäh. Sie braucht nur eben einen Kaffee und muß ihre Gedanken ordnen.“ „Wenn Sie meinen. Bleiben Sie besser bei ihr, ich hol den Kaffee.“ „Danke, General.“ „Ich weiß, ich bin sozial....Stark?“ „Ja.“ Conny geht zurück ins Büro. Gerade hat sich Karo eine Zigarette angezündet. „Hey, alles klar?“ „Soweit. Weißt Du Conny, jeden Tag kann sowas passieren, aber wirklich vorbereitet ist man nie.“ „Ja. Aber ich garantiere Dir: Wenn Tanja noch lebt, holen wir sie zurück.“ Zu Conny aufsehend meint Karo leise: „Danke.“ „Du weiß doch: Einer für alle, alle für einen. Das gilt genauso für Generäle wie für Obergefreite.“ Der Tagesablauf, wenn man keinen festen Bezugspunkt am Tag-Nacht-Rhythmus hat, muß an anderen Dingen festgemacht werden. An den Klo-Zeiten. An den Wachwechseln. An den Essenszeiten. Aber auch das muß man erstmal einordnen. Spontan schätzt Stefan, daß man ihn einmal in 24 Stunden über einem Schacht in einer großen Zelle sein Geschäft erledigen läßt. Er nennt es die Live-Vorstellung, da immer zwei Wachen dabei sind. Das selbe gilt für die bislang einzige Dusche, in der selben Zelle, was sich so darstellte, daß eine Wache einen Schlauch auf ihn richtete. Die Essenszeiten sind nicht viel lustiger: Einmal in 12 Stunden ein Stück Brot mit wässriger Suppe (die schmeckt, wie dreimal gegessen) und einem Becher Wasser. Ansonsten sitzt er auf seinem üblichen Stuhl, gekleidet in einen grauen Overall, die Hände hinter der Rückenlehne festgebunden, die Beine festgebunden. Nur den Knebel lassen die Wachen jetzt weg –nach wem soll er hier auch um Hilfe rufen? Wesentlich häufiger und unregelmäßiger sind die Besuche irgendwelche Gepo-Offiziere, die ihn verhören, meist ist es Gephardt. Immer die selben Frage-und Antwortspielchen, garniert mit Schlägen und Elektroschocks. Eigentlich wird es nie langweilig. Und im Sitzen läßt es sich auch gut schlafen... Sicherlich, alles etwas sehr zynisch. Oder Galgenhumor. Oder beides. Aber Stefan muß versuchen, sich nicht allzu sehr zermürben zu lassen. Das macht man am besten, indem man an jeder Sache das beste sieht. Was freilich gar nicht so einfach ist. Doch jetzt, nachdem er schon eine unbestimmte Zeit in diesem Loch verbracht hat (Stefan hat keine Ahnung, daß er nur wenig mehr als 30 Stunden hier ist), kommt es zu einer vergleichsweise angenehmen Überraschung. Stefan döst gerade so vor sich hin, den Kopf nach unten hängend, als die Tür wieder aufgeht und zwei Mann reinkommen – der gute alte Gephardt und ein noch sehr viel älterer Bekannter: Standartenführer Oschmann. Müde hebt Stefan den Kopf und mustert Oschmann. „Mensch, Jörg, Du verfolgst einen aber auch überall hin.“ Während Gephardt an der Tür stehen bleibt, zieht sich Oschmann den anderen Stuhl in der Zelle heran und setzt sich. Erstmal zündet er sich eine Zigarette an und bläst langsam den blauen Dunst aus. Dann meint Oschmann: „Stefan, Stefan, es scheint, Dein Glück hat Dich verlassen.“ „Keine Ahnung. Laß uns unter der Erde darüber weiterdiskutieren.“ „Ich würde mich ja gern mit Dir darüber unterhalten, aber ich fürchte, Du wirst darauf lange warten können. Zumindest werde ich Dich überleben.“ „Sei Dir da mal nicht zu sicher, Jörg.“ „Oh doch. Im Gegensatz zu Dir leiste ich ganze Arbeit und begnüge mich nicht mit einzelnen Körperteilen.“ Vielsagend deutet Oschmann auf seine Augenklappe. Stefan hatte ihm das Auge ausgeschossen. „Worauf wartest Du dann noch?“ erwidert Stefan zornig. „Hier bin ich, unbewaffnet, wehrlos – und hab nix zu tun. Also: Erschießt mich.“ Gewagt – aber naja, wenn man nichts zu verlieren hat. „Gephardt, hören Sie sich unseren General an: Immer einen flotten Spruch auf Lager!“ „Ja.“ lacht Gephardt. Und Oschmann erklärt Stefan: „Hör zu, Bastard. So einfach machen wir es Dir nicht. Vorher ziehen wir noch eine kleine Gerichtsshow ab, um Deine Leute ein wenig zu diskreditieren. So bezüglich Terrorismus, Kriegsverbrechen usw.“ „Du weißt genau, daß es nichts nachzuweisen gibt – außer bei euch.“ „Und Du weißt genau, wie gut unsere Anwälte im Worteverdrehen sind.“ Ein diebisches Lächeln breitet sich auf Oschmanns Gesicht aus. „Und dann erschießen wir Dich.“ Die Tür wird von der Wache geöffnet und eine junge Frau, vielleicht etwa 28 Jahre alt, schlank, mit sandfarbenem Haar, kommt herein und spricht kurz und leise mit Gephardt. Sie scheint sowas wie eine Sekretärin zu sein. Und dann, als sie Stefan einen Blick zuwirft, erkennt er sie. Er muß sich beherrschen, um ein vielsagendes Grinsen zu unterdrücken. Gephardt wendet sich an Oschmann: „Standartenführer, Leikert hat sich gemeldet.“ „Ok, das soll uns erstmal reichen. Oschmann steht auf und drückt seine Zigarette an Stefans Bein aus. Durch den Stoff des Anzugs hindurch spürt Stefan die Hitze. Zum Glück hält der Stoff das gröbste ab, auch wenn ein Brandfleck in ihm zurückbleibt. Ohne ein weiteres Wort verlassen Oschmann, Gephardt und die Frau den Raum und die Wache schließt wieder die Tür. So klein ist die Welt. Stefan erinnert sich noch genau, wie er die hübsche junge Frau vor drei Jahren während eines Segeltripps mit Philipp an der Maas kennenlernte. Was hat sie wohl hierher verschlagen. Na – egal! Jedenfalls kann es jetzt nicht mehr lange dauern, bis seine Leute ihn finden... Es ist schon spät am Nachmittag und seit dem Morgen sind sie mit dem Zug unterwegs. Fast die ganze Strecke den Rhein entlang und die ganze Zeit hat es geregnet. Ein richtig grauer Tag. Halt typisches Oktoberwetter für Mitteleuropa. Da es eh nichts zu sehen gegeben hat, hat sich Chris in dem Abteil auf der einen Bank hingelegt und macht ein Nickerchen. Sabine liest ein Buch und Dominik schaut aus dem Fenster ins Leere, hängt im Gedanken der Frage nach, wie sie auf dem Züricher Bahnhof den Gepos entgehen sollen. Immerhin haben die nicht die Chance genutzt, sie im Zug festzunehmen, obschon bereits auf der Höhe Straßburgs ihre Ticketts vom Schaffner überprüft wurden. Sabine meinte, sie hätte mit Kontaktleuten in der Schweiz noch telephonieren können und die würden was organisieren. Aber was sollte das heißen? Nur einmal löst Dominik seine starre Haltung und schaut nochmal Sabine an. Die Frau wirkt tatsächlich total gelassen, liest ihren Roman und scheint sich keine weiteren Sorgen zu machen. Vielleicht ist ja wirklich alles gut organisiert. Aber eines gilt jedesmal: Überraschungen können jeden Plan zunichte machen. Der Schaffner öffnet nochmal die Schiebetür. „Entschuldigung. Sie hatten mich gebeten, Bescheid zu geben, wenn wir nur noch zehn Fahrtminuten von Zürich entfernt sind.“ Sabine schaut auf und lächelt. „Ja, danke.“ „Gerngeschehen.“ Der Schaffner, ein junger Mann, lächelt zurück zu Sabine. Immerhin ist sie eine ziemlich attraktive Frau, deren weinrot gefärbte schulterlange Haare einen Kontrast zu ihrer hellen Haut bilden. Der Schaffner schließt die Tür wieder. Einen Moment wartet Sabine noch, dann steckt sie ihr Buch in den Rucksack und holt ihre Pistole raus, prüft das Magazin. Dominik versteht: Jetzt müssen sie sich bereitmachen. Seitlich im Rucksack verstaut hat Sabine die Einzelteile ihres zerlegten Scharfschützengewehres. Sie versichert sich nochmal, wo welches Teil ist. Und Dominik weckt Chris. Die reckt sich und stöhnt: „Was ist...?“ „Wir sind gleich da.“ Chris Loewisch setzt sich auf. „Na gut. Dann wolln ma mal.“ Der Züricher Hauptbahnhof ist ein sogenannter Sackbahnhof – alle Züge enden hier und entsprechend ist das Bahnhofsgebäude strukturiert wie ein U um die Geleise herum. Natürlich ist die Bahnhofshalle überdacht. Das schützt im Winter vor allzu großer Kälte und im Sommer vor der Hitze. Normalerweise sollte in diesem Bahnhof viel los sein, aber auch hier hat der Krieg alles geändert, seit die Kaiserlichen einmarschiert sind. Nur wenige Leute sind hier unterwegs – nämlich nur die, die unbedingt mit dem Zug reisen müssen. Die meisten Menschen im Bahnhof sind Geheimpolizisten. Seit heute morgen haben sie hier alles übernommen und machen in ihren Uniformen nicht mal einen Hehl daraus. Reingekommen sind sie trotzdem. Im Bahnhofscafé auf der oberen Plattform – man hat von hier aus einen schönen Blick über die Bahnsteige – sitzt Nicole Elsing und hat sich gerade ein Glas Mineralwasser bestellt. Jetzt kommt die Bedienung und stellt es ihr hin, Nicole bedankt sich. Über eine Rolltreppe sieht sie eine jung gebliebene Frau mit wuscheligem braunem Haar und Sommersprossen heraufkommen. Sonja Berg, eine „Schimäre“-Agentin. Sie setzt sich kurz zu Nicole. „Ok, alles klar. Lisa ist mit ihren beiden Hunden auf Posten. Sie wird sofort melden, wenn Verstärkungen anrücken.“ „Alles klar. Dann geh auch auf Deinen Posten. Wenn nötig, must Du die Verstärkungen ablenken.“ „Werd ich schon schaffen.“ Sonja steht wieder auf und verläßt den Bahnhof nicht allzu eilig. Als sie durch das Hauptportal nach draußen kommt, regnet es. Wie eben auch schon. Auf den Straßen stehen große Pfützen. Sie überquert den Bahnhofsplatz und wirft dabei einen Blick zu der etwas rundlicheren Frau, die mit zwei großen Hunden in der Nähe des Limnat-Ufers Gassi geht. Es ist Lisa Kirchner, eine „Schimäre“-Agentin, die im September aus Köln angereist kam, um den Schweizer Widerstand organisieren zu helfen. Lisa blickt kurz – wie zufällig – zu Sonja rüber, während diese den Platz überquert. Dieser kurze Blickkontakt reicht zur Verständigung. Die Vorwarnzeit für diese Aktion ist zwar sehr kurz gewesen, aber nichtsdestotrotz haben sie was auf die Beine gestellt. Unter anderem ein Dutzend Widerstandskämpfer, praktisch alles Soldaten der zerschlagenen Schweizer Armee, auf das Bahnhofsgelände geschmuggelt. Mit etwas Glück könnte man die drei aus Bonn eintreffenden Widerstandskämpfer durch die Gepo-Blockade schmuggeln. Als Sonja einen blauen Kleinwagen am Rande des Bahnhofsplatzes erreicht, steigt sie ein und sieht sich nochmal um. Auf dem Platz selber sind 5 Gepos und – unweit der Brücken – ein Wachposten von drei Mann der Armee. Gegenüber des Bahnhofs sind vor allem etwas ältere Bürogebäude vorzufinden, in deren Erdgeschossen etliche Reisebüros untergebracht sind, die aber wohl nicht mehr wirklich Gewinn machen. Einer der Widerstandskämpfer, ein Schweizer Unteroffizier namens Gerbeau, begibt sich gerade zu den Bahnhofstoiletten im Erdgeschoß, etwa 20 m links vom Haupteingang. Er ist als gewöhnlicher Zivilist gekleidet mit brauner Hose, grauem Hemd und einer bläulichen Mütze. Für den Fall, daß er kontrolliert wird, hat er falsche Papiere dabei. Allerdings hat er eine dünne Stoffjacke übergezogen, in deren einer Tasche eine Pistole ist... Als er den Eingang der Herrentoilette erreicht, geht die Tür auf und jemand in der Uniform eines Hauptsturmführers der Gepo steht vor Gerbeau. Der aber erkennt die Gestalt mit den roten Haaren: Unteroffizier Koszarek. Der grinst Gerbeau an. „Ich hab mir schon Sorgen gemacht, als ich sie mit dem Gepo auf die Toilette gehen sah...“ bemerkt Gerbeau leise. „Nö,nö...“ erwidert Christian Koszarek. „Der liegt gut verschnürrt hinten auf dem Klo.“ „Ok, alles klar.“ Gerbeau tritt an Koszarek vorbei, um scheinbar auf Toilette zu gehen und Christian macht sich auf dem Weg zu dem Bahnsteig, wo der Zug ankommen soll, indem Chris, Sabine und Dominik sitzen. Er geht auf die Bahnsteige zu und wendet sich dann dem Bahnsteig 3 zu. Als er diesen entlanggeht und dabei Blicke zum Steig 1, wo ein Zug bereitsteht, wie sie für die Heimaturlauber eingesetzt werden, begegnen ihm mehrere Gepos, die ihn alle freundlich grüßen. Am Steig 4 ist vor einer halben Stunde ein Zug eingetroffen, wo noch die letzten Fahrgäste durch die Gepo-Kontrollen müssen. Christian ist zutiefst angespannt. Wenn die Gepos merken, was er hier für eine Show abzieht, ist er so gut wie tot. Zum Glück hat er zwei P38 dabei. Da fährt der Zug ein. Oben im Café streckt sich Nicole etwas, um das Geschehen jetzt im Blick zu haben. Quietschend kommt der Zug zum Stehen. Sofort stellen sich vor jeden Waggon zwei Gepos und fangen die Passagiere ab. Kontrollieren die Papiere und vergleichen die Fahrgäste mit Fahndungsphotos in einem kleinen Büchlein. Christian bewegt sich zielstrebig den Bahnsteig entlang, dabei den sich nun hier ansammelnden Menschen ausweichend. Die meisten Reisenden können nach einer kurzen Kontrolle weiter. Fast ganz hinten sieht er schließlich einen Mann und zwei Frauen, die gerade von vier Gepos umringt und genau unter die Lupe genommen werden. Schnellen Schrittes ist Koszarek zur Stelle und stellt zu seinem Glück fest, daß es sich durchweg um niedere Gepo-Dienstgrade handelt. „Männer, ab hier übernehme ich!“ meint Koszarek im Kommandoton. Sofort treten die Gepos ein paar Schritte von den drei Fahrgästen zurück. „Wenn haben wir hier?“ fragt Koszarek den Gepo, neben den er sich gestellt hat. Der antwortet: „Dominik Kipshoven, Sabine Granrath und Christina Loewisch. Werden im Rheinland bereits seit Wochen gesucht, weil sie zum ‚Schimäre‘Netzwerk gehören.“ „Identifizierung zweifelsfrei?“ „Ja. Sie haben es selber zugegeben.“ „Dann ist ja alles klar. Wir haben den Verdacht, daß die drei Schattenlagant suchen sollen. Daher soll ich sie mitnehmen.“ „Geht klar, Hauptsturmführer. Sollen wir sie begleiten?“ „Nein. Überprüft den Zug lieber auf Sprengsätze. Bis zu meinem Vorgesetzten hier im Bahnhof werd ich die drei wohl noch bringen können.“ Einer der Gepos blickt sich um, sieht die vielen seiner Kollegen und weiß dann, was der Hauptsturmführer meint. „Sie haben recht, Hauptsturmführer. Wird wohl kein Risiko sein. Die vier Gepos klettern in den Zug und mit einer Kopfbewegung fordert Koszarek die drei ‚Gefangenen‘ auf, ihm zu folgen. Als sie die ersten paar Meter gegangen sind, nuschelt Christian leise zu den dreien hinüber: „Keine Sorge, ich bin Unteroffizier Koszarek von ‚Schimäre‘. Ich werd euch hier rausbringen.“ Ohne ein weiteres Wort gehen sie weiter. Die letzten Fahrgäste werden gerade durchgecheckt. Einige Gepos werfen Koszarek und seinen drei Begleitern neugierige Blicke zu, schöpfen aber keinen Verdacht. Oben im Café läßt Nicole ein paar Münzen auf dem Tisch liegen und steht auf. Langsam geht sie zur Rolltreppe und fährt nach unten. Sie beobachtet, wie sich Koszarek und die drei Angereisten der Eingangshalle nähern. Sollte es wirklich gelingen, die Gepos so zu täuschen, daß man aus der Sache ohne Schießerei rauskommt? So viel Glück hat man doch sonst nicht... In dem Moment sieht Nicole einen alten Bekannten am Kopfende des Bahnsteigs mit zwei Gepos debattieren: Helge Hinkelmann. Nicole hat in der Zeit, als sie noch verdeckte Agentin von „Schimäre“ war, als Geologin gearbeitet. Im Studium und später bei Aufträgen hat sie des öfteren mit Helge zusammengearbeitet, der freiberuflicher Geologe ist. Das letzte Mal hat sie ihn vor anderthalb Monaten gesehen, als ihre Tarnung aufflog, wobei Helge zwischen die Fronten geriet. Man konnte es zum Glück so hinstellen, als wenn Helge ihre Geisel gewesen wäre, so daß er keinen weiteren Ärger mit den Gepos hatte. Was zum Teufel macht der hier? Wenn er sie wiedererkennt! Oh Gott! Ihre Gedanken jagen. Was machen? Erstmal an den Plan halten. Unten angekommen begibt sich Nicole erstmal in die Empfangshalle. Dort stehen fünf Gepos, aber auch vier als Reisende getarnte Widerstandskämpfer, die sich nun unauffällig in der Nähe der Gegner postieren. Vorne am Bahnsteig nähert sich weiterhin Christian Koszarek mit den drei Gästen aus dem Rheinland. Auch er sieht, wie ein Fahrgast mit zwei Gepos debattiert und dabei immer wieder mit einem großen Hammer herumfuchtelt. Als der Mann Christian sieht und erkennt, daß er rangmäßig über den beiden Gepos – mit denen er seit Minuten diskutiert – steht, ist er mit einem Satz vor Christian. Die beiden Gepos können ihn so schnell nicht zurückhalten. Christian springt das Herz bis in den Hals und er hebt die Hand, damit seine drei Begleiter stehenbleiben. Jetzt heißt es kühlen Kopf behalten, denn die beiden Gepos beäugen das Quartett schon so mißtrauisch. Der Mann redet auf Christian ein: „Hauptsturmführer, würden Sie den beiden Pfeifen da bitte klarmachen, daß ein Geologenhammer keine Waffe ist? Würden Sie das bitte machen, zum Teufel nochmal? Ich habe Termine, ich muß einen Plateosaurus ausbuddeln!“ „Moment, bitte was?“ fragt Christian nach und ergänzt dann: „Bitte ganz langsam und von vorn!“ Dominik verdreht hinter ihm schon die Augen, hält aber die Klappe, denn sonst fliegt die Tarnung erst recht auf. „Ich bin Geologe und soll hier in der Schweiz ein paar alte Knochen ausbuddeln. Dafür brauche ich aber das hier!“ Er hält den Hammer hoch. „Ein Geologenhammer von ‚Ostflügel‘. Aber Ihre beiden Kollegen hier meinen, es wäre eine Waffe.“ „Ihre Papiere bitte!“ fordert Christian. Einer der beiden Gepos reicht die Papiere an Christian. Der sieht sie durch. Helge Hinkelmann. „Ok, Herr Hinkelmann. Sie können durch.“ „Aber...“ will sich einer der beiden anderen Gepos einmischen. „Nichts aber, Rottenführer! Das ist ein schlichter einfacher Hammer. Oder wollen Sie etwa jeden Handwerker festnehmen.“ „Natürlich nicht, Hauptsturmführer.“ „Also lassen Sie den Mann gehen! Ich muß die drei Gefangenen hier wegbringen.“ Christian reicht Helge die Papiere zurück und geht dann mit seinen drei Begleitern weiter zur Empfangshalle. Helge geht neben ihnen her und betritt die Halle etwas weiter rechts. Fast gleichzeitig wie das Widerständler-Quartett. Nicole hat sich wohlweislich hinter einen nicht besetzten Zeitungsstand gestellt, damit Helge sie nicht sieht. Das könnte alles kaputtmachen. In dem Moment kommt von der Toilette ein Gepo angerannt. „Jemand hat Hauptsturmführer Rehmen niedergeschlagen!“ Stocksteif bleibt Christian stehen. Auf einmal wird ihm bewußt, daß auf der Uniform natürlich der Name „Rehmen“ steht. Es wird ihm heiß und kalt. Scheiße! Drei der Schweizer Widerstandskämpfer in der Halle sind direkt bei einem Gepo und attackieren sie rücklings. Ziehen ihnen den Pistolenkolben über den Schädel oder rammen ihnen ein Messer zwischen die Rippen. Ein vierter Gepo liefert sich mit einem Schweizer ein heftiges Handgemenge. Nicole springt hinter dem Zeitungsstand hervor und brüllt Koszarek zu: „Bringen Sie Hinkelmann hier raus!“ Helge versucht die Situation zu überblicken, aber alles geht rasend schnell. Chris Loewisch und Sabine sprinten zu den Eingangstüren. Christian schubst Helge in die selbe Richtung – „Schnell! Nach draußen!“ – und entreißt ihm dabei den Geologenhammer, wirbelt herum und wirft das Ding dem Gepo entgegen, der von den Toiletten angerannt kommt. Der Gepo fällt aus dem Lauf seitlich zu Boden, als ihm das spitze Ende des Hammers in der Brust stecken bleibt. Dominik hat zwischenzeitlich seine Pistole gezogen und hält Christian den Rücken frei. Zwei Widerstandskämpfer ringen derweil den bislang widerspenstigsten Gepo nieder. Hektisch blicken sich alle um. Chris, Sabine und Helge sind bereits draußen. Obwohl die Türen zur Halle alle verglast sind, scheint kein Gepo in der Hauptbahnhalle oder draußen auf dem Bahnhofsplatz etwas mitgekriegt zu haben. „Weg, nach draußen!“ befiehlt Nicole. Und Koszarek gibt ihr recht. Sonst wird das doch noch zu einer heftigen Schießerei. Christian eilt raschen Schrittes zur Tür und zieht dabei die Uniformjacke aus. Um die Hose kann er sich später kümmern. Hauptsache, er hat keine allzu deutlichen Gepo-Kennzeichen mehr an. Schnell nach draußen. In strömenden Regen. Die meisten Schweizer Widerstandskämpfer sind nun dabei, sich so unauffällig wie möglich in die nächste Seitenstraße zu verdrücken. Lisa Kirchner ist ebenfalls nicht mehr zu sehen. Nicole, Dominik und Sabine Granrath steuern auf das Auto von Sonja zu. Mit einem kurzen „Mitkommen!“ bedeutet Christian Helge und Chris Loewisch ihm zu folgen – zu seinem Wagen. Das mulmige Gefühl in Christians Magen verstärkt sich immer mehr. Aus dem Augenwinkel sieht er, wie Sonja und die andern mit dem Kleinwagen in die nächste Seitenstraße biegen und sich davon machen. Soweit, sogut. Auch Christians Wagen, einen kleinen Sportwagen von Porsche (der gehörte einem gefallenen Schweizer Offizier), erreichen sie noch unbeschadet. „Hinkelmann, Sie nach hinten!“ meint Christian. „Aber ich gehör doch gar nicht zu Ihnen!“ „Alarm!“ schalt es vom Bahnhof her. Christian deutet zum Eingangsportal hinüber: „Erklären Sie das denen da!“ Aus dem Bahnhof kommen Gepos gerannt und die andern Gepos, die auf dem Platz patrouillierten, wirbeln herum. Nur noch ein paar Sekunden! Da überlegt Helge nicht lange, wirft sich und seinen Rucksack auf den Rücksitz, Christian springt hinters Steuer, Chris Loewisch ist schon auf dem Rücksitz.Türen zugeschlagen, Gas gegeben! Mit quietschenden Reifen brettert Koszarek über den Bahnhofsplatz. Ein Gepo kriegt das nicht schnell genug mit, will zur Seite springen, wird aber vom Wagen noch gestreift und überschlägt sich einmal in der Luft, bevor er auf den Asphalt aufschlägt. Die anderen Geheimpolizisten geben ziemlich ungezielte Schüsse ab. Christian schafft es tatsächlich, in die nächstbeste Straße nach Süden einzubiegen. „Haben Sie eine Waffe?“ fragt er Chris Loewisch. Sie nickt und hält ihre Walther PPK hoch. „Gut, dann nehmen Sie noch meinen beiden P38.“ Während er die Straße entlangbrettert und über den Löwenplatz hinweg und vorbei an einigen verdutzten kaiserlichen Soldaten, zieht er mit einer Hand seine beiden P38 aus den Halftern und reicht sie Chris. „Schießen Sie uns einfach den Weg frei, wenn nötig.“ „Alles klar.“ Er schaltet ruckend einen Gang runter, biegt nach links ab und brettert Richtung Züricher See. Über eine Kreuzung, wo die andern Fahrzeuge quietschend bremsen. Und dann schießt um eine Ecke ein Dienstwagen der Gepos hervor und hängt sich an sie. Versucht zu überholen, geht nicht. Rammt sie seitlich. Funken sprühen auf. Menschen springen überrascht zur Seite, wenn die beiden sich beharkenden Wagen vorbeirasen. Einer der Gepos schießt plötzlich. „Kopf runter!“ Die Kugeln zertrümmern nur die Windschutz-und zwei Seitenscheiben. Über Koszareks Nacken hinweg feuert Chris zurück, schießt ein ganzes Magazin leer. Auch die Gepos feuern nochmal zurück und Koszarek fühlt etwas heißes über seinen Nacken hinwegjagen, daß anschließend in der Beifahrertür einschlägt. Koszarek schlägt mit einem Arm gegen die zerschossene Windschutzscheibe und Scherben prasseln herab, aber immerhin sieht er wieder was. Kurzentschlossen macht er eine Vollbremsung, nachdem er bislang noch mit Höchstgeschwindigkeit dahinraste. Der Gepo ist total überrascht, rauscht an ihnen vorbei, Chris schießt ein halbes Magazin hinterher. Der Gepo-Wagen brettert über einen Rasen und bleibt dann auf diesem stehen. Setzt zurück. Koszarek legt den nächsten Gang ein und gibt wieder Gas. Setzt in voller Fahrt zurück, muß abstoppen, als ein Geldtransporter von der Schweizer Nationalbank, die in einer Nebenstraße sitzt, die Straße überquert. Also wieder vorwärts. Dort haben die Gepos gewendet. Nur 100 m entfernt ist eine Landungsstelle für Fähren und Motorboote. Das wissen auch die Gepos. Sie fahren genau vor dem Zugang zum Pier und steigen dort aus. Legen die Waffen an. Koszarek wartet ab. Läßt den Motor aufheulen. „Schönheit, irgendwelche intelligenten Ideen?“ fragt er Chris. Aber die schüttelt nur den Kopf. „Aber ich. Feuern Sie einfach blindlings und ducken sie sich.“ Kaum hat er das gesagt, gibt er Gas und hält genau auf die Gepos zu. Helge auf dem Rücksitz starrt nur kreidebleich nach vorn und duckt sich, als die Gepos feuern. Chris feuert blindlings über das Amaturenbrett hinweg nach vorn. Man hört, wie Kugeln der Gepos auf die Karosserie prasseln. Aber Koszarek gibt einfach Gas. Nach einem Magazin müssen die Gepos zur Seite springen, drei sogar ins Wasser, denn dann rammt Christian mit voller Wucht den Dienstwagen der Geheimpolizisten, schiebt ihn dann vor sich her über den Pier. Erst dann stoppt er. Der Gepo-Wagen schlägt seitlich über und fällt dann am Ende des Piers in den Züricher See. Christian schnappt sich seine beiden P38 wieder und ruft Chris und Helge zu: „Ergattert ein Motorboot!“ Dann springt er aus dem Wagen, hebt beide Waffen. Zwei Gepos kommen schon angerannt, ducken sich auf dem Pier und feuern. Christian geht hinter der Fahrertür in Deckung und feuert mit beiden Pistolen. Damit gibt er seinen beiden Begleitern Deckung. Fast am Ende des Piers, also nur ein paar Meter entfernt, ist tatsächlich ein vielleicht vier Meter langes, weißes Motorboot festgemacht. Helge springt kurzentschlossen ins Boot, nachdem er seinen Rucksack dort reingeworfen hat und hilft dann Chris hinunter. Die ruft: „Unteroffizier, kommen Sie!“ und löst die Leinen, während Helge den Motor anwirft. Christian hat inzwischen bemerkt, daß der Motor seines Porsche qualmt und Benzin ausläuft. Er schießt beide Magazine leer, springt dann auf, ist mit einem Schritt über die Motorhaube und legt dann einen mehrere Meter weiten Hechtsprung hin, mit dem er im Motorboot landet. Bei der Aktion streift ihn eine Kugel am Bein, was erst später merkt. Helge dreht den Motor jetzt auf und steuert auf den offenen Züricher See hinaus. Hinter ihnen fliegt das Auto auf dem Pier in die Luft. Christian verscheucht mit einer Handbewegung Helge vom Steuer und übernimmt es selber. Erst jetzt meldet sich die leicht blutende Streifschußwunde am Bein und läßt ihn schmerzhaft zusammenzucken. „Warten Sie, ich schau mir das mal an.“ bietet Chris ihre Hilfe an. Christian nickt und setzt sich auf die schmale Bank im Heck des Motorbootes, während Helge wieder ans Steuer geht. In einem kleinen Kasten an der Seite des Bootes findet Chris tatsächlich einen Verbandskasten. Während sie Christian verarztet, fragt der: „Herr Hinkelmann, woher kennen Sie Nicole?“ Helge zuckt die Schultern. „Vor dem Krieg haben wir als Geologen zusammengearbeitet.“ „Stimmt. Sie hat mir von ihrer Tätigkeit früher erzählt.“ bestätigt Koszarek. „Tut uns leid, daß Ihre Pläne durch uns durcheinandergeraten sind.“ Leise schnaubt Helge und erwidert dann: „Das ist schon das zweite Mal, daß ich zwischen die Fronten gerate. Vor etwas mehr als einem Monat ist mir das schonmal passiert.“ „Es soll Leute geben, die die Scheiße anziehen.“ spottet Chris Loewisch, was ihr einen verärgerten Blick von Helge einfängt. „Hinkelmann, wie haben Sie das Ding gestartet?“ Mit einem gaunerhaften Lächeln unter seiner Brille schaut Helge über die Schulter und meint: „Naja, ich habs kurzgeschlossen...Bitte nicht weiter nachfragen.“ „Ähhh, nö, werd ich nicht.“ stimmt Koszarek zu und mustert jetzt erstmal bewußt den Herrn Hinkelmann. Er ist etwas größer als Koszarek, hat kurze braune Haare, einen durchschnittlichen Körperbau. Insgesamt ein etwas seltsamer Vogel. „Wohin soll ich steuern?“ fragt Helge. Koszarek überlegt kurz, meint dann: „Möglichst weit nach Süden.“ Chris hat inzwischen die Verletzung von Koszarek verbunden und blickt in den wolkenverhangenen Himmel. „Wenigstens hat der Regen aufgehört.“ meint sie über den Krach des Motorbootes hinweg. „Ja, wenigstens.“ Kaum hat Christian das gesagt, hört er ein anderes Geräusch. Er richtet sich auf. Blickt hinter sich. Am Himmel ist ein Flieger aufgetaucht. „Helge, könnten Sie etwas mehr Gas geben?“ fragt Chris Loewisch zögernd. „Ich fahr schon mit Höchsttempo. Wieso...?“ Als Helge kurz hinter sich blickt, sieht er, was da auf sie zukommt und fängt an zu fluchen: „Scheiße! Scheiße! Scheiße!“ Da donnert auch schon die Messerschmitt nur 15 m über ihre Köpfe hinweg. Helge geht in eine scharfe Kurve, das die Gischt aufspritzt. Das Flugzeug hat inzwischen eine Kurve am Himmel gezogen und rast nun von Süden her heran. Und läßt seine Bordkanonen belfern. Eine Spur von Wasserfontänen jagt auf das Motorboot zu, Helge fängt es ab, reißt das Steuer herum und die Garben jagen knapp an ihnen vorbei. Und dann zieht die Messerschmitt vorüber, um in die nächste Kurve zu gehen und den nächsten Angriff einzuleiten. Als er Vollgas geben will, würgt Helge den Motor ab. „Scheiße!“ „Verdammt, was haben wir noch an Waffen?“ faucht Christian und zieht seine beiden P38. Er hat noch für jede ein Magazin. „Was ist mit Ihrer Waffe?“ Chris zuckt die Achseln und erwidert: „Kein Magazin mehr.“ „Dann suchen Sie eine Leuchtpistole! Die sind normalerweise auf Booten!“ Chris nickt und öffnet alle Seitenfächer und die Fächer neben dem Steuer. Helge hilft beim Suchen. Christian stellt sich ans Heck des Bootes und zielt mit beiden Pistolen auf die heranrasende Messerschmitt. Deren Motorengeheul wird lauter und lauter. Christian feuert seine Magazine leer, während die Bordkanonengarben wieder auf sie zujagen. Plötzlich reißt Christian etwas von den Beinen und schleudert ihn ins Wasser. Es ist Helge gewesen, der in mit ins Wasser gerissen hat. Chris Loewisch hat kurz davor tatsächlich eine geladene Leuchtpistole im Fach unter dem Steuer gefunden, ist nun allein auf dem Boot, legt kurz an, feuert die Leuchtkugel ab, die nun auf das Flugzeug zurast. Und dann springt auch sie ins Wasser. Ihre sich mit Wasser vollziehenden Klamotten nicht beachtend, versucht sie möglichst weit weg zu kommen von dem Boot. Christian hat den Kopf wieder über Wasser und sieht gerade noch, wie die Leuchtkugel den Propeller des Flugzeugs trifft, worauf hin eine Qualmwolke die Fliegernase einhüllt und das ganze Teil genau ins Boot rast und dann explodiert. Zum Schutz vor der Hitzewolke hält sich Christian die Hand vors Gesicht. Um ihn herum prasseln größere und kleinere Trümmerstücke hernieder – Flügelteile, Leitwerkreste, Rotorsplitter, glühende Motorteile, Reste des Bootes. Neben ihm taucht Chris Loewisch auf. Ihre rötlich gefärbten Haare hängen klatschnaß in ihr Gesicht, sie muß sie mit einer Handbewegung wegwischen und schaut ziemlich wie ein begossener Pudel drein. Und sie schnappt nach Luft. „Kommen Sie...“ meint Christian Koszarek, „wir müssen zum Ufer schwimmen.“ „Ääächh...krächz...alles klar.“ Helge ist schonmal vorgeschwommen. „Mal ehrlich: Gibt es etwas beschäuerteres als aufeinander zu schießen, obwohl man es eigentlich besser weiß? Eben. Soviel zum durchschnittlichen IQ der Menschheit...“ General Reiss zu Generalmajor Stefanie Schoeps, Herbst 1788 Direkt westlich von Smolensk gibt es eine Ansammlung kleiner Holzhäuser mit einem gemauerten kleinen Bahnhof mittendrin und unbefestigten Straßen, die um diese Jahreszeit schlammig sind. Mehr oder weniger schlecht gelaunt starrt Philipp auf das Schild am Bahnhofsgebäude: „Hauptbahnhof Katyn“. Es regnet – wie üblich – und die schlammigen Straßen mit ihren Spurrillen sind mit tiefen Pfützen übersät. Der Schlamm klebt Philipp an den Stiefeln. Noch einmal dreht sich Philipp zu den andern um, wo Jacke, Krakowsky und Tibori sich um Tanja, Tina, Marta und den angeschlagenen Fraker postiert haben. Jacke, Krakowsky und Tibori tragen schwarze Gepo-Uniformen, ebenso Philipp. Letzterer hat eine Uniform mit den Rangabzeichen eines Obersturmführers von Bora bekommen und ist damit der Ranghöchste von ihnen. Hoffentlich funktioniert ihre Tarnung als Gepo-Trupp, der vier Gefangene ins Reich bringen soll. Nervös rückt Philipp seinen geschulterten Rucksack zurecht. Aus dem Büro des Bahnhofsvorstehers kommt ihnen ein Fähnrich des Heeres entgegengeeilt, bei dem sich Philipp nach einer Transportmöglichkeit nach Westen erkundigt hat. „Obersturmführer, in einer Stunde hält hier ein Zug, um zwei Fronturlauber aufzunehmen. Auch sonst sind nur Fronturlauber an Bord. Vier Waggons, aber wir könnten einen freimachen. Ist Ihnen das recht.“ Philipp nickt anerkennend. „Sehr recht, Fähnrich. Wäre es möglich, das wir den ersten Wagen nach der Lokomotive kriegen?“ „Sicher. Wenn Sie das so wollen.“ „Ja, so will ich es.“ „Zu Befehl, Obersturmführer.“ „Ich danke Ihnen, Fähnrich. In einer Stunde sagten Sie?“ „Ja.“ „Wo können wir was trinken?“ Der Fähnrich deutet die Straße hinunter: „Dort vorne die nächste rechts ist sowas wie eine von uns eingerichtete Kneipe. Soll ich solange ein paar Leute abstellen, die auf Ihre Gefangenen aufpassen?“ „Ja, bitte.“ „Irgendwelche speziellen Anweisungen?“ „Ja, rühren Sie unsere Gefangenen nicht an. Wir wollen unsern vollen Spaß.“ „Verstehe, Obersturmführer.“ Eine Patrouille, die gerade vom Ortsrand zurückkommt – fünf Heeressoldaten – winkt der Fähnrich heran und weist sie ein. „Bewacht diese Gefangenen, bis unsere Freunde von der Geheimpolizei zurück sind.“ „Zu Befehl, Fähnrich.“ Die vermeintlichen Gefangenen werden von der Patrouille ins Bahnhofsgebäude geleitet, während Philipp Kipshoven, Christian Jacke, Lars Edgar Tibori und Krakowsky die Seitenstraße ansteuern, die der Fähnrich ihnen genannt hat. Tatsächlich: In einem alten, halb verfallenen Fachwerkhaus – das in diesem Ort wahrscheinlich noch zur „Fünf-Sterne-Sparte“ gehört – finden sie so etwas wie eine Soldatenkneipe. Philipp blickt seine drei Begleiter nochmal an, die zucken die Schultern. Er zuckt auch die Schultern und geht dann voraus hinein in die Spelunke. Ist es draußen kalt und naß – so ist es drinnen warm und feucht von Rauch, Körperausdünstungen und Kochdünsten. Es ist bereits abend und so haben sich an den groben Holztischen mit ebenso groben Holzbänken über ein Dutzend Gäste eingefunden – alles Soldaten von der nahen Front, die ein paar Tage Erholung in Frontnähe gekriegt haben. Ganz hinten ist noch ein Tisch frei und die vier falschen Gepos steuern diesen an. Unterwegs bestellt Philipp noch vier Bier. Dann setzen sie sich. „Meinst Du, es war gut, die andern kurzfristig dem Feind zu überlassen?“ zweifelt Jacke ein wenig. Philipp zündet sich in aller Seelenruhe eine Zigarette an. „Keine Sorge. Für die sind es bereits Gefangene. Sie werden sich an meine Anweisungen halten.“ „Und das ist der Witz bei der Sache.“ grinst Krakowsky. „Ihre Ex-Frau, Kap-....äh, ich meine, Obersturmführer, hätte wahrscheinlich ihre helle Freude daran gehabt.“ „Ja, wahrscheinlich.“ erwidert Philipp mit leicht verdüsterter Miene. „Und jetzt, Krakowsky, sollten Sie das Thema besser lassen.“ „In Ordnung. Entschuldigen Sie.“ „Schon gut.“ „Vier Bier!“ schallt es von der Bar, wo der Wirt vier große Biergläser auf die Theke gestellt hat. Philipp steht auf und holt sie. Jacke tritt Krakowsky sachte unter dem Tisch. „Mensch, Krakowsky, haben Sie vergessen, wie empfindlich er ist, wenn es um seine Ex-Frau geht?“ „Ja, für einen Moment...“ „Äh, dürfte ich erfahren, was hier abgeht?“ fragt Tibori leise. Auf diese Frage hin, schauen sich Krakowsky und Jacke erstmal an, aber Krakowsky nuschelt Tibori nur ein „Ein andern Mal“ zu, als Philipp wieder am Tisch ankommt und die Biergläser abstellt. Alle stoßen an und nehmen erstmal einen tiefen Schluck. Philipp ist der einzige, der seine Uniformmütze aufbehalten hat – um seine langen Haare, die er am Kopf zusammengelegt hat, notdürftig zu verstecken. Denn Gepos tragen keine langen Haare. Mit gesenkter Stimme führt er aus: „Also Leute, wir haben dann den vordersten Waggon für uns. Wir werden heute Nacht aus den Einzelteilen in unseren Rucksäcken das kleine Funkgeräte, das Bora uns gegeben hat, zusammenbauen.“ „Und dann?“ „Dann hören wir erstmal, ob unsere Leute inzwischen mehr wissen.“ „Verstehe, inzwischen könnten sie was rausgekriegt haben.“ stimmt Jacke zu. „Genau. Und wenn nicht, dann lassen wir uns was einfallen. Wir sollten vor allem nach irgendwelchen Zwischenfällen in Gefangenenlagern Ausschau halten. Ich bin sicher, wo immer der Chef steckt, wird er versuchen, Ärger zu machen. Und vielleicht ist Schattenlagant ja nur ein Deckname für ein uns bekanntes Gefängnis.“ „Vielleicht aber auch nicht.“ meint Krakowsky. Das betretene Schweigen auf diesen Einwurf hin sagt alles: Ja, genau, das ist die schlechtere Möglichkeit. Und die wahrscheinlichere. Nach einer halben Stunde verlassen die vier wieder die Spelunke und erreichen nach kurzem Fußmarsch wieder den Bahnhof. In der kleinen Bahnhofshalle (wobei diese Bezeichnung etwas hoch gegriffen ist), in der doch tatsächlich Mäuse herumhuschen, warten auf einer knarzigen Bank Tanja, Tina, Marta und Fraker, bewacht von der Soldatenpatrouille. Philipp grüßt die Soldaten freundlich. „Danke Leute für eure Vertretung! Wir übernehmen wieder!“ meint er lächelnd und legt seine Hand vielsagend auf seine Pistole im Holster. „Alles klar.“ erwidert der zuständige Unteroffizier und bedeutet seinen Männern mit einem Wink, ihm nach draußen zu folgen. Als die Soldaten draußen sind, meint Fraker griesgrämig: „Sagt bloß, ihr habts euch gut gehen lassen?“ „Ja, Hauptmann, haben wir.“ entgegnet Tibori sichtlich erheitert. „Na, jetzt seid mal still Leute, bevor noch einer von denen in ein Gespräch reinplatzt und was merkt.“ ruft Philipp die andern zur Ordnung. Schweigend warten sie die restlichen 20 Minuten ab. Als schließlich der Zug kreischend gehalten hat, läßt der Fähnrich, der sie so freundlich empfangen hat, den vordersten Waggon räumen und unter Murren wechseln die dortigen Soldaten auf die andern Waggons. Philipp und Jacke setzen ziemlich gekonnt dieses überhebliche Grinsen auf, das Gepos in solchen Momenten zu haben pflegen. Dann steigen sie in den Waggon ein. Es ist tatsächlich ein richtiger Personenwagen mit mehreren Abteilen. Philipp wählt zwei Abteile ungefähr in der Mitte aus. Krakowsky postiert sich vorsichtshalber an dem Durchgang zum nächsten Waggon, während es sich die vier vermeintlichen Gefangenen in einem der Abteile gemütlich machen. Philipp meint noch zu ihnen, während sich Fraker auf einen der Sitze fallen läßt: „Immerhin könnt ihr mehr schlafen. Wir müssen jetzt in diesen blöden Gepo-Uniform einen auf ‚Wache-schieben‘ machen.“ Fraker, der jetzt für seine Gefangenenrolle die Kleidung eines Partisanen trägt, grinst ihn nur hämisch an. „Tja, Kapitän, dafür hattest Du ein Bier – ich nicht! Und überhaupt, eigentlich wäre mir doch jetzt, bei dieser netten Gesellschaft,“ – er wirft einen vielsagenden Blick zu den drei Damen der Runde – „nach einem-...“ Mit warnendem Blick unterbricht Marta ihn: „Hauptmann, bringen Sie diesen Satz nicht zu Ende, wenn Sie das hier überleben wollen!“ Sie hat in den letzten 12 Stunden genügend Bekanntschaft mit Frakers manchmal recht zweideutigen, allzu oft aber auch allzu eindeutigen Bemerkungen gemacht. Auf einmal verstand sie, warum er den Ruf eines Schürzenjägers hat (wobei diese Titulierung über seine Erfolgsquote nichts aussagt). Fraker sagt nichts mehr, sondern verschränkt nur die Arme und tot so, als ob er schmollt. Tina zieht derweil die Vorhänge am Fenster zu, während der Zug bereits anfährt. Philipp schließt die Abteiltür hinter sich, die zum Glück kein Fenster hat, und geht rüber ins gegenüberliegende Abteil. „Tibori, Sie übernehmen mit Krakowsky die erste Wache.“ „Geht klar, Kapitän.“ antwortet Tibori, der gerade seinen Rucksack unter dem Sitz verstaut und dann an Philipp vorbei nach draußen auf den Gang tritt. Dienstag, der 14. Oktober In einem der Abteile hat Krakowsky zusammen mit Philipp die Funkanlage kurz nach Mitternacht zusammengebaut. Der Zug rauscht noch immer durch die Nacht, stetig Richtung Westen. Orscha hat man sicherlich schon hinter sich gelassen und noch vor dem Morgengrauen würde man durch Minsk rollen. Der nächste planmäßige Stop ist aber erst in Lodz, zumindest, wenn Tibori den Lokführer richtig verstanden hat. Jetzt sitzt Krakowsky vor der Funkanlage, einen Kopfhörer am Ohr, Stift in der Hand und notiert, was er vom „Schimäre“-Hauptquartier nach kurzer Anfrage für Antworten kriegt. Neben der Funkanlage liegt eine kleine Bibel, denn die Funksprüche sind nach einem Buchstabencode, der mit Hilfe dieses Buches festgelegt wurde, verschlüsselt. Es handelt sich dabei um einen Einmal-Code, der also nur dieses Mal verwendet wird. Das ist sogar noch narrensicherer als die Maschinencodes, die die Kaiserlichen verwenden – zumindest solange der Feind nicht weiß, nach welchem Buch die Schlüssel geeicht werden. Philipp wartet schweigend hinter Krakowsky. Nach fast einer Stunde schaltet er die Anlage wieder aus, nimmt den Hörer ab und die Bibel zur Hand. Es folgt eine weitere halbe Stunde herumblättern und entschlüsseln. Dann gibt Krakowsky ein „Ah haa!“ von sich. Mit einem Seufzer blickt Philipp, der fast im Stehen eingepennt war, auf. „Was gibt’s, Oberfeldwebel?“ Krakowsky richtet sich auf und zeigt Philipp seine Notizen. „Kapitän, drei unserer Leuten wurden nach Zürich geschickt und erfolgreich durch die Gepo-Kontrollen geschleust.“ Krakowsky deutet auf die entsprechende Meldung. „Ja, ich sehe es.“ „Aber wer ist Petra?“ Krakowsky deutet mit seinem Bleistift auf die Meldung: „Hinweis von Petra auf Schattenlagant im Alpenraum.“ Philipp grinst breit. Allmählich beginnt sich sein Verdacht zu erhärten... Mit der Weinflasche in der einen Hand sitzt Karo auf Tanjas Bett im Quartier der „Schimäre“Piloten und starrten zum Fenster raus. Das Licht ist ausgeschaltet und so ist es im Zimmer finster. Ihre Gedanken treiben wirr durcheinander. Allmählich begreift sie, welche Verzweiflung Stefan im Falle von Christiane gepackt haben muß. Jemand räuspert sich und Karo schreckt hoch. Jetzt erst sieht sie, daß jemand das Zimmer betreten hat. „Generalmajor Bohnsack?“ „Ja, ich bins. Frau General, geht’s Ihnen gut?“ „Kommt drauf an.“ Sie hält die Flasche hoch. „Wollen Sie was?“ „Nein.“ „Nehmen Sie ruhig, Generalmajor, ich hab doch keinen Durst, um was davon zu trinken. Seit drei Stunden sitze ich hier, um rauszukriegen, was ich machen soll und habe keinen Durst.“ Bohnsack kommt näher, nimmt die Flasche, stellt sie aber nur auf dem Boden ab. „Tja, Generalmajor, wahrscheinlich ungewohnt für Sie, mich so zu sehen...“ „Um ehrlich zu sein, Frau General: Ja. So ziellos sind Sie mir selten begegnet. Aber ich glaube, daß läßt sich ändern.“ Mit einem selbst in der Dunkelheit zweifelnden Blick mustert Karo den neben dem Bett stehenden Mann. Bohnsack sagt: „Conny hat gerade angerufen. Wir haben einen Funkspruch von Kipshoven reingekriegt. Tanja lebt und ist bei ihm.“ Karo springt auf. „Ehrlich?“ „Ja. Wohlbehalten und gesund. Sie sind auf dem Weg ins Reich.“ „Mensch, Bohnsack, Sie lebt!“ Innerhalb weniger Augenblicke kehrt Karos Energie zurück. Keine Ungewißheit mehr! Kurzentschlossen nimmt Karo wieder die Flasche, zieht den Korken raus und nimmt einen kräftigen Schluck. Die Flasche Bohnsack hinhaltend, meint sie: „Na kommen Sie, Generalmajor!“ Der zuckt die Achseln. „Na gut, einen Schluck.“ Er nimmt auch nur einen kleinen und steckt den Korken wieder drauf. „Frau General, Sie können ruhig hier schlafen.“ „Ok, danke.“ Bohnsack nickt und geht wortlos wieder hinaus. Ein Geräuschkulisse aus Sirenengeheul und Detonationen weckt Karo aus dem Tiefschlaf. Es dauert ein paar Momente, bis sie aufgestanden ist und realisiert, was vor sich geht. Da steht auch schon Bohnsack in der Tür, in Kampffliegermontur. „Frau General, Sie hatten wir ganz vergessen! Die Kaiserlichen greifen an, Sie müssen sofort ins HQ!“ Schon ist er wieder auf dem Weg nach draußen, um mit seiner Fw 190-Jagdmaschine zu starten. Auch Karo ist jetzt hellwach, schnappt sich ihre Pistole, knöpft schnell das Uniformhemd zu und rennt nach draußen. Und dort ist die Hölle los... Die Einfahrt auf das Flugplatzgelände ist aufgerissen, drei Bombentrichter zeugen von der Gewalt, die auch das Wachthäuschen vernichtet hat. Der Hangar brennt lichterloh, dicke Rauchwolken wehen über das Gelände und lassen die Morgendämmerung finstrer erscheinen, als sie eigentlich ist. Am Rande der Startbahn liegen die brennenden Trümmer einer Focke Wulf, daneben die verkohlenden Reste eines menschlichen Körpers. Gerade jagt Bohnsack mit seiner Maschine über die Startbahn und hebt ab. Aus der Ferne, aus Richtung Safonovo, hört man Flakfeuer. Am Rande des Flugplatzes steht eine Batterie Acht-Achter und lädt gerade nach, nachdem sie bei der Angriffswelle wohl ihre ersten Ladungen verschossen hat. Löschtrupps rennen zum Hangarrüber, Sanitäter zu Verletzten. Rufe und Schreie von überall her. Als von Osten her eine Bf 110, die eine Kurve gezogen hat, vorüberzieht, kommt es zum Duell, dem Karo Momente lang gebannt zusieht: Die Bf 110 hämmert mit ihren Bordkanonen gegen die Flakstellung und zwei Acht-Achter feuern mit ohrenbetäubendem Knallen zurück. Die Splitter der Flakgeschosse zersieben einen der Motoren der Bf 110, die abdreht, über einige Baumwipfel hinwegrauscht. Ein weiterer Schatten rast über den Flugplatz und hinter der beschädigten kaiserlichen Maschine her – eine Centauro-Jagdmaschine von „Schimäre“, die von einem kroatischen Piloten geflogen wird, wie am Emblem an den Seiten zu sehen ist. „Sanitäter!“-Rufe reißen Karo aus ihrer Starre. Zwei Sanitäter, die gerade einen Leichtverletzten zur Rot-Kreuz-Barracke 50 m weiter begleiten und dabei an Karo vorbeikommen, werden von Karo angewiesen: „Sobald Sie beide den Mann alleinlassen können, kommen Sie zur Flakstellung rüber!“ Und dann rennt sie selber hinüber zu den Flaks. Tatsächlich: Drei Mann von den Flakbedienungen haben Geschosse der Bf 110 abgekriegt. Ein Unteroffizier der Flakbedienung kommt Karo entgegen: „Wo bleiben die Sanis?!“ brüllt er. „Kommen gleich!“ brüllt Karo zurück. Ein paar Männer stützen einen der leichter Verletzten und lehnen ihn gegen die Lafette. Karo kniet sich neben einem schwerer Verletzten hin. Ein Geschoß hat ihm den Unterschenkel zerrissen, der nur noch eine blutige, weiche Masse ist. Einer seiner Kameraden kommt angerannt, mit einer Feldflasche. „Schnell, geben Sie ihm das Wasser!“ brüllt Karo und drückt dann die Hand des Verletzten. Der Mann ist kreidebleich, aber seine Augen heften sich jetzt an Karos Gesicht und das seines Kameraden, der Karo gegenüber kniet und nun dem Verletzten das Wasser einflößt. „Ich werde jetzt sein Bein abbinden.“ Und schon macht Karo dem Mann den Gürtel auf, zieht ihn vom Hosenbund und bindet den Gürtel dann um das Bein, am Oberschenkel. Kräftig zieht sie die Schlaufe zu, daß der Mann vor Schmerz aufstöhnt. „Schon vorbei,“ flüstert Karo, „schon vorbei.“ „Das Wasser ist bald alle.“ „Dann holen Sie neues, Mann!!“ „Jawohl.“ Der andere Soldat springt auf, gibt Karo die Feldflasche mit dem Restwasser. Vorsichtig stützt sie den Kopf des Verletzten ab. „Trinken Sie, trinken Sie!“ Aber der Mann hustet immer wieder. Endlich kommen die Sanitäter an, mit einem Verbandskasten. „Haben Sie noch mehr Wasser?“ fragt einer der Sanis. „Ist unterwegs.“ antwortet Karo knapp. „Gut, er braucht die Flüssigkeit...“ Sein Kollege macht gerade eine Morphiumspritze gegen die Schmerzen fertig und haut sie dem Verletzten dann in die Ader. Der Soldat von vorhin kommt mit einer Feldflasche an und gibt seinem Kameraden sofort neues Wasser, während einer der Sanis Desinfektionspulver auf den Unterschenkel streut. „Ok, hier wären wir soweit.“ Mit einem Wink bedeutet der eine Sani seinem Kollegen, schnell eine Trage zu holen. Dann meint er. „Gut gemacht, Frau General. Wir könnten ihre Hilfe noch in der Barracke gebrauchen.“ „Ist gut. Aber in einer halben Stunde spätestens muß ich ins HQ aufbrechen.“ „Wird schon hinhauen.“ Karo steht wieder auf und meint zu dem Soldaten: „Passen Sie gut auf Ihren Kameraden auf.“ Dann eilt sie rüber zur Rot-Kreuz-Barracke. Unterwegs bemerkt sie, daß sie Blut von den Verletzten an Uniform und Händen hat. Und sie bemerkt, wie sich die Stimmung in wenigen Minuten geändert hat: Am Anfang noch Hektik, Panik fast. Jetzt: Ruhe, jeder besinnt sich auf die Aufgaben, richtet sich auf und steht seinen Mann mit dem Gefühl, daß sich alles doch noch zum besseren wendet. Sicher, alle haben noch Angst. Vor dem nächsten Angriff, vor dem Tod. Aber die Entschlossenheit ist zurück. Eingetreten ist dieser Wandel, als alle gemerkt haben, daß „die Generälin“ mittendrin dabei ist und Hand anlegt. Die Generälin ist da – dann muß ja alles gut werden. Das ist eines der Geheimnisse von „Schimäre“: Die Generäle drücken sich nicht vor dem Dienst in der vordersten Linie und das schweißt die Einheiten zusammen... In Jakovlevo im HQ von „Schimäre“ ist die Hölle los. Hektisches Hin-und Hergerenne, Kuriere mit Meldungen treffen laufend ein, die Funkzentrale hat alle Hände voll zu tun. Und mittendrin immer wieder das Belfern der Flaks, wenn wieder kaiserliche Flieger am Himmel auftauchen. Absoluten Schutz bieten auch die Flaks nicht, erst vor einer Minute ist nur einen Häuserblock vom HQ entfernt eine 200-Kilo-Bombe eingeschlagen, die einstürzenden Häuser haben die Straße blockiert. General Valkendorn hat das Kommando übernehmen und kurzerhand im Speisesaal den Kartenraum eingerichtet, eine Ordonnanz bringt ständig die neuesten Meldungen. Immer wieder ermahnt Valkendorn die Stabsoffiziere: „Wenn die Chefin wieder hier ist, brauchen wir ein erstes klares Lagebild! Ich will wissen, was da vor geht, ob sich der Plan des Feindes abzeichnet!“ Und kaum beugt er sich wieder über die Karte, um die frischen Eintragungen zu studieren, da ruft er schon wieder aus: „Bringt mir den Wetterbericht, wann es wieder regnet! Und welche Reserven haben wir?“ Kaum hat er die Frage wieder gestellt, brüllt zwei Tische weiter ein Stabsunteroffizier, wobei er einen Telephonhörer hochhält: „General, für Sie!“ Valkendorn jagt um den Tisch herum, reißt dem Mann den Hörer aus der Hand. „Ja?“ „Hier Schoeps! Wo brennt’s? Wir können Feuerwehr spielen!“ „Frau Generalmajor, bin ich froh, von Ihnen zu hören! Der Feind rennt seit zwanzig Minuten mit Artillerie-und Raketenwerferunterstützung gegen unsere zentrale Front an. Unser 3. Regiment hält, aber die Aufklärungsabteilung wurde Richtung Sokino abgedrängt und isoliert.“ „Ok, wir werden sie raushauen.“ Dann ist die Leitung wieder weg – Schoeps hat aufgelegt. Valkendorn schaut nur irritiert den Hörer an. Aber er weiß: Wenn Schoeps sagt, wir hauen sie raus, dann hält diese Frau Wort. Unterdessen liefern sich Bohnsacks Jagdflieger – nach der Rekrutierung neuer Piloten im September und der Anlieferung neuer Focke Wulf 190, die in Russland in Lizenz gebaut wurden, hat sich deren Zahl wieder auf 12 erhöht – mit den kaiserlichen Kampffliegern eine erbitterte Luftschlacht über Jarcevo. Über der Stadt selber steht bereits eine hohe Rauchsäule, denn Ju 88 und Ju 87 haben sich über sie hergemacht wie die Geier über einen Kadaver, bevor Bohnsacks Leute eingreifen konnten. Mit atemberaubenden Kapriolen jagen die Focke Wulfs und die letzten drei Centauros von „Schimäre“, geflogen von Piloten deutscher, polnischer, rumänischer und kroatischer Abstammung, den Messerschmitts hinterher. Wie verbissen jagt Bohnsack selber einer Messerschmitt hinterher, aber der andere schlägt Haken, die Salven Bohnsacks gehen dauernd daneben. Auf einmal hört Bohnsack über Funk Kelter, genannt „Helters“: „Chef, einer hängt an Ihnen dran, der andere hat Sie abgelenkt!“ Instinktiv läßt sich Bohnsack über den rechten Flügel abkippen, gerade rechtzeitig, um einer Salve zu entgehen. Im nächsten Moment explodiert irgendwas über Bohnsack und er sieht einen Trümmerregen weiter vorne herunterregnen, während Helters über ihm vorbeijagt. „Hab ihn erwischt, Chef!“ „Danke, Helters!“ Schon meldet Suhrkamp, genannt „Falk“: „Weiterer Feindpulk, fünf Maschinen! Brauche Unterstützung." Bohnsack fragt bei den anderen an: „Sonst keine Probleme?“ Keine Meldung, also keine Probleme. Bohnsack setzt sich neben Kelter und dann brechen sie zusammen durch die Rauchsäule über Jarcevo – gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie sich Suhrkamps Maschine rauchend nach unten verabschiedet. Allerdings kann Kelter auch einen Fallschirm ausmachen. „Ich glaub, er hats geschafft!“ „Ja, aber davon vorne!“ Ihnen kommt tatsächlich ein Pulk Messerschmitts Bf 109 entgegen, aus allen Rohren feuernd. „Durchbrechen!“ Bohnsack und Kelter feuern aus allen Rohren und halten genau auf die Messerschmitts zu. Schließlich scherren die ersten aus, einer Messerschmitt wird der Motor zerhackt, woraufhin sie einfach nach unten fällt. Der Pilot kann aussteigen, aber als sich sein Fallschirm entfaltet, wird er von einem umherschwirrenden Splitter in Brand gesetzt. Wie der Mann im freien Fall dem sicheren Tod entgegengerast, verfolgt Bohnsack nicht mehr. In Seitenlage rasen die feindlichen Flieger aneinander vorbei. Bohnsack und Kelter bleiben in Seitenlage, schwenken aber nach innen ein, um die Seiten zu wechseln und sich ans Heck je einer Messerschmitt zu hängen. Ein halsbrecherisches Manöver, aber von Bohnsacks Männern oft trainiert und schon beim Polenfeldzug vor einem Monat erfolgreich durchgeführt. Auch jetzt wieder. Die Fw 190 von Kelter streift fast die von Bohnsack, aber dann hat Kelter die Messerschmitt mit einem wahrscheinlich sehr verwirrten Piloten direkt im Fadenkreuz. Und feuert. Die Geschosse der Bordkanonen zerfetzen das Leitwerk und die Flügel der Messerschmitt. Deren Pilot steigt da lieber aus und segelt mit dem Fallschirm davon, während seine Maschine brennend hinab stürzt auf das brennende Jarcevo. Auch Bohnsack hat seinen Gegner erwischt. Zwei weitere Messerschmitts in der Nähe, sind, soweit Kelter das kurz sehen kann, mit zwei von kroatischen Piloten geflogenen Centauros beschäftigt. „Chef, ich helfe den Kroaten!“ „Ist gut, Helters!“ Helters reißt das Steuer herum und stürzt sich wieder dem Kampf entgegen. Ein Kroate verfolgt gerade eine Messerschmitt, „Helters“ Kelter hindert nun einen anderen kaiserlichen daran, sich in den Kampf einzuschalten. Kelters Gegner dreht ab, aber der Gegner des Kroaten reißt die Maschine hoch, Salto und greift die Centauro von senkrecht oben an. Kelter sieht, wie die Centauro in grellen Flammen explodiert. So spielerisch dieser Kampf aussieht, er ist tödlicher Ernst. Insgeheim wünscht sich Kelter, er könnte jetzt woanders sein. Zum Glück ist Angel nicht hier, schießt es ihm durch den Kopf. Die MG-Stellung von Unteroffizier Anna Karlinski liegt am Ende einer kurzen Schlucht oberhalb eines Bachlaufes knapp nördlich von Glinka. Hier haben sich die „Schimäre“-Kämpfer der 3. Kompanie des II. Bataillons/4. Regiment, alles Polen, zwischen Bäumen und Büschen verschanzt gehabt; nur 500 m weiter westlich verläuft ein Bahndamm von Südosten nach Nordwesten, auf dem sich die kaiserlichen Truppen eingerichtet hatten. Doch seit fast zwei Stunden meinen die Kaiserlichen offenbar, dies ändern zu müssen. Begonnen hatte es mit massivem Beschuß, der die Bäume weitestgehend zerkleinerte, zum Glück aber ein paar Meter zu weit lag und daher die Stellung nicht direkt traf. Der Lärm war ohrenbetäubend, Dreck und Holzstücke regneten auf sie nieder, auch Splitter schwirrten umher, aber man bekam nichts direkt ab. Den Preis für dieses Versäumnis dürfen seit ungefähr einer Stunde die Kaiserlichen bezahlen. Ladeschütze Friegow fingert gerade hektisch den so-und-so-vielten Patronengurt rein. Dann meldet er: „Geladen und gesichert!“ Gerade rechtzeitig, denn eine ganze Kompanie der Kaiserlichen kommt wieder den Bachlauf entlang herangestürmt. Anna jagt ihre Munition heraus, dem Gegner entgegen. Aus dem Bach spritzen hohe Wasserfontänchen hoch, Splitter fliegen von getroffenen Bäumen weg und getroffene kaiserliche Soldaten stürzen getroffen mit einem Schrei in den Dreck. Auf ihren beigefarbenen Uniformen bilden sich dunkelrote Flecken. Die andern der kaiserlichen Kompanie werfen sich hin, zwischen Tote und Verletzte. Und feuern dann aus der Deckung mit ihren Gewehren. Sani-Rufe ertönen. Einer der Kaiserlichen wirft eine Handgranate, die knapp neben Annas Stellung krepiert, Erde und Laub regnen auf Anna und Friegow nieder, die sich ducken. „Obergefreiter, neuen Gurt!“ brüllt Karlinski und reißt den Gurt aus dem MG. „Hab keinen mehr! Soltau wollte welche holen!“ Von links feuern weitere „Schimäre“-Kämpfer aus der Deckung mit ihren Sturmgewehren. Einer der Kaiserlichen jagt eine Leuchtkugel hoch. „Scheiße...“ krächzt Friegow, als er sieht, daß die Leuchtkugel rot ist. Das Signal für einen neuen Artillerieschlag. Das Spielchen hatten sie immerhin schonmal heute. Aber dieses Mal könnte der Artillerieschlag besser liegen und die Stellung treffen. Und da zischen auch schon die Granaten heran! Anna hat aber schon das MG von der Lafette genommen. „Abmarsch!“ brüllt sie. Sie und Friegow rennen zwischen zerschossenen Bäumen den Hang hinauf, da schlagen die Granaten ein. Kaliber 7,5 cm. Die Welt um sie herum scheint zu explodieren. Erde und Schlamm werden in Fontänen hochgeworfen, Bäume und Büsche herumgewirbelt und zerkleinert, irgendwo wird jemand mitgerissen und fällt mit grellem Geschrei hernieder. Karlinski wird von einer Druckwelle zu Boden geworfen, rappelt sich wieder auf, registriert nicht, daß sie das MG verloren hat. Egal, sie hat eh noch ihr eigenes Sturmgewehr. Eingehüllt in Rauch und Qualm stolpert sie weiter über das Chaos. An einer zerfetzten Leiche vorbei. Rechts und links Sani-Rufe. Dann die nächste Geschoßsalve. Wieder fällt Anna, aber das rettet ihr womöglich das Leben, da Augenblicke später genau 15 m weiter (wo sie sich befunden hätte, wäre sie weitergelaufen) eine Granate einschlägt. „Friegow!“ ruft Anna, als sie sich wieder aufrappelt. Friegow hatte sich in einen Granattrichter in Deckung geworfen; jetzt springt er wieder auf, als eine Handgranate angesegelt kommt und krepiert. Die Explosion reißt Friegow ein Bein weg, er fällt mit einem gellenden Schrei. Gewarnt wirbelt Karlinski herum, eine Gewehrkugel jagt neben ihr in den Boden, sie schießt zurück und trifft. Der Kaiserliche in einigen Metern Entfernung kippt nach hinten weg. Und Anna rennt weiter, springt in den frischen Granattrichter 15 m vor ihr, rutscht herunter, am Kraterrand schlagen mehrere Kugeln ein. Sofort wirft sich Anna wieder an den Kraterrand, legt das Sturmgewehr an und antwortet dem Gegner mit kurzen Feuerstößen. So zwingt sie ein paar Kaiserliche in Deckung. Jemand springt hinter ihr in den Krater, brüllt aber die Parole. Es ist ein Soldat aus ihrer Kompanie. „Soltau ist tot!“ meldet der Mann, während er neben Anna über den Trichterrand feuert. „Ich hab ihn eben gesehen, wie er von einer Granate zerfetzt wurde.“ „Scheiße!“ flucht Anna. Wieder feuert sie auf die Kaiserliche, da schnellt ihr etwas heißes, stechendes in den linken Oberarm. Sie fällt zurück in den Trichter. Mit einem Aufschrei preßt sie ihre rechte Hand auf die Wunde. Eine Gewehrkugel muß sie getroffen haben, jedenfalls fließt etwas warmes über ihre Hand und breitet sich ein pochender Schmerz im Arm aus. Sie beißt die Zähne zusammen, während um sie herum immer noch geschossen wird und irgendwo links Granaten einschlagen... „Ein guter Feldherr braucht auch Fortune.“ Altes Militärsprichwort, berühmt geworden durch Friedrich den Großen Nachdem man sie lange im Hotel hat warten lassen, ist Leikert an diesem Mittag gekommen und hat Petra abgeholt. Die Gepos haben sie über 20 Stunden lang unter Bewachung gehalten, sie dürfte das Bahnhofshotel von Zürich nicht verlassen. Nichtmal, um sich die schöneren Stadtteile anzusehen. Immerhin ist das Essen im Hotel gut gewesen und eine der Wachen hat ihr ein kleines Radio aufs Zimmer gebracht. Die Top-Meldungen an diesem Vormittag: In Estland haben die Kaiserlichen eine Offensive gestartet, während die Schweden Dagö und Ösel angegriffen haben. In der Nacht hat es wieder schwere Luftangriffe auf südenglische Städte durch die Luftwaffe der französischen Putschistenregierung gegeben. Vor der Westküste Irlands hat es eine Geleitzugschlacht zwischen kaiserlichen U-Booten und der Royal Navy gegeben, die britische und spanische Handelsschiffe nach Belfast eskortierte: Vier versenkte und fünf beschädigte Frachter und ein beschädigter britischer Zerstörer. Aber für Petra die interessanteste Meldung: Eine kleinere kaiserliche Offensive läuft gegen die Stellungen von „Schimäre“ bei Jarcevo. Näheres konnte der Nachrichtensprecher aber noch nicht vermelden. Egal, sie würde Oschmann danach fragen. Leikert bringt Petra mit einem Geheimpolizei-Dienstwagen zu einem dreistöckigen Backsteinhaus im Stadtteil Hottingen. Als er anhält und den Motor ausschaltet, erklärt er: „Das ist die Züricher Vertretung der Geheimpolizei.“ Sie steigen beide aus und Leikert weist sich am Eingang bei zwei Wachen aus. Dann betreten sie einen Hausflur, von dem seitlich zwei Türen abgehen. Auf der rechten Seite führt eine Holztreppe hoch, an der links der Flur zur Hinterhoftür weiterführt. Leikert geht die Treppe hinauf und Petra folgt ihm. Im zweiten Stock führt Leikert sie zu einer schon etwas verzogenen Bürotür. Diese öffnet sich knarrzend und gibt den Blick auf ein kleines Büro mit zwei Stühlen, einem ausladenden Bürotisch und einem Aktenschrank rein. Die Jalousien am Fenster sind hochgezogen, so daß man den Regen draußen beobachten kann, der am Vormittag eingesetzt hat. Es ist jetzt etwa 14 Uhr 30. Am Schreibtisch sitzt Standartenführer Oschmann, seine Uniformjacke über die Stuhllehne gehangen, und kaut gerade auf einem Käsebrötchen rum. Zwischen zwei Bissen meint er: „Bitte, Frau Müller, setzen Sie sich.“ Leikert verläßt den Raum wieder und schließt hinter sich die Tür. Offenbar will Oschmann mit Petra allein sprechen. Als Jörg Oschmann aufgegessen hat, wischt er sich mit einem Taschentuch den Mund ab. Erst dann sagt er wieder was. „Es freut mich, Sie endlich mal zu treffen, Frau Müller.“ „Und ich bin froh, endlich mal meinen wirklichen Auftraggeber kennenzulernen.“ „Äh, das stimmt nicht so ganz...Sehen Sie, inzwischen ist es so, daß es Leute gibt, die Reiss eher früher tot sehen wollen. Und andere wollen das etwas später.“ „Wieso?“ „Weil ein Schauprozeß stattfinden soll, durch den wir ‚Schimäre‘ diskreditieren können. Damit dieses lächerliche Geschwätz von Freiheit nie wieder ernstgenommen wird.“ „Und welche Rolle übernehmen Sie?“ „Ich tue, was möglich ist, um beiden Ansichten gerecht zu werden. In Kürze wird der Schauprozeß stattfinden und dann wird General Reiss ohne weitere Umschweife unter die Erde befördert.“ „Das sollte ich doch eigentlich erledigen...“ wirft Petra ein. „Sie waren ja leider nicht schnell genug.“ „Ich bitte Sie, Standartenführer! Sie haben mir ja gar keine Zeit gelassen!“ „Und? So hatten Sie nicht viel Arbeit, Frau Müller. Also: Was wollen Sie überhaupt hier?“ „Ich hasse es, einen Job unvollendet zu lassen. Außerdem eigne ich mir gern ein Stück persönlichen Besitzes meiner Opfer als Trophäe an.“ Etwas verdutzt schaut Oschmann die schöne Frau an, dann grinst. „Wissen Sie was? Sowas gefällt mir! Ok, ich bringe Sie zu ihm und sie dürfen am Exekutionskommando teilnehmen. Die persönlichen Sachen, die wir dem General bei der Gefangennahme abgenommen haben, werde ich auch noch herschaffen lassen.“ Petra ist bei soviel ‚Großzügigkeit‘ überrascht. „Das war ja leicht.“ wundert sie sich. „Tja, Frau Müller, wir Geheimpolizisten sind nicht unbedingt die Monster, als die man uns hinstellt. Zumindest nicht gegenüber unseren Verbündeten.“ Oschmann steht auf und zieht eine Schublade des Aktenschranks auf. Daraus holt er eine Flasche Rotwein heraus. „Auch, einen Schluck? Vielleicht auf unsere neue Abmachung?“ „Ja, gerne.“ Oschmann hat inzwischen den Korken herausgezogen und selber einen Schluck genommen, dann reicht er die Flasche Petra. Sie nimmt nur einen kleinen Schluck – der Wein ist nicht der beste -, während Oschmann meint: „In drei Stunden fahren wir ab. Dann werden Sie zu den wenigen Zivilisten gehören, die Schattenlagant sehen und es vielleicht überleben werden....“ Kaiser Joseph II., erst am frühen Nachmittag mit dem Flugzeug von seiner Reise nach Stockholm zurückgekehrt, will sich eigentlich ein paar Ruhetage in Wien gönnen, bevor er noch Paris, Sarajevo, Belgrad, Adrianopel, Florenz und Valletta besucht – die Hauptstädte der kleineren europäischen Verbündeten des Kaisers: Das in Paris durch einen Putsch Ende August an die Macht gekommene Militärregime, Bey Faruk von Bosnien, die Provisorische Serbische Regierung, die aus Janitscharen-Offizieren bestehende Rebellenregierung von Adrianopel, das Großherzogtum Toskana (das man nach dem gewonnen Norditalienfeldzug im September mit Piombino und Lucca belohnt hat) und der unabhängige Ordensstaat der Johanniter auf Malta. Die Reisen dorthin werden noch kräftezehrend genug sein. Das Königreich Skandinavien (einstmals Schweden) und der Kirchenstaat verfolgen noch mehr oder weniger die gleiche Linie wie der Kaiser. Aber die vielen kleinen Verbündeten müssen mühsam bei der Stange gehalten werden. Die französischen Putschisten hätten gern eine stärkere Beteiligung der kaiserlichen Streitkräfte beim Luftkrieg gegen Großbritannien und beim Landkrieg gegen Spanien (der momentan in Nordspanien stagniert). Bey Faruk will sein eigenes Großreich auf dem Balkan aufrichten, Dubrovnik und Montenegro hat er schon. Auf Dalmatien mußte er zugunsten der kaiserlichen Truppen (die gegen die venezianischen Truppen dort immerhin die Hauptlast trugen) verzichten, aber das Kosovo interessiert ihn. Das beißt sich mit den Serben, die endlich ihren eigenen Staat in möglichst großzügigen Grenzen errichten wollen. Die Janitscharen wollen lieber früher als später auf den Trümmern des gespaltenen und geschlagenen Osmanenreiches ihren eigenen totalitären Staat errichten – und bei der Grenzziehung sind Konflikte mit den Serben vorprogrammiert. Dazu kommt, daß die Janitscharen Defizite bei ihren Kampffähigkeiten nicht wahrhaben wollen. Und während der Großherzog der Toskana jetzt lieber Frieden schließen will, um die Eroberungen zu sichern, ist Malta, das gerade mal im September während des Italienfeldzugs in den Krieg eingetreten ist, geradezu wild darauf nun erstmal Sizilien zu erobern und anschließend die Reste osmanischer Macht in Afrika plattzumachen. Vor allem beim Gedanken an letzteres schüttelt sich Joseph. Was soll er mit seinen Truppen in Afrika? Irgendwie wird er die Interessen der Verbündeten austarieren müssen – und er wird ihnen irgendwie beibringen müssen, daß sie einen eventuellen Afrikafeldzug gefälligst allein führen sollen. Um darauf vorbereitet zu sein, wollte er eigentlich Energie tanken. Aber dann ist der Anruf gekommen, direkt nach seiner Ankunft. Schneider, der ganz spezielle Gesandte der Prieuré, will ihn sprechen. Der Kaiser hat sich pflichtbewußt zum verabredeten Treffpunkt im Volksgarten am Ballhausplatz begeben – begleitet von einigen Sicherheitskräften in Zivil, die unauffällig die wenigen Passanten, die sich an diesem regnerischen Nachmittag dort aufgehalten haben, hinwegkomplimentiert haben. Er hat sich einen langen schwarzen Regenmantel übergeworfen und hält mit beiden Händen einen Regenschirm fest. Die Tropfen fallen wie in Zeitlumpe vom Rand des Schirms auf den knirschenden Gehweg zwischen zwei großen Wiesen. Mit einem Blick auf die Uhr stellt Joseph fest, daß es schon 17 Uhr ist. Endlich nähert sich eine kleine, ältliche Gestalt mit unauffälliger, britisch wirkender Kleidung und einem über die Schulter geworfenem Schal. Das Gesicht des Mannes ist gekennzeichnet durch ein scheinbares Dauerlächeln – wenn auch nur ganz leicht. Als der Mann den Kaiser erreicht, beginnt der langsam neben dem alten kleinen Mann herzugehen. „Ok, Schneider, was gibt’s?“ „Die Prieuré macht sich ernsthaft Sorgen.“ „Wieso? Wir haben Reiss gefangen.“ „Ja, und Ihre Truppen, Hoheit, greifen die Stellungen von ‚Schimäre‘ an.“ „Wie ich es Ihnen versprochen habe. Nach den letzten Meldungen von der Front, die ich vor einer halben Stunde bekommen habe, läuft es gut. Was soll bitte schön noch schiefgehen?“ „Eure Majestät, wir von der Prieuré haben...na sagen wir: ein sehr viel feineres Gespür für neue Entwicklungen. Was Sie vielleicht noch für unbedeutend halten, erkennen wir bereits als bedeutend.“ „Was soll das denn heißen?“ Schneider bleibt abrupt stehen und mustert den sichtlich verärgerten Kaiser, dem es allmählich auf den Senkel geht, sich von diesem Zivilisten immer wieder belehren zu lassen. „Majestät, wie sicher sind Sie sich, daß die ‚Schimäre‘-Kämpfer den Aufenthaltsort von Reiss nicht kennen?“ Der Kaiser stutzt. „Was soll das? Ich bin mir so gut wie todsicher. Wir haben Schattenlagant bei Baubeginn bereits von den Landkarten getilgt. Sie können es nicht wissen.“ „Haben Sie von dem Vorfall in Zürich gehört?“ „Was für ein Vorfall in Zürich?“ „Der Versuch Ihrer Gepo, ein paar ‚Schimäre‘-Agenten am Bahnhof bei der Einreise abzufangen, ist gescheitert.“ „Und? Sowas haben wir schon öfter gehabt.“ „Und? Majestät! Seit wann reisen ‚Schimäre‘-Agenten einfach so von Bonn nach Zürich?“ „Keine Ahnung. Vielleicht verstärken die Typen ihre Unterstützung für die blöden Schweizer!“ „Ihr Wort in Gottes Ohr, Majestät! Tatsache ist, daß einige meiner Kollegen die Befürchtung hegen, daß ‚Schimäre‘ zurückschlagen könnte...“ „Quatsch, Schneider! In einer Woche werden wir die Schlacht von Jarcevo gewonnen haben und dann wird es von ‚Schimäre‘ nur noch nicht mehr lebensfähige Überreste geben.“ Stirnrunzelnd seufzt Schneider. „Wenn Sie meinen, Majestät. Wie gesagt: Ihr Wort in Gottes Ohr...“ Ohne ein weiteres Wort dreht sich Schneider um, umgeht eine Pfütze und zieht dann von dannen Richtung Burgring. „Hey, Schneider, das war alles?“ ruft ihm der Kaiser hinter her. Keine Antwort. Mit einem verächtlichen Schnauben macht Joseph eine wegwerfende Handbewegung, dreht sich um und geht den Weg zurück, den er gekommen ist. „Arschloch...“ murmelt er vor sich hin. In der Herberge von Jakovlevo, wo „Schimäre“ sein Hauptquartier hat, arbeitet man schon den ganzen Tag fieberhaft daran, Gegenmaßnahmen gegen den kaiserlichen Angriff einzuleiten. Am Nachmittag hatte endlich wieder Regenwetter eingesetzt, was die kaiserliche Luftwaffe einschränkte. Gleichzeitig griffen zwei polnische Jagdgeschwader in die Luftkämpfe ein. Da der Druck durch die kaiserlichen Luftangriffe so nachließ, konnte man sich andern Dingen widmen. Und jetzt, gegen 19 Uhr, ist allmählich auch klar, was die Kaiserlichen vor haben. Im Speisesaal studieren Karo und Conny sowie die Divisionskommandeure Valkendorn und Landgraf von Hessen-Darmstadt das Bild, das sich durch die eingetragenen Meldungen ergeben hat: Mit roten Pfeilen sind die feindlichen Vorstöße gekennzeichnet. Sie zeigen, daß im Süden Glinka schon am Mittag vom Feind genommen wurde. Kardymovo ist im Zentrum gefallen. Doch alles im allen hält die eigene zentrale Front, wo die blauen Linien, die die „Schimäre“Stellungen zeigen, fast noch da verlaufen wie am Morgen. Gewiß, am Hmost-Flüßchen ist die Lage nach wie vor kritisch. Das 3. und das 2. Regiment kämpfen mit dem Mut der Verzweiflung gegen den kaiserlichen Sturm. Und nur die Tatsache, daß die Aufklärungsabteilung in Sokino nicht kapituliert hat, hat einen Durchbruch der Kaiserlichen verhindert. Das ist den ganzen Tag über der Sorgengrund gewesen. Karo schlingt gerade eine Suppe runter. Sie löffelt gerade die letzten Reste ihrer Suppe, als Conny ihr einen Kaffee bringt. „Ich dachte mir, Du brauchst vielleicht einen Schwarzen.“ „Ja, danke, Conny.“ Ja, das braucht sie jetzt wirklich. Der Tag ist stressig gewesen. Ihre Hilfe am Flugplatz von Safonovo beanspruchte dann doch deutlich mehr Zeit. Erst am Mittag hatte sie das Hauptquartier erreicht. Bis dahin hatte Valkendorn zusammen mit Conny und dem Landgrafen alles in die Hand genommen. Besondere Sorgen bereitete der Panzervorstoß der Kaiserlichen im Süden, bei Glinka. Das die Kaiserlichen dort durchgebrochen waren, stand erst fest, als Karo endlich wieder im Hauptquartier war. Und Valkendorn hatte kaum etwas, daß er den Panzern entgegenwerfen konnte. Das 1. und 2. Regiment hatten bei Spas-Lipki selber mit einem feindlichen Durchbruch zu kämpfen. Wirklich in Reserve hatte man nur Orths Panzerregiment. Aber Karo verweigerte spontan die Genehmigung zu dessem Einsatz. Jetzt schlürft sie ihren Kaffee und geht wieder rüber zum Kartentisch. Alle halten kurz inne, als sie am Tisch stehenbleibt und den langen Pfeil mustert, der den feindlichen Panzervorstoß über Glinka und die Höhe 261 in den Rücken des 4. Regiments darstellt. Valkendorn wirft Karo einen düsteren Blick zu. Erst vor zwei Stunden hatte er die letzte Debatte mit ihr gehabt, darüber, was in dieser Situation zu tun sei. Am Ende hatten sie sich angebrüllt. Karo hatte sich weiterhin geweigert, Orth in Marsch zu setzen. Das einzige, was sie getan hatte, war, eine Anfrage an die Russen zu schicken, die immer noch Jelnja in der kaiserlichen Südflanke hielten, ob sie von dort aus die kaiserliche Flanke angreifen könnten. Langsam läßt sie den Kaffee die Kehle runterrollen. Sie spürt, wie die Energie ihren müden Körper wieder belebt. Dann fragt sie: „Haben sich die Russen schon gemeldet?“ Schweigen. „Haben sich die Russen schon gemeldet?“ fragt sie lauter, ohne den Blick von der Karte zu wenden. „Nein.“ antwortet Valkendorn düster. „Sie haben sich nicht gemeldet.“ Er haßte das. Wegen solcher Meinungsverschiedenheiten mit Reiss hatte er den Posten als Stabschef und Ia aufgegeben. Seine Nachfolge trat Karo an. Nur Reiss hatte immer einen guten Grund, warum er anderer Meinung wie Valkendorn war und hatte meistens Recht behalten. Bei Karo ist sich Valkendorn da nicht so sicher. Die Tür geht auf. „Frau General!“ Karo dreht sich um. „Ja?“ Der Stabsunteroffizier in der Tür macht auch schon einen müden Eindruck. „Wir haben endlich Kontakt zu Schoeps!“ „Am Funkgerät?“ „Nein, hier!“ tönt eine Stimme von draußen und dann steht Schoeps in voller Lebensgröße in der Tür. Ihr Kampfanzug ist großflächig von einer dunklen Flüssigkeit befleckt. Erschrocken macht Karo einen Schritt auf sie zu. „Schoeps, bist Du...?“ Mit einer wegwerfenden Handbewegung beruhigt Schoeps sie. „Na laß mal. Das ist nicht mein Blut. Mußte einem Gegner im Nahkampf die Kehle durchschneiden...einfach widerlich. Aber Sokino hält, die Reste der Aufklärungsabteilung sind in die Front zurückgekehrt.“ Sie geht zur Karte, nimmt einem Stabsoffizier einen Stift ab und zieht eine blaue Linie. „Ungefähr hier...das Ding hält.“ Karo trinkt ihren Kaffee aus. „Sehr gut...Valkendorn, irgendwas neues vom Durchbruch an unserer Nordflanke?“ Valkendorn blättert die letzten Aufklärungsmeldungen durch, die vom 1. und 2. Regiment, die bei Spas-Lipki Ärger mit einem zweiten Durchbruch haben. Es ist offensichtlich, daß die Kaiserlichen „Schimäre“ einkesseln wollen. „Nein.“ meldet er. „Mal abgesehen davon, daß der Angriff hier nur von Infanterie vorgetragen wird. Auch wenn das nicht ganz sicher ist.“ „Ok. Valkendorn, Schoeps, Conny in mein Büro.“ Auf dem Absatz dreht sich Karo um und geht voraus. Schoeps schaut Conny und Valkendorn nur an, aber beide zucken die Achseln. Also folgen sie ihr. Als sich alle in dem Büro eingefunden haben, befiehlt Karo: „Conny, schließ bitte die Tür.“ Conny Schönmann tut wie ihr befohlen. Nach einem tiefen Durchatmen fängt Karo an: „Valkendorn ich weiß, daß Sie die Befürchtung haben, ich hätte keinen Plan, weil ich den ganzen Tag voller erbitterter Kämpfe gezögert habe.“ Überrascht sieht Valkendorn auf. Hat man es ihm so deutlich angesehen? Jetzt weiß er, was Stefan damit meinte, als er mal bemerkte, Karo könne die Gedanken von einem beinahe lesen. „Aber ich habe einen Plan.“ verkündet sie. „Etwas riskant, aber es könnte klappen.“ „Dann legen Sie mal los, Frau General.“ fordert Valkendorn sie auf. Sie nickt und fährt dann fort: „Der Feind will uns mit zwei Vorstößen in unsere Flanke einkesseln. Zum Glück für uns findet nur einer dieser Vorstöße mit Panzern statt. Scheinbar zumindest zielt er hierher. Der Panzerkeil ist die gefährlichere Angriffsspitze; die relativ langsame Infanterie im Norden können wir eventuell ja schon im Hmost-Tal aufhalten. Daraus ergibt sich, daß wir uns auf den gefährlicheren Panzerkeil im Süden konzentrieren müssen. Hier mein Plan: Wir lassen die Panzer erstmal durchfahren.“ „Bitte was?“ schnappt Schoeps. „Bist Du verrückt, Karo?“ „Nein, aber es verschafft uns die Gelegenheit alle Panzer plattzumachen.“ Valkendorn stellt die einfache, aber entscheidende Frage: „Wie?“ „Wir werden hier bei Jakovlevo einen letzten Riegel errichten. Bis die Panzer diese Position hier erreicht haben, werden wir sie schwächen und sobald wir sie hier beschäftigen können, lassen wir Orths Panzerregiment an der Flanke angreifen.“ „Klingt gut, Frau General, nur sehe ich nicht, wie sie das machen wollen.“ wendet Valkendorn ein. Darauf antwortet Karo: „Das Spezialbataillon 1 lassen wir gegen die Nachschublinien der feindlichen Panzer vorgehen. Conny, Du erteilst die entsprechenden Befehle an das Spezialbataillon. Ich will nicht einen Tropfen Sprit bei den feindlichen Panzern ankommen sehen.“ „Geht klar.“ „Schoeps, Du operierst mit Deinen berittenen und motorisierten Einheiten gegen die Angriffsspitzen, hinhaltend. Dabei gehst Du auf Jakovlevo zurück.“ „Ok, das könnte klappen.“ pflichtet Valkendorn bei, doch er hat immer noch Einwände: „Mit was bitte wollen Sie, Frau General, Jakovlevo zu einem Riegel machen?“ Stirnrunzelnd lehnt sich Karo an den Schreibtisch, legt einen Finger ans Kinn, dann gibt sie die Antwort. Sie geht um den Schreibtisch herum, zieht die Schublade auf und holt ihre Radom-Pistole heraus, sowie ein Magazin, schiebt es rein und lädt die Pistole durch. „Durchladen, entsichern und schießen. Wir werden dieser Riegel sein, General. Wir werden dieser Riegel sein. Sie und der Landgraf sollten die Regimentskommandeure unterrichten, daß der Funkkontakt eventuell abbrechen kann. Dann müssen sie auf sich gestellt weiterkämpfen. Sobald wir die Panzer geschlagen haben, widmen wir uns dem anderen Durchbruch bei Spas-Lipki.“ „Karo, Du hast zuviel mit Stefan rumgehangen...“ meint Schoeps sarkastisch. „Mag sein.“ versetzt Karo, in deren Stimme jetzt deutlich mehr Entschlossenheit mitschwingt wie noch vor ein paar Stunden. Mit einem Seufzer meint Valkendorn: „Ok, ich und der Landgraf erteilen die nötigen Befehle. Und dann bewaffnen wir den Generalstab.“ „Und lassen Sie die HQ-Kompanie antreten.“ „Zu Befehl, Frau General. Sonst noch was?“ „Ja, Valkendorn. Sagen Sie den Verbindungsoffizieren unserer Verbündeten, sie können gerne abreisen, bevor die Show losgeht. Die Alternative ist mitkämpfen.“ „Ich werde es den Verbindungsoffizieren sagen.“ Valkendorn verläßt eilig den Raum wieder. Jetzt gibt es viel zu tun. Conny blickt ihm kurz nach und meint dann: „Schoeps hat recht. Du hast zuviel mit Reiss rumgehangen. Dieser Plan ist totaler Irrsinn.“ „Aber er kann funktionieren!“ „Glaubst Du das wirklich?“ fragt Schoeps scharf. „Ja.“ „Ok, Karo, dann folgen wir Dir. Aber wenn wir draufgehen, bist Du dran.“ „Ok. Gilt.“ „Dann ist ja alles klar. Ich werd jetzt mal ein paar Paks auftreiben gehn.“ beschließt Schoeps und verläßt den Raum. Sie hat die Tür noch nicht ganz zugemacht, als ein Stabsoffizier hereinkommt, ein Blatt Papier in der Hand. „Frau General, das 4. Regiment hat erste Verlustzahlen gemeldet. Es dürfte Sie vielleicht interessieren, daß Unteroffizier Karlinski ins Hauptlazarett geliefert wurde.“ Hörbar atmet Karo einmal aus und wieder ein. Dann schnappt sie sich ihren Regenmantel. „Ich fahr ins Lazarett. Conny, bestell Schoeps, sie soll sich eine neue Uniform ohne Blut zulegen.“ „Geht klar.“ „Ich bin heut nacht wieder zurück.“ Als Karo über den Parkplatz zu ihrem Geländewagen geht, weicht sie den Pfützen aus. Es regnet wie aus Kübeln und sie ist froh, als sie endlich im Wagen sitzt. In der Ferne hört man grollendes Rumpeln. Gewitterdonnern oder Geschützdonner? Die Antwort will Karo lieber gar nicht erst wissen. Der Regen ist jedenfalls gut. Nicht nur weil er den Druck durch die feindliche Luftwaffe mindert. Auch weil er hilft, die Brände, die den halben Tag lang Jarcevo, wo die Kaiserlichen erst Spreng-, dann Brandbomben abgeworfen haben, verwüsteten, zu löschen. Karo fährt vom Parkplatz runter und verläßt Jakovlevo dann Richtung Osten. Das Hauptlazarett liegt bei Durovo, noch hinter Safonovo. Die Dämmerung ist schon deutlich fortgeschritten. Karo fährt in mäßigem Tempo über den Rollbahn (wie man hier die Hauptstraße nennt) nach Osten, vorbei an Verwundetentransporten, die nach hinten rollen, und an Nachschubtransporten, die nach vorne, zur Front, rollen. Manchmal sieht sie vage am Rand des Lichtkegels der Autolichter ausgebrannten Wagen und Karren im Straßengraben, die am Morgen Opfer von Tieffliegern geworden sind. Als sie von Safonovo nach Jakovlevo gefahren ist, hatte sie auch von Tieffliegern niedergemetzelte Pferde und Kühe auf den Feldern gesehen. Jetzt geht es immer schwerer voran, weil die Straße, die nicht gerade gut befestigt ist, immer mehr Schlammlöcher aufweist. Spätestens gegen Monatsende würde sie sich in bodenlosen Morast verwandelt haben. Die Fahrt dauert fast drei Stunden und das ist für die Verhältnisse hier in Russland eigentlich noch ganz in Ordnung. Solche Fahrten nutzt Karo immer, um sich allerhand durch den Kopf gehen zu lassen. Drängende Fragen quälen sie. Ist ihre eben getroffene Entscheidung richtig gewesen? Was ist mit Tanja? Mit Stefan? Lebt der General überhaupt noch? Und was hat sich ihre alte Jugendfreundin Anna Karlinski, von allen meist Anja genannt, zugezogen, daß sie im Lazarett liegt? Unterbewußt brauen sich schon die wildesten Horrorvorstellungen zusammen. Als sie endlich das Lazarett erreicht, daß man auf einem großen Feld nahe Durovo in Form zahlreicher Baracken errichtet hat, parkt sie den Wagen unter einem Baum, zupft den etwas verrutschten Regenmantel zurecht und steigt dann aus. Als sie die Autotür zuschlägt, bemerkt sie wieder ein Ziehen in ihrem Oberschenkel. Die Verletzung meldet sich wieder. Sie bleibt kurz stehen und atmet bewußt tief und ruhig aus. Das Ziehen vergeht wieder. Aber es erinnert sie immer daran, wie schnell man sich in diesem Krieg eine Kugel einfängt. Jedes Regiment hat eine eigene Baracke für die Verwundeten – ein System, das sich bewehrt hat. Karo folgt den an Pfosten angebrachten Schildern über den schlammigen Acker zur Baracke für das 4. Infanterieregiment. Die Wache am Eingang grüßt Karo freundlich. „Abend Frau General. Vorsicht, die Luft da drinnen ist fürchterlich. Wir haben heute viele Verletzte reingekriegt.“ „Alles klar.“ Als Karo den Raum betritt, begreift sie, was der Soldat mit fürchterlicher Luft meinte. Die Luft ist abgestanden, stickig, geschwängert vom Geruch der Desinfektionsmittel, Penizillin, Blut und Eiter. Wenn man von der kalten Nacht draußen hereinkommt, ist das wie ein Hammer. Und die Wärme hier drinnen auch. Mühsam zwingt Karo ihren revoltierenden Magen wieder zur Ordnung und schnappt sich dann einen der Ärzte, der gerade vorübereilt. „Können Sie hier nicht für bessere Verhältnisse sorgen?“ „Tut mir leid, Frau General, wir bekamen heute so viele Verletzte rein, es geht nicht anders. Wir haben so viel zu tun, daß wir nichtmal die Leichen wegräumen konnten.“ Der Arzt deutet in einen Abschnitt des großen Hauptraumes, wo die Betten aufgereiht sind, wo auf dem Boden unter einer Plane Körper liegen. Und dann eilt der Mann auch schon weiter, um dem nächsten Patienten zu helfen. Irgendwo aus einem Nebenraum, die als Operationsräume benutzt werden, dringen Schreie. Petroleumlampen verbreiten ein diesiges Licht, in dem die gelegentlichen Stöhner der noch nicht eingeschlafenen Patienten fast greifbar sind. Karo schleicht suchenden Blickes an den Betten vorbei. Fast jeder Patient hat einen blutigten Verband, einigen mußte man Gliedmaßen amputieren, andere haben Kopfverletzungen. Krankenschwestern, die schon sichtlich übermüdet sind, huschen von Bett zu Bett und versorgen die am ärgsten Verletzten mit Schmerzmitteln. Viel kann momentan für die wenigsten getan werden. Zumal im hinteren Teil des Gebäudes, wo die Aufnahmestation ist, immer neue Fälle hereinkommen. Schließlich sieht sie zwei Reihen weiter eine Schwester, die gerade bei einer Frau mit langen, leicht lockigen blonden Haaren eine Verwundung am linken Oberarm verarztet. Sofort erkennt Karo in der Patientin ihre Bekannte Anna Karlinski. Erst wartet sie, bis die Schwester den Verband an der Verletzung gewechselt hat, dann kommt Karo näher. „Abend Anja.“ Überrascht sieht Karlinski auf. „Karo!“ „Na, wie geht’s?“ „Geht so. Hab mir ne Kugel eingefangen. Und bei Dir?“ „Viel Streß. Kannst Dir ja denken wieso.“ „Ja, kann ich.“ Nachdem sie sich einen kleinen Klapphocker herangezogen hat, setzt sich Karo neben Anna. „Was sagen die Ärzte?“ Anna verdreht die Augen. „Halb so wild sagen die Ärzte. Auch wenn es sich anders anfühlt. Sie meinen, ich wäre bald wieder draußen. Hast Du was von meiner Schwester gehört?“ „Nein, leider nicht.“ Annas jüngere Schwester ist ebenfalls „Schimäre“-Kämpferin. „Anja, wie wärs, wenn Du wieder fit bist und die Lage wieder was ruhiger ist, gehen wir nochmal alle einen trinken.“ „Ja, das wäre gut. Hab ich länger nicht mehr gehabt.“ „Laß uns das dann zusammen mit Stefan machen, wenn er wieder zurück ist.“ „Glaubst Du denn, daß er zurückkommen wird?“ „Ich muß daran glauben. Die Alternative wäre unvorstellbar....Warte, wechseln wir das Thema. Erzähl mir mal lieber, wie Du Dir die Kugel eingefangen hast...“ Und dann erzählt Anna Karo erstmal von den Gefechten nördlich von Glinka. Am Ende unterhalten sich die beiden noch fast eine halbe Stunde, dann schaut Karo auf die Uhr. „Tut mir leid, Anja, ich muß wieder gehen. Es wird morgen viel zu tun geben. Aber ich werd Dich so bald wie möglich wieder besuchen.“ „Mach das. Viel Glück bei der Schlacht.“ „Danke. Gute Besserung.“ „Ok, bis dann.“ „Bis dann.“ Karo klopft Anna aufmunternd auf die Schulter und geht dann leise zurück zur Tür. Unterwegs begegnet ihr nochmal der Arzt von vorhin. Karo hält ihn an. „Stabsarzt, Sie schnappen sich jetzt ein paar Leichtverwundete, die noch Sachen heben und tragen können, und dann schaffen Sie die Leichen hier raus! Ich werd Ihnen die nötigen Kisten vorbeibringen lassen.“ „Zu Befehl, Frau General.“ antwortet der Arzt resignierend. Auch er ist übermüdet und gestreßt. Der Bahnhof von Lodz ist menschenleer. Nur Soldaten der kaiserlichen Garnison, die hier seit ungefähr zwei Monaten den Ton angeben, patrouillieren jetzt, kurz vor Mitternacht, auf den Bahnsteigen. Durch einen Spalt zwischen den zugezogenen Vorhängen beobachtet Marta die Szene. Der Bahnhof sieht besser aus als der von Warschau, durch den sie gerollt sind. Dort waren die Kriegsschäden vom September noch offenkundig. Ausgebrannte Lokomotiven und Waggons hatten drei Gleise belegt, ein Teil des Daches war eingefallen gewesen, der Beton des Bahnsteigs, an dem sie vorbeigerollt waren, wurde bei den Kämpfen im September offenbar von einem Granateneinschlag aufgerissen. Aber hier in Lodz hat man die Kriegsschäden zumindest oberflächlich bereits beseitigt. Marta läßt sich zurücksinken in ihren Sitz und seufzt hörbar. „Was ist?“ fragt Tanja. „Nix.“ antwortet Marta kühl. „Mir gefällt nur nicht, daß wir in diesem Zug festsitzen und nichts tun.“ „Ich wäre mit so was vorsichtig.“ versetzt Tanja. „Manchmal ändert sich dieser Zustand schneller als einem lieb ist.“ Die Abteiltür geht auf und Philipp steckt den Kopf herein. „Nicht erschrecken, die hängen einen weiteren Waggon an. Ein Gefangenentransport, bewacht von Gepos. Sobald wir weiterfahren, seh ich mir das an.“ Dann schließt er die Tür wieder. Auf dem Gang rückt Philipp seine geklaute Gepo-Uniform zurecht. Ein leichter Ruck geht durch den Zug, als der Waggon angehängt wird. „Dann kann die Show ja losgehen...“ murmelt Kipshoven. „Jacke, solange ich gleich im hintersten Waggon bin, hast Du hier das Kommando.“ „Zu Befehl.“ erwidert Jacke und schnippt mit dem Finger einen Fussel von der Gepo-Uniform. Langsam setzt sich der Zug jetzt in Bewegung und verläßt den Bahnhof von Lodz. Wenige Augenblicke später nimmt er Fahrt auf und rauscht durch die Nacht gen Westen. „Na denn.“ Philipp tritt an Jacke vorbei und öffnet die Tür zum Durchgang in den nächsten Waggon. Dort sitzt eine müde Wache auf einem in der Wand eingelassenen Klappsitz. Etwas erschrocken schaut der kaiserliche Soldat auf, als Philipp an ihm vorbeigeht, grüßt ihn aber freundlich, in dem er die Hand an die Stirn hebt. Philipp geht leise weiter; aus den Abteilen hört man manchmal ein Schnarchen, die Soldaten schlafen offenbar schon alle. So schleicht Philipp durch drei Waggons, in jedem sitzen auf dem Gang ein bis zwei Wachen. Je weiter man sich dem Reichsgebiet nähert, desto nachlässiger werden die Soldaten anscheinend. Nach dem dritten Waggon erreicht Philipp den Flak-Wagen: Ein flacher, länglicher Wagen mit einem 5-cm-Zwillings-Fla-Geschütz, der an den Seiten etwas mit Sandsäcken bestückt ist. Die Bemannung besteht aus fünf Heeressoldaten, die schon wachsamer sind. Sofort stehen zwei bei Philipp. „Moment!“ halten sie ihn an. Erst dann bemerken sie die Gepo-Uniform, die im Dunkeln erst recht finster wirkt. Hoffentlich bemerken die nicht, daß ich meine längeren Haare unter der Uniformmütze versteckt habe, denkt sich Philipp. Aber nach einem kurzen Gespräch lassen sie Philipp passieren. Er geht rechts an der Flak vorbei und erreicht dann den letzten Waggon, einen Frachtwaggon. Man hat am vorderen Ende nachträglich eine Tür eingebaut, damit Wachen von einem Waggon zum andern gelangen können, ohne groß herumklettern zu müssen. Vor dieser Tür steht auf einem schmalen Steg eine Gepo-Wache. Philipp gibt sich freundlich. „Abend Kollege...“ Der andere Gepo ist sichtlich überrascht. „Abend...äh...Obersturmführer...Was möchten Sie?“ „Ich hörte, daß man euch hier drangehangen hat und wollte mir mal ansehen, was ihr hier mitgebracht habt.“ „Äh, moment, da muß ich mal meinen Vorgesetzten fragen.“ „Sicher doch.“ Der Gepo öffnet die Tür, ruft jemanden herbei und tritt ein Hauptsturmführer nach draußen. Philipp fällt auf, daß dieser einen Säbel trägt – ein interessantes Detail, das ihm bekanntvorkommt. „Ja, Obersturmführer, was möchten Sie?“ „Ich wollte nur einen Freundschaftsbesuch abstatten.“ „Ja, na gut...kommen Sie ruhig rein.“ Der Hauptsturmführer verschwindet wieder im Innern des Wagens und die Wache tritt zur Seite, damit Philipp vorbeitreten kann. Die Wache schließt die Tür wieder und Philipp muß seine Augen erstmal an die eine Petroleumlampe gewöhnen. Dann erkennt er, wie stark man den Lastwaggon umgebaut hat: Man hat eine Querwand eingebaut, die ein Aufenthaltsabteil für die Gepos, die als Wachbesatzung fungieren, abgrenzt. An den Wänden hat man vier Klappbetten installiert und einen Klapptisch angeschraubt. Drei Gepos sitzen hier auf den Betten und trinken gerade Kaffee. Außerdem liegen auf dem Tisch mehrere Spielkarten. Der Hauptsturmführer gibt sich freundlich. „Bitte, Obersturmführer, spielen Sie doch eine Runde Skat mit uns.“ „Danke für das Angebot, aber ich habe nicht viel Zeit. Auch ich muß Gefangene bewachen.“ „Ja, ich kann Ihnen gerne mal unser Viehzeug zeigen.“ meint der Hauptsturmführer fast schon fröhlich und schließt eine weitere Tür auf, die auf die andere Seite der Querwand führt. Er nimmt eine Taschenlampe mit. War es im Aufenthaltsraum durch einen kleinen Ofen noch relativ warm, so ist es hier, im eigentlichen Frachtraum, kalt und feucht. Und dunkelt. Der Hauptsturmführer zündet eine Taschenlampe an – und Philipp erschauert. Abgemagerte, bleich wirkende Menschen mit eingefallenen Gesichtern und ungepflegten Haaren hängen von der Waggondecke herab, wo sie mit schweren Ketten an den Armen aufgehangen wurden. Sie tragen nur verdreckte Sträflingsanzüge, in die mangels anderer Möglichkeiten bereits geschissen und gepisst wurde. Es riecht auch danach. Einige der Gefangenen heben müde den Kopf und starren Philipp und den Hauptsturmführer aus verängstigten und verzweifelten Augen an. Bei einem erkennt Philipp blutige Spuren am Anzug an den Seiten und am Rücken, als wenn man ihn erst vor kurzem ausgepeitscht hätte. Leises Wimmern liegt in der Luft. „Keine Sorge, ihr Säcke...“ höhnt der Hauptsturmführer, „heute nacht lassen wir mal die übliche Nummer. Aber morgen früh kriegt ihr alle wieder eine Abreibung.“ „Was sind das für Gefangene?“ fragt Philipp so sachlich, wie es ihm möglich, es aber in der Gepo-Verkleidung nötig ist. Der Hauptsturmführer gibt auch bereitwillig Auskunft: „Das sind Gefangene, die wir Anfang August gemacht haben, Polen. Im Arbeitslager haben sie keine Leistung mehr gebracht, als bringen wir sie jetzt zur Endverwertung.“ „Verstehe.“ Als der Hauptsturmführer die Taschenlampe wieder ausmacht, meint Philipp: „Tja, Sie müssen mich jetzt entschuldigen, aber ich muß wieder zurück auf meinen Posten.“ „Sehr gut. Ich mag Pflichtbewußtsein, Obersturmführer. Dürfte ich dann vielleicht morgen Vormittag mal Ihre Gefangenen begutachten.“ „Sicher. Kein Problem.“ Nach noch ein paar freundlichen Worten verläßt Philipp wieder den Anhänger, grüßt freundlich die Wache und eilt dann über die andern Eisenbahnwagen zurück in den vordersten Waggon. Dort warten die andern bereits auf seinen Bericht. „Leute,“ beginnt Philipp, „das ist einfach unfaßbar.“ Und dann beschreibt er den Anblick, den er eben hatte. Allen schaudert es; sie sehen sich an. Was nun? „Ok, Kapitän, was machen wir jetzt?“ fragt Krakowsky betont sachlich. Philipp geht in eines der Abteile und setzt sich. In der Tür stehen jetzt Jacke, Marta und Krakowsky. Stirnrunzelnd dreht sich Philipp erstmal mit bedächtigen Bewegungen eine Zigarette. „Hat einer von euch Feuer?“ fragt er und steckt sich die Kippe zwischen die Lippen. Jacke zieht sein Feuerzeug und gibt Philipp Feuer. Kipshoven nimmt einen tiefen Zug und bläst den Rauch langsam aus, man sieht ihn in dem Dämmerlicht der Abteilbeleuchtung. Dann spricht er leise, aber mit einem hörbar entschlossenem Ton: „Ich schwöre bei allem was mir heilig ist und vor Zeugen, daß ich für die Freiheit aller Menschen kämpfen und diese gegen die Mächte der Unterdrückung mit meinem Leben verteidigen werde. Ich schwöre, mich für die Menschenrechte einzusetzen und der mit der Freiheit verbundenen Verantwortung gerecht zu werden. Dieser Schwur wird bis über meinen Tod hinaus bestehen. Es lebe die Freiheit und der Friede, deren ewiger Diener ich nunmehr bin.“ Langsam wendet er den Kopf zu den andern. Und stellt fest: „Das habe ich vor nunmehr gut 14 Jahren geschworen. Wir können die Menschen im hintersten Waggon nicht im Stich lassen. Der General würde mir beipflichten.“ Jacke nickt. „Ja, Stefan würde Dir beipflichten. Also – holen wir die Leute aus der Scheiße raus.“ Philipp steht auf, registriert, daß von Marta kein Widerspruch kommt. Krakowsky ist schon im Nebenabteil und fragt Fraker, ob er wieder auf dem Damm ist. Und während Philipp sich im Kopf einen Plan zurechtlegt, knöpft er seine Gepo-Uniform auf. Das Versteckspiel ist vorbei. Jetzt wird dem Feind mal gezeigt, wo der Hammer hängt! Schon hat Philipp die Uniformmütze ausgezogen und sein langes, dunkles Haar fällt über seine Schultern. Aus seinem Rucksack holt er seinen Ledermantel hervor und zieht ihn über, nachdem er seinen Säbel umgelegt hat. „Ok, folgender Plan: Zuerst schalten wir die Lokführer aus. Dann sorgen ich und Marta für etwas Ablenkung. Jacke und Krakowsky behalten ihre Gepo-Uniformen an und geleiten die andern von euch als falsche Gefangene bis zum Flakwagen. Sobald ihr dort eingetroffen seid, beginnt das Ablenkungsmanöver von Marta und mir. Die Verwirrung nutzt ihr um die Wache der Gepos auszuschalten und den Flakwagen vom vom Rest des Zuges loszukoppeln. Alles klar?“ Alle nicken, die verfügbaren Waffen werden verteilt. Krakowsky und Fraker machen sich auf dem Weg zur Lokomotive, um die beiden Lokführer auszuschalten. „Kommen Sie, Marta, wir machen uns schon mal auf dem Weg.“ meint Philipp. „Welchen Weg?“ fragt Marta unwirsch und folgt Philipp zu der vorderen Seitentür, die Philipp kurzerhand öffnet. Fahrtwind weht herein und läßt Philipps Mantel und Haare flattern. „Den Weg!“ Er deutet mit ausgestrecktem Finger nach oben. „Nein!“ Marta schüttelt den Kopf. „Wie verrückt sind Sie, Kapitän?“ „Naja, wer ist der größere Verrückte: Der Verrückte oder der Verrückte, der ihm folgt?“ Schon hängt er sich bei voller Fahrt halb aus der offenen Tür und greift nach rechts, wo fast ganz am Ende des Waggons eine Leiter ist. Da hängt er sich dran. Immer wenn ein neben den Geleisen stehender Mast vorbeirast, drückt er sich an enger an den Zug, um dann sofort weiterzuklettern und schließlich das Zugdach zu erreichen. Hier krallt er sich förmlich fest, um dem Fahrtwind standzuhalten und hilft dann mit einer Hand Marta hoch. Und dann arbeiten sich beide nach hinten, dabei immer darauf achtend, nicht heruntergeweht oder von Stromleitungen, die für die E-Loks gebraucht werden, erwischt zu werden (E-Loks sind erst seit wenigen Jahren und noch nicht sehr zahlreich in Mitteleuropa und Großbritannien im Einsatz, andernorts überwiegen noch die Dampfloks). Hinter ihnen pfeift die Lok einmal laut – also sind die Lokführer ausgeschaltet. Kurz vor der Hinterkante des letzten Wagens vor dem Flakwaggon bedeutet Philipp Marta mit einem Tippen auf der Schulter, hier jetzt auszuharren. Umgeben von eisigem Fahrtwind, inmitten von Dunkelheit. Nach ein paar Minuten, die den beiden wie eine Ewigkeit vorkommen, tut sich unten was. Krakowsky, Tibori und Jacke führen, noch in ihren Gepo-Uniformen, die anderen, die wieder die Gefangenenrolle übernommen haben, auf den Flakwagen. Sofort werden sie von dessen Besatzung angehalten, kurz befragt und dann durchgelassen. Krakowsky geht vor, gefolgt von Fraker und Tina. Jacke, Tibori und Tanja verzögern bewußt. Mittwoch, der 15. Oktober „Jetzt!“ zischt Kipshoven. Und dann springen er und Marta mit aller Kraft auf den Flakwagen. Mit einem weiteren Satz ist Philipp bei einem der Soldaten, treibt diesem mit mehreren raschen Schlägen hintereinander die Luft aus dem Leib, entreißt dem Mann den Karabiner und schleudert ihn dann gegen die seitlichen Sandsäcke. Gleichzeitig greift Marta einen weiteren Soldaten an, bricht ihm mit einer schnellen Bewegung das Genick. Und auch die andern reagieren mit nur leichter Verzögerung. Krakowsky packt die Gepo-Wache vor dem Zugang zum letzten Wagen und schleudert sie zur Seite. Jacke und Tibori wollen zurückhechten, um den Flakwagen vom Rest des Zuges abzukoppeln, doch ein feindlicher Soldat ist schneller, schießt mit seinem Karabiner. Zwar können Jacke und Tibori zur Seite und in Deckung springen, aber sind nicht rechtzeitig an der Kopplung. Und der Schuß alarmiert die Soldaten in dem Waggon. Unterdessen beginnt Fraker einen Zweikampf mit einem anderen Kaiserlichen. Und das in nur ein, zwei Sekunden. Und auch alles andere geht blitzschnell: Da ja der erste Schuß gefallen ist, verzichtet man auf weitere einschränkende Heimlichkeiten. Philipps Gegner hat sich gerade aufgerappelt, aber Philipp legt den Karabiner an und schießt dem Kerl genau ins Herz, wirbelt herum, feuert auf einen weiteren Gegner, der aber in Deckung springt und zurückfeuert. Tibori gibt Jacke mit der Pistole Deckung, als an der Durchgangstür des vorderen Waggons mehrere Soldaten auftauchen und die Karabiner anlegen. Im Kugelhagel kann sich Jacke an die Koppelung vorarbeiten, will gerade die Waggons trennen, da tritt ihm jemand genau vor den Brustkorb. Jacke fliegt drei Meter zurück. Tibori wird von hinten angesprungen, schüttelt den Feind ab und schießt ihn nieder, als dieser sich wieder auf ihn stürzen will. Fraker wird von seinem Feind an die Lafette der Flak gedrückt, sein Gegner will ihn abstechen. „Na los...gib auf....Terroristenschwein...“ Fraker und der Soldat erstarren, als eine sinnliche Frauenstimme sich einmischt: „Hey, Arschloch, laß meinen Kumpel in Ruhe.“ Der Soldat dreht sich unwillkürlich um. Und hat gar keine Zeit mehr, zu erkennen, in den Lauf von was für einer Pistole er starrt, denn da drückt Marta auch schon ab. Fraker flucht, als ein Schwall aus Blut und Hirn sich auf ihn ergießt. Tina fängt derweil die Gepo-Wache ab, die sich wieder aufgerappelt hat, rammt dem Mann das Knie in die Genitalien, zieht ihm den Pistolengriff über den Schädel und schleudert ihn dann zusammen mit Tanja, die herbeigeeilt ist, vom Wagen. Krakowsky hat mittlerweile auch Ärger. Aus dem hintersten Wagen sind drei Gepos hervorgestürmt. Einer hat sich direkt mit dem Säbel auf Krakowsky gestürzt, der hat dem Mann den Säbel aus der Hand getreten, jetzt kämpfen beide ineinander verkrallt am Rande des Zwischenraums der beiden Waggons. Ein Schuß peitscht und der Gepo taumelt zurück – Philipp hat aus drei Metern Entfernung angelegt und gefeuert. Da springt ein kaiserlicher Soldat aus der Deckung hervor und reißt Philipp von den Füßen. Der springt sofort wieder auf, der Soldat versucht ihn runterzuziehen, aber Philipp zieht in einer raschen Bewegung einmal seine Nieten durch das Gesicht des Gegners. Zieht dann ein Messer und rammt es dem Mann seitlich in den Hals. „Werd glücklich damit!“ flucht Kipshoven. Zwei Gepos sind nun direkt auf den Flakwagen gestürmt, wollen auf Fraker und Marta feuern, die springen zur Seite, ein Querschläger trifft einen kaiserlichen Soldaten. Der springt vor Schreck aus seiner Deckung auf, Marta knallt ihn ab. Der Mann taumelt nach hinten und kippt dann rücklings über die Sandsackbegrenzung. Inzwischen stürmen von der anderen Seite auch noch mehrere weitere kaiserliche Soldaten auf dem Wagen, direkt in den Kugelhagel von Jacke und Tibori. Mit einem blitzschnellen Satz ist Philipp bei der Flak, entschlossen, jetzt kurzen Prozeß zu machen. Die Gepos wollen ihn aufhalten, aber werden von zwei Sandsäcken von den Beinen gerissen, die Tanja und Tina nach ihnen geschleudert haben. Philipp nutzt die gewonnene Zeit, richtet die Flak auf den vorderen Waggon aus – und feuert! In grellen Lichtblitzen zerschneiden die Flak-Geschosse die Luft. Ein Soldat, der nicht schnell genug ausweicht, wird zerfetzt, zwei weitere können sich nur durch den Sprung vom Wagen herunter retten – mit einem Schrei verschwinden sie in der Dunkelheit. Mehrere krepierende Flakgeschosse zersprengen den vorderen Waggon, der hell auflodert. Brennende Bruchstücke regnen hernieder, kreischende, brennende Gestalten springen vom Wagen ab. Jacke erkennt seine Chance, springt auf, schießt einen sich ihm entgegenstellenden Gegner nieder und ist dann bei der Anhängerkupplung. Er kann sie lösen und die beiden Wagen trennen sich. Schon entfernt sich der restliche Zug, dessen letzter Wagen lichterloh brennt. Von hinten stürzt sich wieder jemand auf Jacke – ein kaiserlicher Soldat, der auf dem Flakwagen zurückgeblieben ist. Beide fallen unsanft auf den Wagenboden, Jacke verliert seine Pistole, die zur Seite rutscht. Ein wilder Faustkampf entbrennt. Ein Gepo hat sich inzwischen wieder aufgerappelt und stürzt auf Philipp zu, mit gezogenem Säbel. Kipshoven weicht aus und die Klinge des Gepos jagt funkensprühend auf das Metall der Flak nieder. Schnell geht Philipp auf Sicherheitsabstand, schaut sich rasch um – wo ist der zweite Gepo? Ah, da ist er – von Tanja und Tina sowie Marta zur Kapitulation gezwungen. Die drei stehen mit gezogener Pistole vor dem Mann, der die Arme gehoben hat. Mit einer raschen Bewegung kann Philipp seinen eigenen Säbel ziehen. Der Gepo wirbelt herum und will angreifen, aber Philipp pariert. Jacke versucht derweil immer noch seinem Gegner beizukommen, schlägt ihm mehrfach die Faust ins Gesicht. Plötzlich ein ohrenbetäubendes Rauschen, das seinen Gegner ablenkt, als ein Güterzug mit Tankwagen in Gegenrichtung vorbeirauscht. Jacke kann sich ein wenig vom Gegner lösen, ihm das Knie in die Eingeweide rammen, den Mann wegstoßen und an seine Waffe kommen. Aber schon ist der Andere wieder bei ihm, packt seinen Arm, versucht ebenfalls an die Pistole zu kommen. Inzwischen hat Philipp seinen Gegner ausgespielt, mit einer geschickten Bewegung seines eigenen Säbels ihm den Säbel aus der Hand gedreht. Er nutzt den erlangten Schwung zu einer kompletten Drehung um seine eigene Achse, bei der er seinen Feind enthauptet. „Krakowsky! Rein! Da muß noch einer sein!“ brüllt er Krakowsky zu. Krakowsky ist schon dabei, mit gezogener Pistole den hintersten Waggon zu betreten. Jacke und sein besonderer Freund sind immer noch ineinander verharkt. Da lösen sich zwei Schüsse, die die letzten beiden Tankwagen des in Gegenrichtung vorbeirasenden Zuges treffen. Die Tanks explodieren in einer grellen Glutwolke. Ein Hitzeschwall fegt über den Flakwagen hinweg, alle werfen sich in Deckung und Jacke kann seinen Gegner nun endlich abschütteln und sich zur Seite rollen. In einer Kettenreaktion explodieren immer mehr Tanks des Güterzuges, der nun aus den Gleisen springt. Mit grellem Gekreisch und lautem Donner kippt er seitlich vom Bahndamm. Immer neue Detonationen lassen die Luft erbeben. Wagentrümmer fliegen in hohem Bogen auf die umliegenden Felder und Waldungen. Jacke hält seinem Gegner nun die Pistole an den Kopf. „Keine Bewegung!“ Derweil rollen die beiden aneinandergekoppelten Wagen allmählich aus. Der Zug ist längst davongefahren, nur weit weg sieht man noch die Flammen des letzten Waggons. „Sind alle in Ordnung?“ fragt Philipp, sich sichernd umsehend. Die Blitze und das Flackern der Explosionen des entgleisten Güterzuges erhellen alles. In diesem Lichtschein kann man die Leichen auf dem Flakwagen sehen. Erst jetzt fragt Tina: „Wo ist Krakowsky?“ Der ist im letzten Wagen. Er hat die Tür zum Frachtraum offenstehend vorgefunden, der Gestank ist ihm entgegengeschlagen. Die Erschütterungen der Explosionen haben den Wagen schwanken lassen, die an der Decke aufgehangenen Gefangenen schlagen dabei gegeneinander, was schmerzhaftes Aufstöhnen allenthalben zur Folge hat. Langsam begibt sich Krakowsky ins Dunkle, stößt immer wieder an einen der halbtoten Körper und zuckt dann unwillkürlich zurück. Irgendwo von hinten kommt ein gurgelndes Geräusch. Nach ein paar weiteren Schritten sieht Krakowsky auf dem Boden eine langsam verlöschende Taschenlampe, deren spärliches Licht eine Ecke beleuchtet, in der gerade ein Gepo mit den Abzeichen eines Hauptsturmführers einem Gefangenen, den er von der Decke heruntergeholt und auf den Boden gelegt hat, die Kehle durchschneidet. Zwei weitere Gefangene liegen bereits mit durchgeschnittener Kehle in einer dunklen Lache daneben. Langsam hebt Krakowsky die Pistole, da muß irgendwas den Hauptsturmführer alarmieren. Jedenfalls zuckt dessen Arm plötzlich zur Seite, so daß er seine abgelegte Pistole zu fassen bekommt, herumwirbeln kann und dann feuert. Krakowsky feuert gleichzeitig. Seine Kugel trifft den Gepo am Hals, Blut spritzt auf und der Hauptsturmführer sackt mit perforierter Hauptschlagader zusammen. Und Krakowsky? Der wird selber knapp unterhalb der linken Schulter getroffen. Jetzt jagen auf einmal Taschenlampenstrahlen durch den Raum, als Fraker und Marta mit Taschenlampen reingerannt kommen. Sie haben im Vorraum noch den Rucksack, den Krakowsky vorsichtshalber dort abgelegt hatte, denn im Rucksack ist das Funkgerät, gefunden und dann die Schüsse gehört. Fraker kniet sofort neben Krakowsky nieder, der vor Schmerz aufstöhnt. „Mein Gott, Krakowsky!“ Und Marta meldet, nachdem sie den Puls des Hauptsturmführers genommen hat: „Der hier ist tot.“ Alarmstimmung! Kapitan Stonszewska hastet mit seinem Trupp von neun Partisanen über das Feld, schwer atmend, die Kühle der Nacht gar nicht mehr wahrnehmend. Sie hatten die Bahnlinie sprengen wollen, sobald der planmäßige Treibstofftransport nach Osten hier durchgeht. Aber dann die Explosionen und das helle Leuchten nur einen Kilometer weiter westlich! Jemand hat den Zug vor ihnen gesprengt! Nur wer? Stonszewskas rund 200 Mann, alles Freiwillige, sind die einzigen Partisanen in der ganzen Gegend. Er hat sie um sich gesammelt, nachdem Stonszewska selber während der Spätsommerschlachten an der polnischen Front von seiner Einheit getrennt wurde und sich vor den vorbeimarschierenden Kaiserlichen verstecken konnte. Über einen Monat lang hat er die Freiwilligen ausgebildet, haben sie sich Waffen beschafft. Jetzt hatten sie endlich einen ersten schweren Sabotageakt durchführen wollen. Und was ist? Jemand anders kommt ihnen zuvor. Jetzt erreichen sie endlich das Wäldchen, wo der Zug entgleist ist. Überall Trümmer und alles steht in Flammen. Die Hitze läßt Stonszewskas Leute wieder ein paar Schritte zurückweichen. „Drumherum!“ brüllt Stonszewska auf Polnisch. „Drumherum! Vielleicht hängt einer von den Säuen noch hier rum!“ Mehr muß er nicht sagen. Seine Männer packen ihre Gewehre fester und rennen weiter. Nach einem kurzen Zögermoment folgt er ihnen. Die Flammenzone zieht sich über mehrere hundert Meter den Bahndamm entlang, denn der Transportzug ist lang gewesen. Erst nach ein paar Minuten und nachdem man einem lichterloh brennenden Wäldchen ausgewichen ist, sieht einer der Partisanen das kurze Aufleuchten einer Taschenlampe. Er stößt einen kurzen Vogelruf aus, um seine Kollegen zu informieren. Und dann gehen sie vor, das Gewehr im Anschlag. Erst jetzt sehen sie auf dem Bahndamm noch zwei Waggons stehen. Und plötzlich stehen sie einer Menschengruppe gegenüber: Drei Gestalten, die je eine abstützen. Stonszewska stellt sich vor die vordersten beiden und hält einem Mann den Lauf an den Kopf. „Keine Bewegung!“ sagt Stonszewska auf Polnisch. Philipp erstarrt. Hinter ihm ist Marta, die einen weiteren geschwächten Mann abstützt, den sie so eben von den Ketten runtergenommen haben, stehengeblieben. Auf Polnisch antwortet Marta: „Lassen Sie uns durch, wir haben gerade polnische Gefangene befreit!“ „Bitte was?“ schnappt einer der Partisanen und drückt ihr sein Gewehr in die Seite. „Wir sind Alliierte, wir gehören zu ‚Schimäre‘!“ versucht Marta zu erklären, die als einzige des Trupps wirklich Polnisch kann. „Wir haben aus dem Zug einige Gefangene der Gepos befreit! Verdammt, jetzt helfen Sie uns!“ „Still!“ befiehlt Stonszewska und meint dann in brüchigem Deutsch zu Philipp: „Papiere?“ „Linke Mantelinnentasche.“ Stonszewska greift in die Tasche, holt die Papiere raus und leuchtet mit seiner eigenen Taschenlampe kurz drauf. Es sind die echten Papiere Philipps. Die, die ihn als Kapitän zur See von „Schimäre“ ausweisen. „Ok, vorläufig helfen wir Ihnen.“ kauderwelscht Stonszewska und bedeutet seinen Leuten dann mit einem Pfiff, die beiden Wagen auf dem Bahndamm zu überprüfen. Zu Marta meint er: „Wie viele Gefangene?“ „So etwa 15, nachdem die Gepos noch welche umgebracht haben. Zwei Gepos haben wir gefangengenommen.“ antwortet Marta auf Polnisch. „Alles klar. Ihr habt’s gehört!“ Und dann geht Stonszewska zurück zu Philipp: „Sie folgen mir.“ Philipp begreift: Nur dieser Mann kennt sich so gut aus, daß man schnell verschwinden kann. Denn schon bald dürfte es hier von Kaiserlichen nur so wimmeln... „Der, der in das Meer hinausschreitet und meint, er würde nicht naß werden, wird eines Besseren belehrt werden.“ Arabisches Sprichwort Das Wetter ist zum ersten Mal seit längerem wieder richtig gut und klar gewesen. Eine Phase nur, haben die Meteorologen gesagt, aber die Phase haben die Franzosen und Kaiserlichen genutzt zu ihrer bislang größten Angriffswelle gegen London, Southend, Oxford, Cambridge und Birmingham. Krammer läßt sich stets mit den neuesten Meldungen über den Fortgang des erbitterten Luftkrieges versorgen, der seit über einem Monat über dem Kanal, Süd-und Mittelengland tobt. Er und seine Männer sind seit vorgestern vom britischen Kriegsministerium bei Rayleigh untergebracht worden – unweit eines Feldflugplatzes, der auch bei jeder Angriffswelle bombardiert wird. So auch dieses Mal. Seit 22 Uhr hockt Krammer mit seinem Kompaniechef Klekamp und einem Teil seiner Leute in einem der beiden Luftschutzkeller. Gegen 23 Uhr ist dann noch sein Cheffunker eingetroffen, der eine wichtige Botschaft gebracht hat: „Fleure hilft; RAF hält eine Halifax bereit. RW.“ Der Cheffunker hat sich gewundert und auch Klekamp hat sich gewundert, aber Krammer hat es Klekamp erklärt: „Fabian, ich hab einen Mitarbeiter des Secret Service um Hilfe gebeten. Und das ist das Resultat. Die Fleure-Division wird uns bei der Befreiung des Generals helfen und die Royal Air Force hält für uns eine Halifax bereit, damit wir einen kleinen Trupp per Fallschirm auf dem Kontinent bereitstellen können.“ Selbst Klekamp ist klar gewesen, was das für ein Entgegenkommen ist. Von den schweren Bombern Handley Page Halifax hat die RAF derzeit nur knapp 30 Stück – und hat diese im allgemeinen für Luftangriffe gegen Cherbourg, Le Havre, Calais, Ostende und Antwerpen benutzt. Man muß ja irgendwie Flagge zeigen. Seitdem – jetzt ist es knapp vor 0 Uhr 30 – arbeiten Krammer und Klekamp Möglichkeiten durch, was man jetzt tun kann. Seit etwa viertel vor Zwölf hat der Luftangriff zumindest hier aufgehört. Wie es anderswo steht, weiß Krammer noch nicht, es sind keine weiteren Meldungen eingetrudelt. Klekamp und Krammer sitzen jetzt im Scheine einer Petroleumlampe an einem kleinen Tischchen in so ziemlich der hintersten Ecke des Luftschutzkellers; Klekamps blonde Haare sind total grau vom von der Decke gerieselten Staub. Beide suchen eine Landkarte Flanderns und der Picardie nach eventuellen Landeplätzen für den Kommandotrupp ab. Zehn Mann hat man für den Job bereits ausgewählt. Das gesamte Spezialbataillon ins Feindgebiet zu verlegen, ohne allzu sehr aufzufallen, wie man es einmal gewagt hat, wird leider nicht möglich sein. Dieses eine Mal, das Krammer in seiner Kühnheit immer wieder durch den Kopf geht, war nur deshalb möglich gewesen, weil alle Mann als Touristen und Geschäftsleute verkleidet über neutrales Territorium einreisen konnten. Seitdem hat sich einiges geändert: Neutrales Territorium gibt es in Europa nicht mehr. Jeder Staat ist in den Krieg verwickelt, sei es als noch als Ganzes, als Exilregierung oder als bereits besetztes Gebiet. Also bleibt die kleine Lösung: 10 Mann plus einen Kommandeur per Fallschirm. „Was ist hiermit?“ fragt Klekamp und markt mit seinem Bleistift die Region um Lestrem. Krammer schüttelt den Kopf. „Nein, dort haben die Franzosen einen Luftwaffenstützpunkt und entsprechend starke Luftverteidigung.“ „Und Hucqueliers?“ „Schon wieder zu abgelegen. Der Trupp muß schnell untertauchen und abhauen können.“ „Mensch, Christoph, wir haben bald jede Möglichkeit durch.“ „Ja, ja, ich weiß...“ In der Ferne hört man ein donnerndes Grollen und jeder weiß, daß das die Bomben sind, die auf London und Southend fallen. „Was ist mit Langemark. Abgelegen genug, aber Ypern ist in der Nähe, dort kann man sich Transportmöglichkeiten verschaffen-...“ In dem Moment hört man das knarrende Rums der schweren Eisentür zum Luftschutzkeller. Krammers Cheffunker, der wie stets selbst in gefährdeter Lage draußen bleibt, nur um guten Empfang zu haben, kommt rein, sichtlich aufgeregt. „Oberstleutnant, man faßt es nicht!“ „Was denn?“ Krammer ist ihm, sich an einigen vorbeidrängend, entgegengegangen. Der Mann schüttelt den Kopf. „London! Es fällt in Schutt und Asche! Der Angriff dauert immer noch an, aber zum ersten Mal ist jegliche Organisation zusammengebrochen!“ „Wie denn das?“ Mit einer Handbewegung stoppt Krammer das Gemurmel in der Truppe; da alle dicht an dicht in dem finsteren Keller stehen, wird jede Nachricht vom einen zum andern weitergegeben. „Ein Feuersturm, Oberstleutnant! Ein Feuersturm! So jedenfalls hieß es in den aufgeregten Funksprüchen. Es sind wahre Hilferufe!“ Kurzentschlossen dreht sich Krammer um, räuspert sich und brüllt dann: „Ist hier irgendjemand von euch mit Feuerwehrerfahrung, egal wie gering?“ Alle sehen sich an. Schließlich heben zwei, drei Mann die Hände und von hinten hört man ein „Ja, hier“. „Ok, ihr schnappt euch noch ein paar Leutchen und bildet dann drei Trupps.“ „Und dann?“ fragt einer. „Dann fahrt ihr nach London und helft den dortigen Rettungsmannschaften.“ Alle zögern. Krammer stemmt die Fäuste in die Seiten: „Jetzt aber los, das war ein Befehl!“ Sofort rühren sich alle, die Feuerwehrerfahrenen winken ein paar Kumpels herbei und schon hat man genügend Leute zusammen. Krammer meint über die Schulter zu seinem Cheffunker: „Geben Sie nach London durch, daß wir sie unterstützen. Und teilen Sie bitte mit, daß wir die Halifax noch heute Nacht einsetzen.“ „Noch heute Nacht?“ mischt sich Klekamp ein. „Ja.“ erwidert Krammer. „Der Feind ist beschäftigt durch den Luftangriff auf London. Das müssen wir ausnutzen.“ Er winkt den zehn Mann, die den Trupp bilden und weiter hinten bei der Karte stehen zu. „Kommt!“ „Wer kommandiert?“ will Klekamp wissen. „Und wo landet der Trupp denn nu?“ „Ich hab mich für Langemark entschieden.“ sagt Krammer bestimmt. „Und ich werde selbst kommandieren. Du vertrittst mich hier, Fabian.“ „Wie Du meinst. Hab nichts dagegen.“ Klekamp will sich gerade wieder umwenden, dann fällt ihm was ein. „Ach, Christoph? Kann ich in der Zeit Dein Gras haben?“ Ein breites Grinsen umspielt Fabian Klekamps Mundwinkel. „Nein!“ faucht Krammer und ballt spielerisch drohend eine Faust. „Das ist ein Befehl!“ „Jawohl.“ entgegnet Klekamp enttäuscht. Nach diesem verbalen Schlagabtausch gehen Krammer und sein 10-Mann-Trupp (die zur Feuerwehr abgestellten Männer sind bereits weg) nach draußen. Sie schließen hinter sich die schwere Eisentür, gehen einen kurzen Gang entlang und dann die paar Stufen hoch, die nach draußen führen. Man hat den Luftschutzkeller auf einem unbebauten Grundstück direkt zwischen zwei alten Backsteingebäuden, die mehrere Geschosse haben, gebaut. Jedes Mal, wenn Krammer wieder aus dem Keller herauskommt, schaut er zu diesen hoch. Das rechte wurde schon vor drei Nächten getroffen und ist nur noch eine ausgebrannte Ruine mit Dachgerippe, das linke ist auch dieses Mal davongekommen. Als sie auf die Straße treten, liegt Brandgeruch in der Luft. Offenbar ist irgendwo einige Straßen weiter ein Haus getroffen worden. Rufe sind zu hören. „Hoffentlich haben die unser Flugzeug nicht zerstört.“ bemerkt einer der Soldaten. „Wo ist es denn stationiert, Oberstleutnant?“ „Bei Rochford, Unteroffizier.“ erwidert Krammer. „Kommt, wir nehmen einen der Laster.“ Sie gehen die Straße hinauf, zum Hauptparkplatz des Fuhrparks, den Krammers Truppe angemietet hat. Darunter befinden sich fünf Laster. Sie stehen direkt neben dem Postgebäude des Ortes, wo Krammer seinen Cheffunker mit seinen drei Helfern und dem Gerät einquartiert hat. Als sie den Parkplatz erreichen, kommt gerade der Cheffunker aus dem Haus. „Oberstleutnant, die Maschine steht bereit. Wir haben Glück: Rochford wurde heute nicht angegriffen. Nur der Nachbarflugplatz hier bei uns. Warum, wissen die Engländer nicht.“ „Naja, egal, Hauptsache das Flugzeug ist startklar, wenn wir da sind.“ „Ist gut. Ich werde Sie ankündigen.“ Der Cheffunker geht wieder ins Postgebäude. Als Krammer sich umdreht, sieht er seinen Trupp am Randes Parkplatzes stehen und über ein Feld hinwegblicken, das in etwa 500 m Entfernung an eine Waldung stößt. Und dahinter sieht man in einiger Entfernung ein helles, flackerndes Leuchten. Für einen Moment tritt Krammer neben die anderen und starrt ebenfalls fasziniert auf das schaurige Glühen. „London.“ flüstert einer von ihnen. „Mein Gott.“ fügt sein Kamerad leise hinzu. In der Tat: Daß man die Auswirkungen eines Luftangriffes so weit sehen kann, hätten sie nicht gedacht. In London muß wirklich die Hölle los sein – im wahrsten Sinn des Wortes. Krammer räuspert sich. „Männer, wir müssen.“ „Ach so...“ „Ja, richtig...“ „Zu Befehl...“ Alle reißen sich von dem schauderhaften Anblick los und gehen rüber zu einem der Lastwagen. Alle freilich haben beim Einsteigen und als der Lastwagen schließlich losfährt ein mulmiges Gefühl. Es ist fast, als könne man spüren, wie viele Menschen in diesem Moment in London unerträgliches Leid erfahren. Und unfaßbares Leid (die Zahl der Todesopfer in dieser Nacht wurde erst nach dem Krieg von der britischen Regierung freigegeben: 15600 Menschen). Auch Krammer denkt darüber nach, während er vom Beifahrersitz aus nach draußen starrt, in die dunkle Landschaft, durch sie nur mit abgeblendeten Scheinwerfern fahren. Früher, in seiner Jugend, vor nunmehr über 10 Jahren, ist er noch vom Militärischen richtig begeistert gewesen. Deswegen ist er erst in der preußischen Armee, wenig später in der frisch gegründeten Truppe „Schimäre“ gelandet. Aber die letzten fünf Jahre hat er in Ostasien verbracht, Kampfsportarten und die asiatische Philosophie erlernt. Diese hat ihm einen ganz anderen Blickpunkt verschafft, darauf wie das Weltgeschehen abläuft und wie man es zu beurteilen hat. Krammer ist in dieser Zeit ruhiger und friedlicher geworden, neigt weniger als früher zu einer militärischen Lösung. Allerdings war er auch etwas abgeschnitten von der Welt. Fünf Jahre war Krammer ein guter Schüler gewesen, was ihm sein japanischer Meister dadurch bezeugte, daß er ihm einen Katana schenkte. Den Krammer auch jetzt wieder in einer umlegbaren, hübsch mit japanischen Schriftzeichen verzierten Scheide mit sich trägt. Die Schriftzeichen bedeuten: „Für Ehre und Gerechtigkeit.“ Sie erinnern Krammer daran, was wichtiger ist in dieser Welt als viel Geld oder der nächste Vollrausch. Als Krammer zurück nach Europa fuhr – mit der Transsibirischen Eisenbahn - , erreichte ihn erst in Moskau die Nachricht, daß ein großer Krieg ausgebrochen sei. Aus Pflichtgefühl übernahm er im Februar wieder seinen Posten bei „Schimäre“. Das, was er seither bei Kampfeinsätzen in Norwegen, Köln und den Niederlanden gesehen hatte, hat ihn endgültig zur Frage gebracht: Warum tun sich die Menschen das gegenseitig an? Auch auf dieser Fahrt zum Flugplatz Rochford muß Krammer darüber nachsinnen. Die Brahmanen Indiens verstehen die Weltgeschichte als in Zyklen eingeteiltes Geschehen. Diese Maha-Yuga-Zyklen sind mehr als 4 Millionen Jahre lang und selber nochmal in Unterzyklen unterteilt. Der letzte Unterzyklus ist stets der Kali-Yuga, ein dunkles Zeitalter, in dem auf der Erde Tod, Zerstörung und Vernichtung Einzug halten. Zwar weiß Krammer jetzt nicht, wann wieder ein Kali-Yuga ansteht, aber der Gedanke, daß man nun mitten drin hängen könnte, kommt ihm in dieser Nacht nicht zum ersten Mal. Klekamp würde wahrscheinlich darüber den Kopf schütteln. Aber Klekamp, der bis zum Frühjahr in der preußischen Armee gedient hat, hat die furchtbaren Kämpfe rund um Königsberg mitgemacht, die sich Preußen und Schweden im letzten Kriegswinter geliefert haben. Auch Klekamp ist die Frage nach dem „Warum“ und dem „Wieso“ nicht fremd... „Oberstleutnant, wir sind da!“ Damit wird Krammer aus seinen Gedanken gerissen. Er hat tatsächlich im Gedanken versunken die ganze Fahrt vertrödelt. Der Fahrer hat sie bis nahe an die Startbahn gebracht. Auf dieser steht die riesige Maschine, über 20 m lang bei über 30 m Spannweite. Vier starke Motoren an den Flügeln laufen bereits warm. Krammer steigt aus, schultert sein Sturmgewehr und seinen Rucksack, den er aus dem Luftschutzkeller mitgebracht hat und in dem das Nötigste ist – falsche Papiere, Verbandszeug, eine Feldflasche, Munition usw. Hinten springen alle von der Ladefläche. „Ok, alles mal herhören!“ brüllt Krammer. Und dann erklärt er über den Lärm der Flugzeugmotoren hinweg: „Also, wir werden in Flandern bei Langemark landen. Danach werden wir uns erstmal bis in die Eifel durchschlagen, um Kontakt zu unserem Agentennetz zu erhalten. Dann sehen wir weiter. Wer nicht innerhalb einer Stunde zur Gruppe zurückfindet, schlägt sich wie üblich allein zur Eifel durch. Noch Frage?“ Alle schütteln den Kopf. „Ok, dann los.“ Er dreht sich um und rennt voraus, die andern ihm hinterher. Geduckt, sich gegen den Wind der Rotoren stemmend rennen sie zum Flugzeug und steigen über die Seitenluke ein. Minuten später hebt die Handley Page Halifax nur scheinbar schwerfällig in den dunklen, aber sternenklaren Nachthimmel ab. Und in der Ferne sieht man die Erde glühen und lodern – der Feuersturm, der London gerade verwüstet... Sie sind in Smolarze gelandet, einem kleinen dreckigen Kaff irgendwo nordwestlich von Tschenstochau. Auf einem Bauernhof hat Stonszewska sie untergebracht. Nur für die Nacht. Philipp hat beschlossen, wieder aufzubrechen, sobald das Tageslicht und damit das Ende der Ausgangssperre das wieder möglich machen, ohne aufzufallen. Im Gästehaus des mit Stonszewska befreundeten Bauern haben sie sich eingerichtet. Nachdem er erstmal geduscht hat, sitzt Philipp jetzt in der kleinen Küche am Tisch und dreht sich eine Zigarette. Als er sie sich anzünden will, ist sein Feuerzeug leer. „Verdammt...“ „Hier.“ Tibori ist reingekommen und gibt ihm Feuer, holt sich danach ein Glas Wasser. „Tina ist unter der Dusche und Marta wartet, daß sie auch drunter kann.“ meldet Tibori. „Gut. Danach sollen alle sich noch was ausruhen. Wie geht’s Krakowsky?“ „Schlecht. Fraker ist bei ihm. Er meint, es dürfte bald zu Ende gehen.“ „Verdammt. Wenn das so weitergeht, überleben wir diese Scheiße nicht.“ „Ja. Haben Sie schon von der Lage an der Front gehört?“ „Ja, Stonszewska hat’s mir erzählt. Aber Karo wird es schon hinkriegen. Die Frau hatte einen guten Lehrer und ist ohnehin ein Naturtalent.“ Gnüßlich atmet Philipp den blauen Dunst aus. Tibori setzt sich ihm gegenüber an den kleinen Küchentisch. „Kapitän, haben wir überhaupt eine Chance, Reiss zu finden?“ Stirnrunzelnd sieht Philipp Tibori an und zieht dabei nochmal an der Zigarette. Dann zuckt er die Schultern. „Vielleicht eine kleine.“ „Und die wäre?“ „Naja, mein Gefühl sagt mir-...“ Philipp wird unterbrochen, als Fraker nach ihm ruft. „Kapitän, es geht zu Ende!“ Philipp springt auf, rennt über die kurze Diele ins Schlafzimmer, wo sie Krakowsky auf das Bett gelegt und eben erst seine Wunde notdürftig behandelt haben. Aber der Blutverlust war wohl zu hoch. Bleich und zitternd liegt Krakowsky mit nacktem Oberkörper, an der linken Schulter einen Verband tragend, auf dem Bett. Fraker steht daneben. „Ich hab versucht, ihm Wasser zu geben, aber er weist es zurück.“ „Lassen Sie mich mal!“ Mit einer wedelnden Handbewegung scheucht Philipp Fraker beiseite und setzt sich auf die Bettkante. „Krakowsky, verdammt, Sie müssen was trinken.“ „Nein.“ röchelt Krakowsky. „Verdammt, Oberfeldwebel, das ist ein Befehl!“ Müde schüttelt Krakowsky den Kopf. „Nein. Es ist vorbei... Kapitän, Sie...wissen das...“ Mühsam schluckt Krakowsky, er atmet schwer ein und aus. „Es geht zu Ende. Ich spüre es...“ „Reden Sie nicht so einen Quatsch, Mann!“ faucht Philipp. Inzwischen stehen auch die andern in der Tür. Tina hat sich einen Bademantel aus dem Kleiderschrank im Bad geholt und umgelegt. „Kapitan...nicht so traurig... Ich werde endlich wirklich frei sein....“ „Krakowsky, Mensch, die Truppe braucht Sie!“ „Nein...Sagen Sie dem General, es war eine Ehre mit ihm in den Kampf zu ziehen...“ „Ich werd es tun. Wir werden an Sie denken, alter Haudegen.“ Tina tritt näher ans Bett. „Oberfeldwebel, Sie wollen doch etwa nicht...?“ „Doch, schöne Frau....“ würgt Krakowsky mühsam hervor und meint dann noch zu Philipp: „Immerhin werde ich Ihre Ex-Frau wiedersehen.... das hat auch was...“ „Ach, Krakowsky, Sie alter Halunke! Ich hab immer gewußt, daß Sie scharf auf sie waren!“ meint Philipp lächelnd. „Bestellen Sie ihr Grüße, ja? Auf der andern Seite?“ „Mach ich, Kapitän...!“ Ein kurzer Hustenanfall schüttelt Krakowsky, mehrmals muß er schlucken, dann atmet er noch ein paar Mal mühsam ein und aus. „Krakowsky?“ fragt Fraker. Vorsichtig prüft Philipp am Hals den Puls von Krakowsky. Nichts. Mit einer sanften Handbewegung schließt Philipp Krakowskys Augen. Dann steht er auf, Fraker bekreuzigt sich. Tanja, die in der Tür gestanden hat, senkt den Kopf und wendet sich ab. „Fraker?“ „Ja, Kapitän?“ „Würden Sie bei Stonszewska nachfragen, ob sich irgendwie eine Bestattung organisieren ließe?“ „Sicher.“ Fraker nickt nur. Und verläßt dann den Raum, um Stonszewska zu benachrichtigen. Philipp tritt an den andern vorbei und geht wieder in die Küche, gefolgt von Tibori, der in der Diele gestanden hat. „Kapitän, ich will nicht taktlos erscheinen, aber Sie wollten mir eben noch sagen, was für eine Chance Ihr Instinkt wittert.“ „Petra Müller.“ sagt Philipp nur kurz angebunden und läßt sich dann wieder auf den Stuhl fallen, auf dem er eben auch schon saß. Hauptfeldwebel Sven Ellermann liegt mit einem Zug vom Spezialbataillon 1 quasi mitten in der Wildnis auf der Lauer. Irgendwo zwischen Glinka und Tiskovo. Zwischen Farnen und anderem Unterholzbewuchs, mit Farbe im Gesicht und vom russischen Herbstregen durchnäßt, der eine Art Dauergeräusch aus Tropfen und Plätschern im Wald verursacht. Hier ist der Wald etwas aufgelockert und Ellermann und die andern beobachten einen Feldweg, der zwischen dem Wald und einem bereits umgepflügten Feld, das zu einem nahen kleinen Bauernhof gehört, verläuft. Auf dem Feld liegt ein ausgebrannter Aufklärungspanzer vom Typ II – er ist in der Nacht auf eine Mine gelaufen. Das ganze hatte die erwünschte Wirkung: Nämlich die kaiserlichen Kolonnen auf den Feldweg zu zwingen. Jetzt, im düsteren Morgengrauen, beobachtet Ellermanns Trupp wie in langer Reihe Panzer der Typen III und IV vorüberrollen. Hin und wieder knattert auch ein Kradschütze vorbei oder marschieren ein paar Infanteristen mit. Oft sitzen letztere auch auf den Wannen der Panzer drauf. Aber diese Kampftruppen sind nicht das eigentliche Ziel. Ellermanns Befehl lautet: „Warten auf Nachschubkolonnen und diese ausschalten. Die feindlichen Panzer müssen in Spritnot geraten.“ Mit diesem Auftrag wurden am Vorabend die beiden Kompanien des Spezialbataillons 1 losgeschickt, aufgeteilt in mehrere kleine Trupps. Ein Trupp von 15 Mann wurde sogar mit dem Fallschirm südlich Glinka hinter den feindlichen Linien abgesetzt, im Schutze der Nacht und eskortiert von drei Jägern. Bohnsack ist seit dem Verlust der Maschine, die den Trupp von Kipshoven abgesetzt hat, vorsichtig geworden. Neben Ellermann liegt der Obergefreite Sax im Farnkraut und beobachtet mit dem Feldstecher die vorüberziehenden feindlichen Truppen. „Hauptfeldwebel, wann können wir endlich?“ fragt Sax leise. „Immer mit der Ruhe, Obergefreiter.“ flüstert Ellermann zurück. „Sagen Sie einfach nur Bescheid, wenn Transporter mit Nachschub vorüberfahren. Dann geht’s los.“ „Ihr Wort in Gottes Ohr.“ Wie alle von der Truppe haßt Sax das untätige Herumliegen. Vor allem wenn man das schon die ganze Nacht macht. Mit der Zeit kriecht die Kälte in die Glieder. Und man wird unaufmerksam. Das man sich immer wieder zur Konzentration zwingen muß, strapaziert auf die Dauer die Nerven. Irgendwann fällt dem Körper ein, daß er mit einer liegenden Position normalerweise den Schlaf verbindet. Und dann kommt die Müdigkeit. Und der Sekundenschlaf. Dann muß man sich auch noch mit aller Kraft wach halten. Und dann knurrt irgendwann auch der Magen – schließlich fordert der Körper sein Recht auf Energienachschub! Nach weiteren zehn Minuten meldet Sax auf einmal: „Hauptfeldwebel, sehe Laster und Tankwagen!“ „Ist gut.“ Ellermann hebt kurz den Kopf, sieht die neue Kolonne. „Ok, aber noch warten wir was, Sax.“ „Wieso?“ „Ich will nicht, daß die Panzer sofort alles mitkriegen, umdrehen und uns platt machen.“ „Jawohl, Hauptfeldwebel.“ Noch ein paar Minuten lang beobachten sie Kolonnen. Sax stellt fest, daß immer wieder Kradschützen und Infanteristen auf Fahrrädern neben den Tankwagen und den Lastern herfahren. Quasi als Eskorte. Mit Handzeichen bedeutet Ellermann einigen seiner Männer, näher ran zu kriechen, um möglichst gut zielen zu können, wenn es los geht. Noch einen Moment! Dann hebt er den Arm und gibt ein weiteres Handzeichen. Fünf Meter weiter rechts drückt einer seiner Leute einen Hebel in einen Kasten hinunter. Eine heftige Detonation reißt vorne die Straße auf und läßt einen Baum quer über diese fallen, genau in dem Moment, wo einer der Tanklaster die Stelle passiert. Der Laster wird in die Luft gerissen, fällt in einer Rauchwolke zu Boden und explodiert dann in einem orangenen Feuerball. Gleichzeitig springen Ellermanns Männer auf. Ellermann und die hintere Gruppe haben ihre Sturmgewehre auf Dauerfeuer gestellt und geben damit der vorderen Gruppe, die Handgranaten wirft, Feuerschutz. Die angegriffenen kaiserlichen Truppen haben keine Chance. Einige der Kradschützen und Radfahrsoldaten haben sogar noch reagieren und zur Waffe greifen können – da sinken sie aber auch schon im Kugelhagel nieder. Nur weniger retten sich in den Straßengraben, da detonieren auch schon die Handgranaten. Neben oder gar unter den Lastern, die in grellen Feuerbällen explodieren. Einige Soldaten und ein Kübelwagen, die auf das Feld flüchten wollen, geraten dort auf die Minen, werden von diesen zerrissen. Zwei nachfolgende Laster versuchen an den brennenden Wracks vorbeizumanövrieren. Eine weitere Handgranate der „Schimäre“Kämpfer liegt zu kurz, aber nun feuern zwei „Schimäre“-Kämpfer mit ihren Sturmgewehren auf die Tanks. Sofort explodieren diese und einer der brennenden Laster rast in eines der bereits liegengebliebenen Wracks, der andere in den Straßengraben, aus dem ein Schrei ertönt, als ein dorthin geflüchteter Soldat zerquetscht wird. Ein anderer Kaiserlicher wirft aus der Deckung im Straßengraben eine Handgranate in Richtung der „Schimäre“-Kämpfer, doch das Ei krepiert zu weit ab. Pfeifend und kreischend herrschen die Flammen auf dem Trümmerfeld, das den Feldweg bedeckt. Insgesamt hat Ellermanns Trupp 8 Tanklaster und einen normalen Laster erwischt. Einer der in Deckung gesprungenen Kaiserlichen jagt jetzt eine Leuchtkugel hoch, um Hilfe anzufordern. Mit einer zackigen Handbewegung bedeutet Ellermann seinen Leuten, den Rückzug in den Wald anzutreten. Geduckt huschen sie davon und als endlich ein kaiserlicher Kradschützentrupp eintrudelt, sind die „Schimäre“-Kämpfer weg. Zehn Minuten später. Hauptmann Steinberger studiert gerade, im Turm seines Befehlspanzers vom Typ III sitzend, eine Landkarte der Gegend. Man fährt gerade durch das in der Nacht von „Schimäre“ nur hinhaltend verteidigte Tiskovo. Um Uza-Fluß, einige Kilometer weiter nordöstlich, wartet bereits eine der vordersten Angriffsspitzen. Durch die heftigen Regenfälle seit Herbstbeginn ist der Fluß angeschwollen, „Schimäre“-Kämpfer haben alle Brücken gesprengt und Furten vermint. Sobald Steinberger die vorderste Spitze erreicht hat, will er entscheiden wie es weitergeht. Kleine oder große Lösung. Safonovo oder Jakovlevo. Der Funker des Führungspanzers meldet sich über sein Kehlkopfmikro. „Hauptmann, gerade ist von unserer Nachhut die Meldung reingekommen, daß wieder ein Treibstofftransport angegriffen und vernichtet wurde.“ „Scheiße!“ flucht Steinberger und zerknüllt vor Wut die Karte. Er hatte schon ungute Vorahnungen gehabt, als das Wetter nicht so lange gut geblieben ist, wie es die Meteorologen vom Oberkommando vorausgesagt hatten. Als nach nur kurzer Unterbrechung der russische Herbstregen wieder einsetzte. Allerdings hatte er sich damit getröstet, daß man trotz Schlamm und Näße, trotz durch die Wolken nur eingeschränkter Luftunterstützung den Durchbruch noch schaffen kann. Man hatte es schließlich auch bei den vorigen Feldzügen immer geschafft, den Durchbruch zu erzwingen: Im November 1787 in der Lausitz, im Juni 1788 wieder in der Lausitz, im August 1788 in Polen, im September auf dem Balkan und an der Weichsel (dabei leitete Steinberger ebenfalls die Angriffsspitze). Steinberger hatte nur bislang noch nie selber gegen „Schimäre“ antreten müssen. Seit Beginn der Offensive hat er die Erfahrung machen müssen, daß „Schimäre“ nicht die Polen oder die Preußen ist. So haben bei den Durchbruchskämpfen zwischen Glinka und Jelnja „Schimäre“Kämpfer gezielt versucht, seinen Befehlspanzer zu attackieren – die russischen Soldaten bei diesen Kämpfen unterließen dies. Die „Schimäre“-Kämpfer wissen also, woran sie Befehlspanzer erkennen können: Eine besonders große Antenne und statt einer Kanone haben diese Panzer nur ein MG, um im Turm mehr Platz für einen klappbaren Kartentisch und Funkausrüstung zu haben. Und auch in der Nacht begannen „Schimäre“ damit, vor Steinbergers Angriffsspitzen zu operieren, um seinen Vormarsch zu verzögern. Und seit zwei Stunden diese Attacken gegen seine Nachschublinien! „Ok, geben Sie Gas, Mann!“ herrscht er den Fahrer an. Er will sich mit seinen Bataillons-und Kompaniechefs beraten und Auskunft einholen, ob sich die „Schimäre“-Kämpfer bereits von den zentralen Frontabschnitten zwischen Jarcevo und Smolensk zurückziehen. Der Motor heult nochmal richtig auf und kurz ruckelt der Panzer, als der Fahrer die Gänge hochschaltet. Etwa eine halbe Stunde später hält der Befehlspanzer zusammen mit der ihm nachfolgenden Panzerkolonne neben einer weiteren Panzerkolonne. Zwei Kompaniechefs und ein Bataillonschef warten bereits, als Steinberger die Luke seines Turms öffnet und feststellen muß, daß es immer noch regnet. Er klettert erstmal vom Panzer herunter und beredet sich dann mit seinen Untergebenen. Sein Funker fragt derweil bei den übergeordneten Kommandos nach, wie es um die Gesamtlage bestellt ist. „Ok, meine Herren, wie stark ist der Widerstand noch?“ Der Bataillonskommandeur macht ein betrübtes Gesicht. „Herr Hauptmann, wir tanken hier gerade unsere Panzer auf – aber mit unseren letzten Vorräten. Wo bleibt der Nachschub? Wir können jeden Widerstand brechen, aber wir brauchen Sprit.“ „Ja, ja, ja, ja, Mann...ist ja gut. Das Problem ist, daß unsere Sprittransporte einer nach dem anderen überfallen werden. Wie weit reicht denn der Sprit von Ihnen noch?“ In dem Moment unterbricht der Funker des Befehlspanzers Steinberger: „Hauptmann! Es ist noch ein Sprittransport draufgegangen. Und an den andern Frontabschnitten leistet der Feind immer noch harten Widerstand. Nur die Russen bei Jelnja sind ruhiggestellt.“ Sichtlich sauer sieht Steinberger hoch zu dem Funker, der aus dem geöffneten Turmluk auf ihn herabblickt und blickt dann den Bataillonschef an. „Reicht der Sprit noch für einen kampfreichen Weg bis Safonovo?“ „Schlechterdings nein, Herr Hauptmann.“ „Wie steht es mit Jakovlevo?“ „Mindestens einmal müssen wir noch tanken.“ „Stimmt.“ Da kommt Steinberger eine Idee. Er dreht sich wieder zum Funker um. „Geben Sie an unsere Sprittransporte durch: Sie sollen eine unabhängige Route nehmen, nach eigenem Ermessen. Einige Aufklärungspanzer II sollen sie begleiten.“ „Und der Treffpunkt dann?“ „Der Dnjepr.“ „Alles klar.“ „Was nun?“ fragt der Bataillonskommandeur, der ebenfalls bereits gemerkt hat, daß nicht alles wie gedacht läuft. „Ja, wir werden die kleine Lösung wählen, wir machen den Kessel bei Jakovlevo dicht. Nachtanken werden wir am Dnjepr.“ „Gute Idee, das müßte gehen.“ bestätigt der Bataillonskommandeur. Und dreht sich um. „Also los Jungs, ab in die Panzer, es geht weiter!“ „Die erste Welt war Tokpela, der endlose Raum, aus dem Taiowa das Endliche schuf. Er setzte die Menschen an einen Ort, den man die Höhe nennt. Weil die Menschen böse geworden waren, wurde die erste Welt durch Feuer zerstört. Die zweite Welt wurde durch Eis zerstört. Die dritte Welt wurde durch Wasser zerstört. Unsere Welt ist die vierte Welt.“ Zusammenfassung einer alten Überlieferung der HopiIndianer Abgesehen davon, daß das Wetter wunderbar regnerisch ist und die Wolken tief hängen, was einen wunderbaren Schutz vor lästigen Fliegerangriffen bietet, hat der Morgen für Valkendorn mit nicht sonderlich vielen guten Nachrichten begonnen. Die Durchbruchsschlacht bei SpasLipki entwickelt sich immer ungünstiger. Zwischen 1. und 2. Regiment ist eine Lücke entstanden, als ersteres in der Nacht seine Stellung um zwei Kilometer zurückverlegen mußte, damit die Kaiserlichen nicht direkt mit ihrer Infanterie, die teilweise mit Lastwagen motorisiert wurde, ins Hinterland durchbrechen konnten. Das im Norden benachbarte polnische Bataillon wurde endgültig einfach vom feindlichen Ansturm weggefegt. Im Zentrum sieht es nach Valkendorns Meinung nicht viel besser aus. Die ganze Nacht über brandeten neue kaiserliche Sturmangriffe mit heftiger Artillerievorbereitung gegen die zentralen Stellungen des 2. und 3. „Schimäre“-Regiments und der Aufklärungsabteilung. Connys Funkaufklärung hat inzwischen herausbekommen, daß eine vierfache Übermacht hier gegen die Front anrennt, immer wieder Einbrüche erzielt und eigentlich längst hätte durchbrechen müssen. Das motorisierte Bataillon von Schoeps‘ Kavallerietruppe muß dauernd Feuerwehr spielen. Die restlichen, berittenen Verbände unter Schoeps Kommando sind nicht verfügbar – die braucht man um zwischen Jakovlevo und den feindlichen Panzerspitzen im Süden eine Art Widerstandsschleier zu legen, um mehr Zeit zu gewinnen. Ja, diese Panzertruppen des Feindes! Zwar sind erste Meldungen des Spezialbataillons 1 bereits recht erfolgversprechend, aber Valkendorn wäre es lieber, wenn bei der Störung des feindlichen Vormarsches auch die Russen von Jelnja aus helfen würden. Das 4. „Schimäre“-Regiment hat bislang mehr Ärger damit, Frontalangriffe kaiserlicher Infanterie abzuwehren, bei gleichzeitiger Bildung eines Flankenschutzes gegen den Panzerdurchbruch. Ja, russische Hilfe wäre da geradezu traumhaft. Und so telephoniert Valkendorn seit zwanzig Minuten mit den Russen. Er hat erst beim russischen VI. Korps angerufen, die aber haben ihn nur weiterverwiesen ans AOK 17 in Kirov, wo Valkendorn zehn Minuten lang mit General-polkovnik Serjenko debattierte, der ihn dann ans Oberkommando West-Front (als Front bezeichnen die Russen ihre Heeresgruppen; der West-Front unterstehen neben drei russischen Armeen auch eine polnische Armee und „Schimäre“ als selbstständige Einheit) weiterverband. Nun telephoniert Valkendorn mit General Beresowskij. Wenigstens kann der Mann Englisch: „Was zum Teufel wollen Sie denn von mir, General Valkendorn?“ „Ein wenig Waffenhilfe, General.“ „Wie – Waffenhilfe?“ Beresowskij will sich blödstellen. Na toll. „Beresowskij, ich stehe hier in meinem Kartenraum und muß mitansehen, wie sich die feindlichen Panzer immer weiter an meinen Standort heranarbeiten.“ „Na und? Das ist Ihr Problem!“ „Moment mal! Das ist genauso Ihr Problem!“ „Und wie soll ich Ihnen da helfen?“ „Sie müssen doch irgendwelche Reserven haben, die Sie uns schicken können?“ „Wie kommen Sie auf die Idee? Kurz nach dem Angriff an Ihrem Frontabschnitt haben die Kaiserlichen und die Schweden mit einer Offensive gegen Estland und Landungen auf Dagö und Ösel begonnen. Stawka mußte alle unsere Reserven nach Norden schicken. Die Zarin will den endgültigen Verlust Sankt Peterburgs auf jeden Fall vermeiden. Ich hab nichts.“ „Das ist nicht Ihr Ernst!“ schnappt Valkendorn. „Doch!“ faucht Beresowskij zurück. Daraufhin knallt Valkendorn einfach den Hörer in die Gabel, so heftig, daß die Stabsoffiziere im großen Speiseraum, in dem sie sich befinden, zusammenzucken. „Scheiß Russen!“ brummt Valkendorn verächtlich. „Wieso?“ meldet sich Karo hinter ihm zu Wort. Valkendorn dreht sich um und wirft dabei einen Blick zu der Uhr, die an der Wand hängt. Gerademal 10 Uhr morgens. „Die wollen uns nicht helfen!“ wettert er und teilt so die schlechte Nachricht seiner Vorgesetzten mit, die sich gerade die Uniform zuknöpft und noch etwas verschlafen dreinblickt. „Damit habe ich gerechnet.“ stellt sie trocken fest. „Sonst noch was neues?“ „Ja. Ein ziemlich aufgelöster Oberleutnant Pick wartet im Büro auf Sie.“ „Alles klar. Ich kümmere mich drum.“ Karo verläßt den ehemaligen Speisesaal wieder und geht zu ihrem Büro. Sie kann sich schon denken, weshalb Pick da ist. Als sie das Büro betritt, blickt der junge Mann direkt auf. „Ah, Morgen Frau General!“ „Pick, lassen Sie mich raten: Sie machen sich wieder Sorgen um Ihre Verlobte!“ „Ah, fürchterliche! Wo Mira doch in vorderster Linie mitkämpft! Ich hab seit Beginn der Offensive nichts mehr von ihr gehört...“ Karo schließt die Tür und legt die Hände beschwichtigend auf Picks Schultern. „Oberleutnant, machen Sie sich nicht zu viel Sorgen! Sie wird es schon überstehen. Sie wurde gut ausgebildet und sie ist ein kluges Mädchen. Sollte ich was hören, ich verspreche, ich verständige Sie sofort.“ „Danke.“ „Ich weiß doch, wie Sie sich fühlen. Auch meine Freundin ist mir mal wieder einige Kilometer zu weit von mir entfernt.“ meint Karo flüchtig lächelnd. „Machen Sie sich nicht verrückt, Pick.“ „Ok, wenn Sie meinen. Aber hätten Sie vielleicht einen Kaffee?“ „Sicher. Danke übrigens für Ihren Einsatz bei Ihren Vorgesetzten.“ Müde hebt Pick die Schultern. „Nur viel hab ich ja nicht erreicht...“ „Macht nichts....Na kommen Sie, wir organisieren Ihnen einen Kaffee und dann können Sie abreisen.“ „Abreisen, wieso denn abreisen?“ wundert sich Pick. „Ja, hat man Ihnen denn nicht gesagt, daß alle Verbindungsoffiziere gehen können, bevor die Show hier losgeht?“ „Doch.“ „Pick, Sie wollen doch wohl nicht...?“ „Doch ich will. Betrachten Sie mich als die direkte Unterstützung der Exildeutschen Armee. Und außerdem würde ich mich sonst so fühlen, als würde ich Mira im Stich lassen.“ Als sie die Bürotür erreichen, klopft ihm Karo anerkennend auf die Schulter. Und denkt sich: ‘Das ist wahre Liebe und wirkliche Loyalität. Findet man viel zu selten heutzutage.‘ Petra war noch nie in den Bergen. Um so beeindruckender ist, was sie jetzt sieht. Nachdem sie, Oschmann und Leikert am Vortag erst nach Vaduz in Liechtenstein gereist waren, denn dort mußte Oschmann noch auf eine wichtige Konferenz, während Petra sich ein paar Stunden Schlaf gönnen durfte (bewacht von Leikert, der Nervensäge), hatten sie schon früh morgens um 5 Uhr einen Zug nach Bludenz in Vorarlberg genommen. Oschmann wirkte total frisch, obwohl er schwerlich mehr als zwei, drei Stunden Schlaf gehabt haben kann. Im kleinen Bludenzer Bahnhof warteten bereits zwei normale Streifenpolizisten, die einen kleinen dunkelblauen Mietwagen (ein BMW) bewachten. „Das ist unser weiteres Reisemittel.“ erklärte Oschmann. Und damit fahren sie nun durch die Berge, Oschmann sitzt am Steuer. Petra hatte sicher schon bergige Gegenden gesehen, aber die Alpen hier übertreffen alles. Längst hat sie ihre Anspannung vergessen und mustert die Berge nur mit ehrfürchtigen Blicken. Die Straße, die eigentlich dringend mal wieder ein wenig ausgebessert werden müßte, verläuft auf einer Terrasse knapp oberhalb eines glitzernden klaren Flüßchens, das zahlreiche kleinere Stromschnellen aufweist. Rechts und links schwingen sich die Hänge der Berge hoch, auf denen einige unbefestigte Wanderwege entlangführen. Nadelbäume stehen in mehr oder weniger großen Gruppen auf den Hängen, dazwischen immer wieder einsame Hütten, um die herum grüne Weiden gruppiert sind. Ein paar gepflügte Felder kann man auch ausmachen. Am Straßenrand sind manchmal kleine Kapellen zu sehen. Einmal kommt ein junger Bauer mit seinem Schäferhund am Wegesrand vorbei und grüßt freundlich durch Heben der Hand. Kurz vor der nächsten größeren Häuseransammlung sieht man eine schon etwas ältere Bäuerin am Brunnen Wasser holen. In dem Dorf sind alle Häuser Fachwerkhäuser im typischen Alpenstil, man sieht ihnen an, daß sie gut in Schuß sind, obwohl sie schon etliche Jahre auf dem Buckel haben. Und über dieser ganzen – na, man kann schon sagen: Idylle, die einen den Krieg glatt vergessen läßt, thronen hoch oben die Felskuppen der Berge, schroffe Grate und steile Wände, deren Grau im krassen Gegensatz zum Grün der Nadelbäume und Almen steht. Die Glocke der kleinen Kirche im Dorf verkündet gerade, daß es 11 Uhr ist. Auf einigen Felsgipfeln liegt schon erster Schnee und einige etwas dunklere Wolken, zwischen denen dornenartig noch ein paar Sonnenstrahlen durchkommen, rasen über den Himmel. Immer wieder tropft es auf die Autoscheiben, wenn wieder ein Schauer runterkommt und irgendwo weiter weg grollt es. Als sie aus dem Dorf herausfahren, sieht Petra über einem Berggipfel sogar einen grellen, sich schlängelnden Blitz. Sein Abbild bleibt für Sekunden auf ihrer Netzhaut. Ein komischer Druck auf ihren Ohren verrät ihr, daß man in immer größere Höhenlagen kommt. Als Petra nach vorne blickt – sie sitzt auf dem Beifahrersitz und Leikert praktisch direkt hinter ihr, damit sie keinen Blödsinn macht – erkennt sie einen hochaufragenden Gipfel leicht rechts, an dem ein Teil der Felsen irgendwie unnatürlich wirkt. Und jetzt meldet sich ein dumpfes Gefühl in ihr, als wenn irgendetwas auf diesem Gipfel ist, irgendeine nicht näher bestimmbare Kraft oder Energie... Als sich der Bachlauf gabelt, passiert man die letzten Häuser und fährt über zwei kleine Brücken weiter. Die Straße schlängelt sich jetzt stärker um vorspringende Felswände und Geröllhalden herum. Schließlich rückt nach einer Biegung des rechten Hangs eine kleine Schutzhütte ins Blickfeld. Bei ihr hört die befestigte Straße auf und eine von Hand bediente Schranke versperrt den Weg. Als der Wagen die Schranke erreicht, hält Oschmann. Drei Geheimpolizisten stehen mit schußbereiten Karabinern neben der Schranke und zielen auf sie, aus der Schutzhütte kommen fünf weitere Geheimpolizisten mit MPis. Und dann noch einer, der um das Auto herumkommt. Jörg Oschmann kurbelt das Fahrerfenster runter. „Morgen, Standartenführer.“ begrüßt ihn der andere Geheimpolizist. „Bitte Ihre Papiere und der Grund Ihres Besuches in Schattenlagant.“ Petra reicht aus dem Handschuhfach Oschmann die Passierscheine und während der andere Gepo diese mustert, erklärt Oschmann: „Wir sind hier um bei der weiteren Arbeit mit dem Gefangenen Reiss zu helfen. Man erwartet uns bereits.“ „Scheint so weit alles in Ordnung zu sein.“ meint der Wachhabende und wirft noch einen Blick ins Auto. Mißtrauisch mustert er Petra. „Wer ist diese Frau?“ „Petra Müller. Sie ist mein Gast. Ich habe die Verantwortung für sie.“ „Alles klar.“ Der Wachhabende reicht Oschmann die Papiere zurück und winkt dann seinen Leuten zu, daß sie die Schranke öffnen sollen. „Sie können weiterfahren, Standartenführer. Willkommen in Schattenlagant.“ „Danke. Schönen Tag noch.“ Als die Schranke oben ist, gibt Oschmann Gas und sie fahren weiter über die nunmehr unbefestigte Schotterstraße. Die Fahrt geht um eine scharfe Kurve und dann steil bergauf, auf einem Weg, den jemand quasi in die Felswände gefräst hat, die hier zum Gipfel hin ansteigen. Petra riskiert nur einen einzigen Blick aus dem Beifahrerfenster nach unten, dann wendet sie den Blick schnell ab, denn es schwindelt ihr. Und dann biegt die Straße ab in eine Kerbe, die man in den Fels gesprengt haben muß. Rechts und links ragen riesige, gezackte Felsen steil auf. Und plötzlich ragen vor ihnen zwischen den Felsen riesige Betonwände 20 m in den Himmel, gestützt durch in sie versenkte Stahlpfeiler. „Sehen Sie es sich gut an, Fräulein Müller.“ meint Leikert von hinten. „Diese Wände sind 10 m dick.“ Nach weiteren 200 m endet die Straße genau vor dieser Betonwand – in deren Mitte ein riesiges zweiflügeliges Stahltor eingelassen ist, vor dem in zwei kleinen Sandsackstellungen mit Maschinengewehren und Maschinenpistolen ausgerüstete Gepos Wache schieben. Als der Wagen hält, richten sofort die beiden MGs auf den Wagen und vier Mann gehen direkt vor dem Tor mit gezogenen und schußbereiten Waffen in Stellung. Wieder kommt ein Gepo zur Fahrerseite des Wagens und bittet um die Papiere. Mit diesen verschwindet er dann wieder hinter den Sandsäcken, kommt einige Momente später wieder. „Bestätigt, Sie können rein, Standartenführer Oschmann.“ Die Gepos vor dem Tor treten zur Seite, während sich das Tor langsam und schwerfällig von irgendeiner Maschinerie gesteuert öffnet. Langsam fährt Oschmann durch die Toröffnung auf den Innenhof, dessen knirschender Boden komplett aus Fels ist. Rechts an der Mauer parken bereits zwei Laster, zwei kleinere Pkw und ein Motorrad; Oschmann parkt den Wagen direkt daneben. Die drei steigen aus und jetzt kann Petra die Umgebung in Augenschein nehmen. Die riesigen Mauern umgrenzen ein fast quadratisches Gelände von etwa 30 m Länge und vielleicht 25 m Breite. Auf den Mauern patrouillieren hinter einem kleinen Betonvorsprung Gepo-Wachen; zum Innenhof hin verläuft eine etwa Meterhohe Metallbrüstung die Mauern entlang, damit man nicht zu leicht hinunterfällt. An den Ecken ist der Mauergrat verbreitert, denn dort hat man leichte Flaks installiert. Zwei Metallstege führen quer über den Hof hinweg von einer Mauer zur gegenüberliegenden und auch dort patrouillieren Gepos. Ebenso stehen im Innenhof selber Wachen bereit. Das einzige Gebäude im Innenhof ist ein Flachdachgebäude mit Antennenmast an der Hinterwand, direkt gegenüber des Tores. Auch auf dem Dach patrouillieren Wachen. Schon jetzt ist offensichtlich, daß dies eines der best bewachten Geheimnisse des Reiches ist. Und eins fragt sich Petra vor allem: Wo sind die Aufenthaltsräume für die Wachen? Wo ist das eigentliche Gefängnis? Das kann doch nicht alles in das Flachdachgebäude passen. Das Flachdachgebäude ist ohnehin seltsam, mit seinem Antennenmast und ohne Fenster. Nur eine Metalltür führt ins Innere. Diese Tür geht jetzt auf und ein bulliger, gut und gerne zwei Meter großer Mann mit ganz kurz geschorenen Haaren kommt heraus. Er trägt die schwarze Gepo-Uniform mit den Abzeichen eines Standartenführers. „Morgen, Standartenführer Oschmann! Wie geht’s Ihnen?“ brüllt der Mann im Kasernenton quer über den Platz, als Oschmann, Leikert und Petra auf ihn zugehen. „Super geht’s mir, Gephardt. Nur mein Auge juckt manchmal noch.“ Vielsagend rückt Jörg seine Augenklappe zurecht. „Keine Sorge, Oschmann, unserem speziellen Gast geht es leider noch viel zu gut.“ „Was meinen Sie damit?“ „Kommen Sie mit. Ich erklärs Ihnen auf dem Weg nach unten.“ Gephardt geht wieder rein und die drei Neuankömmlinge folgen ihm. Freundlich meint Gephardt zu Petra: „Will Madame die Treppen oder lieber den Aufzug?“ Petra reißt ihren Blick von dem dunklen Quergang, der sich hier auftut, los und erwidert dann: „Lieber den Aufzug.“ Gephardt nickt und führt sie nach rechts zu einem kleinen Aufzug. Er drückt auf den untersten Knopf, als sich die Türen geschlossen haben. Petra spürt den Ruck, mit dem sich der Aufzug in Bewegung setzt. Gephardt berichtet inzwischen: „Reiss hat abgesehen von Flüchen und lockeren Sprüchen noch kein Wort von sich gegeben, obwohl wir es schon mit Stromschlägen und Zigaretten versucht haben. Nichts. Unser Arzt bereitet zur Zeit die chemische Behandlung vor.“ „Jetzt schon?“ Oschmann ist zerknirscht. „Ja. Anders sehen wir keine Chance mehr, rechtzeitig ein Geständnis aus ihm rauszukriegen. Nicht ohne den Prozeßtermin verschieben zu müssen. Außerdem legt Reiss zunehmend ein seltsames Verhalten an den Tag.“ „Inwiefern?“ hakt Leikert nach. „Er verweigert inzwischen die Nahrungsaufnahme, will nur Wasser. Wir versuchen, ihn dadurch zu strafen, daß wir die Wasserration halbiert haben. Aber er schläft auch nicht. Normalerweise gehört das zu unseren Foltermethoden, aber er macht es selber. Sitzt da und starrt einen Punkt an der Wand an. Wir werden nicht schlau daraus.“ Ein räuspern läßt Gephardt abbrechen. „Ja, Madame?“ meint er frostig zu Petra, die sich einmischt. „Nennen Sie mich nicht so abfällig Madame, Standartenführer.“ erwidert sie frostig und wendet sich dann Oschmann zu: „Er meditiert.“ „Bitte?“ schnappt Gephardt. „Sie hat recht.“ stellt Oschmann fest. „Das macht Reiss schon seit Jahren. Sie hat recht.“ „Und was heißt das für uns?“ will Leikert wissen. Oschmann zuckt die Schultern. „Das heißt für uns, daß wir aus ihm nur mit der chemischen Methode was rauskriegen. Er widersteht mit genügend Meditation fast jeder Folter.“ Mit fast wehleidigem Blick gen Himmel fügt er hinzu: „Und in dem Kerker da unten hat er nun wahrlich genügend Zeit für jede Menge Meditation. Was soll er auch sonst tun?“ Griesgrämig meint Gephardt: „Hätten wir ihm vielleicht eine Beschäftigungstherapie geben sollen?“ „Nein, dann wäre er inzwischen hier raus. Er darf nichts in die Finger kriegen, womit er einen Ausbruchsversuch unternehmen kann. Gar nichts!“ faucht Oschmann. „Es reicht schon, wenn seine Leute versuchen werden, ihn rauszuholen.“ Die Aufzugtür öffnet sich und sie betreten einen langen, in den Fels gehauenen Gang, der von ein paar nackten Glühbirnen erhellt wird. Seitlich gehen alle paar Meter Türen oder Seitengänge ab. Jetzt erkennt Petra, wo die Unterkunftsräume und die Hafträume sind – im Berg! Die haben nicht nur eine Straße in die Felswand gesprengt und gehauen und obendrauf diesen Betonklotz gesetzt – die haben auch noch den ganzen Berg mit Gängen und Räumen durchzogen! Gephardt meint zweifelnd zu Oschmann: „Sie glauben doch nicht wirklich, daß ‚Schimäre‘ versuchen wird, hier reinzuschneien? Ich meine: Wir metzeln die Typen doch gerade bei Jarcevo nieder, oder?“ Leikert lacht, was ihm von Gephardt einen ungehaltenen Blick einbringt, aber Oschmann grinst ebenfalls. „Gephardt, Sie haben ja keine Ahnung. In Russland vernichten wir nur die Kerntruppe. Aber ‚Schimäre‘ hat noch Kontingente im Osmanenreich, auf Sizilien, in England, ganz zu schweigen von dem Informantennetz, das Reiss aufgebaut hat. Und solange nur einer dieser Verrückten noch lebt, werden sie versuchen, Reiss hier rauszuholen – oder, wenn er schon tot ist, ihn zu rächen.“ Petra hört dem Gespräch schon gar nicht mehr zu. Wieder spürt sie es. Die Anwesenheit von irgendetwas Unbekannten. Sie wird versuchen müssen, Kontakt aufzunehmen. Was immer es ist, es könnte in der ganzen Angelegenheit von Bedeutung sein. Erst als Oschmann ihr auf die Schulter tippt, schreckt sie auf. „Was?“ „Standartenführer Gephardt wird Ihnen jetzt Ihr Quartier zeigen.“ Vormittags ist es in Madrid um diese Jahreszeit noch relativ erträglich. Es ist angenehm warm und ein kühlender Wind weht. Ein seit zwei Tagen bedeckter Himmel mildert die Sonneneinstrahlung. Jetzt, gegen Mittag, wird es aber trotz des Oktobers wieder drückender, wohl auch, weil einige dunkle Wolken und der charakteristische Geruch Regen ankündigen. Isabel sitzt in ihrer braungrauen Dienstuniform in einem kleinen Bistro am Rande des Plaza de España beim Mittagessen – nur ein paar gut gewürzte Happen, nichts schweres – und beobachtet die flanierenden Menschen in ihrer Mittagspause. Dabei sind auch einige spanische Soldaten, die mit ihren Frauen spazierengehen. Seit Spanien im Krieg ist, gehören Uniformen in Madrid quasi zum guten Ton. Isabel Schmitter ist freilich eine der wenigen Frauen in Uniform – und auf jedenfall die einzige mit Generalsabzeichen. Eingeweihte wissen, daß diese attraktive Frau mit den schönen langen, braunen Haaren die sogenannte Fleur-Division kommandiert, quasi das französische Gegenstück zu ‚Schimäre‘. Kennzeichen der Fleur-Division ist eine Blume in einem weißen Kreis und im Gegensatz zu Reiss setzt Isabel etwas mehr auf Diplomatie. Aber die Zielsetzungen sind die gleichen. Und auch die Fleur-Division hat schon ihre Waffengänge erlebt: Als die Verschwörer in Paris Ende August putschten, gelang es Fallschirmspringern der Division den französischen König nach Spanien zu evakuieren. Schon im Vorfeld des Staatsstreiches hatte Isabel es geschafft, ein paar französische Offiziere auf die Seite der Alliierten zu ziehen; mit Hilfe der Truppen dieser Offiziere gelang es im September die Truppen des „Freien Frankreich“ aufzubauen, die jetzt nördlich von Barcelona an der Front stehen – zusammen mit den Spaniern und einem portugiesischen und einem britischen Expeditionskorps. Die Fleur-Division ist, nachdem sie den ganzen September über in den östlichen Pyrenäen und dann vor den Toren Barcelonas gekämpft hat, aber den feindlichen Vormarsch erst auf spanischem Boden stoppen konnte, in Guadalajara in einem Ruhequartier untergebracht worden. Um engen Kontakt zum spanischen Oberkommando zu halten, das von der Fleur-Division am liebsten nichts halten will außer Abstand, ist Isabel öfter in Madrid, wo sie sich zusammen mit ihrem Verlobten eine kleine Mietwohnung in der Nähe des Archäologischen Nationalmuseums genommen hat. In diesem kleinen Bistro trifft sie sich jeden Mittag mit ihm und einem Verbindungsoffizier vom britischen Secret Service. Der junge Kellner, der als einziger ihr Vertrauen genießt und sie bedienen darf, erscheint. „Frau General, noch etwas?“ fragt er in gutem Englisch. „Ja, noch einen Cappuccino bitte.“ „Kommt sofort.“ Während der Kellner sich um die neue Bestellung kümmert, taucht endlich Isabels Verlobter auf und setzt sich an ihren Tisch. Auch Guido Demirci ist in Uniform, allerdings in der eines Yarbays (Oberstleutnant) der osmanischen Armee. Guido ist zwar halb Deutscher, hat aber gerade deswegen in der Tarnung eines Architekten für den türkischen Geheimdienst in Köln gearbeitet. Immer wieder hat er es dabei hingekriegt, seinen persönlichen Neigungen und Freundschaften entsprechend, die Fleur-Division oder „Schimäre“ zu unterstützen, was ihm Ende August sogar eine Fleischwunde durch eine Kugel eingebracht hat. Die ist zum Glück fast wieder ganz verheilt. Mit Isabel ist Guido schon eine halbe Ewigkeit zusammen, bald wollen die beiden heiraten. Die scharf geschnittenen, markanten Gesichtszüge betont Guido mit einem milimetergenau rasierten Bart, ganz kurz, fast wie aufgemalt. Selbst Stefan hat dafür schon Worte der Bewunderung gefunden. „Wo bleibt Williams?“ wundert sich Guido, nachdem er Isabel zur Begrüßung geküßt hat. „Ja, der ist verhindert. Er wurde zu Beratungen nach London gerufen. Soll wohl die Stimmungslage in Madrid skizzieren.“ „Meine Güte, der war doch gerade erst wieder zurück. Ob er ein Vielfliegerprogramm hat?“ „Weiß nicht. Aber der Anruf kam heute morgen, ganz plötzlich. Auch der britische Botschafter soll heute morgen ganz aufgekratzt zu sein.“ „Ja.“ bestätigt Guido. „Er ist mir heute morgen begegnet. Letzte Nacht dieser Luftangriff auf London hat die britische Regierung und die Königsfamilie gezwungen, aufs Land zu fliehen. Ich fürchte, die überlegen sich, aus dem Krieg auszusteigen....“ Guido verstummt, als der Kellner den Cappuccino bringt, obwohl er mit Isabel ohnehin nur auf Deutsch spricht, was der Kellner ja nicht versteht, und bestellt sich dann selber eine Cola. „Tja, dann wollen wir mal hoffen, daß sich die Briten dafür entscheiden, dabei zu bleiben.“ meint Isabel. „Ja, ohne die Briten sähe es übel aus...“ bestätigt Guido. Die Briten tragen nämlich zu den Kriegsanstrengungen der Alliierten immer mehr bei: Sie haben bislang jeden Versuch der französischen Putschisten, Nachschub in die französischen Kolonien zu bringen in drei größeren Konvoischlachten unterbrunden. Und sie binden wichtige Feindreserven an der Kanalküste. Würden die hunderte von Flugzeugen, die zur Zeit englische Städte bombardieren, dort nicht eingesetzt werden, würde es die spanischen Städte treffen. Gar nicht zu reden von den wichtigen britischen Materiallieferungen an die Verbündeten in Indien, ans Osmanische Reich und die anderen Verbündeten. Isabel reißt Guido wieder aus seinen Gedanken. „Hast Du mit Deiner Regierung telephoniert?“ „Ja. Mit Albay Demir vom Außenministerium hab ich gesprochen. Er konnte mir berichten, daß derzeit in der Nähe von Moskau ein türkisches Panzerregiment mit den neuen russischen Panzern trainiert. Für nächsten Monat ist ein gemeinsames Manöver mit russischen Panzertruppen vorgesehen.“ Verwundert schaut Isabel Guido an. Sie weiß, daß Türken und Russen nicht gerade die besten Freunde sind. Aber Guido zuckt nur die Achseln. „Nennt sich vertrauensbildende Maßnahmen unter Alliierten. Jedenfalls will Demir versuchen, daß Regiment für den Fronteinsatz bei Jarcevo freizukriegen. Allerdings soll ich mitkommen, um die Kontaktaufnahme zu ‚Schimäre‘ zu erleichtern.“ „Hatte dieser Demir nichtmal was mit Schoeps, vor kurzem erst?“ „Ja, eben, deswegen soll ich ja mit.“ Isabel läßt sich in ihrem Stuhl zurückfallen und verschränkt die Arme. „Was soll das, Guido? Dann bist Du ja wieder so weit weg!“ „Es geht nunmal nicht anders. Du kennst das doch, Schatz! Ich beeil mich auch. In einer Stunde flieg ich nach Konstantinopel, dann von dort weiter nach Moskau und dann wird das schon. Und in ner Woche bin ich wieder hier.“ Mit Hundeblick sieht er seine Verlobte an. Die gibt einen genervten Seufzer von sich. „Na schön. Aber dann bestell allen viele Grüße und sag Karo, ich werde Vaultier bereithalten für eventuelle Rettungsaktionen.“ „Oh, da wird sich Vaultier aber freuen.“ „Ja, ich muß nur noch die Spanier bequatschen, daß sie Vaultier für seine Fallschirmeinsätze endlich ein paar Transportflugzeuge überlassen.“ „Oh, ich bin ganz sicher, daß Du das schaffst.“ meint Guido lächelnd und ergreift zärtlich Isabels Hand, als sie diese über den Tisch hinweg ausstreckt. Der Kellner stellt die Cola für Guido ab und entfernt sich dann diskret. „Das, was wir die Vierte Welt nennen, wird bald enden, und die Fünfte wird beginnen. Denn alle überlieferten Zeichen werden bald eingetroffen sein.“ White Feather, Weiser der Hopi Jetzt regnet es wieder, wenn auch etwas zu spät. Der Regen löscht in London nur noch die Schwellbrände und in Windsor-Castle, wohin die britische Königsfamilie und die Regierung während des Luftangriffes geflüchtet sind, drückt er auf die Stimmung. Das haben auch Hauptmann Fabian Klekamp und einige seiner Soldaten, die in der Nacht während des Bombenangriffes der Londoner Feuerwehr zur Hand gegangen sind, zu spüren bekommen. Aber auch ihre eigene Stimmung ist gedrückt. Nachdem Krammer abgereist war, hatte Klekamp sich selbst nochmal fünf Mann geschnappt und sich nach London aufgemacht, um zu helfen. Die „Schimäre“-Kämpfer waren willkommene Helfer und haben in jener Nacht über 100 Menschen, die in einem Luftschutzkeller eingeschlossen waren, vor dem Tod gerettet. Aber sie mußten durch die Hölle gehen, haben grauenhafte Bilder gesehen, sieben von ihnen sind selber umgekommen. Der Empfang in Windsor-Castle an diesem frühen Nachmittag hat dann doch alle sehr verwundert. Als ein britischer Verbindungsoffizier die offizielle Einladung gebracht hat, hat Klekamp entschieden, daß er alleine hingeht. Seinen Männern wollte er Ruhe und Erholung gönnen. Nur drei der Freiheitskämpfer haben sich spontan entschlossen, doch noch mitzukommen. Wann sonst bekommt man schonmal Gelegenheit, Windsor-Castle zu sehen? Ein Teil des Schlosses ist allerdings abgesperrt, weil durch einen Bombentreffer von vor zwei Wochen immer noch einsturzgefährdet. In einem kurzen Empfang wurden Klekamp und den drei Soldaten dann von Regierungschef Pitt (der König gilt längst als nicht mehr zurechnungsfähig – und das ausgerechnet in diesen Zeiten!) vier Orden verliehen für die Hilfeleistung. Jetzt, wo die vier wieder durch den Schloßpark zurück zu dem Mietwagen gehen, den sie sich genommen haben, mutet ihnen die Szene immer mehr seltsam an. Man hat den Anwesenden Vertretern des Ober-und Unterhauses deutlich angesehen, welche Meinung sie über „Schimäre“ haben. Und die Tonlage von Pitt, als er erklärte: „Verleihen Sie die Orden in Ihrer Einheit nach eigenem Ermessen, Hauptmann Klekamp.“ „Die Tommys sind wirklich verrückt.“ meint einer der Männer jetzt, auf Deutsch, damit ein zufällige Mithörer ihn nicht versteht. „Ich weiß.“ bestätigt Klekamp. „Aber momentan brauchen wir die Tommys. Habt ihr deren Gesichter gesehen?“ „Ja, aschfahl. Offenbar haben die jetzt eine Schweineangst.“ stellt ein Unteroffizier fest und zündet sich eine Zigarette an. Sie erreichen den Wagen, sind freilich schon klitschnaß. Gerade will Klekamp die Fahrertür öffnen, als ihn jemand ruft, auf Englisch allerdings: „Klekamp! Warten Sie! Einen Moment noch!“ Es ist der Verbindungsoffizier von heute Mittag. Ein junger Spunt noch, mit einem richtigen Lausbubengesicht. Die Front hat der garantiert noch nie gesehen. „Was ist denn noch?“ fragt Klekamp etwas schroffer, als er eigentlich wollte. Der hohe Spunt zuckt zusammen und fragt dann fast schüchtern: „Können wir eigentlich noch was für ‚Schimäre‘ tun?“ „Nochmehr?“ lästert einer der „Schimäre“-Kämpfer auf Deutsch. „Wollen die uns umbringen?“ Alle lachen, auch Klekamp grinst und erwidert dann: „Erweisen sie sich als gute Alliierte und bleiben sie im Krieg.“ „Das ist alles?“ „Das ist alles.“ Der junge Spunt nickt und geht dann wieder zurück durch den Schloßpark. Als Klekamp und die andern im Auto sitzen, meint Klekamp bevor er den Wagen startet: „Unteroffizier Rolfs, seien Sie das nächste Mal vorsichtiger. Ihre Sticheleien vor Alliierten können uns nochmal den Kopf kosten.“ „Jawohl, Hauptmann.“ Da das kaiserliche Heer trotz seiner ständig durch neue Rekrutierungen zunehmenden Truppenstärke immer noch nicht genügend Truppen hat, um die Schweiz mit ihren unwegsamen Bergen flächendeckend zu besetzen, gibt es für den Widerstand noch ein paar Flecken, wo er die Kontrolle hat. Einer davon ist Kandersteg – die Einwohner unterstützen schon aus Patriotismus den Widerstand, der hier rund 300 Mann als Dauerbesatzung einquartiert hat. Und eine kleine Truppe von Agenten und Kämpfern von „Schimäre“ ist ebenfalls hier untergebracht. In einem kleinen Gasthof im Ort arbeitet Lisa Kirchner. Die leicht rundliche Frau Anfang 30 mit ihren langen braunen Haaren hat in Köln im Rothschild gearbeitet, das eine Schaltstelle des „Schimäre“-Agentennetzes war. Lisa bekleidete wichtige Funktionen in diesem Agentennetz. Jetzt leitet sie zusammen mit Nicole Elsing das „Schimäre“-Kontingent an Kämpfern und Agenten in der Schweiz. Der frühere Besitzer des Gasthofes war im September am Tag der kaiserlichen Invasion in der Schweiz in Frutingen auf dem Markt einkaufen gewesen. Er starb, als einige Ju-88-Maschinen Splitterbomben über Frutingen abwarfen. Seine Frau ist heilfroh gewesen, in Lisa Kirchner jemanden zu finden, der mit ihr zusammen den Gasthof weiterführt. Die beiden Hunde im Hause - zwei Deutsche Doggen, Kim und Kimba - haben sich auch schon mit Lisa angefreundet und die Widerstandskämpfer sind eine gute Kundschaft, die zugleich Schutz vor den Kaiserlichen versprechen. An zwei Tischen sitzen ein paar Schweizer Soldaten in Zivil; Lisa serviert ihnen Bier und geht dann zurück zur Bar. „Ich schreib’s euch wieder an, ok?“ „Alles klar!“ ruft einer der Soldaten rüber. Die Tür geht auf und Chris Loewisch kommt rein. Sie grüßt kurz die Soldaten und geht dann rüber zur Bar. „Hi Lischen. Orangensaft, bitte.“ „Aber immer.“ Lisa macht ihr ein Glas Orangensaft. „Hast Du eine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll?“ fragt Chris. „Nur eine wage. Wir wissen, daß Philipp unterwegs hierher ist, aber nicht, wann er kommt. Dabei fällt mir ein: Wie geht es Dominiks Fleischwunde?“ Chris zuckt die Schultern. „Wir haben eben den Verband wieder gewechselt, aber er weigert sich, zuzugeben, daß es schmerzt. Er macht einen auf harten Kerl. Aber solange die Wunde sich nicht entzündet, wird sie auch verheilen. Er besteht darauf, weiter an Einsätzen teilzunehmen.“ „Immerhin hat er auch die Reise hierher überstanden.“ „Ja, hat er.“ Chris nimmt einen Schluck von ihrem Orangensaft und läßt den Blick durch den in rustikaler Holzeinrichtung gehaltenen Raum gleiten. „Was machen wir eigentlich mit unserem Gast?“ fragt sie schließlich. „Mit Herrn Hinkelmann?“ Lisa zuckt die Achseln. „Keine Ahnung. Die Elsing hat ihn oben in einem der Zimmer einquartiert und eine Wache davorgestellt.“ Lisa nennt Nicole Elsing immer ‚die Elsing‘, um Verwechslungen mit einer anderen Agentin aus Köln, Nicole Oertel, zu verhindern, die ebenfalls hier arbeitet und für die Herrichtung der Felsenburg, die im Ernstfall als Versteck dient, zuständig ist. „Noch haben wir nicht entschieden, was wir mit Hinkelmann machen. Vielleicht machen wir ihm das Angebot, weiterhin mit uns zuzusammenzuarbeiten.“ „Wäre vielleicht nicht das schlechteste...“ überlegt Chris. „Heute abend werde ich mit der Elsing und Major Solt darüber beraten.“ meint Lisa und schenkt sich selber ein Glas Wasser ein. Chris krammt in der Tasche ihrer dünnen Jeans-Jacke nach ihren Zigaretten. „Sag mal Lischen, wo stecken die Elsing und Solt eigentlich?“ „Die sind vor drei Stunden nach Spiez aufgebrochen, wollen dort eine Brücke sprengen. Morgen werden sie zurück sein.“ erklärt Lisa. „Und vielleicht ist dann auch schon zumindest eine Nachricht von Philipp da.“ Die beste Methode, durchs Reich zu reisen, wenn man nicht gefunden werden will, ist, die Kontrollen zu umgehen. Und dazu gibt es nur wenige Möglichkeiten. Eine ist das Aufspringen auf Güterzüge. Diesen Weg hat der verbliebene Trupp um Philipp Kipshoven - also Marta Rambowicz, Tanja Esser, Hauptmann Fraker, Tina Reymann, Gefreiter Tibori und Christian Jacke - gewählt. Man hat auf dem Güterbahnhof von Tschenstochau einen Zug mit Endziel Nürnberg gefunden, der Kisten mit Dosenbohnen und Kartoffelsäcke geladen hat – reiche Kriegsbeute aus dem Polenfeldzug. Es ist schon früher Abend und der Zug hat an irgend einem kleinen Bahnhof gehalten, Philipp weiß nicht wo. Hinter einem Haufen Kartoffelsäcken und aufgestapelten Kisten haben er und die andern sich versteckt, denn der Zug wird kontrolliert. Im Wagen ist es dunkel und still. Draußen hört man Stimmen und wie die Türen der anderen Waggons geöffnet und wieder geschlossen werden. „Glaubst Du, die finden uns?“ zischt Jacke leise zu Philipp rüber. Der zuckt im Halbdunkel die Achseln. „Jetzt sei still...“ flüstert er. In dem Moment wird die Schiebetür des Güterwaggons aufgezogen und abendliches Dämmerlicht fällt herein. Ein Polizist klettert in den Wagen und hebt eine Taschenlampe, leuchtet einmal rum. Tinas Herz macht vor Schreck einen Satz, sie muß schlucken. Martas Hand faßt die schußbereite Pistole fester. „Hans, siehste was?“ fragt jemand von draußen. „Weiß nicht. Ich muß mich mal näher umsehen. Mein Gefühl sagt mir, hier stimmt was nicht.“ Der Polizist macht ein paar Schritte zwischen zwei Kistenreihen hindurch und läßt seinen Lampenstrahl über die Kartoffelsäcke gleiten. Hinter ihm klettert ein weiterer Polizist in den Waggon. „Was haste denn? Sieht doch alles normal aus...“ „Das ist es ja gerade...“ murmelt der erste Polizist. Und klettert über ein paar Kartoffelsäcke hinweg, räumt eine der aufgestapelten Kiste zur Seite und leuchtet umher. Er ist nur noch wenige Meter von den „Schimäre“-Kämpfern entfernt, die sich ducken und den Atem anhalten. Ein Lichtstrahl wandert direkt über Tanja die Wand entlang. „Ach Hans, hier ist nichts...Komm schon, der Zug muß im Zeitplan bleiben.“ Der erste Polizist stößt einen verärgerten Seufzer aus. „Hast ja recht.“ Er klettert wieder herunter und geht zurück zu seinem Kollegen. Zusammen klettern sie wieder aus dem Wagen. „Ok, dann sag dem Lokführer Bescheid, er kann weiterfahren...“ Die Schiebetür wird wieder zugeschoben. Nur wenige Augenblicke später setzt sich der Zug wieder in Gang. Erst jetzt wagen alle, auszuatmen. „Puh, das war knapp...“ stöhnt Fraker. Die Dunkelheit ist über die Schlachtfelder zwischen Smolensk und Jarcevo hereingebrochen. General Robert Mudra steht vor einer kleinen Bauernhütte in Dubrovo, die ihm als Gefechtsstand dient. Von dem Vordach, unter dem er steht, tropfen Wassertropfen herab, denn es regnet. Man hört, wie die Regentropfen auf die Blätter der Büsche und Bäume in dem Vorgarten des Hauses fallen und in den Wassergräben entlang der nahen Felder hört man es gluckern und plätschern. Die Dunkelheit ist ansonsten still. Unter vorgehaltener Hand, um kein verräterisches Glühen durchkommen zu lassen, raucht er seine Zigarette. Damit beruhigt er seine Nerven. Er hatte eben ein nervenaufreibendes Telephongespräch mit seinen Vorgesetzten. Es läuft nicht alles so wie geplant. Mudras Korps hat die zahlenmäßig unterlegenen „Schimäre“-Verbände um fast drei Kilometer zurückgedrängt. Aber Minenfelder, Sperrfeuer und erbitterter Nahkampfwiderstand haben seine Truppen ausgelaugt. Da Mudra die noch nicht ganz wieder aufgefrischten erfahrenen Truppen eingesetzt hatte, wirkt sich dies doppelt aus. Die dreifache Überlegenheit, die man bei Beginn der Offensive hatte, ist längst verbraucht. Im Übrigen weiß Mudra aus früheren Erfahrungen, daß ein Frontalangriff gegen „Schimäre“ eigentlich nur bei vierfacher Überlegenheit ratsam ist. Die Bastarde wissen, daß Gefangenschaft für sie den Tod bedeutet, deswegen kämpfen sie härter als jede andere Truppe an der Ostfront. Buchstäblich bis zum letzten Blutstropfen. Und die „Schimäre“Feldkommandeure sind gerissene Hunde, befehlen ohne zu zögern taktische Rückzüge und Gegenattacken „aus der Hinterhand“, stellen Fallen, wagen riskanteste Rochaden. Mudra hat zwar noch eine frische Division, die man ihm zur Verstärkung gegeben hat und die aus frisch aus der Ausbildung kommenden Grünschnäbeln besteht. Aber die jetzt einsetzen? „Nein, das wäre ein Fehler!“ so meinte Mudra eben zu seinen Vorgesetzten. Die wollen nicht wahrhaben, daß diese Division gegen die erfahrenen „Schimäre“-Kämpfer innerhalb kurzer Zeit zu Schlacke ausbrennen würde. Mudra hat darauf bestanden, die 98. Reichsinfanteriedivision erst einzusetzen, wenn „Schimäre“ endgültig eingekesselt ist. Er hat sich durchgesetzt, aber nur, weil er einen weiteren Sturmangriff südlich der Rollbahn Smolensk – Jarcevo für den nächsten Morgen versprochen hat. Im Osten hört man schon das Donnergrollen der Artillerievorbereitung. Außerdem hat Mudra zwei Regimenter zur Unterstützung des südlichen Durchbruchsangriffs versprochen. Ein Räuspern reißt Mudra aus seinen Gedanken. Mit einer schnellen Bewegung dreht er sich um. Sein Adjutant ist nach draußen gekommen. „Herr General, General Brieskisch am Telephon.“ „Ja, ich komme sofort.“ Der Adjutant nickt und verschwindet wieder hinter der Plane, die vor dem Eingang hängt, um diesen abzudunkeln – sowenig Licht wie möglich darf nur nach außen dringen. In drei schnellen, tiefen Zügen, die ihn leicht hüsteln lassen, raucht Mudra die Zigarette zu ende, dann kehrt er ebenfalls in die Hütte zurück, die innen nur zwei muffige kleinere Räume aufweist: Einen Arbeitsraum mit Tisch, Stühlen und einer Ecke für die Funkanlage und das Telephon; und einen zweiten Raum mit Feldbetten, wo sich die Stabsarbeiter ausruhen können. Mudra geht direkt zum Telephon und nimmt ab; der Raum ist nur durch eine Petroleumlampe erhellt. „Hier Mudra. Was gibt’s?“ „Ich hab von Deinem Zoff mit dem Oberkommando gehört.“ „Ach, hör mir bloß damit auf! Die sollen das den Experten überlassen.“ „Haben sie Dir gesagt, daß wir einen Teil der Artilleriemunition an die EstlandOperation abgeben müssen?“ „Ja! Diese Idioten! Das passiert, wenn man alles auf einmal machen will. Denen ist nicht klar, daß das schlechte Wetter den Feind ohnehin schon genug begünstigt. Hast Du inzwischen neue Wetterprognosen erhalten?“ „Ja, noch schlechter. Regen, Regen, nichts als Regen!“ „Scheiße Mensch...Dann wird alles davon abhängen, ob Du und Steinberger die Einkesselung schaffen.“ „Du sagst es. Also wird die Entscheidung bei Jakovlevo fallen...Du mußt wissen, daß Steinberger mir mitgeteilt hat, sich für die kleine Lösung entschieden zu haben.“ „Hab ich mir schon gedacht.“ „Tja, dann hoffen wir das beste.“ „Genau. Ich lasse Dir morgen einen Bericht über unseren neuen Sturmangriff zukommen.“ „Alles klar. Bis dann.“ „Bis dann.“ Mudra legt auf. Das wird morgen ein schwerer, allzu schwerer Tag werden. Donnerstag, der 16. Oktober Petras Quartier in Schattenlagant ist ein fünf mal fünf Meter großer Raum, mit glatten Felswänden, einer nur ungenügend durch ein Gitter verzierten Glühbirne und immerhin einer Holztür, die auf den Flur führt. Auf dem harten Boden hat man einen Teppich mit buntem orangenem und gelblichem Muster ausgebreitet. Das wirkt aber unpassend in einer ansonsten eher auf Funktionalität bedachten Umgebung: Ein Feldbett ist die Schlafstätte, ein Spint dient als Kleiderschrank, daneben gibt es einen einfachen Holztisch mit Stuhl und ein Nachttischchen mit einer Schublade. Ein Vorhang trennt einen kleineren Nebenraum ab, in dem sich ein Bad mit Dusche und WC befindet – der einzige Hinweis darauf, daß es sich bei diesem Raum wirklich um ein Gästequartier handelt. Momentan aber wird der Raum nur durch einige weinrote Kerzen, die auf dem Boden ein Pentagramm bilden, erhellt. Auf dem Tisch glimmen einige Räucherstäbchen und erfüllen den Raum mit weihrauchartigem Duft. Im Schneidersitz, eingehüllt in ein schwarzes Gewand, hat sich Petra in Trance versetzt. Sie hat damit kurz nach Mitternacht angefangen. Die Rauchschlieren verbinden sich vor ihrem inneren Auge und scheinen sie zu tragen. Das Gefühl der Leichte ist wunderbar. Leichte und Freiheit. Aber auch Leere. Ein Übergangsbereich. Von irgendwoher ein Wispern. In der Ferne. Ein Luftzug, der die Rauchschwaden verweht. Schemenhafte Bewegung. Durchdringen von Materie und loslösen von Materie. Das Leben wie ein Fluß. Zahlreiche Windungen und Biegungen und daran die momentanen Leuchtfeuer der Schrecknisse. Ein Schlaglicht und die Vision verschwimmt wieder. Fernes Grollen und Schreie. Der Krieg. Auch das metaphysische Gleichgewicht ist außer Kontrolle. Plötzliche Kälte! Der Tod! Eine geistige Barriere, ein grüne Wiese, warme Sonne. Nochmal davongekommen! Aber Petras Geist muß weiter. Sie muß Kontakt aufnehmen. Urplötzlich erscheinen vor ihr glühende Augen, die Augen einer Raubkatze. Und dann verändern sie sich, werden zu menschlichen Augen, den Augen einer schönen Frau mit langen, leicht rötlichen Haaren. „Christiane, endlich lernen wir uns kennen....“ „Ja, und wir haben viel zu tun...“ antwortet die Erscheinung. „Wir müssen Stefan hier rausholen...“ „Ich hab schon eine Idee.“ „Ja, ich weiß. Die Idee ist gut.“ Dann verblaßt das Antlitz von Christiane Alleker wieder und Petra spürt den Rückfall auf ihre körperliche Ebene. Als sie die Augen aufreißt, sind die Kerzen bereits heruntergebrannt und erloschen. „Es wird unbedingt erforderlich sein, in dem kommenden Schauprozeß den kriminellen Charakter von General Reiss kenntlich zu machen. Wünschenswert wäre es, ihm verschiedene Kriegsverbrechen, speziell beispielsweise die Liquidierung der preußischen Königsfamilie, anzulasten und nachzuweisen. Unser Oberkommando verspricht sich davon neben einer Diskreditierung von „Schimäre“auch eine öffentlich-juristische Entlastung der Geheimpolizei.Gelingt dies, können wir Reiss ohne weitere Formalität exekutieren, setzen die Nachrichten über die Liquidierungsaktionen unsererseits auf das Niveau von unglaubwürdigen Gerüchten herab und behindern weitere Rekrutenanwerbungen „Schimäres“ schon im Ansatz. Eine Analyse des Heereskommandos hat ergeben, daß „Schimäre“ nur so wirklich auszumerzen ist, was wiederum unabdingbare Voraussetzung für einen allgemeinen Frieden zu unseren Gunsten ist.“ Auszug aus dem Memorandum 23.4 im Stab der GepoEinheit „Kronos“ Dumpf wirkende Explosionen lassen Beke auf ihrer Pritsche aufwachen. Nervös stemmt sie sich mit den Ellbogen hoch und blinzelt. Aber in ihrer Zelle im Keller des „Schimäre“-Hauptquartiers ist es stockfinster. Sie hört weitere Explosionen. Immer noch wie von weit weg und sehr dumpf. Aber sie spürt keine Erschütterungen. Was ist das? Wie ein Bombenangriff hört sich das nicht an. Nach ein paar Minuten herrscht Stille. Beke läßt sich wieder zurücksinken. Sie fröstelt leicht und zieht ihre dünne Decke wieder etwas hoch. Sie versucht abzuschätzen, wieviel Uhr es ist, aber es gelingt ihr nicht. Immerhin ist sie noch ganz gut untergebracht; der Raum hat zwar nur eine Pritsche, aber dafür auch ein Waschbecken zum Waschen. Für andere Geschäfte muß Beke der Wache Bescheid geben, daß man sie zur nächsten Toilette bringt. Aber über die kärgliche Unterbringung macht Beke ihren Bewachern keinen Vorwurf. Im Krieg ist vieles knapp und da kann man keine komplette Einrichtung auf eine inhaftierte Verräterin verschwenden. Und im Übrigen behandelt man sie human – es gibt zwei Mahlzeiten am Tag und gefoltert wird sie auch nicht. Ein wenig döst sie vor sich hin. Als auf einmal Licht hereinströmt, schreckt sie auf. Die Tür ist aufgegangen und die Wache kommt mit einem Tablett herein. „Guten Morgen, Gefreite.“ grüßt der junge Hauptgefreite und stellt das Tablett mit dem Frühstück – zwei Scheiben Brot mit einer mikrigen Ration Butter und einem Glas Wasser – auf den Boden. Daneben legt er ein Handtuch und frische Kleidung. Bei dieser handelt es sich einfach nur um eine grüne Leinenhose und ein grünes Hemd, dazu Unterwäsche. Wortlos will der Hauptgefreite wieder gehen, denn die zweite Wache vor der Tür wartet schon. Aber Beke will wissen, was eben los war: „Was waren das für Explosionen eben?“ Der Mann bleibt kurz stehen und dreht sich um. Was für ein freundliches Gesicht die Verräterin doch aufsetzen kann. „Flakfeuer. Wir haben einen Pulk Ju 88 zur Umkehr bewegt.“ Dann verläßt er endgültig den Raum. Hinter sich schließt die Wache die Tür wieder ab. Eher lustlos ißt Beke die beiden Brote, bevor sie sich wäscht. Bislang hat ihr niemand gesagt, wie es weitergehen soll. Wahrscheinlich will die neue Oberbefehlshaberin General Sus abwarten, was die Suche nach Reiss bringt. Und eine leise Stimme in ihrem Hinterkopf nagt nun doch an Beke: Was hast Du Dir dabei nur gedacht? fragt diese Stimme immer wieder. Beke wollte ihren Mann retten. Eine bessere Antwort fällt ihr auch nicht ein. Bei strömendem dünnem Regen zieht eine Kolonne berittener „Schimäre“-Kämpfer über die Dnjepr-Brücke südlich von Klemjatino. Die klatschnaßen Mähnen hängen den Pferden am Hals herunter, ihre Läufe sind schlammbehaftet, denn viele Wege sind längst grundlos geworden. Die Reiter lassen die Pferde langsam und vorsichtig über die Brücke gehen, deren naße Pflastersteine glitschig sind. Auf dem Nordufer, neben einer kleinen Holzfällerhütte, steht Schoeps und füttert gerade ‚Kurier‘, ihren Lieblingshengst, mit etwas nicht allzu naßem Heu. Ihre berittene Truppe kehrt gerade von einem nächtlichen Vorstoß über den Dnjepr zurück, bei dem sie in wahren Schlammkämpfen noch zwei feindliche Nachschubtransporte in überraschenden Überfällen aufgerieben haben. Aus der klapprigen Sägehütte kommt der Funker der Einheit heraus, der seinen tragbaren Funkapparat dort untergestellt hat. „Und, was sagt das HQ?“ fragt Schoeps, während sie dem Pferd über die Schnauze streichelt. Der Unteroffizier antwortet mit leicht polnischem Akzent (die meisten Soldaten der Einheit sind Polen, einige auch Litauer): „Sie bestätigen, daß wir die Brücke nicht sprengen sollen. Es soll die letzte bleiben. Die Pereleser Brücke wurde schon gesprengt. Außerdem sollen wir umgehend nach Jakovlevo zurückmarschieren, um dort unsere Stellung zu beziehen.“ „Sonst nichts?“ „Nein, sonst nichts.“ „Ok, dann packen Sie den Funkkram wieder ein. Machen wir, das wir wegkommen.“ „Zu Befehl, Frau Generalmajor.“ Der Mann geht zurück ins Gebäude, um seinen Kram zusammenzupacken. Schoeps gibt ‚Kurier‘ noch etwas Heu, worauf das Pferd ein zufriedenes Schnauben von sich gibt. „Ja, is ja gut, Junge...“ Mit einer Handbewegung löst sie ihre langen, sonst in einem Pferdeschwanz zusammengebundenen Haare, wirft sie kurz nach vorn und dann wieder nach hinten und legt wieder das Haargummi an. So bleiben die Haare halbwegs locker. Sie nimmt den Stahlhelm und setzt ihn auf. In dem Moment ertönen Schreie von Pferden und Menschen von der anderen Seite des Flusses. Schüsse peitschen. Motorengeräusche, knackende Äste. Und dann schlagen Geschoßgarben auch auf dieser Seite des Flusses ein. Schoeps wirbelt herum, duckt sich und hat in einem das Sturmgewehr griff-und schußbereit. Und jetzt erkennt sie, was los ist: Drüben, auf dem Südufer, ist ein zur Feindaufklärung eingesetzter Panzer II der Kaiserlichen aufgetaucht und hat mit seinen kleinkalibrigen Schnellfeuerkanonen das Feuer eröffnet. Die noch auf dem Südufer verbliebenen Kavalleristen hat er dabei einfach niedergemäht. Ein kleinerer Baum knickt um und ein zweiter Panzer II rollt heran und hält am Flußufer. Schoeps schaltet schnell und brüllt dann: „Rückzug! Alles weg hier!...Polowski, schnappen Sie sich eine geballte Ladung!“ brüllt sie noch zu dem Feldwebel auf der anderen Seite des Weges, der hinter einem Busch in Deckung gegangen ist, hinüber. Aber Polowski hat schon den selben Gedanken gehabt. Schoeps kramt ihre letzten drei Handgranaten hervor, wickelt Klebeband drumherum und sitzt dann auf. „Ich nehm den linken!“ brüllt sie. Polowski nickt nur und sitzt ebenfalls auf. Schoeps kann gerade noch mit ‚Kurier‘ um das Haus herum-und damit in Deckung reiten, als einer der Panzer seine Garben dort einschlagen läßt, wo sie eben noch war. Und dann gibt sie dem Pferd die Sporen, sprengt um das Haus herum und durch Unterholz und dann mit einem riskanten Sprung an einer flacheren Stelle in den Fluß. In einer Wasserfontänen jagt sie mit ‚Kurier‘ durch den Fluß. Nur an der Uferböschung wieder hochkommen wird schwierig. „Komm schon!“ spornt sie das Pferd an, das vor Anstrengung schwer atmet. Die Böschung ist vom vielen Regen weich und schlammig. Einer der Panzer dreht seinen Turm, visiert an. Genau, als er mit den schweren Maschinengewehren feuert, schaffen es ‚Kurier‘ und Schoeps die Böschung hoch, die Garben schlagen in den Schlamm. Und dann startet der Hengst wieder durch. Schoeps schwenkt auf die Panzer ein, sieht dabei, wie Polowski über die Brücke jagt, um ihn herum schießen die Fontänchen der MG-Garben hoch.Kurz vor dem Panzer wird Polowskis Pferd getroffen, strauchelt mit einem Aufschrei und wirft Polowski ab. Während das Pferd sich schwerverwundet wegschleppen will, rappelt sich Polowski auf und rennt nun zu Fuß auf den Panzer zu und schleudert seine geballte Ladung. Springt in Deckung. Mit einem lauten Knall wird der Panzer in eine Säule aus Rauch und Qualm gehüllt. Im selben Augenblick ist auch Schoeps in Reichweite, hat die Ladung bereits wurfbereit in der Hand. Jetzt zieht sie mit den Zähnen einen der Stöpsel raus, um die Ladung scharf zu machen, fängt ‚Kurier‘ kurz vor dem Panzer ab, der gerade versucht, zurückzusetzen, um Schoeps wieder ins Visier zu kriegen. Aber der Schlamm hat schon die Ketten fast verklebt. Schoeps fängt ihr Pferd ab, schleudert die geballte Ladung und läßt ‚Kurier‘ im Bruchteil einer Sekunde wieder auf den Fluß zujagen. Als sie mit dem Pferd wieder ins kalte Wasser springt, hört sie hinter sich die Detonation, Kettentrümmer fliegen um sie herum ins Wasser... Die Schottersteine knirschen viel zu laut unter den Armeestiefeln. Zwischen zwei Güterzügen hasten sie dahin, um möglichst schnell bei hellichtem Tage einen Weg runter vom Bahnhofsgelände zu finden. Dämlicherweise kann man in Zeiten wie diesen nicht einfach auf den nächsten Bahnsteig klettern und davonmarschieren. Denn das muß man dann erstmal einem Polizisten oder – besser noch! – einem Geheimpolizisten so plausibel machen, daß er einen nicht festnimmt. Was schlechterdings unmöglich ist. Mit einer zackigen Bewegung hebt Philipp seine rechte Hand und die andern bleiben stehen. Vorsichtig wirft er einen Blick zwischen zwei aneinandergekoppelten Waggons hindurch. Auf der anderen Seite sind nur noch zwei weitere Gleise und dann Buschwerk, hinter dem ein Zaun erkennbar ist. „Fraker?“ flüstert er. „Ja, Chef?“ „Sie kommen mit mir. Der Rest wartet erstmal hier." Philipp und Fraker klettern über die Kopplung und treten auf der anderen Seite ins Freie, wo keine Waggons mehr stehen. „Beeilung Chef, ich will wieder ins trockene...“ murmelt Fraker. Denn es regnet wiedermal viel zu viel. Mit schnellen Blicken nach beiden Seiten – zum Glück sind keine Wachen zu sehen! – huschen die beiden rüber zu dem Gebüsch, ducken sich und kriechen zwischen den Ästen durch. Tatsächlich: Ein Zaun und dahinter eine Straße, auf deren anderer Seite irgendein Lagerhaus oder so was in der Art steht. „Sieht sauber aus.“ meint Fraker und zerschneidet schon mit einer Zange die Zaunmaschen. Philipp geht geduckt ein Stück zurück und winkt die anderen rüber. Inzwischen hat Fraker ein Loch in den Zaun geschnitten und schlüpft durch. Philipp folgt ihm. Er blickt kurz auf die Uhr. Kurz nach 11. Aus dem Industriegebäude vor ihnen kommen auch Geräusche und Stimmen. Ein paar hundert Meter weiter vorn, biegt ein Laster um die Ecke und fährt davon. Arbeitszeit. Die andern kommen ebenfalls durch das Loch im Zaun und schütteln sich ein paar Äste ab. „Ok, wir müssen erstmal aus dem Industriegebiet raus.“ meint Philipp und entscheidet dann spontan, sich nach rechts zu wenden, wo eben der Laster wegfuhr. Die anderen folgen ihm, alle mit geschultertem Rucksack und in zivilen Klamotten. So Philipp beispielsweise in Jeans und Hemd, darüber mit dunkelblauer Regenjacke. Es fröstelt ihm, aber in voller schwarzer Montur wäre er zu auffällig. Tina hat zu der Kluft aus beiger Hose und grüner Regenjacke noch eine Kappe auf, von deren Schirm die Regentropfen herunterfallen. Und so sind alle im ähnlichen Stil gekleidet. Während sie an langen Industriegebäuden vorbeilatschen, begegnen ihnen immer wieder Arbeiter, die sie aber kaum beachten. Schließlich erreichen sie eine etwas größere Straße, auf der immer wieder kleinere und größere Fahrzeuge und einmal sogar noch ein Pferdefuhrwerk vorbeifahren. Auf der anderen Seite sind ein paar brachliegende Grundstücke und dahinter Gebäude, die stark nach Wohnhäusern aussehen. Zügig überquert der Trupp die Straße und biegt dann in eine der nach Norden führenden kleineren Straßen ein. Marta schließt zu Philipp auf und meint dann: „So, Kapitän, jetzt sind wir in Nürnberg. Was nun?“ „Gute Frage.“ Mehr sagt Philipp nicht. Längst haben sie ein Wohnviertel erreicht. Neben Einfamilienhäusern gibt es auch immer mehr mehrstöckige Mietshäuser. Als sie wieder eine größere und stärker befahrene Querstraße erreichen, bleibt Philipp stehen. Wartet noch kurz, bis einige Passanten nicht mehr ganz in Hörweite sind. „Ok, hier teilen wir uns auf. Jacke, Fraker, Tanja und Tibori: Sie vier versuchen etwas Proviant für unsere weitere Tour aufzutreiben. Geben Sie alle sich als Touristen. Vermeidet unnötige Kontrollen.“ „Und was machen Du und die andern?“ fragt Jacke. „Ich werde mit Marta und Tina losziehen, um unsere Kontaktperson zu finden. Conny hat mich zum Glück mit einem Notizzettel voller Infos versorgt.“ „Ok, alles klar. Wo treffen wir uns?“ „Heute abend vor dem Hauptbahnhof.“ „Ok. Das müßten wir finden...“ Mit einer Kopfnicken meint Jacke zu den anderen seiner Gruppe: „Los, gehen wir, Richtung Innenstadt.“ Schweigend ziehen sie von dannen. Derweil kramt Philipp erstmal seinen Notizzettel raus. „Also, in jeder größeren Stadt haben wir so was ähnliches wie das Rothschild in Köln...“ murmelt Philipp vor sich hin. Fast ganz unten auf dem Zettel steht, als letzte von mehreren Adressen: „Nürnberg: Zum Sudhaus, Bergstr. 20“. Er blickt Marta und Tina an. „Ok, wo kriegen wir einen Stadtplan her?“ fragt Tina. Da kann Philipp nur mit den Achseln zucken und beschließt daher: „Gehen wir einfach mal weiter in die Stadt hinein...“ Gephardt steht ungeduldig und mit verschränkten Armen in den Lazaretträumen von Schattenlagant. Die Betten sind momentan nicht belegt, denn Dr. Tschirner behandelt hier meistens nur Erkältungen und ähnliche Lapalien. Oder eben widerspenstige Gefangene. Tschirner sitzt an seinem Arbeitstisch und mixt seinen Drogencocktail zusammen. „Doktor, wieso können wir die Sache nicht heute durchziehen?“ „Hab ich Ihnen doch schon gesagt, Standartenführer.“ erwidert Tschirner gereizt, aber weiterhin auf seine Arbeit konzentriert. Der ältere Herr mit dem schütteren Haar und der Nickelbrille läßt sich eben nicht gerne dreinreden. „Standartenführer, Sie wissen ich arbeite seit Jahren mit der selben Mischung erfolgreich, aber mir fehlen eben noch zwei Zutaten, die erst mit der nächsten Medikamentenlieferung kommen. Und die ist übermorgen.“ Gephardt schickt einen genervten Seufzer voraus und meint dann zerknirscht: „Das wird Oschmann gar nicht gefallen. Das ganze muß jetzt schnell über die Bühne gehen.“ „Wieso denn? Bis zum Prozeß schaff ich das schon.“ gibt sich Tschirner zuversichtlich und steht auf, um das Fläschchen mit dem Cocktail in seinen Medikamentenschrank über dem Arbeitstisch zu stellen. „Doktor, es geht nicht nur um den Prozeß.“ erklärt ihm Gephardt. „Oschmann befürchtet, daß ‚Schimäre‘ schon bald einen Befreiungsversuch unternimmt.“ „Wie denn? Die wissen wohl kaum, wo die Anlage hier ist.“ „Erklären Sie das mal Oschmann. Zumal der von dieser Müller noch darin bestärkt wird.“ Tschirner schließt die Schranktür ab und wirft Gephardt einen skeptischen Blick zu. „Das kommt mir aber komisch vor. Ist diese Frau überhaupt vertrauenswürdig?“ „Keine Ahnung...Naja, Doktor, ich werd dann mal zu Oschmann gehen und mit ihm reden.“ „Tun Sie das. Er soll sich in Geduld üben.“ „Alles klar.“ Gephardt nickt dem Mann zum Abschied zu und verläßt dann die Arzträume. Vorsichtig schließt er die Eisentür hinter sich – Tschirner mag es nicht, wenn man die Türen allzu kräftig zuzieht. Die langen Korridore und Gänge, in den Fels gehauen, mit Beton verstärkt – denn nicht überall sind die Felsen auch wirklich stabil genug. Bei an Glimmern reichen Gesteinen ist man lieber auf Nummer sicher gegangen. Ebenso bei einigen Kalkschichten. Um die dunklen Gänge zu beleuchten ziehen sich unter der Decke lange dünne Kabel entlang, an denen alle 8 m eine Glühbirne hängt. Zielstrebig geht Gephardt die Gänge entlang, um etliche Ecken. Ein Neuling würde sich hier rasch verlaufen, aber Gephardt verbringt schon Monate hier und kennt sich aus. Einer seiner Männer begegnet ihm. „Mahlzeit, Rottenführer, wie geht’s?“ „Gut, Standartenführer. Oben schneit es.“ „Oh...“ Gephardt hebt beide Augenbrauen. „Ist es wirklich schon so kühl?“ „Ja, noch nicht ganz, aber es bleibt schon liegen, wo die Sonne nicht zu sehr hinscheint.“ „Ok, dann werd ich wohl auch mal wieder nach oben gehn. Bis später, Rottenführer.“ Gephardt geht weiter und denkt kurz über den Schnee nach. Man vergißt hier unten viel zu leicht, daß das Lager Schattenlagant auf dem Seekopf immerhin über 2500 m hoch liegt. Nach einer weiteren Biegung erreicht am Ende eines kürzeren Korridors Oschmanns Büro. Er klopft an die Holztür. „Herein!“ Gephardt tritt ein und findet Oschmann gerade dabei vor, einige aufgeschlagene Aktenmappen zu studieren. „Ah, Gephardt! Ich hab sie eben gar nicht beim Mittagessen gesehen.“ „Ich esse gern in meinem Quartier. Lieber als in der Messe.“ „Verstehe.“ „Tschirner sagte mir eben, gewisse Zutaten für den Cocktail wird er erst in zwei Tagen haben.“ „Wollen Sie etwa sagen, wir können Reiss dann erst in zwei Tagen wirklich ausquetschen?“ „Genau das.“ „Scheiße...“ Stirnrunzelnd lehnt sich Oschmann in seinem Schreibtischstuhl zurück und trommelt mit den Fingern einer Hand nervös auf der Tischplatte herum. „An was denken Sie, Chef?“ „An die Müller.“ „Wieso an die?“ „Vielleicht fällt der was ein, wie wir des Generals Meditationstricks umgehen können. Wissen Sie, wo sie steckt?“ „Ich glaube, sie wollte Leikert beim Schwertkampftraining helfen. Weil Leikert doch wieder in Form kommen muß nach seiner langen Verletzung.“ Oschmann steht auf. „Kommen Sie, Gephardt, wir gehen mal zum Trainingsraum. Manchmal muß man Leikert echt vor sich selber beschützen...“ „Wie meinen?“ Oschmann hat schon die Tür geöffnet. „Gephardt, niemand garantiert uns, daß diese Frau Leikert dabei nicht ‚versehentlich‘ umbringt...“ Oschmann ahnt gar nicht, wie recht er damit hat. Der Trainingsraum ist eine 10 mal 10 m große Sporthalle in Etage 5 des in den Berg getriebenen Labyrinths. Leikert versucht mit seinem Säbel immer wieder Petra, die mit einem Langschwert mit wunderbar verziertem Griff agiert, anzugreifen, aber Petra pariert und weicht mit eleganten Drehungen immer wieder ausweicht. Ihre schwarze, figurbetonte Kleidung gibt dem ganzen noch zusätzliche Eleganz. Mit einem Ausfall bringt Petra Leikert aus dem Gleichgewicht und auf Distanz. „Leikert, das war schon alles?“ fragt sie fröhlich und läßt ihre Klinge einmal in der Luft kreisen. „Sie müssen entschuldigen, Lady, aber ich bin etwas aus der Form.“ „Stimmt ja. Ihre Verwundung.“ „Genau!“ Damit springt Leikert nach vorn und wagt einen Frontalangriff. Aber Petra ist wieder schneller, taucht darunter her, drückt mit ihrer Klinge Leikerts Klinge nach oben und windet sie ihm dann mit einer raschen Drehung aus der Hand. Leikerts Säbel fliegt zu Boden, Petra hämmert ihm mit der flachen Hand auf den Solar Plexus, das der Sturmbannführer mit einem hörbaren Keuchen gegen die fünf Meter entfernte Wand fliegt. Indessen ist Petra schon zu dem verlorenen Säbel rübergehechtet, hebt in bei einer eleganten Rolle auf, fegt dann wie ein Wirbelwind auf Leikert zu. Sekundenbruchteile später sieht er sich durch zwei gekreuzte Klingen, die seinen Hals einrahmen, an die Wand genagelt. „Sagen Sie, Sturmbannführer, wie genau wurden Sie eigentlich verwundet?“ „Schluß damit!“ brüllt jemand – Petra erkennt Oschmanns Stimme – vom Eingang her. „Frau Müller, fragen Sie das lieber Reiss, der ist für Leikerts Zustand verantwortlichen. Und bitte – so leid es mir tut, aber Sie müssen den Sturmbannführer am Leben lassen.“ „Muß ich das?“ „Ja, das müssen Sie.“ faucht Gephardt, der auf einmal direkt hinter Petra steht. Etwas hartes, kaltes bohrt sich in ihren Nacken. Es gehört nicht viel Phantasie dazu, sich vorzustellen, was das wohl ist... „Tja, dann muß ich das wohl.“ Sie läßt die Klingen sinken und gibt Leikert seine zurück, wobei sie nichts sagt, sondern ihn nur mit einem eisigen Lächeln bedenkt. Leikert tritt seitlich an ihr vorbei und ist etwas bleich um die Nase. Wortlos verläßt er den Raum. „Gephardt, würden Sie jetzt bitte die Waffe runternehmen.“ meint Petra tonlos. Gephardt nimmt zwar die Waffe runter, meint dabei aber: „Für Sie immer noch Standartenführer Gephardt.“ „Ok. Standartenführer Gephardt.“ Mit einem Räuspern bringt sich jetzt auch Oschmann wieder in Erinnerung. „Frau Müller, auf ein Wort.“ Als sie zu ihm rübersieht, macht er eine Kopfbewegung zur Tür. Als er den Raum verläßt, folgt sie ihm. Er führt sie schnurrstracks zu seinem Büro. Dort bleibt er an seinem Schreibtisch stehen. „Schließen Sie die Tür, Frau Müller.“ Als sie die Tür geschlossen hat, faucht er sie an: „Was haben Sie sich dabei gedacht, Leikert zu bedrohen! Wissen Sie, was ich durch Ihre Anwesenheit hier riskiere?“ „Was wollen Sie eigentlich?“ schnappt sie zurück. „Er wollte Training, ich hab ihm welches gegeben! Man kann seine Kampftechniken nicht wirklich verfeinern, wenn man nicht ein wenig das Gefühl der Bedrohung empfindet...“ „Gratuliere, das Gefühl haben Sie ihm vermittelt.“ „Na dann hoffe ich, er hat was gelernt.“ Oschmann sieht sie einen Moment lang durchdringend an und meint dann: „Ich will Ihnen das mal ungeprüft glauben...“ Schließlich wechselt er das Thema. „Ich hab gehört, Sie haben Ihren Kumpel heute morgen angerufen?“ „Ben? Ja. Ich hab ihm gesagt, er soll hierher kommen.“ Wieder braust Oschmann auf. „Sagen Sie mal, Petra, haben Sie noch alle Tassen im Schrank?!“ brüllt er. Petra hebt nur ihr rechte Hand, die Finger leicht gekrümmt. In dem Moment versagt Oschmann die Stimme, sein Brustkorb und seine Kehle schnürren sich zusammen, er schnappt nach Luft. „Standartenführer, Ben hat eine sehr wichtige Lieferung an mich zu überbringen. Es wird auch in Ihrem Interesse sein, wenn er sicher hier ankommt und mir die Lieferung überreichen kann. Sie wollen meine Hilfe? Nun gut. Stehe ich in Ihren Diensten, steht Ben in Ihren Diensten. Vergessen Sie das bitte nicht. Krümmen Sie Ben ein Haar, dann werden Sie alle hier sterben. Ebenso, wenn Sie mir ein Haar krümmen. Denken Sie immer daran...Heute abend nach dem Abendessen dann können wir zu Reiss gehen. Ich weiß längst, daß ich ihn für Sie aushorchen soll. Ich werde dann sehen was ich tun kann.“ Sie läßt die Hand wieder sinken. Sofort kriegt Oschmann wieder Luft. Wie ein Fisch schnappt er danach und kriegt so gar nicht wirklich mit, wie Petra den Raum verläßt. Auf dem Weg in ihr Quartier lächelt Petra ein wenig und denkt bei sich: „Danke, Christiane Alleker, für Deine Hilfe.“ Die Antwort kann nur sie in ihrem Kopf hören. „Schon gut. Mit Oschmann hab ich eh noch ne Rechnung offen....“ „Wenn die Vergewaltigung unausweichlich ist, dann lehn’Dich zurück und genieße sie.“ Russischer Zynismus Am frühen Nachmittag haben Philipp, Marta und Tina endlich in Nürnberg das Restaurant „Zum Sudhaus“ gefunden. Ein Lokal mittlerer Preisklasse, für das bißchen Geld, daß die drei „Schimäre“-Kämpfer dabei haben ist gerademal eine Mahlzeit erschwinglich. Aber sie riskieren den finanziellen Black-out und lassen sich einen der hintersten Tische zuweisen. Hier fallen sie nicht so sehr auf, aber Philipp kann sich so setzen, daß er die Bar und über den Spiegel an der Rückwand der Bar die Eingangstür im Auge hat. Seinen Rucksack und seinen Säbel legt er neben sich auf die Bank, die die Wand entlangläuft. Marta setzt sich neben ihn, Tina auf einen der drei Stühle an dem Tisch. „Das denen der Säbel nicht komisch vorkommt...“ wundert sich Marta. Philipp zuckt die Achseln. „Vielleicht denken die, ich wäre Heeresoffizier oder so was in der Art. Wenn nicht, dann kriegen wir sicherlich bald Besuch.“ Eine junge und – wie Philipp findet – hübsche Bedienung mit blondem lockigem Haar tritt an ihren Tisch. „Was möchten Sie bitte?“ Philipp bestellt sich ein Bier, Tina eine Cola und Marta ein Wasser. „Und was zu essen?“ „Was können Sie empfehlen?“ fragt Philipp. „Momentan können wir sehr unseren Sauerbraten empfehlen. Er ist zwar nicht mehr so gut wie früher, weil unser früherer Schlachtermeister sich als Widerständler entpuppt hat und festgenommen wurde, aber immer noch sehr gut. Oder hätten Sie gerne was anderes?“ Philipp hat’s gecheckt. „Nein, wir nehmen ruhig den Sauerbraten. Und vielleicht einen Salat oder einen Teller Nudeln dazu.“ „Ok....“ Die Bedienung schreibt sich alles auf. „Salat...Nudeln...“ Dann geht sie wieder. Nachdem sie in der Küche verschwunden ist, um die Bestellung aufzugeben, kommt sie wieder raus und Philipp sieht, wie sie hinter der Bar telephoniert. Er hat richtig getippt. Das Wort „Widerstand“ stellt den Kontakt her. Also läuft alles wie am Schnürrchen. Und nebenbei können sie sich nach der ungemütlichen Anreise was ausruhen und sattessen. Nach etwa 20 Minuten serviert die Bedienung ihnen das Essen und wünscht guten Appetit. Der Trupp macht sich begierig über das Essen her. „Worauf warten wir jetzt eigentlich?“ fragt Tina zwischendurch. „Darauf, daß sich jemand bei uns meldet.“ antwortet Marta, denn Philipp hat gerade den Mund voll. „Aha...“ meint Tina nicht sehr überzeugt und stochert mit der Gabel in ihren Nudeln herum. Philipp beobachtet weiter die Tür. Als eine junge Frau mit mäßig langem dunklem Haar, die einen Pullover und eine Jeans trägt, eintritt und an der Bar kurz mit der Bedienung spricht, meldet sich Philipps Instinkt. Und tatsächlich, die Frau kommt auf ihren Tisch zu. „Leute, benehmt euch, unsere Gastgeberin ist da...“ raunt Philipp kurz zu Marta und Tina. Tina blickt in die selbe Richtung wie Philipp und mustert die Frau eingehend. Und findet – Tina ist dem weiblichen Geschlecht nicht gerade abgeneigt – durchaus Gefallen an dem, was sie sieht. Endlich mal eine gut aussehende Kontaktperson... Die Frau setzt sich auf den Stuhl direkt gegenüber von Philipp. „Guten Tag. Wie ist der Sauerbraten?“ Einen kurzen Blick wechselt Philipp mit Marta und erwidert dann: „Danke gut. Aber klären wir erstmal die Formalitäten. Also: Wer sind Sie?“ „Mein Name ist Myriam Schneider. Wir saßen in Würzburg fest.“ Das Codewort. Philipp gibt die korrekte Antwort: „Und entkamen dennoch der Hölle.“ Er grinst. „Nun gut, Myriam Schneider. Ich bin Kapitän zur See Philipp Kipshoven. Meine beiden Begleiter sind Leutnant Marta Rambowicz und Oberfähnrich Tina Reymann. Sie wissen über unsere Mission Bescheid?“ „Den General befreien. Ja, ich weiß Bescheid.“ Ein junger Mann, der Zeitungen verkauft, geht durch das Lokal. „Die Süddeutsche! Die Süddeutsche! Wieder mit Extra-Beilage zum Krieg!“ Als er am Tisch der Widerstandskämpfer vorbeikommt, drückt ihm Myriam ein paar Münzen in die Hand und ersteht so eine Zeitung. Als sich der Mann wieder entfernt hat, fragt sie, während sie die Zeitung durchblättert und Philipp seine Mahlzeit beendet: „Was genau brauchen Sie und Ihre Leute jetzt, Philipp?“ Er schiebt seinen Teller beiseite und Marta stellt die leeren Teller aufeinander. „Wir brauchen neues Geld, eine Unterkunft für eine Nacht und müssen vor allem herausfinden, wo sich eine gewisse Petra Müller aufhält.“ „Geld und Material – kein Problem. Unterkunft geht auch noch. Aber der Name Petra Müller sagt mir jetzt nichts.“ stellt Myriam fest. „Wundert mich nicht.“ erwidert Philipp. „Um dieses spezielle Problem werde ich mich selber kümmern. Es sei denn, Sie haben noch eine andere Spur zum General für uns....“ „Nein, leider nicht. Ich hab mich auch mit Agenten in ganz Bayern kurzgeschlossen. Nichts...“ Sie stockt. Philipp richtet sich auf. „Was ist?“ Myriam dreht die Zeitung um, so daß Philipp eine Schlagzeile lesen kann: „Terroristen überfallen Zug und befreien Verurteilte“. „Waren Sie das, Kapitän?“ „Ja, ich glaub das waren wir.“ meint Philipp zerknirscht. Und Marta murmelt: „Jetzt werden Sie uns überall suchen. Scheiße.“ Tina ist da optimistischer. „Die wissen doch nicht, daß wir in Nürnberg sind und morgen ziehen wir schon weiter.“ „Da hat sie recht.“ bestätigt Philipp. „Und wie geht’s nun weiter?“ fragt Marta. „Ganz einfach.“ meint Philipp. „Marta, Sie und ich werden uns heute abend mal um das Petra-Müller-Problem kümmern.“ „Und wie?“ will Marta wissen. Philipp sieht Myriam an. „Myriam, kennen Sie zufällig einen Gothic-Schuppen, der heute abend auf hat.“ „Gothic? Moment, warten Sie mal, Kapitän...“ Sie legt den Finger ans Kinn, runzelt die Stirn und denkt nach. „Ich glaube unweit des Bahnhofs gibt’s sowas.“ „Ok. Marta, werfen Sie sich in Schale, da gehen wir heute abend hin...Tina, Sie helfen Myriam dabei, Unterkünfte und Reisegelegenheiten zu besorgen.“ „Geht klar, Chef.“ „Gut, dann wäre das ja geklärt.“ Philipp steht auf. „Myriam, da Marta und ich unser letztes Geld noch brauchen werden, wären wir Ihnen sehr verbunden, wenn Sie die Mahlzeit zahlen. Danke.“ Mit einem frechen Grinsen ist Philipp schon auf dem Weg zur Tür und selbst Marta muß schmunzeln als sie ihm folgt. Denn Myriam schaut beiden nur total perplex nach. Als sie ihre Sprache wiedergefunden hat, krächzt sie: „Wie kann er es...?“ Tina lacht. „Er leitet die Mission, er ist der Chef. Momentan steht nur General Sus über ihm.“ Es regnet den ganzen Tag, die Wolken hängen tief, Sichtweite vielleicht 100 m. Die Kaiserlichen müssen die Präsenz ihrer Luftwaffe auf das unbedingt notwendige Soll reduzieren, um die wetterbedingten Verluste niedrig zu halten. Und wenn scheren solche Details nicht wirklich? Genau: Generalmajor Bohnsack von der kleinen Luftwaffe von „Schimäre“. Als Mudras Infanterie am Vormittag wieder zum großangelegten Sturmangriff angetreten ist – und zugegebenermaßen beinahe durchgebrochen ist, was nur mißlang, weil der Schlamm die Verteidiger begünstigt – haben Bohnsacks Flieger den Bodentruppen den Rücken freigehalten. Bohnsack selber hat vier Stukas vom Himmel geholt. Jetzt kreist Bohnsack zusammen mit vieren seiner Flieger über dem Dnjepr, südlich Jakovlevo. Der leicht angeschwollene, dreckig wirkende Fluß zieht sich wie ein geschlängeltes Band durch Felder, Wälder, an kleinen Gehöften vorbei. Noch befinden sich die fünf Flugzeuge vom Typ Fw 190 im Formationsflug, doch erteilt Bohnsack jetzt über Funk Befehle: „Ok, dann schwärmt mal aus. Jede Feindsichtung sofort über sicheren Kanal ans HQ melden.“ „Verstanden.“ geben alle durch, kippen dann einer nach dem anderen über den Flügel ab und jagen davon. Und auch Bohnsack geht tiefer. Bislang hat er sich am Rande der Wolkendecke gehalten, jetzt geht er so tief, daß er einzelne Personen am Boden ausmachen kann und jagt über die Waldungen. Der Auftrag ist einfach: Feindlage aufklären und eventuell auftauchende feindliche Treibstofftransporte angreifen. Als Bohnsack die Brücke von Klemjatino überfliegt, sieht er, was alle im HQ erwartet haben: Eine Kolonne von Kradschützen und Panzern, die den Fluß in nördlicher Richtung überqueren. Einige der feindlichen Soldaten feuern blindlings mit ihren MGs nach oben, ohne Bohnsack ernsthaft gefährden zu können. Diese kurzfristige abstruse Situation jagt ein flüchtiges Lächeln über Bohnsacks Gesicht. Er zieht einen Kreis und entdeckt noch drei Tanklaster, die gerade einige Panzer mit Sprit versorgen. Spontan will er zum Tiefflug und damit zum Angriff ansetzen, als Tacker, einer der anderen Piloten, über Funk meldet: „Chef, schätzungsweise ein Dutzend Messerschmitts im Anflug. Peilung West-Südwest.“ Bohnsack schaut sich hektisch um und entdeckt den feindlichen Pulk. „Scheiße!“ flucht er und schaltet erst dann auf den offenen Kanal. „Ok, Leute, das ist sogar für uns zuviel. Heimflug!“ Dicht unter der Wolkendecke sammelt sich Bohnsacks Pulk wieder und nimmt Kurs auf Safonovo. Unterwegs gibt Bohnsack noch seine Aufklärungsmeldung durch. Tacker bildet das Schlußlicht, um die Messerschmitts im Auge zu behalten, die zwar versuchen, die Focke Wulf-Maschinen einzuholen, aber von vorneherein noch zu weit entfernt waren. Glück gehabt! Unten am Boden steht Hauptmann Steinberger neben zwei ausgebrannten Panzer-II-Wracks, neben den noch verkohlte Gebeine liegen. Er sieht den abdrehenden Fliegern nach. Hinter ihm wartet mit laufendem Motor sein Führungspanzer. Aus einer der seitlichen Luken sieht der Funker nach draußen. „Hauptmann, noch irgendwelche neuen Befehle?“ Langsam dreht sich Ingo Steinberger um und fährt sich dabei mit der Hand durch seinen Bart. Dann rückt er sich seinen Helm zurecht. Schließlich meint er: „Ja. Geben Sie an alle durch: Bis morgen früh 8 Uhr müssen die besprochenen Ausgangsstellungen für den Angriff auf Jakovlevo erreicht sein. Und lassen Sie beim Oberkommando nochmal nachfragen, ob wir nicht doch etwas mehr Infanterieunterstützung kriegen können.“ „Zu Befehl, Herr Hauptmann.“ Ingo dreht sich wieder um, schaut zur Brücke und zum Fluß und dann wieder zum Himmel, wo ein Pulk Messerschmitts endlich wieder die „Schimäre“-Flieger verjagt hat. Ein Gefühl macht sich in seinem Bauche breit. Es ist das Gefühl, daß Hauptmann Ingo Steinberger nur hat, wenn die entscheidende Schlacht kurz bevorsteht. Als Petra nach einem verspäteten Mittagessen in der Kantine von Schattenlagant in ihr Quartier zurückkehrt, findet sie dort auf dem Boden einen Zettel vor. Jemand muß ihn unter der Tür durchgeschoben haben. In Druckschrift steht da geschrieben: „Du bist nicht allein. Reiss hat noch eine Verbündete in Schattenlagant.“ Kurzentschlossen kramt Petra ihr Feuerzeug aus der Hosentasche und verbrennt den Zettel. Und dann überlegt sie: Welche Frauen gibt es noch in Schattenlagant? Es können abgesehen von ihr nicht allzu viele sein. Sie beschließt, jetzt doch nochmal einen Rundgang durch Schattenlagant zu machen. Vielleicht kann sie ja noch vor dem für den Abend geplanten Besuch bei Reiss herausfinden, wer diese unbekannte Verbündete ist. Ihr Gefühl sagt ihr, daß Reiss es ohnehin schon weiß. Ein halb verfallener Altbau in der Innenstadt Nürnbergs, nur wenige Minuten Fußweg vom Hauptbahnhof entfernt – daß ist das Quartier, das Myriam im Angebot hat. Drei unterkühlte, viel zu feuchte Stockwerke, das Treppengeländer morsch, die Türen quietschen, was in den Ecken herumkrabbelt, sollte man gar nicht erst wissen. Immerhin scheint vor kurzem mal durchgefegt worden zu sein. Aber man kann in gewissen Situationen nicht wählerisch sein, schon gar nicht für eine Nacht. Gerade will Myriam ansetzen, um sich für die nicht ganz so luxuriöse Unterkunft zu entschuldigen, als Tina mit einem breiten Grinsen meint: „Keine Frage, wir nehmen die Bude!“ „Der Dreck macht euch nichts?“ Tina dreht sich lächelnd zu Myriam um, die ihr immer sympathischer wird; irgendwie fühlt sie sich immer stärker zu der Frau hingezogen. „Frau Schneider, noch vor nicht allzu langer Zeit hab ich im Schützengraben rumgehangen. Da hat’s auch nicht anders ausgesehen.“ „Verstehe.“ Myriam lächelt sie an. Und dann fällt ihr was ein. „Tina, ich muß Ihnen ja noch den Dachboden zeigen!“ „Was ist da denn?“ „Werden Sie schon sehen.“ Tina folgt Myriam über die knarrende Treppe nach oben. Ein alte Holztür mit abblätternder grünlicher Farbe ist der Eingang zum Dachboden. Myriam öffnet die Tür. Der Dachboden ist ein einziger großer Raum mit einem Dachfenster in dem Schrägdach. Und mehrere Vorhänge teilen den Raum auf. Myriam zieht einen der Vorhänge – eigentlich nur ein über eine Leine gehängtes Laken – zur Seite. „Bitte sehr, Feldbetten.“ Mit diesen Worten läßt sich Myriam auf das vorderste Feldbett fallen. Tina geht an ihr vorbei und schaut hinter die anderen Vorhänge. Alles Feldbetten. „Wo haben Sie die denn aufgetrieben?“ fragt Tina erstaunt. Myriam steht wieder auf. „Wir haben vor sechs Wochen mal einen abgestellten Nachschubzug auf dem Güterbahnhof ausgeräumt. Daher.“ Auf einmal steht Myriam direkt hinter Tina. Ihre Nähe gefällt Tina, aber für einen Moment denkt sie, daß das vielleicht eine Falle des Feindes ist. Aber sie schüttelt den paranoiden Gedanken schnell ab und als Myriam sanft ihre Hand ergreift, entspannt sich Tina wieder. Das ist nicht die Berührung eines Feindes. Es ist mehr...mehr...mehr die Berührung zweier Menschen, die vom ersten Augenblick an füreinander entflammt sind. Von hinten flüstert Myriam ihr ins Ohr: „Möchten Sie vielleicht ein Bett...ausprobieren?“ Tina dreht sich langsam zu ihr um, die beiden sehen sich tief und intensiv in die Augen. Langsam nähern sie sich, ihre Lippen berühren sich erst zaghaft – aber dann kann die beiden nichts mehr halten. Leidenschaftlich küssen sie sich, ihre Zungen bestreicheln einander, während die beiden Frauen sich auf das nächste Feldbett fallen lassen. Myriam knöpft das Hemd von Tina auf und Tinas Hände wandern bereits unter Myriams Pullover und beginnen deren Brüste zu massieren... Philipp und Marta haben erstmal Myriams Angabe bezüglich des Gothic-Schuppens überprüft. Wie sich herausstellte, ist es keine Diskothek, sondern nur ein Shop für Gothic-Klamotten. Marta dachte schon, man könnte wieder die Flatter machen, aber Philipp meinte nur grinsend: „Sehr gut. Das paßt mir perfekt in den Kram.“ Da stand für Marta fest, daß ihr das, was als nächstes kommen sollte, garantiert nicht gefallen würde. Jetzt steht Philipp in dem Laden und begutachtet gerade ein paar T-shirts. Zum Teil wunderbare Sachen sind dabei – vor allem schwarze T-shirts. Besonders bei einem mit dem Aufdruck „Sonne macht albern“ muß er schmunzeln. Ein enges schwarzes Seidenhemd mit Rankenmuster gefällt ihm auch gut. Nur wird wahrscheinlich leider alles Geld für Marta draufgehen... Er schaut auf die Uhr. Schon 18 Uhr 55. „Mensch Marta!“ ruft er rüber zur Tür der Umkleidekabine. „Beeilen Sie sich ein wenig! Wir sind spät dran!“ „Ja, ja...!!“ flucht sie drinnen. Der Verkäufer hinter der kleinen Theke neben der Tür grinst breit. Er ist ein schlanker Mann mit langen, leicht zotteligen Haaren. Philipp geht zu ihm rüber. „Sag mal, steigt hier irgendwo heute abend eine Gothic-Feier?“ Der Mann mustert Philipp, der ja momentan nicht gerade in GothicKlamotten unterwegs ist. Offenbar ist er sich nicht sicher, ob Philipp nicht doch ein Polizist in Zivil ist. Schließlich kommt er zum Schluß, daß er es riskieren kann. „Heute um 22 Uhr in einer alten Fabrikhalle in der Deutschherrn-Straße. Nicht weit von hier.“ „Ok, alles klar. Danke.“ „So – bin fertig!“ ruft Marta und kommt aus der Umkleide. Dem Verkäufer und Philipp verschlägt es den Atem. Marta trägt hohe schwarze Lederstiefel, schwarze Nylons, einen kurzen schwarzen Lederrock, darüber ein schwarzes T-shirt mit der Aufschritt „Vom Teufel geritten“, an den Armen je zwei Nietenbänder, den Händen je einen Gelenkring mit Kralle und um den Hals ein dünnes Nietenband. „Jap...“ meint Philipp und nickt. „Genauso hatte ich mir das vorgestellt.“ Er sieht den Verkäufer an. „Reicht das?“ fragt Philipp und blättert drei Scheine von je 100 Reichsmark hin. Der Verkäufer schürzt erst skeptisch die Lippen, meint dann aber: „Eigentlich nicht, aber für die nette Lady gibt’s Rabat.“ „Danke. Kommen Sie, Marta, wir gehn.“ Als sie auf die Straße treten, regt sich Marta auf. „Nette Lady! Wie konnte er nur auf nette Lady kommen! Nett! Ich bin vielleicht geil, aber nicht nett!“ Hörbar knackt eine von Stefans Rippen, als eine der Wachen ihm den Knüppel in die Seite rammt. Dann packen sie ihn und klatschen ihn an die Wand. Schläge in die Nierengegend. Tritte. Er fällt zu Boden, spuckt Blut aus. Den Schmerz nimmt er nicht mehr wirklich war. Diese Behandlung hat er in letzter Zeit öfter erlebt – und man gewöhnt sich ja an alles. Schließlich reißen sie ihn an den Haaren wieder hoch und binden ihn wieder an den Stuhl fest. Inzwischen hat sich Oschmann ihm gegenüber an den Tisch gesetzt und eine Lampe auf Stefan richten lassen. „Och bitte, Standartenführer. Ich hab rund um die Uhr Licht – eure ach so tolle Foltermethode...Ich bin Licht allmählich gewöhnt.“ meint Stefan nur würgend und spuckt dann aus, was ihm direkt einen Schlag ins Gesicht einfängt. Ein blaues Auge und aufgeplatzte Lippen hat er ja schon. Eine der Wachen legt zwei Kabel auf den Tisch. Stefan verdreht die Augen. Nicht schon wieder Elektroschocks – das hatte er auch schon mal. Allmählich werden die Gepos echt einfallslos. Jörg Oschmann sieht seinen Blick. Und grinst. „Na, na, na, na...General...nicht heute. Heute reden wir nur.“ Im Hintergrund steht Gephardt an der Tür und stößt ein verächtliches Schnauben aus. Erstmal zündet sich Jörg eine Zigarette an. Stefan ist nach einer kurzen Unterbrechung durch die Prügel wieder in einem meditativen Zustand, sieht Oschmann wie durch einen langen Tunnel. „Stefan, es wird Dich freuen zu hören, daß wir Philipp aufgespürt haben. Weißt Du, wir haben einfach vor fast jedem Gothic-Laden im Reich einen Mann postiert mit Fahndungsbildern. Es ist einfach zu schön, wie berechenbar ihr doch seid. Heute abend werden wir Kipshoven festnehmen und dann kriegst Du Gesellschaft....Ich nehme nicht an, daß Du irgendwelche Geständnisse unterschreiben willst?“ Stefan starrt ihn nur ausdruckslos und müde an. Nach ein paar Augenblicken rückt Oschmann seine Augenklappe zurecht und meint dabei: „Na gut. Du hast übrigens Besuch. Vielleicht wirst Du dann gesprächiger.“ Oschmann steht auf und geht zur Tür. Als er sie öffnet, treten zwei Frauen ein. Die Sekretärin führt eine alte Bekannte herein. Petra. Die Welt ist doch arschklein! Zuletzt hatte er die Frau vor Jahren gesehen. Jetzt weiß er, daß Rettung naht. Langsam setzt sich Petra lächelnd auf den Stuhl, auf dem eben Oschmann saß. Aus dem Augenwinkel sieht Stefan aber noch eine andere, schemenhafte Bewegung. Christiane? schießt es instinktiv durch seinen Kopf. Irgendwas sagt ihm, daß sie hier ist. Schon früher hat er Geister gesehen; eine Offizierin von ihm, Jolanda Giusti, die vor ein paar Monaten gefallen war, war ihm auch schon erschienen. Bis heute ist er sich nicht klar, ob das nur Einbildung war oder nicht. Ein kaltes, stechendes Gefühl in seiner Schulter, daß sich dann rasend schnell ausbreitet, seinen Kopf erfaßt, beendet diese Gedanken. Seine Wahrnehmung von Petra, Gephardt und Oschmann verblaßt. Er fühlt wie er fällt... Petra hat sich kaum gesetzt und meint zu Stefan: „Morgen, Herr General...“, als Stefan anfängt zu zittern, bleich wird, seine Augen werden milchig und schließlich zucken seine Glieder so, daß er mit dem Stuhl nach hinten kippt. Die beiden Wachen, dazu Gephardt und Oschmann springen herbei, Petra springt von ihrem Stuhl. „Verdammt, was ist los?“ brüllt Oschmann. „Ich weiß nicht!“ schreit die Wache. „Er hat einen Anfall!“ stellt Gephardt etwas trockener fest. „Holt den Doktor!“ Petra ist schon an der Tür, reißt sie auf. Draußen steht noch die Sekretärin. „Frau Wüstefeld, holen Sie den Arzt! Schnell!“ Die Frau nickt nur und rennt los. Über Petras Gesicht jedoch huscht ein Lächeln. Der Plan hat geklappt. Jetzt liegt alles an Christiane... Nachdem sich alle am Abend am Nürnberger Bahnhof getroffen haben, ist man erstmal gemeinsam in die nächste Kneipe gegangen. Philipp ist dabei aufgefallen, daß sich Tina und Myriam an der Hand hielten, aber schnell wieder losließen, als sie seinen Blick bemerkten. Alle bestellen sich erstmal Cola oder Bier, dann instruiert Philipp alle, wie es weitergehen soll. „Also Leute: Haben wir alles?“ Fraker nickt. „Proviant und ich hab sogar ein paar Magazine für unsere Knarren auftreiben können.“ „Wunderbar. Was ist mit einem fahrbaren Untersatz?“ Jacke räuspert sich: „Wir haben zwei Geländewagen mit Ladefläche aufgetrieben. Gebraucht, aber noch relativ neu.“ Philipp nimmt einen kräftigen Schluck von seinem Bier und lehnt sich zurück. Er lächelt zufrieden; Leute, die ihn kennen, werden dabei aber seinen wachsamen Blick wahrnehmen, der ständig über die anderen Tische gleitet und die Kellner mustert, ob ihnen auch niemand sonst zuhört. „Ok. Folgendes: Marta und ich gehe heute abend aus.“ Fraker setzt entrüstet sein Glas ab. „Kapitän, was soll das! Wir sollen die Zeit totschlagen, während Sie sich vergnügen?“ Alle lachen. „Nein, nein Fraker. Marta und ich werden versuchen, die Spur von Petra Müller aufzunehmen. Ansonsten stimmt es: Ihr andern ruht euch bis morgen früh aus. In etwa einer halben Stunde ist Sperrstunde, dann müßt ihr im Quartier sein.“ Alle nicken. Philipp trinkt sein Bier aus. Auch die andern trinken aus und legen das Geld für die Getränke auf den Tisch. „Also gehn wir. Ich muß mich eh noch umziehen.“ verkündet Philipp. Als sie wieder draußen in der kühlen Abendluft stehen, nickt Philipp Myriam zu: „Also, bringen Sie uns zu unserm Quartier.“ Da die Unterkunft nicht weit vom Bahnhof entfernt ist, haben sie keinen weiten Weg. Schon nach ein paar Minuten sind sie da und alle inspizieren sofort das alte Haus. Und Philipp fühlt sich an das Haus erinnert, was seine Eltern sich vor fast 20 Jahren in Köln-Weiden kauften, um es zu renovieren. Er wirft seinen Rucksack auf eines der Feldbetten und zieht sich dann um. Die rein zivilen Klamotten zieht er aus und wirft sich dann in seine schwarzen Klamotten, inklusive Nieten. Als er sich noch seinen schwarzen Mantel überwirft, ruft er Tina zu sich. „Ja, Kapitän?“ „Oberfähnrich, seien Sie jetzt bitte ehrlich zu mir.“ „Bitte?“ „Haben Sie was mit Frau Schneider?“ Er stellt die Frage mit leise Stimme und sich umsehend, daß die andern gerade nicht in Hörweite sind. Fast schon verlegen nickt Tina. „Ja...ist das schlimm.“ Philipp lächelt kumpelhaft. „Nein, gar nicht. Sie vergessen, daß ich auch mit Generalmajorin Alleker verheiratet war. Ich hoffe nur, Sie wissen, auf was Sie sich da einlassen. Nichts ist furchtbarer, als Menschen, die man liebt, im Krieg zu verlieren.“ „Ich weiß...aber was soll ich machen? Es war Liebe auf den ersten Blick.“ „Verstehe...Also Oberfähnrich, ich muß jetzt gehen. Keine Dummheiten heute Nacht und denken Sie darüber nach, daß uns nach Krakowskys Tod ein Kämpfer fehlt.“ „Ja. Bis dann Kapitän.“ „Bis dann.“ Philipp tritt an ihr vorbei und winkt Marta zu. „Kommen Sie, Marta!“ Tina blickt ihm für Momente nach, als er durch die Tür ins Treppenhaus entschwindet. Erst da wird ihr klar, daß er sie mit dem Zaunpfahl quasi erschlagen hat... Marta ist zuerst draußen. Als Philipp neben ihr aus dem Hausflur auftaucht, fällt ihr auf, daß er seinen Säbel dabei hat – auf den Rücken geschnallt wie immer. „Wozu der Säbel?“ fragt sie. „Aus dem selben Grund, warum Sie Ihre Knarre dabei haben Marta – man weiß ja nie.“ Marta wirft sich ebenfalls den dunklen Mantel über, den sie sich noch im Gothic-Laden gekauft hat. Dann gehen beide zügig Richtung Deutschherrn-Straße. Myriam hat ihnen noch erklärt, wie man dort hinkommt. Zum Glück begegnet ihnen keine Gepo-Patrouille. Angesichts der Tatsache, daß inzwischen Ausgangssperre herrscht wundert Philipp das. Als sie an der ersten Seitenstraße vorbeikommen, erkennt Philipp aus dem Augenwinkel die beiden Karren, die Jacke und Fraker organisiert haben. Schweigend marschieren die beiden Gestalten durch die nur schwach beleuchteten Straßen. Es ist Krieg und da herrscht Verdunkelung, auch wenn Nürnberg noch nicht zu den bedrohten Städten gehört. Selbst die britischen Bomber beschränken sich bislang nur auf Nordfrankreich, Flandern, die Niederlande und kaiserliche Nordseehäfen. Philipp kann die Verdunkelung nur recht sein. Die Dunkelheit ist die Freundin der Rebellen, der Widerstandskämpfer, der Untergrundaktivisten, der Kommandotrupps. So wie sie es sind. Nach einer halben Stunde erreichen sie die Fabrikhalle. Die Fenster in 10 m Höhe sind abgedunkelt, kein Mensch ist zu sehen. Die einzige Tür, die sie finden ist eine Eisentür. Philipp klopft. Ein stämmiger Türsteher öffnet die Tür. Von drinnen wummert bereits krachige Musik heraus. Schnell winkt der Mann sie rein und schließt hinter ihnen die Tür. Ein weiterer Türsteher, etwas jünger, hält sie an. „Tut mir leid Leute, aber wir müssen euch durchsuchen.“ verkündet er mit einem hämischen Grinsen und einem Blick auf Philipps Säbel. In dem Moment klopft es wieder an die Tür. Als der erste Türsteher sie aufmacht, kommt Lars Edgar Tibori hereingeschneit. Verärgert starrt Philipp ihn an, sagt aber nichts. Erstmal muß das Türsteherproblem gelöst werden. Freundlich fragt er: „Reicht keine Zusicherung, daß wir keine Gepos sind.“ Mit ernstem Gesicht schüttelt der Türsteher den Kopf. Ein Zufall retten Philipp. Die zweite Tür zum Innenraum geht auf und ein alter Bekannter steht vor Philipp, ein schlanker Mann Ende 20, mit leichtem Spitzbart und langen blonden Haaren. Martin. Philipp hat ihn vor über zehn Jahren im LaLic in Köln kennengelernt. Auch Martin erkennt ihn und greift ein: „Freunde, ihn und seine Begleiter braucht ihr nicht zu durchsuchen. Die sind keine Gepos.“ „Und wieso trägt der Knabe dann einen Säbel und eine Knarre am Gürtel?“ Martin grinst breit: „Weil er ranghoher Offizier bei ‚Schimäre‘ ist.“ Sowas öffnet in gewissen Kreisen Türen. Der Türsteher tritt zu Seite und Martin winkt die drei „Schimäre“-Kämpfer herein. Nachdem die Türsteher die letzte Tür hinter ihnen geschlossen haben, führt Martin sie durch eine riesige Halle. Unten gibt es zwei Bars, an denen sich Gothics im vollen Ornat tummeln. Auf der Tanzfläche haben sich ein paar echte Rocker versammelt und head-bangen. Die Blitze der Lichtanlage erhellen alles nur wage. Nebelschwaden vom Rauchwerfer ziehen durch den Raum. An den Seiten der Tanzflächen stehen weitere Gothics. Unterwegs herrscht Philipp Lars Edgar an: „Was tun Sie hier, verdammt?“ „Na, ich laß mir doch den Spaß hier nicht entgehen. Außerdem ist Verstärkung immer gut.“ Da muß Philipp ihm recht geben. „Na gut, Tibori, aber Sie mißachten nie wieder einen Befehl von mir.“ „Geht klar, Chef.“ Philipp löst seinen Pferdeschwanz und läßt seine Haare offen über die Schultern fallen. Dadurch ist der Griff des Säbels besser verborgen. Auf dem Weg durch die Halle sieht er auch ein paar Bekannte Gesichter aus früheren Tagen – Bianca und Andrea und Corax. Martin führt die drei zu einer eisernen Treppe, die am hinteren Ende der Halle auf eine Plattform führt. Dort ist eine weitere Bar, vor der drei Stehtische stehen. Und direkt daneben ist die Ecke des DJs. Als sie die Plattform erreicht haben, erkennt Philipp einen weiteren alten Bekannten in dem DJ wieder – Ziggy. Als Ziggy Philipp sieht nickt er ihm zu und hebt zum Gruß die Hand. Philipp grüßt zurück und stellt sich dann zu Martin, Marta und Lars Edgar an einen der Stehtische. „Philipp, was machst Du hier mit Deinen Leuten? Ich dachte ihr seid in Russland.“ läßt Martin seiner Neugierde freien Lauf. Philipp zuckt die Achseln. „Stimmte eigentlich auch.“ Nach einer kurzen Pause fügt er hinzu: „Aber Du hast sicherlich von der Sache mit Stefan gehört.“ Martin nickt. „Ja, das hab ich gehört. Scheiße gelaufen für ihn.“ „Ja...“ Mit einem Wink gibt er Tibori und Marta zu verstehen, sie sollen rüber zur Bar gehen und was zu trinken holen. Dann wendet er sich wieder Martin zu. „Aber wir sind unterwegs, um ihn rauszuholen.“ „Und wie stellt ihr euch das vor? Ich hab gehört, er soll in Schattenlagant sein.“ „Ich weiß.“ Schelmisch grinsend zündet sich Philipp eine Zigarette an. „Ich weiß,“ sagt er nochmal, „na und?“ „Na und? Niemand weiß, wo Schattenlagant liegt!“ „Doch, ich bin mir fast so gut wie sicher, daß es eine Person weiß.“ „Und die wäre?“ „Petra.“ Martin wollte gerade einen Schluck Whisky runterkippen, setzt sein Glas ab langsam wieder ab und blickt Philipp ungläubig an. „Du meinst die Petra?“ „Die meine ich. Die Schwarze Fee. Sie ist kurz vor Stefans Gefangennahme und direkt nach einer Razzia im Lic in Köln aufgetaucht und hat unseren Leuten geholfen. Seitdem ist sie wieder verschwunden. Aber ich vermute mal, sie will Schattenlagant ebenfalls finden. Würde mich nicht wundern, wenn sie da schon weiter ist als wir.“ „Ja, die Razzia im Lic. Echte Scheiße. Ich war zum Glück da nicht dabei. Die Kölner Szene hat sich seitdem zerstreut, ein Teil hat sich hierher gerettet...“ bemerkt Martin. Dann kommt er wieder zurück zum Thema, während Marta und Tibori zwei Bier und einen Wodka bringen. Letzteren für Philipp. „Also Philipp, wie soll’s jetzt weitergehen?“ „Martin, wir müssen Petra finden. Wenn wir sie finden, haben wir eine Chance. Eine andere Spur – schon gar nicht eine bessere – haben wir nicht.“ „Vielleicht kann ich da weiterhelfen...“ meldet sich jemand hinter ihnen zu Wort. Tibori und Marta greifen instinktiv an ihre Gürtel zu den Waffen, aber Philipp hält sie zurück, denn er erkennt den leicht hager wirkenden Mann mit den langen Haaren und dem T-shirt, auf dem ein roter Kommunistenstern prangt sofort: „Xia Ven!“ begrüßt Philipp den alten Bekannten bei seinem Kampfnamen. Den wirklichen Namen kennt kaum noch wer. Xia Ven ist längst berüchtigt, angeblich hat er paranormale Fähigkeiten. Philipp ist sich nicht wirklich sicher, was er davon halten soll; man hat ihm nur einmal erzählt, daß Xia Ven die Luft zur Waffe machen kann. Per Handschlag begrüßen sich Philipp und Xia Ven, der sich eben erst einen Whisky geholt hat und sich jetzt an den selben Tisch stellt. „Ok, wie kann ich helfen, den General rauszuholen?“ fragt Xia Ven und läßt erkennen, daß er gut informiert ist. „Du könntest uns sagen, wo diese Petra ist?“ platzt es aus Marta heraus. „Oh, entschuldige,“ schaltet sich Philipp ein, „ich hab ja noch gar nicht alle vorgestellt.“ Er deutet auf seine beiden Begleiter: „Das sind Gefreiter Tibori und Frau Leutnant Marta Rambowicz.“ Umgekehrt stellt er dann auch die beiden alten Bekannten vor: „Das sind Martin und Xia Ven. Und wenn einer uns helfen kann, dann Xia Ven.“ „Zuviel der Ehre.“ meint Xia Ven verlegen. „Aber ich fürchte, ich kann euch dieses Mal einfach nur weiterverweisen.“ „Und an wen?“ „An mich!“ ertönt es hinter Philipp. Als er sich umdreht, raunt ihm Marta über die Musik hinweg zu: „Noch mehr so Überraschungen und mir kommt’s hoch...“ „Philipp, darf ich vorstellen: Ben.“ bemerkt Xia Ven trocken. Philipp mustert die große dunkle Gestalt. „Wer sagt mir, daß er kein Spitzel ist?“ gibt sich der Kapitän zunächst mißtrauisch. Ben wiegt sein eigenes Glas in der Hand und kippt den Wodka runter. Dann meint er: „Ich hab in der preußischen Armee gedient. Ich bin ein guter Freund von Petra und soll euch verraten, wo Schattenlagant ist. Und wenn Dir das noch nicht reicht, dann kannste ruhig die Idioten da unten fragen.“ Martin dreht sich um und sieht runter in die große Halle, läßt seinen Blick über die Tanzfläche und zum Eingang schweifen. Dort kommen gerade vier Mann in schwarzen Klamotten rein – Gepo-Uniformen. Ein wenig wundert sich Martin über die Säbel, die sie tragen. „Philipp, Du ziehst Ärger immer noch magisch an.“ konstatiert Martin trocken. Philipp stellt sich neben ihn und schaut nach unten. „Ne, in letzter Zeit ging’s eigentlich.“ Nach kurzem Überlegen dreht sich Philipp um. „Xia Ven, würdest Du Ziggy bitten, den Rauch was aufzudrehen?“ „Das dürfte nicht schwer sein. Du kennst Ziggy ja...“ Martin beobachtet derweil die Gepos weiter. Einer geht zur Bar, zwei verteilen sich über die Tanzfläche, einer geht in Richtung der Toiletten. „Philipp, was jetzt?“ „Wir nehmen sie gefangen. Aber lebend.“ „Geht klar.“ Philipp nickt seinen Leuten nur zu und während Ziggy den Nebelwerfer voll aufdreht, gehen sie langsam die Treppe runter. Mit dem Fahndungsbild in der Hand gehen zwei der Gepos über die Tanzfläche. Die Tanzenden in ihrer direkten Nähe bleiben auf einmal stehen und weichen von den Gepos weg. Als der künstliche Nebel immer dichter wird, wird einem der Gepos mulmig. Er sucht den Sichtkontakt mit seinem Kollegen, als eine bleichgeschminkte Frau mit langen schwarzen Haaren aus dem Nebel hervorbricht. Mit einem lauten „Laß Dich umarmen, Schnuckelchen!“ stürzt sie auf den völlig perplexen Gepo zu und umarmt ihn. Dann stößt Bianca den Mann wieder von sich weg und starrt ihn mit ihren schwarz umränderten Augen an. „Ach, entschuldige, eine Verwechslung. Aber ich glaube da will einer mit Dir sprechen.“ Sie deutet mit dem Finger auf einen Punkt hinter dem Geheimpolizisten. Der dreht sich um – und kriegt sofort die geballte Rechte von Martin voll auf den Punkt. Gleichzeitig tritt ihm Bianca von hinten in die Kniebeuge. In nur Sekundenbruchteilen geht der Mann mit einem Aufschrei zu Boden, rücklings. Und Bianca setzt dann sofort einen ihrer Stiefelabsätze sachte auf seinen Hals. „Ich fürchte, für Dich ist der Abend gelaufen...“ stellt sie mit triumphierendem Grinsen fest. Der zweite Gepo auf der Tanzfläche wirbelt herum, als er den Schrei seines Kollegen hört. Marta steht auf einmal vor ihm und zieht ihm in einer raschen Armbewegung die Nieten quer durchs Gesicht. Der Gepo taumelt zurück, fängt sich wieder, wird von zwei Gothics zur Seite geschubst – und dann hält ihm auf einmal Lars Edgar Tibori die Waffe an die Stirn. „Keine Bewegung, Kumpel. Marta, entwaffnen Sie ihn bitte?“ „Aber sicher!“ Zur selben Zeit kommt der dritte Gepo, der die Toiletten wieder inspiziert hat, wieder aus diesen heraus. Direkt neben der Tür hat sich Ben postiert. Der Geheimpolizist kriegt gar nicht mit, wie ihm geschieht, als Ben ihn am Kragen packt, im Halbkreis herumwirbelt und mit voller Wucht gegen die Wand klatscht. Stocksteif und mit einer bluttriefenden Platzwunde an der Stirn kippt der Gepo einfach nach hinten und bleibt liegen. Der Gepo an der Bar hat davon nichts mitgekriegt. Er hält momentan dem Barkeeper ein Bild von Kipshoven unter die Nase, aber der Mann schüttelt nur den Kopf. „Zeigen Sie mal her!“ Eine gut gebaute Frau in schwarzem, seidigem Kleid und mit kurzen schwarzen Haaren ist neben dem Gepo aufgetaucht und bedeutet mit einem Wink dem Barkeeper, ihr eine Flasche Whisky zu bringen. Sie wirkt ziemlich neugierig. „Hier. Kennen Sie diesen Mann? Oder diesen hier?“ Er legt noch ein Phantombild von Fraker drauf. Die Frau nimmt Philipps Bild und studiert es eingehend. „Warten Sie mal...“ Sie dreht sich langsam mit dem Rücken zur Bar, hält das Papier am ausgestreckten Arm vor sich hin. „Sieht der nicht genau aus wie....“ „Wie wer?“ fragt der Gepo mit einem Funkeln in den Augen. „Wie der da?“ Sie läßt das Blatt sinken und deutet auf Philipp. Die anderen Gäste haben einen Platz um diesen freigemacht und dort steht Philipp mit dem Säbel in der Hand. Der Gepo springt von der Bar zurück und zieht seinerseits seinen Säbel. Philipp rührt sich nicht, lacht nur: „Ah, da hat jemand Lust auf ein Tänzchen! Ziggy!!! Corvus Corax bitte!!“ Ja, die Musik einer Corvus-Corax-Platte wäre jetzt echt passend zu einem gepflegten Schwertkampf. Andererseits wäre der bei diesen vielen Leuten viel zu riskant. Das Glück eilt Philipp zu Hilfe. Als die Frau an der Bar ihre Whisky-Flasche bezahlt hat, dreht sie sich wieder zu dem Gepo um, der etwas perplex, aber kampfbereit mit dem Rücken zu ihr steht. Was dann kommt, überrascht Philipp doch: Die Frau zieht dem Gepo einfach die WhiskyFlasche über den Schädel, die in mehrere Scherbenteile zerbricht. Das gute Zeug ergießt sich über den Mann und den Boden; der Geheimpolizist läßt den Säbel fallen, verdreht die Augen und sackt wie ein naßer Sack zu Boden. Alle Umstehenden klatschen und Philipp steckt den Säbel wieder ein. Dann geht er auf die Frau zu. „Danke! Wie heißen Sie?“ „Diana.“ „Diana, ich schulde Ihnen etwas, mindestens ne Flasche Whisky. Aber leider muß ich jetzt weg, ich habs eilig.“ „Kein Problem, ich komm einfach mit.“ Bevor Philipp antworten kann, ist sie schon auf dem Weg zur Tür. Und da muß Philipp ohnehin hin. Auf dem Weg zur Tür, begegnen ihm Martin und Bianca. „Danke Leute.“ bedankt sich Philipp. „Immer doch. Aber würdest Du bitte das nächste Mal ohne Anhang kommen?“ witzelt Bianca und umarmt Philipp zum Abschied. Martin reicht ihm die Hand. „Keine Sorge, Kapitän, Tibori hat einen der Typen im Schlepptau, um die andern drei kümmern wir uns.“ Philipp nickt nur und geht dann nach draußen. Dort haben sich bereits die andern versammelt: Marta und Tibori, Xia Ven und Ben. Tibori fragt gerade einen der Gepos aus, während Marta diesem die Knarre an den Kopf hält. Als Philipp auf die Gruppe vor dem Fabrikgebäude zugeht, kommt ihm Tibori schließlich entgegen. „Kapitän! Die haben uns aufgespürt, weil sie vor jedem Gothic-Laden Posten hatten.“ „Scheiße! Das bedeutet, daß sie auch unser Versteck kennen!“ zischt Philipp. „Genau das.“ bestätigt Tibori. „Und da ist noch was.“ „Was denn?“ „Die Soldpapiere weisen ihn als Mitglied der Kampftruppe ‚Kronos‘ aus. Sagt Ihnen das was?“ „Ja. Das sind die Typen, die Stefan auch gefangennahmen.“ Ein Räuspern schreckt Philipp auf. Langsam dreht er sich um. „Diana, da sind Sie ja! Wollen Sie uns noch mehr helfen oder was?“ „Wenn ich dann endlich weiß, was hier los ist...“ Mein Gott, ist die Frau neugierig, schießt es Philipp durch den Kopf. „Ok. Diana, wenn Sie uns helfen wollen, dann holen Sie doch bitte mal die Uniformen der anderen Gepos, ja?“ „Deren Uniformen? Wozu das denn?“ „Erklär ich später.“ „Na gut.“ Etwas enttäuscht dreht sich Diana um und geht wieder zurück in die Fabrikhalle. Philipp folgt Tibori rüber zu Marta. „Marta, ziehen Sie dem Gepo doch bitte die Uniform aus. Und dann verschnürren Sie ihn mit was auch immer...“ „Zu Befehl.“ Sie und Tibori führen den Gepo in eine dunkle Ecke an der Seite eines Lagerhauses und sorgen dafür, daß er sich die Nacht über nicht mehr von der Stelle rührt. „Zu Ihnen...“ wendet sich Philipp an Ben. „Sie meinten, Sie könnten uns weiterhelfen?“ Ben schaut sich erst noch schnell um, ob nicht noch mehr Gepos herumschwirren und antwortet dann: „Naja, Petra ist in Schattenlagant und ich bin auf dem Weg dorthin. Und ich hab auf einer Karte den ungefähren Standort eingezeichnet.“ Mit diesen Worten holt Ben aus der Innentasche seines schwarzen Mantels eine etwas zerknitterte Karte. „Ich habs hier eingezeichnet.“ „Woher haben Sie die Informationen?“ „Von Petra. Sie hat mir auch gesagt, wo ich Sie finden kann, Kapitän.“ Philipp runzelt kurz die Stirn, gibt sich dann aber gelassen und beschließt, sich die Frage für später aufzuheben. Er nimmt etwas zögernd die Karte ein. „Und jetzt, Ben?“ „Ich werde nach Schattenlagant zu Petra reisen. Keine Sorge, Kapitän. Sie können auf unsere Hilfe zählen.“ „Wie werden wir unsere Aktionen abstimmen können?“ „In etwa einer Woche können wir uns in Bludenz treffen.“ Etwa 200 m entfernt biegen zwei Fahrzeuge mit quietschenden Reifen um die Ecke und rasen auf sie zu. „Ich muß jetzt weg.“ stellt Ben nur fest und eilt schon um die nächste Ecke des nächstbesten Fabrikgebäudes herum. Und weg ist er, nur ein Schatten in der Nacht. Philipp wirbelt herum. „Leute, wir müssen sofort weg hier!!“ ruft er Marta und Tibori zu, die gerade zurückkommen. Aus der Diskothek kommt Diana mit einem Rucksack angerannt. Als sie sieht, wie Philipp, Marta und Lars Edgar ihre Waffen ziehen, bleibt sie stocksteif stehen, aber Xia Ven zieht sie zur Seite in den Schatten. „Sind Sie verrückt so offen darzustehen?“ faucht er sie an. Aber als die beiden Fahrzeuge mit quietschenden Reifen halten, erwartet alle eine wohltuende Überraschung: Oberst Christian Jacke kurbelt das Fahrerfenster des vordersten Wagens runter. „Leute, schnell, steigt auf die Ladefläche! Wir haben Besuch im Schlepptau!“ „Xia Ven, das sind unsere!“ brüllt Philipp. Marta und Tibori sind als erste am zweiten Wagen und klettern auf die Ladefläche. Philipp springt hinten beim ersten Wagen drauf, Xia Ven folgt ihm und beide zusammen helfen Diana hoch. „Jacke, gib Gas!“ Das läßt sich der Oberst nicht zweimal sagen. Schließlich sind sie vor zehn Minuten den Gepos nur knapp entkommen, als diese die von Myriam besorgte Unterkunft stürmen wollten... Freitag, der 17. Oktober „Für einen Kommandeur besteht eine Schlacht emotional aus drei Phasen: Die erste Phase ist die Planungsphase, in der alles sehr angespannt ist, man ist nervös und innerlich verunsichert, versucht sich Entschlossenheit einzureden. Das gelingt nicht immer.“ General Karolina Sus am Vorabend der Panzerschlacht von Jakovlevo zur Journalistin U.Reindl Mitternacht ist schon durch und das Licht in dem zum Hauptkartenraum umfunktionierten Speisesaal ist aus Gründen der Verdunkelung gedämmt – nur zwei Petroleumlampen brennen. Schon seit drei Stunden dauert die Stabssitzung, in der Karo nochmal darüber diskutieren läßt, ob es dabei bleibt, hier, in Jakovlevo, Widerstand zu leisten. Die Lageentwicklung während des Tages spricht eigentlich dafür. Den letzten großangelegten Frontalangriff Mudras hat man am Nachmittag trotz etlicher brenzliger Situationen zurückschlagen können. Man hat sogar rund 2000 Gefangene gemacht. Ein Jagdgeschwader der Deutschen Exilarmee hat seit Mittag endlich massiv in die Kampfhandlungen in der Luft eingegriffen und dadurch die beiden „Schimäre“-Flakabteilungen und Bohnsacks Kampfgeschwader entlastet. Aber immer noch lasten schwere Sorgen auf den Führungsoffizieren von „Schimäre“. Klar, die Trupps des Spezialbataillons 1 werden bis zum Morgengrauen in den vorbereiteten Stellungen bei Jakovlevo sein, ebenso Schoeps‘ Kavallerieregiment, dessen einzelne Teile man nach dem Abwehrerfolg vom Nachmittag endlich wieder zusammenfassen kann. Die Verlegung aller verfügbaren Pak-Trupps (insgesamt 7) nach Jakovlevo läuft ebenfalls. Aber die Sorge um die Nordflanke plagt Karo. Alle anderen Ordnungspunkte sind bereits abgehakt und ein paar der Stabsoffiziere haben den Raum bereits verlassen, um ihre Sachen fertig zu packen. Morgen wird dieser Ort hier zum Schlachtfeld werden. Conny holt gerade für sich, Karo und Valkendorn Kaffee, Valkendorn ist nochmal bei den Funkern, um neueste Berichte von der Nordflanke einzuholen. Karo hängt sichtlich müde im Stuhl und starrt auf die große Karte, auf der bunte Striche und Linien den Verlauf der Schlacht zeigen. Für einen Laien nur bloßes buntes Chaos, für Militärs spricht der Stand der Dinge eine allzu deutliche Sprache: Die Schlacht steht auf der Kippe. Beide Seiten haben jeweils nur eine Chance siegreich zu bleiben und das ist Jakovlevo. Marco Konrad legt ihr beruhigend die Hand auf die Schulter. „Laß den Kopf nicht hängen, Karo.“ Sie legt ihre Hand auf seine. „Danke, Marco, aber es geht schon. Ich hab nur zu wenig Schlaf. Und überhaupt: Du solltest auch schlafen. Morgen geht’s hoch her.“ „Zu Befehl, Chefin.“ spöttelt er und geht dann rüber zur Tür. „Also bis morgen Karo. Ich hoffe, Dein Plan geht auf.“ Sie nickt nur, ohne den Blick von der Karte abzuwenden. Als er draußen ist, meint sie mehr zu sich selber: „Das hoffe ich auch.“ Valkendorn kommt rein, mit einem jener Notizzettel in der Hand, die für ihn so typisch sind. „Unsere Funker haben mal wieder fleißig gearbeitet!“ verkündet er. „Wir haben viele Funksprüche des Feindes aufgeschnappt, aber leider nicht entziffern können. Die arbeiten zunehmend mit immer neuen Codierungen. Aber die Aktivität der gegnerischen Funker läßt für morgen auf einen Angriff schließen.“ Erst jetzt dreht Karo den Kopf, um Valkendorn anzusehen. „Und? Erzählen Sie mir was neues, General! Was ist mit unserer Nordflanke?“ Stirnrunzelnd registriert sie Valkendorns Lächeln, was sich aber sofort erklärt, als er sagt: „Gute Nachrichten! Unsere polnischen Frontnachbarn haben von Duhovscina aus einen Gegenstoß geführt. Angeblich haben sie 3000 Gefangene gemacht und drängen den Feind zurück! Unser 1. Regiment rüstet sich zu einem Gegenangriff gegen Spas-Lipki, um den durchgebrochenen Kaiserlichen den Rückweg zu versperren. Ich fürchte, wir haben Brieskisch dieses Mal echt am Arsch.“ Karo steht auf und seufzt hörbar. „Na gut. Dann müssen wir ja nur noch ihre Panzer ausschalten....“ meint sie müde und gähnt. Valkendorns Miene wird wieder ernster. „Frau General, ich bin sicher, wir und vor allem Dingen Sie werden das schaffen. Glauben Sie mir, ich spüre, wenn ein Kommandeur vom Glück begünstigt ist. Sie gehören dazu.“ Irgendwie traurig sieht Karo ihn jetzt an. „So wie Stefan?“ fragt sie und geht dann an Valkendorn vorbei zur Tür. „Sie sollten schlafen, Frau General.“ „Erst will ich noch unseren besonderen Gast besuchen. Gute Nacht, Herr General.“ Fast lautlos gleitet Karo durch die halb geöffnete Tür. Erst jetzt bemerkt Valkendorn, daß die paar Stabsmitarbeiter, die noch die Karte nach neuen Meldungen aktualisiert hatten, ihn stumm ansehen. Nach ein paar Sekunden findet er zu seiner Haltung zurück. „Hey, Leute, weiterarbeiten!“ schnauzt er sie an. Alle widmen sich sofort wieder ihrem Papierkram. Seine Notizen steckt Valkendorn in die Tasche und dann geht er auch in die Eingangshalle. Dort begegnet ihm Conny mit drei vollen Kaffeetassen. „Oh, General, ist Karo da drin?“ „Nein, sie ist schon gegangen und ich geh jetzt auch schlafen.“ „Wollen Sie keinen Kaffee mehr?“ „Nein, trotzdem danke.“ Wortlos geht Valkendorn nach oben. Und Conny steht da mit drei Tassen frischem Kaffee. „Was mach ich jetzt mit dem Zeug?“ Grüblerisch blickt sie auf den Kaffee und zuckt dann die Achseln. „Trink ich’s eben selber...“ murmelt sie und geht auch nach oben. Beke hat sich eigentlich schon hingelegt. Das Geräusch andauernd vorbeifahrender Laster auf der Hauptstraße, die trotz des starken Regens und der aufgeweichten Fahrbahnen Munition nach vorne bringen, hat nachgelassen. Dafür waren alle dort draußen den Geräuschen nach zu urteilen den ganzen Tag über sehr aktiv. Was geht da vor? Über diese Frage ist sie eingeschlafen, obwohl es mit der dünnen Decke recht kühl ist. Jetzt schreckt sie wieder auf, als die Tür geöffnet wird und Licht in den Raum fällt. Mehrmals muß Beke blinzeln um die Gestalt zu erkennen, die in der Tür steht. Eine Frau, deren schlanke, anziehende Figur von dem Kampfanzug leicht betont wird. „Frau General?“ Karo geht in den Raum hinein und kniet sich vor Beke hin, um ihr direkt in die Augen sehen zu können. „Morgen wird der Feind uns wahrscheinlich hier angreifen. Ich werde der Wache Befehl geben, Ihnen eine Waffe zu geben, sollte Ihr Leben in Gefahr sein.“ „Danke.“ Nach einer Pause fragt Beke dann: „Woher wollen Sie wissen, daß ich ‚Schimäre‘ nicht wieder verrate?“ In Karos Augen tritt eine nur selten bei ihr so deutliche Härte, als sie zwar nichts sagt, aber mit einem Finger an ihrem Hals von links nach rechts entlangfährt. Dann erhebt sie sich wieder und geht zur Tür. Beke ruft sie nochmal zurück: „Werden Sie mich töten, wenn Reiss nicht überlebt?“ Nur einen wütenden Blick wirft Karo über die Schulter zurück, dann schließt sie die Tür hinter sich, die sofort wieder verriegelt wird. Etwas erschrocken läßt sich Beke zurück auf ihr nicht sehr bequemes Kopfkissen fallen. „Scheiße man...scheiße man...“ Die Wachen haben den Gefangenen auf die Krankenstation gebracht und dort mit Gurten auf einem der Betten fixiert – falls er doch noch wieder zu sich kommt. Dr. Tschirner hat gerade die ersten Untersuchungen abgeschlossen. An der gegenüberliegenden Wand stehen Gephardt, Oschmann, Leikert und Petra. „Und Doktor, was fehlt ihm?“ fragt Gephardt, wie üblich ungeduldig. Tschirner kommt zu ihnen rüber und wirft nochmal einen Blick über die Schulter, dann antwortet er: „Ich hab keine Ahnung, an was der General leidet. An der Folter kann es nicht liegen, dazu waren wir bislang noch zu sanft. Allein mit Stromschlägen und Prügel kriegen Sie das in so kurzer Zeit nicht hin. Vielleicht ist es eine Art Mangelerscheinung. Aber...“ „Was aber?“ hakt Oschmann nach. Tschirner zuckt die Achseln. „Es ist kein mir bekanntes Krankheitsbild. Der Puls ist praktisch nicht nachweisbar, die Atmung ist so flach, daß in seiner Lunge quasi Windstille herrschen muß.“ „Ist er tot?“ Leikert runzelt die Stirn. Aber Tschirner schüttelt den Kopf. „Nein. Seine Pupillen bewegen sich. So als sähe er irgendetwas. Aber sie reagieren nicht auf Lichtreize, sondern bewegen sich unabhängig davon. Vielleicht ist es sowas wie eine besonders tiefe Meditation...Ich weiß es echt nicht. Nichtmal, was das ausgelöst hat.“ „Naja,“ wirft Gephardt ein, „es fing an, wie Frau Müller sich ihm gegenübersetzte.“ „Moment mal! Wollen Sie andeuten, ich sei dafür verantwortlich?“ schnappt Petra und baut sich vor dem mindestens zwei Köpfe größeren Gephardt auf. „Vielleicht.“ faucht Gephardt zurück, worauf Petra sauer erwidert: „Es könnte genausogut Ihre Inkompetenz gewesen sein!“ „Hey, auseinander!!“ herrscht Oschmann beide an. „Frau Müller, Sie gehen jetzt besser in Ihr Quartier!“ fügt er hinzu. Erhobenen Hauptes wendet sich Petra ab und verläßt das Lazarett. An der Tür begegnet ihr die Sekretärin. „Standartenführer Oschmann!“ „Was ist, Frau Wüstefeld?“ „Schlechte Nachrichten aus Nürnberg, Standartenführer.“ Sie reicht ihm eine kurze Notiz. „Was ist los?“ will Leikert wissen. Sein Chef zerknüllt das Stück Papier und knurrt: „Der Zugriffsversuch gegen Kipshoven ist in Nürnberg gescheitert. Die sind untergetaucht. Scheiße! Scheiße!“ Innerlich spürt Oschmann, wie sich dunkle Wolken über Schattenlagant zusammenbrauen. Irgendwas hat er übersehen. Aber was? „Doktor, wird Reiss überleben?“ will er wissen. Tschirner verdreht die Augen. „Standartenführer, ich weiß es wirklich nicht! Schließlich bin ich nicht Gott...In einer Woche kann ich Ihnen vielleicht mehr sagen.“ Nachdenklich reibt sich Oschmann das Kinn und beschließt, demnächst mal wieder zum Rasierer zu greifen. „Na gut, Doktor, ich geb Ihnen eine Woche. Dann jagen wir dem General einfach so eine Kugel durch die Birne.“ Ohne ein weiteres Wort über die Angelegenheit zu verlieren geht jetzt auch Oschmann, gefolgt von Leikert und Gephardt. Kopfschüttelnd setzt sich Tschirner an seinen Arbeitstisch und geht nochmal alle Untersuchungsdaten durch, die er bislang hat. Er wird nicht schlau daraus. Im Grunde genommen ist Reiss in einem Zustand, so tot wie man als Lebender nur sein kann. Nach einer Weile merkt er, wie der Sekundenschlaf nach seinen Augenlidern greift. Also steht er auf, hängt seinen weißen Kittel an den Haken und geht zur Tür. Noch einen letzten Blick wirft er auf seinen mit einem weißen Tuch bis zur Brust zugedeckten Patienten, dann macht er das Licht aus. Draußen grüßt er die beiden Wachen vor der Tür. „Paßt mir gut auf ihn auf, daß er mir nicht wegläuft!“ „Wird er sicher nicht!“ flaxen die beiden Wachen zurück. Das Gefühl des Fallens durch einen kalten Schacht hat eine nicht näher bestimmbare Zeit angehalten. Dann – blackout! Jetzt fühlt er allmählich wieder etwas. Keine Schmerzen mehr! Und er liegt auf irgendetwas warmem, weichem. Langsam öffnet er die Augen, blinzelt ein paar Mal in dämmeriges Licht. Und was Stefan sieht, läßt sein Herz einen Hüpfer machen, so scheint es ihm. Eine sanft lächelnde Frau mit einem wunderschönen Gesicht, umrahmt von schulterlangem, leicht rötlichhellbräunlichem Haar. Es ist...aber das kann nicht sein... „Christiane...“ flüstert er. Sie lächelt und streicht ihm mit einer Hand über die Wange. „Ja, ich bin es, Stefan. Hätteste nicht erwartet, was?“ Er versucht aufzustehen und es klappt auch. Die Hütte, in der sie sich befinden, erkennt er wieder. Es ist die Hütte auf dem Fischteich-Gelände in der Eifel, das eigentlich den Gebrüdern Gehlfahrt von der Korps-Werkstatt gehört, „Schimäre“ aber als Agentenversteck dient. Etwas verwirrt sitzt er auf der Bettkante neben Christiane, registriert, daß er Zivil trägt: Ein Baumfäller-Hemd und blaue Jeans. Verwirrt fragt er: „Wie komme ich hierher..? Ich war doch eben noch...Momentmal: Chrissi, Du bist doch tot!“ „Ja. Sehr richtig. Du hast gesehen, wie der Standartenführer auf mich geschossen hat.“ „Rücklings.“ „Ja.“ „Bin ich auch...?“ Christiane schüttelt den Kopf. „Nein. Aber sehr nahe daran. Dich so nahe an den Tod zu führen ist nötig gewesen, um uns Zeit zu verschaffen.“ „Uns?“ „Petra und mir.“ Jetzt fällt es Stefan wieder ein. „Stimmt ja. Petra. Sie ist... dagewesen. Seid wann...seid wann verstehst Du Dich mich Gothics?“ „Seid es nötig ist, um Dich zu retten.“ antwortet sie sanft und hält dabei seine Hand. „Eigentlich gibt es soviel, was ich Dir sagen wollte. Aber die Kugeln kamen mir dazwischen.“ Er sieht sie von der Seite an und merkt, daß sie etwas bedrückt aussieht. „Hey, Chrissi...Ich weiß es.“ Er streichelt mit einer Hand ihre Wange. „Du bist immer noch so schön wie damals.“ Verlegen lächelt sie. „Danke. Und Du immer noch genauso charmant.“ „Man tut was man kann.“ Er sieht zur Schiebetür der Hütte. „Aber wo bin ich hier? Das echte Teichgelände ist es wohl kaum. Ist es sowas, wie das Schlachtfeld, was mir Jolandas Geist mal gezeigt hat?“ Chrissi zuckt mit den Schultern. „Vielleicht. Eine Zwischenwelt. Oder eine Projektion Deines Geistes. Oder eine von Petras Psyche. Oder eine Halluzination einer mentalen Droge. Oder das Jenseits. Such Dir was aus.“ Langsam steht er auf, geht zu der Tür und schiebt sie auf. Draußen ist es kühl und leichter Dunst hängt in der Luft. Zwei Gestalten stehen fast direkt vor der Hütte. Als sie sich umdrehen erkennt Stefan alte Kameraden, längst im Krieg gefallen: Jolanda Giusti und Barnet Busch. „Mensch Leute, was macht ihr denn hier?“ krächzt er. Christiane ist hinter ihn getreten und legt ihm eine Hand auf die Schulter. „Die Gegenseite hat mentale Jäger. Ein Medium könnte Dich hier aufspüren. Daher die Wachen. Komm am besten wieder rein.“ Barnet setzt sein übliches breites Grinsen auf, das dieser Halbkoreaner immer hatte und das unter seinen langen schwarzen Haaren immer auffällig war: „Wir reden später noch über alte Zeiten, Chef.“ Stefan nickt und zieht die Tür wieder zu. Langsam dreht er sich zu Christiane um. Sie blickt ihm genau in die Augen. Und in ihren könnte er nach wie vor versinken. „Das hab ich vermisst...“ seufzt er. Wieder muß sie lächeln. Dann meint sie: „Na komm, kannst mich in den Arm nehmen, wenn’s hilft.“ Wortlos legt er die Arme um sie und drückt sie an sich. Nach kurzem Zögern legt sie ihre Hände auf seinen Rücken. Am liebsten würde er sie immer halten, ihre weichen, sinnlichen Körperkonturen spüren, den Geruch ihrer Haare riechen... Aber er reißt sich los und läßt sie wieder los. „Es ist einfach zu lange her, um wieder damit anzufangen. Zumal zumindest einer von uns tot ist. Es-...“ Sie legt einen Finger auf seinen Mund. „Fang nicht wieder damit an.“ Kurz muß er schlucken. „Ich wollte nur sagen, Chrissi, daß es mir leid tut, wie kühl ich Dich damals kurz vor Deinem Ende abgefertigt habe. Ich hätte taktvoller sein können.“ „Schon gut. Aber ich nehme die Entschuldigung trotzdem an. Aber was hast Du mir immer gesagt: Zu sowas gehören immer zwei?“ Da muß er lachen. „Jetzt nach Deinem Tod beherzigst Du das endlich.“ „Ja. Komisch, nicht wahr?“ schmunzelt sie. Ein paar Schritte geht er an ihr vorbei und bleibt mitten im Raum stehen. Erst jetzt mustert er sie nochmal genauer. Auch sie trägt zivil, eine Jeans und eine weiße Bluse, die ihre gute Figur betonen. „Was ist das für eine Welt, in der wir erst im Tode wieder zueinander finden?“ fragt er. „Eine absurde. Wie Du immer gesagt hast.“ Über diese Antwort muß er erstmal nachdenken und läßt sich langsam auf die Bettkante sinken. Er muß an die wechselvolle Geschichte zwischen ihm und Christiane denken, die sich über mehr als fünf Jahre hinzog: Er lernte sie kennen, kam mit ihr für über ein Jahr zusammen. Dann trennte sie sich von ihm, um mit Philipp zusammen zu sein, den sie schließlich nach drei Jahren heiratete, nur um sich nach nichtmal 10 Monaten wieder scheiden zu lassen. Ihr Verhältnis zu Stefan war erst noch freundschaftlich, nach der Scheidung zunehmend kühler gewesen. Trotz der weiterhin bestehenden Zuneigung der beiden. Und jetzt diese Situation... Wie sollte ein Mensch damit umgehen? „Ich haße es, dauernd recht zu behalten...“ witzelt Stefan müde. Sie lehnt sich an die Schiebetür, legt den Kopf schräg und blickt ihn aus ihren olivfarbenen Augen an. „Stefan, weißt Du, daß ich Dir das nie geglaubt habe, daß Du mich nicht mehr liebst?“ Überrascht blickt er zu ihr auf. Schließlich geht er zu ihr rüber und die beiden umarmen sich wieder. Leise flüstert Stefan eines jener Lieder, die die „Schimäre“-Kämpfer oft im Biwak singen: „Komm schließ die Augen, glaube mir wir werden fliegen, über’s Meer. Ich bin nach Deiner Liebe so krank. Die sich an meinem Blut betrank....“ Die ganze Nacht hat es durchgeregnet. Auch jetzt regnet es noch; die Tropfen, die durch die Äste der Bäume und auf den matschigen Boden fallen verursachen ein ganz eigentümliches Geräusch. Kaum zwei Kilometer entfernt sind Motorengeräusche zu hören – die Lastwagen auf der Rollbahn nach Osten, die das wichtigste Geheimdienstmaterial der C-Abteilung von „Schimäre“ wegschaffen. Und die Laster, die immer noch Munition nach Jakovlevo und Jarcevo bringen. Dazu Laster, die Verwundete nach Osten zu den inzwischen weiter von der Front wegverlegten Lazaretten bringen. Hier, zwischen den Apfel-und Birnenbäumen von Gornyj, versuchen einige „Schimäre“-Kämpfer unter einer zwischen zwei Bäumen aufgespannten Tarnplane ein trockenes Frühstück zuzubereiten: Brot, Butter, Mettwurst. Aber auch hier kommt der Regen durch. Die Klamotten sind längst durchnäßt, seid sie hier biwakieren. Die ersten paar Brote sind fertig und die Soldaten setzen sich auf Kisten, um sie zu essen. Als einer von ihnen, Feldwebel Eichert, aufgegessen hat, blickt er auf die Uhr. Gleich 7 Uhr. Er geht rüber zu den Biwakzelten, die zwischen den anderen Bäumen und den Panzern stehen. Sein Befehlshaber Hauptmann Markus Orth steht bereits vor seinem Zelt und knöpft sich das Uniformhemd zu. „Morgen Eichert. Ich weiß, Sie sollten mich wecken, aber ich bin schon wach.“ „Ich sehe es, Chef.“ „Irgendwelche Vorkommnisse?“ „Nein. Nichts. Nur der Bestätigungsbefehl vom HQ.“ „Ok. Wenn wir die Funkspruch vom Beginn der Schlacht erhalten, warten wir genau zwei Stunden. Dann fahren wir los. Wie geht’s den Panzern?“ „Gut. Wir haben die letzten beiden defekten Motoren heute Nacht repariert. Ich soll Sie von den Gehlfahrt-Brüdern grüßen.“ Orth nickt. „Danke. Ok, in einer Stunde lassen wir die Motoren warmlaufen. Alle sollen bis dahin einsatzbereit sein.“ „Zu Befehl.“ „Dann ist ja alles klar.“ Während Eichert zu den Soldaten zurückgeht – unter denen sich übrigens auch sieben Frauen befinden -, geht Markus rüber zu einem Baum und erleichtert seine Blase. Nachdem das erledigt ist, zündet er sich eine Zigarette an und geht rüber zu seinem Führungspanzer. Die Panzer des 1. „Schimäre“-Panzerregiments sind ganz eigene Modelle, Weiterentwicklungen erbeuteter kaiserlicher Panzer. Die „Schimäre“Kämpfer hatten vor einigen Monaten zunächst erbeutete Panzer provisorisch umgerüstet; auf diesen Vorgaben basierend ließ das HQ dann in polnischen und seit neuestem auch russischen Rüstungswerken eigene Modelle bauen. Der kaiserliche Grundbauplan blieb – aber die Panzerung wurde verstärkt, die Ketten durch Kettenschürzen geschützt, teilweise wurden leistungsfähigere Motoren und bei den schwereren Modellen auch Kanonen mit größerer Reichweite eingebaut. Die so entstandene zweite Generation der „Schimäre“-Panzer trägt, beruhend auf einer Idee der Frontsoldaten, die Namen bekannter „Schimäre“-Kommandeure. Dem kaiserlichen Panzer II entspricht der „Leichte Panzer ‚Karo‘ K2“, dem Panzer III der „Mittlere Panzer ‚Stefan‘ S2“ und dem Panzer IV der „Mittlere Panzer (s) [für „schwer“]‘Markus‘ M2“. Markus Führungspanzer ist ein S2, das Standardmodell des Regiments, von dem insgesamt 50 zur Verfügung stehen. Die K2 (12 Stück) werden nur zur Aufklärung und Sicherung eingesetzt, die M2 (21 Stück) sind quasi die Eingreiftruppe, wenn die S2 allein nicht mehr weiterkommen. Markus setzt sich neben den Turm des Panzers. Seine Klamotten sind eh durchnäßt. Hier raucht er in Ruhe seine Zigarette und blickt dabei zwischen den Ästen hindurch nach Osten. Langsam lugt der erste Sonnenstrahl zart unterhalb der Wolkendecke hervor. Ja, es dürfte ein ereignisreicher Tag werden... Mitten im verregneten Wald hat Hauptmann Steinberger seinen vorübergehenden Gefechtsstand eingerichtet – im Turm seines Führungspanzers. Er instruiert gerade die Bataillons-und Kompaniechefs. „...führt den Luftschlag in etwa einer Stunde. Danach werden wir nur noch minimale Fliegerunterstützung haben, wegen der Wetterprobleme und weil die meisten Flieger nach Estland abgezogen wurden. Glücklicherweise hat Mudra uns heute Nacht in Eilmärschen noch ein Bataillon Infanterie geschickt. Es wird den frontalen Panzerangriff unterstützen. Die Kompanien mit den neuen Panzern werden den Feind im Osten umgehen und dann im Rücken angreifen. Wenn wir Jakovlevo genommen haben, müssen wir wahrscheinlich erstmal Jarcevo besetzen, um die Position zu sichern. Anschließend greifen wir nach Nordwesten an, um die Schlappe, die Brieskisch gestern erlitten hat, wieder auszubügeln. Soweit alles klar?“ Alle nicken. Nur einer der Kompaniechefs meldet sich nochmal: „Mit wie hartem Widerstand haben wir zu rechnen?“ Sehr ernst blickt Ingo Steinberger in die Runde. „Mit sehr hartem Widerstand. Wir haben Befehl, jeden ‚Schimäre‘-Gefangenen zu erschießen oder der Geheimpolizei zu übergeben. Das wissen die Söldner und entsprechen teuer werden sie ihre Haut zu Markte tragen. Deswegen sollen alle Männer ihre Pistolen und Gewehre laden. Jeder soll auch als Infanterist weiterkämpfen, wenn sein Panzer abgeschossen wurde.“ „Wie stark wird das feindliche Aufgebot sein?“ „Vermutlich ca. 700 feindliche Infanteristen mit ein Paks.“ Ingo nimmt einen Schluck Wasser aus seiner Feldflasche und schraubt diese dann wieder zu. „Also gut, meine Herren, wir brechen in einer Dreiviertelstunde auf. Alle sollen sich bereitmachen.“ Steinberger ist schon jetzt einer Täuschung aufgesessen. Karo hat in Jakovlevo über 2000 Kämpfer massiert – Spezialbataillon 1, HQ-Kompanie, das Kavallerieregiment, zwei Flakabteilungen, Pak-Trupps. Vom Generalstab sind fast alle bis an die Zähne bewaffnet geblieben, nur wenige sind mit dem Geheimdienstmaterial der C-Abteilung nach Osten abgereist. Dort wartet das 1. „Schimäre“-Panzerregiment auf seinen Einsatz. In Safonovo bereiten sich Bohnsacks Kampfflieger auf ihren Einsatz vor. Die polnische Luftwaffe und die Luftwaffe der Deutschen Exilarmee haben sich glücklicherweise dazu bereit gefunden, den Luftkampf an der Hauptfront westlich Jarcevo zu übernehmen – als Entlastung. Um 8 Uhr verliest Oberleutnant Flatten vor der HQ-Kompanie den Tagesbefehl: „Für heute erwarten wir den entscheidenden Angriff des Feindes. Der Befehl heute an euch ist einfach: Haltet stand! Werft den Gegner zurück! Wir weichen dieses Mal nicht zurück. Weichen wir, ist alles aus. Selten zuvor wird die Parole für uns so sehr gelten wie heute: Tod oder Freiheit – und nichts dazwischen! Zeigen wir den Mistkerlen, daß wir auch ohne den General nicht zu schlagen sind!“ Als Flatten geendet hat, hebt eine Soldatin ihr Bajonett und brüllt: „Freiheit!!“ Und alle fallen ein: „Freiheit!! Freiheit!!“ Man hört es in ganz Jakovlevo. Der Ort ist in eine Festung verwandelt: Wohnungen wurden zu Unterständen, Balkone zu Schießscharten, die Straßen wurden für Schützengräben aufgerissen, in den Obstgärten haben die Kämpfer Sandsäckstellungen eingerichtet, mit richtigen MG-Nestern. Der Bahndamm südlich des Ortes wurde zur vordersten Stellung erkoren. Davor liegen Minen. Alle sind kampfbereit. Schoeps hat die meisten Pferde ihrer Einheit in Sicherheit bringen lassen, bis auf eine Eingreifreserve nördlich des Ortes, die im Notfall schnell in den Einsatz muß. Kurz nach 8 Uhr verläßt Conny das Hauptquartier, das Sturmgewehr geschultert, im Rucksack ein Maschinengewehr. Ihr folgt Marco Konrad, er trägt vier Munitionsgurte und zwei schwere Munitionskästen. Im Hauptquartier selber lädt Karo gerade ihr Sturmgewehr durch, prüft ihre Pistole und legt ihren Säbel um. Inzwischen hat auch sie den Säbel auf dem Rücken tragen. So ist es einfach leichter. Valkendorn läßt im Erdgeschoß derweil drei tragbare Flammenwerfer einsatzbereit machen. Er hat sie extra in irgendeinem Depot aufgegabelt. Gerade instruiert er zwei Soldaten, die Flammenwerfer nur herauszugeben, wenn die Situation es erfordert, als die Tür nach draußen auffliegt. Flatten kommt in Begleitung einer Frau – der Journalistin Uta Reindl. Etwas verblüfft keucht Valkendorn: „Was macht denn die Zivilistin noch hier? Bald wird hier die Hölle los sein!“ „Das ist es ja, General! Sie will nicht gehen!“ macht ihm Flatten die Situation klar. Frau Reindl gibt sich empört: „Verdammt nochmal, ich will doch nur berichten! Ich muß für meine Zeitung einen Bericht über die Schlacht erstellen!“ „Frau Reindl“, gibt sich Valkendorn freundlich, „General Reiss hat Sie auch früher nicht so dicht ans Geschehen gelassen, zu Ihrer Sicherheit. Ich glaube nicht, daß wir das ändern sollten!“ Einmal atmet Valkendorn tief durch, dann gibt er einen eindeutigen Befehl: „Oberleutnant Flatten, Sie schnappen sich meinen Geländewagen, hier sind die Schlüssel. Und dann bringen Sie Frau Reindl mindestens bis Safonovo.“ „Und wer befehligt die HQ-Kompanie?“ „Das übernehm ich selber, bis Sie zurück sind. Sie sind mir bis dahin für die Sicherheit von Frau Reindl verantwortlich.“ „Zu Befehl!“ Flatten salutiert und greift dann nach Frau Reindls rechtem Arm, um sie zum Wagen zu bringen. Sie reißt sich los und faucht: „Verdammt, ich kann alleine zum Auto gehen.“ Erhobenen Hauptes folgt sie Flatten nach draußen und wirft Valkendorn über die Schulter noch einen bösen Blick zu. Valkendorn schultert sein Sturmgewehr und seinen Rucksack, in dem er Reservemunition und Handgranaten hat und brummt dabei: „Immer diese Reporter...“ „Was ist wieder; General?“ Karo kommt die Treppe runter, hat bereits ihren Stahlhelm aufgesetzt. „Ach nichts...“ knurrt Valkendorn. „Valkendorn, haben Sie die neuen Hafthohlladungen austeilen lassen?“ „Ja. Gleichmäßig an alle Kämpfer, so hat jeder drei.“ „Sehr gut.“ Karo bleibt an der Rezeption stehen und zündet sich eine Zigarette an. „Frau General, ist alles in Ordnung mit Ihnen?“ fragt Valkendorn. Er kennt Karo zwar erst seit etwas mehr als 10 Monaten, aber er merkt, wenn sie Sorgen hat. „Valkendorn, wie soll’s mir gehen? Bald wird hier die Hölle auf Erden los sein. Freude darauf kann man wohl kaum erwarten.“ „Sie wissen genau was ich meine, Frau General. An niemandem geht es spurlos vorbei, wenn seine besten Freunde in Feindesland festsitzen.“ Jetzt schaut Karo auf und faßt Valkendorn fest ins Auge: „General, das ist ganz allein meine Sache. Und ich helfe meinen Freunden am besten, indem wir heute den Kaiserlichen einen kräftigen Arschtritt verpassen.“ Kaum hat sie das gesagt, schultert sie wieder ihr Sturmgewehr und geht nach draußen. Ein paar zehn Meter weiter hat ein Pak-Trupp seine Panzerabwehrkanone in Einzelteilen in den dritten Stock eines alten aus Ziegeln errichteten Verwaltungsgebäudes geschleppt und dort wieder am Fenster zusammengebastelt. Die Kanoniere sind Kroaten, erst vor wenigen Wochen via Athen und Konstantinopel (kurz bevor beide Städte fielen) nach Russland gereist, wo sie sich bei „Schimäre“ freiwillig meldeten. Als sie ihre Pak feuerbereit machen, skandieren sie dabei laut: „Sloboda! Sloboda! Sloboda!“ – „Freiheit! Freiheit! Freiheit!“ Den Schlachtruf der „Schimäre“-Kämpfer hört man in den verschiedensten Sprachen: Deutsche, Polen, Slowaken, Ukrainer, Kroaten, Rumänen sind in Jakovlevo vertreten. Alles Freiwillige, die es im Laufe des Krieges zu „Schimäre“ verschlagen hat. Fröstelnd von der Morgenkühle stemmt sich Helge in seinem Bett hoch und blinzelt sichtlich verschlafen den Schweizer Widerstandskämpfer an, der neben seinem Bett steht und ihn soeben geweckt hat. „Was ist?“ stöhnt er müde. Der Soldat ist offenbar bereits hellwach und gut aufgelegt. „Herr Hinkelmann, würden Sie bitte mit nach unten kommen? Es ist eine Lageänderung eingetreten. Sie haben 10 Minuten zum Anziehen.“ Spricht’s und verläßt den Raum wieder. Etwas verwirrt schaut Helge dem Mann hinterher. „Die haben Nerven...“ grummelt er vor sich hin. Aber vielleicht würden sie ihn endlich aus dem Arrest dieses kleinen, wenn auch gemütlichen Zimmers entlassen. Natürlich kann Helge diese Leute verstehen, daß sie vorsichtig sind. Aber die werden sich noch wundern, wofür er sich entschieden hat. Denn eins ist klar: Seinem normalen Geologenberuf nachgehen – das geht nicht mehr. Nachdem sich Helge Hose und Pullover übergezogen hat, tritt er nach draußen; sein kurzes Haar ist noch etwas zerzaust, aber mehr Zeit hat man ihm ja nicht gegeben. Seine beiden Bewacher warten bereits. „Folgen Sie uns bitte, Herr Hinkelmann.“ meint der eine Soldat freundlich. „Ja, ja.“ meint Helge nur müde und folgt den beiden Männern nach unten. Dort sitzen an einem der Tische bei einem Frühstück – Eier, Brötchen, Butter und Käse gibt es, dazu frische Milch – Major Solt, der Anführer der Schweizer Widerstandsbewegung (praktisch alle ranghöheren Schweizer Offiziere wurden im September bei der Besetzung des Landes durch die Kaiserlichen entweder getötet oder gefangengenommen), Lisa Kirchner und Oberstleutnant Nicole Elsing. Sie und Solt tragen ihre Uniformen und sehen etwas übermüdet aus. Lisa Kirchner ist wie üblich in Zivil und hat ihr freundlich-nachsichtiges Lächeln aufgesetzt. „Bitte.“ Einer der Soldaten bedeutet mit einer entsprechenden Handbewegung Helge, sich dazuzusetzen. Lisas beide Hunde, Kim und Kimba, liegen träge neben dem Tisch auf dem Boden. Kimba hebt den Kopf, als Helge auf den Tisch zugeht, springt auf und springt dann freudig kläffend und mit dem Schwanz wedelnd an Helge hoch. Der versucht die Zuneigungsbekundung mit den Armen abzuwehren. Schließlich pfeift Lisa den Hund zurück und Helge kann sich an den Tisch setzen. Nicole schiebt ihren Teller beiseite, schluckt ihren letzten Bissen runter. „Helge, Dein Arrest ist beendet.“ Na endlich, geht es Helge durch den Kopf. „Kann ich meine Frau anrufen?“ fragt er. Nicole sieht Lisa an. „Nicht von hier aus.“ entscheidet sie schließlich. „Und wie geht’s jetzt weiter?“ fragt er. Nicole zuckt die Achseln. „Du kennst einfach abhauen und Dich festnehmen lassen. Oder...“ „Oder ich kann euch helfen?“ fällt Helge seiner alten Bekannten ins Wort. „Genau. Wie entscheidest Du Dich?“ Obwohl Helge sich eigentlich schon entschieden hat, zögert er noch. Er zieht kurz seine Brille aus, fährt sich mit Zeigefinger und Daumen über den Nasenrücken, setzt die Brille wieder auf. Dann meint er: „Lieber ‚Schimäre‘ helfen, als im Lager verrotten. Also, was steht noch gleich an? Den General befreien?“ „Oh, Sie hatten recht, Frau Oberstleutnant.“ meint Lisa verlegen lächelnd zu Nicole. Die grinst breit. „Ich kenn doch meine Pappenheimer.“ Dann wendet sie sich wieder an Helge. „Du kannst uns vielleicht wirklich weiterhelfen.“ „Inwiefern?“ „Kipshoven hat sich gemeldet. Wir wissen jetzt, wo Schattenlagant ist.“ „Und? Ist doch super!“ meint Helge breit grinsend. „Nicht so toll, wie Sie vielleicht meinen.“ schaltet sich Solt mit seinem Schweizer Akzent ein. „Es handelt sich zufällig um ein Gebiet an der Grenze zur Schweiz, das die Kaiserlichen massiv abgeschirmt haben. Schon vor dem Krieg haben sie dort den Luftraum gesperrt und wir mußten, um einen Angriff zu verhindern, einer Pufferzone entlang der Grenze zustimmen.“ „Was ist mit Karten?“ „Sagen Sie es ihm, Solt.“ meint Nicole trocken. Solts Miene verdüstert sich: „Ich fürchte, die Gegend ist auf allen Karten ein weißer Fleck.“ „Und wie kann ich da helfen?“ fragt Helge etwas verwirrt. Nicole antwortet ihm. „Ich meine mich erinnern zu können, daß es während unseres Studiums einmal eine Kartierung dorthin gab, zu der ich aber nicht mit konnte.“ „Ja, ich erinnere mich...“ meinte Helge, angestrengt nachdenkend. Es ist lange her, mehr als sechs Jahre – als er und Nicole noch zusammen Geologie studiert hatten. Schließlich schüttelt er den Kopf. „Tut mir leid. Ich weiß, welche Kartierung Du meinst, aber auf der war ich auch nicht, weil ich die Polari-Klausur nachholen mußte. Aber...“ „Aber was?“ „Aber ich glaube die eine Ägyptologin, die als Nebenfächlerin bei uns war, war auf der Kartierung... wenn ich nur wüßte wie sie hieß...“ Mit der linken Hand kratzt er sich am Kopf. „Ich komm nicht drauf...“ Auch Nicole denkt nach und dann fällt ihr doch ein Name ein. „Brigitte hieß sie! Ja, Brigitte Fehr, glaub ich...“ Sie blickt Lisa an. „Lisa, könnten Sie den Namen an die C-Abteilung durchgegeben?“ „Sicher. Ich werde das noch vor unserm Aufbruch erledigen.“ „Aufbruch?“ Helge runzelt die Stirn. „Ja.“ bestätigt Nicole. „Kipshoven hat bereits alle verfügbaren Kräfte Richtung Schattenlagant beordert. Wir haben seinen Bruder, Chris Loewisch und Sabine Granrath bereits nach Bludenz vorgeschickt. Ich, Koszarek, Solt und ein Trupp Schweizer Widerständler werden heute abend aufbrechen. Mit allem was wir brauchen – Waffen, Sprengstoff usw.“ „Was soll ich machen?“ will Helge wissen. Nicole steht auf. „Du wirst hier bleiben. Du kannst Lisa und deren Assistentin Frau Oertel dabei helfen, diesen Posten hier zu halten. Wenn Du mich jetzt entschuldigst, ich hab noch zu tun.“ Sie nickt ihm zu und geht dann nach draußen. Helge dreht sich halb auf seinem Stuhl um, um ihr hinterherzusehen. So selbstbewußt und bestimmend hatte er Nicole Elsing früher an der Uni nie erlebt. „Sie wächst mit ihrer Aufgabe.“ bemerkt Solt, der Helges Verblüffung registriert hat. „Die zweite Phase ist die Schlacht selber. Die Anspannung löst sich, die Dinge geraten ins Rollen, entwickeln eine Eigendynamik. Es ist, als löse sich eine schwere Last, denn alle Fragen sind erstmal weggewischt. Alles fokussiert sich nur noch auf das: Entweder die oder wir! Dies führt zu einer neuen Anspannung, einem Bedrohungsgefühl, das erst mit dem Sieg oder der Niederlage enden wird. Niederlage würde in unserem Fall bedeuten, da der Kaiser uns nicht die Rechte Kriegsgefangener zuerkennen will: Tod und totale Vernichtung!“ General Karolina Sus zu U. Reindl Die Tiefflieger kommen aus den grauen Wolken hervorgeschossen und ziehen Schlieren verwirbelter Regentropfen durch die Luft hinter sich her. Ein ganzer Pulk Messerschmitts Bf 109 jagt über Jakovlevo hinweg. Ihnen folgen vier Bf 110, die zweimotorigen Maschinen mit den stärkeren Bordwaffen und den unterm Rumpf festgemachten 250-Kilo-Bomben. Trotz aller Vorbereitungen kommt dieser Auftakt der Schlacht überraschend. Als die einmotorigen Tiefflieger fast in Baumwipfelhöhe dahinrasen, lassen sie ihre Bordkanonen belfern. Fontänen spritzen auf, wo die Geschosse einschlagen. Jeder wirft sich zur Seite und in Deckung. Hinter einem Ochsenkarren hoffen zwei Soldaten Schutz zu finden, aber der Karren wird zersiebt und die beiden Männer sacken einfach blutüberströmt zusammen. Karo kann gerade noch einen Unteroffizier mit sich hinter einen Baum in Deckung reißen; der Stamm des Baums wird ordentlich zerlöchert. „Danke Frau, General.“ „Ja, ich weiß, die gute Tat für heute...“ Auf offeneren Flächen wie Wiesen rennen die Kämpfer weg, schmeißen sich schließlich hin, die Garben schlagen zwischen ihnen ein. Wenn sie spüren, wie der Luftzug über sie hingefegt ist, springen sie wieder auf. Einige bleiben mit häßlichen dunklen Flecken liegen. Jetzt endlich antworten die rund um Jakovlevo stationierten Flaks der Kaliber 3,7 cm, 5 cm und 8,8 cm, die die beiden „Schimäre“-Flakabteilungen besitzen. Aber die Flieger sind zu tief, um wirksam anvisiert werden zu können. Schon nehmen zwei Flieger die Lastwagen, die immer noch fahren, aufs Korn. Zwei Laster werden zerlöchert und landen im Straßengraben. Nur aus einem springt ein schwer verletzter Fahrer heraus. Die nachfolgenden geben Gas, wollen unbedingt durch, um den Nachschub nach vorn zu bringen. Valkendorn steht am Straßenrand, winkt sie durch. „Los, los! Gebt Gas!!“ Da sieht er die zweimotorigen Schlachtflieger in etwa 100 m Höhe heranfliegen. Sie müssen eine Kurve fliegen, um dem Flakfeuer auszuweichen und greifen dann an: Zwei nehmen die Hauptstraße aufs Korn, zwei die südlich gelegenen Obstgärten, wo sich Verteidigungsstellungen befinden. Im selben Moment, wie die Bomben einschlagen und dabei unter anderem zwei Lastwagen zerfetzen, gibt der Funker im Keller des Hauptquartiers den Funkspruch durch: „Die Schlacht hat begonnen. Orth, kommen Sie!“ Als er das leichte Beben der krepierenden Bomben spürt, das Staub von der Decke rieseln läßt, jagt er noch einen Spruch – dieses Mal uncodiert – durch den Äther: „Bohnsack, wo bleiben Sie?“ Schon drei Minuten vorher wurde Bohnsack jedoch von einer der Flakabteilungen gewarnt. Sofort ist er in die Unterkunft seiner Flieger gestürmt, hat alle zusammengebrüllt; darunter auch vier Neulinge direkt aus der Ausbildung. „Kameraden, ihr müßt jetzt sofort wach sein! Die Schlacht hat begonnen und wir starten alle! Die Kroaten werden mit den letzten drei Centauros die Nachhut übernehmen, der Rest von uns fliegt in Keilformation! Unser ausschließliches Kampfgebiet ist heute Jakovlevo! Also los!“ 30 Sekunden später stürmen alle aus dem Gebäude und auf ihre bereitstehenden Fw 190-und Centauro-Jagdmaschinen zu. Einer nach dem andern startet und jagt nach oben. Innerhalb von Minuten wird die Formation gebildet und dann jagt man Richtung Westen. Jetzt geht es um alles oder nichts! Flatten und Frau Reindl waren gerade erst ein paar Minuten unterwegs auf der Hauptstraße Richtung Osten, an ihnen rollten ständig Laster in beide Richtungen vorbei. Und jetzt werden sie von einer einmotorigen Messerschnitt aufs Korn genommen. Von hinten hämmern die Garben in die Straße. Die Geschosse verfehlen den Geländewagen so knapp, daß eines funkensprühend an der Außenseite der Beifahrertür entlangschrammt. Reindl schreit erschrocken auf, aber Flatten hat längst andere Probleme, denn er muß wild am Lenkrad rumreißend einem Laster ausweichen, der plötzlich ausscherrt – die Windschutzscheibe total zerlöchert.Mit dem Geländewagen gerät Flatten auf das aufgeweichte Feld neben der Straße, während der Laster quer zur Straße auf die Seite kippt. Ein anderer Laster kracht beim Versuch auszuweichen, in den Graben und bleibt hängen. Als die Messerschmitt, die zwischenzeitlich umgedreht hat, von oben herabstößt, springt der Fahrer schnell aus dem Führerhaus – und dann fliegt die Ladung, Munition und Sprit, im Kugelhagel in die Luft. Flatten findet den Weg zurück auf die Fahrbahn nicht mehr wirklich. Auch der Geländewagen fährt sich im schlammigen Graben fest. „Raus!“ brüllt er. Nach einer Schrecksekunde gehorcht Frau Reindl der Anweisung. Kaum draußen, hört sie, wie das Motorengeräusch wieder lauter wird. „Kommen Sie!“ Flatten packt sie am Arm, zieht sie mit sich und drückt sie dann dort, wo die Böschung an einer tieferen Grabenstelle etwas überhängt, in Deckung. Um sie herum schlagen wie die Geschosse der Bordkanonen ein. Auf dem Bahndamm südlich von Jakovlevo schlagen ebenfalls Bomben ein – hier greift eine Staffel Ju-87-Sturzkampfbombe mit heulender Sirene an. Zwei werfen dicht nebeneinander ihre Bombenlast ab und ziehen dann hoch. In einer Fontäne aus Dreck werden Menschenleiber und Schienentrümmer durch die Luft geschleudert. Sven Ellermann und Sarah Weigang vom Spezialbataillon 1 liegen im Gestrüpp am Rande des Bahndamms in Deckung und drücken sich flach an die Erde, halten sich den Helm fest. „Scheiße!“ flucht Sven. „Wo bleiben unsere?“ „Werden schon kommen!“ brüllt Sarah zurück. In dem Moment explodiert irgendwas direkt über ihnen. „Was war das?“ 20 m hinter ihnen zerschellt eine Ju 87 in einer orangenen Explosionswolke in einem Obsthain, Trümmer fliegen durch die Luft – und die von den kroatischen Piloten geflogenen Centauros donnern über den Bahndamm hinweg, gefolgt von zwei Fw 190. „Sie hatten recht, Frau Leutnant!“ „Ich weiß!“ Da schlagen irgendwelche Geschosse auf der verminten Gegenseite des Bahndamms ein und dann auch hinter ihnen. Jedem Einschlag geht ein Zischen voraus. „Artillerie!“ brüllt ein entsetzter Soldat. 30 m rechts von ihnen schlagen zwei Granaten genau auf den Bahndamm ein, Dreck rieselt auf sie hernieder. Sie drücken sich wieder an die Erde, Splitter schwirren durch die Luft. Etwas fällt klimpernd direkt vor Sarah. Als sie kurz vor sich schaut, sie sie einen Stahlhelm, der noch etwas hin und her wackelt... Über ihnen führen die Kampfflieger ihr tödliches Ballett auf. Während vier Maschinen den Stuka-Pulk zerschlagen, kümmert sich Bohnsack mit dem Rest seines Geschwaders um die Messerschmitts. Eine Bf 110 ist schon abgeschossen, die andern drei wollen flüchten. Und die Bf 109 sind immer noch die gefährlichsten Gegner. Eine klebt an Bohnsack dran und er kriegt sie nicht abgeschüttelt. Er schafft es nur, der feindlichen Geschoßgarben auszuweichen. „Chef, bin unterwegs!“ meldet Suhrkamp, der neulich seinen Fallschirmsprung überlebt hat. „Ich zieh in vier Sekunden hoch!“ antwortet Bohnsack; Suhrkamp weiß, was er dann zu tun hat....Als Bohnsack das Steuer hochreißt, will sein Verfolger ihm folgen – und bietet dem von hinten heranrasenden Suhrkamp eine bessere Angriffsfläche. Suhrkamps Bordkanonen zerlöchern Leitwerk und Flügel der Messerschmitt, schießen deren Motor in Brand. Als Suhrkamp vorbeizieht, sieht er nur noch aus dem Augenwinkel, wie der feindliche Pilot aussteigt und die Maschine anfängt, wie ein Stein zu fallen. Da kommen über den Sprechfunk schon die Hilferufe von Kelters Maschine. „Werde in die Zange genommen!“ Suhrkamp sofort: „Ich und der Chef sind unterwegs!...Scheiße, wir könnten Angel gebrauchen!“ Bei einer Tankstelle am Rande der Autobahn nahe Regensburg fährt ein Lastwagen ohne Kennzeichen und schwarz lackiert vor. Geheimpolizisten springen ab und stürmen die Pistolen im Anschlag das Hauptgebäude. Zwei reguläre Polizeiwagen sichern Zu-und Ausfahrt der Tankstelle. Der kommandierende Unterscharführer und sein Truppen finden nur einen gefesselten und geknebelten Kassierer in der Tankstelle. „Löst seine Fesseln und den Knebel!“ befiehlt der Unterscharführer. Seine Leute befreien den Kassierer aus seiner mißlichen Lage und helfen ihm hoch. „Danke...“ keucht der Mann und setzt sich seine Brille auf. „Die Typen kamen einfach hier rein, haben mich überwältigt und dann Vorräte und Treibstoff geklaut.“ „Wo sind sie hin?“ will der Unterscharführer wissen. Der Kassierer zuckt die Achseln. „Sie sind wieder Richtung Nürnberg gefahren. Einer faselte was von Köln.“ Die Gepos schauen sich an. Dann meint der Unterscharführer: „Danke, Sie haben uns sehr geholfen, Herr....“ „Schwalm.“ „Ja, Herr Schwalm. Wir schicken in Kürze jemanden vorbei, der eine genaue Aussage aufnehmen wird.“ Ohne weitere Worte marschieren die Geheimpolizisten wieder nach draußen, klettern auf ihren Laster und dann rückt die gesamte Truppe ab. Ein paar Minuten wartet Christoph Schwalm noch, dann geht er nach hinten in die Abstellkammer und hebt dort eine Bodenplatte an. „Leute, ihr könnt wieder rauskommen.“ Er tritt zur Seite und einer nach dem andern klettert nach oben: Jacke, Tibori, Tanja, Tina, Fraker, Marta, Xia Ven, Philipp – und der hilft dann auch Diana rauf. „Danke für Deine Hilfe, Christoph.“ „Scheiße, mein Kleid hat einen Riß.“ Christoph schaut an Philipp vorbei zur fluchenden Diana. „Ich glaub, der besorg‘ ich noch schnell ein paar Klamotten. In meinem Lieferwagen hinten müßte noch was sein.“ „Können wir den wirklich haben?“ fragt Philipp. „Sicher.“ bestätigt Schwalm. „Aber ich will ihn wiederhaben.“ „Klar doch.“ meint Philipp freimütig, obwohl er sich sicher ist, daß der Lieferwagen das Abenteuer nicht überleben wird. Schwalm geht zur Kasse und holt aus einer Schublade die Schlüssel, wirft sie Jacke zu. „Dann befreit mal den General.“ „Alles klar. Dank Dir.“ „Gern geschehen. Ich werd heute abend eine codierte Funkmeldung absetzen, daß ihr unterwegs seid.“ „Is ok.“ Philipp und die andern verlassen die Tankstelle durch die Hintertür. Hinter dem Gebäude stehen unter einem Vordach die beiden Wagen, mit denen sie hier angekommen waren und ein dunkelgrauer Lieferwagen mit seitlicher Schiebetür. „Ok, alles einsteigen. Jacke, Du fährst.“ befiehlt Philipp. Ihre Rucksäcke bringen sie hinten unter, wo sich die meisten auch auf den Boden oder die an einer Seite angebrachte schmale Holzbank setzen müssen. Nur Philipp und Jacke sitzen vorne. „Diana?“ „Ja, Kapitän?“ „Sind da hinten Klamotten?“ Er hört hinter sich im Laderaum ein Rascheln. „Ja, eine Jeans und zwei Hemden in einer Tüte. Wohl neu gekauft.“ „Ok, Diana, wenn Sie uns schon unbedingt begleiten wollen, dann ziehen Sie sich um. Ihr Kleid ist nicht gerade kampftauglich.“ „Na gut.“ „Muß die unbedingt mit?“ murmelt Jacke leise, während er den Motor startet. „Die Frau geht mir furchtbar auf den Senkel...“ Philipp schmunzelt verhalten, während von hinten ein etwas verärgertes „Das hab ich gehört!“ zu hören ist... Die Einleitungsphase des kaiserlichen Angriffs mit Luftangriff und Artillerievorbereitung (die allerdings nur recht schwach und wohl nur von Granatwerfern getragen war) hat fast eine halbe Stunde gedauert. Und jetzt nähern sie sich – die stählernen Ungetüme. Ihre Panzerung ist naß vom Regen und glänzt gespenstisch, während sie über Äcker und Wiesen, zwischen Bäumen und einigen Bauerngehöften und über einen vom Dnjepr heraufführenden Weg angerasselt kommen, dicke Matschklumpen an den Ketten hängend. Hinter jedem folgt, hinter den Panzern einigemaßen in Deckung, ein Trupp Infanterie. Einige wenige Panzer II rollen zur Aufklärung voraus. Über ihnen, am Himmel, liefern sich immer noch die Jagdflieger beider Seiten dicht unter der Wolkendecke eine mörderische Jagd. Zweimal stürzen Messerschmitt-Jagdflieger nur wenige hundert Meter entfernt in den Wald. Von dort steigen dann hohe Rauchwolken auf. Hinter dem Bahndamm liegt die vorderste Linie von „Schimäre“ in Deckung. Valkendorn kommandiert die HQ-Kompanie persönlich im Zentrum der Abwehrlinie. Zwanzig Meter rechts von ihm liegen weitere Stabsoffiziere: Drei Stabsunteroffiziere von der B-Abteilung, die sonst für das Beschaffen von Nachschub zuständig sind und Marco Konrad und Conny mit ihrem MG. Die Regentropfen fallen vom Rand der Stahlhelme. Alle versuchen ihre Aufregung, ihre wild klopfenden Herzen zu unterdrücken. Allmählich wird das Geräusch der Panzermotoren und der Ketten lauter. „Hat jeder seine geballten Ladungen?“ geht die Frage durch die Abwehrlinie. Ein Knall – und einer der leichten Panzer II bleibt brennend liegen. Er ist auf eine Mine gelaufen. Sofort stoppen die Panzer. „Was kommt jetzt?“ flüstert ein Soldat neben Valkendorn. „Das werden wir gleich sehen...“ erwidert dieser leise. Auf dem rechten Abwehrflügel liegen Schoeps und ihre nunmehr zu Fußsoldaten umfunktionierten Kavalleristen im Dreck. Hell kondensiert ihr Atem in der kühlen Luft. Den linken Flügel bildet das Spezialbataillon 1. „Denken Sie immer dran, Ellermann: Zuerst die Ketten zerstören, dann entern.“ schärft Sarah Weigang dem Hauptfeldwebel nochmal ein. „Ich weiß...“ zischt der. Ist schließlich nicht so, als sei er das erste Mal im Kampfeinsatz. Mit lautem Zischen schlagen einige Granaten zwischen den Panzern und dem Bahndamm ein. Allerdings nicht mit lauten Detonationen, was alle, die sich schon fest in den Dreck drückten, um vor Splittern sicher zu sein, wundert. Statt dessen gibt es nur ein dumpferes Geräusch. Alle schauen auf. Weiße Nebelschwaden breiten sich aus und ziehen zu ihnen herüber. Erschrocken hüpfen ein paar Karnickel auf zwischen den Büschen weg. Sie scheinen irritiert, aber nicht weiter geschädigt vom Qualm. Sven atmet auf. Wenigstens kein Giftgas. Aber dafür ist die Sicht jetzt nur noch auf wenige Meter beschränkt. „Verdammt...“ flucht Schoeps. Ihr ist klar, daß der Feind im Schutze des Nebels die Minen räumen und dann zum Sturm ansetzen wird. Minutenlang starren alle in den Nebel. Und dann tauchen Schemen aus diesem auf – feindliche Soldaten. „Feuer frei!“ Auf einen Schlag eröffnen die „Schimäre“-Kämpfer aus ihrer vorteilhaften Position das Dauerfeuer aus den Sturmgewehren. Die Kaiserlichen werfen sich sofort hin (wobei einige nicht wieder aufstehen) und feuern zurück. Allerdings haben die Kaiserlichen abgesehen von ein paar MGs nur Karabiner, mit denen sich nur Einzelschüsse abgeben lassen. Aber darin sind sie gut: Direkt neben Sven Ellermann wird ein Hauptgefreiter in den Oberarm getroffen und wirft sich mit einem Schmerzensschrei herum. „Geht’s?“ brüllt Ellermann über das Geballer hinweg. „Ja, schießen Sie weiter! Ich bind’s selbst ab!“ Schon fummelt der Soldat an seinem Gürtel herum, um mit diesem den Arm abzubinden, der wie Sau blutet. Sven schaut schon gar nicht mehr hin, ballert nur blindlings auf die Schemen, die sich näher ranzuarbeiten versuchen. Irgendwo links krepieren zwei Handgranaten, Schmerzensschreie hallen herüber. Dauerfeuer ist ja schönstes und bestes Sperrfeuer. Nur: Es frißt unheimlich viel Munition. Conny hält mit dem MG einfach nur drauf und alle paar Minuten kann Marco den nächsten Gurt einlegen. „Verdammt, wir brauchen bald mehr Munition!“ flucht Conny. „Ja, ja, ich weiß...“ gibt Marco genervt zurück. Jedesmal wenn er einen Gurt eingelegt hat, greift er zu seinem Sturmgewehr und eröffnet selbst wieder das Feuer. Eigentlich haßt er Kampfeinsätze, denn er haßt es noch viel mehr als einige seiner Kollegen, Gewalt einzusetzen. Deshalb arbeitet er seit längerem nur noch im Stabsdienst. Aber heute – heute geht es um alles oder nichts. Nur wenige Meter neben ihnen ist das Desaster dann da: Bei mehreren Kämpfern und Kämpferinnen ist fast gleichzeitig die Munition alle. Zwei Gegenstände kommen über die Gleise angeflogen. Eine „Schimäre“-Kämpferin ist schnell genug, greift eine der Handgranaten wirft sie zurück, das Ding krepiert auf der anderen Seite des Bahndamms; doch die andere Handgranate explodiert, bevor die umstehenden fliehen können. Zwei Kämpfer sind sofort tot, einer bleibt kreischend am Boden liegen – die Granate hat ihm die Beine abgerissen. Die Soldatin, die eben noch schnell genug war,windet sich mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden und hält sich die linke Seite. Blut durchtränkt ihre Kleidung. Schon ist ein feindlicher Infanterietrupp in die Stellung eingebrochen. Zwei Mann springen auf einmal Conny und Marco an. Marco hat blitzschnell seine Pistole gezogen und streckt seinen Gegner mit mehr Glück als Verstand und zwei Kugeln nieder. Conny wird zu Boden geworfen, ihr Gegner versucht mit einem Kampfmesser auf sie einzustechen. Mit beiden Händen hält sie seinen Arm umklammert, die Messerschmitze immer vor Augen. Marco greift ein, tritt dem Kaiserlichen wuchtig in die Rippen. Mit einem Aufschrei fällt der Mann zur Seite, läßt die Klinge fallen, springt auf, Conny schnappt sich die Klinge und rammt sie dem Kaiserlichen genau in die Genitalien. Brüllend taumelt der Mann davon und Conny kann sich endlich aufrappeln. „Das MG!“ Mit drei Schritten ist sie beim MG. Und kann wieder feuern. Die andern in die Stellung eingebrochenen Kaiserlichen sind auch nicht weit gekommen. Karo ist gerade mit sieben Mann Verstärkung eingetroffen. Die Kaiserlichen laufen ihnen quasi in die Arme. Ohne lange zu fackeln eröffnen Karo und ihr Trupp das Feuer mit den Sturmgewehren und strecken alle Gegner innerhalb von Minuten nieder. Da schlagen auf einmal Geschosse in die Stellung ein und Dreckfontänen schießen hoch. Splitter schwirren umher. Alles springt in Deckung. „Verdammt, wo kommt das her?“ brüllt ein Gefreiter, der sich neben Karo in den Dreck geworfen hat. Karo fällt auf, daß die Abstände zwischen dem knallenden Abschuß und dem Einschlag fast unmerklich sind. Panzerkanonen. „Das sind die Panzer!“ brüllt Karo, nur um sofort bestätigt zu werden: Das kleine Bahnhofsgebäude auf dem Bahndamm, das schon Schäden durch zwei Artillerietreffer erlitten hat, wird durch eine ganze Salve von Treffern in einer großen Rauchwolke in Schutt und Asche gelegt und ein Panzertrupp überrollt bereits den Bahndamm im Abschnitt von Schoeps‘ Truppen. Wer unter ihre Ketten gerät, wird zermalmt, die Ungetüme lassen den Boden erzittern. Hinter den Panzern suchen kaiserliche Infanteristen Schutz vor den Kugeln der „Schimäre“Kämpfer, die gegen das Metall prasseln. Inzwischen ist die Sicht wieder besser. „Los, zerstört die Ketten!!“ brüllt Schoeps den Kämpfern zu. Leichter befohlen, als getan. Mit ihren MGs versuchen die Panzer sich die „Schimäre“-Kämpfer vom Leib zu halten. Und ein Panzer III zeigt, was dem blüht, der den Garben ausweicht: Der Panzer gibt Gas und überrollt genau einen Unteroffizier, der gerade die geballte Ladung ins Ziel bringen will. Der Mann wird zermalmt; die Ladung explodiert und zerfetzt dem Panzer die Ketten. Sofort fliegen die Luken auf, die Besatzung des Panzers will aussteigen. Ein „Schimäre“-Trupp, der dem Panzervorstoß ausgewichen war, taucht aber auf einmal aus der Deckung auf und eröffnet das Feuer, streckt die Panzerfahrer nieder. Einer kommt schließlich nahe genug ran, um eine Handgranate ins Panzerinnere zu werfen; ein Knall und Rauch und Flammen steigen aus dem Panzer auf, dicker Qualm hüllt den Koloß ein, während die Schlacht um ihn herum weitertobt... Auch an anderen Stellen sind die Panzer in die Abwehrstellung eingebrochen und nehmen so eingekeilte „Schimäre“-Trupps in tödliches Kreuzfeuer. Valkendorn und zwei weitere Soldaten geben drei Verwundeten, die nach hinten wollen, Feuerschutz. Aus dem Augenwinkel sieht Valkendorn wie ein Panzer IV auf dem Bahndamm den Turm dreht und mit der Kanone in ihre Richtung zielt. „Runter!!!“ brüllt er und wirft sich hin. Die Panzergranate rast nur einen Meter über ihn hinweg, schlägt genau bei den drei Verwundeten ein und zerfetzt sie. Zumindest haben sie jetzt keine größeren Sorgen mehr. An anderer Stelle machen die Kämpfer von Spezialbataillon 1 aus der Not eine Tugend. Unter einem umgestürzten Baumstamm wartet Sven Ellermann mit drei Mann und einer weiblichen Soldatin auf den Feind. Die Erde bebt, als dieser erscheint: Ein Panzer III rollt dicht an ihnen vorbei, wirbelt dabei eine Dreckwolke mit seinen Ketten auf. „Jetzt!“ brüllt Ellermann. Alle springen auf, schleudern Handgranaten zwischen die Ketten und eine Hohlladung gegen die Panzerung, springen dann wieder in Deckung. In einer gewaltigen Explosion bleibt das stählerne Ungetüm stehen und wird in Rauch gehüllt. Mit Handzeichen bedeutet Sven seinen Leuten, das Wrack zu stürmen und letzten Widerstand auszuschalten. Doch dieses Mal sind die Panzerfahrer schneller draußen und liefern sich mit den „Schimäre“Kämpfern einen erbitterten Schußwechsel. In dieser Situation schießt aus dem Schlachtgetümmel eine Leuchtkugel hoch – eine rote. Karo oder Valkendorn müssen sie abgeschossen haben: Das Signal zum Rückzug zur nächsten Widerstandslinie. „Hoffentlich geht das gut...“ knurrt Sven und brüllt seine Leute zusammen: „Los, Rückzug!“ Geduckt und immer wieder auf den vordrängenden Feind feuernd ziehen sie sich Richtung Jakovlevo zurück... Der junge Oberleutnant Pick hatte durch das Fernglas gesehen, wie Flatten und Reindl mit dem Geländewagen im Graben gelandet waren. Sofort hatte er sich auf den Weg gemacht, um zu schauen, ob er helfen kann. Unterwegs half er bei der Verarztung weiterer Opfer der Tiefflieger und schließlich fand er Flatten zusammen mit der Journalistin in Deckung hinter der Böschung. „Kommen Sie, Oberleutnant Flatten! Die Flieger sind beschäftigt.“ „Ja, und ich muß die Frau nach Safonovo bringen.“ „Wollen Sie da zu Fuß hin?“ fragt Pick mit einem skeptischen Blick auf die von den Tieffliegern zurückgelassenen Lastwagenwracks, während Flatten und die Journalistin die Böschung hoch und wieder auf die Straße klettern. „Ja.“ meint Flatten knapp und fügt hinzu: „Ansonsten wird mir Valkendorn diesen Befehl bestimmt geben.“ Da muß Pick Flatten recht geben. „Aber ich komme mit, Flatten. Sie können jede Hilfe gebrauchen.“ Vielsagend hält Pick seinen Karabiner in die Höhe. „Also los.“ Das war vor nicht ganz einer Viertelstunde. Flatten geht voran, zuletzt Pick, dazwischen Frau Reindl, die sich nicht sicher ist, ob sie sich angesichts der bewaffneten Eskorte wohl fühlen soll oder nicht. So gehen die drei die aufgeweichte Hauptstraße entlang nach Osten. Auf einmal bleibt Pick stehen. „Wartet mal.“ „Was denn?“ fragt Flatten und dreht sich zu Pick um. „Hören Sie!“ Flatten runzelt die Stirn, rückt seine Brille zurecht und horcht dann. Ein Brummen und Rasseln, das schnell lauter wird. „Spürt ihr das auch?“ fragt Frau Reindl. Nur Sekundenbruchteile später spürt es Pick auch: Der Boden zittert. Und zwar immer stärker. „Sind das unsere?“ fragt Pick. Flatten schüttelt den Kopf. Dann müßten wir sie längst sehen.“ Er blickt die Straße entlang, die hier rechts und links von Wäldern und Büschen gesäumt ist. Und auf der rechten, der südlichen Seite sieht man zwischen den Baumstämmen schon riesige Schatten. „Deckung?“ „Deckung!“ Pick greift Frau Reindl am einen Arm, Flatten am andern und dann springen sie in den Straßengraben zur linken. „Kopf runter!“ In dem Moment stürzen Äste, Baumstämme und Büsche auf die Straße, als mehrere Panzer mit voller Wucht auf die Straße durchbrechen. Sie rollen weiter und die Böschung auf der gegenüberliegenden Straßenseite hoch. Schlamm und Dreck spritzen dabei auf, Zweige wirbeln durch die Luft, dünnere Baumstämme werden niedergewalzt. Und irgendwo dazwischen liegen drei Menschen im Dreck und hoffen, nicht entdeckt zu werden. Immer mehr Panzer tauchen auf, einige biegen auch direkt auf die Straße ein und rollen Richtung Jakovlevo. Unter ihrem Gewicht wird die weiche Fahrbahn eingedrückt – Asphalt ist hier in Russland eben nicht gang und gäbe. Der Boden zittert jetzt unaufhörlich und der Krach der Motoren ist ohrenbetäubend. Plötzlich wird alles noch schlimmer: Ein Panzer III rollt direkt über Flatten, Reindl und Pick über den Straßengraben. Sie pressen sich fest an den Boden, während rechts und links von ihnen die Ketten vorüberrasseln und der Unterboden des Panzers gefährlich nahe kommt. Dreckklumpen fallen auf sie herab, Abgase lassen sie husten. Nach endlos scheinenden Momenten ist der Panzer vorbeigerollt. „Scheiße...“ flucht Frau Reindl. „Was machen wir jetzt?“ Pick sieht sich rasch um, registriert, daß die Panzer weiter vorn an der Straße nicht sind, sondern nur an einem eng begrenzten Abschnitt, an dessen Ostrand sie hocken. „Flatten, haben Sie Handgranaten oder Hohlladungen?“ „Eine Hohlladung und zwei Handgranaten.“ Er deutet auf einen Beutel an seinem Gürtel. „Geben Sie sie mir!“ verlangt Pick und hat schon seinen eigenen Beutel mit Handgranaten in der Hand. „Was? Wozu?“ „Nun machen Sie schon!“ Etwas widerstrebend reicht Flatten seinen Beutel rüber zu Pick. „Ok. Oberleutnant Flatten, Frau Reindl, hat mich gefreut! Warten Sie nicht auf mich.“ „Was haben Sie vor?“ japst Reindl, alle möglichen Befürchtungen hegend. „Was schon?“ gibt Pick entschlossen zurück. „Ich werd unsere Freunde hier was ablenken. Den Moment werden Sie beide nutzen, um sich aus dem Staub zu machen!“ Pick schultert seinen Karabiner und schleicht dann am Straßenrand entlang auf die Panzer zu, die inzwischen drei Kolonnen gebildet haben, die alle mehr oder weniger stark nach Osten eingeschwenkt sind. „Kommen Sie!“ raunt Flatten zu Frau Reindl rüber. Gedeckt durch einige Büsche und ein paar Farne hasten sie in die andere Richtung. Hinter sich hören sie auf einmal eine Explosion und dann noch eine. Kurz darauf das Feuer der MGs der Panzer. „Jetzt!“ Flatten springt auf die Straße und rennt rüber zur anderen Seite, wo mehr Wald ist. Reindl folgt ihm. „Was wird aus Oberleutnant Pick?“ keucht sie zwischendurch. „Sie haben’s doch gehört!“ faucht Flatten zurück und hetzt weiter. Frau Reindl ist sich nicht sicher, ob Flatten damit Picks Worte von wegen, sie sollten nicht warten, meint oder das MG-Feuer, das sie hören konnten... Durch die Jalousien dringt nur diffuses Licht in das chaotische Appartement. Klamotten liegen auf dem einzigen Stuhl im Raum, leere Whisky-Flaschen stehen auf dem niedrigen Holztisch. Fliegenfänger hängen in einer Ecke von der Decke und die welke Topfpflanze neben dem Fenster zeugt von zu wenig Wasser. Schweratmend läßt sich eine schlanke Frau mit langen dunkelblonden Haaren und schönen festen Brüsten auf das Sofa fallen. Ein kräftig gebauter Mann mit sandfarbenen Haar liebkost die Innenseite ihrer Oberschenkel, während sie sich mit ihrer Hand kurz in ihren Schritt fährt und dabei kurz zusammenzuckt. „Los, jetzt gib’s mir Danko...“ stöhnt sie lustvoll. „Ich will Dich spüren.“ „Kannst Du haben.“ antwortet der Mann, seine Hände tasten sich an ihren Seiten hoch, er leckt mit seiner Zunge über die sanfte Haut ihres Bauches. Dann liebkost er ihre Brustwarzen und arbeitet sich langsam hoch, schließlich geben sich die beiden lange Zungenküsse. Ihre Beine umschlingen seine Hüften. Danko spürt, wie er richtig heiß wird. „Jetzt...“ flüstert sie ihm ins Ohr. Und er dringt in sie ein. Spürt die Wärme. Sie vibriert vor Erregung, was sich auf ihn überträgt. Rhythmisch bewegen sich ihre beiden Hüften, eng aneinandergepresst. Nach mehreren kurzen Seufzern gibt die Frau leise Stöhner von sich. Immer schneller atmet Danko, als sie sich in seinem Arm windet. „Hör nicht auf...“ Danko denkt auch gar nicht daran, legt mit seiner Zunge über ihre Brüste, während der Griff ihrer Beine um seine Hüfte stärker, verlangender wird... Da klingelt das Telephon auf der Kommode neben dem Sofa. Danko schreckt auf. Sie packt mit einer Hand in sein Haar und gleitet mit der anderen über seinen etwas ausgeprägten Bauchansatz runter zur erogenen Zone. „Nicht drauf achten, Tiger... Mach weiter...Ich will es spüren...ich bin heiß...“ keucht sie schweratmend. Und zunächst macht er auch weiter, aber das Telephon klingelt weiter, geradezu fordernd. Schließlich stemmt er sich hoch. „Tut mir leid, Babe, aber das könnte für wichtig sein.“ Sanft löst er sich aus ihrer Umklammerung und setzt sich neben sie auf das Sofa und schnappt sich den Hörer. Schnell hält er eine Hand vor die Sprechmuschel. Der beleidigten und enttäuschten Schönheit raunt er zu: „Los, geh ins Bad und zieh Dir was an. Dann erst meldet er sich, ziemlich sauer: „Hier General Popovic. Welcher Fichser wagt es mich zu stören?“ Innerlich brodelt er vor Wut. Am andern Ende der Leitung meldet sich jemand auf Kroatisch. „Herr General, waren Sie wieder beschäftigt?“ Danko erkennt die Stimme von Hauptmann Mirovic, Kommandeur des ausschließlich aus Kroaten bestehenden „Schimäre“-Spezialbataillons 6. General Danko Popovic hatte kurzfristig dieses Bataillon selber geführt, nachdem die anfängliche Kommandeurin gefallen und er von der kroatischen Armee Dubrovniks zu „Schimäre“ gewechselt war. Jetzt ist er der ranghöchste „Schimäre“-Offizier im Gebiet Balkan und Naher Osten und Mirovics Vorgesetzter. Außerdem untersteht Danko auch das aus Rumänen und Ungarn gebildete Spezialbataillon 3 von Brigadier Morgenstern, daß momentan auf dem Weg zu einer Kommandoaktion in Bulgarien ist. Mühsam unterdrückt Danko, der selber Serbe mit einem Schuß kroatischen Blutes ist, seine Wut, weil ihm Mirovic den Orgasmus vermasselt hat. „Ja, war wieder beschäftigt...“ knurrt er auf Serbokroatisch. „Nach dem Ton Ihrer Stimme zu urteilen wieder die Tochter des polnischen Botschafters?“ „Ja, Hauptmann.“ „General, das kann Sie noch aufs Schafott bringen.“ „Was geht Sie das überhaupt an, Mirovic?“ faucht Danko, während er sich mit nur einer Hand seine Shorts greift und diese anzieht. „Ich weiß, gar nichts.“ bestätigt Mirovic. „Deswegen ruf ich auch nicht an.“ „Achso. Sondern?“ Mit entsetztem Blick sieht Danko, wie ihm die süße Svetlana noch einen Kuss zuwirft (inzwischen hat sie sich auch was angezogen) und dann das Appartement verläßt und die Tür hinter sich zuknallt. Das läßt ihn doch etwas zusammenzucken. Mirovic klärt ihn derweil über den Grund des Anrufs auf: „Heute morgen bekamen wir doch aus der Schweiz den Ruf an alle ‚Schimäre‘-Posten, nach einer Frau namens Brigitte Fehr zu suchen. Ich sollte mich ja melden, wenn sich da was täte.“ „Ja, ich weiß Mirovic. Ich weiß. Haben Sie deswegen schon mit dem HQ in Jakovlevo Kontakt aufgenommen?“ „Geht nicht. Seit fast zwei Stunden ist der Kontakt dorthin abgebrochen. Die stecken wohl in der Scheiße.“ „Verdammt. Ok, was ist so wichtig, daß Sie mich beim Beischlaf stören?“ „Naja, wir haben Frau Fehr gefunden.“ Jetzt springt Danko aber doch auf und bleibt einigermaßen irritiert, nur mit Shorts bekleidet, mitten im Raum stehen. „Ist nicht wahr! Wo das denn?“ „Tja, das werden Sie kaum glauben. Sie sitzt allen ernstes im Knast!“ „Bitte?“ Die Antwort ist so unwahrscheinlich, daß Danko daran nichtmal im Traum gedacht hätte. Jakovlevo ist ein Schlachtfeld. Auf den Straßen liegen Tote und ausgebrannte Fahrzeugwracks. Trotz der Bemühungen der „Schimäre“-Kampfflieger, die bis zum letzten Tropfen Sprit im Kampf bleiben, und des Sperrfeuers der Flaks konnten weitere Fliegerangriffe nicht ganz verhindert werden. Im südlichen Vorfeld der Stadt liegen bereits mehrere brennende Panzerwracks. Und die Schlacht wird in den Gärten und Obsthainen und um die Garten-und Bauernhäuser, die zum Teil bereits brennen, erbittert weiter geführt. Inzwischen tobt sie seit über zweieinhalb Stunden. Sarah Weigang und zwei weitere Soldaten von Spezialbataillon 1 sind in einen Apfelbaum geklettert und als ein Panzer IV vorüberfährt, springen sie auf. Ein anderer Kämpfer sprengt die Ketten des Panzers, der stehenbleibt. Längst haben die „Schimäre“-Kämpfer natürlich gemerkt, daß die Panzerfahrer in solchen Situationen als Infanteristen weiterkämpfen. Und schon fliegen die Ausstiegsluken aus. Die Panzerfahrer kriegen die Gewehrkolben in die Fresse gedrescht, stürzen zurück in den Panzer. Einer schießt dabei mit seiner Pistole, trifft einen „Schimäre“-Kämpfer, um dessen rechte Schulter sich eine rötliche Tröpfchenwolke bildet. Der Mann stürzt mit einem Schmerzensschrei vom Panzer, während Sarah mit ihrem Sturmgewehr eine und dann noch eine Salve durch das Turmluk ins Panzerinnere, wo die Querschläger hin-und herpeitschen. Schreie künden vom Schicksal der Besatzung. Der angeschossene Kollege von Sarah versucht sich wieder aufzurappeln, hält sich die rechte Schulter, Blut rinnt über seine Hand. Eher zufällig blickt er nach links – und sieht einen Panzer III, hinter dem mehrere Kaiserliche in Deckung gegangen sind und auf irgendwelche „Schimäre“-Kämpfer das Feuer eröffnen. Und der Panzer dreht den Turm. Zu ihnen! „Sarah, runter da!!“ brüllt der verletzte Soldat. Aber Sarah hat die Gefahr auch schon gesehen, kann gerade noch vom Panzer abspringen, als das Geschoß genau in den Turm kracht und diesen halb von der Wanne runter ballert, so daß das Kanonenrohr schief in der Luft hängt. Weiter rechts haben sich Marco Konrad und Conny mit ihrem MG hinter einer Sandsackbarriere verschanzt, die Patronen springen zu Boden, während Conny draufhält. „Wie viel noch?“ „Noch ein Gurt!“ antwortet Marco. „Ok, besorg nochmal neue!“ „Alles klar!“ Als Conny einen weiteren Feuerstoß abgibt und damit einige Panzerfahrer, die sich als Infanteristen betätigen, in Deckung zwingt, springt Marco auf und rennt los. Er muß irgendwo jemanden finden, der noch einen MGGurt erübrigen kann. Was mehr oder weniger aussichtslos sein dürfte. Er rennt zwischen zerschossenen Apfelbäumen durch und dann geduckt über eine Wiese, auf der bereits vier Tote in „Schimäre“-Uniform liegen. Sofort jagt ihm eine MG-Garbe von einem Panzer III hinterher, der hinter einem brennenden Schuppen in Deckung gestanden hat. Marco hechtet sich hinter einer bereits arg beschädigten Steinmauer, die den Übergang zum nächsten Gehöft markiert, in Deckung. Dort sind bereits drei Soldaten der HQ-Kompanie in Deckung gegangen. Dicht über ihren Köpfen schlagen Gewehrkugeln ein. Um besser gedeckt zu sein, rückt Marco näher an die Kameraden heran, die sich in eine Erdmulde ducken müssen, die durch den Regen zu einer Pfütze geworden ist. „Hallo, Herr Oberst, wollen Sie auch ins Planschbecken?“ witzelt einer der Männer, während ein anderer zwei Einzelschüsse in Richtung eines feindlichen Panzerfahrertrupps abfeuert, der sich hinter einem liegengebliebenen Panzer IV in Deckung geflüchtet haben. „Nein, ich suche nach Munition!“ Aber der Soldat schüttelt den Kopf. „Wir können nichts entbehren, aber ich glaub in dem ‚Grünen Haus‘ haben unsere Leute noch Munition.“ „Alles klar. Wer ist dort?“ „Ein paar Sanis, drei von unserer Kompanie, ich glaub auch Leute von der Funkersektion.“ „Ich dachte, die wären alle weg!“ „Nein, ein paar sind zurückgekommen!“ „Danke Soldat, ich werd mich dorthin durchschlagen.“ „Gut, wir geben Ihnen Feuerschutz.“ Mit den Fingern zählt der Soldat bis drei, dann springt Marco auf und rennt los. Hinter sich hört er das Knallen der Sturmgewehre der drei Soldaten, die ihm Feuerschutz geben. Einigen durchgebrochenen Panzern ausweichend erreicht Marco schließlich das ‚Grüne Haus‘: Eine ursprünglich grün gestrichene Holzhütte mit anderthalb Meter hohen Steinfundamenten. Vom Holz steht freilich nicht mehr viel. Zwei Panzerwracks liegen rauchend vor der Hütte, die sie vor ihrer Ausschaltung wohl zusammengeschossen haben. Gehetzt jagt Marco durch einen Durchbruch, der wohl mal die Tür war hinter das Steinfundament in Deckung. Ein Teil der einzigen Innenwand der Hütte steht noch, auf dem Boden sind große Pfützen vom Regen und zwei tote Kaiserliche. Auf der anderen Seite der Wand findet Marco die Verteidiger – es sind wirklich welche vom Generalstab: Stabshauptmann Kruse und Obergefreiter Bleck von den Funkern, Obergefreiter Tripp und Leutnant Iven von der selben Abteilung. Auf dem Boden hockt ein Sanitäter und kümmert sich um Stabsgefreite Denise Neunzig, die ein Splitter an der Wade erwischt hat. Gerade verabreicht der Sanitäter der Frau eine Spritze Morphium, Bleck und Tripp helfen dabei, in dem sie die Frau festhalten, als der Sani die heftig blutende Wunde versorgt. Iven steht an der Mauer in Deckung und gibt hin und wieder mit seinem Sturmgewehr eine Schußsalve ab. „Beeilt euch mal da hinten, bringt die Frau hier weg!“ drängt er. Dann sieht er Marco Konrad. „Oberst, was wollen Sie denn hier?“ „Ich wollte mir eigentlich einen neuen MGGurt bei Ihnen borgen, Leutnant!“ meint Marco über ein paar Explosionen in direkter Nähe hinweg und lehnt sich neben Iven gegen die Mauer. „Geht nicht, Oberst, wir haben nur noch wenig Munition!“ „Scheiße! Außerdem weiß ich nicht, ob ich zurückkomme – da hinten hat der Gegner einen Panzereinbruch erzielt.“ Mit dem Daumen deutet Marco über die Schulter. „Scheiße, verdammt nochmal!“ flucht Iven. Kruse flucht auf einmal auch. „Leute, wir kriegen Probleme!“ Als Iven wieder um die Mauerkante herum schaut, an den beiden Panzerwracks vorbei, sieht er drei weitere Panzer, zwei Dreier und ein Vierer, auf sie zurollen. Sein Herz macht einen kleinen Hüpfer, dann fängt er sich wieder. Zu Marco meint er: „Oberst, Sie haben nicht zufällig noch ein paar Handgranaten?“ „Doch, hier.“ Marco holt seine letzten zwei Handgranaten hervor. Iven dreht sich um. „Obergefreite Neunzig, haben Sie noch Handgranaten?“ Denise steht der kalte Schweiß auf der Stirn und sie zittert vor Schmerzen, aber sie nickt. Tripp holt aus ihrer Tasche am Gürtel zwei Handgranaten. „Iven, ich glaub das reicht!“ In dem Moment flackert in den tiefhängenden Wolken eine weitere Leuchtkugel auf, dicht neben zwei Messerschmitts, die mehreren Flakgarben ausweichen. „Das ist das Signal!“ stellt Bleck fest. „Erneuter Rückzug!“ „Ok, Bleck, Kruse, Tripp, Iven, lenken Sie die Panzer ab, wir bringen die Frau hier weg!“ befiehlt Oberst Konrad. Der Sani nickt ihm zustimmend zu. Der Auftrag ist klar. „Kommt Leute!“ Kruse marschiert los, dann folgt ihm Bleck, schließlich auch Iven und Tripp. Mit nur einer Handvoll Handgranaten drei Panzer ablenken – schöne Scheiße. Wenn nicht sogar ein Himmelfahrtskommando. Die Sturmgewehre in die Hand schleichen die vier um die Hausruine herum, nutzen einen umgestürzten Birnbaum daneben als Deckung. Kruse zählt. „Eins, zwo, drei...los!“ Sie spurten los. Rüber zu den beiden rauchenden Wracks, die als nächste Deckung dienen sollen. Da peitschen auf einmal Schüsse. Zwei Kaiserliche irgendwo von links. Sofort ducken Iven und Bleck sich, Sturmgewehr im Anschlag und geben Feuerschutz. Als Kruse und Tripp beim Wrack in Deckung sind, schießen sie und geben so Iven und Bleck Feuerschutz. Als alle wieder beeinander sind, gibt Kruse den Befehl: „Alle Handgranaten bereit halten!“ Das Dröhnen der Panzermotoren ist schon ohrenbetäubend laut. „Ok, jetzt!“ Alle stürmen hinter dem Panzerwrack vor – da feuern die Panzer. Der laute Knall läßt sich die Männer sofort hinwerfen. Die drei Geschosse schlagen dicht hintereinander ins ‚Grüne Haus‘ ein und lassen Mauerstücke und Bretter in hohem Bogen durch die Luft fliegen. „Scheiße!“ flucht Kruse. „Hoffentlich haben sie es geschafft...“ knurrt Bleck, der neben Kruse im Dreck liegt. „Tripp!!“ brüllt Kruse. „Ja, hier!“ „Wir müssen weg hier! Los, kundschaften Sie den Rückweg aus!“ „Zu Befehl!“ Einer der Panzer – ein Dreier – setzt zurück, dreht sich mehr zu ihnen hin und nimmt sie aufs Korn. „Au Scheiße...“ krächzt Iven. Schon feuert der Panzer mit seinem Maschinengewehr, denn für den Einsatz der Kanone sind sie zu nah, sie liegen im toten Winkel. Die Kugeln jagen dicht über Iven und die andern hinweg, Tripp schafft es nur bis in eine matschige Bodenmulde direkt neben dem einen Wrack, muß dann dort liegen bleiben, um nicht getroffen zu werden. „Was jetzt?“ brüllt Bleck. „Wir müssen weg hier!“ „Scheiße, wir müßten den Panzer ausschalten!“ stellt Iven fest. „Na, dann tun wir das doch!“ ruft Kruse. „Iven, Sie geben Feuerschutz vor den eventuell aussteigenden Panzerfahrern. Werfen Sie uns Ihre Handgranaten rüber. Bleck und ich kümmern uns darum!“ Ohne weiteres Überlegen löst Iven den Beutel mit den Handgranaten von seinem Gürtel, richtet sich was auf, um den Beutel rüber zu Kruse zu werfen. Sofort drückt er sich wieder an den Boden, als ihm wieder Kugeln um die Ohren fliegen. Nur Momente später springen Kruse und Bleck auf und rennen getrennt auf den Panzer zu. Iven sieht, wie das MG des Panzers versucht, ihnen zu folgen, in hohen Spritzfontänen folgen die Geschosse den beiden Läufern. Kruse ist zuerst am Panzer, schleudert die Handgranaten in die Ketten und wirft sich zur Seite. Beim Versuch, die Lage zu überblicken, stolpert Bleck, strauchelt – und wird voll von einer MG-Salve getroffen. Für einen Sekundenbruchteil bleibt er steif wie ein Brett in der Luft hängen, dann ein Zucken, er dreht sich halb um seine eigene Achse und fällt dann blutüberströmt auf den aufgeweichten Boden. Im selben Moment fliegen die Ketten des Panzers auf einer Seite auseinander. Kruse springt auf und kommt zurückgerannt. Die Ausstiegsluken des Panzers fliegen auf. Ivens Auftritt. Er feuert, die Kugeln prallen pfeifend von der Panzerung ab, schließlich fliegt der Panzerkommandant im Turmluk getroffen nach hinten und fällt in den Turm zurück. Die andern Panzerfahrer ziehen schnell wieder die Köpfe ein, nur einer feuert mit seiner Pistole einmal blind in Ivens Richtung. Für Bleck freilich kann man nichts mehr tun. Als Kruse an Iven vorbeihetzt, rappelt sich auch dieser auf und dann treten sie den Rückzug an, bevor die anderen Panzer, die bereits die Trümmer des ‚Grünen Hauses‘ erreicht haben, auf die Idee kommen, sie aufs Korn zu nehmen. Und Iven schießt eine wichtige Frage durch den Kopf: Wo sind die Panzer von „Schimäre“, die doch angeblich nach zwei Stunden eingreifen sollten? Schlammiges Wasser spritzt auf, als die Panzer des 1. „Schimäre“-Panzerregiments die Hauptstraße Richtung Jakovlevo entlangrollen. Wegen des Regens hat Hauptmann Markus Orth das Turmluk über sich zugezogen; aber ansonsten ist er nicht so nervös wie sonst vor anderen Schlachten. Der Gegner wird schon durch den Kampf gegen die bei Jakovlevo stehenden Truppen geschwächt sein. Bohnsack hat inzwischen gemeldet, daß man die feindliche Luftwaffe im Griff habe. Und im Übrigen hat sich schon mehrmals erwiesen, daß die Panzer von „Schimäre“ den kaiserlichen Panzern geringfügig überlegen sind – bessere Panzerung und etwas höhere Schußweite. Über Funk kommt jetzt die Durchsage: „Chef, es sind wieder zwei ausgefallen.“ „Was für welche?“ „Beides K2.“ meldet der Zugführer über Funk zurück. Sofort reicht der Bordfunker von Orths Führungspanzer die Nachricht per Zettelnotiz an Orth weiter. Der verzieht kurz das Gesicht, aber eigentlich ist er froh: Bislang sind nur fünf der leichten Aufklärungspanzer durch den ins Getriebe gedrungenen Schlamm ausgefallen. Plötzlich, vielleicht zwei Kilometer vor Jakovlevo geht’s rund. Über Bordfunk kommt von der vordersten Panzergruppe die Meldung: „Feindkontakt! Panzer III, außerhalb feindlicher Schußweite.“ Auf ein Nicken Orths hin gibt der Funker im Befehlspanzer die Weisung durch: „Feuer nach eigenem Ermessen!“ Und dann ist der Äther voller Leben: „Schuß auf Feind ohne Wirkung....Scheiße man, die schießen ja schon zurück!“ „Hier K2 Nr. 5, sind getroffen, wiederhole: getroffen, steigen aus! Die haben ihre Reichweite erhöht!“ „K2 Nr. 5, helfen Ihnen!“ Und Markus gibt dann selbst über Funk den Befehl: „Durchbruch erzwingen, Feuer frei!“ Über den Äther hört man Kanonenabschüsse und Detonationen, Schreie. „Schnell, bring uns nach vorn!“ brüllt Markus dem Mann am Steuer zu. Hinter ihnen scheren die nachfolgenden Panzer seitlich aus, um sich neben der Straße schneller nach vorn zu schlagen. Dort breitet sich jetzt immer schneller ein heftiges Gefecht aus, als die „Schimäre“-Panzer von den Kaiserlichen mit heftigem Sperrfeuer empfangen werden. Geschosse fliegen hin und her, lassen Dreckfontänen hochschießen und Baumstämme splittern. „Wir müssen näher ran!“ stellt einer der „Schimäre“-Panzerfunker fest. Denn offensichtlich haben die Kaiserlichen ihre Panzer um eine Winzigkeit verbessert. Jetzt muß derjenige mit der besseren Gefechtsführung gewinnen. Ein Trupp von sieben „Schimäre“-Panzern – M2 und S2 – setzt sich vom Rest ab, der auf das Sperrfeuer des Gegners antwortet, und rollt die Straße weiter entlang. Und eröffnet das Feuer aus allen Rohren. Jetzt, auf die kürzere Entfernung, wirken die Treffer bei den kaiserlichen Panzern absolut tödlich. Die getroffenen Panzer fangen an zu qualmen, fangen Feuer, die überlebenden Panzermänner versuchen zu flüchten, geraten aber immer wieder ins MG-Feuer der „Schimäre“-Panzer. Schließlich wehen die Rauchschwaden von fünf kaiserlichen Panzerwracks über die Straße. Eines wird von einem S2 von der Straße runtergeschoben und dann rollen die „Schimäre“-Panzer vorbei. Der Durchbruch auf der Straße hat geklappt. Aber die Schlacht ist ja noch nicht vorbei. In einem nahen Birkenhain haben sich mehrere der aufgewerteten Panzer III versteckt gehalten. Sie eröffnen jetzt das Feuer auf die Seiten der „Schimäre“-Panzer. Der vorderste wird direkt getroffen, die Kettenschürze fliegt davon, die Ketten werden zersprengt, ein zweiter und dritter Treffer setzen ihn in Brand. Zwei M2 bleiben stehen und feuern zurück, um der aus dem Panzer kletternden Besatzung Deckung zu geben, während die andern Panzer weiterrollen. Noch einer wird getroffen, aber noch nicht tödlich, denn die nächste Salve der Kaiserlichen liegt zu kurz. Die aus dem brennenden Panzer gekletterten Panzermänner – drei Überlebende insgesamt – rennen schnell auf die andere Seite ihres Panzers und springen dort an der schlammigen Straßenböschung in Deckung. „Scheiße, ist das kalt!“ flucht einer von ihnen. Weiter rechts haben sich drei weitere M2 durch einen verwilderten Obsthain geschlagen, nachdem sie beim dazugehörigen Gehöft zwei Panzer III in Brand geschossen haben. Jetzt werden die Kaiserlichen im Birkenhain ins Kreuzfeuer genommen. Über die Straße stößt Orth mit seinem Befehlspanzer dazu, übernimmt selbst die Leitung der Aktion. „Los, räuchert sie aus!“ Plötzlich knallen genau von der anderen Seite Schüsse – mehrere Panzer IV der aufgewerteten Version haben sich woanders zurückgezogen, gewendet und greifen jetzt hier die Flanke der durchgebrochenen „Schimäre“-Panzer an. Von denen bleiben direkt wieder zwei getroffen und qualmend liegen.... Hauptmann Ingo Steinberger hat seinen Panzer bei den Trümmern des ‚Grünen Hauses‘ halten lassen. Es muß nachgetankt werden. Er steht draußen neben dem Panzer im Regen und läßt sich von seinem Funker über die neuesten Meldungen informieren, während der Fahrer den letzten Spritkanister in den Tank füllt. „Wieviel Sprit haben die anderen noch?“ will Steinberger über den nahen Gefechtskrach hinweg wissen. Der Funker macht ein düsteres Gesicht. „Diese Kerle klammern sich an jedes Widerstandsnest und keiner gibt auf. Wir haben schon mehr Sprit als kalkuliert verbraucht. Unsere Abteilung im Osten hat gemeldet, daß sie das feindliche Panzerregiment wohl nicht mehr lange wird aufhalten können.“ „Sie sollen sie solange dezimieren, bis sie nicht mehr so gefährlich sind!“ „Ja, sind schon dabei. Aber trotzdem – es läuft nicht gut. Wieso müssen wir auch so langsam vorgehen?“ „Weil wir sonst noch weniger Chancen haben. Schnelle Durchbrüche spielen diesen Typen in die Hände. Wir arbeiten uns weiter langsam vor.“ Nach einer Pause fügt Steinberger, dabei mit einer Hand über seinen roten Bart streichend, hinzu: „Und das mir jedes Haus in Jakovlevo eingerissen wird. Die dürfen keine Verstecke mehr haben!“ Inzwischen haben die kaiserlichen Angriffsspitzen von Süden kommend die letzte Stellung erreicht – Jakovlevo selber. Aus den Gräben, die quer über die Straßen und durch Vorgärten laufen, feuern die „Schimäre“-Kämpfer auf die kaiserlichen Infanteristen. Und ducken sich dann gleich wieder in Deckung, wenn auf einmal die Panzer auftauchen und das Feuer eröffnen. Als ein Soldat zu Sven Ellermann meint, die Luft sei aber sehr splitterhaltig, faucht Ellermann nur müde: „Ach ne!!“ und lädt dann ein neues Magazin ins Sturmgewehr. Es ist sein letztes. Da bebt die Erde auf einmal ganz gewaltig. „Scheiße! Kopf runter!“ Ja, Kopf runter, denn zwei Panzer rollen genau über ihren Graben. Die Wände geben nach, Schlamm und Erde fallen auf sie herab. „Scheeiiiißeee!!“ Als die Panzer vorübergefahren sind, versuchen sich alle im Graben sofort wieder aufzurappeln, denn auf einmal springen kaiserliche Soldaten zu ihnen herab. Sven hat seine Waffe schnell genug bei der Hand und kann zwei abknallen, sieht etwas aufblitzen, wälzt sich schnell zur Seite, sieht nur noch wie sich ein Bajonett neben ihm in den Dreck bohrt. Ein anderer „Schimäre“-Kämpfer hat sich inzwischen wieder auf die Beine gebracht, tritt dem Angreifer das Bajonett aus der Hand, packt ihn und rammt sein Knie in die Weichteile des Kaiserlichen. Der stößt die überraschende Gegenwehr auf einmal weg und versucht seine Pistole zu ziehn. Hinter ihm ist nun Sven schneller: Er zieht sein Kampfmesser und wirft es – es bleibt von hinten im Hals des Kaiserlichen stecken, der erst auf die Knie und dann ganz umfällt. Und auch die anderen Kaiserlichen werden von den „Schimäre“-Kämpfern jetzt im Nahkampf niedergemacht. Die eben vorübergerollten Panzer haben nun gehalten, einer will zurücksetzen. Sven wirft schweratmend einen Blick zu ihnen hinüber. Wenn die Panzer jetzt hier angreifen... Zweimal, viermal knallt es. Die einschlagenden Geschosse lassen die Trümmer der Panzertürme wegfliegen. Alle ducken sich erschrocken. „Was war das?“ fragt ein Kaiserliche, der sich gerade ergeben hat und von einem Unteroffizier den Gewehrlauf unter die Nase gehalten bekommt. „Eine Acht-acht.“ murmelt Sven nur. „Eine Acht-acht.“ In der Tat! Die Kaiserlichen sind den Flaks nun so nahe gekommen, daß diese ihr Feuer nicht mehr gen Himmel, sondern gegen die Panzer richten und zusammen mit den Paks ein mörderisches Sperrfeuer entwickeln können. „Sloboda!“ Mit diesem Ruf gibt der Chef des kroatischen Pak-Trupps den Feuerbefehl. Vom Fenster des dritten Stockes des Verwaltungsgebäudes aus haben sie eine gute Übersicht über das Gefechtsfeld. Alle springen zur Seite, um dem Rückstoßruck der Pak auszuweichen. Der Schuß sitzt, ein Panzer, der gerade durch eine Seitenstraße auf die Hauptstraße wollte, bleibt brennend liegen. Es ist der siebte, den die Kroaten schon abgeknallt haben. Schon schleppen zwei von ihnen die nächste Granate an und die Pak wird geladen. Neben dem eben abgeschossenen Panzer rennen plötzlich drei „Schimäre“-Kämpfer aus einem Flachdachgebäude, das nur Augenblicke später in einer großen Staubwolke zusammenstürzt – ein Panzer IV ist einfach durch das Gebäude durchgebrettert. „Sloboda!“ Wieder jagt ein Geschoß aus der Pak heraus. Doch dieses Mal haben die Kroaten zu hektisch geschossen, der Schuß geht daneben, haut dem neben dem Panzer in den Schutt. Jetzt ist die Aufmerksamkeit des Panzers geweckt. Der Turm dreht sich ein Stück – und dann zielt der Panzer mit seiner Kanone direkt auf den Pak-Trupp. Zum Nachladen und einem zweiten Schußversuch bleibt keine Zeit. „Weg hier!“ brüllt der Truppführer. Aber da schlägt schon das Geschoß genau bei ihnen ins Haus ein. Kruse, Iven, Tripp wollten gerade zu dem Haus hinüberlaufen, sind vielleicht noch 10 m entfernt, als die Explosion die Fassade auf die Straße stürzen läßt. Sie müssen vor den herniederprasselnden Brocken zur Seite springen. „Dort rüber!“ brüllt Iven und deutet auf ein kleines Haus mit einer Kellertreppe an einer Seite. Sie hasten dorthin, knapp hinter ihnen schlägt ein weiteres Geschoß aus einer Panzerkanone ein. Dann erst haben die drei das Loch mit der Kellertreppe erreicht und drücken sich dort gegen die Wand. „Sieht scheiße aus.“ stellt Iven fest. Und Tripp fügt hinzu: „Ich weiß schon, warum ich nur Funkcodes dechiffrieren wollte.“ Kruse schaut die beiden schweratmend an – den etwas gemütlich wirkenden Tripp und den wachsamen Iven, dessen kurze grauen Haare unter dem Helm nicht zu sehen sind. „Meine Herren, nicht so viel lamentieren. Konstruktive Ideen bitte!“ Irgendwo nahe bei ihnen schlägt wieder ein Panzergeschoß ein, Dreck und irgendwelche Trümmer regnen hernieder, Schlammspritzer. Iven weiß es nicht, ahnt es aber: Eine zusammenhängende Front gibt es nicht mehr. Die feindlichen Truppen stehen in Jakovlevo und kämpfen nur noch gegen einzelne Trupps an. Hinter einem brennenden Gebäude fast in der Mitte des Ortes versuchen Marco Konrad und der Sanitäter den Splitter aus dem Bein von Denise Neunzig zu entfernen. „Oberst, Sie müssen sie festhalten! Ich hab keine Betäubungsmittel mehr!“ „Alles klar!“ Sie sind in Eile, denn der Gefechtslärm wird immer lauter. Von irgendwoher kommt Motorenlärm. Nur wenige hundert Meter weiter hat sich Karo zu Schoeps durchgeschlagen, die beiden haben sich in einen der Schützengräben geflüchtet. Vor dem Graben liegen drei Panzer III, ausgebrannt, vernichtet mit den letzten Hohlladungen und Handgranaten. „Schoeps, was ist mit der Reserve, die Du hattest?“ „Du meinst Prezow? Den hab ich vor einer halben Stunde verbraten, um eine Umgehung von uns im Westen zu verhindern. Seine letzte Meldung waren hohe Verluste.“ „Verdammt.“ Beide springen auf und feuern eine Salve ab, um einige feindliche Infanteristen in Deckung zu zwingen und werfen sich dann wieder in den Graben. „Wenn hier Panzer auftauchen...“ grummelt Schoeps. „Ich weiß...“ antwortet Karo. „Hast Du denn noch Munition, Schoeps?“ „Nicht wirklich. Und Du?“ Schoeps sieht Karo an und muß schlucken, denn Karo schüttelt den Kopf. „Auch nicht wirklich.“ „Wir haben Probleme, was?“ „Und wie.“ Karo wirbelt herum und zieht ihr Messer, als eine verdreckte Gestalt in den Graben springt. „Ich bin’s!“ Es ist Conny. „Conny, wie kommst Du denn hier hin?“ „Ach, frag nicht!“ „Karo, sollen wir nicht nochmal über eine Kapitulation nachdenken?“ fragt Schoeps vorsichtig. „Bist Du irre?!“ fährt Karo sie an. Und zieht ihr Bajonett. „Wir werden nicht kapitulieren. Im Gegenteil. Wir holen uns Munition.“ Mit einem schnellen Handgriff hat sie das Bajonett auf dem Sturmgewehr aufgepflanzt. „Und woher?“ will Conny wissen. Karo deutet mit dem Daumen über ihre Schulter zum schlammigen Grabenrand. „Von unseren Gefallenen. Die haben ihre Magazin bestimmt noch nicht leergeschossen. Schoeps, Du gibst uns Feuerschutz.“ „Ist klar.“ Schoeps nickt und eilt dann den Graben entlang zu zwei weiteren „Schimäre“Kämpfern, um von deren besserer Position aus und mit deren Hilfe den Feuerschutz zu gewährleisten. In dem Moment, als die drei sich an den Grabenrand werfen und Dauerfeuer abgeben, klettern Karo und Conny aus dem Graben und rennen los. Nach fast zehn Metern taucht auf einmal ein Kaiserlicher vor Karo auf. Sie rammt ihm ihr Bajonett in den Bauch und stößt ihn zur Seite. Weiter! Da vorne liegen fünf tote „Schimäre“-Kämpfer! Im Eingang eines Gehöfts. Dort werfen sie sich hin, gerade rechtzeitig, denn schon peitschen von irgendwoher feindliche Kugeln. Schoeps hat ihr Magazin leergeschossen. Sie und ihre beiden Kameraden lassen sich in den Graben zurückfallen. Einer der Männer reicht ihr wortlos ein letztes Magazin. Rein damit! Kurzes Anzählen: Eins, zwei, drei...Hoch und Feuer! Unter diesem Feuerschutz schaffen Karo und Conny wieder den Rückweg, doch schließlich tauchen auf dem Gehöft zwei Panzer III auf und feuern mit ihren Kanonen, die beiden „Schimäre“-Kämpferinnen müssen den Einschlägen ausweichen. Völlig außer Atem und leicht zitternd kommen sie wieder im Graben an. Schoeps kommt rübergelaufen. „Und?“ „Hier.“ Conny hält eine blutbefleckte Tasche hoch, die sie einem verstümmelten Toten abgenommen hat, um die eingesammelte Munition zu transportieren. Schoeps nimmt sich drei Magazine und zwei Handgranaten heraus. „Damit beschäftigen wir die beiden Panzer noch was. Na los, bringt den Rest zum HQ!“ Immer noch schweratmend nickt Karo. Das HQ-Gebäude muß jetzt möglichst lang gehalten werden. Sie nimmt die Tasche an sich und bedeutet Conny mit einem Handzeichen, ihr zu folgen. Sie laufen den Graben entlang und verlassen ihn erst nahe eines Lastwagenwracks, um dort Deckung zu suchen. Unterwegs begegnen ihnen immer wieder „Schimäre“-Kämpfer, die noch aushalten und zum Gruß den beiden Offizierinnen nur zunicken. Alles andere wäre jetzt unnötiger Schnickschnack – zumindest nach dem Verständnis der „Schimäre“-Kämpfer. Eine Kette von vier Ju 88 jagt in Baumwipfelhöhe durch die Rauchschwaden über Jakovlevo. Die 8,8-cm-Flaks der Flakabteilung 1 sind mit der Bekämpfung der Panzer beschäftigt und so schicken die leichten Flaks ihre schnellen Schußfolgen nach oben, die in gut erkennbaren Leuchtspurgarben sich an die Flieger herantasten. Nur: Dieses Mal haben die Ju 88 es auf die leichten Flaks abgesehen. Dafür hat eine Messerschmitt-Eskorte die Maschinen extra durch den Abwehrschirm von Bohnsacks Jagdfliegern geschleust. Sie tauchen unter den FlakGeschossen weg, streifen schon die Baumwipfel und werfen dann dicht über den Flaks, deren Besatzungen nur noch rennen können, ihre Bombenlast ab. Eine Serie von Explosionen zertrümmert die Flaks und nebenbei noch eine ganze Häuserreihe. Zufällig in der Nähe befindliche Soldaten springen schnell in Deckung, um nicht von Splittern oder Trümmern getroffen zu werden. Nicht alle schaffen es und fallen mit einem Aufschrei inmitten der Qualmwolken in den Schlamm. „Sanitäter!“ Im Osten von Jakovlevo steigen mehrere kleinere Rauchschwaden auf: Es ist der Qualm von über 45 brennenden Panzerwracks, dort, wo Orths Panzerregiment sich durch den feindlichen Riegel nach Jakovlevo durchbeißt. 25 der Wracks sind „Schimäre“-Panzer, dazu kommen 27 weitere Panzer, die Orth schwer beschädigt zurückschicken mußte. Und noch immer tobt das Gefecht. Noch sind Orths Leute nicht ganz durch. So liegen allein vier abgeschossene „Schimäre“-Panzer am Fuße einer Bodenwelle, wo die Panzer über einen schlammigen Pfad ein Waldstück verlassen müssen und auf eine offene Wiese fahren. Einer will das Rätsel lösen, woher die Schüsse dort kommen: Unteroffizier Wehloneck. In den letzten anderthalb Stunden hat sich um seinen S2 eine Kampfgruppe von sieben weiteren S2 gesammelt. Mit laufendem Motor stehen sie noch im Wald auf dem Pfad, vorne Wehlonecks Panzer; trotz des Regens sitzt Wehloneck im offenen Turmluk. Auch die andern Panzerkommandanten machen es so – denn so haben sie einen besseren Überblick. Und sie müssen rauskriegen, wo die feindliche Kanone steckt. Wehloneck hebt den Arm und gibt mit einem Wink das Zeichen zum Aufbruch. Die Panzer setzen sich in Bewegung, Wehlonecks zuerst. Raus aufs Feld! Bei Wehloneck passiert nichts. Hektisch blickt er sich um, während die Ketten den durchnäßten Boden aufreißen. Aber dann, beim zweiten Panzer – da haut ein Geschoß voll in den Turm und zerfetzt den Kommandanten. Rauchend und qualmend bleibt der Panzer stehen. Schnell dreht sich Wehloneck um. Der Panzer wurde von hinten getroffen. „Wenden!“ Der Panzer vollzieht eine sanfte Kurve über die Wiese, ein weiterer Schuß schlägt dicht neben ihm ein, Wehloneck wischt sich Erdklumpen von der Uniform. Und dann sieht er ihn, den versteckten Schützen: Ein Panzer IV, der sich inmitten einer großen Hecke am Rande des Waldes so versteckt hat, daß man ihn viel zu spät sieht. Wieder feuert er und trifft einen der anderen „Schimäre“-Panzer, der nun mit einer kaputten Kette stehenbleiben muß. „Los, anvisieren!“ befiehlt Wehloneck. Schon dreht sich der Turm und dann gibt er den Feuerbefehl. Mit einem Knall peitscht das Geschoß gegen den Panzer IV, trifft aber wohl nicht ganz, jedenfalls zeigt sich der Kaiserliche noch nicht allzu sehr beeindruckt, sondern will wieder Wehloneck aufs Korn nehmen. Aber dessen Ladeschütze ist schneller. „Geladen und gesichert!“ „Feuer!“ Dieses Mal sitzt der Schuß, genau auf der Grenze Wanne/Turm. Letzterer liegt auf einmal schief auf der Wanne, aus einem Spalt quellen Flammen. Die seitlichen Luken fliegen auf und Männer mit rußgeschwärzten Gesichtern und geröteten Augen klettern aus dem Panzer IV, versuchen sich abzusetzen. Die „Schimäre“-Panzer nehmen sie jetzt unter konzentrisches Feuer, überall schießen die Einschlagsfontänen zwischen den Büschen hoch und wirbeln Äste und Zweige durch die Luft. Auch Orth selber führt unterdessen eine Kolonne aus 12 Panzern an – über die Hauptstraße. Plötzlich bricht ein Panzer IV aus dem Unterholz hervor und rammt Orths Panzer von der Seite, schiebt ihn quasi von der Straße. Allerdings verkeilen sich beide Panzer ineinander. Bei beiden fliegen die Turmdeckel auf. Orth duckt sich, als Schüsse peitschen und vom Luk abprallen. Mit der Pistole in der Hand taucht Orth wieder auf und feuert zurück. Sein Gegner ist nicht schnell genug, fällt getroffen zurück, wobei sich ein Schuß in die Luft löst. „Turm drehen! Feuer!“ brüllt Orth. Seine Panzerbesatzung hatte die selbe Idee. Aus nächster Nähe feuern sie auf den kaiserlichen Panzer, der mühsam versucht, sich loszureißen. Dessen Turm fliegt mit lautem Getöse meterweit weg. Aber auch Orths Panzer ist zu sehr beschädigt worden. „Raus hier!“ gibt er den Befehl, während hinter ihnen das Gefecht weitergeht: Ein Pulk aufgewerteter Panzer III hat die anderen „Schimäre“-Panzer ins Kreuzfeuer genommen und bereits 6 in Brand geschossen. Markus Orth flüchtet mit seiner Pistole hinter den nächsten Baum und sieht die Szene mit Entsetzen. Denn wenn die Kaiserlichen hier den Riegel wieder dichtmachen, dann sitzen sie alle in der Falle – auch das „Schimäre“-Panzerregiment. Und dann wäre alles aus. Als Karo und Conny durch Jakovlevo rennen, erkennen sie das ganze Ausmaß der katastrophalen Lage. Fast alle Häuser sind eingestürzt oder brennen. Zweimal kommen sie an zerschossenen Pak-Stellungen vorbei, um die Kanonen liegen angesengte Leichen. Davor Panzerwracks. Der dünne Dauerregen schafft es kaum, den Qualm aus der Luft zu waschen, es riecht nach Rauch und verbranntem Fleisch. Lkw-Wracks und sogar das Wrack einer Messerschmitt bieten auf der Hauptstraße Deckung. Kleine „Schimäre“-Trupps nutzen diese Deckungen, um eine Art Mindestwiderstand aufrechtzuerhalten. Immer wieder peitschen Schüsse von in Deckung stehenden Panzern, wenn Karo und Conny die Deckung verlassen, um weiterzukommen. Mit donnernden Explosionen krepieren die Geschosse, einmal schlägt ein Granatsplitter nur eine Handbreit neben Connys Gesicht in die Hauswand neben ihnen. Schließlich erreichen sie endlich die Straße vor dem Hauptquartier. Hinter einem Schutthaufen liegt Oberleutnant Pick, der Verbindungsoffizier der Exildeutschen Armee, zusammen mit vier „Schimäre“-Kämpfern in Deckung. Offenkundig hat er als einziger Offizier die Führung der Gruppe übernommen und darüberhinaus seinen Helm verloren; an seiner Schläfe rinnt Blut herunter. Conny und Karo werfen sich neben ihm in Deckung. „Oberleutnant, Bericht!“ „Im HQ ist wohl kaum noch einer! Die Besatzung hat einen letzten Gegenangriff mit Flammenwerfern unternommen, aber – naja, sehen Sie selbst, Frau General!“ Karo riskiert schnell einen Blick hinüber auf die Straße. Vor dem Gebäude, wo das Hauptquartier untergebracht war und dessen oberstes Stockwerk auch schon von einem Treffer eingefallen ist, liegen drei ausgebrannte Panzer – und etliche verbrannte Leichen, von denen zwei seltsame Metallbehälter am Rücken tragen. Darum herum ist alles von Flammen geschwärzt. Offenbar sind die Flammenwerfer im Gefecht von Kugeln getroffen explodiert. „Ich hol uns den dritten Flammenwerfer...“ beschließt Karo, lädt ein eben erst aufgegabeltes Magazin ins Sturmgewehr. „Ihr wartet hier.“ „Bist Du verrückt?“ faucht Conny sie an. Da muß man mindestens zu dritt rein!“ Karo schüttelt den Kopf. „Damit drei draufgehen, wenn der Flammenwerfer explodieren sollte?“ Sie rückt nochmal ihren Helm zurecht und dann nickt sie den anderen zu. „Gebt mir Feuerschutz. Pick, wo sind eventuelle Schützen?“ „Da drüben.“ Pick deutet auf ein Stück in die Straße geschlagenen Schützengrabens, das inzwischen von Kaiserlichen besetzt ist. „Die schießen hin und wieder hier rüber. Und irgendwo dahinten hinter der gegenüberliegenden Häuserreihe haben sich ein paar Panzer versammelt.“ „Ok, alles klar.“ Schon rennt Karo um den Schutthaufen herum und sprintet dann an den Panzerwracks vorbei rüber zum Gebäude. Kurz folgen ihr die aufspritzenden Fontänchen gegnerischer Gewehrkugeln, dann feuern Pick und die andern rüber zu den Kaiserlichen und liefern sich einen heftigen Schußwechsel. Karo wirft sich gegen die Eingangstür, die fliegt auf, sie springt rein und geht direkt hinter der Tür in Deckung. Ein zwei Kugeln schlagen vor der Rezeption auf den Boden. Das wars dann aber auch. Der Tisch, der hier stand, liegt zertrümmert in einer Ecke, die Theke der Rezeption ist zerlöchert. Und vor ihr liegen Tote mit Schußwunden und/oder Stichverletzungen, sowohl in der hellbraunen kaiserlichen wie in der dunkelgrünen „Schimäre“-Uniform. Erst entsichert Karo ihr Sturmgewehr, dann geht sie vorsichtig rüber zur Theke. Dahinter steht noch ein Flammenwerfer, wie sie erwartet hatte. Sie legt ihr Sturmgewehr auf die Theke und prüft den Zustand des Flammenwerfers. Plötzlich hört sie aus dem Speisesaal ein Geräusch. Sofort greift sie wieder ihr Sturmgewehr und pirscht sich an die Tür ran. Die wird aufgerissen und ein total überraschter Kaiserlicher steht vor ihr. Eher reflexartig feuert Karo eine Salve ab, mit mehreren roten Löchern in der Brust taumelt der Mann zurück und stürzt zusammen mit zwei mitgerissenen Stühlen zu Boden. „Hey, was war das?“ brüllt jemand von oben. Karo wirbelt herum und springt hinter der Theke in Deckung. Zwei Kaiserliche kommen die Treppe runter gepoltert. „Ich sags Dir, Fred, da war was.“ „Ach was, das waren unsere Männer draußen. Haben sicher wieder ein Widerstandsnest ausge-...“ Als er seinen erschossenen Kameraden sieht, bleibt ihm der Rest des Satzes im Halse stecken. „Hey, sucht ihr mich?“ Die beiden Kaiserlichen drehen sich um und sehen eine etwas verdreckte Frau in dunkelgrüner Uniform – und mit geschultertem Flammenwerfer, was dem Begriff ‚heiße Braut‘ eine ganz neue Bedeutung gibt... Draußen warten Conny, Pick und die andern immer noch. Und jetzt kommen auch noch zwei Panzer III die Straße raufgerasselt. „Verdammt, wo bleibt sie solang...“ knurrt Pick. Wenn die Panzer nämlich das Haus zusammenschießen sollten, stände es schlecht um Karo. Auf einmal schießen Flammen aus der Türöffnung und den Fenstern des HQ-Gebäudes. Zischend züngeln sie hervor und erlöschen dann nach wenigen Augenblicken. Dann torkelt ein brennender Mann schreiend aus dem Gebäude. Pick legt kurzerhand an und gibt einen gezielten Schuß auf 20 m Entfernung ab, der den Mann niederstreckt. Gnadenschuß auf Entfernung. „Verdammt, wo bleibt Karo...“ knurrt Conny. Aber da kommt Karo schon aus dem Haus gerannt – das Gesicht ein wenig rußgeschwärzt, aber ansonsten offenbar unverletzt. Da feuert einer der Panzer mit seiner Kanone. Der Schuß trifft nicht, wirbelt nur Trümmerbrocken und Schlamm auf, die Druckwelle läßt Karo straucheln. Sie rappelt sich wieder auf, rennt weiter, da hauen dicht neben ihr wieder MG-Kugeln in den Boden. Ein zweiter Schuß der Panzer jagt nur dicht über sie hinweg und schlägt auf dem Parkplatz neben dem Hauptquartier ein, wo ein umgekippter Laster in die Luft fliegt. Mit einem letzten Sprung schafft es Karo wieder hinter den Schutthaufen und damit in Deckung. „Und?“ „Habt ihr doch gesehen. Brauchte den Flammenwerfer selbst. Und jetzt weg hier. Ich muß Valkendorn finden...“ Valkendorn ist zusammen mit einer Gruppe der HQ-Kompanie zur kleinen Kirche des Ortes abgedrängt worden. Seine Männer haben mit den Kirchenbänken die Türen verbarrikadiert und einen Beobachtungsposten im Turm eingesetzt. Und Valkendorn hat sein Sturmgewehr auf dem Altar abgelegt und diskutiert mit dem russisch-orthodoxen Priester, der als einer der wenigen Zivilisten noch im Ort geblieben ist; schon vor einer Woche hatte sich der Priester darüber aufgeregt, daß man zur Sicherheit der Heiligen Bilder eben diese nach Safonovo abtransportiert hatte. Ein Litauer, der in der HQ-Kompanie dient und auch Russisch kann, übersetzt das Gespräch. „Sie können doch nicht einfach die Kirche besetzen! Das geht doch nicht!“ „Und ob ich das kann, ich muß sogar. Schließlich-...“ „Schließlich, General, ist die Kirche ein Hort des Friedens.“ „Erklären Sie das dennen da draußen!“ faucht Valkendorn, etwas heftiger als gedacht und mit der Hand zur Tür zeigend fügt er hinzu: „Wissen Sie, was die Kaiserlichen mit Priestern in Bosnien, Ungarn und Polen gemacht haben? Sie haben sie erschossen!“ Nun doch ein wenig kleinlauter erwidert der Priester: „Aber die Kirche! Sie können sie doch nicht entweihen!“ Noch bevor Valkendorn antworten kann, brüllt einer der Soldaten von einem der Fenster her: „General, der Panzer feuert!“ Schon schlägt das Geschoß ein – in den Turm! Mit Getöse donnert und poltert ein Trümmerhagel auf das Holzdach des Mittschiffs und schlägt teilweise durch. Balken, Steinbrocken und die schwere Glocken schlagen dort auf, wo sich sonst die Gemeinde versammelt, einige dort kampierende Soldaten springen schnell zur Seite. Valkendorn schubst den Priester hinter den Altar in Deckung und wirft sich schützend über den älteren Mann, während eine Staubwolke sie einhüllt. Sofort springt Valkendorn wieder auf und rennt an den Trümmern vorbei zum Hauptportal. „Lage!“ „Chef, der Panzer rührt sich nicht!“ „Muß er auch nicht!“ Ein weiteres Geschoß schlägt ein, dieses mal in der Frontwand des rechten Seitenschiffs, ein Mann wird durch die Luft geschleudert, Trümmer stürzen hernieder, bunte Glasscherben verteilen sich am Boden. „Kommt mit, den kaufen wir uns!“ brüllt Valkendorn und rennt rüber zu der Bresche in der Mauer. Der Panzer feuert nun mit seinem Maschinengewehr. Valkendorn und die Soldaten, die ihm folgen, ducken sich, weichen aus, feuern immer wieder kurze Schußfolgen mit den Sturmgewehren zurück – was freilich wenig nützt. Hinter einer Birke neben dem Kircheneingang und auf die Straße gefallenen Trümmern eines nahebeistehenden und brennenden Hauses gehen sie in Deckung und wollen sich an den Panzer heranpirschen. „Wieso rührt der sich nicht?“ wundern sich die „Schimäre“-Kämpfer. Sie wissen nicht, daß der Panzer keinen Sprit mehr hat. Die Kommandoaktionen gegen die kaiserliche Treibstoffversorgung zeigen jetzt Wirkung. Munition haben die Panzer allerdings noch. Valkendorn gibt gerade seinen Männern mit Handzeichen zu verstehen, sie sollen sich in zwei Gruppen aufteilen, um den Panzer in die Zange zu nehmen. Da richtet der Panzer seine Kanone auf einmal auf Valkendorn aus. Einer seiner Soldaten brüllt noch: „General, Vorsicht!“ Und Valkendorn springt auch noch aus seiner Deckung hinter einem Trümmerbrocken auf und rennt los. Da schlägt das Geschoß ein. In einer Dreckfontäne stürzt Valkendorn zu Boden, verliert seinen Helm, sein Sturmgewehr fliegt in den Schlamm. Seine Leute haben kaum Zeit, nach ihm zu sehen, denn da explodiert auf einmal der Panzer und die Trümmer seines Turms krachen neben der Kirche hernieder. „Wer war das?“ „Einer von uns?“ brüllen die Soldaten. „Nein!“ brüllt einer zurück. Und dann kommen aus einer Seitenstraße ein „Schimäre“-Panzer und ein unbekannter Panzer mit fremder Flagge gerollt... Als die Kämpfe näherrückten, haben Bekes Wachen sie in einen anderen Keller einige Häuser weiter geschafft. Dort hatten sie sie in einer leerstehenden Kammer eingeschlossen, die vielleicht zwei mal drei Meter groß, kalt und feucht ist. Zitternd vor Todesangst hat sie sich in eine Ecke gekauert, als die Gewehrschüsse und Explosionen wieder immer näher kamen. Jetzt ertönen Rufe und Schreie. Direkt in ihrer Nähe. Schüsse, lauter als sonst. Dann: Stille. Ein Kratzen und schließlich wird die Tür von zwei Männern mit Brecheisen aufgestemmt. Beke zuckt zusammen, als wieder Licht in die Kammer fällt – und sie die Uniformen erkennt. Es sind Kaiserliche. „Jam, jam, was haben wir denn da hübsches...“ meint der rechte grinsend. Und der linke fügt hinzu: „Ich hab hier keinen Soldaten mehr gesehen, ich glaub wir haben gewonnen.“ „Und Sieger sollten kriegen, was Siegern zusteht...“ ergänzt der andere mit einem komischen Flackern in den Augen. Langsam richtet sich Beke auf. „Hallo...“ meint sie leise und schluckt. „Oh, sie ist schüchtern!“ lacht der eine Soldat, ein kräftiger, hochgewachsener Bursche. Sein etwas schmalerer und auch schlechter rasierter Kollege, der aber einen Rang höher steht, sagt nun bestimmt: „Peter, geh nach oben und schieb Wache. Wenn ich fertig bin, darfst Du auch ran.“ „Is klar, Harry.“ Peter dreht sich um und verschwindet aus Bekes Blickfeld. „Was...was...was...“ Weiter kommt Beke nicht. Harry stürzt sich auf sie und drückt sie an die Wand. Sie schlägt auf seine Schultern und seinen Kopf ein, versucht ihn zu treten, kommt irgendwie frei, reißt sich los. Harrys Kollege Peter ist gerade wieder in der Diele des Erdgeschosses angekommen und beäugt sich die alte Kommode, die hier steht. Offenbar ein Einfamilienhäuschen, das von seinen Besitzern verlassen wurde, als die Front näherrückte. Jedenfalls findet er beim Durchsuchen der Schubladen nur Leere vor. Plötzlich hört er Stimmen. Er greift sich seinen Karabiner und pirscht bis zur nächsten Tür. Draußen hört er jemanden sagen: „Kommen Sie Ellermann, hier durch geht es schneller. Dann können Sie unserer unerwarteten Hil-...Scheiße!“ Wer immer es ist, dürfte jetzt die toten „Schimäre“-Kämpfer am Eingang entdeckt haben. Peter hört, wie Waffen entsichert werden. Leise schleicht er durch die Diele nach hinten, schiebt die Kommode quer in den Raum und duckt sich dahinter, legt mit dem Karabiner an. Von unten hört er einen Aufschrei. „Harry, beeil Dich beim Ficken! Wir kriegen Besuch!“ „Recht haste!“ sagt jemand hinter ihm. Total verblüfft dreht sich der Kaiserliche um – und kriegt die Faust von Markus Orth genau auf den Punkt. Mit verdrehten Augen sackt der Kaiserliche zur Seite. Von vorne kommt Sven Ellermann rein, das Sturmgewehr im Anschlag. „Alles in Ordnung, Ellermann. Der ist erstmal versorgt. Aber unten ist noch was los!“ Beke läuft durch den Kellergang. Eben erst hat sie Harry in die Hand gebissen, als er sie wieder festhalten wollte. Der Mann ist etwas unkoordiniert, jedenfalls hatte er schon versucht, sich mit einer Hand die Hose zu öffnen. Aber jetzt ist der Gang zu Ende. Kurzentschlossen greift Beke zwischen die Spinnweben in einer Ecke, wo sie eine Tonscherbe liegen sieht. Als sie sich umdreht, steht schon der lüsterne Kaiserliche vor ihr. „Liebchen, damit willst Du mir was tun?“ lacht er und schlägt ihr die Tonscherbe aus der Hand. Da brüllt jemand: „Hey, Flachwichser!“ Irritiert dreht sich der Kaiserliche um, was Beke nutzt, um ihn zur Seite zu stoßen und rüber zu Orth und Ellermann zu flüchten. Kaum ist sie aus der Schußbahn, feuern Orth und Ellermann auf den Kaiserlichen, der von den Salven aus nur wenigen Metern Entfernung an die Wand geschleudert wird. Das Blut spritzt die Wand voll, als die beiden „Schimäre“-Kämpfer ihre Magazine leerfeuern. Dann fällt der bereits tote Kaiserliche stocksteif wie ein Brett nach vorn auf den Boden. „Ich haße diese Schweine.“ stellt Orth fest und Ellermann fügt ein bestätigendes „Ja“ hinzu. Hinter ihnen hat sich Beke weinend in eine Ecke gekauert. „Ellermann, kümmern Sie sich um sie.“ Während Ellermann sich neben Beke hinkniet und beruhigend auf sie einredet, rennt Markus wieder nach oben. Als er aus dem Haus tritt, bleibt er stocksteif stehen. Ein Panzer III steht nur einige Meter vor ihm. Und dreht langsam den Turm. Gerade als Ellermann mit der Verräterin hinter Orth auftaucht, zeigt die Kanonenmündung genau auf sie. „Orth, haben Sie noch ein paar Panzer in der Hinterhand?“ flüstert ihm Ellermann von hinten ins Ohr. Aber Orth schüttelt den Kopf. „Hab ich doch erklärt. Der Widerstand war zu hart. Wir müssen auf unsere Freunde warten.“ „Welche Freunde?“ zischt Beke, noch immer etwas zittrig. „Die da.“ erwidert Orth grinsend und zündet sich eine Zigarette an, als ein etwas kleinerer grünlich-brauner Panzer neben dem Panzer III auftaucht und seine Kanone aus kürzester Entfernung auf die Naht zwischen Wanne und Turm des kaiserlichen Panzers richtet. Markus reicht sein Sturmgewehr an Ellermann weiter und geht langsam mit erhobenen Armen zu dem kaiserlichen Panzer rüber, während von der unbekannten Panzersorte ein zweiter auftaucht. Als Orth auf die Wanne des Kaiserlichen klettert, öffnet der Panzerkommandant das Turmluk. Und blickt sich um. Markus macht ihn höfflich auf die neuen Umstände aufmerksam und deutet auf einen der neuen Panzer: „Unsere Freunde hier haben zwar nur eine 45-mm-Kanone, aber ich versichere Ihnen, daß das ausreichen wird, diesen Panzer III aus der kurzen Entfernung in Stücke zu schießen. Wir würden es aber vorziehen, wenn Sie sich jetzt ergeben. Der kaiserliche Panzerkommandant nickt, holt langsam seine Pistole raus und legt sie in die ausgestreckte Hand Orths. „Ok, dann klettern Sie jetzt bitte mit Ihrer Besatzung langsam aus dem Panzer.“ Mit diesen Worten springt Markus Orth vom Panzer und geht wieder rüber zu Ellermann. Und Beke fragt: „Was sind das denn für Panzer?“ Ellermann grinst breit, denn erst vor ein paar Minuten hatte es Orth ihm kurz erklärt. „Es sind Türken.“ Ja, es sind in der Tat Türken – Einheiten des 9. türkischen Panzerregiments von Binbasi [entspricht unserem Major] Kücükyildiz, das von den Russen im Rahmen der anti-kaiserlichen Allianz mit neuen Panzern vom Typ T-70 ausgerüstet wurde und eigentlich nahe Moskau Manöverübungen abhalten sollte. Aus der Übung wurde nun blutiger Ernstfall, als plötzlich der türkische Außenminister Albay Demir und Yarbay Demirci vom Militärischen Geheimdienst des Osmanenreiches vor Kücükyildiz Hotel auftauchten. Der Befehl, der eigentlich nicht wirklich von Ankara (die Ersatzhauptstadt des Osmanenreiches seitdem Konstantinopel Ende September in Feindeshand fiel) gedeckt war: Kampfeinsatz bei Jakovlevo, um „Schimäre“ zu helfen. Diese überraschende Hilfestellung verschaffte Orths Panzern endgültig das nötige Übergewicht, um den Gegner von Osten und Südosten her zu packen und einzukreisen. Jetzt hat das Kesseltreiben begonnen. Nachdem der Sprit alle war, hat auch Hauptmann Steinberger seinen Führungspanzer aufgeben müssen – seine Mannschaft hat die Kiste gesprengt. Jetzt schlägt er sich zusammen mit drei anderen Panzerfahrern, notdürftig mit Pistolen und zwei Gewehren bewaffnet, durch den Südteil Jakovlevos, um einen Weg zurück zur eigenen HKL zu finden. Nachdem sie gerade über eine Mauer geklettert sind, schleichen sie über ein kleines, brachliegendes Blumenbett, rüber zu einem Schuppen. Per Handzeichen weist Steinberger zwei seiner Männer an, vorauszugehen. Vorsichtig schaut einer von ihnen um die Ecke. Gegenüber des Schuppens steht ein schäbiges kleines Bauernhaus, dazwischen liegen zwei Panzerwracks und verbrannte Leichen liegen in den Regenpfützen. Ein süßlicher Geruch vermischt sich mit dem Geruch des Regens und naher Brände. Vorsichtig laufen die Männer über den Platz, gehen neben einem der Wracks in Deckung. „Wo lang jetzt, Hauptmann?“ fragt ein Gefreiter. Steinberger sieht sich um. Auf der einen Seite geht es zu den Resten eines Holztores, das die Ausfahrt zur Straße markiert. Auf der anderen Seite ist eine Hecke zu sehen, die das Grundstück wohl vom Nachbargrundstück trennt. Wortlos deutet Steinberger auf diese Hecke. Nur Augenblicke später rennen sie rüber. Hinter ihnen brüllt eine Frau: „Halt, stehenbleiben!“ Dann feuert irgendjemand, einer von Steinbergers Leuten fällt mit einem Aufschrei zu Boden. Die drei andern Männer zwängen sich durch die Hecke, wollen weiter, rüber zu einem kleinen zerschossenen und rußgeschwärzten Haus. Da schlägt direkt vor ihnen ein Geschoß in den Acker, alle werfen sich in den Schlamm in Deckung. Drei T-70 und ein S2 stehen vor links und rechts von ihnen. Während Steinberger die Lage noch realisiert, zwängen sich hinter ihm vier weitere Personen durch die Hecke – zwei Frauen und zwei Männer, „Schimäre“-Kämpfer. Die vier umstellen die drei Kaiserlichen und richten die Sturmgewehre auf sie. Eine der beiden Frauen blickt rüber zu einem der T-70 und ruft: „Danke! Jetzt haben wir sie!“ Das Turmluk des Panzers geht auf und ein Mann mit einem ganz kurzen, milimetergenau rasierten Kinnbart schaut grinsend hervor. „Ich dachte mir, daß Du ein wenig Hilfe zu schätzen weist, Schoeps!“ ruft Guido Demirci geradezu fröhlich und fügt süffisant hinzu: „Auch wenn ich sicher bin, daß Du die Halunken auch so gekriegt hättest!“ „Ach, halt die Klappe!“ ruft Schoeps zurück und befiehlt dann ihren Leuten: „Bringt die Gefangenen weg. Ich seh derweil mal nach Kurier.“ Die Kaiserlichen hatten alles gewagt und gesetzt, was sie glaubten woanders entbehren zu können. Und nun haben sie die Schlacht verloren. Wieder ein Rückschlag, der dem Kaiser nicht gefallen wird. Und Schneider schon gar nicht. „Zuletzt ist man nur noch heilfroh, wenn die Schlacht geschlagen und alles Grauen vorbei ist.“ General Karolina Sus zu U.Reindl „Herein!“ ruft Orgeneral Eyüp Düzarduc, erst seit wenigen Wochen Großwesir des Osmanischen Reiches. Die Umstände, die seine bisherige Regierung begleitet haben, sind nicht eben das, was man sich dafür wünscht. Sein Vorhaben, die Regierung von den Spionen und Handlangern des Kaisers in Wien und seiner Verbündeten zu säubern und damit auch eine Demokratisierung des Osmanenreiches vorzubereiten, war erfolgreich, aber der Preis dafür ist hoch: Die Janitscharen, im Solde des Kaisers, haben geputscht und das Land zusammen mit einigen widerspenstigen Beys in Bosnien und Smyrna in einen Bürgerkrieg gestürzt, in den auch kaiserliche Truppen eingegriffen haben. Konstantinopel ist gefallen und jetzt ist Eyüps Büro in einer der alten Villen auf den Hängen rund um Ankara, dessen älterer Name Angora immer noch auf vielen Schildern steht. Eigentlich wollten einige der anderen Regierungsmitglieder noch weiter nach Osten fliehen, denn Ankara liegt noch im Einzugsbereich der feindlichen Flugzeuge; doch die Koalition hat an der Front entlang der kleinasiatischen Westküste zu wenige Flieger, die sie vor allem zur Unterstützung der Bodentruppen einsetzt – daher hat noch niemand versucht, Ankara zu bombardieren. Dennoch hat Eyüp immerhin den Sultan zusammen mit dessen Familie und etwas Dienstpersonal nach Sivas bringen lassen. Auf Eyüps „Herein!“ betritt Danko Popovic den Raum, ein kräftiger Mann, der gut und gerne seine 90 Kilo aufbringt. Zwar ist Popovic erst im September „Schimäre“ beigetreten, doch ist er der ranghöchste „Schimäre“-Offizier in der Region und damit ein häufiger Gast zu Besprechungen. „Danko!“ grüßt Eyüp den Mann; die beiden sprechen unter vier Augen stets in Deutsch, daß beide einigermaßen gut können. „Wie geht es Ihnen?“ Er schüttelt, nachdem er aufgestanden ist, Danko die Hand. „Danke, gut. Aber ich hab es etwas eilig.“ „Ok, um was geht es?“ Mit einer Handbewegung bedeutet Eyüp Danko sich ihm gegenüber zu setzen. Ein Blick aus dem Fenster gibt den Blick über die Vororte der Stadt frei, über denen die ersten Wolken der winterlichen Schlechtwetterfront hängen. „Orgeneral, wir haben kürzlich über die Behandlung internierter Reichsbürger gesprochen, die Kontakte zu ‚Schimäre‘ gehabt haben und für die sich ‚Schimäre‘ verbürgt hat.“ „Ja, ich erinnere mich. Einen Moment.“ Eyüp blättert kurz in einem Notizblock rum, dann nickt er. „In der Tat. Am 1. November werden diese Leute alle wieder auf freien Fuß gesetzt und dürfen sich frei bewegen.“ Er blättert weiter. „Eine Namensliste hab ich auch.“ „Suchen Sie mal nach einer Clarissa Junge.“ „Stimmt, steht drauf. Sie war mit Oberst Barnet Busch verlobt. Hat als Geographin in Ägypten gearbeitet, zusammen mit einem Ägyptologen-Team. Für die Leiterin des Teams, eine von zwei Ägyptologen im Lande, die Reichsbürger sind, hat sie sich ebenfalls verbürgt.“ „Brigitte Fehr.“ „Ja, genau. Aber in diesem speziellen Fall haben wir noch keine Entscheidung getroffen.“ „Äh...ja...es ist so...Brigitte Fehr hätten wir gerne.“ Stirnrunzelnd und etwas verwundert blickt Eyüp Danko an – und ein Schuß Mißtrauen ist auch in dem Blick. „Wieso das denn?“ „Wir brauchen sie um General Reiss zu befreien.“ Total verwundert blinzelt Eyüp Danko an und kratzt sich dabei am Hinterkopf. „Hä...ich meine: Was?“ „Schauen Sie nicht mich so an, Orgeneral. Ich hab mir das nicht ausgedacht. Aber unsere Agentenstation in der Schweiz hat eine allgemeine Fahndung nach einer Person ausgesetzt: Brigitte Fehr. Und als einziger Grund wurde angegeben, daß man sie für die Befreiungsaktion brauche.“ „Ihr Vögel habt schon seltsame Ideen, ihr seid...wie nennt man das noch gleich bei euch Europäern?“ „Komische Käuze...“ „Ja, genau!“ „Bitte Orgeneral, nicht diese Debatten! Ich weiß, das lieben Sie, aber wir haben nicht die Zeit! Also: In welchem Knast sitzt die Lady?“ „Also schön.“ lenkt Eyüp ein, denn er erkennt keinen Nachteil darin, wenn er die beiden Frauen „Schimäre“ überläßt. „Sie kriegen Brigitte Fehr und Clarissa Junge noch dazu. Aber Sie müssen die beiden selber in Kairo aus dem Gefängnis abholen.“ „Kein Problem.“ stimmt Danko freundlich lächelnd zu. „Schließlich muß ich die beiden eh noch irgendwie nach Bludenz bringen.“ „Wohin?“ Danko winkt ab. „Nicht drüber nachdenken, Orgeneral.“ Nach einem Blick auf die Uhr erhebt sich Danko. „Orgeneral, ich muß jetzt auch wieder gehen. Die Zeit drängt.“ Auch Eyüp erhebt sich, die beiden Männer salutieren. „General Popovic, ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich hoffe, Sie und die anderen ‚Schimäre‘-Kämpfer holen den General aus dem Schlamassel raus.“ „Danke, Orgeneral.“ Zügigen Schrittes verläßt Danko wieder den Raum. Als die Tür hinter ihm zufällt, atmet er tief durch. Er kommt sich jedes Mal vor, wie bei einem Verhör. Für ihn sind die Türken irgendwie immer noch „die Mullahs“, wirklich trauen tut er ihnen noch nicht, obschon er die Regeln der Höflichkeit unter Alliierten einhält. Dieses Mißtrauen, ja, vielleicht sogar ein wenig echte Ressentiments, ist allerdings nicht ganz grundlos, schließlich ist es noch nicht lange her, daß Danko gegen die Türken auf dem Balkan gekämpft hat – für die Unabhängigkeit der slawischen Völker auf dem Balkan. Der Zufall will es, daß in diesem Krieg die Kroaten, Montenegriner und Mazedonen bei den Alliierten Seite an Seite mit den Türken kämpfen – gegen die Kaiserlichen, an deren Seite die Serben und auch einige bulgarische Milizen kämpfen. Danko ist zwar eigentlich mehr Serbe als Kroate, aber den Streit zwischen beiden Völkern hat er nie begriffen. Umso trauriger stimmt es ihn, daß die Serben sich auf die Seite der Koalition geschlagen haben. Aber das ist eine Rechnung die vorerst, wo der Balkan seit nunmehr gut zwei Wochen praktisch vollständig von der Koalition besetzt ist, noch nicht beglichen werden kann. Aber Danko ist sich sicher: Der Tag der Abrechnung wird kommen... Niedrig donnert eine Focke Wulf 190 von Bohnsacks Geschwader über das verwüstete Jakovlevo hinweg. Der Himmel ist von tiefhängenden Wolken bedeckt, die ihren Inhalt wieder stärker über dem Lande ergießen. Immerhin hat das die meisten Brände gelöscht. Schoeps hat zusammen mit Marco Konrad Aufräumtrupps zusammengestellt, die erstmal die Hauptstraße wieder von Trümmern, Wracks und Leichen freiräumen. Die Nachschubverbindung zur Front muß endlich wieder stehen. In einem der wenigen Häuser, die nicht zu viel Schäden davongetragen haben – vor allem im Norden des Ortes - , hat Karo sich mit Markus Orth, Sahin Demir, Guido Demirci und Ibrahim Kücükyildiz getroffen, um die weiteren Maßnahmen zu besprechen; die Schlacht ist zwar gewonnen, aber noch nicht vorbei. Noch wird östlich von Spas-Lipki und westlich von Jarcevo gegen die Truppen von Brieskisch und Mudra gekämpft. Bei dem Haus handelt es sich um ein verlassenes, aus Holz aufgebautes Einfamilienhaus. Binbasi Ibrahim Kücükyildiz, ein freundlich lächelnder und immer gutmütig aufgelegter Mann, hat sich in der Küche niedergelassen, auf dem Küchentisch eine Karte ausgebreitet; es ist eine zerknitterte Karte, die ihm Markus Orth überlassen hat und auf eine sich immer wieder aufrollende Kartenecke hat Kücükyildiz seine Offiziersmütze gelegt. Mit einem roten Bundstift trägt er die derzeitigen Stellungen seiner Panzertruppen ein und die Ziele, die noch heute abend erreicht werden sollen sowie die Tagesziele für morgen. Orth kocht gerade etwas Wasser auf einem etwas veralteten Herd, um Kaffee zu machen; im Hauptraum des Hauses nebenan kümmert sich Guido derweil um das Feuer im Heizofen. Karo kommt von drüben rein. „Markus, was macht der Kaffee?“ „Ist in der Mache, Frau General.“ „Gut. Ich brauch jetzt dringend einen.“ Sie läßt sich gegenüber Kücükyildiz auf einen Stuhl fallen, legt ihren Helm ab und vergräbt ihr Gesicht in den Händen. Ein paar Tränen rinnen ihr herunter. Markus fällt das auf. „Was ist los, Frau General?“ Karo schluckt, nimmt sich ein Taschentuch, schnuft einmal kurz. „Ach nix. Nur....Valkendorn ist gefallen...“ „General Valkendorn?“ Entsetzt schaut Markus sie an. „Scheiße.“ „Genau.“ Karo nickt. „Genau. Scheiße.“ „Man hatte sich irgendwie an ihn gewöhnt...“ „Ja. Vor allem, wenn man täglich mit ihm zusammenarbeitete, wie ich...Verdammt Hauptmann, wir haben in letzter Zeit zu viele gute Freunde verloren.“ Als Guido in der Küchentür auftaucht, schaut sie auf. „Was gibt’s Guido?“ „Nicht viel. Demir ist auf dem Weg zu Schoeps und zwei Soldaten bringen gerade den gefangengenommenen feindlichen Kommandeur.“ „Ah, wunderbar. Ich verhöre ihn im Wohnzimmer kurz.“ „Ok.“ Sie gehen wieder zurück in das große Wohnzimmer, wo in einer Ecke der alte, verrußte Heizofen steht, in der Mitte ein niedriger, einfacher Holztisch und davor ein schmuddeliges altes Sofa. Irgendwie nicht dazupassend ist ein niedriger Holzstuhl. Auf dem Sofa sitzt ein hochgewachsener, schlanker Mann in der Uniform eines kaiserlichen Hauptmanns der Panzertruppe, dessen auffälligstes Merkmal sein eckiger, rötlicher Bart ist. Sein nur wenige Millimeter langes Haupthaar ist hingegen so dünn, daß es kaum auffällt. Hinter dem Sofa stehen seine beiden Bewacher, mit schußbereiten Pistolen. Karo zieht sich den Holzstuhl heran und setzt sich so auf ihn, daß sie die Arme über die Rückenlehne hängen lassen kann. Ein wenig feucht ist es hier drin doch, trotz des Ofens, denn die Fensterscheiben an der Hinterwand haben die Schlacht dann doch nicht überstanden. Sie zündet sich erstmal ganz langsam eine Zigarette an: Päckchen raus, Zigarette rausziehen, Päckchen wieder in die Brusttasche der Uniform, Feuerzeug rausholen, anzünden, Feuerzeug wieder in die Tasche und erstmal einen Zug nehmen. Dann fragt sie: „Name und Rang?“ „Hier ist sein Soldbuch.“ Einer der Soldaten hinter dem Sofa reicht ihr ein schmales Heft. Karo blättert es durch. „Also gut, Hauptmann Steinberger. Haben Sie uns was zu sagen?“ „Ja. Wenn Sie mich erschießen lassen wollen, dann bitte jetzt!“ Karo blickt Guido an und meint dann: „Wir erschießen keine Gefangenen. Im Gegensatz zu den Truppen des Kaisers. Aber lassen wir diese Grundsatzdiskussionen...Können Sie uns etwas über die weiteren Pläne der Kaiserlichen an der Ostfront verraten?“ „Nein, kann ich nicht. Und selbst wenn, würde ich es nicht. Sie werden es schon merken, wenn wir angreifen.“ „Da haben Sie recht. Und wie immer werden wir die Angriffe zurückschlagen.“ Karo steht auf, nimmt einen tiefen Zug der Zigarette und geht dann mit Guido zur Tür. „Was willst Du jetzt mit ihm machen?“ fragt Guido; das Problem ist nämlich, daß nicht ganz klar ist, ob Ingo Steinberger Gefangener von „Schimäre“ oder der Türken ist. „Ich bin sicher, Suworow würde sich freuen, wenn er den Mann in die Finger kriegen würde.“ „Stimmt.“ bestätigt Karo. „Suworow würde wahrscheinlich hoffen, er könnte mehr darüber erfahren, welche Kräfte die Kaiserlichen noch in Estland einsetzen wollen.“ Ein kurzes Zucken von Karos Mundwinkel deutet ein Lächeln an. „An was denkst Du?“ will Guido wissen. „An eine Quittung für Suworow.“ Karo geht zurück und baut sich vor Steinberger auf. „Hauptmann, wir werden Sie wieder laufen lassen!“ Alle Anwesenden schauen sich irritiert an, sagen aber nichts; Frau General Sus wird schon ihre Gründe haben. „Wenn Sie meinen...“ murmelt Ingo. Karo lächelt ihn kalt an. „Wissen Sie, Hauptmann, wie manche mich nennen?“ „Äh...wie?“ „Den Kampfnamen, den mir Russen und Polen gegeben haben....“ „Weiße Wölfin?“ „Hey, unser kaiserlicher Hauptmann hat ja doch Ahnung...Also, Steinberger, wir werden Sie zurückschicken. Und dann werden Sie dem Kaiser persönlich von mir ausrichten, daß wir eines Tages in Wien einmarschieren und ihm den Arsch versohlen werden. Ist das angekommen?“ „Ja.“ „Lauter!“ „Ja!“ „Schwören Sie, daß Sie die Nachricht überbringen! Bei Ihrer Offiziersehre, falls Sie sowas haben!“ „Ja, ich schwöre es!“ Mit einem Blick zu Steinbergers Bewachern befiehlt Karo: „Bringt ihn weg. Noch heute abend soll er zu seinen Leuten unbeschadet zurückkehren. Organisiert alles entsprechend.“ „Zu Befehl, Frau General!“ Die beiden Wachen salutiert, packen Steinberger an den Armen und zerren ihn hoch und schubsen ihn zur Tür. „Also, vorwärts!“ Als die Leute raus sind, lacht Guido laut los. „Was ist?“ „Karo, die Idee war echt gut! Wenn Suworow das hört, wird er sich furchtbar aufregen!“ „Ach was, ich hab nicht vor, es ihm so direkt auf die Nase zu binden. Aber ich werd die Tage auf jeden Fall noch nach Moskau fahren. Aber vorher werde ich mal all die kleinen Schrammen und Kratzer verarzten lassen...“ Sahin Demir, Albay [Oberst] und Außenminister des Osmanischen Reiches, hat sich durch halb Jakovlevo gefragt. Jetzt hat er endlich das Gehöft nördlich des Ortes gefunden, wo einige der Pferde des „Schimäre“-Kavallerieregiments untergebracht worden sind – und wo auch auf einem kleinen Stück geweihter Erde gerade ein Soldatenfriedhof angelegt wird. Ein Begräbnistrupp gräbt in der vom Dauerregen durchnäßten Erde, selbst von Regen und Schlamm durchnäßt, eine Grube nach der anderen, vier sind schon fertig, etwa zwei Dutzend Ausbeulungen unter einer Plane neben dem Mini-Friedhof sind zu erkennen. Und an einer Regentonne neben dem Geräteschuppen findet Sahin dann eine „Schimäre“Kämpferin vor, die ihr Sturmgewehr zur Seite gelegt hat, um besser in besagte Tonne kotzen zu können. Schweratmend richtet sich die Frau auf und wischt sich mit einem verdrecksten Handtuch den Mund ab. „Hi Schoeps.“ begrüßt Sahin sie. „Geht’s wieder?“ Überrascht dreht sich Schoeps um. „Sahin, Du auch hier?“ Er grinst amüsiert und nickt. „Ich dachte ich schaue mal vorbei.“ „Achso. Schön.“ „Passiert Dir das öfter?“ fragt Sahin und deutet auf die Tonne. Schoeps folgt seinem Blick. „Nein.“ antwortet sie. „Nur, wenn ich zu viele Tote gesehen hab.“ Jetzt stellt sich eine peinliche Pause ein; die beiden haben schließlich vor einem Monat, bevor Sahin osmanischer Außenminister wurde, miteinander geschlafen. Aber letztendlich hatten sie nicht geklärt, wie es nun mit ihnen weitergehen soll. „Weißt Du, Schoeps, ich hab viel nachgedacht seit der Nacht.“ „Ach, tatsächlich? Ich auch...“ „Hatte ich erwähnt, daß ich verheiratet bin?“ Gerade kramt Schoeps noch in ihrer fast leeren Gaulloises-Schachtel, jetzt blickt sie ihn scharf an. „Bitte?“ „Ja, ich weiß, ich hätte es sagen sollen...aber...“ „Jetzt komm mir nicht damit, daß es der Islam erlauben würde oder irgendsoeinen Bockmist!“ schnauzt Schoeps ihn an. Beschwichtigend hebt er die Hände. „Nein...nein...ich wollte sagen, äh...das die Ehe eh nur noch auf dem Papier-...“ Sie schneidet ihm das Wort ab: „Ach, halt doch die Klappe! Ich will eh nichts mehr von Dir! Wie sollte das denn gehen, über die paar Tausend Kilometer zwischen hier und der Türkei!“ „Ich könnte mich versetz-...“ „Ich sagte, halt die Klappe!“ Wütend setzt sie sich wieder ihren Helm auf und schultert ihr Sturmgewehr. „Schoepsi-....“ „Für Dich Frau Generalmajor Schoeps und jetzt hau ab! Ich hab zu tun...“ Sie zündet sich ihre Zigarette an und stapft davon zu der Weide, wo jetzt vier Pferde endlich etwas Auslauf kriegen, ohne direkt beschossen zu werden. Etwas verdattert schaut ihr Sahin nach. Immer diese Weiber! denkt er sich. Niemals hätte er mit dieser Frau in die Kiste steigen sollen! ‚Hab ich Dir gleich gesagt!‘ meldet sich im Hinterkopf seine innere Stimme. Sauer tritt er einen Stein zur Seite und geht dann wieder zurück. Schließlich hat auch er noch zu tun. Spätestens übermorgen muß er wieder in der Türkei sein. Iven und Tripp brettern mit einem der wenigen Laster, die bei Jakovlevo nicht zerschossen wurden, über die schlammige Piste nach Safonovo. Die Scheibenwischen kommen gegen die Dauerregen kaum an. Aber die beiden haben es eilig. Hinten auf der überdachten Ladefläche liegen vier Schwerverwundete, die möglichst schnell nach Safonovo und dann ins Lazarett müssen. Außerdem sollen Iven und Tripp in Safonovo dabei helfen, das durch den Eilverlegung in der Nacht außer Gefecht gesetzte Funknetz von „Schimäre“ wieder auf Touren zu bringen. Funksprüche zwischen den kämpfenden Verbänden waren zwar möglich, aber nicht Funksprüche mit den Agenten im Reich oder im Mittelmeerraum. Es ist jetzt fast 16 Uhr 30 und nach dem Ausnahmezustand des bisherigen Tages soll, so hat General Karolina Sus befohlen, nunmehr wieder in den Normalgang geschaltet werden. „Ich weiß schon, warum ich nur bei der Funkabteilung arbeiten will...“ knurrt Tripp zum wiederholte Male an diesem Tag. „Ja, hast schon recht...Aber jetzt können wir uns doch wenigstens bei den Ladys mit unseren heutigen Heldentaten brüsten.“ erwidert Iven breit grinsend. „Sehr lustig, Heinz. Deine Zeit ist doch eigentlich vorbei. Denk lieber an Deine Familie.“ „Tu ich andauernd. Kann ja nix dafür, daß sie noch im Reich festhängt.“ „Vielleicht solltest Du die Chefin fragen, ob man Deine Familie nicht per Kommandoraid rausholen könnte...“ „Klar doch. Sonst noch intelligente Ideen?“ knurrt Iven ungehalten. Auf einmal tritt er scharf aufs Gas, Tripp muß sich festhalten, um nicht nach vorn geworfen zu werden. „Was ist denn?“ „Na sieh doch!“ Vor ihnen steht ein Mann mitten auf der Straße, total durchnäßt, die Haare kleben ihm auf der Stirn. Und in der Hand hält der Mann eine Pistole. Tripp erkennt die Uniform – eine kaiserliche Luftwaffenuniform. Wahrscheinlich ein abgeschossener Pilot. „Au Scheiße.“ flüstert Tripp. Der Kaiserliche kommt direkt auf sie zu. Erst ist nur noch wenige Schritte vom Laster entfernt, als plötzlich zwei Schüsse peitschen und der Kaiserlichen zusammenzuckt, zurückstolpert und dann rücklings zusammenbricht. Dabei löst sich aus seiner Waffe ein Schuß in die Luft, bevor er sie fallen läßt. Iven und Tripp schauen dem nur total überrascht zu. Was zum Teufel...? Zur linken rutscht eine Gestalt die schlammige Böschung herunter, wo sie sich zwischen einigen Bäumen versteckt hatte und rennt auf der Straße zu dem Kaiserlichen rüber und hält dabei ein Sturmgewehr auf ihn gerichtet. Iven schnappt sich seine eigene Pistole und springt aus dem Führerhaus, die Knarre im Anschlag. „Werr sind Sie?“ brüllt er. Jetzt erst erkennt er die Uniform des zweiten Mannes – ein „Schimäre“-Kämpfer. „Der Typ ist tot. Ab ihn genau in die Brust getroffen.“ antwortet dieser und dreht sich um. Und Iven läßt die Waffe sinken. „Oberleutnant Flatten. Schön Sie zu sehen.“ „Ja, geht mir ähnlich.“ Total durchnäßt steht Flatten da und winkt nun zu den Bäumen rüber. Eine ebenfalls total durchnäßte Frau klettert etwas umständlich die Böschung herab – es ist die Journalistin Frau Reindl. „Wären Sie vielleicht so freundlich, uns mitzunehmen, Leutnant?“ fragt Flatten. Lachend steckt Iven die Pistole ins Holster und meint: „Aber sicher! Klettern Sie auf die Ladefläche, aber Sie und Ihre Begleitung werden sich diese mit ein paar Verletzten teilen müssen.“ „Das ist nicht schlimm.“ knurrt Frau Reindl etwas zittrig. „Hauptsache es gibt ein trockenes Fleckchen!“ „Bestimmt!“ meint Iven lächelnd und setzt sich hinter das Steuer, während Flatten und Reindl hinten auf die Ladefläche klettern. „Na los, ich will weg hier...“ murmelt Tripp. „Schon gut.“ entgegnet Iven, legt den Gang ein und gibt Gas. „Verzweifelte Situationen erfordern verzweifelte Taten.“ Kalenderspruch Ein kurzes, leises Zischen ist zu hören, als die Zigarette die Haut berührt. Ganz langsam drückt der Gepo die Kippe auf dem Arm des bewußtlosen Patienten aus. Plötzlich legt sich ein eiserner Griff um seinen Hals. „Wenn Sie noch lange leben wollen, Sturmmann, dann lassen Sie das.“ faucht ihm Petra Müller in einem unmißverständlichen Ton. Der Gepo läßt die Kippe fallen, schluckt und krächzt dann: „Habe verstanden.“ Als Petra die Hand von seiner Kehle nimmt, macht er schnell ein paar Schritte zurück. Dr. Tschirner hat dies von der anderen Seite des Bettes aus beobachtet, während er wieder den Blutdruck von Reiss mißt. Jeden Kommentars enthält er sich, denn diese Frau ist ihm unheimlich – so attraktiv und sexy sie auch sein mag. Instinktiv spürt Tschirner auch die Gefahr, die sie darstellen kann. Und irgendwas sagt ihm, daß diese Gefahr jener ähnelt, die von Reiss ausging, bis er ins Koma fiel. Aber das komische Gefühl ist zu unbestimmt, als daß er es Standartenführer Oschmann gesagt hätte. „In welchem Zustand ist er, Doktor?“ fragt Petra, nun wieder ganz freundlich. Tschirner sieht auf. „Naja, abgesehen von ein paar Blessuren durch unsere Folter...“ Sein Blick streift über die Spuren der Stromschläge und der Prügel, über die Brandwunden, wo die Wache ihre Zigaretten ausgedrückt hat. Nach kurzem Zögern fährt er fort: „Er hat natürlich mehrere Narben...einige sind schon sehr alt, wie seine Blinddarmnarbe, andere sind sogar sehr frisch.“ Er nimmt Reiss‘ rechte Hand und hält sie hoch. Man sieht frisch vernarbtes Gewebe. „Schnittwunden, erst kürzlich verheilt. Am Kopf hat er schon mehrere Platzwunden gehabt, eine auch erst in den letzten drei Monaten. Aber die ist bereits verheilt. Insgesamt muß ich sagen, daß sein Körper sehr widerstandsfähig ist.“ „Was meinen Sie damit?“ „Wir wissen durch Untersuchungen aus dem Siebenjährigen Krieg, daß Menschen, die lange Zeit unter extremen Umständen wie sie ein Krieg herbeiführt und bei denen sie häufiger als normal verletzt werden oder mit Krankheiten in Kontakt kommen, daß solche Menschen ein besser trainiertes Immunsystem entwickeln können. Ihr Körper ist dann in der Lage, minder gefährliche Krankheiten und auch Verletzungen besser zu bekämpfen und schneller zu heilen.“ „Irre. Das wußte ich gar nicht.“ „Ja, die wenigsten tun das. Ähnliches habe ich übrigens auch schon in mehreren Straflagern beobachtet, wo ein Teil meiner Versuchspersonen-...“ „Doktor, halten Sie den Mund!“ brüllt auf einmal Gephardt von der Eingangstür der Praxis her. „Fräulein Müller ist nicht berechtigt, darüber Informationen zu erhalten.“ Gephardt kommt zu ihnen herüber und Petra, der die kleine Nuance im Tonfall vor allem beim Wörtchen ‚Fräulein‘ aufgefallen ist, die auf Feindseligkeit hindeutet, bedenkt Gephardt mit einem eisigen Blick. Etwas kleinlaut entschuldigt sich Tschirner: „Tut mir leid, Standartenführer. Ich hab mich hinreißen lassen. Passiert mir manchmal, wenn jemand bei meinen Fachausführungen nicht sofort laufen geht.“ „Schon gut...“ Und an Petra gewandt meint Gephardt: „Frau Müller, wir haben die letzten von Reiss Sachen in ihr Quartier bringen lassen.“ „Danke Standartenführer. Und auch besten Dank an Sie, Doktor, für Ihre Auskunft.“ Petra nickt Tschirner zu, dreht sich um und verläßt dann die Arzträume. „Gephardt, Sie sollten besser auf die Dame aufpassen.“ Irritiert schaut Gephardt den Doktor an. „Wieso, Doktor?“ „Ich weiß nicht...irgendwie ist sie komisch...Ich hatte das Gefühl, daß sie sich Sorgen um unseren Gefangenen macht.“ Da bleibt Gephardt nur ein Schulterzucken. „Mir ist die Frau auch nicht geheuer, Doktor. Aber Oschmann hat mir befohlen, sie als Gast zu behandeln, bis er neue Informationen bzw. Instruktionen bezüglich dieser Frau aus Wien hat.“ „Hoffentlich ist es dann nicht schon zu spät.“ nuschelt Tschirner und trägt die Blutdruckwerte ins Krankenblatt ein. Die Wachen an dem Kontrollpunkt am Fuße des Berges staunen nicht schlecht, als ein gut und gerne über 1 Meter 90 großer Mann auf einem niegelnagelneuen schwarzen schweren Motorrad angerauscht kommt, gekleidet in schwarze Lederhosen, schwarze Stiefel mit Stahlkappen, schwarzes Hemd, einen langen schwarzen Mantel, Nieten an den Armen und sogar am Hals, Nietengürtel und Ketten um die Hüfte, an einer Seite ein Schwert, ein Pentagramm um den Hals, schwarze Haare. Die Brille mit dem dünnen Gestell übersieht man da schon fast. Als er angehalten hat, zieht der Mann wortlos einen Passierschein aus der Innentasche seines Mantels. Der befehlshabende Rottenführer ruft trotz des Passierscheins lieber mal oben in Schattenlagant an – bei Oschmann persönlich. Zunächst hat er natürlich die Sekretärin Frau Wüstefeld am Draht. „Anika Wüstefeld.“ „Ja, hier Rottenführer Detmar. Geben Sie mir bitte sofort Standartenführer Oschmann.“ Nur Augenblicke später nimmt Oschmann ab und Detmar schildert ihm den Sachverhalt. „Rottenführer, wir haben den Herr schon erwartet. Lassen Sie ihn durch.“ „Mit seinen Waffen?“ „Mit seinen Waffen. So wie er da steht.“ „Zu Befehl, Standartenführer.“ Als Detmar dem Herrn in Schwarz seine Papiere zurückgebt, winkt er ihn nur wortlos durch. Einer von Detmars Männern fragt hinter ihm leise: „Was war das denn?“ „Eine Entscheidung von oben Leute. Und jetzt Ruhe, wir haben immerhin noch eine Stunde Schicht und bald wird es ganz dunkel!“ Ein Säbel mit fein verziertem, teilweise mit Blattgold überzogenen Griff, der in einer mit einem Gurt ausgestatteten Scheide aus schwarzem Leder steckt. Ein schwarzer Ledermantel. Ein Nietenarmband. Eine dunkelgrüne Uniform. Ein dunkler Ledergürtel mit silberner Schnalle, auf der „Pour la Liberté“ eingraviert ist. Ein feststellbares Klappmesser mit gut und gerne 10 cm Klinge. Zwei Tokarew-Pistolen. Ein schwarzes Notizbuch. Schwarz? Hatte Stefan früher nichtmal ein blaues gehabt? Aber wahrscheinlich ist das hier neu, denkt sich Petra. Aber immerhin hat sich sein Stil nicht geändert. Sie läßt die beiden Metallketten, die Stefan immer am Gürtel befestigt hat, damals schon, durch die Finger gleiten. Schließlich nimmt sie das Notizbuch und setzt sich damit auf das Feldbett. Auf der ersten Seite prangt das Wappen von „Schimäre“ – der Rabe in einem Dreieck. Sie blättert weiter. Fast nur leere Seiten. Das Buch ist tatsächlich neu. Kurz zögert Petra nochmal beim Weiterblättern. Sowas tut man eigentlich nicht. Sie wiegt das Buch in der Hand. Eine Seite hebt sich leicht vom Luftzug der Bewegung an. Da steht etwas. Unwillkürlich liest Petra es: „Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, mit Christiane glücklich zu sein, ich würde sie nutzen.“ Eine kurze Notiz nur. Erschrocken klappt Petra das Buch zu. Sie hatte ja keine Ahnung, wie zerrissen dieser Mann innerlich offenbar war. „Scheiße, wir haben ein Problem!“ dämmert es ihr. Ein Klopfen an die Tür reißt sie aus ihren Gedanken. „Wer ist da?“ „Ich bins! Ben!“ Petra wirft das Notizbuch zu den anderen Sachen, die sie am Fußende des Feldbettes ausgebreitet hatte, und geht zur Tür, um sie zu öffnen. Als Ben reinkommt, wirft er einen kurzen Blick auf Reiss Sachen, während Petra die Tür hinter ihm schließt. Zur Begrüßung umarmen sich die beiden. Dann fragt Ben: „Geht’s Dir gut?“ Sie zuckt die Schultern. „Abgesehen davon, daß man hier scharf aufpassen muß, beim Spionieren nicht erwischt zu werden, schon.“ Ben tritt an das Feldbett und beäugt die Klamotten von Reiss. „Sind das...?“ „Ja, das sind die persönlichen Sachen von Reiss, die sie mir überlassen haben.“ „Hmmm...der Typ wird mir allmählich sympathisch...“ bemerkt Ben mit einem Blick auf den Säbel. Mit einem aber immer noch skeptischen Blick dreht er sich zu Petra um. „Aber ist dieser Mann wirklich das Risiko wert?“ Bei dieser Frage muß Petra schlucken. „Vertrau mir Ben. Er würde dasselbe tun – für jeden seiner Freunde.“ „Und? Zählst Du Dich zu seinen Freunden?“ Auf die Art und Weise lächelnd, wie sie es immer tut, wenn Petra einer direkten Antwort ausweichen will, fragt sie zurück: „Hast Du seinen besten Freund getroffen?“ „Du meinst diesen Philipp Kipshoven, der in der Szene als ‚Ratte‘ bekannt ist?“ „Ja, genau den...Du hast ihn also getroffen. Sehr gut.“ „Sie wissen jetzt, wo Schattenlagant ist.“ „Wunderbar, Ben. Dann wird es Schattenlagant nicht mehr lange geben. Und allein das ist mir das Risiko wert....Komm jetzt. Du hast eine lange Reise hinter Dir. Laß uns in der Kantine was essen gehen.“ Mit einer einladenden Geste öffnet sie die Tür. Noch ist Ben etwas skeptisch, aber dann meint er: „Hmmm...ja...ok.“ Der Mann im Nadelstreifenanzug sitzt bequem am Kamin und genießt die Wärme der Flammen. Draußen ist es regnerisch, kalt und ungemütlich. Beschissenes europäisches Wetter. Die idiotischen Regierungen Europas kann man wenigstens unter gewissen Umständen teilweise steuern und gegeneinander ausspielen, ja, ganze Völker lassen sich gegeneinander aufhetzen und wieder ruhigstellen. Quasi immer passendes Polit-Wetter. Und auf diesem Sektor ist das Wetter momentan sogar gut. Die Koalition hat die Hegemonie auf dem Kontinent praktisch schon errungen! Wenn der Krieg noch ein Jahr so weiter läuft, Sieg an Sieg, dann hat man ihn gewonnen! Das Telephon auf dem Tisch neben dem Sessel klingelt. Der Mann geht ran und meint mit müder Stimme: „Ja?“ Nach kurzer Pause ist er etwas lebhafter. „Ah, Schneider...Was gibt’s?... Schlacht bei Jarcevo verloren. Aha. Wieso das denn?...Können diese Idioten wenigstens die Ausgangslinie halten?...Na gut. Wenigstens die Ausgangslinie sollte man von den Siegern des Polenfeldzuges erwarten können. Ich nehme an, Sie erbitten neue Instruktionen?...Ok, hören Sie zu Schneider. Vielleicht wird es jetzt Zeit für etwas radikalere Maßnahmen bezüglich dieser Problematik. Leiten Sie das nötige in die Wege. Alles klar?...Ok. Schönen Abend noch.“ Der Mann legt wieder auf und schenkt sich noch etwas Cognac ein. Dann erhebt er das Glas und prostet dem großen Bild über dem Kamin zu: „Sieg Heil, ihr alten Ahnen!“ Samstag, der 18. Oktober „...gegenwärtig treiben unsere Einheiten zusammen mit dem türkischen 9. Panzerregiment und polnischen Truppen den Gegner auf seine Ausgangsstellungen zurück. In der Nacht wurde eine letzte feindliche Panzerkompanie aufgerieben. Es wurden insgesamt 2300 Gefangene gemacht. (...) Nach der Zerschlagung der feindlichen Angriffsspitzen erwarten wir keine größeren kaiserlichen Gegenaktionen mehr. Außerdem hat sich bestätigt, daß der Feind Artillerie und Flugzeuge an die nördlichen Abschnitte der Ostfront abzieht, um von Estland aus weiter nach Osten vorzustoßen. (...) Unsere Verluste seit Dienstag belaufen sich nach vorläufigen Erkenntnissen auf 6890 Gefallene, 200 Vermißte und 9000 Verletzte. Unter den Toten befindet sich auch General Valkendorn. (…)“ Als sie den vorläufigen Bericht von Connys C-Abteilung über die zu Ende gehende Schlacht von Jarcevo und Jakovlevo überflogen hat, wirft Karo die Aktenmappe auf den Tisch. Die Nacht ist stressig gewesen, da das Hauptquartier endgültig in das Hauptgebäude der Kaserne von Safonovo verlegt worden ist. Dort hat Karo ein kleines Büro gekriegt, wo sie sich erstmal ein Feldbett aufgestellt und drei Stunden geschlafen hat. Dann hat schon wieder Arbeit angestanden. Jetzt ist es 8 Uhr morgens und die Sonne geht gerade auf. Conny hat sich für den Bericht die Nacht um die Ohren geschlagen. Jetzt steht Conny in neuer, sauberer Uniform vor Karos Schreibtisch. „Sonst noch was, Frau General?“ fragt Conny etwas förmlich. „Ja.“ Karo blickt sie aus müden Augen an. „Können wir die Verluste bereits ausgleichen?“ „5000 Rekruten aus Polen und Litauen könnten unter Umständen bereits nächste Woche über die Frontverbände verteilt werden, um die ärgsten Lücken zu stopfen.“ „Gut, das machen wir so. Ich werde einen entsprechenden Befehl liegen lassen.“ „Liegen lassen?“ „Ja. Ich werde heute noch wieder nach Moskau reisen. Der Landgraf soll mich hier solange vertreten.“ Conny nickt; nach Valkendorns Tod gehört der Landgraf von Hessen-Darmstadt, vom Range her Generalleutnant, zu den fähigsten und höchstrangigen Offizieren. Aber eins ist Conny nicht klar: „Was willst Du in Moskau?“ Karo schnippt etwas eingetrockneten Schlamm von ihrer dreckigen Uniform und antwortet: „Ich will Suworow etwas auf den Zahn fühlen.“ „Sei bloß vorsichtig. Ich traue es dem Kerl zu, daß er Dich über den Haufen schießen läßt.“ Karo schürzt die Lippen. „Vorsichtig werd‘ ich sein, Conny. Versprochen...OK, das war’s. Ich möchte jetzt alleine sein.“ „Is gut.“ Conny verläßt das kleine Büro. Als sie auf dem Gang steht, murmelt sie mehr zu sich selbst: „Und Suworow täte gut daran, Dir kein Haar zu krümmen, Karo...“ Kairo ist eine pulsierende Stadt, die auf dem besten Wege ist, eine der großen Städte des Orients zu werden.Die ersten wilden Vorortsiedlungen sind schon am Nil angekommen, Bulak ist fast schon fester Bestandteil der Stadt. Im Zentrum der Stadt erheben sich die Paläste des Gouverneurssitzes der osmanischen Regierung; außerhalb der Stadt liegen inmitten von Palmhainen die Villen der höheren Beamten. In den Vierteln des gewöhnlichen Volkes gibt es pulsierende Basare und dunkle Kneipen, in denen man sich nicht zwangsläufig an die Gebote des Islam hält. Von den Minaretten der Moscheen aus lassen die Muezzin ihren Ruf erschallen: „Allah hu akbar!!“ Kairo, eine Stadt mit allen Versuchungen und allen Schrecknissen orientalischer Metropolen, wo Mittags die Hitze in den Straßen steht und die sich ständig vermehrenden Autos allmählich die Kamele und andere Lasttiere von den Hauptstraßen verdrängen. Und seid das Osmanische Reich im Krieg ist, ist die Stadt zu einem wichtigen Militärstützpunkt geworden. Im September hat es Razzien gegen mutmaßliche Sympathisanten der Janitscharen gegeben, besonders nachdem diese endgültig den Weg des Bürgerkriegs wählten und sich auf die Seite der Koalition schlugen. Und natürlich wurden auch alle Staatsbürger der zur Koalition gehörenden Mächte verhaftet. Und spätestens seit Kreta von kaiserlichen und Janitscharen-Truppen erobert wurde und der Kampf um Sizilien tobt, befürchtet das osmanische Oberkommando einen Angriff auf Ägypten selber (was seit dem Beitritt Maltas zur Koalition nichtmal unmöglich ist). Daher wurde die Garnison Kairos verstärkt; außerdem ist es eine zentralen Drehscheiben für Truppentransporte nach Libyen und Tunesien und eine wichtige Nachschubbasis. Entsprechend unwillig reagiert der Militärkommandeur der Stadt, Tümgeneral Yildiram. Es ist 11 Uhr, die Mittagshitze baut sich allmählich auf und Danko Popovic sitzt zusammen mit Mirovic in einem kleinen klapprigen Geländewagen, der auf einer staubigen Piste raus aus Kairo Richtung Westen brettert. Sie kommen direkt von Yildiram. Zwei Stunden und vier Telephonate mit Ankara hat es gebraucht, damit Yildiram die Zustimmung zur Freilassung der beiden Frauen Junge und Fehr gegeben hat. Unter einer Bedingung: Popovic und Mirovic müssen die beiden selber abholen. „Erinnern Sie mich daran, Mirovic, daß nächste Mal eine geladene Knarre mit zu Yildiram zu nehmen.“ Mirovic lacht. „General, ich glaube nicht, daß wir den so schnell wiedersehen! Wir holen die beiden Frauen aus dem Knast und hauen dann wieder ab.“ „Wäre gut. Haben Sie daran gedacht, einen Flieger zum Feldflugplatz Misr-al-Jadida zu beordern?“ „Ja. Die venezianische Exilregierung hat uns einen gestellt.“ „Na wunderbar.“ Von vorne meldet sich ihr ägyptischer Fahrer: „Wir sind in ein paar Augenblicken da.“ Glücklicherweise hat Danko einen Fahrer auftreiben können, der Englisch kann. Die staubige Piste endet vor zwei Flachdachbauten am Ufer des Nils; ein kleiner Pier ragt in den Fluß. Auf der anderen Seite des Flußarmes liegt die Insel Bulak, auf der ein großes Gefängnis errichtet wurde, in dem politische Gefangene und Kriegsgefangene festgehalten werden. Ein schon etwas rostiger Flußdampfer hat gerade erst am Pier angelegt. Zwei etwas verdreckte Frauen mit schulterlangen, leicht verfilzten Haaren und in fleckige Leinenklamotten gekleidet werden von einem Trupp türkischer Soldaten auf den Pier und dann zum Ufer geführt. Dort sind Danko und Mirovic inzwischen aus dem Geländewagen ausgestiegen. „Mirovic, jetzt Deutsch oder Englisch sprechen. Damit die beiden Frauen uns auch verstehen.“ „Wollen Sie deren Vertrauen erwecken?“ „Könnte nicht schaden. Immerhin muß uns die eine helfen, Reiss zu befreien.“ Die Soldaten und die beiden Gefangenen bleiben kurz vor den Danko stehen und der Truppführer tritt vor. „General Popovic, ‚Schimäre‘?“ „Ja, der bin ich.“ „Unterschreibe hier...“ Der Mann hält Danko eine Klade unter die Nase und einen Stift. Danko unterschreibt schnell. „Wir haben Wagen bereit.“ Der Soldat deutet auf einen kleinen Laster, neben dem bereits ein Fahrer wartet: Ein hochgewachsener, schlanker Mann in der Uniform der kroatischen Armee von Dubrovnik. Danko dreht sich zu Mirovic um. „Mirovic, Sie fahren zurück nach Kairo. Und ich kümmere mich um den Rest.“ „Sicher?“ „Sicher. Sie werden mich außerdem in Ankara vertreten müssen. Eine Überführung von zwei Frauen werd‘ ich schon allein schaffen.“ „Wie Sie meinen.“ Während Mirovic wieder zum Wagen zurückkehrt, wendet sich Danko wieder den türkischen Soldaten zu. „Ok, Sie alle können wegtreten. Ich übernehme ab hier.“ Zwar wirft der Mann direkt vor ihm einen skeptischen Blick auf die beiden Frauen, zuckt dann aber die Achseln und nickt. Auf einen Wink von ihm folgen ihm die anderen Soldaten zurück zum Dampfer. Etwas unsicher und zögerlich mustern die beiden Frauen den stämmigen Mann in der dunkelgrünen, wenngleich etwas verstaubten Uniform. „Folgen Sie mir bitte, meine Damen.“ bittet Danko und geht dann rüber zum Laster mit der offenen Ladefläche. Der Mann dort grüßt ihn bereits freundlich. „General Huljev, was machen Sie denn hier?“ grüßt Danko ebenso freundlich seinen alten Vorgesetzten, der zugleich der Präsident von Dubrovnik war und nun die kroatische Exilregierung leitet. Maro Huljev lächelt verlegen und erwidert dann: „Helfen. Kairo ist ein Hornissennest von Agenten.“ Für wie wichtig Maro dieses Gespräch hält, signalisiert er, indem er Kroatisch spricht, damit niemand anders mithören kann. „Was meinen Sie?“ fragt Danko, nun auch auf Serbokroatisch. „In der Gegend sind neulich ein paar Janitscharen-und Malteser Agenten untergetaucht. Sie könnten ja Ärger machen. Deshalb habe ich mir erlaubt, einen erstklassigen Schutz für Sie abzustellen.“ Jemand kurbelt das Fahrerfenster runter und steckt seinen Kopf heraus. Dunkles Haar über einem frechen Grinsen. Brigadier Davor Suker. Grinsen nickt Danko. „Danke, Maro, danke Ihnen.“ „Nichts für ungut, Danko. Sie haben immer gute Arbeit geliefert, auch wenn Sie manchmal faul waren...Und wie ist es bei den neuen Arbeitgebern?“ Schulterzuckend erwidert Danko: „Eigentlich ganz gut, aber die neue hübsche Chefin hab‘ ich immer noch nicht gesehen.“ Maro lacht auf. Das ist Danko wie er leibt und lebt. „OK, ich muß jetzt wieder zurück nach Kairo.“ stellt Maro fest. „Danko, ich wünsche Ihnen viel Glück...Suker, passen Sie gut auf die drei auf.“ „Zu Befehl, General.“ Noch einmal salutieren Maro und Danko voreinander, dann geht ersterer an Danko und den beiden Frauen vorbei und zu einem etwas verstaubten Ford neben einem der Flachdachgebäude herüber. Wenige Augenblicke später sieht man nur noch die von ihm aufgewirbelte Staubwolke auf der Piste nach Kairo. „Dürfte ich die Damen bitten?“ Mit einer Kopfbewegung deutet Danko auf die Ladefläche. Die beiden Frauen schauen sich an, sind ganz offenbar noch total verunsichert. Aber eine der beiden mustert Dankos Uniform und nuschelt dann zu der anderen rüber: „Die sind in Ordnung.“ Die beiden Frauen klettern auf die Ladefläche und Danko geht um den Laster rum, um an der Beifahrerseite einzusteigen. „Nicht weglaufen!“ ruft er nach oben und schlägt dann die Beifahrertür zu. „Suker, auf nach Misr-al-Jadida.“ „Feldflugplatz?“ „Genau.“ „Da müssen wir aber um die ganze Stadt rum.“ „Na, dann geben Sie Gas! Bevor uns die beiden Passagiere abhanden kommen!“ „Wer sind die beiden eigentlich?“ „Eine Geographin und eine Archäologin oder sowas in der Art. Die eine war mit einem verstorbenen ‚Schimäre‘-Offizier verlobt und die andere – nun ja, die andere brauchen wir.“ „Wie, ist der Druck bei ‚Schimäre‘ so groß?“ Danko rammt Suker den Ellbogen in die Seite und dann lachen beide. „Suker, Sie hatten schon immer einen dreckigen Humor!“ Fast eine Stunde später erreichen sie den Feldflugplatz Misr-al-Jadida: Der Ort selber ist eine kleine Hüttenansammlung um einen Palmenhain, unweit eines Nilarmes, doch der Flugplatz besitzt eine große Piste, drei Hangars, zwei kleinere Lagerhallen, drei lange Flachdachbaracken als Unterkünfte für die Piloten und das Bodenpersonal, eine Baracken mit sanitären Anlagen, eine Baracke als Kantine und ein kleines zweigeschossiges Gebäude mit der Kommandantur und der Flugkontrolle. Auf dem Dach dieses Gebäudes wurde vor zwei Wochen erst sogar eine kleine Radaranlage von britischen Ingenieuren errichtet; britische und dänische Offiziere schulen nun die türkischen Verbündeten am Umgang mit den neuen Geräten. Bewacht wird der Flugplatz von einer Infanteriekompanie, die zwei MG-Posten hinter Sandsäcken eingerichtet hat, das einzige Tor im Zaun bewacht und dauernd in der weiteren Umgebung patrouilliert. Nach kurzer Kontrolle der Papiere lassen die Wachen den Laster durch. Suker hält vor einem Hangar, aus dem gerade eine Pipistrello gerollt wird – eine in Italien gebaute Passagier-und Frachtmaschine, deren Baupläne die Junkers Ju52 zum Vorbild hatten. Suker stellt den Motor aus und Danko steigt aus. Überrascht, aber auch erfreut stellt er fest, daß die beiden Passagiere noch da sind. Seelenruhig stellt er sich ans Heck des Lasters und zündet sich eine Zigarette an. „Meine Damen, bevor wir unsere Reise antreten, möchte ich Sie beide bitten, dort rüber zu der Baracke zu gehen, um eine Dusche zu nehmen. Brigadier Suker wird sich um frische Kleidung kümmern.“ „Genau.“ bestätigt Suker in einem wesentlich schlechteren Deutsch als Dankos. „Folgen Sie ihm bitte.“ fordert Danko die beiden Frauen auf. Während Suker die beiden Frauen zu den Duschen begleitet, geht Danko in den Hangar, um mit dem Piloten zu sprechen. Als er den Mann mit dem dunklen Haar und dem Dreitagebart erblickt, ist Danko überrascht: Er kennt ihn! Es ist Sergente Sandro Di Vito, Pilot bei der venezianischen 8. Squadriglia. Danko hat in Ende September bei der Evakuierung Kretas kennengelernt: Damals führte das aus Kroaten bestehende Spezialbataillon 6 Luftlandeeinsätze durch, um die Evakuierungen per Schiff und über eine Luftbrücke zu sichern. Sandro setzte allein dreimal einen Trupp ab und er flog tagelang ohne Pause im Rahmen der Luftbrücke Verwundete und Flüchtlinge von Kreta nach Anatolien. Dafür kassierte er direkt drei Orden – von der venezianischen Exilregierung, von der osmanischen Regierung und der griechischen Provisorischen Regierung. „Sandro!“ ruft Danko. Erst jetzt sieht Sandro von dem Papierkram auf, der mit jedem Flug verbunden ist. „Ach, der Popovic!“ ruft Sandro zurück und fügt dann auf Deutsch hinzu: „Ich hab schon gesehen, daß ich Dich und zwei Ladys fliege. Nach Palermo.“ „Ja, ein wichtiger Auftrag.“ „Wirklich? Hat mich um mein gemütliches Wochenende mit einer hübschen Spanierin gebracht, die ich gestern abend kennengelernt habe.“ „Och ja...ja...entschuldige. Konnte ich nicht ahnen. Aber unsere Passagiere sind glaub ich auch ganz nett.“ „Du glaubst?“ „Naja, ich hab die noch nie ungeduscht gesehen. Kommen frisch aus dem Mullah-Knast.“ Sandro lacht auf. „Aus dem Mullah-Knast? Muß ja schlimm sein.“ „Ja, eben.“ „Und wieso machst Du das persönlich, Danko? Eine Überführung ist doch sonst was für Stuffze...“ „Äääug...ja...ähm...weiß ich, aber ich mußte mal aus Ankara raus.“ „Welche Botschaftertochter haste dieses Mal genagelt?“ „Was denn...wie kommt ihr nur immer alle auf sowas...“ „Naja...ich kenn Dich noch nicht gut, aber ich hab genug gehört...“ „Scheiße man...“ knurrt Danko und wundert sich darüber, wie schnell sich manche Sachen rumsprechen. Sandro reicht ihm die Flugunterlagen, die auch Danko noch unterzeichnen muß. Mit einer schnellen Handbewegung schmiert Danko seine Arztunterschrift drauf – liegt in der Familie, schließlich war sein Vater Arzt. „Kaffee?“ fragt Sandro. „Ja, gern. Danke.“ „Also, was sind das für Passagiere?“ fragt Sandro. „Zwei Ladys.“ „Jam, jam, lecker...“ „Sandro, das sind intellektuelle Frauen, die eine Geographin, die andere Ägyptologin. Wohl kaum was für Dich.“ „Toll, wieviel Niveau Du mir zutraust, Du Halunke.“ Danko lacht laut auf. Eine halbe Stunde später – und nachdem sich Danko und Sandro die wildesten Frauengeschichten aus ihrer beider Leben erzählt haben – werden die beiden plötzlich durch ein Räuspern unterbrochen. Danko dreht sich zum Hangartor um. Dort steht eine schlanke Frau, ein wenig zierlich wirkend, mit langen dunkelbraunen Haaren, die noch feucht von der Dusche sind, und einem ziemlich skeptischen Blick, gekleidet in eine Jeans und ein graues Tshirt, dazu ein Paar Soldatenstiefel. Suker hat ganz offensichtlich etwas wahllos die Klamotten aus dem Flugplatzdepot zusammengeworfen. Immerhin: Nachdem nun der Gefängnisdreck runter ist, sieht die Frau ziemlich hübsch aus – und irgendwie hat sie was süßes an sich. „Sie sind...?“ fragt Danko vorsichtig. „Brigitte Fehr.“ „Ach ja, die diplomierte Ägyptologin.“ „Äh ja...genau. Und wer sind Sie?“ Offenbar wundert es die Frau in keinster Weise, daß Danko jetzt Deutsch spricht. Dieser stellt sich nochmal vor: „General Danko Popovic von ‚Schimäre‘. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen Frau Fehr. Es ist mein Auftrag, Sie sicher nach Bludenz zu bringen.“ Da hat er wenig geflunkert, denn einen ausdrücklichen Befehl hat er dazu nicht. Aber auch keinen Befehl, dies nicht zu tun. Mal was anderes, als in Ankara rumzuhocken. Tatsache ist: Die Frau soll nach Bludenz gebracht werden. „Wohin?“ fragt Brigitte total überrascht und vollkommen irritiert. „Bludenz. Das ist in Tirol.“ „Was soll ich denn da? Ich bin ja heilfroh, nicht im Reich leben zu müssen...obwohl...“ Sie reibt sich ihre von Fesseln wunden Handgelenke. „...obwohl die türkischen Internierungsgefängnisse noch beschissener sind als das Regime im Reich. Aber was soll ich da?“ „Das erfahren Sie noch früh genug, Frau Fehr.“ versetzt Danko. „Ich führe nur Befehle aus.“ „Brigitte, Sie glauben doch nicht, ‚Schimäre‘ macht sich aus Jux und Dollerei eine solche Mühe, wenn wir eh in zwei Wochen freigekommen wären?“ meldet sich eine weibliche Stimme vom Hangartor her. Es ist Clarissa Junge, eine ebenfalls recht attraktive dunkelhaarige Frau, die gerade ihr Uniformhemd zuknöpft. Uniform? Brigitte ist zuerst wieder mal überrascht, als sie die Geographin in der „Schimäre“-Uniform erblickt. Verlegen lächelt Clarissa. „Nicht wundern, Brigitte. Ich bin Agentin von ‚Schimäre‘ und, wenn ich Uniform trage, vom Range her Stabsunteroffizier.“ „Hat ‚Schimäre’ eigentlich überall die Finger drin?“ fragt Brigitte, als sie sich mit forschem Blick wieder Danko zuwendet. Der schüttelt den Kopf. „Nicht überall. Drogen-und Frauenhandel haben wir noch ausgelassen.“ witzelt er und Sandro lacht hinter ihm laut auf. Dann allerdings räuspert sich der Pilot: „Ich will ja nicht nörgeln, aber da die Frauen jetzt reisebereit sind, sollten wir losfliegen.“ „Stimmt.“ stimmt Danko zu und fragt dann noch: „Hat der Kurier meinen Rucksack vorbeigebracht?“ „Ja, ist bereits in der Maschine.“ „Ok, dann sollten wir gehen.“ Als die vier den Hangar verlassen, um zu der wartenden Pipistrello rüberzugehen, wartet Suker bereits am Tor. „Euch vieren viel Glück. Ach – und General Popovic?“ „Ja?“ „Würden Sie General Reiss von mir grüßen und Kapitän Kipshoven?“ „Sicher, mach ich!“ „Ok, danke!“ Als die beiden Frauen ein paar Minuten später es sich auf zweien der Sitze im Passagierraum der Pipistrello bequem gemacht haben, zieht Danko die Seitentür der Maschine zu; Sandro hat derweil die drei Motoren des Flugzeugs angeworfen. Freundlich lächelnd meint Danko zu den beiden Frauen: „Genießen Sie nun den Flug mit ‚Sandro & Danko Airlines‘. Bitte bringen Sie die Sitze in eine aufrechte Position und stellen Sie das Rauchen ein. Bei Schießereien nehmen Sie den Kopf bitte runter. Ansonsten wünschen wir Ihnen einen angenehmen Flug.“ Clarissa und Brigitte sind ein dankbares Publikum und lachen. Grinsend geht Danko nach vorn ins Cockpit und setzt sich auf den Co-Piloten-Sitz. „Können wir?“ fragt Sandro. „Wir können.“ bestätigt Danko. „Gut, wir haben auch Starterlaubnis.“ Sandro läßt die Maschine auf die Startbahn rollen und gibt dann Gas. Nur Augenblicke später hebt das Flugzeug nach ein paar Hopsern ab und Sandro geht in eine sanfte Kurve, wobei er die Maschine weiter hochzieht. Innerhalb weniger Minuten sind sie auf 4000 m gestiegen und Sandro geht auf Westkurs. Danko dreht sich in Ruhe eine Zigarette, als er auf einmal Bewegungen neben ihrer Maschine bemerkt. Ein Blick durch das Fenster verrät ihm, daß es sich um Jagdflieger handelt. Allerdings kennt er sich bezüglich Flugzeugtypen nicht so gut aus und daher fragt er: „Sandro, was sind das für Maschinen?“ „Oh, das ist unsere Eskorte. Die 133. Fighter-Squadron der RAF, seit zwei Wochen in Alexandria stationiert. Hurricane-Maschinen leider nur; die britische Regierung hält momentan alle Spitfires für die Luftkämpfe über Großbritannien selbst zurück.“ „Du verfolgst das wohl sehr genau...“ „Ja, als Pilot ist man daran natürlich interessiert. Zumal jedes französische und kaiserliche Flugzeug, das über Großbritannien gebunden ist, eine Entlastung für uns hier darstellt...Warte mal, ich muß unsere Eskorte begrüßen.“ Sandro geht auf die entsprechende Funkfrequenz und schickt seine Grüße auf Englisch durch: „Hier Sonderflug Ramses-34, 133er, ich grüße euch.“ „Hier Squadronleader 133er. Wir werden für einen ruhigen Ritt für euch sorgen. Bei Treffpunkt Troia werden wir an die 24er übergeben.“ „Alles klar. Dank euch.“ Sandro schaltet wieder nur auf Empfang und meint dann zu Danko: „Geht schon alles klar. Sie eskortieren uns bis zur Syrte, dann werden wir von der 24. neapolitanischen Squadriglia weiter eskortiert. Offenbar hat sich rumgesprochen, daß jetzt mal ‚Schimäre‘ Hilfe braucht.“ Skeptisch läßt Danko seinen Blick über das Meer zu seiner rechten schweifen. Wieso hat er nur das Gefühl, sich auf einem Himmelfahrtskommando zu befinden? Zwei schwarzuniformierte Männer zerren eine junge Frau aus dem Mietshaus im Norden von Florenz. Sie versucht sich loszureißen, schreit laut um Hilfe. Aber alle anderen Bewohner des Viertels haben die Vorhänge zugezogen. Sie sehen nicht gern offen zu, wenn die Inquisition wieder ein Viertel nach feindlichen Agenten, Hexen und Ungläubigen durchsucht. Die Männer schlagen auf die Frau ein, rammen ihr die Knie in den Leib. Einer zieht eine Geißel hervor und zieht damit mehrfach über den Rücken der Frau. Ihre Kleider reißen auf, Blut spritzt auf. Ein zweiter fesselt nun mit einem Lederriemen die Hände der Frau, die immer noch wie am Spieß schreit, bis ein dritter Inquisitor ihr einen Lederriemen durch den Mund zieht und diesen am Hinterkopf zusammengurtet. „Abführen!“ Ein zweiter Inquisitionstrupp marschiert gerade ins nächste Haus. An jede Tür wird geklopft. Und der Truppführer hat natürlich auch eine Liste mit anonymen Verdächtigungen, die mißgünstige Nachbarn, paranoide Spinner und andere bei den Inquisitionsdienststellen in ganz Italien einreichen. Seitdem die Koalition im September die gesamte Halbinsel unter ihre Kontrolle gebracht hat, hat sich der Inquisitionsbetrieb wieder über ganz Italien ausgebreitet und hier quasi das Gegenstück zur Kaiserlichen Geheimpolizei gebildet. Im zweiten Stock steht der Trupp dann vor einer besonders verdächtigen Tür: Hier gab es einen anonymen Tipp, die Bewohnerin würde mit ausländischen Agenten in Kontakt stehen, Sex haben, obwohl sie nicht verheiratet ist (seit dem Sieg der Koalition in Italien ein Verbrechen), mit Haschisch handeln bzw. mit Dealern verkehren; dazu stehen einige weniger eindeutige Punkte auf der Liste. Alles in allem genug, um in diesen Tagen auf den Scheiterhaufen zu kommen. Besonders dann der letzte Punkt auf der Verdachtsliste: Mutmaßliche Hexe. Als die Inquisitoren an der fraglichen Tür klopfen, macht die Frau nicht auf. „Sind wir auch richtig?“ fragt der Truppführer. Einer seiner Männer kontrolliert das Türschild. „Cassim, Chef. Wir sind richtig.“ „Ok, rein!“ Die vier Inquisitoren ziehen ihre Pistolen und dann treten sie die Tür ein, die splitternd auffliegt. Alle stürmen in die Wohnung, innerhalb weniger Augenblicke wird jeder Raum geprüft. Die Balkontür im Wohnzimmer steht offen, im leichten Luftzug weht der Vorhang. Sofort eilt einer der Inquisitoren herüber und auf den Balkon. Nichts. Quietschende Reifen lassen ihn aufschrecken. Er sieht nur noch einen roten Kleinwagen davon-und um die nächste Ecke jagen. Am Steuer kann der Mann gerade noch eine Frau mit langen, leicht lockigem Haar erkennen. „Leute!“ brüllt er nach drinnen. „Sie ist abgehauen! Gebt ne Fahndung raus!“ Petra sitzt auf dem Feldbett in ihrem Quartier und betrachtet den Rabenschädelring, den Ben ihr eben gebracht hat. Nadja hat wieder feinste Arbeit geleistet. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. An der Tür steht Ben noch und lädt gerade seine Luger mit Schalldämpfer. „Wo willst Du hin, Ben?“ „Tja...ich will mich noch was umsehen. Wo warst Du noch nicht?“ „In den drei untersten Etagen. Die sind absolut tabu. Kein Nicht-Gepo kommt da runter.“ „Hmmm...Wo ist die Wäschekammer?“ „Die Klamottenausgabe?“ „Genau die.“ „Irgendwo im ersten oder zweiten Stock.“ „Alles klar. Bis später.“ Ben verläßt den Raum. Eine Weile noch starrt Petra den Ring an. Dann dämmert ihr was. „Wäschekammer? Der wird doch wohl nicht..?“ Doch, Ben hat genau das vor! Die ‚Wäschekammer‘ ist schnell gefunden. Und nichtmal eine stationäre Wache davor. Ben kramt aus der Innentasche seines schwarzen Mantels einen Dietrich-Schlüssel hervor. Ein wenig widerspenstig ist das Schloß dann doch. Von irgendwoher nähert sich eine Patrouille, Ben hört die beiden Männer mit einander reden. „Scheiße!“ knurrt er leise und dann macht es im Schloß schließlich doch ‚Klick‘. Schnell rein in den Raum und dann die Tür leise geschlossen. Mit angehaltenem Atem bleibt Ben stehen, hört, wie die Stimmen lauter werden und dann wieder leiser. Offenbar sind die Männer direkt an seiner Position vorbeigegangen. Glück gehabt! Mit einer Hand sucht er den Lichtschalter. Nach ein paar Momenten findet er ihn. Nur wenige Glühbirnen erleuchten den muffigen, in den Fels geschlagenen Raum, der bestimmt 10 m lang ist und in dem lange Regale mit lauter schwarzen Uniformen stehen. Schnell geht Ben durch. Also die Farbe gefällt ihm schonmal. Jetzt muß er nur noch seine Größe finden... Tatsächlich – in einem der hintersten Schränke liegt eine passende Uniform. Glücklicherweise liegt am Boden ein etwas verstaubter Rucksack, da kann Ben seine normalen Klamotten unterbringen. Nur ein paar Minuten später glättet er die Falten aus der Uniform. Sitzt wie angegossen. Das Ding hat sogar die Rangabzeichen eines Untersturmführers. Ben schnappt sich den Rucksack, macht das Licht aus. Vorsichtig öffnet er die Tür einen Spalt breit. Die Luft scheint rein zu sein. Also raus auf den Flur. Gerade so schnell, daß es nicht zu sehr auffällt, geht er Richtung Aufzug. Zum Glück muß er nicht allzu lange warten – es kommt direkt einer. Als die Türen aufgehen, steht schon ein Rottenführer drin. „Mahlzeit, Rottenführer!“ grüßt Ben, als er den Aufzug betritt. „Mahlzeit, Untersturmführer.“ „Wo wollen Sie hin, Rottenführer?“ „Ganz nach unten.“ „Ah, ich auch, sehr gut.“ Die Türen schließen sich wieder. „Untersturmführer, könnte ich Sie was vertrauliches fragen?“ „Sicher.“ Ben fühlt sich doch ein wenig unwohl – wieso muß ihm auch direkt einer dieser Knilche begegnen? Er besieht sich sein Gegenüber. Ein fast schon schmächtiger blonder Junge, höchstens 21. „Untersturmführer, Sie kennen ja sicherlich die strengen Vorschriften, welche Frauen uns erlaubt sind...“ Ben hebt eine Augenbraue. Wie, Gepos dürfen sich nicht jede x-beliebige Frau nehmen? Seit wann das denn? Aber er unterdrückt die Fragen. „Äh...ja...sicher.“ antwortet er. „Gibt’s da etwa ein Problem?“ „Äh, ja, vielleicht...Untersturmführer, ich hab mich in eine junge Dame verliebt, fürchte ich...eine Polin, die seit einem Monat in Bludenz in einem Gasthof arbeitet.“ „Als Zwangsarbeiterin, wie?“ „Ja...äh...genau. Aber ich kann mich der Gefühle so schlecht erwehren. Ich hab’s schon mit zusätzlichen Konzentrationsübungen versucht, wie es mir Standartenführer Oschmann geraten hat...“ „Ach, Blödsinn. Hören Sie, Rottenführer, nehmen Sie die Vorschriften nicht immer allzu wörtlich! Meine Güte, Polinnen sind ja manchmal recht hübsch.“ „Wie meinen?“ „Mensch, Rottenführer, wenn es Ihre Gefühle besänftigt: Mal kurz anficken ist ja in Ordnung...aber keine Beziehung! Klar?“ Hektisch nickt der junge Rottenführer mit dem Kopf. „Klar...Ja, alles klar... Danke Untersturmführer.“ „Nichts für ungut, Rottenführer.“ Als sich die Fahrstuhltüren öffnen, läßt Ben den Rottenführer vorgehen. So passiert er unbeschadet zwei Wachen, die hier direkt am Fahrstuhl stehen. Seltsam, denkt er sich: Ein Gepo mit Beziehungsproblemen und zwei Wachen vor dem Fahrstuhl, der sonst kaum bewacht wird. Wie im falschen Film! In einigem Abstand zu dem Rottenführer geht er den langen, düsteren Gang entlang, der zunächst keine Abzweigungen in irgendeiner Form hat. Aber Ben bemerkt, daß der Gang leicht geneigt nach unten führt. Was soll das Ganze hier? Plötzlich eine T-Kreuzung. Vorsichtig blickt Ben nach rechts. Etwa 10 m entfernt sieht er den Rottenführer von eben mit zwei Wachen vor einer schweren Metalltür reden. Er hört nur ein paar Gesprächsfetzen: „...soll ich die zwei Gefangenen für heute...wir brauchen sie in zehn Minuten...“ Als die beiden Wachen die Tür öffnen, geht Ben seelenruhig an der Abzweigung vorbei und weiter geradeaus. Gut, wieder hat keiner Verdacht geschöpft! Wieder eine lange Strecke ohne Abzweigung. Von irgendwoher hört Ben ein seltsames Geräusch, wie ein Dauerbrummen – oder ein fernes Murmeln. Jetzt kommt er an eine weitere Abzweigung, die aber nur nach links geht. Keine Wachen. Also biegt er hier ab. Wieder nur ein langer Gang, mit leichter Schrägneigung zur rechten Wand hin, was Ben etwas irritiert. Und vor allem ist dieser Gang noch weniger beleuchtet – nur ganz weit vorne sieht Ben so etwas wie Licht. Diffus, gelblich, flackernd. Als er dieser leichten Biegung näher kommt, bleibt er auf einmal stehen. Das Geräusch ist jetzt ganz laut. Und das komische Licht fällt durch irgendeine Öffnung ein! Was haben diese Irren nur in diesen Berg hineingetrieben? Vorsichtig geht er weiter, bis er einen Korridor erblickt, der an einer Seite bestimmt ein Dutzend dieser Fenster hat, die etwa in anderthalb Meter Höhe die Felswand durchbrechen. Vorsichtig duckt er sich und späht über den Felssims. Ein riesiges Gewölbe haben die Gepos hier geschaffen, bestimmt seine 50 m hoch, 30 m breit und 60 m lang. An den Wänden des Gewölbes hängen in drei Reihen große Fackeln. Darüber eine umlaufende Fenstergalerie – in der sich eben Ben jetzt befindet. Unten am Boden läuft ein weiterer Galeriegang um den Hauptplatz herum, Säulen in Abständen von drei Metern teilen die Durchgänge ab. Auf dem Hauptplatz, dessen Steinboden spiegelglatt poliert wurde – Ben fragt sich, wie die das bei dem harten Gestein hier unten geschafft haben... – haben sich bestimmt fast 300 Menschen versammelt, alles Kaiserliche Geheimpolizisten in ihren schwarzen Uniformen. Alle von der Spezialeinheit, die auch mit Schwertern oder Säbeln ausgestattet ist, denn sie haben sich verbeugt, mit gezogener Klinge, die Hände auf den Griff gelegt, den Blick auf die vor ihren Gesichtern im Feuerschein schimmernde Waffe gerichtet. Das glatte Metall blitzt stellenweise so stark auf, daß es selbst Ben noch sieht. Und jetzt erkennt er auch, was dieses Geräusch ist: Das Gemurmel aus gut und gerne 300 Kehlen, immer wieder die selben Worte, zigfach verstärkt durch die Gewölbestruktur des Raumes. Bens Blick schweift weiter. Am Kopf des Raumes ist ein erhöhtes Felsplateau, auf das eine kurze Treppe führt und das durch fünf lodernde Feuer am Rande erhellt wird. Fünf lodernde Feuer – ein Pentagramm? Und in die Felswand darüber ist ein Symbol eingemeißelt, riesengroß, vielleicht 20 oder 30 m: ein V in einem auf der Ecke liegenden Quadrat. Ben muß schlucken – ihm ist immerhin bekannt, daß dieses Symbol eines der dämonischsten in gewissen Kreisen ist...Und das wiederum bedeutet, daß sie tiefer in der Tinte hängen als bislang gedacht. Jetzt tritt ein Mann auf das Felsplateau, ein Mann mit Augenklappe – Standartenführer Oschmann. Er hebt beide Arme und das Gemurmel schwillt an. Jetzt versteht Ben die Worte: „Novus Ordo Seclorum! Novus Ordo Seclorum! Annuit Coeptis! Novus Ordo Seclorum! Novus Ordo Seclorum! Annuit Coeptis!" Als Oschmann die Arme wieder senkt, werden die Stimmen wieder leiser. „Genossen!“ ruft Oschmann. „Ich habe euch etwas mitzuteilen! Ich werde morgen für einige Zeit nach Wien abreisen! Aber Standartenführer Gephardt wird mich vertreten, wie er es bisher auch schon würdig getan hat. Zuvor werde ich noch das heutige Opfer darbieten!“ Aus dem Galeriegang heraus tritt ein Wachtrupp mit zwei Personen, einem Mann und einer Frau, beide sehen sehr mitgenommen aus. Die Gefangenen, denkt sich Ben. Das erklärt, warum er abgesehen von Reiss noch keine Gefangenen gesehen hat. Die Gefangenen werden auf das Felsplateau geführt. Am Rücken sieht Ben durch die teilweise zerfetzte Kleidung Spuren von Peitschenhieben. Auf dem Felsplateau drehen sich die beiden Gefangenen zu der versammelten Menge um und werden durch unsanfte Tritte dazu gebracht, sich hinzuknien. Jetzt sieht Ben das Gesicht der Frau und erkennt es. „Scheiße, Xia Ven, wieso hast Du uns das nicht gesagt...Du hast es doch gewußt!“ flucht Ben leise. Und Oschmann, quasi der Hohepriester dieser Messe, entscheidet per Münzwurf: „Kopf – die Frau! Zahl – der Mann!“ Klirrend fällt die Münze auf den Fels. „Zahl!“ Ein Raunen geht durch die Menge, während Oschmann befiehlt: „Bringt die Frau weg. Sie kommt nächste Woche dran!“ Die Wachen nicken, packen die apathisch wirkende Frau und bringen sie wieder durch den Galeriegang in ihren Kerker. Inzwischen heben zwei Gepos eine Steinplatte in der Mitte des Felsplateaus hoch. Die Platte ist etwa 2 mal 2,5 m groß und gibt einen vielleicht einen Meter tiefen Hohlraum frei. An einer Seitenwand des Hohlraums ist eine Öffnung, eine zweite am entgegengesetzten Ende im Boden der Nische. Was soll das? Die Wachen schubsen den Mann nun rüber zu der Nische und bedeuten ihm, sich in die Höhlung zu legen. Als der Mann den Kopf schüttelt, kriegt er einen Tritt zwischen die Rippen und wird von den Gepos in den Hohlraum gestoßen. Ein Gepo postiert sich am Rande des Felsplateaus an einem großen Holzhebel, während drei Mann eine schwere Metallplatte heranschleppen. „Nein...! Neeeiiin!! Biitte niiicht!“ brüllt der Mann und fängt sich direkt wieder ein paar Tritte ein. Dann legen die Gepos die Metallplatte, die bestimmt 3 mal 3 m mißt, über ihn. Unter dem Metall hört man die Rufe und Schreie und das Klopfen des Gefangenen nur noch gedämpft. Oschmann wendet sich wieder die Menge zu und hebt nun nur einen Arm, als er brüllt: „Tod allen Verrätern, Unreinen, Juden, Kommunisten und anderen Schädlingen!“ Die Menge antwortet mit einem dröhnenden „Sieg heil!“ In diesem Moment legt der Geheimpolizist den Holzhebel um. Sofort ertönen unter der Metallplatte gellende Schreie, die so laut sind, daß nichtmal die Metallplatte sie zu dämpfen vermag. An den Rändern steigt leichter Dampf unter der Metallplatte auf. Das Todesgeschrei ist so nervenzerreißend, so unmenschlich, daß selbst Ben zusammenzuckt. Die Menge stimmt nur wieder ihren Singsang an: „Novus Ordo Seclorum...!“ Ben hat nun genug gesehen. Er macht sich schleunigst wieder auf dem Rückweg nach oben. Es ist kühl und deswegen hat er sich eine Jacke übergezogen. Die Beine läßt er vom Steg baumeln, während er den Schwimmer auf dem Teich beobachtet. „Barnet, was macht Dein Haken?“ fragt Stefan über die Schulter hinweg zu Barnet Busch rüber, einem alten Kumpel, der eigentlich längst tot ist. Eine unsinnige Situation: Was immer das hier ist, Halluzination oder nicht, jedenfalls geht er gerade mit einem toten Freund fischen und unterhält sich darüber, wer schon mehr Beute hat. „Nichts.“ knurrt Barnet. „Mensch, ich glaube ich bin dazu nicht geschaffen.“ Stefan lacht. „Barnet, Du brauchst mehr Geduld. Jetzt sag bloß nicht, daß Du hier keine Zeit hast!“ „Überzeugendes Argument. Aber darüber unterhalten wir uns, wenn Du wirklich hierher gehörst.“ „Was soll das denn heißen?“ „Du bist doch noch nicht richtig tot, oder?“ Total irritiert schaut Stefan auf die Teichoberfläche. „Gute Frage...“ Nach kurzem Überlegen fragt Stefan zurück: „Was ist, wenn ich hier nicht weg will?“ „Was soll das denn-...“ Barnet bemerkt, daß Stefans Blick rüber zum Haus gewandert ist, wo Christiane sich mit Jolanda unterhält. „Oh nein, Chef, schlag Dir das aus dem Kopf!“ „Hey, ich hab Dich nicht um Deine Meinung dazu gefragt! Ich bin immer noch Dein Vorgesetzter.“ Barnet schmunzelt. „Was gibt’s da zu lachen?“ „Hier bist Du niemandes Vorgesetzter. Im Gegenteil. Wir sind es, die hier auf Dich aufpassen.“ Etwas verstimmt knurrt Stefan: „Toll, Barnet paßt auf mich auf. Man, muß ich verzweifelt sein...“ „Keine Sorge, Du wirst früher zurück sein als Dir lieb ist und dann darfst Du auf Clarissa aufpassen.“ „Wer ist Clarissa?“ „Meine Verlobte.“ „Bitte?!“ krächzt Stefan. „Erinnerst Du Dich an die Kleine, mit der ich mal länger zusammen war, die kurz vor Kriegsausbruch nach Ägypten gefahren ist?“ „Ach die!“ „Ja, die! Ich meine es war...Moment...Anfang ’87 oder so? Ja, irgendwo darum hab ich mich mit ihr verlobt. Du weißt ja, was dazwischengekommen ist.“ „Mmmhmmm...ein Granatwerfergeschoß.“ „Na Männer, was lästert ihr wieder?“ fragt Jolandas helle Stimme hinter ihnen. Stefan dreht sich um und mustert die Frau mit ihren langen dunklen Haaren, mit der er sich früher immer gezankt hatte. Sie ist immer noch ziemlich schlank, obwohl sie irgendwie nicht so schlank wirkt wie zu Lebzeiten. Oder kann das an der Kleidung – Jeans und ein roter Pullover – liegen? Ach, Scheiß drauf! „Nein, wir lästern nicht.“ erwidert Barnet. „Jolanda, könntest Du kurz meine Angel halten?“ „Sicher.“ Barnet reicht Jolanda seine Angel und geht den Steg entlang zum Ufer. Stefan fällt auf, daß Jolanda die Angel zu hoch hält. Da sein Köder offenbar eh nichts bringt, holt er seine Schnurr ein und steht auf. „Jole, Du hälst die Angel zu hoch.“ „Was?“ „Warte ich zeigs Dir.“ Er tritt hinter sie und drückt mit einer Hand ihren Arm runter, so daß die Angelspitze deutlich näher an der Wasseroberfläche liegt. „Hol etwas Schnurr ein.“ „Wozu?“ „Mach einfach...Gut so...Wenn Du die Angel zu hoch hälst, hast Du zu wenig Spielraum, um mit einem Ruck anzuziehen, wenn einer beißt.“ „Wozu muß man anziehen?“ „Um ihnen den Haken in den Gaumen zu treiben.“ „Igitt!“ „Tja, dann darfst Du nicht angeln.“ „Dann nimm Du das Teil!“ Sie drückt ihm die Angel in die Hand und tritt etwas zur Seite. Während Stefan wieder etwas Schnurr gibt, meint er: „Es tut mir leid, daß ich Dich damals nicht retten konnte.“ „Wie meinen?“ „Auf dem Schlachtfeld in der Lausitz.“ Sanft legt Jolanda eine Hand auf seine Schulter. „Macht nichts, General. Du hast es immerhin versucht. Das ist alles, was zählt.“ Unterdessen ist Barnet zurück zur Hütte gegangen. „Chrissi?“ „Ja?“ kommt es aus der Hütte zurück und dann kommt Christiane wieder nach draußen. „Was gibt’s, Barnet?“ „Ein Problem.“ „Was für ein Problem? Läuft doch alles gut.“ „Vielleicht zu gut.“ „Was meinst Du?“ Chrissi sieht ihn verwundert an. „Erinnerst Du Dich daran, daß Stefan mal sagte, er sei süchtig nach Dir?“ „Ja, aber was-...Moment, meinst Du...?“ „Genau das, Chrissi. Vielleicht will er gar nicht zurück. Wieso auch, wenn seine Seele hier ihre Droge kriegt?“ Verärgert atmet Chrissi ein, zweimal tief durch. „Ok, danke Barnet. Ich werde mit ihm reden. Ich...ich krieg das schon hin.“ „Ok, wenn Du meinst.“ erwidert Barnet schulterzuckend und geht wieder zurück zum Steg. „Verstehst Du, Petra?“ fragt Ben, sichtlich aufgeregt. Er geht in ihrem Quartier auf und ab und kommt nicht zur Ruhe, gerade hat er ihr erzählt, was er vor nicht ganz einer Stunde gesehen hat. „Diese irren Typen sind nicht einfach nur eine Truppe Staatsterroristen, sondern ein Orden und wir hocken mitten in ihrer Ordensburg!“ stellt er fest. Sie zuckt nur die Schultern, auch wenn ihr Gesichtsausdruck etwas gequält wirkt. „Und? Sollen wir deswegen gleich in Panik verfallen?“ fragt sie verärgert. Früher wäre sie wahrscheinlich in Panik verfallen, aber jemand hatte ihr mal gesagt: Das bringt nichts. Da kann man genauso gut ruhig bleiben. An der Situation ändert das absolut nichts. Und seitdem hatte sie gelernt ruhig zu bleiben, ihre Nerven unter Kontrolle zu bringen, die Situation aus genügendem geistigem Abstand zu beurteilen und erst dann zu handeln. Nach einer Pause stellt sie fest: „Immerhin könnte das erklären, was mit den Menschen passiert ist, die in den letzten Monaten im Reich verschwunden sind.“ „Toll.“ stellt Ben sarkastisch fest. „Wahrscheinlich können wir ihnen dann bald Gesellschaft leisten.“ „Keine Sorge, wir kommen hier raus, Ben.“ „Sicher? Mensch, das ist doch alles...Naja, hoffen wir auf Kipshoven. Wo bleibt der eigentlich?“ „Der? Der bereitet seinen Angriff vor.“ antwortet Petra und lächelt kalt. Anika schlendert über den Markt von Bludenz, im Arm einen Korb, in dem sie schon ein paar Möhren und eine Packung Eier liegen hat. Jetzt schaut sie, was sie noch gebrauchen kann. Als sie gerade an einem Stand einige Kohlköpfe begutachtet, hört sie hinter sich eine Männerstimme. „Hi, Anika. Wie geht’s Dir?“ „Wer-...?“ „Tsss...nicht umdrehen! Ich bins – Philipp.“ spricht der Mann leise weiter. „Was machst Du hier?“ raunt sie zurück und meint dann lauter zu der Marktfrau: „Wieviel?“ und deutet dabei auf den Kohlkopf. „5 Reichsmark das Stück!“ „Ok, ich nehme zwei!“ Und wieder leiser: „Du brauchst Informationen?“ „Ja.“ „Ok, in einer halben Stunde in der Kirche!“ „Ok.“ Philipp sieht sich hektisch um, ob er irgendwo Gepos oder einen allzu auffälligen Spitzel sieht, dann eilt er rasch vom Markt runter. Zum Glück fällt er in Jeans und gefütterter Jacke – es ist schon recht kühl – nicht allzu sehr auf. Schnell in die nächste Seitengasse. Dort wartet schon Fraker. „Fraker, haben Sie alles gekriegt?“ Philipp hatte sich vor drei Stunden mit Fraker in die Stadt begeben, um einige Besorgungen zu machen: Proviant – den hat Philipp selber im Rucksack – und einige Spezialbesorgungen – dafür hatte Philipp Fraker eine Liste mitgegeben. „Ja, hab das meiste gekriegt, den Rest kann ich morgen abholen.“ „Wunderbar. Sie kehren zum Lager zurück.“ „Und Sie, Kapitän?“ „Ich? Ich hab noch einen Termin in der Kirche.“ „Gute Freunde sind nicht alles. Sie sind das einzige.“ Abwandlung eines Zitats eines amerikanischen FootballSpielers, mit der General Reiss die Bedeutung seiner engsten Freunde für sein Leben beschrieb Zum Glück sind am frühen Samstagabend in der Kirche nicht viele Menschen. Höchstens vielleicht ein paar Ältere, die jetzt schonmal ein paar Kerzen anzünden. Philipp hat Fraker mit dem Wagen vorfahren lassen zum Lager und will später zu Fuß dorthin zurückkehren. Langsam schreitet er durch das Mittelschiff der Kirche, seine Schritte hallen in der dämmrigen Halle wieder. Rechts und links steht je eine Reihe Kirchenbänke. Etwa in der Mitte sitzt ganz links außen Anika Wüstefeld. Als Philipp sie überraschend auf dem Markt gesehen hat – obwohl er sie zuletzt vor mehreren Jahren gesehen hat, hat er ihr hübsches Gesicht und ihre schlanke Gestalt sofort wiedererkannt - , hat ihm sein Instinkt direkt gesagt, daß sich wiedermal gewisse Dinge von selbst ergeben. Zumindest hofft er das. Kann es Zufall sein, daß eine Frau, in die Stefan vor Jahren mal für ganz kurze Zeit ein wenig verknallt war, ausgerechnet jetzt ausgerechnet hier auftaucht? Ehrlich gesagt glaubt Philipp an seine Zufälle nicht. So leise wie möglich setzt Philipp sich hinter Anika, aber die Kirchenbank knarzt dennoch. „Philipp?“ flüstert Anika leise. Er kniet sich wie zum Gebet nieder, faltet die Hände und spricht dann leise zu ihr: „Ja. Was machst Du hier?“ „Du hast gut reden! Weißt Du eigentlich, was die Kaiserlichen im Rheinland seit Ende des dortigen Feldzuges für eine Hexenjagd auf Leute machen, die Kontakt zu ‚Schimäre‘ haben?“ „Ja, ich weiß. Unsere Agenten mußten Köln aufgeben.“ „Habs mitgekriegt. Ich bin schon vor vier Monaten weg und hab‘ bei der Gepo als Sekretärin angeheuert, in München. Besser verstecken konnte ich mich nicht. Da meine Akte bislang weiß ist, haben sie mich nach Schattenlagant versetzt; meine Vorgängerin ist krank geworden. Sie wissen nicht woran. Ich persönlich hab den Verdacht, der dortige Arzt hat mit zu vielen verbotenen Stoffen rumgespielt. Wenn Du verstehst was ich meine...“ „Ich verstehe...“ flüstert Philipp zurück. „Aber ich brauche jetzt vor allem Pläne von Schattenlagant, die Verteidigungsmaßnahmen und den ganzen Quatsch.“ Ein Geräusch läßt Philipp nach unten sehen. Tatsächlich hat Anika einen Briefumschlag aus ihrer Tasche fallen lassen. Vorsichtig hebt Philipp ihn mit einer Hand auf und steckt ihn in die Innentasche seiner Jeansjacke. „Danke.“ „Ja, toll. Was soll ich jetzt machen? Ich will ehrlich gesagt nicht beim Gemetzel dabei sein.“ „Nimm Dir Urlaub und tauch dann in München wieder unter. Kennst Du da irgendwelche Agenten von uns?“ „Ja. Haben mir damals eine Wohnung dort besorgt.“ „Gut. Die werden sich um Dich kümmern.“ „Ok. Ich wünsche euch viel Glück, Philipp. Holt ihn da raus.“ „Wie geht’s ihm denn?“ „Er liegt momentan im Koma oder sowas in der Art. Sie wissen nicht warum. Lag jedenfalls nicht unbedingt an der Folter, denn da waren die Typen noch nicht so weit gegangen.“ „Im Koma? Scheiße, Mann... Naja, das werden wir schon hinkriegen... Nochmals danke Anika. Paß gut auf Dich auf.“ „Ja, Du auch auf Dich-...“ Als Anika sich umdreht, ist Philipp verschwunden. Sie blickt sich hektisch in der Kirche um. Zwei ältere Damen gehen gerade an ihr vorbei nach vorne. Aber kein Philipp. „Wie macht er das nur immer?“ flucht sie, steht auf, bekreuzigt sich und verläßt dann eilens die Kirche. Da jetzt das Hauptquartier in Safonovo ist, hat sich Karo auch ein neues Quartier zugelegt – und in Ermangelung anderer kurzfristiger Möglichkeiten sich in der Stube von Tanja auf dem „Schimäre“-Luftwaffenstützpunkt breitgemacht. Jetzt allerdings packt sie erstmal ihren Rucksack, um dann nach Moskau zu fahren. Eigentlich hatte sie sich ausgedacht, in ihrer verdreckten Frontuniform nach Moskau zu fahren, weil das vielleicht mehr Eindruck macht. Aber andererseits würde man sie so kaum in den Kreml lassen. Also hat sie doch nochmal geduscht und sich ihre weiße Gala-Uniform angezogen, von der Stefan immer sagt, Karo würde darin so unglaublich sexy aussehen; allerdings weiß Karo bis heute nicht, ob er das ernst oder ironisch meint. Begleitung für die Reise hat Karo auch gefunden. Am Nachmittag war Anja Karlinski vorbeigekommen. Zwar mit verbundenem Arm, aber ansonsten in Ordnung. Der Arzt hat ihr Fronturlaub verschrieben und da wollte sie sich mal Moskau ansehen. Eine Nachricht von Anjas Schwester hatten sie immer noch nicht, allerdings stand sie nicht auf den vorläufigen Gefallenenlisten. „Mach Dir keine Sorgen.“ hatte Karo Anja beschwichtigt. „Sie wird sicherlich irgendwo gerade in einem gemütlichen Unterstand sitzen und den Sieg feiern...“ Ein schwacher Trost, denn wenn Unterstände eines nicht sind, dann gemütlich. Sie wuchtet ihren Rucksack auf die Schulter und schnappt sich ihr Sturmgewehr und geht dann nach draußen, wo Anja bereits wartet. Karo tritt nach draußen und bemerkt, daß es bereits dämmert. Anja steht neben dem Wagen und unterhält sich dort mit einem Mann, der zunächst nur mit dem Rücken zu Karo steht, aber eine türkische Uniform trägt. Als sich der Mann umdreht, weil er Karos Schritte gehört hat, erkannt Karo Guido. „Guido, was suchst Du denn hier? Hast Du nichts zu tun?“ „Nein. Ich muß morgen Abend von Moskau aus meinen Rückflug nehmen und da dachte ich, ich begleite euch.“ „Ich hab schon versucht es ihm auszureden, Karo!“ meint Anja. Aber Karo lacht nur. „Lassen wir ihn ruhig mitfahren, Anja. Wenn er meint, er müßte sich mit uns die Nacht auf der Straße nach Moskau um die Ohren schlagen.“ „Ist ja nicht so, als wollte ich euch verführen...“ witzelt Guido. „Naja, ich weiß nicht.“ bleibt Anja skeptisch. Aber wenn Du meinst, Karo...“ „Also, fahren wir!“ meint Guido und will schon die Fahrertür auf machen, als Karo ihm eine Hand auf den Arm legt. „Nichts für ungut, Guido, aber erstmal will ich fahren.“ „Na, wenn Du meinst. Dann kann ich ja was auf dem Rücksitz von diesem achso gemütlichen Geländewagen vor mich hindösen.“ „Genau. Und jetzt rein da!“ Die Schwierigkeiten hatten über der Syrte begonnen. Die Eskorte der britischen Jagdflieger wurde nicht abgelöst. Daher mußte Sandro die Maschine in Tripolis landen. „Ist mir eh recht, dann können wir noch mal tanken und nen Kaffee trinken.“ Und die beiden Frauen konnten sich nochmal die Beine vertreten, bevor man zur nächsten mehrstündigen Etappe aufbrach. Das war dann gegen 20 Uhr 45. Jetzt fliegen sie schon seit einer Stunde östlich der tunesischen Küste nach Norden und immer noch ist nichts von ihrer Eskorte zu sehen. Danko wird allmählich unruhig, was allerdings auch daran liegen kann, daß er an diesem Nachmittag erst eine Zigarette geraucht hat. „Sandro, wo bleiben die Säcke von der 24.?“ Sandro zuckt die Schultern. „Ich hab keine Ahnung. Die Ablösung hat ja schon nicht geklappt, weil es wieder Luftangriffe auf Sizilien gegeben hat, weshalb alle Jäger gebraucht wurden. Vielleicht ist das wieder Fall.“ „Na toll.“ knurrt Danko. „Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll.“ „Wie wärs mit Abstand?“ witzelt Sandro. „Ha, ha, sehr komisch.“ „Keine Sorge, Danko, die kommen schon. Der Kommandeur der 24er ist ein guter Kumpel von mir...“ Sandro bricht ab, als mit brummendem Motorengetöse eine Jagdmaschine links, eine rechts und eine vor ihnen auftaucht. Clarissa kommt von hinten nach vorne und meldet: „Hinten sind noch drei.“ „Ich kann den Maschinentyp nicht bestimmen.“ stellt Danko etwas besorgt fest. „Das sind C.202 ‚Folgore‘.“ stellt Sandro fest. Leider sind die Abzeichen bei der fortgeschrittenen Dämmerung nur schwer zu erkennen. „Hier Sonderflug Ramses-34. Leute, wer seid ihr?“ „Sandro, alter Kumpel, hier Paolo! Die 24er grüßen euch!“ „Junge, seid wann habt ihr die neuen Kisten?“ „Seid einer Woche! Fliegen sich echt Traumhaft.“ „Ok, dann bringt uns mal sicher durch.“ „Wird schon klappen. Allerdings könnte es etwas holprig werden.“ „Alles klar.“ Sandro schaltet wieder um auf „nur Empfang“. „Danko, alles klar, das ist endlich unsere Eskorte. Sie haben nur seid einer Woche diese neuen Maschinen.“ „Was hatten die denn vorher?“ „Fiat CR.42 Falco. Doppeldecker, die im Süditalienfeldzug letzten Monat hohe Verluste hatten. Erst seit die neapolitanische und die venezianische Luftwaffe endlich umrüsten auf modernere Modelle gekauft haben, kommen wir allmählich den koaliierten Luftwaffen bei.“ „Na ganz toll.“ Ein wenig skeptisch ist Danko immer noch. Aber ganz der Mann von Welt strafft er seine Haltung im Sitz etwas und meint dann zu Clarissa: „Sagen Sie doch bitte Frau Fehr bescheid, daß sie sich keine Sorgen machen muß.“ „Werd ich. Aber ich glaube, sie schläft ohnehin.“ Clarissa verschwindet wieder nach hinten; und im Westen verschwindet die Sonne hinter den Bergen Tunesiens endgültig. Es ist schon dunkelgeworden, als Philipp den Waldpfad, den seit Jahren kaum ein Mensch genutzt hat und der deswegen schon stark zugewachsen ist, in den Rungeliner Wald aufsteigt. Der Wald wird um diese Jahreszeit kaum von Menschen besucht. Über einen etwas breiteren Waldweg haben sie den Lieferweg in den Wald gefahren und dann zwischen ein paar Bäumen abgestellt und mit Ästen getarnt. Nach einer Dreiviertelstunde ist Philipp endlich in der Nähe des Lagers. Unweit eines kleinen Wasserfalls hat man es zwischen zwei Felsgraten, die mitten im Wald aus dem Boden ragen, aufgeschlagen. Eigentlich müßte bald einer der Posten ihn entdecken. „Halt!“ zischt jemand hinter einem Baum hervor. Philipp erkennt die Stimme von Christian Jacke. „Jacke, ich bins.“ Christian läßt die Waffe sinken. „Na endlich. Wir dachten schon, Du wärst erwischt worden.“ „Nein. Gibt’s was neues?“ „Ja. Krammer ist mit seinen Leuten eingetroffen. Eine unserer Agentinnen aus dem Rheinland, Heike Schmidt, hat sie hierher gelotst. Aus der Schweiz ist ein Trupp hierher unterwegs, hat sich bereits per Funk angekündigt.“ „Und was neues von Frau Fehr?“ „Wird momentan hierhergebracht, ist aber wohl erst in einigen Tagen hier.“ „Wieso das denn?“ „Unsere Leute haben sie in einem ägyptischen Gefängnis gegabelt.“ „Oh. Na gut. Ich werd mich jetzt mal mit Fraker zusammensetzen und mit den ersten Planungen beginnen. Wie lange hast Du noch Schicht?“ „Noch bis Mitternacht. Dann löst mich Tibori ab.“ „Gut. Bis später.“ Philipp marschiert weiter, die letzten 50 m bis zum Lager. Hier führt nicht mal mehr ein normaler Weg entlang, man muß sich selbst zwischen den Bäumen und Büschen zurechtfinden. Vorsichtig achtet Philipp darauf, daß er trotz des Laubes auf dem Boden nicht zu viele Geräusche verursacht. Schließlich klettert er über einen der Felsgrate und ist im Lager angekommen. Mit Ästen, Decken und Planen haben Fraker, Tanja, Tina und Marta ein getarntes Lager errichtet, fast wie ein großes Zelt, mit einer in die Erde gegrabenen Mulde, die als nicht einsehbarer Feuerplatz dient. Um das Feuer herum haben sich die anderen versammelt und nun gesellt sich Philipp dazu. „Hey Leute, bin zurück.“ Er reicht Krammer die Hand. „Schön Sie hier zu sehen, Oberstleutnant. Wie war die Reise?“ „Schön Sie noch lebend zu sehen, Kapitän. Wir haben von Ihrer Rettungsaktion für die polnischen Gefangenen in dem Zug gehört. Reife Leistung.“ „Danke.“ „Unsere Reise war sehr angenehm. Frau Schmidt hier hat uns dabei geholfen, die Gepo-Kontrollen zu umgehen. War nicht leicht. In den letzten Monaten sind die Kontrollen immer restriktiver geworden.“ „Ja, ich weiß.“ Philipp tritt an Krammer vorbei, neben dem Heike Schmidt sich erhoben hat, und begrüßt diese. „Frau Schmidt, kenne ich Sie nicht irgendwoher?“ Er mustert im Feuerschein ihr Gesicht. Wache Augen, sinnliche Lippen und weinrot gefärbte Haare, die ihr hübsches Gesicht umrahmen. „Haben Sie nicht damals, bei den Unruhen in den Niederlanden den Handstreich auf das Scheveninger Gefängnis durchgeführt?“ Sie lächelt verlegen. „Ja. Zusammen mit Sabine Granrath.“ „Ja. Der Name sagt mir was. Ich wußte nur nicht, daß auch Sie für uns arbeiten. Aber es freut mich, Sie in unseren Reihen begrüßen zu dürfen.“ „Die Freude ist ganz meinerseits. Ich soll übrigens auch mitteilen, daß alle Verstecke in der Eifel bislang sicher geblieben sind.“ „Sehr gut.“ Philipp klopft ihr aufmunternd auf die Schulter und wendet sich dann zu Krammer und Fraker um. „Kommt mit. Wir müssen erste Dinge besprechen.“ „Hey, ich will auch dabei sein!“ meldet sich aus einer Ecke der Mulde Diana zu Wort. „Neugierig wie eh und je.“ stellt Marta fest. Philipp blickt in die Runde. „Sie können bei der Besprechung nicht dabei sein.“ „Aber ich-...“ „Nein! Wie alle anderen werden Sie die wichtigen Dinge morgen mittag erfahren.“ Und zu Krammer und Fraker gewandt meint Philipp: „Kommt!“ Sie klettern aus der Mulde und rüber zu einem aus einer Plane gebastelten Zelt, das einen leidlich trockenen Platz bietet. Die Planen, Decken und Äste halten den Regen ab, ja, aber nicht die Feuchtigkeit oder die Kälte. Die drei Offiziere setzen sich auf den kalten, feuchten Boden und Philipp holt den Briefumschlag hervor, den Anika ihm gegeben hat. Mit seinem Klappmesser öffnet er ihn und holt mehrere zusammengefaltete Blätter heraus. „Das sind die neuesten Informationen, die wir über Schattenlagant kriegen können. Eventuell machen sie sogar die Anwesenheit von Frau Fehr unnötig.“ „Fällt Ihnen aber früh ein, Kapitän.“ knurrt Fraker. „Ich konnte das nicht ahnen, Fraker.“ Krammer hat sich bereits eines der Blätter geschnappt. „Leute, ich glaube, wir haben ein Problem.“ „Wieso?“ Krammer hält das Blatt hoch. „Die Besatzung von Schattenlagant umfaßt derzeit rund 1000 Mann der Gepo-Sondereinheit ‚Kronos‘.“ „Und?“ wundert sich Fraker. „Sind wir damit nicht beim Lager Sechtem auch klargekommen?“ Fraker spielt auf eine Kommandoaktion Ende August an, bei der „Schimäre“ fast alle Gefangenen des Konzentrationslagers Sechtem nahe Köln befreite. Auch damals hatte man es mit rund 1000 Gepos zu tun. Philipp mischt sich ein. „Erstens war der Gegner da nicht ‚Kronos‘ und ich glaube Krammers Zielobjekt sah auch nicht so aus.“ Er hält ein zweites Blatt in die Höhe und Krammer leuchtet es mit seiner Taschenlampe an. Es ist eine Zeichnung Schattenlagants. „Au Scheiße...“ flüstert Fraker. „Da brauchen wir ja eine monatelange Belagerung.“ Philipp hält ein zweites Blatt daneben, auf dem Anika das in den Berg gebohrte Labyrinth von Gängen, Räumen, Hallen und Kerkern skizziert hat. Fünf Etagen hat sie skizziert, aber alles nach unten hin mit Fragezeichen versehen. Offenbar gibt es noch mehr absolut geheime Etagen. „Nur das wir keine Monate haben.“ erwidert Philipp. „Kapitän – bei allem Respekt, aber wie sollen wir das schaffen?“ Krammers Stimme ist auf einmal etwas kleinlaut. „Was haben Sie, Oberstleutnant? Haben Sie gedacht, Schattenlagant wäre ohne Grund berüchtigt? Aber keine Sorge, ich hab sowas geahnt und bereits ein paar Ideen.“ Fraker sichtet die letzten beiden Blätter. Auf einem ist der einzige Zugang, den Anika kannte, zu dem Lager eingezeichnet. „Chef, vielleicht brauchen wir Frau Fehr doch noch.“ „Wieso, Fraker?“ „Vielleicht kennt sie von ihrer Kartierung her noch ein paar andere Wege nach oben als diese blöde und viel zu leicht zu verteidigende Straße.“ „Da haben Sie recht.“ bestätigt Krammer. „Ja,“ meint Philipp. „Oder er will schlicht und einfach nur wissen, wie die Lady aussieht.“ „Ha, ha, sehr komisch...“ knurrt Fraker, der alte Schürzenjäger, während Krammer und Kipshoven breit grinsen. Es ist still geworden im Flieger. Danko ist auf dem Co-Pilotensitz eingeschlafen und die beiden Frauen hinten schlafen auch. Sandro unterhält sich nur hin und wieder kurz mit seinen Freunden von der 24. Squadriglia. „Leute, sagt mir Bescheid, wenn wir in die Funkreichweite von Aeroporto Falcone –Borsellino kommen. Ok?“ „Ok. Wir müßten bald in Sichtweite der Küste sein. Aber viel werden wir nicht sehen.“ „Schon klar, Verdunkelung.“ „Warte mal kurz Sandro, ich muß mich mit meinen Männern unterhalten.“ „Schon klar.“ Während Sandro auf darauf wartet, daß sein Kumpel wieder die Funkverbindung herstellt, checkt er nochmal alle Bordinstrumente durch. Aber alles ist im grünen Bereich. Als er wieder nach vorn blickt, sieht er unter der dünnen, lückenhaften Wolkendecke ein Licht. Dieses flackert und blitzt immer wieder auf. Viele kleine Lichter verglühen darüber wie Feuerfunken. Das kann eigentlich nur Sciacca sein. Aber die allabendliche Luftangriffswelle müßte längst vorbei sein. „Scheiße, Sandro, wir haben Probleme!“ meldet sich der Chef der 24er zu Wort. „Laß mich raten.“ antwortet Sandro. „Die Invasion ist da.“ „Scheiße man, ja! Das Gefecht vor ein paar Stunden war nur der Vorbote! Die Luftverteidigung der Insel bricht gerade zusammen und wir fliegen mittenhinein! Der Funkverkehr auf der Insel ist total überlastet, aber es hört sich für mich so an, als wäre Messina gefallen und würde Catania von See her angegriffen!“ Nach einer Pause wird Sandros Kumpel wieder trocken und kurzangebunden: „Ok, wir schießen euch durch. Am besten halten wir jetzt Funkstille. Wir werden nur den Flakbatterien auf dem Weg Bescheid sagen.“ „Alles klar.“ Sandro rüttelt Danko wach, der sofort aufschreckt. „Hmmm...was...was geht..?“ „Danko, wir kriegen Ärger!“ Für seine Verhältnisse ist Danko erstaunlich schnell wach, spätestens als er rechts unter ihnen das brennende Sciacca sieht. „Scheiße! Ist das...?“ „Ja, die Invasion!“ „Was haben wir an Waffen?“ „Ein 7,7-MG in der Feuerkanzel.“ Sandro deutet nach hinten, wo seitlich im Gang eine Leiter in eine verglaste Kanzel mit einem Mg führt. „Und dazu zwei MG, mit denen man aus den hinteren Fenster feuern kann.“ Danko steht sofort auf. „Ich kümmer mich drum.“ Mit wenigen Schritten ist er hinten. „Mädels, aufwachen!“ brüllt er. Clarissa schreckt als erste auf. „Was ist los, General?“ „Wir hängen mitten in der Scheiße! Da hinten in den Kisten sind zwei MGs mit Munition! Schnappen Sie sich die und schießen Sie auf jeden Flieger, der auf uns schießt!“ „Alles klar.“ Clarissa rüttelt die Fehr wach. „Kommen Sie! Sie müssen mir helfen!“ Danko klettert derweil in die MG-Kanzel direkt hinter dem Cockpit. Ein Gurt ist sogar schon drin, Danko muß nur noch entsichern und hält sich bereit. Mit einem schnellen Blick erkennt er, daß das MG vor allem nach hinten schießt. Das lichterloh brennende Sciacca liegt inzwischen weit hinter ihnen; unten ihnen erheben sich nun die Innlandhöhenzüge Siziliens. Endlich findet Danko neben dem MG das Kehlkopfmikrophon und legt sich dieses zusammen mit den Kopfhörern um. „Sandro, hörst Du mich?“ „Ja. Ich hab gerade über Funk die Nachricht gekriegt, daß die Region um Palermo von Trägerflugzeugen angegriffen wird. Dürfte ein heißer Empfang werden.“ „Träger?“ „Ja, der kaiserliche Träger, der im Mittelmeer unterwegs ist. Hast Du nichts von der Bombardierung Alexandrias gehört?“ „Nur am Rande.“ „Ok, halt die Augen offen.“ Augen offen halten? Danko starrt in die Finsternis. Über sich sieht er ein paar Sterne zwischen den Wolken. Das monotone Motorengeräusch der Pipistrello und der eskortierenden Jäger lullt einen ein. Scheiße man, denkt sich Danko. So viel Ruhe bedeutet normalerweise jede Menge Ärger. Das sagt ihm sein Instinkt, erprobt in vielen Gefechten in den Türkenkriegen und auch in diesem Krieg, den einige bereits den ‚Großen‘ nennen. Nur wenig mehr als eine halbe Stunde später bestätigt sich sein Gefühl: Vor ihnen ist die Nacht auf einmal hell erleuchtet. Riesige Lichtkegel ragen in den Himmel, leuchtende Perlschnüre jagen immer wieder nach oben, Feuerbälle flammen am Himmel auf – fast wie Wetterleuchten. Auch ein blubberndes Grollen ist zu hören. Sandro sieht es auch. „Mein Gott...“ flüstert er angesichts der gespenstischen Szenerie. Gesehen haben er und Danko so etwas schon mehr als einmal während des Balkanfeldzuges im September. Brigitte hat so was noch nie gesehen. Sie hat sich ein eine der seitlichen Scheiben mit der Wange gepreßt, um vorne etwas sehen zu können. „Mein Gott...“ flüstert auch sie. Wie muß es jetzt unten in Palermo zugehen? „Haben Sie schon mal sowas gesehen?“ fragt Brigitte etwas nervös Clarissa Junge. Die schüttelt den Kopf. „Nein, noch nie. Ich hatte gehofft, ich müßte es nie sehen.“ Ohne weitere Worte kümmert sich Clarissa weiter um ihr Maschinengewehr und legt einen Gurt ein, öffnet ein Fenster, kalter Wind peitscht herein, sie verankert auf einem am Fensterrahmen angebrachten Lager das Maschinengewehr. „Sandro?“ meldet sich der Squadriglia-Chef wieder. „Ja, was gibt’s?“ „Ich habe gerade mit Aeroporto Falcone-Borsellino gesprochen. Die Luftverteidigung ist abgesehen von ein paar Flaks zusammengebrochen. Wahrscheinlich sind wir die einzigen Partygäste.“ „Verstehe.“ Der Funkkontakt bricht wieder ab. Nervös kaut Sandro auf seiner Unterlippe rum. So hatte er sich diesen Flug nicht vorgestellt. Das ist kein einfacher Transportflug mehr, das wird wahrscheinlich bald schon ein Trip – so nennen die Jagdflieger bei den Briten, „Schimäre“ und der exildeutschen Luftwaffe ihre Feindflüge. Nachdem ihm ein britischer Kollege davon erzählt hatte, hatte sich dieser Begriff Sandro eingeprägt, weil er ihn irgendwie passend fand. Plötzlich erfaßt ein Flakscheinwerfer die Pipistrello mit dem Pulk Folgores um sie herum. Danko hat auf einmal einen erstaunlich guten Überblick. Und irgendwas stimmt nicht... einige Jagdflieger hängen ungewöhnlich weit zurück und sind viel zu hoch....Das sind doch keine Folgores! Das sind doch Messerschmitts! Kurzentschlossen richtet Danko das Maschinengewehr drauf aus, bis er die mutmaßlich feindlichen Maschinen im Fadenkreuz hat. Und dann drückt er ab. Die Leuchtspurgeschosse zeigen ihm, wohin seine Garben gehen – und das er einmal beinahe eine Folgore trifft, die gerade noch ausweichen kann. Unwillkürlich ruft Danko aus: „Entschuldigung, wollt‘ ich nich...!“ Von den Messerschmitts trifft er keine, aber diese müssen nach unten wegtauchen, um den MG-Geschossen auszuweichen. Immerhin haben jetzt auch die Folgore-Jäger die Messerschmitts bemerkt. Sie schwenken ab und auf die kaiserlichen Jagdflieger zu, eröffnen das Feuer. Der tödliche Tanz ist binnen einer Minute voll entbrannt. Einige Sekunden lang starrt Danko gebannt auf die Szenerie, ohne den Finger vom Abzug zu nehmen. Auf einmal: Ting! Ting! Ting! Das Magazin ist leer. Hektisch lädt Danko nach, als auf einmal direkt neben seiner Kanzel Geschosse in die Flugzeughülle schlagen. Clarissa ist es, die Danko nun wahrscheinlich das Leben rettet, als sie mit ihrem Maschinengewehr das Feuer eröffnet und den Messerschmitt-Piloten zwingt, den Angriff von der Seite abzubrechen, nach oben abzudrehen – und damit etwa 30 m über der Pipistrello genau ins Bordkanonenfeuer einer Folgore zu fliegen. Brennend stürzt die Messerschmitt nach unten und raus aus dem Lichtkegel. Unten hält Clarissa einfach drauf. Allmählich kriegt sie ein Gefühl dafür, wie sie zielen muß, um die Folgores nicht zu sehr zu behindern. „Brigitte, wie steht’s bei Ihnen?“ Keine Antwort. Als Clarissas Gurt leergeschossen zur Seite fällt, dreht sie sich um. Brigitte kriegt ihren Munitionsgurt nicht rein. Mit zwei Sätzen ist Clarissa auf der anderen Seite neben Brigitte. „Zusehen!“ brüllt sie über den Wind hinweg, der aus dem offenen Fenster peitscht und legt im Zwielicht den Gurt ein: Mit der linken Hand hält sie das MG am Griff fest, zieht den Spannschieber in die hinterste Stellung, das der Abzugshebel den Verschluß festhält, dann schiebt sie den Spannschieber wieder bis zum Anschlag nach vorn, alles ganz schnell. Sichert das MG, öffnet dann den Deckel, legt den Gurt ein und zieht ihn bis zum Patronenanschlag ein und schließt dann den Deckel. Alles in wenigen Augenblicken mit flinken Handbewegungen. „Wann...?“ will Brigitte fragen, aber da drückt Clarissa ihr die Waffe auch schon wieder in die Hand. „Und jetzt linke Seite sichern!“ Schon ist Clarissa wieder auf ihrer Seite, legt einen neuen Gurt ein und hört hinter sich die ersten Feuerstöße. Irgendwo draußen explodiert etwas, im hintersten Teil des Flugzeughecks sieht Clarissa aus dem Augenwinkel kleine Löcher – irgendwelche Splitter zersieben nach und nach die Maschine! Danko in seiner Kanzel haut inzwischen schon sein drittes Magazin rein. Die Explosion eben ist eine Folgore gewesen, deren Motor nur 50 m von ihm entfernt explodiert ist. Der Pilot ist als brennendes Geschoß in die Tiefe gestürzt. Ein Trümmerstück hat einen Teil der Kanzelverglasung dicht neben Danko zerdeppert. Über den Bordfunk hört Danko Sandro brüllen: „Danko, Ärger von vorn!“ Schnell dreht sich Danko um. Von vorne greift ein zweiter Messerschmitt-Pulk an – und nur eine Folgore ist zur Stelle, um sich diesem entgegenzustellen! Und von irgendwoher feuert eine Flakbatterie hoch, holt tatsächlich eine Messerschmitt runter, eine Messerschmitt dreht ab, nachdem sie von der Folgore getroffen wurde. Aber dann wird die Folgore von den Messerschmitt-Garben zerfetzt. Bevor das Flugzeug in Brand gerät, kann der Pilot aber noch aussteigen. 50 m weiter unten öffnet sich ein heller Fallschirm. All das bei dem unwirklichen Licht der Flakscheinwerfer. Kurzentschlossen handelt Danko: Mit raschen Handgriffen löst er das MG von seiner Lafette, dreht sich um, zertrümmert mit einer kurzen Salve die Vorderseite der verglasten Kanzel, legt das Maschinengewehr dann auf die Kante und visiert nach vorne an. Vielleicht nicht ganz vorschriftsmäßig, aber immerhin kann Danko jetzt nach vorne feuern. Während er sein Magazin verfeuert und die Messerschmitts erstmal überrascht abdrehen, brüllt er: „Sandro, bring uns hier raus!“ „Ok, alles festhalten, Sonderflug Ramses-34 legt mal was an Tempo zu!“ Kaum hat er’s gesprochen, läßt Sandro die Motoren aufheulen, neigt die Maschine nach links und geht in einen rasanten Sinkflug über. Der Höhenmesser fällt schneller, als manchem lieb sein kann. Auch Dankos Magen rumort und Brigitte verliert das Gleichgewicht und taumelt durch den Passagierraum, bis sie etwas unsanft auf einem der Sitze landet. „Was wird das?“ brüllt Danko und Sandro antwortet: „Ich bring uns hier raus – tief und schnell!“ Tief ist gut: Nur 15 m über den Baumwipfeln donnert die Pipistrello durch eine Senke zwischen zwei Hügelzügen nach Norden, dicht über ein brennendes Dorf hinweg, das offenbar von Stukas angegriffen wurde. Auf einmal sieht Danko dicht über sich Leuchtspurgeschosse hinwegjagen, wirbelt herum – und sieht, daß sich eine Messerschmitt an sie drangehängt hat. Hektisch bringt er das MG wieder auf die ursprüngliche Lafette und eröffnet das Feuer. Er trifft die Messerschmitt in den Motorblock und das Cockpit. Die rauchende Maschine vollführt eine halbe Drehung direkt über der Pipistrello, die Flügelspitze rast auf die MG-Kanzel zu, Danko weicht aus und fällt nach unten in den Gang, während der Rest des verglasten Überbaus weggerissen wird. Aus dem Augenwinkel sieht Sandro die Messerschmitt links an sich vorbeirauschen und in einen Weinberg krachen. „Sandro!“ brüllt Danko von hinten. „Ja, ja, ich mach ja schon!“ Vor ihnen, nur noch wenig mehr als 10 km entfernt, sieht er das Meer glitzern und direkt davor den kleinen Flughafen, der ihr Ziel ist. Allerdings ist ein lichterloh brennender Flughafen bei Dunkelheit auch kaum zu verfehlen. Und über Funk kommt die Unglücksbotschaft rein: „Ramses-34, ihr könnt unmöglich hier landen! Liegen unter Beschuß!“ Es braucht ein paar Augenblicke, bis Sandro merkt, was der Tower meint. Ganz weit, weit hinten am Horizont sind immer wieder aufblitzende Lichter zu sehen. Und nun schlagen die Granaten der feindlichen Schiffsgeschütze auch rund um die dahinjagende Transportmaschine ein. Schwarze Dreck-und Schuttfontänen schießen überall hoch, Splitter sirren durch die Luft. „Scheeiiißeee!!“ brüllt Sandro, als die Maschine kräftig durchgeschüttelt wird. Hinten springt Clarissa überrascht zur Seite, als Granatensplitter die Seitenwände und den Boden des Flugzeugrumpfes durchschlagen. Danko ist inzwischen wieder vorne im Cockpit, stützt sich an der Lehne von Sandros Sitz ab. „Verdammt, bring uns runter!“ „Geht nicht, die beschießen den Flugplatz!“ Ein Ruck geht durch die Maschine, als ein Granatsplitter den rechten Motor trifft, der sofort anfängt zu qualmen, Flammen schlagen aus den Lüftern. Eine weitere Granate schlägt direkt vor ihnen ein, die Scheiben des Cockpits zerbersten, ein Splitterregen geht auf sie nieder. „Das Meer!!“ brüllt Danko auf einmal. „Bring uns auf dem Meer runter!“ „Und dann?“ „Keine Ahnung!“ Sandro begreift: Den Rest kann man sich dann immer noch überlegen. Er reißt das Steuer herum und in einer scharfen Kurve weicht die Pipistrello, wenn auch etwas schwerfällig, der nächsten Granatensalve aus und nimmt Kurs aufs offene Meer... Die Küste ist eine flammende Linie, pulsierend von Granateinschlägen und dem Abwehrfeuer der alliierten Kanonen – die Kanonen der Verteidiger aus Großbritannien, Sizilien, Spanien und sogar ein kleines 500-Mann-Kontingent aus Genua, das beim Einmarsch der Franzosen in Genua vor etwa vier Wochen fliehen konnte. Die Landung bei Palermo kann jeden Augenblick erfolgen. Daher ist Eile geboten. Auf den Sonderflug Ramses-34 hat man leider nicht mehr warten können. Zu lange hat Oberst Marco Grieco, Kommandeur des Spezialbataillons 2 von „Schimäre“, das Unternehmen ‚Kugellager‘ vorbereitet – nämlich zwei Wochen lang. Trotz der abendlichen Kühle sitzt auf dem offenen Achterdeck des von der Küste wegstrebenden Schiffes und beobachtet die flackernden Lichter der Invasionsschlacht. Geschickt drehen seine Finger ein Haschisch-Tabak-Gemisch in das dünne Blättchen ein. Es würde für längere Zeit das letzte Mal sein, denn vor zwei Stunden, als die Schlacht begann, sind sie früher als geplant zu der gefährlichen Mission aufgebrochen. Der Plan ist riskant: Mit dem Schiff, einem vor Wochen aus dem bombardierten Hafen Neapels gerettetem alten Frachter, unter der Fahne der vatikanischen Handelsflotte Genua ansteuern, dort Öltanks, Küsten-und Flakbatterien sprengen, zwei dort stationierte französische Kreuzer mit Haftminen versenken und dann wieder abhauen. Zu diesem Zweck besteht die Besatzung des Frachters aus einigen Genueser Schiffsleuten, die sich noch in ihrem alten Hafen auskennen, und etwa 25 Mann vom Spezialbataillon 2, die in den letzten zwei Wochen diesen Einsatz intensiv geübt haben. Vor einer Woche lieferten einige britische Agenten endlich die benötigten Funkcodes, um bei der Kommunikation mit den Hafenbehörden in kein Fettnäpfchen zu treten. Den alten Frachter haben Griecos Männer umgespritzt und einen neuen Namen draufgepinselt: Roberto. Man hat sogar Fracht organisiert, um die Tarnung perfekt zu machen: Kisten voller Eisennägel und Konserven. Nur in den untersten Kisten sind Waffen und Sprengstoff eingepackt. Und zwei der Rettungsboote hat man zu getarnten MG-Stellungen umgebaut. Jedes einzelne Besatzungsmitglied hat gefälschte Papiere. Und alles nur um eine Nachschubbasis der feindlichen Mittelmeerflottillen auszuschalten. Das Kommando über das restliche Spezialbataillon 2 hat Grieco an seinen Adjutanten Oberstleutnant Guliani weitergegeben; wahrscheinlich wird Guliani gerade jetzt damit beschäftigt sein, mit seinen Männern bei der Abwehr der Invasion zu helfen. Gestern platzt mitten hinein in die letzten Vorbereitungen die Nachricht, man müsse noch drei Leute mitnehmen und dann von Genua aus in den Alpenraum schleusen! Als wenn Grieco nicht genug Probleme hätte! Allerdings wurde ihm auch bedeutet, es sei ganz besonders wichtig. Mit flinken Fingern vollendet Grieco sein kleines Meisterwerk und will sich gerade erheben, um in sein Quartier zu gehen und das Zeug zu genießen, als er über den Lärm der nur wenige Kilometer entfernten Invasionsschlacht hinweg lauter werdende Motorengeräusche hört. Zwei Mann von der Besatzung stürmen an Deck und brüllen laut auf Italienisch: „Da vorne!“ Und dann kommt es auch schon runter: Ein großes Flugzeug donnert mit einem rauchenden Motor dicht über die Roberto hinweg, zieht eine flache Kurve und kracht dann in einem flachen Winkel ins Wasser, wobei Teile des Leitwerks wegfliegen. Einigermaßen erstaunt starren Grieco und die beiden Matrosen darauf. Dann reißt sich Marco als erster los. „Na los, setzt ein Boot aus! Wir müssen die Überlebenden bergen!“ Einige andere Matrosen haben seit ein paar Augenblicken damit begonnen, diesen Befehl eigenmächtig um zu setzen. Nach nur drei Minuten ist das erste Beiboot beim sinkenden Flugzeugwrack, aus dem die Luftblasen herausblubbern. Als das Morsesignal: „Vier Überlebende, kein Toter“ gesendet wird, atmet Grieco auf. Allerdings ist er jetzt mal gespannt, wen sie da aufgefischt haben. Sonntag, der 19. Oktober Spas-Lipki – hier hatte für Brieskischs Soldaten die Schlachte begonnen. Und nun ist sie in die kleine Häuseransammlung inmitten russischer Wälder zurückgekehrt. In den Schatten immer wieder aufflackernder Leuchtkugeln huschen dunkle Gestalten durch den Ort, feuern auf andere dunkle Gestalten einzelne Schüsse ab. Am Ortsrand detoniert eine Handgranate, dann Rufe, Schreie nach dem Sanitäter. Den Ortskern bildet eine Ansammlung von fünf Häusern rund um eine Kreuzung. Im letzten flackernden Glühen einer Leuchtkugel springen drei Gestalten hinter einer Häuserecke in Deckung, um der knatternden Salve eines kaiserlichen Maschinengewehrs zu entgehen. „Verdammt, wo ist das Drecksding?“ flucht Unteroffizier Daniels. „Irgendwo dahinten...“ schlägt sein alter Kumpel, Hauptgefreiter Ilgner, spontan vor, während er gerade sein Sturmgewehr neu durchlädt. „Ach nee...“ knurrt Daniels verärgert. Die beiden sind schon lange dabei. Daniels hat bei „Schimäre“ schon gedient, da gabs diesen Krieg noch gar nicht, da war es noch ein anderer Krieg, von dem alle Welt aber nur als die ‚niederländischen Unruhen‘ schwaffelte. Im Maintal, bei der Rebellion, die diesen Krieg auslöste, hat er dann Ilgner kennengelernt, einen jungen Handwerker aus Schweinfurt, der zunächst in der Rebellenmiliz diente und vor Bamberg die Fahne seines Regiments rettete (ja, sowas zählte damals, vor anderthalb Jahren noch). Bei der Ausbruchsschlacht von Würzburg kämpften sie dann Seite an Seite und Ilgner rettete in einer halsbrecherischen Aktion das Leben des verletzten Daniels. Als dann alle verbliebenen Rebellentruppen unter dem „Schimäre“-Kommando vereinigt wurden, landeten die beiden in der selben Kompanie – und dabei ist es bis heute geblieben. Viel haben sie seitdem erlebt. Zwei Lausitzer Schlachten, die Schlachten während der Polenfeldzüge. In Radomicko mußten sie mit ansehen, wie ein kleines Kind seine Eltern verlor. Gewiß, dies geschieht in Zeiten wie diesen Tausendfach, aber das unmittelbare Erlebnis, wenn man persönlich dabei ist – selbst der sonst so hitzköpfige, stürmische Ilgner ist danach ruhiger und nachdenklicher geworden. Daniels hat schon andere erlebt, die gar zusammenbrachen. „Irgendwelche intelligente Ideen?“ fragt Daniels in die Runde. Ilgner zuckt nur die Achseln und die dritte Gestalt im Bunde, Obergefreite Mira Krapp, Tochter eines exildeutschen Generals und Verlobte des exildeutschen Verbindungsoffiziers Pick, schüttelt den Kopf. Insgeheim bewundert Daniels diese Frau. Jung und schön, könnte es als Generalstochter sowas von gut haben – und dient trotzdem als einfache Soldatin, ohne Sonderbehandlung. Und bislang kämpft sie gut. Seit dem Frühjahr ist sie dabei, im Juli hatte sie ihren ersten Kampfeinsatz und war seitdem bei jeder Schlacht vorne mit dabei. Als wenn sie einen Schutzengel hätte, wurde sie nie verwundet. Plötzlich kracht es heftig am andern Ende des Ortes. Offenbar ist eine Scheune oder so was in die Luft geflogen, nun blecken Flammen in den Nachthimmel. Da alles durchnäßt ist und es immer noch fein nieselt (was immer wieder in stärkeren Regen übergeht), qualmt alles. Aber in dem dämmrig-flackernden Licht kann Daniels einen schnellen Blick um die Ecke riskieren. „Gut. Ich seh die Dreckssäcke. Direkt am Westrand der Kreuzung. Haben einen Ochsenkarren auf dem Weg als Deckung.Haus rechts davon ein Trümmerhaufen, aber das kleine Haus daneben wäre eine gute Deckung.“ „Wie sieht Dein Plan aus, Unteroffizier?“ fragt Ilgner. „Haben wir noch Handgranaten?“ „Eine noch.“ Mira reicht ihre an Daniels. „Ok, folgender Plan: Ilgner, Du und ich wir greifen den MG-Posten direkt an. Mira, Sie besetzen das noch stehende Haus direkt daneben. Haben Sie noch genug Munition?“ „Noch ein Reservemagazin.“ „Ok. Ich zähle bis drei, dann geht’s los.“ Mit den Fingern zählt Daniels bis drei ab. Dann sprinten alle drei los. Daniels und Ilgner schlagen Haken und weichen so den MG-Garben aus, Ilgner feuert dabei mit seinem Sturmgewehr auf den MG-Schützen. Mira erreicht das Gebäude in dem Moment, in dem Daniels die Handgranate wirft. Sie springt durch das Fenster ins Innere des Gebäudes und landet in einem Schwall aus Glassplittern auf hartem Holzboden, im selben Augenblick, wie die Handgranate detoniert. Draußen fliegen die Trümmer des Ochsenkarrens durch die Luft. Ein Schatten versucht wegzurennen, aber Ilgner und Daniels feuern und treffen. Die Gestalt bricht zusammen. Schnell rennt Daniels rüber und kniet sich neben dem in den Schlamm gefallenen Mann hin. Tot. Ein Kaiserlicher. Ilgner feuert eine Leuchtkugel ab, um den andern Zügen der beiden Kompanien, die der Regimentskommandeur auf Spas-Lipki angesetzt hatte, zu signalisieren, das die zentrale Kreuzung eingenommen ist. Als die Kugel hochjagt, geht Ilgner in dem aufgerissenen Loch, das die Handgranate zurückgelassen hat, in Deckung, Daniels hat sich schnell flach neben den Toten gelegt, um eine Deckung zu haben. So warten sie mit schußbereiter Waffe, bis das flackernde Licht wieder verlischt. Irgendwo von Norden her hört man Schüsse und Rufe. Doch ein Ruf kommt von näher. Es ist Mira. Sie ruft aus dem Innern des Hauses. Daniels rennt geduckt rüber und um das Haus herum. Er klettert durch das selbe Fenster rein, durch das Mira hineingesprungen ist. Außen war das Haus beigefarben verputzt und wirkte etwas verdreckt, hier drinnen besitzt es einen großen Raum mit einem Kamin im Zentrum, altem knarrzendem Holzfußboden und einer ziemlich einfachen Einrichtung aus Holzmöbeln. Die Feuerstelle des Kamins dient offenbar zugleich auch als Kochstelle. Nur der hintere Teil des Hauses ist abgetrennt, vermutlich als Schlaf-und Waschkammer. Die ursprünglichen Bewohner sind vermutlich schon vor längerer Zeit geflohen oder umgekommen. Doch diesen Gedanken hält Daniels nur einen Augenblick lang fest. Direkt vor ihm steht Mira stocksteif. Und starrt auf Schemen, Gestalten, die vor ihnen auf dem Boden liegen. „Was ist?“ fragt Daniels mit nervöser Stimme. Mira zittert, das erkennt Daniels sogar im Zwielicht; also zündet er sein Sturmfeuerzeug an. In dem kleinen Lichtkreis erkennt er dann die ersten Leichen. Alle in „Schimäre“-Uniform. Die Kehlen sind durchgeschnitten, Arme und Beine gefesselt. „Oh mein Gott...“ Etwa 10 m vor der Hauptkreuzung von Spas-Lipki fährt ein Kübelwagen durch eine Pfütze und hält dann an. Es ist nun etwa drei Stunden her, seit Mira und Daniels die hingerichteten „Schimäre“-Kämpfer gefunden haben. Seit etwa zwei Stunden ist Spas-Lipki wieder fest in der Hand von „Schimäre“. Die Kaiserlichen haben sich auf eine Grabenstellung etwa anderthalb Kilometer weiter westlich zurückgezogen. Aus dem Kübelwagen steigt Ulf Graf von der Lichterfelde, Generalleutnant und Kommandeur des 1. „Schimäre“-Infanterieregiments. Ein stämmiger Mann mit einem leichten Bauchansatz (sein Appetit ist berüchtigt) und schon etwas hoher Stirn, der aber eine starke Entschlußkraft besitzt und dessen tiefe Stimme ihm zusätzliche Autorität verleiht. Er ist wie Mansfeld zwar ein Adliger, aber auch er glaubt an die Freiheit und hat sich seit der Main-Rebellion immer wieder im Gefecht als guter Kommandeur erwiesen. Als er vor zwei Stunden die Nachricht bekam, daß man die 35 Vermißten seines Regiments gefunden hätte, mußte er sich das unbedingt selbst ansehen. Zackigen Schrittes überquert er, begleitet von einem seiner Stabsoffiziere und zwei Männern von Daniels‘ Zug, die Kreuzung. „Wir haben die Toten in dem Haus dort drüben gefunden. In der Ruine gegenüber haben wir Leichenteile gefunden. Als das Haus zerstört wurde, verbrannten die Toten teilweise.“ „Scheiße, Mann!“ knurrt Lichterfelde. Nur Augenblicke später steht er in dem Haus, in dem Mira etwa 20 der Leichen gefunden hat. Mit drei Lampen haben die Soldaten für Licht gesorgt, aber den Kamin haben sie nicht angemacht – damit die Verwesung nicht zu schnell einsetzt, bevor man die Leichen wegbringen kann. Einer der Sanitäter nimmt gerade eine erste Untersuchung vor. In riesigen, eingetrockneten Blutlachen liegen die Leichen auf dem Boden. „Wie lange?“ fragt Lichterfelde nur. Der Sanitäter blickt im Dämmerlicht der Lampen auf. „Wahrscheinlich gestern. Genau kann ich das nicht sagen. Aber nicht vor vorgestern.“ „Sind es unsere Vermißten?“ Daniels macht von der Seite her einen Schritt auf Lichterfelde zu. „Laut den gefundenen Soldbüchern sind es unsere Vermißten, Herr Generalleutnant.“ „Wer hat sie gefunden?“ „Obergefreite Krapp.“ „Wo ist sie?“ „Draußen.“ „Gut. Räumt die Schweinerei hier auf. Sorgt für ein anständiges Begräbnis bis heute abend. Und wenn mir auch nur einer auf die Idee kommt, seine Wut an kaiserlichen Gefangenen oder gar Verwundeten auszulassen, kriegt er mit mir persönlich Ärger. Verstanden?“ „Verstanden, Herr Generalleutnant.“ knurren die Soldaten. Daher bleibt Lichterfelde nochmal an der Tür stehen und faßt Daniels stellvertretend für alle ins Auge: „Glauben Sie mir – ich würde selber gerne meiner Wut nachgeben und....Aber wenn wir das tun, verraten wir, wofür wir kämpfen. Das darf nicht passieren. Ich werde morgen einen entsprechenden Tagesbefehl rausgeben, daß jeder Kompaniechef das seinen Leuten nochmal einschärfen soll.“ „Jawohl, Generalleutnant.“ knurrt Daniels mit einem wütenden, angeekelten Blick auf die Toten. Lichterfelde tritt wieder nach draußen. Obwohl es in dem Haus noch nicht großartig gestunken hatte – dank das schon recht eisigen Wetters - , rumort Lichterfeldes Magen. Und Lichterfelde hat nun wirklich schon viel gesehen. Allerdings hat er einige der Toten auch persönlich recht gut gekannt, mit zwei Männern war er erst vor zwei Wochen auf ein paar Wodka in einer Kneipe. Etwas rechts von dem Gebäude, wo ein alte Blechtonne steht, stehen zwei Soldaten neben ihrer Kameradin, die sich gerade lautstark übergibt und mit einer Hand an ihrem Sturmgewehr abstützt. „Obergefreite Krapp?“ fragt Lichterfelde vorsichtig und räuspert sich. Einer der Soldaten bedeutet dem Generalleutnant, sich kurz zu gedulden. „Ihr ist ziemlich übel.“ „Ich merks.“ Mira hebt eine Hand. „Danke Leute, es geht allmählich wieder.“ Langsam richtet sie sich wieder auf, wischt sich mit einem alten Handtuch den Mund ab und wendet sich dann Lichterfelde zu. „Was gibt’s, Herr Generalleutnant?“ „Ich wollte nur wissen, ob es Ihnen gut geht, Frau Obergefreite. Immerhin haben Sie die Leichen gefunden?“ „Ach, halb so wild.“ „Und außerdem meine ich, ich hätte da was gehört von privaten Dingen, die Sie belasten.“ „Spricht sich wohl rum, daß ich meinen Verlobten lange nicht gesehen habe. Aber was solls – vielen von uns geht es so.“ „Ach Mira,“ mischt sich ein Soldat ein, „wir wissen nur meistens, wie es um unsere Partner steht. Das kannst Du momentan nicht gerade behaupten.“ „Ja.“ bestätigt der andere Soldat und schaut Lichterfelde an. „Herr Generalleutnant, die Frau hat seit dem Sommer keinen wirklichen Urlaub mehr gehabt!“ „Na und?“ fragt Lichterfelde forsch. „Das gilt wahrscheinlich für ziemlich viele.“ „Ja, aber sie ist noch recht neu im Geschäft und hat besser gekämpft als manch einer von uns...“ „Sie wollen also andeuten, Hauptgefreiter, Frau Obergefreite Krapp könnte einen Urlaub gut gebrauchen?“ „Äh...ich glaube...tja, ich meine...“ Jetzt verhaspelt sich der Mann. „Ist schon gut Leute.“ beschwichtigt Mira. „Ich will keine Sonderbehandlung.“ Um ein neuerliches Erbrechen zu unterdrücken, schluckt sie mehrmals hektisch. „Ich ruh mich nur kurz aus und dann kann es morgen früh weiter gehen. Generalleutnant, wie heißt das Tagesziel für morgen?“ Jetzt muß Lichterfelde flüchtig lächeln. „Ihr Ehrgeiz in Ehren, Frau Obergefreite, aber Sie müssen niemandem etwas beweisen. Und ich sehe, wenn jemand fürs erste am Ende ist. Sie kriegen eine Woche.“ „Wie eine Woche?“ „Mensch, Mira, Urlaub!“ tönt einer ihrer beiden Kameraden und klopft ihr aufmunternd auf die Schulter. Mit einem breiten Grinsen salutiert Lichterfelde und die drei Soldaten schlagen dann auch hastig die Hacken zusammen und salutieren. Dann läßt Lichterfelde die Hand wieder sinken und meint zum Abschied: „Ok, steht bequem. Eine angenehme Nacht noch.“ Ohne weitere Aufregung geht Lichterfelde zurück zum Kübelwagen, tritt dabei versehentlich in eine tiefe Pfütze und flucht laut, denn erst jetzt fällt ihm auf, wie der Regen seine Uniform durchnäßt hat. Ein grelles Licht läßt Danko aus der Dunkelheit der Ohnmacht aufschrecken. Ruckartig stützt er sich mit seinen Ellbogen auf und blinzelt hektisch, um wieder klare Sicht zu kriegen. „Was...Wo...?“ stammelt er. Sanft drückt ihn eine Hand wieder zurück auf die Pritsche, auf der er liegt. Allmählich kann Danko erkennen, daß eine andere Hand eine Taschenlampe getragen hat – das grelle Licht. Über ihm ist eine grünlichgraue Decke, an der eine alte Funzel für wenig brauchbares Licht sorgt. Jemand macht ein zischendes Geräusch und murmelt dann: „Ganz ruhig, General Popovic. Sie sind in Sicherheit. Nur ein wenig Ruhe brauchen Sie.“ Nach nochmaligem Blinzeln erkennt Danko das Gesicht eines etwa 40jährigen Mannes, der volles schwarzes Haar hat und ihn mit besorgtem Gesicht anschaut. Er trägt weiße Leinenkleidung. „Wer...?“ „Wer ich bin?“ lacht der Mann und erst jetzt fällt Danko auf, daß der Mann auf Englisch mit ihm redet. „Ich bin Dr. Fruccanti, Bordsarzt der Roberto. Meinen Sie, Sie könnten sich mit jemandem unterhalten?“ Während die Worte durch seinen Kopf wabbern, schluckt Danko den bitteren Geschmack eingetrockneten Speichels herunter und nickt dann träge. „Aber erst würde ich gern etwas trinken.“ „Sicher. Können Sie gut gebrauchen.“ „Was ist eigentlich...?“ „Passiert? Nun ja, Sie sind mit einem Flugzeug ins Meer gekracht und haben sich ein paar Schrammen und Prellungen zugezogen.“ Jetzt fällt es Danko auch wieder ein. Und jetzt, wo der Arzt es sagt, melden sich auch seine schmerzenden Glieder. „Was ist mit den anderen?“ keucht er. „Haben alle überlebt. Ihr Pilot hat eine kleine Platzwunde an der Schläfe gehabt, die beiden Frauen sind irgendwie praktisch unverletzt davongekommen. Oberst Grieco unterhält sich gerade mit den beiden.“ „Sagten Sie Grieco?“ Auf einmal ist Danko hellwach. Den Namen kennt er doch. Bei diesem Oberst sollte er sich doch für die Reise nach Genua melden! Etwas murrend entscheidet sich Danko nun doch seinem nicht gerade überwältigenden Pflichtgefühl nachzugeben und schwingt seine Beine von der Pritsche. Ein Assistent des Arztes reicht ihm ein Glas Wasser, das Danko schnell in zwei Zügen runterkippt. Dann stellt er sich vorsichtig aufrecht hin, was sein Magen erstmal mit einer flauen Gefühl quittiert, aber es geht. „So, in Ordnung, bringen Sie mich zu Oberst Grieco.“ „Wie Sie wollen.“ meint der Arzt und nickt der Wache an der schweren Eisentür zu. Erst jetzt dämmert Danko, daß er wirklich an Bord eines Schiffes ist – jetzt, wo er die Tür sieht. Und er spürt allmählich auch das hin und her eines auf hoher See befindlichen Schiffes. Die Wache führt Danko durch einen langen niedrigen Korridor fast bis ans andere des Schiffes, wo er an eine hölzerne Tür klopft. „Herein.“ Danko tritt ein und die Wache bleibt draußen stehen. Der Raum ist gleichermaßen als kleines Büro wie als Kajüte eingerichtet. Eine Klappritsche ist an einer Wand angebracht, am Bullauge steht ein kleiner Schreibtisch, um den herum drei Stühle stehen und in einem kleinen Schrank gegenüber der Pritsche kann man seine Sachen unterbringen. Eine einzelne Lampe an der Decke sorgt für etwas Licht. Vor dem Bullauge ist ein Vorhang gezogen, damit das Licht nicht nach draußen dringt. Eine Uhr an der Wand zeigt 4 Uhr an. Auf dem Stuhl hinter dem Schreibtisch sitzt ein schlanker, hochgewachsener Mann mit kurzen dunklen Haaren von etwa Anfang 30. Er trägt die volle Uniform eines „Schimäre“-Oberst. Auf den beiden andern Stühlen sitzen Clarissa und Brigitte. Clarissa erhebt sich gerade. „Ok, ich werd dann mal eine Mütze voll Schlaf nehmen, wenn es recht ist, Herr Oberst?“ „Nichts dagegen, Frau Stabsunteroffizier.“ Clarissa salutiert, tritt mit einem Lächeln an Danko vorbei – das dieser gern erwidert – und verläßt den Raum. Die Tür schließt sie hinter sich. „Bitte General, setzen Sie sich!“ Oberst Marco Grieco deutet auf den freigewordenen Stuhl. Brigitte scheint noch etwas eingeschüchtert zu sein, ihre langen dunklen Haare hängen noch etwas feucht vom Meerwasser über ihre Schultern. Hatte man für Clarissa noch eine trockene Uniform auftreiben können, so konnte man Brigitte vorerst nur einen grauen Overall anbieten. Innerlich ist sie immer noch überrascht, wer so alles bei „Schimäre“ dient: Kroaten, Deutsche, Italiener... Und kein Mensch fragt danach, wo jemand herkommt. Was zählt ist allein das gemeinsame Ziel, sind allein die gemeinsamen Ideale. Erstaunlich... Danko läßt sich auf den Holzstuhl nieder, der dabei leise knarrzt. „General, ich dachte schon, wir hätten uns verpaßt und da fallen Sie mir quasi vor den Bug.“ meint Grieco auf Englisch. „Bitte, Oberst, Sie können auf Deutsch mit mir sprechen.“ erwidert Danko „Achso...hmmm, nix dagegen. Tja, Frau Fehr konnte mir nur mitteilen, daß Sie sie nach Bludenz bringen müssen.“ „Ja. Eine Operation im Rahmen der Befreiung von General Reiss.“ Ein leichtes Lächeln zieht über Griecos Miene. „Was ist Oberst? Sie wissen, daß Sie uns helfen müssen.“ Danko hofft, daß er sich mit seinem Rang nicht zu weit aus dem Fenster hängt, schließlich kennt er Grieco nicht persönlich; aber er weiß, daß dieser schon länger dabei ist, wie er und bessere Beziehungen zum „Schimäre“-HQ hat. Marco Grieco muß lachen. „General, ich kenne Sie nicht. Ich weiß, daß ich streng genommen Ihr Untergebener bin und daß Sie von der kroatischen Armee zu uns übergewechselt sind. Aber machen Sie sich keine Sorgen.“ Brigitte beobachtet fasziniert die Diskussion der beiden Offiziere. Grieco fährt fort: „Ich kenne Reiss persönlich. Ich bin immer gut mit ihm ausgekommen, wir haben sogar etliche Abende gemeinsam im Offiziersklub oder im Biwak verbracht und zusammen gebechert. Um eine gute Freundin von mir hat er genauso getrauert wie ich. Keine Sorge, General: Ich werde helfen. Den Grundsatz, niemals einen unserer Leute hängen zu lassen, nehme ich ernst. Allerdings müssen Sie auch verstehen: Diese Aktion in Genua haben wir von langer Hand vorbereitet. Ich muß überlegen, wie ich beides miteinander unter einen Hut kriege.“ „Tjaa...verstehe..An mir solls nicht liegen.“ meint Danko langsam. „Sagen Sie nur, Oberst, wenn wir helfen können.“ „Gut, das werde ich. Aber sagen Sie mir doch, warum Frau Fehr so wichtig ist.“ „Hmmm...so ganz hab ich das auch nicht geschnallt. Ich nehme mal schwer an, Frau Fehr hat Informationen, die für die Befreiungsaktion wichtig sind.“ „Hey, ich bin auch noch da!“ meldet sich Brigitte vorsichtig zu Wort. „Entschuldigung.“ entgegnet Danko mit einem Blick zu ihr rüber. An der Tür klopft es. „Herein!“ ruft Marco. Die Wache kommt herein. „Das Quartier für Frau Fehr ist fertig.“ meldet der Mann. „Gut. Frau Fehr, schlafen Sie sich doch bitte gut aus.“ „Äh, ja, gut das werd ich.“ stöhnt sie und erhebt sich. „Danke. Herr Oberst. Herr General.“ Sie verabschiedet sich, indem sie den beiden Männern zunickt. Als sie gegangen ist, zieht Grieco eine Schublade auf. „General, in Ihren durchnäßten Klamotten fanden wir das hier.“ Grieco legt die durchnäßten Überreste eines Joints auf den Tisch. „Ähh..ähhh..mmmm...tja...“ krächzt Danko und grinst verlegen. „Ach, General, keine Sorgen!“ meint Marco erheitert und holt aus der Schublade einen selbst gemachten Joint und zündet ihn an. Und auf einmal hat Danko wieder ein richtig breites Grinsen drauf... Es ist noch früh am Morgen, aber Oschmann ist schon seit zwei Stunden wach. Seine Sachen mußte er noch packen, um dann bald nach Wien abzureisen. Und dann kam auch noch Besuch. Ein Mann, Ende zwanzig vielleicht, eins siebzig groß, mittellange, nach hinten gegellte blonde Haare, dünner Kinnbart, schlanke und durchtrainierte Gestalt. Gekleidet in ein schwarzes, seidig glänzendes Hemd, schwarze Jeans. Der schwarze Gürtel besitzt eine Totenkopfschnalle. Den schwarzen Stiefeln sieht man es nicht an, aber Oschmann hat das Gefühl, daß sie Stahlkappen besitzen. Über alles hat der Mann einen langen schwarzen Ledermantel geworfen. Seine stahlblauen Augen blitzen eiskalt. Seine Stimme klingt nur mäßig tief, aber sie hat einen leicht bedrohlichen Unterton. Zwar hat der Herr offenbar erstklassige Papiere, das er überhaupt hier rein kam. Aber er ist nicht sehr auskunftsfreudig. „Wie heißen Sie?“ hat Oschmann gefragt. „Abaddon.“ „Ist das Ihr richtiger Name?“ hatte Oschmann gefragt und sich nur eine eisige Antwort eingehandelt: „Ich bin Abaddon und soll das weitere Verfahren mit General Reiss überwachen.“ Einen entsprechenden schriftlichen Befehl hatte Abaddon tatsächlich bei sich. Nun, nachdem er Abaddon zu seinem Quartier geleitet und kurz die derzeitige Lage skizziert hatte, will Oschmann vor seiner Abreise sich noch von jemandem verabschieden. Leikert hat ihm gesagt, daß Frau Müller im Trainingsraum ist. Allmählich teilt Oschmann die Sorgen von Gephardt. Diese Frau kann auf die Dauer gefährlich werden. Auch wenn sie nicht Oschmanns Typ ist, so hat sie doch einen gewissen Sex-Appeal. Leikert hat bereits erzählt, daß er neulich in der Offiziersmesse gehört hat, wie sich einige der Männer sehr angeregt über Petra Müller unterhalten haben, darunter zwei der Wachen, die Oschmann unauffällig nahe ihres Quartiers postiert hatte. Er weiß wie schädlich sowas für die Moral werden kann und hat erstmal die Wachen ausgetauscht. Zu leise, um nicht von schleichen sprechen zu können, betritt Oschmann den Trainingsraum. In der Mitte des Raumes sieht er Petra, die mit ihrem Langschwert schwungvolle, elegante Bewegungen ausführt, Parieren und Ausfall, verschiedene Drehungen, alles gegen einen unsichtbaren Gegner. Die Klinge saust mit surrendem Geräusch durch die Luft. Ein paar Minuten lang beobachtet Oschmann die Frau und ihm fällt auf, daß irgendetwas an ihrem Kampfstil ihm bekannt vorkommt. Nur was? Irgendwo meint er die Bewegungen schon einmal gesehen zu haben, nur vielleicht weniger elegant. Aber wo? Schließlich räuspert er sich. Petra führt eine Drehung um ihre eigene Achse zu Ende und hält dann inne. Schließlich steckt sie die Klinge wieder ein. „Was gibt’s, Standartenführer?“ „Ich muß nach Wien und wollte mich vorher noch verabschieden.“ Langsam geht Petra zu ihm rüber. „Es ist kalt geworden hier.“ bemerkt sie. „Ja,“ bestätigt Oschmann. „Das Wetter wird immer winterlicher. Der erste Schnee fällt schon.“ Kurz verzieht Petra sowas wie eine Grimasse, denn sie bezog ihre Worte nicht auf das Wetter – nein, sie spürte die Kälte eines neuen Besuchers. „Sie sind wirklich gut mit der Klinge, Fräulein Müller.“ „Sie können sich auch nie für Frau oder Fräulein entscheiden, nicht wahr? Wieso eigentlich? Nur weil ich nach dem Tod meines Mannes wieder den Mädchennamen trage?“ Verlegen lächelt Oschmann. „Wissen Sie, zwar nimmt die Geheimpolizei keine Frauen auf, aber wir könnten in unseren Diensten jemanden mit Ihren Fähigkeiten gut gebrauchen...“ setzt er vorsichtig an, um das Thema zu wechseln. Eisig mustert Petra ihn und antwortet dann mit hartem Tonfall: „Nein.“ Jetzt sieht Oschmann richtig enttäuscht aus. „Wieso nicht? Es könnte Ihr Leben angenehmer machen, wären nie wieder auf der Flucht vor dem System, hätten ständiges Einkommen. Ich halte Sie für klug. Wieso entscheiden Sie sich gegen ein so verlockendes Angebot?“ Petra tritt ganz dicht an ihn heran, beugt sich leicht vor und flüstert ihm ins Ohr: „Ich entscheide mich für die Freiheit!“ Dann tritt sie zurück und geht rüber zu der an der Wand stehenden Holzbank, nimmt das dort abgelegte Handtuch und tupft sich den Schweiß vom Gesicht ab. Etwa irritiert mustert Oschmann die schlanke, in einen schwarzen Trainingsanzug gekleidete Gestalt und meint dann frostig: „Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit. Ich muß jetzt gehen.“ Ruckartig dreht er sich um und meint dabei: „Bei Gelegenheit wird Gephardt Sie töten.“ „Wir werden sehen.“ entgegnet Petra mit fast sarkastischem Ton ohne sich umzudrehen und fügt dann hinzu: „Grüßen Sie auf dem Weg nach oben Abaddon von mir.“ Die Hand hat Oschmann schon an der Türklinke, jetzt bleibt er stocksteif stehen. „Woher...?“ „Sagen wir, Abaddon und ich haben noch eine offene Rechnung.“ Keiner der beiden hat sich umgedreht, ein Gespräch der zugewandten Rücken. Schließlich drückt Jörg Oschmann die Türklinke nach unten und verläßt den Trainingsraum. Wieso hatte er nicht vorher Gephardts Sorgen ernster genommen? Diese Frau gehört offenkundig zu den anderen und jetzt stehen sie alle am Abgrund. „Und die Heuschrecken sahen aus wie Rosse, die zum Krieg gerüstet sind, (...) und hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Rasseln ihrer Flügel war wie das Rasseln der Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen, (...); sie hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds; sein Name heißt auf hebräisch Abaddon, und auf griechisch hat er den Namen Apollyon.“ Auszug aus der Offenbarung des Johannes 9,79,11 Diana fröstelt es. Sie hat sich gerade unter dem kleinen Wasserfall nahe des versteckt gelegenen Lagers gewaschen – quasi eine Dusche genommen. Dabei hat sie sich geschüttelt vor Kälte. Es ist schließlich bald richtig Winter, in den höheren Lagen fällt bereits der erste Schnee und das klare Gebirgswasser ist wirklich eisig! Hastig hat sie sich wieder Unterwäsche, Jeans, T-shirt und Hemd angezogen, nachdem sie sich eben so hastig abgetrocknet hat. Vielleicht etwas zu hastig, jedenfalls kleben die Klamotten jetzt etwas unangenehm an Busen und Beinen und sie fröstelt immer noch. Auch ihre Haare hat sie auch nicht wirklich trocken gekriegt. Sie wirft sich das Handtuch über die Schulter und geht hastig den halb zugewucherten Pfad entlang. Dann hält sie inne, kurz vor dem Lager. Sie hört ein schabendes Geräusch, wie wenn Metall über Metall schabt. Vorsichtig macht sie ein paar Schritte in Richtung des Geräuschs. Sie bleibt hinter einem Baum in Deckung, als sie Philipp Kipshoven auf einem Baumstumpf sitzen sieht; er ist dabei, seinen Säbel zu schärfen. Eine Weile bleibt Diana hinter dem Baum stehen. Fasziniert beobachtet sie diesen Mann, der ihr Leben in nur wenigen Minuten verändert hat. Wieder sieht sie dieses Bild vor sich, wie er sich dem Geheimpolizisten in der Diskothek entgegenstellen will. Selten hat eine spontane Entscheidung aus dem Bauch heraus ihr Leben so verändert. Aber irgendetwas in ihr hatte ihr gesagt, daß sie sich einfach mit diesem Mann verbinden muß. Noch ist sich Diana aber nicht sicher, ob es Liebe auf den ersten Blick ist... „Diana, Sie können ruhig hervorkommen.“ ruft er auf einmal, dabei recht förmlich, und erhebt sich. Sachte wiegt er den Säbel in der Hand. Sie kommt näher. „Woher wußten Sie...?“ „Instinkt.“ erwidert er, dreht sich um und lächelt sie an. „Die meisten Dinge ergeben sich von selbst; ich wollte eh mit Ihnen sprechen.“ Sie schluckt. „Wieso denn?“ „Diana, Sie können nicht hier bleiben.“ „Bitte?!“ schnappt sie. „Ich will aber hier bleiben!“ „Diana, so seien Sie doch vernünftig! Sie können nicht mit uns kommen. Das geht Sie nichts an. Außerdem haben Sie keinerlei Kampfausbildung.“ „Dann geben Sie mir doch einfach eine!“ Total perplex sieht Philipp sie an. Dann schüttelt er den Kopf. „Wir haben leider keine anderthalb Monate Zeit. Ich gebe Ihnen vier Stunden, dann sind Sie hier weg.“ Philipp dreht sich um und postiert sich auf einer freien Fläche zwischen fünf Birken, die etwa vier mal fünf Meter groß ist. Mit schnellen, geschmeidigen Bewegungen führt er einen Kampf gegen die Luft vor, dreht den Säbel mit geschickten Handbewegungen, pariert, macht einen Ausfall. Wirbelt wieder herum und läßt die Klinge pfeifend durch die Luft sausen. Dabei ist er fast wie in Trance, voll konzentriert auf jede Bewegung, Diana kann nur fasziniert zuschauen. Schließlich fährt er auf einmal mit der Klinge vor und spaltet einen dünnen Ast genau in der Mitte, daß Diana der Mund offen stehen bleibt. „Sollten Sie nicht packen?“ fragt er barsch, während er inner hält und sich dann wieder aufrichtet und den Säbel einsteckt. „Wieso tun Sie das?“ fragt sie. „Das will ich noch wissen, bevor ich gehe: Wieso tun Sie das?“ Philipp bleibt direkt vor ihr stehen. „Stefan ist mein Freund, vielleicht mein bester, und das seit fast 30 Jahren. Mein persönlicher wie mein beruflicher Ehrenkodex erlauben es mir nicht, ihn hängen zu lassen.“ „Und was ist mit den anderen? Wieso ziehen Sie die anderen da hinein?“ „Jeder von ihnen ist mehr oder weniger freiwillig hier. Wer nicht aktiv helfen will, kann umkehren und anderswo den Platz derjenigen einnehmen, die aktiv helfen wollen. Es ist unsere Ehrenkodex: Alle für einen, einer für alle und jeder für die Freiheit.“ Als er das sagt, funkeln seine Augen wild. „Sie glauben das wirklich?“ fragt sie. „Ja.“ erwidert er bestimmt. Plötzlich packt sie seinen Kopf mit beiden Händen und küßt ihn heftig. Ihre Zunge gleitet sanft über seine. Nach ein paar Augenblicken zieht sie sich wieder zurück und meint schweratmend, dabei immer noch seinen Kopf haltend und ihm tief in die Augen blickend: „Ich kann mit einer Pistole umgehen. Reicht das? Ach ja: Und entschuldige.“ „Schon gut.“ meint er grinsend und küßt sie nun seinerseits. Dann meint er: „Ich könnte Dir noch ein wenig den Umgang mit einem Schwert oder einem Säbel beibringen.“ Lächelnd nickt sie. „Diana, woher kannst Du mit einer Knarre umgehen?“ „Die Gepos haben vor ein paar Jahren meinen Mann getötet, meine Kinder verschleppt. Ich hab damals eine Weile nur noch mit der Knarre unterm Kissen geschlafen.“ Für einen Moment kriegen ihre Augen einen traurigen Ausdruck. „Kannst Du das verstehen, Philipp?“ Er nickt. „Fast jeder von uns hat jemanden verloren. Auch ich.“ „War Sie Deine Frau?“ „Da schon nicht mehr.“ Jetzt ist sich Diana sicher. Eine steife Brise weht und jagt die Wolken über den Himmel. Brigitte Fehr steht an der Reling des Frachters und beobachtet das Spiel der Wellen, hängt ihren Gedanken nach. Sie hat ein paar Stunden schlafen können, aber kurz vor Morgengrauen hatte es nochmal Aufregung gegeben, als im Osten als kleiner Fleck der kaiserliche Flugzeugträger Karl der Große zu sehen war. Durch die Ferngläser konnten sie Start und Landung seiner Flugzeuge beobachten. Aber die von Grieco für die Roberto verfügte Tarnung als päpstlicher Frachter scheint gewirkt zu haben, wenigstens wurden sie nicht angegriffen. Das ist ein gutes Zeichen, versucht Brigitte sich einzureden. Aber was heißt schon gutes Zeichen? Als der Krieg in Europa ausbrach und immer weiter um sich griff, dachte sie, es sei gut, in Ägypten zu sein und dort einen sicheren Job als Ägyptologin zu haben. Dann landete sie im Knast. Aus dem wird sie rausgeholt – was sie wieder für ein gutes Zeichen hielt. Nur um dann unweit Palermo mit einem Flugzeug vom Himmel zu fallen. Was mag noch alles kommen? Auf eklatante Weise scheint ihr Leben aus den Fugen geraten zu sein und sie kann nichts dagegen tun. Die Kontrolle hat sie längst verloren. Die Entscheidungen werden von den anderen getroffen – von General Popovic, Oberst Grieco, dem „Schimäre“-HQ im fernen Russland. Ein Räuspern läßt Brigitte aus ihren Gedanken aufschrecken. Sie dreht sich um, wobei ihre dunkelbraunen Haare vom Wind verwirbelt werden; ein paar Strähnen muß sie sich aus dem Gesicht streichen. Oberst Grieco steht hinter ihr an die Wand des Brückenaufbaus gelehnt. „Was gibt’s, Herr Oberst?“ „Ich wollte Sie bitten, doch für den Rest des Tages unter Deck zu bleiben.“ Ein Blick auf die Uhr verrät Brigitte, daß es gerade mal 10 Uhr sind. „Wieso das denn, Herr Oberst? Wollen Sie mich einsperren?“ Verlegen lächelnd antwortet Grieco: „Nein, aber wir befinden uns in feindlichen Gewässern und feindliche Luftpatrouillen dürfen an Deck keine Frau entdecken. Unsere Tarnung könnte auffliegen.“ „Achso. Wie lange dauert die Reise denn noch?“ „Voraussichtlich bis heute abend. So gegen 21 oder 22 Uhr dürften wir Genua erreichen. Wenn nichts dazwischen kommt.“ „Was soll denn dazwischen kommen? Jetzt mal abgesehen von Luftpatrouillen.“ Marco zuckt die Schultern. „Keine Ahnung. Aber wir müssen es ja nicht austesten.“ „Na gut.“ Langsamen Schrittes geht Brigitte hinüber zu der Tür, von der eine Treppe nach unten führt. Marco läßt seinen Blick hinausschweifen auf das offene Meer, über das die Wolken hinwegjagen. Von der Gefahr, durch ein alliiertes U-Boot für den Feind gehalten und versenkt zu werden, hat er der Ägyptologin lieber nichts erzählt... Suworow hat sich entschlossen, General Sus in einem seiner größten Arbeitszimmer im Kreml zu empfangen. Das Zimmer ist etliche Meter breit, nochmal doppelt so lang, mit prächtigen Bildern an den Wänden, zwei großen Kronleuchtern und ganz am Ende steht ein schwerer zwei mal vier Meter großer Eichenholzschreibtisch. Vielleicht wird diese Kulisse die Frau etwas einschüchtern, denkt sich Suworow. Zumindest bei einigen aufsässigen Verbindungsoffizieren der exildeutschen Armee, der polnischen Streitkräfte und sogar der türkischen Regierung hat es geklappt. Als er sich auf seinen Stuhl gesetzt hat und mit einer Hand schiebt er kurz ein paar Papiere zur Seite. Dann gibt er der Wache an der Tür einen Wink. Die Wache nickt und öffnet die Tür. Herein kommen zwei Frauen, beide in Uniform, eine mit einem verbundenem Arm. Diese wird von der Wache zurückgehalten und muß warten, während Karo weitergehen darf. Sie hat ihre Haare nach hinten gekämmt, wo sie von einer Spange zusammengehalten werden – so fällt die in den letzten Tagen etwas vernachlässigte Haarpflege nicht so auf. Das Sturmgewehr hat sie geschultert, die Offiziersmütze unter den Arm geklemmt. Direkt vor Suworows Schreibtisch bleibt sie stehen. „Guten Tag, Frau General.“ grüßt Suworow sie überraschend freundlich auf Englisch und lächelt. Wortlos lächelt Karo erst zurück, dann preßt sie die Lippen wieder aufeinander und erwidert mit schneidender Stimme: „Ob der Tag gut ist, Feldmarschall, weiß ich noch nicht. Aber ich weiß, daß die letzten Tage beschissen waren und daran sind Sie mit schuld!“ „Aber, aber, meine Liebe, ich kann doch nichts dafür, wenn die Kaiserlichen Ihnen die Hölle heiß machen...“ versucht Suworow zu beschwichtigen. Aber Karo läßt ihrer Wut jetzt doch etwas freieren Raum und faucht Suworow an: „Sie verdammter Bastard, Sie wissen genau, daß Sie uns haben hängen lassen! Machen Sie das eigentlich mit allen Alliierten so, Sie Arschloch?“ Mit einer schnellen Handbewegung zieht Karo ihre Pistole und zielt genau auf Suworows Kopf. Mit einem Schlag ist der Feldmarschall kreidebleich. „Feldmarschall, Sie wollten doch ‚Schimäre‘ unbedingt nach Fernost schicken. Bitte, tun Sie das! Wenn wir dann wenigstens von Ihnen in Ruhe gelassen werden! Ich gebe Ihnen genau zwei Wochen Zeit, dann lösen russische Truppen uns ab, oder wir marschieren so nach Osten und lassen ein Loch in der Front.“ „Das wagen Sie nicht!“ „Sicher?“ Die Wache an der Tür ist ebenfalls stocksteif stehengeblieben, ihre Hand wandert langsam zu ihrer Waffe. Karo grinst kalt – und drückt dann ab! Suworow zuckt zusammen und die Wache hat blitzschnell ihre Waffe in der Hand. Aber Karos Waffe macht nur ‚klick‘. Lachend steckt Karo die Knarre wieder ein. „Schönen Tag noch!“ wünscht sie dem Feldmarschall, dem der Angstschweiß auf die Stirn getreten ist. „Und bestellen Sie der Zarin Grüße.“ Sagt’s und wendet sich um; die Wache hat ihre Waffe wieder sinken lassen und blickt ziemlich ratlos Karo und Anja Karlinski hinterher, die erhobenen Hauptes den Raum verlassen. Als die Tür zugefallen ist, fragt die Wache: „Feldmarschall, soll ich...?“ „Die beiden festnehmen lassen? Nein. Aber erinnern Sie mich daran, daß wir die Frau General erschießen, sobald dieser Krieg vorbei ist.“ Der Tag hat ruhig begonnen. Ein mit den Widerständlern befreundeter Lebensmittelhändler hat am Morgen Gemüse, Fleisch und Getränke in dem kleinen Gasthof von Kandersteg angeliefert. Einen Teil davon hat Nicole Oertel sofort ins versteckte Depot einlagern lassen, das man in der nicht allzu weit entfernten Felsenburg eingerichtet hat, die oberhalb der Mitholz genannten Häuseransammlung liegt. Nachdem Aufbruch von Nicole Elsing Richtung Bludenz ist die Oertel eine von drei hochgestellten „Schimäre“-Agenten in dem Widerstandsnest; sie leitet quasi den vorgeschobenen Posten der Felsenburg. Lisa Kirchner hat die Gesamtleitung übernommen, während Sonja Berg die Leitung für den Flankenposten am Oeschinensee inne hat. Die direkte militärische Kommandogewalt über freilich hat momentan Stabshauptmann Dechamps, ein frankophoner Schweizer. So hat sich rund um Kandersteg, dem Rebellennest, eine Verwaltung fast wie in Friedenszeiten herausgebildet: Wenn es ruhig ist, so wie jetzt, hat das halb-zivile Trio Kirchner, Oertel, Berg das Sagen. Die vordringlichsten Aufgaben sind momentan Depots anlegen, einen Nachrichtendienst von Kandersteg aus aufzubauen und aus der ganzen Schweiz neue Rekruten für den Widerstand anzuwerben und auszubilden. Außerdem erteilen die drei Frauen Aufträge, die dann Dechamps mit seiner Truppe übernehmen muß: Wie etwa, kaiserliche Nachschubtransporte zu überfallen. Sollte Kandersteg aber angegriffen werden, so übernimmt automatisch Dechamps das Kommando – dann heißt es nämlich, Kampfentscheidungen zu treffen. Aber davon ist man bislang irgendwie weit entfernt, all die Mühe, nicht aufzufallen, hat sich bislang gelohnt. Bis jetzt. Sonja Berg sitzt an einem der Tische im Gasthof und ißt gedankenversunken ein paar Bratkartoffeln mit etwas Salat dabei. An einem der andern Tische sitzen zwei junge Frauen aus dem Ort und unterhalten sich nur ein wenig über „die gut aussehenden Soldaten“, die in letzter Zeit den Ort bevölkern und nur zur Tarnung in Zivil rumlaufen. Das die Eingangstür auf und zu geht, registriert Sonja zunächst nicht. Auf einmal steht die schlanke blonde Nicole Oertel etwas unsicher an ihrem Tisch. „Frau Berg?“ „Ja, was gibt’s?“ „Wissen Sie, wo Lisa ist?“ „Nur kurz was erledigen. Ich soll hier solange alles regeln.“ „Achso... Nun ja, wir haben eine Besucherin.“ Sonja dreht sich um und sieht an der Theke zwei Soldaten in Zivil mit geschultertem Karabiner stehen, zwischen denen eine hübsche, attraktive Frau mit rot gefärbten kurzen Haaren steht. „Wer ist das?“ fragt Sonja Nicole. „Angeblich die Frau von Herrn Hinkelmann. Sagt sie jedenfalls.“ antwortet Nicole. „Wo ist der denn?“ „Oben, in seinem Quartier.“ Sonja steht auf und geht rüber zu der Frau. „Wie heißen Sie?“ „Karin Hinkelmann.“ „Woher wußten Sie, daß Ihr Mann hier ist?“ „Er hat mich angerufen.“ Schnell wechselt Sonja vielsagende Blicke mit Nicole. „Scheiße.“ Und dann stürmt Sonja nach oben und hämmert heftig an Helges Tür. „Herr Hinkelmann, machen Sie bitte auf, es ist wichtig.“ „Moment!“ Nach ein paar Augenblick geht die Tür auf, Helge rückt kurz seine Brille zurecht und fährt sich nochmal mit der Hand durch sein kurzes, aber stets etwas verwirbelt wirkendes Haar. „Was fällt Ihnen ein?“ faucht Sonja ihn an. „Äh...wie...was...was denn?“ „Wie kommen Sie eigentlich dazu, von hier aus nach draußen zu telephonieren und unseren Standort auszuplaudern?“ Die sonst eigentlich eher ruhige Sonja wird nun doch für ihre Verhältnisse etwas laut. „Äh...ich wollte nur meine Frau sehen...“ „Sind Sie eigentlich noch zu retten, Helge? Ich hab auch einen Verlobten, aber ich besuche ihn, nicht er mich!“ „Wieso denn?“ „Verstehen Sie nicht? Die Kaiserlichen haben die Telephonzentralen weitgehend unter Kontrolle! Die haben wahrscheinlich mitgehört!“ „Helge!“ ruft Karin von der Treppe aus, als sie hochkommt. Helge kümmert sich nicht mehr weiter um die wütende Sonja, sondern eilt an dieser vorbei und nimmt seine Frau in die Arme. Sauer stürmt Sonja wieder die Treppe runter und zwingt sich, Ruhe zu bewahren. „Kommen Sie, Frau Oertel, wir müssen zu Dechamps. Wahrscheinlich wird es bald Ärger geben!“ Im einzigen Zwei-Sterne-Hotel des Örtchens Schaan im Fürstentum Liechtenstein hat die 9. Reichsarmee ihr Hauptquartier. Man hätte es auch im Schloß von Vaduz, wo der Fürst der kleinen Monarchie seinen Sitz hat, unterbringen können, aber Rauenfels hat das abgelehnt. Der Befehlshaber der 9. Armee wollte lieber in Ruhe arbeiten können. Von Schaan aus leitet er seit Ende September die Operationen der Armee in der Schweiz; die 9. Reichsarmee, bestehend aus Verbänden des Reichsheeres, der Gepo, der mailändischen und der französischen Armee, bildet die Besatzungstruppe für die Schweiz, die man in der ersten Septemberhälfte in einem Überraschungsangriff eroberte. Rauenfels gehört zu jenen Generälen, die mit Anfang 40 noch relativ jung sind und für das Oberkommando die nächste Kommandeursgeneration bilden, an die man hohe Erwartungen knöpft. Im Rheinlandfeldzug machte sich Rauenfels einen Namen, sein erfolgreicher Einsatz gegen die Schweiz mit nur knapp 60000 Mann hat seinen Ruf dann endgültig begründet. Seitdem ist es Rauenfels gelungen, das unwegsame Land mit inzwischen rund 85000 Mann ganz gut unter Kontrolle zu halten. Aber er weiß, daß „Schimäre“ Agenten eingeschleust hat und ein Minimum an Widerstand aufgebaut hat – Zwischenfälle und Sabotage gibt es alle paar Tage. Nichts aufregendes, aber Rauenfels schwant, daß sich das bald ändern könnte. Daher hat er Befehl gegeben, unablässig nach den Schlupflöchern des Feindes in den Bergen zu suchen. Aber heute wird erstmal gefeiert. Am Morgen ist die Depesche eingetroffen: Rauenfels ist zum Generalleutnant befördert worden. Und jetzt wird angestoßen. Im kleinen Konferenzraum des Hotels bittet Rauenfels zum Empfang. In aller Eile hat er einen Ordonnanzoffizier zwei Flaschen Sekt und ein paar Gläser bereitstellen lassen und dann die wichtigsten seiner Stabsoffiziere – insgesamt zehn Mann – zu sich gebeten. Jetzt ist man bei den obligatorischen Trinksprüchen und Gratulationen. Gerade versucht Rauenfels mit einem Korkenzieher die zweite Flasche aufzumachen, als ein Stabsoffizier der C-Abteilung für Feindaufklärung hereinkommt, salutiert und darum bittet, kurz den Herrn Generalleutnant sprechen zu dürfen. Rauenfels reicht Flasche und Korkenzieher an seinen Ia weiter und geht dann mit dem Stabsoffizier kurz ein paar Schritte zur Seite und spricht leise mit ihm. „Was gibt’s, Stabshauptmann?“ „Wir haben eine Spur der Widerständler. Eine der Personen, die vor kurzem in Zürich verschwunden sind, hat vor kurzem ein Telephonat mit einer Person im Reich getätigt und ihr einen Ort genannt. Und nun ja – wir konnten diese Person wirklich bis zu diesem Ort verfolgen.“ „Wie heißt dieser Ort?“ „Kandersteg, Herr Generalleutnant. Die Nummer 13 auf unserer Liste verdächtiger Ortschaften.“ Rauenfels grinst breit. „Wunderbar. Da haben wir ja noch einen Grund mehr zu feiern. Lassen Sie unserem Luftwaffenkommando mitteilen, heute abend soll Kandersteg bombardiert werden – und dann immer in der Dämmerung. In ein paar Tagen rücken wir dann mit Bodentruppen vor.“ „Zu Befehl, Herr Generalleutnant.“ Der Stabshauptmann nickt, salutiert und verläßt dann den Raum. Als Rauenfels zu der Gruppe zurückkehrt, reicht ihm sein Ia bereits ein Glas Sekt und fragt dabei: „Gabs was neues?“ „Ja.“ meint Rauenfels für seine Verhältnisse ungewohnt fröhlich. „Bald werden wir eines der Widerstandsnester ausräuchern können.“ Jetzt treffen allmählich die Truppen ein, die Philipp braucht. Gerade haben sie über dem Feuer einen Eintopf als verspätetes Mittagessen gehabt, als Fraker, der Wachdienst hat, den Besuch vorbeibringt. „Herr Kapitän!“ ruft er. „Hier ist jemand, der Sie sprechen will!“ Philipp stellt seinen Suppennapf ab und kommt aus der Bodenmulde hoch. Neben den Felsgraten steht Fraker mit drei Personen: Sabine Granrath, Chris Loewisch – beide so schön wie eh und je – und Philipps Bruder Dominik. „Hey, Bruder, alter Halunke!“ Dominik grinst breit. „Na, Bruderherz.“ Erfreut schlagen sich die beiden Männer gegenseitig auf die Schulter und dann meint Philipp: „Was macht Deine Verletzung?“ „Ach, halb so wild. Verheilt schon ganz gut.“ „Freut mich zu hören. Und was gibt’s sonst noch neues? Wißt ihr, wann weitere Verstärkungen eintreffen?“ „Ja.“ bestätigt Chris Loewisch und begrüßt Philipp dann auch erstmal, während Sabine erklärt: „Morgen oder übermorgen müßte Nicole Elsing mit einem kleinen Trupp hier eintreffen.“ „Wunderbar.“ freut sich Philipp. „Ok, dann kommt am besten mal alle mit.“ Er geht wieder zurück zum Lager. „Krammer, ein paar Ihrer Männer sollen Posten beziehen.“ „Zu Befehl.“ Krammer gibt seinen Leuten einen Wink. „Ihr habt es gehört.“ Dann folgen Krammer, Fraker, Jacke, Rambowicz, Granrath, Loewisch, Philipps Bruder und Diana dem Kapitän zu einem Unterstand im Wald, den Philipp und Fraker in mehrstündiger Arbeit zurechtgezimmert haben. Krammers Leute bilden unterdessen eine Vorpostenkette, der Rest von ihnen ist im Lager selbst geblieben. „Ich habe den Unterstand auf Befehl des Kapitäns angelegt, damit wir in Ruhe und trockenen Fußes planen können.“ verkündet Fraker und schlägt vor dem Eingang eine Plane zur Seite. „Ok Fraker, was haben Sie bislang für uns organisieren können?“ will Krammer wissen und geht als erster hinein. Hier unten hat Fraker alles Material gelagert, was bislang hat besorgen können: Karabiner, Pistolen, ein paar Handgranaten, etwas Dynamit, Kampfmesser, drei Säbel. „Schon recht beachtlich,“ meint Krammer. „Wenn wir noch das beisteuern, was wir haben, könnten wir damit einen Angriff wagen. Aber einnehmen können wir Schattenlagant wohl nicht.“ Er dreht sich um zu den anderen. „Kapitän, ich denke, es liegt in der Tradition von ‚Schimäre‘ nicht nur den General rauszuholen, sondern alle eventuell in Schattenlagant Inhaftierten. Oder?“ Philipp nickt langsam. „Ja, so hatte ich mir das gedacht. Sicher. Da brauchen wir noch mehr. Ich will ohnehin, daß jeder genügend Munition für eine Stunde Kampf und einen Säbel hat.“ „Wozu einen Säbel?“ will die Loewisch wissen. Marta erklärt es: „Schattenlagant wird von einer neuen Gepo-Einheit verteidigt, die Schwerter und Säbel einsetzt – mal abgesehen von ihren MPis.“ „Für jeden einen Säbel? Das wird aber schwer...“ sinniert Fraker. „Ich baue da ganz auf Ihr Organisationstalent, Hauptmann. Frau Schneider kann Ihnen dabei vielleicht helfen.“ „Is schon klar.“ „Außerdem hätte ich da noch eine Idee...“ meint Philipp und wendet sich seinem Bruder zu. „Dominik, Du hast ungefähre Vorstellungen von den Drachen, die Drachenflieger benutzen.“ „Jaaa...“ antwortet Dominik zögerlich. „Au weia, jetzt hat er wieder eine Idee.“ murmelt Jacke und verdreht die Augen. „Ja, ich hab eine...“ bestätigt Philipp und fährt dann fort: „Ok, Bruderherz, könntest Du Dir einen solchen Drachen vorstellen, der kleine Sprengprojektile verschießen kann?“ Kurz denkt Dominik nach, während ein paar der anderen die Stirn runzeln. „Du meinst Raketen?“ fragt Sabine schließlich, was Philipp mit einem Nicken bestätigt. „Jetzt dreht er endgültig durch...“ stöhnt Chris Loewisch. „Nein, nein...“ gibt sich Dominik nachdenklich; „ich glaube, ich weiß, was mein Bruder vor hat...Das könnte sogar klappen...“ Noch etwa eine halbe Stunde lang spielt man gemeinsam weitere Ideen durch und vervollständigt dabei die Liste der Materialien die man braucht; so braucht Dominik Material zum Bau von Raketen. Es müssen ja keine Meisterwerke sein – sie müssen nur ins Ziel treffen und explodieren. In Philipps Geist entsteht dabei auch allmählich immer mehr das Bild des perfekten Planes, um Schattenlagant zu erstürmen... Als sie zurück zum Lager gehen, nimmt er Sabine zur Seite. „Sabine, ich hab eine erfreuliche Nachricht für Dich.“ „Ach ja, was denn?“ „Sieh mal da drüben.“ Als Sabine in die Richtung schaut, in die Philipp zeigt, sieht sie bereits Heike, ihre beste Freundin, auf einem Baumstumpf sitzen; sie winkt herüber. „Sie hat grad Wachschicht?“ fragt Sabine. Philipp nickt. „Na gut.“ meint Sabine. „Dann helf ich ihr dabei.“ Sie nickt Philipp nochmal zu und läuft dann rüber zu Heike. „Halten die jetzt ihr Kaffeekränzchen ab?“ fragt Jacke plötzlich hinter Philipp. Der nickt und dreht sich um. „Ja. Die beiden haben sich länger nicht gesehen.“ Es geschieht gegen 19 Uhr 30 abends, bei schon fortgeschrittener Dämmerung. Der Reiter, der nach Kandersteg gesprengt kommt und die Fliegerwarnung brüllt, ist nicht wirklich schneller als die Ju88, die über den Ort herfallen. Schon dröhnt der Motorenlärm durch das Tal. Im Gasthof hat Lisa den Schrank hinter der Theke aufgeschlossen und wirft Sonja Berg einen Karabiner zu, lädt einen eigenen durch. Wer weiß, ob nicht auch noch Bodentruppen anrücken. Zwei weitere Karabiner legt Lisa auf die Theke. „Nach oben damit. Die beiden können ruhig bei der Verteidigung helfen.“ Sonja nickt, schultert den eigenen Karabiner, schnappt sich die beiden anderen und rennt dann die Treppe rauf. Von draußen hört man Rufe und die Kirchenglocke läutet das Signal für „Fliegeralarm“ (die Alarmsirenen gibt es nur in größeren Ortschaften und Städten). Mit aller Kraft hämmert Sonja zum zweiten Mal an diesem Tag gegen die Zimmertür von Helge Hinkelmann. Seine Frau Karin reißt im Bademantel die Tür auf. „Was ist denn?“ schnappt sie ungehalten. „Fliegeralarm. Vielleicht auch heute Nacht ein Bodenangriff. Wenn sie beide heute einen romantischen Abend wollten, dürfte der hiermit gestrichen sein.“ stellt Sonja so lapidar fest, daß Karin erstmal nur sprachlos ist und die Karabiner widerstandslos entgegennimmt. Helge kommt jetzt endlich dazu. „Was ist denn hier los?“ fragt er total verwundert. „Sie dürfen bei der Verteidigung helfen, Hel-...“ setzt Sonja an. Da kracht es mehrfach laut, die Erden bebt, Karin verliert das Gleichgewicht und Helge kann sie gerade noch auffangen, irgendwas klirrt, während Sonja sich am Türpfosten festkrallt. Jetzt hört man auch die Motoren ohrenbetäubend laut, immer wieder kracht es jetzt. Sonja lädt ihren Karabiner durch und entsichert ihn und rennt damit runter. „Zieh Dich an!“ sagt Helge kurzentschlossen zu seiner Frau, schnappt sich einen der Karabiner und lädt ihn ebenfalls durch, folgt Sonja nach unten. Von draußen ertönen laute Rufe und Schreie, erst jetzt fällt Helge auf, daß die Lichter überall aus sind – Verdunkelung. Als er unten ankommt steht er dann doch in hellem Licht – durch die Fenster der Gaststätte sieht er flackerndes weißes Licht, vor dem sich Schatten wild hin und her bewegen, manchmal scheint es, als wandere das Licht, das unglaublich grell ist. „Was ist das?“ „Christbäume.“ erklärt Lisa, die hinter der Theke eine Kiste mit weiterer Munition aufgemacht hat und die Munition nun an Sonja und hereinkommende Soldaten verteilt. „Was?“ Helge kapiert nicht. „Christbäume.“ wiederholt Sonja nochmal und wirft ihm ein kleines Patronenpäckchen zu, das er auffängt. Dann fährt sie fort: „Leuchtbomben, die die Flieger zur Beleuchtung der Ziele abwerfen. Wurde letztes Jahr erstmals sporadisch von den Schweden über Dänemark verwendet, seit anderthalb Monaten wird das Verfahren massiv von beiden Seiten in der Luftschlacht über dem Ärmelkanal eingesetzt.“ „Ich nehme an, das ist jetzt ganz schlecht für uns.“ „Bemerkenswerte Feststellung.“ Lisa versucht nicht, ihren Sarkasmus zu verbergen. Sie ist viel zu sehr damit beschäftigt, die in ihr allmählich doch aufkeimende Panik zu verbergen. Schon ist Sonja auf dem Weg zur Tür, da donnert die nächste Welle Flugzeuge über den Ort hinweg. Und dann kracht es. Die Druckwelle läßt die Fenster platzen, ein Scherbenregen ergießt sich in den Raum. Sonja hat gerade die Tür aufgemacht, wird jedoch zu Boden geschleudert. Karin kommt eben die Treppe runter – inzwischen hat sie sich eine Hose und einen Pullover übergezogen – und will wissen, was los ist, da packt Helge sie am Arm und zieht sie mit nach unten und unter die Treppe. Instinktiv. Und vor allem gerade noch rechtzeitig, denn dann gibt es einen lauten Knall und ein ohrenbetäubendes Getöse, schlagartig wird es finster und die Luft ist auf einmal voller Rauch, Staub und umherfliegender Einzelteile, von irgendwoher kommen Schreie und schwere Schläge lassen den Boden so schwer erbeben, daß Helge, Karin und die andern hin und her geworfen werden... Montag, der 20. Oktober Ob man es glaubt oder nicht – Schwarz ist nicht unbedingt gleich Schwarz. Es gibt feine Nuancen. Denn noch schwärze als die Nacht ist die Schwärze einer verdunkelten Küste. Zumindest erscheint es Sandro so, als er über den Bug der Roberto hinweg dorthin starrt, wo Genua sein müßte. Hin und wieder blinkt ein rotes Signal an der Küste auf, mit dem die Schiffe auch bei Nacht hereingelotst werden. Einer der Matrosen taucht neben Sandro auf und stellt zwei leere Kisten, in denen Taucherausrüstung war, ab. „Wie weit noch?“ fragt Sandro. Der Matrose schaut rüber zu der massiven Schwärze und meint dann: „Vielleicht noch drei Kilometer.“ Zuckt die Achseln und verschwindet unter Deck. Irritiert schaut Sandro ihm nach und dann wieder zur angeblichen Küste hinüber. „Woher weiß der das?“ „Woher weiß er was?“ meint Danko auf einmal, der vom Heck herüberkommt. „Ach nichts.“ knurrt Sandro. „Hast Du ne Ahnung, wie es jetzt weitergeht?“ Danko zündet sich eine Zigarette an und antwortet dann: „Naja. Grieco hat nen Plan.“ Irgendwo von Steuerbord hört man nun rasch hintereinander etwas ins Wasser fallen. „Was ist das?“ Sandro will schon nachsehen, aber Danko hält ihn zurück. „Keine Aufregung. Das sind nur Griecos Männer, die den Rest des Weges zum Hafen tauchen, um dann überraschend anzugreifen.“ „Toll. Und wie sollen wir aus dem Schlamassel rauskommen?“ „Wir werden vor den Tauchern da und auch schnell wieder weg sein. Meinte zumindest Grieco.“ Danko zieht ein paar Mal tief und geht dann wieder unter Deck. Er will sich die Einsatzbesprechung anhören, die Grieco für die anderen seiner Soldaten angesetzt hat. Unten im Gang sieht er gerade noch den letzten Soldaten in dem Besprechungsraum verschwinden, also beschleunigt er seinen Schritt und huscht schnell in den Raum hinein und lehnt sich hinten an die Wand. Grieco hat gerade eine Karte von der Region um Genua an die gegenüberliegende Wand gehangen, dreht sich um und meint dann: „Leute, unser Gast beehrt uns doch mal.“ Alle schauen nach hinten zu Danko, der sich auf einmal etwas fehlamplatz vorkommt und grinsen breit. Erst jetzt fällt Danko auf, daß auch zwei Frauen mit dunklen Haaren – eben reinrassige Italienerinnen – in dem Trupp befinden. Sonst laufen sie immer mit Mützen rum, ihre Haare sind kurz – so fällt es nicht so sehr auf, daß es sich um Frauen handelt. Zumindest nicht, wenn der Feind das Schiff nur oberflächlich unter die Lupe nimmt. Grieco hält seinen Einsatzvortrag in Englisch ab: „Also, die Operation läuft folgendermaßen ab: Stoßtrupp A ist bereits mit 12 Tauchern unterwegs. Wir werden gut zweieinhalb Stunden vor den Tauchern da sein. Auftrag von Trupp B mit 8 Kämpfern ist es, sich unauffällig im Hafen zu verteilen und bei Zielobjekten an Land zu postieren. Die Taucher werden den Angriff gegen die Schiffe durchführen, Trupp B sprengt dann in der allgemeinen Verwirrung zusammen mit eintreffenden Tauchern die Objekte an Land. Anschließend sofortiger Rückzug ins Hinterland. Dort hat der savoyische Widerstand hat in Masone Verstecke vorbereitet. Dort werdet ihr alle den morgigen Tag verbringen. Nächste Nacht dann marschiert ihr wieder zur Küste, wo zwei große britische Flugboot, die von Mallorca aus operieren werden, euch bei Cogoleto aufnehmen und zurück zu den Balearen bringen werden. Vier von euch werden zusammen mit mir unsere Gäste ins Hinterland schmuggeln und bis nach Bludenz begleiten. Da diese Operation relativ plötzlich ansteht, wird sie nur improvisiert durchgeführt werden können. Ich werde sie zusammen mit General Popovic persönlich leiten. Sonst noch Fragen?“ Die Soldaten sehen sich an und schütteln dann den Kopf. „Ok, dann wäre ja alles klar. Wir werden in einer halben Stunde in Genua eintreffen. Macht euch bereit.“ Danko schaut nochmal auf die Uhr. Viertel vor eins. Es ist dann schließlich doch erst halb zwei, bis die Roberto an Pier 14 im Hafen von Genua anlegt. Als Grieco als erster von Bord geht, kommt ihm bereits ein Beamter des Hafenamtes in Begleitung eines Gendarmen vom Zoll entgegen. Am Ende der Gangway unterhält sich Grieco kurz mit den beiden und zeigt ihnen die auf einer Klade festgeklemmten Papiere. „Ist die Fracht angemeldet?“ fragt der Zollbeamte. „Ja, sicher.“ erwidert Grieco. „Angemeldet, eine Lagerhalle ist gemietet und eigentlich sollte der Zoll schon im voraus gestellt worden sein. Ist eine langfristige Bestellung.“ „Verstehe.“ erwidert der Beamte. „Wann möchten Sie entladen?“ „Morgen früh am besten. Meine Mannschaft ist müde, weil wir nur knapp einem U-Boot entkommen sind. Ein Teil hat um Landurlaub gebeten, der Rest will schlafen.“ „In Ordnung. Hier haben Sie einige Pauschalpassierscheine für die Männer, die Landurlaub haben.“ „Danke.“ Grieco nimmt einen Stapel Papiere entgegen. Dabei haben sie eh gefälschte dabei. Der Zollbeamte macht ein Häckchen auf der Klade. „Da wäre noch etwas...“ setzt Grieco vorsichtig an. Bislang ist der Beamte genauso lasch, wie die Genueser Beamten fast immer gewesen sind; das scheint sich durch den französischen Einmarsch nicht geändert zu haben. Hoffentlich bleibt das so. „Ja, was denn?“ fragt der Beamte vom Hafenamt. „Wir unterwegs zwei feindliche Schiffbrüchige aufgelesen, zwei Frauen.“ „Welche Nationalität? Spanisch, Neapel, britisch, osmanisch...?“ „Keine Papiere, leider. Aber sie sprechen nur Englisch, also dürfte es britisch sein.“ „Können Sie selber Männer zur Bewachung abstellen?“ „Ja.“ „Ok.“ meint der Zollbeamte, „dann bringen Sie die beiden Frauen bitte zur Stadtkommandantur. Wir lassen in einer halben Stunde hier einen Laster vorfahren.“ „Na wunderbar, danke!“ gibt sich Grieco erfreut, was noch nichtmal so sehr geschauspielert war. Denn die Stadtkommandantur ist irgendwo außerhalb des noch am strengsten kontrollierten Hafens. War man hier erstmal raus, kann man auch die Stadt verlassen und die Flatter machen. Bis die Gegenseite merkt, daß die Gefangenen nur ein Vorwand waren, dürfte man selber längst irgendwo in Tirol sein. Grieco eilt zurück unter Deck. Dort warten bereits vier seiner Leute, Danko und Sandro – alle mit Gewehren ausgestattet (nicht mit Sturmgewehren, das würde auffallen, da „Schimäre“ die einzige komplett mit Sturmgewehren ausgerüstete Einheit beiderseits der Front ist!). Zwischen ihnen stehen die beiden Frauen. Alle haben keinerlei Rucksäcke oder Taschen dabei – alles was man noch brauchen wird, wird man sich unterwegs organisieren müssen. Nur etwas Geld in der richtigen Währung hat man und ein paar Passierscheine. „Ok, alles klar. Sie stellen uns sogar einen Lastwagen.“ erklärt Grieco. „Wir müssen dann schnellstmöglich abhauen. Alles klar soweit?“ Alle nicken. „Na super. Aber immer dran denken: Es muß schnell gehen. Wenn alles klappt, sind wir übermorgen in Bludenz. Oder tot.“ Dieser letzte Zusatz läßt Brigitte frösteln, was Clarissa sofort merkt. Vorsichtig legt Clarissa ihre Hand auf Brigittes Schulter und merkt wie die Ägyptologin zusammenzuckt. All die verwirrenden Ereignisse sind so schnell auf Brigitte eingestürzt, daß sie bislang kaum Zeit hatte, ihre Gedanken vernünftig zu ordnen. Clarissa versucht ihr jetzt klarzumachen, daß die Tarnung perfekt sein muß: „Brigitte, wir beide müssen jetzt unsere Hände fesseln lassen. Das ist bei Gefangenentransporten in kleinem Maßstab so Praxis. Also jetzt bitte nicht erschrecken. Ok?“ Keine Reaktion. „Ok?“ Brigitte nickt schließlich. „Ja, ja, in Ordnung.“ Sandro hat die Stricke bereits in der Hand und fesselt nun die Arme der beiden Frauen auf deren Rücken. Bei beiden allerdings nicht zu fest. „General Popovic, wie gut können Sie Italienisch?“ fragt Grieco. „Geht so.“ Grieco macht eine Grimasse. „Na dann halten Sie jetzt gleich besser die Klappe.“ „Tjaaa...in Ordnung.“ Und dann nehmen alle Aufstellung und folgen Grieco wieder runter vom Schiff zum Pier. Dort wartet tatsächlich schon ein Laster. Daneben wartet ein Polizist. Während Brigitte und Clarissa zusammen mit ihren Bewachern hinten auf die überdachte Ladefläche klettern und nur Sandro noch draußen stehen bleibt, will Grieco alles klar machen. „Kann einer meiner Männer fahren?“ fragt er. Der Polizist runzelt die Stirn. „Sie kennen doch gar nicht den Weg.“ „Haben Sie eine Karte?“ fragt Grieco. Der Polizist klettert kurz ins Führerhaus, flucht, als er sich irgendwo stößt und holt dann einen Stadtplan hervor. Er deutet auf ein Stadtviertel. „Hier, direkt an einer der Hauptstraßen. Kaum zehn Minuten von hier.“ „Ah ja, alles klar. Das können wir selbst finden.“ „Na gut. Aber verlieren Sie bloß die Gefangenen nicht.“ „Kein Gedanke.“ meint Grieco grinsend, „hab schließlich auch mal in der Armee gedient.“ Das scheint dem Polizisten dann doch etwas mehr Vertrauen einzuflößen, jedenfalls fragt er nicht danach, welche Armee Grieco meint. „Tja, dann fahren Sie bloß schnell ab.“ Der Polizist – offensichtlich froh, mit diesem unvorhergesehenen Fall nichts mehr zu tun zu haben. Grieco winkt Sandro zu: „Sie fahren.“ Sandro nickt und klettert auf der Fahrerseite ins Führerhaus, Grieco auf der Beifahrerseite. „Haben Sie die nötigen Papiere, Grieco?“ „Ja, hab ich. Und jetzt fahren Sie! In vielleicht einer Stunde oder anderthalb geht hier die Show los.“ Im Rückspiegel sieht Grieco, wie sich seine Leute, die vorgeblich Landurlaub haben, unauffällig auf dem Hafengelände verteilen. Schon gibt Sandro Gas – aber noch nicht zuviel, man will ja nicht auffallen. An der Passierstelle einer Ausfallstraße aus dem Hafen schauen die Beamten kurz auf die Papiere, werfen einen Blick auf die Ladefläche, wo ihnen die vermeintlichen Bewacher freundlich zuwinken und geben dann die Zustimmung für die Weiterfahrt. „Und jetzt raus aus der Stadt, über ein paar Seitenstraßen.“ befiehlt Grieco. Eine halbe Stunde später sind sie tatsächlich raus. Über eine Landstraße fahren sie zwischen brach liegenden Weinbergen nach Norden, um viele Kurven in dem hügeligen Gelände herum. Gerade als der Blick auf das verdunkelte Genua erstmals durch einen Hügel vollständig verwehrt wird, hören Brigitte, Danko und die andern auf der Ladefläche das dumpfe Grollen der Explosionen – der Raid gegen den Hafen ist offenbar gelungen. In der Tat können Griecos Männer bei Eigenverlusten von nur 3 Mann zwei Öldepots, drei Lagerhallen und eine Flakstellung sprengen, die Taucher versenken oder beschädigen sieben Frachter und ein Torpedoboot. Aber das wird Grieco erst viel, viel später erfahren; und Danko – nun, den interessiert das eigentlich nicht wirklich. Die Flieger sind weg, es ist finster und die einzigen Lichtquellen sind ein paar allmählich verlöschende Taschenlampen und die etwas langlebigeren Petroleumlampen. Ein paar Soldaten haben auch einfach selbst gebastelte Fackeln angeschleppt. Im Lichtschein sieht man langsam erste Schneeflocken fallen. Noch bleibt der Schnee aber nicht liegen. Immer noch zittrig sitzt Helge Hinkelmann auf einer Pritsche in einem Zelt, das die Widerstandskämpfer unter einem Baum aufgebaut haben. Ihn und seine Frau Karin haben die Rettungstrupps, die Dechamps selbst kommandiert, eben erst aus den Trümmern des größenteils zerstörten Gasthofgebäudes gezogen. Beide haben nur Schrammen und Prellungen abgekriegt, wie durch ein Wunder, Helges Brille ist zerknackst. Aber ansonsten geht es beiden gut. Nicole Oertel freilich hat ihm vorbeigehen Helge böse Blicke zugeworfen. Er wollte etwas sagen, aber Karin hat ihm nur zugezischt: „Jetzt sag nicht wieder ‚Paperlapap, ist doch alles kein Problem‘!“ Die Oertel war schon wieder in der Dunkelheit verschwunden und Helge hat alles runtergeschluckt. Denn Karin hat recht: Jetzt stecken sie wirklich in der Scheiße. Zwei Widerständler sind bereits tot unter den Trümmern der zusammengefallenen Fassade gefunden worden. Vier anderen sind in andern Teilen des Ortes direkt von den Bomben getötet worden. Einer der Sanitäter kommt vorbei und bringt den beiden einen warmen Tee. Dann eilt der Mann weiter, um die gut ein Dutzend weiteren Verletzten zu versorgen, die in weiteren Zelten am Ortsrand untergebracht sind. Langsam schlürft Helge seinen Tee. Plötzlich steht er auf. „Schatz, was hast Du vor?“ wundert sich Karin, der alle Knochen wehtun. „Ich werd helfen.“ bemerkt Helge trocken und marschiert dann rüber zu den Rettungsmannschaft. Die haben gerade wieder jemanden entdeckt. Wild kläffen die beiden Hunde Kim und Kimba einen Spalt in den Trümmern an, ein Soldat in Zivil leuchtet mit der Lampe hinein und brüllt dann auf Deutsch mit Schweizer Akzent: „Hey, hab Frau Kirchner gefunden! Und sie lebt noch!“ Schweißgebadet wacht Gephardt in seinem Quartier auf. Seine Hand tastet hektisch nach der Nachttischlampe und schaltet sie ein. Leicht gelbliches Licht erhellt den Bereich um sein Bett und seinen Spint. Schweratmend läßt sich Gephardt wieder zurück aufs Kissen sinken und wischt sich mit einem Arm den Schweiß von der Stirn. Schon seit Tagen schläft er schlecht, aber dieses Mal war es besonders extrem. Ein irrer Traum. Er hatte allein inmitten einer weiten, kahlen Ebene gestanden und war umringt von zigtausenden Krähen und Raben, die ihn irgendwie bedrohlich anstarrten und nach und nach näherrückten. Irgendwo aus der Ferne schien ein stetes Gemurmel zu kommen. Gephardt drehte sich um seine eigene Achse und verlor beinahe das Gleichgewicht. Plötzlich teilte sich auf der einen Seite das Heer der Krähen und eine schlanke, schöne Frau in einem langen schwarzen Kleid kam näher, die er schließlich als Petra Müller erkannte. Drei Meter vor ihm blieb sie stehen, in ihren Augen loderten kleine orangene Flammen. Und auf der anderen Seite teilte sich das Heer der Raben und ein kräftig gebaute Mann in voller dunkelgrüner Uniform kam bis auf drei Meter heran – General Reiss. Knurrend zog er eine Grimasse, bis Gephardt die kräftigen Eckzähne des Generals, die ein wenig wie Fangzähne wirken, sehen konnte. Fast gleichzeitig heben Petra und Reiss den linken Arm und die Vogelschwärme erheben sich in den grauen Himmel und verdunkeln ihn. Gephardt wurde hier klar: Er wurde von den Raben beschützt und sie von den Krähen. Dann hoben beide auch den rechten Arm und die Raben und Krähen stürzten sich auf Gephardt. Den Schmerz spürte er richtig körperlich; und in den letzten Sekunden des Horrors, bevor er endlich aufwachte, konnte Gephardt endlich das Gemurmel verstehen: „Freiheit! Freiheit! Freiheit!“ „Die Kaiserlichen dachten, sie hätten mit der Gefangennahme von Reiss, dem Schlag gegen den Kölner Widerstand und dem Großangriff auf Jakovlevo einen großen Wurf getan. Aber nicht nur, daß aus Köln praktisch alle Widerständler entkamen und „Schimäre“bei Jakovlevo siegte. Nein, die kaiserliche Führung unterschätzte auch in einer nicht zu verzeihenden Weise die Fähigkeit der Gegenseite, irreguläre Raids aus dem Stand heraus zu improvisieren und eine Niederlage doch noch in einen Sieg zu verwandeln. Dieser Umstand sollte sich als verhängnisvoller Rückschlag für die Koalition insgesamt erweisen...“ Auszug aus: „Official history of the Great War“, herausg. vom Office of War [Kriegsministerium], London, Mai 1800,Band 2, Kapitel 6 (The operations in the second war-winter: an analysis) Ihre Flucht vor der Inquisition hat sie durch quer durch Norditalien geführt. Jetzt ist Denise Cassim in Binasco gelandet, kurz vor Mailand. Dämlicherweise hat sie das Mailänder Gebiet erst kurz nach Abschluß eines neuen mailändisch-kaiserlich-päpstlichen Abkommens erreicht, daß es der Inquisition ermöglicht, auch rund um Mailand so richtig zuzulangen. In fast allen Ortschaften verschwinden jetzt Menschen und landen wenig später auf den Scheiterhaufen. Und in Binasco ist auch Cassims Flucht zu Ende gegangen. Sie hatte in einem Gasthof übernachtet und die Inquisition hat sei bei einer Routinekontrolle aufgestöbert. Immerhin: In Florenz hatten die Inquisitoren genug Beweise gefunden, um gleich mehrere Anklagepunkte gegen sie zu erheben: Spionage, Sittenlosigkeit (was Denise als totalen Quatsch empfindet) und – unter anderem wegen einiger gefundener Tarot-Karten, die ihr Petra vor Jahren geschenkt hatte – Hexerei. Da für die Inquisition die Sache klar ist und im Gegensatz zu den Hexenverbrennungen im Mittelalter bei diesen Säuberungen ein Geständnis nicht mehr unbedingt nötig ist, erspart ihr das immerhin die Folter. Auch gut. Jetzt wird sie über die Hauptstraße geführt. Vor ihr, vielleicht noch hundert Meter, liegt der große Marktplatz. Zwei Scheiterhaufen brennen bereits, mit Knebeln hat man die beiden Delinquenten am Schreien gehindert, jetzt fackeln die Leichen langsam ab. Verbrannt wurden die beiden Kommunisten wegen dem Vorwurf der Gottlosigkeit. Der stechende, süßliche Geruch weht Denise bereits um die Nase. Die Straße ist gesäumt von Menschen, die schweigend zu sehen, wie die bis an die Zähne bewaffneten, militärisch auftretenden Inquisitoren die Frau zu ihrer Exekution führen. Keiner jubelt, gröllt oder wirft wüste Beschimpfungen aus. Die Zeiten sind längst vorbei; in der Bevölkerung ist inzwischen das latente Bewußtsein gewachsen, daß diese Inquisition vor allem als Terrorinstrument des Systems dient, um sich selbst die Macht zu erhalten. In der Menschenreihe stehen schweigend Marco Grieco, Danko Popovic und ihr Trupp. Es ist Nachmittag und sie haben im Morgengrauen erst einen neuen Laster in Voghera organisieren können – und dazu neue, zivile Klamotten. Danko steht in einer etwas abgetragenen alten Lederjacke neben Grieco, der einen ebenso abgetragenen grauen Mantel an hat und murmelt: „Verdammt, das können wir nicht zulassen. Wir müssen etwas unternehmen...“ „Und was?“ zischt Grieco zurück. Sie hatten nicht genug Waffen und nicht die Zeit. Eine große Überraschung allerdings macht jede weitere Diskussion unnötig. Auf einmal springen aus der Menge am Marktplatz vermeintliche Zivilisten mit Gewehren in den Händen und mit Pistolen. In raschem Zugriff entwaffnen sie die überrumpelten Inquisitoren und feuern dabei Warnschüße in die Luft ab. Alles ist zunächst wie erstarrt. Dann gehen die ersten Bewacher von Denise Cassim in Stellung, Gewehr in Anschlag und eröffnen das Feuer auf die überraschenden Angreifer. Die unbeteiligten Zivilisten rennen schreiend weg, während die Angreifer das Feuer erwidern. Plötzlich liegt der erste Mensch sich vor Schmerz windend im eigenen Blut auf dem Straßenbelag. Danko und Sandro schnappen sich Clarissa und Brigitte und ziehen sie schnell in eine Seitenstraße – gerade noch, bevor Querschläger in die Hauswände peitschen. Denise Cassim reißt sich von ihrem direkten Bewacher los, tritt ihm vors Schienbein und schubst ihn zur Seite. Im selben Moment hört Grieco, wie der offenbare Anführer der Angreifer „Liberté!“ brüllt und sieht wie dessen Männer vorstürmen, um die Inquisitoren endgültig aufzureiben. Grieco brüllt seinen Leuten zu: „Los! Auf sie!“ Auch seine Leute haben verstanden. „Liberté!“ brüllen im Kampf nur die Kämpfer der Fleur-Division. In Sekundenschnelle sind Griecos Kämpfer bei den Inquisitoren, die einmal mehr überrumpelt sind und schlagen sie nieder. Einer läßt die Waffe fallen, als ihm Grieco selbst ein Messer an den Hals hält. Cassims Bewacher freilich macht nochmal Ärger, als er sich wieder aufrappelt und mit seiner Pistole auf die Cassim zielt. Einer von Griecos Männern kann gerade noch Denise zur Seite schubsen und wird selbst von der Kugel getroffen. Mit einem Aufschrei geht er zu Boden. Und jetzt greifen auch die bislang unbeteiligten Dorfbewohner ein, treten dem letzten Inquisitions-Kämpfer die Waffe aus der Hand, reißen ihn hoch und klatschen ihn an die Hauswand, die Menge schlägt auf ihn ein. Denise Cassim kriecht zu ihrem Retter rüber, flüstert die ganze Zeit: „Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott...“ Der Soldat hält sich die heftig blutende Seite, das Blut pulst über seine Hand. „Mein Gott...Danke!“ brüllt Denise unter Tränen. Rüttelt an der Schulter des Mannes, aber der rührt sich nicht mehr. Grieco reißt Denise an einem Arm hoch. „Kommen Sie! Sie können ihm nicht mehr helfen!“ Der Soldat – Obergefreiter Da Vicci – ist längst tot. Außerdem heißt es jetzt, schnell die Flatter zu machen. Jeden Moment kann die Situation endgültig eskalieren. Grieco und seine Männer bringen die Frau durch eine Seitengasse weg vom Ort der Schießerei. Die Männer der FleurDivision folgen sichernd nach und zwei von ihnen nehmen auch den Leichnam von Da Vicci mit. Zwei Straßenzüge weiter stürmen aufgebrachte Dorfeinwohner die Polizeiwache, aus der der örtliche Kommandant der Inquisitioren flüchten muß. Jetzt steigen hier die Rauchwolken auf. Standartenführer Jörg Oschmann wartet bereits seit zehn Minuten in dem Büro im Hauptverwaltungsgebäude der Roßauer Kaserne in Wien. Seit drei Jahren ist hier die Befehlszentrale der Kaiserlichen Geheimpolizei. Helldrich hat Oschmann hierher bestellt und läßt ihn nun warten. Immerhin ist der mit schwarzem Leder beschlagene Holzstuhl nicht unbequem; die Büroeinrichtung ist leider sehr zweckmäßig gehalten – Aktenschrank, Schreibtisch, ‚Stummer Diener‘ – und daher nichts fürs Auge. Die einzigen aus dem Rahmen fallenden Gegenstände sind ein Bild des Kaisers an der Wand und ein Photo von Helldrichs Familie auf seinem Schreibtisch. Die Tür wird hektisch aufgerissen, als Helldrich reinkommt. Einen Moment hält Helldrich inne, atmet tief durch und schließt die Tür dann ganz leise. „Entschuldigen Sie, daß Sie warten mußten, Standartenführer.“ Oschmann ist aufgestanden, salutiert und dann geben sich die beiden die Hand, bevor Helldrich sich hinsetzt. „Ich hab leider viel zu tun. Die Rebellen in Siebenbürgen haben in der letzten Woche mehrere unserer Stützpunkte angegriffen und ich mußte ein paar Kommandanten persönlich zusammenscheißen, damit die Säuberungsaktionen vorankommen.“ „Reichsführer, Sie haben mich doch nicht hergebeten, nur um mir Ihr Leid über die Unbelehrbarkeit ungarischer und rumänischer Rebellen zu klagen.“ bemerkt Oschmann. Mit betrübter Miene schaut Helldrich ihn an. „Sie haben recht.“ Wieder macht er eine Pause und stößt einen Seufzer aus. „Siebenbürgen ist nicht die einzige unruhige Region. Auch im Reich selber brodelt es.“ „Das ist nichts neues. Aber ich dachte seid den Ereignissen in Köln wäre endlich Ruhe.“ „Eben nicht. Und es liegt wahrscheinlich genau daran, daß wir Reiss geschnappt haben.“ „Wie meinen?“ „Es hat Ärger in Nürnberg gegeben. Wir haben dort in den letzten beiden Nächten mehrere Razzien gegen die Gothic-Szene durchgeführt.“ „Wieso das denn?“ „Kipshoven ist am Freitag dort gewesen und hat Kontakte zur Gothic-Szene geknüpft, um Hilfestellung für Reiss‘ Rettung zu bekommen. Und er hat sie nach den Aussagen, die wir herausquetschen konnten gekriegt.“ „Ach deswegen haben Sie soviel zu tun...“ kapiert Oschmann endlich. „Ja, genau.“ bestätigt Helldrich. „Wir haben inzwischen deutliche Hinweise darauf, daß die Gothic-Szene ebenfalls Köln weitgehend geräumt hat und sich auf den Rest des Reiches verteilt hat. Mehrere in Köln bekannte Mitglieder dieser Kreise haben wir in Nürnberg festnehmen und verhören können. Wir haben sie erstmal ins Lager geschickt. Aber einige hab ich persönlich bis eben noch verhört.“ Oschmann räuspert sich und deutet mit einem Finger auf Helldrichs Uniform. „Was ist?“ „Ein Fleck, Reichsführer.“ Helldrich sieht an sich herunter und wischt einen kleinen dunkelroten Fleck an seiner Uniform weg. „Danke...worauf ich hinaus will, Standartenführer: Offenbar schließen sich die Gothics endgültig dem Widerstand an. Das alte Arrangement der neutralen Duldung ist vorüber.“ Jörg stößt einen Seufzer aus. „Was geht mich das an? Was hat das mit einem Rettungsversuch in Sachen Reiss zu tun?“ „Einige der Gothics haben nach stundenlangem Verhör dann doch angedeutet, daß Kipshoven weiß, wo Schattenlagant ist.“ „Das ist unmöglich!“ stößt Oschmann hervor. „Mensch, Standartenführer, haben Sie nicht selbst erlaubt, daß zwei Personen aus diesen Kreisen Schattenlagant betreten haben?“ „Ja, aber wir haben versucht es so zu machen, daß sie nichts weitergeben konnten. Sie sind ja seitdem nicht weggewesen. Und sobald die Sache mit Reiss erledigt ist, erledigen wir die beiden.“ Das hat sich Jörg Oschmann schon fest vorgenommen. Diesen mysteriösen Ben würde er aufhängen lassen und für Petra Müller – nun ja, für die würde er sich was ganz besonderes einfallen lassen... „Na gut...“ gibt sich Helldrich auf einmal wieder versöhnlicher. „Immerhin bin ich mir sicher, daß Sie das wieder in Ordnung bringen werden. Bislang haben Sie ja immer einigermaßen akzeptable Ergebnisse abgeliefert.“ „Das kommt daher, daß ich immer viel riskiere.“ „So wie Ihr Auge?“ Helldrich deutet auf Oschmanns Augenklappe. „Genau. So wie mein Auge.“ Nach dem Aufruhr in Binasco sind sie alle weiter nach Norden geflüchtet, zusammen mit den Kämpfern von der Fleur-Division; auch diese hatten sich ein paar Laster organisiert. Sobald sie sicher waren, daß ihnen niemand mehr an den Fersen klebte – die mailändischen Regierungstruppen und eine in Pavia stationierte Inquisitionseinheit waren und sind immer noch viel zu sehr damit beschäftigt, Binasco in Schutt und Asche zu verwandeln und die Männer des Dorfes abzuschlachten, die Frauen zu verschleppen (was man dann verschleiernd Repressalie nennt) - , hatten sie kurz in einem Wäldchen nördlich von Mailand gerastet. Bei dieser Gelegenheit konnte Grieco zusammen mit Popovic mit dem Anführer ihrer unverhofft aufgetauchten Verbündeten sprechen. Wie sich herausgestellt hat, ist es Colonel Vaultier, Befehlshaber des 1. Para-Commandement de la Fleur-Division. „Wir sind unterwegs um Reiss zu helfen, wissen aber nicht genau, wo wir ansetzen sollen.“ hat Vaultier ihnen erklärt. Und Grieco hat erwidert: „Wir sind unterwegs nach Bludenz. Kapitän Kipshoven hat alle, die bei einer Rettungsaktion helfen wollen, dorthin beordert.“ Da hat Vaultier breit gegrinst und zufrieden seine Ansicht geäußert: „Ich bin sicher, Kipshoven wird sich darüber freuen, wenn ich mit meiner Abteilung von 35 Mann dazustoße. Dem konnte nichtmal Popovic widersprechen. Auch wenn es schwierig werden würde, bei der Anreise nicht aufzufallen. Eher beiläufig traf man so den Entschluß, zusammen zu reisen. Kurz bevor man wieder weiterreiste, kam ein Kundschafter des norditalienischen Widerstandes vorbei und berichtete kurz über die Geschehnisse in Binasco. „Die Luftwaffe hat Splitterbomben eingesetzt. Dann sind sie von drei Seiten eingerückt. Die regulären Soldaten haben die Häuser durchkämmt und die Männer zum Markplatz getrieben, wo die Inquisition gewartet hat. Man hat sie vor die Wahl gestellt, euch zu verraten und weiterzuleben oder zu sterben. Die Frauen hat man mit unbekanntem Ziel abtransportiert.“ „Wie haben sich die Männer entschieden?“ wollte Grieco wissen. Da wurde der Kurier ganz traurig: „Keiner hat etwas gesagt. Einige haben sogar gebrüllt, lieber frei zu sterben als unfrei zu leben. Die Hälfte hat man verbrannt, die andere Hälfte wurde gekreuzigt und an der Straße nach Mailand aufgestellt.“ Ernst haben sich Vaultier und Grieco und Popovic angeblickt. Sie hatten es nicht verhindern können. Grieco hat sich nach ein paar Augenblicken wieder gefangen und dem Kurier das Versprechen mitgegeben: „Sobald wir Reiss befreit haben, werden wir der Koalition darauf eine eindeutige Antwort geben. Der Widerstand soll sich darauf vorbereiten. Aber keine voreiligen Überreaktionen!“ „Verstehe.“ hat der Kurier gemeint und ist dann weitergezogen. Und auch Grieco, Vaultier und die andern sind weitergefahren. Vaultiers Adjutant hat bei der Rast schnell gearbeitet und eine wunderbare Route ausgearbeitet, mit der man alle Straßensperren umgehen konnte. Man hat nur Landwege benutzt. Zuletzt hat man die Laster stehen gelassen und ist in der Abenddämmerung zu Fuß weitermarschiert. Jetzt hat man sich in einem kleinen Biwak in den Bergen nördlich von Sondrio eingerichtet. Vaultier weist gerade einen vier Mann Trupp ein, der in zwei Stunden vorausmarschieren soll: „Ihr marschiert am Bianco-See vorbei. Bis zum Morgengrauen solltet ihr St. Moritz erreicht haben, aber ihr müßt aufpassen, daß ihr alle erspähten Grenzposten umgeht. In St. Moritz beschafft ihr ein paar Verkehrsmittel. Am besten nehmt Kontakt zum Schweizer Widerstand auf.“ „Gibt’s dafür eine Parole?“ fragt einer der Männer. „Ja: ‚Lago Maggiore‘.“ „Ok, alles klar.“ „Wir treffen uns dann morgen Nachmittag in Samedan.“ „Zu Befehl.“ Mit seiner Taschenlampe folgt der Chef des Trupps nochmal der Route auf der Karte. Vaultier selber steht von dem Baumstumpf, auf dem er saß, auf und geht rüber zu Grieco, der vor seinem kleinen, aus einer Plane improvisierten Zelt, daß er sich mit einem seiner Soldaten teilen muß, sitzt. Sandro und Danko köcheln gerade über dem in einer Mulde verborgenen Lagerfeuer etwas essbares. „Und Colonel, was gibt’s neues?“ will Grieco wissen. „Nicht viel. Aber wenn alles nach Plan läuft, sind wir übermorgen in Bludenz. Ist zwar etwas Hetze, aber Schnelligkeit ist jetzt alles.“ „Was ist mit den Besatzungstruppen in der Schweiz.“ Vaultier zuckt mit den Achseln. „Was soll mit denen sein. Die Koalition ist gut im Niedermetzeln, aber schlecht in flächendeckender Überwachung.“ Da muß Grieco lächeln. Der Satz hätte glatt von Reiss sein können. „Haben Sie noch einen Kaffee, Grieco?“ „Ja, sicher.“ Grieco greift hinter sich ins Zelt und holt eine Thermoskanne hervor und einen Becher. In diesen schüttet sich Vaultier selbst etwas ein. „Haben Sie genügend warme Klamotten?“ „Ich hoffe.“ erwidert Grieco. „Tja denn... wissen Sie, in den Bergen wird es bereits jetzt richtig winterlich.“ „Ich weiß.“ erwidert Grieco etwas unwirsch. Von links kommt ein Räuspern; ein Gefreiter von Griecos Trupp. „Was gibt’s Gefreiter?“ fragt Grieco auf Italienisch. „Wir sind soweit.“ erwidert der Gefreite nur und geht wieder. Da er kein Italienisch kann, wirft Vaultier Grieco nur einen fragenden Blick zu, worauf der in Englisch erklärt: „Die Brandbestattung.“ „Achso.“ Grieco erhebt sich und Vaultier folgt ihm über einen alten Trampelpfad durch den dunklen Wald, bis zu einer Lichtung, auf der Griecos Trupp, ein paar von Vaultiers Männern, die drei Frauen, die sie im Schlepptau haben und jetzt auch Danko und Sandro im Kreis stehen, jeder mit einer Fackel in der Hand. Den gefallenen Kameraden hat man auf einem Holzscheit in einige bunte Tücher gewickelt, seine Uniform gefaltet danebengelegt. „Wieso so?“ fragt Vaultier leise, aber deutlich ungehalten. „Das ist viel zu riskant.“ „Der Tote hat in seinem letzten Brief darum gebeten.“ faucht Grieco leise zurück. Vaultier stellt sich in den Kreis und Grieco tritt vor, um als Kommandeur der Einheit des Gefallenen die letzten Worte zu sprechen. „Im Kampf für die Freiheit hat er sein Leben gegeben. Obergefreiter Da Vicci war ein guter Kamerad, ehrlich, loyal und menschlich. Wir werden ihn in guter Erinnerung bewahren. Nun werden wir ihn so, wie es sein letzter Wille war, dem Jenseits übergeben. Mögen Gott und das Schicksal seiner Seele gnädig sein und ihm seine Sünden verzeihen.“ Nach einer kurzen Pause brüllt Grieco mit bebender Stimme: „Achtung! Haltung annehmen! Feuer!“ Die Fackelträger treten vor und entzünden das Holz und die Tücher. Dann treten sie zurück. Grieco ergreift wieder das Wort: „Er geht von uns, aber sein Geist wird weiterleben. Seine Waffen werden an den nächsten Krieger weitergereicht, auf daß er ebenso gut für die Freiheit einstehen wird.“ Grieco zurück in die Kreisreihe. Sogar Brigitte, die immer noch versucht, sich in den überstürzenden Ereignissen zurechtzufinden und daher recht schweigsam ist, ist ein wenig berührt davon. Mit traurigen Augen schaut sie den Rauchschwaden nach, die zum Himmel steigen und dort in den vom Mond erleuchteten Wolken verschwinden... Dienstag, der 21. Oktober Der Regen macht alles klitschnaß. Von allen Ästen tropft das Wasser und Fraker und Philipps Bruder Dominik haben alle Mühe, Sprengstoff und Schwarzpulver für die improvisierten Raketen trocken zu halten. Dafür haben sie in den frühen Morgenstunde eine Extramulde ausgehoben und mit Planen ausgekleidet und überdacht. Philipp selber ist mit ein paar von Krammers Leuten in Bludenz – Material für die Drachenflieger und die Raketen organisieren. Für sich selber steht auf der Einkaufsliste auch Lötmaterial und einige kleine Batterien – die Raketen müssen später elektrisch gezündet werden können. Was als vage, ziemlich verrückte und improvisierte Idee begonnen hat, nimmt immer klarere Formen an und allmählich zweifelt selbst Philipp, ob das Ganze so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Xia Ven würde dabei viel lieber mithelfen – aber Philipp ist der Chef im Lager und hat ihn mit den Worten „Jeder ist mal dran“ zum Wachdienst draußen im Wald verdonnert. Jetzt hockt er mit schon reichlich durchnäßter und verdreckster Kleidung seit drei Stunden zwischen zwei Baumstämmen, einen Karabiner im Arm und versucht vor Langeweile nicht einzupennen. Zwei Meter weiter hockt zwar – kaum weniger ungemütlich – Marta Rambowicz hinter einem Gebüsch. So bilden sie einen Zwei-‚Mann‘-Posten. Aber reden is nicht. Nicht nur, daß das nicht allzu laut geht, weil man eventuelle Feinde sonst auf sich aufmerksam machen würde. Nein, Marta mag Xia Ven auch nicht wirklich. Gestern abend am Lagerfeuer war er mit ihr aneinandergeraten, als er mit ihr über Whisky diskutierte. Marta kann dem offensichtlich nur sehr wenig abgewinnen, was Xia Ven nicht wirklich nachvollziehen kann. Seine freilich etwas gekünstelte Aufregung – man will schließlich seinen Spaß – hat sie dann doch zu persönlich genommen. Schließlich hatte sie ihn angefaucht: „Mit Ihnen red ich kein Wort mehr, Sie Arschloch!“ Und war dann in ihr Zelt verschwunden. Philipp und Diana, die Arm in Arm am Feuer saßen, fanden das irre komisch. So hat Xia Ven Zeit nachzudenken. Zwischenzeitlich ist Nicole Elsing mit einem weiteren kleinen Trupp aus der Schweiz eingetroffen. Auf diese Tour hat sammelt sich nach und nach eine einmalige Truppe, zusammengesetzt aus so bemerkenswerten Typen wie der Scharfschützin Sabine Granrath, dem Schürzenjäger Fraker und dem ruhigen Piloten Tibori, der einen ziemlich trockenen Humor pflegt. Xia Ven muß grinsen. Die Besatzung von Schattenlagant tut ihm fast schon leid. Kipshoven hat es geschafft, eine Truppe zusammenzustellen, die ständig stärker wird und mit der man das Unmögliche möglich machen kann. Ein Knacken reißt Xia Ven aus seinen Gedanken. Das war doch ein Ast. Auch Marta hat es gehört; er hört, wie sie ihr Gewehr entsichert. Schnell blickt er zu ihr rüber. Mit Handzeichen bedeutet sie ihm, von links sich heranzupirschen, sie will es von rechts versuchen. Zur Bestätigung nickt er. Leise schleichen die beiden geduckt durchs Unterholz; schon nach ein paar Metern kann Xia Ven zwei schwarzgekleidete Gestalten erkennen, offenbar ein Mann und eine Frau. Die beiden stehen mit dem Rücken zu ihm und suchen offenbar irgendwas. Sieben Meter rechts von sich sieht Xia Ven Marta. Sie nickt ihm zu – das Zeichen für den Zugriff. Beide springen gleichzeitig auf und stürmen von hinten auf die beiden Gestalten zu. Als sie ihre Gewehrläufe zwischen die Schulterblätter der beiden Neuankömmlinge setzen, brüllt Marta: „Keine Bewegung und Flossen hoch!“ „Langsam umdrehen!“ fügt Xia Ven hinzu. Die beiden Gestalten, ein Mann und eine Frau, beide mit Rucksäcken, drehen sich um. Total erstaunt sehen sich Marta und Xia Ven an. Es sind Martin und Bianca, die in Nürnberg beim Ausschalten einiger Gepos auf der Gothic-Feier geholfen hatten. Martin lächelt verlegen und murmelt ein „Hi, Leute...“ „Xia Ven, bringen Sie die beiden zu Kipshoven.“ Xia Ven nickt und meint dann: „Kommt mit.“ Er führt sie durch den Wald und ins Biwaklager. „Man, das habt ihr aber gut getarnt...“ wundert sich Bianca anerkennend und Martin fügt hinzu: „Ja, wir sind genau dran vorbeigelatscht.“ Einer von Krammers Leuten holt Philipp, der gerade mit Lötarbeiten beschäftigt ist. In einem der Schlafzelte dürfen sich Martin und Bianca solange hinsetzen. Nach ein paar Minuten kommt Philipp, spricht kurz und leise draußen mit Xia Ven und begibt sich dann auch ins Zelt. „Was ist da denn los?“ wundert sich Tina, die gerade ein paar Meter weiter im Schutze eines Gebüschs mit Myriam die Pistolen des Trupps reinigt. Myriam zuckt die Achseln. „Keine Ahnung.“ „Hallo.“ begrüßt Philipp die beiden neuen Gäste und hockt sich vor ihnen auf einen Schlafsack. „Was führt euch zu uns?“ Noch ist Philipp doch ein wenig mißtrauisch. Immerhin kann man nicht ausschließen, daß die Gepos den beiden einen Sender angehängt haben oder sowas in der Art. Martin blickt Bianca an und erklärt dann: „Nach neulich abend haben die Behörden mehrere Razzien in Nürnberg durchgeführt und die dortige Schwarzen-Szene quasi gesprengt. Wir konnten gerade noch abhauen.“ „Und wie habt ihr es bis hierher geschafft?“ „Wir haben uns bei einem eurer Agenten in München gemeldet. Die haben uns überprüft und dann Papiere für die Reise nach Bludenz mit einer Wegbeschreibung gegeben.“ erklärt Bianca. Langsam wiegt Philipp den Kopf. „Na gut. Was habt ihr an Waffen dabei?“ will er wissen. Martin öffnet seinen Rucksack und holt zwei Pistolen heraus. „Inklusive je drei Reservemagazinen.“ erklärt er. Bianca holt aus ihrem Rucksack ein paar Wurfsterne, ein Kampfmesser – und eine Armbrust, dazu einen Beutel mit Pfeilmunition. „Spezialanfertigung.“ erklärt sie. „Kann bis zu sechs Pfeile gleichzeitig einspannen, die Pfeile besitzen vorne einen kleinen Sprengkopf.“ Sie reicht Philipp einen der Pfeile. Die Spitze ist ein scharfe Metallhülse, die etwas Sprengstoff umkleidet. Sowas hat er noch nie gesehen. „Krass...“ meint er. „Wo hast Du das her?“ Sie lächelt triumphierend, blickt Philipp dann mit ihren großen wasserfarbenen Augen an und erwidert: „Ein guter Kumpel hat mir sowas mal zusammengebastelt. Hab insgesamt 36 Schuß dabei.“ Philipps Miene hellt sich auf. „Ok. Ihr seid dabei. Wollt ihr das wirklich?“ Er sieht die beiden durchdringend an. Martin zuckt die Schultern, rückt seine Brille zurecht und antwortet nur: „Ich laß doch einen guten Kumpel nicht hängen...“ „Ja, genau...“ stimmt Bianca zu und fügt hinzu: „Außerdem schulde ich dem General noch 20 Reichsmark.“ Alle lachen und Philipp erwidert: „Ich weiß, aber er hat Dir doch gesagt: Geschenkt.“ „Und? Interessiert mich doch nicht!“ Immer noch lachend kommt Philipp wieder aus dem Zelt. Draußen wartet immer noch Xia Ven. „Xia Ven, wir haben zwei neue Kämpfer. Besorg Ihnen was zu futtern!“ Kandersteg ist völlig zerstört. Am Vorabend haben die kaiserlichen Schlachtflugzeuge zum zweiten Mal angegriffen. Zum Glück gab es dieses Mal nicht so viele Opfer, nur drei Verletzte. Und glücklicherweise haben es Lisa und Sonja ebenfalls gut überstanden – wie durch ein Wunder haben sie nur Schnittwunden und Prellungen, Sonja sogar eine Platzwunde davongetragen. Jetzt ziert ein Verband ihre Stirn, ihre wuscheligen Haare fallen markant darüber. Über einem Lagerfeuer kocht Lisa gerade Rindfleischsuppe – die Zutaten hat sie aus den Trümmern gerettet. Hin und wieder wirft sie ihren beiden Hunden Kim und Kimba, denen sie ihre Rettung aus den Trümmern verdankt, ein Stück Fleisch zu. Darauf stürzen sich die beiden dann und Lisa redet ihnen gut zu: „Jaaa, das habt ihr gut gemacht....“ Nur 50 m weiter, neben einem der zerstörten Gebäude, hilft Helge dabei, Proviant auf ein Maultier zu laden. Lisa würdigt ihn seit dem Luftangriff keines Blickes mehr. Karin kommt mal kurz vorbei und bringt noch Feuerholz. Schon in der Nacht hat ein Trupp alle Verletzten über die Berge in Sicherheit gebracht. Nach einer Art Kriegsrat in ziemlich gedrückter Stimmung sind Dechamps, Lisa, Sonja und Nicole Oertel zu der Entscheidung gekommen: Kandersteg wird geräumt. Denn jeden Moment können die Kaiserlichen mit Bodentruppen anrücken. Einige Kämpfer kommen vorbeigelaufen und bringen weitere Kisten mit Munition zu den Maultieren, um diese damit zu beladen. Bis heute abend will man weg sein. Als Lisa die von drei Bombentrichtern aufgerissene Straße hinabblickt, sieht sie Nicole Oertel und Sonja Berg näher kommen. Beide tragen schwere Rucksäcke mit weiterem Proviant und Munition, dazu jede zwei Gewehren. Es wird ein harter Marsch werden – schwer bepackt über die Berge, die Wege sind bereits aufgeweicht von mehreren Regenschauern, bitter kalt ist es dennoch bereits. Auch Lisa hat sich in eine warme Jacke gehüllt und eine Decke darüber geworfen. Als Nicole und Sonja das Lagerfeuer am Rande eines zerstörten Schuppens erreicht haben, setzen sie kurz ihr Gepäck ab. „Alles klar.“ vermeldet Sonja und Nicole fügt hinzu: „Ja. Dechamps wird noch bis morgen mit einer Nachhut hier bleiben und die Felsenburg halten und dann auch abziehen.“ „Ok. Guter Plan.“ stimmt Lisa zu. In dem Moment geht im Norden im Tal eine Leuchtkugel hoch. Lisa springt auf. Rot. „Scheiße...“ flüstert sie. Sonja rennt rüber zu Helge und Karin. „Schnell!! Ladet den letzten Kram auf und dann weg hier! Wir kriegen gleich Besuch!“ „Was?“ krächzt Karin. „Na los!“ flucht Helge, der sofort verstanden hat, noch einen Sack mit Kartoffeln auf das Maultier wuchtet und diesem dann einen Klaps gibt, damit es vorwärtsläuft. Mit einem heulenden Ton setzt sich das Tier in Bewegung... Oberst Freudacker sieht der verglimmenden Leuchtkugel nach. Er kommandiert die Aufklärungsabteilung 45, die von Rauenfels dazu auserkoren wurde, das „Ausräucherungsunternehmen“ gegen Kandersteg durchzuführen. Dabei sollen auch möglichst viele Geiseln genommen werden, die man dann für bei Sabotageakten und Überfällen gefallene Kaiserliche erschießen kann (der momentane Wechselkurs: 40 Geiseln pro getöteten kaiserlichen Beamten und 60 pro getöteten kaiserlichen Soldaten). Von dem tragbaren Funkgerät in seinem Kübelwagen aus gibt Freudacker den Befehl: „Los!“ Als Führungsgruppe rasen mehr als ein Dutzend Kradschützen vor, gefolgt von einem Panzerzug. Letzter ist allerdings nur mit einigen veralteten preußischen Panzern ausgerüstet, die man im Sommer erbeutet hat und die man als „Leichte Panzer 38 (p)“ im Sortiment führt. Sie werden allerdings ausschließlich als Lückenbüßer eingesetzt – so bei den Besatzungstruppen in der Schweiz. Dechamps und seine Truppe haben das Unheil längst kommen sehen. Die Leuchtkugel hat alle Posten in Bereitschaft versetzt. Ein paar Überraschungen hat man dann doch noch vorbereitet. Mitten auf einem Felsvorsprung zwischen zwei vertrockneten kleinen Tannen hockt Dechamps und gibt das zweite Signal, eine grüne Leuchtkugel. Das bedeutet: „Feuer nach eigenem Ermessen.“ Zwar weiß Dechamps, daß sie diesen Tag wohl nicht überleben würden. Aber wenigstens würde man ein paar dieser Arschlöcher mitnehmen.... An einer Stelle rückt ein Steilhang bis dicht an die Straße vor, auf der gegenüberliegenden Seite wird eine Kuhweide durch eine Böschung begrenzt. Versteckt in einem Misthaufen auf der Kuhweide hockt einer von Dechamps Posten. Die Kradschützen läßt man vorbeirauschen. Als dann die Panzer vorüberrollen, drückt einer der Männer den Hebel des Fernzünders runter. Sprengsätze zerreißen den Hang, die Böschung und die Straße. Ein Panzer ist genau im Zentrum der Detonationen und wird hochgerissen und rücklings zurück auf die Straße geworfen, ein Teil des Hanges rutscht über den nachfolgenden Panzer. Aus dem Misthaufen stürmen nun vier Widerstandskämpfer, die Karabiner im Anschlag vor – da peitschen auf einmal Schüsse neben ihnen ins Gras: Ein Radfahrzug hat sich als Flankenschutz der Panzer rangepirscht und greift nun zu Fuß an. Ein Kugelhagel fegt über den Acker. Einer der Schweizer fällt mit einem Aufschrei, zwei seiner Kameraden werfen sich hin und feuern zurück, der vierte rennt zum ihm rüber, wird selber in den Fuß getroffen und wirft sich hin. Erst jetzt sieht er, das sein Kamerad bereits tot ist – mehrere Treffer im Brustkorb. Die andern beiden Widerstandskämpfer liefern sich ein wildes Feuergefecht mit den ebenfalls in Deckung gegangenen Fahrradschützen. Die werfen zwei Handgranaten; eine kann einer der Widerstandskämpfer zurückwerfen – wenn auch zu kurz, sie detoniert mitten auf dem Rasen, ohne Schaden anzurichten. Aber der andere Widerständler ist nicht schnell genug, die Granate explodiert und zerreißt ihn und seinen Kameraden. Schweratmend stemmt sich der letzte der Vieren hoch, versucht humpelnd wegzukommen, als stechende Schmerzen durch seinen Rücken jagen. Vorne, von der nächsten Straßenkurve, hört man Schreie und das Tackern eines MGs, mit dem Dechamps Männer die Kradschützen empfangen... Der kurvenreiche und steil bergauf führende Weg ist leicht rutschig. Wo nicht weicher Boden nachgibt, droht man an glitschigen Felsen abzugleiten. Einzelne Schneeflocken wehen Helge um die Nase. Der Wind wird immer schärfer und kälter, je höher sie kommen. Stoßweise atmet Helge ein und aus, keuchend fast, er kriegt Seitenstiche und Wadenstiche. Verdammt, er hätte doch längst mit dem Rauchen aufhören sollen... Aber die Angst treibt einen weiter. Von Norden her, aus dem Tal, in dem Kandersteg liegt, hört man immer noch Schüße, MG-Garben, Detonationen. „Runter!“ brüllt einer der Soldaten des Spitzentrupps. Alle ducken sich. Knapp über die Grasnarbe des Hanges hinwegblickend, sieht Helge zwei Messerschmitts über den Baumwipfeln des Tales kreisen, die mit ihren Bordkanonen auf irgendwas schießen. „Auf was schießen die?“ fragt Karin leiser als es eigentlich sein muß. „Vermutlich auf die paar Bauernkatten am Oeschinensee.“ flüstert Sonja hinter ihr. „Weiter!“ ertönt der Befehl von vorne. Alle rappeln sich wieder auf. Die Motorengeräusche der Flieger werden wieder leiser, als sie der Höhenlinie kurz nach Süden folgen, dann in eine Mulde im Hang hinabsteigen, wo sie durch eine Baumgruppe marschieren. Plötzlich sieht Helge zwei Soldaten ausscheren und den Hang hinaufmarschieren, während der Rest von ihnen weiter den Hang entlangmarschiert. Einmal sinkt Helge knöcheltief in Schlamm ein, ein Soldat und Karin ziehen ihn wieder raus. „Danke.“ keucht Helge. Der Soldat klopft ihm auf den Rücken und lacht. Dechamps hat sich mit dem letzten Dutzend seiner Männer in die Felsenburg zurückgezogen. Von hier aus werfen sie Handgranaten auf die Straße nach unten. Und wieder eine – Rums! Schüsse peitschen hoch, Querschläger sirren durch die Luft. Durch eine weitere Sprengung nach fast einer Stunde Kampf haben sie die Straße noch ein zweites Mal gesperrt und seitdem beschäftigen sie die Kaiserlichen von der Felsenburg aus. Allerdings wissen Dechamps und seine Männer auch, daß sie den heutigen Tag wahrscheinlich nicht überleben werden. Andererseits werden sie getrieben von grimmiger Wut auf die Besatzer, die die Schweiz unter sich aufgeteilt haben und in nur einem Monat 20000 Schweizer Zivilisten als „politisch Unzuverlässige“ ins Lager gesteckt haben. Die örtlichen Widerstand im September durch wahllose Erschießungen in den Dörfern hatten brechen wollen. Heute würde man ihnen zeigen, daß auch Schweizer bis zum Tod kämpfen können. Man würde wieder anknüpfen an den guten Kriegerruf, den die Schweizer im Mittelalter hatten. „Sie kommen den Hang und den Weg hoch!“ „Wir erwarten sie hier!“ brüllt Dechamps und geht mit seinem Karabiner hinter einem umgekippten Tisch in Deckung. Er nickt seinem Adjutanten zu – der hockt neben einem Sprengkasten in einer in den Fels gehauenen Nische. Er läßt ein Tuch heruntergleiten, das den Nischeneingang verdeckt. Da geht auch schon das Gemetzel los, als die Kaiserlichen durch den Hauptzugang in die Felsenburg stürmen und direkt vom Kugelhagel empfangen werden. Die ersten paar fallen, dann wirft einer der Kaiserlichen eine Handgranate, die vor allem Dreck und Staub aufwirbelt. Im Schutze des Staubes stürmen die Männer herein, feuern auf die aufgesprungenen Schweizer, die zurücktaumeln. Einer verliert sein Gewehr, zückt ein Messer, stürzt hervor, rammt es einem Kaiserlichen von hinten genau in die Türen, dann wird er durch Pistolenschüsse niedergestreckt. „Keine Gefangenen machen!“ brüllt der kaiserliche Kompanieführer. Schließlich dringen seine Männer bis in die zentralen Räume der in den Fels geschlagenen Kammern vor. In einem wilden Schußwechsel verfeuern Dechamps und seine letzten vier Kämpfer ihre Munition, drei fallen. Der vierte will sich ergeben, steht mit erhobenen Händen auf – und wird von drei Schüssen in die Brust getroffen, taumelt zurück und bricht zusammen. Dechamps umklammert sein Bajonett und springt dann auf, mit einem wütenden Brüll. Verfehlt mit seinem schwungvollen Klingenstoß einen feindlichen Soldaten, der ausweichen kann, dann treffen ihn mehrere Kugeln. Klirrend fällt das Bajonett auf den Steinfußboden, Dechamps sackt erst auf die Knie, lächelt trotz des aus dem Mund rinnenden Blutes und bricht dann tot zusammen. Erst nach ein paar Augenblicken löst sich bei den Kaiserlichen die Anspannung, als aus allen Kammern der Ruf ertönt: „Kein Widerstand mehr!“ „Alle tot!“ „Seid ihr sicher?“ fragt der Kompaniechef unwirsch. „Ja.“ bestätigt einer seiner Männer etwas ungehalten, während sich zwei von ihnen in einer Ecke übergeben müssen. Eher zufällig bleibt der Kompaniechef vor der mit Tüchern und Decken behangenen Felswand stehen, schaut an ihr herunter. Drei Kabel führen in die Felswand. Er schlägt das Tuch zurück, ein Widerständler in voller Schweizer Uniform lacht wie irre auf und legt einen Hebel um, drückt einen Knopf. In Zeitraffer sieht der Kompaniechef sein ganzes Leben an sich vorbeirasen, seine Geburt, wie er seine beiden Schwestern ärgerte, seine Schulstreiche, den ersten Kuss, den ersten Sex, wie sein Vater an Krebs starb, die Weihnachtsfeiern, seine abgebrochene Lehre, den Militärdienst, seine Hochzeit, die Geburt seines Sohnes vor einem Jahr... und dann explodiert die Welt in einem grellen Lichtschein und umherfliegenden Gesteinsbrocken und Blutkörperchen, bevor es ihn in eine scheinbar endlose Finsternis schleudert. Seit über drei Stunden marschieren sie schon. Vor einer halben Stunde haben sie von der anderen Seite des Höhenzuges eine heftige Detonation gehört. Die Schweizer Widerstandskämpfer haben daraufhin kurz gehalten und sich bekreuzigt. „Dechamps und seine Mitstreiter sind tot.“ hat Sonja nur knapp festgestellt. Nachdem man ja erst steil hinaufmarschiert war, ging es dann steil bergab. Jetzt ist man wieder in einem Tal, marschiert über sanft nach unten führende Feldwege. Der vorderste Trupp mit Maultieren durchwatet gerade einen zwei Meter breiten Bachlauf. „Karin?“ „Ja Schatz.“ „Fühlen sich Deine Beine auch so schwer an?“ „Ja. Aber ich glaube nicht, daß wir eine großartige Chance haben.“ „Tja...das ist eine typische Tja-Antwort. Deinen Fatalismus will ich haben.“ „Hab ich nicht, Schatz.“ erwidert sie trocken. „Ich spare mir meine Energie nur dafür auf, Dir den Kopf abzureißen.“ „Wieso das denn?“ „Wer hat uns denn in diese Scheiße geritten?“ faucht sie. Sonja hinter ihnen kann sich ein leichtes Grinsen nicht verkneifen. Armer Helge. Hatte es ja nur nicht besser gewußt. Und schwitzt jetzt Blut und Wasser, weil alle auf ihm rumhacken. Vorsichtig läßt sich Sonja zu Nicole Oertel zurückfallen, die vor Lisa, die an zwei Leinen ihre beiden Hunde mitführt, marschiert. „Sagen Sie mal, Nicole, haben Sie eine Ahnung, wie lange wir noch brauchen?“ „Sicherlich noch die ganze Nacht. Wir müssen über den Gebirgszug dort drüben.“ Sie deutet über das Tal hinweg auf einige erst sanft, dann schroff aufsteigende Gipfel. Helge, der sich kurz an einem Nadelbaum angelehnt hat, um sich auszuruhen, kriegt das mit. „Hoch nö, nicht schon wieder bergauf...“ stöhnt er genervt. Rauenfels läßt mit einer leichten Handbewegung den Wein in dem Glas kreisen. Seine Zunge prüft nochmal den Geschmack, dann läßt er den Schluck die Kehle hinuntergleiten. Nein, doch etwas zu fruchtig. Nicht wirklich seine Sache. Wahrscheinlich wird er auf immer und ewig der Biertrinker bleiben. Die Tür geht auf und sein Ia kommt rein. „Chef, wir haben endlich die Rückmeldung von Freudacker.“ Rauenfels richtet sich in seinem Stuhl auf. Den ganzen Tag hat er bereits darauf gewartet. „Ja – und?“ „Die gute Nachricht: Kandersteg eingenommen und gesäubert, keine Gefangenen, 145 Tote, 130 erbeutete Gewehre.“ „Das klingt nach einer schlechten Nachricht.“ „Ja. Unsere Eigenverluste betragen 152 Gefallene und Schwerverletzte. Außerdem ist ein Trupp des Feindes uns offenbar entwischt.“ „Scheiße.“ zischt Rauenfels. Er weiß genau, daß das dem Oberkommando nicht gefallen wird. Solche Verlustzahlen hat man sonst nur, wenn „Schimäre“-Kämpfer dabei waren. Sein Ia scheint Rauenfels‘ Gedanken lesen zu können. „Die Meldung besagt, daß alle Toten entweder Räuberzivil oder die Schweizer Uniform trugen.“ Verärgert zieht Rauenfels eine Grimasse und stellt die einzig logische Schlußfolgerung fest: „Na toll. Dann werden die Schweizer halt nur von ‚Schimäre‘ ausgebildet, bewaffnet und finanziert, wohl auch moralisch unterstützt. Eine schlechte Nachricht bleibt es so oder so.“ Vorsichtig legt der Stabsoffizier die Akte mit der kompletten Meldung auf den Tisch seines Vorgesetzten, salutiert und verläßt dann den Raum. Als er sich im Stuhl zurücksinken läßt, stößt Rauenfels einen Seufzer aus. Nein, so gewinnt man wahrlich keinen Krieg. „Nur für die Toten ist der Krieg wirklich zu Ende.“ Soldatensprichwort Der Tag ist grau und dunkel von den tiefhängenden Wolken. Es regnet mal wieder andauernd, einige matschige Schneeflocken sind schon mit im Regen drin, die Wege sind alle schlammig und der leichte Wind eisig. Es ist fast, als würde die Natur mit trauern. Auf dem Soldatenfriedhof von Safonovo wurden in den letzten Tagen die Toten der Schlacht bestattet. Nun, als letzter, ist General Valkendorn an der Reihe. Vier Soldaten lassen langsam den Sarg in das gut 3 m tiefe Loch hinab. Die letzten Worte wurden bereits gesprochen; der Landgraf von Hessen-Darmstadt hat dies übernommen, auf Bitten von Karo. Verwandte Valkendorns sind leider nicht anwesend – sie leben alle auf der anderen Seite der Front, im Reich und in den Niederlanden. Gekommen sind dafür alle wichtigen Kommandeure von „Schimäre“: Lichterfelde, Mansfeld, Prinz, Orth, Schoeps und ein paar andere Offiziere, Unteroffiziere und sogar eine Abteilung von Gefreiten und Obergefreiten, von jedem Regiment zwei. Der exildeutsche Verbindungsoffizier Pick ist auch da, zusammen mit seiner schönen Verlobten Mira Krapp. Als der Sarg unten ist, treten alle einen Schritt zurück und Karo verkündet mit nicht so fester Stimme, wie man sie von ihr gewohnt ist: „General Valkendorn, möge Gott Ihre Seele ins Himmelreich aufnehmen. Wir werden Sie in guter Erinnerung behalten.“ Nach einer Pause fügt sie hinzu: „Stillgestanden! Anlegen!“ Die Soldatenabteilung schlägt die Hacken aneinander und richtet dann die geladenen Sturmgewehre zum Himmel aus. Man hört die Regentropfen auf den Boden fallen. „Salut!“ Schuß. „Salut!“ Schuß. „Salut!“ Schuß. Nach der Beerdigung setzt sich Karo ins Auto. Anja und Agi sitzen schon drin und warten. Agi legt von hinten ihre Hand auf Karos Schulter; müde hält Karo die Hand mit ihrer Hand fest. „Ich hab Dich weinen sehen. Am Grab, meine ich.“ bemerkt Anja. Karo nickt und wischt sich eine Träne aus dem Gesicht. „Die Schlacht und der Besuch in Moskau...alles hat zuviel Kraft gekostet...Außerdem ist Valkendorn mir in letzter Zeit ein guter Freund gewesen... Und Tanja fehlt mir.“ Sichtlich erschöpft läßt Karo ihren Kopf auf das Lenkrad sinken. „Ich will nicht mehr.“ „Soll ich fahren?“ fragt Agi. „Nein.“ seufzt Karo. „Geht schon.“ Sie richtet sich wieder auf und startet den Motor. „Es wird Zeit, daß Stefan wieder da ist. Damit es wenigstens einmal ein Happy End gibt.“ stellt Anja leise fest und folgt mit ihrem Blick den an der Scheibe herunterlaufenden Regentropfen. In der Kantine sieht Gephardt Leikert bereits an einem Tisch sitzen. Er geht schnell zu ihm rüber, setzt sein Tablett ab und läßt sich gegenüber von Leikert nieder. „Na, Standartenführer, wie geht’s Ihnen?“ fragt Leikert freundlich und schneidet sich ein Stück von seinem Schnitzel ab. „Na, geht so. Wie ist das Abendessen heute?“ „Ich probier gerade.“ Langsam kaut Leikert das Stück Schnitzel, hält den Kopf schräg. „Ja...würde sagen, das geht. Wir müssen den Koch heute nicht auf-, äh, meine ablösen.“ Unfreiwillig muß Gephardt lachen. Er hat den makabren Insider-Witz verstanden. „Was machen unsere beiden Gäste?“ will Gephardt wissen. Leikert zuckt die Achseln. „Er verbringt die meiste Zeit bei ihr im Quartier oder im Trainingsraum. Schwert-und Nahkampf. Außerdem hat sie sich aus unserer Bibliothek ein paar Bücher ausgeliehen.“ „Was für den Bücher?“ „Keine Ahnung. Ein paar Romane meine ich. Soweit ich das beurteilen kann, schlagen die beiden nur die Zeit tot.“ „Sie wissen ja, wir dürfen die beiden nicht mehr weglassen.“ Einen Bissen schlingt Leikert runter und hebt dabei eine Augenbraue. „Standartenführer, die beiden versuchen ja nichtmal, hier wegzukommen.“ Nach einer Pause wird Leikert genauer: „Ich habe fast das Gefühl, als warten die auf irgendwas.“ Gephardt blickt sein Gegenüber an. „Nur auf was?“ „Standartenführer, wenn ich das wüßte...“ Beinahe hilflos hebt Leikert die Hände. Eher zufällig blickt Gephardt zur Seite und sieht zwei Tische weiter Petra Müller sitzen. Sie trinkt einen Apfelsaft und liest ein Buch. Als sie ihre Hand von dem Buch zurückzieht, springt die Buchhälfte mit dem Titelblatt in die Höhe und gibt den Titel frei: „Die Krähe.“ Beinahe fröhlich lächelt Petra Gephardt an, dem es kalt den Rücken runterläuft. Mittwoch, der 22. Oktober Es ist morgens, gegen 6 Uhr. Zwar ist die Sonne noch nicht aufgegangen, aber die Wolkendecke hat ein paar Lücken gekriegt, durch die die Sterne und der Mond etwas Licht geben. Dünne Schneeflocken fallen jetzt, denn es hat einen starken Temperaturabfall in der Nacht gegeben. Die ersten Vorboten des Winters, der wahrscheinlich einer der Kältesten der letzten Jahre werden würde. Sergent Jacquline Dupré hockt zusammen mit ihrem Spähtrupp von vier Soldaten zwischen den Fichten einer Baumgruppe und beobachtet den gut 200 m weiter unten liegenden Ort Gargellen. Der Spähtrupp Dupré ist das Vorauskommando der Truppe um Colonel Vaultier, Oberst Grieco und General Popovic. Jacquline selber ist eine hübsche, attraktive Frau mit momentan schwarz gefärbten Haaren mit rötlichen Strähnchen, die nicht ganz schulterlang sind. Sie trägt wie alle anderen zivile Kleidung, die der widrigen Witterung standhält. Der lange graue Mantel hält einigermaßen warm, außerdem kann man darunter gut das Gewehr verstecken. Ihr Auftrag: Einen sicheren Weg nach Bludenz finden. Der Weg durch die Schweiz an Davos vorbei war ein Kinderspiel gewesen, denn man hatte den Schweizer Widerstand in Anspruch nehmen können. Ursprünglich wollten die Schweizer auch einen Weg nach Bludenz weisen, aber dann ist die Nachricht von dem Überfall auf Kandersteg gekommen. Die Schweizer Widerständler erklärten, sie würden jetzt anderswo gebraucht. Nur die vor der Inquisition gerettete Frau, Denise Cassim, hat man noch den Widerständlern aufschwatzen können, mit dem Auftrag, der Cassim neue Papiere zu verpassen, damit sie untertauchen kann. Also: Das letzte Wegstück mußte man selbst finden. In der Nacht hat Duprés Spähtrupp den Gebirgszug zwischen Prättigau und Montafon überquert. In Kürze würde der Rest nachfolgen. Bis dahin muß Gargellen gesichert sein. Von hier aus kann man dann in aller Ruhe nach Bludenz weiterreisen, wo man mit etwas Glück abends eintreffen würde. Durch den Feldstecher beobachtet Caporal Raffin das Nest. „Nichts, keine Bewegung, kein Licht, abgesehen von der notdürftig abgedunkelten Bäckerei.“ Dupré beißt sich auf die Unterlippe. Das schmeckt ihr irgendwie nicht. Die ganze Reise ist zu glatt gegangen, selbst wenn man in Rechnung stellt, daß man Hilfe vom Widerstand hatte und die Koalition in gewissen Dingen träge ist. Andererseits hat man nicht mehr allzu viel Zeit. Schließlich gibt sie sich einen Ruck. „Ok.“ raunt sie mit ihrem typischen Dialekt aus dem saarländischen Grenzgebiet zwischen dem Reich und Frankreich ihren Untergebenen zu. „Gehen wir rein.“ Schon geht’s los: Drei stürmen etwa 50 m weit vor, dann folgen die beiden andern, stoßen 50 weitere Meter vor, halten wieder inne, während die drei ersten noch weiter vorstoßen. So kann man sich im Zweifelsfall gegenseitig Feuerschutz geben. So geht es im Eilmarsch den Hang runter. Schließlich erreichen sie das erste Gehöft. Dann auf die Hauptstraße. Geduckt huscht man von Haus zu Haus. Schließlich ist man vor dem kleinen Fachwerkhaus, in dem die Bäckerei ist. Während zwei Mann draußen warten, geht Jacquline hinein. Die drei Frauen, die hier bei dem Schein von Petroleumlampen Brot für das Frühstück der Dorfbewohner backen, schauen verdutzt auf. „Gute Frau, wir haben noch geschlossen!“ stellt ein dicke runde Frau, offenbar die Chefin im Laden, mit stark österreichischem Akzent fest. Beschwichtigend hebt Jacquline die eine Hand und hält gleichzeitig mit der anderen das Gewehr fest – womit die Autoritätsverhältnisse fürs erste festgestellt sind. „Gute Frau, ich möchte erstmal nur wissen, ob sich irgendwelche Polizisten, Soldaten oder andere Regierungsvertreter hier im Ort befinden.“ Während die beiden anderen Bäckerinnen weiter ihr Tagewerk verrichten, schüttelt die Chefin nur ein paar Mal den Kopf, klatscht sich das Mehl von den Händen ab und antwortet dann: „Ne, nicht das ich wüßte. Nur einmal in der Woche kommt ein Vertreter der Gendarmerie in Bludenz vorbei, aber das wars auch. Wir sind hier offenbar nicht so wichtig...Nur unsere Söhne in die Armee einziehen, das können die Ärsche!“ Ein Schmunzeln leicht unterdrückend fragt Dupré weiter: „Ist der Weg nach Bludenz mit allzu vielen Straßensperren gepflastert?“ „Ah...“ erkennt die Bäckerin, „Sie sind vom Widerstand, wat Schätzchen? Ne, nur zwei Kontrollpunkte, aber leicht zu umgehen. Die Typen da waren zu meinen Mädchen mal aufdringlich, seitdem umgehen wir sie.“ „Könnten Sie uns zeigen, wie?“ „Sicher dat. Auch wir sind nicht unbedingt Freunde der Regierung. Brauchen Sie vielleicht noch Brot?“ „Ja, Proviant wär nicht schlecht. Allerdings brauchen wir den für gut 40 Leute.“ „Dann müssen Sie rationieren, Liebchen!“ Über die Schulter brüllt die Chefin nach hinten: „Anni, nochmal 10 Brote extra!“ Mit einem Räuspern ruft sich Jacquline wieder in Erinnerung. „Dürfte ich fragen, was Sie gegen die Regierung haben?“ Die Bäckerin zieht eine Grimasse. „Wolln mich prüfen, äh? Ne, ne, geht nicht...denn ich sag Ihnen eins: Wegen denen hab ich meinen Vater im Erbfolgekrieg, meinen Mann im Siebenjährigen Krieg und jetzt noch meinen Sohn verloren. Wieso soll ich den Knilch in Wien da mögen?“ Zwei Stunden später, die Morgendämmerung ist zwischenzeitlich angebrochen, ist der Rest des Trupps angekommen – nach einem beschwerlichen Nachtmarsch quer über den Gebirgszug. In der einzigen kleinen Kneipe des Ortes – die sinnigerweise direkt neben der Bäckerei und dem kleinen Schlachthof liegt und mit diesen zusammen die „Fress-Meile“ des Nestes bildet – haben es sich Sandro und Danko an einem runden Holztisch gemütlich gemacht. Und gönnen sich erstmal ein Bier. Danko, der nicht gerade der Schlankste ist und auch nicht die beste Kondition hat, spürt nach der strapaziösen Reiserei der letzten Tage jeden Knochen und jede Sehne seines Körpers. Vorsichtig streckt er sich aus. „Na, noch alles an seinem Platz?“ frotzelt Sandro und fängt sich einen bösen Blick von Danko ein. Der schüttelt den Kopf. „Ne, nicht wirklich. Scheiße, wofür mache ich das eigentlich...“ „Dein Gehalt?“ Danko zieht die Mundwinkel nach unten. „Ne. Krieg ich auch so.“ „Für die beiden Mädels?“ „Ne. Nicht mein Typ.“ Jetzt muß Sandro lange überlegen. „Jemand hat Dir gesagt, daß die Chefin ganz süß sein soll?“ „Scheiße, Du kennst mich.“ Beide lachen. Aber beide wissen auch, daß Danko damit auch nur sein latent durchaus vorhandenes Pflichtgefühl kaschiert, um sein Gesicht zu wahren. Clarissa kommt zu ihnen rüber, zieht sich einen Stuhl heran und stellt ihren warmen, dampfenden Tee ab. „Hey, was geht?“ fragt Danko in seiner unnachahmlichen Art. „Bin nur erschöpft.“ stellt Clarissa fest. „Wie geht es unserm Gast?“ will Sandro wissen. „Brigitte? Naja, die ruht sich was auf. Vaultier hat tatsächlich ein Bett für sie gefunden. Aber er meint, in drei Stunden brechen wir wieder auf. Er will heute abend endlich bei Kipshoven sein.“ „Nachvollziehbar. Ich will auch endlich alles hinter mir haben.“ erwidert Danko. Und fügt leicht jammernd hinzu: „Wenn nur nicht immer alles so anstrengend wäre. Ich bin doch so ein träger Kerl...“ Lachend schlägt ihm Clarissa mit der Faust leicht an die Schulter. „Jetzt machen Sie sich nicht schlechter als Sie sind, General!“ „Nö, ich doch nicht...“ grummelt Danko und genehmigt sich noch einen kräftigen Schluck von seinem Bier. Wer weiß, wann er das mal wieder kann... Das Bett, das Vaultier bei einem alten Bauern für sie aufgetrieben hat, findet Brigitte dann doch so ungemütlich, daß sie kaum mehr als eine Stunde Schlaf findet. Dutzende Male dreht sie sich hin und her, bevor sie sich dazu entschließt, es sein zu lassen und im Bett aufsetzt. Die Decke riecht doch ein wenig muffig. Brigitte verzieht das Gesicht und wirft die Decke ans Fußende des knarrenden Bettes. Schnell zieht sie wieder Socken und Schuhe an – Vaultier hat tatsächlich trockene Socken und feste Wanderschuhe unterwegs organisieren können – und zieht sich ihren Pullover über. Ein Kratzen an der Schulter erinnert sie dann auch daran, ihren BH kurz zurechtzurücken. Allmählich hat sie sich auch in ihrer neuen Situation zurechtgefunden. Sie hat unterwegs sogar ein paar Takte mit Grieco und Popovic gequatscht. Eigentlich sind die beiden ganz nett. Danko hat ihr sogar in kurzen Sätzen näher erklärt worum es geht. General Reiss aus dem Knast holen...Dunkel kann sich Brigitte daran erinnern, diesen Reiss vor Jahren mal kurz getroffen zu haben. Ein komischer Vogel irgendwie, damals war er auch noch nicht General gewesen, geschweige denn irgendwie wichtig für die Dienststellen in Wien, Prag oder sonstwo. Tja, so schnell kann es gehen. Schon damals hatte Brigitte das Gefühl gehabt, daß dieser Mann ein Talent dazu hat, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Und sie erinnert sich noch an etwas, das Reiss ihr damals gesagt hatte: „Man sieht sich immer zweimal im Leben....“ Als Brigitte das kleine Zimmer von nur neun Quadratmetern schon verlassen will, sieht sie in der Ecke neben der Tür einen Stuhl, auf dem eine Kump Wasser, ein Stück Seife, ein Waschlappen, ein Handtuch und ein Zettel bereitliegen. Auf dem Zettel steht: „Für unsern Gast. Viel Vergnügen! Mit Grüßen DP.“ DP? Ach ja – Danko Popovic! Der Mann weiß, was gut ist. Die nächste halbe Stunde genießt Brigitte wirklich, denn es tut gut, sich mal wieder einigermaßen gut waschen zu können.... Philipp, Fraker, Dominik, Martin und Jacke stehen um eine kleine Schaltvorrichtung herum, die Dominik an ein Metallgestell montiert hat. Zwei kleine Rohre sind an jedem Ende drangeschraubt, an ihrem geschlossenen Ende verkabelt. Höchst interessiert betrachtet Martin das ganze. „Und was soll das werden, wenn es fertig ist?“ will er wissen. Dominik erläutert es ihm: „Wir wollen Raketen abschießen, aber wir brauchen einen Zündmechanismus. Da bietet sich ein elektrischer an.“ „Als Quelle nutzen wir ein paar Batterien, die ich besorgen konnte.“ fügt Fraker hinzu. „Genau.“ ergänzt Philipp. „Und jetzt werden wir sehen, ob es unsere improvisiert zusammengelötete Schaltung tut.“ Er setzt sich hinter das Metallgestell und legt einen Schalter um. Der schließt den Stromkreis. In den beiden Rohren wird eine kleine Ladung Schwarzpulver gezündet, Rauch steigt auf. Martin weicht dem Rauch hustend aus und Jacke meint: „Gratuliere. Zumindest der Teil funktioniert.“ „Stimmt.“ stellt Philipp fest, während er sich wieder aufrichtet. „Es funktioniert. Dominik, Fraker, stellt weitere Schaltungen fertig. Schnappt euch dazu noch ein paar von den andern, die löten können. Und dann montiert das an die fertigen Drachen.“ „Alles klar, Kapitän.“ bestätigt Fraker den Befehl, Dominiks „Is gut“ ist etwas lascher. „Du bist sicher, daß das klappt?“ fragt Martin. Philipp zuckt die Achseln und geht einfach zurück zum Lager. „Zumindest hat die Generalprobe geklappt.“ meint Jacke resignierend, grinst breit und trottet Philipp hinterher. Stirnrunzelnd schaut Martin auf die Abschußvorrichtung hinab. Erste dicke Tropfen, die durch das Geäst herabprasseln kündigen das Ende der kurzen Regenpause an. „Scheiße.“ flucht Martin, in dessen langen blonden Haaren die Tropfen wie Perlen hängenbleiben, und rennt auch zurück zum Lager. Als Philipp gerade in sein Zelt zurück will, fällt ihm Diana um den Hals und küßt ihn. „Und? Wie ist es gelaufen?“ will sie wissen. Er nimmt sie in den Arm, zieht ein skeptisches Gesicht und murmelt nur: „Ich weiß ja nicht...“ „Och!“ Sie haut ihm auf die Schulter. „Na gut.“ lenkt er ein. „Die Zündung funktioniert.“ Jetzt grinst er auch triumphierend. Sie gibt ihm noch einen Kuß und flüstert dann in sein Ohr: „Ich würde gerne noch eine andere Zündung ausprobieren.“ Mit einem frechen Grinsen wehrt er ab: „Nein. Erst wenn wir das hier überlebt haben.“ Enttäuscht schaut sie ihn an. „Wieso das denn?“ will sie wissen. „Sag ich Dir nicht. Ist besser so.“ „Hey. Wir sind zusammen, ich will wissen wieso...!“ Um sie zu beruhigen legt er ihr den Zeigefinger auf den Mund. „Nein. Ich erklärs Dir ein andern mal.“ Die drei Polizisten sprinten dem jungen Hehler hinterher. Die Hauptstraße entlang und über den Marktplatz von Bludenz . Der Verfolgte rennt beinahe ein paar Leute um, flüchtet dann in eine Seitenstraße. Und merkt zu spät, daß diese eine Sackgasse darstellt. Schon packt ihn einer der Polizisten am Kragen und schleudert ihn zwischen zwei Mülltonnen. Reißt den armen Kerl wieder hoch und klatscht ihn an die Wand. „Hast Du ihn?“ fragt einer der beiden anderen Polizisten. „Ja!“ brüllt der erste und schubst den Hehler zu den andern beiden rüber. „Was wollt ihr von mir? Ich hab nichts getan!“ „Ja, ja, erzähl das dem Richter!“ „Verdammt, ich bin sauber!“ „Klar doch, Theo! So sauber wie eine Kakerlake!“ Mit einer Handbewegung bedeutet der Polizist seinen beiden Kollegen, den Typen festzuhalten und wieder in die Gasse zu zerren. „Verdammt, was wollt ihr!!“ kreischt der Mann. „Theo, vielleicht lassen wir Dich ja auch wieder laufen und Du wachst morgen früh wieder neben Maria, Martina oder einer der anderen von Deinen kleinen Huren auf...“ „Was...? Was wollt ihr?“ Allmählich wird Theo panisch. Er weiß nur allzu gut, daß in letzter Zeit etliche Leute einfach von der Straße weg verschwunden sind. Zwar weiß er nicht, was mit denen passiert ist, aber rausfinden will er es nicht. Der Polizist vor Theo macht ein nachdenkliches Gesicht und meint dann: „Theo, wir haben ein paar Tips über seltsame Warenbewegungen gekriegt, darunter Gegenstände aus dem örtlichen Militärdepot. Du weißt nicht zufällig was ich meine?“ „Äh, nein, nein, meine doch, aber nicht genau....“ Der Polizist boxt ihm die rechte Faust in den Magen und Theo krümmt sich, während die andern beiden Polizisten ihn noch kräftiger festhalten. „Theo, sei lieber froh, daß wir keine Gepos sind. Und jetzt sing mal.“ „Ok...ok...da waren ein paar Typen, recht seltsam, wollten nur Drähte, dünnes Blech, Patronen, Messer, sogar Säbel und Schwerter, auch Sprengstoff und all so ein Zeug.“ „Was ist mit Segeltuch, Leinen, Nägeln, Holzstäben...?“ „Ja, auch das.“ Die drei Polizisten sehen sich an. „Wann?“ Theo ist dem Heulen nahe. „In den letzten zwei, drei Tagen. Ich hab das letzte gestern geliefert, aber vielleicht sind da noch andere...“ „Haben diese Typen schon bezahlt?“ „Ja. Alles. Bar.“ „Gut, Theo.“ Wieder boxt der Polizist Theo in den Magen und Theo muß ausspucken. „Laßt ihn los.“ Als die Polizisten ihn loslassen, taumelt Theo nach vorn und fällt auf die Knie. Seine Peiniger schlendern langsam wieder zur Hauptstraße, einer ruft noch: „Schönen Tag noch, Theo!“ Theo schaut ihnen nicht mal nach; allerdings kommt ihm die Idee, seine alte Mutter zu ihrem Geburtstag zu besuchen jetzt nicht mehr so blöd vor, wie noch in den letzten Tagen. Auf die Tour kann man gut unauffällig die Flatter aus Bludenz machen. Die Ermittlungsergebnisse der drei Polizisten erreichen freilich nicht mehr rechtzeitig die richtigen Stellen. Das schlechte Wetter hat sich mal wieder auch Wien gekrallt. In der letzten Nacht hat es den ersten Frost gegeben, jetzt ist es wieder milder, dafür hat ein furchtbarer Dauerregen eingesetzt. Ein grauer Tag. Aber Standartenführer Jörg Oschmann kümmert das nicht. Er nutzt die freie Zeit, um ein kleines persisches Restaurant im Süden der Stadt zu besuchen. Er weiß, daß dort der neue persische Militärattaché, der seit Anfang Oktober in Wien akkreditiert ist, jeden Tag gegen 18 Uhr sein Abendessen zu sich nimmt. Und – nun ja, Oschmann ist dem Herrn schon einmal begegnet. Ein Gespräch dürfte bestimmt sehr informativ sein. Als Oschmann die Tür des Restaurants öffnet, bimmelt ein kleine Glocke am Türgriff. Um diese Uhrzeit sind nicht viele Gäste da und an einem der mittleren Tische sitzt ein uniformierter Mann mit mittellangen schwarzen Haaren, mit dem Rücken zum Eingang. Nach kurzem Zögern setzt sich Oschmann dem Mann direkt gegenüber. „Hallo, Oberst Dashti.“ begrüßt er ihn. Der persische Oberst mit dem leicht rundlich wirkenden Gesicht schaut von seinem Essen auf. „Was machst Du denn hier?“ faucht er. Oschmann grinst breit. „Auf einmal beim ‚Du‘?“ „Dann hab ich weniger Skrupel zuzuschlagen.“ „Ach so. Aber lassen Sie sich nicht vom Essen abhalten, Herr Oberst.“ Ehsan Dashti nimmt seinen Teller und stellt ihn auf den nicht besetzten Tisch hinter sich, bevor er sich wieder dem ungebetenen Gast in schwarzer Uniform zuwendet. „Nein, danke. Hab keinen Appetit mehr.“ „Och...das tut mir aber leid, mein lieber Oberst.“ „Ich bin nicht Ihr lieber Oberst. Was machen Sie hier überhaupt?“ „Ich war in der Stadt, hörte, daß ein gewisser Oberst Dashti auf einmal neuer persischer Militärattaché ist und dachte mir, ich schau mal vorbei.“ „Hätten Sie sich sparen können, Standartenführer. Ich bin sicher, daß auch meine Regierung noch auf alliierter Seite in den Krieg eintreten wird und dann kann ich wieder abhauen.“ „Schade. Dabei haben wir uns so selten gesehen...Wann war noch gleich das letzte Mal? War das nicht in Bosnien, in einer zerschossenen Kirche? Dabei fällt mir ein – wie geht’s Ihrer Verletzung?“ Ehsan verzieht beim Gedanken an den Handgranatensplitter, der seinen Rücken beim Bosnieneinsatz verletzt hatte, das Gesicht. Das ist jetzt auch schon mehr als zwei Monate her. Schließlich ringt sich Ehsan zu einer Antwort durch: „Danke, so gut wie verheilt. Und was macht das Auge?“ Oschmann gibt ein ärgerliches Knurren von sich – sein Auge hat er bei der selben Gelegenheit verloren. „Ich nehme nicht an, daß Sie etwas von Kipshoven gehört haben?“ versucht Oschmann das Thema zu wechseln. Ehsan trinkt seinen Kaffee aus und überdenkt dabei die Antwort. „Nein.“ meint er schließlich. „Ich weiß nur, was man so sagt.“ „Und was sagt man so?“ „Das wissen Sie doch, Standartenführer. Daß er Reiss sucht. Und da Sie wissen, wo Reiss ist, schneit Kipshoven bestimmt noch bei Ihnen rein.“ Das Philipp vor seiner Abreise aus Russland einen Funkspruch an die persische Regierung geschickt hat, der für ihn bestimmt war, sagt Ehsan vorsichtshalber nicht. Ein blödes Grinsen aufsetzend erwidert Oschmann: „Dashti, verkaufen Sie mich nicht für blöd. Was sollte mich daran hindern, dieses Restaurant zu schließen – eines der wenigen in der Stadt, die sich nicht der Verordnung betreffs der Lebensmittelmarken angeschlossen haben?“ „Versuchen Sie es doch, Standartenführer. Dann such ich mir ein neues Restaurant.“ „Sie müssen immer den harten Kerl markieren, was?“ „Klar. Bei Arschlöchern wie Ihnen. Und wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, Standartenführer, ich hab noch einen Termin.“ Ehsan erhebt sich. Oschmann steht ruckartig auf und seine Stimme kriegt einen härteren Unterton. „Dashti, fordern Sie mich nicht zu sehr heraus.“ Sein Gegenüber zieht eine Grimasse und meint dann süffisant: „Standartenführer, ich genieße nur meine diplomatische Immunität. Meine Frau ist ja leider nicht da, damit ich sie genießen kann. Sie müssen verstehn – in Teheran fühlt sie sich wohler. Schönen Abend noch!“ Ehsan winkt dem Kellner zu, der zurücknickt und verläßt dann das Lokal. „Möchten Sie etwas?“ fragt der Kellner gestelzt den Standartenführer. Aber Oschmann schubst ihn zur Seite. „Ach, lassen Sie mich!“ Und verläßt ebenfalls das Lokal. Kurz vor Mitternacht ist es, kalt und feucht wie immer. Philipp schlürft gerade seine Suppe. Diana setzt sich neben ihn auf den klammen Baumstamm. „OK, Fraker meint, wir hätten dann alle benötigten Schaltungen. Morgen früh will er sie zusammen mit Koszarek und Deinem Bruder an die Drachen montieren.“ „Gut. Hoffentlich denkt er dran, daß alles so konstruiert sein muß, daß man die Drachen leicht auseinander-und wieder zusammenbauen kann.“ „Wieso denn das?“ will Diana wissen und schüttelt den Kopf, als Philipp ihr etwas von der Suppe anbietet. „Weil wir die Teile schließlich noch den Berg raufschleppen müssen.“ Leises Gerede irgendwo aus dem Wald läßt Philipp verstummen. Vorsichtig stellt er seine Schüssel ab und richtet sich langsam auf. Tina und Tanja kommen in die Lagermulde gesprungen und angerannt. Außer Atem bleiben sie vor ihm stehen. „Kapitän, sie sind da!“ „Wer ist da?“ fragt Diana schneller, als Philipp es kann, was ihr von ihm einen säuerlichen Blick einträgt. Dann wiederholt Philipp die Frage: „Wer ist da?“ „Der Trupp mit der Ägyptologin!“ verkündet Tanja und Tina fügt hinzu: „Verstärkt durch einen Trupp der Fleur-Division.“ Diese Information muß Philipp erstmal sickern lassen. Dann muß er seine Freude mühsam zügeln. „Na los, bringt sie her!“ „Zu Befehl.“ Tina und Tanja verschwinden wieder aus der Richtung, aus der sie gekommen waren. Diana wartet, bis sie außer Hörweite sind und fragt dann: „Fleur-Division?“ Philipp grinst breit: „Ein paar gute Freunde aus Frankreich.“ Schnellen Schrittes geht Philipp rüber zum Zelt, in dem Jacke, Koszarek und Fraker versuchen, ihre Klamotten trocken zu halten. „Leute, wir kriegen Besuch. Und wo steckt eigentlich Krammer?“ „Keine Ahnung.“ gähnt Jacke, der eben erst eingeschlafen war. „Na, dann finde ihn, Jacke! Er soll das Funkgerät wieder zum Laufen kriegen.“ „Es läuft doch schon. Wir haben gestern erst die letzten Teile wieder besorgt.“ „Na dann soll er eine Verbindung zum HQ herstellen! Und zwar flott! Jetzt geht’s erst richtig los!“ „Seit jenem Tag streiten die Historiker, was jenen Haufen antrieb, der Schattenlagant stürmte. Tief empfundene Freundschaft beim einen, eine Art Pflichtgefühl beim andern? Aber ist das nicht zweitrangig gegenüber dem, was wichtig war? Schattenlagant wurde gestürmt, ein schauderhafter Ort vernichtet und damit war der Beweis erbracht, daß den Kämpfern für die Freiheit nichts unmöglich sein würde. Ein Funken der Hoffnung für die Alliierten, furchterregendes Menetekel für die Koalition.“ Auszug aus einem Zeitungsartikel zum 50. Jahrestag des Kriegsendes Donnerstag, der 23. Oktober Zwei Stunden lang hat Philipp zusammen mit Krammer und Nicole Elsing in seinem Zelt Brigitte Fehr darüber ausgefragt, was sie noch von dieser Region hier aus der Zeit ihrer Kartierung weiß. Das meiste hatte Nicole schon zusammen mit Sabine, Heike und Solt in den letzten 24 Stunden bei einem Spähtruppunternehmen auskundschaften können. Aber ein paar Details sind dann doch noch wichtig. Für 3 Uhr nun hat Philipp zum Kriegsrat gebeten. Alle sind da. Christian Jacke, der sich eben erst rasiert und sich dabei an der linken Wange geschnitten hat, gibt sich schon ungeduldig. „Also, Kapitän, was hast Du ausgebrütet? Wie sieht unser Schlachtplan aus?“ Philipp macht mit einer Hand eine beschwichtigende Handbewegung und mahnt damit wortlos zu noch etwas Geduld. Myriam breitet derweil unter der in den Bäumen befestigten Plane, unter der sie sich versammelt haben, auf einem Holzbrett eine Karte der Region um Schattenlagant aus. Vorsichtig streicht sie sie glatt. Obwohl Philipps Englisch nicht das beste ist, hält er die Besprechung in dieser Sprache ab, damit Vaultier auch genug mitkriegt. „Ok Leute. Ich weiß, ihr seid alle einem Hilferuf unseres HQs gefolgt. Dennoch möchte ich nochmal klarstellen: Niemand muß bei dieser Rettungsoperation mitmachen. Die Beteiligung ist allein freiwillig. Wer aber mitmacht, untersteht für die Dauer der Operation meinem Kommando. Und wer aussteigen will, muß es jetzt sagen. Also: Will irgend jemand aussteigen?“ Schweigen. „Keiner will aussteigen?“ Vaultier tritt vor: „Captain, wir haben den langen Weg nicht gemacht, um jetzt zu kneifen. Ich sage: Stürmen Schattenlagant und treten wir ihnen in den Arsch. Liberté!“ Krammer tritt vor. „Schließe mich an. Für die Freiheit!“ Tanja tritt vor. „Reiss hat mich aus dem Lager Sechtem rausgeholt. Ich sage: Für die Freiheit!“ Und alle stimmen mit ein: „Für die Freiheit!“ Ein eindeutiges Votum. „Na gut.“ Philipp nickt. „Also dann folgendes: Wir schlagen an mehreren Stellen gleichzeitig zu.“ „Und wo?“ „Wir haben drei Piloten: Tanja, Sandro und Lars Edgar. Ihr drei fahrt nach Dornbirn und klaut euch auf dem dortigen Feldflugplatz drei Messerschmitts.“ „Wie er das so sagt klingt das so einfach...“ knurrt Lars Edgar. Philipp grinst breit: „Ihr dürft euch dann ein Duell mit den Flakschützen liefern. Ihr habt den längsten Weg, mit eurem Abmarsch bei der Zeit T beginnt die Operation. Der Rest von uns marschiert um T+ 20 Minuten los. Krammers Trupp überfällt den Fuhrpark in Brand um T+70 Minuten. Kurz vorher werde ich mit einer kleinen Leibgarde und einer weißen Fahne bei den Posten von Schattenlagant vorstellig geworden sein. Krammers Leute übergeben die Laster dann an Vaultier. Anschließend greifen Krammer und Solt mit möglichst vielen unserer Leute den Wildberg an. Er wird von einer kleinen Gepo-Abteilung als Flankenschutz von Schattenlagant gehalten. Er ist der einzige Berg, der etwas höher als Schattenlagant liegt. Die Nachhut dieses Trupps muß die Drachen mitschleppen. Soweit der einfache Teil.“ „Das war der einfache Teil?“ mault Sandro überrascht. „Was denn noch?“ Jacke kennt Philipp zu genügen und bemerkt nur: „Aufgepaßt, jetzt wird es lustig.“ „Allerdings. Wenn ich mit meiner Leibgarde in Schattenlagant eintreffe, werde ich dem Kommandanten ein Ultimatum zur Aufgabe stellen.“ „Das werden die Typen kaum annehmen.“ bemerkt Myriam. „Davon gehe ich aus.“ erwidert Philipp. „Der entscheidende Moment ist die Zeitmarke T+180 Minuten. Dann muß der Luftangriff von unsern drei Fliegern beginnen. Vaultier wird, verstärkt um Fraker und Koszarek, den Angriff über die Hauptzugangsstraße führen. Fraker, was machen unsere Sprengstoffvorräte?“ „Wir haben etwa 200 kg. Die Handgranaten nicht mitgezählt. Dabei fällt mir ein, ein paar Lieferanten wollen noch Kohle sehen.“ Philipp zuckt die Achseln. „Sie werden in den nächsten Tagen von unseren Agenten hören und das Geld kriegen. Interessiert mich nicht weiter.“ „Was ist mit dem Trupp, der den Wildberg gestürmt hat?“ will Solt wissen. „Gute Frage.“ stimmt Philipp zu. „Dieser Trupp wird mit den Drachen zwei Angriffswellen nach Schattenlagant übersetzen. Wenn alles geklappt hat, wird die Flak dann schon ausgeschaltet sein. Die Kämpfer, die auf dem Wildberg zurückbleiben ziehen sich dann zurück und organisieren unsere Flucht.“ Er sieht alle der Reihe nach an. „Ich habe jedem noch genaue schriftliche Anweisungen als Notiz in den Zelten hinterlassen, in denen notwendige Details ausgeführt sind. Seid euch bitte alle bewußt, daß wahrscheinlich etliche von uns nicht wiederkommen werden. Dabei fällt mir ein: Frau Fehr wird Vaultiers Leute beim Sturm über die Hauptzufahrtsstraße begleiten. Sie kennt sich dort am besten aus. Fraker, Ihnen habe ich eben noch eine Liste gegeben mit dem endgültig zu erreichenden Ausrüstungsstand.“ „Ja, schon durchgesehen. Bis auf ein paar Kleinigkeiten haben wir alles, dank Vaultiers Hilfe. Bis wann muß ich den Rest auftreiben?“ „T-Zeit ist 9 Uhr.“ „Was?“ „Ja. Wir haben auch keine Zeit für eine vorherige Einsatzübung. Der Test ist der Einsatz selbst und dann muß alles klappen.“ „Mal wieder typisch.“ knurrt Fraker. „Aber ich werds wie üblich hinkriegen.“ „Na gut. Ich schlage vor, alle Ruhen sich vorher noch aus. Ich werd ans HQ noch eine kurze Funknachricht schicken, daß es losgeht.“ Philipp nickt nochmal allen zu und geht dann rüber zu der kleinen Bodenhöhlung unter einem Baum, wo sie das Funkgerät versteckt haben. Die Runde löst sich in allgemeinem Gemurmel auf. „Kann das gut gehen?“ fragt sich Myriam. „Glaub mir, das ist absolut typisch, so typisch!“ Und durch den Äther jagt das Signal, verschlüsselt und selbst dechiffriert nur von den Kämpfern der Freiheit zu erkennen: „Es regnet, es regnet Blut – es regnet den Spielmannsfluch!“ In Safonovo sitzen Iven und Tripp an den Funkgeräten. Bereitschaftsdienst. Horchen in den Äther hinaus. Aber bislang nur der übliche funkerische Kleinkram drüben beim Gegner. Auf einmal hört Tripp auf seiner Frequenz einen Funkspruch mit auffälliger Kennung. Er schreibt ihn schnell mit, entschlüsselt ihn mit dem Schlüsselhandbuch. „Iven, ich hab was!!“ keucht er. Iven springt auf, ist mit einem Schritt bei Tripp, schaut ihm über die Schulter. „Man, das kenn ich!“ Er schnappt sich den Zettel und rennt zum Telephon, ruft beim Flughafen an. Bohnsack geht nach fast einer Minute ans Telephon. „Wer stört uns beim Skat?“ schnauzt er. „Leutnant Iven hier, Funkabteilung. Gehe ich recht in der Annahme, daß Frau General Sus bei Ihnen ist?“ „Ja, die Frau schläft ja neuerdings im Quartier von Frau Esser.“ „So wars gedacht.“ „Sie wollen Frau General sprechen?“ „Ja.“ „Sehr gut, die Frau hat erstaunliches Anfängerglück.“ „Hä?“ „Ich erklärs Ihnen ein andern Mal...So hier ist sie.“ „Karo Sus hier.“ „Hier Leutnant Iven, Funkabteilung. Wir haben gerade einen Funkspruch von Kipshoven reingekriegt.“ „Wie lautet er?“ „Es regnet, es regnet Blut – es regnet den Spielmannsfluch.“ Kurz Schweigen. Dann: „Leutnant, wecken Sie den Landgrafen. Alle Einheiten sollen sich in Bereitschaften halten. Nur bereits laufende Operationen wie die von Morgenstern auf dem Balkan werden nicht eingefroren.“ „Habe verstanden.“ „Und statten Sie Frau Rosleff-Sörensen einen Besuch ab. Sie sollte wissen, daß jetzt über ihr weiteres Schicksal entschieden wird.“ „Alles klar. Sonst noch was?“ „Nein. Alle andern wissen was zu tun ist.“ „Frau General?“ „Ja?“ „Was ist eigentlich los?“ „Iven, Iven, morgen werden wir wissen, ob Reiss tot ist oder noch lebt.“ Auch andernorts trifft die Nachricht ein. In Ankara klopft es bei Eyüp Düzarduc an die Gemächertür. Es ist Korgeneral Hassan Akdogdu, der Geheimdienstchef des Osmanischen Reiches. „Orgeneral, wir haben gerade die Mitteilung von Morgenstern gekriegt: Es geht los. In 6 Stunden holen sie Reiss raus!“ Ein paar Augenblicke braucht Eyüp, der bis eben geschlafen hat, bis die Information eingesickert ist. Dann fragt er: „Bitte?“ „Ja. Sie holen ihn raus.“ „Konsequenzen für uns?“ Erst jetzt tritt Eyüp zur Seite und läßt Hassan ins Zimmer. Hassans schwarzes Haar ist einfach nur nach hinten gekämmt, fast etwas zerzaust, offenbar hat ihn die Nachricht auch ziemlich überrumpelt. „Bislang sind wir um nichts gebeten worden. Morgenstern hat die Kommandooperationen in Bulgarien auch nicht annulliert. Allerdings wurden einige Urlauber vom Spezialbataillon 6 zurückgepfiffen worden.“ „Was ist mit dem ‚Schimäre‘-Trupp auf Sizilien?“ „Befindet sich wohl immer noch im Einsatz im Sicani-Gebirge und deckt dort den Rückzug der alliierten Truppen.“ Eyüp kratzt sich am Kinn und erinnert sich an die letzte Meldung von gestern abend: „Alliiertes Armeekommando 1 räumt Sizilien.“ Man hatte alle alliierten Truppen auf Sizilien als 1. alliierte Armee zusammengefaßt, kommandiert vom neapolitanischen General Geli. Geholfen hat es nichts. Langsam geht Eyüp auf und ab und bleibt dann direkt vor Hassan stehen. „Alle neuen Erkenntnisse, die unsere Horchposten und Agenten in dieser Angelegenheit reinkriegen werden sofort ans ‚Schimäre‘-HQ weitergeleitet. Unsere Luftwaffeneinheiten sollen sich bereithalten, vielleicht braucht ein eventueller Sonderflug Eskorte. Alle Flugplätze haben für 12 Stunden die ‚Schimäre‘-Wünsche bevorzugt zu behandeln.“ „Werde es weiterreichen.“ Hassan salutiert und verläßt den Raum. Leise zieht er die Tür hinter sich zu. Eyüp setzt sich ans Fußende seines Bettes. Bei dieser Operation ist er nur Zuschauer. Wie gerne würde er selber mitmachen. Denn es geht ums Prinzip: Wenn die Allianz nichtmal einen einzelnen, einen ihrer eigenen Leute noch dazu, retten kann – wie bitte soll sie dann die Welt vor der Koalition retten? Guido Demirci erreicht die Nachricht im Flieger Richtung Madrid. Der Co-Pilot kommt nach hinten und gibt ihm den Zettel mit der eben über Funk aufgefangenen Nachricht. Eigentlich ist auch Guido eben erst eingenickt. Er faltet den Zettel, steckt ihn in die Hosentasche und läßt sich zurücksinken. So nehmen die Dinge also ihren Lauf. Isabel würde sicher in diesem Moment ebenfalls geweckt werden, sich darüber aufregen, die Nachrichten kriegen und dann wieder Stunden brauchen, um sich zu beruhigen. Solche Dinge regten sich immer noch auf, besonders, wenn sie keinen Einfluß auf den Lauf der Ereignisse hat. Die Nachricht hat natürlich längst auch das Fischteich-Gelände in der Eifel erreicht. Andreas Beiß hat sofort die Posten verdoppeln lassen und Linda Meier-Grolman hat ihm gesagt, er soll seine Reise nach Basel – wo er sich einen neuen Hoteljob suchen sollte, um das dortige Agentennetz zu verstärken – verschieben. Jetzt steht Linda auf dem Steg, der in den größten Teich hineinreicht, atmet die kühle Nachtluft tief ein. Insgeheim hofft sie, so Antworten zu erhalten, was als nächstes geschehen wird. „Du wolltest mich sprechen?“ Jennifer ist hinter Linda aufgetaucht. Diese dreht sich um. „Ja. Ich wollte Dir etwas geben.“ „Was denn?“ Wortlos reicht Linda ihr eine Pistole und zwei Magazine. „Hat bislang Sarah Alleker gehört, aber die braucht das ja nicht mehr.“ „Hä, wieso?“ „Sie hat uns gestern abend verlassen. Bei einem Waldspaziergang hat sie mir gesagt, sie hätte keinen Bock mehr auf den Mist. Ich hab ihr neue Papiere gegeben und sie mußte ihre Waffe abgeben. Ab sofort ist sie nur noch Zivilistin.“ „Oh.“ Jennifer ist sichtlich überrascht. Aber die Ereignisse in Köln in den letzten drei Monaten haben alle etwas mitgenommen. Ganz besonders Sarah, denn schließlich ist ihre Schwester Christiane Ende August in Köln umgekommen. „Und was jetzt?“ fragt Jennifer. Linda zuckt die Schultern. „Was schon. Wir hoffen, daß Philipp den General raushauen kann.“ In der persischen Botschaft in Wien wird Ehsan vom Klingeln des Telephons geweckt. Im Dunkeln tastet er dennoch, nimmt den Hörer ab und fragt dann müde: „Ja?“ „Wir haben ein seltsames ‚Schimäre‘-Signal aufgefangen und auf Bludenz eingepeilt.“ Sofort setzt sich Ehsan im Bett auf und ist hellwach. „Und?“ „Wir haben über Ankara angefragt. Offenbar geht es wirklich los.“ „Ok. Alles klar. Sagen Sie Masdak Bescheid. Wie geplant. Wir brechen in einer Stunde nach Bludenz auf. Und lassen Sie auf dem am nächsten zu Bludenz gelegenen Flugplatz ein Flugzeug bereitstellen.“ „Ok, alles klar.“ Damit ist das Gespräch beendet, Ehsan hört noch, wie es am andern Ende der Leitung klickt, als der Hörer aufgelegt wird. Die kaiserliche Funkaufklärung kriegt von dem Funkspruch zwar auch ein Bruchstück mit. Aber die Funkaufklärung ist überwiegend Aufgabe des Heeres und des Generalstabs. Zudem kriegt man den Funkspruch nicht entziffert. Also beeilt sich niemand von der Nachtschicht damit, die Angelegenheit an die Geheimpolizei weiterzuleiten... Es ist dunkel geworden und kühl. Überhaupt ist es scheinbar zum ersten Mal Nacht geworden hier – zumindest kann sich Stefan nicht erinnern, daß es schon mal dunkel gewesen ist, seit er hier ist. Sollte er wirklich nur einen Tag hier verbracht haben? Wieviel Zeit ist eigentlich vergangen? Es ist wirklich wie ein Traum, ein zeitloser Traum. Und jedes Mal, wenn er versucht, ein Zeitgefühl zu finden, wird ihm schwindelig und das zwingt ihn, sich nicht weiter zu konzentrieren. Also starrt er wieder ins Lagerfeuer, das vor sich hinflackert. Zusammen mit Christiane sitzt er auf einem dicken Baumstamm, eine Decke umhüllt sie beide. Seinen Arm hat er um sie gelegt und streicht ihr sanft durchs Haar. Die andern hatten sich zu einem gemütlichen Essen ins Haus verdrückt, so hatten Christiane und Stefan Zeit, lange zu reden. Sie hatte ihm jedenfalls schon die Überlegung, einfach hier zu bleiben, schon mal ausgeredet. „Du würdest dann wirklich sterben. Das geht nicht. Es ist noch viel zu viel zu tun.“ Scheiße man, sie kannte ihn einfach viel zu gut. Ihn und sein Pflichtgefühl, das er in den letzten Jahren entwickelt hatte. Sie legt ihren Kopf auf seine Schulter. „Du mußt mich endlich aufgeben, Stefan.“ murmelt sie. Die Worte hallen in seinem Kopf wie ein böser Fluch. Schließlich aber ringt er sich zu einer Erwiderung durch. „Das will ich aber nicht. Noch nie hab ich eine Frau so intensiv geliebt wie Dich. Das will ich nicht aufgeben.“ Sie küßt ihn auf die Wange. „Du mußt. Wie willst Du sonst weiterleben? Es lenkt Dich nur ab und wird Dir den Tod bringen.“ „Ich dachte, ich wäre schon tot.“ „Nein, Du schläfst nur.“ „Also ist es doch nur ein Traum?“ „Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Es liegt an Dir. Was Du daraus machst. Ich kann Dir keine Antwort darauf geben. Ich kann Dir nur dieses eine Mal den groben Kurs zeigen.“ Eine Weile sitzen sie nur so da. Allmählich brennt das Feuer nieder. „Ich kann die Glut aber nicht einfach erkalten lassen.“ stellt Stefan plötzlich fest. „Sollst Du auch nicht.“ flüstert sie zurück. „Du hast mir doch mal gesagt, daß man die seelischen Energien aus Wut, Haß, Liebe nicht begraben darf, sondern eher nutzbringenderen Zwecken zufließen lassen sollte.“ „Ja, das hab ich Dir mal gesagt. Und Du verwendest es jetzt gegen mich.“ „Stefan, es war einer der wenigen intelligenten Sätze, die Du jemals gebracht hast.“ „Ah, danke.“ Ein wenig muß er schmunzeln. Dann begreift er. „Du meinst also, das ist die Entscheidung? Die Energie vom Haß, gespeist aus dem Tod meiner Familie, von meiner Wut, gespeist aus dem Tod der Frau, die ich liebe, die Enttäuschung über eine Frau, die ich liebte.“ Sie schaut ihn an. „Und die Energie aus der Liebe zu Deinen besten Freunden und aus dem Glauben an die Freiheit. All das hast Du. Eine absolut tödliche Mischung. Alles zusammen. Es ist der größte Fehler, den sie tun konnten.“ Mit ihrer Hand ergreift sie seine. „Versprich es mir.“ „Ok, Chrissi. Alles was Du willst.“ Sie schmiegt sich an ihn. Noch einmal fühlt er ihre Wärme. „Stefan, ich werd immer bei Dir sein.“ „Also laß uns nochmal zu den Waffen greifen und zu Felde ziehen.“ „Ja, noch einmal. Ein letztes Mal, nämlich immer. Du mußt jetzt gehen.“ „Jetzt schon?“ „Ja. Die Zeit hier ist anders verlaufen als in Deiner Welt.“ „Werden wir uns wiedersehen?“ „Vielleicht. Aber dann wirst Du schon tot sein. Wirklich tot. Denk nicht darüber nach, Du wirst es nicht verstehen. Und jetzt geh und tu, was Du tun mußt. Schließlich hast Du es versprochen.“ „In Ordnung.“ Er steht auf und kann seinen Blick mit einem Ruck von Christiane losreißen. Es fällt schon bedeutend leichter. Ein paar Meter weiter stehen wieder Barnet und Jolanda. Die beiden lächeln und heben zum Abschied die Hand. Stefan winkt zurück. Und dann lösen sich die Bilder vor seinen Augen auf. Bis schließlich ein Lichtblitz über ihn hereinbrandet. Er will nach Christiane schreien, aber er kann nicht, fällt statt dessen unendlich tief durch undurchdringliche Schwärze, sieht von irgendwoher blutrote Funken heranwehen. Dann beginnen rasende Kopfschmerzen, die innerhalb von scheinbar endlosen Sekunden seinen Körper über die Schulter verlassen, blaß sieht er noch das letzte Bild, daß er vor seiner Bewußtlosigkeit gesehen hat, das Bild von Petra.... Mit einem wuchtigen Schlag landet er zurück in seinem Körper, reißt die Augen auf, grelles Licht gräbt sich in seinen Sehnerv und sein Körper krümmt sich, als er nach Luft schnappt und die Lederriemen, die seine Arme und Beine fixiert halten, schneiden sich in die Gelenke... Noch während er den langen Gang entlanggeht, schnellen, harten Schrittes, knöpft sich Gephardt sein Uniformhemd zu. Es ist 7 Uhr 55 und man hat ihn gerade geweckt. Reiss ist wieder aufgewacht. Und niemand weiß wieso. Abgesehen von Nährstoffinfusionen hat ihm der Doktor nichts gegeben. Als Gephardt sich dem Verhörraum nähert, in den man Reiss wieder gebracht hat, steht davor bereits Dr. Tschirner. Und der scheint nicht gerade guter Laune zu sein. „Ach, da sind Sie ja!“ begrüßt er Gephardt. „Ja, da bin ich. Doktor, könnten Sie den Herrn jetzt unter Drogen setzen?“ „Verdammt nochmal, das wollte ich schon Ihren Leuten erklären... ich muß Reiss erst untersuchen, bevor ich beginnen kann. Wegen der Dosierung und allem. Damit er uns nicht wegstirbt. Aber Ihre Leute wollten ihn ja unbedingt erstmal verprügeln!“ „Sie wissen doch wie das hier ist, Doktor. Die jungen Männer müssen ihren Frust ablassen. Abe ich sag Ihnen was: Kommen Sie in zwei Stunden wieder, dann können Sie ihn untersuchen und unter Drogen setzen. Und dann fragen wir ihn gemeinsam aus. Ok?“ Tschirner schaut immer noch mürrisch drein, zuckt aber schließlich die Achseln. „Na gut. Bis später.“ Ohne weitere Worte tritt er an Gephardt vorbei und verschwindet in die Richtung, aus der dieser kam. Kurz schaut ihm Gephardt noch nach, dann geht er in den Verhörraum. Genau in dem Moment, als wieder eine Peitsche auf eine in einer Ecke kauernde Gestalt niedersaust. Auf Reiss‘ Rücken sind bereits jetzt mehrere blutige Striemen zu sehen. „Setzt ihn auf den Stuhl!“ donnert Gephardts Stimme. Einer der Geheimpolizisten legt die Peitsche auf den Holztisch in der Mitte des Raumes, packt Reiss am Arm, reißt ihn hoch und schleudert ihn gegen die gegenüberliegende Wand. Ein zweiter Gepo schubst Reiss dann auf den Stuhl. Eine Lippe von Reiss ist aufgeplatzt, sein Körper schon wieder grün und blau, bis oben hin angefüllt mit Schmerzen. Aber noch hält er es aus, die Aussicht, daß es bald vorbei sein wird, hält ihn aufrecht... „Wie weit seid ihr?“ fragt Gephardt. „Chef, wir haben ihm zwei Rippen gebrochen und ein wenig mit seinem kleinen Finger rumgerenkt, ein paar Stromstöße, angebrüllt, ausgepeitscht. Aber er will wohl noch nicht.“ Stefan spuckt vorsichtig Blut aus und schluckt schwer. Wie lange noch? In der Kantine sieht Petra Dr. Tschirner. „Doktor!“ ruft sie und steht auf. Der Doktor kommt an ihren Tisch. „Guten Morgen, Frau Müller. Wie geht es Ihnen?“ „Oh, gut. Hab gerade ein Käsebrötchen gegessen. Und Ihnen?“ „Viel zu viel zu tun. Ein Dutzend Mann von der Nachtschicht mußte ich krankschreiben und auf ihre Quartiere schicken.“ „Wieso das denn?“ „Eine Art von Vergiftung, aber ich kann das Gift nicht nachweisen und daher nicht dagegen behandeln. Es wirkt fast wie eine Lebensmittelvergiftung.“ „Ach Du meine Güte!“ gibt sich Petra erschrocken. Sie muß dem Herrn ja nicht auf die Nase binden, daß sie gestern abend den Inhalt ihres kleinen Giftringes in den Kaffee der Nachtschicht geschüttet hat. Über eines aber will sie Gewißheit haben: „Sagen Sie Doktor, stimmt es, daß Reiss aufgewacht ist?“ Etwas überrascht schaut Tschirner sie an. „Ja. Woher...?“ „Och Doktor, der Laden hier ist wirklich klein und überschaubar.“ Nach einem Moment das Zögerns hellt sich die Miene des Doktors auf. „Da haben Sie recht! Also dann – ich will auch noch was essen!“ „Ja, bis zum nächsten Mal, Doktor.“ Etwas hektisch verläßt Petra die Kantine und macht sich auf den Weg zu Ben. Bald würde es losgehen. Und dann müssen sie und er kampfbereit sein. Den Plan haben sie inzwischen mehrfach durchgesprochen, aber das war schließlich alles nur graue Theorie... „Sobald der erste Schuß gefallen ist, ist auch jeder noch so schöne Plan für den Arsch.“ Soldatensprichwort über die wunderlichen Pläne mancher Offiziere In den Wäldern nahe Bludenz verscharren Tina, Myriam und Dominik die zurückbleibende Ausrüstung in Gruben. Es zu verbrennen, würde zu viel Rauch aufwirbeln – im wahrsten Sinn des Wortes. Die andern packen ihren Kram zusammen. Fraker hat in letzter Minute noch alles an Ausrüstung organisieren können, was sie brauchten. Den Rest würde man sich beim Feind organisieren. Danko hat sich eben noch von seinem Kumpel Sandro verabschiedet. „Wir sehen uns bei Schattenlagant.“ Jetzt geht Danko nochmal rüber zu Philipp. „Kapitän, wäre es möglich, daß ich mich dem Trupp anschließe, der über die Hauptzufahrtsstraße angreift?“ „Sicher, General. Wieso?“ „Es ist die wahrscheinlich bequemste Tour.“ Philipp muß laut lachen, fängt sich wieder und faßt dann seine langen Haare mit einem Haargummi zu einem Pferdeschwanz zusammen. „Gute Begründung, General. Aber wir werden alle einen harten Tag haben.“ „Wenn werden Sie als Leibgarde mitnehmen?“ „Bitte, Herr General, Sie können mich Duzen. Diana, Xia Ven, Bianca und Martin werden mitkommen.“ „So wenige nur? Sicher, daß das reicht?“ „Danko, es hat zu reichen.“ „Na dann, viel Glück.“ „Danke.“ Zur selben Zeit macht Bianca an einem Baum ein paar Dehnübungen. „Was machst Du da?“ fragt Xia Ven. „Wonach sieht das wohl aus?“ flucht Bianca. „Ich versuch meinen Rücken dazu zu kriegen, nicht mehr wehzutun.“ „Oh. Sag Bescheid, wenn ich helfen soll.“ „Nein danke, kannste eh nicht.“ Sie hat ein schwarzes Kleid angezogen, daß ihr noch am meisten Bewegungsspielraum läßt, darunter Springerstiefel, trägt die langen schwarzen Haare offen, silberne Krallenringe an den Fingern und hat sich bleich geschminkt. Volles Ornat also – wie übrigens Philipp auch, der gerade seinen schwarzen Mantel überwirft. Diana und Martin tragen nur schlichte schwarze Klamotten; Diana wollte zwar auch ein Kleid, aber es war keins aufzutreiben, daß genügend Bewegungsfreiheit für die Beine beläßt – also kriegt eine schwarze Hose die Ehre. Martin sieht mit seinem weißen Hemd (die einzige Aufhellung) unter dem schwarzen Jackett fast aus wie ein Mafiosi, zumal die Brille und die gepflegt nach hinten gekämmten langen blonden Haare ihm irgendwie etwas intellektuelles verleihen. Auf beiden Seiten stecken innen im Jackett allerdings Pistolen. Xia Ven verzichtet zwar auf großartige Ausstattung – sieht man mal von einer Pistole, einem Messer am Gürtel und seinem Schwert ab -, trägt aber ebenfalls einen langen schwarzen Mantel. Seine mittellangen blonden Haare fallen offen auf die Schultern. Die andern tragen alle – außer Frau Fehr – Uniform. Philipp geht nochmal rüber zu seinem Bruder Dominik. „Und alles klar?“ „Soweit.“ „Gut. Wie geht’s den Raketen?“ „Ich hoffe, sie überstehen die Tour den Berg hoch.“ „Tja, hoffentlich.“ Die Raketen, die sie gebastelt haben, bestehen im wesentlichen aus gerolltem Blech mit Sperrholzleitwerk und einer Plastikspitze. Fraker hat die Füllung vorgenommen: Als Treibladung irgendein komisches Schwarzpulvergemisch, das das Geschoß einmalig für 10 Sekunden beschleunigt und unter der Plastikkappe instabiles, weil eigentlich schon zu altes Dynamit. Das muß es sein, damit es beim Aufschlag von selbst explodiert. 12 Raketen haben sie, jede mit 1,5 Kilo Sprengstoff. Nicht wirklich schlagkräftig, aber ein gutes Ablenkungsmanöver, das die Landung der ersten Drachenseglerwelle ermöglichen soll. Dabei kann soviel schiefgehen. Während des Transports in Dominiks Rucksack können die armlangen Raketen immer noch explodieren. Oder die Treibladung funktioniert nicht. Oder sie zerfallen vor dem Einschlag. Oder, oder, oder... „Ok, Bruder, spreng Dich nicht in die Luft.“ meint Philipp schließlich und klopft seinem Bruder auf die Schulter. „Jo, wird schon werden...“ erwidert Dominik breit grinsend und schultert den Rucksack mit den Raketen. Innerlich zählt Sabine, die nur ein paar Schritte weiter steht, schon bis drei. Das Zeug ist nicht in die Luft geflogen. Gut so. Und Fraker lacht laut, als er ihren kurz erstarrten Gesichtsausdruck sieht! Stefan fällt auf die Knie, sein Körper krümmt sich vor Schmerz, der ihm die Tränen in die Augen treibt, seine Arme verkrampfen sich. Neue Tritte in seine Flanke lassen ihn auf die Seite fallen, er hört etwas knacken. „Ups, Chef, ich glaube wir haben ihm wieder eine Rippe gebrochen.“ lacht einer der Gepos. „Ja, ja, ihr hattet euren Spaß. Laßt ihn etwas ruhen.“ Gephardts Stimme klingt unendlich fern. Irgendwer packt Stefan und schleift ihn wieder zum Stuhl. Wie lange noch? Die Zeit dehnt sich unendlich lang in einem Meer aus Schmerzen. Eine Wache kommt rein und bittet Gephardt nach draußen. Zunächst verzieht Gephardt ein mürrisches Gesicht. Aber so sind nunmal die Pflichten. „Gönnt dem Typ etwas Ruhe. Er soll uns ja nicht wegsterben.“ befiehlt er und geht nach draußen. Dort warten Leikert – der wie fast immer üblich nicht wirklich gut gelaunt ist – und Abaddon. Gephardt haßt diesen Kerl. „Was gibt’s?“ „Abaddon will, daß wir sofort Frau Müller und diesen Ben einkerkern.“ Nicht wirklich überrascht blickt Gephardt Abaddon an. „Habe nichts dagegen, Leikert. Oschmann ist schließlich nicht hier. Abaddon, reicht es Ihnen, wenn wir die beiden in Frau Müllers Quartier einsperren.“ „Völlig.“ „Ok. Leikert, Sie haben den Mann gehört. Stellen Sie vier Mann als Wachen ab.“ „Zu Befehl.“ Gephardt geht wieder zurück in den Verhörraum. Wieso die Leute ihn auch immer mit solchen Lapalien belästigen müssen. Der graue Lieferwagen steht im Schutze einiger bereits kahler Birken auf einem matschigen Feldweg. Ein paar Meter weiter steht Sandro hinter einem Busch und beobachtet mit einem kleinen Feldstecher den Flugplatz von Dornbirn, der etwa 100 m entfernt inmitten von einigen Wiesen und sporadisch verstreuter Wäldchen liegt. Nach ein paar Minuten kommt er zurück zum Wagen, wo Lars Edgar und Tanja die Karabiner laden. „Und?“ fragt Tanja nur kurz angebunden. Nach Sandro hat sie den höchsten Rang. Den Feldstecher legt Sandro wieder in den Wagen und macht dabei ein mürrisches Gesicht. „Die machen gerade eine Staffel Messerschmitts startklar.“ „Welche Ausrüstung?“ will Tanja wissen. „Unterm Rumpf werden kleine Bomben angebracht. Wohl 50 Kilo pro Bombe. Deshalb schwirren viele vom Bodenpersonal da rum und einige Wachen patrouillieren unregelmäßig am Zaun.“ Tanja lehnt sich gegen den Wagen und denkt nach. Von allen hier ist sie die einzige, die schonmal eine Messerschmitt geklaut hat. Lars Edgar hat sich an eine der Birken gelehnt, raucht vorsichtig eine Zigarette und wartet ab. Schließlich richtet sich Tanja auf. „Wirkten die Wachen sehr aufmerksam?“ fragt sie. „Nein.“ erwidert Sandro. „Überhaupt frage ich mich, wozu die hier Bomben an die Bf 109 montieren...“ „Wegen der Widerstandsgruppen in der Schweiz.“ erwidert Lars Edgar und zieht an seiner Zigarette. „Wir sind ja auch nicht hier, um darüber nachzudenken.“ wirft Tanja ein. „Wir sind hier, um drei der Dinger zu klauen. Also klauen wir sie.“ „Und wie?“ fragt Sandro mit deutlichem Zweifel in der Stimme. Tanja geht zu ihm rüber, beäugt den Lieferwagen. „Den brauchen wir wohl kaum noch, oder?“ „Oh, ich ahne furchtbares.“ murmelt Lars Edgar vor sich hin. Auch Sandro seufzt nur: „Nein, das kann nicht Ihr Ernst sein, Frau Esser.“ „Doch. Und wir sollten uns beeilen.“ „Stimmt. Wir haben nicht viel Zeit.“ Tanja nimmt das Fernglas und blickt den Feldweg entlang. „Da vorn führt der Feldweg bis auf 3 m an den Zaun heran. Da brechen wir durch.“ Die drei setzen sich wieder in den Lieferwagen, Tanja ans Steuer. Lars Edgar murmelt was von Frau am Steuer, als Tanja den Wagen anwirft und den Gang einlegt, was Sandro laut auflachen läßt. Erst setzt Tanja ein Stück weit zurück, dann drückt sie das Gaspedal durch und schaltet dabei einen Gang höher. Der Lieferwagen schießt auf den Feldweg hinaus und jagt diesen entlang. Sandro und Tibori werden kräftig durchgeschüttelt, aber das merkt Tanja nicht, sie hat nur den Zielbereich im Zaun des Flugplatzes im Blick. Die dem Zaun am nächsten stehenden kaiserlichen Soldaten starren den Lieferwagen zuerst nur fassungslos an. Der Wagen bricht durch den Zaun, säbelt ihn einfach um. Aus dem Beifahrerfenster heraus legt Lars Edgar Tibori sein Gewehr an und feuert auf etwa 60 m entfernt stehende Fäßer. Die fliegen in einem großen Feuerball in die Luft. Was freilich wiederum die Kaiserlichen aus ihrer Lethargie reißt, nachdem sie sich erstmal instinktiv in Deckung geworfen haben. Tanja stoppt den Wagen kurz. „Steuerst Du weiter?“ Lars Edgar nickt nur, Tanja und Sandro springen aus dem Wagen. Ein paar Kugeln schlagen neben ihnen ein. Sandro kniet sich hin und feuert zurück. „Zu den Fliegern!“ brüllt er. Tanja nickt und sprintet los. Sie erreicht einen Flieger, der eben losrollen will, gerade noch, springt von hinten auf eine der Tragflächen und klopft an die Scheibe. Als der überraschte Pilot aufblickt, zielt sie bereits mit dem Gewehrlauf auf ihn und bedeutet ihm die Kanzel zu öffnen. Da der Pilot weiterleben möchte, öffnet er die Kanzel und klettert heraus. Mit einem kräftigen Stoß mit dem Gewehrlauf befördert Tanja ihn nach unten. „Danke für den Flieger!“ ruft sie noch und klettert nun selbst hinters Steuer. Lars Edgar hat mit einem kurzen Seil das Steuer des Lieferwagens festgestellt und springt aus dem fahrenden Wagen raus. Der Wagen rast weiter auf zwei Bf 110 zu, die 50 m entfernt stehen. Aber darum kümmert sich Lars Edgar nicht. Auf dem Dach eines Hangars haben die Kaiserlichen offenbar ein Maschinengewehr wiederentdeckt. Die Feuerspur folgt dem zu den einmotorigen Jagdmaschinen herüberrennenden Lars Edgar dichtauf. Sandro hat sich zwar erst ein heißes Feuerduell mit drei Schützen, die hinter einer Hangartür standen geliefert, ist dann aber selber hinter einer der Messerschmitts in Deckung gegangen. Er sieht Tibori gerade noch hinter eine andere Maschine springen, als die MG-Garbe Staub aufwirbelt. Schnell feuert er nochmal in Richtung seiner neuen Freunde am Hangar, dann muß er nachladen. Was zwei Probleme ergibt: Zum einen hat er kaum noch Munition, zum andern Ladehemmung. Ganz zu schweigen von den Wachen, die nun um das Kommandanturgebäude herumgerannt kommen. Wie war das? Alles ganz einfach? Lars Edgar Tibori ist da schon weiter. Nachdem er aus dem Zielbereich des MG-Schützen weggetaucht ist, rennt er geduckt unter einem Flugzeug durch, schubst einen Mechaniker des Bodenteams zur Seite und springt auf den Flügel einer Maschine, deren Motor bereits läuft. Nach rechts sieht er, das Tanja bereits auf der Rollbahn ist. Der Pilot seiner Beutemaschine will gerade einsteigen, aber Lars Edgar rahmt ihm den Gewehrkolben in die Fresse und der Mann kippt rücklinks auf der anderen Seite des Flugzeugs zu Boden. Da packt jemand Lars Edgar am Fuß. „Was zum-...?“ Schon landet er ebenfalls rücklinks auf dem Boden, was ihn erstmal überrascht nach Luft schnappen läßt. Im selben Moment knallt es, als der Lieferwagen in die zweimotorigen Bf 110 reinfährt und der Sprit in Flammen aufgeht. Sandro wirft sein ladegehemmtes Gewehr weg und zieht seine Pistole, rennt los. Unter einem Flieger durch, feuert dabei auf zwei heranstürmende Kaiserliche, die sofort hinter einem Lastwagen, der 20 m entfernt neben den Flugzeugen steht, in Deckung springen. In dem Moment hebt Tanja vom Boden ab, zieht eine leichte Kurve von 10 Grad nach links und verschwindet dicht über die Bäume hinweggleitend nach Südwesten. Der Mechaniker, der Tibori angegriffen hat, will kurzen Prozeß machen, hat schnell einen Schraubenschlüssel zur Hand. „Verabschied Dich, Du Arschloch!“ brüllt er, holt aus und schlägt zu. Lars Edgar kann sich gerade noch zur Seite drehen, den Typen in die Seite treten und selbst wieder auf die Beine kommen. Schon muß einem Schwinger von dem Typ ausweichen, schlägt zurück, der weicht aber auch aus. Die beiden Duellanten umkreisen sich zwischen zwei Flugzeugen wie Raubtieren. Immer wieder versucht der Mechaniker mit dem Schraubenschlüssel einen Schlag anzubringen. „Tibori, spielen Sie nicht immer so viel!“ ruft Sandro, der inzwischen in dem einen der beiden Flugzeuge sitzt und gerade den Motor anwirft. Das lenkt den völlig überraschten Mechaniker für einen Moment ab. Lars Edgar tritt ihm den Schraubenschlüssel aus der Hand, versetzt ihm einen Kinnhaken und klettert dann schnell in seine Beutemaschine, deren Motor ja bereits läuft. Der Mechaniker taumelt derweil nach hinten, versucht sich am Flügel festzuhalten, rutscht ab und fällt. Sofort rappelt er sich wieder auf, da setzt sich aber die Maschine bereits in Bewegung. Geistesgegenwärtig versucht der Mechaniker nach einem der hölzernen Stopper, die man unter die Räder der Maschinen klemmt, zu greifen, stolpert aber dabei, will sich wieder aufrichten, ist jetzt aber zu nahe an den Propeller geraten. Lars Edgar ist vollauf damit beschäftigt, daß Flugzeug raus aufs Rollfeld zu steuern und bemerkt nur einmal einen kräftigen Ruck. Im nächsten Moment hat er lauter bräunliche, weißliche und vor allem rote Tropfen auf dem Fenster. Angewidert verzieht er das Gesicht, kümmert sich aber nicht weiter darum und fährt raus aufs Flugfeld. Jetzt peitschen Schüsse, eine Kugel schlägt gegen den rechten Flügel. Nur heißt es nun Augen zu und durch. Danach handelt Tibori. Er beschleunigt und jagt über die Piste. Hinter ihm rollt auch Sandro raus auf die Piste und feuert dabei aus den Bordkanonen auf die Kaiserlichen, die nun mit mehr als einem Dutzend mit Gewehren bewaffneten Männern versuchen, den Beutezug noch zu verhindern. Einen Pulk von fünf Mann zersprengt Sandro mit seinen Geschoßgarben, zwei leblose Körper bleiben liegen. Als er aus dem Augenwinkel sieht, wie Tibori abhebt und in die selbe Richtung wie Tanja entschwindet, dreht Sandro ebenfalls nach links aufs Rollfeld ein, beschleunigt – und ist Augenblicke später schon in der Luft. Die Geschoßspur einer leichten Flak jagt ihm noch hinterher, liegt aber zu kurz und zieht unter ihm hinweg. Er schwenkt leicht nach Südwesten und sieht ein paar Kilometer vor sich bereits Tanja und Lars Edgar. Er schaltet den Funk ein und stellt auf die vorher mit den beiden ausgemachte Frequenz um. „Leute, hier Sandro, wie geht’s euch?“ „Hier Angel.“ meldet sich Tanja. „Wo haben Sie solange gesteckt, Sandro?“ „Jetzt bloß nicht Mäkeln, Obergefreite Esser.“ „Sergente, hier oben bin ich Angel für Sie, verstanden? Aber mal abgesehen davon – Sie sind jetzt als Ranghöchster der Staffelführer. Also bitte – führen Sie die Formation an!“ Das läßt sich Sandro nicht zwei Mal sagen. Das Unternehmen ist doch recht gut gestartet. Erst jetzt wird Sandro bewußt, daß die ganze Aktion nur wenige Minuten gedauert hat. Einen solchen Anblick haben die Wachen an der Zufahrtsstraße zu Schattenlagant wahrscheinlich noch nie gehabt: Fünf fast vollständig schwarz gekleidete Gestalten, teilweise mit silbernen Ringen, Ketten und Nieten, darunter zwei Frauen, eine davon bleich geschminkt, dieselbige bewaffnet mit einer Armbrust, die andern mit Schwertern und Säbeln, dazu mit Handfeuerwaffen. Und der vorderste Mann, ein schlanker Kerl mit dunklem Kinnbart und langen dunklen Haaren, trägt an einem Stock eine weiße Fahne – in Ermangelung anderer Materialien aus einem weißen Hemd geschnitten. Die Wachen haben sofort zu fünf Mann mit den MPs im Anschlag die Gruppe umringt, ein Mann hat oben in der Zentrale angerufen und Philipp – eben derjenige mit der weißen Flagge – hat beschwichtigend gemeint: „Hey Freunde, wir sind hier, um uns zu ergeben.“ Demonstrativ haben er und die andern die Hände gehoben. Schließlich hat man sie mit einem Lastwagen nach oben gebracht. Nachdem man ihnen alle Waffen abgenommen hat, versteht sich. Und die weiße Flagge hat man ihnen auch abgenommen. Ein dummer Fehler: In den Vorschriften von „Schimäre“ steht, daß man sich an die mit einer weißen Flagge verbundenen Regeln hält, solange man eine hat. Hat man sie nicht mehr – nun ja...Aber das scheint sich bis zu den Gepos noch nicht rumgesprochen zu haben. Jetzt erreichen sie Schattenlagant. Erst als eine der Wachen die Plane zur Seite schlägt und die Ladeklappe runterläßt, so daß Philipp und seine Getreuen aussteigen können, erblicken sie die riesigen Mauern. „Scheiße man...“ murmelt Diana, die plötzlich nicht mehr so sicher ist, ob das alles eine so gute Idee ist. Philipp dreht sich um, um sich einen Überblick zu verschaffen. Selbst wenn er sie nicht sehen würde – er würde die Dutzenden Gewehr-und Maschinenpistolenläufe, die auf sie gerichtet sind beinahe körperlich spüren können. Doch etwas überrascht stellt Philipp fest, daß das einzige Gebäude im Innenhof der Festungsanlage das Flachdachgebäude gegenüber des riesigen Eingangstores ist. Anika hatte ihnen zwar genau Bericht über die Anlage erstattet, aber etwas schwer war es doch zu glauben. Über ihnen ist der Himmel sonnenklar – eine kurze Schönwetterperiode, wie es scheint. „Na los! Rein da!“ treiben die Wachen sie an. Die Gepos fühlen sich so sicher in Schattenlagant, Philipp und seine Leute werden nichtmal gefesselt. Als man sie in das Flachdachgebäude hereinführt, begegnet ihnen bereits Leikert. Philipp kennt ihn noch aus Bosnien. „Hi, Sturmbannführer, wie geht’s Ihnen?“ fragt Kipshoven Leikert fast fröhlich. Leikert lächelt nur kalt. „Jetzt schon sehr viel besser. Kipshoven, das ist wahrscheinlich die dümmste Aktion Ihres Lebens. Jetzt haben wir halt euch beide – Reiss und Sie!“ „Wenn Sie meinen, Sturmbannführer.“ Plötzlich muß Leikert lachen. Dann weist er die Wachen an: „Bringt die fünf nach unten. Und sagt Gephardt Bescheid. Ich ruf Oschmann an.“ „Diese verdammten Mistkerle!“ brüllt Ben und haut mit der Hand gegen die Wand. Er zuckt zusammen und bereut sofort den Schlag gegen den blanken Felsen. „Jetzt haben die uns eingsperrt!“ stellt er sauer fest. Petra zuckt die Achseln, schnallt sich ihr Schwert um, prüft nochmal die Schnürsenkel ihrer Stiefel und meint dann: „Soll uns nicht kümmern. Hast Du die geklaute Uniform an?“ Sie dreht sich um und sieht, wie Ben gerade die letzten Knöpfe zumacht. „Ja.“ knurrt er. „Und ich bevorzuge den Ausdruck ‚geliehen‘.“ Petra lädt ihre Knarre durch. „Bist Du bereit?“ „Wofür?“ „Hier abzuhauen.“ „Jederzeit.“ „Gut.“ Sie hockt sich hin und streut Salz auf den Boden, in einem Umkreis von etwa einem Meter um sich. „Was wird das denn?“ fragt er. „Wirst schon sehen.“ erwidert sie trocken. Sie stellt sich in den Salzkreis. „Stell Dich hinter mich.“ „Was?“ „Tu’s einfach.“ Ben zuckt resigniert die Schultern und stellt sich hinter sie. „Paß auf Ben, was auch immer gleich passiert, schließ die Augen, schau nicht hin.“ „Soll das eine billige Art der Anmache sein?“ „Bitte Ben, ich mein’s ernst.“ „Schon gut, schon gut. Was soll ich noch tun?“ „Halt mir ein Messer an den Hals.“ „Petra, was hast Du doch für kranke Gelüste...“ murmelt er vor sich hin; sie spart sich den bösen Blick, während er sein Messer zieht und ihr an den Hals hält. „Gut so.“ stellt sie fest. Ein paar Mal atmet sie tief durch, dann raunt sie ihm zu: „Vertrau mir.“ Und fängt dann mit dem Geschrei an: „Hiiilfeee! Hiiiilfeee! Der will mich umbringen!“ Ben zuckt zusammen und ein Gedanke schießt ihm durch den Schädel: Was soll der Scheiß? Ist sie doch eine Verräterin? Schon fliegt die Tür auf und die Wachen – insgesamt vier Gepos – stürmen herein, mit gezogener Waffe, einer brüllt: „Lassen Sie sie los!“ Noch bevor Ben die Situation überhaupt erfaßt hat, hört er Petra irgendwelche komischen Worte murmeln, irgendeine Sprache, die er nicht identifizieren kann – eventuell Latein, aber irgendwie auch nicht. Instinktiv schließt er die Augen. Er hört, wie die Tür zuknallt, die Gepos erschreckt aufschreien, dann geht ein mächtiges Sturmrauschen durch den Raum, überall. Ein unheimliches Murmeln, in das immer wieder furchtbare grelle Schreie eingebunden sind, läßt Bens Trommelfelle erdröhnen. Auf einmal verspürt Ben ein Gefühl, das er so intensiv noch niemals in seinem ganzen Leben hatte: Angst, unaussprechliche Angst. Zumal jetzt auch noch eine unangenehme Hitze nach ihm zu greifen scheint. Und durch seine Augenlider hindurch nimmt er auf einmal ein bösartiges orangenes Glühen war. Das wütende Geschrei in dem Hitzesturm wird lauter, irgendwie spürt Ben, wie etwas nach ihm greifen will. Weit, weit, weit entfernt hört Ben Petra wieder seltsame Worte murmeln – und dann ist alles von einer Sekunde auf die andere vorbei. Stille. Keine Hitze mehr. Auch das Glühen vor den Augenlidern ist weg. „Ben, kannst die Augen wieder aufmachen. Und auch das Messer vielleicht allmählich mal runternehmen.“ Wortlos läßt Ben die Klinge sinken und öffnet die Augen. Die Gepos sind weg. Dafür sieht er jetzt an der Tür und den Wänden vier schwarze Schatten mit menschlichem Umriß, von denen langsame geschwärzte Stückchen herunterrieseln. Und die Luft ist irgendwie – rauchig. Petra kickt eine verformte Pistole zur Seite und sieht, wie Ben vorsichtig einen der noch warmen Umrisse antippt. Leicht schmierig, aber fast wie Holzkohle mit etwas viel Asche und Ruß... Langsam dreht er den Kopf zu Petra. „Wie hast DU das gemacht?“ Petra tritt neben ihn und berührt ebenfalls mit einem Finger den Ruß. Angeekelt macht sie einen Schritt zurück, schluckt und meint dann: „Würde sagen, ich war den Jungs etwas zu heiß.“ Sie geht nach draußen und nach ein paar Sekunden folgt Ben ihr, wobei er versucht, seine Verunsicherung zu verbergen. „Also los.“ ruft sie ihm zu. „Du weißt, was wir zu tun haben!“ Mühsam versucht Stefan seine schnelle Atmung und seinen allzu hektischen Puls unter Kontrolle zu kriegen. Sonst würde er nicht durchhalten. Gerade gönnen ihm seine Peiniger nochmal eine Pause. Wie durch einen Schleier nimmt Stefan wahr, daß jemand hereinkommt, Gephardt etwas zuflüstert. „Bin in einer Stunde wieder da. Wartet solange.“ befiehlt Gephardt und verläßt den Raum. Das ist die Gelegenheit. Ruckartig steht Stefan auf, der Stuhl kippt um. Die beiden Gepos, die noch im Raum sind, fahren herum und sind total überrascht, einen so malträtierten Gefangenen auf einmal wieder kampfbereit zu sehen. Und Stefan wundert sich ja selber, welche Kräfte die Verzweiflung noch freisetzen kann. Der eine Geheimpolizist will ihn angreifen, um ihn wieder zur Räson zu bringen. Doch dieses Mal weicht Stefan den Schlägen aus, packt den linken Arm des Gepos, hält ihn so eisern fest, ruckt ein paar Mal – und der Gepo brüllt vor Schmerz auf, als der Arm an Ellbogen und Schulter verrenkt ist. Mit einem wütenden Knurren, bei dem er seine auffälligen Eckzähne zeigt, schleudert Stefan ihn gegen die Wand. Wie eine Holzlatte bleibt der Mann zunächst direkt an der Wand stehen, an der sich ein roter Blutfleck in Stirnhöhe bildet, dann kippt er nach hinten. Der zweite Gepo hat die Lage immer noch nicht wirklich begriffen. Statt seine Waffe zu ziehen, schnappt er sich die Peitsche und läßt sie einmal durch die Luft knallen. Als Reiss sich ihm zuwendet, meint der Gepo: „Gut, wer nicht hören kann, muß fühlen!“ Sagt’s und läßt wieder die Peitsche knallen. Blitzschnell kriegt Reiss die Peitsche gepackt – allerdings zieht er sich einen langen, blutigen und schmerzhaften Striemen an seinem rechten Unterarm dabei zu. Der überraschte Geheimpolizist kann nicht mehr rechtzeitig reagieren, als Reiss sich an der Peitsche zu ihm rüberzieht und ihm die Handunterkante gegen die Nase rammt. Mit einem Aufschrei taumelt der Mann nach hinten, Reiss greift schnell nach seinem Kopf, ein Ruck. Es knackt einmal und der Gepo sackt zusammen wie ein naßer Sack. Schwer atmend bleibt Stefan erstmal stehen und läßt sich dann auf die Tischkante sinken. Langsam blickt er an seinem blutenden Arm runter. „Tja... war ja leichter als gedacht.“ Irgendwie wundert es ihn schon, daß die Wache von draußen nicht reingekommen ist. Und erst jetzt denkt er wirklich über diesen seltsamen Umstand nach. Wie das im Leben so ist: Vieles ergibt sich von selbst. Denn schon geht die Tür auf. Stefan zuckt zuerst zusammen, in Erwartung hereinstürmender Gepos. Aber nichts dergleichen passiert. Statt dessen steht eine wunderschöne Frau in der Tür. Petra, die zwar erstaunt ist, was Stefan mit seinen Peinigern angestellt hat, aber andererseits sichtlich erleichtert wirkt, daß es ihm gut geht. „Gott sei dank, Stefan, es geht Dir gut.“ stöhnt sie, noch immer in der Tür stehend. „Aber was zum-...“ Stefan spürt wie allmählich wieder richtig Leben in seine schmerzenden Glieder fährt und erwidert nur, nun ganz wieder auf die wichtigen Dinge konzentriert: „Nicht der Rede wert. Du weißt ja, wie ich bin, wenn mir was auf den Senkel geht.“ Er geht zu dem Gepo mit dem gebrochenen Genick rüber. „Der hat etwa meine Größe.“ Während er die Uniform dem Gepo auszieht, fragt Petra: „Was soll das denn werden?“ „Na was schon? Ich sorg für eine vernünftige Tarnung. Wo soll’s zuerst hingehen?“ „In mein Quartier. Deine Sachen liegen da.“ „Sehr gut.“ Schon zieht er sich die Hose des Gepos über. Elmar liegt lang unter dem Lkw und überprüft gerade die Schläuche und die Federungen. Routinecheck und da es in den letzten Tagen viele Krankmeldungen (was wohl am beschissenen und/oder kalten Wetter liegt) gegeben hat, muß mit Elmar der Chefmechaniker des Fuhrparks ran. „Viktor!“ ruft er nach seinem Gesellen. „Viktor! Ich brauche ein neues Handtuch! Das hier ist schon durchgetränkt von Öl!“ Keine Antwort. Dafür hört Elmar ein metallisches Klicken. Er dreht den Kopf nach rechts – und starrt in den Lauf einer Pistole. Ein dunkelgrün uniformierter Soldat liegt neben dem Lkw auf dem Boden und grinst breit. „Tut mir leid, Meister, aber Viktor ist momentan indisponiert. Und jetzt schön langsam raus da!“ Der Soldat zuckt nur einmal mit der Pistole und Elmar versteht. Langsam kommt er unter dem Laster hervorgekrochen. Langsam steht er auf und hebt die Arme. Noch zwei weitere Soldaten in der gleichen Uniform halten die Waffen – in diesem Falle Sturmgewehre – auf ihn gerichtet. „Wer seid ihr denn?“ fragt Elmar total perplex. Krammer betritt in diesem Moment die Werkstatt. „Wir beantworten keine Fragen. Fesselt und knebelt ihn und bringt ihn zu den anderen in den Schuppen!“ befiehlt er. Während seine Leute den Chefmechaniker in den Schuppen bringen, der ebenso wie diese Werkstatt und ein Verwaltungsgebäude an den großen Parkplatz grenzt, meldet sich ein weiterer seiner Kämpfer zur Stelle, salutiert und meldet: „Vaultier und seine Kämpfer sind eingetroffen. Von 15 vorgefundenen Lastern sind 9 zu gebrauchen. Wir laden gerade alles auf.“ „Wunderbar. Aber beeilt euch. Wir dürfen nicht hinterm Zeitplan erhinken.“ „Zu Befehl.“ Der Soldat tritt wieder weg und Krammer geht ebenfalls wieder ins freie. Die frische Luft bei diesem klaren Wetter, das wahrscheinlich so schnell wieder verschwinden wird wie es aufgezogen ist, gefällt ihm. Es ist fast wie ein gutes Omen. Bei dem Anmarsch hatten sie einen Rückstand von fast 10 Minuten gehabt, aber die Besetzung des Fuhrparkgeländes unter Ausschaltung der Wachposten – von denen es überraschend wenige gab – ist erstaunlich glatt gelaufen. So hat man die verlorene Zeit tatsächlich wieder reinholen können. Solt hat man schon mit einem Trupp vorgeschickt Richtung Wildberg. Dort soll Solt warten, bis Krammer mit den restlichen verfügbaren Truppen eintrifft. Vaultier und seine Leute beladen gerade die Laster mit dem bißchen Ausrüstung, das sie haben: Waffen, Munition, darunter auch Bestände, die sie in einem kleinen Depot zwei Häuser weiter gefunden haben (die Wachen auch dort seltsamerweise nicht sehr aufmerksam – wahrscheinlich rechnen die Kaiserlichen in dieser Gegend nicht so sehr mit Überfällen). „Vaultier!“ ruft Krammer ihn. Schnell läuft Vaultier zu ihm rüber. „Alles klar, Krammer, Sie brauchen wir nicht mehr.“ Krammer nickt und winkt seinen Leuten zu. „Kommt, wir müssen weiter!“ Von Vaultier verabschiedet er sich mit einem kräftigen Händedruck. „Viel Glück, Colonel!“ „Ihnen auch Lieutenant-Colonel.“ Krammer nickt nochmal, dann läuft er zu seinen Kämpfern rüber, die am Tor bereits abmarschbereit warten. Und Vaultier teilt seinen Trupp ein: Zwei Laster mit zusammen 16 Mann an Bord (1 Fahrer, 1 Beifahrer, 6 Mann auf der Ladefläche) fahren vor, um die Posten an der Abfahrt Richtung Schattenlagant auszuschalten. Vaultier, Danko, Frau Fehr und die restlichen 19 Kämpfer der Fleur-Division verteilen sich auf drei weitere Laster. Einen letzten Laster fahren Christian Koszarek und Fraker. Dieser Laster wird noch einen besonderen Zweck erfüllen, denn er ist mit allem verfügbaren Sprengstoff, den Fraker auftreiben konnte, beladen. Danko hilft Brigitte auf ihren Laster. „Danke.“ meint sie lächelnd. „Na, immer doch.“ erwidert Danko liebenswürdig. „Was ist das denn?“ wundert sich Brigitte über einen Haufen Rucksäcke im vordersten Teil der Ladefläche. Vaultier, der bereits auf einer der ausklappbaren Seitenpritschen sitzt, grinst breit: „Das ist unser Fluchtweg.“ Derweil fahren die ersten beiden Laster los. Christian setzt sich gerade ans Steuer von dem Lkw, den er und Fraker fahren müssen. Auf dem Beifahrersitz sitzt Fraker auch schon und zündet sich gerade eine Zigarette an. Wie gebannt starrt Koszarek darauf. „Was ist?“ fragt Fraker schließlich. „Halten Sie das für so intelligent?“ Koszarek deutet auf die Zigarette. Fraker hält sie hoch, schaut sie sich an. „Ne, intelligent bestimmt nicht. In ein paar Jahren dürfte meine Lunge weg sein. Und?“ „Tssss...“ seufzt Koszarek nur und denkt lieber nicht an die Ladung, die sie hinten drauf haben... Standartenführer Jörg Oschmann hätte den Telephonhörer beinahe fallengelassen. „Leikert, bitte wiederholen Sie das!“ „Ja, Kipshoven hat sich vor ein paar Minuten mit vier weiteren schrägen Vögeln ergeben. Einsperren und foltern?“ Oschmann greift mit einer Hand nach einer Notiz, die eben erst auf seinem Schreibtisch gelandet war: „Wahrscheinlich unwichtig, aber kurzes, nicht zu dechiffrierendes Funksignal heute Nacht im Alpenraum aufgetaucht.“ Es fügt sich alles zusammen. Auch Ben und Petra sieht Oschmann plötzlich im richtigen Licht. „Nein, Leikert, Sie werden alle erschießen. Reiss, Kipshoven, die schrägen Vögel, Frau Müller, Ben. Und dann setzen Sie Alarmstufe 1 in Kraft. Ich werde noch heute mit einem Verstärkungstrupp unserer Reserve anrücken. Auch werde ich vom Heer die ganze Gegend abriegeln lassen.“ „Bitte, was ist los, Standartenführer?“ „Fragen Sie nicht, Leikert, tun Sie es einfach! Und beten Sie, daß ich unrecht habe.“ Oschmann knallt den Hörer auf die Gabel, nimmt wieder ab und ruft beim Flughafen an: „Hier Standartenführer Oschmann, ich brauche sofort eine Maschine Richtung Dornbirn....“ Allmählich hat Philipp genug von seinen Bewachern. An seinen Gelenkringen an den Mittelfingern schiebt er vorsichtig einen kleinen Metallstift nach vorn, wodurch eine 2,5 cm lange Stilettklinge ausgefahren wird – unheimlich scharf. Die Ringe sind Spezialanfertigungen mit einer besonders widerstandsfähigen Legierung. Genau das Richtige für einen kleinen Befreiungsschlag... Schnell tauscht Philipp noch einen Blick mit den anderen aus. Hinter jedem von ihnen geht ein Gepo, außerdem geht einer vor Philipp her. Ein paar Meter vor ihnen macht der Gang einen Knick. Perfekt. Der Gepo vor Philipp verschwindet um die Ecke. Philipp passiert sie. Und wirbelt herum. Der hinter ihm gehende Gepo kann gerade noch zwei Schritte um die Biegung machen, bevor Philipp ihm mit dem Stilett die Kehle aufschlitzt und mit einem raschen Griff die MPi entreißt. Ein kurzer Feuerstoß jagt der Wache vor Philipp in den Rücken, mit einem Aufschrei taumelt der Mann nach vorn und fällt zu Boden. Bianca packt den Gepo, der zwischen ihr und Diana geht und reißt ihn nach hinten, so daß er genau gegen Biancas eigenen Bewacher taumelt. Der feuert einen kurzen Feuerstoß gegen die Decke, Staub rieselt hernieder, dann entgleitet ihm die Waffe. Ganz hinten wirbelt gleichzeitig Xia Ven herum, stößt einen uralten Fluch aus drei Worten hervor und macht mit dem rechten Arm, die offene Handfläche nach vorn, eine ruckartige Bewegung auf den Gepo hinter ihm. Er berührt den Gepo nichtmal, aber der spürt nur noch, wie eine harte unsichtbare Wand ihn nach hinten schleudert und dabei jeden seiner Knochen bricht. 10 m weiter bleibt der Mann als ein schmerzerfüllter regloser Körper liegen. Martin hat sich zur selben Zeit um seinen Bewacher gekümmert, der so überrascht von der Aktion gewesen ist, daß er nicht wußte wohin. Noch während Martin herumwirbelt, tritt er dem Gepo die Beine weg und packt ihn am Kragen. Schleudert ihn gegen die Felswand, packt ihn wieder und schleudert ihn wieder dagegen. Mit blutüberströmten Kopf sackt der Gepo zusammen, Martin entreißt ihm die MPi. Die Bewacher von Diana und Bianca rappeln sich derweil wieder auf, einer feuert in Richtung Martin und Xia Ven, die Kugeln peitschen aber nur in die Felswand. Diana tritt dem andern Gepo die Waffe aus an der Hand, doch der Mann springt auf und packt Diana, drängt sie nach hinten. Damit gerät er aber in Philipps Schußfeld, der hinter der Ecke steht. Und abdrückt. Die Kugeln lassen den Kopf des Mannes direkt vor Diana zerplatzen, sie schreit auf, als Blut und Hirn über sie spritzen und stößt die kopflose Leiche von sich. Der letzte Gepo will auch noch nicht aufgeben, schubst Bianca zur Seite, die ihn gerade ausschalten will und rennt in die Richtung aus der sie gekommen sind – genau in eine Schußsalve von Martin hinein. Der getroffene Geheimpolizist klappt augenblicklich zusammen. Vom Adrenalinschub schwer atmend bleiben alle einen Moment lang bewegungslos stehen. Schließlich fragt Bianca: „Alle noch an einem Stück?“ „Naja, zumindest von uns.“ bemerkt Martin. Philipp läßt langsam die Waffe sinken und befiehlt dann: „Ok, holt euch eure Ausrüstung zurück.“ Er deutet auf die Rucksäcke, die die Gepos mit sich getragen haben und in denen die Ausrüstung, die sie Philipp und den andern abgenommen haben, verstaut wurde. „Und dann müssen wir weg hier. Laut Anikas Angaben sind Petra und Ben irgendwo auf der vierten oder fünften Etage zu finden. Wir befinden uns in der vierten. Also fangen wir an zu suchen.“ Er dreht sich um und geht den Gang weiter entlang. „Also los! Haben alle ihr Zeug?“ „Ja.“ ruft Xia Ven von hinten. Und Diana wischt sich fluchend mit einem Taschentuch das Hirn und Blut von Gesicht und Hals. „Bah, ist das eklig!!“ Mit der geklauten Uniform ist Ben überall durchgekommen und steuert nun den Funkraum von Schattenlagant an, der im ersten Stockwerk des in den Berg getriebenen Labyrinths liegt. Vor dem Funkraum steht eine Wache. ‚Mein Gott, die fühlen sich hier oben wirklich verdammt sicher‘, denkt sich Ben. Glücklicherweise ist die Wache ein paar Ränge unter ihm – zumindest den Abzeichen nach. Sie salutiert. „Lassen Sie mich rein.“ sagt Ben im Befehlston. Die Wache nickt, dreht sich um, um die Tür aufzumachen. Mit raschem Griff packt Ben den Kopf der Wache, ruckt einmal – knack! – und der Mann sackt tot zusammen. Dann greift Ben in seine Innentasche und zieht die Luger mit Schalldämpfer heraus. Einmal noch atmet er tief durch und öffnet dann die Tür. Vier Gepos haben gerade Funkschicht und schauen überrascht auf. Ben feuert so schnelle sein Schüsse ab, daß die vier kaum reagieren können: Zuerst trifft es die beiden Ben am nächsten sitzenden, die sofort in den Kopf getroffen werden und tot über ihrem Arbeitsplatz zusammensacken. Die beiden andern Gepos wollen aufspringen – einer wird in die Brust getroffen, sinkt auf seinen Stuhl zurück, der andere kann nur zwei Schritte machen, Ben trifft ihn zweimal und der Typ fällt gegen die Wand und rutscht an ihr herunter. Ben schaut die Waffe an. Sehr effektiv – zielgenau und unheimlich leise. „Was ist denn hier los?“ Ben dreht sich um, legt aus der Bewegung heraus die Pistole an und feuert. Trifft genau zwischen die Augen; der Gepo, der hinter ihm aufgetaucht war, taumelt an die gegenüberliegende Korridorwand und rutscht an ihr hinab, wobei zwei Tassen Kaffee zu Boden fallen: Die zweite Wache, die nur mal eben Kaffee holen wollte. Noch einmal schaut Ben in den Funkraum. Eine Handgranate holt er aus seinem Beutel am Gürtel, zieht den Stift und wirft sie in den Raum. Dann geht er zügig den Korridor entlang. Hinter sich hört er die Detonation und wird Steinbrocken herunterregnen. Verdammt, das war seine letzte. Das meiste an Ausrüstung aus Petras Geheimdepot in Köln hatten sie den in die Eifel geflohenen Widerständlern überlassen. Während er weitergeht, reißt er sich die widerlichen Gepo-Rangabzeichen von der ansonsten ja recht modischen Uniform (wen wundert’s, daß Ben die schwarze Farbe gefällt?). Jetzt will er erstmal noch in sein Quartier zurückmarschieren, Munition holen und sein Schwert und seinen schwarzen Mantel. Und dann noch für ein wenig mehr Ablenkung sorgen, um die Petra ihn gebeten hat... Den Wildberg stürmen – leichter gesagt als getan. Ein zwischen Geröll und Moosen kaum erkennbarer Trampelpfad führt steil bergauf. In langer Kolonne marschieren die Freiheitskämpfer im Eilmarsch voran. Der Trupp ist ein zusammengewürfelter Haufen: Solt mit fünf Schweizern, Grieco mit drei Italienern und Nicole Elsing führen die Kolonne an, dahinter marschieren Dominik Kipshoven, Marta Rambowicz, Tina und Myriam, Christian Jacke, Sabine Granrath und Heike Schmidt, Clarissa Junge und Chris Loewisch. Der Marsch ist anstrengend und Chris Loewisch stöhnt schon: „Verdammt, wie weit ist es noch?“ Weiter vorne lacht Jacke auf. „Halt durch, Chris. Du wirst Dir noch wünschen, wir wären nicht so bald an unserm Zielort.“ Was den Marsch natürlich erschwert, ist die Tatsache, daß alle schwer beladene Rucksäcke tragen: Die Einzelteile für die Drachen, Waffen, Kletterausrüstung.... Über ihnen ragen die Felsgrate hoch. Irgendwo da oben hockt der Feind. Jetzt zweigt die Route auf einen noch schlechter zu erkennenden Weg durch eine Geröllhalde ab, der genau auf die hochragenden Felswände zuführt. Nach ein paar Minuten beschwerlichen Vorwärtskommens gibt Solt vorne ein Zeichen, daß alle sich ducken sollen. Myriam nutzt das dazu, Tina, die sich neben ihr hinter einen Felsen kauert, einen kräftigen Stoß in die Rippen zu geben. „Hey, was soll das?“ zischt Tina leise. „Starr nicht immer die Loewisch so an...“ zischt Myriam eifersüchtig zurück. Tina schenkt ihr nur einen bösen Blick – „Später, das gehört hier nicht hin!“ -, schüttelt den Kopf und schaut dann wieder nach vorne, um zu sehen, was nun passiert. Innerlich freilich fühlt sie sich ein wenig schuldig. Sie hat vielleicht eine Sekunde zu lang die vor ihr hergehende Loewisch angestarrt – aber der Anblick dieser Frau in Uniform ist einfach ungewohnt. Philipp hatte ja angeordnet, daß alle Uniform tragen. Irgendwie hatten Fraker und Solt tatsächlich welche auftreiben können. Die Rangabzeichen freilich hat dann Diana mit wasserfester Farbe draufgepinselt. Chris Loewisch hat die Abzeichen einer Obergefreiten gekriegt; Heike und Sabine sind Unteroffiziere, Myriam Gefreite, Dominik Hauptgefreiter. Vorne huscht Grieco zu Solt und Nicole rüber, die nebeneinander im Geröll liegen und über eine Bodenwelle hinweg etwas beobachten. „Was ist los?“ flüstert er leise. Nicole deutet auf die Felswand. „Ein Klettersteig führt zur feindlichen Stellung hinauf. Natürlich haben die hier unten einen Posten zur Sicherung gelassen.“ „Wie stark?“ „Vielleicht 6 oder 7 Mann.“ murmelt Solt und nimmt den kleinen Feldstecher runter. „Vorschläge, meine Herren?“ nuschelt Nicole. „Ja.“ flüstert Solt zurück. „Grieco, Sie greifen mit Ihren Leuten von rechts an, ich mit meinen gleichzeitig von links. Elsing, Sie warten mit den anderen ab. Wenn wir die Stellung genommen haben schicken wir einen Spähtrupp nach oben und warten ansonsten Krammers Eintreffen ab.“ Er schaut auf die Uhr. „Verdammt, wir hinken schon 6 Minuten hinter dem Zeitplan her.“ „Wird schon klappen.“ gibt sich Grieco optimistisch. Sie rutschen ein Stück durch den Schotter zurück, rennen geduckt zu den andern rüber. Dann huschen Grieco und seine Italiener nach rechts, Solt und die Schweizer nach links. „Was machen die?“ fragt Jacke Nicole Elsing, als diese wieder hinter dem selben Felsen wie er in Deckung geht. „Sie heben eine kleinere Stellung aus.“ „Na toll, haben wieder Spaß und das ohne mich...“ flucht Jacke. Nicole muß sich mühevoll ein Lachen verkneifen. Sie ist sich dabei nie sicher gewesen, was sie von Christian Jacke halten soll. Der Mann ist zwar nichtmal 1 Meter 70 groß und damit einen Kopf kleiner wie die meisten seiner Kameraden, aber an Selbstbewußtsein hat es ihm nie gemangelt. Vorne geht die Schießerei los. Mehrere Einzelschüsse, gedämpfte Schreie. Die Geräusche hallen von den Felsen zurück. „Scheiße man, jetzt wissen die da oben, daß wir da sind...“ knurrt Jacke zerknirscht. Nach ein paar Minuten kommt einer von Griecos Leuten zurück und meint: „Ok, alles klar. Kommt!“ Als er sie in die eingenommene Vorpostenstellung führt, sieht Jacke ein paar Sandsäcke zwischen den Felsen, hinter denen die Gepos wohl ihr Biwak aufgeschlagen haben, von dem jetzt aber nur umgestürzte Zeltreste zu sehen sind. Daneben beginnt der Klettersteig durch den Fels. Ein leichtes MG auf Lafette ist zwei Meter weiter rechts hinter einem Felsen und zwei Sandsäcken aufgestellt. Fünf Leichen legen Solts Männer gerade hinter einen Felsen außer Sichtweite, zwei Gepos werden als Gefangene von drei Schweizern bewacht. Einer von Griecos Kämpfern hat eine Kugel in die Schulter bekommen, Grieco hockt neben ihm und schaut sich die Wunde gerade an. Chris Loewisch geht zu den beiden rüber. „Chris, können Sie Wunden verarzten?“ „Mehr schlecht als recht.“ bemerkt sie. Der Verletzte sagt etwas auf Italienisch. „Was sagt er?“ „Das es reichen muß.“ erwidert Grieco. „Ok, ich schau mal, was ich mit den paar Verbandssachen im Rucksack machen kann.“ „Danke, Chris.“ Einer der Schweizer durchsucht jetzt die zusammengesunkenen Zelte. Und findet ein Funkgerät. Es knackt und rauscht und dann: „Hey, was ist da unten los...“ Sofort ruft der Widerstandskämpfer einen seiner Kameraden mit einem der Gefangenen rüber. Dem halten sie die Waffe an den Kopf. „Ok, jetzt erzähl Deinen Kameraden was plausibles...“ Der Geheimpolizist zögert. Hörbar lädt sein Bewacher das Gewehr durch. Schließlich entschließt sich der Gepo doch dazu, so eingeschüchtert zu reagieren, daß er sich ans Funkgerät setzt und durchgibt: „Hier unten ist alles in Ordnung. Haben nur ein paar Karnickel gejagt.“ „Ok, alles klar. Bis später.“ „Ja, bis später.“ Zitternd dreht sich der Gepo zu seinen Bewachern um. „Zufrieden?“ „Fürs erste.“ meint einer der Schweizer breit grinsend. Dann lachen die beiden, während sie den Gepo zurück zu dem anderen Gefangenen schleifen. Grieco weist derweil Tina und Sabine ein: „Paßt auf, ihr geht als Spähtrupp schonmal vor, soweit ihr könnt. Sabine, Du kannst mit Deinem Zielfernrohr wahrscheinlich recht gut die feindliche Stellung da oben ausspähen. Alles klar? Also los!“ Die beiden Frauen nicken und laufen dann zu der Felswand rüber und beginnen über die in den Fels gehauenen Metallstiegen nach oben zu klettern. Solt tritt neben Grieco. „Tja, dann wollen wir hoffen, daß Krammer sich nicht zu sehr verspätet...“ Kurz hält er den Kopf unter das eiskalte Wasser, das aus dem Hahn kommt. Dann dreht er wieder ab, richtet sich auf und Petra reicht ihm ein Handtuch. Mehr schlecht als recht trocknet er die Haare ab und streicht sie mit der Hand halbwegs zurecht. „Du siehst furchtbar aus.“ stellt Petra trocken fest. „Danke. Würdest selbst Du, wenn Du aus der Gefangenschaft kämst.“ Mit der geklauten Uniform sind sie an allen Wachen vorbeigekommen. Jetzt zieht sich Stefan wieder seine eigene Uniform über. Er zieht seine Stiefel an, legt sich seinen Säbel um, steckt sein Messer und seine Tokarews ein, schnallt sich am linken Arm sein Nietenarmband um. „Das sieht bescheuert aus bei der grünen Uniform.“ „Dunkelgrün. Trotzdem – halt die Klappe, Petra.“ Sie reicht ihm sein Notizbuch und schließlich auch den schwarzen Mantel. Als er ihn anzieht meint er: „Ok. Dann kann die Party ja losgehen.“ Eine Tokarew zieht er und lädt sie durch. „Wir sollten hier verschwinden.“ schlägt Petra vor. Genau in dem Moment ertönen irgendwo in dem Korridorlabyrinth Alarmsirenen. „Ja. Verschwinden wir. Und zwar alle Mann.“ „Wie meinen?“ fragt sie. Er bleibt direkt vor ihr stehen. „Hier sind noch andere Gefangene, Petra. Und ich geh nicht ohne die.“ Mit zwei Schritten ist er zur Tür hinaus. Und läuft dort quasi Philipp in die Arme. Einen Moment lang blinzeln die Männer sich nur an. Dann: „Mensch, Stefan, da biste ja!“ „Ja, Philipp, hast Dir ja ganz schön Zeit gelassen!“ „Besser spät als nie.“ „Stimmt. So und jetzt laß uns den Rest hier rausbringen.“ „Ganz Deiner Meinung. Kennst Du den Weg?“ „Ne.“ „Aber ich kenn den Weg – so halbwegs.“ mischt sich Petra ein. „Woher?“ fragen Philipp, Stefan und auch Xia Ven wie aus einem Munde. „Ben hat ihn mir verraten.“ „Leute!“ ruft Martin von der nächsten Korridorecke. „Da kommt Besuch und der sieht nicht sehr friedlich aus!“ „Ok.“ beschließt Stefan. „Führ uns hin!“ Die Alarmsirenen hören nach nur wenigen Minuten wieder auf, zu heulen – aber bis dahin ist ja auch die ganze Garnison alarmiert. Gephardt weist gerade einen Trupp von fünf Gepos an, sich sofort den Sicherheitskräften im dritten Stockwerk anzuschließen. Der Truppführer bestätigt den Befehl und marschiert ab Richtung Treppenhaus. Das eine Stockwerk – hier vor Gephardts Büro befindet man sich im zweiten Stock – kann man auch laufen. „Standartenführer!“ Leikert kommt, Abaddon im Schlepptau, den Korridor herunter. „Standartenführer, Abaddon hat darauf bestanden, Sie sofort zu sprechen.“ „Wieso das denn? Wir haben alles in Griff.“ „Ach ja?“ will Leikert wissen. „Konnten Sie schon Kipshoven und die andern erschießen lassen?“ „Nein.“ erwidert Gephardt lapidar. „Sie haben ihre Wachen überwältigt.“ „Was gedenken Sie jetzt zu tun?“ fragt Abaddon. „Alle töten.“ erwidert Gephardt. Und an Leikert gewandt: „Leikert, Sie kommandieren die Sicherungskräfte in den unteren Stockwerken.“ „Zu Befehl.“ Als Leikert weg ist, redet Gephardt Klartext: „Abaddon, glauben Sie mir, ich weiß, was ich tue. Wir werden die Sache schon in den Griff kriegen. Die sitzen alle in den unteren Stockwerken fest. Wir müssen nur von hier oben aus nach unten hin alles durchkämmen und sie alle niederschießen.“ „Wenn Sie meinen. Aber einer von denen gehört mir.“ „Quatsch, Abaddon. Wir werden alle unterschiedslos liquidieren. Ich kann schlecht meinen Männern sagen, ballert auf alle, aber einen laßt ihr für Abaddon. Nein, wenn Sie ein paar persönliche Rechnungen klären wollen, sollten Sie selbst nach unten gehn und schneller als meine Männer sein.“ „Wissen Sie was, Standartenführer? Genau das werde ich machen.“ Ben lädt seine beiden Pistolen durch und steckt sie ein. Er legt seinen Gürtel mit dem Schwert an der einen Seite um. Steckt noch ein Kampfmesser ein. Mit der rechten Hand rückt er sich seine Brille auf der Nase zurecht. „OK, Ben, gehen wir metzeln...“ meint er zu sich selber. Er wirft seinen schwarzen Mantel über die erbeutete schwarze Uniform und verläßt sein Quartier. Es wird Zeit, ein wenig für Unruhe zu sorgen. Kaum hat er einen Fuß auf den Korridor gesetzt, brüllt jemand von rechts: „Halt! Keine Bewegung!“ Reflexartig läßt sich Ben fallen, zieht dabei seine Pistolen, rollt sich ab, feuert in die Richtung, von der die Geschosse kommen, die um ihn herum einschlagen. Wirbelt herum und ist mit einem Sprung bei der nächsten Korridorabzweigung. Hier sieht Ben gerade noch rechtzeitig etwas aufblitzen und duckt sich. Funkensprühend schrammt das Schwert des Gepos über die Felsen. Ben rennt nun geduckt in den Mann hinein und diesen dabei über den Haufen. Scheppernd landet das Schwert auf dem Boden, der Gepo rücklinks auf dem Boden. Er will sich gerade aufrappeln, als Ben ihm einen Kinnhaken verpaßt, der Kopf des Gepos nach hinten auf den Boden knallt. „Schlaf gut!“ Ben entwindet seinem bewußtlosen Gegner die MPi und rennt weiter den Korridor entlang. Zum Treppenhaus! denkt er sich – und dann nach unten, wo die andern wahrscheinlich sind! Um die nächste Korridorecke, hinter ihm hauen MPi-Garben in den Felsen. Sie sind ihm dicht auf den Fersen! Auf einmal tauchen direkt vor ihm aus einem Seitengang kommend weitere Gepos auf dem Gang auf, Ben ist schneller, feuert seine MPi leer. Einen Gepo zerlöchert er, einer wird verwundet und von seinem Kameraden zurück in den Seitengang geschleift. Damit hat Ben nicht gerechnet. Er wirft die MPi weg, zieht seine Pistolen. Aus der Richtu