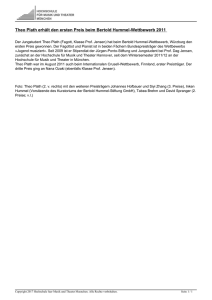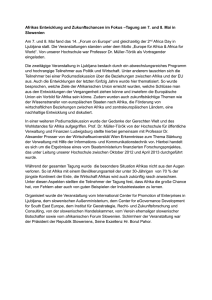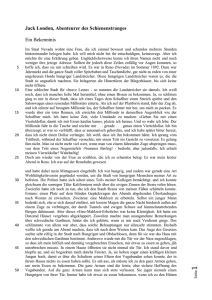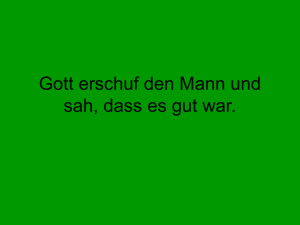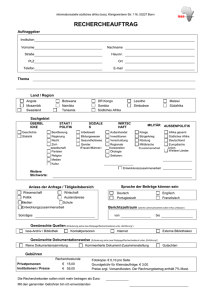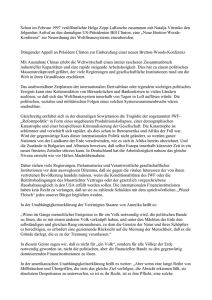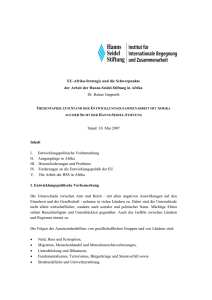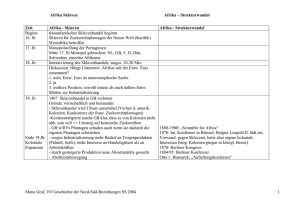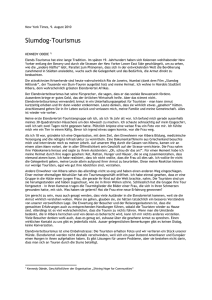Afrika1 - Online
Werbung

0 1 Edition www.online-roman.de 2 3 Erzähl mir was von Afrika Band 1 Herausgegeben von Ronald Henss Dr. Ronald Henss Verlag Edition www.online-roman.de 4 Originalausgabe März 2005 Dr. Ronald Henss Verlag Sudstraße 2 D-66125 Saarbrücken [email protected] Edition www.online-roman.de © Alle Rechte bei den Autoren Umschlaggestaltung: Ronald Henss unter Verwendung eines Fotos von Michel Quenneville (Vorderseite) und Manfred Vaeth (Rückseite) Druck und Bindung: Druckerei Pirrot Trierer Straße 7 D-66125 Saarbrücken 1. Auflage 1.000 Exemplare + Print on Demand Printed in Germany ISBN 3-9809336-2-8 5 Inhalt Über dieses Buch Vorwort des Herausgebers Carmen Caputo: Nagobi und ihre Träume Unbarmherzig brannten Sonnenstrahlen auf die staubbedeckte Erde Namibias und ließen die Luft vor Hitze flimmern. Seit Monaten hatte es nicht mehr geregnet. Die Trockenheit hatte … Didier: Babas balle Man kann beim besten Willen nicht behaupten, dass er ein besonders sympathischer Junge war, der kleine Baba. Dafür war er viel zu sehr von sich selbst überzeugt und das, was man eine große Klappe … Anne Grießer: Die Geschichte vom unglaublich fruchtbaren Opa Yongai Als Kinder fürchteten wir uns sehr vor Opa Yongai. Nicht dass er jemals etwas Böses zu uns gesagt hätte, überhaupt erhob er niemals seine Stimme, lächelte stattdessen freundlich, wenn wir an seiner … Birge Laudi: Das Buschmannohr Theo hockte zwischen Umzugskisten in der fast leer geräumten Wohnung seines Großvaters und sortierte Bücher. Wählte, welche er mitnehmen wollte. Legte beiseite, die nicht in sein Interessengebiet fielen … Hassan Aftabruyan: Als uns Kalal vom Staub erzählte Hier ist überall Staub. Es ist wirklich Staub, kein Sand, sondern feiner Staub, der sich festsetzt. Wie in Westernfilmen, in verlassenen Städten. Aber ich bin hier in keiner Stadt. Manu bin ich und im … 6 9 13 Regina Besting: Der Mann auf dem Dach Der Falke sitzt auf dem Dach. Schweigend, observierend. Sie nennen ihn den Falken weil er bevorzugt von hohen Positionen aus arbeitet. Er ist gut. Nicht der Beste, aber ausreichend für diesen Job … Christiane Stüber: Sinnverkehr(t) Eine Wolkendecke – halb Nebel, halb Luftverschmutzung – verhüllt den Berg. Wüsste man es nicht besser, könnte man fast vergessen, dass er sich dort inmitten der Stadt erhebt. Manchmal vergisst … Margit Breuss: Nachbarn „Fadi“, ruft Amina aus der Hütte, „lass die Nassara in Ruhe!“ Noch immer zucke ich zusammen, wenn ich unumwunden „Nassara“ genannt werde: „Weiße“. Jedes Mal werde ich mit der Nase auf das … V. Groß: Die Geister Afrikas Eigentlich kann ich sagen, dass ich die Trommeln Afrikas schon immer vernommen habe. Als Kind bereits, wenn ich, wie vielleicht jedes Kind, von großen Abenteuern in weit entfernten Ländern … Susanne Weinhart: Malesch, Mädchen Geisterschiffe auf dem Nil. Nach dem Terroranschlag der Islamisten in Kairo vom Dritten kreuzten nur noch fast leere, blitzende Motorschiffe auf der braunen Suppe; die langärmeligen, safaribeigen … Mila Carnel: Fräulein Afrika Liebe Tilda, dann will ich dir also noch einmal schreiben, bevor ich nach Deutschland komme, und will versuchen, deine Fragen zu beantworten. All die Zeitungsausschnitte über mich hast du … 7 Keno tom Brooks: Briewe uit Namibia, #12 Bruder Johannes Johannes saß auf dem nackten, festgetretenen sandigen Boden seines Steinhauses. Das Haus stand in einer langen gleichförmigen Reihe anderer Häuser, die wie die Glieder einer ineinander verwobenen … Anja Labussek: Ein letztes Mal – In Memoriam Karen (Tania) Blixen Wenn es auf dieser Welt einen Ort gibt, der die Bezeichnung „vollkommen“ verdient, dann ist das für mich der Gipfel des gewaltigen Ngong-Gebirges. Wie oft habe ich in den letzten siebzehn Jahren … Raiko Milanovic: Der Blick nach Süden Ich folgte dem alten Pfad durch die warme Nacht, bis ich an Großvater Apudos Zaun stieß. Hier kam ich nicht weiter, das wusste ich ja, aber meine Füße kannten den Weg, am Zaun entlang bis an das … Über die Autoren 8 Über dieses Buch Vorwort des Herausgebers Afrika – … Ronald Henss Saarbrücken, im März 2005 9 Carmen Caputo Nagobi und ihre Träume Unbarmherzig brannten Sonnenstrahlen auf die staubbedeckte Erde Namibias und ließen die Luft vor Hitze flimmern. Seit Monaten hatte es nicht mehr geregnet. Die Trockenheit hatte die Hirsefelder zerstört, auch Jams und Maniok, und erschwerte das ohnehin mühselige Leben noch mehr. Nagobi saß im Schatten der Holzhütte und sah den klaren Himmelszügen nach. Nein, Regen würde es auch die nächsten Wochen nicht geben, hatte Großvater gesagt, nicht mit diesem Himmel, nicht mit diesem Blau. Nagobi dachte nicht weiter darüber nach. Sie hatte andere Gedanken in ihrem kleinen, dunklen Mädchenkopf. In ihrem Schoß lag ein kleiner angeschmuddelter Schreibblock, der einzige Reichtum, den sie besaß. Sie schrieb gerne, die Handschrift zog flüssig über die durchgezogenen Linien, worauf sie sehr stolz war. Der Bleistift war alt und abgenutzt, nur kurze Zeit würde sie damit noch schreiben können. Geld, um einen neuen Stift kaufen zu können, besaß sie nicht. „Er muss einfach noch ausreichen“, dachte sie energisch, „ich muss es schaffen, ich muss einfach.“ Dabei fegte sie etwas Staub von ihrem bunten Kleid, das Großmutter für sie genäht hatte, und begann zu schreiben. Schon sehr früh – Nagobi hatte gerade Laufen gelernt – waren ihre Fantasie, ihr Ideenreichtum und ihre Neugier auf das Leben außerhalb des Dorfes ungewöhnlich gewesen. Nagobi fragte und fragte. Sie fragte, bis sie von den anderen Kindern belacht wurde und die Erwachsenen nur den Kopf schüttelten. 10 Die Männer ablehnend, denn Mädchen hatten nichts zu fragen, nicht in diesem Teil der Welt. Auch wenn Missionare und Hilfsorganisationen Schulen gebaut hatten und jeden Tag singende Kinder um sich scharten, tolerierten es die meisten Männer nur. Die Frauen hingegen sahen Nagobi mitleidvoll an, denn sie ahnten, was für ein Leben ihr bevorstand und sie wussten, für ein Mädchen würde es besser sein, sich dem Dorf und den Traditionen anzupassen, je früher, desto besser. Das war Großmutter Ragionis Rat: „Du musst lernen zu nicken, hörst du, Nagobi? Einfach nicken und du wirst ein gutes Leben haben.“ Nagobi nickte nicht und weder störten sie die bösen Blicke der Männer noch das Gelächter der Kinder. Je älter sie wurde, umso mehr begann sie die Welt zu hinterfragen. Eines Nachts hatte sie wach gelegen und beschlossen, einen Traum aufzuschreiben, die Seiten in eine Glasflasche zu stecken und in den Fluss zu werfen. Sie hatte an der großen Wandkarte von Mutter Rutha entdeckt, dass der kleine Fluss, der sich am Dorf entlangzieht, in den Auob mündet, der wiederum in den Malopo und der in den großen, in den Oranie, der direkt ins weite Meer hineinfließt. „Irgendjemand wird sie finden und die Welt verändern“, dachte sie, drehte sich um und schlief zufrieden ein. „Was sitzt du denn hier herum, Nagobi, es gibt genügend Arbeit für dich!“ Verbittert starrte Martita zuerst auf das Mädchen, dann auf den Block in seinem Schoß. „Schreiben ist etwas für Reiche, merk dir das doch endlich.“ Sie selbst hatte nie Schreiben oder Lesen gelernt. In ihrer Kindheit hatte auf dem Dorfplatz noch keine Schule gestanden, sie hatte nie etwas anderes gelernt als sich um Haus und Familie zu kümmern. So war das Leben, so war Martita geboren, so in Tradition erzogen; und sie hatte früh gelernt es hinzunehmen. 11 „Woher du nur diesen Unsinn im Kopf hast“, schimpfte sie weiter. Dieses Kind brachte ihr nur Ärger ein. Sogar die Dorfältesten hatten sich Gedanken über Nagobi gemacht und Martita darauf angesprochen. „Martita“, hatten sie gesagt, „Schreiben und Lesen akzeptieren wir inzwischen, aber die Fragerei deiner Tochter ist bedenklich.“ Es hatte Mutter Rutha, einer deutschen Ordensschwester, einige Monate Überzeugungsarbeit gekostet, bis die Dorfältesten zögernd den Mädchen den Besuch der kostenlosen Schule erlaubt hatten. Aber damit war ihre Einsicht auch am Ende. Eine Frau blieb schließlich eine Frau, ob mit oder ohne Bildung, darüber waren sie sich einig. „Du bist die Mutter, du musst ihr die Träume ausreden. Du musst sie auf das Leben als Frau vorbereiten.“ Martita nickte wie sie immer nickte, wie sie es gelernt hatte zu nicken. Von Großmutter. „Sie haben ja Recht“, dachte Martita, „Aber soll es ihr wirklich so ergehen wie jeder hier im Dorf? Die Zeiten haben sich verändert, vielleicht verändern sich auch die Köpfe der Menschen.“ Martita liebte ihre Tochter, vielleicht auch ein Stück ihrer Träume, vielleicht auch die Hoffnung, dass diese neue Generation Frauen, die mit Nagobi heranwuchs, stark sein würde, stärker als sie es je gewesen war. Sie war zu alt um es zu ändern, ihr Leben zu hart, als dass sie ihre Energie in Träume und Ziele hätte verschwenden können. „Ach, Mama, lass mich doch, bitte!“ Nagobi verlegte sich aufs Betteln. „Du weißt doch, ich muss schreiben. Wenn nicht heute, dann schreibe ich morgen oder übermorgen, Mama, bitte ... Morgen helfe ich dir auch wieder beim Brotbacken. Bitte ...“ „Träume! Du hast nichts als Unsinn im Kopf, schon als kleines Kind. Als ob du die Welt damit verändern könn12 test! Komm schon, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Vater wird schimpfen, wenn du die Steine nicht wäschst.“ Verständnisvoll aber unnachgiebig sah Martita in Nagobis Augen, strich ihr über das Haar und lächelte. „Meine kleine Nagobi, wenn du wüsstest, wie sehr ich mir ein besseres Leben für dich wünsche.“ Martita seufzte auf. Nagobi bemerkte die Traurigkeit in ihren Augen. „Stell dir nur vor, Mama, wie die Menschen am anderen Ende der Welt meine Worte lesen werden. Kannst du dir ihre Gesichter vorstellen? Vielleicht geht es anderen Frauen anders. Mutter Rutha erzählt uns manchmal von den Frauen in Europa, sie leben anders als wir.“ In Nagobis Stimme lag eine Art Trotz, den zu zeigen sie nur ihrer Mutter gegenüber wagte. „Nein!“ Martitas Stimme wurde hart. „Aber ich kann mir das Gesicht von deinem Vater vorstellen, wenn er heimkommt und sieht, dass du herumsitzt.“ Ohne ein weiteres Wort zu verschwenden, drehte sich Martita um und ging ins Haus zurück. „Ich beeile mich, Mama, ganz bestimmt“, rief Nagobi hinter ihr her. Sie senkte die Schultern und begann zu schreiben, Seite um Seite, unzählige Seiten, die Bücher füllen würden, wenn sie nur mehr Hefte und einen neuen Bleistift gehabt hätte ... Jeder Mensch könnte schreiben und lesen; niemand würde auf die Ungebildeten herabsehen; jede Frau würde den Männern ebenbürtig sein, kein Mensch wäre besser als der nächste; für jeden gäbe es genügend zu essen, zu trinken; die Welt würde krieglos werden; lachende Kinder überall auf der Erde, lachende Frauen; und ... und ... Nagobi schrieb und schrieb, bis auch der letzte Rest Blei verschrieben war. Langsam ertrank die Sonne gelbrot im Nebenfluss des Auob. 13 Sie lief ans Ufer hinunter und während das warme Wasser ihre nackten Füße umspülte, nahm sie die kleinen Zettel, rollte sie ineinander und steckte sie in die längliche Glasflasche, die sie seit Tagen bei sich getragen hatte. Dann warf sie sie ins mückenbedeckte Wasser und sah ihr nach, wie sie langsam mit den kaum fühlbaren Windzügen fortglitt. Nagobi dachte an Mutter und an die Steine, die sie immer noch nicht gewaschen hatte. Sie beeilte sich nach Hause zu kommen und spürte, wie sich ein warmes Gefühl in ihrem Herzen ausbreitete. Längst hatte Martita begonnen, sich Sorgen zu machen. Sie stand vor der ärmlichen Hütte und wartete. „Nagobi, wo bist du nur so lange gewesen?“ Sie nahm sie erleichtert in die Arme. Nagobi senkte schuldbewusst den Kopf und schwieg, ganz entgegen ihrer sonstigen Art, den Mund nicht stillstehen zu lassen. „Vater ist noch nicht da, geh und wasche die Steine.“ 14 Didier Babas balle Man kann beim besten Willen nicht behaupten, dass er ein besonders sympathischer Junge war, der kleine Baba. Dafür war er viel zu sehr von sich selbst überzeugt und das, was man eine große Klappe nennt, gesellte sich, wie meistens in solchen Fällen, noch dazu. Er war nicht der typische Loser und das wusste er. Und ich auch. Wenn ich mir meine Volleyballmannschaft zusammenstellte, sicherte ich mir gern Babas Künste. Zugegeben, er spielte zu eigensinnig, drosch den Ball immer gleich rüber anstatt „passe“ zu spielen, wie das Zuspiel auf Französisch heißt. Aber im Gegensatz zu den anderen Kleinen, die unbedingt immer mitspielen wollten, bekam er den Ball wenigstens über das Netz. Seine Selbstsicherheit half ihm dabei. „La balle m’aime et moi, j’aime la balle!”, erklärte mir Baba mit stolz geblähter Brust einmal nach einem wunderbar herausgespielten Punkt. Ich sehe ihn noch heute vor mir: seinen meist unbekleideten, drahtigen Oberkörper, seine kurzen, schwarzen Locken, sein breites, weißes Grinsen, seine schmuddelige kurze, rote Sporthose. Schwer zu sagen, wie alt Baba war, vielleicht zehn. Die afrikanischen Kinder bleiben ja oft länger klein und schmächtig, weil die Reisgerichte manchen Wunsch des wachsenden Kinderkörpers unerfüllt lassen. Aber zum Volleyballspielen reichte es allemal. Ich sehe auch die anderen noch alle vor mir, diesen „Kindergarten“, die versammelte Jugend von acht bis achtzehn aus der Nachbarschaft des Centers, wie sie hinter dem Haus auf dem steinigen Acker baggerten und pritschten, auf jenem unebenen Spielfeld, das ich im September in einer schweißtreibenden Sammelaktion erst bespielbar 15 gemacht hatte. Die dicken, roten Felsbrocken und die vielen kleineren Steine, die ich aufgesammelt hatte, liegen vielleicht heute noch als großer Haufen an der Rückseite des Hauses. Ich sehe auch noch vor mir, wie Baba, Martin oder Maldini – ihre richtigen Namen habe ich nie gekannt – den Ball über die hohe, graue Mauer auf das Nachbargrundstück droschen. Und Baba wohnte da irgendwo und kannte die Leute. Er war es meist, der dafür sorgte, dass der Ball bald wieder auftauchte. „Je vais checher la balle“, rief er selbstbewusst und peste über den Basketballplatz zum Haupteingang des Peuple de l’Injil um vor Ort nach dem Ball zu forschen. Meist kam „la balle“ dann in hohem Bogen über die Mauer geflogen und das Spiel ging weiter. „La balle“ – das französische Wort ist ja mit dem deutschen „Ball“ nicht ganz bedeutungsgleich, denn „la balle“ heißt eigentlich Kugel und „ballon“ ist der Ausdruck für „Ball“, aber jeder, der schon einmal im französischsprachigen Afrika gewesen ist, wird bestätigen können, dass afrikanisches Französisch seine eigenen Gesetze hat, über die jedes Mitglied der Académie Française nur die Hände überm Kopf zusammenschlagen kann. Volleyball war übrigens nur eines der Freizeit-Angebote, die unsere protestantische Missions-Außenstelle, die wir, dem muslimischen Gepräge von Conakry gemäß, als Peuple de l’Injil bezeichneten, für die Jugendlichen des Viertels bereithielten. Der Name ist ein französisch-arabischer Mix und bedeutet so viel wie „Volk des Evangeliums“. Die Nennung des arabischen Begriffs „Injil“ fungiert dabei als Wink mit dem Zaunpfahl und sollte in etwa folgende Botschaft übermitteln: „Schaut euch euren Koran mal genau an. Wir kommen auch drin vor!“ Die amerikanischen Missionare, mit denen ich zusammenarbeitete, und ich, die deutsche Aushilfskraft, benutzten freilich lieber den einprägsameren und viel kürzeren Ausdruck Center. Und das war es ja auch, dieses Haus mit Unterrichtsräu16 men, einem Lesesaal, der sonntags zum Gottesdienstraum wurde, Tischfußball, einem Garten, einer Tischtennisplatte, Basketball- und eben dem von mir eigenhändig ins Leben gerufenen Volleyballplatz: eine Anlaufstelle, ein Jugendtreff, ein Zentrum gegen Langeweile und Alltagsfrust. Dass sich mit Küche, Bad und Schlafzimmer auch meine Privatgemächer in diesem Haus befanden, war für die meisten reine Nebensache und ich als Betreuer des Centers eine zwar beliebte, aber letztlich austauschbare Figur. Das bekam ich vor allem dann zu spüren, wenn ich meiner Hauptaufgabe, Englischunterricht für Erwachsene, nachging und deswegen der Spielbetrieb in den späten Nachmittagsstunden ruhte. Da gab es manchmal wüste Klagen und Beschwerden, wie man ihnen denn den Zutritt verweigern konnte! Auch Baba, frech und vorlaut, wie er war, forderte gern sein Recht ein, die Spielanlagen benutzen zu dürfen, das er mit dem Erwerb der Peuple de l’Injil-Mitgliedskarte für den eher symbolischen Preis von umgerechnet einem Dollar uneingeschränkt und auf Lebenszeit zuerkannt bekommen zu haben meinte. Ziemlich genau ein halbes Jahr hatte ich auf diese Weise in der unbeschreiblich schwülen Tropenhitze und unter fortgesetzten Angriffen bissiger Moskitos zugebracht, als sich das ereignete, was unter dem Namen „Ereignisse vom 2. und 3. Februar“ in die jüngere Geschichte dieses bitterarmen, aber bis dahin wenigstens friedlichen Landes eingehen sollte. Es war Freitagmorgen und irgendwie war alles anders als sonst. Eine gespenstische Ruhe, die alles Leben zu lähmen schien, lag über der sonst pulsierenden Stadt. Unterbrochen wurde sie nur durch vereinzelte Knallgeräusche, die vage aus der Ferne zu mir drangen und denen ich nicht sonderlich viel Bedeutung beimaß. In dieser Stadt knallte es öfter mal. Die Ruhe rührte vor allem daher, dass die Hauptstraße zum Stadtzentrum – Hauptstraßen kann man in Conakry an einer Hand abzählen – 17 wie leer gefegt war. Nur vereinzelt fuhren dort Autos, wo sich sonst die in Europa ausgesonderten Blechkisten gegenseitig über den Asphalt jagten. Als ich bei einem Blick über die Mauer des Center-Geländes einen Armeelaster mit bis an die Zähne bewaffneten Soldaten sah, der einsam in Richtung Zentrum sauste, war mir klar, dass etwas nicht stimmte. Wenig später kam Abdourahamane, der gelegentlich für die Mission als Nachtwächter arbeitete, und erklärte: „On tire là-bas!“ („Da wird geschossen!“) Bald konnte ich sie auch auf meinem Grundstück hören: die Salven aus den Gewehren der guineischen Armee. Ausnahmezustand. Die Zeit schien den Atem anzuhalten, der Alltag aus den Angeln gehoben. Per Funk wurde ich von Dan, dem Leiter der Administrativ-Abteilung der Mission, darüber informiert, dass im Zentrum Unruhen ausgebrochen seien. Dan hörte sich ziemlich verängstigt an. Er war „en ville“ gewesen um den üblichen Papierkram zu erledigen und mitten in die Tumulte geraten. Er hatte mit ansehen müssen, wie aufgebrachte Soldaten das Innenministerium stürmten, den Minister aus seinem Büro zerrten und brutal verprügelten. Alle Missionare wurden auf Kanal 24, den alle vom Team gleichzeitig hören konnten, aufgefordert zu Hause zu bleiben. Die amerikanische Botschaft habe bereits Evakuierungsmaßnahmen ins Auge gefasst. Doch noch wolle man abwarten und vor allem dafür beten, dass Dan heil aus der Sache herauskommen möge. Denn natürlich waren Tausende auf der Flucht aus dem Stadtzentrum. Gleichzeitig hatte das Militär aber an allen wichtigen Verbindungsstraßen Sperren errichtet. Einen Steinwurf vom Center entfernt befand sich eine Tankstelle, von der es hieß, sie gehöre dem Präsidenten. Hier tummelten sich seit dem frühen Morgen einige Soldaten und noch viel mehr Zivilisten. Durch ein Loch in 18 der Wand, die das Grundstück umgab, konnte ich sehen, wie meine Nachbarn schwer beladen mit randvollen Eimern und Kanistern aus Richtung Tankstelle kamen. Als ich des besseren Panoramas wegen aufs Dach des Hauses stieg, sah ich, was los war. Plünderer waren eifrig damit beschäftigt, Benzin in Kanister zu füllen. Andere brachen Teile vom Dach ab, wieder andere flohen mit Gegenständen aus dem Verkaufsraum. Soldaten schossen immer wieder in die Luft. Es sah nach einer völlig außer Kontrolle geratenen Situation aus. Bis an den Horizont säumten Schaulustige die Straße. Sie standen als endlose Menschenkette auf den Wällen, die sich am Rand der Hauptstraße durch die Ausbauarbeiten gebildet hatten. Die wenigen Zivilwagen, die gelegentlich über die völlig vereinsamte Straße fuhren, wirkten wie Zugvögel, die den Abflug nach Süden verpasst haben. Als Abdourahamane, der es sich wie üblich, nachdem er von mir mit einem Becher Wasser versorgt worden war, auf einem der Stoffstühle auf der Veranda des Centers bequem gemacht hatte, sah, dass ich vom Dach kam, schimpfte er mit mir: Das könne ich nicht machen, das sei zu gefährlich. „Wieso“, fragte ich, „es wird doch keiner auf mich schießen!“ Das vielleicht nicht, aber es gebe immer wieder Opfer durch „balles errées“, verirrte Kugeln, zum Beispiel wenn Soldaten in die Luft schössen. Ich verstand das nicht: Wie soll man von einer Kugel getötet werden können? Wenn sie senkrecht in die Luft fliegt, kann sie doch nur als harmloses Hagelkorn wieder runterkommen, nachdem ihr die Puste ausgegangen ist. Oder sprach Abdourahamane von Querschlägern, wie ich sie aus Western kannte? Wie kann es aber Querschläger geben, wenn jemand in die Luft schießt? Oder schießen afrikanische Gewehre um die Ecke? Abdourahamane konnte sich mir nicht verständlich machen. Ich stieg trotzdem vorläufig nicht mehr aufs Dach und wenn doch, dann mit einem vagen Gefühl von Furcht. 19 Die Meuterei hatte auch ihr Gutes. Was sonst ein fast lebensbedrohlicher Akt war – das Überqueren der Hauptstraße – war heute ein Kinderspiel. Auf der anderen Seite, wo der Ortsteil Haifa beginnt, besuchte ich Samoura, einen pensionierten Soldaten aus der Volksgruppe der Yalunke. Als ich ihn vor einem halben Jahr kennen lernte, hatte er mir täglich einmal sein Knie vorgeführt, in dem sich Wasser angesammelt hatte, das operativ entfernt werden musste. Das Knie sah tadellos aus, aber er konnte die kritischen Stellen immer genau bezeichnen und wusste seinen Gesundheitszustand mit weitschweifigen medizinischen Analysen zu kommentieren. Inzwischen hatte ich mich an sein furchtbares Französisch gewöhnt. Als Yalunke sprach er jedes französische „eu“ „ee“ aus (also „Diee“ statt „Dieu“ um nur ein Beispiel zu nennen), und anfangs hatte ich kein Wort seiner Ausführungen verstanden. Dennoch war Samoura, der ständig in ein herrliches Gekicher ausbrach, ein stets unterhaltsamer, ein „formidabler“ Gastgeber. Seine Pension, die aus Frankreich bezahlt wurde, sicherte ihm und der undurchsichtigen Dutzendschar der mit ihm lebenden Angehörigen die nötige Anzahl Reissäcke und mir bei jedem Besuch eine Flasche Fanta oder Cola. Die musste einer seiner zahlreichen Sprösslinge jedes Mal eilends im Laden um die Ecke besorgen. Der alte Samoura kam mir, wie üblich mit nacktem Oberkörper und kurzer Hose, gleich entgegen, als ich den verdreckten Innenhof mit dem angeketteten Affen betreten wollte. Mit einer eigentlich unnötigen Geste wies ich auf das Geballer hin, von dem die Luft zunehmend schwanger war. „C’est les militaires“, erklärte er. Die wollten mehr Geld und begehrten gegen die Korruption auf, die verantwortlich dafür sei, dass einige Soldaten seit Monaten keinen Lohn empfangen hätten. Nun hole man sich den eben mit Gewalt. Dem Innenminister sei es schlecht ergangen. 20 Er habe dafür leiden müssen, dass der Verteidigungsminister rechtzeitig das Weite gesucht habe. Dann gehe ich, weiter in den Ortsteil Haifa eindringend, zu Sami, einem Kongolesen, der in der Firma seines Chefs eine glänzende Laufbahn vor sich hatte. Er sollte die Aufsicht über eine Druckerei führen, die Tochter des Chefs war seine Verlobte. Dann verliebte er sich in ein hübsches Mädchen, das nicht seine Verlobte war, schlief in der Nacht vor der Hochzeit mit ihr und – um es kurz zu machen – die Sache flog auf. Sami hat jetzt keine Arbeit und keine Frau und natürlich auch kein Geld mehr. Aber ein Radio hat er, mit dem man sehr gut Radio France internationale hören kann und das tun wir und hören den Bericht eines aufgeregten Reporters, der erzählt, dass der Präsident sich in einen Bunker unterhalb seines Palastes verkrochen hat. Führende Militärs haben die Unruhen offenbar für ihre Interessen genutzt. Jetzt wollen sie an die Macht, der Präsident soll gestürzt werden. Der Palast ist von Panzern umstellt und wird von Stalinorgeln und anderen schweren Geschützen beschossen. Die Präsidentengarde liefert sich mit den Aufständischen heftige Gefechte. Die Zukunft Guineas steht auf der Kippe. Als ich mich von Sami verabschiede und das Grundstück verlasse, auf dem ein gutmütiger Freund ihn umsonst wohnen lässt, schauen wir auf die Kawasaki-Niederlassung Haifa, die genau wie die Tankstelle von Vandalen-Horden geplündert wird. Letztere löst sich in den nächsten Stunden quasi in ihre Einzelbestandteile auf, am Ende werden nur noch Mauern und Metallgerüste stehen. Ich gehe, von Sami kommend, neugierig hinüber zu dem Bienenschwarm auf der Tankstelle und werde Zeuge, wie ein Soldat einen Mann mit seinem Gürtel peitscht, der sich unerlaubt an der Benzinspritze zu schaffen macht. Der Mann windet sich wie eine Hyäne unter den Schlägen, aber er weicht nicht. Da schießt 21 der Soldat mehrmals in die Luft. Ein Kollege tut es ihm gleich. Das laute Geknatter ist mir nicht geheuer. Das Chaos, das hier herrscht, noch weniger. Mir wird ziemlich mulmig zumute. Ich spüre, dass die Stimmung jederzeit kippen und es zu Blutvergießen kommen kann. Die Bilder vom Völkermord in Ruanda kommen hoch. Als ich den wilden Haufen hinter mir lasse und die paar Schritte zum Center zurücklege, stoße ich auf Michel, einen Nachbarn vom Volksstamm der Toma. Michel gehört auch zum Militär. Bisher habe ich ihn nur in Zivil gesehen. Richtig Furcht einflößend kommt er mir jetzt vor: Er hat seine grüne Militäruniform angezogen und sich ein Militärfahrzeug unter den Nagel gerissen, neben dem er jetzt stolz posiert. Bewaffnet ist er natürlich auch. Anscheinend hat der Jeep kein Benzin mehr, aber das Problem lässt sich mit einem der vielen Eimer lösen, die an diesem Tag schon durch das Viertel getragen wurden. Wie immer verstehe ich nur die Hälfte von dem, was die Nachbarn mir erzählen. Aber so viel ist auch mir klar: Eigentlich sollte Michel mit dem Militärfahrzeug nicht hier und nicht jetzt stehen. Als es dunkel wird und aus Richtung Zentrum immer noch Gewehr- und Geschützfeuer zu hören ist, muss ich an Silvester denken: Ja, so hört es sich bei uns zu Hause nur zwischen null und ein Uhr am ersten Tag des Jahres an. Silvesterstimmung will trotzdem nicht recht aufkommen. Am nächsten Morgen kam das große Geheule. Wenn in Afrika jemand stirbt, ist die Trauer vielleicht nicht größer als bei uns, nur in jedem Fall viel besser zu hören. Kalil, der manchmal als Nachtwächter im Center ausgeholfen und wie Abdourahamane ein gewaltiges Alkoholproblem hat, dem bereits eine vorteilhafte Karriere bei der Polizei zum Opfer gefallen ist, macht ein ernstes Gesicht, als er morgens zu mir auf die Veranda tritt. So ernst ist er sonst nicht. Meistens reißt er Witze, schlägt einem auf die Schulter und lacht laut dazu. Unnötig zu erwähnen, dass er 22 sich mit Samoura bestens versteht und gewissermaßen dessen Protégé ist. Kalils ernste Miene alarmiert mich: Etwas Schlimmes ist passiert. „C’est le petit Baba!”, erklärt er mir, indem er kurz mit dem Kopf in Richtung des unüberhörbaren Gewimmers aus der Nachbarschaft deutet. „Quoi?“, rufe ich ebenso ungeduldig wie bestürzt aus. „Il est mort. C’était une balle errée!“ Balle errée, dieser französische Ausdruck, den ich gestern erst gelernt habe und als Gefahr nicht ganz ernst nehmen konnte! Jetzt erschrecke ich über meine Unbedarftheit. In knappen Worten schildert mir Kalil, was geschehen ist: Baba war auf dem Markt in Taouyah um an den wenigen besetzten Ständen für die Familie ein paar dringende Besorgungen zu machen: Reis vielleicht, Gemüse, Speiseöl. Dann habe es einen dieser typischen afrikanischen Tumulte gegeben: Niemand weiß, wer angefangen hat, kaum jemand, worum es eigentlich geht, aber laut wird es, so laut wie jetzt das Trauergeschrei – und handgreiflich. Und in Tagen wie diesen kann so etwas rasch eskalieren – bis hin zu Waffengewalt. Ein paar Soldaten standen in der Nähe, ein paar Schüsse fielen – niemand wurde verletzt, nur einer getötet: ein Unbeteiligter, ein Unschuldiger, ein kleiner Junge in einer kurzen, roten Hose, der für seine Mama ein paar Lebensmittel einkaufen wollte. Balle errée. Ausgerechnet Baba, denke ich, der Treffsichere, der Zielgenaue, der mit dem Ball so selbstbewusst umzugehen wusste, der, wie er einmal sagte, den Ball liebt und der Ball ihn, ausgerechnet Baba trifft diese tödliche balle errée. Es ist ein blöder Witz des Schicksals, denke ich traurig, ein selten blöder Witz, über den niemand lachen kann. „On va aller?“, fragt Kalil. Die Höflichkeit und der Respekt gebieten, dass ich mich im Kreise der Trauernden 23 blicken lasse, erklärt er mir, als ich Unsicherheit zeige, ob man mich als Weißen denn dort sehen möchte. Wie ein Schatten sitzt Babas Mutter nur ein paar Häuser weiter in vornehmer Trauerkleidung auf einem Schemel unter dem Unterstand der einfachen Blechdachbehausung. Vom Vater, wie so oft in diesem Land, keine Spur. Wer weiß, ob er je vom Tod seines Sohnes erfahren wird. Alles, was in der Nachbarschaft an Stühlen verfügbar war, steht im vergleichsweise großen Innenhof, der in gleißendes Licht getaucht ist. Die Sonne kennt auch heute keine Gnade. Als ich, von Kalil geleitet, in der Trauergesellschaft auftauche, ernte ich wohlwollende Blicke. Wie gut, dass es Kalil gibt, denke ich. Mir wird ein Stuhl angeboten, dann bekomme ich Wasser. Und dann sitze ich und sitze und warte darauf, dass etwas passiert. So ist Afrika. Schließlich bildet sich eine lange Reihe. Ich stehe auf und reihe mich mit Kalil ein in den Zug der Trauernden. Wortlos ziehen sie an der verwaisten Mutter vorbei. Ich imitiere meinen Vorgänger und schüttele ihr die lahme Hand – mehr nicht. Ich muss kein Wort sagen. Keine klingenden Schellen, keine Beileidsfloskeln, keine formelhaften Lippenbekenntnisse werden mir abverlangt. Mir gefällt dieses schweigende Vorüberziehen, dieses Verstummen vor der Urgewalt des Todes. Am Montag ist der Spuk vorbei. Der sichtlich angeschlagene Präsident hält in betont einfacher Militärmontur – er hatte sich ja Mitte der Achtziger als General selbst an die Macht geputscht – im guineischen Staatsfernsehen eine Ansprache und erklärt: Die Lage ist unter Kontrolle, die Ordnung wiederhergestellt, die Schuldigen werden bestraft. Mein Kollege Dan konnte übrigens unbeschadet aus dem Gewühl im Zentrum entkommen. Michel hatte weniger Glück: Er wurde ein paar Wochen später verhaftet und im Gefängnis – sagen wir’s mal vorsichtig – nicht gut behan24 delt. Sein Schicksal steht stellvertretend für das vieler höherrangiger Militärs. Ach ja, und Samoura: Es ist kaum zu glauben – das alte Regime hat den Mann, der schon unter den Franzosen diente, doch tatsächlich reaktiviert. Samoura ist wieder Soldat! Die Uneinigkeit der Meuternden, so ist später zu hören und zu lesen, hat sie am Ende in diesem dreitägigen Kräftemessen den Sieg gekostet. Und den Präsidenten hat es seinen ersten Wohnsitz gekostet: Der Palast, ein 62 Millionen Dollar teures Prestigeobjekt, ist nur noch eine Ruine. Obdachlos ist der alte General trotzdem nicht geworden ... Etwa sechzig Todesopfer – das ist die offizielle Zahl – hat der gescheiterte Putschversuch gefordert, allein zwanzig durch so genannte verirrte Kugeln. Und einer von ihnen, einer von diesen vielen namenlosen Toten, hatte für mich ein Gesicht, das bis heute nicht ganz verblasst ist. 25 Anne Grießer Die Geschichte vom unglaublich fruchtbaren Opa Yongai Als Kinder fürchteten wir uns sehr vor Opa Yongai. Nicht dass er jemals etwas Böses zu uns gesagt hätte, überhaupt erhob er niemals seine Stimme, lächelte stattdessen freundlich wenn wir an seiner Hütte vorüberhuschten. Er saß bei Tag und Nacht auf seiner Veranda, wo er aß, im Sitzen schlief, Geschichten erzählte und schließlich starb. Manchmal hob er langsam die Hand und winkte uns zu, doch ich sollte elf Jahre alt werden, bis ich mich zum ersten Mal in seine Nähe traute. Es waren die Vögel, vor denen ich mich am meisten fürchtete. Ständig flatterten und piepsten sie rund um Opa Yongais Kopf, besonders wenn gerade junge Regendommler geschlüpft waren. Sie schissen auf die Veranda, auf die Kleider meines Großvaters, auf sein verfilztes Haar. Sie schleppten in ihren Schnäbeln lebende und tote Würmer heran, um ihre Jungen damit zu füttern. Und Opa Yongai bewegte sich nie, er war wie ein Baum mit einer mächtigen, wirren, grauhaarigen Krone. „Warum brüten die Vögel in Opa Yongais Haar?“, fragte ich meine Mutter häufig. „Das musst du ihn schon selber fragen“, antwortete sie stets. Und mit elf Jahren traute ich mich endlich. Zwischen seinen schwarzen, vollen Lippen steckte eine Marihuanazigarette, so gelb wie seine Zähne, die kreuz und quer in der dunklen Mundhöhle wuchsen, aber noch vollständig erhalten waren. „Die Vögel!“, kicherte er kindisch. „Ja, ja, die Vögel.“ Er spitzte die Lippen um mir anzudeuten, dass er mir ein Geheimnis verraten würde. „Das 26 liegt, wie so vieles in meinem Leben“, flüsterte er, „an meiner unglaublichen Fruchtbarkeit.“ Ich machte große Augen. „Setz dich zu mir, mein Junge. Dann werde ich dir die ganze Geschichte erzählen.“ Zögernd ließ ich mich auf dem alten Schemel nieder, der für Besucher bereitstand. Ich achtete allerdings darauf, Opa Yongai und seinen Regendommlern nicht allzu nahe zu kommen. „Ich war damals etwa so alt wie du“, begann mein Großvater, nachdem er einen tiefen Zug genommen hatte. „Es muss also mindestens 120 Jahre her sein. Unser Dorf war damals viel kleiner und bei weitem nicht so modern. Es waren jene Zeiten, als die Ahnen noch mächtig waren, als wir nur wenig über den Islam wussten – und dennoch fromm waren.“ Er unterbrach seine Rede um Allah zu preisen, den er auf eine äußerst individuelle Art verehrte. „Im Gegensatz zu dir“, fuhr er fort und zwinkerte, „war ich ein schwächlicher Knabe. In meiner Altersklasse war ich nicht nur der Kleinste und Dünnste, sondern auch bei weitem der Ängstlichste. Selbst vor einem Regendommler fürchtete ich mich, wenn er meinen Kopf umschwirrte! Stell dir das einmal vor! Ich war ein Bild des Jammers – vor allem für meine arme Mutter, denn sie hatte neben sieben Töchtern nur mich als einzigen Sohn. Was hat sie nicht alles versucht, um einen starken Jungen aus mir zu machen! Mein Hals, die Hand- und Fußgelenke waren so üppig mit Amuletten behangen, dass ich mir einen merkwürdig schleppenden Gang zulegte, da mich die schweren Figuren fast in die Knie zwangen. Ich litt häufig unter Auszehrung und kein Heiler konnte mir helfen. Ein mächtiger Feind musste mir all diese Krankheiten auf den Leib hexen! 27 Besonders schlimm wurde es immer dann, wenn man mir den Kopf schor. Jedes einzelne verlorene Haar, so kam es mir vor, fügte mir höllische Schmerzen und schweres Fieber zu. Tagelang dämmerte ich vor mich hin, geschüttelt vom Frost, verfolgt von furchtbaren Träumen. In einem solchen Zustand, mehr tot als lebendig, zog mich meine Mutter eines Tages aus der Hütte und schleppte mich ins Nachbardorf. Dort gab es einen Wahrsager, von dem man glaubte, er könne das ganze Leben eines Kindes aus einer Hand voll Kaurimuscheln lesen. Warum wir ihn nicht schon früher aufgesucht hatten? Ganz einfach: Er war nicht eben billig. Er war, ehrlich gesagt, sogar der teuerste Wahrsager, dem ich in meinen 131 Lebensjahren begegnet bin, so teuer, dass meine Mutter den Brautpreis von vier meiner sieben Schwestern dafür ausgeben musste, damit er mir meine Zukunft voraussagte. Da siehst du, mein Junge, wie groß die Liebe meiner Mutter war. Allah möge sie preisen!“ Opa Yongai gab sich seinen Erinnerungen hin und erst als ich schon glaubte, er sei eingeschlafen, erzählte er mit unheilschwangerer Stimme weiter. „Fanon, der Wahrsager, war eine Furcht einflößende Person. Sein linkes Auge war blind, doch er konnte so beweglich damit rollen, dass nur noch das Weiße zu sehen war, während das rechte Auge völlig stillstand und gelangweilt auf das Säckchen mit den Kaurimuscheln starrte. Das Erste, was Fanon tat, nachdem wir gezahlt hatten, war, meine Mutter vor die Tür zu schicken. Er verscheuchte sie wie eine lästige Fliege. ‚Wenn ein Mann aus dem Leben eines Mannes liest’, sagte er, ‚können Frauen schlimmes Unheil anrichten.’ Er warf seine Muscheln auf den Boden und betrachtete sie so ratlos, dass ich mich schon fragte, ob mein Fall völlig hoffnungslos sei, als plötzlich ein Geistesblitz seine Züge erhellte. Er begann zu singen und seine Stimme 28 klang sehr heiser dabei. Schließlich strahlte er und schnalzte zufrieden mit den Fingern. ‚Gib mir ein Haar!’, befahl er ungeduldig. Ich erschrak. Selbstverständlich wusste ich, wie viel Schaden ein Zauberer mit Haaren oder Fingernägeln anrichten konnte. Außerdem hatte mir meine Mutter erst vor drei Tagen den Kopf geschoren – es gab also nichts auszureißen. ‚Nicht vom Kopf!’, rief der Wahrsager. ‚Wenn du am Schwanz noch keine hast, dann gib mir eine Wimper!’ Es tat weh, als ich sie mir ausriss, doch das freudige Geheul des Wahrsagers machte den Schmerz wieder wett. ‚Du Glückspilz!’, brüllte er, nachdem er die Wimper in eine Schale mit Öl getaucht und danach ins Feuer geworfen hatte, wo sie stinkend verschmorte. ‚Siehst du das Leuchten des Feuers?’, rief er begeistert. ‚Die Ahnen lieben dich!’ Das war mir neu. Aber es klang gut. ‚Nun hol deine Mutter herein.’ Ich wurde sofort wieder zur Nebenfigur, als der Wahrsager meiner Mutter erklärte, was er gesehen hatte. ‚Dieser Knabe’, begann er, ‚wird in die Geschichte eingehen als der fruchtbarste Mann, den die Ahnen je kannten. Er wird so fruchtbar sein, dass nie wieder jemand in seinem Dorf Hunger leiden muss und dass hundert Hütten nicht ausreichen werden um seinen Kindern und Enkeln ein Zuhause zu geben. Seine Feinde werden in Ehrfurcht erstarren und flüchten, sobald sie seine Fruchtbarkeit riechen. Er wird so fruchtbar sein, dass man auch in tausend Jahren noch Geschichten über ihn erzählen wird! – Jedoch nur unter EINER Bedingung!’ Meine Mutter zitterte vor Freude und Aufregung. ‚Wie lautet diese Bedingung?’ ‚Der Junge darf sich nie wieder die Haare scheren! All seine Lebenskraft sitzt allein im Haar! Nur dort kann sie 29 sich entfalten! Wenn er sich die Haare abschneidet, dann wird seine Kraft schwinden und der Knabe wird sterben. Habt ihr das verstanden?’ Wir nickten beide atemlos und meine Mutter gab dem Wahrsager vor Begeisterung auch noch den Brautpreis meiner fünften Schwester.“ Opa Yongai zündete sich eine neue Marihuanazigarette an und sagte lange nichts. Es begann zu dämmern und ich hätte eigentlich nach Hause gehen sollen, doch nun, da ich mich endlich in die Nähe des Alten getraut hatte, war ich so sehr von seiner Geschichte gefangen, dass mir jede Unterbrechung wie eine unzumutbare Störung vorkam. Mit der schwindenden Sonne hatten auch die Regendommler ihre flattrigen Umtriebe eingestellt und auf Opa Yongais Kopf kehrte Ruhe ein. „Und?“, wagte ich schließlich zu fragen. „Hat sich die Prophezeiung erfüllt?“ „Du bist ungeduldig“, tadelte Opa Yongai. „Eine Geschichte muss der Reihe nach erzählt werden. Sonst ist es keine Geschichte, sondern eine Belehrung. Und du wärst der erste Junge, den ich kenne, der sich lieber eine Belehrung als eine Geschichte anhört! Nun, was der Wahrsager mir prophezeit hatte, gefiel mir außerordentlich gut und so nahm ich es gelassen hin, wenn die anderen Jungen meiner Altersklasse mich verspotteten, weil ihre glatt geschorenen Schädel in der Sonne glänzten, während sich auf meinem Kopf ein wirres Dickicht aus drahtigem, schwarzem Haar auszubreiten begann. Ich wurde nicht mehr krank und wuchs in die Höhe, außerdem bildeten sich erste Muskeln auf meinem schlanken Körper. Meine Mutter platzte schier vor Stolz, wenn sie mich Ringkämpfe mit anderen Knaben austragen sah, bei denen ich jetzt nur noch jedes zweite Mal unterlag. Als unsere Männlichkeit zu wachsen begann, interessierten wir uns für andere Spiele. Eines Tages maßen wir uns 30 am Rande des Dorfes im Weitpissen – und obwohl mein Schwanz von allen anwesenden Knaben der kürzeste war, gewann ich den Wettbewerb doch mit großem Vorsprung. Das Wunder ereignete sich einen Tag später: Genau an der Stelle, an der mein heiliger Urin die Erde benetzt hatte, war eine Pflanze gewachsen! Und obwohl es nur ein ganz gewöhnliches, weit verbreitetes Unkraut war, so wusste ich doch in eben diesem Moment, dass der Wahrsager Recht gehabt hatte! Meine Fruchtbarkeit war so ungeheuerlich, dass ich mich fortan hüten musste, um nicht den Neid und die Missgunst aller anderen auf mich zu ziehen!“ Vorsichtig versuchte Opa Yongai mit dem Kopf zu nicken, doch obwohl die Bewegung kaum auszumachen war, purzelte ein Regendommler-Ei aus dem Nest und die empörte Vogeldame schimpfte lautstark. Opa Yongai hatte das Ei jedoch geschickt aufgefangen und platzierte es wieder in seinem Haar. „In den folgenden Jahren“, fuhr er fort, „bemühte ich mich, trotz meiner besonderen Gabe ein ganz normales Leben zu führen. Keinesfalls wollte ich meine Altersgenossen eifersüchtig stimmen! Ich ließ mir nichts anmerken und als ich ein erwachsener Mann war, nahm ich mir zunächst nur eine einzige Frau. Und nun stell dir vor, mein Junge: Die Ahnen wollten es so, dass ausgerechnet diese Frau keine Kinder gebären konnte! Nicht einmal meine außergewöhnliche Fruchtbarkeit kam dagegen an! Nun gut, dachte ich mir. Ich würde sie deswegen nicht verstoßen. Sicher war es eine Prüfung. Denn wenn überhaupt irgendjemand dieser armen Frau helfen konnte, dann war es wohl ICH mit meiner besonderen Gabe. Außerdem mochte ich Binta. Ich würde es weiterhin mit ihr versuchen und darauf warten, dass mein göttlicher Same eines Tages aufginge. Und, nun ja, ich hatte schließlich nichts zu 31 verlieren. Ich konnte mir jederzeit eine zweite und dritte Frau nehmen. Andere Dinge gewannen zu jener Zeit an Bedeutung. Der Jiwara-Bund hatte mich auserwählt, bei den rituellen Fruchtbarkeitstänzen die weibliche Antilope zu tragen! – Du musst wissen, mein Junge, dass damals vor etwa 96 Jahren die rituellen Tänze eine wesentlich größere Bedeutung besaßen als heute. Das Ernteglück des gesamten Jahres hing von ihnen ab! Die Ausdruckskraft des Tanzes entschied über Regen oder Dürre, über Heuschrecken, Läuse und Ameisen, über Fülle oder Hunger. Es war eine große Ehre, für diesen Tanz auserkoren zu sein. Er musste lange Zeit geübt werden, damit jede Bewegung stimmte und nichts schief gehen konnte. Außerdem durften nur die fruchtbarsten Männer des Dorfes tanzen. Der andere Mann, der die männliche Antilope darstellen sollte, hatte bereits fünf Söhne gezeugt und strotzte vor Gesundheit. Ich selbst hatte zwar noch keinen Sohn, doch meine Fruchtbarkeit war ohnehin legendär. Mein Haarschopf war schon damals prächtig, wenn auch nicht so außergewöhnlich wie heute. Ich trug ihn zu einem langen Zopf geflochten, den ich mir um den Bauch knotete, damit er mich nicht beim Tanzen behinderte. Trotzdem blieb noch eine Mähne von beachtlichem Ausmaß übrig, die drahtig von meinem Kopf abstand. Die Männer brauchten zwei volle Tage, um den Antilopenaufsatz darauf zu befestigen! Ob das folgende Unglück mit dieser schwierigen Zeremonie in Verbindung stand? Ich weiß es nicht und werde es wohl nie ergründen. Wie oft habe ich darüber nachgegrübelt! Ich bin nicht dahinter gekommen. Wir hatten gefastet, uns gereinigt und den Masken das ordnungsgemäße Opfer dargebracht. Wir hatten mit aller Leidenschaft getanzt, zu der wir fähig waren. 32 Und dennoch! Kurze Zeit später begann die schrecklichste Dürreperiode, die unser Dorf je heimsuchte! Die Hirse auf den Äckern verkümmerte, kaum dass sie aus der Erde lugte, kein Tropfen Regen fiel, nichts half den Pflanzen zu überleben. Der Boden bekam Risse und war bald so hart wie die Felsen im Nigerbett. Was sollte ich nur tun? An mir konnte das Unglück ja kaum liegen! Meine fürchterliche Fruchtbarkeit hat vermutlich sogar das Schlimmste noch verhindert! Vier Jahre lang fiel kein Regen, die Hirsespeicher waren jedoch schon im zweiten leer. Manche Männer verließen das Dorf, gingen in die Städte und versuchten dort Arbeit zu finden. Viele von ihnen sahen wir nie wieder. Im dritten Jahr der entsetzlichen Dürre wusste ich, dass ich etwas unternehmen musste. Wenn ICH nichts ausrichten konnte – wer konnte es dann?! Weil mein schwerer Haarschopf mich bei der Arbeit behinderte und schnelle Bewegungen sowieso unmöglich machte, hatte ich mir vor einigen Jahren das Lesen beigebracht. Immer, wenn jemand in die Stadt reiste, bat ich ihn mir einige Bücher mitzubringen, die ich im Schatten meiner Veranda lesen konnte. So hatte ich im Laufe der Zeit eine beträchtliche Bibliothek angelegt – die größte im ganzen Dorf – was zwar nicht viel zu heißen hatte, denn es war schließlich auch die einzige – aber immerhin! Als ich meine Sammlung eines Tages genauer betrachtete, schlug mein Herz schneller. Unter all den Büchern über die Behandlung von Bauchschmerzen, unter den Märchen und Fabeln und den Abenteuern des Leopardenjägers Mopti befand sich auch ein schmales Bändchen über Bewässerungssysteme und Brunnenbau. Ich hatte es bislang nicht gelesen, hatte es nach wenigen Seiten weggelegt, weil es langweilig klang und weil ich einige Wörter nicht auf Anhieb verstand. Doch nun verschlang ich es geradezu! 33 Und als ich damit fertig war, lud ich alle Männer zu mir auf die Veranda und erklärte ihnen genau, was sie tun mussten. Wie gerne hätte ich ihnen geholfen, wenn mein Haarschopf es erlaubt hätte! Nun, sie arbeiteten auch ohne mich recht ordentlich und es dauerte nicht lange, bis wir das modernste Kanalsystem der gesamten Region besaßen – und den ertragreichsten Brunnen. Die Hungersnot war bezwungen! Ich aber setzte mich auf meine Veranda und freute mich in aller Stille. Denn natürlich wollte ich keinen Dank für eine Tat, die ich gar nicht wirklich vollbracht hatte – wo es doch allein meine unerhörte Fruchtbarkeit war, die das Dorf gerettet hatte!“ „Aber was hat ...?“, unterbrach ich Opa Yongai, doch er blickte mir derart streng in die Augen, dass mir die übrigen Worte im Halse stecken blieben. „Wenn du den Rest der Geschichte hören willst, dann musst du deine Fragen für später aufheben! Ich bin nicht mehr der Jüngste und wenn ich den Faden einmal verloren habe, finde ich ihn vielleicht nicht wieder! Also, wo waren wir stehen geblieben?“ „Ähm. Wie deine unerhörte Fruchtbarkeit das Dorf gerettet hat ...“ „Ja, mein Junge.“ Zufrieden nahm er einen Zug von seinem Joint. „Es war schon eine großartige Gabe, die ich da besaß! Was mir inzwischen jedoch mächtigen Kummer bereitete, war die grausame Prüfung, die unsere Ahnen mir auferlegten. Ich hatte zu jener Zeit nämlich dreiundzwanzig weitere Frauen geheiratet. Und nun stell dir vor, mein Junge: Keine dieser vierundzwanzig – die erste mitgerechnet – hatte mir bislang ein Kind geschenkt! Ich grübelte Tag und Nacht darüber nach, was ich tun konnte um die Unzulänglichkeit dieser armen Geschöpfe zu beheben. Denn natürlich war es ganz klar, dass die Ah34 nen mir alle unfruchtbaren Frauen der Gegend geschickt hatten, damit ich ihnen half! Aber wie, um Allahs willen, sollte ich das anstellen? Wie sollte mein göttlicher Same aufgehen – wenn er doch stets auf trockenen Stein fiel? Eines Nachts saß ich genauso wie jetzt mit einem Pfeiflein aus feinstem Gras auf dieser Veranda, da kam Binta, meine erste Frau zu mir. ‚Yongai’, sagte sie. ‚Ich weiß, was dich bedrückt. Und vielleicht kann ich dir helfen!’ ‚Du?!’, fragte ich erstaunt. ‚Nun gut, lass mich hören, was du mir zu sagen hast!’ ‚Jede Nacht’, sprach Binta, ‚liegst du bei deinen Frauen. Jede Nacht wählst du eine oder mehrere aus, um mit ihnen die Matte zu teilen. Obwohl ich weiß, dass du – der fruchtbarste Mann im Dorf – ein Recht auf unsere ständige Bereitschaft hast, so glaube ich doch, du verhältst dich unklug!’ ‚Unklug? Erkläre mir das!’ ‚Nun, wir Frauen wissen schließlich alle von deiner besonderen Gabe und sie schüchtert uns natürlich ein. Jede Nacht, wenn wir überlegen, welche von uns an der Reihe sein mag und ob sie dir einen Sohn gebären wird, dann erstarren wir vor Ehrfurcht und erhärten zu Stein. Denn natürlich möchte es jede von uns besonders gut machen und die erste sein, die schwanger wird. Glaub mir, Yongai, du tätest gut daran, uns gelegentlich eine Ruhepause zu gönnen, damit wir uns von unserer Ehrfurcht erholen können! Wenn du vielleicht ... nur jede zweite Nacht kämst – und dich in den verbleibenden von unseren Schlafstätten fern hieltest ... Nun, ich denke, das würde helfen!’ Als Binta, meine erste Frau, wieder gegangen war, dachte ich über ihre Worte nach und kam zu dem Schluss, dass sie weise gesprochen hatte. Natürlich musste meine unglaubliche Fruchtbarkeit die Frauen einschüchtern! Ich hätte selber darauf kommen 35 können! Ich dankte Binta für ihren Rat und besuchte von nun an nur noch jede zweite Nacht die Schlafhütten. Nun, mein Junge, Allah preise die Weisheit meiner ersten Frau! Es funktionierte! Innerhalb weniger Wochen wurden alle vierundzwanzig Frauen schwanger! Sie schenkten mir im Laufe der Jahre 66 Söhne und 41 Töchter von bester Gesundheit. Ganz unterschiedliche Knaben und Mädchen waren das! Manche hatten eine so krumme Yamsnase wie Amadou, der Schmied, andere hatten eine ganz helle Haut, fast so hell wie der weiße Forscher, der einige Jahre bei uns lebte. Ja, drei meiner Söhne hatten sogar die gleiche eigentümliche Augenfarbe wie unser Nachbar Damba, der bis dahin der einzige Mensch mit grünen Augen war, den ich je gesehen hatte! ‚Du trägst das Leben des ganzen Dorfes in deinem Schwanz!’, lächelte Binta, als ich ihr von meinen Beobachtungen erzählte. ‚Gepriesen sei deine Fruchtbarkeit!’“ Opa Yongai hustete und wiederholte den letzten Satz. „Gepriesen sei meine Fruchtbarkeit! – Selbst als mein wachsender Haarschopf mich daran hinderte, weiterhin die Matte mit meinen Frauen zu teilen, hörte der Kindersegen nicht auf. Mein Same wirkte noch viele, viele Jahre nachdem ich meine männlichen Rechte längst nicht mehr wahrnahm! Seither sitze ich hier auf der Veranda und beobachte, wie meine Enkel heranwachsen. Außerdem stelle ich mein magisches Haar den Regendommlern als Nistplatz zur Verfügung. Und wie gut ihnen das tut! Ich kann schon gar nicht mehr zählen, wie viele Eier sie in der Zwischenzeit gelegt haben. Es müssen Tausende sein! Ja, mein Junge. Tausende. So unglaublich fruchtbar bin ich!“ Er nahm einen tiefen Zug von seinem feinen, würzigen Marihuana und lächelte verklärt, als das Regendommlerweibchen ihm auf die Nase schiss. 36 Birge Laudi Das Buschmannohr Theo hockte zwischen Umzugskisten in der fast leer geräumten Wohnung seines Großvaters und sortierte Bücher. Wählte, welche er mitnehmen wollte. Legte beiseite, die nicht in sein Interessengebiet fielen. Theos Großvater war vor ein paar Tagen gestorben. In hohem Alter. Er war Arzt gewesen. Die Großmutter wurde seit Jahren in einem Heim betreut. Sie litt an der Alzheimer-Krankheit. Theo hatte seine Großeltern sehr geliebt, doch es hatte Themen gegeben, die er zeit ihres Lebens kaum zu berühren wagte. Sprach er vom Dritten Reich, von Mitschuld und vom ‘Das müsst ihr doch gewusst haben’, da zogen sich die Großeltern zurück, zurück in die Gegenwart: „Sind wir doch froh, dass diese Zeit vorbei ist“ und „was bringt es, immer darüber zu reden“ und „am besten, wenn man das alles vergisst“. Theo und seine Geschwister hatten es bald aufgegeben dieses Thema anzuschneiden. Buch um Buch nahm Theo von dem Stapel, den er neben sich auf dem Boden aufgehäuft hatte. Plötzlich hielt er inne. Ein Buch über die menschliche Erblehre und Rassenhygiene aus der Zeit des Dritten Reiches. Der Namenszug seines Großvaters stand auf der ersten Seite. Daneben das Jahr. 1944. Da hatte Großvater bereits als Arzt gearbeitet. In einem Lazarett. Theo blätterte in dem Buch. Erstaunliche Sätze standen da. Fesselten ihn. Sätze, die das Gedankengut der Ärzte in Großvaters jungen Jahren gewesen waren. Das klassische Werk über Rassenkreuzung ist das von Eugen Fischer über die Rehobother Bastards. Im Jahre 1908 hat er eine Mischlingsbevölkerung, Nachkommen 37 von Burenmännern und Hottentottenfrauen, im damaligen Deutsch-Südwestafrika untersucht, die lebende Bevölkerung anthropologisch aufgenommen und die Sippentafeln zurück bis zu den Ausgangskreuzungen verfolgt, sodass der Grad und die Art der Mischung in jedem Falle sichergestellt waren. Das Mosaikspiel der zwischen Europäern und Hottentotten so stark verschiedenen Rassenanlagen trat in dieser Mischlingsbevölkerung klar hervor. Und ... Fischers Werk wurde Grundlage und Programm einer neuen Wissenschaft, der Rassenbiologie, aus welcher dann unsere heutige Rassenpolitik herausgewachsen ist. Und weiter ... Der Führer des Deutschen Reiches ist der erste Staatsmann, der die Erkenntnisse der Erbbiologie und Rassenhygiene zu einem leitenden Prinzip in der Staatsführung gemacht hat. Theos Interesse war geweckt. Es ging um das, was seine Großeltern verdrängt, worüber sie nicht gesprochen hatten. Um die Vermischung von Rassen. Minderwertige Rassen. Um Rassenhygiene. All das musste Theos Großvater gewusst haben. Für Theo aber war vieles neu. Mendel, ja, dessen Gesetze hatte er in der Schule gelernt. Nicht aber, dass alles, was rein wissenschaftliche Vererbungslehre war, zur Legitimation für das Verbrechen an dem jüdischen Volk herangezogen wurde. Seite für Seite blätterte er sich durch das Buch. Las hier einen Absatz, dort eine Erklärung. Überflog manches Kapitel. Noch eine weitere Abhandlung über Vererbungslehre fand Theo unter Großvaters Lehrbüchern. Gedruckt im Jahr 1934. Darin stieß er im Zusammenhang mit der Erforschung der Rehobother Bastards und ihrer körperlichen Auffälligkeiten auf eine ungewöhnliche Geschichte. Sie 38 fesselte ihn ebenso wie offensichtlich damals ihren Entdecker. Hochinteressant ist das deutliche Herausmendeln des Buschmannohres, das in den Erbmassen der Hottentotten aus früheren Mischungen mit Buschleuten latent vorhanden ist und nun durch die Bastardierung eine Demaskierung erfährt. Nie in seinem Leben hatte der Biologiestudent etwas von Rehobother Bastards und von einem Buschmannohr gehört. Wusste nichts über Eugen Fischer und seine Verbindung zur Rassenpolitik. Deutsch-Südwestafrika war nur eine geografische Bezeichnung ohne Sinn für ihn und Worte wie Hottentotten und Bastard kannte er lediglich aus der Kindheit und Schulzeit als üble Schimpfworte. Doch nun tauchten diese Begriffe in einem Zusammenhang auf wo es um Familien ging, um Ehen, die vor langer Zeit zwischen Europäern und Bewohnern Südafrikas geschlossen worden waren. Das war neu für ihn und aufregend. Für den Rest des Tages versank Theo in den großväterlichen Büchern, die ihm eine bislang unbekannte Geschichte und ferne Welt erschlossen und nie geahnte Wünsche und Sehnsüchte hervorbrachten. All das Grauen der Rassenpolitik eines Adolf Hitler, das bei dem dürftigen Quell der Bastards aus Rehoboth und ihrem Buschmannohr begonnen und schließlich in den Gaskammern von Auschwitz geendet hatte, all das wurde in diesem Moment übertönt von den reizvollen Wörtern Rehoboth und Buschmannohr. Fremdartig und lockend. Melodisch das Rehoboth, ein Wort wie gesungen in einer uralten Sprache. Erlauscht von einem Ohr, das diese Melodie einer vergangenen Zeit einfängt. Die Melodie der Geschichte eines Volkes in einem fernen Land. Der Zauber des Fremdartigen betörte Theo. Er regte seine Phantasie an, begann seine Gedanken zu besetzen, sickerte in seine Studien und schlich sich in seine Träume. 39 Das Phantom Buschmannohr drängte sich in die Unterhaltungen mit seinen Studienkollegen, die ihn befremdet ansahen, ihn auch verspotteten. „Die Ohrmuschel ist nichts als eine Hautfalte über einem Gerüst aus Knorpel“, belehrten sie ihn, „und an diesem Gebilde, das ein wenig ausschaut wie ein halbes Herz, hängt noch ein kleiner Lappen aus Haut und Fett und das nennt man Ohrläppchen.“ Sagten es und ließen lachend Theo mit seiner Begeisterung für das Buschmannohr stehen. Verletzt von ihrem Spott vergrub sich Theo fortan in Büchereien und Bibliotheken und las sich durch die Geschichte Südafrikas. Setzte sich mit der Vergangenheit der Rehobother Baster, wie sie sich heute selbst noch nennen, auseinander. Er las und lebte mit ihnen ihr Schicksal, erlitt wie sie die Vorurteile der Apartheid in einem Land, das weiß sein wollte und schwarz war und wo die Demütigungen der Schwarzen durch die Weißen erst mit Nelson Mandela ein Ende finden sollten. Er wurde zu einem von ihnen. Zu einem Baster mit dem Buschmannohr. Zu einem Mischling, einem Farbigen, dessen Vorfahren Mitte des 17. Jahrhunderts weiße Männer und Khoi-San-Frauen gewesen waren. Diese Frauen eines Nama-Volkes nannte man Hottentotten. Beleidigend, diskriminierend. Sie aber waren es gewesen, die das Gen für die besondere Form des Ohres in sich getragen hatten, das latent vorhanden ist und nun durch die Bastardierung eine Demaskierung erfährt. Bei Theo wurde dieses Ohr zu einem imaginären Organ, das ihn eng mit dem Volk der Rehobother Baster und mit den Buschmännern Südafrikas verband, auch wenn er nicht wusste, worin sich ein Buschmannohr von anderen Ohren unterschied. Träumend schloss Theo die Augen und alles, was er bisher über Südafrika und Deutsch-Südwest, das heutige 40 Namibia, gelesen hatte, mischte sich in seiner Phantasie zu einem Reigen bunter Bilder, die er zu einer vermeintlichen Wirklichkeit zusammensetzte. Theo hörte in seiner Vorstellung die Geräusche Afrikas, spürte die glühende Sonne auf seinem Gesicht und begleitete den langen Marsch der Baster. Ging im Geiste mit ihnen, als sie sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Südafrika auf den Weg machten, der in Rehoboth nahe Windhoek sein Ende fand. Mit müden Füßen zog er neben den enttäuschten Menschen über staubige Straßen. Wanderte wie sie neben den Ochsenwagen her. Hörte das Knarren der Räder. Lauschte dem schweren Herzschlag der 90 Basterfamilien, die der Unterdrückung durch die Buren Südafrikas entflohen, sich eine neue Heimat in DeutschSüdwest suchten. Theo war in seinem Herzen einer von ihnen geworden, ein Baster, aber er schlüpfte ebenso in die Welt eines Buschmannes. Er lebte in den Welten beider. Sein Buschmannohr vernahm Laute, die ihm bislang verborgen gewesen waren. Er lauschte auf das Flüstern des Windes im trockenen Gras der Kalahari, das ferne Rufen des Perlhuhns. Er hörte den Hufschlag einer Herde weit hinter den Bergen, das Schleichen der Katze, den Wimpernschlag der Gazelle. Dort in der ausgedörrten Ebene ließ sich der Strauß vorsichtig auf sein Gelege nieder, breitete raschelnd das Gefieder über die Eier. Auf dem heißen Sand zog eine Schlange ihre Spur. Wie ein Seufzen drang ihre Bewegung in Theos Ohr. Er ahnte das uralte Geriesel des Sandes vom Kamm der Düne, wie sie windgetrieben ihre Gestalt wieder und wieder veränderte. Leise sangen Wind und Sand ihre Wüstenmelodie. All das vernahm das Ohr. Ein Ohr, das Buschmännern in der rauen Wirklichkeit zu überleben half. Ein Ohr, dessen Gene sie vor langer, langer Zeit an Frauen weitergegeben hatten, die dereinst den ersten holländischen Seefahrern 41 auf südafrikanischem Boden farbige Kinder gebären sollten. Diese Kinder traten ein Erbe an, das in den Erbmassen der Hottentotten aus früheren Mischungen mit Buschleuten latent vorhanden ist und nun durch die Bastardierung eine Demaskierung erfährt. Fest hielt Theo dieses uralte Ohr an das Herz Afrikas gepresst. Hörte die Stimmen, die von Afrika erzählten, die Legenden und Sagen. Und während er lauschte, meinte er die Kochfeuer vor den Rundhütten zu riechen, den faden Geruch von Hirsebrei. Spürte den harten ausgedörrten Boden unter den nackten Füßen. Glaubte, alles so zu sehen und zu hören wie es sich in seinem Inneren widerspiegelte. Theo verlor sich mehr und mehr in seinen Vorstellungen und Phantasien. Er wollte sehen, wollte hören. Die Sehnsucht zu riechen, zu schmecken, zu fühlen wie der Süden des schwarzen Kontinents wirklich war, begann ihn zu verzehren. Theo, den stillen, den unscheinbaren und scheuen Biologiestudenten. Hätte Theos Großmutter nicht bereits den Kontakt zur realen Welt verloren, so würde sie sicher bei einer gemütlichen Tasse Kaffe zu ihren Freundinnen gesagt haben: „Der Theo, das ist so ein lieber Junge. Brav und fleißig ist er und so wissbegierig. Und stellt euch vor, nicht einmal Zeit für eine Freundin hat er. Aus Theo, da wird bestimmt einmal was ganz Besonderes.“ Das würde sie gesagt haben. Ja, all die Lobreden hätte sie auf Theo gehalten und ihm wäre es furchtbar peinlich gewesen, auch wenn vieles von dem, was Großmutter gesagt hätte, tatsächlich auf ihn zutraf. Mit seinen sanften braunen Augen blickte er unter den mädchenhaft geschwungenen Wimpern ruhig und gelassen hervor, strich sich mit immer wiederkehrender Geste das Haar aus der Stirn und ging seiner Wege. Ein Einzelgänger. Kein Frauenheld. Dazu fehlte ihm die imposante Statur, das Draufgängerische. Zu klein, um die Blicke der 42 Mädchen auf sich zu ziehen, das schmale, lange Gesicht zu reizlos. Ein Bücherwurm. Hielt nichts von ausufernden Studentenfeiern. „Er ist langweilig“, war die einhellige Meinung der Kommilitoninnen gewesen. Doch seit Theo seiner Begeisterung über all das, was er nun gelesen hatte, freien Lauf ließ, lauschten auch die Mädchen seinen Erzählungen. Begannen sich zu interessieren für die Geschichte von Eugen Fischer, der Rassenhygiene des Hitler-Regimes, der Reinerhaltung der nordischen Rasse und der Verfolgung derer, die sie zu bedrohen schienen. Die Untersuchungen Eugen Fischers bei den Rehobother Bastern und die Folgen davon, das alles war so außergewöhnlich und jenseits dessen, worüber sie sich sonst unterhielten. Und es war auch umwerfend komisch wenn Theo vom Buschmannohr schwärmte. Hingerissen lauschten sie dem Sonderling, der all das todernst nahm. Immer wieder las Theo in Großvaters Büchern, prägte sich die Sätze ein, die ihn in so kurzer Zeit in eine andere Welt entführt hatten. Als das Semester zu Ende ging, stand Theos Entschluss fest. Er wollte nach Namibia fliegen. Wollte die Rehobother Baster sehen, wollte ihnen aufs Ohr schauen. Ein nicht alltäglicher Grund, um für viel Geld eine Reise zu einem fernen Kontinent anzutreten. Der Großvater hatte seinem Enkel einen kleinen Geldbetrag hinterlassen. Obwohl der für das Studium gedacht war, buchte Theo davon einen Flug nach Windhoek. Ohne jemandem davon zu erzählen, tat er es. Strich sich das Haar aus der Stirn und lebte still seine Afrika-Sehnsucht. Es war eine große Überraschung für seine Kommilitonen, als Theo plötzlich zu einer kleinen Party auf einem Grillplatz in romantischer Umgebung einlud, ohne den Grund dafür zu nennen. Für ihn selbst aber sollte es eine Abschiedsparty sein, Abschied vom Semester und Ab43 schied von den Studienkollegen. Eine Party zum Start in ein unbekanntes Land. All jene, die ihn in der letzten Zeit als Exzentriker kennen und schätzen gelernt hatten, folgten begeistert seiner Einladung. Brachten nicht nur eine Flasche Wein, eine Schüssel Salat oder ein Stangenweißbrot mit, sondern auch einen Schwarm netter Mädchen. Es war eine fröhliche Menge, die begierig auf neue kuriose Ideen des Gastgebers wartete. Theo genoss den Abend in lockerer Aufgeschlossenheit und trank ganz gegen seine Gewohnheit zusammen mit seinen Freunden ein paar Gläser Wein. Die fröhliche Entspanntheit half ihm seine Schüchternheit zu überwinden und er warb geradezu draufgängerisch um die Gunst einer braun gebrannten Schwarzhaarigen. Er hatte sie noch nie gesehen. Ihre wüste Lockenpracht, die das zarte Gesicht umspielte, wäre sicher sogar ihm aufgefallen, hätte sie am gleichen Ort studiert wie er. Sie hieß Elisabeth. Es kam so wie es die Natur erfunden hat. Die beiden fanden Gefallen aneinander, rückten Körperkontakt suchend Stück um Stück näher zueinander und ließen sich schließlich in einer innigen Umarmung in die Löwenzahnwiese sinken. Während die Würstchen und Fleischstücke langsam auf dem Grill verkohlten und den Geruch eines KuduSteaks auf offenem Feuer in der Steppe verbreiteten, grub Theo seine Hände in Elisabeths Haar. Er meinte, das weiche Fell eines jungen Wüstentieres im dürftigen Schatten des Dornbusches zu fühlen und er presste sein Gesicht in die schwarze Mähne. Roch den Westwind, der Feuchtigkeit vom Meer bringt. Atmete den Duft von dürrem Gras und sonnenheißen Steinen. Sog den Hauch Afrikas ein. Theo schloss hingerissen die Augen, wanderte mit dem Mund den schlanken Hals hinauf, suchte begierig unter dem üppigen Haarschopf nach Elisabeths Ohr und begann 44 es mit der Zunge zu erforschen. Das Mädchen kicherte. Theos Tun kitzelte und löste gleichzeitig große Wonne in ihrem Bauch aus. Und Theos Zunge fuhr die wundervolle Biegung der Ohrmuschel entlang, erkundete die knorpeligen dunklen Täler, Senken und Untiefen und biss lustvoll und zärtlich in das Ohr des Mädchens. Mit einem Ruck erwachte Theo aus seiner genussvollen Erforschung des entzückenden Ohres. Irgendetwas stieg aus den fernen Tiefen seines Lebens vor diesem Abend auf. Irgendeine Erkenntnis, die er so rasch nicht zuordnen konnte. War es die Form des Ohres? Wie ein Halbkreis fühlte es sich an. Weder nach oben noch nach unten ausladend. Und plötzlich wusste er es: Das von ihm so heiß begehrte Mädchenohr hatte nicht das, was seine Freunde einst spöttisch als einen lappigen Anhang aus Haut und Fett bezeichnet hatten. Theos Zunge und Lippen hatten ein Ohrläppchen vermisst, einen weiteren Ort für liebevolle Aktivitäten. „Was ist los?“, fragte verwundert Elisabeth, schmiegte sich in seine Arme. „Warum machst du nicht weiter?“ In der Dunkelheit des späten Abends versuchte Theo ihr in die schwarzbraunen Augen zu sehen. „Wer bist du?“, fragte er sie, ein wenig brüsker in seiner Überraschung als er gewollt hatte. „Ich bin Elisabeth, du Dummkopf. Das weißt du doch; und ich studiere Biologie, genau wie du. Hast du was dagegen?“, konterte das Mädchen aufsässig. „Nein, nein“, wehrte Theo ab, „nur weißt du, dein Ohr und … ach, ich weiß nicht. Ist ja auch egal.“ Theo strich sich verwirrt das Haar aus der Stirn, dann schlang er seine Arme erneut um die hübsche Studentin und setzte genussvoll seine Eroberung des weiblichen Körpers fort. 45 Doch jetzt löste das Mädchen sich aus der Umarmung. Sie schob Theo weg und forschte nun ihrerseits in seinem Gesicht. „Sag, was war das eben? Was war mit meinem Ohr?“ Theo fuhr sich durch die Haare, wie immer wenn er eine Sache durchdenken musste. Er überlegte, ob er es ihr erzählen sollte. Schließlich berichtete er ihr doch von dem Buschmannohr und seinen Phantasien, seit er in dem alten Buch seines Großvaters den Satz gelesen, der sein Leben verändert hatte. Der Satz, den er bereits auswendig konnte: Hochinteressant ist das deutliche Herausmendeln des Buschmannohres, das in den Erbmassen der Hottentotten aus früheren Mischungen mit Buschleuten latent vorhanden ist und nun durch die Bastardierung eine Demaskierung erfährt. „Das sind keine Phantasien, Theo. Ich komme aus Namibia, aus einem Ort nahe Windhoek.“ „Und wie kommst du hierher?“ „Ganz einfach. Ich habe ein Stipendium bekommen für einen Ferienkurs an der hiesigen Universität.“ „Du sagst, du kommst aus der Nähe von Windhoek. Aus welchem Ort?“ Theo war plötzlich hellwach geworden. Namibia! Windhoek! Er vergaß die Küsse und das wundervolle Haar. Wartete begierig auf Elisabeths Antwort. „Nimm die Bibel zur Hand und schlag nach in der Genesis. Im 26. Kapitel, Vers 22, findest du den Namen meiner Heimatstadt.“ So wie Elisabeth dieses Rätsel um ihren Heimatort abspulte, merkte man, dass es nicht das erste Mal war, dass sie ihn auf diese Weise preisgab. Immer freute sie sich darauf, dass dann verzweifelt nach einer Bibel gesucht wurde. Doch anders Theo. Voller Erregung rief er aus: „Sag bloß, du kommst aus Rehoboth?!“ 46 Nun war es an ihr, erstaunt zu sein. „Woher weißt du das denn?“ Theo erzählte ihr, wie er auf der Suche nach Informationen über Rehoboth auch auf den Ursprung des Namens gestoßen war. „Sind deine Eltern Rehobother Baster?“, fragte er voller Spannung. „Ja und nein“, antwortete Elisabeth ein wenig abwehrend. „Das ist eine lange Geschichte, Theo. Lass uns ein andermal darüber reden. Wir sehen uns doch morgen wieder, ja?“ Theo konnte es nicht fassen. Er hatte alles auf einmal gefunden, was er gesucht hatte. Hielt ein doppeltes Glück in den Händen. Ein berauschend schönes Mädchen mit einem Ohr, das anders geformt war als seines und dieses Mädchen kam aus Rehoboth. Der Beginn eines großen Glückes. Oder war es bereits sein Ende? „Wir sehen uns doch morgen wieder, ja?“, hatte sie gesagt. Am nächsten Morgen aber ging Theos Flugzeug nach Windhoek. Quellenhinweise. Die kursiv gesetzten Zitate entstammen den folgenden Werken: O. Freiherr von Verschuer (1944, 2. Auflage). Leitfaden der Rassenhygiene. Leipzig: Georg Thieme Verlag, Seite 101 und Seite 11. O. Naegeli (1934, 2. Auflage). Allgemeine Konstitutionslehre. Berlin: Verlag Julius Springer, Seite 81. 47 Hassan Aftabruyan Als uns Kalal vom Staub erzählte Hier ist überall Staub. Es ist wirklich Staub, kein Sand, sondern feiner Staub, der sich festsetzt. Wie in Westernfilmen, in verlassenen Städten. Aber ich bin hier in keiner Stadt. Manu bin ich und im Nirgendwo gelandet. Das Lager sah gar nicht schlimm aus. Einfache Hütten und kleine Waschstellen waren nebeneinander. Aber das Lager fühlte sich schlimm an. Als wir nahe genug waren, konnten wir die traurigen Augen der anderen spüren. Augen sieht man eigentlich, wie zum Beispiel die Augen meiner Großmutter. Sie schaute mich immer an, wenn es draußen kalt war oder wenn ich Angst hatte. Ich konnte die Augen meiner Großmutter nicht mehr sehen, als sie starb. Sie wurde von einem Soldaten von hinten in den Kopf geschossen. Einfach so. Weil sie ihm seine Schuhe nicht putzen wollte. Mich hielt ein anderer Soldat an den Haaren fest. Ich konnte ihn nicht sehen. Er war nur eine Hand und eine Stimme. Ich sah die Augen meiner Großmutter, als sie lebte, wie sie weinte, als der Soldat seine Pistole an ihren Kopf hielt. Dann bekam ich einen harten Schlag auf meinen Hinterkopf. Als ich aufwachte, sah ich um mich herum Arme, Beine und Köpfe liegen. An dem Blut klebten Fliegen, und ich habe angefangen ganz laut zu schreien. Niemand hörte mich. Warum haben sie das getan? Warum haben sie mich leben lassen? Ich weiß nicht. Wir haben in einem kleinen Dorf gewohnt. Ich weiß nicht, wo dieses Dorf ist. Ich kann nicht mehr zurückfinden. Aber ich kann weite Strecken laufen, rennen und gehen. Deswegen bin ich auch weggerannt, bis ich nicht mehr konnte. Und danach noch weiter. Irgendwann waren da andere 48 Kinder und ich hörte auf zu schreien. Wir alle hatten nur wenig zu essen. Wir hatten Hunger. Wir haben uns zusammengetan und gestohlen. Wir wurden nach einigen Tagen von einem Mann aus Europa gefragt, ob wir nicht mit ihm kommen wollten. Er würde uns nach Europa bringen, wo viele kinderlose Familien uns gerne aufnehmen würden. Ich hatte noch nie von kinderlosen Familien gehört. Der einzige in meinem Dorf, der keine Kinder hatte, war der verkrüppelte Onkel meines Vaters. Und natürlich gingen wir mit dem Herren in der weißen Weste mit. Er brachte uns zu großen Lastern. Wir stiegen auf und fuhren aus dem einen Niemandsland in das andere. Auf der Fahrt hatten wir gute Laune, weil es genug zu Essen gab und niemand sein Gewehr auf uns richtete. Dann kam das Lager. Jeder musste seine Finger auf ein blaues Kissen drücken und danach auf ein weißes Papier, wo unsere Namen standen. Keiner von uns konnte lesen. Ich träume nachts immer von meiner Großmutter. Sie wollte mir das Lesen beibringen. Großmutter hatte gute Augen, obwohl sie schon alt war. Aber ihre Augen sind alleine gestorben. Unser Priester hat einmal gesagt, im Moment des Todes sehnt sich die Seele nach einem Menschen, um die Last abgeben zu können. Damit die Seele zu ihren Ahnen aufsteigen kann. Ich weiß nicht, ob Großmutters Seele ihre Last abgeben konnte oder in einem Zwischenreich noch warten muss. In meinen Träumen stehe ich vor einem großen Baum mit vielen weißen Früchten. Ich mache daraus eine Suppe. Wenn ich die Suppe essen will, sehe ich, dass darin die Augen meiner Großmutter schwimmen. Dann wache ich hungrig auf. In der Dunkelheit rückten wir im Lager enger zusammen und unsere Körper berührten sich. In die besonders kleinen Ecken legte sich meistens Lasier. Er hatte eine mandel49 braune Haut und erzählte immer, dass er einen Onkel in Amerika hätte, der uns retten wird. Dann lachte er mit großen weißen Zähnen. Ich vergaß die Augen meiner Großmutter und wurde müde von der Wärme der vielen Körper um mich herum. Meine Wunden heilten. Plötzlich schien grelles Licht in unsere Hütte und überall waren Stimmen. Ich schrie laut. Das Blut war wieder da und auch die Augen von Großmutter. Wir stiegen auf einen Laster und drängten uns aneinander. Der Sand sammelte sich in unseren Haaren. Wir hielten an. Lasier war sehr schwach und kam nur langsam vom Laster herunter. Der Laster setzte zurück und fuhr gegen ihn. Während sein kleiner schwacher Körper zerdrückt wurde, sah er mich an. Alles Gute und alles Schlechte gab er mir, und ich nahm es. Seitdem träume ich von zwei Bäumen, von denen ich meine Suppe mache. Ein Baum mit Augen von Großmutter und ein Baum mit Augen von Lasier. Bald werde ich nichts mehr essen. Ich weiß meistens nicht, was um mich geschieht. Wir müssen immer warten. Manchmal habe ich einige Gegenstände bei mir. Bei den vielen Reisen verliere ich sie immer wieder. Was bleibt mir außer Staub? Die Zeit mit Kalal! Kalal war eines Tages da und verschwand dann wieder. Aber er hat uns seine Geschichte dagelassen. Wir alle sind alt genug um zu wissen, dass es keine Märchen gibt. Aber Kalal erzählte uns keine Märchen. Er war etwas älter als wir anderen und hatte starke Muskeln. Seine Brustwarzen waren durchbohrt und er hatte den Zahn eines Löwen in seinem linken Ohr, also am Herzen. Er hatte das Herz eines Löwen. Kalal erzählte uns von dem großen Löwen, den er ganz alleine verjagte. Der Löwe stand plötzlich vor ihm. Kalal schlotterte vor Angst. Aber dann nahm er seinen ganzen 50 Mut zusammen und warf eine Hand voll Sand auf den Löwen. Der Löwe erschrak vor dem glitzernden Sand in der Sommerhitze und Kalal hatte ihn besiegt. Während Kalal vom Löwen erzählte, sahen wir, dass aus einer Hütte Rauch aufstieg. Wir rannten hin und sahen, wie der Lageraufseher mit einem brennenden Hut auf dem Kopf aus dem Haus gerannt kam. Kalal schaufelte seine Hände voll Sand und Staub und warf alles über den dicken und schwitzenden Aufseher. Der Hut hörte auf zu brennen und vor uns stand ein staubiger, sandfarbener Aufseher. Wir hatten Angst, er würde vielleicht wütend werden. Aber er fing an zu lächeln, musste dann arg niesen und rief schließlich: „Danke. Jetzt muss ich wohl duschen.“ Wir hielten uns die Bäuche vor Lachen. Der Staub rettete den Aufseher. Und er rettete Kalal vor dem Löwen. Kalal ist schon lange nicht mehr bei uns, aber immer noch genug Staub. Wenn mich in meinen Träumen die Augen von Großmutter und Lasier aus der Suppe ansehen, dann erzähle ich den beiden von Kalal, wie er den Aufseher mit Sand und Staub beworfen hat und wir lachen bis zum Morgen. Manchmal lache ich im Traum so laut, dass ich die anderen aufwecke. Dann lachen wir zusammen weiter. Wir sagen bei uns, dass Lachen reich macht. Eine lustige Sache, mit dem Staub, hier im Warten auf das Irgendwo. Ich möchte so gerne allen Menschen von meinem endlosen Reichtum an Staubkörnern erzählen. Das werde ich meiner kinderlosen Familie in Europa sagen, wenn ich ein Staubkorn auf ihrem sauberen Boden finde. Sie haben ein Haus und ein Auto, aber seit Kalal bei uns war bin ich durch den ganzen Staub der glücklichste und mutigste Mensch auf der ganzen Welt. 51 Regina Besting Der Mann auf dem Dach Der Falke sitzt auf dem Dach. Schweigend, observierend. Sie nennen ihn den Falken weil er bevorzugt von hohen Positionen aus arbeitet. Er ist gut. Nicht der Beste, aber ausreichend für diesen Job. Der Beste wäre vermutlich sowieso ungeeignet gewesen, dieses Mal. Und wozu unnötig Geld ausgeben? Er wartet, den Rücken gegen die überstehende Hausmauer gelehnt, die Beine leicht angewinkelt, die Füße beide fest auf dem Boden. Er betrachtet die kleinen weißen Kieselsteine, die auf der Teerdecke verstreut wurden. Seine Schuhe haben leichte Spuren hinterlassen. Es sind die einzigen hier oben. Vor ihm hat vermutlich noch nie jemand das Dach betreten, von den Bauarbeitern vor zwanzig Jahren einmal abgesehen. Doch lange wird das nicht so bleiben. Er versucht sich vorzustellen, wie viele Füße den Kies hier oben bis zum Ende des Tages zertreten werden. Er kann es nicht, es lenkt ihn zu sehr vom Wesentlichen ab. Er wartet. Man hatte ihm gesagt, er würde um Punkt 15 Uhr nachmittags vorfahren. Und dann will der Falke bereit sein. Noch zwanzig Minuten. Langsam greift er in seine Jackentasche und zieht ein Päckchen Zigaretten heraus. Ein Bier wäre ihm jetzt lieber, ein frisches, kaltes Castle gegen die unerbittliche Hitze. Doch er weiß, dass selbst ein kleines Bier seine Konzentration einschränkt. Und heute darf er keinen Fehler machen. Daniel würde es ihm nie verzeihen und die Sache wäre verloren. So ganz verstanden hatte er seinen Auftrag nicht. Aber Daniel hatte auch nach mehrmaligem Fragen nur gemeint, dass Verstehen nicht wichtig sei. Nur die korrekte Ausführung zählt. Und deshalb wird er es auch 52 tun. Er wird es nicht verstehen, doch er vertraut Daniel. Der weiß schon was er tut. Immerhin spielt er eine große Rolle in der Organisation. Er öffnet die Schachtel. Nur noch eine einzige Zigarette. Er hätte sich besser einteilen sollen. Er zieht sie heraus, zündet sie an und nimmt genießerisch den ersten Zug. Der erste Zug ist immer der beste, findet er. Doch dieses Mal schmeckt er ein wenig bitter. Er dreht sich um, bleibt in der Hocke, ein Knie auf dem Boden. Er darf nicht gesehen werden. Er schaut auf den großen Braak-Platz hinunter. Eigentlich mehr eine Rasenfläche. An der Südseite die kleine Kirche, die durch unzählige Ansichtskarten berühmt geworden ist. Direkt dahinter die Kleinbusse der Schwarzen. Taxis nennen die sie, doch eine offizielle Genehmigung haben die wenigsten der Fahrer. Und die Regierung sieht natürlich tatenlos zu! An der Ost- und der Nordseite des Platzes stehen dichte Büsche und Bäume, dahinter kleinere Mehrfamilienhäuser. Alles unbrauchbare Positionen. Deshalb ist er hier oben; auf dem einzigen höheren Haus der Umgebung. Und von hier aus beobachtet er die Touristen, die diese schöne Stadt schon seit Jahren überfallen, täglich, unabhängig von Jahreszeit und Wetter. Europäer meistens, manchmal Amerikaner und Australier. Sie streifen umher und beschauen die Altstadt als wäre sie ein Artefakt längst vergangener Zeiten. Was macht diesen Menschen das neue Stellenbosch nur so interessant? Vor einigen Jahren noch war die Stadt wirklich schön. Er hatte sie geliebt und er war stolz gewesen, in der zweitältesten Stadt Südafrikas aufzuwachsen. Doch heute findet er nichts mehr an ihr. Seit sie ihre Pforten öffnen musste, für alles und jeden, sind jeden Tag mehr Slumbewohner gekommen, die sich anmaßen, sie zu besetzen. Ein ruhiges, weißes Leben ist seitdem nicht mehr möglich. Deshalb sind er und sein älterer Bruder an den Oranje-Fluss gezogen, in die neue Siedlung, wo noch wahre Weiße leben, 53 nach den Regeln der Moral, denen sie so lange gefolgt waren und die sie beide sich sehnlichst zurückwünschen. Doch der Weg dorthin ist steinig, hatte Daniel gesagt. Und er vertraut Daniel. Jetzt, um exakt 14:55 Uhr fährt der erste große Bus vor. Die Schulbusse kommen. Er kennt sie. Schon seit 1987, also Jahre vor dem Umbruch, erreichen sie mehr oder weniger pünktlich gegen 15 Uhr den Platz. Sie kommen von der „Stellenzicht Secondary School“, einer Mittelschule Stellenboschs im Stadtteil Jamestown. Sie wird vornehmlich von schwarzen Kindern besucht. Die Busse hielten schon immer auf der Straße zwischen seinem Standort und dem Platz. Die Kinder in den Bussen verteilen sich dann auf die kleineren Taxis und werden nach Hause befördert, wenn man diese verdreckten und verseuchten Townships vor der Stadt überhaupt ein Zuhause nennen kann. Nahezu zeitgleich mit dem Halten des Busses steigen sie aus. Kleine und größere, farbige und schwarze Kinder. Wer zu welcher Rasse genau gehört, könnte er nicht sagen. In der heutigen Zeit, wo die Mischung der Rassen nicht mehr überwacht wird, ist es unmöglich zu beurteilen, welches Kind reinblütiges Stammeskind und welches ein Mischling ist. Aber die Ordnung wird wiederhergestellt werden, eines Tages. Dafür hat er geschworen zu kämpfen, deshalb ist er hier. Vorsichtig fasst er neben sich. Sicher und fest greift seine Hand nach dem Gewehr. Er legt es auf der Mauer auf, gestützt von seiner linken Hand und blickt durch das Zielfernrohr. Er sieht sich die Mädchen und Jungen genau an, jeden einzelnen. Es wäre so einfach für ihn … Schon sieht er die weiß/grau/türkise Schuluniform des Mädchens, das er gerade anvisiert, sich rot verfärben. Schnell setzt er das Gewehr wieder ab. Nein. Keine Fehler. Er wird seine Chance bekommen. Doch nicht heute. Nicht jetzt. 54 Es kann jetzt jeden Augenblick so weit sein. Und tatsächlich, an der Südseite, zwischen der kleinen Kirche und der Touristeninformation fährt in diesem Augenblick ein unscheinbarer schwarzer BMW vor. Er hält genau in seinem Blickfeld. Ein bisschen weiter vor, und Bäume hätten die Sicht versperrt. Ein bisschen weiter zur Kirche hin, und eben diese hätte ihm jede Chance auf einen sauberen Schuss genommen. Vorsichtig hebt er sein Gewehr wieder ans Auge und beobachtet die Situation vergrößert. Die Informationen scheinen zu stimmen. Keine Polizeieskorte. Und auch an Leibwächtern scheint gespart worden zu sein. Der Plan besteht darin, das Opfer auf dem Weg zwischen dem Auto und der Kirche zu erwischen. Er beobachtet den Fahrer um den Wagen herumlaufen und die hintere Tür öffnen. Und dann steigt er aus. Der Falke erkennt den Mann sofort. Weiße Haut, weiße Haare, schwarzer Anzug, weiße Schuhe. Die Schuhe. Sein Erkennungszeichen. Nicht dass er heute noch eins benötigen würde. Jeder echte Südafrikaaner kennt Senator van Kuck. Der Falke zögert. Wieso ist er hier, wieso ausgerechnet Senator van Kuck? Das macht keinen Sinn. Er versteht es nicht. Der Senator schaut sich um. Es ist, als hielte er seinen Kopf absichtlich in die Schusslinie, als zögere er absichtlich. Doch wie ist das möglich? Jetzt schaut er genau zum Falken hoch. Der zögert noch immer. Doch dann erinnert er sich an das, was sein Bruder Daniel gesagt hat: Verstehen ist unwichtig – ausführen! Also zielt er und schießt. Gleichzeitig mit dem lauten Knall fällt der Senator auf den Bürgersteig. Kopfschuss. Saubere Arbeit. Tot, bevor er aufschlug. Er hört die Kinder kreischen und weiß, dass sie nun unten auf dem Platz kreuz und quer laufen, nach Schutz suchen. Zu gerne würde er sich die Szene anschauen. Doch dafür hat er keine Zeit. Die Polizei wird schnell da sein, die Station ist nicht weit. Sie werden alles absuchen und 55 schnell auf dieses Gebäude stoßen. Der einzige mögliche Standort für einen Scharfschützen. Sie werden hochkommen und er säße in der Falle. Er packt er alles zusammen, so schnell er nur kann und rennt los. Eine Stufe nach der nächsten. Ein Treppenabsatz mehr und noch einer. Das Erdgeschoss ist erreicht. Der Wagen steht direkt vor dem Haus. Er steigt ein, braust los. Niemand kann ihn mehr aufhalten. Er hat es geschafft. Doch anders als sonst verspürt er keinerlei Befriedigung über seine Arbeit. Er ist nicht stolz, er ist nicht glücklich. Er hat gerade einen der rar gewordenen Verfechter der alten Ordnung getötet, einen wahren Anhänger der Sache. Und so sehr er auch nachdenkt, er versteht den Sinn einfach nicht. Er wird Daniel noch einmal fragen müssen, denn so, wie er sich in diesem Moment fühlt, kann er nicht weiterleben. Doch er muss sich noch gedulden. Erst morgen früh um acht Uhr dürfen sie sich wieder treffen. Keine Aufmerksamkeit auf sich lenken. Er fährt ohne Unterbrechung durch bis in die Innenstadt des etwa 50 Kilometer entfernten Kapstadt. Dort lässt er den Wagen einfach stehen, das Gewehr, gesäubert von jeder Art von Spuren, im Kofferraum. Den Schlüssel lässt er in der Fahrertür stecken, wie zufällig, als hätte ein unvorsichtiger Mensch vergessen ihn abzuziehen. So hatte es ihm Daniel befohlen, auch wenn er sich nicht vorstellen kann, warum er dieses schöne Auto stehlen lassen soll. Wird bestimmt keine fünf Minuten dauern. Zu Fuß geht er weiter in das verabredete Versteck, den Keller eines Hochhauses. Kein Radio, kein Fernseher, nur ein paar alte Zeitungen werden ihm die Zeit bis morgen vertreiben. Er setzt sich auf den Boden, auf eine alte Matte und wartet. Die Stunden vergehen langsam. Seine Uhr zeigt 21:56 an. Vor sieben Stunden hat er den Schuss abgegeben. Und es sind noch zehn Stunden bis er sich wieder auf den Weg 56 machen muss. Schlafen wird er nicht, diese Nacht; das kann er nie nach erledigter Arbeit. Doch dieses Mal ist es nicht das Adrenalin, das ihn wach hält. Es ist das schlechte Gewissen. Mit jeder Minute wird es größer. Er hat Senator van Kuck umgebracht. Einen von drei Männern, die ihr Amt öffentlich dafür einsetzen, die alte Ordnung des getrennten Lebens der Rassen wiederherzustellen, nachdem die Regierung unter de Klerk so entsetzlich versagt hatte. Zwei schwarze Männer waren seitdem Leiter des Staates geworden und einer von ihnen war sogar ein Schwerverbrecher und genießt heute größeres Ansehen als jeder Rockstar. Wenn es so weiterläuft wird sich der prächtige Staat Südafrika zu einem von Buschmännern bewohnten und von Häuptlingen regierten Urwald zurückentwickeln. So hatte Daniel es ausgedrückt. Und er stimmt voll damit überein. Daniel. Was der wohl gerade macht? Sitzt bestimmt zu Hause bei seiner Frau und verabschiedet sich von der Oranje, weil er doch in ein paar Stunden aufbrechen muss. Daniel de Seek betritt in dieser Sekunde das Hochhaus über einen versteckten Seiteneingang. Mit leisen Schritten steigt er die Kellertreppe hinab und öffnet lautlos die Tür. „Hallo, Bruder.“ Erschreckt zuckt der Falke zusammen und dreht sich zur Tür um. „Daniel! Was machst du hier, sagtest du nicht ...“ Doch sein Bruder lässt ihn nicht ausreden. „Ich weiß, ich sagte morgen früh, acht Uhr. Doch das galt nur für den Fall, dass alles wie geplant läuft.“ Der Falke zuckt zusammen. „Tut es das denn nicht?“ Daniel lächelt. „Ganz und gar nicht. Es läuft noch viel besser!“ Er zieht ein kleines Taschenradio aus seinem Rucksack hervor. „Sie haben es geschluckt, der Plan wurde bei weitem übertroffen. Hör dir das an!“ Die Nachrichten laufen bereits. Die dunkle Stimme der Sprecherin erfüllt den Kellerraum. 57 „... heute in der Altstadt von Stellenbosch zu einer Katastrophe. Vier Menschen wurden getötet und mindestens dreißig zum Teil schwer verletzt, als polizeiliche Untersuchungen zu schlimmsten Ausschreitungen führten. Grund der Ermittlungen war das Attentat auf Senator Wilhelm van Kuck, der am Nachmittag gegen 15 Uhr am BraakPlatz tödlich von einer Gewehrkugel am Kopf getroffen wurde. Van Kuck machte vor allem in den frühen neunziger Jahren auf sich aufmerksam, als er aktiv gegen den Abbau der von der Malan-Regierung eingeführten Apartheid eintrat. Seine umstrittenen Veröffentlichungen, den Vorteil einer weißen Oberherrschaft zum Thema, erfreuen sich bis in die heutige Zeit größter Beliebtheit bei regierungsfeindlichen Gruppierungen. In den letzten Jahren nahm sich Senator van Kuck mit seinen Äußerungen zurück, doch seine Einstellung hat sich nie geändert, wie sich an seinem Abstimmungsverhalten nachweisen lässt. Weiteres zu diesem Thema und zu Senator van Kucks kürzlich erfolgtem Aufenthalt in der onkologischen Abteilung des Kapstädter Groote Schuur Hospitals anschließend in unserer Sondersendung 'Senatoren im Kreuzfeuer'. Wer für den Anschlag aus dem Hinterhalt verantwortlich ist, gab die Polizei noch nicht bekannt, doch es ist zu vermuten, dass eine Gruppe radikaler schwarzer Aktivisten den Besuch van Kucks bei der Trauerfeier eines Freundes ausnutzte. Der Senator reiste ohne besonderen Schutz, da er, laut einem Parteifreund, nicht auf sich aufmerksam machen wollte. Die Trauerfeier habe Vorrang vor jeder Art des Presserummels gehabt, mit dem Senatoren hierzulande konfrontiert werden. Unbestätigten Meldungen zufolge wurden heute in Kapstadt zwei junge schwarze Männer festgenommen, in deren vermutlich gestohlenem Wagen ein Gewehr mit Zielfernrohr gefunden wurde. Diese Verhaftungen führten zu einem Aufschrei der schwarzen Bevölkerung des Landes wie man ihn seit Jahren nicht mehr 58 gesehen hat. Beginnend in Stellenbosch zieht sich inzwischen eine Welle von gewalttätigen Demonstrationen bis hin zu Straßenkämpfen zwischen Weißen und Schwarzen durch alle größeren Städte. Über die Zahl der Verletzten oder Toten kann zurzeit nur spekuliert werden, es steht jedoch zu befürchten, dass es nicht bei den Opfern von Stellenbosch bleibt. Präsident Mbeki erwähnte inzwischen öffentlich die Möglichkeit der Verhängung des Notstandes, was der Polizei größeren Handlungsspielraum ermöglichen würde. In seiner Rede um 20 Uhr rief er die Menschen zur Besonnenheit auf. Weiter meinte er, er sei sehr enttäuscht über die Handlung einiger weniger Menschen, die den Annäherungsprozess zwischen schwarzen und weißen Bürgern dieses Landes sehr weit zurückgeworfen hätten. Das gegenseitige Verständnis sei zutiefst erschüttert und er wisse nicht, ob das so bald zu reparieren sei. Wir halten Sie natürlich weiter zu diesem Thema auf dem Laufenden. Johannisburg. Der Rugbyspieler Joost van der Westhuizen gab heute in einer Pressekonferenz bekannt ...“ Daniel schaltet das Radio aus. „Ein echter Märtyrer, meinst du nicht? Ein voller Erfolg! Verstehst du nun?“ Und er versteht. 59 Christiane Stüber Sinnverkehr(t) Eine Wolkendecke – halb Nebel, halb Luftverschmutzung – verhüllt den Berg. Wüsste man es nicht besser, könnte man fast vergessen, dass er sich dort inmitten der Stadt erhebt. Manchmal vergisst man es tatsächlich für ein paar Tage, weil es hier unten im urbanen Tal so viel Zerstreuung gibt. Die Kapstädter sagen, dass der Berg ihr Ruhepol ist, dass sie nur ihm ihre entspannte Art zu verdanken hätten. Man spricht hier gern von Energien und geheimnisvollen Kräften. Das gehört genauso zum Alltag wie zertrümmerte Fensterscheiben und durchstochene Reifen. Kapstadt ist meine neue alte Heimat. Nach einem Jahr in Deutschland bin ich hierher zurückgekehrt. Dabei hatte ich mit diesem Land und seinen Menschen bereits gründlich abgeschlossen. Ich hatte mich in Berlin sehr wohl gefühlt und die Stadt mit dem massiven Berg, dem Ozean drum herum und meiner zerbrechlichen Liebe nicht einmal besonders vermissen wollen. Doch als ich eines Abends allein am menschenleeren S-Bahnhof Bellevue stand, hat sich etwas in mir herumgedreht. Das war nach einem Konzert gewesen. Ich war wunderbar melancholisch gestimmt. Die Künstlerin hatte von unglücklichen Lieben und sehnsuchtsvoller Einsamkeit gesungen und ich hatte heftig applaudiert. Ich hatte dazu geraucht und ein Glas Rotwein getrunken. Es war schön, sich so genüsslich mit dem Leiden zu identifizieren. Ich kam mir dabei außerordentlich erhaben vor. Ein ganz spezielles Gefühl. Wie ich mich allerdings hinterher über der Großstadterde weiterhin so herrlich erhaben und speziell fühlen wollte, kam mir plötzlich ungebeten zu Bewusstsein, dass es furchtbar kalt war – was mich Ende Februar freilich nicht weiter verwundern 60 sollte – und dass ich gleich in eine leere Wohnung zurückkehren müsste. Die nächste Bahn würde in fünf Minuten kommen. In diesen fünf Minuten war es mir nicht möglich, die Romantik des Alleinseins heraufzubeschwören. Ich fror im modischen, aber viel zu dünnen Mantel, meine Nase lief, ohne dass ich ein Taschentuch dabeigehabt hätte. Kurz bevor die Bahn endlich einfuhr, blies der frostige Februarwind durch die Halle. Dieser eisige Wind, der mir damals in Herz und Knochen fuhr, flüsterte eindringlich, dass es hier kein Zuhause für mich gäbe. Ein Haus braucht einen Ofen, jedenfalls im Winter, auch wenn der manchmal rußt. Mein Haus war an einem anderen Ort. Und so blies mich der kalte Berliner Wind eines Tages sanft zurück, hinab in die dampfende Stadt im Süden. Da bin ich nun, in einer Stadt, in der es gerade Frühling wird. Auf meinem Fensterbrett blüht eine Osterglocke. Es ist September. Am Morgen laufe ich die zehn Minuten bis zur Hauptstraße, der Main Road. Ich bin die einzige weiße Frau, die sich um diese Zeit zu Fuß vorwärts bewegt, hauptsächlich in Gesellschaft von dicken schwarzen Nannies, die im langsamen Wiegeschritt auf dem Weg zu ihren weißen Arbeitgebern sind. Der Tankwart an der BP Tankstelle winkt mir freundlich mit seiner stählernen Handprothese zu. Ich weiß nicht, wo er die Hand verloren hat. Wir haben noch nie miteinander gesprochen. Wenn man kein Auto hat, kommt man selten mit einem Tankwart ins Gespräch. Man winkt nur. Landmine? Angola? Ich werde ihn fragen, auch ohne Auto. Morgen vielleicht. An der Brücke rennt ein Mann in verschlissenen Kleidern mit gehetztem Blick an mir vorbei. Er trägt einen dürren Hund auf dem Arm. Hund und Herrchen schauen mich für den Bruchteil einer Sekunde verängstigt an. Ein paar Schritte weiter liegt zerbrochenes Glas auf dem Gehweg verstreut. Eine blond gelockte Dame und ein junges Mäd61 chen mit Handtasche suchen die Böschung ab. Der chromblitzende Jeep steht mitten in der Kurve, die Warnblinkanlage flackert nervös. „Wo ist er, wo ist er nur?“, fragt das Mädchen. Ich überlege: Was haben die beiden Frauen, das zerbrochene Glas auf dem Gehweg, das Auto und der rennende Mann mit dem Hund miteinander zu tun? Wie lange wird es dauern, bis jemand dem aufgeregten Mädchen die paillettenbestickte Handtasche entwendet? Ich kann keinen Schaden am Fahrzeug entdecken, alle Scheiben sind intakt. Hat sie den Hund angefahren? Aber warum ist er dann mit ihm weggerannt? Und woher kommt das zersplitterte Glas auf den Gehweg? Ohne meine Überlegungen zu einem nennenswerten Ergebnis führen zu können, trotte ich weiter zum Fish & Chips Stand am Busbahnhof. Die Abgase der gelben Uraltbusse, die man zuversichtlich immer noch „Goldene Pfeile“ nennt, vermischen sich in schönster Synergie mit zwei stinkenden Fehlzündungen und den entrüsteten Rufen einer Marktfrau. Ich kaufe mir eine Tüte Calamari mit Pommes zum Frühstück und stelle mich schließlich wartend an die Straße. Die Luft riecht nach verbleitem Benzin, Öl, Fett und Knoblauch. Ein Kirchenchor singt und tanzt vorm Eingang zum Shoprite, der südafrikanischen Antwort auf Aldi. Daneben ist ein Schild aufgestellt, auf dem die Künste eines afrikanischen Wunderheilers und Astrologen angepriesen werden. Dem Namen des Spezialisten ist mutig ein „Professor“ vorangestellt. Man weiß sich in einer modernen Stadt der südlichen Hemisphäre durchaus auch dem europäischen oder europäisierten Zweifler glaubwürdig zu machen. Es hätte mich in diesem Moment nicht verwundert, wenn plötzlich von irgendwoher ein Hare Krishna, ein Quäker oder ein Zeuge Jehovas aufgetaucht wäre. Religion ist hier sehr dynamisch und wird feilgeboten wie überreife Avocados: im Zehnerpack. Man sucht sich die besten Stücke aus dem Sack und bäckt sie mittels erhöhter 62 Herzenswärme zu seinem eigenen Hoffnungskuchen zusammen. Konsistenz bedeutet nichts. Hauptsache es funktioniert und man kann dazu tanzen. Keine zwei Minuten später zerrt mich ein junger Mann zu seinem Taxi. Er spricht Afrikaans, nicht das feine Afrikaans der Leute aus Kirstenbosch, sondern eben das der Taxifahrer und Fischer vom Kap. Das ist breit und voller lieb gemeinter Obszönitäten, die die feinen Vorortburen nie freiwillig in den Mund nehmen würden. Ein zweiter kommt hinzu, versucht mich abzuwerben, verspricht, dass sein Taxi sofort weiterfahren wird und nennt mich vertraulich „Schwester“. Bei beiden Konkurrenten fehlt ein Schneidezahn. Irgendwer hat mir erzählt, dass die so genannten „Cape Coloureds“ annehmen, dass wir Frauen solche Zahnlücken sexy fänden. Mag sein. Mein Geschmack ist es allerdings nicht und ich reagiere auf Flirtversuche aus einem unterbestückten Mund gewöhnlich mit einem abwehrenden Grunzen. Ich bleibe unentschlossen zwischen den beiden Kampfhähnen stehen und kaue an einem Tintenfischring bis schließlich ein drittes Fahrzeug direkt neben uns anhält. Aus den Fenstern dringt ein lauter Hip-Hop Beat auf die Straße. „Na dann“, denke ich und krieche auf den letzten freien Platz, der zu zwei Dritteln aus dem Schoß einer großrähmigen Zulu-Frau besteht. Der Geldeinsammler des Taxis ist so zufrieden mit seinem Fang, dass er die Tür noch einmal aufreißt und seine beiden verdutzten Kollegen mit einem Redeschwall erlesener Gemeinheiten belegt. Das ganze Taxi freut sich mit ihm über seinen Erfolg. Wenn man selbst nicht viel zu lachen hat, und das trifft hier auf die meisten zu, dann nimmt man gern an der Freude seiner Mitmenschen teil. Das gefällt mir. Nachdem ich es mir auf dem Schoß der Zulu-Frau einigermaßen bequem gemacht habe – nicht ohne zuvor einen Teil ihrer ShopritePlastiktüten umzuarrangieren – fange ich an, die Insassen 63 zu zählen. Das mache ich immer so. Es ist mir zur Gewohnheit geworden seitdem auf einer meiner Fahrten ein Feuer im Kleinbus ausgebrochen war und ich aus dem Fenster auf die Straße hatte klettern müssen. Ich komme auf neunzehn. Das schließt den Fahrer und den schreienden Geldeinsammler mit ein. Während der halsbrecherischen Fahrt öffnet Letzterer wieder und wieder die Tür seines Fahrzeuges, lehnt sich hinaus und schreit: „Mowbray, Kap Tu.“ „Kap Tu“ steht für Cape Town und bedeutet in der Taxisprache so viel wie der zentrale Busbahnhof im Zentrum der Stadt. Mit mir hat es noch einen weiteren Weißen in den Kleinbus verschlagen. Er ist dürr und trägt eine Halskrause. Er fragt, wie viel er zahlen müsste, wenn er noch unter siebzig sei. Der Geldeinsammler schmunzelt angesichts der seltsamen Frage. Der Mann seiner Frau sei schon über siebzig, seiner Ex-Frau natürlich. Er findet seinen Kommentar amüsant und bringt mit seinem Heiterkeitsausbruch bald auch alle anderen zum Lachen. Doch dann wird er still und beschäftigt sich angelegentlich mit seinem Münzbeutel. Auch er hat eine Zahnlücke, die man nun aber nicht mehr sehen kann, weil das Lächeln auf seinen Lippen erstorben ist. Der mit der Halskrause erklärt ungefragt, dass er eigentlich erst 58 sei und aus Mozambique stammt. Es klingt fast so als wäre ihm das gerade wieder eingefallen. In Mozambique sei die Lage schlimm. Trotzdem will er jetzt von Kapstadt nach Durban und schließlich zurück nach Maputo fahren. Und das alles im Taxi. Die restlichen Passagiere schauen ihn mitleidig an und fragen sich, ob er das überleben wird. Die meisten sind noch nie über Kapstadt und seine Randbezirke hinausgekommen. Wozu auch? Vielleicht, so denken sie, sollte man den weißen Sonderling lieber am Falkenberg Krankenhaus abgeben. Das ist die nächste Klapsmühle auf dem Weg zur Stadt. 64 Der Fahrer dreht die Musik bis zum Anschlag auf. Er ist guter Laune und singt hingebungsvoll in den Verkehr hinein. In der nächsten Kurve purzeln wir alle durcheinander. Ein paar Orangen rollen über den Boden. Die Bässe dröhnen durch unsere Glieder; die Stimmung ist beschwingt. Selbst die verschleierte Greisin, die man beim letzten Halt mühsam im Wagen verstaut hat, wiegt ihren Kopf im Takt. Nun – etwas anderes wäre ihr vermutlich auch nicht übrig geblieben, denn es ist so eng, dass wir entweder alle stillsitzen oder alle wippen müssen. Zum Zeitvertreib stelle ich mir dieses Szenario versetzt in die Berliner U-Bahn vor, die U2, um genau zu sein, vielleicht an einem Samstagabend, wenn alles dicht gedrängt steht und Herr und Frau Gemahl ihr Abonnement für die Philharmonie wahrnehmen wollen. Er mit exakt gekämmtem Verlegenheitsscheitel, sie mit Silberbrosche und artig geknüpftem Seidentuch. Und dann plötzlich: ein deftiger Hip-Hop Sound aus dem Lautsprecher. Ob diese beiden dann ihre scheue Verklemmung von sich werfen und sich locker unters Volk mischen würden? Das wäre doch eine willkommene Abwechslung im neongelben Einerlei. Ich lächle vor mich hin. Ein kleines schwarzes Mädchen, das mich schon seit ein paar Minuten mit großen Augen anschaut, lächelt zurück. An der islamischen Fleischerei verlangt die Greisin wild gestikulierend hinausgelassen zu werden. Schreien hätte bei der Lautstärke auch nichts genützt, schon gar nicht, wenn man wie sie einen dicken Schleier vor dem Mund trägt. Kurz entschlossen schiebe ich mich hinter ihr aus dem Taxi. Hier habe ich früher gewohnt. Lang ist’s her. Es fühlt sich jedenfalls wie eine Ewigkeit an. Auf einem Plakat lese ich, dass es heute im Gemeindezentrum eine „Ganzheitliche Messe“ gibt. Ich habe mich schon immer gefragt, was es mit diesen monatlichen Zusammenkünften auf sich hat. Also schlendere ich neugierig die schmalen 65 Gassen hinunter. Die Straßen vor den kleinen bunten Häuschen sind enger und gewundener als alle anderen in Kapstadt. Künstler, Verrückte und Studenten haben sich in diesem Viertel, das nach seiner Sternwarte benannt ist, eingenistet. Die Fassaden sind brüchig. Überall bröckelt der Putz. Ich gehe an der Moschee vorbei, schaue mir die Auslagen einer indischen Galerie an. An der Ecke entdecke ich den rotblauen Holzzaun von Alfred wieder. Alfred hat vor ein paar Jahren aufgehört, als gewöhnlicher Bettler zu arbeiten und ist zum Geschäftsmann geworden. „Black Empowerment“ nennt man das hier. Er sucht mit seiner Frau den Müll aus der weißen und muslimischen Nachbarschaft zusammen und verkauft die besseren Stücke preisgünstig weiter. Früher hätte er das nicht gedurft. Da gab es Regeln. Heute ist er integraler Bestandteil des südafrikanischen Recyclingsystems. Alte Kinderwagen, Gießkannen, Blumentöpfe, all das haben er und seine Frau ordentlich hinter dem rotblauen Holzzaun aufgeschichtet. Wie er zu dem kleinen Häuschen gekommen ist, weiß natürlich keiner so recht. Wahrscheinlich hat er es leer vorgefunden und ist mit seiner bescheidenen Habe einfach eingezogen. Alfred kennt mich nicht mehr. Dabei ist es nicht mal zwei Jahre her, dass ich ihm den alten Poolfilter abgekauft hatte. Den verwenden wir in unserer Kommune als Grill im Garten. „Zwei Jahre“, denke ich, „mein Gott!“ Das Gemeindezentrum ist rundherum zugeparkt. Auf dem Rasen hat sich die Hippiegemeinschaft der Stadt eingefunden. Man trägt das Haar zerzaust und hat sich orangefarbene Bänder um den Kopf gewickelt. An Töpfern und Kartenlegern streife ich vorsichtig entlang und dringe schließlich ins Gebäude vor. Drinnen sieht es wie in einem lang verlassenen Krankenhaus aus, das nur noch einmal im Monat für die Liebhaber des „Ganzheitlichen“ seine knarrenden Pforten öffnet. Auf der ersten Etage kann man sich selbst finden, so sagt man mir jedenfalls. Die Werkzeuge, 66 die mir dazu angeboten werden, heißen Kundilini-Yoga, Shiatsu und Tarot. Als ich etwas ratlos von einem Experten zum nächsten blicke, spricht mich eine grauhaarige Dame an. Sie trägt einen riesigen Kristall an ihrer Halskette. Normalerweise würde sie dreißig Rand verlangen, aber sie wollte mir gern aus meinem Geburtsdatum ein grundlegendes Profil erstellen, und zwar umsonst. Ich hätte so eine interessante Aura. Ich beschließe, das als Kompliment aufzufassen, und lasse mich auf dem wackligen Klappstuhl vor ihrem Pult nieder. Meine Geburtsdaten werden alsdann auseinander genommen, wieder zusammengezählt, in kleine Kästchen eingetragen, dann einzeln umkringelt. Am Ende erfahre ich, dass ich sehr kopflastig, aber auch intuitiv sei, intelligent und doch kreativ, dass ich einen Verlust erlitten hätte (nein, genauer wollte sie sich dazu nicht äußern, aber ich würde aus selbigem zu lernen haben) und dass ich viel Raum um mich bräuchte. Ich höre für ein Weilchen zu und pflichte ihr dann entschieden bei. Ich brauche tatsächlich viel Raum und würde daher ganz intuitiv die Räumlichkeit verlassen wollen. Sie nickt verständnisvoll. Ich werde den Eindruck nicht los, dass hier alle ständig verständnisvoll nicken. Bei ihr hätte es auch lange gedauert bis sie begriffen hätte, man könne es nicht erzwingen, aber es würde schon noch werden. Sie hätte früher als Sekretärin in Johannesburg gearbeitet und gar nicht gewusst, wie stark sie der inneren Heilung bedurfte, der Heilung, die sie erst hier unten am Kap erfahren sollte. Johannesburg, die Stadt der Geschäftsleute, Banken und Gangster hatte sie beinahe kaputt gemacht. Ich hätte eine gute Energie um mich herum, sagt sie. Ich soll sie nutzen. Ich bedanke mich höflich und bekomme eine Visitenkarte überreicht. Elaine ist ihr Name. Ich frage Elaine, warum sich in Kapstadt das spirituelle Leben zu einer solchen Blüte entfaltet hat. „Es ist der Berg“, sagt sie bedeutungsschwer. „Aha“, denke ich, „das erklärt es dann wohl. 67 Berlin hat nämlich keine Berge. Da ist alles schön platt.“ Dann stelle ich unversehens die Frage, die mich wirklich bewegt: Ich frage Elaine, ob sie vielleicht wüsste, warum mir heute Morgen dieser Mann mit dem dürren Hund auf dem Arm begegnet war und was der mit dem zerbrochenen Glas auf dem Gehweg, dem Auto in der Kurve und den zwei suchenden Frauen zu tun gehabt hätte. Die Frage erscheint mir nun ungeheuer wichtig. Aber da reicht sie mir einfach nur die Hand und wünscht mir einen guten Tag. Enttäuscht verlasse ich die Etage der Heiler, Masseure und Wahrsager und besorge mir ein Stück Karottenkuchen und eine Tasse Kaffee. Damit bleibe ich erschöpft auf dem Treppenabsatz sitzen und betrachte den Menschenstrom um mich herum. Sie alle scheinen dieses ganz bestimmte Leuchten in den Augen zu haben, das Leuchten derer, die auf der Suche sind. Ich ziehe meinen Notizblock aus der Tasche und schreibe: „Unter all den Suchenden fühlte ich mich plötzlich ein wenig verloren.“ Dann verbrühe ich mir die Zunge am Kaffee, blicke grimmig zum allgegenwärtigen Berg empor, der sich mittlerweile seiner Wolkenhülle entledigt hat, und enteile schließlich dem orangefarbenen Treiben. Doch wie man es auch dreht und wendet, in einer jeden Stadt gibt es Dinge, die einen einfach immer wieder einholen – manchmal sogar an ein und demselben Tag. Als ich nach einer weiteren vergnüglichen Taxifahrt – diesmal zur Abwechslung mit einem gesprächigen Jazzliebhaber – auf dem Heimweg bin (das zerbrochene Glas liegt immer noch auf dem Gehweg), kommen mir zwei meiner Mitbewohner in ihrem alten VW-Käfer entgegen. Ob ich nicht Lust hätte, mit ihnen zum Hare Krishna Tempel zu kommen. Dort gäbe es ein kostenloses Abendessen. In punkto kostenlose Nahrungsmittel bin ich außerordentlich verführbar. Die haben mich schon zu den seltsamsten religiösen Veranstaltungen geführt, wenn ich mal wieder kein Geld oder keine 68 Lust zum Einkaufen gehabt hatte. Ich klettere also auf den Rücksitz und lasse mich zu den Krishnas fahren. Wir sind spät dran. Das Tanzen und Singen ist schon vorbei. Es geht ans Essen. Der Raum ist blumengeschmückt. Räucherkerzen verströmen ihren Duft. Ich setze mich auf den Fußboden und bekomme sofort einen Pappteller und eine Plastikgabel in die Hand gedrückt. Dann kommt ein schöner Krishna-Mann nach dem anderen zu mir, kniet nieder, lächelt bezaubernd und tafelt mir eine beträchtliche Portion auf. So ähnlich muss es im Paradies sein, hoffe ich. Ich bin so mit dem Essen beschäftigt, dass ich dem Mädchen neben mir, das mir beharrlich ihre Philosophie auseinandersetzt, kommentarlos zuhöre. Nach dem letzten Gang – das Aufstehen bereitet mir bereits Mühe – stellt sie mir den Prediger vor. Ich frage ihn, was er denn da für eine gelbe Markierung auf der Nase trüge. Er antwortet nachsichtig, dass das der Fußabdruck Krishnas sei. Aus echtem Lehm vom Ganges. Natürlich. Sein weltlicher Name ist Steven; den geistigen kann ich mir nicht merken. Der Prediger will wissen, ob ich an einen persönlichen Gott glaubte. Ich antworte treuherzig, dass ich sozialistisch sozialisiert sei und daher nur an Marx glauben dürfe, dass der aber ganz sicher eine Persönlichkeit gewesen sei. Das Lächeln des Predigers verliert keinen Deut an Innigkeit. Er hat Erfahrung. Unverdrossen fährt er in seinem Interview fort. Ob ich denn nicht glaubte, dass ein ganz bestimmter Zweck hinter meinem Aufenthalt in Kapstadt stünde, etwas was mich meinem Dharma näher bringen würde. Ich lasse mir erklären, was ein Dharma ist, überlege und sage dann: „Das Einzige, was mich wirklich interessiert, ist, warum dieser Mann am Morgen mit seinem dürren Hund an mir vorbeigerannt ist und was das mit dem zerbrochenen Glas auf dem Gehweg, dem Auto in der Kurve und den zwei suchenden Frauen zu tun gehabt hat.“ Wenn er darauf eine Antwort wüsste, wäre ich sehr dankbar und 69 würde auch gern noch einmal über mein Dharma nachdenken. Doch da reißt er unvermittelt seine Arme in die Höhe und alle fangen an zu singen: Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare, Hare. Im Englischen klingt das „Hare, Hare“ wie „Hurry, hurry!“ – „Beeil Dich!“ Das scheint mein Stichwort zu sein. Ich greife mir noch ein letztes Dattelbällchen mit Haselnussfüllung für den Weg und empfehle mich. Auf die wirklich wichtigen Fragen hatten die hier also auch keine Antwort. Draußen ist die Dämmerung schon vorbei. Das geht hier schnell. Grad war’s noch Tag, schon ist es Nacht. Keine sanft fließenden Übergänge. Die gibt es in dieser Stadt, in diesem Land, nicht. Obwohl man es als Frau um diese Tageszeit wirklich nicht tun sollte, gehe ich zu Fuß nach Hause. Ich habe keine Lust, auf die anderen zu warten. Um mir Mut zu machen, starre ich in den dunkelblauen Himmel. „Die Sterne sind hier nicht dieselben wie in Deutschland“, murmle ich sinnlos vor mich hin (nicht dass man sie in Berlin oft zu Gesicht bekommen hätte, aber man kennt sie ja ein bisschen von den gelegentlichen Wochenendausflügen nach Brandenburg). Kein Wunder also, dass ich zuweilen die Orientierung verliere. Aber wenn man sich wirklich verirrt, kann man sich in Kapstadt immer noch auf den Berg verlassen. Der wird erst in ein paar Millionen Jahren vom Meer aufgefressen werden. Und bis dahin – so überlege ich später gähnend in meinem vorgewärmten Bett – würde ich vielleicht herausgefunden haben, was der rennende Mann mit dem verängstigten dürren Hund auf seinem Arm, das zerbrochene Glas auf dem Gehweg, das Auto in der Kurve und die zwei suchenden Frauen an diesem Morgen zu bedeuten gehabt hatten. Aber vielleicht hätte ich die Frage bis zum nächsten Morgen auch vergessen. 70 Margit Breuss Nachbarn „Fadi“, ruft Amina aus der Hütte, „lass die Nassara in Ruhe!“ Noch immer zucke ich zusammen, wenn ich unumwunden „Nassara“ genannt werde: „Weiße“. Jedes Mal werde ich mit der Nase auf das gestoßen, was offensichtlich ist: Ich bin anders. Doch eine „Andere“ zu sein oder als solche bezeichnet zu werden, ist nicht dasselbe. Und Fadimatou besteht darauf, mich bemerkenswert zu finden. „Aber Mama“, ruft sie in die Hütte, „die Nassara trägt den Kochtopf wie ein Baby.“ Ich starre auf den Topf mit Reis, den ich in den Händen halte. „Fadimatou“, sagt Amina, tritt aus der Hütte und fasst ihre Tochter am Arm, „sie kann nichts dafür. Ihre Haare sind einfach zu rutschig.“ „Ach, lass sie nur“, beschwichtige ich und stelle den Topf auf die Erde, „sie hat ja Recht. Wo käme man auch hin bei euch, wenn man die Hände zum Tragen bräuchte.“ Tatsächlich ist es anstrengend gewesen, den Reistopf den Hügel heraufzuschleppen. Vorbei am letzten Maisfeld des Dorfes über den schmalen, ungeschützt der Sonne ausgesetzten Pfad bis zur Familie Ousoumanou, meinen Nachbarn. Der Reis ist mein Geschenk. Die Familie hatte mich zum Essen eingeladen und ich war mir nicht sicher gewesen, was ein passendes Geschenk zu diesem Anlass wäre. So war ich in Gedanken durchgegangen, was ich selber im Lauf der Woche geschenkt bekommen hatte: Reis, eine meterlange Bananenstaude, einen lebenden Hahn und eine Tomatenmarkdose, gefüllt mit gebratenen Termiten. Am liebsten hätte ich natürlich eine Termitendose mitgenom71 men. Doch die Termiten hatte ich längst weitergeschenkt und ich selber verstehe mich leider nicht auf die Zubereitung von Termiten. Den Hahn hatte ich, unwillig ihn zu köpfen, eine Nacht lang in einer Kiste im Wohnzimmer untergebracht. Am nächsten Morgen brachte ich den armen Kerl, der vom stundenlangen Protest völlig erschöpft war, zum Haus des Bürgermeisters, wo er sich sogleich in die dortige Hühnerschar eingliederte. Und so blieb mir nur die Wahl zwischen einem Topf Reis und einer Bananenstaude. Natürlich hatte ich mich für das leichtere Mitbringsel entschieden. Die Ousoumanous, ich weiß nicht ob sie wirklich so heißen, jedenfalls steht Amina Ousoumanou auf dem Heft der Gesundheitsstation, wo ich die Nachbarin kennen gelernt habe, leben zwar nur zweihundert Meter hügelaufwärts hinter unserem Haus, doch auf diesen zweihundert Metern verändert sich die Welt. Unser Haus ist das letzte im Dorf, das ans Strom- und Wassernetz angeschlossen ist. Das Haus ist außen weiß getüncht, es verfügt über blau gerahmte Fenster mit klappbaren Glasscheiben und Moskitogittern dahinter und eine blaue Tür, die am Boden nicht dicht abschließt, was die Kinder des Dorfes in Verzückung versetzt. Durch den Türspalt fällt in der Dunkelheit Licht, und dieses Licht zieht Termiten an, die dort zuhauf von den Kindern eingesammelt werden können. Hinter dieser Tür befindet sich unsere Küche. Gleich hinter der Tür liegen jeden Morgen die Termiten, die sich in der Nacht durch den Türspalt durchgedrängt haben: Immerhin etwa zwei Hände voll pro Tag. In dem schmalen Raum befinden sich rechts der Gasherd und der Kühlschrank, links die Abwasch. Leider ist die Abwasch nicht ans Abwassernetz angeschlossen, sodass sie nicht im herkömmlichen Sinn zu verwenden ist. Wir waschen das Geschirr in großen Bottichen, das Abwasser schütten wir hinter das Haus. Neben der Küche gibt es ein Wohnzimmer mit einem Esstisch 72 und acht Stühlen, was in Anbetracht unserer Besucher stets etwas knapp bemessen ist; daneben steht eine Sitzgarnitur, etwas altmodisch zwar, aber sie erfüllt ihren Zweck. Hier finden zwölf Besucher Platz, wenn sie sich ein bisschen zusammendrängen. Leider hatten wir die Krätze in den Sitzpolstern und es war gar nicht leicht, sie wieder herauszubekommen, sodass wir über die Sitzgarnitur praktisch wochenlang Quarantäne verhängen mussten. Hinter dem Wohnraum geht es weiter zur Dusche und zu den beiden Schlafräumen, einen für meine Kollegin, einen für mich. In der Dusche gibt es fließendes Wasser und eine Spültoilette, beides mit dem Abwassersystem verbunden. So können die sanitären Einrichtungen regelgerecht benützt werden, wenn es im Dorf gerade Diesel gibt, denn mit Diesel werden die Stromaggregate betrieben, die ihrerseits wieder die Wasserpumpen betreiben. Und nicht zu vergessen: Unser Haus hat ein Wellblechdach. Wenn der tropische Regen auf dieses Dach trommelt, ist im Inneren des Hauses zwar kaum eine Unterhaltung möglich. Doch das Dach hat den Vorteil, dass es nicht alle paar Jahre erneuert werden muss, was uns sehr recht ist. Aminas Haus liegt hinter den Maisfeldern des Bürgermeisters, außerhalb der Strom- und Wasserzone. Es ist das dritte von links im Anwesen ihrer Familie. Im ersten wohnt Tante Aissatou, habe ich erfahren, im zweiten Djeinabou, deren Verwandtschaftsgrad ich vergessen habe, und im dritten eben Amina mit ihren drei Jüngsten. Harouna zieht gerade aus, hat mir Amina stolz erzählt, er ist jetzt zehn und baut sein erstes Haus drüben bei seinen Brüdern. Das Gerüst aus Ästen stehe schon, er baue noch kein Ziegelhaus meint Amina, er wachse ja noch heraus und werde irgendwann ein größeres Haus brauchen. Aminas Haus ist aus Lehmziegeln gemauert und strohbedeckt. Das sei aber kein Problem, hat mir Amina versichert, das Ausbessern der Dächer sei Männerarbeit. In Aminas Haus steht ein 73 großes Bett für sie und die Kinder. Daneben türmen sich Kochtöpfe, die großen zuunterst, fünf Stapel nebeneinander, die meisten mit Blumenmotiven verziert. Diese Kochtöpfe sind blitzsauber, im Gegensatz zu den rußgeschwärzten Töpfen, die vor dem Haus liegen. Amina bewahrt darin ihre Habseligkeiten auf und ich denke mir, dass das sehr praktisch ist, wenn man so oft übersiedelt wie die Familie Ousoumanou, denn Amina muss ihre Sachen nicht erst in Bananenschachteln verpacken wie ich schon so oft im Leben. Halbnomaden sind eben aufs Umherziehen eingestellt. Ich weniger, obwohl ich den Arbeitsplätzen nachziehe wie die Familie Ousoumanou den Weidegründen. Aminas Haus hat einen einzigen Raum. Dort wird geschlafen, aufbewahrt und bisweilen auch gegessen, zusammengesessen und geredet. Gekocht wird meist im Freien. Nur wenn es regnet, kocht Aminas Familie im Kochhaus, das eigentlich kein richtiges Haus ist, sondern nur ein Dach über einer Feuerstelle. Und dann gibt es noch den Ort, den Aminas Familie „ha ladde“ nennt, „im Wald“. Wenn Amina sagt, sie gehe in den Wald, geht sie aber natürlich nicht in den Wald, sondern zu einem Erdloch hinter dem Haus, das durch Matten vor Blicken und Kriechtieren geschützt ist. Ich suche manchmal dort Zuflucht, wenn unsere Toilettenspülung nicht funktioniert, weil wieder einmal die Wasserpumpe ausgefallen ist. Welches Haus des Anwesens Dieudonné Ousoumaou gehört, weiß ich noch nicht. Dieudonné ist Aminas Mann. Er war als Säugling an Malaria erkrankt und wurde damals von seiner Familie zum Missionskrankenhaus gebracht. Da die Familie Ousoumanou sehr arm war, konnte sie nicht bezahlen, doch die Missionsleute haben sich erbarmt und den kleinen Kerl gratis behandelt. Zum Dank dafür musste die Familie Ousoumanou das Kind aber Dieudonné nennen, „Gottgegeben“ also, was vielleicht in der Familie Ousoumanou gar nicht so sehr aufgefallen wäre, da die 74 Familie sehr gläubig ist und täglich fünfmal zu Allah betet. Leider haben die Missionsleute darauf bestanden, dass der arme Dieudonné seinen Namen genau so, nämlich französisch trägt, was in der Familie Ousoumanou seltsam fremdländisch klingen muss, weil niemand in der Familie Französisch spricht. Andererseits wissen in Dieudonnés Familie viele wohl gar nicht, was der Name bedeutet, und möglicherweise klingt es für sie etwa so wie Soraya Müller oder Dean Unterleitner, was in Österreich ja auch etwas fremdländisch anmutet, aber durchaus in Mode ist. Amina jedenfalls weiß, wo ihr Mann den Namen herhat, sie hat es mir erzählt, als sie mit Haoua, ihrer Jüngsten, wegen Malaria in der Gesundheitsstation war. Heutzutage ist es ja kein Problem mehr, wenn die Kinder schöne, biblische Namen wie Haoua tragen, was so viel wie Eva bedeutet. Meinen Namen spricht Amina ungefähr französisch aus: Marguerite. Das klingt für mich fremd und bereitet mir Unbehagen, aber wenn man einen Namen hat, den es nicht gibt, muss man eben Kompromisse eingehen. Meistens werde ich ohnehin „Nassara“ genannt. Dafür könnte ich nach den hiesigen Gebräuchen einfach „Kind“ rufen, wenn ich ein Kind ansprechen will. Das würde die Sache sehr vereinfachen, ist mir aber zu unhöflich. Deshalb bin ich auch immer befangen mit Kindern, deren Namen ich vergessen habe, und das sind fast alle. Inzwischen haben sich sieben um mich versammelt und ich kenne nur Fadimatou, die ich Fadi nennen darf. Fadi erklärt den anderen Kindern gerade, dass meine Haare zu glatt sind um darauf Milchkalebassen zu transportieren, es sei mir geradewegs nicht einmal möglich, einen kleinen Kochtopf Reis auf dem Kopf zu transportieren. Fadi möchte eine Haarsträhne von mir haben. Wenn ich ganz still stehe, kann ich eine Kalebasse mit Mais auf meinem Kopf halten. Der Mais ist wichtig. Je schwerer die Kalebasse, desto leichter lässt sie sich ausba75 lancieren. Fadi hat für das Experiment eigentlich Milch vorgeschlagen, aber ich bevorzuge Mais. „Du musst dir die Haare flechten“, sagt sie, „dann wirst du eines Tages auch Milch tragen können.“ Ich schweige, denn ich fürchte, dass die Kalebasse ins Schwanken gerät, wenn ich den Mund bewege. „Mama“, ruft Fadi stolz, „schau, ich habe es der Nassara beigebracht.“ Amina schlägt vor, ein Foto zu machen. Mit mir und den Kindern und der Kalebasse auf meinem Kopf. Wenn ich einen Fotoapparat hätte, würde sie das für mich tun. Raffiniert, denke ich. Amina will wohl Fotos von den Kindern haben. Von jedem einzeln und von allen zusammen. Den Kindern, den Cousins, den Nichten und Neffen. Jede Mutter will das. Eine Erinnerung an die Zeit, als die Kinder noch krabbelten, sich Käfer in den Mund steckten oder gerade die erste Zahnlücke hatten, wie im Moment Fadi. „Ja“, erwidere ich und halte die Kalebasse fest, „Das werden wir tun.“ Und ich werde ein Foto an meine Familie in Europa schicken: Ich, mit der Kalebasse auf dem Kopf und rundherum die Kinder. Und insgeheim hoffe ich, dass meine Familie erkennen wird, wie glatt meine Haare sind. 76 V. Groß Die Geister Afrikas Eigentlich kann ich sagen, dass ich die Trommeln Afrikas schon immer vernommen habe. Als Kind bereits, wenn ich, wie vielleicht jedes Kind, von großen Abenteuern in weit entfernten Ländern träumte. Und auch dieses schwarze Mädchen, um das sich meine Geschichte in gewisser Weise dreht, habe ich schon immer gesehen. Mein Name ist Jim, Jim Locke, und als meine Reise begann, war ich gerade 14 Jahre alt. Meine Eltern waren beide gestorben und mein Patenonkel, der mich zu sich genommen hatte, war kein besonders herzlicher Mann. Vor Jahren schon hatte man ihm wegen der Schulden sein Geschäft, das er als Färber von Stoffen betrieben hatte, genommen, und nun suchte er Trost im Alkohol, war verbittert und mürrisch. Ständig beklagte er sich darüber, dass er mich durchfüttern müsse, obwohl er zu Lebzeiten meiner Eltern niemals irgendwelche Hilfe von diesen bekommen hatte. Eines Morgens eröffnete er mir, er habe für mich auf einem Schiff angeheuert, und wies mich an, mich reisefertig zu machen. So verließ ich Bristol, die Stadt in der ich geboren und aufgewachsen war, um zur See zu fahren. Ich war nicht unglücklich darüber, glaubte ich doch, nun ein neues Leben beginnen zu können, ein freies Leben, weitab von den beengenden schmutzigen Gassen meiner Heimatstadt und den ewigen Nörgeleien meines Onkels. Mit meinem Bündel in der Hand lief ich am Hafen umher und spähte auf die Schiffsrümpfe, wo irgendwo der Name meines Schiffes, der „Stuart Withling“, auftauchen musste. Ich kannte mich aus, denn schon seit Jahren war ich an den Docks he77 rumgeschlichen, hatte die abfahrenden Schiffe beobachtet und die heimkehrenden Seemänner bewundert, deren Haut braun gebrannt und dick wie Leder war, die von ihren Reisen und Abenteuern erzählten und bei Dunkelheit in den Tavernen ihre Shantys sangen und dazu tanzten. Nun also sollte ich selber ein Seemann werden. Endlich entdeckte ich durch die Menge der Menschen, die Fässer von den Schiffen rollten und schwere Bündel ausländischer Stoffe an den Kais stapelten, den weißen Schriftzug meines Schiffes. Es war ein sonniger Vormittag im Jahre 1744, die Möwenschreie gellen mir noch heute im Ohr und noch immer rieche ich den Geruch von Salz und Teer, der, wie ich später feststellen sollte, so typisch war für die Häfen der Welt. Bald stand ich also vor der „Stuart Withling“, einem ansehnlichen Klipper, der, wie ich nebenbei bemerkte, frisch gestrichen war. Ein durchschnittlicher Dreimaster wie er seit Jahren schon in Gebrauch war, um Handelswaren über die Meere zu bringen. Ich lief die Schiffsplanke hinauf und sah mich nach dem Mann um, der fürs Anheuern zuständig war. Ich fand ihn, übergab ihm das Schreiben, das mein Onkel mir mitgegeben hatte, machte mein Kreuz an die dafür vorgesehene Stelle der Besatzungsliste und erfuhr, dass ich als Schiffsjunge an Bord genommen war. Während der ersten Nacht, die ich unter Deck in den engen Mannschaftsquartieren in meiner Hängematte verbrachte, hörte ich einiges über die bevorstehende Reise. Tatsächlich war ich ja an Bord gegangen, ohne das Geringste über Ziel und Auftrag des Schiffes zu wissen. Nun lag ich also hier, während sich das Deck nach und nach mit den Seemännern füllte, die auf dieser Reise meine Gefährten sein sollten; grobschlächtige Kerle in allen Altersklassen und darunter manch wirklich finsterer Geselle, der mir einen gehörigen Schrecken einjagte. Ich drückte mich tiefer in meine Hängematte und war froh, 78 dass mich niemand so recht zur Kenntnis zu nehmen schien. So lauschte ich ihren Gesprächen, während sie Rum tranken und Tabak rauchten. Viele Geschichten erstaunten mich doch sehr, Berichte von seltsamen Vorkommnissen, von Seeungeheuern, Klabautermännern und fremden Ländern, von Kannibalen und glänzenden Städten aus purem Gold; das berüchtigte Seemannsgarn, wie ich später erfuhr. Aber ich schnappte auch einiges Brauchbares auf. So erfuhr ich, dass wir im Auftrag einer Londoner Handelsgesellschaft nach der Goldküste unterwegs sein würden um dort die Waren, die wir geladen hatten, hauptsächlich Waffen, Branntwein und Baumwollstoffe, gegen Gold, Elfenbein und Pfeffer zu tauschen. Unser Kapitän, den ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht an Bord gesehen hatte, war ein Portugiese oder Spanier namens Don Felipe, ein verwegener Mann und, wie es hieß, ehemaliger Freibeuter. Allmählich sank ich in einen unruhigen Schlaf und ich träumte von den fernen Küsten jenes dunklen, geheimnisvollen Kontinents, der unser Ziel sein sollte. Wilde exotische Tiere bevölkerten meine Traumlandschaften, Löwen und Elefanten und allerhand anderes merkwürdiges Getier, das ich aus einem Buch meines Onkels kannte, das dieser stets sorgfältig in seiner kleinen Bibliothek aufbewahrt hatte. Ich sah in meinen Träumen ebenso die Bewohner dieses fernen Kontinents. Ich sah sie so wie ich sie von meinen früheren Beobachtungen am Hafen kannte. Ausgemergelte, halb verhungerte Gestalten von schwarzer Hautfarbe, gebückt und niedergedrückt, in Ketten darauf wartend, was mit ihnen geschehen würde. Ich hatte gelernt, dass diese Wesen nicht mehr waren als eine Vorstufe der zivilisierten Menschheit, dem Affen näher als uns Europäern. Hin und wieder wurden einige von ihnen nach England gebracht. Zumeist jedoch brachte man sie, wie ich wusste, nach Amerika, in die neue Welt, wo sie niedrige 79 Arbeiten verrichteten, auf den Feldern oder als Bedienstete der hohen Herrschaften. Immer wieder sah ich jedoch in meinen Träumen auch das schwarze Mädchen, das mich anlächelte und mir zuwinkte. Eine Merkwürdigkeit, die erst später Bedeutung gewinnen sollte. Am nächsten Morgen ging es los. Die Pfeifen ertönten und die Wanten füllten sich mit gewandten Kletterern, die sich anschickten die Segel zu setzen. Der Anker wurde gehoben und das Schiff setzte sich in Bewegung. Wir segelten durch den Kanal von Bristol hinaus aufs offene Meer und schlugen sodann einen südlichen Kurs ein, der uns entlang des europäischen Festlandes über den nördlichen Wendekreis hinaus zu den geheimnisvollen Küsten Afrikas bringen sollte. Die Zeit des Müßiggangs war vorbei. Ich wurde fürs Erste dem Schiffskoch zugeteilt und verbrachte von nun an endlose Stunden in der engen stickigen Kombüse, wo ich half das Essen zuzubereiten. Zuweilen trug ich dem Kapitän und seinen Offizieren Mahlzeiten auf oder wurde dazu verpflichtet, das Deck zu schrubben oder im Mastkorb Ausschau nach anderen Schiffen zu halten. Mir blieb nur wenig Zeit um mich träumerischen Gefühlen hinzugeben und mich in den unbeschreiblichen Sonnenuntergängen auf offener See zu verlieren. Abends fiel ich todmüde in meine Hängematte und schlief traumlos wie ein Stein bis zum nächsten Morgen. Aber ich war sehr neugierig und lernte viel über das Handwerk der Seemänner. Ich lernte bald, die See zu lieben und genoss nach anfänglichen Schwierigkeiten die ewige träge Bewegung unseres Schiffes, das andauernde Geräusch der gegen die Bordwand anrollenden Wellen, die salzige Luft und den freien Blick über einen gewölbten Horizont, der durch nichts behindert wurde. Während unserer gesamten Reise blieben wir von französischen Galeonen und marodierenden Freibeutern ver80 schont, nicht zuletzt wegen des Geschicks unseres Kapitäns, der, immer wenn ein fremdes Schiff in Sichtweite kam, nicht zögerte, die entsprechende Flagge hissen zu lassen, die uns als ein befreundetes Schiff auswies. Nach einer kurzen Zwischenlandung bei Cap Verde, wo wir Proviant und Trinkwasser an Bord nahmen, gelangten wir nach beinahe anderthalb Monaten auf See unbehelligt an unser Ziel. Schon von weitem leuchteten die weiß getünchten Mauern der Festung Cape Coast, auf einer hohen Klippe über dem Meer gelegen, im gleißenden Sonnenlicht. Gemächlich segelten wir in Richtung der Festung und schließlich warfen wir unweit der Küste unseren Anker und refften die Segel. Wir waren am Ziel unserer Reise angekommen. Vor uns lag die Goldküste Afrikas. Ich muss gestehen, dass ich sehr aufgeregt war, als ich zum ersten Mal die Ufer dieses sagenumwobenen Kontinents aus der Nähe zu Gesicht bekam. Doch ich sollte bald noch engere Bekanntschaft mit diesem Land machen. Der Kapitän, mit dem ich mich während der Fahrt angefreundet hatte, und der offensichtlich meine ständige Neugier und Lernbereitschaft wohlwollend zur Kenntnis genommen hatte, kam kurz nach unserer Landung zu mir und fragte mich, ob ich ihn bei seinem Landgang begleiten wolle. Natürlich willigte ich sofort ein und die Begeisterung muss meinen Augen einen strahlenden Glanz verliehen haben, denn Don Felipe lächelte und schien sich mit mir zu freuen. Was für ein guter Kerl er doch eigentlich war, unter dieser rauen Schale des draufgängerischen Kapitäns. Ich muss sagen, dass ich ihn sehr mochte. Vielleicht galt er mir damals bereits als eine Art Ersatz für den Vater, den ich so früh verloren hatte. So bestiegen wir, während der Rest der Mannschaft sich an das Abladen der Ladung machte, eine Schaluppe und wurden über das sanfte Meer hinüber an Land gerudert. 81 Gebannt starrte ich zu der strahlenden Festung auf den Klippen, die langsam größer und größer wurde. Nie zuvor hatte ich etwas Prachtvolleres zu Gesicht bekommen. Wir erreichten die schmale Pier und gingen an Land. Ein ausgetretener Weg führte die Klippe hinauf zur Festung. Schon nach wenigen Metern wurde mir bewusst, wie sehr der ewige Meereswind an Bord die Hitze gemildert hatte, denn hier an Land war es unerträglich heiß, so dass mein Hemd bald durchgeschwitzt war und nass an meinem Körper klebte. Unser kleiner Trupp näherte sich der Außenmauer Cap Coasts und ich sah die großen, schweren Kanonen, mit denen die Festung bestückt war. Auf den Mauern patrouillierten Wachen mit Hellebarden. Die Festung schien keineswegs so friedlich wie sie gewirkt hatte. Herrschte hier etwa Krieg? Während wir uns dem Tor näherten, durchschritten wir eine Ansammlung von provisorischen Handelsständen, die überall um die Anlage herum aufgebaut waren; manche größer und stabiler, mit einem Leinendach zum Schutz gegen die unerbittliche Sonne, andere nur durch ein Stück Stoff auf dem Boden gekennzeichnet, auf dem die Waren ausgebreitet lagen. Mich beschlich ein ungutes Gefühl, eine Unsicherheit angesichts der Massen von dunkelhäutigen Menschen, und erstmals wurde mir bewusst, dass in diesem Teil der Welt wir, die wir von weißer Hautfarbe waren, die Minderheit darstellten. Ein befremdliches Gefühl, das sich in eine unbestimmte Angst verwandelte. Umso erleichterter war ich, als wir durch das geöffnete Tor ins Innere der Festung gelangten. Hier überwogen Menschen unserer Rasse. Soldaten, Händler, Bedienstete bevölkerten das Innere der Mauern. Don Felipe setzte mich davon in Kenntnis, dass er nun unverzüglich die Geschäftsverhandlungen in Angriff nehmen wolle und ich mich in dieser Zeit hier umsehen könne. Er selbst wäre für mindestens zwei Stunden in der Palaverhalle beschäftigt, wo es für mich sicher langweilig 82 wäre. Die Palaverhalle, so erklärte er mir, war der Ort, an dem sich alle, die irgendwelche Geschäfte tätigen wollten, versammelten um ihre Konditionen auszuhandeln. Aus purer Neugierde begleitete ich ihn bis zum Eingang dieses seltsamen Ortes, warf kurz einen Blick in die weite, nach den Seiten fensterlose Halle, in der ein unglaubliches Getümmel und ein undurchdringliches Gewirr von Stimmen herrschte. Dann beschloss ich, ein wenig auf eigene Faust durch die Festung zu streifen. Der Kapitän hatte mir versichert, dass einem englischen Jungen innerhalb der Anlage keine Gefahr drohte. Im Notfall sollte ich seinen Namen oder den Namen unseres Schiffes verwenden, wenn es aus irgendeinem Grund galt mich auszuweisen. So zog ich unbesorgt los um die Geheimnisse von Cape Coast zu enthüllen. Leider entsprachen meine träumerischen Erwartungen in keiner Weise der Realität. Bald musste ich feststellen, dass das Innere der Festung sehr schmutzig war und deutliche Verfallserscheinungen zeigte. Niemand schien sich um die Instandhaltung der Anlage zu kümmern. Selbst die Soldaten, die ich unterwegs beobachten konnte, wirkten nicht gerade so, als verrichteten sie ihren Dienst mit großer Freude und ehrlichem Pflichtbewusstsein; viele waren betrunken und ihre Uniformen ungepflegt, unordentlich, ja geradezu verdreckt. Keine Spur jener Disziplin und Korrektheit, die ich aus England von den Soldaten unserer Majestät gewohnt war. Der Dienst hier schien seinen Tribut zu fordern. Nach einiger Zeit, in der ich über die Mauern und Wehrgänge gestreift war um mir die schweren Kanonen anzusehen und einen Blick über das Meer auf unser Schiff zu werfen, das neben vielen anderen vor der Küste lag, entschloss ich mich etwas tiefer in die Räume der Festung vorzudringen. Dort würde es kühler sein als oben auf den Mauern, auf die die Sonne unerbittlich nieder brannte. So gelangte ich in tief gelegene Gewölbe, die mir wie große 83 Katakomben erschienen. Ich vernahm gellende Schmerzensschreie, knallende Peitschenhiebe und eine Sinfonie rasselnder Eisenketten. Durch schattige tunnelartige Hallen näherte ich mich, neugierig geworden, der Quelle der erschütternden Geräusche. Doch ich kam nicht weit. Als ich um eine Ecke bog, traf ich auf zwei Soldaten, die mir mit gekreuzten Hellebarden den Weg versperrten. Barsch machten sie mir klar, dass ich hier nichts verloren hätte, gaben sich aber glücklicherweise damit zufrieden, dass ich mich einsichtig zeigte und umkehrte. Zuvor jedoch gelang es mir noch einen Blick auf die Szenerie hinter den beiden Uniformierten zu werfen, in ein Gewölbe, überfüllt von schwarzen Leibern, die aufs Engste zusammengepfercht waren. Mehrere Soldaten schienen irgendeine Ordnung in den konturlosen Haufen der Menschen bringen zu wollen. Sie versuchten verschiedene Gruppen zu bilden, wobei sie ihre Peitschen auf die Rücken der Gefangenen niederschnellen ließen, herumbrüllten und ihre Opfer mit Tritten malträtierten. Sie behandelten diese Menschen wie Vieh. Das ganze Gewölbe war verdreckt und es stank nach Urin und Kot. Angewidert suchte ich das Weite. Die schrecklichen Bilder aber gingen mir nicht mehr aus dem Kopf und noch heute erschauere ich bei dem Gedanken an jene unmenschlichen Szenen. Draußen im Hof bemerkte ich entlang der Innenseite der weiß getünchten Mauer eine Reihe alter schwarzhäutiger Menschen. Es schienen Händler zu sein, denn wie auch die anderen vor der Festung hatten sie bunte Decken und Tücher vor sich ausgebreitet, auf denen ich die verschiedensten Gegenstände erkennen konnte, geschnitzte Figuren, Federschmuck, aus Holz und Elfenbein gefertigte Kunstgegenstände. Um mich von dem eben Erlebten abzulenken, vertiefte ich mich in die Betrachtung der wunderschönen Schmuckstücke, die hier feilgeboten wurden. 84 Nach einer Weile bemerkte ich, dass mich einer der Händler unentwegt ansah. Er schien noch älter als die anderen zu sein. Seine dunkle, fast schwarze Haut war faltig und wirkte wie Pergament. Seine Haare waren von Grau durchzogen. Er war entsetzlich dürr und seine Augen blickten verschleiert. Zu meinem Erstaunen und, wie ich zugeben muss, allergrößten Entsetzen winkte er mich mit seiner knochigen Hand zu sich. Dabei stieß er gutturale Laute aus, die ich nicht verstehen konnte. Der Alte winkte und rief ohne Pause. Es dauerte ein wenig, bis ich fähig war zu reagieren. Schließlich ging ich zu ihm. Sofort verzog sich sein Gesicht zu einem breiten zahnlosen Lächeln des Glücks, was mir absurd vorkam, da ich immer noch nicht wusste, was er eigentlich von mir wollte. Er zog mich zu sich herunter und wiederholte, soweit ich es verstand, immer wieder dasselbe Wort: „Allijah … Allijah“, wobei er glücklich lachte und Freudentränen weinte. Er umarmte mich wie einen lange verlorenen Sohn, betastete mein Gesicht mit seinen rauen Händen, als könne er nicht glauben, dass ich wirklich vor ihm stand. Ich verspürte eine seltsame unnatürliche Kälte bei der Berührung des Alten; eine Kälte, die mich am ganzen Leib erzittern ließ. Mir wurde unheimlich zumute. Ich befürchtete, irgendetwas Dummes oder gar Verbotenes getan zu haben, und versuchte mich aus seiner Umarmung loszureißen. Endlich gab er mich frei. Immer noch lachend vor Glück nahm er einen Gegenstand, der vor ihm auf der Decke gelegen hatte, und hielt ihn mir auffordernd hin. Es war eine wunderschöne Kette. Violett-silbern schimmernde Muscheln waren daran aufgereiht und die Kette hielt eine kleine, klobige Figur aus schwarzem Holz. Er streckte mir das Schmuckstück entgegen und forderte mich offensichtlich auf, sie an mich zu nehmen. „Allijah … Allijaaah …“, sagte er immer wieder. Anscheinend sollte dies ein Geschenk sein. Verlegen griff ich nach der Kette und auf 85 seine eindringlichen Gesten hin legte ich sie mir um den Hals. Der Alte nickte zufrieden und sprach nun die ersten Worte, die ich verstand. Mit einem gräulichen Akzent, der die Worte kaum noch als Teil des Englischen erkennbar werden ließ, hörte ich ihn sagen: „Du behalten … ziehen nicht aus … nicht aus … niemals ziehen aus … lassen an … dich schützen … dir helfen.“ Ich verstand: Es handelte sich um eine Art Talisman. Ich lächelte und versuchte ihm klarzumachen, dass ich begriffen hatte und die Kette gerne anbehalten würde, wenn ihm so viel daran lag. Er wirkte, als sei ihm eine tonnenschwere Last von den Schultern gefallen, und ich stand da und verstand noch immer nichts. In diesem Moment sah ich Don Felipe den Hof betreten und schon hörte ich ihn nach mir rufen. Ich verabschiedete mich von dem Alten und beeilte mich, zum Kapitän zu kommen. Hinter mir hörte ich jenes seltsame Wort, das der Alte leise flehend von sich gab: „Allijaah … Allijaaah …“ Ich erreichte den Käpten und seine beiden Begleiter und nach einigen scherzhaften Bemerkungen über die Kette, die ich nun trug, wurde mir eröffnet, dass dies noch nicht das Ende unseres Ausfluges war. Die eigentlichen Abenteuer standen mir erst noch bevor. Ich erfuhr, dass wir einen Ausflug ins Landesinnere unternehmen würden, wo wir am Abend jemanden treffen sollten, der uns mit besonderen Waren beliefern würde. Ich ahnte nicht, worum es sich bei diesen Waren handelte, die die Männer als „schwarzes Ebenholz“ bezeichneten. Nach kurzen Vorbereitungen brachen wir am frühen Nachmittag auf in Richtung des vereinbarten Treffpunktes, der etwa drei Stunden entfernt landeinwärts lag. Die Sonne stand wie ein glühender Ball über unserem kleinen Trupp, der aus mir, dem Kapitän und einem einfachen Matrosen unseres Schiffes bestand. Gequält von der sengenden Hitze trabte ich auf dem Maulesel, den man mir als Reittier 86 zugewiesen hatte, hinter den beiden Männern auf ihren Pferden und den mitgeführten Packtieren her. Wir ritten die Klippe hinunter, auf der die weiße Silhouette Cape Coasts aufragte, und schlugen einen staubigen Weg ein, der uns in eine Landschaft versetzte, die nicht die geringste Spur von Zivilisation aufwies. Weite, steppenartige Grasebenen durchsetzt mit vereinzelten Wasserlöchern und dünnen Flussläufen, an denen unzählige Tiere um das Leben spendende Nass kämpften; exotische Vögel, die ich nie zuvor gesehen hatte; Raubtiere, die aus dem Wasser hervorschossen, schwerfällige Fluss-Kolosse mit monströsen Mäulern, die sie so weit aufrissen, als wollten sie alles um sich herum verschlingen. Am hitzeflirrenden Horizont sah ich gewaltige Herden gehörnter rehartiger Tiere, die mit unglaublicher Geschwindigkeit und Eleganz dahinsprangen. Ich war wie betäubt von der Vielfalt des Lebens unter diesem strahlend blauen Himmel, dessen Farbe so intensiv war wie es sich ein Europäer nicht vorzustellen vermag. Weit hinter der Ebene ragten majestätische Gipfel auf, gekrönt von weißem Glanz. Dieses Land war atemberaubend schön und blieb von diesem Tag an für immer meiner Vorstellung vom Paradies verwandt. Die Zeit verging wie im Flug, während ich nicht genug davon bekommen konnte, alles mit begierigem Blick in mich hineinzusaugen. Schließlich näherten wir uns jenem See, der unser Bestimmungsort war. Wir stiegen ab und richteten uns darauf ein zu warten. Wir schlugen ein Zelt auf und fertigten uns eine provisorische Feuerstelle. Während wir zusammensaßen und warteten, erzählte Don Felipe merkwürdige Geschichten, die sich um den See rankten, an dem wir lagerten. Ein Zwischenhändler in Cape Coast hatte davon berichtet. Vor ein paar Jahren hatte in der Gegend ein blutiges Massaker stattgefunden. Über hundert Eingeborene, Aschanti-Krieger, waren von englischen Soldaten und gedungenen Söldnern grausam 87 niedergemetzelt worden. Der Boden war mit Blut getränkt und das Wasser des Sees hatte sich zur Gänze rot gefärbt. Furchtsam lauschte ich den Worten Don Felipes, den seine Erzählung nicht im Geringsten zu bewegen schien. Vielmehr schien er belustigt, als er nach der Schilderung des Massakers ein spöttisches Grinsen aufsetzte und uns zuraunte, dass diese Gegend seit jenem Tag als verflucht galt. Die Händler erzählten sich haarsträubende Geschichten über den Ort, an dem wir unser Lager aufgeschlagen hatten, Geschichten von geisterhaften Erscheinungen, von den Seelen der toten Aschanti-Krieger, die keine Ruhe finden konnten und darauf brannten, sich an den weißen Unterdrückern zu rächen. Ich erschrak und mir wurde mulmig zumute. Verstohlen sah ich mich um. Mir war mit einem Mal als würden glühende, hasserfüllte Augen auf mir ruhen, hinter meinem Rücken, unsichtbar, unberechenbar. Als Don Felipe sah, dass ich bleich geworden war, brach er in lautes Gelächter aus, das am Seeufer einen großen Schwarm Vögel kreischend in den Himmel aufsteigen ließ und sich in der Weite der Landschaft verlor. Nach dem Essen wurde der Kapitän zunehmend unruhiger. Seine gute Laune war verflogen. Immer wieder stand er auf und blickte über die Ebene. Der vereinbarte Zeitpunkt war längst überschritten. Auch ich machte mir Sorgen, denn ich legte keinen Wert darauf, an diesem Ort zu übernachten. Ich griff nach dem Amulett, das der alte Händler mir gegeben hatte. „Vielleicht“, so dachte ich, „wird es mich schützen.“ Eine Stunde später, der Himmel hatte sich inzwischen in ein phantastisches Farbenspiel verwandelt, näherte sich vom Ostufer des Sees ein Reiter. Der Mann erreichte uns, zügelte sein Pferd mit einer Härte, die das Tier in den Hinterläufen einknicken ließ und unser Lager mit einer Staubwelle überschüttete. Er sprang ab und brachte Don Felipe die Nachricht, die mich in blankes Entsetzen 88 versetzte: Die Kolonne war aufgehalten worden und würde nicht vor dem nächsten Morgen zu uns stoßen. Don Felipe fluchte und wies uns mit barscher Stimme an, die Übernachtung vorzubereiten. Ich ahnte, dass es eine schlaflose Nacht für mich werden würde. Nachdem wir uns bei Einbruch der Nacht ins Zelt zurückgezogen hatten, Don Felipe, der Matrose und ich, lag ich noch einige Zeit wach und lauschte den Geräuschen dieses Landes, die wie eine fremdartige Melodie um uns herum erklang. Durchbrochen wurde diese Melodie, die schön und beängstigend zugleich war, nur durch das schnarrende Schnarchen des Kapitäns, der in der Dunkelheit neben mir lag und sorglos wie ein Kind seinen Träumen nachstieg. Der Bote, der uns die Nachricht gebracht hatte, war trotz unserer Einladung entschlossen, die Nacht im Freien zu verbringen. Er war, seinen eigenen Worten nach, mit diesem Land vertraut, es machte ihm nichts aus, unter freiem Himmel zu übernachten. Mich graute bei dem Gedanken, die Nacht außerhalb des Zeltes verbringen zu müssen, und ich hielt seinen Entschluss für das Zeichen großen Mutes. Ein erstickter Schrei riss mich aus dem Schlaf. Noch bevor ich ganz zu mir gekommen war, bemerkte ich den Kapitän und den Matrosen, die beide zu ihren Waffen gegriffen hatten und aus dem Zelt stürmten. Ich hörte Schüsse und lautes Fluchen. Dann erneut ein Schrei; ein Todesschrei, den ich, wie so vieles andere, das ich in diesem Land erlebte, nie mehr vergessen sollte. Ängstlich hob ich die Plane, die den Zelteingang bedeckte, ein Stück nach oben und schob mich mit angespannten Muskeln aus dem Eingang, jederzeit zur Flucht bereit. Was ich sah, raubte mir den Atem. In der mondbeschienenen Dunkelheit gewahrte ich eine Anzahl wild aussehender Männer. Ungewöhnlich große und schlanke Erscheinungen, bewaffnet mit langen Speeren, mit bemalten 89 Gesichtern, die Köpfe mit Federschmuck verziert. Es musste sich um Aschanti-Krieger handeln, jene auf Rache sinnenden Untoten, von denen Don Felipe gesprochen hatte. Und tatsächlich: Ein Schuss, den der Kapitän auf eine der Erscheinungen abfeuerte, blieb ohne Wirkung. Die Kugel jagte glatt durch das Wesen hindurch und ließ es unverletzt. Die Geister Afrikas! Entsetzt sah ich, wie nur wenige Meter vom Zelteingang entfernt ein Krieger seinen Speer in den am Boden liegenden Körper des Matrosen stieß. Sein Gesicht war hassverzerrt und sein einziges Ziel schien es zu sein, den Tod zu bringen. Mir blieb nichts als die Flucht. Ich schoss aus dem Zelt, bereit um mein Leben zu laufen. Doch ich kam nicht weit. Aus dem Nichts erschien ein Krieger und versperrte mir den Weg. Gelähmt blieb ich stehen, unfähig irgendetwas anderes zu tun als dem Schrecken ins Auge zu sehen. Der Untote hob seine Waffe und in diesem Augenblick, ich weiß nicht, wie ich in diesem furchtbaren Moment auf solch absurde Gedanken verfiel, nahm ich die ganze Schönheit, die ganze Eleganz dieses schwarzen Kriegers wahr. Den Stolz, den er empfand, seine Liebe zu diesem Land, in dem er gelebt hatte, zu seinen Stammesbrüdern, seiner Familie, seinen Kindern. Ich erkannte die Würde der uralten Kultur, die diese Menschen geschaffen hatten, die Prächtigkeit ihrer Mythen, ihrer Götter, und zugleich sah ich die Erniedrigung, die ihnen zugefügt wurde, von denjenigen, die in ihr Land gekommen waren und die sie wie wilde Tiere behandelten, sie in die Sklaverei verschleppten und ihrer Heimat beraubten. All die Kinder, die ihre Eltern verloren hatten, all die toten Krieger, hingeschlachtet aus purer Gier. All das sah ich in diesem einen Augenblick, der, wie ich dachte, mein letzter sein würde. Aber ich wurde gerettet. Es war das Amulett, das mein Leben bewahrte. Aus irgendeinem Grund, den ich damals nicht erahnen konnte, den ich aber heute, Jahre später zu 90 akzeptieren gelernt habe, ganz einfach weil es keine andere Erklärung gibt, hielt der Krieger mitten in der tödlichen Bewegung seines speertragenden Armes inne und starrte mit großen, geisterhaften Augen auf das Amulett auf meiner Brust. „Allijah“, hörte ich ihn mit dunkler, weit entfernter Stimme sagen. Dann drehte er sich um und rief, lauter diesmal, das Wort seinen Gefährten zu, die gerade dabei waren, den wütend um sich schlagenden und brüllenden Don Felipe einzukreisen. „Allijah … Allijah ...“ Plötzlich war alles so abrupt zu Ende wie es begonnen hatte. Die Aschanti-Krieger ließen von uns ab, ihre Erscheinungen begannen zu verblassen. Immer durchsichtiger wurden ihre Körper und auch der Krieger vor mir verblasste. Im letzten Moment tat er etwas Außergewöhnliches. Er lächelte. Das Gesicht war nun friedlich, ja freundlich, als er die Hand hob, durch die ich bereits die dahinter liegende Landschaft sehen konnte, und mir über den Kopf strich. Ich spürte eine unermessliche Kälte und die Angst kam zurück. Aber nichts geschah. Der stolze Krieger löste sich auf und verschwand. Stille fiel über das Lager. Der Matrose und der Bote waren tot. Ihre Leichen lagen blutüberströmt im Mondlicht auf der staubigen Erde. Don Felipe hatte überlebt. Verwundet zwar, aber noch bei Kräften schleppte er sich zu mir herüber, während ich immer noch wie versteinert stand und mit der rechten Hand das Amulett hielt, das uns beiden das Leben gerettet hatte. Gemeinsam durchwachten wir die Stunden bis zum Morgengrauen. Als die Kolonne unseres Handelspartners auftauchte, waren wir gerettet. Die Waren, die sie uns lieferten, waren Sklaven, schwarzes Elfenbein. Es handelte sich um eine kleine, etwa zwanzigköpfige Gruppe ausgewählter, besonders gesunder und kräftiger Menschen, die wir nach England bringen sollten, wo sie zur exklusiven Freude eines 91 hohen Lords als Diener und Küchenmägde angestellt werden sollten. Es schmerzte mich, diese Menschen in Ketten zu sehen, denn mein Herz war für sie erwacht. Zu viel hatte ich im Angesicht des Todes gesehen und über sie erfahren. Ich flehte Don Felipe an, sie frei zu lassen. Zwar reagierte er freundlich und ich glaubte Mitgefühl und Verständnis in seinen Augen zu sehen. Aber mein Flehen nutzte nichts. „Es ist ein Geschäft, Jim“, sagte er, „Nichts weiter. Ich muss meine Pflicht erfüllen und diese Kreaturen nach Bristol bringen. Es tut mir Leid, Junge.“ Tränen der Wut füllten meine Augen. Dann sah ich das Mädchen. Ich erkannte sie sofort. Das kleine Mädchen aus meinen Träumen. Verloren stand sie inmitten der Gruppe von Sklaven, die für unser Schiff bestimmt waren. Ich fragte mich, wie sie wohl hierher gelangt war, da doch ansonsten nur Erwachsene der Gruppe angehörten. Aber das alles spielte nun keine Rolle mehr. Sie war hier und sah mich von unten herauf mit ihren großen, wunderschönen dunklen und geheimnisvollen Augen an. Wir standen inzwischen am Kai von Cape Coast und warteten mitsamt unserer unheiligen Fracht auf das Beiboot, das uns zur „Stuart Withling“ zurückbringen würde. Entschlossen und mit dem sicheren Gefühl, dass er meine Bitte nicht abschlagen konnte, sprach ich Don Felipe noch einmal an. Ich bat ihn, mir nur dieses eine Kind zu überlassen. Ich versprach, mich um sie zu kümmern, für sie zu sorgen. Er willigte ein. Er wusste wohl genau, dass er mir sein Leben verdankte, mir und dem Amulett, das ich nach wie vor um den Hals trug. Ich nahm das Mädchen auf den Arm, wo es wie selbstverständlich den Kopf an mich schmiegte und seine Arme um mich schlang. Wir ruderten zu unserem Schiff, zogen den Anker ein und hissten die Segel. Während wir langsam Fahrt aufnahmen, stand ich mit dem Kind auf meinen Armen an der 92 Reling und sah ein letztes Mal hinüber nach Afrika, jenem geheimnisvollen Kontinent, der mein Schicksal geworden war. Zuletzt glaubte ich am Kai eine Gestalt zu sehen, die mir winkte. Es war eine Frau, gekleidet in bunte Tücher. Sie weinte. Das Kind auf meinen Armen hob die Hand und winkte zurück. Heute lebe ich mit Allijah in Bristol. Mein Onkel war während meiner Reise zur Goldküste gestorben und hatte mir Werkstatt und Haus hinterlassen. Mit Hilfe einiger alter Geschäftsfreunde und der Unterstützung Don Felipes, der niemals vergaß, was in jener Nacht in Afrika geschah, und sich immer um mich gekümmert hat, gelang es mir, die Färberei wieder in Betrieb zu setzen und unser Auskommen zu sichern. Allijah geht es gut und trotz mancher Schwierigkeit, die wir aufgrund dummer und grausamer Vorurteile durchleben mussten, kann ich sagen, dass wir glücklich sind. Erst vor kurzem hat Allijah mir von ihrer Familie berichtet, von ihrem Vater, dem stolzen AschantiKrieger, der am „Geistersee“ im Kampf gefallen war, ihrer Mutter, die damals auf dem Marsch, der Allijah zu mir brachte, an Entkräftung gestorben war, und schließlich von ihrem lange schon verstorbenen Großvater, der als einer der Ersten in Cape Coast mit den Weißen Handel getrieben hatte. Zufall? Vielleicht. Aber wer gibt uns eigentlich das Recht, unsere Sicht der Dinge als das einzige Vernünftige über alle anderen Sichtweisen zu erheben? Ich jedenfalls trage das Amulett noch immer und werde es bis zu meinem letzten Atemzug nicht ablegen. Zur See bin ich jedoch nie wieder gefahren. Ich denke, es gibt Männer, die auf vielen Reisen um die ganze Welt ihrem Schicksal entgegengehen. Ich dagegen fand mein Schicksal bereits auf meiner ersten Reise … nach jenem fernen Kontinent voller Mythen und unerklärlicher Geheimnisse … Afrika. 93 Susanne Weinhart Malesch, Mädchen Geisterschiffe auf dem Nil. Nach dem Terroranschlag der Islamisten in Kairo vom Dritten kreuzten nur noch fast leere, blitzende Motorschiffe auf der braunen Suppe; die langärmeligen, safaribeigen Personen an Deck erschienen vom Ufer aus wie Leprakranke, die man nicht mehr an Land lassen wollte. Ein dahintreibender Zauberberg, Davos mit Schwimmflügeln. „Die riechen förmlich nach Malariaimpfung“, meinte mein Vater. Weicheier, hieß das. Auch beim Essen im La Palme d’Or waren wir fast eine Viertelstunde das Knetspielzeug von zwei Polizisten, die allein durch ihr Rasierwasser einen Raum schachmatt halten konnten. Der eine Polizist jonglierte mit meinen Tampons aus dem Camelbak, der andere richtete seine Wumme auf einen jung wirkenden Polen, der eben ein ägyptisches Baby abgelichtet hatte. Handschellen rasteten ein, er wurde über den Tisch geschmissen, dass der bunte Porzellankrug mit dem Besteck auf dem Boden zerbarst. Dann, behutsam, wie ein Entlaufener aus einem Altersheim, wurde er abgeführt, was ihm passierte, konnte ich mir vage und gleichzeitig in Zeitlupe vorstellen. Ich fühlte nichts mehr, steckte festgekorkt in einem Flaschenhals der Erschöpfung. Mein Vater sah ihnen nach wie zwei uniformierten Rockstars nach ihrer dritten Zugabe. Dieser Blick war eine einzige Ode an die Obrigkeit. Zwanzig Berliner Mauern waren zwischen uns. Die Tampons lagen auf den blauen Fliesen wie Angelköder zwischen den Splittern des Kameraobjektivs, der Gabeln und Messer, der Baguettebrösel; ich räumte meinen Rucksack wieder ein und fand den Reisepass glücklicherweise in einem feuchten roten Pulli. 94 Meine Wasserflasche war ausgelaufen. Mein Vater aß sein zweites Mussaka mit militärischer Demut. Der Krankenhausverband beulte ihm die Hose aus. Vor zwei Stunden waren wir mit dem maroden Geländewagen im islamischen Kairo angekommen. Mein Vater war als Erstes humpelnd hinter einem türkis fächelnden Vorhang eines Barbiers am Bab el Nasr (Tor des Sieges) verschwunden, nachdem er mir einen Packen weißer, mit Blutstropfen ornamentierter Tücher in die Hände gestoßen hatte. Wenn man sie auf dem sandigen Boden ausbreiten wollte, würde man sehen, dass es zerrissene Bettlaken waren, alte, schmucklose, mitgiftfähige Bettlaken, zu gut gewebt um sie schmerzlos zerreißen zu können. Wenig touristenlike stand ich mit tränenden Augen vor dem unscheinbaren Stadttor und verfluchte Kairo, Kontaktlinsen und kriegsnostalgische Väter. Ich versteckte meine langen Haare unter einem Baseballcap und wurde trotzdem erbarmungslos angemacht. Drei Fellachen, die den Vorgang beobachteten, amüsierten sich über mein „Fi muschkila?“ (Gibt’s ein Problem?). Wahrscheinlich sprach ich es falsch aus. Wir hatten Bernd, den Kriegskameraden meines Vaters, schon einmal besucht, in einem katholischen Nürnberger Vorort kurz vor Sylvester, als ich ungefähr neun war. Er hatte uns Dias von seinem Forschungsjahr in Windhuk gezeigt, wobei ich meistens seine Frau zwischen dunkel glänzenden Einheimischen mit nacktem Oberkörper bewundern musste. Dazwischen unzählige Dias von anemonenähnlichen Blüten und undefinierbarem Kraut. Bernd servierte Erasco-Hühnersuppe in Teetassen. Bernds Frau Diane war in Windhuk geblieben, was Bernd locker mit der Bemerkung „Da hab ich noch mal Glück gehabt“ kommentierte. Dabei spielte er mit der Klinge eines Schweizer Offiziersmessers und schnitt sich in den Daumen. Ich hatte damals furchtbare Angst vor dem Besuch. Mein Vater 95 hatte mir erklärt, ohne Bernds Hilfe wäre er beim Aufstand im Warschauer Ghetto eingesetzt und nicht in den Zug nach Frankreich aufgenommen worden, ohne Bernd wäre er wohl tot, Bernd hatte für ihn in Ostpreußen in letzter Minute den Rucksack gepackt, und mich hätte es dann natürlich auch nicht gegeben. „Ohne Bernd wärst du auch nicht da. Also sei bloß nett zu Bernd. Zick ja nicht rum, hörst du?!“ Ich musste Bernd also für mein Leben danken, so schien es. Ich war also stumm wie eine patronenleere MP dagesessen, in einem kratzigen Pulli, den ich sonst wie Gräserpollen mied, und hatte zusammen mit meinem vor Unterwürfigkeit schwitzenden Vater Bernds Pläne angehört. Bernd war Oberleutnant a.D. und nebenbei Diplombiologe und wollte eine Forschungsstation in der Nähe von El Alamein aufmachen. In meiner Phantasie war das damals in der Nähe von Frankfurt. Maingegend eben. Arme Frankfurter Fauna, Bernd kam. „Da kenn ich doch noch jeden Halm“, prahlte er und sprach von seinem Minentrupp. „Mädchen, da unten liegen noch Minen, da ist das Sylvesterfeuerwerk bei euch in München Peanuts.“ „Papa, fahren wir auch nach El Alamein?“, fragte ich atemlos vor Schreck. „Klar, Hajo, ihr kommt mich besuchen, das ist ein Befehl!“ Bernd knallte zwei kühl gestellte Bierflaschen auf den Tisch, als müsste er damit vierzig Ameisen zerdrücken. Das war ein Befehl mit Damoklescharme. Ich vergaß ihn irgendwann im Gymnasium. Mein Vater kam aus dem Haus des Barbiers, als mich ein Bakschischjäger an der Bluse zog. Sofort ließen die Männer von mir ab und brachen in wieherndes Gelächter aus. „Heil Hitler“, kreischten sie, eigentlich „El Itla“, und streckten ihre dunklen Arme wie angespitzte Lanzen nach ihm. Der Barbier hatte meinem Vater ein Hitlerbärtchen verpasst und die Haare scharf gescheitelt. Er sah zum Fürchten aus, mit seinen schwarzen, öligen Haaren und der sich vor Sonnenbrand pellenden Gesichtshaut. Einen Spie96 gel hatte es beim Barbier wohl nicht gegeben; ich klärte ihn nicht auf, sondern hielt ihm wortlos den Bettlakenwust hin, den er sich wieder um das rechte Bein wickelte. „Fahr du“, befahl er weinerlich bis aggressiv bzw. aggressiv bis weinerlich. Meine Augen brannten wie Pfannen, als ich den Jeep anließ. Die Lederfläche meines Sitzes kochte, er schien an meiner sandigen Jeans zu kleben. Hinter dem grünen verbeulten Jeep liefen bestimmt vierzig Kinderfüße her, ich sah ein zerlumptes Mädchen im zerkratzten Außenspiegel, das uns Steine und Sand hinterherwarf. Sie traf uns nicht mehr und traf mich doch. Wir waren nicht direkt nach El Alamein gefahren. Wider Erwarten zeigte sich mein Vater dankbar ob meiner Begleitung und erklärte sich zu einem „Sixpack Kultur“, wie er es nannte, bereit. In Alexandria, dem Hort aufmüpfiger Wissenschaftler und versunkener Bibliotheken, gerieten wir als Erstes in eine Beerdigung. „Können die nicht auf dem Friedhof rumhüpfen wie jeder normale Mensch?“, fragte mein Vater und fixierte, bis auf den kleinsten Nerv angespannt, eine schreiende Frau, die sich auf unserer Motorhaube aufstützte. Sufis taumelten zu Trommelklängen, die in den klaustrophilen Gassen wie Peitschenschläge widerhallten, in eine Ekstase hinein. Wir schwitzten, als ob wir es wären, die sich bewegten. Instinktiv krallte ich meine Finger um das Lenkrad. Ich fragte mich, ob das tatsächlich alles Verwandte waren oder professionelle Klageweiber, ich hatte mal gehört, dass es so was noch irgendwo gab, es erinnerte mich dunkel an Martial-Epigramme. Männer waren weit und breit nicht zu sehen. Mir gefiel diese laute Art der Trauer nicht. Aber ich spürte, dass es eine gesunde Art der Trauer war – man ließ sie zu wie den Hunger. Und irgendwann hatte man gegessen. Wir kamen fast eine Stunde weder vor noch zurück. El Alamein hatte den Gesichtsausdruck eines Sandkorns. Es wirkte mit allen anderen Dörfern hier völlig austausch97 bar, wie ein Hustenbonbon unter anderen. Von Alexandria aus waren es ungefähr 120 Kilometer Fahrt gewesen, mein Vater hatte sich dreimal übergeben, er hatte in einer Raststätte Leitungswasser getrunken, was er natürlich bestritt. „Für wie dumm hältst du deinen Vater? Bloß, weil ich nicht studiert habe wie du? Ha!“ Leichenblass spie er beim „Ha!“, wie um seine Worte Lügen zu strafen, auf die einzige Landkarte, die wir von dem Gebiet hatten. Ich konzentrierte mich auf das fremde Straßenlabyrinth um uns herum, es war schlicht ein Wunder, dass wir Alexandria verlassen konnten, ich heftete mich an die Fersen eines französischen Lkws und fuhr mir über die entzündeten Augen. Die arabischen Zahlen auf den wenigen Richtungsschildern waren im Vorüberfahren nahezu unmöglich zu entziffern, die sprunghaften Autos schienen sogar aus dem Boden zu hupen, wie ein Gräberchor. Malesch, Mädchen. Malesch ist freundliche Resignation. Als ich von der Abschlussfeier am Campus zurück in meine WG am Josephsplatz gekommen war, ging das Telefon in meinem Zimmer. Ich beachtete es nicht und ging zu Welf in die Küche. Er räumte die undichte Geschirrspülmaschine aus und sah mich missbilligend an, als er mich bemerkte. Ich küsste ihn, die Heimat. „Dein Telefon geht schon den ganzen Nachmittag. Nonstop! Geh ran, sonst erschlag ich den Typen noch.“ Er stürmte in sein Zimmer und drehte laut den Schlüssel herum. Dann übte er entnervende Tonleitern auf dem Saxophon. Julia, unsere Mitbewohnerin, schaute mit nassen Haaren aus dem Bad heraus. Ich trank einen Rest Milch aus dem Tetrapak auf dem Küchentisch. „Das interessiert mich jetzt aber auch, wer das ist.“ Seufzend ging ich in mein Zimmer, dessen Boden man unter dem stabilobunten Bücherkopienteppich nur erahnen konnte. 98 „Ja?“ „Ich bin’s. Wo treibst du dich eigentlich rum am helllichten Tag? Wieder mit diesem Welf oder einem von deinen ergebenen Sklaven, von denen mir deine Mutter erzählt hat?“ „Mein Vater“, flüsterte ich Julia zu, damit sie verschwand. „Ach sooo“, meinte sie und tropfte ins Bad zurück. „Was ist los, weshalb rufst du an?“ Ich hatte gerade in der Großen Aula mein Diplomzeugnis in Informatik erhalten, ein sehr gutes für die hiesige Universität, aber das würde meinen Vater so interessieren wie Diabetikerzwiebackrezepte. Ich vergaß augenblicklich, dass ich auf etwas stolz sein konnte. Als hätte ich gerade einen Fußball in das Klofenster der Polizei gekickt, so fühlte ich mich. „Ich fahr übermorgen runter. Du weißt schon.“ Was wusste ich? Was? Nachfragen würde ich nicht. „Afrika. Ich hab’s Bernd Weihnachten geschrieben. Zwei Flugtickets hab ich schon gekauft, von MünchenRiem ab.“ Afrika und Bernd, Bernd und Afrika, die Wörter tauchten auf wie rote Bojen, die man vergeblich unter Wasser drücken wollte. PLOPP. Afrika. PLOPP. Bernd. Als ich auflegte, hatte ich zwei voll gekrakelte DIN-A4-Seiten, einen abholbereiten Vater (Dienstag, 12:30 Uhr, Bahnhof München-Pasing, PÜNKTLICH!!) und seit fünf Jahren zum ersten Mal wieder mit diesem abholbereiten Vater gesprochen. Über Bernd und Afrika, die unversinkbaren Bojen. „Wie lang willst du noch in Kairo bleiben?“ Wir hatten gerade das Ägyptische Museum besichtigt, beziehungsweise versucht zu besichtigen. Total überfüllt. Im abgedunkelten Mumiensaal sah ich von den meisten Toten in den mit Edelgas gefüllten Glassärgen nur ein Stück Laken. In der Früh waren wir relativ ziellos durch die nördliche 99 Totenstadt geschlendert, Zehntausende von Menschen lebten hier in den Oberbauten der noch intakten Grabanlagen, blühendes Leben in den Friedhöfen, wenigstens hatten sie Strom und Wasser. Ich schämte mich, dass ich in dem Elend rumspazierte wie im Englischen Garten. Ganz Ägypten kam mir bald wie ein einziges Grab vor, die darauf herumhetzenden Menschen wie einstudierte Totentänzer. Ich hing mit meinem Vater an einem der Busse, mit denen in Kairo täglich vier Millionen Menschen unterwegs waren, in einem hydraähnlichen, feuchtwarmen Menschenknäuel an der Tür, der ganze Bus schien nach rechts abzudriften. Ein Mal hatte der Fahrer gehalten und ein parkendes Auto weit zur Seite geschoben, vorsorglich schien hier niemand die Handbremse anzuziehen. Eine verfallene Straßenbahn rumpelte vorbei, sie fuhr um ihr Leben. In der Querstraße trieb man eine Ziegenherde heim, man hörte ab und zu ein zartes Glockengebimmel, wie aus einer anderen Zeit. Ich wollte wenigstens Pyramiden sehen, bevor wir zu Bernd fuhren. Etwas Erhebendes vor dem Erniedrigenden. „Heute noch, dann geht’s nach Alamein. Wir sind früh genug da.“ Wir mieteten uns Pferde, die erstaunlich günstig waren, mein Vater, der gewöhnlich bereit war, zwei Stunden über Preise zu verhandeln, ließ den Mund zuschnappen wie ein satter Karpfen. Ich suchte mir in dem Überangebot eine ruhige Stute aus, die weit ausschritt und offensichtlich gesund war. Es war ein großartiges Gefühl, wieder im Sattel zu sitzen, die Dunstglocke Kairos hinter sich zu lassen, die geometrische Klarheit der Pyramiden von Giseh schemenhaft am Horizont. Danach wollten wir noch zur Pyramide von Sakkara reiten, drei Stunden schweißtreibender Ritt ungefähr. Zehn Minuten flog ich nur dahin, an der völkerbewanderten Cheopspyramide vorbei. Als ich mich nach einem strengen Galopp umdrehte, erkannte ich meinen Vater in einiger Entfernung auf dem schwarzen Wal100 lach, den er sich ausgesucht hatte. Er buckelte und stieg. Zögernd kam ich zu ihm zurückgeritten, der Wallach hatte ihn schon abgeworfen und ich eine Heidenmühe, das nervöse Tier am Halfter zu fassen zu kriegen und zu beruhigen. Das Maul des Tieres war blutig gerissen, der Vorgänger meines Vaters musste ihn böse herangenommen haben. Flüssigkeit tropfte auf den Sand, das Pferd hatte panisch geweitete Augen und versuchte zu steigen, ich konnte mich kaum im Sattel halten. Nebenbei musste ich eine Schar heranstürzender Dragomanen abwimmeln, die Tausend-und-Eine-Nacht-Märchen auf Lager hatten, gegen Bakschisch natürlich. Mein Vater rappelte sich fluchend auf und hielt sich den Rücken. „Scheißgaul!“ Die Sphinx von Giseh hatte das alles schon tausend Mal gesehen. Sie grinste. Um uns herum traf man bereits Vorbereitungen für die Light and Sound Show. In der S-Bahn nach Riem redeten wir nur das Nötigste. Wir wussten beide, wie wir das Ganze einzuordnen hatten. Das war eine alte Rechnung. Nach der Fahrt, gleich wie sie ausging, gab es nichts mehr zwischen uns. Meine Mutter würde als Verbindungsglied nicht mehr genügen. „Sie sind Vater und Tochter? Wie Sie sich ähnlich sehen! Und Sie unternehmen gemeinsam eine Reise? Ist das nett!“ Wir sahen uns tatsächlich mehr als ähnlich. Die dicken dunklen Haare, die braunen Augen, die gleichen kleinen Ohren, das undurchsichtige Lächeln. Mein Vater wirkte, wenn er seinen Bart nicht getragen hätte, sogar weiblich. Natürlich störte ihn das nicht unerheblich. „Was macht dein Studium?“ Mein Vater sprach zu seiner tarnfarbig gefleckten Sporttasche, aus der er eine Bifi fischte. Ich ließ den Blick aus dem Fenster wandern, München noch einmal umknabbern. Zwei Wochen musste das reichen. „Passt schon.“ „Die Bifis werden auch immer kleiner.“ Er verschlang ein großes Stück. 101 Mein Vater bekam einen Schuss ins Bein, als er Bernd aus der Hütte zerrte. Er schrie auf, es blutete so sprudelnd als würde er Marcomar nehmen, der Knochen war nicht betroffen. Ich packte die zerwühlten Bettlaken von der Pritsche und zerriss sie in Streifen, dass mir die Hand brannte. Irgendwo hörte ich ein Auto wegfahren. „Drück das drauf und lass Bernd endlich los!“, schrie ich meinen Vater an, der unter Schock zu stehen schien. Er rührte sich nicht, gab keinen Laut von sich, starrte auf Bernds Nacken. Plötzlich kamen vier Polizisten aus den Sträuchern und packten meinen Vater und Bernd. Bernd ließen sie gleich wieder fallen. Mit mir wussten sie anscheinend nicht, was sie machen sollten. Blut war an meinen Händen. Einen Polizisten kannte ich von gestern, er hatte an der Küste eine amerikanische Schwimmerin verhaftet, die einen Bikini trug. Er hatte eine stacheldrahtartige Narbe, quer über das ganze Gesicht. Unverwechselbar. Er sah mich an wie eine Wespe im Bierglas. Ich dachte, ich sehe die Sonne nicht wieder. Wir waren ungefähr acht Kilometer westlich von El Alamein und fuhren an dem deutschen Ehrenmal für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges vorbei, ein Monolith auf einem Hügel. „Und das ging 1942 nur drei Wochen, wenn du dir das vorstellst, was das für ein Abschlachten in kürzester Zeit war – unfassbar! Rommel – Montgomery, beides ausgezeichnete Generäle ... ausgezeichnete Generäle ... hat Hitler nicht honoriert, was Rommel geleistet hat in dieser Hölle.“ Mein Vater schien zwischen Schwärmen und Schrecken zu schwanken. Er hatte sich erstaunlich schnell von seiner Diarrhöe erholt. Ich sah ihn von der Seite an. „Rossnatur“, sagte er, meine Gedanken erratend. Ich hing den linken Arm leichtsinnig aus dem Fenster, die Finger klebrig von einer Ananas, streifte das bügeleisenheiße Blech der Seitentür. Wir passierten auf dem Weg nach Alamein Friedhöfe über Friedhöfe über Friedhöfe 102 von alliierten und deutschen Afrikacorpssoldaten, an einem hielten wir und blieben kurz an ein paar Kreuzen stehen. Lange konnte man das Stehen nicht aushalten, die Luft war knochentrocken. Das Wasser lief mir den Rücken hinunter, in Richtung Erich Günther, Jahrgang 1919 – ich ging in die Hocke, alles flirrte vor meinen Augen. Das langärmelige Hemd umklebte die Wirbelsäule wie ein verrutschtes Pflaster, die geschlossenen Lederschuhe schienen zu schmelzen. Der Wasserkanister. – Mein Vater zog mich hoch, er konnte es wohl gar nicht mehr erwarten, Bernd zu sehen, Bernd zu imponieren, Bernd zu überraschen, Bernd zu danken, Bernd anzubeten, Fliegen umschwirrten uns. Erich Günther, leb wohl! – Eine Schlange sonnte sich auf einem glatten Begrenzungsstein. Bernd hatte es hinter verriegelten Türen getan, neben ihm lief ein kleiner markenloser Tischfernseher. Es stank erbärmlich. Die zwei Jungen, die uns zu Bernds Hütte geführt hatten und jetzt kreischend Bakschisch einforderten, waren von dem Anblick nicht im Mindesten erschrocken und liefen lachend davon. Man sah ihn durch das Seitenfenster, seit ein paar Wochen musste er dort in dem Taustück hängen. Ich hatte so was noch nie gesehen. Ich hatte noch nie tote Augen gesehen, tote Haut. Ich drehte den Fernseher ab, mein Vater schnitt das dicke Seil mit einer Machete durch, der leblose Körper polterte zu Boden wie eine Marionette, deren Schnüre man losließ. Das Gesicht hatte die lehmige Farbe der Wände angenommen, ich erkannte es nicht mehr. Das war nicht mehr der NürnbergBernd. Er hatte lange, verfilzte graue Haare, ein sackähnliches Hemd, einen dicken weißen Bauch, der sich gegen die braun gebrannten Arme abhob. „Fotografier ihn“, sagte mein Vater leise. Ich fotografierte mit zitternden Händen. Würde bestimmt ein Spitzenfoto werden. Er sammelte ein paar von Bernds Sachen ein, darunter einen Kompass und militärische Abzeichen, Barometer, Blechgeschirr. „Was 103 hast du mit ihm vor?“ „Begraben, was sonst.“ Was sonst, klar. Er legte einen Arm um Bernd und schleifte ihn durch die aufgesprengte Tür. Sofort fielen Schüsse. Die Einheimischen kamen zusammengelaufen und redeten laut auf die Polizisten ein. Sie gestikulierten mit einer Leidenschaft, als wäre das Letzte, was sie taten, den Tathergang zu schildern. Ich war froh, dem Quartett nicht allein gegenüberstehen zu müssen Froh? Heilfroh! Mein Vater stöhnte und glitt mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Ich war unfähig, ein Wort zu sagen, einen Zeh zu bewegen, die Zunge, den Kopf, wusste nicht, wen ansehen, wohin mit den Händen, wie atmen. Schließlich trat eine schwarz umhüllte Frau auf mich zu und wischte mit einem Stück Zeitung das braun verkrustende Blut von meinen Händen. Noch nie war ich für eine Geste so dankbar gewesen. Ein dicker Polizist schleifte den noch dickeren Bernd umstandslos zum Polizeiauto, die Fersen hinterließen auf dem weichen Boden serpentinartige Schleifen. Er wurde in den Kofferraum gerollt, ein schwarzer Plastiksack über ihm ausgebreitet. Zwei Polizisten schoben uns ununterbrochen schimpfend zum Jeep, ich ließ mich hinter den Fahrersitz fallen wie erlegtes Wild, mein Vater hievte sich hoch, alle Adern in seinem Gesicht waren bläulich hervorgetreten. „Bernd ... Was passiert jetzt mit Bernd?“, röchelte er. „Er war mein Freund ... er hat mich nicht im Stich gelassen!“ Den letzten Satz brüllte er. Ein Polizist flößte ihm Schnaps ein, den er sofort ausspuckte. „Leave Egypt, soon as possible“, das verstand ich noch. Dann wurde mir für Sekunden schwarz vor Augen. Ich hatte immer noch den verendenden Geruch in der Nase. Die Polizisten hatten es nicht gemerkt, sie diskutierten heftig untereinander. Als ich den Motor anließ, waren sie mit ihren Gedanken wohl schon bei der Ausschlachtung von Bernds Hütte – der weltberühmten Wetterstation von El Alamein. Heiter-wolkige Aussichten. Mein Vater brüllte wieder. Zum ersten 104 Mal sah ihn weinen, verzweifelt, wie ein eingesperrtes Tier. Ich musste mich zwingen, ihm über den Kopf zu streichen. Vielleicht würde Bernd ja einen Platz auf dem Soldatenfriedhof finden. Neben Erich Günther, zum Beispiel. Erich Günther. 23, wie ich. Ich gab den Einheimischen alles aus unserm Jeep, das mir entbehrlich schien. Ein jüngerer Polizist kniff mir in die Wange. „Malesch, German girl. El Alamein is no good place for Germans. Remember?“ Ich hörte ihr Lachen noch kilometerweit. Krankenhaus, Restaurant, Autovermietung, Flughafen. Im Bus wurde mein Vater von seinem Sitznachbarn zu ihm nach Hause eingeladen, was er nur mit einem Kopfschütteln quittierte. Das Komische am Ramadan war, dass man nach Sonnenuntergang erst recht prasste. Nach Hause. Ich hatte nur noch ein kurzärmeliges Hemd gehabt, das sauber war. Arme als Sexsymbol. Bis zum Flughafen würde das gehen, hoffte ich. Neben mir saßen Frauen. Eine hatte Schischas, Wasserpfeifen, gekauft. Wieder rollten wir durch diese Stadt, die ein Ameisenhaufen war, in dem man es nur zwischen A und B, aber nie in A und B, aushielt. Am Flughafen Kairo bat mich in der Damentoilette eine ältere Frau um Kaugummi. Überall waren Löcher in den Wänden, durch die man Einsicht hatte, man brauchte Kaugummis oder Datteln zum Verstopfen. Auf der Kaugummipackung waren Bilder der Papyruspflanze zu sehen, das Wappenzeichen der Pharaonen. Eine halbe Stunde bis zum Einchecken. Ich konnte es noch gar nicht glauben. Ein Ägypter saß neben meinem Vater auf der Wartebank und erzählte detailliert von einem Film, den er neulich im Kino gesehen hatte. Ägypter sind filmbesessen. Mein Vater kramte in seiner Sporttasche nach Taschentüchern und nickte abwesend. Vor ein paar Tagen hätte er den Mann neben ihm wohl zum Teufel gejagt. „Na?“, fragte er, als er mich sah. „Amun sei mit dir“, lächelte ich gequält. „Am 105 besten auch noch Anubis und Osiris.“ Der Ägypter verstummte. Ich hatte Welf nicht erreichen können, wahrscheinlich hatte er ein Bigbandkonzert oder war beim Basketballspielen; ich hinterließ ihm eine Nachricht, dass wir um 23:30 Uhr in München-Riem landen würden und es wäre Malesch, wenn er uns nicht abholen würde. Eine braun gebrannte Frau im Flugzeug meinte, dass wir alle zu beneiden wären. „Wer weiß, wann man wieder gefahrlos nach Ägypten fliegen kann?“ Von gefahrlos konnte keine Rede sein. Jedenfalls nicht jenseits der Clubhotelzäune. Jemand rief über den Gang. „Und am Strand die Teerklumpen an den Füßen?“ Mein Vater sagte die ganze Zeit so gut wie gar nichts. Ich war mir sicher, dass er das, was wir erlebt hatten, meiner Mutter nicht erzählen würde. Niemandem, er würde es immer mit sich tragen, wie Steine im Schuh. Als wir Tomatensaft tranken, sagte er plötzlich: „Vier Wochen früher. Vier Wochen bloß.“ „Was meinst du?“ Ich schlief beinahe beim Trinken ein. „Wenn wir Bernd vier Wochen früher besucht hätten.“ Er war dabei, sich in einen Schuldkomplex hineinzureden, hineinzudenken, hineinzuflüchten, wahrscheinlich schon die ganze Fahrt von El Alamein. Ich reagierte nicht. Man konnte nie quitt sein. So einfach kam man nicht davon. Welf lachte acht Minuten am Stück, samtig wie sein Saxophon. „Fang mich!“ Wir rannten wild am Chinesischen Turm vorbei, die Glöckchen blitzten feucht in der Sonne, es war noch ruhig, 9:00 Uhr. „Keine Lust auf das Aristoteles-Seminar? Hmm?“ Welf konnte man alles erzählen. Ihn ekelte es regelrecht körperlich an, Dinge weiterzuverbreiten. Alles, was an die Außenwelt kam, ging durch ein engmaschiges Sieb. Nächste Woche hatte ich meinen ersten Arbeitstag als Informatikerin bei einem Münchner Versicherungskonzern. Ich freute mich nicht auf die Arbeit, aber auf den geregelten Tagesablauf. Wie lange Letzteres 106 anhalten würde, wusste ich natürlich nicht. „Deine Mutter hat gestern übrigens angerufen, als du in der Metro warst“, keuchte Welf. Er hielt sich an einem Stoppschild fest. „Du sollst vorbeikommen, wenn du Zeit hast.“ Meine Mutter. Das Seitenstechen ließ nach. Flugzeuglandungen waren immer noch Kunst. Mein Vater und ich taumelten Halt suchend in den Shuttlebus, Afrika in den Beinen. Wir hatten nicht viel Gepäck, es ging am Förderband recht schnell. Schon stand Welf da, unbewegt wie ein Baum. Mein Vater gab ihm die Hand, was mir erst im Auto ins Bewusstsein kam. Was war da passiert. Welf fragte gar nichts, er drückte mich an sich und trug mich mehr zu seinem Golf, als dass ich ging. „Entschuldige, dass du so spät anrücken musst, Welf“, murmelte ich. „Wir haben einen Flieger früher genommen.“ Er lächelte. Ich schlief im Wagen sofort ein. Meine Wimpern schienen Gewichte zu stemmen. Als ich aufwachte, rüttelte mich mein Vater an der Schulter, wir standen vor seiner schmiedeeisernen Haustür in Polling. Licht brannte unangenehm hell. Ich stieg aus, Welf machte von innen die Tür zu. Mein Vater hatte das Gepäck schon in der Wohnung und stand verloren am Gartentor herum. Ja. Ja. Die Rechnungen, die alten. Im Rückspiegel sah ich ihn seine Sporttasche umarmen. 107 Mila Carnel Fräulein Afrika New York, 19.7.53 Liebe Tilda, dann will ich dir also noch einmal schreiben, bevor ich nach Deutschland komme, und will versuchen, deine Fragen zu beantworten. All die Zeitungsausschnitte über mich hast du gesammelt! Ich werde dich in Berlin besuchen, vielleicht magst du ja mit an den Rhein kommen; warst mir immer eine gute Freundin und ich wüsste dich gerne beim Festakt an meiner Seite, wenn Herr Adenauer mich um meine Arbeit ehrt. Wie das also zuging? Von dem Fred musste ich weggehen, als er sich mit seiner Frau aussöhnte. Sie war plötzlich wieder da, nachdem sie ihn mit so viel Drama verlassen hatte. Er machte mir eine „anständige Erklärung“, wie er es nannte, damit jeder wusste, woran er war. Ich wusste es dann doch nicht, bin viel in den Straßen von Berlin umhergezogen. Beim Hinterhof-Karl konnte ich beizeiten unterkommen. Die Stadt war mir wie eine große, fröhliche Familie – die mich aber verstoßen hatte. Da war in einer Kirche eine Filmvorführung von der „Mission der Weißen Väter“, gab meine letzten Groschen, es sei eine Gabe für die Mission, hieß es und sah den Film. So dunkel die Menschen und so anders und so wenig am Leib und doch so stolz. Einer der Missionare mit weißem Bart und Tropenhelm sprach anschließend davon, dass sie immer gesunde Menschen christlicher Gesinnung suchen für Afrika, da wusst’ ich: Ich will fort! Und geh ganz höflich zu dem Rauschebart und frag ihn: Was ist ihm eine “christliche Gesinnung“ und was macht man da in Afrika? Treu im Glauben soll man sein 108 und eine gute Ehefrau und ein Beruf sei wichtig, und ich denk: Das schaff ich ihm alles und er schafft mich auf ein Schiff nach Afrika. Ich wusste plötzlich, was ich all die Jahre in Berlin gesucht hatte: Die Aufregung, was von Abenteuer, die Menschen und ich in allem. Ich hörte noch den ganzen Abend die Trommeln, die sie von einer Walze abgespielt hatten, und das war dann mein Puls, meine Unruhe. Ich sprach mit Karl darüber und sagte ihm: „Du willst mich doch, dann lass mich deine Frau werden und wir gehen nach Afrika.“ Das war ihm nur zum Lachen, er wollt in seinem Hinterhof bleiben, bei seinen Knöpfen und Kaninchen und sagte mir, ich sollte doch in den Zoologischen gehen, da wär oft Völkerschau. Ich sag ihm, er hat einen Tag zum Überlegen – ich käm nach Afrika! Ich schrieb dem Fred einen Brief mit Lebewohl und so. Und denk dir: Am nächsten Morgen ganz in der Früh ist der Fred plötzlich da, schlecht sieht er aus, meinen Brief hat er dabei, und sagt, ohne mich kann er dann auch nicht sein. Und überhaupt, was wären das für Zeiten: Alle wollten einem die Welt erklären, aber sagen doch nur warum sie schlecht ist. Viele Parolen gibt es, aber keine Arbeit. „Elli, ich möchte mit dir nach Afrika!“ „Was sagt denn deine Frau dazu?“ „Die sagt, sie erstickt an meinen Ansprüchen und wir würden aneinander doch nur unglücklich werden.“ Und so geben Fred und ich das christlich gesinnte Paar vor den weißen Vätern, einen Trauschein hat uns der Karl gemacht und weil der Fred Zeichner ist, sagen sie, er soll Bibelbilder malen; und ich kann Maschine schreiben, das ist gut für die Verwaltung, denn je wilder das Land, desto wichtiger die Verwaltung. Bald sind wir in Bremerhaven und auf dem Schiff; ich habe keinen zum Hafen kommen lassen, wäre ich doch vielleicht schwach geworden, hätte ich ihre Tränen gesehen. Als wir auf hoher See sind und 109 die Wellen uns schwanken lassen, weiß ich: ich bin jetzt kein Korken mehr, der in der Stadt umhergesprudelt wird, jetzt wird alles anders. Wir kamen nach Daressalam. Mit uns waren BethelMissionare und solche von den Weißen Vätern, und dort wo der Zug seinen letzten Halt hatte, war eine Musikkapelle in weißen Uniformen angetreten und spielte entschlossen aus schwarzen Gesichtern einen Marsch. Am Rande des Bahnsteigs standen Eingeborene, dürftig mit Webtuch bekleidet, zwei auch mit Raubtierfell; sie standen dort auf lange Stöcke gelehnt, den Fuß des einen Beins am Knie des anderen Beins; standen dort wie seit Zeitaltern, sahen Züge kommen, Deutsche, Engländer, Missionare und jetzt bin ich da und es ist das Aufregendste in meinen Leben, aber ihnen ist das eins. Die Hütten der Einheimischen sind rund, unser Haus ist rechteckig und hat eine Tapete aus Krabbeltierchen, vor denen ich zunächst einen Graus hatte. Dann bekamen wir ein Hausmädchen, das zur „Agnes“ getauft war und nie lächelte und seine beiden kleinsten Kinder mitbrachte, davon eines stillte, das sollte ich ihr abgewöhnen, sagten die anderen Weißen, aber wie soll man einer Mutter das Nähren abgewöhnen? Bei mir ist es ja nichts geworden mit Kindern. In Berlin habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, aber hier in Afrika, da war doch alles mit Kindern; und Fred und ich waren uns sehr nahe, obwohl es zu Anfang eine Gewöhnung war, weil unser Haus keine Fenster hatte, nur Tücher, und die Türen konnte man nicht absperren und da spazierten Hühner und Hunde und Ziegen an unserem Bett vorbei. Aber wenn ich dann sehe, wie die Frauen sich quälen mit dem Kinderkriegen, hab’ ich sie nicht beneidet, auch unsere Agnes war immerzu schwanger und ihr Mann wollte nicht, dass sie zu Weißen geht, sie verderben die Frauen 110 und die Kinder, sagte er, aber Agnes kümmerte das so wenig wie die Belehrungen über ihren nackten Busen. Mit mir war die erste Schreibmaschine hierher gekommen. Ein jedes Mal, wenn ich auf ihr tippte, liefen die Einheimischen am Fenster des Amtsraums zusammen. Mir erklärte jemand, dass sie das Geräusch für die Nachricht halten, so wie bei den Trommeln und also dastanden, um etwas zu verstehen. Sie müssen mich für sehr dumm gehalten haben, weil mein Lärm keinen Sinn für sie machte. Ich habe zuerst in der Missionsverwaltung gearbeitet, da hatte es noch viele Deutsche, auch wenn das Land jetzt den Engländern gehörte. Ich musste Anzeigen tippen, wenn einer der Eingeborenen zu lange Hosen trug, denn sie durften nur bis zu den Knien gehen. Nur die Weißen durften lange Hosen tragen. Aber die Anzeige wegen dem nackten Busen von Agnes habe ich nicht geschrieben. Sie hatte ja ein Kind davor, habe ich gesagt, das ist so gut wie angezogen. Und dann war da also Mr. L., ein Deutsch-Amerikaner, der am Ufer unseres Sees nach Knochen grub und er kam immer wieder zu mir: „Sehen Sie, Fräulein Elli, das ist ein Stück von einem Kiefer und das von einem Wirbel und das von einem Schädel.“ Wo denn all die toten Menschen herkommen, wollte ich wissen. „Hominiden“, sagte er und dass Mensch und Affen gemeinsame Vorfahren hatten und danach suchte er. Die Missionare meinten, es sei Sünde, so etwas zu behaupten, und es sei Sünde, dass ich mich mit Mr. L. abgebe, und dass sie von mir enttäuscht wären. Sie haben mich entlassen, aber das machte nichts: Ich fing an, für Mr. L. zu arbeiten; er brauchte wen, der seine Aufzeichnungen abtippte. Anfangs verstand ich gar nicht, was ich da schrieb, war ja alles in Englisch, aber mit der Zeit lernte ich etwas von der Sprache. Mr. L. sagte immerzu, ich sei begabt, und das hat noch keiner zu mir gesagt, und er erklärte mir alles unermüdlich und fragte mich auch: 111 „Miss Elli, passt das zu den Knochen von gestern?“ Und ich nummerierte und sortierte alles in Kästchen, saß bald auch im Sand und siebte und wo ich ihn früher wegen jedem Kieselstein rufen musste, da konnte ich die Knochen dann selbst herausfinden. Der Fred hat auch für ihn gearbeitet, denn vieles musste gezeichnet werden, der Fundort, die Umgebung, aber dann bekam Fred Fieber und starb. Ich schrieb es seiner Frau und wollte die Leiche nach Deutschland schicken, aber da war inzwischen der Krieg ausgebrochen und da einen Sarg hinzuschicken, wäre doch wie Eulen nach Athen gewesen. Dann brachte Agnes ihren Mann um. Sie kam zu mir, Blut auf dem Busen, ein Kind auf dem Arm, das andere an der Hand. Sie musste weg wegen der Familie ihres Mannes, die sonst Rache nehmen würde. Wegen der Behörden hatte sie keine Angst, die wären jetzt mit dem großen Krieg beschäftigt, die kümmere es nicht, wenn ein Bantu den anderen umbringt. Und ich dachte mir, sie ist doch so gescheit und viel zu schade zum immer nur Kinderkriegen und Putzen und Kochen und es tat mir Leid, dass sie in die Berge gehen musste. Und dann ging Mr. L., weil es ihm zu unsicher wurde. Ich beschloss zu bleiben. Die Engländer luden mich immer wieder vor, weil sie befürchteten, ich sei eine deutsche Spionin. Einmal durchsuchten sie alles und brachten die Knochen durcheinander und wie sie sahen, dass ich geduldig alles wieder sortierte, wurden sie sehr höflich, nannten mich eine Forscherin und ließen sich alles erklären. Viele Tage habe ich dann am Seeufer zugebracht und die Knochen gesucht. Manchmal kam Agnes herunter und half mir mit dem Essen und brachte mir viel bei über das Wetter und die wilden Früchte und die Raubtiere, die am Wasser besonders gefährlich sind. Nach dem Krieg kehrte Mr. L. zurück und als er sah, was ich alles gesammelt hatte, kamen ihm die Tränen – und na112 türlich, weil ich gesund und lebendig war. Er machte sich an die Auswertung und stellte fest, dass es zwei Skelette waren, und das wurde eine Sensation. Er nahm mich mit nach Kapstadt und telegraphierte in alle Welt und als er in die USA sollte, um die Funde zu präsentieren, sagte er, ich müsse mit als seine Assistentin! Was hatte ich eine Aufregung, weil ich dachte, man merkt doch, dass ich nichts gelernt habe, und dann nennen sie mich eine Betrügerin. Aber alle wollten mit mir sprechen und trotz meines schlechten Englisch nannten sie mich ein „Fraulein-Wunder“ und immer wieder musste ich ihnen von Afrika erzählen. Es kam ein Foto von mir in die Zeitung, wo ich den rekonstruierten Schädel halte und auf derselben Seite war eins von Ingrid Bergman und wie ich das sah, dachte ich mir, jetzt bin ich eine richtige Berühmtheit geworden mit den alten Knochen. Mr. L. sagte, es wären die Gebeine von einer Frau und einem Mädchen, und abends beim Einschlafen habe ich mich oft gefragt, wie mag ihr Leben wohl gewesen sein? Ich versuchte mir vorzustellen, wie sie gelebt haben, was sie da am See gemacht haben, welche Vorstellung sie vom Leben hatten und ich fragte mich, ob jemand irgendwann einmal meine Knochen finden und darüber philosophieren würde. Wir kehrten mit einem ganzen Team nach Afrika zurück, es waren Leute von der Universität, und ich sollte ihnen erklären, wie man es anstellt, eine Ausgrabung zu beginnen, alles abzustecken und Buch zu führen. Dann fingen meine Beschwerden an und als sich herausstellte, dass ich operiert werden muss, bot Mr. L. an, alles in den USA zu arrangieren. Aber es war eben mein Wunsch, zuvor noch einmal nach Deutschland zu kommen und erhielt dann auch die Einladung zur Ehrung wegen Forschung und Völkerverständigung. Wie seltsam es sein wird, alles wieder zu sehen! Ich freue mich auf euch weit mehr als auf den Empfang beim 113 Herrn Reuter. Und dann fällt mir ein, es war ja Krieg und viele sind tot, wie meine Mutter. Und jetzt ist eine kleine Stadt am Rhein Hauptstadt und ein gewöhnliches Mädchen vom Rhein bekommt eine Ehrung. Ich bin zuversichtlich, was meine Gesundheit betrifft, ich habe hier eine Aufgabe, zu der ich zurückkehren möchte. Wir sehen uns in Berlin; ich schicke dir ein Telegramm aus Bremerhaven. Viele Papiere muss ich mir noch beschaffen für Westdeutschland und die sowjetische Zone und Berlin, du weißt ja: Je wilder das Land, desto mehr Verwaltung. In Liebe Deine Elli 114 Keno tom Brooks Briewe uit Namibia, #12 Bruder Johannes Johannes saß auf dem nackten, festgetretenen sandigen Boden seines Steinhauses. Das Haus stand in einer langen gleichförmigen Reihe anderer Häuser, die wie die Glieder einer ineinander verwobenen Kette vom Stadtrand Swakopmunds in die Wüste hinausreichten. Es bestand nur aus zwei Räumen mit kleinen glaslosen Fenstern, die die Wüstenhitze in stetigem Luftstrom ins Haus ließen. Ein Regal mit ein paar alten Töpfen auf den verstaubten Brettern, ein schon lange nicht mehr benutzter Holzherd und ein paar Decken waren alles, was Johannes besaß. Den Slum der Armen, die Mondesa, konnte man direkt von der einzigen Zufahrtstraße nach Swakopmund, der „Kaiser-Wilhelm-Allee“, sehen. So hatte die Regierung Häuser in der Mondesa errichten lassen, um den zahlungskräftigen Touristen nicht schon bei der Anfahrt den Urlaub zu verderben. Die Armut wurde hinter Steinfassaden versteckt, aber die Menschen lebten nicht besser als vorher in ihren Hütten aus Pappe und Blech. Johannes wohnte in der 7th Avenue, einer kleinen staubigen Sandpad, an deren gegenüberliegender Straßenseite die neu angekommenen immer noch ihre Hütten aus Abfällen und Unrat errichteten. Die Regierung duldete das, solange die Hütten nicht fest gebaut waren, nur Pappe, Holz und anderer Abfall lose zusammengefügt wurde. Regen gab es in der Wüste nicht. Die Bauwerke mussten nur die Sonne des Tages mildern und die Kälte der Nacht abhalten. Von Zeit zu Zeit kamen Beamte mit einem Bautrupp und bauten wieder einen Straßenzug mit zehn oder zwölf Häusern, rissen einige der Unterschlüpfe und Hütten jenseits der 7th Avenue ab und verschwanden wieder. Das Material ließen sie liegen, denn 115 ein Abtransport war nicht notwendig. Es fand noch am gleichen Abend wieder Verwendung an anderer Stelle. Es waren zu wenig Häuser für die vielen Menschen, die durch die Wüste aus dem Inland kamen um hier, in dem Touristenort an der Küste, ihr Glück zu machen. Und es gab zu wenig Arbeit, zu wenig Wasser und zu wenig Geld. Johannes schlug mit einem Stein auf eine kleine Batterie, die vor ihm auf einem festen Teil des Bodens lag, aber der Stein war brüchig wie Krokant und kleine Splitter bedeckten den Boden rund um die Batterie. Neben ihm stand eine alte Plastikschüssel, verkratzt und dunkel, in der eine sämige Flüssigkeit schwamm. Er hatte schon ein paarmal hineingespuckt, denn Johannes wusste, dass viel Spucke auch viel Alkohol bedeutete. Das Pombe hatte er gestern schon aus Maismehl und etwas Zucker angesetzt. Jetzt musste er nur noch die Batterie aufschlagen, damit die Batteriesäure das Pombe stark machte. Stark wie den Löwen der Wüste. Neben Johannes auf dem Boden lag sein Sohn auf einer alten, zerrissenen Decke. Schon seit Wochen konnte er nicht mehr aufstehen. Er war krank. Vigs. Die Weiße Krankheit. Er hatte schon früher davon gehört, aber alle hier in der Mondesa sagten, die Weiße Krankheit sei nur eine Erfindung der Weißen, damit sich die Schwarzen nicht mehr vermehren, damit sie keine Kinder kriegen und die Weißen das Land übernehmen können. Er hatte nie an die Weiße Krankheit geglaubt; und auch die Frau, die regelmäßig in den Ort kam und den Männern und Frauen erklärte, wie sie ein Plastiktütchen über einen Holzstock ziehen mussten um keine Krankheiten und keine Kinder zu bekommen, war von der Regierung bezahlt. Sie steckten unter einer Decke. Die Regierung, das wusste Johannes, die Regierung bekam ihr Geld von den Weißen. Aus Deutschland und aus Amerika. Außerdem hatte er schon gehört, dass das mit dem Stock nicht funktionierte. Einige 116 hatten das ausprobiert, aber der Stock mit dem Plastiktütchen in der Ecke des Zimmers hatte nicht vor Schwangerschaft und Krankheit geschützt. Schlechter Zauber. Johannes glaubte lieber an die Fetischmänner. Die wussten einen Zaubertrank aus Kuduschwänzen und Gepardenohren, aus Pavianleber und Nashornhorn zu brauen. Aber es wurde immer schwieriger, die Zaubertränke zu bekommen, weil die Weißen immer besser aufpassten, die Tiere immer weniger und die Zaubertränke immer teurer wurden. Johannes schlug mit seinem Stein fester auf die Batterie und die Schweißnaht begann sich langsam nach außen zu stülpen. Ah, es würde ein gutes Bier werden, ein starkes Bier. Er musste nur noch etwas Geduld haben, bis er diese Batterie aufhatte. Nur etwas Geduld. Der Stein in seiner Hand zerbröckelte fast vollständig unter dem nächsten Schlag und er nahm einen anderen von dem Haufen, den er sich zurechtgelegt hatte. Jetzt lag sein Sohn hier auf dem Boden und konnte nicht arbeiten. Seine Frau war schon lange mit einem Ovambo aus der Stadt verschwunden. Der hatte Geld. Ovambos hatten immer Geld. Sie waren die Regierung, saßen in ihren schwarzen Mercedeslimousinen mit Klimaanlage und ließen sich durchs Land fahren. Das Geld, die Wirtschaftshilfe, die Entwicklungshilfe, die Zuwendungen, die sie für Namibia erhielten, verteilten sie in ihren Familien und nur wenig blieb für die Projekte, für die die Menschen in Europa überall sammelten und spendeten. Ah, die Ovambos aus dem Norden. Eingewandert aus Angola, haben sie hier heimlich die Macht übernommen, haben die Ureinwohner, die Buschmänner wie Karnickel gejagt und wie Schweine abgeschlachtet. Die Herero und Damara verdrängt, die Mischlinge in Rehoboth ins Abseits gestellt. Ihre eigenen Landsleute, Flüchtlinge vor dem großen Krieg jenseits der Grenze hungerten in Lagern wie Osire und hatten keine 117 Zukunft. Oh ja, die Ovambos, die Herren im Land. Die Regierung. Schlimmer als die Weißen. Schlimmer als Vigs. Johannes hatte noch vier Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter. Aber die Töchter waren schon lange verschwunden, irgendwo in Windhuk, in der großen Stadt lebten sie immer wieder bei anderen Männern, hatten selbst schon Kinder. Aber alle waren krank. Die anderen Söhne arbeiteten beide in Swakopmund, reinigten Teller in Hotels und Restaurants, leerten Mülltonnen, machten Hilfsarbeiten für 60 Namib Dollar im Monat. Davon konnten sie nicht leben. Oft stahlen sie Dinge, die sie in der Nachbarschaft für ein paar Cent, ein Bier oder etwas Dacha verkauften. Wenn sie erwischt wurden, gingen sie für ein paar Tage ins Gefängnis. Dann lungerten sie wieder in der Siedlung oder in Swakop herum, bis sie irgendwo einen Gelegenheitsjob fanden. Manchmal gingen sie nachts auf Raubzug und stahlen in den Gärten draußen in Vineta oder dem Weißen-Viertel Kramersdorf Möbel und Wäsche. Aber das war auch gefährlich, denn die Mauern um die Häuser hatten Glasscherben auf ihren Kronen und scharfe Hunde bewachten das Gelände. Da war es schon einträglicher, unvorsichtigen Touristinnen die Handtaschen zu stehlen. Oft hatten sie so schon Hunderte von Dollars erbeutet, die aber nie lange anhielten. Die Familie hatte viele Mitglieder und alle wollten leben. Wenn solch ein Geldsegen über sie hereinbrach, dann stiegen sie in den Bus und fuhren nach Norden, hoch ins Okawango, wo sie empfangen wurden wie Stammesführer. Sie gaben ihr Geld großzügig aus, bezahlten Hochzeiten und Feiern, unterstützten diesen und jenen, gaben hier und da ein paar Dollar und fuhren, war das Geld verbraucht, mit dem Bus wieder zurück nach Mondesa. Im Okawango hielt man sie für reich, und nicht wenige versprachen jedes Mal nachzukommen und auch ihr Glück zu machen. 118 Johannes war gerade erst von solch einer Fahrt zurückgekommen. Sie waren zu einem Initiationsritus nach Hause gefahren und er, Johannes, der Bruder des Vaters des Mädchens, der Onkel, Onkel Johannes hatte nach alter Tradition das Mädchen entjungfern dürfen. Sie war zwölf oder dreizehn Jahre alt und hatte feste Brüste und ein schmales Becken. Oh ja, trotz seiner 35 Jahre war er kein alter Mann, das Feuer brannte noch in ihm obwohl er sich im Augenblick nicht wohl fühlte. Das wusste auch die Frau von nebenan, die er manchmal, wenn das Pombe besonders stark und er voller guter Geister war, besuchte. Dann schliefen sie direkt auf dem steinigen, sandigen Boden miteinander und er vergrub sich in die schwitzenden Fleischberge, besorgte es dieser schwarzen Mama wie ein Zwanzigjähriger. Dann fühlte er sich wieder jung und kraftvoll und unbesiegbar wie ein Löwe in den Sümpfen des Okawango. Es störte ihn nicht, dass die Nachbarin auch mit anderen schlief, mit allen, die ihr Essen und etwas Dacha brachten oder einen guten Schluck Pombe. Er war besser als alle anderen. Oh ja, er war ein guter Liebhaber. Er hatte viele Frauen gehabt, viele Nichten ins Leben gerufen. Er hatte groote Ballas und einen dicken Piel, er würde noch lange die Frauen glücklich machen. Nur in letzter Zeit fühlte er sich schwach, verließ das Haus nur noch um sich vorne auf die kleine Mauer an der Straße zu setzen. Aber das war bestimmt nur vorübergehend. Zu wenig zu essen. Jeden morgen Millipap mit etwas Fett und Zucker, manchmal, wenn Geld da war, gab es auch Millipap mit Tomaten und Zwiebeln. Fleisch hatte er schon lange nicht mehr gegessen. Außer bei den Festen, aber dann wurde ihm auch immer schlecht von dem vielen ungewohnten Essen und er musste sich oft übergeben. Nein, nein, er würde schon wieder auf die Beine kommen und seinem Piel Arbeit geben. 119 Die Batterie vor ihm platzte mit einem leisen Knirschen auf. Johannes warf den Stein zur Seite, nahm die Batterie geschickt mit einer Hand auf und beförderte sie mit einem Schwung in die Plastikschüssel neben ihm, damit kein Tropfen der bräunlichen Säure verloren ging. Er leckte sich die Lippen. Das würde ein gutes Pombe werden. Ein Fest. Er würde damit hinübergehen zu seiner Nachbarin. Sie würden trinken und irgendwann würde er sie fragen: „Wil jy met my naai?“ Und sie würde ihn nehmen und an sich drücken und er würde wieder in ihr versinken und schwitzend und schreiend das Leben genießen. Er musste nur noch Geduld haben, bis das Bier fertig war, bis die Batteriesäure ihre Wirkung beendet hatte, bis das Bier ordentlich schäumte. Dann ...! Neben ihm stöhnte sein Sohn. Fiebrig und unruhig wälzte er sich schwitzend auf der Decke. Johannes versuchte ihn zu ignorieren. Er konnte ihm nicht helfen, hatte keine Medikamente, kein Essen. Der Fetischtrank, den er aus dem Okawango mitgebracht hatte, war verbraucht. Sein Sohn hatte alles getrunken. Etwas hatte auch Johannes probiert, nur ein wenig, einen kleinen Schluck, weil es ihm auch so schlecht ging; und wenn der Zauber bei seinem Sohn wirkte, dann könnte er doch auch ihm etwas helfen?! Jetzt war nichts mehr da und seinem Sohn ging es nicht besser. Johannes hatte in einer alten Plastikflasche etwas Wasser von dem öffentlichen Wasseranschluss, der einen Großteil des Viertels versorgte, geholt und seinem Sohn damit die Stirn gekühlt. Trinken mochte er schon seit gestern nicht mehr. Immer erbrach er alles, fühlte sich hinterher noch schlechter und Johannes musste die grünliche Flüssigkeit mit einem alten Lappen vom Boden wischen. Die anderen beiden Taugenichtse waren wieder irgendwo in der Stadt betteln, stehlen oder auf der Suche nach Arbeit. Martin, der ältere der beiden wollte unbedingt nach Lüderitzbucht. Dort hatte man die Kaianlage ausgebaut 120 und große Touristenliner legten jetzt dort an. Da war Geld zu machen. Vielleicht ist er dorthin? Vielleicht auch zu dem Herero, der das neue Bestattungsgeschäft oben in der 10th Avenue aufgemacht hat. Der stellte aus den Brettern der abgerissenen und verlassenen Behausungen Särge her. In letzter Zeit starben viele hier in der Mondesa und zu Hause im Okawango. Zu viel schlechter Zauber. Aber ein gutes Geschäft. Der kleine Friedhof draußen in der Wüste wuchs schneller als Mondesa. Johannes rührte mit einem Stock in dem weißlich schäumenden Gebräu vor seinen Füßen. Ah, sein Pombe würde gut werden. Alles würde gut werden. Seine Söhne würden Arbeit finden, sein Jüngster gesund werden und sie würden noch viele Feste feiern und viele Nichten zu Frauen machen. Seine Schmerzen würden gut werden, sein Hunger würde vergehen und die Nachbarin würde mit ihm Liefde machen sooft er wollte. Johannes nahm die Schüssel mit beiden Händen, hob sie an den Mund und begann mit tiefen Zügen zu trinken. 121 Anja Labussek Ein letztes Mal – In Memoriam Karen (Tania) Blixen Wenn es auf dieser Welt einen Ort gibt, der die Bezeichnung „vollkommen“ verdient, dann ist das für mich der Gipfel des gewaltigen Ngong-Gebirges. Wie oft habe ich in den letzten siebzehn Jahren dort oben gestanden und meinen Blick schweifen lassen: Unter mir reichte weites Grasland bis hin zum Fuß des Kilimandscharo, auf der anderen Seite erstreckte sich die dürre Mondlandschaft der afrikanischen Tiefebene. Es war ein imposantes Farbenspiel aus Gelb-, Grün- und Brauntönen, in dem jedes Detail seinen tiefen Sinn hatte. Immer, wenn ich dort stand, überkam mich das Gefühl, einen Blick in die Seele Afrikas zu werfen. An diesem Augustnachmittag des Jahres 1931 war jedoch etwas anders, als ich wieder hinaufstieg. Morgen schon würde ich die Rückreise in mein Geburtsland Dänemark antreten und meine afrikanische Farm für immer verlassen müssen. Das Bewusstsein, diese Landschaft zum letzten Mal zu sehen, hatte meine Wahrnehmung in eigentümlicher Weise geschärft und meinen Sinnen eine Intensität verliehen, die geradezu körperlich schmerzte. Lange hatte ich mich davor gescheut, doch nun war es an der Zeit, nicht nur von den Ngong-Bergen, sondern auch von Denys Abschied zu nehmen. Er hatte mich schon erwartet. „Ich wusste, dass du noch einmal kommen würdest“, begrüßte er mich. „Die letzten Wochen war ich damit beschäftigt, die Farm aufzulösen und meine persönlichen Angelegenheiten zu regeln“, sagte ich und war erstaunt, wie gefasst meine Stimme klang. „Es gab so vieles zu bedenken. Morgen nehme 122 ich ab Mombasa das Schiff nach Europa. Aber ich kann nicht abreisen, ohne mich von dir zu verabschieden.“ „Du bist eine bemerkenswert tapfere Frau. Das alles muss dir ungeheuer schwer fallen.“ „Denys, was würdest du empfinden, wenn der einzige Platz, an dem du dich wirklich zuhause fühlst, nicht mehr deine Heimat sein kann?“, fragte ich ihn nachdenklich. „Ich wäre vor allem dankbar“, antwortete er, „dankbar, dass ich das Glück hatte, viele Jahre an einem solchen Ort gelebt zu haben, der mein Innerstes zum Schwingen bringt. Das ist mehr als die meisten Menschen je erfahren dürfen.“ „Wird denn nicht dadurch die Trauer über das, was jetzt verloren ist, nur noch größer?“, hielt ich ihm entgegen. „Was um Himmels willen soll ich in Dänemark anfangen? Das Land ist mir fremd geworden, es wird mich einengen und mir die Luft zum Atmen nehmen.“ All der Kummer, den ich mühsam unterdrückt hatte, brach nun aus mir heraus. „Denys, warum hast du mich nicht unterstützt? Als ich dich am nötigsten gebraucht hätte, hast du mich allein gelassen. Gemeinsam hätten wir vielleicht das Geld aufgebracht, um die Farm zu retten. Aber nun ist es zu spät.“ „Mir ist klar, dass du dein Herzblut in diese Kaffeefarm gesteckt hast. Trotzdem musst du den Tatsachen ins Gesicht sehen.“ Denys’ Tonfall war sanft und doch eine Spur ungehalten. „Das Farmgelände ist für den Kaffeeanbau ungeeignet, es liegt viel zu hoch, als dass dort etwas gedeihen könnte. Glaub’ mir, wann immer ich bei dir auf Bogani war, habe ich mich dort genauso wohl gefühlt wie du. Aber die Farm war durch und durch unrentabel und mein Geld hätte sie nicht retten können, es hätte höchstens ihren Niedergang etwas hinausgezögert.“ Im Grunde wusste ich, dass Denys Recht hatte und dass ich nicht gegen seine handfesten Argumente ankommen 123 konnte. Das ärgerte mich. „Du hast gut reden“, antwortete ich heftiger als ich wollte. „Du hattest schließlich deine Safaris und die Fliegerei, ich aber nur die Farm. Sie war mein Lebenswerk.“ „Du sagst es – sie war dein Lebenswerk, jetzt ist sie es nicht mehr. So hart das klingen mag: Es ist an der Zeit, deine bewundernswerte Energie für neue Aufgaben einzusetzen.“ „Wofür denn? Ich habe doch nichts gelernt. Ein paar Malkurse damals an der Kunstakademie in Kopenhagen und einige Geschichten, die ich abends aus Langeweile auf der Farm geschrieben habe – das ist alles, was ich je zustande bringen konnte.“ „Deine Geschichten ... wie habe ich mich immer darauf gefreut, dass du sie mir vorliest, wenn ich von meinen Reisen auf die Farm zurückgekehrt bin. Und es war wunderbar, wie wir sie gemeinsam weitergesponnen haben. Versprich mir, nicht mit dem Schreiben aufzuhören, wenn du wieder in Dänemark bei deiner Familie bist.“ „Ach, ich weiß nicht, ob ich überhaupt talentiert bin“, wandte ich ein. „Malen und Schreiben, das habe ich immer gerne getan. Aber wer sagt, dass die Dinge einem auch wirklich gelingen, nur weil man sie gerne tut?“ „Wage es einfach! Afrika hat dir so viele Impulse gegeben, jetzt liegt es an dir, sie umzusetzen und etwas zu erschaffen, was dich unsterblich macht.“ „... was dich unsterblich macht“, wiederholte ich und musste unwillkürlich lachen. „Entschuldige Denys, aber es klingt so komisch, wenn du das sagst. Du bist schließlich ...“, ich stockte, als ich das Wort aussprechen musste, „... tot.“ Es war eine Tatsache und doch erschien es mir immer noch unwirklich, dass ich hier an seinem Grab stand. Das Gras war grün und kurz wie ein geschnittener Rasen. Ich selbst hatte einen Stapel weiß getünchter Steine von der 124 Farm heraufgebracht und sie zu einem Viereck angeordnet, um die Stelle zu markieren. Drei Monate lag Denys’ Flugzeugabsturz zurück, der ihn mit nur 44 Jahren aus dem Leben gerissen hatte. Und meine Trauer über seinen Tod war eins geworden mit der Trauer um mein verlorenes Afrika. Oft hatte ich sein Grab vor Augen gehabt, als ich in den vergangenen Wochen meine Farm auflösen und alles verkaufen musste, was mir ans Herz gewachsen war. Nächtelang hatte ich gegrübelt, ob es nicht das Beste sei ihm zu folgen. Aber es wäre keine Lösung gewesen. Denn ich sehnte mich ja gerade nach Freiheit und Lebendigkeit, fürchtete mich vor Leere und Isolation – und was sonst hätte ich vom Tod erwarten können? Ich wollte leben, nicht sterben. Denys hatte Recht gehabt. Afrika war mir das Tor zu einer Welt voller Poesie gewesen, und dafür war ich zutiefst dankbar. Ich dachte an die Löwen, denen ich bei Sonnenaufgang in die Augen geschaut hatte. An das verdorrte Steppengras, das nach dem Regen wieder anfing, in zartem Grün zu sprießen. An das helle Kreuz des Südens am nächtlichen Sternenhimmel. Und wenn es mir gelang, einen Funken dieser Poesie in mein neues Leben hinüberzuretten, ihn in Worte zu kleiden und unvergänglich zu machen, dann würde ich eines Tages bereit sein, ein Leben jenseits von Afrika zu akzeptieren. Ich spürte, es war an der Zeit zu gehen. „Weißt du was, Denys?“, fragte ich laut, obwohl mir in diesem Moment überdeutlich bewusst war, dass ich ganz allein auf dem Berg stand. „An welchem Ort der Welt ich in Zukunft auch bin, ich werde immer daran denken, ob es gerade in Ngong regnet.“ Ein letztes Mal glitt mein Blick über die majestätische Landschaft und die Grabstätte. „Adieu“, murmelte ich. Dann drehte ich mich um und begann mit dem Abstieg, ohne noch einmal zurückzuschauen. 125 Raiko Milanovic Der Blick nach Süden Ich folgte dem alten Pfad durch die warme Nacht, bis ich an Großvater Apudos Zaun stieß. Hier kam ich nicht weiter, das wusste ich ja, aber meine Füße kannten den Weg, am Zaun entlang bis an das Tor. „Mzee“, rief ich, „mach auf! Ich bin zurück!“ Licht flammte auf, eine Tür öffnete sich und Großvater lugte zur Tür heraus. Die Tür ruckte noch einmal und flog auf, dann rannte Akinyi heraus. „Mzee, mach auf, mach auf! Es ist Mgeni!“ Sie lachte und tanzte vor dem Tor, bis der alte Mann kam zu öffnen. „Mgeni, wie schön! Seit wann bist du zurück?“ Ich kam nicht weiter als „Gut“ zu sagen, weil Akinyi versuchte an mir hochzuklettern. Sie ließ von mir ab und rannte ins Haus um Jibu zu holen. Er kam und hatte nichts Besseres zu tun als über meine Verspätung zu bemerken und über meine Blässe zu sticheln. Aber wir lachten zusammen und ich nahm es ihm nicht krumm. Akinyi schaffte es, noch mehr Menschen aus dem Haus zu locken, die mich mit Fragen, Geschwätz und Gelächter überschütteten. Alle Fenster waren erleuchtet und Akinyi tanzte mit den Kindern und rief mit heller Stimme nach noch mehr Tänzern. Freunde und Verwandte kamen. Doch bevor der Hof meines Großvaters zum Tollhaus wurde, nahm Großmutter die Sache in die Hand. Sie scheuchte die Kinder zu den Frauen, rief gebieterisch nach Essen und Bier, beschimpfte Koch wie Mägde und ließ den alten Herd, trotz lautstarken Protestes, anfeuern um selber zu kochen. Alles lachte und schwatzte, lärmte und tanzte während es aus der Küche immer besser roch und ich mich endlich zurücklehnen konnte. 126 Wir aßen im Wohnzimmer, alle Möbel an die Wand gerückt, auf dem Boden. Es war schön, wieder im Kreis der Familie zu sitzen, auf den alten Bastmatten, inmitten von Tellern und Töpfen und freundlichem Geschwätz. Ich hatte schon lange nicht mehr so gesessen oder gegessen, aber ich hielt mit, so gut ich konnte, obwohl Großmutter mit noch einem Teller aus der Küche kam. „Nimm noch, mein Junge. Das hier ist richtiges Essen. Nicht das moderne Zeug aus dem Flugzeug.“ Sie konnte Mikrowellen nicht leiden, weil sie ihr die Vorfreude beim Kochen nahmen. Ich drückte den Teller schwach gegen ihre fürsorgliche Hand und erreichte ein Patt, sodass er vor mir auf den Boden sank. Jibu grinste schadenfroh und meinte, dass die Reise mir nicht nur die Farbe, sondern auch den Appetit genommen hätte. Ich knuffte ihn und er schubste zurück. Großvater räusperte sich. „Ihr wart diesmal auf Mallorca?“ „Ich bin Ski gefahren, Großvater. Richtig Ski gefahren. Auf echtem Schnee! Kolja hat es mir gezeigt.“ „Kolja?“, fragte Großmutter. „Nikolaj, vom Moskauer Institut. Wir mussten so oder so jeden Tag vom Gletscher herunter, da, meinte Kolja, könnten wir auch Skier nehmen und ein bisschen Spaß haben.“ Großmutter runzelte die Stirn und schüttelte ungläubig, fast tadelnd den Kopf. „In der Kälte? Bei Eis und Schnee?“ „Es macht Spaß, Großmutter. Es knirscht leise, wenn man über den Schnee gleitet und die Schneeflocken glitzern in der Sonne. Es ist wunderschön.“ Ich holte meinen Laptop heraus und zeigte Bilder. Die Familie kicherte, als sie mich auf dem Bildschirm erkannten; ein schwarzes Gesicht in einem orangenen Parka vor dem Gletscher des Soler Massivs. 127 „Und die Flüchtlinge?“, fragte Großvater nachdem mein Laptop die Runde gemacht hatte. „Auf dem Gletscher sind natürlich keine, sie drängen sich alle an der Küste. Die ist noch eisfrei, aber ...“ Großvater nickte müde. „Ich weiß, fast zweihundert Millionen Menschen.“ Niemand sprach und Akinyi schaute erstaunt in die Runde, bevor sie sich wieder an mich kuschelte. Großvater tippte an den Laptop. „Ihr habt das Gutachten?“ Ich nickte. „Ja, es ist fertig.“ „Wie sind die Aussichten?“ Ich holte tief Luft. „Der Gletscher am Soler Massiv ist bereits an die hundert Meter stark und wird weiter wachsen.“ „Und die Küste?“ „Das kann niemand mit Bestimmtheit sagen. Es gibt zu viele Variablen, weißt du, aber wir haben eine fünfzigprozentige Wahrscheinlichkeit ermittelt, dass sie eisfrei bleibt.“ „Also wisst ihr es nicht genau.“ Ich nickte. „Und die Menschen?“ „Sie können nicht bleiben. Egal, ob die Küste eisfrei bleibt oder nicht, die bewohnbare Zone wird schrumpfen.“ „Und das Festland? Wie ist deine Prognose?“ „Die Gleiche wie für die Inseln, Großvater. Der Rest des Golfstroms wird die Westküste warm halten, aber das Hauptland wird in ein paar Jahren vereisen. Ich kann dir die Wachstumsraten zeigen ...“ Er schüttelte den Kopf, als ich nach dem Laptop griff. Ich legte meine Hand auf seine. „Da ist noch was, Großvater.“ „Gibraltar?“ 128 „Ja, Gibraltar. Es wird vollständig zufrieren. Nächstes Jahr schon. Und dann ist der Landweg nach Afrika offen.“ Es war still geworden im Raum. Ich hatte schnell geredet, nicht darauf geachtet, dass meine Stimme immer kratziger wurde, als ich alles heraussprudelte. Großvater wartete, bis ich mich geräuspert und einen Schluck Bier genommen hatte. Vielleicht wollte er selbst eine Pause, denn er fragte nicht weiter und schaute auch niemanden an, sondern blickte auf den Teller vor sich. Die Stille dauerte an, bis Großmutter sich schwer auf Jibu stützte, der ihr beim Aufstehen half. Sie ging zur Klimaanlage und schaltete sie ab und öffnete ein Fenster. Die Kälte sei nicht gut, weder für ihre alten Knochen noch für uns, sagte sie. Niemand widersprach. „Das ist sicher?“, fragte Großvater schließlich und ich nickte wieder. „Gibraltar wird vollständig vereisen. Das musst du dem Rat mitteilen, Großvater. Mach ihnen klar, dass es kommen wird. Sprich mit dem Präsidenten. Das Gutachten darf nicht bei irgendeinem kleinen Funktionär hängen bleiben!“ Er hob die Hand. „Nächste Woche tagt der Präsidialrat. Bis dahin ist Zeit.“ Jibu mischte sich ein. „Dann sag ihnen auch, dass sie unser Land stehlen wollen.“ Er hatte leise, aber bestimmt gesprochen. Ich war mir nicht sicher, an wen es gerichtet war, aber ich antwortete darauf. Was hätte ich sonst tun sollen? „Red keinen Unsinn. Europa vereist. Eine Eiszeit kommt, verstehst du? Das ist keine Ausrede.“ Er nickte nur und schaute mich mit altbekannter Sturheit an. „Sie werden kommen und sich hier breit machen.“ Jibu wartete nicht auf Antwort, überging mein lahmes „Sie wollen raus aus der Kälte“ und setzte noch einen drauf: „Die Weißen sind selber schuld. Sie nehmen sich alles und lassen nur Abfall zurück.“ 129 „Sprich nicht von ihnen als ob es Heuschrecken wären!“, rügte Großmutter ihn, doch er war nicht zu bremsen. „Aber es stimmt doch! Irgendeine Ausrede werden sie schon finden um uns zu bestehlen. Erst stahlen sie Menschen, dann Rohstoffe und jetzt kommen sie wegen der Wärme.“ Akinyi richtete sich plötzlich in meinem Schoß auf. „Stimmt das, Onkel Mgeni? Kommen die Weißen um die Wärme zu stehlen?“ Ich antwortete etwas Belangloses, sprach drauflos, redete von dem weiten Weg und dem großen Wasser zwischen Europa und Afrika, alles um Akinyi zu beruhigen. Aber gerade das Seichte genügte nicht. Ich konnte ihr den Schatten nicht beiseite reden und kannte auch keinen Zauberspruch um die Angst zu vertreiben. Ich zog sie einfach an mich und funkelte meinen Bruder böse an. „Was ist mit den Menschen, Mgeni?“ „Wir haben den Gletscher untersucht, Großvater. Zu den Flüchtlingen hatten wir keinen Kontakt.“ „Warum nicht, Mgeni?“ Ich zuckte mit den Schultern. Warum wohl? Wir sollten das Gletscherwachstum abschätzen und wie lange die Eiszeit dauern würde. Zwei Wochen hatten wir auf dem Soler Massiv verbracht, hatten den Gletscher untersucht und geprüft, hatten gemessen und uns den Kopf zerbrochen um ihm mit den Mitteln der Wissenschaft näher zu kommen. Wir waren, und ich senkte unwillkürlich meinen Kopf, nur wegen des Eises gekommen. Ich schauderte. „Auf dem Weg zum Heliport“, begann ich „sahen wir ein Lager. Die Leute hocken zwischen Windfängen und Felsen. Es ist ja nicht nur das Eis, der Wind selbst ist kalt, müsst ihr wissen.“ Großmutter beugte sich vor und nickte. Akinyi entspannte sich auf meinem Schoß. 130 „Die Flüchtlinge sehen die Hubschrauber. Die vom Roten Kreuz, die der Armee und natürlich unsere. Die Helis heben in alle Richtungen ab, aber die Menschen blicken nur denen nach, die in den Süden fliegen.“ Ich erinnerte mich. Ein Bild stieg in mir auf, wie die Flüchtlinge, das Eis im Rücken, das Wasser vor sich, auf Mallorcas hellem Sandstrand standen und uns nachschauten, bis ich sie und sie den Hubschrauber nicht mehr sehen konnten. Meine Stimme wurde lebhafter. „Sie stehen am Strand mit ihren Alten, mit ihren Kindern und schauen uns nach. Sie winken nicht, sie rufen nicht, und manchmal heben sie ihre Kleinen hoch. Sie stehen da und man sieht ihnen an, wie sie sich nach der Wärme sehnen, wenn sie uns fortfliegen sehen. Selbst die Kinder, die zu jung sind um etwas anderes als Eis und Schnee zu kennen, folgen uns mit ihren Blicken. Sie alle, sie alle haben den Süden im Blick.“ Ich schaute in die Runde. Alle schienen in Gedanken versunken. Großvater schaute zu Boden und nickte wie jemand, der seine Erwartung bestätigt sieht. Großmutter schaute Akinyi an und niemand sprach, bis Jibu sich räusperte um seine Kehle und sein Gewissen zu befreien. „Sie werden kommen. Wir müssen uns vor ihnen schützen.“ „Wovor müssen wir uns bei halb erfrorenen Alten und Kindern schützen?“ Ich konnte es mir nicht verkneifen. „Es wird Gesindel kommen. Und Krankheit.“ „Ein Grund mehr, ihnen zu helfen. Sollen wir unsere Türen vor Alten und Kranken verschließen?“ Er schwieg verstockt. „Sollen wir sie ins Eis zurückschicken, Jibu? Es sind doch unsere Verwandten; der Mensch ist vor drei Millionen Jahren in Afrika entstanden.“ Er schnaubte verächtlich. „Verwandte? Erinnere dich besser daran, was sie mit uns gemacht haben. Malaria, 131 Beri-Beri, Aids. Jahrzehnte – es dauerte Jahrzehnte, bis wir Medikamente statt Ausreden bekamen! Und selbst dann wollten sie noch ein Geschäft daraus machen. Ein Geschäft mit Krankheit und Tod.“ Er knirschte mit den Zähnen, aber diesmal ließ ich nicht locker. „Ja, Jibu, es geht um Erinnern. Was werden sie tun, wenn wir sie nicht aufnehmen? Wenn das Eis wieder geht, werden sie sich daran erinnern, wie wir sie behandelt haben. Und was dann?“, fragte ich. „Wer weiß, wann das sein wird und ob es dann noch Weiße gibt. Sollen sie doch selber sehen, wie sie zurechtkommen. Uns haben sie auch im Stich gelassen.“ Er holte tief Luft. „Mach dir nichts vor. Dass die Weißen plötzlich so freundlich zu uns sind, liegt an der Kälte und sonst nichts. Die wollen nur raus da!“ Großmutter, die bis dahin geschwiegen hatte, mal Jibu, mal mir mit Stirnrunzeln, Verständnis, Belustigung und Mitleid gefolgt war, sagte schlicht: „Wie wir alle, Jibu.“ Ich erwiderte nichts. Weder auf die kalte Wut meines Bruders noch auf Großmutters Einwurf. Mir war klar, dass mein Volk die afrikanischen Wunden arrogant vor sich hertrug wie einen Orden. Aber ich hatte immer gehofft, dass wir es besser machen würden als unsere Vorfahren und uns nicht nur von Wut leiten ließen. Die meisten, ich schaute Jibu an, der stur zurückblickte, waren nicht wie Nelson Mandela, sondern wie die Weißen und er – mein Bruder. Akinyi war in meinem Schoß eingeschlafen. Ich musste trotz meiner trüben Gedanken lächeln. Sie hatte meinetwegen getanzt und sich gefreut, mit mir gegessen und sich vertrauensvoll in meinen Schoß gekuschelt, während wir über die Eiszeit stritten. Sie vertraute mir, dass sie in meinen Armen geborgen war, dass, wenn sie aufwachte, ich da wäre und Großmutter immer einen vollen Teller für sie hätte und alle Erwachsenen dafür sorgen würden, dass sie 132 weiter tanzen und lachen konnte, egal ob die Welt zufriert oder nicht. Ich hatte ihr die Angst nicht fortreden können, aber sie war ruhig eingeschlafen, weil sie darauf vertraute, dass wir für sie sorgen würden. Großmutter stand schwerfällig auf und schüttelte den Kopf darüber, welch missratenen Enkel ihr das Leben nur beschert hatte, während sie die Teller forträumte. Trotzdem drehte sie sich in der Küchentür, die Hände voller Geschirr, um und fragte beinahe heiter: „Nun, Alter. Weißt du, was du dem Rat sagen wirst?“ Großvater blickte verdutzt auf, seine Hand fuhr zu einem Teller, der nicht mehr da war, und schaute erst Großmutter und dann uns an. Betrachtete besonders Jibu und mich und ließ seinen Blick schließlich auf Akinyi ruhen. Sein Rücken straffte sich. „Ja, natürlich!“ 133 134 135 Über die Autoren Hassan Aftabruyan Geboren 1968 in Tabriz (Iran). Studierte Philosophie und Germanistik. Er lebt in Köln und arbeitet als Unternehmensberater. Neben wissenschaftlichen Texten und Fachveröffentlichungen hat er begonnen Romane, Kurzgeschichten und Theaterstücke zu schreiben. Interessen: Kochen, Aikido und das damit verbundene Reisen. Regina Besting Geboren 1983 in Olpe im Sauerland. Lebt und studiert seit kurzem in Siegen. Sie schreibt seit vielen Jahren Kurzgeschichten und Gedichte, doch „Der Mann auf dem Dach“ ist ihre erste Veröffentlichung. Sie liebt Afrika, die Schauplätze der Geschichte hat sie selbst mehrmals besucht, doch selbstverständlich sind Handlung und Personen reine Fantasie. Margit Breuss Geboren 1970 in Bregenz, von Beruf Ärztin, lebt in Innsbruck. Veröffentlicht Kurzgeschichten in Anthologien und Literaturzeitschriften. Keno tom Brooks Lebt seit 1958 und schreibt seit 1972 in Mittelhessen, USA, Kanada, Namibia, Tunesien, Frankreich und Italien. Heute bei Palmbyte Online-Verlag, Syntax-acut.de und anderen. Fünfzehn „Briewe uit Namibia“ sind das Ergebnis einer mehrmonatigen Fußwanderung durch Namibia. Carmen Caputo Jahrgang 1965. Lebt in Iserlohn. Schreibt seit 1995. Mitglied der Autorengruppe „Federstift“. Zahlreiche Veröffentlichungen von Lyrik und Kurzgeschichten, Lyrikausstellungen und Lesungen, Italieni136 sche Leseabende. Herausgeber von Pablo, kostenl. Cafehausblättern. Literaturpreise: Preisträgerin KUI-Literatur, Iserlohn (2002); 2. Preis internationaler Lit.-Preis Fürstenwalde Deutschland/Polen/Russland (2004); 3. Preis Märkische Krimigeschichte, Märkischer Kreis (2004); 1. Preis Wettbewerb „Born to write“ Tropen Verlag, Köln (2004). Lyriklesung Radio Unerhört Marburg (2004). Arbeitet zurzeit an einem Buch über einen süditalienischen Emigranten und einem Lyrikband. Mila Carnel Geboren 1970 in Köln. Ausbildung zur Buchhändlerin, Studium der Literaturwissenschaften (Amerikanistik/Germanistik). Mitarbeiterin „Federwelt“Literaturmagazin. Seit 2003 Tätigkeit als freie Lektorin/Texterin. Mitglied „Quo Vadis“, Verein für den deutschsprachigen historischen Roman. Mitglied der Literaturgruppe „Lauschtour“. Diverse Veröffentlichungen von Kurzprosa und Lyrik. Bonner Kurzgeschichtenpreis, Jokers-Lyrik-Preis. Lesungen im Literaturhaus Köln, Haus der Sprache und Literatur Bonn u.a. Didier wurde 1967 in dem beliebten holsteinischen Kurort Bad Bramstedt geboren und machte hier 19 Jahre später auch sein Abitur. Nach dem Studium der Philologie und Theologie in Hamburg und Lausanne war er Missionar in Westafrika, anschließend unter anderem tätig als Soap-Autor, TV-Redakteur (für Pro-Sieben) und Publizist. Neben einigen Kurzgeschichten und Gedichten veröffentlichte er 2001 sein erstes Buch „König ohne Krone“, das aufwühlende Psychogramm eines jugendlichen Mörders. In den Startlöchern steht darüber hinaus die Jugendkrimireihe „Karl und seine Freunde“. Seit 2003 lebt Didier zurückgezogen in einem entlegenen Winkel der Mandschurei (Nordostchina), wo er an einer Universität Deutsch lehrt. 137 Anne Grießer Geboren 1967 in Walldürn im Odenwald. Die Leidenschaft für gute Geschichten hat mir meine Großmutter mit auf den Weg gegeben. Sie konnte wunderbar erzählen: Märchen, erfundene Geschichten und wahre Begebenheiten aus ihrem eigenen, bewegten Leben. Ich konnte nicht genug davon bekommen und begann schon früh, mir selbst Geschichten auszudenken. Nach dem Abitur zog ich nach Stuttgart und studierte Öffentliches Bibliothekswesen. Aber der Beruf hatte zu viel mit Verwaltung und zu wenig mit Büchern zu tun. Ich zog nach Freiburg, wo ich ein Zweitstudium in den Fächern Volkskunde, Ethnologie und Germanistik begann und 1996 abschloss. Nach der Magister-Prüfung wurde ich Reisemagazin-Autorin und Redakteurin bei einem kleinen Verlag in Köln, bei dem ich viel lernte und auch veröffentlichte. Gleichzeitig schrieb ich Drehbücher für das KrimiMitmachtheater der MordsDamen in Freiburg, denen ich seit 1998 angehöre. Mein erstes Buch erschien 2001 unter dem Titel: „Was war los in Freiburg 1950-2000“. Seit 2000 lebe ich als freiberufliche Autorin in Freiburg. Ganz ohne Nebenjobs ging es aber nicht: Ich arbeitete als Schlussredakteurin beim Burda-Senator-Verlag in Offenburg, als Reiseleiterin auf Mallorca und als Export-Sachbearbeiterin bei der Firma UPS. Zurzeit schreibe ich für mehrere Zeitschriften, arbeite an einem Hörspiel für den Südwestrundfunk, schreibe Kurzgeschichten in den Genres Krimi, Fantasy und Märchen, und veranstalte gemeinsam mit den MordsDamen regelmäßige „Dunkel-Krimi-Abende“ bei denen in einem traditionsreichen Freiburger Keller-Restaurant während des Essens im Stockdunkeln Kriminalhörspiele (von mir verfasst) vorgetragen werden. V. Groß Geboren 1967 in Saarbrücken. Studium der Erziehungswissenschaft, Sozialpsychologie und Sprachwissenschaft, danach zahlreiche Jobs. Lebt in Wadgassen, 138 Saarland. Seit frühester Jugend Beschäftigung mit „Phantastik“, sowohl als Leser wie auch als Autor von Kurzgeschichten. Seit 2003 Veröffentlichungen im Internet und in verschiedenen Anthologien, u.a. im Dr. Ronald Henss Verlag und als Stammautor der SF-Anthologiereihe des Wurdack-Verlages. Für die nahe Zukunft geplant sind eine Sammlung eigener Storys („Psyche und Phantastik“), die zu einer Anthologiereihe ausgebaut werden soll, sowie ein phantastischer Roman. Anja Labussek Jahrgang 1969, lebt in Düsseldorf und arbeitet als Redakteurin in einem technischen Fachverlag. Sie schreibt Kurzgeschichten verschiedener Genres und ist Mitglied in zwei Internet-Autorengruppen. Birge Laudi Geboren 1938 in Tachau im Sudetenland. Nach der Vertreibung aufgewachsen in Steinbach am Wald in Oberfranken. Studium der Medizin in Erlangen und Wien. Seit 1964 verheiratet und wohnhaft in Erlangen. Nach der Berufstätigkeit an verschiedenen medizinischen Einrichtungen und örtlicher sowie überörtlicher ehrenamtlicher Tätigkeit in der evangelischen Kirche bin ich jetzt im Ruhestand und fröne meiner Liebhaberei von Katzen und Kartoffeln, Büchern und Flohmärkten, Sukkulenten und Faulheit. Kurzgeschichten schreibe ich erst seit drei Jahren. Raiko Milanovic 1958 in Münster i.W. geboren. Mein Vater ist Jugoslawe, meine Mutter stammt aus Lettland – ich betrachte mich daher als Europäer (was sonst?!). Ich habe in Aachen Luft- und Raumfahrttechnik studiert und bin in der Forschung tätig. Ich lese gern und viel, treibe lieber Sport als ihn mir anzusehen und kam zum Schreiben, als mich, wieder mal, eine schlechte Science-FictionGeschichte ärgerte. Ich war überzeugt, ich könne das 139 besser und kann seitdem nicht mehr davon lassen. Wenn mich meine Kinder lassen, arbeite ich an einem ScienceFiction-Roman. Meist samstags morgens mit Pink Floyd oder Sting unterm Kopfhörer und einige Lichtjahre weit draußen. „Der Blick nach Süden“ ist meine erste Veröffentlichung. Christiane Stüber Geboren 1978 in Gotha (Thüringen). Studierte Philosophie in Deutschland, Wales und Südafrika. In Kapstadt schrieb sie Beiträge für verschiedene Frauenzeitschriften. In dieser Zeit wurde auch ihre Kurzgeschichte „Between two Platforms“ in einer südafrikanischen Anthologie veröffentlicht. Momentan lebt sie in Leipzig, arbeitet an ihrer Doktorarbeit und unterrichtet. Susanne Weinhart Geboren 1979 in Garmisch-Partenkirchen. Wohnort: Murnau am Staffelsee. Studium der Germanistik, Politischen Wissenschaften und Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Teilnahme an MANUSKRIPTUM. Münchner Kurse für Kreatives Schreiben mit Dagmar Leupold und Jo Lendle. Schreibt Prosa, Lyrik, Drehbücher und Hörspiele. Publikationen/Wettbewerbe: Münchner Hefte. Zeitschrift junger Literatur 02/2003; DUM – Das ultimative Magazin 28/2003 und 29/2004; „Meine schöne, hässliche Geliebte – Gedichte und Geschichten aus der Hohenzollernstraße“, hrsg. von Marta Reichenberger und Tatiana Hänert, München, Oktober 2003; Gewinnerin des „Gepunkteten Trikots“ des Wettbewerbs Literatour de France 2004 des Charlatan-Verlages. Publikation in der Anthologie „Das gelbe Buch der Spitzenschreiber. Literatour de France 2004“, Blauhut & Fuchs 2003. Teilnehmerin der Endausscheidungslesung des 17. Internationalen Jungautorenwettbewerbs der Regensburger Schriftstellergruppe International, Oktober 2004. 140 141 142 143 Edition www.online-roman.de im Dr. Ronald Henss Verlag, Saarbrücken Abenteuer im Frisiersalon. Kurzgeschichten aus dem Internet. Edition www.online-roman.de Dr. Ronald Henss Verlag Saarbrücken, 2004 ISBN 3-9809336-0-1 156 Seiten 10,00 Euro (Deutschland) 10,30 Euro (Österreich) Das Buch enthält eine Auswahl der besten Beiträge zum Kurzgeschichtenwettbewerb „Abenteuer im Frisiersalon“. 21 Autoren aus Deutschland und Österreich präsentieren eine bunte Mischung: Mal ernst, mal heiter, nachdenklich, spannend, sentimental, skurril, phantastisch, … In Vorbereitung: Erzähl mir was von Afrika. Band 2 ISBN 3-9809336-3-6 Noch mehr Kurzgeschichten aus dem Wettbewerb „Afrika“ www.ronald-henss-verlag.de 144 Edition www.online-roman.de im Dr. Ronald Henss Verlag, Saarbrücken Heiligabend überall. Kurzgeschichten zum Weihnachtsfest Edition www.online-roman.de Dr. Ronald Henss Verlag Saarbrücken, 2004 ISBN 3-9809336-1-X 130 Seiten 8,90 Euro (Deutschland) 9,20 Euro (Österreich) Alle Jahre wieder … wollen Menschen Weihnachtsgeschichten lesen. 19 Weihnachtsgeschichten von 17 Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. In Vorbereitung: Erzähl mir was von Afrika. Band 2 ISBN 3-9809336-3-6 Noch mehr Kurzgeschichten aus dem Wettbewerb „Afrika“ www.ronald-henss-verlag.de 145 Kurzgeschichten online lesen und veröffentlichen Besuchen Sie unsere Partnerseite www.online-roman.de 146