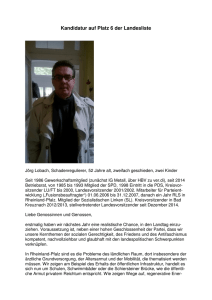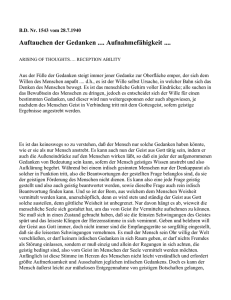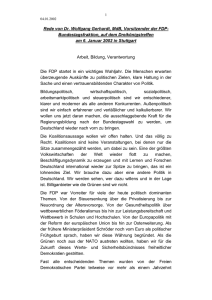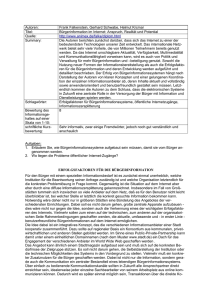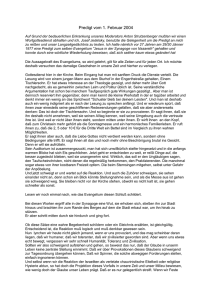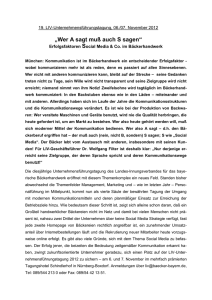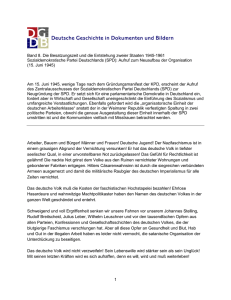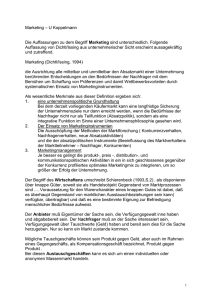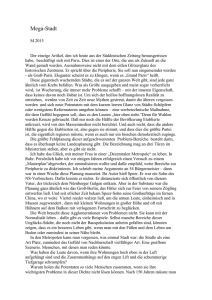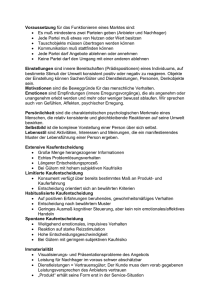Wozu ist die Schule da?
Werbung

Aus: Neue Sammlung 35 (1995) 3, S. 93-104 Wozu ist die Schule da?* Von Hermann Giesecke Das Unbehagen an der realexistierenden Schule wächst zusehends. Ein Viertel jahrhundert mehr oder weniger konsequenter Schulreform scheint in eine Sackgasse geführt zu haben, wofür sich die Belege häufen. So hat das Baden- Württembergische Kultusministerium unlängst öffentlich darüber nachgedacht, ob für dienstunfähig erklärte Lehrer – das seien 80% der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeitsfähigen Beamten – nicht an anderen Stellen der öf fentlichen Verwaltung eingesetzt werden sollten. Aus weiteren Bundesländern ist ähnliches zu hören. Nach einer Umfrage der „Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft“ sind das größte Problem der Lehrerinnen und Lehrer die Schüler, mit denen sie nicht mehr zurechtkämen1. Lehrerinnen und Lehrer tragen inzwi schen ihre Kritik in die Öffentlichkeit. Unter dem Titel „Mir langt's!“ schrieb eine Lehrerin2 ein Buch, in dem sie erklärt, warum sie das Handtuch geworfen und ihren Beruf aufgegeben habe und ein Kollege3 beschreibt seine Schulerfah rungen unter dem Titel „Gewalt auf dem Schulhof“. In Nordrhein-Westfalen hat sich eine „Arbeitsgemeinschaft“ von Gesamtschullehrern gebildet, die diese Schulform, das Hätschelkind der Schulreform der siebziger Jahre, bilanzieren will. Aus diesem Umkreis hat Horst Hensel4 schon 1993 seine kritischen Re flexionen in einem kleinen Bändchen vorgetragen, das inzwischen in 6. Aufl. vor liegt, und Ulrich Sprenger5, pensionierter Gesamtschullehrer, hat im vergange nen Sommer seine Erfahrungen in der GEW-Zeitschrift „neue deutsche schule“ unter dem Titel „Vier Thesen zum Thema Gesamtschule“ resümiert. Das sind nur einige Stimmen, die sich z.B. durch Berichte über hohe Zahlen von Frühpensionierungen von Lehrern weiter ergänzen ließen. Hier handelt es sich offensichtlich nicht mehr um das übliche Wehklagen eines Berufsstandes, der die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich lenken möchte – im Gegenteil scheint er sich eher seiner Ohnmacht zu schämen. Und die gewiß nicht als nachsichtig bekannten Gesundheitsämter schreiben keinen Beamten so ohne weiteres dienst unfähig. [S. 94] Irgendetwas muß faul sein an unseren Schulen, und was ihnen fehlt, ist wohl nicht nur durch mehr Personal und mehr Geld zu kompensieren, es muß vielmehr an der Substanz, also an ihrem pädagogischen Selbstverständnis liegen. Es sind offenbar die neuen Schüler, „neu" im Sinne eines eigentümlichen Sozialisations-Typus, die die Schwierigkeiten mit der „alten Schule" verursachen. „Sowohl Eltern als auch Kinder begreifen immer seltener, daß Lernen eine Tätigkeit ist, und daß jede Tätigkeit Mühe kostet und mit der Verausgabung von Arbeitskraft einhergehen muß. Die Einstellung gewinnt Raum, Lernerfolge müßten sich allein durch Anwesenheit von Kindern im Unterricht von selbst ergeben. Die Anzahl der "guten" Schülerinnen und Schüler nimmt ab; die Anzahl der »schlechten" nimmt zu. ... Weniger Kinder als je zuvor sind bereit und fähig, die Lernziele der Schule durch Tätigkeit zu erreichen ... Sie sind nervös, können sich nicht konzentrieren, bedürfen der immer neuen Reize, Stimuli und Sensationen, können nicht mit sich allein sein, behalten nichts, strengen sich nicht an – kurz: Das Konstante ihrer Persönlichkeit ist die Flüchtigkeit" ... Festzustellen sei, "daß sich ein Pluralismus der Werte und Er ziehungskonzepte zeigt, der an Beliebigkeit grenzt und in bezug auf die Schularbeit auch handlungsunfähig macht. Dominant ist allerdings die Instrumentalisierung aller menschlichen Beziehungen, die Asozialität der Lebensstile, der Werte, Erziehungs konzepte und Verhaltensrepertoires – und die Bevorzugung gewaltsamer Lösungen von Konflikten. Hierbei ist die Tendenz wirksam, die gegnerischen Ansichten oder den gegnerischen Menschen nicht bloß abzuwehren oder zu dominieren, sondern zu vernichten“ 6. Nur wer die Wirklichkeit zumindest in unserer durchschnittlichen Massenschule verleugnet, kann behaupten, hier handele es sich um Einzelfälle oder gar um das Ergebnis bloß unfähiger Pädagogik. Gemeinhin wird aus solchen Analysen nun die Schlußfolgerung gezogen, die Schule müsse noch „kindgerechter“ werden, also ihre pädagogische Strategie und ihre didaktisch-methodische Phantasie noch stärker auf die pädagogische und psychologische Sanierung dieser Kinder rich ten, – nach dem Grundsatz, daß die Schule sich den Schülern anpassen müsse und nicht umgekehrt. Ich halte diese reformpädagogische Strategie für gescheitert. Die Schule kann vielmehr die Schul- und Unterrichtsfähigkeit ihrer Schüler nur bis zu einem bestimmten Grade selbst herstellen. Sie muß ein Mindestmaß davon jedoch voraussetzen können und, wenn dies nicht der Fall ist, die Eltern in die Pflicht nehmen, damit diese, u. U. mit Hilfe der einschlägigen Jugendhilfeangebote, erst einmal für die nötigen sozialen und emotionalen Grundqualifikationen sorgen. Diese These will ich im folgenden begründen und erläutern, um damit die öffent liche Diskussion über dieses Problem aus der üblichen reformpädagogischen Verengung herauszuführen. l. Über Sinn, Zweck, Aufgaben, Ziele und Methoden der Schule herrscht nicht nur unter den Fachleuten, sondern auch in der Öffentlichkeit eine ziemliche Konfusion. Lehrer, Eltern und Schüler wissen nicht mehr genau, wozu sie eigent- [S. 95] lich da ist. Aus der Öffentlichkeit werden alle möglichen Wünsche an sie heran getragen: Sie soll die Defizite der Familie kompensieren, also in diesem Sinne wieder stärker „erziehen“; sie soll den Rechts- und Linksradikalismus unter Ju gendlichen eindämmen; sie soll präventiv gegen Kriminalität und Verwahrlosung wirken, die Wehrbereitschaft erhöhen, Aids verhindern, die Verkehrstoten mini mieren. Es gibt inzwischen kein gesellschaftliches Problem mehr, das nicht laut hals der Schule zur Lösung aufgetischt wird. Betrifft das Problem in erster Linie die Erwachsenen, so soll die Schule langfristig vorbeugen, betrifft es die Kinder und Jugendlichen selbst, soll sie möglichst schnell und effektiv intervenieren. Jedes halbwegs für wichtig gehaltene politischgesellschaftliche Problem – und davon gibt es wahrlich genug – wird zumindest auch als pädagogisches formu liert und damit zur Aufgabe der Schule erklärt. Derartige Erwartungen resultieren jedoch nicht etwa aus irgendeiner halbwegs plausiblen Schultheorie, sie sind vielmehr das Ergebnis von Bequemlichkeit, weil schließlich alle Kinder in der Schule versammelt und insofern für entsprechende Erlasse erreichbar sind. Da andererseits die hehren Erwartungen der Professio nalität des Lehrers – scheinbar! – schmeicheln, ist es schwierig, den Blick auf die eigentliche Aufgabe der Schule zu richten und gegen ihre hoffnungslose Über forderung Widerstand anzumelden. Pädagogisch falsch an diesen Erwartungen ist, daß dabei die Rolle der Schule im Rahmen der gesamten Sozialisation der Schüler überschätzt wird. Zum Ausdruck kommt darin ein anti-pluralistisches Ressentiment, der alte Hitler-Jugend-Traum von der „Einheit der Erziehung“, von der Re-Integration von Erziehung und Sozialisation. Tatsächlich jedoch ist deren Auseinandertreten ein Grundtat bestand des modernen demokratischen Lebens. Die außerschulischen Sozialisationsfaktoren wie Massenmedien, Freizeit- und Konsumsystem und Gleich altrigen-Szene sind nämlich für ein gelingendes Aufwachsen auf ihre Weise ebenso wichtig wie die Schule und können von dieser nicht einfach als eine Art von feindlichem Ausland betrachtet werden. Ihre Gefährdungen zu vermeiden und ihre Chancen zu nutzen ist zu einer wichtigen Aufgabe des Erwachsen werdens geworden. Ähnlich kritisch muß der pädagogische Allmachtsanspruch der Schule im Vergleich zu den übrigen pädagogischen Instanzen wie Familie und Jugendhilfe gesehen werden. Im Konzert der Sozialisationsfaktoren kann eine pädagogische Instanz, z.B. die Schule, nicht das ganze Orchester sein, son dern nur ein Instrument in diesem. Je präziser sich der Sozialisationsfaktor Schule in diesem Ensemble präsentiert, umso mehr trägt er zur Orientierung der Heranwachsenden bei. 2. Zu den falschen Erwartungen an die Schule gehört fast folgerichtig, daß vie le Eltern ihre eigene pädagogische Verantwortung für ihre Kinder an der Schultüre abgeben in der Annahme, die Lehrer würden es schon richten, denn schließlich würden sie ja dafür bezahlt. Unter- stützt wird diese Haltung dadurch, daß durch die Schulverfassungen die Eltern erhebliche Mitwirkungsrechte erhal ten haben, die sich – je nach Bundesland – bis in die Unterrichtspraxis etwa durch die Auswahl der Schulbücher erstrecken können. Sie und die Schülervertreter [96] sind in Zeugniskonferenzen und in fast allen anderen Schulgremien zu finden. Will z.B. in Niedersachsen ein Schulleiter mit seinem Kollegium einmal intern über die Probleme der Schüler sprechen, muß er schon eine Dienstversammlung einberufen. Dieses System funktioniert dort, wo Eltern und Lehrer in gegensei tigem Respekt für die unterschiedlichen Rollen miteinander umgehen; sonst ent steht, wie vielfach berichtet wird, Rollenkonfusion, die im Extremfalle bei den Eltern zu der Vorstellung führen kann, die Lehrer seien für sie eine Art von Erziehungs-Dienstboten. Für die schulpolitische Aufwertung der Eltern auf Kosten der Professionalität der Lehrer waren primär nicht pädagogische Gründe maßgebend. Wer sich an die schulpolitischen Auseinandersetzungen in den sieb ziger Jahren erinnert, wird feststellen, daß es in erster Linie um die politische Mobilisierung der Eltern ging: Die „Linken“ wollten sie für ihre gesellschafts-verändernden Intentionen einspannen, sie gleichsam unter Führung der Lehrer für die Vision einer besseren Gesellschaft gewinnen; die „Konservativen“ setz ten dagegen auf das politische Beharrungsvermögen der meisten Eltern. Im Kampf um die hessischen Rahmenrichtlinien tobte sich diese Konfrontation dann beispielhaft aus. Aber die Eltern einer Schule oder Schulklasse haben als solche kein politisches Mandat, und wenn sie, wie oft von Lehrern beklagt wird, nur die Karriere ihre eigenen Kinder im Blick haben, so ist dies eine vernünfti ge Grundeinstellung, die durch die politisch und nicht pädagogisch bedingte schulpolitische Aufwertung nur verunklart wird. Die Eltern vertreten ein pri vates Interesse, die Schule dagegen muß ein öffentliches Interesse geltend machen. Die Eltern dürfen z. B. nicht-pluralistisch denken und handeln und in ihren vier Wänden jeden intoleranten Unsinn verkünden, die Schule dagegen ist zum Konsens und zur Aufklärung verpflichtet; sie darf und muß auch Welterklärungen anbieten, die denen der Eltern widersprechen. Die Schule ist nicht die Fortsetzung des elterlichen Erziehungswillens mit anderen Mitteln, sondern zumindest auch ein Beitrag zur Emanzipation des Kindes aus fami liärer Borniertheit, und das Kind tritt mit dem Besuch der Schule ins öffentli che Leben ein. 3. Die Schulreform-Euphorie der letzten Jahrzehnte setzte vor allem auf die In dividualität des Schülers, auf anti-autoritäre Strukturen in der Schule, eher auf innerpsychische als auf soziale Komponenten des kindlichen Verhaltens, eher auf die unmittelbare Beziehung zwischen Lehrern und Schülern als auf institu tionelle Vorgaben. Alle diese pädagogischen Prämissen haben sich als zumindest teilweise illusorisch erwiesen – vor allem deshalb, weil sie heute auf eine Schüler generation treffen, die – anders als die der sechziger und siebziger Jahre – kaum noch autoritär drangsaliert wird, sondern in fast völlig offenen sozialen und nor mativen Horizonten aufwächst und deshalb nach maßgebender Orientierung verlangt –, wie die eingangs zitierte Beschreibung Hensels zeigt. Dazu kann die Schule ihren Beitrag nur dann leisten, wenn sie die durch ihre zwar begrenzte, aber bestimmte Aufgabe gegebenen sozialen und disziplinarischen Anforde rungen auch geltend macht und wenn sie aufhört, das bessere Fernsehen und eine „Erlebnisgesellschaft“ (Schulze) in nuce sein zu wollen. [S. 97] 4. Unsere Gesellschaft leistet sich deshalb ein 60 Milliarden Mark teures Schul wesen, weil sie ein vitales Interesse daran hat, ihren Nachwuchs so auszubilden, daß er den bereits erreichten Standard an Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertig keiten zumindest erreichen, möglichst sogar übertreffen kann, um das wirtschaft liche und das darauf basierende sozio-kulturelle Überleben zu sichern. Diesen Anspruch für nicht „kindgerecht“ zu halten, und statt dessen die Funktion der Schule aus der kindlichen Innerlichkeit abzuleiten, verrät nur Weltfremdheit, weil die Ansprüche schließlich nicht von einer beliebigen Gesellschaft ausgehen, sondern von derjenigen, in der das Kind sein aktuelles und späteres Leben ent falten muß. Dabei geht es nicht nur um die Förderung herausragender Bega bungen, sondern auch um eine höchstmögli- che Bildung für alle, – nicht nur im Sinne eines demokratischen Bürgerrechts auf Bildung, sondern auch zum Zwecke der Mobilisierung des verfügbaren „Humankapitals“. Alles Nachdenken über Schule muß also bei ihrer gesellschaftlichen Funktion ansetzen, und es darf nicht von den individuellen Bestrebungen der Schüler ausgehen. Die Welt ist nun einmal nicht „kindgerecht“, und deshalb müssen Kinder lernen, deren Kegeln auch gegen ihre aktuellen Bedürfnisse zu lernen und zu akzeptieren. Die Schule als gesellschaftliche Institution entsteht nicht aus der Fortschreibung der kind lichen Individualität und der kindlichen Bedürfnisse, sondern ist diesen entge gengesetzt, aber nicht, um sie zu unterdrücken, sondern um sie herauszufordern. Die Chance für Individualisierung, die unser Schulwesen anbietet oder jedenfalls anbieten sollte, ist Teil seiner gesellschaftlichen Punktion, ihr nicht etwa über geordnet. Individualisierung ist nämlich nur in solchen Gesellschaften funk tional, wo sie auch gebraucht wird, wie dies unter unseren pluralistischen Bedin gungen der Fall ist. 5. Aufgabe der Schule ist demnach, mit ihren besonderen Möglichkeiten – nämlich denen des Unterrichts im weitesten Sinne – jedem Kind die Chance zu geben, seine Fähigkeiten in optimalem Maße zu entfalten, damit es in einer Ge sellschaft voller Optionen eine individuell befriedigende Balance zwischen objek tiven Anforderungen und subjektiven Bestrebungen finden und darauf seine per sönliche Lebensplanung, z. B in beruflicher Hinsicht, gründen kann. Zu fördern sind also sowohl die sogenannten „guten“ wie die sogenannten „schlechten“ Schüler, aber so, daß sie einander dabei nicht behindern und etwa die letzteren das Tempo für alle bestimmen. Daraus folgt, daß das Schulwesen in irgendeiner Form gegliedert sein muß, damit jedes Kind auf seine Kosten kommen kann und damit Lerngruppen, z.B. Schulklassen, entstehen können, in denen jedes Kind einen chancengleichen Zugang zu den Leistungsanforderungen erhält. Ob dies im Rahmen eines von vornherein gegliederten Schulsystems oder im Rahmen des Gesamtschulsystems erfolgt, ist dabei zweitrangig. Aus dem Prinzip des chan cengleichen Zugangs resultiert u. a. der pädagogische Sinn des Sitzenbleibens, was der unpolitische Zeitgeist für Ausgrenzung hält. Aber was hat denn ein weniger begabtes Kind davon, wenn es durch die anderen ständig an seine Mängel erin nert wird, anstatt unter seines Begabungsgleichen die Chance einer wenigstens mittleren Erfolgserfahrung zu gewinnen? Daran gemessen muß jede Sozial-[S. 98]romantik zurückstehen, die etwa möglichst alle altersgleichen Kinder – ob begabt oder weniger begabt – in möglichst einer Klasse bzw. Lerngruppe zusammen fassen will. Das ergäbe nur dann pädagogischen Sinn, wenn in einer solchen Lern gruppe die Leistungsfähigkeiten nicht generell, sondern nur je nach Fach bzw. Leistungsanspruch unterschiedlich sind, so daß keine grundsätzliche Hierarchie unter den Schülern entstehen kann. 6. Dem Kind steht – bei allem Respekt vor seiner Persönlichkeit – nicht frei, ob es in der Schule lernen will oder nicht. Die Entwicklung seiner Fähigkeiten ist kein Luxus und kein Selbstzweck, vielmehr ist es darauf angewiesen, um einmal damit seinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Nur wenn es einen Dummen findet, der dies heute und vor allem morgen für es besorgt, – z.B. die Eltern oder Vater Staat – muß es nicht lernen. Der „faule“ Schüler muß sich also fragen las sen, auf wessen Kosten er lebt und künftig zu leben gedenkt, bzw. ob er eine andere Möglichkeit als die schulische Qualifizierung sieht, sich seinen späteren Lebensunterhalt zu verdienen. Diese Frage, die heute in pädagogischen Zusam menhängen kaum noch erörtert wird, müssen natürlich in erster Linie die Eltern stellen, und wenn sie dies nicht tun, müssen sie von den Lehrern daran erinnert werden. Nicht die Lehrer müssen ja die Schüler in Zukunft ernähren. Die hierin begründete Verantwortung der Eltern kann die Schule nicht stellver tretend übernehmen. Gewiß haben Familienkrisen wie Scheidung oder Trennung fast immer negative Rückwirkungen auf das Schulinteresse der betroffenen Kinder, und der Hinweis darauf fehlt in keiner einschlägigen schulpädagogischen Veröffentlichung. Aber solange die Schule so tut, als seien diese Folgen selbst verständlich und unvermeidlich, zwingt sie die Eltern nicht, in solchen Fällen optimal für das Leben ihrer Kinder nach der Scheidung bzw. Trennung zu han deln, wofür es ja heute eine ganze Reihe von Möglichkeiten gibt. Abgesehen da von geht es den Schülern in der Regel selbst in solchen Fällen materiell bereits so gut, daß sie nicht einsehen können, wozu sie eigentlich die Mühe des Lernens für die spätere wirtschaftliche Selbständigkeit noch auf sich nehmen sollen. Die ser Motivationsmangel ist durch keine didaktisch-methodische Inszenierung letztlich zu kompensieren. 7. Die Schule ist deshalb unentbehrlich, weil selbst die einfachsten Erwerbs möglichkeiten, die unsere Gesellschaft zur Verfügung hält, eines Mindestmaßes an systematischer geistiger Vorbildung bedürfen, um sachgerecht und sozial kal kulierbar ausgeübt werden zu können. Die kulturelle Erfindung „Unterricht“ erlaubt uns, unsere ursprüngliche Verhaftung an die Unmittelbarkeit des all täglichen Lebens zu überschreiten und „auf Vorrat“ zu lernen, nämlich für noch unbekannte spätere Verwendungssituationen. Diese Chance der Schule ist kei ner anderen Sozialisationsinstanz gegeben, und deshalb markiert sie deren ein zigartige Bedeutung im Konzert der übrigen Sozialisationsfaktoren wie Fami lie, Freizeit, Massenmedien und Jugendszene. Sie ist unter den Bedingungen der pluralistischen Sozialisation eher noch gestiegen. In der früheren Klassengesell schaft, wo die Lebensperspektiven für die meisten Menschen weitgehend festge- [S. 99]legt und die beruflichen Optionen deshalb sehr gering waren, war auch die Schul bildung weniger von Belang, da sie den durch die Eltern erlangten sozialen Status im wesentlichen reproduzierte und verfestigte. Heute hat zumindest prinzipiell jedes Kind die Chance, sich vom Status seiner Eltern zu emanzipieren und durch eine zielgerichtete Nutzung des Bildungsangebotes sich seinen eigenen beruflich-sozialen Status zu verschaffen. Zwar ist nicht zu leugnen, daß faktisch die Herkunftsfamilie immer noch in erheblichem Maße den künftigen Status ihrer Kinder beeinflußt – heute wohl weniger aus materiellen Gründen als vielmehr im Hinblick auf ein die Schule unterstützendes geistiges Klima –, aber schließ lich kann die Politik die Ursachen für die ökonomischen Statusunterschiede der Kinder nicht abschaffen; sie kann diese nur kompensieren durch ein Schulan gebot, das die Schüler in die Lage versetzt, herkunftsbedingte Benachteiligungen selbst zu korrigieren. Zweifellos ist unser Schulsystem heute dafür offen wie nie zuvor. Allerdings kann es die Anstrengung nicht eliminieren, die dem Schüler für dessen optimale Nutzung abverlangt werden muß. 8. In diesem Punkte ist die Schule auf eine falsche Weise „kindgerecht“ gewor den. Um den fernsehverwöhnten Schülern das Lernen so angenehm wie mög lich zu machen, wurde in den letzten Jahren erhebliche Phantasie in die Erfin dung solcher didaktisch-methodischer Konstruktionen gesteckt, die möglichst „Spaß“ machen sollen. Nun ist natürlich nichts dagegen zu sagen, daß es in der Schule auch lustig zugeht, aber problematisch wird ein solches Verfahren späte stens dann, wenn Schüler mit dem Hinweis, es mache ihnen eben keinen Spaß mehr, die Mitarbeit verweigern und mit dieser Begründung bei ihren Eltern auch noch Zustimmung finden. Die Aufgabe der Schule kann nicht darin bestehen, die Maximen der „Erlebnisgesellschaft“ in ihren Mauern zu reproduzieren, das kann das Fernsehen besser. Vielmehr muß sie die Idee des aufklärenden Unterrichts entgegen allen andersartigen, außerschulischen Erwartungen der Schüler und nicht zuletzt auch vieler Eltern zur Geltung bringen; nur dann vermag sie im Konzert der übrigen Sozialisationsfaktoren ihren eigentümlichen Part zu spielen. 9. Die Schule ist also eine Institution der Gesellschaft, die nicht einfach aus dem Willen der dort Versammelten resultiert, sondern deren Bestrebungen – bei aller Mitbestimmung – übergeordnet ist, weil sie eben wesentlich aus gesellschaftli chen Zwecken begründet ist. Jede Institution muß aber den Zweck, dem sie dient, auch durchsetzen können. Wenn nun Zweck der Schule Unterricht ist – alle ande ren ihr angesonnenen Zwecke werden von den übrigen Sozialisationsinstanzen mindestens ebenso gut und vor allem billiger erfüllt – dann folgt daraus, daß sie als Institution auch Sanktionen ergreifen können muß, um ihren Zweck zu sichern. Sie muß also Strafmaßnahmen gegen solche Schüler ergreifen können, die z. B. durch Disziplinlosigkeit oder gar Gewalttätigkeit die ordnungsgemäße Durchführung des Unter- richts erheblich behindern. Nun hat der unpolitische pädagogische Zeitgeist aber erreicht, daß „Schulstrafen“ fast völlig abgeschafft wurden. Keine Institution wie auch darüber hinaus keine menschliche Gemein schaft kann aber fortdauernd auf Sanktionen verzichten, ohne dabei ihre Existenz [S. 100] aufs Spiel zu setzen. Sie sollen ja nicht nur die Abweichler, die „Störer“ im Zau me halten, sondern gerade dadurch auch die anderen, nämlich die Lernwilligen schützen. Der eigentliche Skandal an vielen Schulen ist, daß eine kleine Min derheit von undisziplinierten Schülern die Mehrheit der lernwilligen terrori sieren darf und dafür dann nicht nur die besondere Aufmerksamkeit der Lehrer erhält, sondern auch noch als prototypisch für die Probleme aller Schüler bzw. Jugendlichen ausgegeben wird. Der Einwand des Zeitgeistes gegen Sanktionen lautet, daß auf diese Weise Schüler „ausgegrenzt“ würden; das ist eine Umkehrung des tatsächlichen Sach verhaltes, weil der disziplinlose oder gar gewalttätige Schüler sich zunächst ein mal selbst ausgrenzt, und die pädagogisch gebotene Reaktion kann nur sein zu helfen, diese Position wieder zu verlassen. Strafen sind interne soziale Maßnahmen, sie setzen dem Verhalten unmißver ständliche Grenzen und drohen einen zeitweisen oder dauerhaften Ausschluß aus der jeweiligen Gemeinschaft an. Nun sind die wenigen noch verbliebenen Schulstrafen mit einem geradezu lächerlichen bürokratischen Aufwand verbun den. so daß ihre Wirkung geradezu ins Gegenteil verkehrt wird. Ein cleverer Schüler kann seine Lehrer nach dieser Melodie mühelos zum Tanzen bringen – von den Eltern ganz zu schweigen, die leicht einen Anwalt in Marsch setzen kön nen, der selbst dann, wenn alles wie das Hornberger Schießen ausgeht, den Leh rer zur Produktion einer Menge beschriebenen Papiers zwingen kann. Soge nannte „pädagogische“ Strafen wie Nachsitzen oder Strafarbeiten haben ihre Wirkung längst verloren; die kann nämlich nur eintreten, wenn der Schüler sein Vergehen einsieht und solche Strafen als ein weiteres Lernangebot zu verste hen vermag, wenn er also die Definition des Normalfalles akzeptiert, daß die Schule in erster Linie zum Lernen da ist. Wenn dieser Zusammenhang von Schulstrafe und Schulzweck verloren geht, muß Orientierungslosigkeit um sich greifen. Nicht die Lehrer, sondern die Eltern sind dafür verantwortlich, daß der Schüler den Schulzweck akzeptiert und eine hinreichende Lernfähigkeit und Lernwilligkeit mitbringt. Statt Sanktionen empfiehlt der pädagogische Zeitgeist, Vereinbarungen mit den Schülern über die für alle notwendigen Regeln zu treffen. In der Tat ist diesem Verfahren schon deshalb der Vorzug zu geben, weil es die individuelle Verant wortungsfähigkeit der Schüler zu stärken vermag. Allerdings hängt der Erfolg von zwei Voraussetzungen ab: Einmal muß der Schüler auch kontraktfähig, d.h. in der Lage sein, Vereinbarungen einzuhalten oder dies zumindest bei solchen Gelegenheiten lernen zu wollen. Zum anderen muß er den grundlegenden Zweck der Schule akzeptieren, denn darüber kann in der Schulklasse nicht abgestimmt werden. Vereinbarungen können nur innerhalb des Spielraums erfolgen, den die ser Zweck begrenzt. Ohne diese Voraussetzungen bleiben sie im wesentlichen für die Katz. Mit anderen Worten: Die Institution Schule kommt nicht darum herum, den „Normalfall“ zu definieren, und der kann nur heißen, daß die Schüler grundsätzlich bereit und in der Lage sind, dem Unterricht zu folgen. „Abwei chungen“ können von daher überhaupt erst wahrgenommen und daraufhin (woraufhin sonst?) korrigiert werden. Erst wenn diese Klarstellung erfolgt ist, [S. 101] ergibt es Sinn, den davon abweichenden Schülern eine angemessene besondere Förderung zuteil werden zu lassen, nämlich im Hinblick auf ihre Integration in den „Normalfall“. Politisch gesprochen ist die Definition des Normalfalles eine Machtfrage. Wenn die Schule als Institution dieser Frage ausweicht, verwechselt sie die päd agogische mit der politischen Dimension ihrer Existenz. Klärt die Institution die Machtfrage nicht, werden dies andere tun, z.B. die „Diktatoren der letzten Bank“. Es gibt keine machtlosen sozialen Gebilde, die Frage ist immer nur, wes sen Macht sich mit welcher Legitimation Geltung verschafft. 10. Die Institution Schule muß aber nicht nur die Realisierung ihres Zweckes durchsetzen – nämlich Unterricht abzuhalten – sondern auch eine dementsprechende Ästhetik der Kommunikation. Im Rahmen ihrer pluralistischen Sozialisation müssen die Schüler lernen, sich an unterschiedlichen sozialen Orten unter schiedlich je nach den dort geltenden Regeln zu verhalten – anders in der Diskothek als in der Schule, anders im Kaufhaus als in der Kirche, in der Familie anders als unter Gleichaltrigen. An manchen dieser Orte – z.B. in der GleichaltrigenGruppe – verwenden sie einen eigentümlichen „Jugend-Jargon“ – was im übrigen nicht neu ist. Wenn die Schule nun in falsch verstandener Anbie derung diesen Jargon generell- in Ausnahmen kann dies durchaus anschaulich sein – als Unterrichtssprache zuläßt, oder Schimpfkanonaden und andere Ver balaggressionen in Gegenwart von Lehrern oder gar während des Unterrichts hinnimmt, verhält sie sich nicht etwa „kindgerecht“, sondern verwahrlosend und betrügt die Schüler um eine wichtige Sozialerfahrung. Schule ist eben Schule, keine Diskothek und kein Fußballplatz, und was als Schimpfkanonade während eines Konfliktes in der großen Pause vielleicht noch toleriert werden kann, ist während des Unterrichts fehl am Platze. Damit ist kein generelles Werturteil gegen den „Jugendjargon“ gesprochen, son dern nur auf die Notwendigkeit einer sozialen und damit auch sprachlichen Differenzierung aufmerksam gemacht. So wenig es Sinn ergäbe, von Jugend lichen die Verwendung der Unterrichtssprache in einer Diskothek zu erwarten, so abwegig ist es, umgekehrt im Unterricht eine Sprache zu verwenden, die für ganz andere soziale Zwecke gedacht ist. Diese Verwechslung geht zurück auf die 68er-Bewegung, die ihre fehlende soziale Erfahrung mit Unterschicht- bzw. Arbeiterkindern, als deren Avantgarde sie gelten wollte, durch Anbiederung an deren Sprachgebrauch zu kompensieren trachtete. Aber die sogenannte „Mittelschicht-Sprache“ ist nicht irgendeine beliebige und deshalb austausch bare, sondern diejenige, in der die offizielle gesellschaftliche Kommunikation in Politik und Beruf nun einmal stattfindet, weil sie nicht an ein subkulturelles Milieu gebunden ist. Wer diese Sprache nicht beherrscht, bleibt eben auch in die sen Kommunikationen behindert. Das, was die Schule im Unterricht an Auf klärung zu bieten hat, wird konterkariert, wenn die „Arschlöcher“ nur so durch die Luft fliegen. Wer das zuläßt, läßt seine Schüler nicht lernen, wie man sich er folgreich in der Öffentlichkeit bewegt. Hier geht es nicht um beliebige pädago gische Ideen, die man auch anders sehen könnte, sondern um elementare sozia-[S. 102]le Lernleistungen, die für ein Zusammenleben in unserer komplizierten und zudem dichtbesiedelten Gesellschaft unentbehrlich sind. Die Schüler brächten eben ihre Probleme mit in die Schule und müßten sie dort auch ausleben - heißt es oft zur Erklärung wie zur Rechtfertigung. Aber jeder Mensch schleppt seine Probleme überall mit hin, der Prozeß der Zivilisierung besteht jedoch gerade darin, daß man sie nicht an jedem sozialen Ort jedermann um die Ohren haut. Außerdem produziert die Schule oft das Problem selbst, indem sie den Schülern einen gegen Disziplinlosigkeit und Gewalt machtvoll abgesicherten Raum verweigert, in dessen Mauern vielleicht die mitgebrachte Aufregung und Labilität zur Ruhe kommen könnten. Die Schule ist in solchen Fällen Täter, nicht Opfer. Anstatt, wie der Zeitgeist nahelegt, auf die Gesinnung zu zielen – „Seid lieb zueinander!“ – wäre auf diese soziale Differenz aufmerksam zu machen. Dies nicht zu leisten und zur Not auch rigoros durchzusetzen, ist pädagogisch unent schuldbar, denn schließlich ist die Schule die erste öffentliche Institution, mit der die Kinder ausführlich und für lange Zeit zu tun haben. Welches politisch gesellschaftliche Weltbild muß sich in ihnen auftun, wenn sie diese Institution als ein permanentes Chaos erleben? Wie werden sie andere gesellschaftliche Institutionen aufgrund dieser Erfahrung verstehen, die unser Zusammenleben ordnen, z. B. Polizei, Gericht, Finanzamt, Arbeitsplatz oder Parlamente? In sol chem sozialen Chaos züchtet eine heruntergekommene pädagogische Institution die Verwahrlosung des öffentlichen Verhaltens. 11. Das Problem vieler Lehrer in vielen Schulen ist nicht, daß sie des Unterrichts müde wären, sondern daß sie gar nicht mehr dazu kommen, in Ruhe und Ge lassenheit ihren Unterricht zu erteilen, weil ihre Klassen zu sozialpädagogischen Problemgruppen geworden sind und die meiste Anstrengung darauf gerichtet werden muß, sie disziplinarisch im Zaume zu halten. Aus dieser Tatsache schlie ßen viele Pädagogen, daß die Schule sich eben sozialpädagogisieren müsse, also ihre Ziele nicht in erster Linie im Unterricht sehen dürfe. Das ist ein funda mentaler Fehlschluß, der, wie die Praxis zeigt, nichts bessert, sondern alles nur verschlimmert. Wenn sich in unseren Massenschulen tatsächlich zunehmend Kinder befinden, die weder die sozialen noch die intellektuellen Vorausset zungen haben, um bei wenigstens mittlerem guten Willen erfolgreich am Unter richt teilnehmen zu können, dann kann die Schule dies genau so wenig ändern, wie das Finanzamt für Steuergerechtigkeit sorgen kann. Dann muß vielmehr die jenige öffentliche Institution um Unterstützung gebeten werden, die dafür vor gesehen und dafür fachlich viel besser ausgestattet ist: Nämlich die Jugendhilfe. Das dafür zuständige „Kinder- und Jugendhilfegesetz“ (KJHG) wendet sich aber an die Familie, nicht an die Schule, und deshalb müssen die Eltern hier die Ini tiative ergreifen. Wenn es zutrifft, daß immer mehr Kinder in ihren Familien immer weniger die grundlegenden sozialen Selbstdisziplinierungen lernen, die für ein Auftreten in der Öffentlichkeit unentbehrlich sind, dann kann die Schule diesen Mangel nur in Grenzen, nämlich im Rahmen ihres Zweckes, korrigieren; darüber hinaus müssen dann im Rahmen der Jugendhilfe z.B. Alternativen des [S. 103] Aufwachsens unter Gleichaltrigen angeboten werden, die die Herkunftsfamilie im Unterschied zu früheren Jahrzehnten nicht mehr diskriminieren, wie es im Rahmen des neuen KJHG auch vorgesehen ist. Die Frage also, wozu die Schule eigentlich da sei, muß offensichtlich gegen den Zeitgeist neu beantwortet werden. Einer Umkehr stehen jedoch einige Schwierig keiten im Wege. Von der gegenwärtigen Krise der Schule leben sowohl die Administrationen wie die einschlägigen Lehrerverbände ganz gut; die schulpoliti schen Positionen sind festgefahren, institutionell verhärtet und werden bei entsprechenden Anlässen einfach wieder aus den Schubladen gezogen, und die jeweiligen Funktionäre sind nicht darauf angewiesen, die Probleme der betrof fenen Schüler wirklich ernst zu nehmen. Vielleicht brauchen wir eine neue Lehrergewerkschaft, die unter Verzicht auf pädagogisch-ideologische Kampf parolen nichts weiter als eine Interessenvertretung ist. Nicht minder bedeutsam ist die Tatsache, daß der übliche Generationswechsel in unseren Schulen nicht zum Zuge kommt. Das Durchschnittsalter vieler Kolle gien liegt bei 50 Jahren. Lehrer, die seit Jahrzehnten ein bestimmtes, z.B. durch die 68er-Erfahrung geprägtes pädagogisches Konzept verfolgt haben, das für den gegenwärtigen inneren Zustand der Schule wesentlich mitverantwortlich ist, kön nen nicht so einfach umdenken, ohne bei den Schülern unglaubwürdig zu wer den oder ohne ihre professionelle Identität in Frage zu stellen. Aus pädagogischer Sicht kann man den Kultusministern deshalb nur raten, ähnliche Überlegungen anzustellen, wie die eingangs erwähnten aus Baden-Württemberg; wenn es finan ziell halbwegs zu machen ist, sollten sie jeden Lehrer, der will, unter einiger maßen zumutbaren Bedingungen gehen lassen oder ihm eine andere Aufgabe geben, und dafür so viele junge Lehrer wie möglich einstellen. Nur der Gene rationswechsel kann hier auf längere Sicht etwas ändern. Denjenigen Lehrern jedoch, die noch im Amt bleiben müssen und sogar wollen, weil ihnen ihr Beruf immer noch viel bedeutet, wäre vielleicht zu raten, allen pädagogischen Maximen eine Absage zu erteilen, die mit ihrer Erfahrung nicht mehr übereinstimmen, und sich auf ihre eigentliche Aufgabe zu konzentrieren. Die weltfremden (schul)pädagogischen Konzepte werden nämlich in der Kegel nicht von denen gemacht, die sie auch ausführen müssen, sondern z.B. von Poli tikern und Professoren. So wenig wie ein Arzt sich für den Tod im allgemei nen verantwortlich fühlen kann, so wenig kann ein Lehrer alles pädagogische Elend seiner Umgebung auf seihe Schultern nehmen. Damit nützt er letztlich niemandem, schon gar nicht den Schülern. Er kann die Eltern beraten und ihnen Empfehlungen geben, aber er muß sich auch weigern, deren Kinder selbstver ständlich in seinen Unterricht zu nehmen, wenn sie nicht unterrichtsfähig sind. Erst mit einer solchen Weigerung eröffnet er die Möglichkeit, sich den Pro blemen des Kindes kompetent zuzuwenden. Nur dann, wenn die Eltern auf die se Weise in die Verantwortung genommen werden, können sie auch ihr pädago gisches Verhalten ändern. Aber das Leiden des Lehrers ist letztlich nicht individuell zu heilen. Wenn die Kollegien nicht zusammenhalten und gemeinsam eine Strategie beschließen und [S. 104] auch durchhalten, die wieder deutlich macht, daß die Schule, repräsentiert durch eben dieses Kollegium, im Unterschied zu den privaten Ambitionen der Eltern einen öffentlichen Anspruch zur Geltung zu bringen hat, wird sich nichts ändern können. Das gilt erst recht im Hinblick auf die disziplinarischen Bedingungen des Unterrichtens. Die entsprechenden Regeln, die innerhalb der Schule gelten sollen, können zwar mit den Vertretern der Eltern und Schüler erörtert werden, aber sie letztlich zu bestimmen und durchzusetzen muß in der Verantwortung des Kollegiums bleiben. Diese Distanz muß wieder zur Geltung gebracht werden, was eine entsprechende Vereinbarung mit den Eltern über gemeinsame Reaktionen bei Disziplinschwierigkeiten und anderen Problemen durchaus einschließt. Ein in wesentlichen Fragen einiges Kollegium kann mit den zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten mindestens genau so erfolgreich operieren, wie der erwähnte clevere Schüler. Erst wenn die pädagogische Basis sich derart neu formiert hat, können auch die Berufsverbände unter Druck gesetzt werden, durch Interventionen bei der Kultusbürokratie diejenigen admi nistrativen und rechtlichen Voraussetzungen wieder herzustellen, die für eine normale Schularbeit unabdingbar sind. Eigentlich müßten aus den Überlegungen über den Zweck der Schule und über ihren Ort im Gesamtzusammenhang der gegenwärtigen Sozialisation noch Schlußfolgerungen für deren lehrplantheoretische und didaktisch-methodische Konstruktion sowie über bildungspolitische Konsequenzen abgeleitet werden. Das würde hier jedoch den Rahmen sprengen. Aber selbst wenn die Beurteilung dieser Rahmenbedingungen und Vorgaben im ganzen negativ ausfallen müßte, wäre dies immer noch keine Rechtfertigung für die gegenwärtige Konfusion über Sinn und Zweck der Schule als öffentlicher Institution. * 1 2 3 4 5 6 Überarbeitete Fassung eine Funk-Vortrags, der unter gleichem Titel am 1.2.95 auf NDR 4 gesendet wurde. Zuerst in Neue Sammlung 35 (1995) 3, S. 93 - 104. Frankfurter Rundschau, 8.12.94. Pauly, Gisela: Mir langt's. Eine Lehrerin steigt aus, Hamburg 1994. Korte, Jochen: Faustrecht auf dem Schulhof, Weinheim-Basel 1993 . Hensel, Horst: Die neuen Kinder und die Erosion der alten Schule, Bönen 1993. Sprenger, Ulrich: Vier Thesen zum Thema Gesamtschule. Ein Erfahrungsbericht, in: neue deutsche schule H.14/15,1994. H. Hensel, a.a.O.,S. 16 ff.