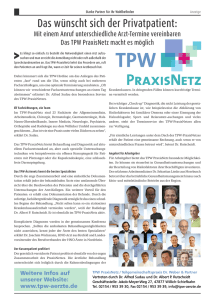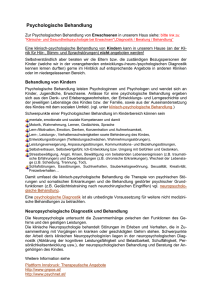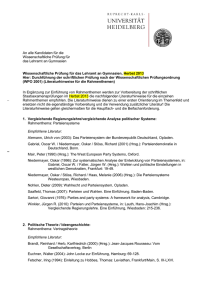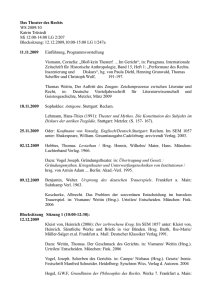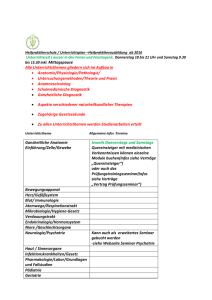Institut für Bewegungsbildung und Psychomotorik
Werbung
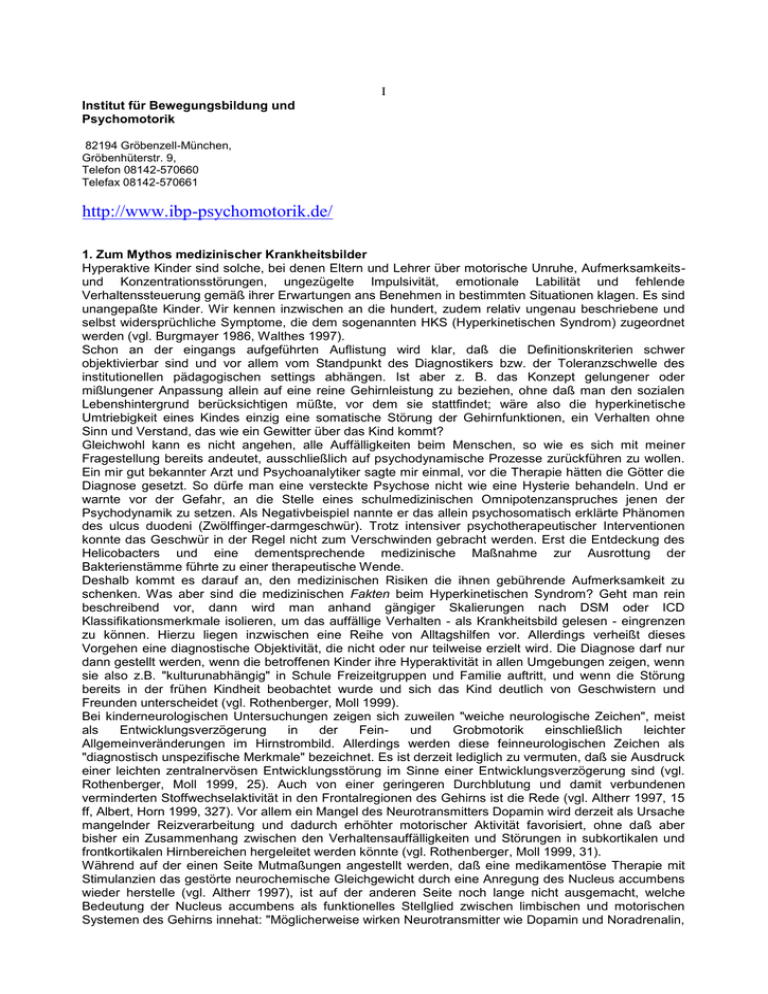
I Institut für Bewegungsbildung und Psychomotorik 82194 Gröbenzell-München, Gröbenhüterstr. 9, Telefon 08142-570660 Telefax 08142-570661 http://www.ibp-psychomotorik.de/ 1. Zum Mythos medizinischer Krankheitsbilder Hyperaktive Kinder sind solche, bei denen Eltern und Lehrer über motorische Unruhe, Aufmerksamkeitsund Konzentrationsstörungen, ungezügelte Impulsivität, emotionale Labilität und fehlende Verhaltenssteuerung gemäß ihrer Erwartungen ans Benehmen in bestimmten Situationen klagen. Es sind unangepaßte Kinder. Wir kennen inzwischen an die hundert, zudem relativ ungenau beschriebene und selbst widersprüchliche Symptome, die dem sogenannten HKS (Hyperkinetischen Syndrom) zugeordnet werden (vgl. Burgmayer 1986, Walthes 1997). Schon an der eingangs aufgeführten Auflistung wird klar, daß die Definitionskriterien schwer objektivierbar sind und vor allem vom Standpunkt des Diagnostikers bzw. der Toleranzschwelle des institutionellen pädagogischen settings abhängen. Ist aber z. B. das Konzept gelungener oder mißlungener Anpassung allein auf eine reine Gehirnleistung zu beziehen, ohne daß man den sozialen Lebenshintergrund berücksichtigen müßte, vor dem sie stattfindet; wäre also die hyperkinetische Umtriebigkeit eines Kindes einzig eine somatische Störung der Gehirnfunktionen, ein Verhalten ohne Sinn und Verstand, das wie ein Gewitter über das Kind kommt? Gleichwohl kann es nicht angehen, alle Auffälligkeiten beim Menschen, so wie es sich mit meiner Fragestellung bereits andeutet, ausschließlich auf psychodynamische Prozesse zurückführen zu wollen. Ein mir gut bekannter Arzt und Psychoanalytiker sagte mir einmal, vor die Therapie hätten die Götter die Diagnose gesetzt. So dürfe man eine versteckte Psychose nicht wie eine Hysterie behandeln. Und er warnte vor der Gefahr, an die Stelle eines schulmedizinischen Omnipotenzanspruches jenen der Psychodynamik zu setzen. Als Negativbeispiel nannte er das allein psychosomatisch erklärte Phänomen des ulcus duodeni (Zwölffinger-darmgeschwür). Trotz intensiver psychotherapeutischer Interventionen konnte das Geschwür in der Regel nicht zum Verschwinden gebracht werden. Erst die Entdeckung des Helicobacters und eine dementsprechende medizinische Maßnahme zur Ausrottung der Bakterienstämme führte zu einer therapeutische Wende. Deshalb kommt es darauf an, den medizinischen Risiken die ihnen gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. Was aber sind die medizinischen Fakten beim Hyperkinetischen Syndrom? Geht man rein beschreibend vor, dann wird man anhand gängiger Skalierungen nach DSM oder ICD Klassifikationsmerkmale isolieren, um das auffällige Verhalten - als Krankheitsbild gelesen - eingrenzen zu können. Hierzu liegen inzwischen eine Reihe von Alltagshilfen vor. Allerdings verheißt dieses Vorgehen eine diagnostische Objektivität, die nicht oder nur teilweise erzielt wird. Die Diagnose darf nur dann gestellt werden, wenn die betroffenen Kinder ihre Hyperaktivität in allen Umgebungen zeigen, wenn sie also z.B. "kulturunabhängig" in Schule Freizeitgruppen und Familie auftritt, und wenn die Störung bereits in der frühen Kindheit beobachtet wurde und sich das Kind deutlich von Geschwistern und Freunden unterscheidet (vgl. Rothenberger, Moll 1999). Bei kinderneurologischen Untersuchungen zeigen sich zuweilen "weiche neurologische Zeichen", meist als Entwicklungsverzögerung in der Feinund Grobmotorik einschließlich leichter Allgemeinveränderungen im Hirnstrombild. Allerdings werden diese feinneurologischen Zeichen als "diagnostisch unspezifische Merkmale" bezeichnet. Es ist derzeit lediglich zu vermuten, daß sie Ausdruck einer leichten zentralnervösen Entwicklungsstörung im Sinne einer Entwicklungsverzögerung sind (vgl. Rothenberger, Moll 1999, 25). Auch von einer geringeren Durchblutung und damit verbundenen verminderten Stoffwechselaktivität in den Frontalregionen des Gehirns ist die Rede (vgl. Altherr 1997, 15 ff, Albert, Horn 1999, 327). Vor allem ein Mangel des Neurotransmitters Dopamin wird derzeit als Ursache mangelnder Reizverarbeitung und dadurch erhöhter motorischer Aktivität favorisiert, ohne daß aber bisher ein Zusammenhang zwischen den Verhaltensauffälligkeiten und Störungen in subkortikalen und frontkortikalen Hirnbereichen hergeleitet werden könnte (vgl. Rothenberger, Moll 1999, 31). Während auf der einen Seite Mutmaßungen angestellt werden, daß eine medikamentöse Therapie mit Stimulanzien das gestörte neurochemische Gleichgewicht durch eine Anregung des Nucleus accumbens wieder herstelle (vgl. Altherr 1997), ist auf der anderen Seite noch lange nicht ausgemacht, welche Bedeutung der Nucleus accumbens als funktionelles Stellglied zwischen limbischen und motorischen Systemen des Gehirns innehat: "Möglicherweise wirken Neurotransmitter wie Dopamin und Noradrenalin, II für deren Systeme Aktivitätsminderungen bei HKS- Patienten gemessen (...) wurden (...) und deren Transmissionen durch eine Methylphenidat-Medikation erhöht werden, nur modulierend auf glutamerge Neuronensysteme, die selbst die eigentlich verhaltenswirksamen Faktoren i.S. eines Kompensationsmechanismus darstellen könnten" (Rothen-berger, Moll 1999, 32 f) Das heißt, es muß die Frage erlaubt sein, ob die neurobiologischen Dysfunktionen der Störung überhaupt der Ansatzort der therapeutischen Wirkungen einer medikamentösen Therapie sind. Viel eher steht zu vermuten, daß dadurch zentrale Kompensationsmechanismen zum Abbau ihres hyperaktiven Verhaltens aktiviert werden. So ließe sich erklären, warum Auffälligkeiten auf der Verhaltensebene vermindert werden, obwohl ihr neurobiologisches Substrat erhalten bleibt. Sammeln wir weiteres Material. Erkrankungsrisiken in der Lebensphase etwa kurz vor oder nach der Geburt haben nach jüngsten Ergebnissen offensichtlich keinen signifikanten Einfluß auf den Schweregrad einer Hyperaktivitätsproblematik. Auch allergische Störungen sind nicht als bedeutendes Verursachungsmoment zu ermitteln und treten erst im Zusammenwirken mit mangelnder elterlicher Erziehungskompetenz in Erscheinung. Biologische Faktoren spielen demnach im Vergleich zu psychosozialen Aspekten eine untergeordnete Rolle. Dennoch wird beharrlich ignoriert, daß die Prävalenz für einen medizinischen Befund im Sinne des klassischen hyperkinetischen Syndroms lediglich bei etwa einem oder zwei Prozent liegt (vgl. Linderkamp 1998, Steinhausen 1996, Esser u.a. 1992). Obwohl auf der einen Seite unumwunden eingestanden wird, daß wir uns diagnostisch auf schwankendem Boden bewegen, wird auf der anderen Seite der Bedingungszusammenhang dieses Erscheinungsbildes noch immer gerne oberflächlich verfremdet (vgl. Albert, Horn 1999, Grissemann 1986, Hartmann 1986, von Lüpke 1983, 1988, 1989, Mattner 1989, 1997, Passolt 1997, Steinhausen 1996, Tietze-Fritz 1997, Voß 1983, DSM-IV 1998, ICD-10 1999). Es wird selbst dann auf einer Störung der Gehirnfunktionen bestanden, wenn sich dort im Sinne harter medizinischer Fakten keine ursächlichen Beeinträchtigungen feststellen lassen, was nach neueren Untersuchungen bei 95 % aller betroffenen Kinder der Fall ist (vgl. Linderkamp 1998, Mattner 1988). Und damit finden wir eine ganze Reihe von Indizien, die für einen ausgeprägten Hang zu einer geradezu globalen Medizinierung abweichenden Verhaltens sprechen, obwohl eine saubere medizinische Diagnostik dem entgegensteht. Insgesamt ist also Vorsicht angeraten, zu vorschnellen Diagnosen zu gelangen. Immer wieder wird davon gesprochen, daß es kein gesichertes medizinisches Wissen über die Ursache dieser Störung gibt (vgl. Altherr 1997, 15, Mattner 1999, 209). "Selten taucht in der medizinischen Literatur so oft der Begriff ‘Mythos’ auf wie in diesem Zusammenhang" (von Lüpke 1983, 55). Unter testheoretischen Betrachtungen kommt Eggert zum Ergebnis, daß es sich bei diagnostischen Testverfahren, die den Prinzipien der Objektivität, Reliabilität, Validität oder Normierung entsprechen wollen, in der Regel um diagnostische Mythen handelt (vgl. 1998, 32). Was aber bewegt Pädagogen und andere Fachleute, die mit sogenannten hyperaktiven Kindern arbeiten, dazu, sich diesen Mythen eher voller Überzeugung denn kleinlaut hinzugeben? Wir können wohl bloß emotionale Entlastungswünsche für Fachleute wie Eltern als Begründung dieser Diagnosepraxis wider besseren Wissens annehmen. Zudem kommt es häufig zu einer Verwechslung von Befund und Diagnose: Das festgestellte auffällige Verhalten wird selbst für die Ursache gehalten. Auch wird meist versäumt, eine genaue Anamnese aufzunehmen: Wenn das umschriebene Verhalten erst in der Schulzeit auftritt, was häufig der Fall ist, kann man schlechterdings nicht von einer hirnorganischen Fehlsteuerung ausgehen. Wir sehen also, wie weit wir uns bei der Betrachtung des Phänomens bereits von objektiven Beurteilungsmustern entfernt haben. Unter dem Einfluß der Abwehr ihrer eigenen Hilflosigkeit werden die Fachleute dazu verführt, aus der Erfahrung der kindlichen Hyperaktivität auf medizinische, aber mehr noch pseudomedizinische Konstruktbegriffe zurückzugreifen, anstatt angemessene pädagogische Kategorien oder Methoden zu entwickeln (vgl. Krawitz 1992). Die entscheidende Frage aber lautet doch: Warum verhält sich ein Kind in dieser Weise? Denn wir sollten wissen und beherzigen: "Alles was ein Mensch tut, macht für ihn Sinn, sonst würde er es nicht tun" (Walthes 1997, 153). Bestärkt durch die von medizinischer Seite eingestandene mangelnde Präzision bei der Ursachenbestimmung muß man sich indessen fragen: Warum bleiben wir so beharrlich auf dieser Schiene? Wäre es nicht angemessener, nach der Bedeutung des auffälligen Verhaltens zu fragen? Die medizinische Betrachtungsweise orientiert sich in der Regel am positivistischen Modell objektiver Befunde. Das unzweifelhaft Beobachtbare, das zu Tage tretende abweichende Verhalten wird zum alleinigen Indikator eines bestimmten Störungs- oder Krankheitsbildes gemacht. Man beschreibt und klassifiziert anhand scheinbar einwandfrei gültiger Kategorien. Fragen nach dem Wesen hinter den Verhaltensphänomenen gelten als unzulässig. Grundlage dieser positivistischen Diagnostik ist die ‘objektive’ klinische Verhaltensbeobachtung, aus der in der Praxis in der Regel verhaltenstherapeutische Copingstrategien zwecks besseren Selbstmanagments folgen (vgl. Albert, Horn 1999, 327 ff), wobei Eisert selbstkritisch darauf hinweist, daß es keine Belege dafür gäbe, daß durch solche Interventionen eine dauerhafte Veränderung des auffälligen Verhaltens eintrete (vgl. Eisert 1999, 117). III Die Diagnosestellung beruht in den allermeisten Fällen auf dem Einsatz anerkannter, geeichter Testverfahren. Dem testtheoretische Modell, welches dieser landläufigen Praxis zugrunde liegt, wird ein Stichprobencharakter zuerkannt, der verbindliche Rückschlüsse auf die Gesamtsituation erlauben soll. Indem man die Testsituation als neutrale Untersuchungs- und Beobachtungssituation konfiguiert, glaubt man, bestimmte vorab definierte Merkmalsdimensionen einwandfrei isolieren zu können. Das Erreichen oder Nichterreichen eines Testwertes wird erhoben und in eine Maßzahl gegossen, die normierte Vergleiche zur Altersgruppe zuläßt. Die Annahme lautet nun: Diese Maßzahl im Sinne einer Merkmalsausprägung pendelt um den wahren Wert, es gibt nur kleinere Schätzfehler. Somit läßt sich prognostisch auf den weiteren Entwicklungsverlauf schließen. Nicht nur merkt man aber bei neueren Untersuchungen, daß die Variabilität viel größer als erwartet ist und die Merkmalsausprägung nicht konstant bleibt, sondern, was für Kinder völlig normal sein muß, entwicklungsbedingten Veränderungen unterliegt, nein, es spielt ein noch entscheidenderer Faktor eine große Rolle: Die Testsituation ist für das untersuchte Kind keine neutrale Situation, sondern stellt ein bestimmtes Beziehungsarrangement dar, auf die es sich auf seine Weise einläßt; das Kind gestaltet die Testsituation nicht neutral, sondern dialogisch. Deshalb kommt etwas ganz anderes dabei heraus, als angenommen. Wen das als Diagnostiker irritiert, der wird dieses Ergebnis ignorieren oder dem Kind als Abweichung von der Altersnorm anlasten. So wundert es nicht, daß an dieser Art diagnostischen Schauens in letzter Zeit massive Kritik geübt worden ist (vgl. Ahrbeck 1993, Kleinbach 1993, Eggert 1998, Kautter 1998, Seewald 1998, Eberwein 2000). Im einzelnen stechen dabei folgende Aspekte hervor: Meist heißt Diagnostik in der Praxis noch immer Statusdiagnostik, d.h. an Hand gängiger Klassifikationsmuster wird ein Kind defizit- und defektorientiert 'vermessen' (vgl. paradigmatisch zuletzt Andreae, Fischer 1999). In Abkehr von dieser problematisch gewordenen Vorgehensweise kam in den letzten Jahren verstärkt der Ruf nach förderdiagnostischen Verfahren auf, mit denen sich nicht bloß Zuschreibungen vornehmen lassen, sondern auch die Lebensrealität ergründet werden soll, um eine kindgemäße Förderung zu ermöglichen. Allerdings trägt eine pauschale Verwerfung der traditionellen Diagnostik auch nicht weiter, wenn sie in reiner "Reformsemantik" versandet (vgl. Hofmann 2000). Diagnostik besteht immer im Kategorisieren und Vergleichen, moralisch unbedenkliche Förderabsichten im Sinne einer 'guten' Diagnostik verwischen eher Grenzen als daß sie Klarheit erbrächten. Was allerdings zu leisten ist, ist die Offenlegung des theoretischen und vor allem wissenschaftstheoretischen Hintergrundes, von dem aus diagnostische Überlegungen angestellt werden. Erst dann wird deutlich werden, was der eigene Bezugsrahmen sozial erwünschten Verhaltens ist bzw. welches 'Krankheitsmodell' handlungsleitend ist. Insofern ist auf die Weiterentwicklung dieses Ansatzes im Sinne einer strukturorientierten Diagnostik zu verweisen, die theorie-, inhalts- und entwicklungsbezogene Zusammenhänge herzustellen sucht. Damit etwa verstanden werden kann, warum ein Kind in einer bestimmten Weise reagiert, muß diesbezüglich der Diagnostiker seine "neutral-distanzierte 'objektive' Position" aufgeben und seine Verwobenheit in den Dialog mit dem Kind erkennen und sinnvoll nutzen. Die handlungsleitende Frage lautet nun: Von welchen Entwicklungsbedürfnissen und Entwicklungsnotwendigkeiten ist auszugehen, welche pädagogischen Konzepte werden benötigt, um ein Entwicklungsziel zu erreichen und unter welchen Bedingungen läßt sich dies am besten bewerkstelligen (vgl. Ahrbeck 1993, 168 f)? Hier muß der ganz unterschiedliche Fokus der verschiedenen Entwicklungstheorien benannt werden, der Tatsachenforschung immer als Interpretationsforschung ausweist (vgl. Seewald 1998, 43). So verlangt Eberwein nach einer "verstehenden Diagnostik", die es dem Diagnostiker gestattet, sich mit dem Kind auf einen Dialog einzulassen, um sich in sein Erleben einzufühlen und seine Wirklichkeitskonstruktionen und Situationsdefinitionen zu erfahren. Nur so läßt sich Hyperaktivität im Sinne einer "epochaltypischen" Form von Behinderung (vgl. Kobi 1990, 242; zit n. Seewald 1998, 41) als subjektiv sinnvolle Verhaltensmöglichkeit verstehen. Schließlich erfolgt die Wahl einer bestimmten Handlungsweise "immer in einer für das handelnde Subjekt bedeutungsvollen Situation" (vgl. Kautter 1998, 83). Das Handeln liefert sozusagen einen lückenhaften Text, dessen Leerstellen interpretativ-verstehend zu füllen sind. Ohne die Fähigkeit zur Einfühlung bleibt dem Diagnostiker ein tieferes Verständnis dieses lückenhaften Textes aber verschlossen: "Wenn wir in uns selbst nicht irgendetwas finden können, das dem, was im anderen vor sich geht, gleicht, können wir ihn nicht einfühlsam verstehen" (Bettelheim 1975, 313; zit. n. Kautter 1998, 87). Im andern Fall wird übersehen, daß das Verhalten von Menschen in gesellschaftliche Verhältnisse eingebettet ist, deren Normen und Werte sie verinnerlicht haben bzw. verinnerlichen sollen. Abweichungen von diesen Normen gelten dann unreflektiert als unsozial oder als krank. Es wird nicht mehr gefragt, von wem und zu welchem Zwecke solche Normen aufgestellt werden. Ziel ist eine exakte Vorhersage und Kontrolle des Verhaltens. Sozial erwünschtes Verhalten wird als zielorientierter Prozeß gesehen, der durch eine positive Verstärkung zu erreichen ist, schlechte Angewohnheiten sollen durch Nichtbeachtung aus dem Verhaltensrepertoire getilgt werden. Das Subjekt verschwindet hinter einer konfliktbereinigten Konzentration auf ein Verhalten, das allein als cerebral gesteuert, nicht aber sinnhaften Mustern folgend angesehen wird. Dabei ist zu kritisieren, daß IV uns die Kenntnis vom Bau des Gehirns und unsere vielfältigen Spekulationen darüber, wie es funktioniere, keine auch nur einigermaßen verläßliche Meinung gebracht haben, ob und wie die Architektonik des Gehirns und die Architektonik des Seelenlebens miteinander verknüpft sind. Die Physiologie allein ist jedenfalls nicht in der Lage, aus sich heraus Wissen über seelische Strukturen und Prozesse zu schaffen. Auch die Kognitions-psychologie liefert nur "'kalte' Daten". Subjektiver Sinn und Bedeutung sind Informationsprozeßmodellen unzugänglich. Vor allem wird in diesen Vorstellungen alles Konflikthafte geleugnet, es hat sich dort kein Interesse für Affekte, Motive, Angst, Konflikt und Zensur entwickelt (vgl. Leuschner u.a. 1998). Geht man also der wissenschaftlichen Forschung zum Hyperkinetischen Syndrom auf den Grund, so lautet die Regel: Das, was sich diagnostisch als objektive Ergebnisermittlung präsentiert, ist nichts anderes als eine eigene Form der Wirklichkeitskonstruktion. Bemerkung 1 Es gilt sogar zu berücksichtigen, daß "der Effekt, den ein Neurotransmitter an der postsynaptischen Nervenzelle erzielt, nicht von der Transmittersubstanz abhängig ist, sondern von dem Rezeptor, an den sich die Substanz anlagert" (vgl. Deneke 1998, 48). Bemerkung 2 Das Denksystem des Positivismus erhebt das Positive zum Prinzip wissenschaftlichen Wissens, wobei das Wort positiv das Gegebene, Tatsächliche und unhinterfragt Vorhandene umschließt. Es entstand in Abkehr von einer Erkenntnisform, welche metaphysisch und spekulativ Erdachtes als Wissen auszugeben suchte, wurde später aber auf eine fast vollständig theorielose, um nicht zu sagen theoriefeindliche Tatsachenforschung reduziert (vgl. Schnädelbach 1989, Gerspach 2000). Die Fundamentalkritik des Positivismus an metaphysischen und spekulativen Theoriegebäuden kann und muß man teilen. Schon Freud hat gesagt, sich mit dem Irrationalen zu beschäftigen könne nicht heißen, selber irrational zu werden. Aber das Kind mit dem Bade auszuschütten und jede Form von Interpretation als spekulativ abzutun entspricht selbst einer Spekulation. Dieses Dogma verkürzt Erkenntnissuche auf reine Fliegenbeinzählerei. 1. Zum Mythos medizinischer Krankheitsbilder Hyperaktive Kinder sind solche, bei denen Eltern und Lehrer über motorische Unruhe, Aufmerksamkeitsund Konzentrationsstörungen, ungezügelte Impulsivität, emotionale Labilität und fehlende Verhaltenssteuerung gemäß ihrer Erwartungen ans Benehmen in bestimmten Situationen klagen. Es sind unangepaßte Kinder. Wir kennen inzwischen an die hundert, zudem relativ ungenau beschriebene und selbst widersprüchliche Symptome, die dem sogenannten HKS (Hyperkinetischen Syndrom) zugeordnet werden (vgl. Burgmayer 1986, Walthes 1997). Schon an der eingangs aufgeführten Auflistung wird klar, daß die Definitionskriterien schwer objektivierbar sind und vor allem vom Standpunkt des Diagnostikers bzw. der Toleranzschwelle des institutionellen pädagogischen settings abhängen. Ist aber z. B. das Konzept gelungener oder mißlungener Anpassung allein auf eine reine Gehirnleistung zu beziehen, ohne daß man den sozialen Lebenshintergrund berücksichtigen müßte, vor dem sie stattfindet; wäre also die hyperkinetische Umtriebigkeit eines Kindes einzig eine somatische Störung der Gehirnfunktionen, ein Verhalten ohne Sinn und Verstand, das wie ein Gewitter über das Kind kommt? Gleichwohl kann es nicht angehen, alle Auffälligkeiten beim Menschen, so wie es sich mit meiner Fragestellung bereits andeutet, ausschließlich auf psychodynamische Prozesse zurückführen zu wollen. Ein mir gut bekannter Arzt und Psychoanalytiker sagte mir einmal, vor die Therapie hätten die Götter die Diagnose gesetzt. So dürfe man eine versteckte Psychose nicht wie eine Hysterie behandeln. Und er warnte vor der Gefahr, an die Stelle eines schulmedizinischen Omnipotenzanspruches jenen der Psychodynamik zu setzen. Als Negativbeispiel nannte er das allein psychosomatisch erklärte Phänomen des ulcus duodeni (Zwölffinger-darmgeschwür). Trotz intensiver psychotherapeutischer Interventionen konnte das Geschwür in der Regel nicht zum Verschwinden gebracht werden. Erst die Entdeckung des Helicobacters und eine dementsprechende medizinische Maßnahme zur Ausrottung der Bakterienstämme führte zu einer therapeutische Wende. Deshalb kommt es darauf an, den medizinischen Risiken die ihnen gebührende Aufmerksamkeit zu schenken. Was aber sind die medizinischen Fakten beim Hyperkinetischen Syndrom? Geht man rein beschreibend vor, dann wird man anhand gängiger Skalierungen nach DSM oder ICD Klassifikationsmerkmale isolieren, um das auffällige Verhalten - als Krankheitsbild gelesen - eingrenzen V zu können. Hierzu liegen inzwischen eine Reihe von Alltagshilfen vor. Allerdings verheißt dieses Vorgehen eine diagnostische Objektivität, die nicht oder nur teilweise erzielt wird. Die Diagnose darf nur dann gestellt werden, wenn die betroffenen Kinder ihre Hyperaktivität in allen Umgebungen zeigen, wenn sie also z.B. "kulturunabhängig" in Schule Freizeitgruppen und Familie auftritt, und wenn die Störung bereits in der frühen Kindheit beobachtet wurde und sich das Kind deutlich von Geschwistern und Freunden unterscheidet (vgl. Rothenberger, Moll 1999). Bei kinderneurologischen Untersuchungen zeigen sich zuweilen "weiche neurologische Zeichen", meist als Entwicklungsverzögerung in der Feinund Grobmotorik einschließlich leichter Allgemeinveränderungen im Hirnstrombild. Allerdings werden diese feinneurologischen Zeichen als "diagnostisch unspezifische Merkmale" bezeichnet. Es ist derzeit lediglich zu vermuten, daß sie Ausdruck einer leichten zentralnervösen Entwicklungsstörung im Sinne einer Entwicklungsverzögerung sind (vgl. Rothenberger, Moll 1999, 25). Auch von einer geringeren Durchblutung und damit verbundenen verminderten Stoffwechselaktivität in den Frontalregionen des Gehirns ist die Rede (vgl. Altherr 1997, 15 ff, Albert, Horn 1999, 327). Vor allem ein Mangel des Neurotransmitters Dopamin wird derzeit als Ursache mangelnder Reizverarbeitung und dadurch erhöhter motorischer Aktivität favorisiert, ohne daß aber bisher ein Zusammenhang zwischen den Verhaltensauffälligkeiten und Störungen in subkortikalen und frontkortikalen Hirnbereichen hergeleitet werden könnte (vgl. Rothenberger, Moll 1999, 31). Während auf der einen Seite Mutmaßungen angestellt werden, daß eine medikamentöse Therapie mit Stimulanzien das gestörte neurochemische Gleichgewicht durch eine Anregung des Nucleus accumbens wieder herstelle (vgl. Altherr 1997), ist auf der anderen Seite noch lange nicht ausgemacht, welche Bedeutung der Nucleus accumbens als funktionelles Stellglied zwischen limbischen und motorischen Systemen des Gehirns innehat: "Möglicherweise wirken Neurotransmitter wie Dopamin und Noradrenalin, für deren Systeme Aktivitätsminderungen bei HKS-Patienten gemessen (...) wurden (...) und deren Transmissionen durch eine Methylphenidat-Medikation erhöht werden, nur modulierend auf glutamerge Neuronensysteme, die selbst die eigentlich verhaltenswirksamen Faktoren i.S. eines Kompensationsmechanismus darstellen könnten" (Rothenberger, Moll 1999, 32 f). Das heißt, es muß die Frage erlaubt sein, ob die neurobiologischen Dysfunktionen der Störung überhaupt der Ansatzort der therapeutischen Wirkungen einer medikamentösen Therapie sind. Viel eher steht zu vermuten, daß dadurch zentrale Kompensationsmechanismen zum Abbau ihres hyperaktiven Verhaltens aktiviert werden. So ließe sich erklären, warum Auffälligkeiten auf der Verhaltensebene vermindert werden, obwohl ihr neurobiologisches Substrat erhalten bleibt. Sammeln wir weiteres Material. Erkrankungsrisiken in der Lebensphase etwa kurz vor oder nach der Geburt haben nach jüngsten Ergebnissen offensichtlich keinen signifikanten Einfluß auf den Schweregrad einer Hyperaktivitätsproblematik. Auch allergische Störungen sind nicht als bedeutendes Verursachungsmoment zu ermitteln und treten erst im Zusammenwirken mit mangelnder elterlicher Erziehungskompetenz in Erscheinung. Biologische Faktoren spielen demnach im Vergleich zu psychosozialen Aspekten eine untergeordnete Rolle. Dennoch wird beharrlich ignoriert, daß die Prävalenz für einen medizinischen Befund im Sinne des klassischen hyperkinetischen Syndroms lediglich bei etwa einem oder zwei Prozent liegt (vgl. Linderkamp 1998, Steinhausen 1996, Esser u.a. 1992). Obwohl auf der einen Seite unumwunden eingestanden wird, daß wir uns diagnostisch auf schwankendem Boden bewegen, wird auf der anderen Seite der Bedingungszusammenhang dieses Erscheinungsbildes noch immer gerne oberflächlich verfremdet (vgl. Albert, Horn 1999, Grissemann 1986, Hartmann 1986, von Lüpke 1983, 1988, 1989, Mattner 1989, 1997, Passolt 1997, Steinhausen 1996, Tietze-Fritz 1997, Voß 1983, DSM-IV 1998, ICD-10 1999). Es wird selbst dann auf einer Störung der Gehirnfunktionen bestanden, wenn sich dort im Sinne harter medizinischer Fakten keine ursächlichen Beeinträchtigungen feststellen lassen, was nach neueren Untersuchungen bei 95 % aller betroffenen Kinder der Fall ist (vgl. Linderkamp 1998, Mattner 1988). Und damit finden wir eine ganze Reihe von Indizien, die für einen ausgeprägten Hang zu einer geradezu globalen Medizinierung abweichenden Verhaltens sprechen, obwohl eine saubere medizinische Diagnostik dem entgegensteht. Insgesamt ist also Vorsicht angeraten, zu vorschnellen Diagnosen zu gelangen. Immer wieder wird davon gesprochen, daß es kein gesichertes medizinisches Wissen über die Ursache dieser Störung gibt (vgl. Altherr 1997, 15, Mattner 1999, 209). "Selten taucht in der medizinischen Literatur so oft der Begriff ‘Mythos’ auf wie in diesem Zusammenhang" (von Lüpke 1983, 55). Unter testheoretischen Betrachtungen kommt Eggert zum Ergebnis, daß es sich bei diagnostischen Testverfahren, die den Prinzipien der Objektivität, Reliabilität, Validität oder Normierung entsprechen wollen, in der Regel um diagnostische Mythen handelt (vgl. 1998, 32). Was aber bewegt Pädagogen und andere Fachleute, die mit sogenannten hyperaktiven Kindern arbeiten, dazu, sich diesen Mythen eher voller Überzeugung denn kleinlaut hinzugeben? Wir können wohl bloß emotionale Entlastungswünsche für Fachleute wie Eltern als Begründung dieser Diagnosepraxis wider besseren Wissens annehmen. Zudem kommt es häufig zu einer Verwechslung von Befund und Diagnose: Das festgestellte auffällige Verhalten wird selbst für die Ursache gehalten. Auch wird meist versäumt, eine genaue Anamnese VI aufzunehmen: Wenn das umschriebene Verhalten erst in der Schulzeit auftritt, was häufig der Fall ist, kann man schlechterdings nicht von einer hirnorganischen Fehlsteuerung ausgehen. Wir sehen also, wie weit wir uns bei der Betrachtung des Phänomens bereits von objektiven Beurteilungsmustern entfernt haben. Unter dem Einfluß der Abwehr ihrer eigenen Hilflosigkeit werden die Fachleute dazu verführt, aus der Erfahrung der kindlichen Hyperaktivität auf medizinische, aber mehr noch pseudomedizinische Konstruktbegriffe zurückzugreifen, anstatt angemessene pädagogische Kategorien oder Methoden zu entwickeln (vgl. Krawitz 1992). Die entscheidende Frage aber lautet doch: Warum verhält sich ein Kind in dieser Weise? Denn wir sollten wissen und beherzigen: "Alles was ein Mensch tut, macht für ihn Sinn, sonst würde er es nicht tun" (Walthes 1997, 153). Bestärkt durch die von medizinischer Seite eingestandene mangelnde Präzision bei der Ursachenbestimmung muß man sich indessen fragen: Warum bleiben wir so beharrlich auf dieser Schiene? Wäre es nicht angemessener, nach der Bedeutung des auffälligen Verhaltens zu fragen? Die medizinische Betrachtungsweise orientiert sich in der Regel am positivistischen Modell objektiver Befunde. Das unzweifelhaft Beobachtbare, das zu Tage tretende abweichende Verhalten wird zum alleinigen Indikator eines bestimmten Störungs- oder Krankheitsbildes gemacht. Man beschreibt und klassifiziert anhand scheinbar einwandfrei gültiger Kategorien. Fragen nach dem Wesen hinter den Verhaltensphänomenen gelten als unzulässig. Grundlage dieser positivistischen Diagnostik ist die ‘objektive’ klinische Verhaltensbeobachtung, aus der in der Praxis in der Regel verhaltenstherapeutische Copingstrategien zwecks besseren Selbstmanagments folgen (vgl. Albert, Horn 1999, 327 ff), wobei Eisert selbstkritisch darauf hinweist, daß es keine Belege dafür gäbe, daß durch solche Interventionen eine dauerhafte Veränderung des auffälligen Verhaltens eintrete (vgl. Eisert 1999, 117). Die Diagnosestellung beruht in den allermeisten Fällen auf dem Einsatz anerkannter, geeichter Testverfahren. Dem testtheoretische Modell, welches dieser landläufigen Praxis zugrunde liegt, wird ein Stichprobencharakter zuerkannt, der verbindliche Rückschlüsse auf die Gesamtsituation erlauben soll. Indem man die Testsituation als neutrale Untersuchungs- und Beobachtungssituation konfiguiert, glaubt man, bestimmte vorab definierte Merkmalsdimensionen einwandfrei isolieren zu können. Das Erreichen oder Nichterreichen eines Testwertes wird erhoben und in eine Maßzahl gegossen, die normierte Vergleiche zur Altersgruppe zuläßt. Die Annahme lautet nun: Diese Maßzahl im Sinne einer Merkmalsausprägung pendelt um den wahren Wert, es gibt nur kleinere Schätzfehler. Somit läßt sich prognostisch auf den weiteren Entwicklungsverlauf schließen. Nicht nur merkt man aber bei neueren Untersuchungen, daß die Variabilität viel größer als erwartet ist und die Merkmalsausprägung nicht konstant bleibt, sondern, was für Kinder völlig normal sein muß, entwicklungsbedingten Veränderungen unterliegt, nein, es spielt ein noch entscheidenderer Faktor eine große Rolle: Die Testsituation ist für das untersuchte Kind keine neutrale Situation, sondern stellt ein bestimmtes Beziehungsarrangement dar, auf die es sich auf seine Weise einläßt; das Kind gestaltet die Testsituation nicht neutral, sondern dialogisch. Deshalb kommt etwas ganz anderes dabei heraus, als angenommen. Wen das als Diagnostiker irritiert, der wird dieses Ergebnis ignorieren oder dem Kind als Abweichung von der Altersnorm anlasten. So wundert es nicht, daß an dieser Art diagnostischen Schauens in letzter Zeit massive Kritik geübt worden ist (vgl. Ahrbeck 1993, Kleinbach 1993, Eggert 1998, Kautter 1998, Seewald 1998, Eberwein 2000). Im einzelnen stechen dabei folgende Aspekte hervor: Meist heißt Diagnostik in der Praxis noch immer Statusdiagnostik, d.h. an Hand gängiger Klassifikationsmuster wird ein Kind defizit- und defektorientiert 'vermessen' (vgl. paradigmatisch zuletzt Andreae, Fischer 1999). In Abkehr von dieser problematisch gewordenen Vorgehensweise kam in den letzten Jahren verstärkt der Ruf nach förderdiagnostischen Verfahren auf, mit denen sich nicht bloß Zuschreibungen vornehmen lassen, sondern auch die Lebensrealität ergründet werden soll, um eine kindgemäße Förderung zu ermöglichen. Allerdings trägt eine pauschale Verwerfung der traditionellen Diagnostik auch nicht weiter, wenn sie in reiner "Reformsemantik" versandet (vgl. Hofmann 2000). Diagnostik besteht immer im Kategorisieren und Vergleichen, moralisch unbedenkliche Förderabsichten im Sinne einer 'guten' Diagnostik verwischen eher Grenzen als daß sie Klarheit erbrächten. Was allerdings zu leisten ist, ist die Offenlegung des theoretischen und vor allem wissenschaftstheoretischen Hintergrundes, von dem aus diagnostische Überlegungen angestellt werden. Erst dann wird deutlich werden, was der eigene Bezugsrahmen sozial erwünschten Verhaltens ist bzw. welches 'Krankheitsmodell' handlungsleitend ist. Insofern ist auf die Weiterentwicklung dieses Ansatzes im Sinne einer strukturorientierten Diagnostik zu verweisen, die theorie-, inhalts- und entwicklungsbezogene Zusammenhänge herzustellen sucht. Damit etwa verstanden werden kann, warum ein Kind in einer bestimmten Weise reagiert, muß diesbezüglich der Diagnostiker seine "neutral-distanzierte 'objektive' Position" aufgeben und seine Verwobenheit in den Dialog mit dem Kind erkennen und sinnvoll nutzen. Die handlungsleitende Frage lautet nun: Von welchen Entwicklungsbedürfnissen und Entwicklungsnotwendigkeiten ist auszugehen, welche pädagogischen Konzepte werden benötigt, um ein Entwicklungsziel zu erreichen und unter welchen Bedingungen läßt sich dies am besten bewerkstelligen (vgl. Ahrbeck 1993, 168 f)? Hier muß der ganz unterschiedliche Fokus der verschiedenen Entwicklungstheorien benannt werden, der Tatsachenforschung immer als VII Interpretationsforschung ausweist (vgl. Seewald 1998, 43). So verlangt Eberwein nach einer "verstehenden Diagnostik", die es dem Diagnostiker gestattet, sich mit dem Kind auf einen Dialog einzulassen, um sich in sein Erleben einzufühlen und seine Wirklichkeitskonstruktionen und Situationsdefinitionen zu erfahren. Nur so läßt sich Hyperaktivität im Sinne einer "epochaltypischen" Form von Behinderung (vgl. Kobi 1990, 242; zit n. Seewald 1998, 41) als subjektiv sinnvolle Verhaltensmöglichkeit verstehen. Schließlich erfolgt die Wahl einer bestimmten Handlungsweise "immer in einer für das handelnde Subjekt bedeutungsvollen Situation" (vgl. Kautter 1998, 83). Das Handeln liefert sozusagen einen lückenhaften Text, dessen Leerstellen interpretativ-verstehend zu füllen sind. Ohne die Fähigkeit zur Einfühlung bleibt dem Diagnostiker ein tieferes Verständnis dieses lückenhaften Textes aber verschlossen: "Wenn wir in uns selbst nicht irgendetwas finden können, das dem, was im anderen vor sich geht, gleicht, können wir ihn nicht einfühlsam verstehen" (Bettelheim 1975, 313; zit. n. Kautter 1998, 87). Im andern Fall wird übersehen, daß das Verhalten von Menschen in gesellschaftliche Verhältnisse eingebettet ist, deren Normen und Werte sie verinnerlicht haben bzw. verinnerlichen sollen. Abweichungen von diesen Normen gelten dann unreflektiert als unsozial oder als krank. Es wird nicht mehr gefragt, von wem und zu welchem Zwecke solche Normen aufgestellt werden. Ziel ist eine exakte Vorhersage und Kontrolle des Verhaltens. Sozial erwünschtes Verhalten wird als zielorientierter Prozeß gesehen, der durch eine positive Verstärkung zu erreichen ist, schlechte Angewohnheiten sollen durch Nichtbeachtung aus dem Verhaltensrepertoire getilgt werden. Das Subjekt verschwindet hinter einer konfliktbereinigten Konzentration auf ein Verhalten, das allein als cerebral gesteuert, nicht aber sinnhaften Mustern folgend angesehen wird. Dabei ist zu kritisieren, daß uns die Kenntnis vom Bau des Gehirns und unsere vielfältigen Spekulationen darüber, wie es funktioniere, keine auch nur einigermaßen verläßliche Meinung gebracht haben, ob und wie die Architektonik des Gehirns und die Architektonik des Seelenlebens miteinander verknüpft sind. Die Physiologie allein ist jedenfalls nicht in der Lage, aus sich heraus Wissen über seelische Strukturen und Prozesse zu schaffen. Auch die Kognitions-psychologie liefert nur "'kalte' Daten". Subjektiver Sinn und Bedeutung sind Informationsprozeßmodellen unzugänglich. Vor allem wird in diesen Vorstellungen alles Konflikthafte geleugnet, es hat sich dort kein Interesse für Affekte, Motive, Angst, Konflikt und Zensur entwickelt (vgl. Leuschner u.a. 1998). Geht man also der wissenschaftlichen Forschung zum Hyperkinetischen Syndrom auf den Grund, so lautet die Regel: Das, was sich diagnostisch als objektive Ergebnisermittlung präsentiert, ist nichts anderes als eine eigene Form der Wirklichkeitskonstruktion. 2. Die Beweggründe der Diagnostiker, zu objektiven Ergebnissen zu greifen Man erklärt das Phänomen motorischer Ruhelosigkeit deshalb gerne zur Krankheit, weil sich damit alle Beteiligten - das Kind, die Eltern, die Pädagogen - von ihrer Verantwortung für die Entstehung antisozialer Verhaltensweisen entlastet sehen: Wer krank ist, der ist für sein Tun nicht zur Rechenschaft zu ziehen, sondern muß medikamentös behandelt werden. Weder Eltern noch Lehrer sind dann als Erziehende in der Verantwortung. Insbesondere die neue These vom Neurotransmittermangel wird ungeprüft als generelle Verursachungshypothese für eine Million deutscher Kinder hergenommen, weil damit alle Verantwortung und jedes Schuldgefühl von den Erwachsenen genommen ist (vgl. von Thadden 2000). Ich möchte hier übrigens nicht die pharmakologische Wirkung von Methylphenidaten wie Ritalin verleugnen. Allerdings ist wie oben gesehen, der Wirkmechanismus offensichtlich komplexer und folgt nicht dem bisher angenommenen einfachen Stimulus-response-Muster. Selbstredend führt die biochemisch hergestellte Beruhigung eines Kindes zu einer allgemeinen Entspannung auf der Interaktions-ebene mit seinen Bezugspersonen. Worüber im übrigen nicht nachgedacht wird ist die Tatsache, daß eine mögliche biologische Ursache in der Tat Auswirkungen auf das Selbst- und Affekterleben des Betroffenen hat. Und genau an jenem Punkt muß man sich doch fragen, was auf einer symbolischen Ebene in der innerseelischen Eigenwahrnehmung geschieht, wenn ein Mittel verabreicht wird. Diese Frage muß auch und gerade gestellt werden, wenn eine organische Mangelsituation vorliegt was aber offenbar eher die Ausnahme denn die Regel ist. Einem möglichen Mangel an Transmittersubstanz in den Synapsenbläschen, der für die hyperaktive Reaktion verantwortlich gemacht wird, kann eigentlich kein Wert 'an sich' zukommen. Vielmehr führt dies zu einer verfälschten Sicht auf die Wirklichkeit: Es kommt beim Kind zur Wahrnehmung einer subjektiv bedeutenden Gefahr, was schließlich zur Ausbildung eines situationsabgelösten chronischen Reaktionsmusters führt: Der eigentliche bzw. vermeintliche Anlaß verschwindet aus dem Fokus der Betrachtung. Erklärtes Ziel ist also die medikamentöse Dämpfung des impulsiven Antriebsverhaltens. Es gilt aber zu erkennen, daß ein vom Arzt bzw. den Eltern verabreichtes Pharmakon wie ein vom Kind "dringend benötigtes gutes inneres Objekt oder als ein Übergangsobjekt im Sinne Winnicotts" wirken kann (vgl. VIII Rauchfleisch 1999, 113). Das bedeutet, daß sich das Kind in seiner Phantasie womöglich mit dem verabreichten Mittel ein sein Gleichgewicht stabilisierendes, beruhigendes Introjekt einverleibt. Damit würde auch plausibel, warum paradoxerweise ein stimulierendes Methylphenidat wie Ritalin ein hyperaktives Kind zur Ruhe bringt: Das Ritalin füllt die Leere, die das fehlende Selbst-Objekt hinterlassen hat. Mit solchen Überlegungen kehren wir zurück auf die Ebene psychodynamischer Beziehungsprozesse. Auf jeden Fall ist der Kontext der Interaktionserfahrungen mit den Beziehungspartnern in den Blick zu nehmen, um hier mögliche Wechselwirkungen und Verstärkungen zu erkennen. Man darf auch nicht übersehen, daß die medizinische Diagnosestellung und die Interessen der Pharmaindustrie eng miteinander zusammenhängen, schließlich geht es um riesige Absatzmärkte. Damit finden wir ein weiteres Motiv, auf rein organmedizinische Diagnosen zu setzen. Für meine Frage ist aber ein anderer Aspekt viel wichtiger: Das Phänomen des hyperkinetischen Verhaltens löst bei uns eine irritierende Beängstigung aus. Hier geschieht etwas im pädagogischen, vor allem schulischen Alltag, das nicht sein darf. Diese Beunruhigung verlangt nach affektiver Abfuhr. Folglich sucht man nach Gründen, die von außen einwirken und dieses unsinnige Verhalten hervorrufen, ohne daß das Kind etwas dafür kann. Es ist gleichgültig, ob da ein schlechtes Milieu, unangemessene familiäre Erziehungsstile, ein zu hoher Fernsehkonsum oder eine hirnorganische Verschaltungsstörung genannt werden. Vor allem um eines geht es: Das eigene Nicht-Verstehen des hyperaktiven Verhaltens soll durch "irgendwelche Erklärungen" gemildert werden (vgl. Reiser 1993). Ich möchte das an einem ähnlichen Thema erläutern. Mir wurde ein Fall zugetragen, wo ein Kind mit vermindertem Muskeltonus von seiner Frühförderin einer Physiotherapautin zwecks Krankengymnastik vorgestellt wurde. Diese reagierte entsetzt, als sie bemerkte, daß das Kind offensichtlich geistig behindert war. Sie empörte sich darüber, daß man ihr das nicht vorher gesagt hatte, und vor allem: wer sollte es der Mutter sagen. Im Grunde genommen stellt sich die banale Frage, was diese zusätzliche Information an der Art der therapeutischen Intervention geändert hätte. Für die Therapeutin war es aber ein Fakt, daß die geistige Behinderung als schwerwiegende Beeinträchtigung alles andere in der Hintergrund drängte. Sie war beunruhigt und wollte diesen Affekt so schnell wie möglich wieder los werden, indem sie dem 'Ding' einen Namen verlieh. Damit war es eingegrenzt und konnte leichter unschädlich gemacht werden. Außerdem machte sie der Frühförderin Vorwürfe und wollte das Thema der Mutter zurückgeben. Die Diagnose 'geistige Behinderung' wirkte auf die Therapeutin wie ein vergiftetes Introjekt, das sie schleunigst ausspucken mußte. Man kann sich lebhaft vorstellen, wie dann einer Mutter zumute ist, die selber mit diesem Stigma zu kämpfen hat, wenn sie von seiten der Diagnostiker oder Therapeuten schonungslos konfrontiert werden, und zwar nicht, um ihnen einen besseren Umgang damit zu ermöglichen, sondern um sich selbst von der unbewußten Gefahr zu entlasten, die hinter der Diagnose und den eigenen Phantasien dazu lauert. Das gleiche Phänomen begegnet uns bei den hyperaktiven Kindern. Vielfach wird man auf sie nur aufmerksam, "weil sich irgendwelche Erwachsene durch deren Symptome (die praktisch immer durch andere Erwachsene hervorgerufen wurden) gestört fühlen. Auf ein gefügiges, dissoziatives, niedergeschlagenes kleines Mädchen werden psychologische Beratungsstellen im allgemeinen nicht aufmerksam gemacht, auf den aggressiven, verbal ausfälligen und verhaltensimpulsiven, übererregten Bruder" aber durchaus, obwohl beide demselben Problemhintergrund entstammen (vgl. Perry u.a. 1998, 295). Vieles spricht dafür, daß das subjektive Erleben der eigenen Lebenswelt für das Kind genügend, wenngleich oftmals versteckte Motive bietet, nach motorischer Abfuhr zu suchen, sprich: hyperaktiv zu reagieren. Wenn wir dies tun, sehen wir uns aber unentrinnbar auf den Beziehungsrahmen einer individuellen Auffälligkeit zurückgeworfen. Womöglich entdecken wir auf diesem Wege eine konflikthafte oder emotional unzureichende Lebenssituation. Bleiben wir der Ebene der Hirnfunktionsstörung verhaftet, haben wir es allerdings einfacher: Wir können alle aufkommenden Affekte und Phantasien verleugnen und so unser eigenes emotionales Mitschwingen, das uns selbst in Unruhe versetzt, effektvoll verhindern. In den allermeisten Fällen handelt es sich nicht um medizinische Krankheitsbilder, sondern um "'ins Stocken geratene Prozesse', Notsituationen" (Bundschuh 1985, 96). Die sichtbare Ebene beobachtbaren Verhaltens greift zu kurz, es gilt eine zweite Ebene einzuziehen und sich den inneren Bildern zuzuwenden, die dieses Verhalten determinieren. Wie erfährt sich ein hyperaktives Kind im Zusammenhang seiner innerfamiliären Beziehungen? Welche Querverbindungen gibt es zwischen diesen Erfahrungen und seinem gezeigten Verhalten? Wenn man als Diagnostiker oder als Praktiker verstehen möchte, warum sich ein Kind in einer bestimmten Weise verhält, dann gilt es vor allem, die hinter seinem manifesten Verhalten latent verborgenen Sinnzusammenhänge zu entschlüsseln, die es unbewußt kommuniziert. Ahrbeck verweist in diesem Zusammenhang auf Lorenzers Konzept vom szenischen Verstehen, das er als diagnostischen Ansatz empfiehlt. Es handelt sich dabei um eine psychoanalytisch orientierte Wahrnehmungshaltung, die IX uns sensibilisieren möchte für das, was ein Kind von seinen inneren Schwierigkeiten und Nöten und Konflikten in reale Handlungen transformiert, d.h. in Szene setzt. Das Kind äußert sich über sein inneres Erleben, indem es unbewußt in seinem Verhältnis z.B. zu seinen Mitschülern und Lehrern etwas inszeniert und diese damit in seinen Bann zieht. Seine innere Problematik und seine unbewältigten Lebensthemen zeigen sich in der Art und Weise, wie es seine Beziehungen zu und mit anderen Menschen arrangiert. Das von uns Gesehene, Erfahrene, ja auch Erlittene darf uns demnach nicht vorschnell zu kognitiv-kategorisierenden Urteilsbildungen verleiten. "Vielmehr gilt es, sich zunächst von Eindrücken, Gefühlen, Phantasien leiten zu lassen, die sich notgedrungen aus den Interaktionen mit dem jeweiligen Kind ergeben" (Ahrbeck 1993, 177). Indem ein solches Kind unter dem Eindruck des Wiederholungszwanges seine innerseelischen Konflikte nach außen projiziert bzw. externalisiert, stellt es ein bestimmtes Übertragungs- und Gegenübertragungsszenario her. Ich möchte dies kurz erläutern (vgl. Gerspach 1998, 140 ff). Der Mensch, besonders der gestörte, neigt dazu, in aktuellen Beziehungszusammenhängen unbewußt bestimmte Regungen wiederaufleben zu lassen. Dies geschieht aber eher auf der Ebene agierten Handelns als daß es in Form einer Erinnerung bewußt kommuniziert würde (vgl. Racker 1993, 59). Sind die Reminiszenzen aus der frühen Kindheit allzu stark mit affektiven Belastungen beladen, dann machen sie blind gegenüber gegenwärtigen Erfahrungen. Verzerren und blockieren also die früheren Beziehungsarrangements mit den primären Objekten die aktuelle Wahrnehmung und Erfahrungsverarbeitung, so sprechen wir seit Freud von Übertragung. "In der Übertragungsreaktion wird also das Objekt subjektiv so erlebt, als ob es sich beispielsweise um die Mutter, den Vater oder ein Geschwister handelte" (vgl. Trescher 1985, 77 ff). Die Übertragung beinhaltet die unangemessene Verschiebung einer vergangenen Beziehung in die Gegenwart. Die Übertragungsbeziehung belebt die Beziehung zu einem frühen Objekt wieder, die mittels eines Stellvertreters aktualisiert wird. In der Beziehung zum Pädagogen oder Therapeuten kommt es zu einer Reproduktion der leidvollen Erfahrung, die nun in einer dramatischen Neuinszenierung an deren Person gebunden wird. Hier erscheint es sehr wesentlich zu erkennen, daß man nur als Stellvertreter fungiert und alle zugefügten Kränkungen nicht wirklich der eigenen Person gelten. Im anderen Falle wird man sich leicht zu rächen wissen, und sei es durch ein vernichtendes diagnostisches Urteil. Jede Übertragung löst ihrerseits eine Gegenübertragung aus, denn alles, was im Klienten vorgeht - alle Regungen, Empfindungen und Befürchtungen - und in die Beziehung zum Erwachsenen einfließt, löst bei diesem verschiedene Impulse aus. Diese Gefühle und Phantasien, die in uns ausgelöst werden, sollen nun nicht als störend eliminiert werden, sondern sie können zum tieferen Verständnis unseres Gegenübers beitragen, schließlich beruhen sie auf einer Identifizierung mit ihm und seiner unbewältigten Geschichte. Nun gibt es hier zwei mögliche Formen der Gegenübertragung. Im Falle einer "konkordanten Identifizierung" überwiegt die Identifikation mit den Selbstanteilen. Sie basiert auf der Resonanz, daß das zum anderen gehörige Fremde zu einem zu uns gehörenden Eigenen wird (vgl. Racker 1993, 159). Mittels Verstehen und Einfühlung bilden wir das Fremdpsychische im eigenen Erleben nach (vgl. Trescher 1985, 125). Es kommt sozusagen zu einem Rollentausch. Hochaggressive Kinder versetzen, wenn sie andere schlagen, den Pädagogen in einen Zustand ohnmächtiger Wut, weil sie scheinbar nicht zu bändigen sind. Sie zwingen ihn, indem es zu einer konkordanten Identifizierung kommt, ihre eigenen Selbstanteile der ursprünglichen traumatischen Situation, einschließlich der Abwehrvorgänge, und damit das "schmerzliche Erleben des Traumas stellvertretend" zu übernehmen (vgl. Trescher 1993, 176 ff). Im Fall einer "komplementären Identifizierung" überwiegt die Identifikation mit den Objektanteilen. In dem Maße, wie die konkordante Identifizierung scheitert, verstärken sich die komplementären Identifizierungen mit den frühen Objekten (vgl. Racker 1993, 159). Wenn der Pädagoge etwa seine eigene Aggressivität abwehrt, wird er auch die seines Klienten ablehnen und sich unbewußt mit jenem Objekt identifizieren, das bereits früher dessen kindlichen aggressiven Impulse unterdrückte. Dieser Vorgang einer komplementären Identifizierung ist wohl jedem Pädagogen bestens vertraut. Wird er z.B. als strafender Vater phantasiert und auch so behandelt, wird er sich, nicht zuletzt unter dem Druck seines engen Handlungsfeldes, nur allzu leicht zur Übernahme dieser Rolle drängen lassen und der Versuchung nachgeben, diesem Kind stark restriktiv zu begegnen. Wird ihm die unbewußte Dynamik nicht bewußt, die in der "Übertragungsidentifizierung" begründet liegt, dann wird er sich entweder erschrocken zurückziehen oder diesen Impuls pädagogisch - im Sinne des: strenger ‘anfassen’ - durchsetzen (vgl. Trescher 1993, 175 f). Gerade motorisch unruhige Kinder entwickeln raffinierte und ihr Gegenüber anstrengende Mechanismen, um sich ihrer nicht verarbeiteten Erfahrungen zu entledigen. Der Pädagoge muß sie aushalten lernen, um aus Selbstschutz und einem uneingestandenen Wunsch nach Abgrenzung nicht selber ins Agieren zu geraten. Wie leicht wird zu einer "Gegenaktion" verführt, der er dann im Sinne eines unbewußten Abwehrmechanismus auch noch einen pädagogischen Wert verleihen möchte (vgl. Trescher 1985, 140, Finger-Trescher 1991, 59, Bion 1992). X So spricht Leber davon, daß es auf seiten des Pädagogen eine Reihe von inneren Widerständen gibt, die ihm die gefühlsmäßige Offenheit gegenüber seinen Klienten erschweren (vgl. 1985, 160). Dabei weist er auf Bernfelds Erkenntnis hin, daß der Erzieher immer vor zwei Kindern steht: "dem zu erziehenden vor ihm und dem verdrängten in ihm. Er kann gar nicht anders, als jenes zu behandeln wie er dieses erlebte" (vgl. Bernfeld 1973, 141). Leidvolle Erfahrungen wie beängstigende Phantasien, die assoziativ an das verdrängte Kind in ihm selbst erinnern, werden in der Begegnung mit seinen Klienten aktualisiert, und gerade die Konfrontation mit hyperaktiven Kindern kann nun bei ihm eine nachhaltige Empathiesperre bewirken, die ihn rigide reagieren läßt und damit die Gefahr einer erneuten Traumatisierung für das betroffene Kind heraufbeschwört. Das Zusammentreffen mit hyperaktiven Kindern kann mehr oder weniger heftige Abwehr- und insbesondere Projektionsmechanismen auslösen, und das auch und gerade in der diagnostischen Situation. Verstehen ist auf diese Weise nur schwer möglich. Diesem Problem ist nur durch eine gründliche Reflexion der eigenen affektiven Verstrickung, etwa mit Hilfe von Supervision, vorzubeugen. Wenn wir auf diese Weise vorgehen, gibt uns ein solches Kind mit der szenischen Herstellung seines psychodynamischen Beziehungshintergrundes eine gute Möglichkeit an die Hand, die zentralen, aber entstellten Motive, die seinem hyperaktiven Verhalten zugrunde liegen, zu durchschauen und etwas Wichtiges von seinem Erleben wahrzunehmen. Der Maßstab für die Störung liegt also eher im Kind und seinem Selbsterleben im sozialen Umfeld begründet als in cerebralen Fehlschaltungen. Dieser Zusammenhang von affektivem Klima und individueller Entwicklung bzw. Entwicklungshemmung findet leider nicht die ihm gebührende Beachtung. Hyperkinese entsteht, wenn das Affektleben nicht im Lot ist (vgl. Gerspach 2000). Affekte - als "emotioneller Nachklang einer im allgemeinen eindrucksvollen Erfahrung" (vgl. Laplanche, Pontalis 1972, 37) - bieten schon dem ganz jungen Kinde die erste sinnliche Möglichkeit, um seine subjektive Innenwelt, d.h. die psychische Realität, zu erkunden. Von Anfang an sind Affekte die Basis der Beziehungen zu den Beziehungspartnern (vgl. Moré 1998). Ein gesundes Selbstgewahrsein beginnt bei den körperlichen Selbstbewegungen (vgl. Mattner 1989, 1997). Vor allem muß das Kind die ausreichende Erfahrung machen können, von der Mutter beruhigt zu werden, um seine Selbstbewegungen koordiniert zu entwickeln. Wenn die Mutter mit Sensibilität die Empfindungen ihres Kindes erspürt und sie ihm spiegeln kann, kommt es in der Regel zu befriedigenden Einigungssituationen, wo keiner der beiden Beziehungspartner den anderen dominiert. Dies ist die Grundlage einer in ruhigen Bahnen verlaufenden Entwicklung. Das Ineinander der ersten sensorischen Selbst- und Fremdwahrnehmungen spielt unseres Erachtens eine nicht zu unterschätzende Rolle für die Integration von Erleben und motorischen Handlungen. Kommt es hier frühzeitig zu Störungen des Gleichgewichts, hat dies oft massive Auswirkungen auf den kindlichen Entwicklungsprozeß. Die ungenügende affektive Übereinstimmung wird als elementarer Mangel erlebt und durch erhöhte Bewegungen zu kompensieren gesucht. Man muß sich bewegen, um sich noch spüren zu dürfen. Vielfach bleibt eine Fixierung auf diese einzig möglich erscheinende Reaktion zurück. Ohne uns der Bedeutung der frühen Beziehungserfahrungen zuzuwenden, können wir den tieferen Sinn der Hyperkinese nicht verstehen. Der Schlüssel zur Hyperaktivität im Sinne erhöhter Selbst-Bewegungen liegt im verletzlichen Selbst-Erleben (vgl. Moré 1998, 237). So gesehen stellt Hyperaktivität kein Defizit dar, sondern entspringt einer affektiv eingefärbten Wahrnehmung von Wirklichkeit: Das betroffene Kind wehrt sich mit seinen motorischen Aktivitäten gegen eine vermeintliche wahrgenommene Bedrohung seines inneren Gleichgewichts. Bereits bei ganz kleinen Kindern läßt sich beobachten, daß sie aktiv werden, wenn sie sich unwohl fühlen. Sie haben noch keine klare Vorstellung von sich und ihrer Umwelt, kennen nicht ihre Grenzen, aber spüren sehr genau die Insuffizienz. Sie reagieren wie automatisch mit erhöhter Aktivität, ohne allerdings bereits Anlaß und Ausmaß der Gefahr erkennen und einschätzen zu können. Sie spüren die Bedrohung, ohne bereits kognitive Kompetenzen zu besitzen, die Bedeutung der Gefahr zu erfassen, noch können sie im Sinne von Erfahrungslernen in einer neuerlichen Gefahrensituation auf bewußte Erinnerungen zurückgreifen, wie sie früher damit fertig wurden. Die Bedrohung ist existentiell und allumfassend. Wird einem Kind die nötige frühe Spiegelerfahrung nicht ausreichend gewährt, bleibt es auf sich selbst zurückgeworfen. Seine gesamte Entwicklung von Autonomie und Initiative muß darunter leiden (vgl. Erikson 1971, 246 ff; Fischer 1997). Neben die Gefahr einer unzureichenden Spiegelung kann aber auch jene treten, die von unbewußt feindseligen Regungen von seiten der primären Bezugsperson getragen ist. Die gemeinsame geteilte Erfahrung emotionaler Übereinstimmung bleibt dem Kind verschlossen. Die ihm von der Mutter gespiegelten Affekte werden vom Kind als so gefährlich erlebt, daß es sie wieder loswerden möchte: Folglich reagiert es mit motorischer Abfuhr und erhöhter Aggression. Langfristig können diese Reaktionsweisen einen organisierenden Einfluß auf den Aufbau seiner Persönlichkeit erlangen: Der hyperkinetische 'Charakter' entsteht (vgl. Fonagy 1998, 365 f, Moré 1998, 240, Fonagy u.a. 1998, 125). XI Gerade die Körpermotorik ist in diesem Lebensabschnitt ein unbestechlicher Zeuge dafür, welche Gefühle das Kind bewegt. Die Körpermotorik offenbart den Zustand seiner inneren Ausgeglichenheit oder Unausgeglichenheit (vgl. Dornes 1993, 26). Sehr deutlich sehen wir hier den Zusammenhang zwischen Beziehungserfahrung, innerer Befindlichkeit und motorischem Ausdruck. Die elterlichen Phatnasien über ihr Kind und die aus diesen Phantasien gespeisten Beziehungsangebote haben einen entscheidenden Einfluß auf das kindliche Selbst-Erleben. Leider vernachlässigen Forschung und Praxis diesen Faktor nur allzu gerne: Das hyperkinetische Verhalten wird kontext- und das heißt in erster Linie: konfliktbereinigt zum alleinigen Problem des Kindes erklärt. Ohne uns der Frage der Beziehungsdynamik zwischen Eltern und Kind zu öffnen, werden wir aber keinen Schlüssel zum Verständnis des Problems finden. So können wir auch nicht auf das Umfeld des Kindes Einfluß nehmen. Sein ungelöstes Beziehungsproblem bleibt ihm erhalten, und also kann es auf sein Symptom nicht verzichten. Es sei denn, wir kommen dem medikamentös oder über Verhaltenstraining bei. Für die gedeihliche Entwicklung eines Kindes ist es vor allem wichtig, daß die Elternfiguren mit Einfühlung auf seine inneren Zustände 'einsteigen'. Es muß sich verstanden fühlen. Dieses Einsteigen wird weitgehend von den Phantasien, Hoffnungen und Ängsten geleitet, die Eltern, und zwar mehr unbewußt als bewußt, ihrem Kind entgegenbringen. Je nachdem, welche elterliche Phantasie vorherrschend ist, wird dem Kind eine diskrete Botschaft übermittelt. In ihren Reaktionen teilen die Eltern dem Kind die eigenen Phantasien mit. Das Kind ist eine "'Idee' seiner Eltern", aufgehoben in ihrem Wissen, welches mit der affektiven Beziehung in das Kind übergeht - als erste Gewißheit von sich als einem "Selbst in Beziehung mit anderen" (vgl. Moré 1998, 244). Intentionen und Absichten einer Mutter sind oft von Phantasien und Ängsten geleitet, die u.a. in der Dynamik mit ihrem Partner wurzeln (vgl. Paulsen 1992, 55 ff). Insbesondere, wenn sich die Mutter emotional belastet sieht, wenn sie zum Beispiel fürchtet, nicht genug für die Entwicklung ihres Kindes zu tun, kann es zu sogenannten Regulationsstörungen bei den gemeinsamen Handlungsabläufen kommen. Ein solches Kind bleibt auf sich selbst zurückgeworfen. Es weiß nichts anderes als mit verstärkter - und zwar destruktiver - Aktivität zu reagieren. Hintergrund ist die Erfahrung, daß ein befriedigender Dialog mit der Mutter immer wieder scheitert: Aus dem Dialog wird ein tonischer Monolog (vgl. Mattner 1989, 96). Das emotional allein gelassene Kind versucht seiner inneren Unruhe durch erhöhte Aktivität Herr zu werden. Wenn sich das Kind von seiner Mutter nicht empathisch gehalten fühlt, mißlingt ihm eine stabile Trennung von ihr. So lernt es auch nicht, Gefahrsituationen eigenständig und angemessen zu bewältigen. Im bleibt die Einschätzung verwehrt, den Einsatz seiner körperlichen und psychischen Energie situationsentsprechend zu dosieren. Die fehlende Erfahrung eines einfühlsamen Objekts bewirkt, daß das Wechselspiel von Bindung und Loslösung scheitert (vgl. Stern 1979, 1998, Paulsen 1992). Die Welt erscheint bedrohlich, und bald wird jede Begegnung mit anderen Menschen als gefährlich phantasiert. Die Vorstellung von den Objekten ist von Mißtrauen, Wut und Angst geprägt, die vom eigenen Selbst von Wertlosigkeit, Ohnmacht und der Überzeugung, auf die Objekte keinen Einfluß zu haben. Folglich können kein kompetenten Handlungsschemata aufgebaut werden. Zurück bleiben Hyperaktivität und Aggressivität als vorherrschendes Moment des Verhaltensrepertoires. Sie sind Anzeichen einer zwanghaften Wachsamkeit. Ein ausgleichendes Wechselspiel von Spannung und Entspannung ist hier massiv gestört. Dieses Kinder erträgt keine Entspannung, können sich nicht fallen lassen aus Angst, wehrlos einer erneuten Verletzung ausgesetzt zu sein. Weil ein solches Kind Angst vor Entspannung hat, wird von ihm auch manch friedliche Situation in einer Kindergruppe scheinbar grundlos zunichte gemacht. Leber berichtet von einem dieser hyperaktiven Kind, das seinen Vater fragte: "Papa, wenn ich mit dem Ruderboot auf einem tiefen See bin und mal nicht rudere, gehe ich dann unter?" (vgl. 1989, 26). Über seine hektische Motorik versucht dieses Kind verzweifelt sein inneres Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Ruhe bedroht dieses Gleichgewicht. Aus meiner Sicht spielen problematische oder mißlingende affektive Erfahrungen mit den primären Objekten eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung innerer Unruhe. Warum aber vermeiden viele Diagnostiker eine solche Sichtweise? Ich denke, sie spüren selber die große Gefahr, in der das Kind sich wähnt und haben nicht gelernt, diese Empfindung systematisch - als zum ungelösten Problemkreis des Kindes gehörig - zu reflektieren. Besonders bei der Arbeit mit gestörten Kindern kommt es von deren Seite nun häufig zu einer projektiven Identifizierung mit ihrem Gegenüber (dem Diagnostiker, dem Therapeuten, dem Lehrer usf.). Bei diesem innerpsychischen Abwehrprozeß werden unliebsame Selbstanteile abgespalten und ins äußere Objekt projiziert, "mit der Folge, daß dieses Objekt so erlebt wird, als sei es von den projizierten Anteilen kontrolliert und durchdrungen" (vgl. Staigle 1994, 139). Auf diese Weise sollen das Selbst von schlechten Anteilen befreit und seine guten Anteile geschützt werden. Das Kind möchte sein Gegenüber wie einen Container für seine nicht zu bewältigenden Ängste benutzen. Im Zuge eines Rollentausches werden daher die abgewehrten Selbstanteile dem erwachsenen Beziehungspartner ‘zugeschustert’. Das Kind fühlt sich dann plötzlich entlastet, während bei jenem mißliebige Empfindungen von Ohnmacht, Kränkung XII und Wut mobilisiert werden. In der projektiven Identifizierung übernimmt der Erwachsene unbewußt tatsächlich die Rolle, in die er gedrängt wird (vgl. Bion 1992, Trescher 1993, Gerspach 1998). Das Konzept des Containings wurde von Bion entwickelt. Containing ist nach diesem Verständnis zentraler Teil früher strukturbildender Interaktionserfahrungen. Auf diesem Fundament beginnen sich die Selbst- und Objektrepräsentanzen zu entwickeln, die die Grundlage der Entwicklung reifer Persönlichkeitsstrukturen bilden. Containing bedeutet entwicklungstheoretisch zunächst, daß sich die Mutter zur Verfügung stellt, um "alle die noch nicht bewußten und (noch) unintegrierbaren Affekte und Empfindungen des Säuglings (z.B. Wut und Angst) eine Zeitlang in sich zu bewahren, in sich stellvertretend zu verarbeiten, um so das Kind vor einem Überflutetwerden von seinen Affekten zu schützen und ihm ein Gefühl der Kontinuität seiner Existenz in Beziehung zu seiner Umwelt zu ermöglichen" (vgl. Trescher, Finger-Trescher 1992, 94). Dies verhilft dem Kind dazu, ‘gut’ und ‘böse’, Liebe und Haß in sein Selbsterleben zu integrieren anstatt abzuspalten. Bei einem ungünstigen Entwicklungsverlauf mißlingt diese Integration. Das Kind entledigt sich dann seiner schlimmen und unverdaulichen Affekte, indem es zappelig wird. Die pädagogische oder therapeutische Fachkraft spürt nun bei der Begegnung mit einem solchen Kind die ihn ihr aufkommenden Unlustgefühle im Sinne der projizierten Introjekte. Im Prinzip müßte sie wie ein Container die Funktion einer bisher nicht ausreichend erfahrenen haltenden Umwelt übernehmen. Die unguten Introjekte wären demnach auszuhalten, zu verdauen und dann dem Kind zurückzuspiegeln, damit es die nun entschärften Affekte und Phantasien besser in sein wachsendes Selbst verinnerlichen könnte, anstatt sich ihrer über motorische Abfuhr zu entledigen. Weiß der Erwachsene aber diese interaktiven Vorgänge nicht mittels eingehender Reflexion zu deuten und zu verarbeiten, wird er sich ihrer zwangsläufig schnellstens entledigen müssen. Die effektivste Art dazu ist es, dem Kind mittels objektivierender Zuschreibungen ein organisches und/oder funktionales Defizite zu bescheinigen. Mit anderen Worten: Hält der Erwachsene diesen emotionalen Druck nicht aus, wird er die projizierten Inhalte schleunigst zurückgeben und das Kind zum Kranken stempeln. Um sich selbst zu entlasten, wird er darum ringen, dieser Krankheit einen Namen zu geben: HKS. Diese Vorgehensweise ist Ausfluß eines archaischen magischen Denkens, wie es schon für die kindlichen Anfänge von Denkprozessen kennzeichnend ist. Das Kind glaubt, daß es sich nur etwas zu wünschen braucht, damit dies in Erfüllung geht. Es fürchtet übrigens gleichermaßen, daß seine bösen Gefühle, z.B. den Eltern gegenüber, Wirklichkeit werden und diese sich dann an ihm nach dem Prinzip "Auge um Auge, Zahn um Zahn" rächen werden. Die menschliche Urteilskraft befreit sich niemals vollständig von dieser magischen Haltung, was mithin die Unzuverlässigkeit von Realitätsprüfungen offenbart. Stets bleibt ein unauflösbarer Rest von Allmachtsphantasie, mit der man glaubt, Lenker der Dinge zu sein. Freud spricht davon, daß es eine Zeit ohne Religion und Götter gab, die er Animismus nannte (vgl. 1933a). Dämonen beherrschten die Welt, die dem Menschen feindlich gesonnen waren. Zwar litt er beständig unter schweren Ängsten vor diesen bösen Geistern, aber er traute sich selbst mehr zu. Durch bestimmte Handlungen, denen er magische Kräfte zusprach, wußte er sich ihrer zu erwehren. Wollte er Regen, so betete er nicht zum Wettergott, sondern er übte einen Zauber, von dem er sich eine direkte Beeinflussung der Natur versprach. "Im Kampf gegen die Mächte der Umwelt war seine erste Waffe die Magie, die erste Vorläuferin unserer heutigen Technik". Freud fährt fort, daß unsere Philosophie noch immer wesentliche Züge dieser animistischen Denkweise aufweist, "die Überschätzung des Wortzaubers, den Glauben, daß die realen Vorgänge in der Welt die Wege gehen, die unser Denken ihnen anweisen will" (S. 178 f). An anderer Stelle stellt er einen Zusammenhang her zwischen dem Seelenleben von "Kindern und primitiven Völkern" (vgl. 1914c, 140).errHe Ungebrochen dominieren Aberglaube und magische Bräuche viel mehr das öffentliche Leben, als eingestanden wird. So ist die Vergötzung der Technik, bis tief hinein ins diagnostische Feld, an die Stelle heidnischer Kulthandlungen und der okkulten Tätigkeit von Schamanen getreten. Wir alle halten Täuschungen gerne für Wirklichkeit, obwohl sie ihren wahren Ursprung in Ängsten und Wünschen haben. Auch der Diagnostiker ist nicht frei davon, das von ihm diagnostizierte Material im Sinne einer unbewußten, animistischen Welt- und Selbstauffassung in die Kategorien "lieb" oder "böse" einzuteilen, und zwar entlang der ihm einst selbst zugestandenen erzieherischen Freiheitsgrade. Gleichzeitig passiert etwas Ungeheuerliches: Der Diagnostiker bedient sich mit seinen verbalen Festschreibungen der Diagnose eben jenes archaischen Wortzaubers, der den Dämon - in unserem Fall die Hyperaktivität - zu bannen weiß. Die verbale Erklärung "Ihr Kind leidet am Hyperkinetischen Syndrom" erhält in den Ohren der Eltern eine grandiose Nebenbedeutung, die unmittelbar auf jene magische Macht von Worten zurückgeht, die in der frühen verbalen und den Reaktionen des kleinen Kindes auf die verbalen Äußerungen der Eltern eine vorherrschende Rolle spielen (vgl. Blanck, Blanck 1989, 181). Das Kind erlebt Sprache zuerst, indem es die Eltern mit Erstaunen zu ihm reden hört. Deshalb ist es nicht verwunderlich, weshalb die Eltern auffälliger Kinder soviel Wert auf die Aussagen der Elternfigur des Diagnostikers bzw. Therapeuten legen: Sie statten ihn in ihrer Phantasie mit sehr viel Macht aus. Bald XIII glaubt es der Fachmann selber. Die Diagnose ist der unbewußte Versuch, die eigene Irritation zu bannen. Balint spricht davon, daß ein Patient zum Arzt geht, um mit dessen Hilfe seinen "'unorganisierten' Zustand" von Unwohlsein in eine "'organisierte' Krankheit" zu verwandeln. Ihr vordringlichstes Anliegen ist die "Frage nach dem Namen der Krankheit, nach der Diagnose. Erst in zweiter Linie fragt der Patient nach der Therapie" (vgl. 1970, 26 ff). Auch hier stoßen wir auf dieses magische Denken. Es sei noch einmal unterstrichen, wie wichtig es ist, diese unbewußten Wünsche in ihrer Tragweite für das Erleben des Subjekts zu erkennen, um nicht gemäß der zugedachten Rolle blind mitzuagieren. Mit Devereux (1984) ist der Forscher selbst Gegenstand der Forschung. Folglich muß er der Wahrnehmung der eigenen Gefühlsreaktionen Beachtung schenken - "Selbstwahrnehmung ist so Medium des Fremdverständnisses" (vgl. Leber 1985, 154). Die Angst des Forschers vor seinem Gegenstand, die Devereux für die Verhaltenswissenschaften thematisiert hat, ist nicht als zu eliminierende Störgröße, sondern im Gegenteil als Erkenntnisquelle zu betrachten: "Ohne zu verstehen, was ihnen bei ihrer Arbeit Angst macht, verstehen sie überhaupt nichts" (Müller 1995, 60). Es gilt, die eigene affektive Verstrickung selbstreflexiv aufzuarbeiten, die zwingend in jeder pädagogischen oder therapeutischen Wechselbeziehung enthalten ist, um eine Antwort auf die Frage finden, was mit einem Kind los ist und was wir tun können. Ein weiteres kommt hinzu: Das Gefühl der Allmacht im Sinne eines Schutzwalles gegen aufkommende Bedrohungsgefühle, die durch das Phänomen der Hyperaktivität hochkommen, trägt nicht weit. Denn die durch projektive Identifikation im Diagnostiker aufkommende Unruhe macht eine dumpfe Ahnung der darin verborgenen Konfliktthemen und verlangt nach Abwehr. Folglich greift der Diagnostiker gegenüber den Eltern gern zu einem bestimmten Vermeidungsverhalten. Mögliche beziehungsdynamische Zusammenhänge, die die kindliche Störung am Leben erhalten, bleiben aus seiner Betrachtung ausgespart. Aus verinnerlichter Schuldangst vor den einstigen Konflikten mit den eigenen Elternfiguren kann es zu keiner Identifikation mit der kindlichen Position kommen. Vielmehr wird die Identifikation mit der starken Elternposition bevorzugt und das Kind fachmännisch als Störungspotential geoutet. Der Teufelskreis schließt sich. Fazit: Es gilt, das Kind in seinem hyperaktiven Verhalten zu verstehen, es gilt aber auch, die Eltern in ihren Beziehungssignalen zu verstehen. Nur auf diesem Wege läßt sich eine effektive Bearbeitung der kindlichen Symptomatik bewerkstelligen. Das setzt aber voraus, daß der Diagnostiker in der Lage ist, mit seinem Material so distanziert umzugehen, daß er zur wirklichen Hilfe und nicht zum Teil des Problems wird. Bemerkung 3 Dieser Hintergrund ist unseres Erachtens auch und gerade für solche Kinder zu bedenken, die von ihrem Temperament her eine Disposition zu einer besonderen Reizempfänglichkeit aufweisen mögen. Temperamentmäßig "schwierige" Kinder erleben feinfühlige Reaktionsweisen ihrer Mütter nicht unbedingt als feinfühlig, was diesen eine besonderes Maß an Empathie und Geduld abverlangt (vgl. Dornes 1998, 333, Fonagy 1998, 355). Mängel in der Affektabstimmung werden sich später insbesondere dann bemerkbar machen, wenn die primären Beziehungspersonen Mutter oder Vater vor dieser Aufgabe allzu schnell ausweichen. Bemerkung 4 Insofern auch ist es unmöglich, sich als 'gute Mutter' zur Einfühlung zwingen zu wollen, wenn andere Empfindungen dominieren. In solchen Fällen wäre es angeraten, der Mutter eine Möglichkeit zu bieten, sich ohne Schuldgefühle über ihre Gefühle und Phantasien äußern zu dürfen. Wird dieser Teil der Beziehung zum Kind enttabuiert, kann auch auf seiten des Kindes die emotionale Blockade, die sich als hyperkinetisches Verhalten darstellt, überwunden werden. Bemerkung 5 Ich bin mir bewußt, daß wir uns auf diese Weise auf ein mitunter sehr konflikthaftes Terrain begeben, nicht zuletzt weil Eltern sich schuldig fühlen oder sich verantwortlich gemacht sehen für das Tun ihrer 'unartigen' Kinder. Sich mit den latenten innerfamiliären Konflikten zu konfrontieren, heißt aber nicht, zur Elternbeschimpfung anzusetzen. Vielmehr gereicht, und das zeigt alle Erfahrung, eine offene Thematisierung in der Regel zur psychischen Entlastung und einem entspannteren Umgang miteinander. 3. Fallvignetten XIV Ich möchte nun abschließend zwei Fallvignetten hernehmen, die uns die unbewußte Abwehr der Diagnostiker vor Augen führen sollen, die eigentliche Wahrheit zu sehen. Betrachten wir zunächst die Geschichte vom Zappel-Philipp. In der Tat steht diese Geschichte heute für das hyperkinetische Kind schlechthin. Meist aber wird nur die deskriptive Position gewählt: Man begnügt sich damit, sich das Phänomen zu betrachten, ohne ihm aber auf den Grund zu gehen. Kurz: Es ist hier wie im wirklichen Leben: Bei der Diagnose vermeiden wir die Berührung mit dem wahren Kern der Sache So wie Heinrich Hoffmann den Zappel-Philipp beschrieb, ist er der Prototyp des hyperaktiven Kindes. Aber Hoffmann tut uns einen Gefallen und schildert jene häusliche Situation in der das hyperaktive Verhalten seinen Ursprung findet: Philipp und seine Eltern haben sich zum Essen um den Tisch versammelt, aber Philipp will nicht stillsitzen. Wir hören, daß der Vater ihn beständig ermahnt, während die Mutter, was zweimal erwähnt wird, nur stumm blickt. Am Ende fällt der mit seinem Stuhl schaukelnde Junge um, nicht ohne das Tischtuch mitsamt dem Essen mitzureißen. Welcher latente Sinn verbirgt sich hinter dem manifesten Verhalten Philipps? Eckstaedt liefert uns eine mögliche Interpretation, die sich auf die Biographie von Hoffmann selbst bezieht (vgl. 1998, 117 ff). Der kleine Heinrich verlor seine leibliche Mutter, als er noch nicht ein Jahr alt war. Drei Jahre später heiratete der Vater die leibliche Schwester seiner verstorbenen Frau. Die Geschichte vom Zappel-Philipp birgt dieses Geheimnis: Es ist die Geschichte des kleinen Heinrich, seines Vaters und seiner neuen Stiefmutter. Diese hat noch keine Beziehung zu ihm entwickelt - signalisiert durch ihr Unbeteiligtsein an der Szene. Heinrich ist wütend und eifersüchtig - ein vortreffliches Motiv für seine Zappeligkeit. Er ist das "verlassene, einsame und unverstandene Kind", unfähig, sein Gleichgewicht in dieser veränderten Situation zu finden. Die Liebe des Vaters gilt jetzt seiner neuen Frau, Heinrich muß sich einen anderen Platz suchen. Der Junge will das nicht. Also stört er die Idylle. Daß am Ende nicht nur die erbosten Eltern nichts mehr zu essen haben, sondern auch er Hunger hat, wird nicht erwähnt: Er hat Hunger danach, "geliebt, verstanden und getröstet zu werden" (S. 122 ff). Vielleicht ist auch nicht die Hochzeit der Anlaß für Philipps Zappeligkeit, sondern die Schwangerschaft der Stiefmutter. Denn bei genauerem Hinsehen erkennt man auf dem letzten Bild, auf welchem sie aufgestanden ist, ihren gerundeten Bauch. Eckstaedt erwähnt, daß sie noch drei Kinder bekam. Wut und Eifersucht fanden demnach reichlich Nahrung. So ist auch zu verstehen, warum der gemalte Philipp älter als ein Dreijähriger aussieht, der er nach der Deutung Eckstaedt sein müßte. Nun möchte ich mich noch kurz auf die schriftliche Darlegung eines diagnostischen Verfahrens beziehen (vgl. Schleider 1997, Gerspach 1998). Die nämliche Fallanalyse belegt zunächst den durchaus plausiblen Wunsch von Praktikern, bezüglich kindlicher Störungsmuster, mit denen sie sich konfrontiert sehen, zu klaren Handhabungen mittels objektivierter Schadensfeststellungen zu gelangen. Deshalb sind sie immer dankbar, wenn ihnen die Psychodiagnostik eindeutige Belege liefert, was mit einem Kind los ist. Daß ein solch stringentes wie widerspruchsfreies Vorgehen aber nicht so ohne weiteres möglich ist, und wir hier die Praktiker eher desillusionieren sollten, möchte ich nun belegen. Es geht mir im folgenden weniger um den Fall selbst als die meines Erachtens auffindbaren Ausblendungen wichtiger und konflikthafter Aspekte. Es geht um Alexander, einen siebenjährigen Jungen, der als Notfall in die Kinder- und Jugendpsychiatrie eingeliefert wurde, nachdem sein Elternhaus durch sein Zündeln beinahe vollständig ausgebrannt ist. Die Mutter berichtet ferner über "äußerst oppositionelles und aggressives Verhalten. Außerdem nässe er seit ca. einem Vierteljahr wieder nachts ein" (vgl. Schleider 1997, 190). Hinzu komme eine immer schon erhöhte motorische Unruhe. Alexanders Mutter ist 25 Jahre alt und Hausfrau, der Vater ist 24 Jahre alt und Kraftfahrzeugmechaniker. Die beiden Geschwister sind zweieinhalb und eineinhalb Jahre alt. Ein viertes Kind ist unterwegs. Vater und Mutter divergieren in ihrem Erziehungsstil: Die Mutter beschreibt sich als sehr streng und leistungsorientiert, ihren Mann (der offensichtlich nicht am Anamnesegespräch teilnimmt) als eher gewährend und verwöhnend. Ferner deutet sie "erhebliche Spannungen zwischen beiden Eltern sowie zwischen den Eltern und den Großeltern väterlicherseits" an. Insbesondere sie selbst sei emotional sehr belastet. Schleider kommt zum Ergebnis, daß die Persönlichkeitsprofile der beiden Eltern "insgesamt nicht klinisch auffällig" seien, wenn auch sehr unterschiedlich: Die Mutter erscheint eher extrovertiert, leistungsorientiert, leicht erregbar und äußerst angespannt, der Vater dagegen eher introvertiert, tendenziell bedrückt und mit psychosomatischen Beschwerden. Bezüglich des Jungen heißt es, vorläufige Verdachtsdiagnosen seien eine funktionelle Enuresis, eine hyperkinetische Störung mit Aufmerksamkeitsschwäche sowie eine fragliche Pyromanie. "Als vorläufige Maßnahme wird für eine gründliche Diagnostik und zur initialen Therapie, aber auch zur Entlastung der Familie ein stationärer Aufenthalt in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtung vorgeschlagen" (vgl. S. 191 ff). Der Junge wird dann einer ganzen Batterie von Tests ausgesetzt. U.a. wird sein nächtliches Einnässen protokolliert und mit lerntheoretischen Verstärkern begleitet. Die Beobachtung gilt auch seinem Hang zum XV Zündeln sowie seiner "Hyperaktivität, Unaufmerksamkeit und allgemeine(n) Verhaltensprobleme(n)". Hinzu kommen projektive Verfahren und Leistungsprüfungsmethoden. Im Fortgang der Diskussion wird nun ein vollkommen strukturiertes Vorgehen im Hinblick auf die Abstimmung von Diagnostik und ein daraus abgeleiteten Handeln emfohlen. Über die Entdeckung klarer Krankheitsbilder "entlang der Kriterien der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10)" (S. 195), die auf systematischer Verhaltensbeobachtung gründen, kommen wir zu operationalisierten Handlungsweisen bezüglich der Modifikation des ungewünschten Verhaltens. Indem wir, wie an diesem Beispiel expliziert, mit Hilfe objektivierter Beschreibungen auffälliger Verhaltensweisen zur klassifikatorischen Einkästelung eines Störungsbildes gelangen, verlassen wir nicht die Position des äußeren Beobachters. Die uns ereilende Irritation oder Beunruhigung wird systematisch aus unseren Befunden gelöscht, und auch die Vorläufigkeit oder Wertungsabsicht unserer Vorannahmen wird nicht mehr transparent. Weder wird es auf diese Weise noch gestattet, eine mögliche Kränkung zu reflektieren, die uns ein Kind zufügt, weil es die Mitarbeit verweigert, und die dann als ‘objektive Kriterien’ in die Untersuchungsergebnisse einfließen (vgl. Hirmke 1983), noch wird berücksichtigt, daß bereits einer diagnostischen Situation immer schon Momente einer prozeßhaften Beziehungsdynamik zu eigen sind. Auch wenn wir uns einer objektiven Sprache mittels standardisierter Methoden bedienen, sind wir von Anbeginn an mit unserem eigenen subjektiven Erleben beteiligt. Deshalb auch wäre es viel sinnvoller, anstelle punktueller statusdiagnostischer Erhebungen die Diagnostik als prozeßorientiert zu konzipieren und Veränderungen auf beiden Seiten ins Kalkül zu ziehen. Denn jede Störung ist, unabhängig vom klinischen Bild, stets eingebettet in einen sie determinierenden Interaktionsrahmen. Kolt und Rother haben deshalb angeregt, "diagnostisches Handeln als integrierten Bestandteil pädagogischen Handelns" aufzufassen (vgl. Kolt, Rother 1984, 345). Diagnostik geht in Förderung über, weil sie das intersubjektive Beziehungsgeschehen von Pädagoge und Kind als bewegende Kraft ansieht, und also begreifen wir eine "Störung als Chance", weil sie die Probleme - "seien es nun affektive oder kognitive" - als solche wahrzunehmen und zu deuten versteht. Dieser Aspekt bleibt im vorliegenden Fall ausgespart. Problematisch erscheint mir die völlige Auftrennung des familiendynamischen Hintergrunds von Alexanders Störung. Die Mutter macht mehrfach Andeutungen darüber, ohne daß diese Hinweise als versteckte Selbstmitteilung und heimlicher Wunsch, darüber zu reden, aufgegriffen würden. Es gibt offensichtlich viele ungelöste Probleme und eine insgesamt sehr angespannte Situation. Sie selbst, zudem hochschwanger, wirkt sehr belastet und unruhig. Wie wird ihre Zukunft aussehen mit vier Kindern, jetzt, da ihr Zuhause abgebrannt ist? Über all dies erfahren wir herzlich wenig. Geradezu penibel wird die Berührung mit aufscheinenden Affekten zu vermeiden gesucht. Wahrscheinlich wirken sie derart bedrohlich, daß, würden sie benannt, die Phantasie aufkäme, die Geister nicht mehr loszuwerden, die man rief. Man kann fast vermuten, daß das Ausmaß objektivierender Betrachtungen stets in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis zu abgewehrten Affektlagen steht. So bleibt der subjektive Faktor von Selbst- und Fremderleben, in dem ein bestimmter Erziehungsstil steht, unbeachtet, als könne man diesen frei wählen. Wir wissen, daß die Wahl des Erziehungsstils, wie man dem eigenen Kind begegnet, immer auch von unbewußten narzißtischen Projektionen mitbestimmt ist. Dabei schließt sich an die Frage nach der jeweiligen Färbung der elterlichen Affekte unmittelbar die nach ihrem Bild vom Kind an, welches ihrer affektiven Zuwendung zugrunde liegt. "Gerade die Eltern mit den sogenannten Problem-Einstellungen (...) lieben oder hassen doch im allgemeinen weniger das Kind, wie es wirklich ist, als vielmehr ein illusionär verzerrtes Bild des Kindes" (vgl. Richter 1972, 51). Das Kind kann auch unbewußt an die Stelle der eigenen Eltern treten oder mit anderen Beziehungspersonen ‘verwechselt’ werden. Die erzieherische Haltung von Mutter oder Vater wird dann von Reminiszenzen alter Verhaltensmuster überlagert. Hier aber werden solche Realitätsfälschungen nicht eingerechnet. Eine Überlegung, warum die Mutter fordernd, der Vater verwöhnend auftritt und was das mit der gesamten Beziehungsdynamik zu tun habe, wird gar nicht erst angestellt. Alles Nachdenken über den Fall verbleibt auf der Ebene technischer Regeln. Mich würde dagegen viel mehr interessieren, ob meine Vermutung stimmt, daß zentral ein ungelöster und noch schwelender Autoritätskonflikt mit dem Großvater den Vater introvertiert und bedrückt erscheinen läßt. Spannende Fragen wären diesbezüglich: Wie nahe stehen sich die Familien (auch räumlich)? Müssen wir davon ausgehen, daß die Dominanz des Großvaters ungebrochen ist? Hat sich der Vater nie wirklich abgelöst von seinem Elternhaus? Welche Akzeptanz erfährt da die Mutter? Hält sie, eine leistungsbetonte starke Frau, ihren Mann für einen ‘Schwächling’? Ist da Feuer unterm Dach? Kurz: Was handelt Alexander mit seinem Zündeln stellvertretend für den Vater (oder auch die Mutter) ab? An diesem Familiengeheimnis wird nicht gerüttelt. Wie häufig zu beobachten, erfolgt keine Identifizierung mit dem Kind und seinen inneren Nöten, was es auch nötig erschienen ließe, aus seiner Perspektive auf die Gesamtsituation mit den Erwachsenen (und den Geschwistern) zu schauen. Aus dem Scenotest erfahren wir übrigens ein nicht unwichtiges Detail über Alexanders Selbstwahrnehmung: Er verwendet nur Figuren für Vater und Großvater und baut dicke Mauern auf, die ihn von den anderen trennen (vgl. XVI Schleider 1997, 192). Leider wird dieser Hinweis auf gestörte Beziehungsmuster und ihre Bedeutung für eine gestörte Subjektgenese leichtfertig verschenkt. Dagegen läßt sich die schon beinahe klassisch zu nennende Identifikation mit Über-Ich-Positionen ausmachen: Die Erwachsenen werden nicht mit ihrer Eigenbeteiligung am Geschehen konfrontiert, aus ihrer Sicht erscheint einzig das Kind als Problem, und so verfährt die Diagnostik. Über die stationäre Unterbringung wird die Familie vorm Kind geschützt und nicht umgekehrt. Demgemäß bleibt es bei einer individualistischen, konfliktbereinigten Sichtweise, der dann der Konstruktbegriff Hyperaktivität wie von selbst in den Schoß fällt. Daß die Mutter selbst sehr angespannt und unruhig wirkt, der Junge in der ersten Untersuchungssituation zu ihr weder Blick- noch Körperkontakt aufnimmt, liefert erste Anhaltspunkte für eine gestörten Dialog zwischen beiden. Und wir wissen, daß nicht selten eine solche basale affektive Fehlabstimmung mit der Mutter beim Kind motorische Unruhe hervorbringt. Wenn es keine ausreichende emotionale Stimulation von außen erfährt, muß es zu einer Erhöhung seines motorischen Selbstaktivierung greifen, um sich noch spüren zu dürfen. Wie so oft einigt man sich stillschweigend darauf, all diese heißen Eisen nicht anzufassen und das Problem einzig im Kind - und hier noch am besten in biologische Faktoren gegossen, für die keiner etwas kann - zu lokalisieren. Erst, wenn Alexanders Störung - sein sich und andere gefährdendes Zündeln - als sinnvolle Selbstmitteilung über nicht bewältigte innerfamiliäre Konfliktthemen verstanden würde, wäre ein Weg gebahnt, daß er nicht mehr auf derlei (selbst-)zerstörerische Inszenierungen zurückgreifen müßte. Hier liegt meines Erachtens die Grundaufgabe pädagogoischen und therapeutischen Intervenierens darin, sich nicht in den Fallstricken jener "manipulativen Technokratien, die Subjektivität verwalten" (vgl. Schülein 1986, 197), zu verfangen. Ich komme zum Schluß: In der Begegnung mit einem zu diagnostizierenden Kind wie mit den betroffenen Angehörigen wäre es die vordringliche Aufgabe des Diagnostikers, weder zu einer Verleugnung des beziehungsdymischen Motivrahmens der Störung zu neigen, noch aus eigenen Entlastungswünschen zu einer konfrontativen Schuldzuweisung an Kind oder Eltern zu greifen. Die Frage lautet: Was können Kind und Eltern in ihrem jetzigen Selbstzustand bereits ertragen an unschönen Wahrheiten, ohne das Gehörte wieder projektiv und entrüstet von sich weisen zu müssen? Wie behutsam und doch bestimmt muß der Diagnostiker auftreten, um bei jedem der an einem komplexen innerfamilialen Prozeß Beteiligten eine allmähliche Ausweitung der Selbststruktur zu erreichen. Wie kann das Kind emotional bereit werden, seine Auffälligkeit aufzugeben, die sein Selbst bislang (scheinbar) stabilisiert? Wie läßt sich bei den Eltern das Gespür für die Nöte ihres Kindes und die selbstreflexive Einsicht in ihre eigene Verstricktheit ins Thema fördern? Welche Funktion bekommt der Diagnostiker selbst in diesem Prozeß zugewiesen? Kann er die Unruhe des Kindes, die Wut und Enttäuschung der Eltern, schließlich seine eigene Irritation aushalten und diese Gefühle so spiegeln, daß seine Dialogpartner daran zu wachsen und sie ins eigene Selbst zu integrieren vermögen? Bemerkung 6 Ich möchte nicht so tun, als könne eine psychodynamische Hypothese hypermotorischen Verhaltens immer die einzig stimmige Erklärung liefern. Aber wenn man sich die Massierung der 'gemeldeten' Fälle betrachtet, dann kann die globale Annahme neurophysiologischer Auffälligkeiten einfach nicht stimmen. Im übrigen möchte ich darauf hinweisen, daß die Psychoanalyse, auf deren methodisches Konzept ich mich berufe, die einzige Wissenschaft ist, die Verstehen und Physiologie legiert. Lorenzer nannte sie die hermeneutische Naturwissenschaft vom Seelischen (vgl. 1977, 122 ff). Literatur Ahrbeck, B.: Psychologisch-pädagogische Diagnostik zwischen Segregation und Integration. In: Behindertenpädagogik 2. 1993. 164 - 181 Albert, R., Horn, K.: Hyperkinetische Störungen im Kindes- und Jugendalter. Das hyperaktive Kind in Schule und Familie. In: Zeitschrift für Heilpädagogik7. 1999. 326 - 331 Albrecht, F. u.a. (Hrsg.), Perspektiven der Sonderpädagogik. Neuwied, Kriftel, Berlin (Luchterhand) 2000 Altherr, P.: Das Hyperkinetische Syndrom des Kindesalters aus kinderpsychiatrischer Sicht: Diagnostik und Therapiemöglichkeiten im Überblick. In: Passolt, M. (Hrsg.) 1997. 11 - 22 XVII Andreae, A., Fischer, C.: Quantitative Messung von adoleszentärer Dissozialisation: der Dissozialisationsindex DINX. In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete 3. 1999. 308 - 323 Balint, M.: Der Arzt, sein Patient und die Krankheit. Frankfurt (Fischer) 1970 Bernfeld, S.: Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung. Frankfurt (Suhrkamp) 1973 Bettelheim, B.: Der Weg aus dem Labyrinth. XXX (Deutscher Taschenbuch-Verlag) 1990 (1975) Bion, W.: Lernen durch Erfahrung. Frankfurt (Suhrkamp) 1992 (1965) Blanck, G., Blanck, R.: Ich-Psychologie II. Psychoanalytische Entwicklungspsychologie. Stuttgart (Klett-Cotta) 1989 Bowlby, J.: Trennung. München (Kindler) 1976 Bundschuh, K.: Dimensionen der Förderdiagnostik bei Kindern mit Lern-, Verhaltens- und Entwicklungsproblemen. München, Basel (Reinhardt) 1985 Burgmayer, S.: 'Syndrome' als Behandlungsgegenstand. In: Brack, U. (Hrsg.), Frühdiagnostik und Frühtherapie. München, Weinheim (Urban & Schwarzenberg) 1986. 107 - 121 Deneke, F.: Psychische Struktur und Gehirn. Die Gestaltung subjektiver Wirklichkeiten. Stuttgart, New York (Schattauer) 1999 Devereux, G.: Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften. Frankfurt (Suhrkamp) 1984 (1967) Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen (DSM-IV). Göttingen (Hogrefe) 1998 Dornes, M.: Der kompetente Säugling. Frankfurt (Fischer) 1993 Eberwein, H.: Verzicht auf Kategoriensysteme in der Integrationspädagogik. In: Albrecht F. u.a. (Hrsg.) 2000. 95 - 106 Eberwein, H., Knauer, S. (Hrsg.): Handbuch Lernprozesse verstehen. Weger einer neuen (sonder-)pädagogischen Diagnostik. Weinheim, Basel (Beltz) 1998 Eckstaedt, A.: "Der Struwwelpeter". Dichtung und Deutung. Frankfurt (Suhrkamp) 1998 Eggert, D.: Von der Testdiagnostik zur qualitativen Diagnose in der Sonderpädagogik. In: Eberwein, H., Knauer, S. (Hrsg.) 1998. 16 - 38 Eisert, H.: Kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen bei hyperaktiv-aggressiven Kindern. In: Franke, U. (Hrsg.) 1999. 105 - 120 Erikson, H.E.: Kindheit und Gesellschaft. Stuttgart (Klett) 1971 (1950) Esser, G. u.a.: Prävalenz und Verlauf psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter. In: Z. Kinder-Jugendpsychiat. 20. 1992. 232 - 242 Finger-Trescher, U.: Wirkfaktoren der Einzel- und Gruppenanalyse. Stuttgart, Bad Canstatt (Frommann-Holzboog) 1991 Fischer, K.: Hyperaktivität im frühen Kindesalter aus entwicklungstheoretischer Sicht. In: Passolt, M. (Hrsg.) 1997. 47 - 60 Fonagy, P.: Die Bedeutung der Entwicklung metakognitiver Kontrolle der mentalen Repräsentanzen für die Betreuung und das Wachstum des Kindes. In: Psyche 4. 1998. 349 - 368 XVIII Fonagy, P. u.a.: Aggression und das psychische Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie 47. 1998. 125 - 143 Selbst. In: Praxis der Franke, U. (Hrsg.): Therapie aggressiver und hyperaktiver Kinder. München, Jena (Urban & Fischer) 1999 Freud, S.: Zur Einführung des Narzißmus. In: Gesammelte Werke Bd. 10. 1914c Freud, S.: Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. In: Gesammelte Werke Bd. 15. 1933a Gerspach, M.: Erlebensstruktur und Behinderung. Zur Wechselwirkung von Krankheitsbild und Beziehungsmuster. In: Psychosozial 3. 1994. 109 - 124 Gerspach, M.: Wohin mit den Störern? Zur Sozialpädagogik der Verhaltensauffälligen. Stuttgart, Berlin, Köln (Kohlhammer) 1998 Gerspach, M.: Einführung in pädagogisches Denken und Handeln. Stuttgart, Berlin, Köln (Kohlhammer) 2000 Grissemann, H.: Hyperaktive Kinder. Kinder mit minimaler zerebraler Dysfunktion und vegetativer Labilität als Aufgabe der Sonderpädagogik in der allgemeinen Schule. Bern, Stuttgart, Toronto (Huber) 1986 Hartmann, K.: Heilpädagogische Psychiatrie in Stichworten. Stuttgart (Enke) 1986 Hirmke, V.: Er fürchtet sich vor dem schwarzen Mann oder: Ein Gastarbeiterkind zwischen zwei Welten. In: Leber, A. u.a., Reproduktion der frühen Erfahrung. Frankfurt (Fachbuchhandlung für Psychologie - Verlagsabteilung) 1983. 103 - 116 Hofmann, Ch.: Förderungsdiagnostik als Reformsemantik? In: Albrecht, F. u.a. (Hrsg.) 2000. 107 - 121 Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10. Bern (Huber) 1999 Kautter, H.: Das "Thema des Kindes" erkennen. Umrisse einer verstehenden pädagogischen Diagnostik. In: Eberwein, H., Knauer, S. (Hrsg.) 1998. 81 - 93 Kleinbach, K.: Sehzwang als Blindheit - Versuch zum 'diagnostischen Blick' in der Sonderpädagogik. In: Behindertenpädagogik 2. 1993. 140 - 152 Kobi, E.: Aussichten einer künftigen Heilpädagogik aufgrund gegenwärtiger Einsichten und Absichten. In: Raemy, D. u.a. (Hrsg.), Heilpädagogik im Wandel der Zeit. Luzern (Schweizerische Heilpädagogische Gesellschaft) 1990 Köhler, L.: Ergebnisse der Kleinkindforschung. Ihre Bedeutung für die Theorie und Praxis der Psychoanalyse und (Heil-)Pädagogik. In: Werkstattgruppe Frühförderung (Hrsg.), Frühförderung und Psychoanalyse. Heidelberg (Asanger) 2000 (in Vorbereitung) Kolt, Ch., Rother, H.-J.: Förderdiagnostik in der Sackgasse. In: Behindertenpädagogik 4. 1984. 332 - 343 Krawitz, R.: Neue Möglichkeiten der sonderpädagogischen Diagnostik individualpädagogischer Sicht). In: Behindertenpädagogik 4. 1992. 370 - 379 (aus Laplanche, J., Pontalis, J.-B.: Das Vokabular der Psychoanalyse. Frankfurt (Suhrkamp) 1972 Leber, A.: Wie wird man psychoanalytischer Pädagoge? In: Bittner, G., Ertle, Ch. (Hrsg.) Pädagogik und Psychoanalyse. Würzburg (Königshausen & Neumann) 1985. 151 - 165 Leber, A.: Ein Prototyp der Traumabewältigung? In: Psychosozial 37. 1989. 22 - 27 XIX Leuschner, W. u.a.: Couch im Labor Prozesse. In: Psyche 9/10. 1998. 824 - 849 Experimentelle Erforschung unbewußter Lichtenberg, J.: Psychoanalyse und Säuglingsforschung. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo (Springer) 1991 Linderkamp, F.: Untersuchung zur phänomenologischen Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen im Kindesalter. Forschung 1. 1998. 2 - 11 Differenzierung bei In: Heilpädagogische Lorenzer, A.: Sprachspiel und Interaktionsformen. Frankfurt (Suhrkamp) 1977 Lüpke, H. von.: Der Zappelphilipp. Bemerkungen zum hyperkinetischen Kind. In: Voß, R. (Hrsg.), Pillen für den Störenfried? Absage an eine medikamentöse Behandlung abweichender Verhaltensweisen bei Kindern und Jugendlichen. München, Basel (Reinhardt) 1983 Lüpke, H. von: "Kinder, die nicht tun, was sie könnten" - Motorische Entwicklungsverzögerung unter psychodynamischen Aspekten. In: Hölter, G. (Hrsg.), Bewegung und Therapie. Dortmund (Modernes Lernen) 1988. 24 - 32 Lüpke, H. von: Psychodynamische Aspekte bei der "Minimalen Cerebralen Dysfunktion". In: Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik 1. 1989. 74 - 89 Mattner, D.: Vom Sinn des Unsinnigen - Überlegungen zum hyperkinetischen Verhalten. In: Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik 1. 1989. 90 - 100 Mattner, D.: Vom Sinn des Zappelns - das Hyperkinetische Syndrom verstehen. In: Passolt, M. (Hrsg.) 1997. 34 - 46 Mattner, D.: Zur Biologisierung unerwünschten Schülerverhaltens. In: Der pädagogische Blick 4. 1999. 207 - 214 Moré, A.: Die Integration sensorischer, affektiver und kognitiver Fähigkeiten beim Säugling. In: Kinderanalyse 3. 1998. 228 - 247 Müller, B.: Außensicht - Innensicht. Freiburg (Lambertus) 1995 Passolt, M. (Hrsg.): Hyperaktive Kinder, Psychomotorische Therapie. München, Basel (Reinhardt) 1997 Paulsen, S.: Wie entsteht Beziehung? Beitrag und Perspektive der Säuglingsforschung. In: Beiträge zur analytischen Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie 76. 1992. 35 - 61 Perry, B. u.a.: Kindheitstrauma, Neurobiologie der Anpassung und "gebrauchs-abhängige" Entwicklung des Gehirns: Wie "Zustände" zu "Eigenschaften" werden. In: Analytische Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie 3. 1998. 277 - 307 Racker, H.: Übertragung und Gegenübertragung. München, Basel (Reinhardt) 1993 Rauchfleisch, U.: Außenseiter der Gesellschaft. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1999 Reiser, H.: Entwicklung und Störung - Vom Sinn kindlichen Verhaltens. In: Behindertenpädagogik 3. 1993. 254 - 263 Richter, H.-E.: Eltern, Kind und Neurose. Reinbek 1972 (1963) Rothenberger, A., Moll, G.: Klassifikation und neurobiologische Grundlagen des Hyperkinetischen Syndroms. In: Franke, U. (Hrsg.) 1999. 13 - 39 Schleider, K.: Psychodiagnostische Methoden und ihre Bedeutung für sonderpädagogisches Handeln. In: Zeitschrift für Heilpädagogik 5. 1997. 190 - 196 heil- und XX Schnädelbach, H.: Positivismus. In: Seiffert, H., Radnitzky, G. (Hrsg.), Handlexikon der Wissenschaftstheorie. München (Ehrenwirth) 1989. 267 - 269 Schülein, J.A.: Selbstbetroffenheit. Über Aneignung und Vermittlung sozialwissenschaftlicher Kompetenz. Gießen (Focus) 1986 Seewald, J.: Am Leitfaden von Körper und Bewegung - Motologische Sichten auf die Sonderpädagogik. In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete 1. 1998. 25 48 Staigle, J.: Supervision und Krise. In: Verein für Psychoanalytische Sozialarbeit (Hrsg.), Supervision in der psychoanalytischen Sozialarbeit. Tübingen (Edition Diskord) 1994. 139 - 157 Steinhausen, H.-C.: Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Lehrbuch der Kinderund Jugendpsychiatrie. München, Wien, Baltimore (Urban & Schwarzenberg) 1996 Stern, D.: Mutter und Kind. Stuttgart (Klett) 1979 Stern, D.: Die Mutterschaftskonstellation. Stuttgart (Klett-Cotta) 1998 Thadden, E. von: Sagt ADS-Kind zu mir. In: DIE ZEIT Nr. 10 vom 2.3.2000. 47 - 48 Tietze-Fritz, P.: Integrative Förderung in der Früherziehung. Entwicklungsgefährdete Kinder und ihre psychomotorischen Fähigkeiten. Dortmund (Borgmann) 1997 Trescher, H.-G.: Theorie und Praxis der Psychoanalytischen Pädagogik. Frankfurt (Campus) 1985 Trescher, H.-G.: Handlungstheoretische Aspekte der Psychoanalytischen Pädagogik. In: Muck, M., Trescher, H.-G. (Hrsg.), Grundlagen der Psychoanalytischen Pädagogik. Mainz (Grünewald) 1993. 167 - 201 Trescher, H.-G., Finger-Trescher, U.: Setting und Holding-Function. In: Finger-Trescher, U., Trescher, H.-G. (Hrsg.), Aggression und Wachstum. Mainz (Grünewald) 1992. 90 - 116 Voß, R., (Hrsg.): Pillen für den Störenfried? Absage an eine medikamentöse Behandlung abweichender Verhaltensweisen bei Kindern und Jugendlichen. München, Basel (Reinhardt) 1983 Walthes, R.: Wahrnehmungs- und Bewegungsstörungen: Neue Wege zum Verständnis von "Störungen" und Konsequenzen für therapeutische Konzepte. In: Leyendecker, Ch., Horstmann, T. (Hrsg.), Frühförderung und Frühbehandlung. Wissenschaftliche Grundlagen, praxisorientierte Ansätze und Perspektiven interdisziplinärer Zusammenarbeit. Heidelberg (Schindele) 1997. 147 156 zurück zu: Entwicklungsabweichungen