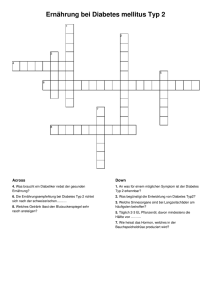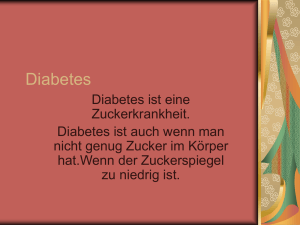ADBWpublik 1/2014
Werbung

ADBWpublik... ISSN 1614-7472 Arbeitsgemeinschaft Diabetologie Baden-Württemberg – Regionale Gliederung der Deutschen Diabetes Gesellschaft Diabetes in Baden-Württemberg Heft 1 / 14 Erfol g dur ch Ve März / April 2014 rnetz ung IN DIESEM HEFT: Editorial: Erfolg durch Vernetzung ............................................................................................... Bewegung ist die beste Medizin ................................................................................................. Diabetiker über den Dächern von Ulm ........................................................................................ Diabetikertag in Ulm ................................................................................................................... Beitrag des Schatzmeisters ........................................................................................................ Programm ADBW Diabeteskongress am 10./11.07.2014 in Bad Boll ........................................ Anmeldung zum ADBW Diabeteskongress ................................................................................ Gambia 2014 .............................................................................................................................. Fachkurs Diabetes der ADBW für Pflegekräfte .......................................................................... Hochrangige Publikation von DPV-Daten ................................................................................... ADBW Studentenseminar 2014 ................................................................................................. Diabetologische Ausbildung junger Ärzte in der ADBW ............................................................. Beitrittserklärung ........................................................................................................................ Berufspolitik 2014: Ein Überblick ............................................................................................... Neue Leitlinie – interessante neue Aspekte ................................................................................ 15. Workshop „Diabetes und Bewegung“ am 28. Juni 2014 in Radolfzell ................................. Bericht über den EASD .............................................................................................................. Der Visitenbogen Gestationsdiabetes am HBH-Klinikum Singen / Radolfzell ............................. Erfolgreicher DiaWalk in Tuttlingen ............................................................................................ Stationäre Rehabilitation bei Diabetes mellitus .......................................................................... Karlsruher Diabetes Aktionsplan unterzeichnet! ......................................................................... Fussballcamp für Jungen / Mädchen mit Diabetes beim KSC ..................................................... Nachrichten aus der ADBW Geschäftsstelle / Impressum ......................................................... Termine ....................................................................................................................................... S. 3 S. 4 S. 6 S. 7 S. 9 S. 10 S. 12 S. 14 S. 15 S. 16 S. 17 S. 19 S. 20 S. 22 S. 23 S. 24 S. 25 S. 26 S. 27 S. 28 S. 31 S. 32 S. 33 S. 34 Informationsheft der Arbeitsgemeinschaft Diabetologie Baden-Württemberg Seite 1 www.lilly-diabetes.de Lilly Diabetes. Leben so normal wie möglich. Seite 2 DEDVC00190 GANZ INDIVIDUELL. WIE FÜR MICH GEMACHT. DER NEUE HUMAPEN®SAVVIO. DER INSULIN-PEN, DER ZUM MENSCHEN PASST. www.HumaPenSavvio.de Erfolg durch Vernetzung Die Kommunalen Gesundheitskonferenzen bieten sich als Forum an, die Gesund­ heitsziele der Landesregierung auf der Ebene der Land- und Stadtkreise umzusetzen. Vernetzung, Rückkoppelung, öffent­ lichkeitswirksames und zielorientiertes ­Arbeiten sollen helfen, mehr zu erreichen und den Gesundheitszielen näher zu kommen. „Diabetes mellitus Typ 2 – Risiko senken und Folgen reduzieren“ ist bekanntlich prioritäres Gesundheitsziel in Baden-Württemberg und damit deckungsgleich mit vielen Zielen unserer Fachgesellschaft ADBW. Was liegt näher, als dies zu nutzen, um unseren schon laufenden Projekten mehr Schwung zu geben. Ein gutes Beispiel für eine derartige Vernetzung ist das Projekt „DiaWalk“ im Kreis Tuttlingen (s. S. 27). Vom VDBD kam vor drei Jahren die gute Idee, eine niederschwellige Laufaktion zu veranstalten, um Diabetiker in Bewegung zu bringen. Ein kleiner Kreis war beim ersten Anlauf zum Mitmachen zu motivieren. Als gemeinsame Aktion des schon im Landkreis aktiven „Runden Tisch Diabetes“ war der zweite Anlauf 2012 schon erfolgreicher und öffentlichkeitswirksam. Doch erst als der „Runde Tisch“ als Arbeitskreis der Kommunalen Gesundheitskonferenz anerkannt und sich auf den damit verbundenen Rückhalt, das Gewicht und die Vernetzung stützen konnte, wurde es möglich, eine wirklich große und hoffentlich nachhaltige, von der Kommunalpolitik und Sponsoren unterstützte Aktion mit Signalcharakter zu etablieren. Ressourcen erschließen durch Kooperation (z.B. Sportverein, DRK, kommunales Thermalbad, Landkreis) war das Erfolgsrezept. Prinzipiell bedeutet eine solche Vernetzung auch für alle Beteiligten eine „win-win-Situation“. Dieselben Erfah­ rungen haben offenbar in Karlsruhe die Mitglieder des Runden Tisch der Initiative „Diabetes in Aktion-Medikament Bewegung“ gemacht. Sie haben 2013 den Karlsruher Dia­betes Aktionsplan auf den Weg gebracht (s. S. 31). Gemeinsame Interessen mit verstärkten Kräften verfolgen, das könnte generell ein Erfolgsrezept für Selbsthilfe sein. Haben doch viele Selbsthilfegruppen Probleme, neue Mitglieder zu gewinnen, eine ausreichende Durchdringung zu erreichen, um angemessen die Interessen der Betroffenen vertreten zu können. Vernetzung ist auch ein Ziel des neuen „Fachbeirat Diabetes Baden-Württemberg“. Vor eineinhalb Jahren gelang es der ADBW, durch eine gut organisierte Veranstaltung in der Landespolitik endlich das Bewusstsein zu wecken, wie wichtig angesichts des „Diabetes-Tsunami“ Prävention von Diabetes und Diabetesfolgen ist. Nun werden Vertreter der unterschiedlichsten Institutionen aus der Diabetesbetreuung gemeinsam in diesem Arbeitskreis dafür geeignete Wege suchen. Die ADBW gab den Anstoß und viele der Kommissionsmitglieder werden ADBW-Mitglieder sein. Wir hoffen, dass diese Vernetzung ebenso die Kräfte bündeln und verstärken kann und uns unseren Diabetes­zielen näher bringt, Ihr Seite 3 Bewegung ist die beste Medizin „Das Sofa ist ein gefährlicher Ort“, warnt Professor Jürgen Steinacker. „Dort passiert in der Regel zwar nichts Gefährliches, doch stundenlanges Sitzen vor dem Fernseher – oder auch am Schreibtisch – stellt für große Teile der Bevölkerung ein beträchtliches Gesundheitsrisiko dar“, so der Sportmediziner Mitte November 2013 beim Diabetologie-Kongress an der Universität Ulm. Denn die Deutschen werden nicht nur immer dicker, sondern auch immer fauler, was sportliche Aktivität und Bewegung angeht. „Nur 12 Prozent der Deutschen sind sportlich aktiv. Schlechter sind nur noch die Mittelmeerländer, deren Bewohner so gut wie gar keinen Sport treiben. Europäische Spitzenreiter sind wir dagegen in Adipositas und Diabetes, wo wir regelmäßig Platz 2 oder 3 belegen“, beklagt der Leiter der Sektion Sport- und Rehabilitationsmedizin am Ulmer Uniklinikum. Und das, obwohl der Mensch genetisch auf körperliche Aktivität programmiert sei. „In der Steinzeit legte man oft bis zu 50 Kilometer am Tag zurück, heute sind es gerade mal zwischen 300 und 700 Meter“, informiert Steinacker. Und was früher überlebenswichtig war, nämlich die Fähigkeit, Nahrungsenergie im Fettgewebe zu speichern, birgt für viele Menschen heute ein großes gesundheitliches Risiko. Über­ ernährung und Bewegungsmangel sind – bei entsprechender genetischer Veranlagung – Hauptursachen für Volkskrankheiten wie Adipositas und Diabetes Typ 2. Warum ist Übergewicht so gefährlich? Und wieso ist Sport gut bei Diabetes? „Fettgewebe ist ein endokrines Organ und setzt hormon-ähnliche Substanzen frei, so genannte Adipokine“, erklärt der Sportmediziner. Diese senden bei starkem Übergewicht verstärkt inflammatorische Signale aus, die sich als chronische Entzündungen im Gehirn, in den Gefäßen oder den Fettzellen bemerkbar machen können. Parkinson und Arteriosklerose beispielsweise würden damit genauso begünstigt wie kardiovaskuläre Krankheiten, darunter Herzinfarkt und Schlaganfall. „Außerdem fördern gewisse Adipokine die Insulinresistenz und damit die Entstehung von Diabetes Typ 2. Die Zellen nehmen die Glukose aus dem Blut nicht mehr auf, so dass der Blutzuckerspiegel steigt“, erläutert Steinacker. Wenn die Kilos hingegen purzeln, sinken meist Blutzucker-, Blutdruck- und Blutfettwerte ganz automatisch. Sport und körperliche Aktivität könnten diese schädlichen Adipokin-Reaktionen ebenfalls parieren. Denn auch der arbeitende Muskel ist ein wichtiges sekretorisches Organ, das stoffwechselaktive Prozesse in Gang bringt, wie die Glukoseaufnahme aus dem Blut oder die Fettverbrennung. Verschiedene Myokine, das sind hormonähnliche Substanzen, die bei Muskelaktivität freigesetzt werden, verbessern zudem Insulinproduktion und -resistenz, fördern die Durchblutung und das Knochenwachstum. Sogar entzündungshemmende Effekte und immunstärkende Wirkungen sollen durch aktive Muskelzellen über diverse Myokine ausgelöst werden. Seite 4 „Zur Verbesserung der Blutzuckerwerte sollten bei Diabetes Typ 2 nicht immer nur neue Medikamente eingesetzt werden, sondern der Patient muss motiviert werden, sich mehr zu bewegen“, regt Steinacker an und verweist an dieser Stelle auf die Plattform „Exercise is medicine“, die die Bedeutung körperlicher Bewegung für die gesamte Medizin herausstellt. Es gilt als wissenschaftlich belegt, dass eine Ernährungsumstellung in Verbindung mit sportlicher Aktivität bei Diabetes-Patienten so effektiv sein kann, dass Insulingaben kaum oder gar nicht mehr nötig sind. Ernährungstipps der wissenschaftlichen Art lieferte Dr. Robert Wagner von der Universität Tübingen in seinem Vortrag über den Zusammenhang zwischen Ernährung und Diabetes. Die Quintessenz aus den zahlreichen vorgestellten epidemiologischen Untersuchungen und Interventionsstudien: protektive Wirkung haben Nüsse, Ballaststoffe, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, aber – ziemlich überraschend – auch Kaffee und Rotwein! Das Diabetes-Risiko steigert hingegen der Konsum von Nahrungsmitteln mit hoher glykämischer Last und von rotem Fleisch. Gemieden werden sollen vor allem industriell gefertigte Lebensmittel mit hohem Transfettsäuren-Anteil. Schlecht seien auch zu fette Nahrungsmittel wie Pommes oder Chips und süße Softdrinks, da sie Übergewicht fördern und schon dadurch Dia­betes begünstigen. Früchte wie Blaubeeren, Trauben und Äpfel dagegen könnten helfen, Diabetes zu verhindern. Doch – wie die Tübinger Interventionsstudie zeige – sprächen nicht alle Diabetiker auf eine Veränderung des Lebensstils mit gesünderer Ernährung und mehr Bewegung an. Jahren noch viel Forschungsbedarf und Tagungsstoff geben“, so PD Dr. Sigrun Merger. Die Diabetes- und Adipositas-Expertin ist Oberärztin am Ulmer Uniklinikum und hat gemeinsam mit Professor Reinhard Holl (ZIBMT, Institut für Epidemiologie und medizinische Biometrie) die Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Diabetologie BadenWürttemberg (ADBW) in der Münsterstadt organisiert. Dort trafen sich Diabetologen und Praxisärzte mit Sportmedizinern, Er- nährungswissenschaftlern und Pflegeexperten sowie Patienten- und Krankenkassenvertretern, um sich über neue Erkenntnisse zur Krankheitsentstehung, Diagnose und Behandlung von Typ 2 Diabetes auszutauschen. Tagungsschwerpunkt: die Rolle der so genannten „Lifestyle-Intervention“ bei der Prävention und Therapie dieser weit verbreiteten Form der Zuckerkrankheit. Der Ulmer Diabetologe und ADBW-Sprecher Holl forderte in diesem Zusammenhang die Abkehr von der hergebrachten „Rezeptblockorientierung“ der Ärzteschaft: „Für viele Patienten ist die `Lifestyle-Intervention´ die Therapie erster Wahl. Denn körperliche Aktivität und gesunde Ernährung können Typ 2 Diabetes nicht nur verhindern, sondern auch effektiv therapieren.“ „Hierfür gibt es wohl vielfältige Ursachen, die bisher allerdings noch im Dunkeln liegen. Es wird also auch in den nächsten Seite 5 Andrea Weber-Tuckermann Diabetiker über den Dächern von Ulm Diabetikertag Ulm: Turmbesteigung, Donau „Walk“, Münsterführung und Kochstudio „Ich wäre bestimmt nicht auf den Turm ­gestiegen ohne diese tolle ärztliche und persönliche Begleitung“, freute sich Claudia Müller* über ihren Aufstieg zur Turmstube im Ulmer Münster. Besucher des Diabe­ tikertages, organisiert vom Deutschen Dia­ betiker Bund Baden-Württemberg (DDB), konnten im Rahmenprogramm zwischen Spaziergang an der Donau, Führung im Münster, Besteigung des Münsterturms Münsterführung mit Pfr. A.Schloz-Dürr (2.v.re.) oder dem Kochstudio der AOK im Stadthaus wählen. Wer die Turmbesteigung wagen wollte, musste sich vorher einer Blutdruckmessung durch Frau Dr. Dürr (Uni Ulm) und Blutzuckermessung durch Elke Gebhard (DDB) stellen. von links: Elke Gebhardt, Frau Dr. Dürr Bei Teilnehmern, die unterzuckert waren oder einen kritischen Blutdruck aufwiesen, wurde angeregt, im Münster zu bleiben. Langweilig wurde es dabei niemandem. Denn Pfr. Adelbert Schloz-Dürr erläuterte in einer interessanten Führung die Historie des Münsters. Dabei achtete er auf ausreichend Bewegung der Teilnehmer. Diese dankten es ihm mit viel Applaus. In der Turmstube angekommen wurden die mutigen Diabetiker von Claude Dürr mit einem Trompetentusch belohnt. Blutzucker und Blutdruck wurden auch hier von Frau Dr. Gläser (Uni Ulm) und Dr. Firuz Sadr (2. Vorsitzender DDB) gemessen. Erstaunt zeigten sich die Teilnehmer über die guten Werte und genossen den Rundblick über die Dächer von Claude Dürr begrüßt die „Turm­ Ulm. stürmer“ mit einem Trom­peten­ tusch Währenddessen spazierte Frau Dr. Ebert (Uni Ulm) mit ihrer Truppe und begleitet von Eckhard Geisler (DDB) zügig an der Donau entlang. Der Vergleich der gemessenen Blutzucker- und Blutdruckwerte vor und nach dem Spaziergang machte deutlich, wie positiv sich Bewegung auf den Blutzucker auswirkt. Die Teilnehmer im Rahmenprogramm erhielten ein Zertifikat mit Foto und waren sichtbar glücklich über diesen Erfolg. DDB LV BW * Name von der Redaktion geändert Seite 6 Diabetikertag Ulm: Die glücklichsten Diabetiker leben in Ulm und um Ulm herum Diabetes – mitten in der Gesellschaft Ein bisschen Zucker, ernst genommen, kann Folgeschäden wie Fußamputationen verhindern. Aktive Patienten im konstruktiven Dialog mit dem Arzt sind besonders gefragt. Das wurde beim Diabetikertag Ulm sehr deutlich. Unter dem Motto „Nur ein bisschen Zucker? – Diabetes ernst nehmen!“ informierten sich mehr als 1.000 Menschen im Stadthaus. Veranstalter waren der DDB Baden-Württemberg in Kooperation mit der ADBW. Belohnt wurden die Besucher mit interessanten Vorträgen und einer attraktiven Ausstellung. Die glücklichsten Diabetiker Deutschlands wohnen in Ulm. So zumindest könnte die Aussage von Oberbürgermeister Dr. Ivo Gönner in seiner Rede im Umkehrschluss lauten. Der Oberbürgermeister freute sich über zwei Aspekte an diesem Tag. Zum einen gehören die Ulmer zu den glücklichsten Menschen Deutschlands, wie sich aus der ARD-Umfrage ergab. Zum anderen war mit dieser hochkarätigen Veranstaltung das Thema Diabetes wieder in der Stadt präsent. Von links: OB Dr. Ivo Gönner, Prof. Dr. Reinhard Holl, Heidi Gruber, Elke Brückel Prof. Dr. Reinhard Holl ist nach eigener Aussage „einer der glücklichen Ulmer“. Für ihn war besonders wichtig, dass das Thema Dia­betes mit der Veranstaltung am Münster „wieder mitten in der Gesellschaft“ sei. Er machte deutlich, dass Diabetes sich von anderen Krankheiten unterscheide. Es sei weder eine Erkrankung, die chirurgisch gelöst werden könne noch allein durch neueste pharmazeutische Produktentwicklungen, sondern vor allem durch eine konsequente Mitarbeit des Betroffenen. Jeder Diabetes sei individuell und fordere aktive Patienten „Basis für ein gutes Lebensgefühl bei Diabetes ist Bewegung und eine sinnvolle Ernährung und zwar so früh wie möglich“, sagte Prof. Holl mit Nachdruck. Diabetologie hat eine lange Tradition in Ulm und ist ein wichtiger Schwerpunkt in der Uniklinik. Etwa 15.000 Menschen in Ulm und um Ulm herum leiden an dieser chronischen Krankheit. Prof. Holl betonte, dass in Baden-Württemberg die Selbsthilfe und die Diabetologen sehr gut zusammen arbeiten. Zum Beispiel als gemeinsame Stimme im Sozialministerium für den Einsatz eines Seite 7 Landesdiabetesbeirats. Er wünschte sich, dass die Selbsthilfe in Ulm weiter ausgebaut werde. Elke Brückel, Landesvorsitzende des DDB, hob hervor, dass die Selbsthilfe die sinnvollste Ergänzung zur medizinischen Betreuung sei. Denn die Arbeit des DDB setze bei den alltäglichen Situationen und persönlichen Problemen der Diabetiker an. Sie bedankte sich bei Prof. Holl für seine Idee, einen Diabetikertag in Ulm zu veranstalten. Auch Brückel wies eindringlich auf die frühe Behandlung von Zucker hin. Sie bedauerte, dass die Mitglieder des DDB immer wieder auf Aussagen stoßen, wie: „mein Arzt meint, es sei grenzwertig“ oder „ich habe doch nur ein bisschen Zucker.“ Sie ergänzte: „Ein bisschen Zucker ist wie ein bisschen schwanger – so etwas gibt es nicht. Unbehandelt kann dieses bisschen Zucker schnell zu Folgeerkrankungen führen. Leider tut Zucker nicht weh – zumindest am Anfang. Wenn er dann weh tut, ist bereits wertvolle Zeit verstrichen, um die Weichen für den Verlauf der Erkrankung zu stellen.“ Schon bei den ersten Anzeichen müsse ihrer Meinung nach der Arzt reagieren und der Betroffene die Diagnose sehr ernst nehmen. So könne das „süße Rad“ frühzeitig angehalten und Folgeschäden vermieden werden. Folgeschäden können zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall, Nervenstörungen, Nierenversagen und Erblindung sein, wie Dr. med. Wolfgang Böck in seinem Vortrag „Dia­betes – gute Behandlung von Anfang an“ aufzeigte. Dr. Martina Kuhn-Halder re- ferierte über „diabetische Neuropathie – kribbeln, brennen, taube Füße“ und PD Dr. Burkhard Manfras informierte über die „Grundzüge der Ernährung bei Diabetes mellitus“. Prof. Dr. Werner Kern erläuterte das „Medikament Bewegung als Vorbeugung und Therapie“. Bewegung und Ernährung sind die zentralen Themen, nicht nur bei Diabetes, so Elke Brückel. Bewegung müsse nicht immer mit einem Dauerlauf oder dem Gang ins Fitness Studio verbunden sein. „Suchen Sie sich raus, was Ihnen am besten zusagt – Schwimmen, Tanzen, Fensterputzen – egal – Hauptsache es macht Ihnen Spaß und Sie sind bewegt“. Sportliche Ausreden ließ Brückel nicht gelten. Das Angebot, sich zu bewegen sei sehr groß. Auch wer bewegungseingeschränkt sei, durch Arthrose zum Beispiel, kann Hocker-Gymnastik machen. „Auch hier ist der DDB als Ratgeber Ihr bester Begleiter“, betonte Brückel. Den Zusammenhang zwischen Diabetes und Bluthochdruck zeigte Dr. med. A. Alexopoulos auf. In Vertretung für Dr. Gwendolyn Etzrodt referierte Dr. Harald Etzrodt zu „Arzt-Patient im Dialog“. Dieses Thema lag der Landesvorsitzenden besonders am Herzen. Eine gute Einstellung des Diabetes lässt sich nur durch das Zusammenwirken und die gute Kommunikation von Arzt und Patient erreichen. Prof. Dr. Ralf Lobmann ging auf die Thematik der „erektilen Dysfunktion“ ein. Dieses Thema dürfe kein Tabuthema sein. Sprechen Sie offen mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin darüber, riet Prof Lobmann. Seite 8 „Dieser Diabetikertag bietet von Hightech bis zur Biolösung alles an wichtigen Informationen für Diabetiker jeder Altersklasse und Art,“ beschrieb Prof. Holl die Ausstellung im Foyer des Stadthauses. Pharma­ unternehmen mit den neuesten technischen Highlights und regionale Dienstleister waren bei den Besuchern ebenso gefragt wie der Diabetikerhund „Laurin“, der gerade dafür ausgebildet wird, Unterzuckerung bei seinem Herrchen zu erschnüffeln, um diesen rechtzeitig zu warnen. In ihrem Schlusswort fasste Brückel zusammen: „Wenn wir dazu beitragen konnten, dass Sie durch diese Veranstaltung mehr Wissens über Ihren Diabetes und dadurch mehr Lebensqualität erhalten haben, dann sind wir sehr glücklich“. DDB LV BW Beitrag des Schatzmeisters Ausgabendisziplin und gute Erträge haben die Finanzen der ADBW 2013 deutlich stabilisieren können. Die ADBW konnte wieder ein kleines Polster anlegen, was der Arbeit des Vorstands in Zukunft den notwendigen Rückhalt geben wird. für Pflegekräfte und „Diabetes und Sport“ bevorzugt Zuwendungen zukommen zu lassen. Auch in 2013 haben wir aber klar erkennen müssen, dass die Geschäftsstelle für ihre Arbeit den Betrag braucht, den wir mit unserem neuen Mitgliederbeitrag einnehmen werden. An dieser Stelle möchte ich mich für das große Verständnis unserer Mitglieder für die Beitragserhöhung bedanken. Ich bin froh, dass wir nur sehr wenige Kündigungen hinnehmen mussten. Der Finanzplan für 2014 steht. Auf der Strategietagung wurde beschlossen, unseren Projekten Studentenseminar, Diabetes Mit Spannung erwarten wir auch die Umstellung unseres ADBW Kongresses vom Herbst auf den Sommer. Wir hoffen, dass Sie zahlreich im Juli nach Bad Boll kommen werden. Dann werden wir auch am Ende des Jahres 2014 eine erfreuliche Bilanz vorweisen können. Seite 9 Wolfgang Stütz Schatzmeister Arbeitsgemeinschaft Diabetologie Baden-Württemberg e.V. Regionale Gliederung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft ADBW Kongress Bad Boll 2014 – erstmals SOMMERKONGRESS! 11. und 12. Juli 2014 im Seminaris Hotel in Bad Boll Michael-Hörauf-Weg 2, 73087 Bad Boll +49-7164-8050 Die bewegt … sich Programm Stand 21.03.2014 Freitag, 11. Juli 2014 Beginn Ende Thema/Titel ReferentIn 9.00 — 13.00 ZERTIFIKATSFORTBILDUNG DiSko (Anmeldung erforderlich!) AG Diabetes & Sport 9.00 — 13.00 ZERTIFIKATSFORTBILDUNG bot leben Teil 1 (Anmeldung erforderlich!) Scholz Meißner-Single 9.00 — 11.00 Satellitensymposium Fa. Sanofi-Aventis SGLT-2 Hemmung durch Canagliflozin Diabetes Therapie und mehr Schulz 11.00 — 13.00 14.00 — 16.30 Plenum I 14.00 — 14.10 Begrüßung Holl/Gölz 14.10 — 14.45 Wie ungesund ist Übergewicht wirklich? Evidenz des Zusammenhangs BMI und Morbidität und gibt es die MHOs? (metabolical healthy obese) Diskussion der Daten Kern 14.45 — 15.20 Lebensstilintervention bei Menschen mit Typ 2 Diabetes Die Look AHEAD Studie kritisch bewertet Diskussion der Daten Klare 15.20 — 16.00 Bedeutung von Fitness und körperlicher Aktivität bei der Prävention des Typ 2 Diabetes Nieß 16.00 — 16.30 Bewegung und Gestationsdiabetes Eine geburtshilfliche und diabetologische Einschätzung Rasenack Laubner Satellitensymposium Allianz Boehringer Ingelheim GmbH & Co KG und Lilly Deutschland GmbH Herausforderung Typ 2 Diabetes: Neue, Insulin unabhängige Therapieoptionen für eine komplexe Erkrankung Mittagspause parallel Lunch-Symposium unterstützt durch AstraZeneca „Update der individualisierten Therapie des Typ 2 Diabetes“ Referenten Seufert/Laubner Seite 10 Gallwitz Stephan Kaffeepause 17.00 — 18.30 Plenum II 17.00 — 17.20 Einblick in die diabetologische Tätigkeit in Gambia Gaye 17.20 — 18.00 Optimale Ernährung für Menschen mit Diabetes bei Bewegung/Sport Tombek 18.00 — 18.30 Bewegung, sedentariness, Prävention Der sportwissenschaftliche Blick Schlicht Gemeinsames Grillbuffet im Garten ab 19.30 Uhr Samstag, 12. Juli 2014 Beginn Ende Thema/Titel ReferentIn Ab 7.00 Uhr Bewegung mit Spaß 9.00 — 11.00 Plenum III 9.00 — 9.50 Psychologie der Motivation Kulzer 9.50 — 10.20 Lebensstilintervention aus Patientensicht Polacek 10.20 — 11.00 Individuelle Mobilität im Zeichen der gesteigerten gesellschaftlichen Mobilität Borchert Kaffeepause 11.30 — 12.30 Plenum IV 11.30 — 12.30 Mitgliederversammlung Mittagspause parallel Lunch-Symposium unterstützt durch Novo Nordisk - Referent Gölz 14.00 — 17.00 Fortbildung „refresher“ Diabetes für Pflegekräfte 14.00 — 17.00 Workshop Psychologische Aspekte der Hypoglykämie 14.00 — 17.00 Insulinpumpentherapie 17.00 ZERTIFIKATSFORTBILDUNG bot leben Teil 2 (Anmeldung erforderlich!) – Voraussetzung Teilnahme an Teil 1 14.00 — Schnäbele Born Lippmann-Grob Schäfer AG Diabetes & Pumpe Dapp Scholz Meißner-Single Ende der Veranstaltung Wir bedanken uns bei den Sponsoren des wissenschaftlichen Programms Abbot Diabetes Care (1.200 €), AstraZeneca GmbH (3.700 €), Allianz Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG und Lilly Deutschland GmbH (2.500 €), Janssen-Cilag GmbH (1.200 €), Lilly Deutschland GmbH (1.200 €), Mediq Direkt Diabetes GmbH (1.200 €), mediaspects GmbH (600 €), Medtronic GmbH (1.200 €), Novartis Pharma GmbH (1.200 €), Novo Nordisk Pharma GmbH (2.700 €), Roche Diagnostics Deutschland GmbH (1.200 €), Sanofi-Aventis Pharma Deutschland GmbH (5.000 €) für Werbezwecke/Standkosten Seite 11 ADBW Diabeteskongress Baden-Württemberg 11./12. Juli 2014 Verbindliche Anmeldung bis 20. Juni 2014 Titel, Vorname, Name: ___________________________________________________________________ Straße: ___________________________________________________________________ PLZ / Ort: ___________________________________________________________________ E-Mail: ___________________________________________________________________ Übernachtung: □ EZ □ DZ mit: Name _____________________________________________ GEBÜHREN: (inkl. Tagungsbeitrag und ggf. Übernachtungskosten - bitte ankreuzen) □ Übernachtungsgäste: □ Mitglieder: 90 € Nichtmitglieder: 140 € Die Anreise muss bei reservierten Zimmern bis 18:00 h des Anreisetages erfolgen. Geschieht dies nicht, kann das Hotel über die Zimmer verfügen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Abendessen: 15 € Ich nehme am Abendessen teil: Tagesgäste: □ ja mit ____ Person/en Mitglieder: □ 35 € □ nein Nichtmitglieder: □ 70 € Der Gesamtbetrag in Höhe von ___________ € wird per einmaliger SEPA-Lastschrift eingezogen. Bitte füllen Sie dazu das umseitige SEPA-Lastschriftmandat aus und senden Sie den ausgefüllten Anmeldebogen bis spätestens 20.06.2014 an die ADBW Geschäftsstelle, Okenstr. 290 c, 77652 Offenburg. Stornierungen werden mit einer Bearbeitungsgebühr von 25 € berechnet, nach dem 20.06.2014 sind Stornierungen mit Rückerstattung nicht mehr möglich. Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgender/n Veranstaltung/en an: Freitag Vormittag (9-13 h) Samstag Nachmittag (14-17 h) □ SGLT-2 Hemmung durch Canagliflozin (9-11 h) □ Herausforderung Typ 2 Diabetes (11-13 h) □ Lunch-Symposium (13-14 h) - (AstraZeneca) □ Workshop Psychologische Aspekte der Hypoglykämie □ Insulinpumpentherapie □ Lunch-Symposium (12.30-13.30 h) – (Novo Nordisk) □ Zertifikatsfortbildung DiSko (09-13 h) □ Zertifikatsfortbildung bot leben (Teil 1) (09-13 h) Ich nehme am Mittagessen teil: □ ja □ nein □ Fortbildung „refresher“ Diabetes für Pflegekräfte □ Zertifikatsfortbildung bot leben (Teil 2) (Voraussetzung Teilnahme an Teil 1) Ich nehme am Mittagessen teil: □ ja □ nein -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich benötige folgende Bescheinigung/en (bitte ankreuzen): □ Teilnahmebescheinigung □ Teilnahmebescheinigung für Ärzte Seite 12 SEPA–Lastschriftmandat Zahlungsempfänger Arbeitsgemeinschaft Diabetologie Baden-Württemberg e.V. Okenstr. 290c 77652 Offenburg Gläubiger-Identifikationsnummer: DE12ZZZ00000113922 Mandatsreferenz: wird separat vergeben und erscheint auf der Rechnung Ich ermächtige (Wir ermächtigen) die ADBW, einmalig eine Zahlung von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von der Arbeitsgemeinschaft Diabetologie Baden-Württemberg e.V. auf mein (unser) Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber) Titel, Vorname und Name: Straße und Hausnummer: PLZ und Ort: Falls Kontoinhaber und Teilnehmer nicht identisch: Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für Name des Teilnehmers Kreditinstitut (Name): _____________________________________________________ IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ BIC: ________|___ Ort, Datum Unterschrift/en Seite 13 Gambia 2014 Mitte Februar 2014 flog eine Gruppe von 12 Personen, darunter Ärzte, Pflegepersonal und Mitglieder des Reutlinger DiabetesProjekt in Gambia e.V. nach Gambia. Dort wurden verschiedene Fach-Vorträge zum Thema „Diabetes und Schlaganfall“, Schlaganfall aus internistischer (Dr. Bettina Born), neurologischer (Dr. Volker Malzacher) und gefäßchirurgischer (Dr. Rainer Claußnitzer) Sicht für Ärzte und Pflegepersonal aus dem Royal Victoria Teaching Hospital, der Pakala Clinic und der Schwestern- und der Hebammenschule gehalten. Diese Fortbildung ist eine sehr kostenaufwändige Herausforderung, da die Referenten die Arbeitsausfall-, Anreiseund Verpflegungskosten für die Teilnehmer tragen müssen. Fortbildungsurlaub und finanzielle Unterstützung wie bei uns gibt es in Gambia nicht. Wer lernen und an einer Fortbildung teilnehmen will, muss alles selbst zahlen. Die vom Reutlinger Diabetes Projekt in Gambia e.V. angebotenen Schulungen ­waren, wie auch schon in den Jahren zuvor zu anderen Themenstellungen, sehr gefragt. Auch eine Fortbildung zur besseren ­Schu­lung von Menschen mit Diabetes Typ 1 und Typ 2 fand statt. Die Lower Basic School in Brufut sowie der „Waisenkindergarten“ standen auf der Besuchsliste und waren die eigentlichen Highlights der einwöchigen recht eng verplanten Reise. Natürlich durfte zum Abschluss der Besuch in der Pakala Clinic nicht fehlen, in der Sr. Sukai arbeitet und ihre „Diabetikerfüße“ behandelt und pflegt, streng nach Reutlinger Vorbild, so gut es geht. Der Erfolg ihrer Arbeit zeigt, dass ihre Hospitation in der Fußambulanz in Reutlingen (wir berichteten darüber) viel Gutes für die Kranken gebracht hat und bringen wird. Deshalb hat auch jeder unserer Mitreisenden Verbandsmaterial und Wundauflagen mitgebracht, um ein bisschen Kontinuität in der Wundversorgung zu ermöglichen. Wir danken allen Helfern für ihre Spende, war sie auch noch so klein. Jede ist niemals nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn viele Tropfen machen ein ganzes Meer. Seite 14 Eleonore Morville Fachkurs Diabetes der ADBW für Pflegekräfte Am 24. / 25. Oktober sowie am 21. November 2013 fand in Reutlingen in der Akademie der Kreiskliniken der Fachkurs für ­examinierte Pflegekräfte statt. Am Donnerstag, 24. November, konnten Dr. Bettina Born, KKH Reutlingen, Doris Schröder-Laich, KKH Reutlingen, Eleonore Morville, DDB/SHG Reutlingen sowie Klaus Notz, Leiter der Akademie der Kreiskliniken, die Anwesenden begrüßen. Die 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen überwiegend aus den Kliniken Reutlingen, Münsingen und Bad Urach. Auch vom Ambulanten Dienst des DRK, Diabetologie Nürtingen bis hin zur Chirurgie Landau waren sie angereist. Dieses Mal nahmen schon drei männliche Pflegekräfte an der Fortbildung teil, was die Hoffnung zulässt, dass die Anzahl der Männer im Bereich Pflege weiter zunimmt. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde ging es mit „Volldampf“ an den umfangreichen theoretischen Stoff: angefangen von den Blutzucker-Normalwerten für jeden Patien­ ten nach Lebensalter und Krankheitsbild (Dr. Bettina Born) über Ernährung (Gud­ run Giesecke, Ernährungsberaterin DDG), Stoffwechselentgleisungen, Insulininjek­tion, BZ-Kontrolle, Folgeerkrankungen (Doris Schröder-Laich, Diabetesberaterin DDG) bis hin zu Methodik und Didaktik in Schulungen (Regina Reinauer-Glahn, Diabetesberaterin DDG) am letzten Tag. Reutlinger Fortbildung steht für geballte Wissensvermittlung in allen den Diabetes betreffenden Bereichen, um den Teilnehmenden eine professionellere Diabetes­ behandlung, ein zuverlässiges Grundwissen und mehr Sicherheit bei ihrer Arbeit zu ermöglichen. Sehr erfreulich war die intensive und sehr interessierte Mitarbeit der Teilnehmenden. Auch das Erkennen, dass die Erkrankung Diabetes keine eigenständige Krankheit ist, wurde immer wieder betont. Der letzte Tag begann mit einer schriftlichen Wissenssicherung, anschließend gab es Feedback und Ausgabe der Zertifikate. Die Auswertung der Lernkontrolle fiel sehr positiv aus und beim Feedback wurden noch einige Vorschläge zur Intensivierung und Optimierung des Kurses gemacht. Die Übergabe der Zertifikate mit einer Rose beschloß einen wieder erfolgreichen und rundum gelungenen Kurs. Seite 15 Hochrangige Publikation von DPV-Daten Wissenschaft ist auch mittels QM-Daten möglich Viele ADBW-Mitglieder beteiligen sich an der Qualitätssicherung und am Benchmark der DPV-Initiative. Inzwischen erlaubt die riesige Datenbank nicht nur interessante Qualitätsvergleiche zwischen den teilnehmenden Zentren. Aus den Daten von insgesamt über 340 000 Patienten kann mittlerweile auch wertvolle, für die diabetologische Praxis nützliche wissenschaftliche Information gewonnen werden. So verwundert es nicht, dass kürzlich eine Arbeit unseres ADBW-Mitglieds Katharina Laubner aus Freiburg hochrangig online in DMRR publiziert wurde (doi: 10.1002/dmrr.2500). Diabetes/Metabolism Research and Reviews ist eine online publizierte wissenschaftliche Zeitschrift aus dem renommierten englischen Wiley-Verlag. Sie veröffentlicht Arbeiten zu Diabetes, Endokrinologie, Stoffwechsel und Obesitas mit einem ImpactFaktor von derzeit 2.968. Das Abstract ist verfügbar unter: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ dmrr.2500/abstract Wir gratulieren Frau Laubner herzlich zum Erfolg! Ausgewertet wurden Patienten mit Insulintherapie. Wie häufig werden NPH-Insulin bzw. Insulinanaloga über den Tag injiziert? Welche Dosen sind notwendig? Es wird berichtet, dass bei Typ-1-Diabetes NPHInsulin in über 40%, bei Typ-2-Diabetes in über 75% benutzt wird. Knapp 20% der Typ-1-Betroffenen spritzen Detemir, knapp 40% Glargin. Dabei sind die Ergebnisse jeweils vergleichbar, nämlich die glykämische Kontrolle (HbA1c bei Typ-1-Diabetes durchschnittlich jeweils bei mäßigen 8 %, bei Typ-2 bei 7,6 %) und die Häufigkeit von schweren Hypoglykämien (jeweils bei Typ-1 etwas über 11 %, bei Typ-2 4,5 – 5,6%). Nicht unerwartet liegen die Injektionshäufigkeiten deutlich auseinander, nämlich bei 1,9 (NPH), 1,8 (Detemir) bzw. 1,1 (Glargin) Basalinsulingaben pro Tag. Die adjustierten basalen Tagesdosen lagen bei Typ-1Diabetikern bei 0,36 IU/kg für NPH, 0,39 IU/kg für Detemir und 0,31 IU für Glargin, die durchschnittlichen Tagesgesamtdosen (also Basalinsulin plus Mahlzeiteninsulin) differierten zwischen 0,74 IU/kg bei Glargin, 0,76 IU/kg bei NPH und 0,81 IU/kg bei Detemir. Bei Typ-2-Diabetes wurden durchschnittlich täglich 1,6 Injektionen NPH, 1,4 Injektionen Detemir und 1,1 Injektionen Glargin vorgenommen. Die BasalinsulinTagesdosen betrugen im Durchschnitt 0,3 (NPH), 0,33 (Detemir) und 0,29 (Glargin) pro kg KG, die durchschnittlichen Gesamtdosen täglich 0,63 IU/kg bei NPH, 0,77 IU/kg bei Detemir und 0,67 IU/kg bei Glargin. Hochinteressant, aber durchaus mit den täglichen Beobachtungen übereinstimmend war also im Ergebnis, dass bei der Verwendung von Glargin der Bedarf an täglichen Injektionen, basalem und gesamten Insulinbedarf am niedrigsten war, mit Detemir der Bedarf basal und gesamt jedoch am höchsten, und dies bei gleich guten Ergebnissen, gemessen an HbA1c bzw. schweren Hypogly­ kämien. Diese Daten aus der realen Versorgungssituation von Menschen mit Diabetes in Seite 16 Deutschland zeigen Unterschiede der aktuellen Praxis der Insulintherapie, abhängig vom gewählten Basalinsulin-Präparat. Bei der Interpretation ist zu beachten, dass es sich um Beobachtungsdaten handelt, nicht um eine randomisierte Therapiestudie. Im Sinne der Versorgungs- und Therapie­ forschung werden also die aktuell durchgeführten Therapieentscheidungen dargestellt, nicht jedoch die Frage untersucht, welche Therapie überlegen ist. Die DPV-Datenbank ermöglicht Analysen zu zahlreichen weiteren relevanten Fragestellungen der Diabetologie bei Patienten mit Typ-1- oder Typ-2-Diabetes, aber auch bei Gestationsdiabetes oder seltenen genetischen Diabetesformen. Diabetologische Praxen, Kliniken oder Reha-Einrichtungen, die sich an der Initiative beteiligen möchten, finden alle Informationen unter http:// www.d-p-v.eu. Dr. Albrecht Dapp Spaichingen Studentenseminar „Diabetologie“ der ADBW am 16.05.14 –17.05.14 in Karlsruhe Nach einer Pause im letzten Wintersemester wird auch dieses Jahr wieder ein Studentenkurs der ADBW in Karlsruhe im Mai stattfinden. Es ist jetzt der 5. Kurs, den die ADBW veranstaltet. Der Kurs, der 2009 erstmals stattfand, hat sich mittlerweile sehr gut etabliert und wird von den Studenten jedes Jahr sehr gut angenommen. Er bietet eine kompakte und umfassende 2-tägige Einführung in wissenschaftliche und klinische Aspekte der Diabetologie. Auch Patientenvorstellungen und Kontakte mit Patientenorganisationen sind auf dem Programm. Wir sind sehr froh, dass wie beim vorangegangenen Kurs auch Prof. Helmut Mehnert seine Erfahrung als Diabetologe zusammenfasst und die Studenten Diabetologie der letzten 50 Jahre erfahren lässt. Verantwortlich: Prof. Dr. med. E. Siegel, Karlsruhe, Prof. Dr. B. Gallwitz, Tübingen Zielgruppe: Medizinstudenten im 2. und 3. Klinischen Semester Veranstaltungsort: St. Vincentius-Kliniken, Südendstr. 32, 76137 Karlsruhe Seminarraum in der Krankenpflegeschule 1. OG Raum Nr. I 108 – Die Krankenpflegeschule ist über den Seiteneingang von der Hirschstraße her zu erreichen (Haus H, I) Vorläufiges Programm Freitag, 16.5.2014 15:00 Einleitung, Grundlagen, Ziele (Siegel) 15:45 Pathophysiologie, Pathogenese: wichtige Aspekte (Gallwitz) 16:15 Grundlagen der Ernährung mit BE-Schätzung (Anja Hopf, Diabetesberaterin) 17:00 Kaffeepause mit Blutzuckermessung 17:30 Therapie Diabetes mellitus Typ 2 (Seufert) 18:15 Forschungsergebnisse und Forschungsschwerpunkte Uniklinik Freiburg (Seufert) 18:40 F allbeispiele Typ 2-Diabetes / Patientenvorstellung, Zukunftperspektive (Siegel, HD u. Siegel KA) 19:40 Ende der Veranstaltung 20:00 Gemeinsames Abendessen Seite 17 Samstag, 17.5.2014 08:30 Insulintherapie einschl. Pumpentherapie (Gallwitz) 09:30 Patientenvorstellung (Siegel) 10:00 Pause 10:30 Gefäßkomplikationen (Hammes) 11:15 Wissenschaft an der Uniklinik Mannheim (Hammes) 11:35 Hypoglykämie als Therapiekomplikation (Gallwitz) 12:00 Stellenwert der Bewegung bei Diabetes (Lücke) 12:30 Mittagspause mit Besichtigung der Diabetesstation 13:45 Fußsyndrom bei Diabetes, Neuropathie (Lobmann) 14:30 Fußgymnastik (Siegel) 15:00 Fallbeispiele Insulintherapie (Dieterle / Team) 15:35 Diabetes in der Praxis des Niedergelassenen (Stütz) 16:00 Pause 16:30 Forschung an den Universitätskliniken in Baden-Württemberg (Gallwitz) 17:00 50 Jahre Diabetestherapie (Prof. Mehnert) 18:00 Gelegenheit zum individuellen Gespräch / Diskussion und Abschluss mit kleinem Imbiss Ziel des Studentenseminars ist es, bei den in der Klinik kommen nicht zu kurz. Ein geStudenten das Interesse für Diabetologie meinsamer Abend der Studenten mit den zu wecken und ihnen in zwei Tagen ei- Kursdozenten lässt Raum für den individunen Einblick in die Diabetologie zu ge- ellen Austausch und ist ein gutes „Social Programme“, bei dem ben, ihnen die wichtigen in der „Dinner Speech” Forschungsprojekte der auch die Geschichte der Universitäten in BadenDiabetologie und deren Württemberg vorzustellen Karlsruher Besonderheiten und ein zusätzliches und immer gut ankamen. Die komplementäres Angebot Studenten haben für die eine zu den Lehrangeboten an Übernachtung eine gute den Heimatuniversitäten zu Unterbringungsmöglichkeit geben. Der Kurs hat auch in Karlsruhe. ganz praktische Teile mit Übungen in Kleingruppen Wir freuen uns auf den zusammen mit Ärzten fünften Studentenkurs und Diabetesberatern. Diabetologie der ADBW Auch Patienten und die Patientenorganisationen Prof. Mehnert mit Prof. Siegel und Prof. in Karlsruhe vom 16.5. – 17.5.14, das endgültige haben in beiden Kursen Gallwitz beim letzten Studentenkurs einen sehr wichtigen und wertvollen ak- Programm mit allen Referenten und den tiven Part übernommen, um den Aspekt genauen Uhrzeiten der einzelnen Themen „Leben mit Diabetes“ und die Aspekte der wird im April zirkuliert. Selbsthilfe und politischer Patientenarbeit hautnah erleben zu lassen. Auch Themen Prof. Dr. Baptist Gallwitz wie Praxisorganisation und Diabetologie Prof. Dr. Eberhard Siegel Seite 18 Diabetologische Ausbildung junger Ärzte in der ADBW Warum ein zusätzliches Ausbildungs­ angebot für den ärztlichen Nachwuchs im Fach Diabetologie? Nach langem Studium inklusive praktischem Jahr, sollte man doch annehmen, sind ausreichende Kennnisse vorhanden. Leider sprechen die Erfahrungen im ­klinischen Alltag klar dagegen. Woran liegt es? Neben einer abnehmenden Zahl an diabetologischen Ausbildungsstätten im universitären Bereich (Ordinariaten) gibt es in Deutschland bei einer Gesamtzahl von ­ca. 2.080 Krankenhäusern nur ca. 160 anerkannte diabetologische Einrichtungen. Insgesamt gibt es nur wenige diabetologische Fachabteilungen. Dies vor dem Hintergrund, dass ein großer Teil der stationären Patienten an Diabetes mellitus leidet, auch wenn dies nicht die Aufnahmedia­ gnose ist. So leidet ca. ein Drittel der Herzpatienten an einem Diabetes mellitus. Die Diabetestherapie steht hier jedoch nicht im Vordergrund, was sich allerdings während des stationären Aufenthaltes schnell ändern kann. Hier besteht (nicht nur) bei den Jungassistenten eine große Unsicherheit, wie sie mit entgleisten Blutzuckerwerten umgehen sollen. Im Rahmen der klinischen Gesamtsituation kann meist die häusliche Diabetestherapie nicht einfach übernommen werden, entweder weil die Therapie nicht suffizient oder kontraindiziert (Stichwort Metformin) ist, oder aber die Präparate schlicht nicht vorhanden sind. Nicht wenige Patienten kommen auch wegen entgleister Blutzuckerwerte zur Aufnahme. In all diesen Fällen ist das zentrale Medikament Insulin. Gerade der Umgang mit ei- ner Insulintherapie wird in der Ausbildung kaum trainiert. Wohl auch, weil die „Ausbilder“ hiervon selber nicht genug verstehen und die Diabetologie nebenbei betrieben wird. Tatsache ist aber, dass eine schlechte diabetologische Versorgung nicht nur zu mehr Komplikationen führt, sondern auch die Hospitalisierungszeiten verlängert. Ein wesentliches Ziel dieses Fortbildungsangebots ist daher, den Umgang bzw. die Einleitung einer Insulintherapie anhand praktischer Beispiele zu üben. Es soll den Nachwuchskräften Handlungsschemata an die Hand geben, damit die Scheu vor der Insulintherapie genommen wird und nicht unüberlegtes „Nachspritzen“ („Blutzucker beim Infarktpatient 250? Geben Sie 8 IE Alt“) der Standard ist. Neben dem Üben der Insulintherapie werden aber auch besondere Aspekte der klinisch-diabetologischen Versorgung wie Ernährungstherapie, Vermeiden von Komplikationen und spezielle klinische Situationen (z.B. Intensivstation, Kortisontherapie etc.) beleuchtet. Nicht zuletzt soll auch das Interesse an der Diabetologie geweckt und deren Bedeutung vermittelt werden. Gerade die ADBW als größte Regionalgesellschaft innerhalb der DDG sieht sich in der Nachwuchsförderung in einer besonderen Verantwortung. Hier soll nicht unerwähnt bleiben, dass bereits seit vielen Jahren durch die ADBW erfolgreich Studentenseminare in Karlsruhe durchgeführt werden. Die erste Assistenzärzte-Veranstaltung wird am 11.10. 2014 in Heidelberg stattfinden. Die Fortbildung wird von erfahrenen Referenten durchgeführt und soll ohne Sponsoring auskommen, weswegen ein Unkostenbeitrag in Höhe von 70 € erhoben wird. Seite 19 Michael Morcos Arbeitsgemeinschaft Diabetologie Baden-Württemberg Geschäftsstelle / J. Braun Okenstr. 290 c 77652 Offenburg Aufnahmeantrag / Beitrittserklärung zur Arbeitsgemeinschaft Diabetologie Baden-Württemberg Die ADBW strebt die Verwirklichung moderner Qualitätsstandards in der Betreuung von Diabetikern an, insbesondere sollen die interdisziplinäre Zusammenarbeit gefördert und diabetesgerechte Behandlungsstrukturen durchgesetzt werden. O O Ich bin bereits Mitglied der DDG und erkläre hiermit meine Mitgliedschaft in der ADBW. Ich bin nicht Mitglied der DDG. Ich beantrage die Mitgliedschaft in der ADBW. Ich erkläre, dass ich mich mit Engagement für die Interessen der ADBW einsetzen werde. _____________________________________________________________________________ Ort / Datum Unterschrift Antragsteller: Titel: _________ Name: _____________________________ Vorname: ___________________ Beruf: ____________________________________________ Funktion: ___________________ Dienstadresse: Institution: _______________________________________________________________ Strasse: _______________________________________________________________ Plz, Ort: _______________________________________________________________ Tel.: ___________________________________ Fax: _______________________ E-Mail: _______________________________________________________________ Privatadresse: Strasse: _______________________________________________________________ Plz, Ort: _______________________________________________________________ Tel.: ___________________________________ Fax:_______________________ E-Mail: _______________________________________________________________ Ich bin damit einverstanden, dass meine obige Dienstadresse O auf der Homepage der ADBW hinterlegt O bei Anfragen von Krankenkassen oder KVen an diese weitergegeben wird. Die Mitgliederzeitschrift ADBWpublik sowie die Korrespondenz soll an folgende Adresse gesandt werden: O Dienstadresse O Privatadresse Bürge: Als Arzt und Mitglied der Deutschen Diabetes Gesellschaft bin ich der Ansprechpartner für den o.g. Antragsteller und bürge für sein Interesse an der Versorgung von Diabetikern. _____________________________________________________________________________ Name in Druckbuchstaben Ort, Datum Unterschrift SEPA-Basislastschrift-Mandat Zahlungsempfänger Arbeitsgemeinschaft Diabetologie Baden-Württemberg e.V. Okenstr. 290c 77652 Offenburg Gläubiger-Identifikationsnummer: DE12ZZZ00000113922 Mandatsreferenz: wird separat in der Beitrittsbestätigung mitgeteilt Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den oben genannten Zahlungsempfänger, den Jahresbeitrag nach Eingang des Lastschriftmandats und in den Folgejahren zum 15. Januar von meinem (unserem) Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von der Arbeitsgemeinschaft Diabetologie Baden-Württemberg e.V. auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber) Vorname und Name: Straße und Hausnummer: PLZ und Ort: Falls Kontoinhaber und Mitglied nicht identisch: Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für den Jahresbeitrag von Name des ADBW Mitglieds Kreditinstitut (Name): _____________________________________________________ IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ BIC: ________|___ Ort, Datum Unterschrift/en Seite 21 Berufspolitik 2014: Ein Überblick EBM-Reform 2013 Mit dem erklärten Ziel, hausärztliche Grundversorgung zu stärken, wendet sich der neue EBM gegen Praxen, die vom hausärztlichen Versorgungsspektrum abweichen. Leider fallen auch die diabetologischen Schwerpunktpraxen darunter. Geplant war anfangs, die Grundpauschale und den Chronikerzuschlag für überwiesene Patienten zu streichen. Auf Grund starker Gegenwehr und der Unterstützung einiger Landes KVen (hier ist besonders die KVBW hervorzuheben) ergibt sich jetzt eine Lösung, die annähernd das bisherige Einnahme-Niveau wieder herstellt. (EBM 03010, 03040 zur Hälfte und 03220 plus evtl. 032030). Es handelt sich dabei um einen Grundbetrag, der nur unzureichend den großen Aufwand im Umgang mit unseren multimorbiden Diabetespatienten widerspiegelt. Die vom BVND in diesem Zusammenhang geforderten diabetesspezifischen Leistungsziffern im EBM wurden leider nicht umgesetzt, so dass die diabetologische Schwerpunktpraxis auch zukünftig überwiegend von den DMP-Verträgen leben muss. DMP-Verträge Die neue Bundesregierung will an den DMP-Verträgen festhalten. Das ist eine gute Nachricht. Auch aus der KVBW ist zu vernehmen, dass die bisherige Strategie der Kassen, die Verträge immer nur für 2 Quartale zu verlängern, einer langfristigen Festschreibung weichen soll. Diese Entscheidung war seit langem fällig und sichert den Erhalt der niedergelassen Diabetologie. Das nächste Ziel muss die Anpassung der Schulungstarife und der Ziffern für die Behandlung des diabetischen Fußes nach über 20 Jahren sein. Dafür wer- den wir auch zukünftig kämpfen müssen, denn eines ist sicher: die Kosten der Praxen sind in den vergangenen 20 Jahren gestiegen und werden weiter steigen. Zum Thema DMP-Einschreibung, das ausführlich im letzten Heft besprochen wurde, gibt es noch keine neuen Erkenntnisse. Auch andere Kassen neben der AOK haben der KV Fälle vorgelegt, in denen DMPZiffern bei nicht eingeschriebenen Patienten abgerechnet worden waren. Man ist sich über die juristische Einordnung noch nicht einig. Wir werden davon aber noch hören. Ein weiteres unangenehmes Thema sind die Qualitätsberichte für das DMP Typ 1 und besonders Typ 2. Wie man auf der Homepage der KVBW nachlesen kann, entwickeln sich die indikationsspezifischen Berichte zum Negativen hin. Es werden weniger Qualitätsziele erreicht als noch vor einigen Jahren. Die KV Thüringen hat hier bereits reagiert. Praxen mit schlechten Qualitätsberichten erhalten einen Honorarabschlag. So weit sind wir in BW noch nicht. Allerdings wird man einer qualitativen Negativentwicklung mittelfristig nicht einfach kommentarlos zusehen. Die KV wird die Schwerpunktpraxen zu diesem Thema informieren. Selektivvertrag Diabetes Der Vorstand der Diabetesgenossenschaft Baden-Württemberg hat seine Mitglieder zur Jahreswende darüber informiert, dass die Umsetzung des Facharztvertrages Diabetes weiter im Ungewissen liegt. Trotz des Wunsches der AOK, den Vertrag zügig umzusetzen, liegt das Problem an dem hohen personellen und finanziellen Aufwand, den ein jeder 73c Vertrag mit sich bringt. Die Gruppe der Diabetologen ist mit ca. 80 Mitgliedern klein, und es können nur wenige Patienten erreicht werden. Seite 22 MEDI hat Ende 2013 den Facharztvertrag für die Orthopäden fertig gestellt. Als nächstes wären die Urologen an der Reihe und dann wäre die Reihe an uns. Die Genossenschaft hat jedenfalls die Vorarbeiten geleistet. Das Vertragskonzept steht und die erforderlichen Daten liegen auf dem Tisch. Wolfgang Stütz Neue Leitlinie – interessante neue Aspekte Die European Society of Cardiology (ESC) und die European Society for the Study of Diabetes (EASD) haben eine neue gemeinsame Leitlinie zu Diabetes, Prädiabetes und kardiovaskulären Erkrankungen veröffentlicht und auf ihren Jahreskongressen besprochen. Sie macht auf wichtige Gesichtspunkte aufmerksam. Da (Typ-2-)Diabetes von Anfang an eine kardiovaskuläre Erkrankung darstellt, müssen deren Komplikationen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall von Anfang an vermieden werden, möglichst durch intensive und strukturierte interdisziplinäre Zusammenarbeit von Hausärzten, Diabetologen und Kardiologen. Präventiv wirken in erster Linie LebensstilModifikationen wie Nikotinkarenz, körperliche Bewegung und Gewichtsreduktion (oder zumindest -stabilität). Medikamentös gehören dazu eine optimale Einstellung einer arteriellen Hypertonie (Ziel < 140/85 mmHg, bei Nierenerkrankung < 130/80, bei erhöhtem Schlaganfallrisiko noch niedriger), Statine bei erhöhtem LDL-Cholesterin bzw. bekannter KHK (LDL-Ziel < 100, bei „sehr hohem Risiko“ – s.u. – < 70 mg/dl), ACEHemmer (AT-1-Blocker) oder Betablocker bei Herzinsuffizienz und Antikoagulation bei VHF. Die Erfassung eines Diabetesrisikos erlaubt der einfache Findrisk-Fragebogen (http:// diabetes-risiko.de); eine Diabetesdiagnose erlaubt ein HbA1c-Wert über 6,5 %. Ein Wert darunter schließt einen solchen allerdings nicht aus. Ein HbA1c-Ziel von 6,0 – 6,5% gilt für jüngere Patienten mit kürzerer Krankheitsdauer, langer Lebenserwartung ohne relevante kardiovaskuläre Vorerkrankungen. Bei älteren Patienten mit langer Krankheitsdauer und Folgekomplikationen liegt dieses bei 7,5 – 8%. Alle Diabetespatienten haben ein „hohes“, alle Patienten mit zusätzlichen kardiovaskulären Erkrankungen ein „sehr hohes (kardiovaskuläres) Risiko“. Medikamentös wird in erster Linie Metformin empfohlen, bei nicht ausreichender Wirksamkeit in Kombination mit anderen oralen Antidiabetika bzw. Insulin. Sulfonylharnstoffe sind zwar wirksam, jedoch häufig nur begrenzte Zeit bis zum „Sekundärversagen“, besitzen aber auch ein Risiko für Hypoglykämien und Gewichtszunahme. DPP-4-Inhibitoren besitzen diese Risiko nicht, konnten bisher nur die Nichtunterlegenheit für kardiovaskuläre Ereignisse in den abgeschlossenen Studien (EXAMINE, SAVOR-TIMI-53), nicht aber eine erhoffte Risikoverminderung belegen. Zu den SGLT-2-Inhibitoren gibt es noch keine Ergebnisse. Herzinsuffizienz ist bei Diabetespatienten zwei- bis sechsfach häufiger. Dann sind Glitazone kontraindiziert (bei uns sowieso zu Lasten der GKV nicht verordnungsfähig), DPP-4-Inhibitoren umstritten. Seite 23 Albrecht Dapp Arbeitsgemeinschaft Diabetologie Baden-Württemberg e.V. AK Diabetes & Sport Regionale Gliederung der Deutschen Diabetes-Gesellschaft „Diabetes und Bewegung“ 15. Workshop für alle, die Diabetiker in Bewegung bringen Samstag, 28. Juni 2014 Ort: Hegau-Bodensee Klinikum Hausherrenstr. 12, 78315 Radolfzell Leitung: Dr. med. Wolf - Rüdiger Klare Internist, Diabetologe, Chefarzt Diabeteszentrum Hegau-Bodensee-Klinikum Radolfzell Der mittlerweile 15. Workshop "Diabetes in Bewegung" am 28. Juni 2014 in Radolfzell bietet wieder ein sehr vielseitiges Programm (siehe unten). Die theoretischen und praktischen Beiträge richten sich an Übungsleiter von Bewegungsgruppen, Trainer in Fitnessstudios, an Angehörige der Beratungsberufe und Ärzte. Die Organisatoren freuen sich wieder auf einen regen Austausch und einen schönen Tag am Bodensee Vorläufiges Programm: 09.30 Uhr Begrüßung/Vorstellung der Teilnehmer 09.45 Uhr „Lebe Balance“ – Zur Stärkung der psychischen Gesundheit (Rieke Raphael, Sportwissenschaftlerin der AOK Mittlerer Oberrhein) 10.45 Uhr Praxisworkshops (je 60 Min. im Wechsel): • Yoga zum Kennenlernen (N.N.) • Spielerisches Herz-Kreislauf-Training (Holger Haist, Sportfachkraft AOK Mittlerer Oberrhein) 13.00 Uhr Mittagspause 14.00 Uhr Laienreanimation mit dem Defi – mit Praxis (Dr. Bernhard Walter, Breisach) 14.30 Uhr Nervenschäden bei Diabetes (Neuropathie). Was ist zu beachten beim Sport. (Thomas Hönig, Internist/Diabetologe, Rheinfelden) 15.30 Uhr Abschlussrunde Kosten: 25 € pro Person inkl. Mittagessen Bitte melden Sie sich unter Angabe Ihres vollständigen Namens und Adresse per E-Mail an [email protected] bis spätestens 10. Juni 2014 an. Der Workshop wird mit 5 Fortbildungspunkten für die Verlängerung von Übungsleiterlizenzen im Rehabilitationssport (Lizenzbereich "Innere Medizin") anerkannt. VDBD-Fortbildungspunkte: 8,5 Punkte. Seite 24 Bericht über den EASD Das 49. jährliche Treffen der EASD fand vom 23. bis 27. September 2013 in Barcelona statt. Gut besucht waren die Vorträge „UKPDS: 15 years from Barcelona“ Zweifellos war die United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) die erste und größte Studie, in der die Wirksamkeit antidiabetischer Therapie bei Typ 2 Diabetes gezeigt wurde. Gewürdigt wurde Prof. Robert Turner, der 1976 die Studie konzipierte und 1999 überraschend verstarb. Seine Witwe war anwesend, somit hatte diese Vortragsreihe auch eine persönliche Note. Die wichtigsten Studienergebnisse fassten die Autoren wie folgt zusammen: Während einer Therapiedauer von 10 Jahren ergab sich in der intensivierten Gruppe eine Verbesserung des HbA1c im Durchschnitt um 0,9% (7,0 vs 7,9%). Dies führte zu einer signifikanten Reduktion mikro­vaskulärer Endpunkte, nicht jedoch im makrovaskulären Bereich. Die intensivierte Blutdruckeinstellung ergab jedoch einen fast doppelt so hohen Benefit sowohl bei den mikrovaskulären als auch bei den makrovaskulären Folgeschäden. 2007 wurden in Rom die Daten der 10-jährigen Nachbeobachtung vorgestellt. Die Reduktion der Gesamtsterblichkeit und die Reduktion der Herzinfarkte erreichten nun statistische Signifikanz („legacy-effect“). Die Sulfonylharnstofftherapie wurde in einer Substudie der UKPDS nach 7 Jahren Studienteilnahme näher beleuchtet. Aus dem intensiven Arm wurden 537 Patienten unter maximaler SU-Therapie und einem Nü-BZ >106 mg/dl randomisiert, entweder in die Fortführung der Therapie oder die Zugabe von Metformin mit dem Ziel eines Nü-BZ < 108 mg/dl, bei einem follow-up nach 6,6 Jahre. Die Kombinationstherapie zeigte doppelt so hohe diabetesbezogene Todesfälle, wobei in Bezug auf Herzinfarkt, Schlaganfall und mikrovaskuläre Schäden keine Unterschiede bestanden. In der Nachbeobachtungszeit bis 2007 verlor sich dieser Effekt. DPP-4-Hemmer sind sicher! Gemäß den Vorgaben der FDA von 2008 muss für neue Antidiabetika die Nichtunterlegenheit im Vergleich zur Standardtherapie nachgewiesen werden. Die Daten der EXAMINE-Studie belegen dies für Alogliptin (in Deutschland nicht im Handel). Savor-TIMI 53 konnte dies für Saxagliptin zeigen. SOS-Studie: Bariatrische Chirurgie gleich Diabeteschirurgie? Trotz veralteter Methoden wie Magenband (19%), vertikale Gastroplastie (68%) und Magenbypass (13%) konnte von ca. 2000 operierten Patienten (Einschluss 1997– 2001) nach 15 Jahres eine Risikoreduktion von 78% für das Neuauftreten eines Diabetes verzeichnet werden (NNT 4,6). Es wurden 375 adipöse Typ 2 Diabetiker operiert. Die Diabetesremission lag nach 2 Jahren bei 70% und reduzierte sich nach 15 Jahren auf 30%, war aber noch 6 x höher war als in der Kontrollgruppe. Die Inzidenz von Diabetes-Folgeschäden, die eine stationäre Therapie erforderlich machten, wurde nach 20 Jahren um 54% reduziert. Nach bisherigem Wissensstand profitieren Patienten ohne Diabetes mit einem BMI > 40 kg/m² und Patienten mit Diabetes ab einem BMI von 35 kg/m². Fazit: Es war allemal eine lohnende Woche in einer interessanten Stadt. Seite 25 Brigitte Ruh-Daikeler Der Visitenbogen Gestationsdiabetes am HBH-Klinikum Singen / Radolfzell – ein nützliches Hilfsmittel Entsprechend der aktuellen S3-Leitlinie Gestationsdiabetes DDG/DGGG 2011 sind die Blutzucker-Zielwerte für die Mutter abhängig vom Wachstum des Feten. Es wird ab der 24. Schwangerschaftswoche (SSW) die Messung des Abdominalumfangs des Feten (AU) mittels Ultraschall empfohlen. Diese Messung sollte alle 2 – 3 Wochen erfolgen. Liegen die Werte innerhalb der 10. bis 75. Perzentile, gelten als Grenzwerte Nü < 95 mg/dl und 1h nach Beginn einer Hauptmahlzeit < 140 mg/dl. Liegt der Werte unterhalb der 10. Perzentile, besteht der Verdacht auf eine intrauterine Wachstumsretardierung. Jetzt gelten höhere Obergrenzen: Nü < 105 mg/dl und 1 h postprandial < 160 mg/dl. Wenn sich Hinweise auf eine Makrosomie ergeben, sind Wert von ­nü 85 mg/dl und 1 h postprandial von < 120 mg/dl anzustreben. Es liegt auf der Hand, dass bei diesen Vorgaben der betreuende Diabetologe rasch über das Ergebnis der Ultraschalluntersuchungen informiert sein muss, will er die Schwangere gut beraten. Umgekehrt muss auch der Gynäkologe wissen, ob die Blutzuckereinstellung den Zielvorgaben entspricht. Es ist also ein Visitenbogen erforderlich, der in den Mutterpass eingelegt werden kann und als Kommunikationsmittel zwischen Gynäkologen und Diabetologen fungiert. Ein solches Einlegeblatt wird von der DDG zur Verfügung gestellt (www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/fileadmin/Redakteur/ Leitlinie/1_Einlegeblatt_Mutterpass_mg_ dl.pdf). An unserer Klinik haben wir einen Visitenbogen entwickelt, der etwas einfacher gestaltet ist (er enthält z.B. nicht die Perzentilenkurven), dafür wird deutlicher zwischen der Dokumentation des Gynäkologen und der des Diabetologen getrennt (siehe Abb. 1 und 2). Die Kommunikation funktioniert nach meinen Erfahrungen bei Verwendung dieses Bogens sehr gut. Die Benutzung eines der genannten Instrumente kann nur empfohlen werden (Kontakt: [email protected]). Seite 26 Wolf-Rüdiger Klare Erfolgreicher DiaWalk in Tuttlingen Unter dem Motto „Lauf Dich gesund“ nahmen mehr als 130 Teilnehmer aller Altersklassen 9. November 2013 am DiaWalk teil. Dies ist eine erfreuliche Verdopplung der Teilnehmerzahl gegenüber dem vorigen Jahr. Veranstaltet wurde er vom Runden Tisch Diabetes, einem Arbeitskreis der Kommunalen Gesundheitskonferenz Landkreis Tuttlingen, unter der Schirmherrschaft von Landrat Stefan Bär, der die Teilnehmer vor dem Start begrüßte und das Startsignal gab. Der Deutsche Diabetiker Bund war mit einem Infostand vertreten. Die Veranstalter freuten sich über die überwältigende Resonanz und dankten allen, die diese Veranstaltung unterstützt haben. Start und Ziel war beim Tuttlinger Freizeitund Thermalbad TuWass, das für diese Aktion gewonnen werden konnte. Schon ab 13.00 Uhr waren die zahlreichen Messplätze unter der Regie von Dr. Albrecht Dapp und seinem Team vom Diabeteszentrum Spaichingen im Foyer des Thermalbades von sportlich gekleideten Menschen belagert, die sich Blutdruck und Blutzucker messen ließen. Bei trockenem, aber teilweise etwas frischen Temperaturen ging es pünktlich um 14.00 Uhr mit einer Aufwärmrunde unter Anleitung von Elke Beiswenger vom TSF Tuttlingen los. Alle machten begeistert mit. Die Führung der Walker und Nordic Walker übernahm in bewährter Weise Klaus Waitschull auf seinem roten Fahrrad. Ihm folgte eine bunte Gruppe in gelben T-Shirts, die es als Belohnung für die Teilnahme gab. Menschen mit oder ohne Diabetes gingen gemeinsam auf die Strecke rund um das Thermal- und Freizeitbad, auf einer Runde von 3 oder 5 km Länge. Die ganz gut Trainierten machten sich auf die sogenannte 11er-Runde, die über elf Kilometer an der Donau entlang verläuft. Dafür gab es dann bereits den ersten Stempel im Gutscheinheft des Bades. Dies ist ein weiterer Ansporn für alle Teilnehmer, sich auch künftig regelmäßig zu bewegen. Dr. Albrecht Dapp marschierte begeistert als gutes Beispiel bei der 11er-Runde mit. Die Teilnehmer wurden durch die Mitglieder des TSF Tuttlingen rund um die Veranstaltung optimal betreut. Durch Fahrradeskorten wurden die Walker unterwegs mit Bananen als so genannten Sport-BEs rasch versorgt. Streckenposten wiesen unterwegs den richtigen Weg. Der Spaß an der Bewegung und das gemeinsame Erlebnis standen im Vordergrund dieser Veranstaltung. Daher konnten sich die Teilnehmer unterwegs gut über ihre Erfahrungen austauschen. Viele Helfer versorgten den ganzen Nachmittag über die Sportler mit Getränken, Obst und Hefezopf. Die anschließenden Blutdruckund Blutzuckermessungen zeigten, dass sich Bewegung auf diese Werte sehr positiv auswirkt. Jeder Teilnehmer holte sich anschließend seine Urkunde mit den gemessenen Werten ab. Damit konnte dann das Thermalbad kostenlos besucht werden. Es war ein erlebnisreicher Nachmittag, der allen Beteiligten sehr viel Spaß gemacht hat. Veranstalter und Teilnehmer sind sich einig: Das machen wir nächstes Jahr wieder! Anmerkung: Der Termin für den DiaWalk 2014 ist der 8. November 2014. Helga Dressler Seite 27 Stationäre Rehabilitation bei Diabetes mellitus Die Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist die Verbesserung des Zustands oder das Abwenden einer Verschlechterung bei Erkrankungen oder Behinderungen, die länger als sechs Monate bestehen. Bei chronischen Erkrankungen wie dem Dia­betes mellitus besteht daher häufig die Indikation für eine Rehabilitationsbehandlung. Zuständiger Kostenträger ist bei Patienten im erwerbsfähigen Alter bei Erfüllen der versicherungsrechtlichen Voraussetzungen in der Regel die gesetzliche Rentenversicherung. Diese stellt als Behandlungsziel den Erhalt beziehungsweise die Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit in den Mittelpunkt. Für alle anderen Patienten, also auch bei allen Altersrentnern, ist die Krankenversicherung Träger der Reha. Hier steht der Gesundheitszustand als Behandlungsziel im Vordergrund, mit einem Schwerpunkt darauf, Pflegebedürftigkeit abzuwenden oder eine Verschlechterung zu verhindern. Die stationäre Rehabilitation ist grundsätzlich multimodal und interdisziplinär ausgerichtet. Neben der ärztlichen Betreuung sind Physiotherapeuten, Diät­assistenten, Psychologen, Ergotherapeuten und Sozial­ arbeiter im Behandlungsteam. In RehaKliniken, die von der DDG als Behandlungseinrichtungen zertifiziert sind, ist die Betreuung durch Diabetologen und Diabetesberater DDG gewährleistet. Eine statio­ näre Rehabilitation wird in der Regel für einen Zeitraum von drei Wochen gewährt. Dieser bietet einen optimalen Rahmen für eine Optimierung der Diabetestherapie, eine strukturierte Schulung ohne die Ablenkung durch Anforderungen des Alltags, und um Bewegungstherapie sowie ganz allgemein die Modifikation von LifestyleFaktoren zu initiieren. Gerade was die Änderung von Ernährungs- und Bewegungs- verhalten angeht, ist das praktische Erleben in der Reha ebenso hilfreich wie die psychologische Unterstützung. Medizinische Rehabilitation ist eine Antragsleistung. Es gibt zwei Zugangswege. Der klassische Weg zu einem Heilverfahren ist der Antrag durch den behandelnden Hausarzt oder Facharzt beim zuständigen Kostenträger. Dieser Antrag wird geprüft durch den MDK bzw. den ärztlichen Dienst der Rentenversicherung. Entsprechend müssen in dem Antrag der Rehabedarf, die Rehafähigkeit und die Rehaprognose nachvollziehbar dargestellt werden. Der Reha-Bedarf ergibt sich einerseits aus einer Darstellung der vorliegenden Erkrankungen beziehungsweise Behinderungen, mit besonderem Augenmerk auf Funktionseinschränkungen und deren Auswirkung im Alltag und insbesondere auf die Erwerbsfähigkeit. Die bisherigen Behandlungsmaßnahmen sollen auch dargestellt werden, um den Einwand zu entkräften, dass noch Seite 28 nicht alle ambulanten Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Ein wesentliches Argument ist das Vorliegen unterschiedlicher Problemstellungen, die zur Behandlung ein multimodales, interdisziplinäres Vorgehen erfordern. Hier gibt der Kieler Algorithmus1 eine in der Reha-Forschung anerkannte Argumentationshilfe für den Reha-Bedarf. Wenn fünf oder mehr Berufsgruppen für die umfassende Behandlung notwendig sind, definieren die Autoren das als Bedarf für eine stationäre Rehabilitation. Mehrere Erhebungen bei gesetzlich Krankenversicherten2 zeigten einen Reha-Bedarf bei etwa 20% der befragten Probanden. zeitnahen, d. h. innerhalb von maximal vierzehn Tagen anzutretenden, Rehabilita­tion nach akutmedizinischem Aufenthalt. Bei AHB-Anträgen bei der Deutschen Renten­ versicherung erfolgt zur Beschleunigung des Verfahrens keine medizinisch-ärztliche Überprüfung, sondern nur der Abgleich der Reha-Diagnose mit der Liste der Indika­ tionen für eine AHB durch den Sachbearbeiter. Die Reha-Fähigkeit definiert sich aus der Fähigkeit, die Rehabilitationseinrichtung erreichen und am Therapieangebot auch teilnehmen zu können. Die stationäre Rehabilitation ist ein Sektor der Versorgung von Menschen mit Diabetes, der in der derzeitigen Situation des Gesundheitssystems eine sinnvolle Ergänzung zur ambulanten und akutstationären Versorgung darstellt. Der multifaktorielle Ansatz, die Möglichkeit, praktische Erfahrung zu sammeln, und die Mitbehandlung von Begleiterkrankungen, und das alles in einem vernünftigen Zeitrahmen, ist bei einer chronischen Erkrankung wie dem Diabetes mellitus ein wertvolles Angebot. Für die Reha-Prognose muss dargestellt werden, welche der zuvor beschriebenen Einschränkungen sich voraussichtlich durch die Reha-Maßnahme verbessern lassen, beziehungsweise wo sich eine drohende Verschlechterung abwenden lässt. Sollte der Reha-Antrag trotz guter Begründung abgelehnt werden, lohnt es sich auf alle Fälle, Widerspruch einzulegen. Eine Besonderheit stellt die Anschlussheilbehandlung dar. Diese Maßnahme dient der Für die Hauptdiagnose Diabetes mellitus umfasst die Indikationsliste nahezu alle Fälle, die auch den Krankenhausaufenthalt begründen (s. Tab.). Insbesondere unter dem Gesichtspunkt der kurzen Liege­ zeiten durch den Druck des DRG-Systems eröffnet sich hier die Möglichkeit einer weiteren stationären Behandlung, z. B. bei weiterhin instabiler Stoffwechsellage, Akzeptanzproblemen oder beim diabetischen Fuß-Syndrom. Über die Anschlussrehabilitation über die gesetzlichen Krankenversicherungen wird allerdings auch vom MDK entschieden. Sie bedarf deshalb ­einer ebenso detail­lierten Begründung wie die Heilverfahrens­anträge. Seite 29 Abbildung 1: (nach 1 Dodt et al.) Tabelle 1: Indikationen für eine Anschlussheilbehandlung (AHB) bei Diabetes mellitus nach stationärer Krankenhausbehandlung (aus: AHB Anschlussrehabilitation, DRV Bund 20083): • Unzureichende Stoffwechselkontrolle • Rezidivierende Hypoglykämien • Makro- oder mikrovaskuläre Folgekrankheiten (KHK, cerebrale Durchblutungsstörungen, pAVK; diabetische Retinopathie, PNP oder Niereninsuffizienz) • Diabetisches Fußsyndrom Literatur: 1. Dodt, B. et al.: Reha-Score für Typ-2-Diabetes mellitus: Ein Instrument zur Abschätzung des Rehabilitationsbedarfs, Rehabilitation 2002; 41:237-248 2. Hüppe, A. et al.: Wirksamkeit und Nutzen eines Screeningverfahrens zur Identifikation von rehabilitationsbedürftigen Personen mit Diabetes mellitus Typ 2: eine randomisiert, kontrollierte Evaluationsstudie unter Versicherten der Hamburg Münchner Krankenkasse, Gesundheitswesen 2008,; 70(10):590 – 599 3. AHB Anschlussrehabilitation Ausgabe 2008, Informationsschrift für Krankenhäuser; Deutsche Rentenversicherung Bund, Berlin 2008 Seite 30 Dr. med. Thomas Helling Internist, Diabetologe, Sozialmedizin MediClin Staufenburg Klinik Durbach Karlsruher Diabetes Aktionsplan unterzeichnet! Beim 2. Runden Tisch der Initiative „Diabetes in Aktion – Medikament Bewegung“ wurde im Juli 2013 der Karlsruher Diabetes Aktionsplan auf den Weg gebracht. Menschen mit Diabetes durch Aufklärung, Information und Motivation bei einer Lebensstilveränderung zu unterstützen ist das Hauptziel der Aktion. Hierfür ist eine Vernetzung aller Akteure rund um den Diabetes notwendig. Zu den Initiatoren zählen neben der AOK – Die Gesundheitskasse Mittlerer Oberrhein – die Vereinsinitiative Gesundheitssport e.V. (ein Zusammenschluss von 30 Vereinen des Großraum Karlsruhes) und der Deutsche Diabetiker Bund Bezirksverband Karlsruhe. Schirmherr ist Bürgermeister Klaus Stapf, der selbst mit bestem Beispiel voran geht und einen sehr aktiven Lebensstil mit Radfahren und Laufen praktiziert. Unterstützt wird die Initiative von den Rundum gesundApotheken in Karlsruhe, die u.a. geführte Spaziergänge mit Blutzuckermessung (analog DiSko) anbieten. In 10 Arbeitstreffen seit dem ersten Runden Tisch 2011 wurden Rezeptblöcke entwickelt, Flyer, Plakate und Banner entwor- fen und die Öffentlichkeitsarbeit voran getrieben. Die Karlsruher Hausarztpraxen wurden besucht, die Übungsleiter der Rehasportgruppen haben sich bei den dia­ betologischen Schwerpunktpraxen vorgestellt, Ärzten und Arzthelferinnen wurden auf Schulungen und bei Qualitätszirkeln das Medikament Bewegung näher gebracht. Vortragsveranstaltungen mit bis zu 120 Besuchern hatten zum Ziel, Menschen auf die nächste Stufe des transtheoretischen Modells der Verhaltensänderung zu begleiten und sie von der „Vorbereitung“ („Ich sollte mich vielleicht mehr bewegen“) zur Aktion („Ich bewege mich“) zu bringen. Beim 2. Runden Tisch trafen sich 36 Vertreter unterschiedlicher Institutionen, die alle durch Ihre Unterschrift auf dem Karlsruher Diabetes Aktionsplan ihre Unterstützung im Hinblick auf die Ziele bekräftigten. Mit dabei waren alle großen Karlsruher Kliniken, das Sportinstitut mit seinem Leiter Prof. Dr. Alexander Woll, das Max-Rubner Institut (Bundesforschungsinstitut für Ernährung), vertreten durch Prof. Dr. Achim Bub, die Kassenärztliche Vereinigung, andere Krankenkassen sowie Vertreter der Stadt Karlsruhe und mit Ingo Wellenreuther (MdB) der Präsident des Karlsruher Sport Clubs. In Karlsruhe leben geschätzte 30.000 Menschen mit Diabetes, das entspricht der Personenzahl eines ausverkauften KSCWildparkstadions. Desweiteren nahmen Apotheken, der VdK, der Stadtseniorenrat und das Gesundheitsamt am Runden Tisch teil. Inspiriert durch die Wuppertaler Erklärung von 2012 und die Überlegungen eines Nationalen Diabetes Plans für Deutschland sieht sich die Karlsruher Initiative als ein kommunaler Vorreiter auf dem Weg zur Umsetzung der UNO Resolution. Es ist mitnichten so, dass die beteiligten Akteure schon jetzt von einer Seite 31 erfolgreichen Initiative sprechen können. Man hat schon viel erreicht, aber man ist noch weit von den gesetzten Zielen entfernt. Trotzdem sind die Beteiligten überzeugt, etwas bewegen zu können. In 2014 steht mit dem 1. Karlsruher Gesundheitstag am 12. und 13. April 2014 ein weiterer Meilenstein auf dem Aktivitätenplan. Mit der Information über den Karlsruher Diabetes Aktionsplan in dieser Ausgabe von ADBWpublik möchten wir einen Aufruf an alle engagierten Mitstreiter rund um Diabetes & Lebensstilveränderung starten. Wenn Sie aus dem Großraum Karlsruhe sind und die Initiative unterstützen wollen, dann melden Sie sich bitte bei uns. Dr. Petra Lücke AOK Mittlerer Oberrhein Tel. 0721-3711-172 [email protected] Diana Marusic Vereinsinitiative Gesundheitssport e.V. Tel. 0721-496789 [email protected] Fussballcamp beim KSC für Jungen / Mädchen mit Diabetes Wo: KSC-Fußballschule Wann: 4. bis 6. Juli 2014 Alter: 8 – 15 Jahre (Campteilnehmer) Was: tägliches Training, Besuch eines aktuellen oder ehemaligen KSCProfis, Besuch von Willi Wildpark, Abschlussturnier der Teilnehmer usw. treuung durch medizinisches Fachpersonal sowie Familiengespräche usw. Preis (pro Person): Mitglieder DDB • Camp-Teilnehmer bis 15 Jahre 40,00 € • Geschwisterkinder bis 15 Jahre 40,00 € • Begleitpersonen ab 16 Jahre 78,00 € • Nichtmitglieder 100,00 € Leistung: Übernachtung / Halbpension in der Jugendherberge, Tagesbetreuung der CampTeilnehmer der KSC Fußballschule und Be- Anmeldung / Programm: Deutscher Diabetiker Bund Landesverband Baden-Württemberg Landesgeschäftsstelle Tel.: 07 21/3 54 31 98 E-Mail: [email protected] Mit freundlicher Unterstützung der AOK Baden-Württemberg, Medtronic und dem Karlsruher Sportclub (KSC). Seite 32 Nachrichten aus der Geschäftsstelle Liebe Mitglieder, Wie immer begrüßen wir an dieser Stelle unsere neuen Mitglieder. Dagmar Meißner-Single, Esslingen Uta Puin, Ellwangen Michail Savantoglou, Nürtingen Erika Schwarzkopf, Geislingen Marianne Simon, Mannheim Rudolf Ebner, Berlin Dagmar Hecke, Rutesheim Erika Hiller, Tübingen Uta Jacobsen, Eppingen Dr. Antje Jauernig, Reutlingen Ihre Jacqueline Braun ADBW Geschäftsstelle Impressum Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft Diabetologie Baden-Württemberg e.V., Regionale Gliederung der Deutschen Diabetes Gesellschaft Herausgeber: Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Diabetologie Baden-Württemberg e. V. 1.Vorsitzender: Prof. Dr. Reinhard Holl Uni Ulm, Uni West Albert-Einstein-Allee 41, 89081 Ulm Tel: 0731/502-5314, Fax: 0731/502-5309 E-Mail: [email protected] Redaktion: Dr. Albrecht Dapp Klinikum Lkr. Tuttlingen, GZ Spaichingen, Robert Koch Str. 31, 78549 Spaichingen Tel: 07424/950-4321, Fax: 07424/950-4323 E-Mail: [email protected] Druck: Franz Huber Druckerei + Verlags GmbH Hauptstr. 128, 77652 Offenburg Tel. 0781/72038, Fax 0781/72039 E-Mail: [email protected] Geschäftsstelle der ADBW: Jacqueline Braun Okenstr. 290 c, 77652 Offenburg Tel. 0781/32054, Fax 0781/9267874 E-Mail: [email protected] Bankverbindung: Baden-Württembergische Bank Stuttgart BLZ 600 501 01, Konto-Nr.: 7477504668 BAN: DE84 6005 0101 7477 5046 68 BIC: SOLADEST ISSN 1614-7472 ADBWpublik erscheint etwa viermal jährlich für die Mitglieder, Auflage 1.500 Exemplare. Der Bezugspreis ist im Mitgliederbeitrag der ADBW enthalten. Wir bedanken uns bei folgenden Firmen für ihre Unterstützung: AOK, Lilly Deutschland GmbH Sponsoring in Höhe von 1.250 € für Werbezwecke, Roche Diagnostics GmbH Bildnachweise: S. 4, 5 Universität Ulm, S. 6 - 9 DDB, S. 9 Dapp, S. 14 Born, S. 15 Schnäbele, S. 27 Dressler, S. 28, 29 MediClin, S. 31 AOK, S. 32 KSC Seite 33 Termine...Termine...Termine...Termine...Termine...Termine...Termine...Termine Veranstaltungen der ADBW, des DDB und der DDG 16. / 17.05.2014 ADBW Studentenseminar in Karlsruhe; Info unter www.adbw.de/Termine 28. Juni 2014 – 15. Workshop „Diabetes und Bewegung“ in Radolfzell 11. / 12.07.2014 ADBW Diabeteskongress Bad Boll 11.10.2014 ADBWdidact Klinik-Akademie ADBW Fachkurs „Diabetes für Pflegekräfte“ Termine Markgröningen 18./19.10.2014 ● 13.12.2014 Anmeldung und Info: Rechbergklinik Bretten – Markgröhningen Andrea Domann – Fort- und Weiterbildung Regionalen Kliniken Holding RKH GmbH [email protected] Tel. (07252 54241 oder über die ADBW Geschäftsstelle, [email protected] Übungsleiter-Lehrgänge „Sport mit Diabetikern“ des WBRS zusammen mit der ADBW in der Sportschule in Ruit / Fildern Anmeldung: Geschäftsstelle des WBRS Tel. 0711/28077-620, Fax 0711/28077-621 [email protected] sowie www.wbrs-online.net Deutscher Diabetiker Bund, LV BW Kriegsstr. 49 76133 Karlsruhe Tel.: 0721/ 3 54 31 98 Fax: 0721/ 3 54 31 99 E-Mail: [email protected], www. ddb-bw.de Weiterbildungskurse zur / zum Diabetesassistentin / -en DDG • Kreiskliniken Reutlingen GmbH 05.05. – 09.05.2014 Leiter: Klaus Notz, Auskunft: Sekr. Frau Yemis Tel. 07121 / 325 90-60 • Sinsheim (Schwerpunktpraxis Dr. Daikeler) Info: Frau Gabriele Buchholz, Tel. 07261/8778 oder Fax 07261 8668, [email protected] Fortbildungen der Diabetes-Akademie Bad Mergentheim Auskünfte: Diabetes Akademie Bad Mergentheim Geschäftsstelle: Sandra Jessberger Tel: 07931 / 80 15, Fax: 07931 / 77 50 E-Mail: [email protected] www.diabetes-akademie.de Weiterbildungsveranstaltungen der Universitäten Lunch-Seminar der Med. Universitätsklinik Tübingen (mit kleinem Imbiss), donnerstags 12.45 Uhr Med. Klinik und Poliklinik, Kleiner Hörsaal (Gäste herzlich willkommen) Universitäten Heidelberg und Mannheim Auskünfte: Akademie für Weiterbildung an den Universitäten Heidelberg und Mannheim e.V. Tel.: 0 62 21-54-78-10 Med. Universitätsklinik Ulm Auskunft: Frau PD Dr. Sigrun Merger [email protected] Fortbildungen anderer Institutionen DiabetesNetz Breisgau e.V. Das ausführliche Programm finden Sie unter www.adbw.de – Termine Deutsches Institut für Wundheilung in Radolfzell Weiterbildung Wundassistentin DDG in Radolfzell vom 05. – 09.05.2014 Schulungsschwerpunkt „Diabetischer Fuß“ ärztl. Leitung: Dr. med. Wolf-Rüdiger Klare Unterricht Montag bis Freitag ganztags Kontakt: Deutsches Institut für Wundheilung Telefon: 07732-9391525 [email protected] www.deutsches-wundinstitut.de DiaWalk 2014 am 08. November 2014 in Tuttlingen. Start um 14.00 Uhr am Thermalbad TuWass Info: www.diawalk.info - Mail: [email protected] Termine...Termine...Termine...Termine...Termine...Termine...Termine...Termine Für jeden Alltag. Blutzuckermessgerät, Stechhilfe und 50 Tests in einem: Accu-Chek Mobile Entdecken Sie die Vielfalt an Stickern auf www.accu-chek.de/mydesign Mit AOK-Curaplan bei chronischen Erkrankungen. Mit dem Betreuungsprogramm AOK-Curaplan tun wir alles dafür, damit sich auch Menschen mit chronischen Erkrankungen fit für den Alltag fühlen: von der umfassenden ärztlichen Versorgung bis hin zur individuellen persönlichen Beratung bei Diabetes mellitus Typ 1 und 2, Brustkrebs, koronarer Herzkrankheit, Asthma oder COPD. Mehr dazu erfahren Sie bei Ihrer AOK vor Ort oder auf www.aok-bw.de AOK Baden-Württemberg ZGH 0014/04 · 1/14 · Foto: plainpicture/OJO Immer und jederzeit gut aufgehoben.