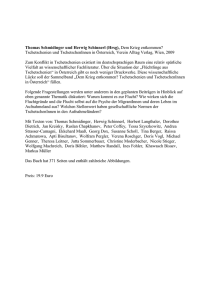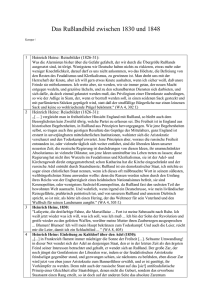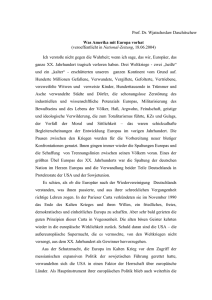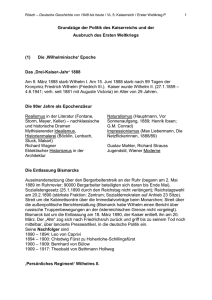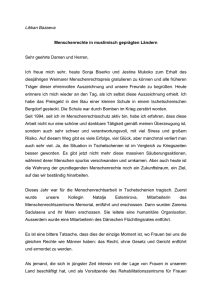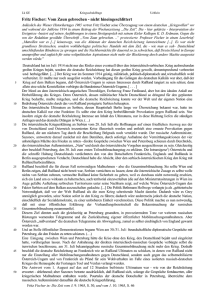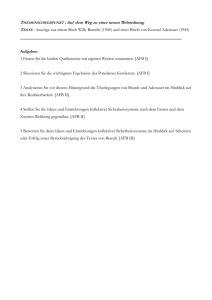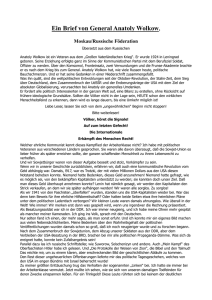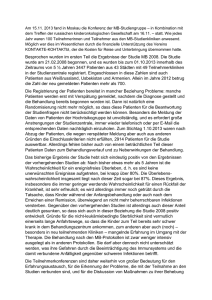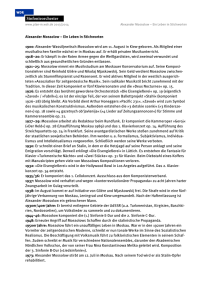Moskau. Freitag, den 3. Mai 2002. - Martin W hlisch
Werbung
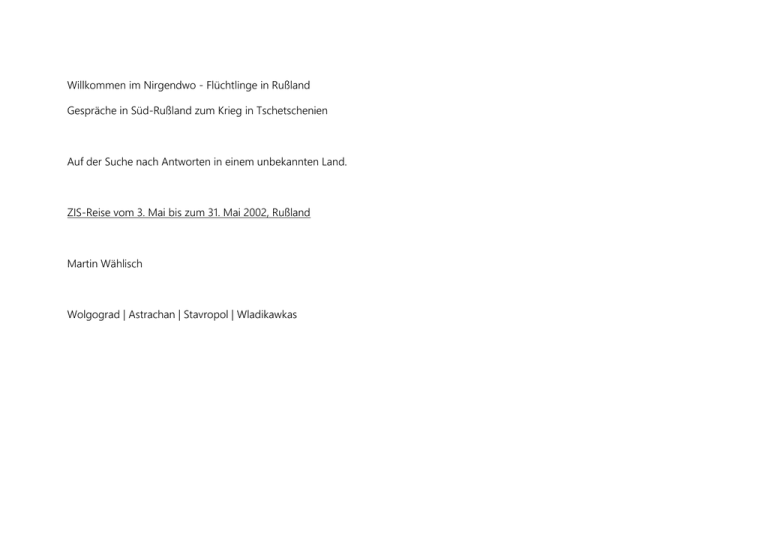
Willkommen im Nirgendwo - Flüchtlinge in Rußland Gespräche in Süd-Rußland zum Krieg in Tschetschenien Auf der Suche nach Antworten in einem unbekannten Land. ZIS-Reise vom 3. Mai bis zum 31. Mai 2002, Rußland Martin Wählisch Wolgograd | Astrachan | Stavropol | Wladikawkas 2 Inhaltsverzeichnis Moskau. Freitag, den 3. Mai 2002. ........................................................................................................................................................................................................ 8 Moskau. Freitag, den 3. Mai 2002. ........................................................................................................................................................................................................ 9 Wolgograd. Sonnabend, den 4. Mai 2002. .......................................................................................................................................................................................14 Wolgograd. Sonntag, den 5. Mai 2002. ............................................................................................................................................................................................ 20 Wolgograd. Montag, den 6. Mai 2002. ............................................................................................................................................................................................. 24 Wolgograd. Dienstag, den 7. Mai 2002. ............................................................................................................................................................................................ 30 Wolgograd. Mittwoch, den 8. Mai 2002............................................................................................................................................................................................. 31 Wolgograd. Donnerstag, den 9. Mai 2002. ...................................................................................................................................................................................... 34 Wolgograd. Freitag, den 10. Mai 2002............................................................................................................................................................................................... 38 Astrachan. Sonnabend, den 11. Mai 2002. .........................................................................................................................................................................................41 Astrachan. Sonntag, den 12. Mai 2002. ............................................................................................................................................................................................. 42 Astrachan. Montag, den 13. Mai 2002. .............................................................................................................................................................................................. 45 Astrachan. Dienstag, den 14. Mai 2002. ............................................................................................................................................................................................ 49 Astrachan. Mittwoch, den 15. Mai 2002............................................................................................................................................................................................. 50 Astrachan. Donnerstag, den 16. Mai 2002. ....................................................................................................................................................................................... 55 Wolga-Delta. Freitag, den 17. Mai 2002. ........................................................................................................................................................................................... 60 Wolga-Delta. Sonnabend, den 18. Mai 2002. .................................................................................................................................................................................. 64 3 Astrachan. Sonntag, den 19. Mai 2002. ..............................................................................................................................................................................................65 Stavropol. Montag, den 20. Mai 2002. ...............................................................................................................................................................................................69 Stavropol. Dienstag, den 21. Mai 2002. .............................................................................................................................................................................................. 75 Stavropol. Mittwoch, den 22. Mai 2002. ............................................................................................................................................................................................ 78 Stavropol. Donnerstag, den 23. Mai 2002. .......................................................................................................................................................................................82 Stavropol. Freitag, den 24. Mai 2002. ................................................................................................................................................................................................. 87 Wladikawkas. Sonnabend, den 25. Mai 2002...................................................................................................................................................................................88 Wladikawkas. Sonntag, den 26. Mai 2002.........................................................................................................................................................................................93 Wladikawkas. Montag, den 27. Mai 2002. .........................................................................................................................................................................................99 Wladikawkas. Dienstag, den 28. Mai 2002. ..................................................................................................................................................................................... 105 Wladikawkas. Mittwoch, den 29. Mai 2002. .................................................................................................................................................................................... 108 Zugfahrt. Donnerstag, den 30. Mai 2002. ........................................................................................................................................................................................ 111 Moskau. Freitag, den 31. Mai 2002. ....................................................................................................................................................................................................112 Nachwort ....................................................................................................................................................................................................................................................113 Nachwort ................................................................................................................................................................................................................................................... 114 Anhang ........................................................................................................................................................................................................................................................116 1. Rezept, Osterspeisen ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 116 2. Zitate über Ossetien ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 117 3. Auszüge von Kostai Hetagurov ................................................................................................................................................................................................................................................... 118 4. Auszüge aus Gedichten von Kosta Hetagurov ...................................................................................................................................................................................................................... 119 5. Gedicht Michael Lermontov ........................................................................................................................................................................................................................................................ 124 Literaturnachweis .................................................................................................................................................................................................................................... 126 4 Vorwort Liebe Leserin, Lieber Leser, dieses Tagebuch ist während meiner Studienreise im Mai diesen Jahres durch Süd-Rußland entstanden. Ich wollte das Leben von Flüchtlingen in Rußland dokumentieren und die Rolle von Hilfsorganisationen kennenlernen. Es kam aber doch alles anders, als ich dachte. Allein die Vorbereitungen für diese Reise bergen eine eigene Geschichte. Im Februar bewarb ich mich bei ZIS für ein Stipendium, um nach Inguschetien zu fahren und dort einen Einblick in die Arbeit mit Flüchtlingen zu bekommen. Inguschetien hat nach Ausbruch des Krieges in Tschetschenien den größten Teil der Flüchtlinge aus seiner Nachbarregion aufgenommen. Die geographische und kulturelle Verbindung der beiden Regionen, aber auch die moderate Politik des ehemaligen Präsidenten der Republik, Ruslan Aschew, gegenüber den Flüchtlingen haben zu dieser Rolle Inguschetiens geführt. Durch den Bau von Zeltlagern und die Sicherung der Versorgungslage leisten internationale Hilfsorganisationen ihren Teil, um den Menschen vor Ort zu helfen. Ich meinerseits wollte durch jene Organisationen Aufgaben wie humanitäre Hilfe verstehen und ins Gespräch mit Flüchtlingen kommen. In Folge nahm ich Kontakt u.a. zu englischen und deutschen Hilfsorganisationen auf. Eine enge Absprache war schon aufgrund der Sicherheitslage in Inguschetien nötig. Mit der Zusage durch zwei Hilfsvereine plante ich die Details der Reise. Mitarbeiter vor Ort rieten mir, einen Flug nach Nazran zu nehmen. Ein Zitat bleibt mir dabei noch im Kopf: “Wir haben nie von einem Ausländer gehört, der mit der Bahn nach Nazran gekommen ist“. Die Aussagen waren unterschiedlich. Ich fuhr zum Bahnhof, sprach mit Reisenden und der Schaffnerin, und entschied mich für die Fahrt mit der Bahn. Letztlich schließen die Bedingungen von ZIS einen Flug aus. Soweit so gut. Mit einem Mitarbeiter der deutschen Botschaft besprach ich die bevorstehenden Wahlen in Inguschetien. Da Aschew zurücktrat, gab es ein Gerangel mehrerer Kandidaten, die teilweise von Kreml unterstützt wurden. Der Ausgang der Wahlen war vorhersehbar und daher fürchteten viele, dass die Arbeit der Hilfsorganisationen vor Ort eingeschränkt würde. Von der Wahl in Inguschetien hing also auch meine ZIS-Reise ab. Die Wahl war am 4. April. Bei der Auszählung konnte keiner der Kandidaten die Mehrheit auf sich vereinigen. Die Nachwahlen sollten am 28. April stattfinden. Den 3. Mai hatte ich als Beginn meiner Studienreise datiert. Alles hing an mehreren goldenen 5 Fäden. Im Briefwechsel mit meiner Betreuerin von ZIS einigten wir uns, dass ich nur einen Teil meiner Studienreise in Inguschetien verbringen würde. Weitere Orte für die Recherche lagen am Fuße des Kaukasus. Zwei Wochen vor Reisebeginn passierte aber noch etwas völlig anderes. Als ich einen Mitarbeiter für humanitäre Hilfe in der deutschen Botschaft um eine Schreiben bat, in dem die Botschaft meine Reise bestätigte, fielen alle Reisevorbereitungen wie ein Kartenhaus zusammen. Erst im März hatte er mir einen Kontakt zu einem deutschen Hilfsverein und dem UNHCR verschafft. Er war verblüfft von der Tatsache, dass ich wirklich vor hatte zu fahren. Auf einmal wußte er nichts mehr von meinem Vorhaben. Komisch, dabei hatte ich mich ebenfalls seit März mit einem Mitarbeitern aus dem politischen Referat und der Wirtschaftsabteilung über die Sicherheitslage unterhalten. Beide konnten ihm das bestätigen. Mir war klar, dass eine Studienreise nach Nazran nur mit einer Hilfsorganisation möglich ist und niemand für mich Verantwortung übernehmen könnte. Die Zusage von Hilfsvereinen vor Ort stand, daher war ich über die Aufregung verwirrt. Zu spät. Kurzerhand war aber das Auswärtige Amt in Berlin informiert, die wiederum den Geschäftsführer von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in Kenntnis setzten. Jener wiederum rief meine Länderkoordinatorin in Moskau mit der Frage an, „ob wirklich einer der Freiwilligen nach „Tschetschenien“ fahren wolle“. Nun waren die Dinge völlig verdreht. Am Tag darauf bekam ich eine Mail von einer deutschen Hilfsorganisation, die alles weitere absagte. Bis dato hatten wir alles geregelt und jetzt die Wendung. Mir war alles unverständlich. Lag es daran, dass das Auswärtige Amt Projekte von deutschen Hilfsorganisationen finanziert? Vielleicht hatte ich die Sicherheitslage aber doch unterschätzt. Es ist eine Groteske und ich war mitten drin. Es ging bis dahin, dass mir gesagt wurde, der FSB würde mich vielleicht bereits überwachen. Man warf mir vor, die gesamt Arbeit der Freiwilligen in Moskau zu gefährden. Mein Visum würde nicht verlängert werden. „Wer will schon, das ein junger Ausländer über die Lage von Flüchtlingen in inguschischen Zeltlagern schreibt?“, hieß es nur. Am gleichen Tag kam unabhängig von allem die Absage durch ZIS. Zwei Wochen vor der geplanten Reise war alles wie weggespült. Neben meiner normalen Arbeit in Moskau hatte ich drei Monate Zeit und Kraft in die Vorbereitung gesteckt, Treffen und Absprachen mit Hilfsorganisationen, alles war hinfällig. Ich kam nicht weiter. In einem Telefonat mit Sabine, meiner Betreuerin von ZIS, sammelten wir verschiedene Gedanken. Das Thema Flüchtlinge in Rußland ist mir zu noch zu unbekannt, um es nicht in Angriff zu nehmen, und zu interessant, um es mit einem Schlag loszulassen. Es ist ein riesiges Buch mit hiesigen Kapiteln. Ich war bisher gerade mal dazu gekommen, den Staub vom Umschlag zu pusten. Wir änderten die Reiseroute. In der Kürze der Zeit ich versuchte alles nötige zu organisieren. In Wolgograd gibt es einen guten 6 Freund, der mit Flüchtlingen arbeitet und ebenfalls Freiwilliger bei Aktion Sühnezeichen ist. Hier sollte meine erste Station liegen. Unweit an der Wolga liegt Astrachan, die Lage am Kaspischen Meer und die Nähe zum Kaukasus machen diese Stadt sicherlich zum Brennpunkt. Von Rostov aus wollte ich den Zug aus Nazran nehmen und auf der Rückfahrt versuchen, Interviews mit Flüchtlingen zu machen. Ich nahm die gleichen Fragen mit, die ich mir schon ganz am Anfang stellte: Wie leben Flüchtlinge aus Tschetschenien in Rußland? Welche Aufgaben nehmen Flüchtlingsorganisationen dabei wahr? Ein grundsätzliches Interesse lag mir an der Meinung von den Menschen auf der Straße. Was denken sie über die Flüchtlingsproblematik und den Krieg in Tschetschenien? Mir brannte alles unter den Fingernägeln. Doch wieder stieß ich auf das Unbekannte, denn wie heißt es in einem Lied: Der Mai macht alles neu. Ich möchte Sie mitnehmen auf eine Suche nach Antworten in einem unbekannten Land. Viel Freude beim Lesen, Ihr Martin Wählisch 7 Kasaner Bahnhof | Moskau 8 Moskau. Freitag, den 3. Mai 2002. Die Reise fing ja gut an. In Rußland gibt es die Tradition, vor einer langen Fahrt in Ruhe zu Hause eine Tasse Tee zu trinken. Bei mir hat das noch nie geklappt. Auf den Spuren des großen Zeigers der Uhr wanke ich zum Bahnhof. Es ist einer dieser ungewöhnlich warmen Tag im Mai, an denen nur der kalte Wind in den Gängen der Metro einen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen scheint. Das Treiben auf den Moskaus Straßen ist wie immer eilig. Die Sonne spiegelt sich bereits auf den Scheiben des Zuges, als wir auf dem Kasaner Bahnhof die Nummer meines Waggons suchen. Ben, ein guter Freund, beruhigt mich. Die Pünktlichkeit russischer Züge ist eine Frage des Schicksals. Geschafft bin ich, nachdem ich mich durch die schmalen Gänge bis zu meinen Abteil zwänge, die Sachen verstaue und den Rückweg zu einem Abschiedsfoto antrete. Ich hoffe auf einem Monat voller Abenteuer und Erlebnisse. Was ich suche, sind Begegnungen mit Menschen in einem fremden Land und Lösungen auf unzählige Fragen. Mein Kopf ist voller leerer Kästchen, die herum schwirren, sich den Weg zu meinem Mund erobern, um die Welt zu erkunden und satt in mein Ohr zu schlüpfen. Der Zug rumpelt, und ich sitze neben zwei grinsenden Russen. Häuser und Bäume verschwinden von rechts nach links mit dem Blick aus dem Fenster, und ich bin mir unschlüssig, ob wir uns nun bewegen oder einfach nur kleine Zwerge die Landschaft an uns vorbei tragen. Eine Armeslänge hinter dem kleinen Tisch, der wie ein klappbares Bügelbrett in unser kleines Coupe montiert ist, sitzt eine schwangere Frau in Latzhose. Wir sind also zu fünft, denke ich und stimme auf die Fragen der jungen Russen neben mir ein. Beide sind vor fünf Jahren aus Aschchabad nach Rußland gekommen, um in Moskau zu arbeiten. Die ganze Familie lebt jetzt an der Wolga. Jura und Dima sind auf den Weg zum Geburtstag ihrer Mutter. Die Situation in Turkmenistan sei schlecht. Ihr Präsident Saparmurat Nijazov regiere wie ein Monarch. Nijazov läßt sich selbst "Turkmenbaschi", Führer aller Turkmenen nennen. Goldene Statuen, Jubelparaden, Heldenlieder: „Der Personenkult um ihn hat längst absurde Ausmaße angenommen. Die Opposition im Land wird unterdrückt. Um Wahlen auch künftig zu vermeiden, ließ er sich 1998 vom Parlament zum Präsidenten auf Lebenszeit ernennen. Turkmenistan ist reich an Rohstoffen. Turkmenbaschis Reich schwimmt auf Erdgas und ist ein Schlüssel für Zentralasien. Vielleicht ist das ein Grund, warum die USA, Russland und China mit dem Diktator auf Schmusekurs fahren. Trotzdem sind die meisten der viereinhalb Millionen Menschen bitterarm. Nach dem Zerfall der Sowjetunion funktionieren soziale Einrichtungen wie Gesundheitswesen und Bildungssystem mehr schlecht als recht. Drogensucht ist zu einem großen Problem geworden.“ „Rußland bedeutet Arbeit“, erzählt mir der 24-jährige Jura später auf dem Gang. Viele zieht es aus den ehemaligen Sowjetrepubliken nach Moskau. Planmäßig kam der Exitus für die Wirtschaften der Staatengemeinschaft. Der Preis für die Freiheit ist ein Leben ohne Kompromisse. Wir lehnen uns gegen die Metallstange unter den Gardinen. Russische Züge haben Stil. Die Plastikblumen an der Wand 9 wippen im Klang der Schienen, und ich schmunzle über den roten Teppichläufer unter meinen Füßen, der sich durch den Waggon schlängelt. Und da ist es wieder. Dieses unbehagliche Gefühl, bei dem der Puls im Handgelenk pocht. Du bist unschuldig, doch trotzdem fühlst du dich schlecht. Russische Beamte in blauen Hemden und nackten Schulterklappen rufen einen Schauer in mir hervor. Paßkontrolle. Ich erinnere mich nur zurückhaltend an eine Situation nachts an der weißrussischen Grenze bei der ein kleiner Zöllner mit riesigem grünen Filzhut alle Pässe einsammelte und uns Stunden der Angst verleben ließ. Letztlich erwachten wir doch aus unseren schwarz-weiß-Filmen und schliefen beruhigt weiter. Diesmal sollte aber alles anders kommen. Mit einem kurzen Klopfer auf seine Brust bekommt Jura seinen Paß zurück. Jura lächelt und zwinkert mir zu. Ob sie überhaupt Russen wären, höhnt der Uniformierte die beiden an. Mit den Blick auf meine Papiere, fällt seine Stimmlage. „Wo sind Ihre Sachen? Der Rucksack dort? Mitkommen.“ Jetzt geht der Spaß erst richtig los, denke ich mir, als ich mich und mein Hab und Gut den Gang entlang zum kleinen Kabuff der Schaffnerin schleife. „Sachen auspacken!“, die Worte des blauen Hemdes vor mir klingen nüchtern und kühl. Er hebt seinen Bauch vom Tisch und mustert mich. Ich fühle mich gedemütigt. Die Dokumente sollen nicht richtig sein. „Und wo ist überhaupt Ihre Zolldeklaration?“. Ich stutze. „Wir haben doch einen Inder gesehen. Wo ist der?“. Er spricht wohl von Ben, der mich zum Bahnhof gebracht hat. Die Situation wird immer grotesker. Ich versuche meine Nervosität durch ein Ausweichmanöver zu beruhigen. Ich summe ein Lied. Nach kurzer Zeit muß ich lachen. Mit Augenschein auf den 10 stummen Milizionär vergeht mir alles. Ich packe zwei Diktiergeräte und den Fotoapparat aus. Als er mein Teleobjektiv erblickt, steht schon ein zweites schmales Männchen in der Tür. Ruhig bleiben, sage ich mir immer wieder und darf ein zweites Mal alles ein- und auspacken. Es ist still, und die Frage meines Gegenüber bohrt sich in mein Gedächnis: „Sind Sie ein Spion?“. Ich verneine. „Haben sie Drogen bei sich?“. Abermals verneine ich. Der Dünne schmökert in meinem gelben Langenscheidt Wörterbuch und entdeckt den Lonely-Planet. Der Dicke schnauzt mich weiter an und versucht mich zum Aufgeben zu bringen. Die Bücher über Tschetschenien in Deutsch, Englisch und Russisch gefallen ihm gar nicht. Die zwölf Filme in meiner Fototasche kann er nicht verstehen. “Ja, Jungs soll ich Wirtschaftsspionage in eurem Land machen, oder was?“, schießt es durch meinen Kopf. Ich schalte das Tonbandgerät ein. Die deutschen Stimmen machen ihn mißtrauisch. Gut, dass ich die Kassette mit Glückwünschen für einen Freund in Deutschland eingepackt habe. Ein bekanntes russisches Geburtstagslied quetscht sich etwas verzerrt durch den Lautsprecher meines Diktiergerätes. Der Dünne winkt ab. Der Dicke will noch mal den Fotoapparat sehen. Ob das alles ist, frage ich. Die Dokument von der Botschaft sind für ihn aber nur eine Kopie und das Visum ohnehin gefälscht. Außerdem dürfte ich gar nicht nach Wolgograd fahren. Und wieder die Frage nach dem Inder, mit dem sie mich doch auf dem Bahnsteig in Moskau gesehen haben. Ich habe mich selten so hilflos gefühlt und werde patzig. Mein Visum hat die Russische Botschaft in Berlin ausgestellt, die sollte man doch zur Überprüfung einfach mal anrufen. Ich finde die Visitenkarte einer Bekannten aus der Deutschen Botschaft und tippe mit dem Finger auf den gedruckten Bundesadler. Rufen sie bei der Botschaft in Moskau an, man wird ihnen meine Dokumente bestätigen. Was wäre ich für ein Spion, wenn sie mich auf Anhieb entdecken würden? Es bleibt still. Mit einem „Packen und gehen sie“ beendet der Bauch mit einer Handbewegung die Vorstellung. Mechanisch wünscht er eine gute Reise, und mir wird klar, dass mich diese Sache auf weitere Erlebnisse der Reise einstimmt. Am späten Nachmittag löffeln wir gemeinsam Nudeln aus einer Styroporschale und diskutieren über das Thema Freiheit in Rußland. Bisweilen hat sich meine Geschichte im Zug herumgesprochen. Kleine Kinder wurden dazu ermutigt, sich an unser Abteil heranzuschleichen, um den verdächtigen Deutschen zu bestaunen. 11 Dima und Jura | Im Zug 12 Bahnhof | Wolgograd 13 „Papa ist das der?“, höre ich eine Mädchenstimme fragen und wende mich wieder an Dima. Ich verstehe nicht, warum ich bei einem Visum für die gesamte Russische Föderation jede Fahrt in eine andere Stadt durch eine Einladung von Freunden oder eine Bestätigung von Projekten belegen muß. Jegliche Schikane der Milizionäre sprechen auch gegen meine Persönlichkeitsrechte. Jura erklärt mir, dass Rußland den Einfluß asiatischer Sekten begrenzen will. „In den letzten Jahren wurde das Land von verschiedenen Gruppierungen überschwemmt. Deswegen sind sie schon am Bahnhof auf meine indische Begleitung aufmerksam geworden. Du bist Ausländer, du fällst auf. Das Thema Flüchtlinge und Tschetschenien ruft bei den Russen eine andere Wirklichkeit hervor. Das Bild in den westlichen Medien finden sie ungerecht und einseitig. Da können sie einen 19jährigen Jungen mit Adressen von Flüchtlingsorganisationen und Studienvorhaben schon gar nicht einordnen.“ Freiheit und innere Sicherheit passen in Rußland nicht in einen Topf. „Vielleicht wollten die beiden aber auch nur Geld“, fügt Gaja an, die sich kurz von ihren Familienmagazinen gelöst hat. Zum Krieg in Tschetschenien will sie lieber nichts sagen. „Woher kenne ich schon die Wahrheit?“, sagt sie. Russische Milizionäre werden schlecht bezahlt, da sind schnell mal einige Dokumente nicht richtig. Kleine Zuwendungen dürfen den Tatbestand aber gerne korrigieren. Ich stehe immer noch zu ehrlicher Arbeit. Ob ich Bier trinke? Nein, dann halt Cognac, der ist selbst gebrannt und sei wieso besser. Lustig sieht die Sache schon aus: Eine Plastikflasche und kleine Porzellantassen mit Blumenmotiv stehen vor uns. Jura organisiert Schokolade. Dima zeigt mir, wie man Zedernüsse knackt. Wir sprechen über das Gewicht von 14 Neugeborenen. Gaja fragt, ob wir schnarchen. Geschichten, Erzählungen, so habe ich mir Rußland immer vorgestellt. Im Zug rückt man zusammen. Die Atmosphäre ist nostalgisch. In der Nacht schaltet Jura seinen Laptop an. Wir schauen „Herr der Ringe“ auf DVD. Das Schild neben der Waggontür mahnt das Baujahr 1952 an. Ich schüttle den Kopf, die Welt ist doch verrückt. Alles liegt vor mir. Ich denke an die letzten Worte von Ben auf dem Bahnhof in Moskau. Ich: „Es geht bestimmt alles schief. Die Schaffnerin guckt schon so böse.“ Ben: „Die gucken immer böse. Die müssen so gucken.“ Gehört das in Rußland vielleicht einfach zum Leben dazu? Ende der Aufschrift gegen 23.30 Uhr Wolgograd. Sonnabend, den 4. Mai 2002. Im Zug. Gegen 6 Uhr morgens. Ich sitze allein im Abteil. Die Sonne hat längst die Wolken durchflutet. Das Radio summt vom Anfang eines neuen Tages. Wir fliegen vorbei an gelben und braunen Feldern, einer Hand voll Häuser und einem einsamen Ölfaß. Nur die Linien der Strommasten am Wegesrand scheinen uns zu begleiten. Ankunft an der Wolga. Gegen 12 Uhr mittags. Wolgograd ist eine Wurst. Eigentlich bin ich für Interviews mit Flüchtlingen unterwegs und jetzt das. Feiertagswoche, in ganz Rußland werden Eier bemalt oder Laternen für den 9. Mai geschmückt. Mein erster Blick fällt auf die riesige Eisentafel neben dem Bahnhofsgelände. „Willkommen in der Heldenstadt“, entziffere ich die verblichenen Lettern. Daneben hängt eine Karte. Wolgograd liegt an der Wolga. Das leuchtet ein. Dass die Stadt aber 90 km lang sein soll, wird mir erst klar als ich mit dem Bus über eine Stunde bis ins andere Ende der Stadt brauche. Gebogene Holzhäuser und versprengte Fabriken scheinen auf die jenigen zu warten, die mitten auf der Fahrt aussteigen wollen. Auf einer riesigen Wiese thront die Technische Universität. Katharina die Große holte deutsche Kolonisten ins Land. Geschnitzte Fensterrahmen, ein kleiner Park. Es ist, als hätte jemand das Grün in die graue Steppe geworfen. Die weiße Kirche und das Pfarrhaus der Gemeinde wirken wie eine Insel. In dieser Gegend wohnten einst gemeinsam Russen, Deutsche, Tataren, Kalmücken und Ukrainer. „Wolgograd kommt mir manchmal vor wie eine riesige Straße“, erzählt mir Martin, der mich mit seiner Freundin Sara und Erik vom Bahnhof abgeholt hat. „Die Stadt ist nur sechs Kilometer breit, erklärt er weiter. „Der südlichste Bezirk war früher ein eigener Ort. Den hat man kurzerhand an Wolgograd angeschlossen. Daher trennt das Nichts den Krasnoarmejski Bezirk vom Zentrum.“ Auf den Weg zur Kirche treffen wir Menschen mit Plastiktüten, die ihre Osterspeisen zur Segnung bringen. Aus der Ferne hören wir die ersten Gesänge. Die Kirche liegt im Dunkeln. Ein Scheinwerfer gibt uns die Richtung an. Die Miliz hat das Gelände weiträumig abgesperrt. Vor der Kirche: Eine Frau, die Pascha, eine traditionelle pyramidenartige Speise aus Quark verkauft. An kleinen Ständen bieten Großmütter Kerzen für den Gottesdienst feil, dann beginnt der Gottesdienst. Plattenbauten so weit das Auge reicht. Zwei Pappschilder mit Schrift stehen vor dem Kino. Die Autos wirbeln durch den Staub. Die Gesichter der Menschen vor dem Lebensmittelgeschäft kann ich nur ungenau erkennen. Eine rote Straßenbahn rattert an uns vorbei, als wir an einem kleinen Stand einen russischen Osterkuchen für den Abend kaufen. Für die Tage in Wolgograd kann ich im Haus der lutherischen Gemeinde Sarepta unterkommen, in der Martin und Erik als Freiwillige arbeiten. Gegen 22.30 Uhr. Es ist ein Abend wie Seide, als wir mit unserem Osterkuchen zur Bushaltestelle schlendern. Ostern ist das größte christliche Fest in Rußland und beginnt in der Osternacht mit einer stundenlangen Auferstehungsmesse. Ich mache die ersten Schritten in die orthodoxe Menge und nehme meinen ersten Zug Weihrauch. Die Kirche ist gedrängt voll. Kinder, junge Leute, Frauen mit Kopftüchern. Alle Augen sind auf den Altar gerichtet. Gebete ertönen, die Menge kreuzigt, verbeugt sich. Wieder und immer wieder scheint sich dieser Ritus zu wiederholen. Wir sind in der größten Kirche von Wolgograd und ich fühle mich wie in einer unwirklichen Geschichte. Das Gefühl, hier zu sein und das mitzuerleben, ist überwältigend. 15 Kurz vor Mitternacht gibt es kaum noch einen Stehplatz im Gotteshaus. Der Geruch von Kerzenwachs hat sich auf uns gelegt. Auf einmal geht das Licht an. Ein riesiger Leuchter über unseren Köpfen wirft ein tausendfaches Licht auf die Ikonen. Das Gold an den Wänden strahlt gelb. Es ist still. Die schweren Türen des Altars öffnen sich. Mit schnellen Schritten schreiten vier Geistliche heraus. Einer von ihnen schwenkt ein kleines Gefäß. Süße Dämpfe legen sich um meine Nase. Zwei Gestalten in weißen Gewändern tragen ein besticktes Tuch mit dem Antlitz Christi in den Altarraum. „Das symbolisiert die Auferstehung Christi, schließlich wurde damals auch die Grabplatte weggerollt“, flüstert mir eine alte Frau zu. Genau so schnell, wie das Schauspiel begonnen hat, endet es. Der Altar schließt sich wieder. Zwei Meßdiener, einer mit Schwert, ein anderer mit Kerze stellen sich seitlich der Treppenstufen auf. Der Altar öffnet sich erneut. Nun treten sechs, sieben Mann mit großen 16 17 Strasse | Wolgograd 18 Osterkuchen | Wolgograd Kerzen durch den Raum. Im nächsten Augenblick kann ich nur noch zwei Männer mit Fahnen aus Samt erkennen. Die Situation verläuft zu schnell, um alles in Tausenden von Einzelheiten festhalten zu können. Zwischendurch drängen Menschen mit Kerzen zu den Ikonen an die Wände. Alte Frauen sind still in der Ecke in ihr Gebet vertieft. Ein Chor färbt den Raum mit einer weichen Melodie. Im nächsten Moment stürzt ein junger Mann im Trainingsanzug auf die Ikonenwand zu. Seine Stimme zittert. Er fleht um Verzeihung. Möge Gott ihm für seine Sünden vergeben. Einzelne hören zu. Seine Worte schallen durch den Raum. Er ruft ohne Unterlaß. Eine Frau hilft ihm, eine Kerze am Altar zu entzünden. Es ist ein unaussprechliches Spektakel vor einem kleinen Tor, einem Fenster zum Paradies, das zumindest für den Augenblick des Göttliche offenbaren soll. Alles scheint bis auf die Sekunde zu passen. Jeder Schwenk, jeder Spruch scheint Teil eines einzelnen ewigen Lied, das durch die Nacht führt. Es ist wie ein warmer Traum, umschlossen von dicken Klängen in einem riesigen goldenen Palast. Plötzlich zerreißt Glockenläuten die feierliche Stille: “Christos woskres”, singt ein Priester. „Vo istinu voskrese“, antwortet das Volk. Christius ist auferstanden! – Er ist wahrhaftig auferstanden! Wir folgen dem Priester dreimal um das Gotteshaus. Hunderte von Kerzen flackern in der Dunkelheit. „Die Leute gehen wieder in die Kirche“, erzählt mir Iwan, ein Student, der wohl durch mein Wörterbuch auf mich aufmerksam geworden ist. „Langsam werden die alten Traditionen wieder lebendig. Nicht nur die kirchlichen, auch das alte Volksbrauchtum ist wieder populär. Ich bin gläubig, deswegen bin ich hier.“ Er erklärt mir die Liturgie des Gottesdienstes und fügt an: „Die dunkle Kirche symbolisiert eine düstere Welt ohne das Licht des Glaubens. Gegen Mitternacht werden dann die Osterkerzen angezündet, Freudengesänge des Chores setzen ein, vielstimmig, voll, denn die Stimmen ersetzen die in orthodoxen Kirchen nicht vorhandene Orgel. Auch gibt es in der orthodoxen Kirche keine Bänke. Nach dem Kreuzgang wechseln die Priester ihre weißen Gewänder gegen rote. Die Farbe steht für die Wiederauferstehung, daher werden die meisten Eier auch rot gefärbt. Nach der Zeremonie umarmen sich Bekannte und küssen sich dreimal.“ Gegen vier Uhr treten wir mit zusammengekniffenen Augen den Heimweg an. Der Lautsprecherwagen vor der Kirche hat seinen Betrieb eingestellt. Die Glocken schlagen immer noch hell und vielstimmig. Der Tag ist noch dunkel. Die Menschen strömen aus der Kirche. Es war ein märchenhafter Abend. Ich habe Kirche noch nie so intensiv erfahren. Ich komme mir vor, als hätte mich jemand bis in die Fingerspitzen mit russischen Traditionen getränkt. Ende der Aufschrift gegen 5 Uhr morgens Vielleicht noch eine kleine Geschichte zum Thema meiner Studienarbeit. Nachdem mir Iwan, der Student, die Liturgie in der Kirche erklärte, unterhielten wir uns über den Krieg in Tschetschenien und das Leben in Wolgograd. Seine Freundin 19 selbst ist aus Grozny. „In Wolgograd lebt man wie überall“, berichtet er. „Skinheads sind ein Problem in der Stadt. Dann gibt es noch die vielen Gastarbeiter: Koreaner und Kasachen, die arbeiten nur für ihr Essen und günstige Geschäfte. Auch gibt es hier viele Leute aus Kalmücken. Aus Tschetschenien sind Familien erst gekommen, als der Krieg anfing. Die suchen sich ein Haus und verkaufen Produkte auf dem Markt.“ Es ist kalt. Ich habe meine Jacke vergessen. Wir stehen hinter dem Kirchenhaus neben einem Baum. Vorne im Licht ist es zu laut. Iwan bringt mich mit einem Mönch zusammen, der gerade zufällig vorbei kommt. Mit ihm spreche ich über das Verhältnis zur katholischen Kirche. Nur die orthodoxe Kirche ist für ihn das Wahre. Zu Putin will er nichts sagen. Als ich beginne, ihm Fragen zu Tschetschenien zu stellen, verstummt er. Zwei Milizionäre beobachten uns erst von weiten und haben sich dann endgültig neben uns gestellt. Soviel dazu. Wolgograd. Sonntag, den 5. Mai 2002. Ostermorgen. Kopfschmerzen. Ich rieche nach Weihrauch. Sechs Stunden Orthodoxie gehen ins Mark. Unser Osterkuchen ist gesegnet. Erik hatte ihn noch rechtzeitig auf einen der Holztische vor der Kirche gestellt, ehe der Pope sein heiliges Wasser mit dem Quastenpinsel auf die Backwaren schleuderte. Ich bin glückselig. Nur ein gefärbtes Ei konnte sich im Gedränge auf dem Weg zum 20 Kreuzgang nicht durchsetzen. Es ist festlich. Auf einem kleinem Stuhl in einer Neubauwohnung mitten in Wolgograd thront unser Kulisch. Je höher der Osterkuchen, um so angesehender ist die Hausfrau. Alles egal, unser Hefekuchen kommt aus der Fabrik. Das strenge Fasten der Karwochen ist vorbei. Bei den Butterwochen habe ich in Moskau noch richtig zugelangt. Die vierzig Tage Obst, Gemüse, Brot und Wasser wollte ich dann aber doch nicht „mal so zum Spaß“ mitmachen, auch wenn es mir meine Russischlehrerin ans Herz legte. Rußland fordert viel von seinen Gläubigen. Ich habe mich von meiner Vermieterin gerade mal zu einem Frühjahrsputz hinreißen lassen. Gegen 16 Uhr. Es sind nicht viele, die sich am Sonntagnachmittag nach der anstrengenden Osterprozession auf dem Paradeplatz gegenüber dem Intourist versammelt haben. Ich zähle 20 Geistliche und ca. hundert Menschen vor der Bühne. Hat die russisch-orthodoxe Kirche wieder großen Einfluß auf das Leben in Rußland gewonnen? Siebzig Jahre lange hatte der Kommunismus Atheismus verordnet. Jetzt scheint das Volk wieder süchtig zu werden. Es herrscht Volksfeststimmung. Nur die Hartgesottenen sind heute Nachmittag zum zweiten Gottesdienst gekommen. Vorher gab es ein Konzert der ansässigen Kindergruppe. Russische Folklore klingt wie Jodeln, nur etwas langsamer. Getanzt wird in Trachten. Die Kinder sehen wie hüpfende Schneeflocken aus. Eine Frau um die vierzig mit weißem Kleid animiert das Publikum. Sie schwingt hin und her. Mit jedem zweiten Wort dankt sie der Auferstehung Jesu. Nach einer Stunde wandert ein Demonstrationszug zur Wolga. Ein junger Meßdiener trägt ein Kreuz voran. Auf den Treppenstufen am Ufer gibt es einen Gottesdienst im Freien. Ich bin besonders von einem Priester mit einer zylinderförmigen Samtkappe beeindruckt, der vom Gesang an einen Mullah erinnert. Soviel Programm zu Ostern. „Die Bühne und der Marsch zur Wolga, das gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal“, erzählt mir Iwan, den ich durch Zufall mit zwei Studienkollegen wieder treffe. „Die Kirche ist im Kommen. Sie ist die Hoffnung, die Lösung für alle Probleme. Das Orthodoxe ist dabei ganz klar das Wahre.“ Die Worte des Mönchs habe ich noch im Ohr. Interessant ist dabei auch, wie die orthodoxe Kirche sich mit der russischen Kultur verwebt. Dieses Aufgebot an Festlichkeit glitzert wie Wahlkampf. Da kommt es mir vor, als würden sich die Russen in die Zeit des Zaren zurückwünschen. „Jetzt müssen die Russen verstehen, wer sie sind, was sie sind. Und sie können das nur, wenn sie auf ihre 21 22 Messdiener | Wolgograd Verkehr | Wolgograd 23 Vergangenheit schauen“, gab mir der Geistliche gestern Nacht mit auf den Weg. „Die orthodoxe Kirche fürchtet die Konkurrenz anderer Glaubensrichtungen“, deutet Eduard, der Vikar, am Abend in der lutherischen Gemeinde an. „Es ist schon schwierig genug Visa für deutsche Pfarrer zu bekommen. Einen katholischen Priester hat man erst kürzlich die Einreise verweigert, als er von einer Dienstreise ins Land wollte.“ Die Zusammenhänge wurden klarer, ähnliches hat mir bereits Jura auf der Zugfahrt erzählt. „Die orthodoxe Kirche ist eng mit der Politik verbunden. Ein Teil des Schwarzhandel läuft über die orthodoxe Kirche, da offiziell Steuern für Zigaretten und Alkohol entfallen. Das wissen doch alle.“, fügt einer der Wachmänner der Gemeinde hinzu. „Dieses Volk ist kulturell, historisch und geistlich die Glaubensgemeinschaft der Orthodoxen Kirche“, unterstrich Patriarch Alexii II einmal in einem Interview. Mir kommt es vor, als dürfe nur die „rechtgläubige Kirche“ den Anspruch erheben, in Staat und Politik mitzureden. Was sagen nur die über sechs Millionen Muslime, die halbe Million Juden in Rußland und Dutzende Naturreligionen in den Weiten Sibiriens dazu? Wolgograd. Montag, den 6. Mai 2002. Viel zu spät stand ich vor der Tür zum Komitee Hoffnung. Ich wollte mehr über die Situation von Flüchtlingen und Migranten in der Region um Wolgograd erfahren. Das Haus ist aus roten 24 Steinen gebacken, nur drinnen war niemand. Meinen Anruf aus Moskau hat man wohl vergessen. Schon am Morgen meldete sich niemand in der Bürgerhilfe. Da stehe ich nun in einem dreckigen Flur. Eine Mutter durchstöbert mit ihrem Kind Tüten mit Kleidern und Schuhen, die sie unter einem Tisch neben der Tür hervorgezogen haben. Beide raten mir morgen wieder zu kommen. Warum sie hier sind, frage ich sie. Die Tochter deutet mit dem Finger um die Ecke. „Familienhilfe“ steht da mit roten Druckbuchstaben an der Kalkwand. Merkwürdig trotzdem, dass Mutter und Kind sich einfach aus fremden Plastiktüten bedienen. Vielleicht ist das aber auch in Ordnung. Auf einer Bank hinter meinem Rücken meckert eine alte Frau, als ich die Zettel auf der Tafel des Komitees entziffere. Am Sonntag malen zwei Pädagogen mit Kindern. Der Jurist ist nur am Dienstag da. Für Flüchtlinge aus Grozny kann keine Registration vorgenommen werden. Für Entschädigungszahlungen muß man sich direkt an das Amt für Migration wenden. Ganz beiläufig finde ich eine Notiz: „Kleiderspenden bitte unter den Tisch stellen.“ Die alte Frau im Gang sitzt anscheinend bequem und klagt munter weiter. Der Staat würde ja sowieso nichts tun. Nun sitze sie da und wüßte auch nicht weiter. Sie fängt an zu lachen und grunzt ein bißchen. Ich fühle mich wie in einem Theater mit Stehplätzen, wo am Eingang Freikarten verschenkt werden. Bei einem Gespräch mit Eduard und Martin bringe ich weiteres über das Komitee Hoffnung in Erfahrung. Eduard regt mich an, bei einem Interview mit der Leiterin der Organisation doch ganz genau nach der Nationalität der Flüchtlinge, denen sie geholfen haben, zu fragen. Er erzählt mir von zwei tschetschenischen Familien, die vor einiger Zeit die lutherische Gemeinde um Unterstützung baten. Jene wiederum fühlten sich von der Flüchtlingshilfe im Stich gelassen. „Wir konnten ihnen aber auch nicht weiterhelfen. Ein paar Orangen lösen ihre Probleme nicht“, gibt Eduard zu. Es existiert wohl ein Interview, dass mit den zwei Familien aufgezeichnet wurde. Martin will es mir bei Gelegenheit nach Moskau mitbringen. Eduard versucht einen Kontakt zu einer der tschetschenischen Familien herzustellen. „Sie leben arm in einer verkommenden Neubauwohnung irgendwo hier im Wohngebiet. Sie sind verschreckt. Wenn wir sie finden, wäre es gut, wenn du etwas für die Kinder mitbringst.“ Ich fasse Mut mit meinem Studienthema in Wolgograd doch noch weiterzukommen. Wie töricht war, es zu denken, einen einfachen Weg geschenkt zu bekommen. Auf der Straße laufen einem doch keine Flüchtlinge zu. Die Flüchtlingsorganisation hat mich aber auch richtig versetzt. Enttäuscht mache ich mich von der Innenstadt auf zum Heimweg. Die letzten Sonnenstrahlen kitzeln bereits mein rechtes Ohr. Ich sitze auf den Treppenstufen zum längsten Fluß Europas und erlebe für Dich Geschichte Nummer eins, liebes Tagebuch: Oleg und Alexei sind zwei Maikäfer. Einer ist betrunkener, als der andere. Sind in der Feiertagswoche alle so alkoholisiert und völlig betäubt? Jetzt schleppen mir beide noch ein Eis an. In einer Fabrik hat er gearbeitet, erzählt mir Oleg, für militärisches Gerät. Doch seit vier Monaten haben sie ihm keinen Lohn gezahlt. Er ist neunzehn, schwankt auf seinen zwei Beinen und grient mich durch seine Sonnenbrille an. Was er denn jetzt mache, frage ich ihn. Auf dem Markt verkauft er Spielzeug. Hundert Rubel sind das am Tag. Das reicht ihm, heute ist sein freier Tag, da will er sich einfach mal betrinken. Das sei doch schließlich Tradition in Rußland, meint er. In solchen Trinkgemeinschaften gibt es ein interessantes Phänomen: Trotz des Alkohols scheint zumindest einer von ihnen abschnittsweise Nüchternheit zu simulieren. Das lenkt den anderen von seinem Buchstabensalat ab, was wiederum zur Folge hat, dass er eine Flasche Bier für seinen Zeitgenossen anordnet. Beide haben eine schwache Blase, darum ist das Spiel limitiert. Die Sonne ist dem Untergang geneigt. Es wird kühler. Ein Großvater tritt mit seinem kleinen Enkelsohn ans Wasser und deutet mit dem Regenschirm auf die andere Seite. Eine Familiengesellschaft tritt mit dem Auto die Heimfahrt an. Es war ein wolkenloser Tag, den viele mit der Bierflasche in der Hand abschließen wollen. Ich versuche, mir die tief roten Wolken genau einzuprägen, die sich in der Ferne auf die Spitzen der Bäume werfen. Ein Schiff fährt an meiner Nasenspitze vorbei, und ich hoffe, in ein paar Tagen mit einem ähnlichen nach Astrachan zu kommen. Eine alte Frau mit Kopftuch, dicker Hornbrille und rotschwarzem Blumenkleid schneuzt sich vor der brechenden Welle am steinernem Ufer. Ich muß schmunzeln, als sie ihren ebenfalls mit Blumen bedruckten schwarzen Stoffbeutel nimmt und Bierflaschen darin anfangen zu klirren. Etwas gutes hat die Sache ja wenigstens: Morgen kann die Babuschka die ganzen leeren Bierflaschen der Leute einsammeln. 25 Antworten kommen also doch immer. Manchmal haben sie bloß Verspätung. Da hilft es nur sich treiben zu lassen. Ein junges Paar fotografiert sich auf dem Steg. Ich hoffe für alle Betrunkenen, dass sie immer genügsame Zuhörer finden. Mögen sie beim vielen Reden niemals ihre Zunge verschlucken. Erinnerungen kann man leider nicht verborgen. Manchmal ist die Stimmung aber so einmalig, dass man sie nicht vergessen will. Genauso ging es mir, als ich in der Marschrutka1 eine Stunde lang für zehn Rubel viel Freude hatte. Ich erlebe Geschichte Nummer zwei auf der Heimfahrt von einem Ende zum anderen Ende der Wurst entlang der Wolga: Die Leuchtreklame auf der Hauptstraße surrt bereits, als ich mich neben den Fahrer und einen Soldaten dränge. Das blecherne Mobil ist gerade mal halbvoll, als der 1 Kleiner Linienbus. 26 27 Reparaturauto | Wolgograd 28 Mann auf dem Fahrrad | Wolgograd Kaukasier Blinker ansetzt, das Gefährt ausschwenkt und die Dose samt Inhalt in den Verkehr rudert. Die Gesellschaft in solchen Menschenfrachtern arbeitet. Ganz selbstverständlich wird Geld zum Vordermann gegeben, der aus dem gesammelten Topf das Wechselgeld verteilt. Erst dann wird das Büschel an Scheinen dem Busfahrer in die Hand gestopft. Der meistert gleichzeitig das Ausweichmanöver um des nächste Schlagloch, sichtet mit dem anderen Auge willige Fahrgäste am Straßenrand, schlägt einen Haken um einen lahmenden Trolleybus und balanciert lässig seinen glühenden Zigarettenstummel im Mundwinkel. Das Prinzip ist einfach. Wer raus will, brummt einfach „Anhalten!“. Experten geben schon Minuten vorher Bescheid, um sich auf Höhe ihres Plattenbaus bringen zu lassen. Dem Fahrer ist das Wurst. Der nickt, sagt „Gut!“ oder hält einfach zur richtigen Zeit an. Mitfahren ist da schon etwas schwieriger. Da die meisten an einem Zipfel einsteigen ist meist mittendrin kein Platz für willige Zusteigende. Unser Fahrer hat seine Besatzung aber bestens im Blickfeld. Ein Platz genau in der letzten Reihe am Fenster ist schnell geortet. Ob er denn auch bei der Schule 37 vorbeifährt, fragt eine Frau, die mit ihrer ausgestreckten Hand unsere Räder zum Stehen gebracht hat. „Ja!“, hallt es zurück. Die Frau steigt ein und fällt beim sofortigen Ausscheren des Kleinbus erst mal in die helfende Menge. „Zeit ist Geld, schließlich bringt jede Runde die Punkte für die Abrechnung am Monatsende“, erzählt mir der Fahrer später. Bereits nach zehn Minuten vergewissert sich die zugestiegene Frau abermals nach besagter Schule 37. Die Frau scheint mir eine besorgte Mutter auf dem Weg zur Elternversammlung zu sein. Bei erneuter Nachfrage einige Minuten später tröstet sie der Kaukasier: „Ja, ich weiß doch. Ich werde dort anhalten. Das dauert aber noch.“ Dann dreht er den Kopf zu mir und fragt „Hier?“, ich ziehe verdutzt meine Schultern bis zu dem Ohren. „Wie bitte? Ich will hier nicht aussteigen“, und wende mich zu meinen Mitfahrer zur rechten. Der Soldat telefoniert gerade und war wohl der unbemerkte Auslöser für die Verwirrung. Der Fahrer schaut mich an, wir müssen beide anfangen zu lachen. Nur die Stimme der übereifrigen Mutter geht mir langsam auf die Nerven, die sich schon wieder nach der Haltestelle erkundigt. Vorher steigt noch ein alkoholisierter Russe zu, den ich bis nach vorne rieche. „Die Fahrpreise sind doch viel zu teuer!“, lallt er und brabbelt auf die anderen Fahrgäste ein. Nach weiteren zehn Minuten ist aber wenigstens die vermeintliche Mutter am Aussteigen. Schule 37 haben wir erreicht. Zwei junge Russen warten schon mit einer Flasche Bier auf sie. Doch keine Mutter, denke ich mir. Einfach jemand, der durstig ist. Nach über einer Stunde ist der Spaß vorbei. Ich entknote meine Beine aus dem Fahrerhäuschen. Ein letzter Blick auf den kaukasischen Fahrer. Der hat sich schon wieder eine Zigarette angezündet und den ersten Gang bereits eingelegt. Morgen darf ich den gleichen Spaß erleben. Jeden Tag ein ganzes Abenteuer in einer Stunde für zehn Rubel. Ende der Aufschrift gegen 2 Uhr morgens 29 Wolgograd. Dienstag, den 7. Mai 2002. Heute mal alles in Kurzform: Verschlafen. Telefonate hinsichtlich der Flüchlingsorganisation Komitee Hoffnung führen weiterhin ins Leere. Bekomme die private Telefonnummer der Leiterin über die Auskunft heraus. Ebenfalls keine Antwort. Fahre in die Stadt. Die Frau von der Administration des Bürogebäudes schlußfolgert auf die Feiertage. Gang zur Stadtverwaltung. Das kann doch hier noch nicht alles gewesen sein. Der Mitarbeiter für Migrationsfragen hat gar keinen Plan. „Ja, wer sind Sie überhaupt? Warum wollen Sie diese Informationen? Sind Sie Deutscher? Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen.“ Ihr Vorgesetzter läßt auch nicht mit sich reden. Beide kennen noch nicht mal das Komitee „Hoffnung“. Verweisen mich auf das Rote Kreuz. Das Amt für Migrationsdienst will auch keine Angaben herausgeben. Mache mich auf zum NGO-Beratungszentrum vom DeutschRussischen Austausch. Durchforste mit Claudia, einer deutschen Praktikantin, die Bibliothek. Plündere sämtliche Listen mit Hilfsorganisationen in Süd-Russland. Finde Hinweise auf Ressource-Zentren in Krasnodar, Stavropol und Astrachan. Überlege meine Reiseroute zu ändern. Ich setze auf nichts und niemanden mehr. Endecke ein Schild mit arabischen Schriftzug auf dem Rückweg. Das Rote Kreuz hat geschlossen. Abends, fahren Angeln. Treffen uns mit Wowa. Sohn des Wachmanns, der ihn mit Martin zusammengebracht hat. Wohnt in einer Siedlung außerhalb der Stadt. Kleines Sammelsurium an Häusern. Alles sehr heruntergekommen und improvisiert. Um so herzlicher er und seine Familie. Nette Menschen. Er ist 19 Jahre alt, studiert Archäologie. Schenkt mir eine Patrone aus dem 2. 30 Weltkrieg. Ein Rohr der Panzerabwehr liegt hinter dem Schuppen im Garten. Zeigt mir begeistert einen Helm mit Einschussloch. Ich schweige. Gehen zum Kanal. Quer über die einzige endlos auseinandergezogene Straße. Vorbei an einem hintümpelnen Bach. Gekonnter Sprung über ein Abflußrohr. Ein bellender Hund. Leute, die nach dem rechten Sehen. Es riecht es nach Kuhdung. Dorfleben, mal was anderes für einen Stadtmenschen. Die Stechmücken hätten nicht sein müssen. Nach dem ersten Wurf der Pose schon der erste Fisch. Russen tun die gefangenen Fische einfach so lebendig in eine Tüte. Auf einmal, ein riesiges Schiff in einem kleinem Kanal. Faszinierend. Tee und Blini2 zum Abschied. Das muss die russische Gastfreundschaft sein. Kein Auto nimmt uns als Anhalter mit. Wolga-Don-Kanal. Gigantischer Staudamm. Festungswall ließ der russische Zar errichten. Bollwerk gegen die dauernden Überfälle von Kosaken und Steppenvölkern. Ein Schleuse. Beeindruckendes Bauwerk. Neoklassizmus. 1952 fertiggestellt. Stalin war bei der Eröffnung nicht dabei, soll aber drüber geflogen sein. Technik, die Hunderte von Bruttoregistertonnen anhebt. Shell-Fässer. Öltanker vom Kaspischen Meer. Denke an den Krieg in Tschetschenien. Wirklichkeiten liegen so nahe. Ende der Aufschrift 4 Uhr morgens 2 Eierkuchen. Wolgograd. Mittwoch, den 8. Mai 2002. Immer noch Feiertagswoche. Sprüche werden zwischen zwei Bäume gespannt. Auf dem Markt steht ein Veteran. Viel Metall hängt an seiner Brust. Ein Blumenhändler preist seine roten Nelken an. „Für die Russen ist das wie Weihnachten“, witzelt Erik am Morgen. Martin ist krank. Ich breche zu dem Ehepaar auf, dass er sonst zwei mal die Woche betreut. Ina und Achmed empfangen mich offen mit einer unbeschreiblichen Selbstverständlichkeit. Sofort wird mir ein Platz in der Küche angeboten. Sie freuen sich über den unbekannten Besuch. Ich habe mich noch nicht mal richtig vorgestellt, als mir Irina einen Teller mit Reis und Suppe reicht. Ich 31 Stadtlandschaft | Wolgograd Zu Besuch bei Ina und Achmed | Wolgograd 32 solle doch erstemal essen und satt werden. Die Situation ist ausweglos. Ich fühle mich unsicher. Mein Blick geht durch die Wohnung. Das Zimmer ist nicht groß. Viel haben sie nicht. Hier wohnen sie nun zu dritt, ihre kranke Schwester liegt im Bett. In der Küche: drei Teller, eine Kanne, zwei Töpfe. Beide sind aus Grozny. Ina ist Russin, er Ingusche. Sie lernten sich vor dreissig Jahren in Tschetschenien kennen. Damals hatte Ina noch für die Verwaltung die Renten verteilt. Achmed hat als Bauarbeiter Häuser und alles mögliche für die sozialistische Republik gebaut. Seit 1999 sind sie in Wolgograd. „Der Krieg ist doch nicht auszuhalten“, erzählt Irina. „Nur er ist viel zu spät nach Wolgograd nachgekommen“, murrt sie. Beide sind herzlich, stacheln sie gegenseitig an, und ich bin vergnügt, ihrem Plaudern zuzuhören. Ina stellt mir Hühnchen vor die Nase. Als sie an den mitgebrachten Lebensmitteln herumwuselt, lenke ich ein. Das geht doch nicht. Die beiden haben nichts, dennoch bieten sie mir alles was sie haben an. Wie kann ich ihrer Gastfreundschaft nur gerecht werden? Ina erzählt mir von ihrem Leben vor und während des Krieges in Tschetschenien. Ich blicke heimlich zu Achmed. Der sitzt einfach nur da und lächelt mich an. „Du sollst nicht in der Küche rauchen!“, schimpft Ina heftigst. „Ja, ja“, sagt er nur und trollt sich ins Wohnzimmer. Achmed ist Invalide der ersten Stufe. Sein Alzheimer ist bemerkbar. Er schwärmt vom Kaukasus: „Кавказ это Кавказ - Der Kaukasus ist der Kaukasus. Dazu kann ich dir nichts erzählen, das mußt du sehen und spüren. Dazu hat der Junge aber noch Zeit.“ „Weder gut, noch schlecht geht es uns. Wir leben noch“, stellt Ina fest. „Wir helfen uns untereinander, dann geht es schon. Die Bürgerhilfe in der Stadt hat jetzt auch die Dokumente für Achmed aus Grozny angefordert. Vielleicht bekommt er bald auch seine Pension. Die Töpfe dort haben mir Freunde geschenkt.“ Der Wasserhahn im Bad ist hin. In der Platte müßte man so einiges reparieren. Als ich gehe, drückt mich Achmed zum Abschied auf der Straße. Mir ist warm, auch wenn ein kalter Wind durch den Pullover bläst. Am späten Abend in Sarepta versuche ich, die zwei Familien ausfindig zu machen, von denen mir Eduard berichtete. Fehlanzeige, Martin erzählt mir dafür von einer Frau, die er auf der Straße kennengelernt hat: „Für gewöhnlich steht sie dort drüben neben dem Kiosk. Die letzten Wochen hat sie Sirok3 verkauft. Früher war sie wohl Politikerin in Tschetschenien, jetzt schreibt sie Briefe an Putin. Sie bittet um einen Termin. Einmal wollte sie in einem Geschäft ein Brot kaufen. Die Verkäuferin stellte sich stur, Tschetschenen würde sie nicht bedienen. Danach hat sie sich die Haare gefärbt, um nicht aufzufallen und arbeiten zu können.“ Sie wohnt in einem Hotel, zwei Häuser neben der Gemeinde. Ich mache mich gleich auf den Weg und finde ein ranziges Haus. Die Luft ist schlecht. Das Ambiente erinnert mich an eine Jugendherberge. Nur ihr Sohn ist da. Die Mutter ist in Moskau. Kasbek ist zurückhaltend, nur zögerlich läßt er mich in den 3 Eine süße kleine Speise aus Quark und Käse überzogen mit Schokolade. 33 kleinen Raum. Vor dem zweiten Krieg in Tschetschenien war er Geschäftsmann. Ein Cafe, einen Laden und ein Haus mit 14 Zimmern hatte er. „Ich war reich“, flüstert er. „An einem Abend hat ein Hubschrauber alles nieder gebombt. Vor drei Jahren sind wir hierher geflüchtet. Nun habe ich nichts.“ Ich kann mich nur schwer in seine Situation denken. Warum er nicht wieder arbeitet, frage ich ihn. „Wenn du nur wüsstest.“, antwortet er und zittert. Manchmal sollte ich einfach keine Fragen stellen. Ich höre ihm zu: „Wir hatten Bekannte hier. Über Elista in Kalmückien sind wir mit dem Auto hierher gekommen. Danach habe ich das Auto verkauft. Unsere Ersparnisse sind längst dahin. Der Krieg hat uns bankrott gemacht.“ Die Stimmung ist mutlos. Kasbek zuckt mit den Schultern. Als ich mich mit ein paar tschetschenischen Wörtern bedanke, weicht sein hartes Gesicht auf: „Hoffnung, das heißt warten. Warten darauf, dass der Krieg aufhört. Wie lange es noch dauert, wissen wir nicht. Geholfen wird dir nicht.“ Von „Hoffnung“ hat Kasbek gehört, für das Komitee und den Migrationsdienst findet er aber nur böse Worte. „Ich träume von einer besseren Welt mit einer gerechten Zukunft.“ Ich schwimme in Eindrücken. Wie optimistisch können wir sein? Meine Gedanken machen mir Angst. Viel zu spät schleiche ich mich in den Jugendabend der Gemeinde herein. Es geht um Flüchtlinge, die nach dem Bau der Berliner Mauer von Ost- nach Westdeutschland geflohen sind. Ich will ihre Meinung zum Krieg in Tschetschenien hören. Ein Junge mit blonden Haaren hat Angst vor Kaukasiern. Ein Freund 34 von ihm ist einmal in eine Schlägerei geraten. „Die Kulturen sind zu unterschiedlich. Eine Integration findet nicht statt“, findet er. „Außerdem kannst du doch nicht einfach dorthin, wohin du willst, nur weil es dir schlecht geht“. Diese Aussage ist spannend, da es den Freiheitsbegriff berührt. Ein 20-jähriges Mädchen kritisiert die Rolle der Medien: „Woher wissen wir, was wirklich dort abläuft? Ich bin Russin und selber aus Grozny. Die Vorurteile im Fernsehen sind unerträglich.“ Die Diskussion bleibt differenziert. Erik erzählt uns von seiner Wohnungssuche. „Ist euch mal aufgefallen, dass in den Annoncen «Только русских – Nur für Russen» steht? Wie würdet ihr euch fühlen? “ Dazu fallen mir etliche Momente ein, bei denen die Miliz ausschließlich Kaukasier auf der Straße anhielt. Setzt diese Art der Paßkontrolle nicht schon den Gleichheitsgrundsatz außer Kraft? Erstaunt hat mich die generelle Angst vor den Kaukasiern. Interessant auch, dass mich ein Student fragt, wie wir in Deutschland damit umgehen würden: „Ist es bei Euch besser?“. Wir einigen uns darauf, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. „In jeder neuen Kultur liegt doch eine Bereicherung“, schließt ein Mädchen ab. Ich bin zu müde, um alle Meinungen aus dem Kopf zu fischen. Ende der Aufschrift 11 Uhr abends Wolgograd. Donnerstag, den 9. Mai 2002. Kriegsende, Heldentag, die roten Fahnen sind gehißt. Wir sind mutig und fahren zum Ehrenmal. In der Straßenbahn herrscht Ausnahmezustand. Am Mamajew-Hügel geht die Post ab. Zivilisten und Soldaten wandern empor zur „Mutter Rußland“. Ein Mann fotografiert seinen Sohn. Der Kleine salutiert. Seine Uniform blitzt. Am „Tag des Sieges“ werden die Orden wieder angelegt. Auf dem Rand eines Springbrunnens legen Kinder Blumen nieder. Im Schein der Sonne treiben Blüten auf einen Helden aus Stein zu. Die Inszenierung ist perfekt. Beim Gang die Treppen hinauf hören wir den Radioausschnitt der Kapitulation Hitlerdeutschlands. Musik spielt auf. Wir streiten vorbei an Bildern, die links und rechts neben uns in die Granitwände geschlagen sind. Stalingrad ist Heldenstadt. In einer Halle sind die Namen der Toten verewigt. Umschlossen von einer kolossalen Hand brennt eine Fackel in der Mitte. Ein junger Soldat wacht über die Ordnung. Die Menge schiebt sich staunend zum Ausgang. Die nächste Stufe dieses riesigen Parks ist erreicht. Ich sehe drei Herren, die sich auf 35 Schulterklopfer am 9. Mai | Wolgograd Feuerwerk | Wolgograd 36 der Wiese treffen. Einer von ihnen trägt das Bild Stalins. Man klopft sich auf die Schulter. Eine alte Sowjetfahne weht im blauen Himmel. In ihrem Schatten liegen Hefte. Sie sollen über das Leben des Genossen Stalin aufklären. Entlang an den Grabplatten gefallener Generälen nähern wir uns der Mamaja. Die „Mutter Russland“ ist gigantisch. Ihr Gesicht ist energisch. Das Schwert erhebt sie drohend dem Feind und schützend der Heimat entgegen. Dem Pathos dieser Figur kann ich mich nur schwer entziehen. Ihr Haar und ihr Kleid sind im Wind versteinert. Sie ist die größte freistehende Statue der Welt, exakt zweimal so groß wie die New Yorker Freiheitsstatue. Die Leute grillen hinter den Büschen. Ein fülliges Damentrio trällert russische Volkslieder. Die Gesellschaft sitzt im Gras und applaudiert. Menschenschlangen warten vor den gelben Tonnen auf einen Becher Kvas4. An einem Stand kann man Militärkappen mit rotem Stern kaufen. Das Volk drängt zu den Schaschlikbuden. Glocken läuten den Weg hinauf. Die orthodoxe Kirche pilgert zum Gottesdienst im Grünen. Später wird der Pope einen Grundstein für ein neues Gotteshaus ganz in der Nähe der Mamaja legen. Die Presse hat schon die Kameras auf die Baustelle gerichtet. An einem Baum entdecke ich in einem kleinen Glaskasten eine Ikone. Dieses Land ist ein Rätsel. Nach dem Krieg wurde Wolgograd vollkommen neu aufgebaut. Das Zentrum ließ Stalin im Neoklassizismus rekonstruieren. Nur ein Haus stand noch. Heute steht daneben das Panorama- 4 Gegorenes Getränk aus Brotteig. Museum, das wie ein in die Höhe gezogener Schützenbunker aussieht. Wie ein Raumschiff platzt das Bauwerk in die Landschaft. In der letzten Etage ist die Schlacht von Stalingrad nachgestellt. Die Szenerie wirkt echt. Mit Wohlwollen führt eine alte Dame durch die Ausstellung und deutet auf einen Mann, der brennend mit einem Molotow-Cockail auf einen deutschen Panzer rennt. „Dieser Soldat gab sein Leben für die Freiheit unserer Heimat“, erläutert sie. Straßen und Stadtbezirke sind im ehemaligen Stalingrad nach den Helden benannt. Überall finden sich viele signifikante Zeichen des Großen Vaterländischen Krieges. Die Siegessymbolik schwebt in der Stadt mit. Die unverständlichste fand ich neben einem Ehrenfeuer in der Innenstadt. Zwei Mädchen mit Schleifen im Haar stehen davor, typisch russisch denke ich mir. Ich entdecke zwei Jungen in grüner Montur mit Gewehren und erschrecke. „Die stehen meist vormittags in der Woche da. Frage mich, ob die überhaupt zur Schule gehen“, kommentiert Martin die Gegebenheit. Nach dem Wachwechsel marschieren sie im Gleichschritt auf die andere Straßenseite. „Ob das in China auch so ist?“, überlege ich mir und muß lachen. Ich hatte ja viel erwartet, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Ähnlich ging es mir mit Lenin. Der steht nämlich am Ufer zur Wolga und schaut auf das Wasser. Der größte Lenin der Welt steht in Wolgograd. Diese Stadt ist die Heimat der Superlative. Am Abend genießen wir das Feuerwerk. Am Tag des Sieges hört man die Nationalhymne im Autoradio. Ich habe an dem heutigen Tag das Gefühl mir einen ganz anderen Teil russischer Wirklichkeit erschlossen zu haben. 37 Wolgograd ist voller Helden. Meiner heißt Sascha. Um Mitternacht warte ich vor der Brotfabrik. Umhüllt von Brotgeruch lasse ich mich in eine Traumwelt tragen. Fleißige Hände patschen Laibe in die Maschine. Kübel mit Teig werden durch die Gegend geschoben. Sascha steht mir seinem weißen Lada vor dem Tor. Er ist der Brotfahrer. Ich bettle in gebrochenem Russisch. „Wat, habt da bei euch etwa keen Brot?“, gluckst er. Ich träume weiter. Sascha ist weg. Der Wachhund kläfft. Das Tor öffnet sich. Ich gehe. Nur ein warmes Brot schützt mich gegen die eisige Nacht. Es braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Ende der Aufschrift gegen 2 Uhr morgens Wolgograd. Freitag, den 10. Mai 2002. Es regnet. Ich sitze im Zug und nehme Abschied von Wolgograd. In diese Stadt läßt es sich schnell einleben. Trotz Chemiefabriken und Plattenbauten hat sie ihren ganz eigenen Charme. Kurios allein der Hafen und das Operngebäude. Wie eine riesige Torte wirkt das Gebilde, verbacken zu einer futuristischen Konstruktion. Ob nun schön oder mutig, ich mag mich gar nicht entscheiden. Es ist schon grotesk, wie rasant uns doch die Zeit mitnimmt. Wir begegnen Menschen, hören ihre Geschichten. Sie sind ehrlich. Wir steigen heimlich in fremde Träume und erleben alles still mit. Es ist nur die Frage, auf welcher Seite wir stehen. Die Hitze im Autobus ist unerträglich, als wir uns auf den Weg zu Luzi machen. Wir kommen direkt vom Staudamm, den wir aus 38 der Nähe betrachten wollen. Der Schriftzug „Ehre der Arbeit“ auf einem Fabrikgebäude verwundern mich gar nicht mehr. Vergangenheit und Zukunft sind irrelevant, denn sie sind eins. Kurz nach meiner Ankunft lernte ich Luzi am Hafen kennen. Sie wartete auf ein Schiff, dass ihr Briefe von Freunden aus Deutschland mitbringen sollte. Von der Städtepartnerschaft Wolgograd-Köln erzählte sie schon am Montag. Nun folgen wir ihrer Einladung. „Bringt bloß keine Blumen mit“, bittet sie uns vorsorglich. „Die sind so vergänglich. Überhaupt, ich brauche nichts.“ Lustig sind sie schon die Österreicher. Ich fühle mich wohl, als wir in Luzis kleinen vier Wänden „guten Kaffee aus Wien“ trinken, wie sie selbst sagt. Mit 14 Jahren ist sie von Österreich nach Swetlowsk geflüchtet. „Das war 1934, als die Nazis uns „Heim ins Reich“ holen wollten“, erzählt sie. „Ich bin Jüdin, wir mußten fliehen.“ Ihr Bruder arbeitete schon in Wolgograd, die Familie sollte nachkommen. An der Technischen Universität hat sie gelernt. Für das Ingenieurstudium hat sie aber keinen Abschluß bekommen. Später arbeitete sie als Spezialistin für Hebe- und Neigetechnik im Traktorenwerk am Reißbrett. „In den Traktorenwerken wurden früher Panzer gebaut“, weiß Luzi und schenkt Kaffee nach. Nach Rußland kam sie ohne ein Wort Russisch. „Nur „nitschewo5“ konnte ich sagen“. Das ist übrigens eines der vielen russischen Universalwörter und heißt so viel wie „gut, schlecht, ich habe nichts oder das macht nichts“. Es mag an der Betonung liegen, um es in den entsprechenden Situationen richtig einzusetzen. 5 ничего. Luzi will hundert werden, das hat sie sich ganz fest vorgenommen. Eine bekannte Sängerin aus Wolgograd ist 95 Jahre alt geworden. Die will sie schlagen, meint die 81-Jährige. Vorher wird sie Bürgermeisterin in Wolgograd und räumt auf. „Die wollen mich ja nicht“, gibt sie spaßend zu. Ihr österreichischer Akzent ist köstlich. In Rußland will sie bleiben. „Was soll ich in Deutschland oder Österreich, mein Leben ist hier“, sagt sie. „Hier habe ich doch alles. Und wenn du hier zu Besuch kommst, sind die Menschen offen und herzlich. Hier geben die Menschen für den Gast alles was sie haben. Und was kostet es? Machen wir uns doch nichts vor, Brot und Käse hat doch jeder. Dann gibt man es gerne und zählt vorher und hinterher nicht nach. Ich war einmal in den Staaten, da meinte meine Freundin noch: Iß gut, bei denen sind die Wurstscheiben abgezählt. Was soll das, so verklemmt will ich nicht leben.“ Da hat sie irgendwie recht. Als Gast ist man Freund. Ich hatte und habe in Rußland immer das Gefühl, willkommen zu sein. Luzi | Wolgograd 39 40 Kinder am Abend auf der Strasse | Astrachan Ich hoffe, dass Luzi über hundert wird, und sie bald wiederzusehen. Es ist mitreißend, solche herzlichen Menschen zu treffen. Am späten Abend mache ich mich auf zum Bahnhof. Im Kleinbus erzählt mir noch ein Mann von seinem Leben in Grozny. Vier Kinder hat er. Vor drei Jahren sind sie geflüchtet. Die Familie lebt jetzt in einer Einzimmerwohnung im Randbezirk. Sie haben alles zurückgelassen. Freunde, Verwandte, das Glück, ihr Leben, alles hat sich der Krieg geholt. Seine Worte klingen ohne Hoffnung. Seine braunen Augen blickten in die Leere. Dennoch, seine Freundlichkeit und Offenheit machen mir Mut, seine Menschlichkeit scheint unsterblich zu sein. Er klagt nicht. „Irgendwie muss es ja weitergehen“, sagt er. „Politik ist doch ein riesiges abgekartetes Vergnügungstheater. Die machen mit uns was sie wollen.“ Damit hat er Recht, vielleicht ist das ja, was die Zustände auf der Welt so katastrophal macht. „Freiheit? Ich will, dass es aufhört und meine Kinder keine Angst haben müssen“, endet er. Und dann erinnere ich mich noch an eine Begegnung auf dem Markt am heutigen Morgen. Ich komme mit einem Obsthändler ins Gespräch. Er ist seit zwei Jahren in Wolgograd, seine Familie hat er jetzt aus Dagestan nachkommen lassen. Schon komisch, die Zeit scheint nur die Koordinatensysteme zu verschieben, die Probleme bleiben im Kern doch beständig. Es regnet immer noch, als die Zugrädern sich mit uns quietschend in Bewegung setzen. Auf in Richtung Astrachan. Wolgograd, du bist eine merkwürdige Stadt. Ich habe mir dich viel kleiner vorgestellt. Aber nein, die Leute sagen, du hättest sogar eine Metrostation. Oder gaukelst du uns nur etwas vor? Das „T“ für Tramwai6 sieht in der russischen Schreibschrift ganz wie ein „M“ für Metro aus. Verdächtig, verdächtig. Du bist halt eine Wurst. Man weiß nie was kommt, denn der Zufall pirscht sich von zwei Seiten auf einen zu. Doch jede Stadt hat seine Eigenarten. Du hast dazu das Rauschen der Wolga und den Glanz des Ruhmes. Grüß mir die Stille. Dein Bild bleibt mir ein Weggefährte auf meiner Reise. Ich sehe dich wieder, sooft ich will, denn dein Bild lebt in meiner Erinnerung. Wir bewegen uns rhythmisch zur Melodie der Gleise. Meine letzten Blicke haften an der Mamaja. Nur das kleine rote Licht auf ihrem Schwert durchbricht die Nacht. Dieses Monument ist so überwältigend und wirkt doch wie eine winzige Spielzeugfigur. Ein kleiner Junge schreit auf: „Da ist sie, da ist sie. Wir kommen wieder. Mama, wir müssen wiederkommen.“ Astrachan. Sonnabend, den 11. Mai 2002. Ich sitze wieder im Dunkeln. Stromausfall. Es gibt doch noch Hoffnung auf dieser Erde. Solche Augenblicke stimmen mich glücklich. Das Unerwartete liegt doch in den kleinen Dingen des Lebens. Es ist abend, doch am Morgen fing dieser Tag an: Da wartete Vera am Bahnhof. Sie, eine lustige Frau, rüstig um die vierzig. Gelernt hat Vera Modedesign, jetzt ist sie Vikar der lutherischen Gemeinde in Astrachan. Eduard hat mir die 6 Strassenbahn. 41 Telefonnummer vermittelt. „Vera kennt jeden in Astrachan. Sie kann dir helfen.“ Astrachan hat das Kaspische Meer vor der Tür und grenzt an Dagestan, hier sollte ich in puncto Flüchtlinge doch fündig werden. In Astrachan sind die Kinder noch mit dem Fahrrad unterwegs. Hier kann man ohne Herzklopfen die Straße überqueren. Die Stadt ist das Venedig Rußlands. Kleine Brücken und Kanäle verschlingen sich gegenseitig. „Wenn wir etwas haben, dann Fisch. Die Leute werden so immer überleben.“, erzählt Vera. Auf der Hafenpromenade angeln drei Jungs mit Holzstöcken. Ein Stückchen Kork haben sie als Pose an die Schnur geknotet. Ein zottliger Hund tapst um sie herum. Neben ihnen ein alter Mann mit Schlappmütze, der einen Fisch nach dem anderen aus dem Wasser zieht. Ausgediente Frachter schwimmen als Restaurants daher, das Netz und ein Grill direkt auf der Brücke. Frischer hüpft der Fisch nicht auf den Tisch. Urlauber flanieren an den Booten vorbei. Ich bin mitten im Wolga-Delta. Die Sumpflandschaften sind mir schon auf der Zugfahrt am Morgen aufgefallen. Astrachan ist historisch gedient. „Das Haus ist 180 Jahre alt. Mach dir keine Sorgen, aber es hat so seine Macken.“, sagt Vera, als sie eine große Tür aufschließt. Ein Teppich hängt an der Wand, die Balken knarren, die Luft riecht nach faulem Holz. Eine Brigade von Ameisen fangen an, die Zuckerdose zu erobern, als wir in der Küche sitzen und über Nationalitätenkonflikte in Astrachan sprechen. „Ich habe nur kaltes Wasser. Wir können heute Abend zu einer Freundin fahren, dann kannst du dich dort duschen.“ Und so sitze ich schon wieder in einer anderen Küche. Der Strom ist immer noch nicht an. Vera erzählt weiter von den Kosaken. 42 „Bei uns leben alle friedlich zusammen: Russen, Tataren, Kasachen, Deutsche. Über zwölf Nationalitäten konzentrieren sich auf einen Fleck. Im Gegensatz zu Krasnodar und Stavropol kommen hier alle gut miteinander aus.“ Im Fernseher läuft russischer Humor, den verstehe ich nicht und kann nicht lachen. Auf dem Tisch steht Fisch, wie sollte es anders sein, ich freue mich. Astrachan. Sonntag, den 12. Mai 2002. Gegen 7 Uhr in der Früh brechen wir zum Gottesdienst auf. Ich hätte nicht gedacht, dass ich auf meiner Reise mit Kirche zu tun haben würde. Vera sucht alle Utensilien zusammen, derweil schaue ich „Dienen in Rußland“. Der Sprecher lobt die Spezialausbildung von Jugendlichen in Moskau zu Elitekämpfern. Im Deutsch-Russischen Haus sitzt die Gemeinde. Da werde ich erstemal in den Deutschunterricht abkommandiert und kritzle Autogramme in die Schulhefte. Danach geht es auch schon auf Exkursion durch die Stadt. Die Kinder zeigen mir, wie man es einem Grashalm eine Tröte bastelt, ich bin begeistert. Wir schlendern über einen Flohmarkt und lästern im Park über eine Volkstanzgruppe ab. Heute ist Muttertag, da hat sich die Jugendgruppe ein Theaterstück ausgedacht. Später erzähle ich vom nationalsozialistischen Hintergrund des Feiertags. Eine alte Dame rettet mich aus den Gesellschaftsspielen mit den Jugendlichen und will alles über Deutschland wissen. Es gibt viele Russlanddeutsche in Astrachan, die müssen jetzt einen Sprachtest bestehen, um nach Deutschland zu kommen. Da wollen alle mit mir Deutsch sprechen, und die Geburtsstadt ihrer Eltern an der Karte gezeigt bekommen. Man holt Listen von Hilfspaketen aus Deutschland hervor, alles haben sie ganz genau notiert. Erst am späten Abend komme ich aus dem Deutsch-Russischen Haus los. Vera und ich schlendern durch die Fußgängerzone und suchen ein Internetcafe. Das verrückte ist, das wir eins finden, da sage doch noch jemand Rußland sei rückständig. Durch Zufall trifft Vera eine Bekannte wieder. Sie ist aus Baku und arbeitet am Blumenstand neben dem Fotoladen. Mit ihren drei Kindern ist sie gleich nach Ausbruch des Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan geflüchtet. Zuerst waren sie obdachlos, dann hat 43 Lenin vor dem Kreml | Astrachan 44 Zirkus | Astrachan ihnen Vera geholfen. Ihr Gesicht ist alt, die Haare kurz, sie steckt sich eine Zigarette an. Ich schätze sie auf 45 Jahre, dabei ist sie erst 32. Das kommt vom Streß, erzählt mir Vera später. Die Gemeinde hat viel zu tun. Ein Problem sind die vielen Straßenkinder. Wir sprechen über Armut in Rußland und Vera hat da so eine Theorie beim Betteln: „Schau dir die Leute vorher ganz genau an, ehe du ihnen Geld gibt’s. Alte Frauen mit sauberer Kleidung betteln, weil ihre Rente zu niedrig ist und sie anders nicht überleben können. Straßenkindern mit glasigen Augen gib nichts, sie kaufen sich davon nur wieder Klebstoff. Zigeuner auf der Straße betreiben organisierte Kriminalität, für die ist Betteln ein Geschäft.“ Ich habe mich oft gefragt, wie man helfen kann. Es mag doch egal sein, wem man hilft oder wie vielen. Doch so viele leere Hände wurden mir allein heute hingehalten: vor der Kirche beim Spaziergang mit den Kindern durch die Stadt; im Geschäft, ein kleines Mädchen brauchte Geld für Brot. Was sollen wir machen? Natürlich können wir nicht allen helfen, aber schon einem, dem wir helfen, ist geholfen. Die Gedankengänge von Vera hatte ich noch nicht bedacht. Rußland ist ein Mysterium. Bei aller Gastfreundschaft und Herzlichkeit, die mir hier entgegengebracht wird, hat dieses Land doch seine ganz eigenen Probleme, die fernab von unserer westlichen Alltäglichkeit liegen. Am Abend sitze ich mit gestütztem Kopf auf der Hand vor dem Fernseher. Die Berichterstattung läuft. Ich sehe weinende Mütter und blutverschmierte Soldaten. In einer Stadt in Dagestan wurde ein Anschlag während der Militärparade verübt. Putin ist entrüstet. Die Stellungnahmen von Blair und Schröder flimmern über die Scheibe. Bush spricht von einem „niederträchtigen Schlag des internationalen Terrorismus“. Es geschah am 9. Mai. Ich habe seit letzter Woche keine Zeitung gelesen, die Nachrichten im Fernsehen machen mich jetzt sprachlos. Warum Dagestan? Was ist genau passiert? Das kann doch nicht wahr sein, rast es durch meinen Kopf. Ende der Aufschrift 1 Uhr morgens Astrachan. Montag, den 13. Mai 2002. Gegen Mitternacht. Es ist, als wäre es Freitag der 13. Spätestens mit dem heutigen Abend ist mir klar geworden, dass ich mir mit meinem Studienthema hier an allen Ecken anstoße. Genau in diesem Moment fühle ich mich verängstigt. Auch nach einigem kräftigen Durchatmen gelingt es mir nicht gleich einen klaren Gedanken zu fassen. Auch wenn ich mir fünfmal ins Ohr zwicke, werde ich nicht aufwachen können. Ich bin schon viel zu lange mit wachen Augen in einer erschreckenden Wirklichkeit angekommen. Es gibt wohl Themen, die man lieber anspricht. Schon gar nicht dann, wenn man in einem Land lebt, in dem man sich um seine eigene Antwort fürchten muss. Es ist auch schon zu spät. Ich würde mich lieber glückseelig in einen süßen Traum verkriechen. Ich habe aber um so mehr Angst, diesen Punkt, diese Begegnung und diese Eindrücke nie wieder in meinem Leben so genau wiedergeben zu können. Ich bin mir nicht sicher, wann ich diesen Fehler im Interview mit Sira gemacht habe. Doch spätestens, als sie bat das Band zu löschen, ist mir klar geworden, 45 dass ich es mit irgendwas zu tun habe, dass ich selbst bis zu diesen Augenblick nicht ganz zu begreifen mag. Eigentlich lief alles ganz normal. Sie, Inspektorin bei der Miliz und Major bei der Marine ist heute aus Dagestan zurückgekommen. Sira zeigt mir Fotos vom Ort des Anschlags in Kaspisk. Eine Gasbombe wurde während der Militärparade gezündet. Neun Menschen sind gestorben, es gab 15 Verletzte. Sira hat dort als Offizier der Flotte den umgekommenen Astrachaner Soldaten gedacht. Ich stelle ihr Fragen zu Tschetschenien, Dagistan und den Zustand der russischen Armee. Klar, man muß bei diesem Konflikt beide Seiten beleuchten. Aber was wissen wir schon? Können wir den Nachrichten trauen? Ich frage zu dem Vorfall im Zug. „Warum bist du überhaupt auf dieser Reise?“, fragt sie mich, „du willst uns doch nur schlecht darstellen.“ Dabei geht es mir doch nur darum, den Dingen auf den Grund zu gehen. „Deine Organisation verfolgt doch damit irgendwas“, wirft sie mir vor. Dieser Verfolgungswahn verwundert mich. Alles geht mit einem Male entzwei. Ihre Gesichter verändern sich. Ich erzähle von Kasbek, der alles verloren hat, und gebe zu, dass ich mich in eine solche Lage eines Flüchtlings nicht hineindenken kann. Mein Mitgefühl für Kasbek kann sie nicht verstehen, ich solle schließlich an die russischen Flüchtlinge aus Tschetschenien denken. Tschetschenen sind für sie Terroristen. Sie beschwört die Freundschaft zwischen allen. „Deutschland, ja wir müssen uns doch verbrüdern. “ Ich habe das Gefühl in einer schlechten Seifenoper zu stecken, in der sich alle gegenseitig anlügen. Was will sie? Geht es ihr um die Brüderschaft mit Deutschland? Wir 46 sehen Doris Schröder bei einem Jugendwettbewerb von jungen Russen und Deutschen im Fernsehen. Weitere Fotos kann sie mir nicht zeigen, die hat sie dem Admiral gegeben. Dann erzählt mir Sira von ihrem Vater. Der hätte doch Orden verdient, schließlich saß im Konzentrationslager in Deutschland. Das hat sie selber erst vor einiger Zeit erfahren, dass er ein Held ist. Sie hat Angst, dass ich ihre Worte anders auslegen könnte und sie dann Probleme bekommt. Den gleichen Eindruck hatte ich auch heute vormittag, als ich in der Uni mit Studenten sprach. Die gleiche Zurückhaltung sah ich auch bei der Frau aus Baku, die wir gestern abend auf der Straße trafen. Welche Kontrolle gibt es in der Stadt? Warum wollen die Leute über solche Themen nicht mit Ausländern sprechen? Was heißt Freiheit für Bürger in diesem Land? Wie soll ich Rußland nur verstehen? Heißt verstehen, sich nur auf eine Seite zu schlagen, die russische? Natürlich, keiner von beiden hat Recht. Aber was wissen wir schon? Oder geht es hier um etwas größeres: Geld, Macht, LukOil, den Islam, die USA oder Bin Laden? Wo steht Rußland? Und warum hat Sira gesagt, dass Geld für Tschetschenien aus Israel kommt, und sich dabei selbst auf den Mund gehauen? Welche Rolle spielt Hatab, der zweitgrößte Terrorist nach Bin Laden, den sie gerade im Fernsehen für den Anschlag in Kasbisk verantwortlich gemacht haben? Hier kam auch der Bruch mit Vera, die bis dahin ruhig im Sessel unser Gespräch verfolgte. Warum haben beide nicht zwischen Tschetschenen und Terroristen getrennt? Ich hatte ja schon gesehen, welche Probleme es bei der Vorbereitung für die Reise nach Inguschetien gab. Diese Probleme haben aber einen stärkeren Charakter. Um was geht es in diesem Krieg? Geht es um Mentalitäten? Ist es nun russisch, betrunken auf der Straße herum zu grölen? Das Gespräch mit den Studenten in der Universität hatte mir ein ganz anderes Bild auf den Weg gegeben. Ich hatte das Gefühl, dass in Astrachan alles ruhig und friedlich ist. Jetzt erzählt mir Sira, dass Putin Astrachan zu einer halb geschlossenen Stadt erklärt hat, die nun bald völlig geschlossen wird, wohin man nur auf Einladung hinreisen darf. Man hat Angst vor Terroristen und weiteren Anschlägen. Die russische Flotte im Kaspischen Meer liegt ja vor ihnen. „Jeder Flüchtling könnte auch ein Terrorist sein“, sagt Sira. Sie steht auf, hebt den Kopf und weist mit ausgestrecktem Arm nach vorne. „Es gibt einfach Leute, die wollen, dass Rußland unterentwickelt bleibt; die wollen, dass Rußland ohnmächtig und 47 Kirche | Astrachan 48 Katze in der Tonne | Astrachan schwach ist; dass es hier Angst und Panik gibt, und Menschen sterben. Aber die Leute haben keine Angst. Matrosen sind stark, heldenhaft und sterben, ohne Schreie und Laute von sich zu geben. Die anderen, die lebendig sind, haben Wut in den Augen. Ich weiß, dass sie dieses Gesindel finden. Und sie werden noch wütender gegen sie kämpfen. Sie werden alle Terroristen vernichten. Sie werden bald eine nötige Ordnung schaffen. Und so muß man es machen. Wir sind dort, weil der Europarat, Johnson, Russel, oder wie sie heißen, die ganze Zeit schreien. Zehn hat man die Kehle durchgeschnitten, und alles ist gut.“ Sie lacht. Ich fürchte mich. Letztlich geht es um den Freiheitsbegriff. Soll ich das Tonband löschen oder nicht? Was soll man Eindruck von der Gegebenheit sein? Warum wollen Leute es sich immer so einfach machen? Am Ende rät mir Sira davon ab, weiter nach Stavropol zu reisen. „Da lauern überall die Extremisten, die Wahabiten. Du paßt nicht auf und schon entführen sie dich auf der Straße. Wir machen uns doch nur Sorgen um dich.“ Gerade das bestärkt mich noch mehr, dort hin zu fahren. Bei der Art und Weise, wie mit mir umgegangen wird, kann ich die Worte einfach nicht mehr ernst nehmen. Ihre weitere Reiseplanung ist eindeutig: ich muß nach Stavropol und in den Kaukasus, um mich von der Wirklichkeit zu überzeugen. Auf dem Heimweg versuche ich, mich mit Vera nicht zu verstreiten. Sie zweifelt sehr an den Zielen von ZIS. „Die schicken dich doch nicht so einfach los mit diesem Thema. Die bezwecken doch etwas damit? Was machen sie nur mit den Ergebnissen?“. Sie läßt sich nicht abbringen. Rußland ist schwer zu verstehen, seine Menschen sind noch unverständlicher. Ende der Aufschrift gegen 2 Uhr morgens Astrachan. Dienstag, den 14. Mai 2002. Drei Streifen hocken aufeinander und lassen sich hängen. Weiß, blau, rot sind die Farben der russischen Flagge. Die steht auf dem Tisch, an dem über Ketchup gesprochen wird. Drei Männer in Anzügen trinken Tee, einer von ihnen verstreut Zucker, ein anderer trommelt mit dem Finger gegen die Tischkante und der dritte wiederum findet einfach nur die Sonnenbrille in seinem Haar schön. Wie gesagt, es geht um Ketchup und der soll aus Astrachan kommen. Deswegen hat man sich getroffen: Zwei Russen, die Ketchup ganz toll finden und die vielen Tomatensträucher auf den Feldern kennen, und ein Deutscher, der für sie die Fabrik bauen und die Rezepte für den Ketchup rausrücken soll. Ketchup findet der übrigens auch ganz klasse. Ich habe die Nacht nicht geschlafen und kann nur Momentaufnahmen auf das Papier bauen. Welch ein Unterfangen, warum kann ich nicht einfach meinen Kopf nehmen, alles ausschütten und gemütlich zusehen, wie sich alles, was da so herausfällt, zu einem sinnvollen Ganzen sortiert? Da ich Blut aber eh nicht sehen kann, wende ich mich von diesem Irrsinn ab. Ich kann doch dieses Heft nicht völlig matschig weiter mit mir herumschleppen. Der Abend steckt mir noch in der letzten 49 Synapse. Ich bin mir immer noch völlig im Unklaren, welche Schlüsse ich daraus ziehen soll. Ist das Studienthema überhaupt noch zweckmäßig? Was ich einzig und allein liefern darf, ist doch nur eine Dokumentation der Zustände. Ich will mich nicht auf eine Seite stellen. Wird die Quersumme aller Antworten der Gegenwart gerecht? Es ist wie verhext. Die Flüchtlingsorganisation Sunscha, die ich über Claudia in Wolgograd herausbekommen habe, ist umgezogen. Die Auskunft hat keinen Rat. Durch Zufall erinnert sich Vera an den Namen und schickt mich mit einer Adresse los. Sunscha ist übrigens die russische Übersetzung des tschetschenischen Wortes соьлж und ist eigentlich der Name eines Flusses in Tschetschenien. Ein Stadtteil in Grozny ist ebenfalls nach diesem Fluss benannt. Anzunehmen ist also gar, dass diese Flüchtlingsorganisation von Tschetschenen gegründet wurde. Ich bleibe ratlos. Nach Streifzügen durch Seitenstraßen finde ich eine kleine Tür mit der entsprechenden Buchstabenkombination auf einem Hinterhof. Ein großes Schloß hängt davor. Sunscha arbeitet nur am Wochenende. Merkwürdig. Auf dem Busbahnhof erkundige ich mich nach dem Bus nach Stavropol. Ich muss in den Kaukasus. Es ist voll, verschiedene Nationalitäten wuseln herum. Ich spreche mit zwei Usbeken, die sind auf der Durchreise, so wie viele hier. Am Nachmittag stehen Vera und ich auf dem Amt. Nach einem Aufenthalt länger als drei Tage braucht man eine Registration. Den Rest des Tages haben mich die Kinder im DeutschRussischen Haus adoptiert. Nach dem Deutschunterricht schenken sie mir Trockenfische und Salatrezepte, ich solle mich doch immer an sie erinnern und Rußland nie vergessen. 50 Am Abend gehe ich ins Kino. Ich habe die Wahl zwischen „Война – Krieg”, einem russischen Actionfilm, indem Russische Helden, Terroristen in Tschetschenien jagen, und einer Komödie. Ich entscheide mich für die Komödie, das nimmt sich ja nichts. Astrachan. Mittwoch, den 15. Mai 2002. In Astrachan werfen die Bäume unscharfe Muster auf manche Straßen. Sie bewegen sich, und ich frage mich, ob nun der Wind die Bäume zum Reden bringt oder die Bäume den Wind machen. Astrachan ist gemütlich und ich habe ein Gesicht, wie ein Honigkuchen. Ich begleite Vera zu ihrer Arbeit. Auf einem Markt wollen wir vorher noch vier Kilo Kekse kaufen. Bei einer Kaukasierin aus Argun greifen wir zu. Ihr Goldzahn blitzt, als ich das Paket mit den Haferflockenkeksen, wie ein Kind in den Arm nehme. Dabei fällt mir eine Unterhaltung vom Vormittag ein. Eine Frau um die vierzig erklärt mir auf der Parkbank gegenüber der Post, dass die Leute aus dem Kaukasus doch nur betteln würden, kriminell sind sie obendrein. Erstaunlich: „Betteln bedeutet etwas schlechtes in der tschetschenischen Kultur. Bei uns fangen die Kinder schon in frühen Jahren an zu arbeiten und selbständig zu sein.“, hält die Tschetschenin am Marktstand dagegen. Wir schlendern weiter, es ist laut, es ist schmutzig, es wird gehandelt, ein Mann prüft Ventile, die am Boden auf einer Decke ausgebreitet sind. Eine Mutter schätzt ihr Kind in ein weißes Pokemon T-Shirt, ihr Sohn treibt sich am Nachbarstand herum. Hinter dem Hauptweg, neben dem Zigarettenstand kaufen wir usbekisches Brot gefüllt mit Käse. Ich tanze. Auf einer staubigen Straße folge ich Vera, die zielstrebig an den uralten Holzhäusern mit ihren winzigen Verzierungen im hölzernen Fensterrahmen vorbei den Weg sucht. Die Sonne schlägt auf meinen Kopf. In einem Fenster auf der linken Seite ist eine Flaschenannahme eingerichtet. Als ich die Schreie der zerdrückten Kekse unter meinem Arm höre, haben wir das Kinderheim schon erreicht. Das Haus sieht wie ein einziger Baustein aus Beton aus. In den Fluren windet sich der Geruch von Gekochtem. Die Räume sind groß und sauber. Eine Schar Kinder fallen Vera um den Hals: „Vera, Vera, du bist da, das ist schön. Wir haben dich vermißt!“ Einige von ihnen haben grüne Flecken im Gesicht. „Das ist ein Desinfektionsmittel. Viele Kinder sind krank, wenn die Polizei sie 51 Staubige Strasse | Astrachan 52 Im Kinderheim | Astrachan 53 hier abliefert.“, klärt Vera auf. Offizielle Stellen sprechen von 3000 Straßenkindern, Vera schätzt die Zahl auf das dreifache. Ich warte im Computerraum auf die Chefin und unterhalte mich mit Julia, die hier für die Kinder Computerkurse gibt. „Wir haben einfach einen Brief an LukOil geschrieben. Jetzt sind sie unser Sponsor“, erzählt mir die 20-jährige Juristin, die an einigen Tagen im Kinderheim aushilft, ehrenamtlich. „Warum die Kinder von zu Hause abhauen? In vielen Familien gibt es etliche Probleme. Entweder die Mutter trinkt oder der Vater. Die Kinder fliehen vor der Gewalt in der Familie. Soziale Probleme und Arbeitslosigkeit sind meist Auslöser für schwierige Verhältnisse. Für die Kinder ist es ausweglos, deshalb flüchten sie auf die Straße. Dieses Haus ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Es sind aber Kinder bei uns, die keine Eltern haben und als Waisen zu uns kommen. Hier finden sie ein neues Zuhause.“ „Zwölf Betreuer, unter ihnen Psychologen und Pädagogen kümmern sich um die 52 Kinder. In drei Gruppen leben die Kinder, wie Schwestern zusammen“, ergänzt die Leiterin des Heims. Ein Gesicht blickt um die Ecke und mit einem Satz steht Nastia im Raum. Ihr schwarzer Pferdeschwanz schwingt lustig. Sie ist 14 und fängt an zu plappern: „Es ist gut, dass hier nur Mädchen sind. Der Zusammenhalt ist größer. Jeder sorgt sich um jeden. Meine Mutter ist im letzten Jahr gestorben. Nun schlage ich mich allein durchs Leben.“ Sie ist voller Zuversicht, lacht und wippt mit ihren Füßen. „Mein Bruder ist in Usbekistan. Ich kenne ihn gar nicht, meine Oma hat mir von ihm erzählt. Er ist 20 und hat eine Familie, ist das nicht toll. Ich werde ihm schreiben. Ich habe nur noch keinen Umschlag.“ Das Heim und die Großmutter haben die Adresse Nastias Bruder in Usbekistan 54 herausbekommen. Doch Nastia wird ihrem Bruder keinen Brief schicken können. „An dem Kuvert scheitert das nicht. Rußland und Usbekistan haben kein Postabkommen. Wir können keine Briefe aus Rußland dorthin schicken“, erzählt mir später Julia. Trotzdem, Nastia bleibt zuversichtlich: „Ich mache ein gutes Examen in der Schule und dann studiere ich, irgendwas mit Mathematik, das macht mir Spaß.“ Die Kinder fühlen sich hier wohl. Ich werfe einen Blick in einen kleinen Raum neben dem Ausgang: Grüne, rote, kleine, lange, dreckige und saubere Schuhe liegen da durcheinander geworfen. Die Kinderjacken zappeln am Haken an der Wand. Schon erstaunlich, an Straßenkinder hatte ich in Rußland gar nicht gedacht. „Putin hat das Thema das erste Mal Anfang des Jahres in einer Fernsehansprache erwähnt. Die Kinder sind nicht weniger geworden. Die Polizei stopft sie bloß direkt in eines der überfüllten Kinderheime.“, endet Vera, als wir am Abend eine der vielen kleinen Brücken in Astrachan überqueren und vor einem Gully haltmachen. Vera schiebt die angelehnte Metallplatte zur Seite, deutet auf die Rohre im Dunkeln: „Hier verstecken sie sich. Im Winter geben die Heizungsrohre den Kindern wenigstens etwas Wärme. Im Sommer schlafen sie meist unter den Brücken auf einer Pappe.“ Jetzt konnte ich Vera verstehen. Deshalb schaute sie den Kindern in die Augen. Was bringt ein Leben, wenn man nur auf der Suche nach Klebstoff zum Schnüffeln ist? Das Leben hält alles bereit. Unsere Rolle können wir uns nicht unbedingt aussuchen. Möglichkeiten sind nur die Grenze des Machbaren. Oder haben sich diese Kinder ihren Platz auf dieser Erde ausgesucht? Ich weiß es nicht. Und trotzdem hat alles einen Sinn? Wir leben in Widersprüchen. Wie soll ich das ganze noch verstehen? Am späten Abend treffe ich mich mit der Pianistin der lutherischen Kirche und ihrem Freund. Sie laden mich in ein Konzert der Musikhochschule ein. Der Chor ist gehalten gut. Wir sind die einzigen, die am Ende klatschen und pfeifen. Danach gibt es wieder eine Priese Orthodoxie. Die Tage gibt es in Astrachan ein Popen-Seminar. Der Ober-Pope teilt uns ein weiteres Mal mit, das erst kürzlich Ostern war. „Vo istinu voskrese“, sage ich leise, schmunzle und schließe die Augen. Schon wieder eine dieser vielen unbekannten Küchen in Rußland. Trockenfisch steht auf dem Tisch. Schenja, der Freund der Pianistin klärt, mich über das Ungetüm auf, das da ganz leblos und platt, friedlich auf meinem Teller vor mir liegt. „Also Martin, die Sache ist ganz einfach. Du nimmst den Kopf fest in die Hand, faßt mit den Fingern unter die Kiemen und reißt das Ding auseinander.“ Das war es ja nun. Und das zu dieser späten Stunde. Mit Fisch haben es die Leute hier wohl so richtig in Astrachan. Gastfreundschaft verlangt viel von seinen Gästen. Ich lasse mich auf Rußland ein und kaue das salzige Stück Fisch mit verzweifeltem Blick. Die Mutter meint es gut mit mir und rät mir zu dem eingetrocknetem Rogen. Fischeier, mit Mut hatte es an diesem Abend nichts mehr zu tun. Schon der Geruch war unbeschreiblich. Ich habe drei Tage lang versucht, den Geschmack aus dem Mund zu bekommen. Die Eindrücke dieses Tages werden mich dagegen wohl noch mein Leben lang begleiten. Astrachan. Donnerstag, den 16. Mai 2002. Jeder Versuch ist ein Versuch. Der Dienst für Migrationsfragen will auch in Astrachan nicht mit mir sprechen. Verabredete ich mich doch gestern mit dem Roten Kreuz für den heutigen Morgen, höre mir ihre Arbeit an und lasse mich von einer Mitarbeiterin zur Administration der Stadt bringen, um wiederum dann mitgeteilt zu bekommen, dass es von offizieller Seite keine Stellungnahme gibt. Ergo, keine Zahlen, kein Interview, doch wie sagen die Russen: Die Hoffnung stirbt nie. Auf dem Hinterhof des Roten Kreuz werden Kisten für einen Transport nach Kasbisk gepackt, alle sind die nächsten Tage beschäftigt. Vor dem Verwaltungsgebäude finde ich dafür eine Babuschka, sie verkauft Piroschki7 mit Leber, ihr Hund mag mich irgendwie nicht, heute ist nicht mein Tag. Ich suche das Historisches Museum, die Geschichte soll mir Antworten geben. Einige Fetzen der Vergangenheit seien hier wiedergeben: «Город Астрахань лежит на границе Европы и Азии, на острове долгом ... Он окружен толстой и каменной стеной, на которой стоят 500 металлических пушек. В городе всегда сильный гарнизон для защиты от татар и казаков.» 7 Teigtaschen mit Füllung. 55 Ян Стрейс, 1669 г. „Die Stadt Astrachan liegt an der Grenze zu Europa und Asien, auf einer langen Insel... Sie ist umgeben von dicken und steinernen Wänden, auf denen, 500 metallene Kanonen stehen. In der Stadt gibt es immer eine starke Garnison für die Verteidigung vor den Tataren und Kasachen.“ Jan Strejs, im Jahre 1669 56 57 Haus | Astrachan 58 Strasse | Astrachan «С внешней стороны из-за множества башен и церковных глаб Астрахань выглядит весьма красивой. Это отличный торговный город, где торгуют не только бухарские, крымские, ногайский и калмыцкие приезжающие в Астрахань по Каспискому морю на кораблях ...» Ян Стрейс, 1669 г. “Von Außen sieht Astrachan wegen der Türme und kirchlichen Kuppeln höchst schön aus. Diese ausgezeichnete Handelsstadt, wo der Handel nicht nur bucharische, krim und kalmückische Tataren, aber auch Perser, Armenier, Inder, Reisende in Astrachan über das Schwarze Meer auf den Schiffen anzieht ...” Jan Strejs, im Jahre 1669 «Наши интересы отнюдь не допускают, чтоб какая другая держава, чья ни была, на Касписком Море утвердулась.» Пётр I. „Unsere Interessen lassen wir überhaupt nicht vor, damit irgendeine andere Macht, wer auch immer, am Kaspischen Meer Fuß fasst.“ Peter I. «Хоть ты не велика, но торг тебя прославил и дальних множество племен к тебе направил ... Грань луших двух частей вселенной здесь проходит, «Важное место в политической истории края занимала восточная политика Русского государства. В 1722-1723 гг. Петр I. предпринял Персидский поход, одной из задач которого было развитие торговых отношений России с Востоком. В результате успешной восточной политики Россия утвердила свое влияние на Касписком Море.» ... „Einen wichtigen Platz in der politischen Geschichte des Gebiets nahm die Ostpolitik des Russischen Staates ein. In den Jahren 1722 bis 1723 führte Peter der Erste den Persischen Feldzug an. Eine der Aufgaben davon war die Entwicklung der Handelsbeziehungen Rußlands mit dem Osten. In Folge der erfolgreichen Ostpolitik verstärkte sich Rußlands Einfluß auf die Region am Kaspischen Meer. “ ... И в Астрахань явясь, всяк к обе разом входит. Он руку здесь Европе может протянуть И повернувшись, вновь на Азию взглянуть ...» Пауль Флеминг, 1636 г. „Selbst du bist nicht groß, aber der Handel hat dich berühmt gemacht und fern die Mehrheit des Volkes zu dir geschickt ... Der Rand zweier bester dichter Welten gehen hier hindurch, Und in Astrachan will jeder zu beiden auf einmal eintreten. Er kann Europa hier zur Hilfe kommen Und umgedreht, von neuem nach Asien blicken ...“ Paul Fleming, im Jahre 1636 59 Gegen 20 Uhr abends. Szenenwechsel. Das Rot der Sonne legt sich auf die gelben Felder. Die Luft ist salzig. Einige Stunden später sitze ich mitten im Wolga-Delta und trinke heiße Milch mit Honig. Eine Freundin von Vera hat an einem Seitenarm der Wolga eine Erholungsbasis. Da fährt ein Kutter zum Fischen auf die Hochsee, eigentlich wollte ich ja nur einmal im Kaspischen Meer baden, jetzt wurde hier her verfrachtet und für zwei Tage eingeladen. Die Sache ging mir zu schnell, schon saß ich im Lada. Die Kirche veranstaltet in diesem Ort jeden Sommer ein Lager für obdachlose Kinder aus der Stadt. Zehn Ferienwohnungen warten hier auf einen riesigen Grundstück auf reiche Moskowiter, die sich in den Sommermonaten an der Wolga erholen. Jetzt baut die Familie noch ein Hotel. Ringsherum nichts als Natur, eine kleine Straße, ein kaputter Traktor und zwischendurch das Knarren der Grashalme. Hier darf ich also bleiben. Eine JazzGruppe spielt auf der Wiese. Das Gelächter einer Reisegruppe ist vielstimmig. Ich spreche mit der Chefin über Putins Politik und Tschetschenien, ihre Meinung ist ehrlich. Was sie weiß, hat sie aus dem Fernsehen und von dem hält sie nicht viel. Ihre Vorstellungen vom Leben sind klar: Ihrer Familie soll es gut gehen, Gäste sollen kommen und glücklich will sie sein. Die Familie hat ein Feld, das sie bestellen. Die Tochter fährt in die Stadt, um zu studieren. Die Mutter ist froh, hier in Ruhe umschlungen von der Natur zu leben. Mehr braucht sie nicht. Und da werde ich eingeladen, die Welt doch mal mit anderen Augen zu sehen. Berlin kennt sie auch, Moskau findet sie nur schrecklich. Ich gehe in der Nacht zum Steg und blicke durch das Funkeln des Wassers. Hier steht die Welt still. Wolga-Delta. Freitag, den 17. Mai 2002. Gedankenmanöver. Ich schlafe, versuche die Interviews zu übersetzen und höre Putin im Fernseher. Manchmal ist es einfach nur schön, Gast vom Chef zu sein. Gerade dann, wenn Chef dir ein Haus mit Terrasse und eine eigene Köchin an die Seite stellt. Anna trägt lächelnd Essen heran. Danke Anna! Dein warmer Heidelbeerkuchen ist der leckerste seit Lebzeiten. Jetzt ist auch der Geschmack vom Trockenfisch endlich gegen das Paradies eingetauscht. „Halten sie ein, gute Frau“, komme ich ihr entgegen und muss dabei an das Frühstück denken, dass ich zur Hälfte unverzehrt im Kühlschrank deponiert habe. Zwei Wochen sind nicht mehr als ein kurzes Zwinkern der Zeit. In den nächsten Tagen will ich in Stavropol und Krasnodar sein. Am Ufer angeln zwei Männer. Die Fähre tuckert gegen die Strömung. Der Himmel ist rot und blau. Das Fischerboot ist zurück. Der Fisch glitscht über die Planken. Am Firmament entdecke ich ein riesiges Sternenzelt. Der Sterndeuter Die Nacht brach an, und ich stieg auf den Turm und begann, den gestirnten Himmel zu betrachten. Als wäre ich fortgegangen in den Schlaf. Und da vernahm ich den harmonischen Gang ferner Sterne. 60 Ihr kristallenes Licht ist hell und verständlich, aber etwas Beängstigendes schimmert durch die wirbelnde Bewegung der mystischen Nebel und der Flecken hindurch, die mit einem phosphorfahlen Feuer brennen. 61 62 Fischer | An der Wolga 63 Vögel in der Abenddämmerung | An der Wolga Doch jetzt erst recht richte ich meinen Blick tief auf sie, um in ihm mit eintretendem Dunkel Schattentheater auf eben jenem gleichen Netz spielt. Wie friedlich die Welt sein kann. Ich erblicke einen Vogel, der einen kurzen Bogen fliegt, die Richtung ändert, auf einen Ast zusteuert und sich mit einer exakten Präzision auf einem dickes grünes Blatt niederläßt. Eine haarige Raupe hat sich derweil meinen großen Zeh erkämpft und purzelt nun an ihm herunter. Und immer wieder Tausend Vogelstimmen, die das Grün der Erde und das Blau des Himmels auf unerklärliche Weise miteinander verbinden und alles dazwischen mit reiner Natur füllen. beim Fortgang in den bodenlosen Schrecken der Leere Was für einen Streit, was für einen Kampf kann es schon geben die Sinnlosigkeit und den Schmerz der Existenz zu vergessen. mit dem unmenschlichen Schicksal? ich löse mich ab, erkalte, fliege; als wäre ich von einem Schiff hinuntergesprungen, sinke ich und vergehe - ich will es ja. Ich warte auf das nächtliche tote Schweigen, All das ist Trug und Wahn. Boris Narcissov Aber dieser blaue Abend ist noch mein Besitz. Wolga-Delta. Sonnabend, den 18. Mai 2002. Und der Himmel. Rot zwischen den Zweigen, Es ist der zweite Tag hier im Nirgendwo zwischen Astrachan und dem Kaspischen Meer. Ein Uhu-Geschöpf versucht mir schon seit den Morgenstunden etwas mitzuteilen, ständig ruft er mir seine Uhu-Worte zu. Sein beständiger Rhythmus ist beruhigend. Nein, mein kleiner Freund, beim besten Willen, ich kann dich nicht verstehen. Oder willst du mir mitteilen, dass meine Wäsche schon wieder ins nasse Gras gefallen ist, die gute Handwäsche schon wieder schmutzig ist? Ein klarer kühler Rausch geht durch die Bäume, die Sonne siebt sich durch das Fliegengitter auf der Terrasse. Es ist abenteuerlich, wie sich gleichsam ein 64 und perlweiß an den Rändern ... Eine Nachtigall singt im Flieder, eine Ameise kriecht durchs Gras: jemandem ist das von Nutzen. Vielleicht ist selbst darin ein Nutzen, dass ich die Luft einatme, und dass mein alter Mantel auf seiner linken Seite vom Sonnenuntergang übergossen ist und auf seiner rechten in den Sternen versinkt. wuscheliger Engel deinen ganzen Kram auf einem goldenen Tablett zurückbringt. Ich entscheide mich für das Huhn. Galgenhumor ist wirklich angesagt. Gegen 12 Uhr Georgij Ivanov, 1950 Astrachan. Sonntag, den 19. Mai 2002. Tag der Pioniere, Karl Marx hat Geburtstag, so ein Pech, ich werde wieder einmal meinem blauen Halstuch nicht würdig. Vergesse ich doch meinen Paß, mein Geld und meine deutsche Gründlichkeit irgendwo in einem Haus im Wolga-Delta. Ich würde nur dann nichts verlieren, wenn meine Hosentaschen absolut leer wären. Russischen Vorurteile helfen mir da gar nicht weiter. Nun gut. Die Herausforderung kommt mit der Entfernung zum verlorenen Objekt. Kurze Kontrolle: Wo sitze ich? Auf dem Busbahnhof in Astrachan. Warum sitzt du hier? Ich will mit dem Bus nach Stavropol. Wie bist du hier her gekommen? Mit dem Auto der Chefin, die hat mich mitgenommen. Woran denkst du? Den Paß, meine Zukunft, mein Leben, meine verlorene Seele. Kennst du den Weg zurück? Nein. Ist jemand da, der den Weg zurück kennt? Nein. Vera ist nach Saratow gefahren. Telefonnummer, Adresse? Hab ich nicht. Schach. Wann fährt der Bus? In acht Stunden. Ok, es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder du läufst wie ein Huhn wild durch die Stadt, oder du bleibst hier ganz einfach sitzen und wartest bis dir ein kleiner weißer Gut, gut, das Schicksal schickt mir die gelben Seiten, da müßte doch die Basis verzeichnet sein. Ich mache mich auf zur Post. In meinem Hühnerkostüm treffe ich Iwan und Andrej vom Jugendclub der Gemeinde. Ich atme durch. Die beiden kennen die Basis bestimmt. Fehlanzeige. Wir verabreden uns im DeutschRussischem Haus, es sollte das Hauptquartier einer legendären Suchaktion werden. Doch es kam, wie es kommen sollte. Die Frau von der Auskunft machte einen Strich durch unseren Plan. Sie quäkt, dass sie keinen Eintrag hat und legt einfach den Hörer auf. Sauerei. Die müßte mal zu den Schulungsseminaren der Deutschen Post! Dann läuft das. Irina, die junge Deutschstudentin unternimmt einen letzten Versuch. Es ist hoffnungslos. Wir bleiben ratlos. Weder ein Reisebüro, noch die Polizei kennt die Basis. Habe ich vielleicht alles nur geträumt? Wo bin ich? Hier oder dort? Wir geben die Suche erstemal auf. Ohne Dokumente bin ich in Rußland verloren. Da kann ich mir noch nicht mal eine Bahnfahrkarte kaufen. Gegen 14 Uhr Wir essen Kuchen. Andrej hat Geburtstag. Die Sahnetorte gibt mir den Zuckerschock. Wir singen russische Volkslieder, das Geburtstagskind fährt morgen für vier Monate zum Studium in die USA. Jeder darf eine Abschiedsrede halten. Ich schluchze. Der kleine weiße wuschelige Engel ist immer noch nicht gekommen. 65 Ich will nicht mehr das Huhn sein. Die Leiterin des Jugendclubs hat einen Einfall. Wenige Minuten später sitze ich mit aufgerissenen Augen im Auto. Nichts soll mir entgehen. „Erinnere dich, war es hier?“, fragt Ina, die unser Spähfahrzeug steuert. Ich kann mich nur an Bruchstücke erinnern, auf der Fahrt heute morgen habe ich im Auto geschlafen. „Halt, da war eine Brücke. Das weiß ich noch“, lenke ich ein. In Astrachan sind Brücken aber eher keine Seltenheit, auch in der Nähe der Stadt lauern sie förmlich an jedem Finger der Wolga. Auch die Fähre, an die ich mir erinnere, ist eine von vielen hier im Delta. Und so fahren wir auf unbekannten Wegen zu einem unbekannten Ziel. Nach über einer halben Stunde auf einer schnurgerade Straße gelangen wir in eine Polizeikontrolle. Ich schwitze. Ina macht kurzen Prozeß: „Hören sie mal, dieser junge Herr hier ist Ausländer und hat seinen Paß verloren. Irgendwo hier muß es eine Siedlung mit Ferienhäusern geben, wo die aus der Hauptstadt absteigen. Haben se nicht eine Idee?“. Ich schaue in die Augen des Wachtmeisters, die sich im Schatten seiner Mütze 66 67 Im Nirgendwo | In der N ähe von Astrachan 68 Fähre | An der Wolga verstecken, und höre seine Anweisungen: „Das Sie keine Dokumente dabei haben, gefällt mir schon mal gar nicht. Die Sache ist sehr unschön - für Sie. Dann fahren Sie mal dort vorne rechts, nehmen den Abzweig. Am Ende der Straße ist die Siedlung, die Sie suchen. Nun holen Sie Ihren Paß schon. Und gucken Sie nicht weiter so, Sie sehen ja elend aus. Schöne Fahrt.“ Wunder geschehen, wenn man alle Hoffnung verloren hat. Russischen Polizisten sind manchmal einfach klasse. Die Schnitzeljagd sollte aber noch nicht gleich ihr Ende finden. Angekommen bei der Basis fällt mir ein, dass ich den Schlüssel für das Haus der Chefin im Auto gegeben habe und die ist zu ihrer Kranken Mutter unterwegs ist. Ich krame nach dem Hühnerkostüm. Einen Zweitschlüssel gibt es nicht, wie mir die Tochter mitteilt. Ich warte also. Gegen 16 Uhr Und ich bin, wo ich schon immer war. Auf dem Busbahnhof halte ich nach dem Omnibus nach Stavropol Ausschau. Alles ist gut gegangen, auch wenn ich nicht an Engel glaube. Vor mir stehen fünf Soldaten, ihre Freundinnen rücken ihnen die Uniform zurecht. Zwei beleibte Zigeunerfrauen fragen nach Geld. Ein Engländer kauft am Schalter einen Talon für sein Gepäck. Dann geht es los, durch Kalmückien will ich über Elista zu den Bergen. Schon wieder regnet es. Der Bus trieft von Benzin, die Scheiben sind beschlagen. Poka8 Astrachan, deine Farben sind außergewöhnlich. 8 Tschüss. Ende der Aufschrift gegen 20 Uhr Stavropol. Montag, den 20. Mai 2002. Die Wolken sind grau. Kleine, dicke Tropfen prasseln auf die Erde herab. Mir ist warm, eingepackt in meiner Jacke schaue ich aus dem Busfenster auf die nassen Straßen einer schlafenden Stadt. Stavropol liegt im Morgenhellen. Wie durch Zauberhand bohrt jemand ein Loch in den verwaschenen Schleier, als ich aussteige. Das Sonnenlicht badet sich in den Pfützen. Ich staune, welch eine schöne Stadt lag da im Verborgenen. Natascha macht einen Schritt auf mich zu, eine Stunde hat sie im strömenden Regen gewartet. Wir hatten Verspätung. Mit verschlafenden Augen folge ich Natascha, wir haben nur kurz am Telefon miteinander gesprochen, ihre Adresse habe ich von einer Freundin in Moskau bekommen. Natascha war auf einem Toleranzseminar der Quäker in Moskau, da habe ich gleich Fotos für sie mitgebracht. Ihr Haarschnitt ist flott und kurz, ich schätze sie auf Mitte dreißig. Natascha hat einen Sohn und arbeitet als Psychologin mit Flüchtlingskindern. Der Leninplatz ist leergefegt. Wir sind die einzigen, die zur dieser frühen Stunde an der Haltestelle am Dom Knigi9 warten. Im Trolleybus, ein Mädchen, dass mindestens so müde ist, wie ich. Mit Schulranzen und gesenktem Kopf wankt sie bei jeder Bewegung des Buses. Da wacht sie kurz auf, als die Türen sich öffnen und neue Fahrgäste einsteigen. 9 Haus des Buches. 69 Frühstücken tun wir erstemal bei Ina. Sie ist in Dagestan geboren, kam zum Studium nach Stavoropol, lernte ihren Mann kennen und blieb hier. In zwei Tagen kommt ihre Mutter zu Besuch. Dann kann sie mir über das Kultur in der Region erzählen. „Das Leben ist ganz normal. Meine Eltern wohnen in einem kleinen Dorf. Warum sollte es gefährlich sein? Nein, das stimmt doch alles nicht, was sie in den Medien bringen. Wir haben keine Angst. Der Anschlag in Kasbisk hätte auch überall anders in Rußland passieren können“, kommentiert Ina meine Gedanken zu Dagestan. Und da sitzen wir nun, helfen mir die Woche Stadtrand kann ich Einraumwohnung über ausgehandelt. Natascha und Ina sind freundlich und zu organisieren. In einer Platte am unterkommen. Natascha hat die eine Bekannte einen günstigen Preis Der Tag ist vollgepackt, wie mein Reiserucksack: Ich spreche beim Danish Refugee Council (DRC) vor und lasse mir Ansprechpartner von Flüchtlingshilfen aus der Region geben. Der DRC konzentriert sich selbst auf Trainingsseminare, um die Organisationen untereinander zu vernetzen. Die Leiterin des Büros ist hilfsbereit, ihre rote Nadel mit dem Schriftzug der Dänen blitzt an ihrem dunkelblauen Kostüm, sie gibt mir weitere Hinweise: „Unsere Verbindung zu staatlichen Einrichtungen hält sich in Grenzen. Der Migrationsdienst wird gerade umorganisiert, daher werden Sie wohl auch hier keine offiziellen Daten über Flüchtlinge und Migranten bekommen.“ Angewiesen ist der DRC auf den Russischen Staat wohl eher nicht, die Organisation vergibt selbst Mikrokredite für Projekte, das Geld kommt aus dem Ausland. Schon haben wir wieder vier Räder unter den Füßen, Natascha arbeitet noch bei der Flüchtlingssorganisation Alter Vita, von dort telefoniere ich die Liste vom DRC ab. Alter Vita sitzt in einem alten Verwaltungsgebäude einer Fabrik. Der Lackgeruch ist ein aufdringlicher Begleiter beim Gang auf dem Flur. An der Tür hängt ein Plakat mit einem Kindergesicht. In Stavropol sammelt eine Jugendgruppe Kleidung für Flüchtlingskinder in Tschetschenien und Inguschetien. Voller Wollmützen und Strickhosen ist auch ein kleines Zimmer bei der Bürgerhilfe Orden, die seit elf Jahren humanitäre Hilfe ausgibt und Nachmittage organisiert, an denen Pädagogen mit Kindern basteln. Aber auch praktische Dinge, wie Anleitungen zur Ersten Hilfe und Strickmuster halten sie bereit. Die alltäglichen Probleme macht Olga Iwanowna klar: „24.000 Flüchtlinge hat der Amt für Migration im Januar 2002 gezählt. Inoffiziell wird aber vom Zehnfachen gesprochen. Mittlerweile hat das Amt die Registrierung der Flüchtlinge ausgesetzt.“ Sie berichtet über die spezielle Situation in Stavropol: „Kasachstan, Georgien, Aserbaidschan und Tschetschenien. Wir waren einfach darauf vorbereitet. In den letzten Jahren haben wir unser bestes gegeben. Wir suchen Arbeit für die, die zu uns kommen. Ein großes Problem dabei ist eine Propistka10 für die Leute zu erhalten.“ Und dann zeigt Olga Iwanowna noch einen Brief vom Migrationsdienst, der ihre Wohltätigkeit anerkennt und sich für 10 70 Arbeitsgenehmigung, Aufenthaltserlaubnis. die Arbeit bedanken. „Was die machen, können wir nicht sagen.“, legt sie nach. Trotz alledem, komisch kam mir die ganze Situation bei „Orden“ schon vor. Kekse, Varenije11 und Tee sind ja normal, die Auftritt der Leiterin war etwas künstlich. Ständig streichelte sie sich ihre Fingernägel und scheuchte ihre Mitarbeiterin hin und her. Vielleicht sind das aber auch einfach nur typische russische Eigenarten. Natascha bleibt skeptisch: „Auf dem Papier sieht alles immer gut aus. Da werfen sie mit Broschüren um sich. Du mußt selber sehen.“ Ich entschließe mich die Eindrücke wirken zu lassen und freue mich über die mißtrauische Reaktion Olga Iwanownas, als ich ihr am Ende noch einige Fragen zu Rußland stelle. „Früher war es besser. Warum fragen sie?“, antwortet sie mit leiser Stimme. Schon gut, dass ich das Schreiben von ZIS nicht bekommen habe, so bekommt jedes Gespräch einen naiven Charakter. 11 Eingekochte Früchte. 71 72 Paradeplatz | Stavropol 73 Wohnort | Stavropol Fragen über Politik so von Mensch zu Mensch einfach aus Interesse sind hin und wieder unbekannt. ausgesprochen.“ Sie zeigen mir Fotos, ich bin beeindruckt, so hatte ich mir Rußlands Jugend gar nicht vorgestellt. Ich erinnere mich an Sira in Astrachan, die mich davor warnte, in Stavropol von Terroristen auf der Straße entführt zu werden. Welch ein Trug, die Stadt ist herrlich. Kleine Hügellandschaften und Berge zieren das Tal. Überall grünt es. An einigen Ecken haucht mir das Flair vom Mittelmeer entgegen. „Wie in Italien!“, staune ich. In einem Panoramabus, der wie eine Schildkröte aussieht, brumme ich an weißen dicken Lehmmauern vorbei. Eine Babuschka hütet ihre Ziegen am Rand eines Fußballplatzes, auf dem die Jungs in der Abendsonne das Leder über das Feld kicken. Natascha hört, dass ich über Flüchtlinge schreibe. Die eine 21jährige Physikstudentin schildert mir ihre Lebensgeschichte: „Ich bin Russin. Im November 1995 sind wir aus Usbekistan nach Tscherkessien12 geflüchtet. Alles war nur noch auf Usbekisch, ich habe gar nichts mehr verstanden. In der Schule mußten wir doch nicht Usbekisch lernen. Jetzt studiere ich in Stavropol, weil es mir hier gefällt. Unser Leben in Usbekistan war gut, jetzt gibt es dort keine Zukunft mehr für uns. Wir hatten alles verkauft, mit einer Kiste sind wir losgezogen. Erst haben wir bei unserer Oma gewohnt, dann konnten wir uns eine Zwei-Raumwohnung vom Migrationsdienst aussuchen. Alles ging so schnell. Im Sommer 1995 habe ich noch mit Freunden Musik gemacht und auf der Wiese vor dem Haus getanzt; als meine Eltern mir sagten, dass wir gehen, habe ich es für einen Witz gehalten. Ich mußte alles zurücklassen. Ich kam in eine neue Klasse, es war schwierig neue Freunde kennenzulernen. Am Anfang habe ich mit niemanden gesprochen, jeden Tag Briefe geschrieben und nach Usbekistan telefoniert. Sie haben mir immer gesagt, dass sie mich nicht vergessen. Das gab mir Mut. Wo meine Heimat liegt? In Tscherkessien, dort gibt es Berge, Schnee und viele Ausländer. In Tscherkessien ist alles gut. Auch möchte ich mal nach Petersburg fahren, ich habe gehört, dass es dort sehr schön ist. Und Usbekistan? Ich würde gerne schauen, wie es dort so ist, was sich jetzt verändert hat.“ Jugendliche machen in Stavropol aber noch ganz andere Dinge. Am späten Abend bin ich wieder bei Alter Vita und treffe Studenten, die Kleiderspenden für Flüchtlingskinder organisieren. Ein Benefizkonzert ist auch geplant, die Jugendgruppe dahinter nennt sich „Junges Europa“. „Wir suchen uns Themen, die uns interessieren und versuchen etwas zu bewegen. Umweltschutz steht bei uns auch ganz groß auf der Tagesordnung“, erzählt mir Tanja, eine 19-jährige Studentin, die nebenbei in Stavropol für eine Zeitung schreibt. Ich erinnere mich an eine Aktion vor dem Kreml, bei der Jugendliche mit weißen Plastikanzügen zur Turmuhr gerobbt sind. „Genau das waren wir.“, stellt Tanja fest. „Nach fünf Minuten war alles vorbei. Die Miliz kam und die Kameramänner sind über den Roten Platz gerannt. Später hat man ihnen alles abgenommen. Wir wurden erstemal alle mitgenommen, vor Gericht haben sie uns dann eine Verwarnung 12 74 Karatschai-Tscherkessien, Region im Kaukasus, Rußland. In der Nacht suche ich meinen Hauseingang in dem Wald von Hochhäusern. Tatjana hat mich noch in die richtige Maschrutka gesetzt. Nach einigen mißglückten Versuchen mit meinem Schlüssel an fremden Türen rette ich mich vor dem Regen in meine vier Wände. zum „Djetskij Fond – Kinderfond“, um mit einer Juristin über den rechtlichen Stand von Flüchtlingen zu sprechen und lande schließlich bei Solidarnost, einer Flüchtlingsorganisation am anderen Ende der Stadt. Vorher sollte ich aber noch als Statist herhalten. Ende der Aufschrift gegen 1 Uhr morgens. Am Denkmal von Lermontov vorbei hole ich mir weitere Informationen aus dem NGO-Zentrum in der Innenstadt, eile Wieder einmal verzweifele ich an Rußland. Auf der Fahrt mit dem Trolleybus Nummer 17 erlebe ich den Wahnsinn des russischen Alltags. Wenn man mit dem Bus fährt, muss man bezahlen. Das haben wir früh gelernt. Engels schrieb gar einmal, das ein kostenloser öffentlicher Nahverkehr der erste Schritt zum Sozialismus sei. Selbst in der DDR mußte man für seine Papierfahrkarte zehn Groschen hinlegen. Engels wird leider nicht mehr gelesen. Bezahlen muss man überall auf der Welt. Das ist aber nur der Prolog zum eigentlichen Schauspiel. Drücke ich doch dem Konduktor14 fünf Rubel in die Hand und schnappe nach dem Haltegriff über meinem Kopf, da schnarrt die Fahrkartenverkäuferin los: „Ja, das geht doch nicht. So etwas mache ich nicht mit. Und überhaupt, so etwas muss ich mir nicht bieten lassen“, und so weiter und so fort, im Fluchen scheinen die Russen Weltmeister zu sein. „Was ist denn nun los?“, denk ich mir. Eine junge Russin um die 20 will bezahlen. In ihrem Kleingeldsortiment haust aber ein kleiner Rubel, der sich mit einer Delle von den anderen Münzen unschuldig hervortut. Das mag die Fahrkartenverkäuferin gar nicht gerne. „Ja, so etwas nehme ich nicht an. Bezahlen sie mit ordentlichem Geld. Bringen sie das Ding zur Bank. Das nimmt mir doch später niemand ab. Geben sie mir einen richtigen Rubel“, stöhnt sie herum. Die junge Russin 13 14 Stavropol. Dienstag, den 21. Mai 2002. Auf zu den Dänen! Am frühen Morgen will ich näheres über die Mikrokredite erfahren. Stanislav, der Programmleiter, ein aufgeschlossener Russe im Wollpullover faßt die Vergabe kurz zusammen: “Zur Zeit laufen 600 Projekte in mehreren Republiken Rußlands. Wir funktionieren wir eine kleine Bank. Wir geben 20.000 Rubel13 für maximal ein Jahr. Zu uns kommen Flüchtlinge, die mit dem Geld z.B. Tiere kaufen oder ein Geschäft aufmachen. Grundsätzlich kann jeder einen Kredit erhalten. 75 Prozent unserer Klienten sind Russen. Mit der Arbeit haben wir vor vier Jahren begonnen. Probleme gibt es meist bei der Rückzahlung der Summe.“, er lacht. Wir verabreden uns für den morgigen Tag, um Interviews mit zwei Flüchtlingsfamilien zu machen. 1 Euro sind ungefähr 30 Rubel. Der Schaffnerin. 75 ist verzweifelt, hat sie doch kein weiteres Münzstück und will eine Fahrkarte kaufen. Solche eine hartnäckige Passagierin hat man lange nicht gesehen: „Jetzt nehmen Sie das Geld schon an, der Rubel ist doch nur etwas verbogen, das ist doch kein Problem“, versucht sie zu beruhigen. „Ich will doch nur eine Fahrtkarte!“ Der Fahrkartenverkäuferin reicht es, sie nimmt den Rubel, hebt den Arm, holt weit aus und schleudert den kleinen Rubel auf den harten Holzboden des Trolleybusses. Der Mop hält inne. Die junge Russin rückt näher zu ihrem Freund ans Fenster. Der Busfahrer peilt gar nichts. Eine alte Dame räkelt ihren Kopf in Richtung Gang. Ich staune. Der Rubel klimpert. Die Fahrkartenverkäuferin verschnauft. Damit hat sie es uns allen bewiesen. Ein junger Offizier mit Aktentasche und faltenloser grüner Uniform steht auf. „Nun mal halblang gute Dame“, brummt er, „Dieses Münzstück ist immer noch ein offizielles Zahlungsmittel. Sie sind dazu verpflichtet diese Frau zu befördern, der Rubel ist völlig korrekt.“ Die Fahrkartenverkäuferin ist bockig. Sie hängt sich ihr schwarzes Geldtäschchen im den Hals, rückt ihre 76 Wolkenfluten | Stavropol blaue Rüschenschürze zurecht und setzt sich auf ihren Konduktersessel neben der Tür. Der Bus hält an, die Leute steigen aus, es ist wieso Endstation. Ich bin zu weit gefahren. Hat die Frau mir doch in dem ganzen Theater vergessen, bei der richtigen Station Bescheid zu sagen. So was. Ich hebe den Rubel auf und lege ihn auf einen Sitzplatz. Ruhe sanft kleiner Rubel, ruhe sanft. Das Ziel meiner Wege ist eine kleine Wohnung im Erdgeschoß eines gewöhnlichen Mietshauses. Vor mir steht ein freundlicher Mann um die fünfzig. Vasili Petrowitsch schafft Brot und Butter heran und tischt mir seine Meinung auf. Die Organisation „Solidarnost“ hat gegründet, als er selber aus Grozny geflohen ist. Vasili ist Russe und hat durch Bekannte nach Stavropol gefunden. Sein Standpunkt scheint unumstößlich: „Dass Stalin die Tschetschenen nach Kasachstan deportiert hat, war richtig. Anders hätte man die Region nicht kontrollieren können. Die Ethnien muss man trennen. Natürlich ist das schmerzhaft, aber politisch pragmatisch. Als die Tschetschenen zurückkamen, begannen doch erst die Probleme.“ Da muss ich erstemal durchatmen und höre ihm weiter zu: „Den ersten Tschetschenienkrieg habe ich vorhergesagt. Völlig unnötig war der, Jelzin hat einen großen Fehler begangen. Der zweite Krieg dagegen ist richtig, Anarchie herrschte zu der Zeit in Tschetschenien. Aber sollen sie doch frei sein und unabhängig werden, dann müssen sie alleine sehen, wir sie weiterkommen.“ Er greift zu Papier und Bleistift und rechnet mir vor, wieviel Geld Moskau in die Region steckt. „Die Tschetschenen wollen doch nicht arbeiten, die sind faul. Ich kenne die Leute, ich habe doch selber dort gelebt“, setzt er nach. Ganz abstrus wird es, als er mir von der tschetschenischen Mafia erzählt: „Du kennst doch sicherlich das Rossija am Roten Platz oder das Kaufhaus am Manegenplatz in Moskau, der Hausherr ist ein Tschetschene. Die Avto-Bank ist auch in ihren Händen. Das ist wie mit den Juden. Hier in Stavropol haben die auch einen riesigen Supermarkt.“ Leider merke ich erst im Nachhinein, dass mein Tonbandgerät stehengeblieben ist und das Gespräch nicht aufgezeichnet hat. Mir ist kalt, der Wind hat das Fenster aufgestoßen. Die gelben Heftzettel an der Schreibtischlampe flattern. Er nennt mir seine Fakten für den Krieg in Tschetschenien: „Die Religion von Russen und Tschetschenen ist zu unterschiedlich. Die haben Gesetze, die sich von unseren komplett unterscheiden. Sie rauben Frauen und haben keine Moral. Hitzig sind sie obendrein. Die Tschetschenen sind reich, sie leben bei weitem besser als wir Russen“. Aus einer Schublade holt er Fotos von einem zerstörten Haus in Grozny hervor: „Hier schau. So sieht es aus. Und auf dem Foto, ist alles neu und in Ordnung. Die Tschetschenen haben sich schnell ihre Häuser aufgebaut. Die haben Geld und verstehen Geld zu machen. Denen geht es gut.“ Vasili Petrowitsch gestikuliert und läßt seinen Emotionen freien Lauf: „Und jetzt? Moskau und alle anderen Regionen finanzieren Inguschetien und Tschetschenien. Das ist doch nicht richtig. Dennoch, wir helfen allen, die unsere Hilfe brauchen, tschetschenischen und russischen Flüchtlingen“, erklärt Petrowitsch. Ich bin zwischen den Fronten von Wahrheiten geraten. Kann man diese Diskussion losgelöst von gut und böse führen? Wohin werde ich treiben? Es pocht an der Tür, ein Mann mit einer viel zu großen Hose und gekämmtem Seitenscheitel steht auf einmal im Raum. Serjoscha ist vor vier Jahren aus Grozny geflüchtet, er ist Russe, seine Frau 77 hat ihn verlassen, jetzt schlägt er sich mit Gelegenheitsjobs durchs Leben. Ob jemand Zigaretten kaufen will, fragt er. Ich versuche mit ihm über seine Erlebnisse im Krieg und seine Gegenwart zu sprechen; er sitzt zusammengekauert auf dem Stuhl, die Schultern vornüber, die Hände zusammengefaltet auf dem Schoß. Serjoscha sagt nicht viel: „Es geht schon, so stehen die Dinge“, wiederholt er monoton. Eigentlich habe ich heute Geburtstag. Ina und Natascha haben das irgendwie herausbekommen. Zum Feiern ist mir nicht zu Mute, trotzdem gibt es „aus Anlaß des Tages“, wie Ina sagt, Tomatensalat mit Kapern, Birnenbrause und Sekt aus Dagestan. „Runde Geburtstage zeigen die Zukunft für ein Jahrzehnt“, sagte meine Russischlehrerin in Moskau. Ich seufze, dann werde ich wohl bis dreissig auf Reisen sein, in Trolleybussen frustrierten Frauen um die vierzig begegnen und mir Verschwörungstheorien von unrasierten Herren um die fünfzig anhören müssen. Alles Gute für Dich. Als mein Opa anruft, kommt Stimmung auf: „Mensch Junge, geht es Dir gut? Hast Du denn auch immer genug zu essen? In Rußland ist det doch sicher nicht einfach“, fragt er fürsorglich, ich nicke und flüstere leise: „Ja, ganz schön schwierig hier“, in den Hörer. Ende der Aufschrift 1 Uhr morgens 78 Stavropol. Mittwoch, den 22. Mai 2002. Holländer schubsen mich aus der Reihe. Der Termin mit Stanislav platzt. Eine Gruppe Journalisten kommt, da hat der Chef am Morgen alle Pläne umgeworfen und das Auto geordert. Stanislav wird jetzt meine Tour mit den orangen Zeitungsleuten machen. Meine Tagesplanung ist für die Katz. Die Vorfreude auf die Fußballweltmeisterschaft ist dann das einzige, was so einem Morgen Süße gibt. Ich fahre in die Stadt und entdecke ein weiteres Mal Kinder mit Gewehren. In einem harmlosen Park halten sie Wache vor einem steinernen Denkmal. Diesmal ist das Mädchen auch bewaffnet. Die drei stehen sich regungslos gegenüber und blicken sich an. Ich drücke ab, sie zucken noch nicht mal eine Wimper, als ich ein Foto von ihnen mache. Ein kleiner Junge planscht mit seinen Händen in einem Springbrunnen neben den Treppenstufen, seine Mutter schwatzt mit einer Freundin auf der Parkbank. Der Wind ist weich. In einem Internetcafe plaudere ich mit dem kasachischen Besitzer. Vor fünf Jahren ist er nach Stavropol gekommen, jetzt arbeiten sein jüngerer Bruder und sein Vater mit im Geschäft. Mit dem Internet kann man Geld verdienen, noch mehr bringen aber die Computerspiele, bei denen sich Jugendliche in LAN-Sessions den Thrill geben. „Die sitzen den ganzen Nachmittag hier, in den Ferien ballern sie den ganzen Tag auf dem Computer durch die Gegend“, erzählt er mir. Er schüttelt mir die Hand, freut sich über meinen Besuch, verabschiedet mich und eilt zum Tisch einer Studentin, die ihr Textverarbeitungsprogramm zum Absturz gebracht hat. In einem Telefonamt zwei Querstraßen weiter gehe ich dem Hinweis einer Email nach. Ich telefoniere nach Wladikawkas. Durch Zufall bekomme ich die Nummer eines Deutschen, der im Kaukasus eine Spedition betreibt. Ich spreche mit seiner Frau, die einer Übernachtung bei ihnen zustimmt. Ich korrigiere alle Gedankengänge und ändere meine Reiseroute. Diese Chance ist einmalig. Dann geht es fix. Ich zahle eine hohe Summe Rubel bei der Kassiererin ein und telefoniere nach Nord-Ossetien. Über einen Kontakt bei UNICEF15 gelange ich zum UNHCR16. Eine aufgeschlossene Frauenstimme sucht mir zwei Telefonnummern von Flüchtlingsorganisationen in Wladikawkas raus. Mein erster Anruf schlägt fehl, ich lande beim Ossetischen Außenministerium. Der zuständige Mitarbeiter für Flüchtlingsfragen ergänzt meine Liste mit Telefonnummern. Nach einer halben Stunde habe ich die ersten Termine für nächste Woche vereinbart. Ich denke an den Philip Reis und das erste Telefon, niemand hat damals geglaubt, dass die Welt durch Kupferdraht und Glasfaser auf ein Dorf zusammenschrumpfen würde. Es ist immer noch hell, als ich Maxim am Abend treffe. Wir überreden einen Besitzer hinter seiner geschlossenen Ladentür noch schnell zwei Kassetten für mein Tonbandgerät zu verkaufen und machen uns auf den Weg zum Studentenwohnheim. Maxim erzählt mir von seinem ersten Studium in Moskau. Kurz vor dem Abschluß als Ingenieur hat er alles hingeschmissen. Jetzt ist er wieder in Stavropol und arbeitet als Versicherungsvertreter. 15 16 Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Hoher Kommissar für Flüchtlinge der Vereinten Nationen. Nebenbei studiert er Wirtschaft. Maxim rückt seine Brille zurecht, schwenkt nach rechts, und wir stehen vor einem dieser gelbbraunen Backsteinhäuser, die eigentlich mehr gelb als braun sind und an den Frühversuch erinnern, Lego in die Wirklichkeit zu holen. Auf zwölf Etagen schlurfen Studenten mit Badelatschen durch die Gänge, bringen in einer improvisierten Küche Makkaroni gemeinsam zum Kochen oder rauchen einfach nur stumm in der Hocke eine Zigarette auf dem Flur. Zwölf Quadratmetern, Natascha und Olga leben in einem Zimmer zusammen. „Hier ist die Gemeinschaft groß. Wer nicht im Studentenwohnheim gelebt hat ist kein echter Student gewesen“, erklärt Natascha. „Das Leben könnte besser sein. In Rußland muß man bezahlen, wenn man studiert. Wer Geld hat, geht zum Studium nach Moskau. Stavropol ist die größte Stadt in der Gegend, deswegen sind wir hier.“ Und dann reden sie alle durcheinander. Maxim und Natscha haben Kommilitonen auf der Etage eingeladen. Von den elf, die gekommen sind, will ich mehr, über ihr Bild von Rußland erfahren. Vorher nehmen sich mich aber noch auseinander: „Warum macht Du überhaupt einen Alternativen Dienst in Rußland? Welches deutsche Bier ist das Beste? Gibt es auch Straßenbahnen bei Euch in Berlin? Und sag mal, wie viele Buchstaben hat das deutsche Alphabet?“, wollen sie wissen. Ich berichte davon, wie schwierig es ist mit Flüchtlingsorganisationen in Kontakt zu kommen, halte Krieg für die einfachste Antwort und mache klar, dass man in Berlin 13 Jahre zur Schule geht und nicht wie in Rußland zehn. Weißwürste ißt man übrigens traditionell in Bayern, und nicht alle Deutschen laufen auf der Straße mit Seppelhosen herum oder stemmen Bierkrüge, wehre ich mich mit Berliner Akzent. Sie fallen aus allen Wolken. Wir sprechen über Tschetschenien, Putin, das Klonen, die 79 Globalisierung, ihre Träume und Wünsche. „Es geht voran, wir bauen Rußland auf. Mit Rußland geht es nach oben. Wir werden alles selbst in die Hand nehmen“, sind sie sich einig. „Wir werden unsere Wirtschaft verbessern, aber in der Gegenwart sind alle gegen uns“, ist der Tenor des Abends. Ein 19-jähriger Mathematikstudent antwortet auf die Frage, ob es noch ehrliche Leute gibt, mit einem russischen Sprichwort: „Es gibt sie, aber es ist nicht möglich, weil alles abgesprochen ist. Wenn du einen würgen wirst, wird der Rest dich würgen.“ Amerika bedeutet für eine Studentin nichts gutes. Die Mehrheit bleibt sicher: „Rußland ist der Bauchnabel der Welt.“ „Alle haben Angst vor Rußland, weil wir so viele Waffen haben. Wir haben immer noch ein schwarzes Kästchen mit einem roten Knopf“, sagt gar eine junge Stundentin, die mit Schlappen auf dem Bett sitzt. „Es ist genug, immer der letzte zu sein“, wirft ein Junge mit Schnurrbartansatz vom Stuhl gegenüber ein. Ein Kühlschrank singt in der Küche. Über die Gänge tappen Füße. Gelächter prallt gegen die Wände. Die Nacht ist schon stockfinster. Im Zimmer nebenan läuft der Fernseher. Bis zum letzten Bus sitze ich im Obtscheschitije17. Eindringlich bleibt mir die Verzweiflung in Studentenwohnheim | Stavropol 17 Studentenwohnheim. 80 Ehre der Arbeit | In der Nähe von Stavropol 81 der Stimme eines Mädchens im Gedächtnis. Ihr Bruder ist in Grozny stationiert. Was sie davon hält, frage ich sie. „Ich denke gar nichts“, sagt sie still. Reiner Sonnenschein leuchtet durch das Weiß der Zeitung eines Mannes. Der sitzt auf einer langgezogenen Steinbank, und löst sich aus Zeit und Raum. Ende der Aufschrift gegen Mitternacht Vor dem Kulturpalast schwatzen Frauen mit Kopftüchern und Männer in Anzügen. Die Stadtverwaltung und der Djetskij Fond werden zwei Stunden lang in einem Plenum Fragen von Flüchtlingen beantworten. Anna, die Juristin vom Djetskij Fond, hat mich Dienstag eingeladen mitzukommen. Olga Iwanowna und ihre Mitarbeiterin von der Organisation Orden sind ebenfalls angereist. Einmal im Monat gibt es eine solche Veranstaltung, diesmal sind sie nach Novoaleksandrovsk gekommen. Ein Hahn kräht in der Ferne. Wir warten noch auf den Mann vom Migrationsdienst. Es ist schon kurz nach elf. Ein Junge ringt mit seinem Fahrrad, das viel zu groß für ihn ist. Den schwarzen Geigenkasten hat er über den Lenker gekrempelt. Der Samtbezug glänzt. Sicherheitshalber lehnt er sich zwischen eine Bank und sein Gefährt. Er findet halt und guckt sich in der Gegend um. Stavropol. Donnerstag, den 23. Mai 2002. Mit dem Barkas geht es raus aus Stavropol. Zwischen saftigen Wiesen und flachen Felder finden sich Spuren von kleinen Dörfern. Astrachan kommt jetzt dagegen wie eine Sandwüste vor. Das Schild am Ortseingang hält sowjetische Insignien bereit. Ein Zahnrad, eine Gerstenehre, die Sichel, in dem Dorf wird gearbeitet, hier wird der Pflug noch mit der Hand geführt. Am Wegesrand immer wieder Schulklassen, die Unkraut jäten. Die Lehrer packen mit an. Eine Frau in Turnhose sägt an einem Ast herum. Eine Kollegin kehrt das Laub zusammen. Vier Jungen wandern mit der Harke auf der Schulter lässig an einer Gruppe Mädchen vorbei. Wir parken gegenüber dem Stadion „Freundschaft“. Lenin winkt uns in Bronze gegossen zu. Rote Buchstabenklötze stehen vor dem Kulturzentrum: „Ehre der Arbeit“, heißt es wieder einmal. Die Farbe ist frisch, eine Frau mit Kinderwagen zieht zügig an dem Schriftzug vorbei. Ein älterer Herr mit Baskenmütze radelt zur Dorflitfaßsäule. Zierrahmen aus in blassen grau schmücken die Informationstafel. Morgen lädt der Folkloreverein zum Tanzen ein, gute Laune bitte mitbringen. Der Himmel ist blau. 82 Ich bin es ja schon gewöhnt. Von der Stadtverwaltung werde ich nicht gerne gesehen, mein Tonbandgerät versagt leider wieder einmal bei der Aufzeichnung der Veranstaltung. „Liebe Genossen“, beginnt der Vertreter des Migrationsdienstes, „hiermit möchte ich allen Organisationen Dank aussprechen.“ Dann rattert er in einer Tour seinen Text herunter. Von 4000 Zwangsvertriebenen haben nur acht einen Status zuerkannt bekommen. Das Amt baut an neue Strukturen. Die Entschädigung für Zwangsvertriebene scheitert an den fehlenden Finanzmitteln. Die Saal ist gefüllt, wie in einem Kino sitzen wir auf harten Klappsesseln und verzweifeln an der schlechten Akustik. Sechzig Leute sind gekommen, in der Überzahl Mütter und Pensionäre. Eine Frau aus Grozny klagt an: „Kein Geld, nichts haben wir bekommen. Wie Hunde leben wir. Sie gaben uns ein Buch, na toll, mir reicht es.“ Die humanitäre Hilfe vom Roten Kreuz ist für sie keine Lösung. Eine Mitarbeiterin vom Migrationsdienst rechtfertigt sich: „Die Frist für Ihren Antrag auf Kompensation war abgelaufen, da konnten wir nichts machen.“ „Ich habe zwei kleine Kinder, mein Mann ist gestorben. Der Russische Staat kümmert sich um nichts. Sehen Sie, was der Krieg aus uns gemacht hat.“, resigniert die Frau aus Tschetschenien. Die Stimmung ist angeheizt. Etliche Arme ragen nach oben. Jeder will sich Luft verschaffen, ein Mann um die siebzig im verschlissenen grauen Sacko hält es nicht mehr aus: „Zwei Jahre haben Sie nichts gemacht. Immer wieder haben Sie uns vertröstet. Putin macht doch nichts. Jelzin hat diesen Krieg angefangen. Warum hilft uns niemand? Was soll das?“. Er gestikuliert, seine Hände und seine Stimme zittern: „Viermal habe ich Ihre Bescheinigung eingereicht. Tun Sie doch endlich etwas.“ Er ist ganz außer Atem, die Schweißperlen sind unübersehbar. Eine Frau aus der ersten Reihe steht auf: „Wir haben alle Dokumente verloren. Wir haben schon viel versucht, um eine Bestätigung zu bekommen. Man nimmt uns nicht ernst“, erklärt sie. Der alte Mann hat derweil mit gesenktem Kopf den Saal verlassen. Er weint. Die zierliche Frau vom Migrationsdienst zieht Akten aus der Tasche, schlägt ihr buntes Halstuch zur Seite und versucht gegen die allgemeine Gemütslage anzukämpfen. Dennoch, Emotionen sind stärker als Beschwichtigungsversuche. Anna, die Studentin vom Kinderfond, berät nach dem Plenum juristisch. Eine Frau aus Kasachstan ist nicht als Flüchtling anerkannt, Anna hilft ihr. „Eigentlich müßte das ja alles der Staat machen“, kommentiert sie nüchtern. „Flüchtlinge sind schutzlos der Bürokratie ausgeliefert. In Rußland ist jeder auf sich allein gestellt. Es ist ein Handel und Schieben der Fälle zwischen dem Staat und den NGOs18. Den ganzen Nachmittag geben wir hier noch Kleidung an Flüchtlinge und hilfsbedürftige Familien aus. Die Liste haben wir von der Stadtverwaltung, die können das selbst gar nicht leisten.“ Ich streife durch das Dorf. Birkenblüten schweben durch die Luft und kitzeln unerhört meine Nase. Kinder spielen Fußball auf der Straße. Zwei Frauen tragen ihre Stoffbeutel nach Hause. Der Mann mit der Baskenmütze ist wieder da. Er tritt genüßlich in die Pedale. Es ist wie an einem Sonntag im August. Auf einem Hinterhof spielen sechs Männer Karten. Eine gescheckte Katze schleicht um die Beine der Altherrengesellschaft. Der Wind weht frisch. Blütenflocken aus den Bäumen schweben über den Holztisch. Niemand stört sich. Ein Kamerad mit Pfeife tritt in die Geselligkeit. Ein Mann mit Hornbrille und Zigarre teilt neu aus. Wieder begegnet mir eines dieser unbeschreiblichen Wunder. Wir besuchen eine Familie mit 13 Kindern. Die Enten watscheln aus dem Tor. Wir laden Nudeln und Kleidung aus dem Kofferraum aus. Die Altesten hieven die Säcke mit Hühnerfutter in den Schuppen aus Wellblech. Die Mutter sucht Hosen und Jacken aus der großen Tüte heraus. Ein kleines Kindergesicht versteckt sich hinter dem Treppengeländer. Ich blinzle ihm zu, es kichert 18 Nicht Regierung Organisationen, Non Governmental Organisations. 83 und verschwindet im Haus. „Hab keine Angst“, ruft mir die Mutter zu, „geh ruhig ins Haus und schau dich um. Du sollst doch schließlich wissen, wie wir leben. Wir haben nichts zu verbergen.“ Ich ziehe die Schuhe aus. In der Küche werkeln die Jungs mit den mitgebrachten Wasserflaschen herum. Das Haus ist nicht groß, aber sauber. Ich stolpere über einen Plüschelefanten. Ich fühle mich wohl, die Kinder hopsen eifrig an mir vorbei. Im Wohnzimmer sitzen die leiblichen Töchter. „Unsere Eltern haben vor drei Jahren angefangen Kinder aufzunehmen - Kinder, die ihre Eltern weggestoßen haben, weil sie körperliche Mißbildungen haben.“, erzählt die älteste Tochter. Der Vater geht den ganzen Tag arbeiten, die Mutter kümmert sich um die Kinder. Jede Kopeke sparen sie für kostspielige Operationen der Kinder.“ 84 85 Dorfleben | Stavropol Vorschule für Flüchtlingskinder | Stavropol 86 Das Leben ist improvisiert. Vor dem Haus steht ein Plumpsklo aus Holz. Eine Ziege, Hühner, Ente, die Familie versorgt sich mit dem Einfachsten. Die Nachbarn bringen Gemüse. „Ich liebe jedes meiner Kinder“, sagt mir die Mutter ins Ohr und umarmt ihre Schützlinge. In diesem kleinen Dorf irgendwo im Süden Rußland leben stille Helden der Gegenwart. wir die Geschichte „Das Rübchen“21, die Lehrerin ist nett“, so der kleine Aljoscha aus der ersten Reihe. Die Tische und Stühle haben Zwergenformat. Für die Kinder muß ich wie ein Riese wirken. Ich spreche langsam, um die herausgeputzten Wesen nicht umzupusten. An den Wänden hängen Buchstaben aus Papier, eine grüne Rechentafel steht neben dem Tisch der Lehrerin. Ende der Aufschrift gegen 10 Uhr abends Die Mütter auf dem Flur reden Klartext. „Ohne Dokumente bekomme ich keinen Paß, ohne Paß keine Arbeitserlaubnisse, ohne Arbeit keine Wohnung - es ist ein Teufelskreislauf“, weiß eine Frau aus Abchasien. Ein Mädchen bringt die Tochter einer Freundin zur Schule, sie sind zu spät. „Krieg ist nie richtig“, sagt Milana, die sechs Kilometer von Grozny geboren wurde. „Die gegenwärtige Situation in Tschetschenien wird sich nicht schnell verbessern. Die russische Regierung birgt nichts Gutes. In der tschetschenischen Regierung streiten sie sich alle nur. Tschetschenien ist meine Heimat. Ich möchte zurück in das Haus, in dem ich gelebt habe. Meine Freunde sind verschollen; ich habe lange nichts von ihnen gehört, nachdem wir von Inguschetien nach Stavropol geflüchtet sind“, reflektiert sie. „Ich bin keine Terroristin. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass die Leute so urteilen. Russische Soldaten töten unsere Väter und verschleppen unsere Brüder. Von denen sind viele nicht normal. Sie töten Menschen, ohne Rechtfertigung haben sie unsere Häuser durchsucht und nahmen alles mit, was ihnen gefiel. Einen Freund aus der Nachbarschaft haben Soldaten bei einer der Säuberungen mitgenommen. Er war 16, niemand weiß, wohin sie Stavropol. Freitag, den 24. Mai 2002. Neben dem Kiosk mit frischen Bulotschki19 gibt es eine Vorschule für Flüchtlingskinder. Hinter dem Torbogen mit den mitgenommenen Stuckverzierungen in einem Raum auf der dritten Etage. Vor den weiß gestrichenen Fensterrahmen warten die Mütter. 300 Rubel20 kostet ein Platz für ein Kind in einer Vorschule: „Ich habe drei Kinder. Wir sind vor einem Jahr aus Aserbaidschan geflüchtet. Unser Geld reicht gerade für das Nötigste“, erzählt mir eine Mutter, die froh über diese kostenfreie Möglichkeit für die kleinste Tochter ist. Vor zwei Jahren wurde die Schule von der Heilsarmee gegründet, die zwölf Kinder sind im Alter von sechs bis sieben Jahren, mit acht geht es in Rußland in der Grundschule weiter. „Wir tanzen und singen, heute lesen 19 Süße Brötchen, manchmal mit Rosinen, Mohn oder Zimt. Zu Erinnerung: Ein Euro sind ungefähr 30 Rubel. Zum Verständnis: Natascha verdient im Monat als Psychologin in einem Therapiezentrum in Stavropol 2100 Rubel. 20 21 Russische Erzählung, bei der eine Familie vom Opa bis zur Hausmaus versuchen eine Rübe aus den Erdboden zu ziehen. 87 ihn gebracht haben, ob er lebt. Immer und immer wieder verschwinden Menschen; Wochen später werden Leichen gefunden. Das Leben in Tschetschenien ist schrecklich, mein Vater hat es mir verboten wieder dort hin zu fahren.“ „Nach dem Krieg will ich zurück.“, bekennt die 20-Jährige. „Wie lange wird dieser Krieg noch dauern? Solange sie es wollen, wird es so weitergehen. Wer weiß schon, wohin Rußland geht?“ Milana wünscht sich, dass alles gut wird, träumt von einem normalen Leben, um keine Angst mehr zu haben: „Wenn die Kinder ein Flugzeug hören, verstecken sie sich. Ich beruhige sie dann und sage, dass sie hier sicher sind.“ „Gerade Kinder nehmen ihre Umwelt viel intensiver wahr, als Erwachsene. Der Krieg traumatisiert sie. Lernschwächen, Schwierigkeiten sich zu konzentrieren sind unmittelbare Folge. Auch die fluchtartigen Veränderungen ihrer Lebensumstände sind für Kinder eher unbekannt, und können zu Ängsten führen“, legt Natascha dar, als ich sie am späten Nachmittag bei ihrer Arbeit in einem Rehabilitationszentrum besuche, in dem sie Kinder psychologisch betreut. „Krieg schafft viel größere Probleme, als dass er etwas löst“, schlußfolgert sie. Der Schatten der Platanen fällt durchs Zimmer. Im Garten spielen Kinder mit Bällen und tollen in der Gegend herum. Ende der Aufschrift gegen 11 Uhr abends Wladikawkas. Sonnabend, den 25. Mai 2002. In den frühen Morgenstunden nehme ich den Bus von Stavropol nach Wladikawkas. Auf der Fahrt mit dem Taxi verabschiede ich mich von der mitreißenden Schönheit dieser Stadt. Die Straßen sind überzogen mit Nebel, die Bäume schlafen, nur in einigen Fenstern brennt Licht. Der Busfahrer ist ruppig. Sein schwarzer Schnauzer paßt zu den markanten Zügen seines Gesichtes. Für einige Rubelscheine nimmt er zwei Kisten von einem Mann mit, der kurz vor Abfahrt mit seinem Moskwitsch angeprescht kommt. Sie laden um, schnell, schnell, die letzten steigen ein. Im Bus: Soldaten, Frauen dunklen Kleidern und bunten Kopftüchern, sechs Männer mit kaukasischem Blick und ein Deutscher. Vor der Grenze zu Nord-Ossetien gibt es die ersten Polizeikontrolle. Stopps solcher Art sind gewöhnlich auf den Straßen Rußlands. In Nevinnomissk, Mineralnije Vodi, Pjatigorsk und Novopawlowsk überprüft uns die Miliz. Wir vertreten uns kurz die Füße. Nazran, Grozny, Machatschkala steht auf einem blauen Schild neben unserer Haltestelle. Die Schrift ist verwaschen, neben einer Bank wirbt eine Frau mit bunter Schürze für ihre Tschebureki22. Wir kaufen Eis. Ich unterhalte mich mit dem jungen Fallschirmspringer, der vor mir im Bus sitzt und ein Handbuch zur islamischen Kultur liest. „Ich komme gerade von einem Seminar in Stavropol, jetzt geht es wieder zurück zu meiner Einheit“, erzählt er und zeigt mir stolz ein Foto: „Im Armdrücken habe ich den ersten Platz belegt, schau mal.“ Als ich ihn zur seiner Arbeit in 22 Fritierter Teig mit Hammelfleischfarce oder Käse, sieht aus wie ein Halbmond mit Zacken. 88 Tschetschenien befrage, antwortet er unbefangen: „Ich weiß, dass es eine schlechte Sache ist, aber jemand muss sie ja machen.“ Neben uns stehen zwei Panzerfahrer und rauchen. Sie sind bei weitem älter, als der junge Russe mit dem breiten Kreuz, der in meinem Alter sein könnte. Von der Zugfahrt nach Wolgograd habe ich gelernt. Am Abend vorher rolle ich die Filme und Tonbänder in meinen Schlafsack ein. Fotoapparat und Bücher verpacke ich in dreckige Wäsche. An der Grenze werden die Pässe kontrolliert. Allein drei mal im Abstand von 200 Metern steigen Uniformierte mit ihren Schirmmützen ein. Auf die Fragen antworte ich, dass ich Student bin und Freunde besuche. Alles andere wäre zu kompliziert. 89 90 Stadtpanorama | Wladikawkas 91 Berge | Nord-Ossetien An einer Straßensperre gibt es Ärger. Ein Georgier muss aussteigen. Wir fahren rechts auf einen Seitenstreifen und warten. Ich spaziere auf einer Wiese, vor mir erhebt sich das Gebirge aus der Erde und entfaltet seine Schöhnheit. Ein Bauer zieht mit seinem Heuschober querfeldein vorbei. Das ist der Kaukasus. Ich habe das Gefühl endlich angekommen zu sein. Der Busfahrer und der Georgier sind zurück. Beide grummeln, wir haben Verspätung, der Georgier mußte 1500 Rubel Strafe zahlen. Wir fahren weiter. “Wir sind mit dem russischen Volk verbrüdert“, steht in großen Buchstaben mit Kalk auf einem Berghang geschrieben. Auf einer langen Asphaltstreifen ziehen wir durch das Land. Die Ebene ist flach, unwirklich scheint sich das Gestein in der Ferne in die Wolken zu bohren. Am Nachmittag gegen vier Uhr erreichen wir Wladikawkas. Frank und seine Frau Elina holen mich ab. Er war bei der Nato, sie ist Dolmetscherin. Jetzt leben sie mit Oma, Tochter, Hund und Katze in einem Haus am Fluss mitten im Zentrum. Frank hat zwei Lkw mit Obst und Gemüse zu laufen. Ohne Atmen zu holen, stürtze ich mich in ein weiteres Abendteuer. Wir stellen nur kurz die Sachen ab und fahren mit dem Jeep in die Berge. Elina will wilden Knoblauch stechen, die Oma braucht eine Wurzel für eine kranke Freundin, die gibt es nur an einer bestimmten Stelle im Gebirge. Ossetien ist eine kleine Region im Kaukasus, in Wladikawkas leben ungefähr 400.000 Einwohnern. „So viele Menschen wohnen auch an einer Hauptstraße in Moskau.“, scherzt Elina. Früher hieß die Republik übrigens früher „Alania“, so nannten die Georgier „die aus dem Norden“. 92 Durch Gisel hindurch, kreuzen wir eine Allee und nehmen galant die Kurve auf eine Sandweg. Wir verlassen das Tal und sind die einzigen auf der Straße. Vor dem Abzweig in die Berge, neben einem Baum wieder ein Polizeiposten. Frank winkt ihm freundlich zu. Links und rechts neben uns Felder mit gelben Gräsern. In Fiagdon steht ein Kalb vor der Schule. Kinder mit weißen Hemden und roten Schleifen sitzen auf den Treppen. Ein großes LeninEmblem hängt über dem Eingang. Das Kalb muht und frißt weiter dreist Gras durch den Zaun. Im dem Marktplatz verkauft eine Frau Tomaten, Gurken und Zwiebeln aus dem Kofferraum ihres Autos. Zwei Omas und ein Opa laufen vor uns auf dem Bürgersteig. Es staubt. Die drei debattieren heftig. Wir steigen weiter in die Höhe. Vor den Bergschluchten: Abgestellte Ladas, Leute im Gras sitzen und Schaschlik machen, das Wetter ist herrlich. Auf einer kleinen Holzbrücke überqueren wir einen reißenden Fluß. Zwei Männer mit hohen Gummihosen angeln in der Strömung Forellen, eine Mutter und ihre Tochter hocken am Rand in den Sträuchern und sammeln Blaubeeren. Es ist, als hätte Gott in die Berge gepustet. Sanft und leicht legt sich das Grün auf das Gebirgsmassiv. Ich blicke wie verzaubert auf die braunen Felsen, die mit blühenden Auen und üppigem Buschwerk verflochten sind. Elina sucht Blumen für ihren Garten, die Oma sammelt Kräuter für einen Tee, Frank versucht mit dem Spaten die Staude mit der Heilwurzel aus dem harten Boden zu graben. Ich werde süchtig von der reinen Luft der Berge. Frank holt das Fernglas heraus und zeigt mit dem Finger in die Wälder: „Hier gehe ich sonst im Winter auf die Jagd. Mit dem Krieg in Tschetschenien sind die ganzen Bären und Bergziegen nach Inguschetien und Ossetien geflüchtet. Es gibt ein Rudel mit Wölfen, das jetzt in den Bergdörfern das Vieh und Hühner reißt.“ Ein Gewitter überrascht uns, wir kehren um. Es ist der Geruch nach einem Regen, der das Paradies auf Erden schafft. Mit Elina klettere ich einen kleinen Weg einer Bergschneise entlang, die vom Gletscherwasser ausgespült wurde. Das Wasser ist glasklar. „Ringsum war es still, so still, dass man nach dem Summen einer Mücke ihren Flug hätte verfolgen können. Links war eine schwarze und tiefe Schlucht, hinter ihr und vor uns ragten die dunkelblauen, zerklüfteten Berggipfel; von reichlichem Schnee bedeckt, standen sie gegen den blassen Himmelsgrund, der noch immer Spuren der erlöschenden Abendröte aufwies. Am dunklen Himmel flimmerten bereits die ersten Sterne, und es kam mir eigentümlicherweise so vor, als stünden sie viel als bei uns im Norden.“23 Ich denke an Lermontov. Auf den Auen weiden Kühe und Schafe. Auf dem Rückweg durch Fiagdon fallen mir Löcher in den Felswänden auf. Ganze Häuser mit Fenstern und Treppen sind da in den Stein geschlagen. „Das ist die Totenstadt“, weiß Elina. „Im 17. Jahrhundert haben dort Menschen gelebt. Bei Gefahr hat man die Familien und das Vieh in dem Höhlensystem versteckt. Die kleinen Öffnungen sind Schießscharten.“ Die Häuser aus Steinplatten mit kleinen Schächten erklärt sie anders: „Die Leute waren sehr arm und haben in den Feldern geschlafen. Als die Pest kam, sind viele Menschen gestorben. Später sind die Leute einfach in die Kammern gekrochen und dort gestorben. So konnten die Hunde die Leichen nicht fressen.“ 23 Lermontov, S. 9 Der Kaukasus ist der Kaukasus. Am Abend gehen wir am Flußufer vor dem Haus mit dem Hund spazieren. Prompt lädt uns der Vetter von Frank zum Schaschlik ein, den besten soll es am Ende der Stadt geben. Ein Taxi wird angehalten. Der Fahrer des kleinen viereckigen Ladas ist hilflos, als Adür angeheitert auf ihn einredet: „Ist das nicht ein schöner Tag? Den Preis kann man mal etwas drücken. Wir wollen was essen, willst du nicht mitkommen?“. Die Stimmung ist großartig, Ossetien nimmt mich an seine Hand. „Gib Gott, dass uns noch viele Gäste besuchen und Frieden auf Erden herrscht“, betet Adür in der Landessprache. Dann spricht er ein Gebet für mich und hält mir einen großen Fladen hin. Von dem soll ich als erster abbeißen. „Pizza“ nennen die Ossieten diese nationale Spezialität, die mit einer Mischung aus Käse, Kräutern, roter Beete oder Kartoffeln gefüllt ist. Allein der Duft ist köstlich, der Teig fettig mit Butter bestrichen. Und dann folgt eine Rede nach der anderen, wir stoßen mit Wodka an. Die Gläser klirren. Die Kellnerin wird herangerufen, die soll schließlich auch auf den Besuch trinken. Erst bei Sonnenaufgang schenkt mir die Gastfreundschaft die Freiheit. Wladikawkas. Sonntag, den 26. Mai 2002. „Der Morgen war frisch und schön. Goldene Wolken ragten über die Berge wie eine Kette von Zauberbergen; vor dem Tore lag ein breiter Platz; auf dem Markt dahinter wogte das Volk, denn es war ein Sonntag; barfüßige Ossetenknaben, die ihre Quersäcke mit Wabenhonig auf dem Rücken trugen, schwirrten um mich 93 herum.“24 Am Eingang kontrolliert die Miliz die Rucksäcke und Taschen. Die Angst vor Bomben ist groß. Im April gab es den letzten Anschlag. „Die Russen wollen, dass wir uns immer wieder bekriegen“, erzählt Elina und macht klar: „Inguschen und Tschetschenen sind in Ossetien eher unbeliebt. Sie sind aggressiv und stiften Unruhe. Blutrache und Mädchenraub sind im Kaukasus althergebracht, doch die Banditen haben den Krieg gebracht.“ Wir sind auf dem Hauptmarkt in Wladikawkas. Unter Dächern aus Leinentüchern suchen wir Trockenpflaumen und Walnußkerne aus. 24 Lermontov, S. 61 94 95 Alter Mann in den Bergen | Nord-Ossetien 96 Moschee | Wladikawkas Die Tochter hat morgen Geburtstag, da kauft man gerne Konfekt in grellen Papierschachteln. Das Blumenmotiv lächelt unter dem glänzenden Zellophan. Säbel aus Glas gefüllt mit Weinbrand sind ebenso traditionell. Mit einem Weidenkorb schlendern wir an Säcken voll Reis und Hirse, frischem Gemüse und Bottichen mit Ziegenkäse vorbei. An einem Stand kaufen wir Oliven mit Knoblauch. Ein Junge baut mit flinken Fingern eine Pyramide aus Datteln im Schatten eines dickbäuchigen Händlers. Ein Zipfel Asien scheint hier auf dem Boden zu liegen. Und überhaupt, der Markt ist sauber und offen. Niemand drängt durch die Reihen, es ist viel mehr ein genüßliches Treiben und Feilschen. Ich fühle mich sicher. fürchten sie nicht, Terroranschläge gibt es schließlich überall.“ Wladikawkas wirkt friedlich, in der Universität studieren die besten Mediziner und Techniker Rußlands. „Die Stadt hat sich verändert, schrittweise wird die Industrie aufgebaut, wir haben jetzt sogar eine Tankstelle im Zentrum. Ringsum bauen sie neue Häuser.“ Es gibt viel zu tun: „Allein der Schlacke neben der Fabrik dort ist einige Millionen Dollar wert, nur die Anlage zur Rückgewinnung der Edelmetalle läuft noch nicht“, weist Frank auf einen schwarzen Berg hinter einem Fabrikzaun. Auf der Suche nach Luftballons landen wir im ZUM25. In dem größten Kaufhaus an der Hauptstrasse von Wladikawkas haben früher Touristen gegen Devisen handbestickte Ledergürtel und feine Seidentücher gekauft. „Heute sind alle verängstigt. Grozny liegt 90 Kilometer entfernt. Das Fernsehen hat das Bild von der Region verklärt. Die Leute in Moskau glauben, dass hier überall Krieg herrscht“, klagt Elina. Die Russische Föderation hat ein Bataillon am Ausgang zu Stadt stationiert. Ein weitläufiges Gelände ist da mit Stacheldraht abgesteckt. „Gleich in der Nähe gibt es einen Bezirk, indem vor zwei Jahren vorwiegend Tschetschenen und Inguschen gelebt haben“, berichtet Frank, als wir mit dem Auto eine Rundfahrt machen. „Das war ein Umschlagplatz für Banden und Schiebereien. Die Miliz hat fast nie etwas gefunden. Als man die Häuser abgerissen hat, haben sie ganze Waffenlager in den Kellern entdeckt. Die Menschen Eine Straßenbahn flitzt über die Brücke. Junge Paare sitzen umschlungen in der Nachmittagssonne. Auf Uferpromenade wirbt eine Biermarke auf einem Zeltdach. Ein kleines Mädchen läuft mit einer Kugel Eis über die Wiese. Zwei Jungen im AdidasLook halten mich für einen Finnen. Das Panorama hinter den Mauern der Stadt ist gigantisch. „Amphitheatralisch aufgebaut, immer blauer und immer nebliger erheben sich die Berge, und fern am Horizont erstreckt sich die silberne Kette der Schneegipfel, beginnend mit dem Kasbek und endend mit dem doppelten Gipfel des Elbrus.“26 Die Kulisse bietet Raum für ein kraftvolles Reiterstandbild. Ein Mann mit Pelzkappe holt Anlauf zum Sprung über die Giebel der Dächer. Der Stadtpark ist nach dem Nationalheld Kosta Ketagurov benannt. Der berühmte Dichter ist Elinas Onkel. Die Adelsfamilie gehört zu einer der Größten in Ossetien. „Ich habe mit dem Kulturminister gesprochen. Die stellen eine Eskorte, dann fahren wir übermorgen noch einmal ins Gebirge und lassen uns von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter das System der steinernen Wachtürme im Kaukasus erklären“, 25 26 Zentrales Warenhaus. Lermontov, S. 91 97 schlägt Elina vor. Wir machen vor einer Moschee halt. Orientalische Ornamente schmücken den spitzen Fensterrahmen zwischen den Minaretten. Die Keramikfarben funkeln in blau, braun, rot und gelb. Der Innenraum ist mit weichen Perserteppichen ausgelegt. „Anfang des Jahrhunderts heiratete ein armenischer Erdölmagnat aus Baku eine Ossetin. Aus Dank baute er dem Ossetischen Volk diese Moschee“, erzählt mir ein Student, der kurz den Koran zu Seite legt. Der Kaukasus ist einzigartig. Unzählige Kulturen und kleine Stämme leben auf kleinstem Raum zusammen. Jede kaukasische Sprache ist ein Unikum, gemeinsam bilden sie eine Sprachgruppe. Ossetisch baut zwar auf dem kyrillischen Alphabet auf, streut aber noch ganz eigene Schriftzeichen unter. Wissenschaftler entdeckten vor zwei Jahren eine Sensation, danach lassen sich Ursprünge der deutschen Sprache im Ossetischen finden. Das ossetische Wort für einen Berg, zum Beispiel, heißt „hoch“27. Schnittpunkte finden sich aber auch mit Irland. Die Kirchen und Gräber erinnern steinerne Bauwerke auf der grünen Insel. Für die Osseten waren rote Haare typisch. Ossetische Tänze ähneln ebenfalls irischen Pendants. Heute ist das mit den Traditionen auch in Ossetien so eine Sache. Elina spricht mit ihrer Tochter zu Hause absichtlich nur die Landessprache. Nach zehn Minuten gibt sie es auf, die jungen Leute reden so wie in der Schule viel lieber Russisch. Im Kaukasus mißversteht man sich nicht nur von der Sprache her. „Um einen Streifen Land zwischen Inguschetien und Ossetien 27 Хох. 98 gibt es schon lange Streit; Stalin schenkte es nach der Deportation aufmüpfiger Bergvölker den Osseten. 1992 wollten die Inguschen ihr Gebiet zurück. Sie kauften Waffen und fielen in Wladikawkas ein. Interessant ist, dass drei Tage zuvor sämtliche inguschische Familien die Republik verlassen. Die Leute waren ahnungslos, als eines Morgens Lastwagen in die Stadt rollten und Scharfschützen von den Dächern auf Bevölkerung schossen. Die Süd-Osseten kamen den Nord-Osseten zur Hilfe. Sie hatten die Kriegserfahrung und die Gewehre vom Krieg gegen Georgien, und lebten als Flüchtlinge in Nord-Ossetien. Die Inguschen wurden innerhalb einer Woche bis weit nach Inguschetien hinein zurückgeschlagen. Eine Groteske, denn mehrfach hatte das inguschische Volk um die Rückgabe des umstrittenen Gebiets gebeten. Bei dem Alleingang der Inguschen wollte Rußland wegschauen, nun griffen russische Truppen ein, um Inguschetien zu sichern“, berichtet mir die Oma am Abend beim Mitternachtstee. Interessant auch, dass die Inguschen den Vorfall ganz anders darstellen: Ausgangspunkt für den Krieg war ein Mädchen, das bedrängt wurde. Geschichte war ja schon immer eine lose Blättersammlung mit unzählig farbigen Seiten. Der Zerfall der Sowjetunion brachte aber noch einen ganz anderen Konflikt an den Tag. „Nord- und Süd-Ossetien sind durch einen Bergkamm und eigenständige Kulturen getrennt. Süd-Ossetien fiel zu Georgien, wollte aber zurück zu Rußland. Visa beschränkten die Familien, die auf beiden Seiten verstreut lebten, und einen Besuch problematisch machten. Vielleicht war auch das ein Auslöser für einen Krieg gegen Georgien“, erfahre ich von Elina weiter. Dann schimpft sie über den Einfall der Wahabiten in das christliche Dagestan. Das war der Auslöser für den zweiten Tschetschenienkrieg. „Ossetien gehört zu Rußland. Wir sehen doch was in Mittelasien, wie Armenien, passiert ist. Tschetschenien strebt nach Unabhängigkeit; uns geht es gut, bei uns hat jeder ein Stück Brot.“ Wladikawkas. Montag, den 27. Mai 2002. „Einen so blauen und frischen Morgen hatte ich noch nie erlebt! Die Sonne blickte noch kaum über die grünen Wipfel, und die Vereinigung ihrer ersten warmen Strahlen mit der vergehenden kühlen Nacht versetzte alle Gefühle in den Zustand einer süßen Erschlaffung. 99 100 Ehrenmal | Wladikawkas 101 Kinder, UNICEF | Wladikawkas Wie neugierig betrachtete ich jeden Tautropfen, der auf den breiten Weinblättern bebte und Millionen regenbogenfarbiger Strahlen in die Welt schickte! Wie gierig versuchte mein Blick, die neblige Ferne zu durchdringen! Dort wurde unser Weg immer enger, die Klippen ragten immer blauer und gefahrvoller und schienen endlich zu einer undurchdringlichen Wand zu verschmelzen. Schweigsam ritten wir dahin.“28 Wir legen mit einem Faden ein Bild. Das hellblaue Wollknäuel geht weiter. Ich besuche ein Integrationszentrum für Flüchtlingskinder. In einem der mit Platten verbauten Außenbezirke hocke ich ohne Socken in einem Kreis auf dem Boden. „Zweimal in der Woche bringen wir 28 Kinder mit einem Bus aus den Zeltlagern nach Wladikawkas. Psychologen versuchen spielerisch ihre Kriegserlebnisse zu verarbeiten. Nach zwei Monaten wechselt die Gruppe, die Kinder haben meist ihre Eltern verloren und leben in den traurigsten Bedingungen in Inguschetien“, murmelt mir Natascha zu, die das Projekt koordiniert. Das Wollknäuel ist wieder da, jetzt versuchen wir uns eine Geschichte zu den einzelnen Bildern auszudenken. „Über 8.000 Kinder leben in Flüchtlingslagern in Inguschetien. UNICEF finanziert das Projekt bis Ende des Jahres, danach müssen wir weiter sehen.“ Das zweite Spiel ist aktionsgeladener, jeder stellt eine beliebige Figur dar. Als ich mir aus Versehen am Kopf kratze, haben das die Kinder längst aufgegriffen, drehen sich, kichern oder klatschen in die Hände. Dann machen wir uns gegenseitig Komplimente. Eine dieser seltenen Tugenden unserer Zeit kommt an. Wir loben uns gegenseitig, und all die 28 Lermontov, S. 175 102 Nettigkeiten rufen ein Lächeln in den Gesichtern hervor. Die Kinder sind aufgeweckt, die Pädagogen liebevoll. Vergessen werde ich wohl nie das Gespräch im Spielzimmer vor dem Mittagessen. Wieder einmal sind die Stühle viel zu klein. Ich bin umzingelt von buntem Plastik. Gerade noch hat eine Ärztin mit den Kindern über Sauberkeit und das zu lange Fernsehgucken gesprochen. Übrig geblieben sind die 50-jährige Russin im weißen Kittel, ein zwölf-jähriger tschetschenischer Junge und ein Kriegsdienstverweigerer aus Deutschland. Aadm trägt eine weiße Tjubetejka29 und sinnt über die Frage nach, die die Ärtzin vorhin gestellt hatte: „Was darf man alles im Fernsehen schauen?“. Klar, Gewaltfilme dürfen die Kleinen nicht sehen, da waren wir uns noch vor zehn Minuten mit allen Kindern einig. Aadm beschäftigt aber ein ganz anderes Problem: „Im Fernsehen stellen sie Tschetschenen immer nur schlecht da. Alle denken, dass wir Terroristen sind.“ Und da sitzen wir nun und wissen auch nicht weiter. Die Weißbekittelte versucht zu überzeugen, dass es ja auch Wahabiten unter den Tschetschenen gibt; ich stimme für den Frieden; mir ist es einfach nicht möglich die Gedanken und Gefühle zu beschreiben, die mir bei dieser Diskussion durch den Kopf gingen. Diese Runde, dieser Junge mit seinen kompromißlosen Fragen gehört zu den tiefgreifendsten Erlebnissen meiner Studienreise. Auf der Fahrt mit dem Bus zum Mittagessen unterhalte ich mich weiter mit Aadm. Er hat zwei jüngere und eine ältere Schwester. Sein Vater wurde von russischen Soldaten vor seinen Augen 29 Moslemische Kappe, die nur von Männern getragen wird. umgebracht. Die Mutter kann seit der Flucht keine Nacht ruhig schlafen. Aadm will eine gute Welt mit einer friedlichen Zukunft. „Aber wie lange wird das noch dauern? Dieser Krieg kann doch noch Jahre so weiter gehen.“ Die Menschen werden ihre Erlebnisse vom Krieg in die Erinnerung mitnehmen. Es ist eine Perversität der Mächtigen. Eldat, ein Zwölf-jähriger erzählt mir von der Situation in den Flüchtlingcamps: „Wir wohnen zu sechst mit noch einer Familie in einem Zelt in einer Zeltstadt in Aki Yut. Die Wände wackeln. Trinkwasser gibt es aus großen Kanistern. Gas und Strom gibt es selten. Nachts rascheln die Kakalaken. Ich will zurück in mein altes Dorf in Tschetschenien, doch es ist Krieg“, sagt er traurig. Mir wird mulmig, wir sind mit den Kindern im Zoo, ich höre ein Knattern in der Luft. Zwei Kampfhelikopter in voller Montur fliegen über unsere Köpfe hinweg. Gott sei Dank, drücken sich die Kinder gerade die Nasen am Affengehege platt, ich werde den Anblick wohl nie vergessen, die beiden Helikopter waren auf den Weg nach Tschetschenien. Beim Mittagessen mampfen die Kinder die Tische leer. Nach Hause wollen sie nicht so schnell. Aus Sicherheitsgründen werde ich sie im Bus nicht begleiten können. Zum Abschied hebt Aadm den Zeigfinger: „Аллах один, Аллах един. - Allah ist einer, Allah ist einzig“, winkt er mir zu. Gedicht eines 13 Jahre alten Jungen aus einem Flüchtlingscamp in Inguschetien Минам – нет! Припав к земле, Побелевшими губами Плачет мать Над убитым сыном. Седые головы склонив, Вытирают слезы мужчины, Боль невыносимо сердце жжет. Как же материнскому Горю помочь? Пришла беда в ее дом, Не смогла она сына от мин уберечь. Маленькая девочка К ней подбежала, Ручонками слезы ей вытирая. Двух братьев своих Ей отдать обещала, Материнскому горю По-детски она помогла. Давайте, ребята, Чтоб не было бед, Юнисефу экзамен сдадим Мы на «пять»! Все вместе скажем «нет!» Мы минной войне. Пусть мамы и дети 103 Не плачут во сне. Амаев Магомед – 13 лет Май 2002, палаточный городок «Сацита». Keine Minen! Abgeworfen zur Erde, Mit erblaßten Lippen Weint die Mutter Über ihren toten Sohn. Mit geneigten grauen Köpfen Trocknen sich die Männer die Tränen, Ein unerträglicher Schmerz brennt im Herzen. Wie kann man dem Kummer der Mutter helfen? Das Unheil kam zu ihrem Haus, Sie konnte ihren Sohn nicht vor den Minen bewahren. Ein kleines Mädchen Flüchtete zu ihr, Mit den Händen wischte sie ihr die Tränen hinfort Zwei ihrer Söhne Versprach sie ihr zu geben, Den Kummer der Mutter In einer kindlichen Weise half sie. Los, Leute, Auf dass es kein Unheil mehr gibt, Für UNICEF werden wir das Examen mit einer Eins bestehen! Alle zusammen sagen wir “Nein!” 104 Zum dem Krieg der Minen. Mögen die Mütter und Kinder Nicht weinen, wenn sie schlafen. Amaev Magomed – 13 Jahre Mai 2002, Zeltlager “Sazita”. Als ich mich am Nachmittag mit der Leiterin des Djetskij Fonds treffe, kann ich mir nur schwer konzentrieren. Die Organisation vermittelt Waisenkinder an neue Familien, hilft bei der Finanzierung von Operationen und organisiert humanitäre Hilfe. Als sie mir Fotos von angeschossenen Kindern in Krankenhäusern mit blutverschmierten Verbänden zeigt, muss ich an die frische Luft. Ich werde zu einer Ausstellung im Kulturministerium eingeladen: „Мир на земле – Frieden auf der Erde”, “Конец войне! – Ende des Krieges!”, “Мы дети мира! – Wir sind die Kinder des Friedens!”, “Нам нужен мир – Wir brauchen Frieden”, “Мы все равно! – Wir sind alle gleich!”, “Нет терроризму! – Kein Terrorismus!”, “Мир и любовь! – Frieden und Liebe” haben da Schulkinder aus den Flüchtlingslagern mit Tusche auf das Papier gebannt. Sie haben die Botschaft längst verstanden. Die Bilder des Malwettbewerbs wollen die Veranstalter in die Duma30 bringen. Auf einer Zeichnung schaukelt ein Mädchen auf einem Gewehr in einem verdorrten Wald, auf einer anderen zieht ein Mann mit einem Kind im Arm durch eine kalte Wirklichkeit. Die Nacht ist sternenklar. „Schauen Sie nur die Tscherkessen an, wenn die sich auf einer ihrer Hochzeiten oder Beerdigungen an ihren Busa toll und voll trinken, gibt’s immer eine Messerstecherei.“31 Bei den Osseten ist es wohl nicht so. Wir feiern aber auch nur einen Geburtstag. Das Glanzpapier ist längst der Konfektschachtel gewichen. Spielen Nardi, ein kaukasisches Brettspiel. Drei Männer heben Trinksprüche. Zusammen stehen sich auf und stoßen auf Gott, die Gäste und die Frauen an. Die Oma hat schon letzte Woche Bier aus wildem Hopfen gemacht. Im Gegensatz zu dem Feldwebel in Lermontovs Buch bleiben wir nüchtern. Anders wäre es mir heute nicht mehr zu Mute. „Über dem gezackten Dächerhorizont ging voll und rot der Mond auf wie der Widerschein eines Brandes; ruhig schienen die Sterne am dunkelblauen Firmament, und ich mußte lachen, als ich daran dachte, dass es einstmals überkluge Leute gegeben hat, die der Ansicht waren, die himmlischen Gestirne nähmen Anteil an unsern kleinlichen Streitigkeiten, um ein paar Stückchen Erde oder um irgendwelche erdachten Rechte! ... Doch wie? Diese Lampen, ihrer Ansicht nach nur zu dem Zweck angezündet, ihren Kämpfen und Siegen Licht zu geben, brennen immer noch mit dem vorigen Glanz, die Leidenschaften und Hoffnungen jener Leute jedoch sind 30 „Gedanke, Rat“ - bezeichnet das Russische Parlament. 31 Lermontov, S. 13 längst mit ihren Trägern erloschen wie ein Feuerlein, das am Waldrande von einem sorglosen Wanderer angesteckt wurde. Und dennoch, wieviel Willenskraft verlieh ihnen die Überzeugung, dass der ganze Himmel samt seinen unzöhligen Bewohnern mit wenn auch stummer, so doch unwandelbarer Teilnahme auf sie herabschaue! ...“32 Wladikawkas. Dienstag, den 28. Mai 2002. „In den schlichten Herzen lebt das Gefühl für Schönheit und Majestät der Natur viel stärker, ja hundertmal lebendiger, als in uns, den begeisterten Erzählern in Worten und auf dem Papier.“33 Der Geruch von Schwefel liegt in der Luft. Wir sind auf den Weg zu einer versteckten Quelle in der Nähe zur georgischen Grenze. Vor uns ein Schwerlaster mit Kies. Die Steine spielen lustig unter den Rädern. Der Staub ist undurchdringlich. Neben einem Abhang liegen die Reste einer gewaltigen Eislawine. Die Brücke hat es im Winter zerfetzt. Das Weiß hat sich bis in den Frühjahr auf den Anhöhen gehalten. Eine kleine Fähre aus einem Metalltrog schaukelt über ein Seil von der einen Seite zur anderen Seite der Kluft. Der Wind ist frisch. Bergbau hat die Hochhäuser ins Gebirge gebracht. Hier wohnen die Familien, wenn die Kumpel in der Zeche Buntmetalle abbauen. Ein Arbeiter hastet an der rot-weißen Absperrung vorbei. Seine orange 32 33 Lermontov, S. 201 Lermontov, S. 34 105 Schutzweste flattert, den weißen Plastikhelm hält er lieber mit angezogenem Arm fest. Tunnel und Straßen wurden von deutschen Kriegsgefangenen gebaut. Ein georgischer Reisebus fegt auf ein Betonplateau neben dem Bauhäuschen zu. Motorschaden. Sein Heck qualmt. Fiagdon und Saramag haben wir hinter uns gelassen. Eins mit den Mooswiesen der Bergen schlängeln wir durch die Landschaft. Über einen Pfad finden wir eine Siedlung aus drei klapprigen Häusern. Wir sagen Hallo. Elinas Cousins wohnen hier autark. Bei Minusgeraden kommen sie mit den Kühen und Eingewecktem aus. Eine Satelitenschüssel für den Fernsehempfang baumelt auf dem Dach der Scheune. Ein verschlafener Hahn kräht. Wir rollen ganz langsam den Berghang hinauf. Hinter einer Schneise liegt die Burg Toborscha. Hier hat früher die Familie gewohnt. Übrig geblieben ist der Turm, die Häuser ruhen in Ruinen. Elinas Oma hat hier zuletzt gelebt. Als kleine Kinder sind Elina und ihre Schwester mit den Pferden hinaufgestiegen, im Winter gab es kein Durchkommen. Die Steinklötze haben sich wacker gehalten. Damals haben sie auf dem Dach gespielt. Die Holzbalken waren auch schon zu jener Zeit mit einem Fell aus Gras zugedeckt. Die Wind war sicher nicht minder schneidig. Bei eisiger Kälte wurde das Vieh in den Keller gebracht, um das Haus zu wärmen. Neben dem Torbogen gibt es einen alten Dreschplatz. Der Wachturm späht von einem Steinvorsprung auf die Berge. Je höher der Ausguck, um so angesehener war die Familie. Elina und Frank wollen die Burganlage rekonstruieren, um Freunde und Touristen im Sommer ins Gebirge einzuladen. Ich streife durch ein Meer aus Enzian. Ein Frosch hüpft, der Tau wirbelt. Die Festung liegt auf einer Anhöhe, der Blick vom Wall ist wunderschön: Auf der einen Seite erstreckt sich ein breites, von einigen Schluchten 106 durchzogenes Gelände, das von einem Wald begrenzt wird, der sich bis zum Gebirge hinzieht; hier und da steigt Rauch von Dörfern auf, hier und da weiden Herden; auf der anderen Seite rieselt ein kleiner Bach, der von dichtem Gebüsch eingefaßt ist, das die ganzen steinigen Anhöhen bedeckt, die sich in der Ferne mit der Hauptgebirgskette des Kaukasus vereinigen. Mutter Erde greift in den Himmel und trägt uns auf ihren Fingerkuppen. Heiter brennt das satte Gelb auf dem Schnee, dass einem unwillkürlich der Gedanke kommt, hier sollte man für immer bleiben; hinter einem dunkelblauen Berg, den nur das geübte Auge von einer Wetterwolke unterscheiden kann, erhebt sich unmerklich die Sonne. Die Berge sind voller Geschichten. Eine erzählt mir Elina: „Mein Großvater wurde über 90 Jahre alt. Trotz seines schon hohen Alters brauchte er keine Brille, und konnte er sehr gut sehen. Alle wunderten sich, nur mir verriet er das Geheimnis. Jeden Tag sollte ich frische Blätter von einem dicken Kraut pflücken, das vor dem Tor zwischen den Steinen wächst. Dann schlief ich für einige Minuten, und als ich wieder kam, lief eine weiße Flüssigkeit aus seinen Augen. Er hatte sich die Blätter unter die Augenlieder geschoben, die sie vom Dreck reinigten. Erst kürzlich habe ich in einem Lexikon nachgeschlagen, die Heilpflanze heißt “Молодила - ewig Jung“ und wächst nur hier im Kaukasus. Wir begannen den Abstieg, rechts ragte die Felswand, links dagegen gähnte eine so tiefe Schlucht, dass ein ganzes Ossetendorf, das auf ihrem Grunde lag, nur wie ein kleines Schwalbennest aussah. Auf einem Ausläufer einer Bergzunge wacht Kosta Ketagurov. Einen dicken Wollmantel hat er sich über die steinerne Schulter geworfen. Eine Brücke, die zwei Hänge miteinander verbindet, trägt seine Worte: Весь мир – мой крам, любовь – моя святыня, Вселенная – отечество мое. («Я не пророк») Die ganze Welt – mein Gebiet, die Liebe – mein Heiligtum, Das Weltall – mein Vaterland. („Ich bin kein Prophet“) Die Felswände sind wie Blätterteig. Schieferplatten schneiden senkrecht durch die Luft und liegen zerplatzt in Waagerechten auf dem Boden. Bis zur Quelle Haschite Schuar ist es nicht mehr weit. Eine Hürde gilt es noch zu nehmen – von der Brücke über den Fluss ist nur noch eine Ahnung übrig. Wir halten. „O dieses Asien! Auf nichts kann man sich verlassen – weder auf seine Menschen noch auf seine Flüsse.“34 Neben einem Engpass gibt es eine Senke. Ohne Vorwarnung lenkt Frank in die Stromschnellen. „Das ist ein Diesel, der säuft nicht ab. Martin, mach mal das Fenster zu.“ Ich schlucke. Das Wasser klatscht gegen die 34 Frontscheine. Der Jeep frisst sich sukzessiv den Flusslauf hinauf. Auf einmal knackt es unter der Karosserie. Ein Loch. Wir stecken fest. Vom Rauschen auf der anderen Seite der Glasscheibe ist nichts zu hören. Die nächste Welle nimmt uns mit. Wir rutschen. Der Motor bleibt ruhig. Die Räder krallen sich fest. Mit einem Ruck reißt sich der Jeep mit dem Kopf aus dem Flussbett. Mein Herz klopft wieder. Der Rest ist einfach, über ein bißchen Geröll hoppeln wir bis zu kleinem Bachlauf. Dicke Wattewolken schlummern im blauen Himmel. Eine Eidechse huscht an meinen Sandalen vorbei. Hinter einer Steinplatte tauchen wir unsere Plastikflaschen in die schwefelsaure Quelle. Das Kohlendioxid sprudelt. Die reine Nass wurde durch den ganzen Berg gespült. Die Mineralien sind gut für Nieren, Leber und Magen. In Frankreich macht Diognes Creme aus dem Wasser aus dem Kaukasus. Das Wasser ist blumig. Der saure Geruch kommt aus der Bergöffnung. In Sichtweite schimmern die weißen Zelte des russischen Grenzposten. Auf der Heimfahrt blökt uns eine Herde Schafe an. Auf einem braunen Pferd reitet ein Cowboy mit seinem gerollten Lasso vorüber. In den Abendstunden mache ich mich zum UN-Gebäude in der Innenstadt auf. In einem weißen Hochhaus sitzen die internationalen Organisationen. Der Wachmann ist freundlich, ich spaziere durch die Kontrolle hindurch. Auf der dritten Etagen will ich zu Rudi Luchmann, dem Leiter der UNICEF-Mission im Kaukasus. Seit 1999 ein Mitarbeiter des UNHCR umgekommen ist, wird das Personal der Vereinten Nationen 24 Stunden bewacht. Es ist schon merkwürdig, als ich von Rudi erfahre, das Frank gar nicht bei der UN gearbeitet hat. Auch Nachfragen beim FSB Lermontov, S. 38 107 ergaben nichts weiteres. Nach dem Abendessen mit Rudi bin ich völlig verwirrt. Ende der Aufzeichnung 23 Uhr Wladikawkas. Mittwoch, den 29. Mai 2002. Der Hase, der Bär und der Igel haben sich gern. Die drei drolligen Gesellen erklären, warum Minen gefährlich sind. Freilich, die Dinger lieber erst gar nicht anfassen und den Eltern Bescheid sagen. Zweihundert Kinder schauen ihnen mit großen Augen zu. UNICEF hat das Stück beim Russischem Theater in Auftrag gegeben. Mit sechs Bussen hat ein Konvoi die Kinder aus den Flüchtlingslagern gebracht. Kunterbunt wimmeln die Kleinen durch die Gänge. Die Tapeten sind aus roten Samt. Es ist ein riesiges Spektakel. Ähnlich erging es mir am heutigen Morgen. Ein weiteres Mal wollte ich in dem Integrationszentrum etwas über Methoden bei der Arbeit mit Kindern lernen. Das Verhalten einer Lehrerin kam mir erst suspekt vor. Mit ernster Miene ließ sie uns Zeitungen zerreißen. Nun gut, viel Sinn sah ich in der Sache ja noch nicht. Dann sollten wir die Schnipsel zu einem großen Berg in der Mitte des Raumes anhäufen. Da kam schon einiges zusammen, die junge Dame hatte wohl ihren ganzen Restbestand an Altpapier mitgebracht. Die Kinder wußten noch nicht so recht, was das werden sollte. In einem Kringel standen wir um den Haufen herum und hielten die Spannung. Bislang tat sich nichts. Der 108 Gesichtsausdruck der Pädagogin wurde nicht freundlicher. Das Kuriose passierte aber, als sie sich herunter beugt, eine riesige Handvoll der Papierfetzen nimmt, sie wild in die Luft wirft und uns auffordert unverzüglich mitzumachen. So viel Spaß hatte keiner von uns seit langem erlebt. Ausgelassen kugeln wir uns auf dem Boden und genießen den Regen aus Zellulose. Der Turm aus Bauklötzern, den wir noch vorher mühsam gemeinsam in die Höhe gestapelt haben, fliegt als erstes auseinander. Auf kolossalen Hüpfbällen jagen wir uns durch den Raum. Wonnig, gar vortrefflich ist die Atmosphäre. 109 Papierspiel | Wladikawkas Wartesaal | Wladikawkas 110 Hin und her gerissen bin ich dagegen beim Zeichenunterricht. Wir schließen die Augen und denken an etwas, was uns Angst macht. Danach muss die Knete herhalten. Ein Junge fragt, ob er auch einen Panzer machen darf. Eine Gänsehaut bekommen die Kinder, als die Lehrerin ihnen mit ihrer Plastilinfigur bei geschlossen Augen über die Hand fährt. Und so hocken Schlangen, Panzer, ein Igel und Flugzeuge auf dem Fensterbrett. Nur ein Mädchen hat eine Blume geformt. Sie guckt ganz traurig, aber sie hat eine Allergie gegen Blütenstaub. Manchmal funkeln solche Sternstunden wie ein Licht in dunkler Nacht. die Weide und auf einmal machte es Bum. Die Kuh und mein rechtes Bein hat es weggerissen. Ich bin froh, dass ich noch lebe.“ Der Krieg ist erbarmungslos. Die Unschuldigen holt er sich als Erste. Aber wem sag ich das. Zurück zu den Zuschauerplätzen. Die Brüstung ist gepolstert. Wir lehnen uns weit hinüber und wollen den Hasen, Igel und Bären tanzen sehen. Zu spät. Schon ausgetauscht. Jetzt suchen der Löwe und das Nilpferd einen besten Freund. Und na klar, wie sollte es anders sein, die Geschichte geht gut aus. Sie finden sich selbst, schließlich waren sie ja auch die ganze Zeit in der Nähe und haben miteinander rumgehangen. So saßen wir lange. Die Sonne verbarg sich bereits hinter den kalten Gipfeln, und ein weißlicher Nebel kroch über die Täler.“35 „10.000 Minenopfer hat der Krieg in Tschetschenien bereits geholt. Kinder und Erwachsene mit verstümmelten Gliedmaßen sind Realität. 100 Kindern konnten wir bis jetzt helfen“, schildert Aida, eine Mitarbeiterin von UNICEF in einem Krankenhaus für Minenopfer. „Viel Arbeit liegt in der gerade psychologischen Nachbetreuung. Dieser plötzliche Einschnitt in ein Leben ist nur schwer zu bewältigen.“ Und so linse ich die Prothesenwerkstatt. Jede Stütze muss individuell angefertigt werden. Ein 72-jähriger Bauer im Wartesaal erzählt mir seine Geschichte: „Es war ein ganz normaler Morgen. Ich ging zu den Kühen auf Wieder einmal regnet es in Strömen. Meine Studienreise geht zu Ende. Am Abend sprinte ich durch Pfützen nach meinem Zug Richtung Moskau. „In meinen Gedanken nahm ich Abschied von den Bergen: es tat mir leid, sie verlassen zu müssen ... Zugfahrt. Donnerstag, den 30. Mai 2002. Die Berge sind verschwunden. Im Zug ist der Alltag eingekehrt. Taube legen stumm Zeitungen und Bücher ins Coupe. Für sie ist es oft die einzige Möglichkeit Geld zu verdienen. „Moroschenoje, Moroschenoje, Piwo, Mineral!“36, gellt an den Bahnhöfen. Jede Station hält ihre einheimischen Produkte bereit. In Rostov gibt es Trockenfisch. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Ich kaufe eine große Tüte Zedernüsse. „Bald kommt der goldene Honigbahnsteig“, meint meine Mitreisende im Abteil. Sie fährt die 35 Lermontov, S. 57 ff. Eis, Eis, Bier, Mineralwasser – «Мороженое, мороженое, пиво, минерал!». 36 111 Strecke zweimal in der Woche. Die kennt sich aus, denke ich mir, für den Honigkauf organisieren wir uns aber einen Experten. Der kommt vom Coupe nebenan und hat selber eine Königin mit ihrem Reich bei sich im Garten hinter dem Schuppen. Schon wieder eine Schwangere! Eine Studentengruppe aus Georgien adoptiert mich, als ich ihrer Kommilitonin die untere Liege anbiete. Im Juni kommt das Kind auf die Welt. Ein Mädchen soll es werden. Die sechs sind auf den Weg zu einem Seminar der Adventisten in der Nähe von Moskau. Bereits den letzten Abend haben wir uns köstlich amüsiert. Diese Bande ist göttlich, zwischen Gurken, Tomaten, die nicht tomatiger sein könnten, rundem Brot, fetten Käse und gelbe Limonen lerne ich Georgien kennen. „Wai, wai, wai“ kann man praktisch in allen Lebenslagen sagen. Auf dem Flur, ein junger Russe in Flecktarnhose. Wodka soll ich mit ihm trinken, das KaukasusVerdienstkreuz baumelt an seiner Uniform. Ich habe genug. „Der Mond war noch nicht aufgegangen, und nur zwei Sternchen schimmerten am dunkelblauen Himmel wie zwei rettende Leuchtturmfeuer.“37 Moskau. Freitag, den 31. Mai 2002. Ankunft Moskau gegen 6 Uhr morgens. Alles so wie immer. Oder doch nicht? 37 Lermontov, S. 87 112 Moskau stinkt. Ich will zurück. Habe mehr Fragen, als Antworten mitgebracht. Ende. 113 Berge | Wladikawkas Nachwort Wenn einer eine Reise macht, muss er an viel gedacht haben. Erste Hindernisse genommen, lässt man sich auf das Unbekannte ein. Das Leben ist bunt. Reisen bildet. Die Begegnung mit Menschen ist ein einmaliger Schatz. Ihre Lösungen sind längst ein Teil von mir. Die Welt verzaubert seine Eroberer und belegt sie mit dem Bann der Verwunderung. Forschen, enträtseln hin und her, nach einem Monat Studienreise fällt es mir schwer, die Dinge in ihrer Gesamtheit erfassen zu wollen. Bilder haben die Theorie ersetzt, Worte eine Ahnung von der Wirklichkeit geschaffen. So ist doch jede Antwort der Beginn einer neuen Frage. Danke für den Versuch, Der Autor Moskau, 2002 114 115 Anhang 1. Rezept, Osterspeisen Hier das Rezept für den Osterkuchen, das ich aus einem russischem Backbuch in der Bibliothek der lutherischen Gemeinde abschrieb: Die Russen servieren den Kulitsch, indem sie erst die Haube abschneiden und auf die Mitte eines großen Kuchentellers legen. Dann wird der übrige Kuchen der Länge nach halbiert und schließlich quer in dicke Scheiben geschnitten. Diese Scheiben werden um die Haube herum angeordnet. Eine traditionelle Beilage ist Pascha. Кулич | Kulitsch (runder Hefekuchen) Пасха | Pascha (Pyramide aus Quark) Zutaten: Hefe, 250 g Zucker, ¼ lauwarme Milch, 700 bis 900 g Mehl, 250 g Butter, 10 Eigelb, Eier, Puderzucker, Früchte, Rosinen, Mandeln, Kardamom, 2 TL Salz Zutaten: 2 Pfund Quark, 2 bis 3 Eier, ½ Pfund Butter, 200 g Zucker, Rosinen, Vanille Die Hefe mit dem Zucker verkrümeln und mit wenig Wasser zu einer Paste verrühren. Die Milch und die Hälfte des gesiebten Mehls zufügen und zu einem geschmeidigem Teig schlagen. 30 Minuten zugedeckt an einem warmem Ort gehen lassen, bis sich die Masse gut verdoppelt hat. Die zerlassene Butter, Eier, Zucker, kandierte Früchte, Rosinen, abgezogene, gehackte Mandeln, Kardamoms, Salz und das restliche Mehl zufügen und so lange durcharbeiten, bis sich der Teig gut von den Rändern löst. Zugedeckt 30 Minuten gehen lassen. Einen Springformrand (ca. 23cm) in eine gleich große Springform stecken, damit der Rand höher wird. Ausfetten und den Teig hineinfüllen. Ein Band aus mehrfach gefalteter Alufolie um den Rand legen, damit er insgesamt etwa 15 cm hoch wird. Abermals zugedeckt gehen lassen. Bei 175°C ca. 75 Minuten backen. Abkühlen, mit weißem oder rosa Zuckerguß begießen, bunten Zuckerperlen und Mandeln verzieren. 116 Den Quark über nacht in einem Handtuch aufhängen, damit die Molke abtropft und der Quark trocken wird. Den Quark mit den oben genannten Zutaten versehen. Alles durch ein engmaschiges Sieb drücken oder mit einem Mixer gut verrühren. Das Ganze unter Rühren einmal aufkochen. Danach in eine offene Form geben, damit der noch vorhandene Saft abfließen kann und alles fester wird. Traditionell wird Пасха pyramidenartig aufgetürmt und mit dem kyrillischen Buchstaben XB, den Anfangsbuchstaben des Auferstehungsgrußes, und einem Kreuz verziert. 2. Zitate über Ossetien Осетин я знаю хорошо. Это народ гордый, умеет постоять за Родину в любой обстановке и с большим достоинством. И. Сталин Die Osseten kenne ich gut. Das ist ein stolzes Volk, das sich für seine Heimat in jeder beliebigen Lage und mit großer Würde einsetzt. I. Stalin Чем в рабстве жить нам и позор терпеть, уж лучше всем со славой умереть! Из послания нартов к Богу Schon besser, dass wir alle mit Ehre sterben, als dass wir in Sklaverei sterben! Aus einem Schreiben mit einem Hundeschlitten zu Gott 117 3. Auszüge von Kostai Hetagurov Die Werke des Schriftsteller der Nord-Osseten haben mich auf meiner Reise begeistert, da sie doch ein Bild von der Kultur eines Volkes wiedergeben. Einige Übersetzungen sollen hier gegeben sein. Ich habe nie mit meinen Wörtern gehandelt, niemals nicht für eine meiner Zeile nie von jemanden Geld bekommen. Und ich schreibe nicht dafür, zu schreiben und veröffentlichen, weil das viele tun. Nein! Nie Lobeeren dafür das Schreiben das brauche ich nicht, nie die Vorteile über es. Ich schreibe /das/ deswegen, weil ich schon nicht in der Stärke vorkomme (etwas) in meinem erkrankten Herzen festzuhalten. А стихи я пишу только в такое время, когда потребность высказаться всецело охватывает все мое существо. Над многими стихотворениями я рыдал, как нервная институтка, когда я их писал. Коста Хетагуров, 1859-1906 Kosta Hetagurov, 1859-1906 К. Л. Хетагуров (28, с. 165-166) Я никогда своим словом не торговал, никогда ни за одну свою строку ни от кого не получал денег. И пишу я не для того, чтобы писать и печататься, потому что и многие это делают. Нет! Ни лавры такого писания мне не нужны, ни выгоды от него. Я пишу то, что я уже не в силах бываю сдерживать в своем изболевшем сердце... К. Хетагуров (122, с. 144) 118 Und Gedichte schreibe ich nur in /jener/der Zeit, wann sich ein Bedürfnis äußert ganz und gar alles meines Wesens umfaßt. Über vielen Gedichten schluchzte ich, wie eine Pensionatschülerin, als ich sie schrieb. 4. Auszüge aus Gedichten von Kosta Hetagurov Завещание Vermächtnis Прости, если отзвук рыданья Услышишь ты в песне моей: Чье сердце не знает страданья, Тот пусть и поет веселей. Entschuldige, wenn der Widerhall des Schluchzens Du in meinem Liedern hörst: Wessen Herz nicht Leid kennt, Der möge ein fröhlicher Poet sein./Der moege lustiger singen/ Но если б народу родному Мне долг оплатить удалось, Тогда б я запел по-другому, Запел бы без боли, без слез. Aber wenn der Heimat des Volkes Mir die Pflicht der Verwegenheit bezahlt, Dann fange ich für jemand anderen an zu singen, Singe ohne Schmerzen, ohne Tränen 119 Горе Kummer Горы родимые, плачьте безумно. Лучше мне видеть вас черной золой. Судьи народные, падая шумно, Пусть вас схоронит обвал под собой. Heimatgebirge, weine irrsinnig. Besser ich sehe Sie als schwarze Asche. Richter des Volkes, stürzend laut, Mögt Ihr unter einem Erdrutsch begraben werden. Пусть хоть один из вас тяжко застонет, Горе народное, плача, поймет. Пусть хоть один в этом горе потонет, В жгучем страданье слезинку прольет. Цепью железной нам тело сковали, Мертвым покоя в земле не дают. Край наш поруган, и горы отняли. Всех нас позорят и розгами бьют. Мы разбрелись, покидая отчизну,Скот разгоняет так бешеный зверь. Где же ты, вождь наш? Для радостной жизни Нас собери своим словом теперь. Враг наш ликующий в бездну нас гонит, Славы желая, бесславно мы мрем. Родина-мать и рыдает и стонет... Вождь наш, спеши к нам – мы к смерти идем. (Перевод с осетинского) (Übersetzung aus dem Ossetischen) 120 Möge wenigstens einer von Euch schwer aufstöhnen, Kummer volksverbindener, weinend, verstehen. Mögen nur einer von Euch in Kummer sinken, Im brennenden Leid eine Träne vergießen. Eine Eisenkette fesselte unseren Körper, Man gibt den Toten in der Erde keine Ruhe. Es wurde unser Gebiet geschmäht, und das Gebirge genommen. Allen von uns stellen sie an den Pranger und schlagen uns mit der Gerte. / Wir waren auseinandergelaufen, das Vaterland verlassend,Das Vieh auseinandertreiben wie ein tollwütiges Tier. Wo bist du schon, unser Führer? Für ein glückliches Leben Nimm uns mit deinen Wörtern heute. Feind treibt uns jubelnd zum Abgrund , Den Ruhm wünschend, ruhmlos sterben wir. Mutter-Heimat und schluchst und stöhnst... Unser Führer, eile zu uns – wir gehen zu Tode. Как честь страны, свободу края Ценить умеет осетин. Твои страданья – капля в море. («Когда тебя, мой друг...») («Плачущая скала») Wie die Ehre des Landes, Freiheit der Regionen Schätzen kann der Ossete. (“Weinende Felsen”) Wenn Dich der Kummer ergreift, Erinnerst Du Dich nur an das Volk,Umwelt seines Mißgeschickes Dein Leiden – ein Tropfen im Meer. (”Wenn dir, mein Freund..”) Лучше умереть народом Свободным, чем кровавым потом Рабами деспоту служить. («Плачущая скала») Besser stirbt das Volk Frei, als mit blutigem Schweiß Als Sklaven dem Despoten dienen. (“Weinende Felsen”) Весь мир – мой край, любовь – моя святыня, Вселенная – отечество мое. («Я не пророк») Die ganze Welt – mein Gebiet, die Liebe – mein Heiligtum, Das Weltall – mein Vaterland. (“Ich bin kein Prophet”) Когда тебя постигнет горе, Ты вспомни лишь народ,Среди его невзгод Как долга беспросветная ночь!.. Как ещё далеко до восхода!.. Но... и днём не могу я помочь Безысходному горю народа... («Зигзаги мысли в бессонницу») Wie lange undurchdringliche Nacht!.. Wie lange noch bis zum Sonnenaufgang!.. Aber... und am Tage kann ich nicht helfen Dem ausweglosem Kummer des Volkes... (“Zickzack der Gedanken in der Schlaflosigkeit”) Оставьте! Слепому кумиру Как вы, я не стану служить... Laß es sein! Blindes Abgott Wie Sie, habe ich nicht die Gestalt zu dienen... Мне вашего счастья не нужно,В нем счастья народного нет... 121 Dich, heimatliche Aul und unser armes Volk. (“Glaube nicht, dass ich den Kummer unseres Volkes vergessen habe...”) В блестящих хоромах мне душно, Меня ослепляет их свет... Их строило рабство веками, Сгорают в них стоны сирот, В них вина мешают со слезами... Нет, будьте вы счастливы сами, Где так обездолен народ! («Друзьям-приятелям...») Ich brauche Ihr Glück nicht,In ihnen liegt das Glück des Volkes nicht... In den gläzenden Gemächern ist es mir stickig, Mich blendet ihr Licht... Sie bauten Sklaven jahrhundertelang, Verbrennen in ihren Stöhnen der Waisenkinder, In ihr vermischt sich man die Weine mit Tränen... Nein, werdet Ihr selbst glücklich, Wo so ein Volk ist elend! (“Freunden-Kameraden”) Люблю я целый мир, люблю людей, бесспорно, Люблю беспомощных, обиженных, сирот, Но больше всех люблю, чего скрывать позорно? – Тебя, родной аул и бедный наш народ. («Не верь, что я забыл родные наши горы...») Ich liebe die ganze Welt, die Menschen, zweifellos, Ich liebe die Hilflosen, Beleidigten, Waisen, Aber mehr als alle liebe ich, die sich schwächlich verstecken? – 122 Как знать,– и этот стих несчастного поэта Не есть ли только бред, не есть ли только стон И страстный, дикий вопль прощального привета Всему, что он любил, чему молился он?... О, если это так, то все мои страданья Теперь, о родина, признаньем искуплю: Все помыслы мои и все мои желанья Одну имели цель – снискать любовь твою. («Перед операцией») Wie weiß man,– und dieses Gedichte eines unglücklichen Poeten Gibt es nicht nur Fieberwahn, gibt es nicht nur Stöhnen Und leidenschaftliches, wildes Schreien eines abschiednehmenden Grußes Alles, was er liebte, betete er an?... Oh, wenn diese so, so alle meine Leiden Heute, oh Heimat ich werde durch Anerkennung sühnen: Alle meine Gedanken und alle meine Wünsche Hatten ein Ziel – Deine Liebe erwerben. (“Vor der Operation”) Я не боюсь разлуки и изгнанья, Предсмертных мук, темницы и цепей... Везде, для всех я песнь свою слагаю, Везде разврат открыто я корю Ich habe keine Angst vor der Trennung und Vertreibung, Letzte Qual, des Kerkers und der Ketten... Überall, für alle dichte ich mir Lieder, Überall werfe ich offen Unzucht vor Und mit eigenem Leibe begegne ich der Gewalt, Und tapfer spreche ich mit allen über die Wahrheit. (“Ich bin kein Prophet...”) И грудью грудь насилия встречаю, И смело всем о правде говорю. («Я не пророк...») An welche ich mich gewöhnte, wie ein Glück, zu schätzen, Zurückgeben für einen Schritt, der für das Volk Konnte ich irgendwann zur Freiheit anlegen. (“Ich fürchte den Tod nicht...“) Я смерти не боюсь,– холодный мрак могилы Давно меня манит безвестностью своей, Но жизнью дорожу, пока хоть капля силы Отыщется во мне для родины моей... Я счастия не знал, но я готов свободу, К которой я привык, как счастьем, дорожить, Отдать за шаг один, который бы народу Я мог когда-нибудь к свободе проложить. («Я смерти не боюсь...») Ich fürchte den Tod nicht,– kalte Finsternis des Grabes Lange hat mich dein Unbekanntes angelockt, Aber das Leben schätze ich, wenigsten einen Tropfen Stärke gibt es vorläufig in mir für mein Volk... Ich kannte das Glück nicht, aber ich bin bereit für die Freiheit, 123 5. Gedicht Michael Lermontov Кавказ, Михаил Лермонтов Хотя я судьбой на заре моих дней, О южные горы, отторгнут от вас, Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз; Как сладкую песню отчизны моей, Люблю я Кавказ. В младенческих летах я мать потерял, Но мнилось, что в розовый вечера час Та степь повторяла мне памятный глас. За это люблю я вершины тех скал, Люблю я Кавказ. Я счастлив был с вами, ущелия гор; Пять лет пронеслось: весь тоскую по вас. Там видел я пару божественных глаз; И сердце лепечет, воспомня тот взор: Люблю я Кавказ!... 124 Kaukasus, Michael Lermontov Obwohl ich des Schicksals im Morgenrot meiner Tage, Oh südliche Berge, abgetrennt von euch, Um sich ewig an sie zu erinnern, muß man nur einmal dort gewesen sein; Wie ein süßes Lied meinem Vaterland, Ich liebe den Kaukasus. In den Kinderjahren habe ich meine Mutter verloren, Aber es dünkte mir, dass mir in der rosafarbenen Stunde des Abends; Jene Steppe eine erinnerte Stimme wiederholte. Dafür liebe ich die Gipfel jener Felsen, Ich liebe den Kaukasus. Ich war glücklich mit euch, Schluchten der Berge; Fünf Jahre sind verflogen: ich sehne mich ganz nach euch. Dort sah ich ein Paar der göttlichen Augen; Und das Herz murmelt, sich an jenen Blick erinnernd: Ich liebe den Kaukasus. 125 Literaturnachweis Das Gedicht von Georgij Ivanov und das Gedicht «Der Sternendeuter» von Boris Narcissov sind aus dem Sammelbuch Russische Lyrik vom Reclam Verlag entnommen: Kay Borowsky und Ludolf Müller: Russische Lyrik, Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Reclam, Seite 488 f. und Seite 552 f. Lew N. Tolstoj: Hadschi Murat, Eine Erzählung aus dem Lan der Tschetschenen, Insel Verlag, Seite 38 Michail Lermontov: Ein Held unserer Zeit, Reclam Казбек Сергеевич Челехсаты: Осетия у осетины, Ассоциация творческой и научной интеллигенции «ИР», Владикавказ Коста Хетагуров: Стихотворения и поэмы, Сост. А. А. Дзантиев, Ассоциация творческой и научной интеллигенции «ИР», Владикавказ, 1994 – 232 с. (Осетинская лира) 126 Weitere Informationen und Fotos sind im Internet abrufbar unter: http://mwaehlisch.narod.ru/zis/ ! Fragen und Hinweise jederzeit per Email an [email protected] ! Martin Wählisch Moldaustraße 47, 10319 Berlin, Tel. 030-512389 127