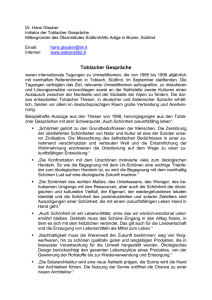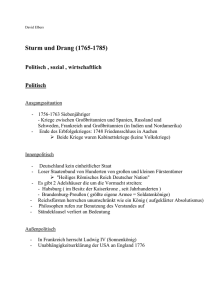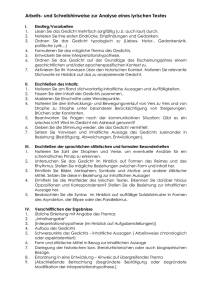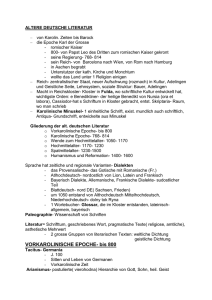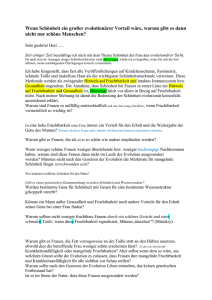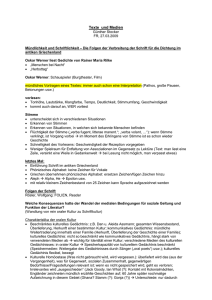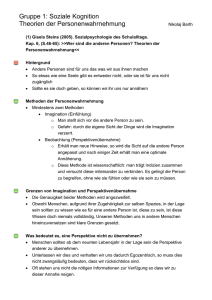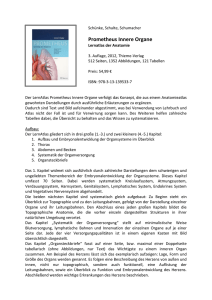Vorlesung - UK-Online
Werbung
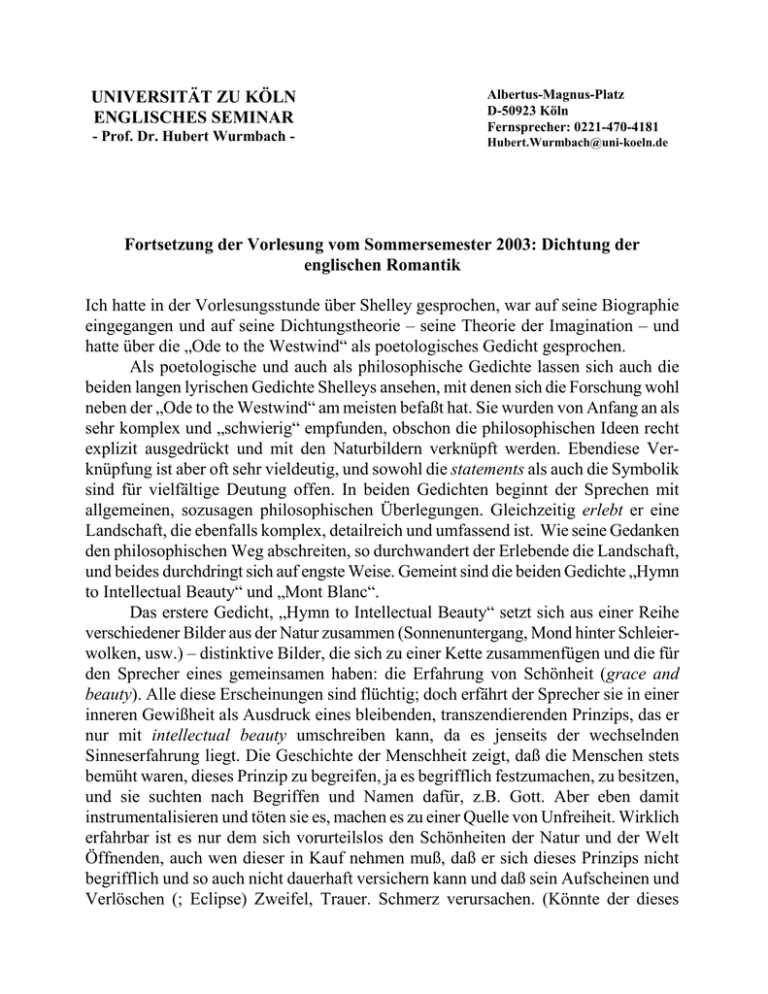
UNIVERSITÄT ZU KÖLN ENGLISCHES SEMINAR - Prof. Dr. Hubert Wurmbach - Albertus-Magnus-Platz D-50923 Köln Fernsprecher: 0221-470-4181 [email protected] Fortsetzung der Vorlesung vom Sommersemester 2003: Dichtung der englischen Romantik Ich hatte in der Vorlesungsstunde über Shelley gesprochen, war auf seine Biographie eingegangen und auf seine Dichtungstheorie – seine Theorie der Imagination – und hatte über die „Ode to the Westwind“ als poetologisches Gedicht gesprochen. Als poetologische und auch als philosophische Gedichte lassen sich auch die beiden langen lyrischen Gedichte Shelleys ansehen, mit denen sich die Forschung wohl neben der „Ode to the Westwind“ am meisten befaßt hat. Sie wurden von Anfang an als sehr komplex und „schwierig“ empfunden, obschon die philosophischen Ideen recht explizit ausgedrückt und mit den Naturbildern verknüpft werden. Ebendiese Verknüpfung ist aber oft sehr vieldeutig, und sowohl die statements als auch die Symbolik sind für vielfältige Deutung offen. In beiden Gedichten beginnt der Sprechen mit allgemeinen, sozusagen philosophischen Überlegungen. Gleichzeitig erlebt er eine Landschaft, die ebenfalls komplex, detailreich und umfassend ist. Wie seine Gedanken den philosophischen Weg abschreiten, so durchwandert der Erlebende die Landschaft, und beides durchdringt sich auf engste Weise. Gemeint sind die beiden Gedichte „Hymn to Intellectual Beauty“ und „Mont Blanc“. Das erstere Gedicht, „Hymn to Intellectual Beauty“ setzt sich aus einer Reihe verschiedener Bilder aus der Natur zusammen (Sonnenuntergang, Mond hinter Schleierwolken, usw.) – distinktive Bilder, die sich zu einer Kette zusammenfügen und die für den Sprecher eines gemeinsamen haben: die Erfahrung von Schönheit (grace and beauty). Alle diese Erscheinungen sind flüchtig; doch erfährt der Sprecher sie in einer inneren Gewißheit als Ausdruck eines bleibenden, transzendierenden Prinzips, das er nur mit intellectual beauty umschreiben kann, da es jenseits der wechselnden Sinneserfahrung liegt. Die Geschichte der Menschheit zeigt, daß die Menschen stets bemüht waren, dieses Prinzip zu begreifen, ja es begrifflich festzumachen, zu besitzen, und sie suchten nach Begriffen und Namen dafür, z.B. Gott. Aber eben damit instrumentalisieren und töten sie es, machen es zu einer Quelle von Unfreiheit. Wirklich erfahrbar ist es nur dem sich vorurteilslos den Schönheiten der Natur und der Welt Öffnenden, auch wen dieser in Kauf nehmen muß, daß er sich dieses Prinzips nicht begrifflich und so auch nicht dauerhaft versichern kann und daß sein Aufscheinen und Verlöschen (; Eclipse) Zweifel, Trauer. Schmerz verursachen. (Könnte der dieses 2 Prinzip dauerhaft an sich binden, so wäre er unsterblich.) Der Sprecher, der sich erst am Ende des Gedichts explizit einführt, läßt trotzdem keinen Zweifel daran, daß sein Leben der Suche nach dieser „intellectual beauty“ und dem Dienst vor ihr gewidmet ist. Hier wird auch deutlich, daß diese intellectual beauty sich in der Schönheit der Natur zeigt, aber auch in den Gedanken, Reflexionen der Menschen, vor allem denen, die zur Befreiung des Menschen beitragen, und daß sie besonders durch den Dichter vermittelt wird. Hier berührt Shelley die These der „defence of poetry“, daß alle wahren Philosophen Befreier der Menschheit und gleichzeitig Dichter sind. Shelley berührt sich hier mit einem Kerngedanken der Dekonstruktion, daß nämlich in dem Moment, in dem die offene Erfahrung des Menschen, die sich im ständigen Fluß der Signifikation widerspiegelt, zentriert, systematisiert und damit begrifflich fixiert wird, Macht ausgeübt wird, die der Anfang von der Versklavung des Menschen ist; Shelley hält aber gleichzeitig an der eher hermeneutischen Idee fest, daß transzendente Wahrheit den Menschen prinzipiell zugänglich, erfahrbar und vermittelbar ist, auch wenn diese nie ganz ausschöpfbar ist, d.h. wenn der Mensch nie wirklich ins Zentrum dieser Wahrheit gelangt. Auch in „Mont Blanc“, einem der komplexesten, dichtesten und suggestivsten Gedichte Shelleys, geht es um die Frage einer Transzendenz hinter den sichtbaren Erscheinungen. Shelley verbindet diese Frage hier mit einem eindrucksvollen, da vom Leser lebhaft nachempfindbaren oder nachschaffbaren Bild der grandiosen Landschaft der Arve, die sich vom Mont Blanc herunter, aus seinen Gletschern, durch felsige Waldlandschaft bis ins Tal von Chamonix ergießt. (Shelley hatte Chamonix kurz vorher besucht und das Tal der Arve bis zum Rand des unzugänglichen Gletschers durchwandert). Der Fluß bleibt die zentrale Metapher des Gedichts, aus der sich alle anderen Bilder speisen (bzw. alle anderen speisen die zentrale Metapher des Flusses). Auch wenn diese Bilder in z.T. modernistisch anmutender Technik eher assoziativ nebeneinander stehen, da die logischen und syntaktischen Verbindungen teilweise nur locker sind, ergibt sich doch eine in etwa nachvollziehbare Folge bzw. ein in seinem Grundmuster durchschaubares Gewebe von Gedanken. Diese beginnen mit dem Problem menschlicher Erkenntnis: Das Denken des einzelnen Menschen erscheint wie ein Nebenfluß, der sich mit vielen anderen zum Gesamtstrom des menschlichen Denkens vereint. Das Denken des einzelnen Geistes wird aber auch konstituiert vom „Fluß“ (Durchfluß) des „Universums der Dinge“, das Shelley nicht weiter definiert. Man hat dies so erklärt, daß das Denken das „Universum der Dinge“ im empiristischen Sinne abbildet, aber auch so, daß dieses „universe“ nicht als Summe der Dinge zu verstehen ist, sondern als Transzendenz, aus der sich das Denken, das die Dinge der Welt umfaßt und deutet, als „geheimer Quelle“ speist. Seine Äußerung, sein „Klang“, wie Shelley im Bild des Flusses sagt, ist daher auch nur halb das Eigentum des einzelnen Menschen, es vermischt mit dem Schall vieler anderer Bäche, Wasserfälle, ja des Windes, der Wälder usw. Wir könnten also sagen: Das 3 denken des Einzelnen, auch des Sprechers – „my separate mind“ – speist sich aus der wahrnehmbaren Welt, vernetzt sich mit dem Denken der Menschheit und bezieht seine letzten Impulse aus einer transzendenten Quelle. Platonistisches und empiristisches Gedankengut scheinen sich hier zu verbinden. Die bereits angelegte Analogie wird im zweiten Teil fortgesetzt. Die Schlucht der Arve, „thou many coloured, many voiced rail“ wird zum zentralen Analogieträger. Schon die beiden einführenden Epitheta (many coloured, many voiced) fassen die Aussage der ersten Strophe im Bild zusammen, das zum Gegenstand der folgenden Zeilen wird: Die Schlucht der Arve wird konstituiert von den komplexen, vielfältigen, ja kontrastreichen Elementen der sichtbaren Landschaft: dem urtümlichen Pinienwald, dem ätherischen Regenbogen über dem Wasserfall, den vielfältig tönenden Höhlen: „Thou art pervaded with that ceaseless motion, /Thou art the path of that unresting sound –/dizzy Ravine!“ (Z. 32f.). Die Vielgestaltigkeit der Schlucht macht sie zu einer Analogie des menschlichen Denkens; aber sie hat auch ein Zentrum, eben den Fluß, der sie kontinuierlich durchzieht und der sich aus den Gletschern des Gipfels, dem ungesehenen und unzugänglichen „Gipfel der Macht“ speist (Z. 16 und weiter Teil III/IV). Damit eben wird diese Schlucht zur Analogie des Geistes, in ihr sieht der Sprecher wie in einer Epiphanie („ in a trance sublime“, Z. 35) die Relation seines eigenen separate mind zum universalen Geist. Er wird in Bewegung gesetzt von der ständigen Interaktion mit dem universe of things (Z. 39f.), aber er sucht in diesem auch wie in den Schatten von Platos Höhlengleichnis den „Geist“ dieser Dinge. Schon hier wird dies auch in besonderer Weise auf die Dichtung bezogen (also daß sie „wählt“, also die Natur und die uns bekannte Erfahrungswelt, vermittelt, uns ein Bild von ihr bietet, das sie aber auch nach deren Bedeutung, Wesen, „Geist“ sucht. ) In Teil III wendet sich der Sprecher nun dem mit den Sinnen nicht wahrnehmbaren aber doch wißbaren Teil der Landschaft, der Gipfelregion zu. In seiner Imagination erschafft er sozusagen ein Bild dieser erhabenen Landschaft (vgl. auch vorletzte Zeile), wobei er nicht weiß, ob dieses ein „Traum“ oder eine Offenbarung ist. In diesem Bild erscheint die Eislandschaft des Gipfels als Inbegriff des den Menschen Übersteigenden, Transzendierenden. Ihm werden Attribute verliehen wie unearthly, unfathomable, desert peopled by storms alone, region of eagle and wolf, eternal. Sie ist also das dem Geist des Menschen eigentlich Unfaßbare (“the spirit fails”), das für den Menschen Ganz Andere. Diese ewige, eintönige, kalte, unzugängliche Region speist, mal so konstituiert, die sichtbare lebendige, vielfältige Welt der Sinne, bedroht sie aber auch ständig, da sie nach ihren eigenen transzendenten, unergründlichen Gesetzen handelt, was die Natur und den Menschen nähren (der Strom im Tal) oder zerstören (der Abgang der Lawine oder Überschwemmung) kann. Dies ist Gegenstand von Teil IV, wo der Gipfel zum Bild des law of necessity wird. Als solcher inspiziert der Gipfel oder was er versinnbildlicht Glauben, der Versöhnung mit der Natur führt (ähnlich wie bei Wordsworth), der aber auch Zweifel (angesichts seiner „unmenschlichen“ Seiten), also 4 Zweifel an seiner Güte nähren kann, vor allem aber Zweifel erweckt, an den tradierten Glaubenssystemen (da sie, wie man aus dem Denken Shelleys ergänzen könnte, diese gewaltige, die Sinne und das Denken des Menschen übersteigende Wirklichkeit in begriffliche Systeme pressen, sie ihr damit das eigentlich Transzendente, das Übersteigende nehmen und sie zur Quelle von Macht und Ausbeutung machen), die der Sprecher auch hier als „large codes of fraud and woe“ bezeichnet. Wieder also der Gedanke, daß die Menschen in ihrer Metaphysik das unzugängliche Andere der Transzendenz in begriffliche Systeme bannen möchten, es sich damit verfügbar und auch zum Instrument von Herrschaft zu machen versuchen, die wiederum Leid (woe) auslöst. (Bei diesen letzten Ausführungen habe ich mich auf Teil III zurückbezogen). Dieser aw-inspiring, sublime aspect wird in Teil IV in der chaotischen Gewalt und Schönheit der Urlandschaft der Arve sichtbar, in Teil V schließlich im Bild des unzugänglichen Gipfels selbst, auf dem sich in völliger Stille – was wohl heißt, außerhalb des Wahrnehmungsbereichs der menschlichen Sinne – die Formung der Eisund Schneelandschaft vollzieht (Z. 130-33), die als transzendente Machtquelle die wahrnehmbare Landschaft bestimmt. Sie ist so „Sitz“, „Wohnung“ jener Macht, die das Gesetz sowohl des sichtbaren Universums als auch des Denkens des Menschen ist. (Z. 139-141), wie schon Wordsworth in „Tintern Abbey“ sagte. Am Schluß schreibt der Sprecher sein Bild vom Mont Blanc durchaus seiner Imagination, also seiner Vorstellungskraft zu, stellt aber die rhetorische Frage, was den wäre, wenn die „Stille“ (Transzendenz), welche die Imagination ausfüllt, wirklich nur „Leere“ wäre und nicht Sitz oder Manifestation eines universalen und realen Prinzips. Shelley stellt also hier zum einen schon den in der „defence of poetry“ zentralen Anspruch einer Wahrheitserkenntnis für die dichterische Imagination. Sie erahnt die Wahrheiten, die der Mensch eben nicht in philosophische Systeme pressen kann, und kleidet sie in Bilder. Sie geht damit sozusagen hinter die verfestigten begrifflichen Systeme der Philosophie und Theologie, die den Menschen versklaven, und trägt daher dazu bei, den Menschen zu befreien. Shelley weigert sich daher auch selbst, begrifflich/diskursive Definitionen oder Formulierungen dessen zu liefern, was er als das das Denken Transzendierende erfährt. Mit den drei verbleibenden Texten aus dem Handout wenden wir uns „reineren“, aber doch die Linie der behandelten Gedichte fortsetzenden Naturgedichten zu. Von ihnen ist „The Cloud“ vielleicht das eigenwilligste. In ihr erscheint die Wolke selbst als Sprecher (Z. 1-4). Shelley verläßt also hier die Form der Ode. Auch die Wolke wie die Arve-Landschaft zunächst einmal ein sichtbares Phänomen, oder besser gesagt, ein Begriff für eine Vielzahl von Phänomenen, aber auch gleichzeitig ein transzendentes, unvergängliches Prinzip. Die Spannung zwischen diesen beiden Polen prägt das ganze Gedicht. In einem teils kapriziösen, mutwilligen, teils gewalttätig-finsteren, teils auch empfindsam, sprich zartem Ton besingt oder feiert die Wolke sozusagen ihre eigene ständige Verwandlung und die Vielzahl ihrer wohltätigen oder bedrohlichen 5 Einwirkungen auf die Erde. Im Monolog der Wolke endet ihre Reihe von Transformationen schließlich im Nichts, im leeren blauen Sommerhimmel (letzte Strophe); aber mit diebischer Freude weist sie darauf hin, daß dies eben nur ein scheinbares Nichts ist, da die Kräfte ihrer Neuformierung schon im Gang sind. Im ständigen Werden und Vergehen, im scheinbaren Nihil, erweist sie sich als unvergängliche und letztlich auch als unverwechselbare Essenz. Die Wolke verkörpert gleichzeitig die verschiedenen typischen Seiten der Natur im Naturbild des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Sie ist sowohl das Idyllisch schlicht Zarte, das Harmonisch-Schöne und das Vielgestaltig-Pittoreske und schließlich auch das Düstere, Bedrohliche, Schreckerregende, Erhabene. Sie ist also letztlich ein pars pro toto für die Natur. Auch diese, so vielfältig sie dem Menschen erfahrbar ist, entzieht sich dem begrifflichen Zugriff, ist aber dennoch stets sie selbst, obschon dieses selbst für den Menschen als ein Nichts erscheint. In „To a Skylark“ variiert Shelley das Thema vieler romantischer Gedichte auf die Lerche oder auf andere Vögel (wie etwa den Kuckuck): Die unsichtbare Stimme des Vogels als Verkörperung eines das konkrete Lebewesen übersteigenden, also letztlich wiederum transzendenten Prinzips. Die Stimme der Lerche, die scheinbar schwerelos in den Himmel aufsteigt, dort den Blicken entschwindet, mit ihrer Stimme aber den ganzen Himmelsraum ausfüllt, wird zum Symbol, ähnlich wie bei Wordsworth zur Verkörperung reiner Freude, rein hier nun deswegen, weil unkonditioniert ganz dem gegenwärtigen Augenblick hingegeben, daher nicht wie beim Vor- und zurückschauenden Menschen von Leid und Sorge getrübt (XVI-XVIII). (Wordsworth sprach im 6. Buch des Prelude von der imaginativen Erfahrung der Natur als einer Freude, die in sich selbst ruht oder sich selbst genug ist, „not looking for spoils or trophys“). In diesem Ausdruck reiner Freude vereinigt sicht die Lerche mit vielen anderen Naturphänomenen, die ihr in einer Kette von Vergleichen an die Seite gestellt werden und somit sichtbar machen, daß auch die Lerche – ähnlich wie vorher die Wolke – als pars pro toto für die Natur steht, die eine erfahrbare vielgestaltige und eine transzendente, „fühlbare“ Seite hat und als deren innerstes Wesen eine ganz in sich selbst ruhende sich ganz in der Gegenwart erfüllende Freude ist. In dieser Analogie wird schließlich auch der Mensch miteinbezogen, allerdings nur in zwei Erscheinungsformen, die offensichtlich der Natur nahestehen: das Mädchen, von der Liebe singend (IX), und der Dichter (VIII). Die Beziehung zu ihm wird zum Schluß des Gedichtes noch einmal betont (XX/XXI). Sie liegt im Prinzip der ekstatischen Freude, die die Quelle der Dichtung zu sein scheint (genauso wie in Coleridges „Ode on Dejection“), aber auch im Gefühl des Einsseins mit der Natur, das in dieser Freude involviert zu sein scheint („harmonious madness“, XXI – vgl. „Kublai Khan“), schließlich auch im Moment des „Aufstiegs“ in den „Himmel“, einen transzendenten Bereich, der hier noch einmal genannt wird. („Scorner of the Ground“), und das ganze Gedicht prägt. Das Gedicht zeigt in seiner Ausgangsfrage, seinem Kreisen um das Wesen der Natur und dem Schlußbezug auf den 6 Dichter einen klaren Aufbau, gleichzeitig aber auch einen hymnischen, begeisterten Ton, der einen emotionalen Einklang zwischen Sprecher und Vogel suggeriert. Der erwähnte Ton der begeisterten Empathie wird auch durch das Metron und die Strophenform unterstützt, welche in jeder Strophe die Verbindung von Aufwärtsbewegung und dem Sich-Ergießen in die Breite des Himmelsraums suggeriert (4 x 3hebiger Trochäus, dann 6-hebiger Jambus). – In „The Cloud“ dagegen verwendet Shelley eine lange, variable Strophe, in der sechsmal längere und kürzere Zeile miteinander wechseln (4 vs. 3 oder 2 Hebungen); die Langzeilen können auch als Zeilenpaar gelesen werden (Binnenreim). Es entsteht so ein melodisches, spielerisches, wellenförmiges Auf und Ab, gleichzeitig ein Sich-Ausdehnen und Kontrahieren; der Wechsel zwischen jambischen und (selteneren) daktylischen Versfüßen gestaltet diesen rhythmischen Wechsel wiederum spielerisch, kapriziös, und er gestattet mehrere „Tonarten“, wie sie oben schon erwähnt wurden. Versmaß, Strophenform und Rhythmus sind also hier dem Selbstbild und der Erscheinung der Wolke durchaus angepaßt. In dem Zusammenhang der poetologischen Gedichte gehört auch das frühere Gedicht Alastor, or The Spirit of Solitude von 1816, das ebenfalls eine kontroverse Interpretationsgeschichte hat. Hier erzählt ein Dichter als Rahmensprecher die Geschichte eines Jünglings, der sich früh zum Dichter berufen fühlt, die Welt verläßt für ein Leben des Studiums und der Naturerfahrung. Seine Suche kulminiert in einer ekstatischen Traumbegegnung mit einem verschleierten Mädchen, das als Inbegriff all seiner Ambitionen – der vollen Erfahrung der transzendenten Wahrheit – erkennbar ist. Das Ende des Traums, in dem ihm das Mädchen verschwindet, treibt den Jüngling dann auf die Wanderschaft durch immer menschenfernere Landschaften, mit denen er immer weniger kommunizieren kann, und schließlich in den Tod, der allerdings in einer idyllischen Szenerie stattfindet. Der Rahmensprecher sagt von sich, daß er von der gleichen Ambition getrieben wird; doch obschon die Natur auch „ihm ihr innerstes Heiligtum nicht offenbart hat“ (Z. 37f.), bleibt er mit ihr im Einklang, wartet geduldig auf ihre unverhofften und augenblickshaften Offenbarungen und tut diese dann den Menschen kund, – wie eine Äolsharfe –, welche die vom Wind auf ihr erzeugte Musik selbst nicht versteht. Der Sehnsucht des Dichteres nach letzter Wahrheit steht also die Unmöglichkeit gegenüber, diese hier „unverschleiert“ zu sehen, ein Bild, das auch in der deutschen Romantik immer wieder vorkommt. Trotzdem erkennt der Rahmensprecher die Notwendigkeit oder Verpflichtung an, die Suche, die eben doch zu seinem innersten Wesen gehört, nicht aufzugeben, gleichzeitig ist er sich aber ebenso der Verpflichtung bewußt, mit den Menschen zu kommunizieren, sich nicht aus der Welt zu entfernen, also zum Wirken in der Welt. Ob die von Shelley intendierte Aussage in diesem Gedicht in der auszuhaltenden Spannung zwischen diesen beiden Seiten des Dichters zu finden ist oder aber in einer Ablehnung der weltfernen idealistischen Suche oder aber eben umgekehrt in der Ablehnung des Wordsworthschen Realitätsprinzips, 7 dem sich der Rahmensprecher verpflichtet fühlt, zugunsten der Suche des Protagonisten, ist in der Geschichte der Rezeption umstritten geblieben. Auch hier (oder schon hier) zeigt sich Shelleys Begabung zum Entwurf großartiger, suggestiver, sinnlicher und trotzdem symbolischer Landschaften und Szenen, wobei man ihm allerdings auch ein Schwelgen in diesen Bildern auf Kosten gedanklicher Klarheit vorgeworfen hat. Bisher haben wir uns mit Gedichten beschäftigt, die Shelley selbst als seine esoteric poems bezeichnete. Ihnen stellte er selbst seine exoteric poems gegenüber, die eine unmittelbare agitatorische Gesellschaftskritik enthalten. Die beiden Seiten seiner Dichtung sind allerdings trotz wechselseitiger Akzentuierung nicht trennbar, wie wir es schon sahen. Das erste Gedicht dieser Gruppe, schon 1813 entstanden, ist auch das längste und trotz vieler üppiger Details und starker Formulierungen letztlich wohl auch das unoriginellste – „Queen Meb“. Shelley nimmt in ihm die traditionelle Form der Traumvision (vgl. Dante und Chaucer) auf, und er verarbeitet oder vereint die wesentlichen Grundzüge der aufklärerischen Gesellschaftskritik, des radikal-utopischen Gedankenguts der Jahrhundertwende und seine Idee vom inspirierten prophetischen Dichter. Die einheitliche, radikale, aber auch plakative Form, in die dieses gefaßt wurde, machte das Gedicht zu einer Art Bibel der größten Reformbewegung des 19. Jahrhunderts, des Chartism; es wurde von Karl Marx als ein Dokument proto-sozialistischer Theorie angesehen, und es stand noch bei den Fabians (Vorläufer der Labour-Party) hoch im Kurs, fiel dann aber im 20. Jahrhundert eine Zeitlang fast der Vergessenheit anheim. Das lange Gedicht (ca. 2000 Verse, etwa 50-55 Druckseiten) erzählt in neun Büchern die Reise der Seele eines jungen – also noch bildungsfähigen – Mädchens, das von der Feenkönigin Queen Meb durch den Sternenhimmel geführt wird und dort im Blick auf die Erde einen Abschauungsunterricht auf die Mißstände der menschlichen Gesellschaft erhält; es wird ihr dann aber auch ein Blick in die utopisch-paradiesische Zukunft eröffnet, zu der Vernunft und spirit of necessity die menschliche Geschichte führen werden, ja müssen. In den einzelnen Büchern bietet Shelley durch die der Seele dargebotenen „Luftaufnahmen“ der Erde und die dazugehörigen Erläuterungen eine radikale Kritik je eines bestimmten Aspekts der menschlichen Gesellschaft. Er beginnt mit der Fürstenkritik, ganz im Stil der kontinentaleuropäischen Tradition des 18. Jahrhunderts. Bilder des Luxus und der Trägheit kontrastieren mit Bildern der Armut und Ausbeutung. Beherrschte und Herrschende werden ihrer menschlichen Natur entfremdet, zugleich aber auch blind für ebendiese Entfremdung (Buch 3). Im 4. Buch vor allem beschäftigt sich Shelley mit den Ideologien, die zur Stabilisierung der Herrschaftssysteme entworfen werden und die durch umfassende Konditionierung funktionieren. Das Kind übernimmt z.B. schon in seinen Spielen und Geschichten vom Heldentum die Vorstellung, daß „Blutvergießen Tugend ist“. Daher der Schluß, der sich schon in 8 Blakes Gedicht „London“ findet: „Die Ketten, mit denen der Mensch gefesselt wird, werden bereits vor seiner Geburt geschmiedet.“ Besonders intensiv befaßt sich Shelley wie auch Blake mit der Kritik von Religion und Kirchen. Er folgt d’Holbach und Condorcet (Baron d’Holbach, On the System of Nature or the Physical and Moral Laws of the World, 1770, eine erste systematische Theorie des Atheismus und Materialismus; Condorcet, Sketch for a Historical Picture of the Progression of the Human Mind, 1795, auf d’Holbach aufbauend eine Skizze der vermeintlichen gesetzmäßigen Entwicklung der Vernunft in der Geschichte zu einem freiheitlichen Endzustand hin). Die Religion wächst mit dem Heranwachsen des Menschengeschlechts, wird aber dann, bevor die Vernunft erwacht, mit Gewalt und List befestigt. Sie ist also ein Produkt der Unreife des Menschen und der Perfidie der Mächtigen. Besonders kraß ist Shelleys Kritik an der altund neutestamentarischen Religion: Ein machtbesessener und bösartiger Gott – der allerdings wiederum eine Projektion des Menschen, also nicht wirklich existent ist, – erschafft die Gebote, die der Mensch nicht halten kann, und er antwortet auf diese von ihm gewußte Unfähigkeit des Menschen mit der Erlösungsgeschichte, die auf subtile Weise – durch eine Mischung aus Dankbarkeit und Schuld – die Versklavung festigt (auch in diesem Punkt erinnert Shelley an Blake, besonders dessen Heurism-Mythos). Vorher, im 5. Buch, war auch die Kommerzialisierung der frühindustren Gesellschaft der Kritik anheim gefallen: Freundlichkeit, oder Mitmenschlichkeit und Bedürfnis als Grundlage des Handels werden durch den kommerziellen Wert der Güter ersetzt, „true and generous love“ durch Wettbewerb und materiellen Erfolg. „Wealth of nations“, wie Shelley in klarer Anspielung auf Adam Smith sagt, bildet das politische Ziel statt „harmony and happiness of man“. Dieser zentrale Stellenwert des Geldes ermöglicht die Käuflichkeit des Menschen, wie er sich etwa in der geflissentlichen Bereitschaft, den Herrschenden zu dienen, zeigt, besonders kraß aber in der Prostitution oder dem Kauf geistlicher Ämter. Statt einer Stätte ethischen Handelns wird die Welt zu einem „allgemeinen öffentlichen Markt“. Das Werk endet, wie schon angedeutet, mit einem visionären Ausblick auf einen paradiesischen Endzustand, im Bild einer pastoralen Landschaft, in der die leidvolle Vergangenheit in Form mächtiger Ruinen aufgehoben ist im doppelten Sinne des Wortes. In der utopischen Tradition, in die sich Shelley hier stellt, wurde dies nicht als Wunschdenken empfunden; vielmehr herrschte die Überzeugung – auf die ich ja im Einleitungsteil der Vorlesung schon eingegangen bin –, daß das Gesetz der Geschichte (the spirit of necessity), das mit dem Gesetz der Vernunft zusammenfällt, eine solche Teleologie in sich birgt, und daß sich die Vorstufen dieser „Heilsgeschichte“ dem „wissenschaftlichen Betrachter“ in der Geschichte des Abendlands und der Neuen Welt bereits offenbaren. Der vernünftige und tugendhafte Mensch stellt sich in den Dienst dieses Fortschritts, auch wenn dieser unaufhaltsam ist, also auch ohne ihn statthaben würde. Er gewinnt eben darauf seine Würde, „Tugend“ und Selbstverwirklichung; denn anstelle eines Opfers, über das die Geschichte so oder so (das gilt auch für Könige) 9 hinwegschreitet, würde er zum mitschaffenden Subjekt dieser Entwicklung. Die vorherrschende Versform von „Queen Meb“ ist der Blankvers, allerdings nicht stichisch, sondern in ungleiche Strophen gegliedert. Bei den freudigen oder auch traurigen Gesängen der Fee, in denen sie ihrer Freude oder ihrer Enttäuschung bzw. Trauer Ausdruck verleiht und die teilweise die Form von Gesängen annehmen, verwendet Shelley aber auch unterschiedliche lyrische Versformen. Er nimmt damit in einfacher Form die Verstechnik des viel späteren Werks „Prometheus Unbound“ vorweg. Das Gedicht zeigt, darin sind sich alle Kritiker einig, viele typische Fehler eines dichterischen Frühwerks; es bietet aber das radikal-utopische Gedankengut der Zeit in einer eingängigen, bildmächtigen und geschlossenen Vision. Es spielte eben daher die schon erwähnte Rolle in den „progressiven“ Bewegungen des 19. Jahrhunderts, wurde zur „Bibel der Radikalen“ und wurde natürlich von der bürgerlichen Kritik aufs heftigste angegriffen; Entsetzen und Empörung mischten sich hier mit heftigsten Invektionen und Verrissen, bis es dann wie gesagt im 20. Jahrhundert stiller um das Werk wurde. „Queen Meb“ zur Seite tritt eine Reihe kürzerer, bewußt agitatorischer Gedichte vor allem der Jahre 1816-1819. Erwähnt werden sollen „A New National Anthem“, eine bissige Parodie auf die entstehenden Nationalhymnen, und „A Song to the Men of England“, eine künstlerisch vollkommenere Form der verbreiteten Lieder des working class radicalism (etwa der Luddites), das in einem mitreißendem Marschton bekannte Motive, etwa das von den Bienen und Drohnen, vereint mit geradezu vampiristischen Bildern der Ausbeutung, das aber auch einen pejorativ-sarkastischen Ton gegenüber denjenigen anschlägt, die sich lieber niedertreten lassen als sich zu erheben. Das bekannteste, längste und ambitionierteste dieser exoteric poems ist „The Mask of Anarchy“, das als Antwort auf die blutige Niederschlagung einer friedlichen Arbeiterkundgebung in St. Petersfield in Liverpool (damals bekannt als „“Peterloo“) 1819 entstand und das in der Cambridge Guide to English Literature als „perhaps greatest poem of political protest in the language“ bezeichnet wird. Shelley benutzt auch hier eine alte poetische Tradition, die Allegorie, als Ausdruck von Gesellschafts-, Ständeund Menschenkritik (vgl. Swift). In einem langen allegorischen Zug folgen die führenden Politiker und Bischöfe des Landes der an Dürers Gemälde vom apokalyptischen Reiter erinnernden Gestalt der Anarchie. Sie tragen Masken wie Mord, Herrschsucht, Gewalt, Heuchelei, Masken, die jedoch ebenso wie die zentrale Gestalt der Anarchie ihre wahre Natur offenbaren. (Diese zentrale Gestalt selbst allegorisiert den Gedanken, daß nicht der regierungslose Zustand, sondern die Gewaltherrschaft die eigentliche Anarchie ist, m.a.W. sie illustriert den anarchischen – gesetzlosen – Charakter der Gewaltherrschaft). Das Volk weicht wehrlos zurück, die Londoner Bürger öffnen die Tore und huldigen dem wilden Zug. Hier, im Zentrum des Gedichts aber, tritt dem Zug eine weibliche Gestalt entgegen, bleich und verzweifelt, die sich aber doch als „Hoffnung“ bezeichnet und aus der sich ein Phantom erhebt, das sich über 10 den Menschen ausbreitet und sie sozusagen erweckt und gleichzeitig den Tod der Anarchie bewirkt. Von hieraus schlägt das Gedicht um in eine Verheißung einer besseren, gerechteren Zukunft, die möglich ist, wenn Menschen dafür kämpfen, und insofern in den berühmten Aufruf, der in vielfacher Form in der politischen Agitation übernommen worden ist: Rise like lions after slumber In unvanquishable number Shake your chains to earth like dew Which in sleep had fallen on you – Ye are many – they are few. (151-155) Trotz dieser agitatorischen, zu Widerstand und Aktion aufrufenden Lieder stand Shelley physischer Gewalt als Mittel der Befreiung – ganz ähnlich wie Blake und der junge Wordsworth – ambivalent gegenüber. Das ergibt sich schon aus der Gestaltung des Wendepunkts in „The Mask of Anarchy“, der ja mehr eine geistige Wende als einen physischen Kampf ausdrückt. Dieses Problem tritt nun ins Zentrum der großen epischen Gedichte zwischen 1818 und 1821. Hellas (1821) repräsentiert die in der europäischen Romantik verbreitete Sympathie mit der griechischen Erhebung gegen das türkische Imperium, deren prägnanteste Erscheinung Byron ist, der sich in diesem Kampf selbst engagierte und darin 1824 starb. Die griechische Revolution wurde aber nicht nur in sich begrüßt, sondern als ein weiterer Schritt auf dem Wege der Befreiung der Menschheit nach dem Gesetz der Notwendigkeit empfunden, wie es eben skizziert wurde. Dementsprechend stellt Hellas eine Art Vision dar, in der dem türkischen Sultan Mahmud bewußt wird, daß sein waffenstarrendes Reich zum Untergang bestimmt ist. Den düster-melancholischen Reden des Sultans stehen die Freiheitschöre der Griechen und lyrische Lieder gegenüber, eine Orchestrierung, die in Prometheus Unbound zur Vollendung geführt wird. Als zweites dieser Epen erwähne ich The Revolt of Islam von 1818, auch unter dem Titel Laon and Cythna herausgegeben. Shelley nimmt hier die im späten 18. und im ganzen 19. Jahrhundert beliebte Form des Oriental kail auf. Auf eine etwas dramatisch anmutende und auch naiv erscheinende Weise verherrlicht der „Sänger“ dieses Epos den Opfertod der reinen Liebenden (Laon und Cythna), der nach dem Scheitern ihres eigentlichen Kampfes auf geheimnisvolle Weise dennoch den Zusammenbruch des Regimes des Tyrannen Othman herbeiführt. Von zentraler Bedeutung ist aber hier Shelleys größtes, komplexestes und kunstvollstes Epos Prometheus Unbound, das 1821 vollendet wurde. In ihm nimmt Shelley den Mythos von Prometheus auf, der nach seinem Ungehorsam – indem er den Menschen das Feuer brachte – von Zeus an einen Felsen im Kaukasus geschmiedet wird, wo ein Adler täglich von seiner nachwachsenden Leber frißt, bis er von Herakles befreit wird. Shelley gibt diesem Mythos seine ganz und gar eigene Interpretation. 11 Wie zu erwarten, beginnt auch Shelleys Epos mit einem haßerfüllten, rachsüchtigen Prometheus, der sich an seinen Fluch, den er einst bei seiner Ankettung Zeus entgegenschleuderte, zu erinnern versucht. Bezeichnenderweise hat er aber ebendiese Worte vergessen. Es gelingt ihm aber, das Phantom des Zeus zu erzeugen, das seine damaligen Worte wiederholt. In diesem Augenblick aber, als Prometheus seine eigenen Fluchworte hört, bereut Prometheus diesen Fluch und will ihn nicht wiederholen. Erde und Gestirne erschrecken, brechen in Klagegesänge aus, da sie glauben, Prometheus sei nun zermürbt und habe sich dem Tyrannen Zeus unterworfen. Daß dem aber nicht so ist, zeigt sich, als Prometheus sich weigert, Hermes das nur ihm bekannte Geheimnis mitzuteilen, von wem Zeug gestürzt werden wird. Zeus selbst hat also Prometheus’ Rücknahme des Fluchs als Unterwerfung verstanden und will diese durch die Preisgabe des Geheimnisses bekräftigt wissen. Aber eben dies verweigert Prometheus. Obschon er also der Gewalt entsagt, läßt er sich keinesfalls von der Herrschermacht instrumentalisieren, weder durch Versprechen auf Befreiung noch durch Androhung von Qual. Die schlimmste dieser Qualen, die Zeus ihm dann auch sendet, besteht bei Shelley nun darin, daß die Furien in bissigen Liedern und Kommentaren Prometheus vor Augen führen, welche Bosheit und welches Elend in der Menschenwelt herrschen. Wie sehr sie also die von ihm (Prometheus) verliehene Vernunft mißbrauchen. Der Kampf für Freiheit und Vervollkommnung, so soll ihm bedeutet werden, lohnt sich nicht. Dennoch gibt Prometheus – sozusagen wider besseres Wissen – seinen Widerstand und seine Hoffnung nicht auf. In dieser Beharrlichkeit in der scheinbaren Niederlage vereinigt er sich aber, wie schon aus „Queen Meb“ bekannt ist, mit dem Gang der Notwendigkeit, ja er setzt diesen Gang hier in diesem Moment geradezu frei. Denn durch seine Beharrung im passiven Widerstand wird im Fernen Osten seine ebenfalls gefangen gehaltene Geliebte, Asia, befreit. Zusammen mit ihrer Schwester Panthea kann sie als Verkörperung des Prinzips der Liebe im umfassenden Sinne und auch als Verkörperung der Imagination (der dichterischen Weisheit) verstanden werden. Die Reise der beiden vollzieht sich daher in einem Austausch in einer langen Reihe lyrischer Lieder, welche die Wiedergeburt Asias als zweite Aphrodite – deutlich an Botticellis berühmten Gemälde von der Geburt der Venus erinnernd – feiern und in der eine Vielzahl von Stimmen der Erde, der Luft und des Himmels zusammenklingen. Während dieser Reise, in diesen Liedern, erlebt Asia auch eine Verklärung mit deutlicher Analogie an die Tabor-Szene im Neuen Testament, und sie kommt zu einem Bewußtsein ihrer selbst, unnachahmlich schön in dem oft erwähnten Lied „My Love is an Enchanted Boat“ ausgedrückt (II, 5, Z. 73-110). Liebe und Imagination kommen also durch die Hoffnung des Prometheus zur Befreiung und zu ihrer vollen Entfaltung als transzendentales Prinzip, das in allen sichtbaren Objekten und Wesen zur Erscheinung kommt. Ihre Reise führt Asia und Panthea schließlich im 3. Akt zu Demogorgon, der – tief in der Erde hausend und formlos – das Prinzip der Notwendigkeit verkörpert und eben jetzt, sozusagen unter den genannten Bedingungen, mit ihnen aufbrechen kann, um 12 Zeus zu stürzen– in einer kurzen fast lakonischen Szene. Zeus erkennt also jetzt, wer ihn stürzt – letztlich er selbst: Denn das Prinzip der Geschichte, das ihn zur Herrschaft geführt hat, führt ihn auch wieder in die Welt des nicht Sichtbaren hinab. Dies führt im letzten und 4. Akt zu einer universalen Feier der Befreiung und Harmonie, die als ein Konzert vieler Stimmen und als kosmischer Tanz erscheint. Letzteren beginnen die Horen: die Linearität der Zeit wird in diesem paradiesischen Zustand aufgehoben: Die Stunden bewegen sich nicht in einer linearen Bewegung sondern eben jetzt in der Gleichbewegung des Tanzes. Alle Wesenheiten reihen sich ein, schließlich auch die spirits of the human mind, Wissenschaft, Kunst, Dichtung u.a. In den Mittelpunkt tritt dann die Hochzeit von Erde und Mond. In diesem Bildern schmilzt Shelley Erkenntnisse der Naturwissenschaft seiner Zeit und kosmologische Vorstellungen in der Renaissance zum Ausdruck seiner Idee zusammen: Erde und Mond stellen zwei kontrastierende Prinzipien dar: Die Erde dynamisch, gewaltig, hitzig, damit auch potentiell gefährlich, gewaltsam; der Mond ruhig, harmonisch, unschuldig, aber auch kalt und starr. Indem sie beginnen, sich gegenseitig zu bewundern und als schön zu erkennen, beginnen sie sich zu lieben und dann anzunähern, was zu einem Ausgleich ihrer Attribute und so zur Vollkommenheit und Glück führt, das aber hier eben nicht theoretisch sondern in einem einzigen dialogischen Liebeslied ausgedrückt wird. Prometheus Unbound kann als Epos, eher aber als lyrisches Drama bezeichnet werden. Es besteht aus einer Kette von Szenen, die sich durchaus gegenseitig bedingen, aber doch im wesentlichen das Gerüst für eine Vielzahl von Dialogen und vor allem für eine Vielzahl von Liedern liefern, in denen die „Mitspieler“ in diesem kosmischen Drama Gefühle wie Haß, Liebe, Klage, Freude ebenso wie ontologische Einsichten ausdrücken und in denen Shelley eine unglaubliche Fülle von Metren, strophischen Formen und Bildern verarbeitet. Prometheus Unbound ist ein komplexes Werk. Der Symbolgehalt der vielen Gestalten, die sowohl der antiken Mythologie als auch der Renaissancekosmologie entstammen, teilweise aber auch Shelleys eigener Phantasie, ist keineswegs immer ganz offensichtlich, die vielen Szenen und Bilder aus dem Reich der Natur enthüllen ihre Bedeutung ebenfalls nur dem Interpreten, der sie im Detail studiert und aufeinander bezieht, und der gedankliche Gehalt wird bis auf Ansätze nicht explizit, etwa in Form eines rationalen Dialogs, ausgedrückt, sondern eben in der Vielzahl von Liedern. Das Werk ist daher im Detail keineswegs einheitlich interpretiert worden und es bietet den Interpreten auch heute noch durchaus eine Reihe von Rätseln. Es muß also darauf hingewiesen werden, daß die Interpretation hier, in der kurzen Befassung, notwendigerweise vereinfacht wurde. Prometheus Unbound gehört nicht nur zu den letzten Werken Shelleys, es stellt auch wohl eine Art Summe seines Werkes dar. Mit ihm will ich daher auch die Ausführung über Shelley beschließen ohne noch zu einer längeren Schlußbemerkung anzusetzen, und mich dann John Keats zuwenden. 13 John Keats Eines der letzten Gedichte, das Shelley kurz vor seinem Tod schrieb, war die Elegie „Adonais“ auf den Tod seines Freundes John Keats. In ihr beklagt Shelley in pastoralen Bildern den Verlust des „Sängers“, der die Welt ärmer macht, führt Klage über die Unbill, die ihm widerfahren ist und die an seinem Tod mitschuldig ist, äußert aber auch die Überzeugung, daß er wie alle wahren Dichter letztlich bei den Menschen bleibt, also unvergänglich ist. John Keats wurde 1795 als Sohn eines Londoner Stallmeister (englisch: manager of a livery stable) geboren, stammte also aus der lower middle class. Auch seine Familienverhältnisse waren nicht die glücklichsten. 1804 starb der Vater, 1810 die Mutter, zu der aber ohnehin ein distanziertes Verhältnis bestanden zu haben scheint. Umso enger scheint das Verhältnis zwischen Keats und seinen Brüdern und seinen Freunden gewesen zu sein. Der Briefverkehr zwischen ihnen ist eine Fundgrube hinsichtlich seiner Biographie und der Entwicklung seines Selbstverständnisses als Dichter. Es traf ihn sehr hart, als 1818 sein ein Jahr jüngerer Bruder George an Tbc starb. Seiner sozialen Klasse entsprechend, wurde Keats in eine Lehre geschickt, und zwar in eine Apothekerlehre, die er 1816, nach einer zusätzlichen Ausbildung am Guy’s Hospital mit seiner Approbation abschloß. Keats sah sich selbst aber bereits als 15-jähriger sehr entschieden als Dichter. Nach der Veröffentlichung einzelner Gedichte konnte er schon 1817 seinen Gedichtband herausbringen. Dies brachte ihn in Kontakt mit Leigh Hunt, dem bekannten „linken“ Essayisten und Verleger, der mehrfachen wegen Verstößen gegen die Pressegesetze im Gefängnis gesessen hatte. Hunt brachte den größten Teil der späteren Werke von Keats heraus, und Keats gehörte bald zu dem ausgedehnten liberalen oder auch in der damaligen Terminologie radikalen Freundeskreis um Hunt, wo er u.a. auch Shelley und Hezlitt (auch Coleridge) traf. – Der erste Gedichtband fand nur wenig Absatz und Beachtung; die Rezensionen waren äußerst negativ: Verantwortlich dafür waren wohl hauptsächlich seine Verbindung mit Hunt (den sogenannten Radikalen) und seine Herkunft aus dem Londoner Kleinbürgertum, das zu arbeiten und zu schweigen hatte, dessen Ausgriff auf eine „hohe Kunst“ jedenfalls noch vielfach als anmaßend erachtet wurde. Diese Verachtung verschaffte sich auch darin Ausdruck, daß er und mit ihm der ganze Hunt-Kreis, in dem sich ja auch durchaus Mitglied der „hohen Gesellschaft“ befanden, flugs mit dem Etikett cockney-school belegt wurde (obschon außer Keats niemand aus dieser Schicht oder gesellschaftlichen Gruppe stammte). Die Kritik traf Keats angesichts seiner Überzeugung, zum Dichter berufen zu sein, hart; dennoch hielt er an dieser Überzeugung fest, obwohl ihm dies einer mehr als ungewissen Zukunft aussetzte, woran auch schließlich seine Verlobung mit Fanny Brawne (1819) scheiterte. – Ein weiterer Grund für diese Trennung war aber auch seine sich verschlechternde Gesundheit. Nach dem Tod seines Bruders zeigten sich auch bei 14 ihm Anzeichen von Tbc, die sich 1819-20 verstärkten. Er versuchte ein damals übliches Heilmittel anzuwenden, das man ihm anriet, eine Reise in ein Mittelmeerland. Er begab sich nach Rom, wo er jedoch schon nach sechs Monaten, im Februar 1821, starb, 26 Jahre alt. Seine Entscheidung, sich ganz und professionell dem Dichterberuf zu widmen, war angesichts seiner Bildung und seiner gesellschaftlichen Voraussetzungen gewagt. Um so mehr (oder auch deswegen) erwies er sich als fleißiger, aufopferungsvoll arbeitender Dichter, der ständig bewußt an sich arbeitete. Er machte sich mit den literarischen und intellektuellen Leben seiner Zeit vertraut und setzte sich intensiv mit ihm, aber auch der literarischen Tradition, auseinander. Dies gilt besonders für die Dichtung seines älteren Freundes Shelley, aber auch für die von Coleridge und vor allem von Wordsworth, den auch er als wesentlichen Ausgangspunkt einer neuen Dichtung ansah. Eine zentrale Frage blieb ihm, wie sich eine solche nach N. Abrams „expressive“ Dichtung (oder Konzeption von Dichtung) weiterentwickeln ließ, welche Wahrheitsanspruch sie stellen und welche Geltung und Bedeutung sie in der Gesellschaft haben konnte. Es ist daher wahrscheinlich kein Zufall, daß er sich in seinem ersten größeren Werk, das unmittelbar nach der Entscheidung zum Dichterberuf entstand, mit der Figur des Dichters selbst beschäftigt. Gemeint ist Endymion: A Poetic Romance, das viel mit Shelleys Alastor gemein hat. Auch Keats Vorlage ist ein antiker Mythos, den er sehr frei gestaltet: Der von der Liebe zwischen dem latmischen Schäferkönig Endymion und der Mondgöttin Cynthia. Endymion ist also bei Keats wie im antiken Mythos der König einer pastoralen Schäfergemeinde auf der Insel Latmos, die den Gott Pan in der Natur verehrt, dessen eigentlichen Bereich, die tabuisierte wilde Natur, aber nicht zu betreten wagt. Endymion aber dringt in diesen Bereich vor, entdeckt eine überwältigend schöne, üppige Natur (die in ihrer Beschreibung an die „Ode to a Nightingale“ erinnert), und er erlebt in einem Traum eine Begegnung mit der schönen Mondgöttin, die ihn für einen Moment ans Firmament entrückt. Seine Schwester Peona warnt ihn: Der Traum kann sich nicht erfüllen, wird Endymion als Mensch und König sogar verderben. Die Transzendenz bleibt dem Menschen verschlossen, ein ungeordnetes Verlangen nach ihr hindert ihn an der Selbsterfüllung auf der Erde – als Mensch (Liebe, Freundschaft) und als König (Einsicht, Fürsorge, Stärke). Endymion weiß, daß sich der Mensch als solcher mit Spuren der absoluten Schönheit in Natur, Kunst, Freundschaft und Liebe begnügen muß; sein Verlangen nach der einmal geschauten Schönheit läßt ihn jedoch nicht los und treibt ihn wie Alastor auf eine Wanderschaft. Diese jedoch führt ihn in immer wildere, grotesk und kalt erscheinende Landschaften und schließlich in eine vegetationslose, fahle, bizarre Höhlenwelt, in der er verzweifelt. Auf seine Bitten an seine Göttin hin wird er aus ihr befreit. In die Welt des Lichts und des Lebens zurückgekehrt, trifft er auf ein Mädchen aus Fleisch und Blut, die „Indian Maid“, 15 verliebt sich auch in sie und bejaht auch diese Liebe – d.h. beide tun das, beide glauben aber auch, sich nicht vermählen zu dürfen. Endymion zieht sich in ein Einsiedlerleben zurück und lebt ausschließlich im Gedenken an seine Göttin. Seine Schwester jedoch ruft ihn nach längerer Einsamkeit daraus zurück, und in einer plötzlichen ekstatischen Begegnung entdeckt er nun, daß seine Göttin und das Mädchen eins sind, und sie nimmt ihn in „spiritualisierter Form“ zu sich. Keats selbst macht in seiner Einleitung zu dieser romantischen Erzählung klar, daß er sie als Allegorie verstanden wissen will, in der Fragen verhandelt werden, die auch schon in den frühen Gedichten „I Stood Tiptoe Upon a Little Hill“ und „Sleep and Poetry“ auftauchen und die zentrale Aspekte in Keats’ Konzeption von Dichtung bleiben. Der Sprecher des Prologs schließlich stellt als den Mittelpunkt des Gedichts die Frage nach beauty heraus: Schönheit ist, wie er ausführt, einerseits transzendent, andererseits Quelle und Bedingung alles Schönen auf der Welt, wo sie dem Menschen indirekt erfahrbar wird. Sie ist für den Menschen einerseits Fluchtort vor der Dunkelheit und Wirrness der Welt, bindet uns andererseits aber als „blumiges Band“ an die Welt zurück, ermöglicht es uns, in ihr dennoch Hoffnung und Sinn zu finden und so überhaupt in ihr zu leben. Ähnlich wie in Shelleys „Hymn to Intellectual Beauty“ offenbaren sich so die sinnlich erfahrbaren Erscheinungen als zeitlich begrenzte und wandelbare Verkörperungen dieses Prinzips, und Versenkung und Verzückung („meditation and ecstacy“) führen uns im ästhetischen und im emotionalen Erleben der Gegenstände zu dieser ihrer Essenz hin. Wenn Keats seine Erzählung als Ausdruck dieser Idee von der Verschmelzung transzendenter und irdischer Schönheit, von truth und beauty, verstanden wissen will, so müßten wir Endymions Entwicklung als einen Bildungsweg, einen Weg kontinuierlichen Reifens bis zu der Erkenntnis dieser Identität auffassen. Mir scheint aber, daß der Protagonist in der Romanze selbst eine erfolglose Suche verfolgt, die ihn immer mehr frustriert und paralysiert und schließlich in einem Zustand passiver Resignation endet und daß diesem Weg dann eine deus-ex-machina-Lösung aufgesetzt wird, welche die Überwindung der qualvollen Distanz zwischen idealer Schönheit und irdischer Realität eher als Wunschdenken offenbart. Nun ist Endymion ein sehr facettenreiches und keineswegs wirklich einheitliches Gedicht. Es berauscht durch seinen fließenden, schmiegsamen, weichen Rhythmus und seinen Klang (trotz der Versform des heroic couplet) und durch die Vielzahl üppiger deskriptiver Szenen. Diese allerdings überlagern auch die Narration und das ihr – als intendierter Allegorie – zugrundegelegte gedankliche Gerüst, und sie signalisieren oft eine Art Selbstverliebtheit des Dichters bzw. ein Schwelgen im sinnlichen Detail, in schönen Bildern. So jedenfalls sind sie in der Rezeption oft empfunden worden. Keats ist daher sowohl mit den späteren Bewegungen des Impressionismus als auch des Ästhetizismus in Verbindung gebracht worden. Auch Keats selbst betrachtete den Stil des Gedichtes später als zu überladen und nannte ihn mawkish (rührselig, kitschig). 16 Dennoch bietet das Werk einen herragenden Einstieg in Keats’ Stil, vor allem die Dichte seiner sinnlichen Bilder und seine impressionistische Zeichnung von Szenen, in wesentliche Bildbereiche und auch in die zentralen Fragen, die er an Dichtung und Dichter stellte: Was ist die Aufgabe des Dichters? Worin besteht seine spezielle Vision, die er in seinen Kunstwerken dem Leser vermittelt? – Die unmittelbare Antwort ist für Keats: In der Erkenntnis und in der Vermittlung oder Erschaffung von Schönheit! Die Entdeckung der Welt – der Natur und des Menschen (ohne dessen Transformationen durch die moderne Zivilisation bzw. „unter“ diesen) – als schön und die Hypostasierung dieses Prinzips der Schönheit als einer transzendenten Essenz ist ein zentrales Kriterium der Romantik, besonders der zweiten Generation. Die Frage von Keats geht aber weiter: Was ist Schönheit? Wie vor allem verhält sie sich zu Wahrheit und Wirklichkeit? Zur menschlichen Gesellschaft? Und: Was bedeutet sie für den Menschen: Eskapismus, Flucht, Ablenkung oder Ausweichen vor den wahren Problemen des Lebens, oder bedarf er vielmehr ihrer unbedingt zur Lebensbewältigung und Sinnfindung? Das Ringen um diese Fragen durchzieht Keats’ ganzes Werk, wenn auch mit unterschiedlicher Akzentuierung, so auch sein zweites, allerdings fragmentarisches Epos, das häufig im Zentrum der Keats-Interpretation steht, Hyperion, von Keats selbst als sein Lebenswerk betrachtet, allerdings, wie gesagt, unvollendet. Hyperion beginnt mit dem Sturz der Chroniden (des Göttergeschlechts vor den Olympiern) durch Zeus. Genauer gesagt beginnt es mit einem richtigen Bild des gestürzten Saturn (des alten Götterkönigs), in der Tiefe eines lichtlosen Tals brütend – ein Bild gigantischer Resignation und Paralyse, das an die Bilder Blakes erinnert. Dieses Bild wird dann mit dem Hyperions, des Sonnengotts kontrastiert. Er ist der letzte Gott aus dem Geschlecht Saturns, der dem Rebellen Zeus noch machtvoll entgegentritt, aber auch bereits von Sorge, böser Erwartung und von Zorn befaßt ist. Das aber bedeutet, daß er schon von einem Bewußtsein von Zeit angegriffen zu sein scheint, und dieses verweist ihn bereits aus der transzendenten Sphäre der Götter auf die vergängliche des Menschen: Die eternal essence der Götter kennt nur ein in sich ruhendes all-mächtiges und all-genießendes Sein; Sorge, bange Erwartung, Wut, Enttäuschung sind aus ihr ausgeschlossen, sind Elemente der wandelbaren und wankelmütigen Existenzform des Menschen. – Noch klarer als Hyperion begreift– im Kreis der gefallenen Chroniden – Oceanus (der Vorläufer Poseidons) das Ende ihrer Herrschaft. Es ist nicht begründet in der Heeresmacht des Zeus, sondern im Gesetz des Schicksals oder der Notwendigkeit, nach dem stets das Unvollkommenere vom Vollkommeneren abgelöst wird, und dieses Vollkommenere beweist sich durch seine Schönheit: „For ‚tis the eternal law/That first in beauty should be first in might.“ (228f.). So wird denn auch Hyperion Apollo weichen müssen, dem neuen Sonnengott unter Zeus, um dessen Heranwachsen es im 3. Teil des Epos geht. Apollo begegnet uns als junger, einsamer Sänger in pastoraler Landschaft, der seine Umgebung durch seinen 17 Gesang verzaubert, der aber selbst nicht weiß, warum, und der darunter leidet. Der Prozeß seines Bewußtwerdens ist ein Prozeß des Wachsens, in dem er das ganze Wissen oder die ganze Erfahrung der Welt umspannt: Schönes und Schreckliches, Schöpfung und Zerstörung, Wonne und Freude ebenso wie Leid und Schmerz. In einem agonieähnlichen Zustand „stirbt“ Apollo in diese göttliche Existenz hinein. Apollo steht gleichzeitig für Schönheit (nach den Worten des Oceanus) und für die Dichtung. Aspekte des Dichters, die in ihm deutlich werden: Seine Initiation erinnert an oft zitierte Stellen aus Keats’ Briefen, in denen er betont, daß die Erfahrung der leidvollen Realität der Welt notwendig für den Dichter ist und ebenso das was Keats negative capability nennt, die Fähigkeit, sich selbst, die eigene Identität zu überschreiten und sich in die Erfahrung anderer geradezu existentiell hineinzuversetzen. – Die Sphäre Apolls – der Bereich der Götter, in denen er hineinwächst – ist nun aber auch die Sphäre absoluter, ungetrübter, harmonischer und beglückender Schönheit. Warum aber verleiht sein schmerzlich erworbenes Wissen Apoll ebendiese Schönheit, die ihn zum Gott macht? Und zeigt nicht auch die Kluft zwischen den triumphierenden Olympiern und den ewig gequält vor sich hin brütenden Chroniden, die ja durchaus den Menschen gleichen, daß die Kluft zwischen leidvoller Immanenz und jenseitiger, absoluter, entrückter Schönheit unlösbar ist? Keats bricht an ebendieser Stelle ab, und auch die Umarbeitung von 1821 unter dem neuen Titel The Fall of Hyperion führt die Erzählung in diesem zentralen Punkt nicht weiter. – Für den Abbruch des Hyperion-Projekts, dessen Wiederaufnahme allerdings auch durch Keats’ frühen Tod verhindert wurde, sind biographische und formale Gründe geltend gemacht worden. Keats selbst wies auf seine wachsende Unzufriedenheit mit dem gewählten Versmaß und dem Stil hin, die in der Tradition von Miltons Paradise Lost stehen, die wiederum damit erklärt werden könnte, daß er im Gegensatz zu Milton oder auch zum griechischen Epos eigentlich kein heroisches, sondern eher philosophisches Thema gewählt hatte. Die neuere Forschung sieht den Grund für den Abbruch aber vorwiegend in den eben angedeuteten poetologischen Widersprüchen, deren sich Keats zunehmend bewußt wurde. In seinen berühmten Oden, die hauptsächlich 1819/1820 parallel zum Hyperion-Projekt entstanden, nimmt Keats viele dieser poetologischen und auch existentiellen Fragen auf. In ihnen schafft er aber auch anerkanntermaßen die reifsten und vollendetsten Zeugnisse seiner Imaginationskraft, seines Vermögens, kraft der Sprache üppige und gleichzeitig kontrollierte, funktionale und aussagekräftige Bilder für zentrale Erfahrungen, Ideen oder Fragen zu schaffen. In ihnen zeigt sich seine lebhafte und nuancierte sinnliche Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit besonders auf die Natur, das was man oft als Keats-Sensualismus bezeichnet hat. – In ihnen zeigt sich aber auch sein Vermögen zur 18 Aneignung der antiken Mythologie in sehr eigenwilligen Kontexten, die eben seine Erfahrung und Weltsicht ausdrücken (ähnlich wie in Endymion und Hyperion), und in ihnen zeigt sich schließlich auch der Stand seiner dichterischen und poetologischen Entwicklung, die er kurz vor seinem Tod erreicht hatte. Ich beginne mit einigen zusammenfassenden Bemerkungen zu Keats’ viel diskutierten sensualism: Dieser wurde als besondere Stärke Keats’ besonders von den Viktorianern gepriesen, später, wie schon bei Endymion ausgeführt, als eine Vorwegnahme der späteren Bewegungen des Impressionismus und Expressionismus, also als ein besonders progressives Element, gewürdigt. Aber sie wurde auch als eine Form von Selbstverliebtheit, von mangelnder gedanklicher Präzision (ähnlich wie bei Shelley) und vom Schwelgen im sinnlichen Detail im Sinne des von Keats selbst auf Endymion bezogenen mawkishness. Dabei hat sich aber die Ansicht durchgesetzt, daß in den Oden dieser Hang und gleichzeitig diese Fähigkeit so ökonomisiert und funktionalisiert haben, daß die Oden zu vollkommenen Kunstwerken etwa im Sinne des New Criticism wurden. Die Naturszenen in den Oden bestehen aus präzisen Details, die einer intensiven Beobachtung abgewonnen wurden; so erscheinen sie einerseits jedem, der mit der Beobachtung von Naturobjekten vertraut ist, „real“, andererseits aber sind sie Details, bleiben Verweisstücke, und regen durch ihre Selektion und Zusammenstellung die Imagination des Lesers an, welcher aus ihnen letztlich seine eigenen Bilder entwirft und mit vielen Konnotationen verbindet, die diese Bilder zweifellos auslösen. Denn diese Bilder sind, um einen weiteren häufig genannten Charakterzug zu nennen, äußerst suggestiv, sie schaffen oder suggerieren eine Stimmung. Gerade die Stimmungshaltigkeit der Keatsschen Oden ist immer wieder gerühmt worden. Der Atmosphäre von Beglückung, Harmonie, Fülle, Berauschung, von Belebung oder Müdigkeit, von Freude oder Melancholie, auch von Düsterheit und Zweifel, kann sich wohl kaum ein Leser, der sich wirklich auf diese Gedichte einläßt, entziehen. Umstrittener blieb immer die Frage, ob auch ein „tieferes Anliegen“, eine Idee, Einsicht oder „Wahrheit“ – wie sie ja Keats selbst von der Kunst fordert – in ihnen zum Ausdruck kommt. Die Ansicht, daß dies der Fall sei, hat sich immer mehr durchgesetzt, während z.B. die Viktorianer diese Seite gegenüber den Stimmungsentwürfen vernachlässigten oder herabsetzten. Worin die Idee der Gedichte jeweils besteht, das ist allerdings für die meisten Oden (und auch für die Balladen Keats’) kontrovers geblieben. Leider muß ich diese Kontroverse hier mehr oder weniger einebnen, wenn ich jetzt einzelne Aspekte an einzelnen Gedichten aufzuzeigen versuche. Die Ode mit dem Titel „To Autumn“ ist immer wieder als Triumph von Keats’ „sensual art“ gefeiert worden. Keats benutzt die traditionelle klassizistische Technik der Allegorie, aber nur, um ein besonders suggestives Bild der Erscheinungsweise und des Wesens des Herbstes zu schaffen oder um eine besonders intensive Erfahrung des Herbstes zu vermitteln: Wird zunächst die Kraft und die Energie der Jahreszeit gefeiert, mit der sie die Natur zur übervollen Reife drängt (ähnlich wie Rilkes „Dräng sie zur 19 Reife hin und jage/Die letzte Süße in den schweren Wein“), so erscheint der Herbst im folgenden in Form von Gestalten, die diese Fülle ernten und genießen (Schnitter bzw. Garbenbinder, Ährenleser, Weinpresser) und die dabei Arbeit und Ruhe, ja man kann fast sagen Paralyse, miteinander verquicken. Diese Ambivalenz führt dann vielleicht auch zu einer grundlegenden, das ganze Gedicht tragenden Ambiguität oder vielleicht sogar Paradoxie, die sich besonders in der letzten Strophe herauskristallisiert: Die Musik des Herbstes, süß wie sie ist, mit ihrer eigenen beglückenden Suggestivität, erinnert doch gleichzeitig an die vergangene Musik des Frühlings und – etwa im Bild der sich zur Abreise versammelnden Schwalben, ja sogar in der Rückschau im Bild der überquellenden Waben der Bienen von Strophe 1 – an den immer wiederkehrenden Winter: Die Zeit höchster Vollendung, in der ein natürlicher Prozeß seinen Nadir, seinen Kulminationspunkt erreicht, sich selbst vollkommen erfüllt und ausgeschöpft hat, ein scheinbarer Punkt der Ruhe und des Stillstands, des höchsten Genusses – fast ein Kairos außerhalb der Zeit – ist unter den Bedingungen der irdischen Existenz auch der Punkt des Umschlags in den Verfall, den Tod, die dissolution, ein Gedanke, von dem sich auch manche der deutschen Expressionisten fasziniert zeigten. Erfüllung und Tod oder Vergehen stoßen also in der Natur unmittelbar zusammen, und ebenso im menschlichen Leben, im menschlichen Schaffen und in den menschlichen Produkten. Blake spricht in „ Rose, thou art sick“ vom unsichtbaren Wurm, der das Leben der Rose in ihrer höchsten Entfaltung der Schönheit zerstört. Für ebendiese Erfahrung schafft Keats dann in der „Ode on Melancholy“ eine Reihe von Analogien, die in den Erfahrungen der flüchtigen Schönheit der Natur bestehen. Shelley zog in seiner „Hymn to Intellectual Beauty“ (und auch in „The Cloud“) daraus die Folgerung, daß hinter diesen vielen flüchtigen Erscheinungsformen des Schönen ein unvergängliches transzendentes Prinzip der Schönheit liegen müsse. Keats scheint hier (anders als in Endymion) dazu nicht fähig zu sein, und auf dieser negativen Erkenntnis – „She dwells with Beauty – Beauty that must die“ – resultiert Melancholie als Grundzustand des Menschen und im besonderen als Grundzustand des sensiblen Menschen (also wohl besonders des Künstlers), der nicht abgestumpft und eben deswegen nicht in der Lage ist, die Freude (an der Schönheit, deren Fragilität er ja nicht übersehen kann) in vollem Maße auszukosten – fast zwanglos und dennoch genial führt Keats diesen Gedanken in folgendes Bild: Wer die Freude auskosten oder verkosten kann, sie wie eine reife Frucht mit der Zunge am Gaumen zerdrückt und sie damit genießt und zerstört, der erst gewinnt den in ihr verborgenen „Geschmack der Traurigkeit“ (Z. 2530). Diese Melancholie durchzieht den Ton, den Rhythmus und die Bilder fast aller Oden. Wir sahen schon am Beginn der Vorlesung, in dem Einstieg in die Romantik, daß sich die „Ode to a Nightingale“ fast als Fortsetzung dieses Gedankens lesen läßt. Die Erfahrung des mit der menschlichen Existenz notwendigerweise verbundenen Leids – „the weariness, the fever, and the threat“ (Z. 23) – ist der Ausgangspunkt des 20 dringenden, existenznotwendigen Wunsches, dem Lied der Nachtigall zu folgen und sich mit ihr, der Verkörperung des transzendenten, ungetrübten, weltentrückten Schönen, zu vereinen durch das Vermögen der Imagination. In der dadurch zustande gebrachten imaginativen Erfahrung der nächtlichen Naturlaube, in der die Sinne des Sprechers vollkommen gesättigt werden, scheint dies einen Augenblick möglich, der Sprecher scheint sich in reinen Genuß aufzulösen (Strophe 4-6), aber genau in diesem Moment erfolgt auch hier der Umschlag (Strophe 6-8) – man fühlt sich an „To Autumn“ erinnert. Der Sprecher wird sich in diesem Augenblick höchster Erfüllung bewußt, daß er seine Individualität nur um den Preis des Todes ablegen kann und daß ebendiese, seine menschliche Individuation, ihn hindert, die in der Natur aufscheinende beauty wirklich zu erreichen. Die sich entfernende Nachtigall erweist sich als „deceiving elf“ (Strophe 8). Heißt das nun, daß der Mensch das durch sie (und das wiederum heißt wohl durch die Natur) repräsentierte Prinzip der Schönheit hie ganz erreichen kann, oder heißt das, daß das Streben nach ihr in sich schon gefährlich bzw. eine „Versuchung“ ist: Was ist das Wesen der Schönheit und ihre Bedeutung für die Kunst und den Menschen? Das wird nun zur zentralen Problemstellung der „Ode on a Grecian Urn“, vor allem wenn man von ihren Schlußversen ausgeht: ‚Beauty is truth, truth beauty,’ – that is all/Ye know on earth, and ye need to know.’ Dieser Ode liegen offenbar Keats’ Begegnungen mit griechischer Plastik zugrunde, die damals infolge der engen Beziehung zwischen England und dem nach Unabhängigkeit strebenden Griechenland in großen Mengen nach England gebracht und der interessierten Öffentlichkeit – etwa im Britischen Museum – zugänglich gemacht wurden. Dazu gehörten neben den berühmten Parthenon-Fries (den von Keats ebenfalls besungenen „Elgin Marbles“) vor allem Vasen. Keats war von der griechischen Kunst außerordentlich beeindruckt, wie viele Aussagen in Briefen und Gedichten belegen. Die ästhetische Vollendung der Bilder bzw. Reliefs, ihr Schweben zwischen Natur und Kunst (Idealisierung) und ihre Fähigkeit, über die Jahrtausende hinweg auch zum heutigen Beobachter zu „sprechen“, faszinierten Keats. Die Versenkung der Bilder in der imaginativen Vase – denn wie Bowra nachgewiesen hat, baute Keats die Szenen wahrscheinlich aus zwei konkreten Vasen und aus Bildern des Parthenon-Frieses zusammen) rufen daher im Betrachter, also im Sprecher des Gedichtes, die lebhafte Frage nach dem Wesen der Kunst hervor. Nun ist allerdings hinsichtlich der im Gedicht intendierten Antwort auf diese Frage und vor allem hinsichtlich der Rolle, die die letzten beiden Zeilen des Gedichts, also die Antwort der Vase selbst, dabei spielen, eine fast unendliche und differenzierte, ja teilweise auch kontroverse Fülle von Interpretationen entwickelt worden, welche dieses Gedicht fast an die Seite von Shakespeares Hamlet rückt. Für den Versuch, hier eine relativ einfache und hoffentlich einleuchtende Interpretation anzudeuten – und das noch in wenigen Worten – muß also fast um Nachsicht gebeten werden. „Beauty is truth, truth beauty…“: Diese kategorische Feststellung, welche die Vase den drängenden Fragen des Sprechers entgegenstellt, erscheint in ihrer Ober- 21 flächenbedeutung klar genug, wird aber doch gleich irritierend, wenn man sich fragt, welchen Sinn diese paradoxe und unserer Alltagserfahrung wohl doch eher widersprechende Aussage denn eigentlich haben soll und vor allem, welchen Zusammenhang eine solche kategorische und explizit belehrende Tendenz mit dm doch eher suggestiven und meditativen Gedicht hat. Eine Antwort auf diese Frage ist häufig auch geradezu als unmöglich bezeichnet worden, das Gedicht damit als fehlerhaft, wie z.B. von T.S. Eliot. Die Schilderungen der Szene auf der Vase und die vielen von ihnen hervorgerufenen Reflexionen und Fragen des Sprechers sind meines Erachtens von zwei Sinnachsen durchzogen: 1. Die Kunst ht eine Verewigungsfunktion und –fähigkeit, aber nur um den Preis des Verzichts auf tatsächliche Teilnahme am Leben, an seinem Vollzug oder Genuß, an fruition, d.h., wie wir vielleicht heute sagen würden eben um den Preis der Fiktionalität: Die Melodien auf der Flöte werden nicht wirklich gespielt, der Liebhaber kann die Geliebte nie erreichen, um sie zu küssen; andererseits genießen sie das Privileg immerwährender Liebe, Jugend, sozusagen des immerwährenden Augenblicks (des kairos), während der Vollzug z.B. der Liebe diese den Bedingungen der Zeitlichkeit unterwerfen würde, was für den Sprecher bedeutet, daß sie hinabgezogen würde (to clogg), da sie notgedrungen dann deren Unvollkommenheit offenbaren würde (28-30). Die Liebe ist also in einem idealen Moment „aufgehoben“ im doppelten Sinne dieses Wortes (Strophe 2 und 3). 2. Die in der Kunst dargestellten Szenen verweisen über sich hinaus: jedes Bild und gar jede Einzelheit weist sozusagen aus dem Bild hinaus (etwa auf den Kontext des Aufzugs und des Liebespaars, auf die Melodie, auf die nicht sichtbare Stadt); in fast quälender Weise wird der Betrachter auf eine dahinterliegende Realität verwiesen, die er aber nicht begrifflich fassen kann (Strophe 4). – Unter beiden Perspektiven ist die schöne Vase ein „cold pastoral“ und irritierend: „Thou, silent form, dost tease us out of thought/As doth Eternity: cold pastoral!“ In dieser Provokation, die sie auf uns ausübt, wird sie explizit mit der Ewigkeit verglichen (die wir auch hinter den wahrnehmbaren Dingen, sozusagen außerhalb des Bildes, nicht faktisch erfassen können und die wir doch erahnen und nicht aufhören können zu suchen). Kunst hält also das „wirkliche Leben“, die „Natur“ fest – in den realistischen Szenen der antiken Vase – stilisiert sie aber auch, abstrahiert und idealisiert; durch ihre Ästhetisierung bannt sie Szenen des Lebens in eine Form, welche diese sinnhaft, und das heißt wohl auch, sinnvoll, macht; sie entrückt sie der Zeit und macht sie auf eine hinter ihr liegende Wahrheit durchscheinend (vgl. auch die Vision Endymions). Diese läßt sich freilich nicht begrifflich-diskursiv, von der Ratio, fassen und auf den Punkt bringen – wäre das so, bedürfte es nicht der Kunst. Nun muß aber diese irritierende begriffliche Unzugänglichkeit des Kunstwerks nicht heißen, daß seine Wahrheit tatsächlich – in jeder Beziehung – unzugänglich ist. Der Sprecher im Gedicht will zwar von der Vase solche begrifflichen Antworten (Namen, Fakten usw.), und diese verweigert sie ihm; insofern ist sie eine silent form, 22 und damit ärgert sie den Fragen, aber „Thou dost tease us out of thought“ – will sie uns also nur aus der Ebene des rationalen Denkens oder Diskurses „hinausärgern“, in einen anderen Bereich der Erfahrung oder Betrachtung verweisen? Und wenn ja, welche käme hier eher in Frage als der der Imagination? Und für deren Wahrnehmungs- und Erkenntnisfähigkeit wäre die Schlußsentenz dann im Sinne der Romantik weder inkohärent noch trivial. Die Antwort auf die Frage nach dem Sinn ihrer abschließenden Antwort ist die Vase selbst; sie macht die Idealität von Schönheit und Wahrheit für den Betrachter erfahrbar, spricht also seine Imagination an, beantwortet seine Frage auf rationaler Ebene aber nicht. Die „Ode to Indolence“ ist weniger komplex; sie ist ein Zeugnis einer aus frustrierender Erfahrung resultierenden Sehnsucht nach Flucht, Rückzug. Der Sprecher erteilt dem Streben nach Ruhm und einem Platz in der Welt eine Absage; er möchte jeder Aktivität entkommen und das Bewußtsein seiner selbst in einem Zustand reiner Passivität und reiner Erfüllung sinnlich-ästhetischen Genusses verlieren. Eine ähnliche „Momentaufnahme“ liegt in der „Ode to Psyche“ vor, die gleichzeitig ein hervorragendes Beispiel für die Transformation eines antiken Mythos in die eigene Ideen- und Gefühlswelt des Dichters, also seiner mythopoetischen Kraft, ist. Die Begegnung zwischen Psyche und Amor oder Cupido, die der Sprecher auf einem Waldspaziergang wie zufällig miterlebt, wird hier als Bild reinen Glücks verstanden, dem der Sprecher einen Ort der Verehrung in seinem Geist errichten will. In einem üppigen Spiel seiner Phantasie erschafft der Sprecher diese innere Seelenlandschaft (die er aus dem Wald des Denkens, den Wiesen des Gefühls, den Verzierungen des Verstandes und den Blumen der Phantasie gestaltet), dabei hält Keats aber gleichzeitig auch eine strenge Analogie zu einer typischen griechischen Tempellandschaft – wie er sie von Vasen und Friesen her kannte – und die gemeinte symbolische Signifikationskette ein. Ähnlich wie Shelley vereint Keats in seinen Oden Merkmale der horazischen (feste Strophenform) und der pendarischen Ode (Apostrophe, hymnischer Ton, innerer Aufbau). In der „Ode to a Grecian Urn“ und in der „Ode to a Nightingale“ bestehen weiterhin deutliche Parallelen zwischen dem Aufbau der einzelnen Strophen und der Form des Sonnets, so daß Keats auch hier traditionelle Formen aufnimmt, aber deren Grenzen überschreitet oder auflöst. Ohne auf diesen Aspekt noch einmal explizit eingehen zu können, hoffe ich, vermittelt zu haben, welch individuelle Dichter die behandelten Romantiker, auch die der zweiten Generation, sind. Aber auch, daß sich doch zentrale gemeinsame Anliegen, Anschauungen und Formen bei ihnen finden. Versuchen wir abschließend noch einmal stärker zu abstrahieren und dabei einen Blick auf die Romantik insgesamt als dichterische Bewegung zu werfen. Schon zu Beginn der Vorlesung habe ich doch ein kurzes Eintauchen in verschiedene Texte Subjektivität, Gefühlsbetontheit, Rückzug in die Natur und Rückzug in sich selbst als gemeinsame Faktoren der Romantik aufzuzeigen versucht. Nach N.H. Abrams ist es üblich geworden, mit dem Beginn der 23 Romantik vom Entstehen eines neuen dichtungstheoretischen Paradigmas, der expressiven Auffassung von Dichtung bzw. Kunst (gegenüber der mimetischen des Klassizismus) zu sprechen. Dichtung ist danach mit Wordsworth berühmten Worten: „The spontaneous overflow of powerful feelings“. Dies ist insofern richtig, als die Erfahrung des Dichters als Person oder Individuum der Ausgangpunkt oder die Quelle der Dichtung ist (wobei Erfahrung oder auch Gefühl nicht unbedingt im engen biographischen Sinne, also als bestimmtes belegbares Erlebnis, zu verstehen ist, vielmehr als seine Welterfahrung). Richtig ist dies auch insofern, als die Romantiker die Verarbeitung dieser Erfahrung nicht allein dem Verstand auftragen, sondern daß bei einer solchen gültigen Verarbeitung die Empfänglichkeit der Sinne und die Empfindsamkeit, d.h. die Reagibilität des Gefühls (oder des Fühlens) eine eher übergeordnete Rolle spielen. Die Vorstellung von einer expressiven Dichtung kann nun aber nicht bedeuten, daß die Romantik den Anspruch auf eine allgemeine Relevanz ihrer Dichtung aufgeben. Alle romantischen Dichter waren engagierte, besorgte, ja leidende Beobachter ihrer Mitmenschen und ihrer gesellschaftlichen und politischen Situation; der Glaube an rein rationale Lösungen innerhalb politischer Systeme (also allein durch strukturelle Änderungen) war jedoch bei allen stark erschüttert. Der Neuansatz einer Sinnfindung konnte nach ihrer Überzeugung nur aus der Subjektivität der eigenen ganzheitlichen Erfahrung heraus erfolgen, denn ihr allein wurde Authentizität zugesprochen. Wie aber ließ sich der Anspruch auf allgemeine Gültigkeit, auf gesellschaftliche Relevanz, auf „Wahrheit“ in dieser Situation aufrecht erhalten? Stark vereinfacht ausgedrückt, gründeten die Romantiker diesen Anspruch oder diese Hoffnung auf die Imagination, der sie die zentrale Rolle bei der Schaffung von Dichtung zuwiesen. Sie ist zunächst einmal wie auch schon vor der Romantik zu verstehen als die Vorstellungskraft, mit der Dichter seine Welten anwirft. Sie besitzt dabei insbesondere die Kraft, diesen Welten bzw. den ästhetischen Gebilden, in denen diese sich realisieren, organische Einheit zu verleihen, eine Einheit von Inhalt, Bildern, Worten, Klang und Rhythmus, die mehr ist als die Summe der Teile, wie es vor allem Coleridge betont und darlegt. Was aber ist das Prinzip dieser Einheit, der Punkt, aus dem sie erwächst? Bei der Antwort auf diese Frage verweist Coleridge auf die Fähigkeit der Imagination, auch als Erkenntnisorgan tätig zu sein, daß hinter (oder über) der diskursiv-rationalen Erkenntnis des Menschen liegende Ideen zu erfassen, wenn auch nicht logisch-diskursiv zu definieren und zu erklären vermag. Und ebendiese drücken sich dann in den echten Produkten der Imagination aus, und sie sind der Grund ihrer Einheit. Die Imagination bzw. das Wirken der Imagination ist ein ganzheitlicher, synthetischer und kreativer Akt. Er hat seinen Ausgangspunkt in der Erfahrungswelt, den, wie Coleridge sagt, „Objects fixed and dead“, transformiert sie aber, stellt in einem neuen Licht dar, verlebendigt und idealisiert sie, womit Coleridge eben meint, daß sie auf eine lebendige Wahrheit hin, auf „Ideen“ hin durchscheinend gemacht werden. Shelley und Keats wiederholen in 24 mehrfachen Variationen diese Coleridgesche Vorstellung von Imagination und die darin für die Dichtung implizierten Ansprüche. Eine stärkere Betonung findet bei ihnen aber der in dieser Konzeption implizierte Aspekt der Schönheit: Die Erkenntnis der Imagination ist eine Erfahrung von Sinnen, sie verleiht der chaotischen Welt der empirisch-rationalen Wahrnehmung Sinn und eben damit auch Ordnung. Als eine solche Sinnerfahrung in der sonst eher als „weary white“ empfundenen „unintelligible world“ ist das Werk der Imagination notwendigerweise selbst schön – es zeigt eine befriedigende, stimmige, einheitliche Ordnung – wirkt auf den Rezipienten harmonisch, erhellend, beglückend, ist eben in all diesen Aspekten schön. Die Produkte der Imagination lösen daher Wohlgefallen aus, d.h. sie sind vollendete Kunstwerke, selbst wenn ihre Themen Leid und Dunkelheit sind. Schönheit wird neu definiert, nicht mehr als tradierte, rational erfaßbare oder meßbare ästhetische Kategorie, nach Regeln wie Dekorum, Proportion, Variation tradierter Formen, Transparenz. Vielmehr erwächst das Kunstwerk aus individueller Erfahrung, bezieht aus ihr seine Form, in der alle Elemente in diesem Punkt der Einheit, also als Aspekte seines Sinns, zusammenstimmen. Ästhetik ist also nicht mehr eine rein formale Kategorie; sie tritt in enge Interdependenz mit Sinnerfahrung oder Sinnvermittlung, ja auch mit Ethik, und sie wird weiterhin an das jeweilige Kunstwerk gebunden, in dessen Rezeption sie sich vollzieht. Shelley bezieht die Theorie der Imagination nun auch direkt auf den gesellschaftlichen Bereich. Die Imagination des Dichters löst die aus selbstsüchtigen Interessen der Mächtigen heraus entworfenen, verfestigten rationalen Systeme der Philosophie, Theologie und Politik, bricht sie auf, öffnet den Blick der Menschen auf die durch sie verschütteten oder verstellten zeitlosen Wahrheiten und spornt die Menschen zu neuen Versuchen an, diese in ihrer Gesellschaft tatsächlich zu realisieren. Auch für Shelley tragen diese Wahrheiten, die sie vermittelnden Formen und der durch sie letztlich garantierte utopische Endzustand das Merkmal der Schönheit, das wiederum zur Quelle der Freude und Begeisterung wird, aus welcher letztlich sowohl die Dichtung als auch jede Dynamik, jeder Fortschritt des Menschengeschlechtes entspringt. – Bei Keats dagegen scheint sich von seinen ersten größeren und bewußteren dichterischen Versuchen an eine Sehnsucht nach unmittelbarer, reiner Schönheit zu finden. Diese Sehnsucht wird erfüllt vor allem durch die mit größter sinnlicher Intensität erfahrenen Begegnung mit der Natur. Diese erfüllt eine existentielles emotionales Bedürfnis nach Freude, Harmonie und Beglückung. Eine solche Erfahrung geschieht in Momenten völliger Passivität, in Momenten des Selbstvergessens und der Auslöschung von Welt und Ich, an deren Realität sich jedoch das Schönheitsbedürfnis immer wieder reibt. Auch Keats sucht immer wieder nach Bestätigungen dafür, daß diese sinnlich-ästhetische Schönheit letztlich einen transzendenten Fluchtpunkt hat, auf den die Imagination Dichter und Leser hinlenken kann, und daß daher Schönheit ein Moment der Wahrheit ist oder umgekehrt. Schönheit tritt aber auch immer wieder, wie gesagt als Gegensatz zur Realität der Welt auf, die fast immer als negativ erfahren wird („The weariness, the 25 fever, and the threat“). Schönheit ist also auch Gegenpol zu einer Welt, die von persönlicher Frustration und Leiderfahrung geprägt ist. Sie scheint nur erreichbar in einem Akt des Vergessens, der Flucht. Anders als bei Shelley wachsen bei Keats im Laufe seiner dichterischen Entwicklung die Zweifel, ob Dichtung, wie er und seine Dichterfreunde sie verstanden, wirklich ein Transzendieren der Welt zu Wahrheit und Sinn hin leistet, oder ob sie nicht vielmehr eine Flucht darstellt vor der Realität der menschlichen und gesellschaftlichen Kondition und auch vor deren Verantwortung. Die Viktorianer, die einerseits an die romantische Dichtung anknüpften, nahmen andererseits gerade diese Zweifel von Keats auf und führten sie weiter. Matthew Arnold z.B. verweist auf den Trost, den die romantische Dichtung mit ihren Naturszenen und ihrer Schönheit dem modernen, vom Elend der Stadt und der Häßlichkeit der modernen Zivilisation geplagten Menschen spenden kann, stellt aber auch die Frage, ob Wordworths Subjektivität (sein „egotistical sublime“), Shelleys „esoterischer Idealismus“ und Shelleys und Keats’ Schwelgen im sinnlichen Detail, der Aufgabe des modernen Dichters in der Welt des industriellen Zeitalters gerecht wird. Das romantische und das klassizistische Paradigma, könnte man sagen, treten in der viktorianischen Dichtung in ein letztlich unlösbares Spannungsverhältnis, und es ist nicht uninteressant festzustellen, daß sich dieses bei Keats bereits anzudeuten scheint.