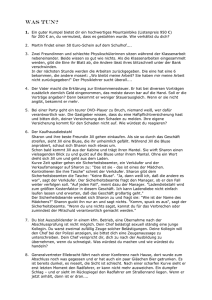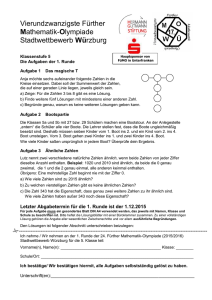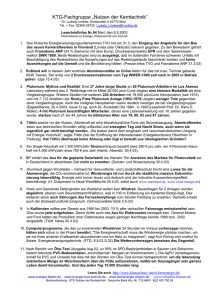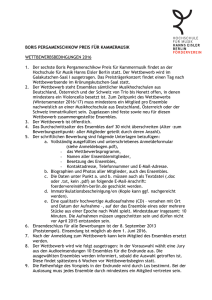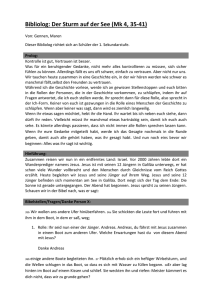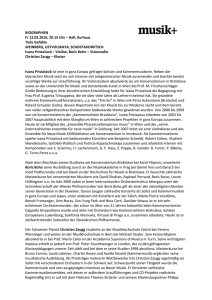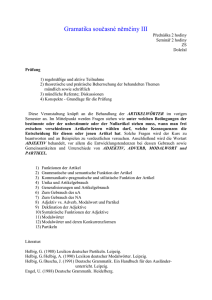Vorspann zu METALLISCHE GIER von Franz Theiler
Werbung
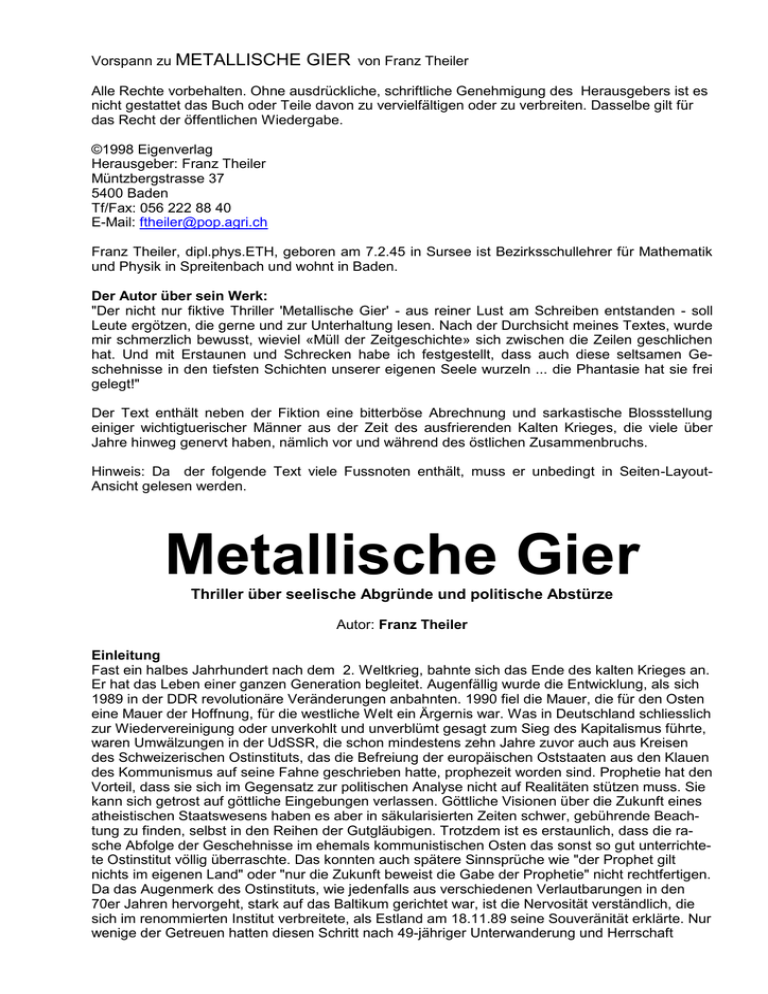
Vorspann zu METALLISCHE GIER von Franz Theiler Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung des Herausgebers ist es nicht gestattet das Buch oder Teile davon zu vervielfältigen oder zu verbreiten. Dasselbe gilt für das Recht der öffentlichen Wiedergabe. ©1998 Eigenverlag Herausgeber: Franz Theiler Müntzbergstrasse 37 5400 Baden Tf/Fax: 056 222 88 40 E-Mail: [email protected] Franz Theiler, dipl.phys.ETH, geboren am 7.2.45 in Sursee ist Bezirksschullehrer für Mathematik und Physik in Spreitenbach und wohnt in Baden. Der Autor über sein Werk: "Der nicht nur fiktive Thriller 'Metallische Gier' - aus reiner Lust am Schreiben entstanden - soll Leute ergötzen, die gerne und zur Unterhaltung lesen. Nach der Durchsicht meines Textes, wurde mir schmerzlich bewusst, wieviel «Müll der Zeitgeschichte» sich zwischen die Zeilen geschlichen hat. Und mit Erstaunen und Schrecken habe ich festgestellt, dass auch diese seltsamen Geschehnisse in den tiefsten Schichten unserer eigenen Seele wurzeln ... die Phantasie hat sie frei gelegt!" Der Text enthält neben der Fiktion eine bitterböse Abrechnung und sarkastische Blossstellung einiger wichtigtuerischer Männer aus der Zeit des ausfrierenden Kalten Krieges, die viele über Jahre hinweg genervt haben, nämlich vor und während des östlichen Zusammenbruchs. Hinweis: Da der folgende Text viele Fussnoten enthält, muss er unbedingt in Seiten-LayoutAnsicht gelesen werden. Metallische Gier Thriller über seelische Abgründe und politische Abstürze Autor: Franz Theiler Einleitung Fast ein halbes Jahrhundert nach dem 2. Weltkrieg, bahnte sich das Ende des kalten Krieges an. Er hat das Leben einer ganzen Generation begleitet. Augenfällig wurde die Entwicklung, als sich 1989 in der DDR revolutionäre Veränderungen anbahnten. 1990 fiel die Mauer, die für den Osten eine Mauer der Hoffnung, für die westliche Welt ein Ärgernis war. Was in Deutschland schliesslich zur Wiedervereinigung oder unverkohlt und unverblümt gesagt zum Sieg des Kapitalismus führte, waren Umwälzungen in der UdSSR, die schon mindestens zehn Jahre zuvor auch aus Kreisen des Schweizerischen Ostinstituts, das die Befreiung der europäischen Oststaaten aus den Klauen des Kommunismus auf seine Fahne geschrieben hatte, prophezeit worden sind. Prophetie hat den Vorteil, dass sie sich im Gegensatz zur politischen Analyse nicht auf Realitäten stützen muss. Sie kann sich getrost auf göttliche Eingebungen verlassen. Göttliche Visionen über die Zukunft eines atheistischen Staatswesens haben es aber in säkularisierten Zeiten schwer, gebührende Beachtung zu finden, selbst in den Reihen der Gutgläubigen. Trotzdem ist es erstaunlich, dass die rasche Abfolge der Geschehnisse im ehemals kommunistischen Osten das sonst so gut unterrichtete Ostinstitut völlig überraschte. Das konnten auch spätere Sinnsprüche wie "der Prophet gilt nichts im eigenen Land" oder "nur die Zukunft beweist die Gabe der Prophetie" nicht rechtfertigen. Da das Augenmerk des Ostinstituts, wie jedenfalls aus verschiedenen Verlautbarungen in den 70er Jahren hervorgeht, stark auf das Baltikum gerichtet war, ist die Nervosität verständlich, die sich im renommierten Institut verbreitete, als Estland am 18.11.89 seine Souveränität erklärte. Nur wenige der Getreuen hatten diesen Schritt nach 49-jähriger Unterwanderung und Herrschaft durch die russischen Sowjets noch erwartet oder für möglich gehalten. Als dann im Laufe des Jahres der Konflikt1 Estlands mit der sowjetischen Zentralmacht in Moskau eskalierte, entstand im Ostinstitut und in den baltischen Exilorganisationen in Skandinavien ein enormer Handlungsdruck. Pläne für Interventionen im Baltikum gab es schon in der Vergangenheit. Aber unter den damals völlig anderen machtpolitischen Verhältnissen hatten sie nie die Spur einer Chance auf Realisierung. Jetzt sind rasche Entscheidungen gefragt. Die seit den 50er Jahren immer weiter vom Herd gerückten und langsam ausfrierenden Töpfe der kalten Krieger beginnen - auch in der Schweiz wieder zu köcheln. Dampf machen heisst die Devise. Die Befreiung der russischen Satellitenstaaten von der sterbenden Sowjetunion aktiv voranzutreiben, ist nun eine Sache von höchster Priorität. Fieberhaft werden alte Kontakte aktiviert. Geheime Botschaften laufen zu baltischen Exilorganisationen nach Schweden, zu deutschen Vertriebenenorganisationen und zu der im deutschsprachigen Raum NFBE genannten nationalen Freiheitsbewegung Estonias. In den Büros des Ostinstituts wird das Porträt von F.J. Strauss entstaubt. Die Dramaturgie der Ereignisse ist atemberaubend. Jeder Tag bringt neue Überraschungen. Die Lage ändert sich so schnell, dass es für neue Konzepte an Zeit und auch an Beweglichkeit fehlt. Ein seltsames Unternehmen läuft an... 1 Estland ,1918 als Republik ausgerufen, wurde 1940 nach dem Einmarsch der sowjetischen Truppen als Estnische sozialistische Sowjetrepublik ein Teilstaat der UdSSR. Russland anerkannte am 21.8.1991 die Unabhängigkeit Estlands. 2 Der Plan Altoberst Areznitz sass steif und aufrecht mit zwei Gästen am vom Fenster weg gerichteten Schreibtisch in seinem engen Büro. Obwohl er von hier aus eine schöne Aussicht über Zürich hatte und sogar ein kleines Stück des Sees überblicken konnte, zog er die Übersicht über seinen Arbeitsraum vor. Vielleicht war das auch bloss Angewohnheit aus seiner aktiven Zeit, als er noch Schulkommandant war und im Laufe des Tages von seinem Sessel aus Dutzende von militärischen Grüssen abnehmen musste. Neben dem Pult, in die gleiche Richtung blickend wie er, ritt Lennart Borlov einen sattelähnlichen Ledersessel. Ihre Augen waren auf Rainer Regaz gerichtet. Dieser hockte, sich aus alter Gewohnheit im Hintergrunde haltend, zwischen einem altmodischen hohen Sekretär und einem eisenbeschlagenen Kassenschrank auf einem unbequemen Faltstuhl in der Zimmerecke. "Die tragende Idee des Unternehmens besteht also darin, in Estland einen Unruheherd zu schaffen, der zum Zentrum des Aufstandes gegen die Zentralmacht in Moskau werden soll." Mit diesem Satz fasste Areznitz seine vorherigen Ausführungen prägnant zusammen. Als Mann mit einem Gefühl für militärische Präzision hatte er eine Vorliebe oder besser eine Technik für absolute Klarheit des sprachlichen Ausdrucks entwickelt. Jetzt entspannte er sich und blickte abwartend auf Regaz. "Danke Rolf, danke" quittierte dieser und wandte sich nach einer kurzen Pause an Borlov: "Nun, wie schätzen Sie die Erfolgsaussichten einer solchen Operation im heutigen politischen Szenarium ein?" Borlov rutschte nervös an den Rand seines Sattelfauteuils und räusperte dabei seine verstopfte Kehle von Zigarettensaft frei. "Meine Herren, hechch! Zuerst möchte ich Ihnen im Namen des schwedischen Exilverbandes der nationalen Freiheitsbewegung Estonias danken für ihre Ausführungen, Oberst. Sie lassen an Schärfe und Genauigkeit nichts vermissen." Areznitz' gerader Rücken bog sich leicht zurück. Das geschah unwillkürlich, wenn er seine Arschbacken zusammenzog. "Ich möchte hier mit Nachdruck und grosser Überzeugung versichern, dass die Prognose für das Gelingen einer solchen Aktion noch nie so günstig war. Die Verunsicherung des Kremls ist gross, seine Schwäche offensichtlich. So ist beispielsweise bekannt, dass Gorbatschow ein Landhaus in Ostfinnland gekauft hat. Wir nehmen an als Folge seiner grossen Zweifel in der Beurteilung der politischen Lage", versicherte Lennart Borlov mit leuchtenden Augen. "Das könnte allerdings auch anders interpretiert werden, Herr Borlov. Gorbatschow hat sicher allen Grund, die Rückkehr der Hardliner zu befürchten", lachte Regaz. Lennart Borlov lief rot an: "Entschuldigung, so habe ich das nicht gemeint. Aber wenn Leningrad endlich wieder zu Petersburg wird, mit anderen Worten, wenn es zur grossen Ausmarchung kommt, wird Gorbatschow, falls er sich in Moskau nicht halten kann, in Finnland hinter der Front auf der richtigen Seite stehen. In den von Stalin überrannten Gebieten brodelt es. Das Baltikum kann an dieser Entwicklung der Dinge nur interessiert sein. Wir müssen jetzt das Korn auf der Tenne schlagen, um die Spreu vom Weizen zu trennen." "Höre ich da nicht die treffliche Ausdrucksweise Ihrer ostpreussischen Mutter?", witzelte Regaz und fuhr ernsthaft fort: "Ich teile natürlich Ihre Einschätzung der Lage. Seit 40 Jahren warten wir auf diesen Moment Noch nie standen die Zeichen so günstig. Nullum erit tempus hoc amisso2. Jetzt oder nie, nicht wahr Rolf?" Oberst Areznitz nickte feierlich. Sichtlich bewegt murmelte er: "Dass eine mutige Vorhut trotz Totalverlust in einer Schlacht den Krieg entscheiden kann, wissen wir Schweizer spätestens seit St.Jakob an der Birs." Verstohlen wischte er sich eine Träne der Rührung ab. "So gut kenne ich mich in Ihrer Geschichte nicht aus", hüstelte Borlov verlegen. "Aber wie werden Sie das ihrer Regierung beibringen? In Schweden hätten wir damit auch nach dem Tod von Olof Palme grosse Schwierigkeiten." "Ich kenne die schwedischen Verhältnisse zu wenig, aber ich nehme doch an, dass sich unsere beiden Regierungssysteme stark unterscheiden. Wie Sie vielleicht wissen, ist unsere Staatsform immer noch die der direkten Demokratie", beantwortet Areznitz die Frage. "Wir haben die ideale Regierungsform der schweigenden Mehrheit, und wir kennen ihren heiligen Willen." "Wie bitte? Könnten Sie mir erklären, wie Sie das meinen?" 2 lat. "Es wird keine Zeit sein, wenn diese verloren ist"; "Die Zeit kommt nicht wieder" 3 "Er meint," mischte sich Regaz ein, "dass wir als Classe politique darauf achten, wie sich die schweigende Mehrheit verhält, und dass die schweigende Mehrheit darauf achtet , wie wir uns verhalten." "Und woher kennen Sie die Meinung dieser Mehrheit, wenn sie doch schweigt?" "Ganz leicht, wir sind es, die sie definieren!" Borlov schaute verständnislos von einem zum andern. "Sie meinen..." ."..wir meinen, "unterbrach ihn Areznitz präzisierend, "dass wir dann richtig denken, wenn wir so denken wie die, welche sich so verhalten wie jene, von denen wir denken, dass sie sich richtig verhalten." "Ah, ha, aha!", stotterte Borlov verwirrt. Der Oberst erhob sich diskret, da er wegen eines Krampfes im grossen Gesässmuskel, der sich schnell auf die ganze Rückenmuskulatur ausdehnte, nicht mehr aus dem hohlen Kreuz heraus kam. "Es ist die stille Übereinkunft der schweigenden Mehrheit, die uns stark macht", fasste Regaz knapp zusammen. Borlovs Mine hellte sich auf. "Und sie bieten sich dem Volk als rettende Führung an, und es jubelt ihnen zu. Bestechend! ", strahlte er verstehend. "Faktisch ist es so, selbst wenn sie uns vorwerfen, wir würden das Volk ausnehmen. Kürzlich wurden wir in einer Fernsehsendung sogar als Plünderer und Bankrotteure des Staates beleidigt. Das tut weh. Als hätten wir es nötig, dem Hühnervolk die Eier zu stehlen!" "Wer sagt das? Ich bin empört, wenn ich an ihren Idealismus und ihre Selbstlosigkeit denke!" "Die Linke, das Fernsehen DRS, die Verräter an der schweigenden Mehrheit, die Untergraber unseres Rechtstaates, die Aushöhler der wahren Demokratie", legte Areznitz los. "Zum Glück gibt es Männer wie uns, Männer, die sich nicht beirren lassen in der Stunde der Gefahr", eine Aussage, die ihm einen weiteren Krampf bescherte. "Das mit ihrer Demokratie verstehe ich zwar nicht ganz, aber ich glaube, in der Sache sind wir uns einig. Als Kapitalisten sind wir in dieser historischen Stunde gefordert." Borlov schloss mit einem Lieblingsspruch seiner preussischen Grossmutter: "Wenn die Grütze ruhig im Topf schmort, fällt es dem Koch leicht, die Eier in die Pfanne zu hauen." "Gut gesagt, Borlov, ich bewundere die Bildhaftigkeit ihrer Sprache", lobte Regaz. "Aber genug der Worte, schreiten wir zur Tat." "Die Stunde ist gekommen, im Namen der grossen westlichen Demokratien die Hellebarden und Morgensterne gegen die Speere der atheistischen Diktaturen im Osten zu erheben", doppelte Areznitz pathetisch nach. "Sorgt für meine Frau und meine Kinder und ich will euch eine Gasse bahnen", zitierte er verklärt sein grosses Vorbild aus der Schlacht von Sempach anno 1286, den Urschweizerischen Nationalhelden Arnold Winkelried. "Und über die Leiche tritt das Heldenvolk im Sturmesschritt, nicht wahr Rolf", lächelte Regaz milde. Mit diesen Worten beendete er die Sitzung. Er stand auf, faltete den Klappstuhl und grüsste mit erhobener Hand. Dann öffnete er die gepolsterte Tür und verschwand in der Tiefe des langen Korridors, wie ein Schatten im hellen Licht. Kurz nach diesem Gespräch im Büro von Oberst Areznitz beschloss die geheime Führung der Gruppe "Armee Neue Urschweiz mit Nationalstolz" (ANUMNS) in Absprache mit konspirativen deutschen Natokreisen 1'000 Sturmgewehre StG53 mit je 10 kg GP11 und 2000 Panzergranaten mit Treibladung nach Estland zu liefern. Ausschlaggebend für die Wahl dieser Ausrüstung war ihr durchschlagender Erfolg in unzähligen Manövern der Schweizerarmee gegen ihre fiktive rote Übungsarmee, in denen seit Jahrzehnten immer wieder die Einsatzdoktrin "Panzerstopp im Mittelland" getestet wurde. Diese nach dem Krieg entwickelte revolutionäre Strategie hatte in den 50er Jahren den Reduitgedanken der Kreise um General Guisan abgelöst. Damals setzte sich die These durch, dass die Urschweiz eine grössere Chance hätte, von künftigen Kriegswirren verschont zu werden, wenn die Schlachten vor ihren Toren geschlagen würden. Das neue Abwehrkonzept setzte bewaldete Hügel, Seen und - damals im Schweizerischen Mittelland noch reichlich vorhanden - Moore im Operationsgebiet voraus. Für einen Landschaftstyp, wie er im Baltikum vorherrscht, drängte sich eine solche Art der Bewaffnung geradezu auf, insbesondere auch deshalb, weil von Militärattachés östlicher Länder für diese Verteidigungsart immer wieder viel Lob gespendet worden war. Wie Oberst Areznitz ausgeführt hatte, war das Ziel der Unternehmung die Schaffung eines militanten Klimas in Nordosteuropa. Das ganze hatte aber auch eine innenpolitische Komponente. Seit die 68er Bewegung im Ausland zerschlagen und in der Schweiz systemisch integriert war, gab es immer weniger Indizien und Beweise für die Steuerung oppositioneller Gruppen durch das verhasste Moskau. Das hatte die Wachsamkeit vieler guter Patrioten einschla4 fen lassen. Die Wehrbereitschaft lief Gefahr, furchtbar und nachhaltig geschwächt zu werden. Früher so zügige Slogans wie "Lieber tot als rot" durften bereits ungestraft permutiert und damit pervertiert werden. Wer seine Gegner früher mit Sprüchen wie "ab nach Moskau" abkanzeln konnte, wurde nun schon offen verdächtigt, Kuoni-Aktien zu besitzen. Selbst von gutbürgerlich Reisenden trafen zweideutige Kartengrüsse wie "Osteuropa hat uns" aus fast allen Teilen des verhassten Sowjetimperiums ein. Wer von Sibiriens Landschaften als "wie aus dem Bilderbuch" schwärmte, meinte damit sicher nicht Solschenizyns düsteren "Archipel GULAG". 5 Regaz Liebe Kameraden und Lebens- und Kampfgefährten! Ihr kennt mich alle unter meinem offiziellen Namen Rainer Regaz. Meinen richtigen Namen habe sogar ich fast vergessen. Ich will euch, Ihr Teuren, diese meine Erinnerungen überlassen. Verbindet sie würdig mit meinem Andenken. Die Abfolge meiner Lebensbilder beginnt mit einer braunen Früchteschale, die ich als kleiner Knirps in der elterlichen Stube in Griffweite brachte, indem ich am Tischtuch zog. Damals hiess ich noch Kurt Graf. Stolz brachte ich die Glasschüssel zu meiner Mutter in die Küche am Ende des langen dunklen Flurs. Vor ihren Augen liess ich die Schale jauchzend auf den Boden fallen, wo sie in tausend Scherben zersprang. Die Motive für meine Handlung kenne ich nicht, nur dass sie fröhlicher Natur waren. Obzwar es sich um meine erste Erinnerung handelt, ist sie nicht bedeutender als andere auch. Meine Mutter versohlte mir zu Recht tüchtig den Hintern. In meinen Gedanken tauchen Bilder auf, die sich mit meiner Jugend verbinden. Unser steinernes Haus ist gross und voller Geheimnisse, die es zu erkunden gibt. Mein Lieblingsort ist der Estrich. Hier riecht es nach Rauchkammer und brütender Sommerhitze unter dem Dach. Alte Schränke und Kommoden bergen neben altem Kram und verstaubtem Zierrat die Geheimnisse der vorherigen Generationen. Alte Röcke und Kleider meiner Urgrossmutter, die manchmal in nun ebenfalls längst verrauschten fastnächtlichen Zeiten wieder auferstanden sind, hängen fein säuberlich gebügelt in Leinensäcken. Was hat der Zylinder in der Hutschachtel zu tun mit meinem Vater, den ich nie mit einer solchen Kopfbedeckungen gesehen habe. Ausser vielleicht auf Fotos, die ihrerseits aus einer verschwundenen Welt stammen! Wer ist mit den riesigen Seekoffern, die aus der Zeit der Titanic zu stammen scheinen, in der Welt herumgereist? Wo sind die alten Gemälde einst gehangen, die jetzt abgedeckt an der Wand stehen? Die Dinge, die hier gelandet und eingelagert sind, haben ihren Bezug zur Gegenwart schon lange vor meiner Zeit verloren. Nur der Geruch hier oben ist mir vertraut. In der Räucherkammer hängen die schwarzen Fleischhaken und der würzige Duft zweier Schinken vom Schlachttag im letzten Herbst. Ihre Farbe bekamen sie vom Holzfeuer im Küchenherd. Im kleinen Verschlag gegen Süden steht neben Haartornister, Trinkflasche und Helmmütze das Langgewehr meines Grossvaters. Kisten mit Sand gegen Brand und zwei alte Gasmasken erinnern an Vorsichtsmassnahmen gegen befürchtete Fliegerangriffe im Weltkrieg. Aus dieser Zeit stammen auch die Kisten voller Rationalisierungskarten, die damals, als unsere Väter an der Grenze standen, in der Kolonialwarenhandlung meiner Eltern die Lebensmittelverteilung regelten. Auf einem Regal verstauben alte Geschäftsbücher, geschrieben in einer für mich unentzifferbaren, wunderschönen Schrift. In diesem Verschlag gab es eine seltsame Wendeltreppe, die noch viel weiter in die Vergangenheit zurückführte. Ich habe aber diese Treppe nur im Traume gesehen. Immer und immer wieder versuchte ich erfolglos ihr Geheimnis zu ergründen und bin traurig darüber aufgewacht. Später träumte ich nicht mehr. Für mich zählen jetzt, da ich das schreibe, nur noch die Realitäten. Realität ist das, was ich will und das, was sein muss. Den anderen Dingen hänge ich nicht mehr nach, weil es sinnlos ist und zu nichts führt. Am Boden des Estrichs, der sich abgesehen von einigen seitlichen Kammern über die Fläche des ganzen Hauses hinzog, lag ein Fahnenmast. An Festtagen wurde er mit einem Ende aus dem Südfenster gegen die Strasse geschoben, versehen mit dem breiten Fahnenwimpel, der bis auf die Höhe des ersten Stockes reichte. Noch heute, wenn sich die Häuser mit den Farben unseres stolzen Landes schmücken, sehe ich den Fahnenbaum unserer Familie vor mir, und ich höre die Flagge vor meinem Kinderzimmer im Winde knattern. Als mein Elternhaus abgerissen wurde, hätte ich gerne diese Stange gerettet und in meinem eigenen Garten aufgestellt, doch ihr Holz war wurmstichig geworden, wie so vieles andere in unserem Land. Im Norden des Estrichs befand sich eine Tür, die immer mit einem Riegel verschlossen sein musste, da sie ins Nichts führte oder genauer hinunter in den Abgrund auf das Kopfsteinpflaster im Hof. Mit Hilfe eines dicken Seils, das über eine Umlenkrolle an einem Baum über der Aussentüre geführt werden konnte, wurden nach Bedarf Lasten zwischen Estrich und Hof verschoben. Manchmal durfte ich mich von Vater mit dem Aufzugshaken am Hosengurt in schwindelerregende Höhen ziehen lassen. Obwohl ich an seinem Seil hing, fühlte ich mich ihm dann haushoch überlegen. An einer Pfette des Estrichs war ein kleines Holzkästchen mit fest verleimtem Deckel aufgenagelt. Es zu öffnen war uns allen streng untersagt. "Es schützt unser Haus. Wird es geöffnet, verliert es seine Wirkung", hatte mich die Grossmutter gewarnt und mir verboten, darüber mit jemandem zu sprechen. Ich glaube, nicht einmal sie selber 6 wusste, was darin verschlossen war. Viel später, als ich die Scheu vor Geheimnissen verloren habe, brach ich das Kästchen heimlich auf und fand die gesegnete Medaille der Muttergottes darin. Ich habe sie an Ort und Stelle gelassen und weiss nicht, was mit ihr geschehen ist. Gesprochen habe ich nie mit jemandem darüber. Auf meinen Streifzügen in die Vergangenheit liess ich eine Kammer meistens aus. Der Lattenverschlag gehörte zu der kleinen Wohnung im zweiten Stock des Hauses, die an ein älteres deutsches Ehepaar, die Schulzes, vermietet war. Schulzes Estrichkammer war mir unheimlich wegen der vielen Gehstöcke, die dort aufbewahrt wurden. Die beiden älteren Leute waren behindert. Der Mann hatte eine Beinprothese, die nach seinem Tod ebenfalls im Estrich aufbewahrt wurde. Bis heute habe ich ich Krankheit und Gebresten verabscheut. Wenn ihr diese Zeilen lest, mag Gott mir einen frühen Tod beschert haben, der mich davor bewahrte! Schulzes Wohnung besass neben Küche und Toilette nur eine Stube und ein Schlafzimmer. An Herrn Schulze habe ich nur undeutliche Erinnerungen. Wenn ich ihn mir vorstelle, sehe ich ihn tot im offenen Sarg liegend, umstellt von süsslich riechenden Kerzen und Blumen. Die alte Frau hingegen haben wir Kinder häufig und gerne in ihrer altmodischen Stube besucht. Sie sass immer unter einer runden Ständerlampe, beschäftigt mit einer Stickerei. Ich glaube sie besass einen Kanarienvogel, der sprechen konnte. Auch sie starb zu Hause im eigenen Bett. Meine Mutter hat sie bis in den Tod begleitet. Nach der Waschung ihrer Leiche durften ich sie anschauen gehen. Ich erinnere mich noch, wie sie im weissen Totenhemd unnatürlich steif wie ein Brett auf ihrem Bette lag. Erst nachher wurde sie im gleichen Zimmer wie schon früher ihr Mann im offenen Sarg aufgebahrt. Nur wenige Menschen kamen auf Besuch, um Abschied zu nehmen. Wenn ich sehe, wie wir heute mit unseren Toten umgehe, kommt es mir oft vor, als wäre ich im Mittelalter aufgewachsen. Ich verliere mich bei solchen Gedanken in den alten Zeiten und möchte nicht mehr in die Gegenwart zurückkehren. Die Gefühle, die mich dann bedrängen sind sehr schlimm und ich kann sie fast nicht ertragen. In der Ecke von unserem Hühnerhof stand ein Apfelbaum. Der Baum war nicht besonderes gross, trug aber enorm viele Früchte. An ihm wuchsen zwei verschiedene Apfelsorten, eine saure und eine süsse Sorte. Der saure Apfel war grün und ungeniessbar, der süsse rot und schmackhaft. Ich habe lange nicht begriffen, dass am gleichen Stamm so verschiedene Früchte wachsen können. Ich verstand nicht, warum es dem Baum erlaubt wurde, neben den guten auch schlechte Früchte zu tragen. Zwar kannte ich die Geschichte von Kain und Abel, doch konnte ich den Zusammenhang damals nicht erkennen. Als ich endlich begriff, habe ich die Äste mit den sauren Äpfeln zum Ärger meines Vaters weggeschnitten. Mein Vater war viel zu weich gegen das Schlechte. Ich selber wusste mich auf der Seite des Guten, daran hat sich bis heute nichts geändert. Die grossen Apfelbäume standen auf der Wiese gegen Süden. An schönen Tagen erhob sich hinter dem Baumgarten der Pilatus. Im Herbst musste ich am Morgen, bevor ich in die der Schule ging, die Äpfel auflesen. Das unreife Fallobst spiesste ich auf Stecken. Damit schleuderten ich die holzigen Äpfelchen über die Dächer der Nachbarhäuser oder auf weit entfernte Passanten. Nie hat mich jemand dabei erwischt. Die guten Äpfel wurden unter dem Blechdach der Scheune mit einer Handhäckselmaschine zerkleinert und in das grosse Schnapsfass befördert. Am Ende des Herbsts wurde dieses Fass fest verschlossen und sein Inhalt der Gärung überlassen. Geöffnet wurde es erst wieder, wenn der Schnapsbrenner mit seiner von einem alten Gaul gezogenen Schnapsbrennerei von Hof zu Hof zog. Offiziell wurde der Apfelschnaps bei uns zu Hause zur Pflege der zwei Kühe verwendet. Ich glaube, das war nicht der einzige Kasus, wo sich mein Vater nicht ganz gesetzestreu verhielt. "Gesetze schützen die Dummen, also sollen sich die Toren daran halten", brachte er mir bei. Zu Bäumen habe ich eine ganz besondere Beziehung. "Wer hat dich du schöner Wald, gepflanzt so hoch da droben" war schon in der Primarschule mein liebstes Lied. Daran hat sich bis heute nicht geändert. Wenn es mir vergönnt sein wird, werde ich mir zum 80. Geburstag am Radio dieses ergreifende Lied wünschen, gesungen von kernigen Männerstimmen. Aus meiner Gymnasialzeit ist mir von der deutschen Literatur nur Hölderlins "Die Eichbäume" lebhaft in Erinnerung geblieben. Wenn ich dieses Gedicht rezitiere, verbinde ich noch heute seine Verse in meinen Gedanken mit dem hehren Bilde unseres die Freiheit so innig liebenden Volks. Leider musste ich in meinem Leben diese Gefühle häufig verstecken. Zeigen konnte ich sie nur Euch und ganz besonders meinem väterlichen Freund Rolf Areznitz, Gott hab ihn selig.. In der Primarschule war ich mit einem Jungen aus der Nachbarschaft befreundet. Mit ihm traf ich mich häufig auf einem krummen Boskoopapfelbaum. Versteckt in der Blätterkrone gestand er mir einmal, er möchte Missionar werden, weil in Afrika alle Frauen nackt herumliefen. Ich bin ganz rot geworden und habe mich furchtbar geschämt. Selber wäre ich auch gerne Missionar geworden, 7 freilich aus edleren Motiven. Damals habe ich noch geglaubt, dass nur das Christentum uns retten kann vor dem Kommunismus. Schliesslich hat das Christentum den Ausgleich geschafft zwischen den Ansprüchen des einzelnen und denen der Gemeinschaft. "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst bedeutet eben so sehr, dass du dich selber wie den Nächsten lieben sollst", lehrte uns der Pfarrer am Sonntag in der Christenlehre3. Mein Freund fragte mich nachher auf dem Apfelbaum, ob das wohl auch gelte, wenn Homosexualität und Onanie im Spiel sei. Wieder wurde ich furchtbar rot. Solche Sprüche haben mich dann bewogen, diese Baumbeziehung abzubrechen. Nahe bei der Scheune stand ein Birnbaum. Die ausladenden Äste waren auf Hochglanz poliert durch unsere Kinderhintern. Ich kannte jeden seiner Knorren, jedes Ästchen und jeden Stummel. Ihn zu erklettern war allerdings nicht ganz einfach und nur dank einer grossen Faulstelle im Stamm möglich. Faulstellen sind auch die Trittstellen jeder Karriere, nicht wahr? Auf Bäume geklettert bin ich seit meiner frühesten Jugend. Im Laufe der Jahre haben sich die Kletterobjekte ständig gewandelt. Bald genügte die Herausforderung des Holunderbaums im Hühnerhof nicht mehr. Jetzt wurde die Höhe alter Tannen gesucht, deren Äste sich wie die Stufen einer Wendeltreppe emporwinden. Welche Lust war es, eine der riesigen Tannen im Park meiner Klavierlehrerin zu besteigen und hinauf zu klettern bis zu ihrem Kobold an der Spitze. Wie klopfte das Herz in so schwindelnder Höhe. Auf Platanen zu steigen hingegen ist sinnlos. Ihre Rinde ist glatt. Äste fehlen zwischen den Verzweigungen. Kein Hauptstamm führt hinauf zum höchsten Punkt. Ich hasse Platanen, weil sie mich an die aalige Glätte und Charakterlosigkeit gewisser Politiker erinnern. Der Klettertrieb unserer Jugendjahre wurde auch klerikal gefördert. Von unserem Pfarrer wurde immer wieder der heilige Don Bosco als leuchtendes Beispiel eines Jungen hingestellt, dem es gelungen sei, dank Bäumeklettern keusch zu bleiben. Ich habe meine Zweifel an dieser Geschichte. Mir jedenfalls hat diese Methode nicht sehr geholfen. Soviel zu meinen geliebten Bäumen! Einmal im Spätherbst wurden jeweils in der Dunkelheit des frühen Morgens das Mastschwein getötet und ausgeblutet. Bevor wir es durch mit einem Haken versehene Metallhörner entborsteten und entklauten, wurde es in eine Holzstande mit kochend heissem Wasser gelegt. Während mein Vater das Schwein ausnahm, wurde von der Mutter das Blut für die Würste gewürzt und aufbereitet. Dieses jährlich wiederkehrende Ereignis, auf das sich alle ausser das Hausschwein - Ihr seht meine Freunde, Euer Rainer hat seinen Witz bis zum Schluss behalten- freuten, hat mir zu einer natürlichen Beziehung zum Töten verholfen. Sicher ist das der Grund dafür, dass ich jegliche Art von Vegetarismus, übrigens genau so wie den Kommunismus und alle anderen "Ismen", für eine der menschlichen Natur zuwiderlaufende Ideologie halte. Ich lehne sie als inhuman im Sinne des Wortes ab. In einem Anbau der Scheune befand sich die Waschküche und aufgemauert auf ihr ein Magazin. Es war über eine Steintreppe erreichbar, die auf eine Rampe hinauf führte. Im Hinterteil des Magazins befand sich oben unter dem Dach ein grosser Holzverschlag, der Getreidesilo. Die Säcke mit den Getreidekörnern wurde mit einem Brückenwagen zur Rampe vor dem Magazin geführt. Von der Rampe aus wurde eine Rutsche bis hinauf zum Silo eingerichtet, auf der die Säcke mit Hilfe eines Seilhakens hinaufbefördert wurden. Das Seil wurde oberhalb des Silos über eine Umlenkrolle, dann wieder hinunter zur Rampe und von dort auf den Hausplatz hinaus geführt. Hier wurde es an das Zuggeschirr des Pferdes gebunden. Das Pferd wurde dann solange vor und zurückgeführt, bis alle Säcke oben waren. Wie habe ich diese langweilige Arbeit gehasst. Viel lieber wäre ich hoch zu Ross durch die Prärie galoppiert und hätte Rothäute gejagt. Nicht dass ich etwas gegen Menschen anderer Hautfarbe gehabt habe. Auch heutzutage nicht. Aber es stört mich doch, dass wir jetzt nicht mehr sprechen dürfen, wie uns der Schnabel gewachsen ist! An der seitlichen Aussenwand des Magazins gab es eine Aussenkellertreppe, auf der die unterirdische Waschküche erreichbar war. Neben einem Holzofen zur Heisswasseraufbereitung und einem Brunnentrog stand darin eine Wäscheschleuder mit Wasserantrieb. An den Waschtagen erschienen jeweils zwei Waschfrauen, die zusammen mit Mutter und Köchin Berge von Wäsche laugten und kochten. Vater und die Knechte spannten im Baumgarten die Wäscheleine, die durch Wäschestangen unterstützt wurde. Die sauber gespülte Wäsche trugen die Frauen auf einer Trage, einer Art Bahre mit Stützfüssen, von der Waschküche zur Leine und hängten sie dort auf. Bei schlechtem Wetter brachten sie sie zum Trocknen in den Estrich des Hauses. Für die Frauen war das harte Arbeit. Die heutigen Feministinnen sollen sich das hinter die Ohren schreiben, wenn sie neben gleichem Lohn auch gleiches Recht auf Arbeit für die Frauen fordern. Ich bin froh, durfte ich noch in einer heilen Welt aufwachsen. 3 Sonntagsschule der Katholischen 8 "Ohne Fleiss kein Preis", predigten meine Eltern. Ich habe mir ihre Worte zum Motto meines Lebens gemacht. Ich weiss, propria laus sordet4, aber ich bin gut gefahren mit diesem Grundsatz meiner Eltern, nicht wahr? Weil ich Priester werden wollte, durfte ich studieren. Am Anfang hatte ich das auch wirklich vor. Später kam ich vom Beruf des Klerikers weg, weil ich keine göttliche Berufung spürte und weil mir das Gebot ewiger Keuschheit unerfüllbar schien. Nach dem Tod meiner religiösen Grossmutter habe ich aufgehört, die Eltern weiterhin zu täuschen über meine wahren Berufswünsche. Im Kollegium einer Klosterschule kam ich in Kontakt mit den höheren Kreisen der Gesellschaft. Die Väter einiger Klassenkameraden waren Ärzte oder Juristen. Aus dieser Zeit stammen meine guten Beziehungen zu politischen und wirtschaftlichen Machtzirkeln. Damals begann ich mich mehr und mehr zu verstecken. Ich erinnere mich, dass ich in einer Schultheateraufführung eine grössere Rolle übernehmen musste. Ich hatte zuerst grosse Bedenken, da ich befürchtete, mich auf der Bühne selbst offenlegen zu müssen. Das Gegenteil war der Fall. Ich weiss nun, dass es keinen besseren Ort gibt auf der Welt, sich zu verstecken als hinter einer Bühnenrolle. Um mich zu verbergen, machte ich konsequent auf Opportunismus. Ich versuchte, nicht anzuecken und nur aus dem Hintergrund zu agieren. Meinen Kollegen gegenüber gab ich mich indifferent. Ich wurde deswegen nicht gehasst, aber auch nicht geliebt. Auf Grund meiner grossen Bewunderung für unser Vaterland trat ich in eine Studentenverbindung ein. Hier lernte ich den Altherrn Rolf Areznitz kennen, meinen späteren Freund, der in dieser Zeit Privatdozent an der Militärabteilung der ETH in Zürich war. Mit grosser Inbrunst sang ich an den bierseligen Kommersen - mit Wehmut denke ich daran zurück - den "Riesenkampf", den "Schweizerpsalm", oder das "Sempacherlied". Letzteres ist übrigens eines von Rolfs Lieblingsliedern geblieben, neben Friedrich Silchers "Zu Strassburg auf der Schanz" und Amiels "Roulez, tambours!". An der Universität studierte ich Jurisprudenz und schloss mit einer Doktorarbeit über Militärstrafrecht ab. Nachher bin ich spurlos in der Bundesverwaltung und im diplomatischen Corps aufgegangen und später kosmetisch leicht verändert als Rainer Regaz, ehemals Auslandschweizer und Konvertit, in Zürich wieder aufgetaucht. Aus staatspolitischen Gründen, die ihr meine lieben Freunde kennt, habe ich auf Ehe und Familie verzichtet. Meine wahre Biografie habe ich seither aus Liebe zu unserem Vaterland stets verleugnen müssen. Unglücklich darüber bin ich aber nie gewesen, schon darum nicht, weil ich immer hoffte, dass meine Vergangenheit irgend einmal aufhören würde, mich zu bedrängen. Doch nun lebt wohl meine Lieben! Und bedenkt der Worte: De mortuis nil nisi bene5. Diese Zeilen sind Bestandteil meines Testaments. Sie sollen nach meinem Ableben im Kreise meiner Freunde vorgelesen werden. Auf meinen Grabstein setzt die Worte: "Mundus vult decipi, ergo decipiatur"6. 4 lat. "Eigenlob stinkt". lat. "Von Toten (rede) nur Gutes". 6 lat. "Die Welt will betrogen sein, darum werde sie betrogen!". 5 9 Tauschgeschäft Das schwierige Unternehmen Schweiz-Estland kommt nun rasch in Gang. Stäbe werden aufgebaut. Für reanimierte Reservisten gibt es Wiederholungskurse zur Auffrischung altbewährter geheimdienstlicher Techniken wie "Die Tarnung mittels der Enttarnung", "Kidnapping im Kampf gegen Erpressung" oder "Konservierendes Ob- und Abservieren." Grosse Sorgfalt wird auf die Entwanzung des höheren Kaders und ihrer Büros verwendet. Regaz nannte die dafür zuständigen Spezialisten aus Sicherheitsgründen Kammerjäger. Als Dienstabzeichen trugen sie die Tzylindrige Spritzpumpe. Eilig wurde ein bereits in den 60er Jahren gegründeter, in den 70er Jahren mühsam geäufneter und von verschiedenen europäischen Vertriebenenorganisationen gespiesener Fond reaktiviert. Als Stiftungspräsident waltete Rainer Regaz, eine dubiose Figur, deren oberflächlichste Ebene seiner mehrfachen biografischen Tarnung später im Laufe der schweizerischen Fichenaffäre teilweise aufflog, respektive preisgegeben wurde. Mit inoffiziellem Wissen der Abteilung Rüstung des Eidgenössischen Militärdepartements (EMD) kaufte Regaz mit Geldern dieses Fonds die gewünschten Waffen samt Munition aus Ausmusterungsbeständen der Schweizerarmee. Die Kaufsumme landete in einer Spezialkasse des EMD, die der parlamentarischen Kontrolle bis heute entzogen ist. Es wird gemunkelt, dass zur Verschleierung des Transfers Einbrüche in abgelegene Munitionshäuschen der Schweizerarmee vorgetäuscht worden seien. Laut Aussagen eines ehemaligen Zeughäuslers sei das dabei "erbeutete" Kriegsmaterial vorläufig im Zeughaus Sarnen unter einem Berg von feldgrauen Mützen eines aus der Mode gekommenen Ausgangstenüs deponiert worden. Mit der Organisation des Transports der Waffen nach Estland wurde Altoberst Rolf Areznitz betreut, dessen Familie einst aus Armenien in die Schweiz geflohen war. Wurde er auf seine Herkunft angesprochen begann er, sich durch nichts in der Welt bremsen lassend, munter drauflos zu schwafeln: "Meine Vorfahren hatten das Glück, in den Schweizeralpen einen echten Ersatz für ihre vaterrechtlich geprägte, bergige Urheimat zu finden, vielleicht den letzten Hort freien und urchigen Männertums, denn viele Länder - mit angemessenem und vergleichbarem Lebensstandard wohlverstanden - gibt es ja leider nicht mehr, in denen das Frauenstimmrecht noch als das bezeichnet werden darf, was es in Wahrheit ist: Ein Verbrechen gegen die Natur, insbesondere gegen die Natur des Berglers, ein Vergehen, schlimmer noch als die Errichtung gemeinsamer Badeanlagen für Frauen und Männer an den ursprünglich sittlich reinen Seen des Mittellandes - ich sehe den Teufel, wie er die Befürworter herunterzieht - oder die Koedukation an den früher keuschen Dorfschulen, deren Einführung, wie heute sogar die Feministinnen zugeben, erst zur wahren Unterdrückung der Frau führt oder das scheussliche und unsittliche neue Eherecht, das den Ehefrauen erlaubt, den eigenen Namen zu führen, nur noch zu vergleichen mit der Zulassung des Weibes zur Armee, dieser urmännlichen und damit im Sinne des Wortes menschlichen Institution der Selbstverteidigung und Befriedigung, excusez-moi, Befriedung." Nach diesem Herzenserguss seines betagten Freundes pflegte Regaz beschwichtigend Ciceros Sentenz "Patria est, ubicumque est bene7" zu zitieren. Als Assistentin erhielt der greise Oberst eine junge Frau namens Jill Kehl zugeteilt, eine Person, die das Abenteuer liebte. "Ich war leicht für diesen Job zu gewinnen. Das aus der Normalität Verrückte hat mich schon immer angezogen", bekannte sie rückblickend. "Diese kalten Kriegsgruftis hatten ja längst Blaueis angesetzt und standen mit ihrem Vorhaben und ihren abstrusen Ideen etwa so vielversprechend in der Landschaft wie das Firneis eines abschmelzenden Gletschers." Als Gymnasiastin hatte Jill Kehl russisch gelernt und war ab und zu über Helsinki nach Leningrad gereist. Dort machte sie Bekanntschaft mit einem Sowjet namens Boris Lattem, einem Metallurgen und Spezialisten für Kernwaffen. Er arbeitete in einer Spezialeinheit zur Abwrackung und Verschrottung ausgedienter und verrosteter A-Waffen der Marine. Seit Jill Kehl das Sekretariat der ANUMNS führte, traf sie sich in Leningrad mit Lattem allerdings nicht mehr bloss zufällig, weil dieser inzwischen vom KGB auf Kehl angesetzt war. Eine seiner Aufgaben bestand darin, den sowjetischen Geheimdienst über die Aktivitäten des Schweizerischen Ostinstituts auf dem Laufenden zu halten. Jill Kehl hatte nichts dagegen, da sie sich dank ihrer Bereitschaft zur geheimdienstlichen Zusammenarbeit in der Sowjetunion relativ frei bewegen konnte. Sie glaubte, dass sie mit ihren gelegentlichen Informationen an Lattem niemandem ernsthaft schadete. Dem KGB habe sie nur unwichtige Informationen zugespielt, etwa die Namen von Exilrussen oder im Ausland wohnender Dissidenten aus andern Oststaaten. Deren Briefkästen seien tot gewesen. Ihre Fichen hätten längst von jedem Geheimdienst eingesehen werden können, der sich ernsthaft für 7 lat. "Das Vaterland ist überall, wo es gut ist." 10 solche Marginalitäten interessierte, gab sie später der Parlamentarischen Untersuchungskommission zu Protokoll. Mit den schweizerischen Behörden hatte sie keine Probleme, da sie ja für das renommierte Ostinstitut unterwegs war. Nur von einem Beamten der kantonalen politischen Polizei wurde sie periodisch vor den Spitzeln des KGBs gewarnt, da Areznitz es als zu gefährlich erachtet hatte, subalterne Stellen über die wahren Gründe von Kehls Reisen in den Ostblock zu orientieren. Seine Ermahnungen seien lächerlich gewesen, erinnerte sich Jill Kehl. So habe er ihr empfohlen, Knoblauchtabetten zu essen, um sexuelle Annäherungsversuche von KGB-Agenten im Keim zu ersticken. Ausgerechnet Knoblauch gegen Russen! Da die meisten Geheimnisse im Schlaf ausgeplaudert würden, habe sich dieser elende Lüstling, dummdreist wie er war, anerboten, eine Nacht mit ihr im Bett zu verbringen. Nur so könne geklärt werden, ob sie im Schlaf spreche! Lattem war seiner Zeit voraus. Als er merkte, dass die Sowjetunion im Begriffe war, sich aufzulösen, begann er mit dem Diebstahl von waffenfähigem Plutonium8 aus Armeebeständen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich zwischen Jill und Boris eine Art platonisches Vertrauensverhältnis. Eines Tages erfuhr er durch sie vom Lieblingsplan der ANUMNS, dem "Traum der Träume", wie Oberst Areznitz nach dem Genuss eines halben Glases Wodka jeweils gerührt zu schwärmen pflegte. Dabei ging es um die Beschaffung von waffenfähigem Plutonium für die atomar unbewaffnete Schweiz. Lattem witterte das Geschäft seines Lebens. Er verriet Jill das Geheimnis seines Plutoniumdiebstahls. Jill erfuhr in diesem Gespräch ausserdem von einer geheimnisvollen Substanz, dem roten Mercurium. "RedMercury heisst sie in den USA", erklärte Boris. "Und was lässt sich damit anstellen?" fragte Jill. "Die Militärs der ganzen Welt sind verrückt danach, weil dieses Antimon-Quecksilber-Gemisch so hilfreich ist beim Zünden von Plutoniumbomben! Ich kenne das Geheimnis dieses Stoffes und besitze genug davon, um jedem Abnehmer meines Plutoniums grosse Freude zu bereiten." Lachend fügte er hinzu: "Du hast mich nun in der Hand." Für die Obristen in der Schweiz eröffneten sich in der Person Lattems alte Horizonte in ganz neuen Perspektiven. Die völlig geheime, internationaler Kontrolle entzogene Beschaffung von kernwaffenfähigem spaltbarem Material war noch nie so greifbar nahe. Peinlicherweise liess sich die Schublade im Schreibtisch von Rainer Regaz, in der dieses Projekt unter dem Namen XP3 schon fast vergessen schlummerte, nicht mehr öffnen. Das verrostete Schloss des Pultes, das Regaz an einer Auktion von Bismarcks Büromöbeln erstanden hatte, wurde schliesslich durch einen in die Sache eingeweihten Schlosser aus einem alten Zofinger Familienunternehmen geölt und restauriert. XP3 konnte anlaufen. Die erste Phase sah die Einberufung einer ausgewählten Gruppe von Spezialisten und Eingeweihten vor. Der inzwischen ergraute Institutchef einer ehemaligen reaktorphysikalischen Abteilung der ETH brach in Tränen aus, als er den hochgeheimen Marschbefehl erhielt. Zum Ärger von Regaz erschien der emeritierte Professor in Gefreitenuniform zum Treffen. Eingeladen war auch ein bereits in seiner Amtszeit mitmischelnder heutiger Exdivisionär, ein beliebter Panzergeneral und der Mitbegründer einer dem Parlament nicht zugänglichen Bundesabteilung zur Förderung der geheimen Landesverteidigung. Dieser alte Haudegen liess sich aber entschuldigen, da er seinen Lieblingsjeep, ein kugelgespicktes Relikt aus dem zweiten Weltkrieg nicht mehr fahren dürfe. Das Strassenverkehrsamt hatte ihn aus medizinischen und materialtechnischen Gründen als fahruntüchtig erklärt und nicht mehr zugelassen. Da Regaz der Sache mit dem RedMercury nicht traute, bat er den Nuklearphysiker John Zufall vom Imperial College um das Einführungsreferat des Treffens. Zufall hielt seinen Vortrag auf Englisch. Nicht alle der Anwesenden verstanden ihn, kaum einer begriff den Inhalt seiner Ausführungen. Jill Kehl, die das geheime Sitzungsprotokoll schrieb, übrigens die einzige Frau in der Runde, wurde um eine Zusammenfassung gebeten: "Laut Aussage von Frank Barnaby, Experte für Nuklearwaffen, soll ein russischer Politiker9 neuerlich zugegeben haben, dass die hier zur Diskussion stehende Substanz existiert. Es müsse sich um eine verflüssigte Antimon-Quecksilber-Mischung handeln, die in einem Reaktor oder in einem Teilchenbeschleuniger mit Californium 252, ‘an extremely good emitter of neutrons’, angereichert werden dürfte. Professor Zufall meint, dass die schweren Antimon und Quecksilberatome, im richtigen Verhältnis genommen, ein Gitter bilden könnten. Plutonium dürfte durchaus fähig sein, in die dadurch entstehenden Hohlräume einzudringen. Zweifelsohne verspreche dieser neuartige Stoff, der bis zu 2'000 US-Dollar ‘per ounce’ 8 "A terrorist with a little technical know-how and 20 pounds of smuggled plutonium could make a bomb powerful enough to destroy a city. That's what we should be worried about." U.S.Pentagone official, NY Times, May 13, 1996 9 Es dürfte sich um den späteren Energieminister Mikhailov gehandelt haben. 11 auf dem Schwarzmark gehandel werde, eine wesentliche Verkleinerung der für eine Atombombe benötigten Plutoniummenge." John Zufall erhielt eine Standing Ovation. Nach seinem Abgang meinte der jüngste der Anwesenden, ein 59-jähriger Strahlenschutzbeauftragter des EIR10: "RedMercury ist also eine durchaus ernst zu nehmende Substanz und nicht nur die neueste Version eines pervertierten Alchimistentraumes. Es wäre unverantwortlich, dieses vielversprechende Elixier unseren roten Feinden zu überlassen." Die Begeisterung war gross und der gefreite Professor wurde mit weiteren Abklärungen betraut. An der denkwürdigen Sitzung in Areznitz' engem, mit den eingeladenen Koryphäen vollgestopften Arbeitszimmer wurde beschlossen, eine Gesellschaft zur Beschaffung von Plutonium zu gründen. Sie solle unter dem Deckmantel "Metallica" in Erscheinung treten. Auf Vorschlag Regaz' setzte die Versammlung einen Mann namens Max Salg als deren Verwalter ein. Dieser Salg trat als Makler an der Metallbörse auf. 10 Eidgen. Institut für Reaktorphysik, später mit dem SIN zum Paul Scherrer Institut (PSI) zusammengelegt. 12 Die Nacht in der Gondel Regaz hatte Max Salg vor einigen Jahren in einer eiskalten Nacht im Berner Oberland kennengelernt, als sie zusammen auf der letzten Talfahrt versehentlich in einer Seilbahnkabine zwischen zwei Masten, hoch über der Piste hängend vergessen worden waren. Während der ersten drei Stunden hatten die beiden Unglücksraben auf ihrem exponierten Hochsitz biografische Daten ausgetauscht. Regaz erfuhr von Salgs beruflicher Tätigkeit an der Metallbörse, dass er unverheiratet und kinderlos war, im Zürcher Niederdorf eine Wohnung besass und dort relativ ruhig lebte. Salg musste mit der uninteressanten Biografie von Regaz dritter Tarnebene vorlieb nehmen. Es war ja zu befürchten, dass zu ihrer Befreiung aus der Gondel die Presse erscheinen würde. Regaz tat so, als wäre er von seiner Frau geschieden und gab sich als Vater zweier mündiger Kinder aus, die zusammen mit ihrer Mutter im Ausland lebten. Seine wahre Berufung habe er nach der Lateinmatur - von diesem Ausbildungsgang konnte er sich in keiner seiner vielen Biografien trennen - in der Versicherungsbranche gefunden. Er leide unter der hohen Alimente, die er für ungerecht halte. Seine Exfrau habe schliesslich einen Neuen...und so weiter und so fort. Wohl nur noch Regaz wahre Biografie hätte Salg mehr langweilen können. Eine Biografie braucht ja nicht a priori spannend zu sein, nur weil sie sich unter mehreren Tarnebenen versteckt. Es war also an der Zeit das Thema zu wechseln. Die beiden waren ja gezwungen, das Gespräch in Gang zu halten, denn wären sie eingeschlafen, hätte das den sicheren Tod bedeutet. "Sind sie auch fasziniert von Computern?", wollte Regaz im Laufe der langen Nacht von Salg wissen, als sie zwangsläufig auch auf dieses vieldiskutierte Thema stiessen. "Faszinieren kommt von lateinisch «beschreien, verhexen». Ich habe im lateinischen Wörterbuch nachgeschaut", fuhr Regaz fort. "Hinter fascinare fand ich das Wort fascinum zu übersetzen mit «männliches Glied». Ich nehme an, dass beide Wörter etymologisch verwandt sind. Was glauben Sie, Salg? Weist nun meine Computerfaszination auf eine latente Schwulheit hin, oder ist sie einfach Ausdruck einer Fixierung auf den eigenen Schwanz?" Die beiden lachten, soweit das die eingefrorene Gesichtsmuskulatur zuliess, über das, wie Regaz betonte, Witzchen unter Männern, das sicher erlaubt sei, besonders unter diesen Umständen. "Schwierig zu sagen, was uns am Computer verhext", meinte Salg. "Die Freude an ihm kann nicht oder zumindest nicht nur in der gängig gemachten Annahme begründet sein, wir hätten dank seiner Hilfe die täglich anfallende Arbeit besser im Griff", sinnierte er. Diese Begründung halte er eher für einen Vorwand. So wild sei er ja nun auch wieder nicht darauf, fehlerfreie Papers und Flyers mit wohl gestaltetem Text und richtig plazierten Grafiken zu gestalten. "Manchmal muss ich das zwar tun und dann bin ich froh, in meinem Bestreben nach Perfektion von einem Elektronengehirn unterstützt zu werden. Aber ehrlich gesagt, viele Arbeiten erledige ich nur deshalb mit dem Computer, weil ich mir und meiner Umgebung dann einreden kann, der finanzielle Aufwand für meine teure Anlage und der zeitliche für den Erwerb meiner EDV-Kompetenz habe sich gelohnt." Regaz versetzte ob dieser Worte vor Begeisterung die Gondel in Schwingung: "Das, was Sie soeben so offen ausgesprochen haben, könnte ich nicht einmal meiner Frau gegenüber zugeben. Wäre meine Computerleidenschaft nur mit der Erleichterung der Arbeit zu begründen, dann müsste ich mich schon fragen, warum auf meiner Festplatte unzählige Programme liegen, die ich überhaupt nie benütze. Von einigen habe ich sogar vergessen, dass sie existieren. "Wozu dient denn das schon wieder?", frage ich mich belämmert und leicht beschämt, wenn ich per Zufall auf so ein Artefakt stosse. Sicherheitshalber lasse ich es dann aber doch stehen. Vielleicht braucht es ja die "Kiste", vielleicht wird es in ferner Zukunft unabdingbar für den Betrieb eines Programms, das ich möglicherweise einst geschenkt kriegen oder auch klauen werde." Salg hauchte in seine klammen Hände: "Solange ich genug Speicherplatz habe, lasse ich sowieso alles stehen und..." "Mit diesem Argument erhalten bei mir sogar veraltete Programmversionen das Gnadenbrot", fuhr Regaz aufgeregt dazwischen. "Noch nie habe ich ohne Not einen Druckertreiber gelöscht, denn vielleicht werde ich einmal in einer verlassenen Alphütte froh sein, wenn ich mit meinem Powerbook einen Drucker betreiben kann, der dort aus irgend einem Grund liegen geblieben ist, ha, ha, ein Witzchen darf schon sein, nicht wahr, ha,ha..." "...ha,ha", nahm Salg den Faden wieder auf. "Ich lasse mir schon seit geraumer Zeit keine Programme mehr schenken, und wissen Sie warum?" "Sie meinen diese kleinen Hilfsprogrämmchen und Schnäppchen, die uns Freunde und Feinde zukommen lassen?" "Genau! Ich weise sie strikte zurück, weil ich den ganzen Plunder nachher nicht mehr los kriege! Übrigens wie halten Sie es mit Updates und Upgrades?" Auf diese Gretchenfrage eines Computerfreaks hatte Regaz nur gewartet. 13 "Noch nie habe ich ein Update verpasst, weder beim System noch bei meinen Programmen. Ich mache auch dann Updates, wenn ich eigentlich gar nichts vermisse". "Ich habe nichts anderes erwartet", kommentierte Salg seinen Vorredner mit mildem Spott. Und weil er sich nicht mehr auf seine kalten Füsse konzentrieren musste, da er sie ohnehin nicht mehr spürte, fuhr er sarkastisch fort: "Und warum tun Sie es? Ich sage es Ihnen. Updates zu verpassen ist gefährlich. Jede Altversion läuft Gefahr, irgendwann den Anschluss an die Zukunft gänzlich zu verlieren. Da nehmen wir dann schon lieber die Mühen derer auf uns, die ..." - Salg wurde unterbrochen durch eine Lawine, die unter der Seilbahn durchdonnerte und enormen Staub aufwirbelte - "...an der Front stehen." Und nach einer kleinen Pause, in der er einen kleinen Eiszapfen aus seiner Nase brach: "Natürlich, Updates haben ihre Tücken. Manchmal laufen die alten Sachen nicht mehr oder das System wird instabil. Neue Bugs ersetzen die durch das Update eliminierten. Die in der Folge von Programmerweiterungen oft auftretenden Speicherprobleme hingegen lassen sich mit etwas finanziellem Aufwand meistens schnell lösen. Nicht immer ist die ganze Anlage auszuwechseln oder der Powerchip zu upgraden, nur weil die alte Anlage durch das Update zur Datenschnecke mutierte." "Und vergessen Sie nicht", liess Regaz die Gondel erdröhnen, "Investitionen zur Temposteigerung lassen sich innerhalb der Familie...mhm....., denke ich jedenfalls, bestens begründen, da mit mehr Tempo Computerzeit eingespart werden kann ". Als die beiden schon nahe am Erfrierungstod waren, fragte Regaz den Metallmakler, und er gab sich dabei betont naiv, ob waffenfähiges Plutonium auch zu seinen Geschäften gehöre. Salg verneinte mit klappernden Zähnen, meinte aber, der Handel mit Kernwaffenmaterial dürfte - obwohl schwierig - nicht unmöglich sein, falls es gelänge, mit der russischen Mafia, "der kommenden Macht im Osten", ins Gespräch zu kommen. Mit den richtigen Leuten im Rücken könnte er sich, wenn Not am Manne sei, da durchaus weiter vorwagen. Die lange Nacht neigte sich damit ihrem Ende zu. Wenn sich zwei Männer so lange so nahe gesessen sind, und sie sich in einer so extremen Situation so glänzend verstanden haben, hinterlässt das tiefe Spuren in ihrer maskulinen Psyche. Max wurde Rainers Freund, und als sich die Gondel endlich wieder in Bewegung setzte, boten sie sich das nach solchen Erlebnissen unvermeidliche "du" an. In die ANUMNS aufgenommen wurde Salg mit dem üblichen Ritual. Dazu gehörte die Unterschrift unter einen 40-seitigen Vertrag, dessen Kleingedrucktes sich 30 Tage nach der Unterschrift zuerst verflüchtigte und dann sinnentstellt wieder einstellte. 14 Nachrichtensendung Als Kontaktperson zwischen Areznitz und der Metallica wurde Jill Kehl bestimmt. Sie erschien nur unregelmässig in Max Salgs Büro. Die Informationen von Areznitz überbrachte sie mündlich. Anfänglich kam sie Salg vor wie eine Nachrichtensprecherin vom Fernsehen. Sie schien ihre Mitteilungen hinter seiner linken Schulter von der Wand abzulesen. Wenn er um weitere Details bat, machte sie ihn lächelnd darauf aufmerksam, dass sie nur das übermitteln könne, was ihr gesagt worden sei. Er hielt aber Jill deswegen keineswegs für unkommunikativ. Anfänglich lud er sie nach der "Nachrichtensendung", wie er die Prozedur nannte, aus reiner Höflichkeit in die Cafeteria des Bürogebäudes ein. Später verabredete er sich mit ihr nach den Besprechungen oft auch ausser Hauses. Es kam dann die Zeit, wo auch die "Nachrichtensendungen" nicht mehr im Büro stattfanden. Ort und Zeit der Treffen bestimmte in der Regel sie. So war es ausgemacht. Bald nannten sie sich beim Vornamen. Das deutete nicht unbedingt auf ein Zeichen von Nähe, sondern hing eher damit zusammen, dass ihre Jugendzeit in die 70er Jahren gefallen war. Jill fand Max nicht besonders attraktiv. Sein Körper wirkte phlegmatisch, marklos und unsportlich. Sie hielt ihn für lethargisch, verweichlicht und irgendwie unantastbar. Es dünkte sie, er wende zu viel Energie darauf, sich bedeckt zu halten. Aus Areznitz' Fichenkasten wusste sie, dass er keine privaten Kontakte pflegte und auch kein erwähnenswertes Sexualleben besass. Sie nahm aber an, dass er die Rendez-vous mit ihr schätzte. Jill Kehl war eine mittelgrosse blonde Frau. Die Haare trug sie halblang, offen oder im Nacken verknotet. Sie versuchte sich nicht einzureden, die Rundungen ihrer Figur im Griff zu haben, da diese wechselhaft waren wie der Mond. Auffällig an ihr war die Brille. Die dicken Gläser machten ihre lustigen Augen ganz klein. Wenn Max sich für etwas an Jill interessierte, dann für diese Brille. Die ungetönten Brillengläser, rund und dick wie Flaschenböden, zogen ihn magisch an. "Meine Mutter trug auch eine Brille", erzählte er einmal. "Als kleiner Junge habe ich versucht, sie ihr von der Nase zu reissen. Aber sie hat das gar nicht gemocht." Er verriet Jill nicht, wie er es genossen hatte, sich in Mammas künstlichen Augen zu spiegeln, welche sinnliche Lust es ihm bereitet hatte, mit seinen Händen nach ihren Gläsern zu greifen, und wie wütend er wurde, wenn er sein Ziel nicht erreichte. "Hoffentlich hast du auf die Finger gekriegt, wenn du ihre Brille erwischt hast!", sagte sie lachend. "Meine Mutter hat mich nie geschlagen", erwiderte er hässig und beleidigt. Im Laufe der Zeit geriet Max immer mehr in den Bann von Jills Sehhilfe. Jills Brillengläser liessen ihn ihre Nähe suchen. Mit kleinen Geschenken und Aufmerksamkeiten versuchte er, sie an sich zu binden. Je weniger Erfolg er damit hatte, desto mehr bedrängte er sie. Beim Sprechen verkleinerte er seine Sozialdistanz zu ihr. Anfänglich kam das Jills Kurzsichtigkeit entgegen. Aber seine Aufdringlichkeit wurde so gross, dass sie sich - mehr instinktiv als bewusst - zu wehren begann. Wenn er sie, wie so oft, vereinnahmen wollte, versuchte sie, ihm auszuweichen. Führten sie beispielsweise ein Gespräch im Stehen, brachte sie diskret einen Stuhl oder sonst ein Möbelstück zwischen sich und Max. Viel nützte ihr das nicht, da Max solche Hindernisse entweder rasch beseitigte, umging oder überstieg. Sassen sie sich an einem Tisch gegenüber, bildeten ihre Oberkörper mit der Platte ein auf Jills Seite geneigtes Parallelogramm, das dauernd zu kippen drohte. Max duldete nicht die kleinste Spur von einem Fettfleck oder einer andern Trübung auf Jills Gläsern. Es kam vor, dass er in einem plötzlichen Ausfall mit beiden Händen die Brille von Jills Kopf zerrte und sie damit unversehens in Halbblindheit stürzte. Dadurch blieb ihr sein Gesichtsausdruck erspart, wenn er die dicken Gläser mit einem weichen Tuch, das er stets bei sich trug, auf Hochglanz polierte. Max bekam bei dieser Tätigkeit einen hochroten feuchten Kopf, seine Halsschlagadern verdickten sich. Schnaubend und mit hervorquellenden Augen rieb er das Glas zwischen seinen Fingern. Jill ertrug diese Übergriffe, weil sie seine komischen Exzesse visuell nicht mitbekam. Vielleicht fühlte sie sich auch geschmeichelt von Salgs scheinbarem Interesse an ihrer Behinderung. Seit er Jill kannte, blieb Salg auf dem Heimweg öfter mal vor einem Optikergeschäft stehen. Er starrte auf die ausgestellten Brillenkollektionen, mit seinen Händen breit auf die Schaufensterscheibe gestützt und unfähig weiterzugehen. In dieser Zeit begann er Lupengläser zu sammeln wie andere Joghurtdeckel oder Briefmarken, nicht weniger leidenschaftlich, aber sicher viel triebhafter. Gefiel ihm eine Fassung nicht, brach er das Glas heraus. Seine kostbarsten Stücke bewahrte er in teuren Etuis oder Schmuckkassetten auf. Max Salg lachte sich ins Fäustchen, als er durch Jill Kehl von Boris Lattems Existenz und seinen dunklen Machenschaften erfuhr. Er fand das "eine tolle Option". Salg dachte nicht einmal im 15 Traum daran, den zu erwartenden Plutoniumsegen diesen, wie er sich Jill gegenüber ausdrückte, "eisklirrenden Greisen der Geheimschweiz" zu überlassen. Das hinderte ihn nicht daran, ihnen bei jeder sich bietenden Gelegenheit sein patriotisches und ideelles Interesse vorzuheucheln. Dank seiner Beziehungen in der Metallbrache wusste er, wo er finanziell weit besser auf die Rechnung kommen würde, wo ihn höchste Gewinne erwarteten, wenn er nur erst an das kostbare Metall herankam. Er hielt Jill an, ihre personellen Kontakte für die Operation Waffenlieferung nach Estland vor Ort auszubauen und dienstbar zu machen. Sie war froh, in Lattem eine zuverlässige Kontaktperson zu haben. Dass er im Umkreis der NFBE verkehrte, war ihr schon längst bekannt. "Wir kaufen dir dein Plutonium ab, wenn du uns bei einem kleinen Transportproblem hilfst", schlug sie ihm vor. Damit begann eine spannende Zeit für Jill. Das war genau nach ihrem Geschmack, sie fühlte sich in ihrem Element. 16 Max Salg Im Büro der Metallica in Zürich stand Max Salg in der Mitte seines Büros. Den drahtlosen Hörer weit von sich gestreckt, mit dem Blick des Weitsichtigen wählte er eine Nummer, die er auswendig wusste und doch so selten benutzte, dass er sie nicht einprogrammiert hatte. Nach dem ersten Summruf legte er das Gerät neben die leere Blumenvase auf das Fensterbrett, damit er beide Hände frei hatte. "Ich komme gleich", sang er dreimal nacheinander mit erhobener Stimme, während er den kleineren seiner beiden Fauteuils ans Fenster rückte. Schnell setzte er sich und ergriff den Hörer wieder. Dieser hatte nicht aufgehört, periodisch Summlaute in die Welt zu schicken. Aber sie schienen an kein Ohr zu dringen oder wurden nicht beachtet. Max steckte den Apparat schliesslich weg und lachte, als er sich gewahr wurde, dass er nun grundlos am Fenster sass. Weit unten sah er ein stadtauswärts fahrendes Tram und die Autokolonnen auf der Universitätsstrasse. Der Stadtlärm tönte hier hinter der Fensterwand seines Arbeitszimmers eintönig und fern. "Verbindung - keine Verbindung - unverbindlich - bindungslos", assoziierte sein Gehirn und er wusste nicht , ob er in diesem Augenblick an das weit entfernte Bild des Verkehrs hinter dem Fenster oder an den missglückten Telefonanruf dachte. Die Wortkette brachte ihn dazu, eines seiner wichtigsten Prinzipien zu reflektieren. Er nannte es "Nähe mit Abstand." Auf Abstand bleiben oder auf Distanz halten war für ihn schon immer ein Bedürfnis, und er hatte es zu seinem Wesenszug verinnerlicht. Nähe liebte er zwar, aber er lebte sie möglichst in der Anonymität. Nichts illustrierte das besser als das, was er am Telefonieren schätzte: zu wissen um die unendliche Ferne einer Person am andern Ende der Verbindung und gleichzeitig die intime Nähe einer Stimme am Ohr zu verspüren. Distanz halten, Nähe bei Bedarf simulieren und Intimität heimlich geniessen, folgerte und abstrahierte er aus seiner Selbstanalyse. Als Voyeur fühlte er sich deshalb nicht. Nein, er war kein einsamer Spanner vor der beleuchteten Scheibe. Das heisst aber nicht, dass er sich auf der andern Seite des Fensters besser fühlte. Selbst in der Nacht bot ihm Verborgenheit draussen im Dunkel genau so wenig Schutz wie die Helligkeit drinnen im ausgeleuchteten Zimmer. Meine Welt ist weder die vor, noch die hinter dem Glas . Mein Ort ist vielmehr im Glas selbst, in der Scheibe, die das Innen und Aussen trennt, dachte er. Schon als 16-jähriger hatte er leicht pathetisch in sein Tagebuch geschrieben: "Glas ist zweigesichtig in seiner doppelten Durchsichtigkeit, oft schillernd spiegelnd, manchmal kühl opak, einmal voller Glanz, dann wieder unsichtbar. Es ist, obwohl berührbar, unerbittlich abweisend, ein amorphes Kristallgefüge, an dem sich Vögel narzisstisch spiegeln oder geblendet zu Tode stossen." Sein Blick wanderte zurück in die Stadt unter ihm. Ob der "Alte Leuen" dort unten um diese Zeit schon geöffnet hat? In seiner Studienzeit hatte er in der beliebten Quartierbeiz eine wort- und weinreiche Zeit mit Walliserfreunden verbracht, als Zürcher nota bene. Schon damals hatte er es verstanden, sich von allem fern zu halten, was ihm nahe zu treten versuchte. Er verpasste es nie im richtigen Augenblick den Arm zum Prosit zu heben, aber er tat es nur, um sich gläserklingend von der Runde abzugrenzen. Die Namen und Gesichter seiner Zechkumpane begann er an dem Tage zu vergessen, als er aufgehört hatte, dort Abende und Nächte zu verbringen. "Fliegenscheisse auf Glas ist abwaschbar", konstatierte er. Unten auf der Strasse fuhr eben ein Tram stadteinwärts. Gefangen in der Eindimensionalität seines Geleises fährt es immer geradeaus, liess er seine Gedanken treiben. Sogar in den Kurven verfolgt es unbeirrt sein Ziel. Aber haben Trams denn überhaupt ein Ziel? Vielleicht ist es der Weg durch die Stadt oder die Verknüpfung von Haltestellen mit der Zeit. Freiheit bleibt da wenig, ausser in der Wahl zweier möglicher Richtungen. Aber die Richtung ändert ja nichts am eigentlichen Ziel. Trams sind im Hinblick auf ihre Bestimmung neutral gegenüber der eingeschlagenen Richtung, und das, obwohl sie beispielsweise auf dem Weg hinunter Fahrt aufnehmen, hinauffahrend hingegen Antriebsenergie dissipieren. Wie anders ist es bei uns! Selbst wenn wir uns auf dem richtigen Gleise wähnen, können wir trotzdem in die falsche Richtung reisen. Und besteht - je nach Blickwinkel - nicht immer Gefahr oder Hoffnung, dass Umkehr etwas zu ändern vermag, fragte er sich. Aus seinem Schreibpult holte er sich einen Bacardi, goss ihn sorgsam in ein hohes HergiswilerGlas mit feinem Tropfendesign und kehrte zurück an seinen Lieblingsplatz. Er hob das halb gefüllte Glas und hielt es gegen das helle Fenster. Er liebte klare Drinks in klaren Gläsern! Wie unterschiedlich sich das Licht im flüssigen und im festen Medium brach. Mit kleinen Unterbrechungen trank er leise schlürfend. Vor jedem Schluck fuhr er vorsichtig mit seiner Zungenspitze über den Rand des kostbaren Gefässes und prüfte seine sanfte Rundung. 17 Das Tram erschliesst die Fläche der Stadt durch Linien, philosophierte er weiter. Aber erst die Vernetzung der Schienen schafft die gewünschte Zweidimensionalität. Punkte ruhen in sich. Erst wenn der Punkt eine Linie durchwandert, braucht oder erschafft er die Zeit. Von der Fläche kann er nicht so leicht Besitz ergreifen wie der Teig beim Auswallen mit dem Rundholz von der Tischebene oder der Gummiwischer beim Reinigen von der Fensterfläche. Punkte eignen sich auch schlecht als Fliegenklappen im Raum. Sie müssen neben den alten Linien laufen, wenn sie Fläche und Raum gewinnen wollen. Nur wer die ausgetretenen Pfade verlässt, durchmisst seine Räume neu. Salg beendete seinen Ausflug in das Innere der Welt. Sein Blick kehrte von draussen zurück in sein Büro, blieb aber am Glas der Scheibe hängen. "Wie lieblich schimmerst du heute und wie schön lässt du mich in deinem Glanze spiegeln", flüsterte er. "Du verhältst dich neutral gegen die Richtung des einfallenden Lichtes. Und doch, was für ein gewaltiger Unterschied besteht zwischen der Sicht von aussen nach innen und dem Blick hinaus." Mit seiner flachen Hand fuhr er liebkosend über die Scheibe. Die Wärme seiner Haut strömte hinaus in die Stadt und liess ihn ihre Kühle spüren. Erregt stand er auf und drückte wollüstig sein Gesicht gegen das Glas. Mit den Zähnen probierte er die abweisende Härte des durchsichtigen Kristalls. Er merkte, wie es ihm Widerstand bot. Das Blut stieg ihm heiss in den Kopf. Wütend begann er das Glas zu lecken. Immer heftiger versuchte er einzudringen in die glatte Oberfläche. Seine Finger verkrümmten sich zu kratzenden Krallen. Vergeblich versuchten sie, die perfekte Glätte aufzureissen. Stöhnend riss er sich das Hemd auf und drückte die nackte Brust gegen das unnahbare Objekt seiner Begierde. Drei Minuten später reinigte er das Fenster mit Papiertaschentüchern und ging dann zur Toilette. 18 Die Werft Salg erwarb für die Metallica eine bankrotte Surfbootsbaufirma in Spreitenbach, die anfangs der 70er-Jahre versucht hatte, mit einem neuen Bootstyp auf den Markt zu kommen und dabei Konkurs ging. In einem Schuppen neben dem Shopping-Center liess Salg Surfbretter im Sandwichverfahren bauen. Die mit Hohlräumen versehenen beiden Hälften der Boote passten genau aufeinander. Noch als Rohlinge liess er sie nach Sarnen bringen und dort mit dem für Estland bestimmten Kriegsmaterial auffüllen. Die beiden Bootsteile wurden dann zusammengeklebt und mit einem weissen Lackanstrich so übermalt, dass die Fuge nicht mehr sichtbar war. Mitte Dezember, zwei Monate später als vorgesehen, wurde der Surfbretttransfer dann endlich abgewickelt. Deklariert als Sportgeräte für ein neues Plausch-Wasserzentrum in Finnland beförderte sie die Firma Eurotrans per Lastwagen nach Finnland. Die heisse Ware passierte sämtliche Zölle ohne Verdacht zu erwecken. Den Zollpapieren lag ein Werbeprospekt bei, der Auskunft gab über die "Fahrten-Bretter für extrem lange Trips in stark bewegter See". Der Text wies auf die neuen Eigenschaften der Boards hin und pries die angebliche Stahlverstärkung der Bretter. "Aus Gründen der Sicherheit und der Stabilität", wurde behauptet. Von der ausserordentlichen Stärke der Konstruktion zeugten auch die Tragringe hinten und vorne am Brett, "Vertäuungsringe" genannte Vorrichtungen, die ja normalerweise an Surfboards fehlten. Verschwiegen wurde, dass die Bretter wegen ihrer versteckten Fracht gar keine Schwimmfähigkeit besassen. In den Schären östlich von Helsinki endet ihre vorläufige Reise in einer Werft für Kleinbootbau. Die noch auf dem Festland liegende Werft gehörte einer alten Familie, die neben ihrer alltäglichen Beschäftigung im Schiffsbau und im Transportgeschäft seit Generationen auch dem Schmuggelgeschäft zwischen Finnland und Estland nachging. Sie hatte mit dieser illegalen Tätigkeit, wenn auch mit personellen Verlusten immer wieder teuer bezahlt, ein ansehnliches Vermögen angehäuft. Als Salg die Insel vorgängig rekognoszierte, legte er ein kleines Dossier an, in welchem er die Ergebnisse seiner Recherchen festhielt: "In früheren Zeiten wurde in diesem Gebiet recht gewinnbringend und ungehörig mit Alkohol geschmuggelt. Dabei kamen schlaue, oft auch skrupellose und schurkische Methoden zur Anwendung. Die Alkoholfässer z.B. wurden auf den Fischerbooten mit Salzbeuteln beschwert. Wenn ein Zollboot über der Kimm oder unter einer Insel erschien, warfen die Schmuggler ihre Fässer ins Wasser. Das Gewicht des Salzes zog sie nach unten. Nach der ergebnislosen Zollkontrolle konnten später die Schnappstonnen wieder eingesammelt werden, da sie nach dem Auflösen des Salzes wieder an die Oberfläche kamen. Das frevelhafte Verfahren soll während der Prohibition auch in Amerika angewendet worden sein. Die Schärenleute berichteten mir auch von Verfolgungsjagden in den Untiefen zwischen den eng nebeneinander liegenden Inseln und Inselchen. Die gewissenlosen Schmuggler hätten sich absichtlich von Zollbooten verfolgen lassen und sie schuftig in gefährliche Gewässer gelockt. Immer wieder sei es vorgekommen, dass behördlich kommandierte Boote unter dem Hohngelächter der ortskundigen Banditen Totalschaden erlitten. Andere, risikobereite Gangs wendeten, immer nach verbürgten Berichten alter Inselbewohner, probalistische Methoden an. Mehrere Boote fuhren im Verband, nur eines davon trug Schmuggelware. Tauchte plötzlich eine Polizeipatrouille auf, zerstob der Konvoi in alle Himmelsrichtungen. Es war nur eine Frage der Wahrscheinlichkeit und Psychologie, welches der Fahrzeuge gejagt und gestellt wurde. Das langsamste Boot mit dem grössten Tiefgang hatte natürlich nur Sand und Ballast geladen. Hier ist ausdrücklich anzumerken, dass die hart arbeitenden und fleissigen Bauern und Fischer im Allgemeinen Wichtigeres zu tun hatten, als Zoll und Polizei zu narren. Inertiam non amant11, um ein altes Sprichwort abzuwandeln. Auch Geschichten von Schiffen, die mit Hilfe falscher Leuchtfeuer ins Verderben gelockt worden seien, wie z.B. auf der Insel Borstö unter den sich noch so gerne gruselnden Touristen herumgeboten wird, dürften historisch nicht belegbar sein und gehören ins Reich der Phantasie. Wer würde sich schon die Mühe machen, bei nächtlichem Sturm und Regen ein Feuer zu unterhalten, in der trügerischen und gemeinen Hoffnung auf das Scheitern eines unfähigen Kapitäns. Und das nur in der verwerflichen Absicht, sich an der vielleicht ohnehin mageren Beute aus seinem in der Brandung und auf den Felsen zerschellten Schiff gütlich zu tun! Die andere Geschichte, dass unglücklich gestrandete Schiffe von den Inselbewohnern ab und zu ausgeraubt worden seien, halte ich allerdings für mehrfach erwiesen. In einem Falle konnte ich sie sogar mit einer mir vorgelegten alten Fotografie verifizieren. Der Schiffsbau war zu allen Zeiten ein gutes Geschäft, besonders für Leute, die sich darauf verstanden. Boote wurden immer gebraucht, zum Fischen, zum Warentransport, zum Reisen, und 11 inertiam amat, lat. "Er liebt die Trägheit", "Er isst sein Brot mit Sünden". Hier: Sie sind nicht faul und sündig. 19 auch zum blossen Vergnügen. Auch hier auf diesen Inseln galt, was wir schon aus derAntike wissen: Navigare necesse, vivere non necesse12. In alten Zeiten führte ein Pilgerweg und eine Handelsroute für Waren und Sklaven zwischen Petersburg und Stockholm mitten durch die Schären am Rande des finnischen Festlandes. Der direkte Weg über das offene Meer wurde gemieden wegen der vielen unsichtbaren Felsen unter der Wasseroberfläche, die nicht nur Ortsunkundigen eine sichere Navigation lange verunmöglichten. Damals war es schwieriger, markierte Fahrwasser auszustecken und den Meeresboden exakt zu vermessen, als das heute der Fall ist. In den Lehmboden eingerammte Besen dienten als Pricken. Bemalte Felsen oder aufgeschichtete Steinhaufen an den Inselspitzen eigneten sich als Seezeichen und Orientierungshilfen. Mit Ketten verankerte schwimmende Fässer und Glaskolben13 wurden als tauglich erachtet zur Verwendung als Seetonnen. Leuchtfeuer kamen erst nach und nach auf. Metergenaue Satellitennavigation, Radar- oder Sonarortung sind Techniken, die damals ausserhalb menschlichen Vorstellungsvermögens lagen. Die Kraft menschlicher Fantasie dürfte nicht ausgereicht haben, solche moderne Erfindungen auszudenken. Sie waren genau so wenig voraussehbar, wie die Äste der biologischen Evolution von auf Menschenart denkenden Wesen erahnbar gewesen wären, selbst wenn solche Kreaturen lange vor unserer Zeit existiert hätten und, immer unter Voraussetzung darwinistischen Wissens, in der Lage gewesen wären, über diese Frage zu spekulieren14. Die zivilisatorische Entwicklung der Menschheit hat genau wie die biologische im Pflanzen und Tierreich immer wieder überrascht. Sie wird, dessen bin ich mir sicher, auch weiterhin Dinge hervorbringen, die vorher undenkbar waren, oder die wir damals niemals für realisierbar gehalten hätten. Die ältesten Fahrwasser in Finnland führten oft über trockenfallende Rinnen zwischen den Inseln. Hier wurden die Kähne auf Rutschen über Land geschleppt. Oder die Reisewege auf dem Wasser führten durch ausgedehnte Schilfgebiete, in denen durch Ausreissen des Schilfes eine Fahrrinne freigehalten wurde. Die Überreste derer, die auf einer Reise das Leben verloren, wurden in vorchristlicher Zeit oft auf der östlichen Seite einer Landerhebung unter einem Hügel von Schottersteinen oder vielleicht sogar im Oval eines kleinen Schiffgrabes bestattet. Requiescant in pace15. Später entstanden entlang des Weges Holz- oder Steinkapellen, die den Pilgern, den Handelsreisenden und den christlichen Sklaventreibern - ich bin entrüstet - Orientierung, geistige Erbauung und bei schlechtem Wetter auch Unterschlupf versprachen. Später wurden die Schiffe ständig grösser, die Seekarten immer exakter und ausgefeilter, der Verkehr stetig dichter. Die alten von den Inseln geschützten Seewege rückten immer weiter nach aussen. Sie wuchsen zu Seestrassen und Freeways oder "Schiffsautobahnen"16. Eine gute, innovative Werft fand immer ein Auskommen. Flaue Zeiten wurden mit Reparaturen, dem Bau von Bootsstegen oder mit Transportaufträgen überbrückt. Wenn Eis in harten Wintern teilweise oder ganz den finnischen Meerbusen bedeckte, transportierten Pferde und Schlitten die Menschen und das Handelsgut über die See. Bei günstigem Wind flitzten mit Segeln ausgerüstet Eisyachten von Insel zu Insel. Sogar die Toten - cita mors ruit17 wurden über das Eis zu den oft weit entfernten Friedhöfen gebracht. War das Eis zu brüchig, blieben die Särge mit den Leichen in der Kälte liegen, bis im Frühjahr die Seefahrt wieder möglich wurde. Noch in diesem Jahrhundert wurden während des finnischen Winters die Schienen einer Eisenbahn über das Eis eines Sees verlegt, zur Verkürzung der Fahrzeit. Gefährlich waren die wärmenden Sonnenstrahlen im Mai. Manche Tragödie ereignete sich, etwa wenn unaufschiebbare Geschäfte anstanden, die eine Reise weg von den Inseln erforderten, oder wenn ein kranker oder verletzter Mensch über das dünne Eis ins Spital ans Festland gebracht werden musste. Die mutigen Reisenden oder Helfer und Helferinnen wateten oft in knietiefem Wasser über die morsche Eisdecke. Ich muss, schon aus Respekt für diese zähen Menschen, diese beeindruckenden Bilder in meinem Bericht schildern. Sie sollen aber auch Zeugnis ablegen, von der Unwirtlichkeit dieser Landschaft im Winter. 12 lat. "Schiffen ist notwendig, leben ist nicht notwendig." hier dürfte Salg sich irren. Nach Meinung des Verfassers wurden Glaskugeln eher als Auftriebskörper für Fischnetze gebraucht. Errare hunanum est. 14 Areznitz hätte, wäre dieser Satz aus seinem Munde gekommen, nachher enorme Rückenprobleme gehabt" (Der Verfasser). 15 lat. "Mögen sie in Frieden ruhen" 16 Schiffsautobahnen in Anlehnung an den Begriff Datenhighway, der im Deutschen seltsamerweise mit Datenautobahn übersetzt wird. 17 lat. " Schnell kommt der Tod!" 20 13 Aber nicht nur auf den seit Menschengedenken benützten Eisstrassen, sondern leider auch auf illegalen Eispfaden wurde Ware verschoben. Solche Fahrten unternahmen häufig junge Leute, die wenig Erfahrung mit den wechselnden Eislagen hatten. Kein Wunder, dass viele von diesen Abenteurern nicht mehr zurückkehrten, da sie mit Pferd und Ladung, später auch mit Auto und Motorschlitten, nur den Wind als Zeugen, im Eis versunken sind". An dieser Stelle lässt Salg eine ausführliche Chronik des winterlichen Postbetriebes zwischen Finnland und Schweden während der Zarenzeit folgen, eine erschütternde und leidvolle Geschichte. Mit der Feststellung (Salg nannte es sein ceterum censeo18): "Alles in allem denke ich, dürfte diese Inselwelt mit ihrer abenteuerlichen Vergangenheit für unser geplantes Unternehmen geradezu ideale Voraussetzungen bieten", schloss Salg seine Studie, die er bewusst in moralisierendem Ton abgefasst hatte, weil er damit das Herz Areznitz' erfreuen wollte. Mit lateinischen Zitaten schmückte er sie, weil er annahm, dass sie Regaz entzückten19! Das tat er nicht aus Freundlichkeit, sondern aus reinem Eigennutz, da er die beiden Männer für sich einnehmen wollte. Die Übergabe der Surfboote sollte am 23. Dezember in der Werft stattfinden, falls bis dann die Eislage eine Fahrt über den finnischen Meerbusen noch erlaubte. Areznitz hätte zwar lieber den Frühling abgewartet, aber die NBFE drängte auf eine rasche Abwicklung des Geschäfts und ausserdem konnte viel geschehen während der Wintermonate. Für die Russen wäre etwas Eis in der Ostsee die beste Absicherung für Kampfhandlungen in den baltischen Staaten. Auch Lattem hatte keine Lust noch länger auf seinem Plutonium sitzen zu bleiben. Die Sache wurde für ihn täglich heisser.20 Regaz wollte vor dem Transfer noch eine wichtige Kleinigkeit geklärt haben. "Rolf, wie kannst du verhindern, dass das Plutonium bei der Übergabe in falsche Hände kommt", fragte er an einer Koordinationssitzung. Areznitz liess sich durch diese Frage nicht überraschen. Noch in der Schweiz hatte er die Schlagbolzen aus den Gewehren entfernen lassen. Die NBFE wurde angewiesen, das Plutonium nur im Austausch gegen diese Schlagbolzen auszuhändigen. "Ausgezeichnet, Rolf", lobte Regaz und Areznitz klemmte voller Stolz die untere Partie seiner Rückenmuskulatur zusammen. "Weisst du, nur zu Hause lasse ich alles treiben und wuchern. Du solltest den Grasplatz in meinem Garten sehen. Er sieht aus wie eine Elchwiese in der Taiga!" "Ich hoffe du liebst Elche", spottete Regaz. 18 lat. "Im übrigen bin ich der Meinung...". Teil aus dem vom älteren Cato immer wieder verwendeten Schluss seiner Senatsreden. Der Verfasser ist der Meinung, dass Salg dieses Zitat hier unpassend verwendet, da seine Schlussfolgerung nicht den Charakter eines unerbittlichen Impetus besitzt. Dieser peinliche Missgriff dürfte auch Rainer Regaz nicht entgangen sein.(Der Verfasser). 19 Das war dann auch der Fall. (Der Verfasser). 20 Ursprünglich war geplant, die Boote durch eine baltische Exilorganisation aus Schweden der Wassersportabteilung des Verbandes "Estnische Jugend" auf dem Papier verschenken zu lassen. Dessen Leitung war unter der Kontrolle der NBFE. Die NBFE wagte es dann aber doch nicht, die Bretter offiziell einzuführen und zog den Schmuggelweg vor. 21 Jill Kehl Die Sonne brannte für diese Jahreszeit ungewöhnlich stark auf den Asphalt. Jill Kehl versuchte die Pedalen ihres Fahrrades völlig gleichmässig zu treten. "Wie langsames Treppensteigen!", dachte sie. Sie hob sich vom Sattel ab und trampelte eine kurze Zeit stehend im höchsten Gang. Sie stellte sich dabei vor, langsam die überhohen Treppenstufen einer Pyramide hinaufzusteigen. "Ich...bin...ei...ne Pries...ter...in", wiederholte sie mehrmals im Takt der Pedalenumdrehungen und liess ihr Fahrrad gewaltig hin und her schwanken. Lachend setzte sie sich wieder auf den Sattel. Gute Performance, lächerliche Idee! Eine Priesterin, die auf Pyramiden steigt, sucht den geradlinigen Weg hinauf zum Lichte und zur Macht. Dafür fehlte ihr nicht nur der Ehrgeiz, sondern vor allem die Lust. Sie selber liebte viel mehr die krummen Wege des Lebens mit ihren plötzlichen Biegungen und überraschenden Steigungen. Wie um diesen Gedanken zu verdeutlichen, schaltete sie ein paar Mal wild hinauf und hinunter. Dadurch verlor sie den Rhythmus und das Tempo. Nach einer kleinen Richtungsänderung führte die Strasse in schnurgerader Linie durch das flache Tal. In der Ferne verlor sie sich in den Obstbäumen eines Bauerndorfes. Es war Mittagszeit und praktisch kein Verkehr. Am linken Strassenrand standen in exakt gleichen Abständen grosse Pappeln. Jill nahm plötzlich den Wechsel von Licht und Schatten wahr. Am liebsten hätte sie die Augen geschlossen und losgelöst von dem, was das Auge sieht, die Abfolge von Wärme und Kühle auf ihrer Haut gespürt. Sie liebte das Atmen des Lebens, den steten Wechsel, die immer neue Wiederkehr. Was sie hasste, war die langweilige Regelmässigkeit von Abläufen. Auch deshalb liess sie ab und zu, wie heute, das Auto zu Hause stehen und suchte mit dem Velo21 ihren Arbeitsplatz auf. Ausserdem fand sie, Fahrrad fahren sei sportlich und der Kontrolle ihres leicht zu beeinflussenden Gewichtes dienlich. Als sie noch in die Volksschule ging, suchte sie sich Abwechslung bei der Ausübung verschiedener Gelegenheitsjobs: Möbel eintippen an der Kasse der Ikea, saisonale Früchte verkaufen vor der Migros im Shopping-Center, Leibchen drucken im Stand daneben oder auch mal babysitten. Gar nicht zu verachten war auch das Sackgeld, das sie dabei verdiente. Nach einem Jahr an der Kantonsschule, hatte sie vorerst genug vom "Frust des passiven Lernens", wie sie dem Rektor anvertraute. Finanziell unterstützt durch ihre alleinerziehende Mutter reiste sie nach Kanada. In den Okanagen lernte sie einen jungen Farmer kennen. Er brachte ihr die körperliche Liebe bei. Ausserdem wollte er ihr den american way of life aufdrängen. Ihr Hang zur Oberflächlichkeit kam ihm bei seinen Bemühungen gelegen. Lange hielt sie es aber dort nicht aus. Einmal versuchte der Obstbauer sie, betrunken von Alco pops, Bier und Cooler ins Gesicht zu schlagen. Noch in der gleichen Nacht brannte sie mit seinem Cheverolet durch. Das verlotterte Gefährt liess sie an der Grenze zu den USA liegen. Im einzeiligen Abschiedsbrief zitierte sie deutsch und deutlich aus Schillers Wallenstein, sonst hatte ihr Herz nichts weiter auszuschütten. In Kalifornien lernte sie einen knauserigen Weinverkäufer kennen. Der Händler vermarktete Chardonnay und Cabernet aus dem Napa Valley und den Zinfandel des Dry Creek Valleys. Von ihm lernte sie die Bewertung der Weine nach Parker, wenigstens theoretisch. Praktisch führte er ihr nämlich keine Gewächse vor, die mehr als 79 Punkte erreichten. Wein aus Eichenfässern lehnte er persönlich ab: "Ich hasse diesen Burgundergeschmack. Ist mir zu europäisch". Seinen Kunden gegenüber äusserte er sich natürlich anders. Er trank prinzipiell nur junge Weine: "Lieber Kinderschänder als Leichenfledderer", posaunte er nach der zwanzigsten Verköstigung. Jill fand keinen Gefallen an solchen Sprüchen, ausserdem fand sie seine acht- bis zwölfstündigen Degustationsmarathons, in denen die Weine nicht getrunken, sondern herausgespuckt wurden, geschmacklos. "Zum Glück kredenzt du diesen Leuten nur mittelmässige Gewächse. Die kennen sich garantiert prima aus mit allen Abarten von «Fried chicken». Wette, dass keiner merken würde, wenn eine Flasche korkt und wie alter Karton schmeckt", steckte sie ihm nach einer solchen Versammlung giftig. Einige Monate befasste sie sich mit dem Export von Cabernet Sauvignon Weinen nach Europa. Dann hatte sie genug von Amerika und kehrte in die Schweiz zurück. Einige Jahre später beendete Jill die neusprachliche Abteilung des Gymnasiums mit der Maturitätsprüfung. In diese Zeit fielen auch ihre Reisen nach Leningrad. Statt ein Studium zu beginnen, bildete sie sich durch praktische Tätigkeit im In- und Ausland zur Sekretärin aus. Dieser Zeit hing sie gerne in Gedanken nach. "Vergangen, aber nicht vergessen! Eingebrannt auf der CD des Lebens. Nicht überspielbar. Unauslöschlich, aber jederzeit abspielbar!", deklamierte sie laut aus ihrem fahradgesteuerten Denkprozess. 21 Schweizerdeutsch für Fahrrad. 22 Zwischen zwei Häusern bog sie, ohne zu bremsen, scharf nach rechts in einen schmalen Weg ein, der zu einer Brücke über den Fluss führte. Sie querte sie und fuhr auf der andern Seite die Strasse nach links verlassend über eine steile Böschung hinunter zum Fluss. Sie kannte diese Strecke gut. Früher hat sie auf diesem Spazierweg immer furchtbare Angst gehabt. Kein Wunder, wenn sie sich darauf besinnt, was sie auf diesem selten benützten schmalen Pfad entlang des Flusses bei unzähligen Fahrten durchgemacht hat. Früher litt Jill häufig unter Angstzuständen. Manchmal packte sie plötzlich das Grauen und versetzte sie in Panik. Eines Tages beschloss sie ihr Problem esoterisch anzugehen. Von ihrer Mutter kannte sie das taoistische Buch der Wandlungen. Also warf sie das chinesische Horoskop I Ging, und zwar so richtig mit Schafgarbenstengeln und dem ganzen Brimborium! Die uralte "Basis allen Denkens", wie es im alten China hiess, liess sie nicht im Stich. Dem Orakel entnahm sie die Worte: "Der Abgrund wird nicht überfüllt, er wird nur bis zum Rand gefüllt." Sie verstand das so: "Wenn das Wasser steigt im Fluss, wird es die Ufer übertreten, denn es kann nicht mehr Wasser durch das Flussbett hinunter fliessen, als darin Platz findet. Wenn ich den Fluss über seine Ufer treten lasse, wenn genügend Wasser übergelaufen ist, wird er wieder friedlich seinen Lauf nehmen." Und so deutete sie das Bild: "Wenn du gelernt hast, dich treiben zu lassen wie der Fluss in seinem Bett, kann dich die Angst nicht mehr packen. Wohl schnürt sie dich zusammen, aber sie kann dich nicht lähmen. Im Gegenteil du fühlst dich wie geborgen in ihr." Seither dachte sie, wenn die Panik auszubrechen drohte, an den Fluss und sein friedliches Wesen. Die Gebüsche gaben ihr plötzlich eine milchige Sicht auf das Wasser frei. Vielleicht hingen die schrecklichen Phantasien mit ihrer Kurzsichtigkeit zusammen, die sie behinderte, solange sie wusste. Was ausserhalb der Lesedistanz war, brachte auch die Brille kaum näher. Ein paar Mal war sie hier durch einen Heckenschützen vom andern Ufer aus beschossen worden. Nur hartes Treten in die Pedalen rettete sie heil hinter die nächsten Sträucher. Heute gab es keine Heckenschützen. Sie musste auch keiner Mine auf dem Wege ausweichen. Nur beim Unterqueren der Autobahn, die hier rücksichtslos auf Natur und Umgebung über den Fluss verläuft, zog sie instinktiv den Kopf ein, wegen der leeren Flaschen und Dosen, die aus den Autofenstern über das Geländer hinunter geworfen werden. Zu Recht! Glasscherben neben dem Wegrand zeugten davon. Ungehindert wie der Lauf des Flusses neben ihr, ging die Fahrt weiter. Dort nach der Wegbiegung wartete die gewaltige Eiche, an deren Ast ein Selbstmörder an seinem Stricke über dem Weg hing. Sie hasste es, wenn seine nackten, baumelnden Beine in ihr Gesicht schlugen. Wieso hatte er wohl vor dem Sturz ins Seil die Schuhe ausgezogen? Sie liess sie ihn hängen. Der Mittag war hier kühl wegen des nahen Flusses. Trotzdem griff sie durstig nach der Trinkflasche im Haltebügel des Fahrrades. Sie zog einen grossen Schluck durch das Saugrohr. Nein, seit sie gelernt hatte, mit ihrer Angst umzugehen, wagte kein frecher Junge mehr in ihr Trinkbidon hineinzupissen, wenn sie auf einer Reisepause für kurze Zeit ihr Fahrrad verliess. Sie schaltete ganz hinunter, um die Böschung der Strasse zu überwinden, die nun ihren Weg und den Fluss kreuzte. Freundlich nickte sie dem Bauern zu, der sich mit seinem Traktor auf der zum unteren Niveau abfallenden Böschung überschlagen hatte und nun mit zerdrücktem Brustkorb auf dem Lenker lag. Jetzt radelte sie parallel zu einem Bahndamm weiter. Jill war froh, dass um diese Zeit kein Zug fuhr. Soviel sie wusste, endeten die Toilettenrohre der Schweizerischen Bundesbahnen immer noch offen über dem Bahntracé. Trotz dieser realen Bedrohung, kam bei ihr keine Spur von Panik auf. Vor der Realität hatte sie sich nie geängstigt, so verrückt diese auch sein konnte. Jill bog links ab und fuhr, ihren Schwung ausnützend zum Bahngeleise hinauf bis zur Bahnhofunterführung des Dorfes, das sie nun erreicht hatte. Ihr Fahrrad nahm sie mit in die S-Bahn. 23 Platinschmuggel "Metall gegen Metall! Ihr braucht Plutonium und ich will Platin", stellte Boris klar, als Jill ihn nach seinem Preis fragte. "Warum ausgerechnet Platin? Täte es nicht Gold auch?", fragte Jill verwundert. "Ich weiss, dass ihr in der Schweiz Gold sammelt und hortet. Ich habe auch gehört von diesen spleenigen Gebrüder Hunt - aus Texas, glaub' ich - die alles Silber der Welt aufkaufen wollten. Menschen wie sie verdienen meinen Respekt und meine Hochachtung. Aber Metall ist nicht einfach Metall. Nichts gegen Gold und Silber! Aber Platin ist nun mal die Krone der metallischen Schöpfung. Für mich ist es schlicht und einfach das Metall der Metalle, und das nicht nur weil es dehnbarer ist und gewichtmässig weniger Raum einnimmt als alle andern Edelmetalle. Wenn ich mich mit Schrott begnügen will, kann ich ja ebensogut das Plutonium behalten", maulte er. "Ich dachte, dir geht es um Geld!", warf Jill ein. "Geld , Geld! Hab ich hier nicht genug zum Leben, kann ich mir nicht alles leisten, was es hier zu konsumieren und zu geniessen gibt?", fauchte er. "Hast du vergessen, ich gehöre zur Oberklasse unserer sich auf die Klassenlosigkeit hin entwickelnden Gesellschaft. Die Diktatur des Proletariats wird sicher noch eine Weile auf sich warten lassen. Gut Ding will schliesslich Weile haben." "Nimm Dollars und kauf' dir, was dein Herz begehrt, von mir aus auch Quecksilber oder Plumpudding", sagte sie spitz. "Dollars, was soll ich mit Papier? Fälscher laufen genug herum, und sicher wird bald einer die Frechheit besitzen, auf dem, was weiss ich, Ameisenfühler einer imitierten Tausendernote sein Smiley einzuprägen." Jede weitere Diskussion war sinnlos. Lattem bestand kategorisch darauf, dass sein Plutonium in Platin aufgewogen werde, zumindest teilweise - darüber lasse sich ja noch verhandeln - sonst könne man die Sache vergessen. Immerhin sei er auch bereit, als Zugabe eine Probe des Roten Quecksilbers zu liefern und dessen Geheimnis preiszugeben. Damit sei beim Bombenbau eine beträchtliche Menge Plutonium einzusparen. Stur wie ein alter Geissbock! Echt ein Spinner, regte sich Jill auf. Ach, was soll's, schliesslich habe auch ich meine Macken. Und gehe ich deswegen gleich zum Psychiater, beschwichtigte sie ihren Unmut. Auf Schweizerdeutsch reimte sie laut: "Jedem Tierli sys Plaisierli, jedem Metallürgli sys Traumbürgli." Salg beschaffte das Platin ohne Wissen von Areznitz auf dem Schwarzmarkt über Italien. Kehl erhielt den Auftrag, das von Lattem so heiss gewünschte Edelmetall nach Finnland zu schmuggeln. Areznitz schlug dafür die Methode F326 vor. Sie hatte sich schon so oft bewährt, dass sie in Geheimdienstkreisen als sicher galt und gerne angewendet wurde. Jill Kehl hatte sie selbst einmal praktiziert, als sie für Regaz fünfzig antike römische Münzen aus dem Kanton Aargau zur Bestechung eines englischen Diplomaten nach Bombay schmuggeln musste. Im Organisieren war sie Spitze. Akkurat und pedantisch plante sie den heiklen Transport der gewichtigen Ware. "Ich liebe die Perfektion und die Struktur von Abläufen". Zuerst besorgte sie sich im Kostümverleih Mellingen eine Uniform, wie sie vom Personal der Cafeteria in der Abflughalle des Flughafens Kloten hinter der Sicherheitskontrolle getragen wird. Dann verpackte sie die Platinplatten in kleine Kartonschachteln und überdeckte sie mit quaderförmig abgepackten Butterwürfeln. Schliesslich besorgte sie sich ein Servierbrett, einige Tassen und eine grosse Falttasche. Alles kam in eine grosse Reisetasche. Den Uniformjupon zog sie an und wählte dazu eine weisse Bluse mit rotem Foulard. Als Reisetag war der erste Tag der Zürcher Herbstschulferien vorgesehen, ein Samstag anfangs Oktober. Eine Beamtin winkte die Passagiere nervös durch die Passkontrolle ohne gross auf Pass und Boardingkarte zu achten. Auf der Toilette zog Jill die Uniformjacke an. Die leere Falttasche klemmte sie zwischen Jacke und Busen. Dann stellte sie sich vor einen unbesetzten Infoschalter der Qantas. Aus der Reisetasche nahm sie das Tablar, setzte die Tassen und die Platinbutterpakete darauf. Die leere Tasche blieb zurück. Diese löste zwei Stunden später einen Alarm aus und wurde wegen Verdachts auf Sprengstoff samt Qantasschalter von der Flughafenpolizei in die Luft gejagt. Mit dem fürchterlich schweren Tablar machte Jill sich über die Rolltreppe auf den Weg hinunter in Richtung Gate 24. Jetzt nur nicht straucheln! Eine lange Menschenkolonne stand vor der Sicherheitsschleuse. Sie überholte die Wartenden und stellte sich vor die Glastür neben der Gepäckdurchleuchtung. "Hallo", rief sie dem Sicherheitsbeamten am Ende des Förderbandes zu und zeigte lächelnd mit dem Kopf auf die Glastür. Nach einem nachlässigen Blick auf das Tablar mit den unverdächtig wirkenden Butterportionen und den Tassen drückte der Beamte auf einen Knopf, der die Tür für Jill öffnete. In der Abflughalle stellte sie das Tablett auf einen Koffertisch neben zwei leeren Stühlen. Sie zog die Falttasche aus ihrem Versteck am Busen und schichtete die Butterschachteln mit dem darunter versteckten Platin hinein. Das Tablett liess sie stehen. Auf der Toilette zog sie die Uniformjacke wieder aus. Sie trug sie von nun an auf dem 24 Arm. Die Butterquader steckte sie in einen Plastikbeutel, den sie anschliessend in den Abfall warf. Die Münzen für Bombay hatte Jill auf die gleiche Art durch die Sicherheitsschleuse geschmuggelt, nur waren sie in Brötchen eingebacken. Damals wäre die Sache beinahe schief gelaufen, da ein Geschäftsreisender nach Delhi eines der präparierten Brötchen klaute. Der Dieb sass nachher im Flugzeug zufällig neben Jill. Als er zwischen den Mahlzeiten das Brötchen wie ein Scheunendrescher in den Mund stopfte, verlor er beim Biss auf den darin eingebackenen "Caesar" einen Schneidezahn. Jill nahm dem schockierten Mann das julianische Corpus delikti hilfsbereit aus dem Mund und anerbot sich, das Bordpersonal zu rufen. Auf dem Weg dahin vertauschte sie die lateinische Münze gegen eine indische Rupie. Nach der Landung in Helsinki brachte Jill Kehl das Platin in Salgs finnische Operationsbasis nach Illnäs, einem Ort, der unweit von der Werft mit den Surfbooten lag. Die Zentrale war im ehemaligen Bedientestenzimmer eines zum Kongresszentrum umgebauten alten Gutshofs eingerichtet. Jill übergab die schwere Reisetasche mit dem kostbaren Metall dem dortigen Einsatzleiter, einem Sämi Reck. Reck war von Salg für diesen Job angeheuert worden. Salg hatte ihn beim Bodybuilding kennengelernt und von ihm erfahren, dass er sein Leben als Leibwächter friste. Ob er notfalls auch töten würde, hat ihn Salg einmal scherzhaft gefragt. Darauf freue er sich tierisch, erwiderte Sämi. Seine Antwort tönte so überzeugend, dass Salg ihm glaubte. Bei späteren Recherchen erfuhr Salg von Recks diversen Vorstrafen wegen Schlägereien, Körperverletzung und Tierquälerei. "Hier also die Tasche mit dem Silber", log Jill in Salgs Auftrag, mit der Absicht, Recks Begehrlichkeit nicht herauszufordern und ihn zu täuschen. "Dumm wie Bohnenstroh, dieser Russe! Lässt sich in Silber bezahlen. Hat wahrscheinlich noch nichts mitgekriegt vom Silbercrash." "Dämlich wie Schifferscheisse, dieses Pack!", antwortete Reck grob und brummte: "Die Russki mit ihrem Silberfimmel! Kommt aus der Zarenzeit. Die verschrobenen Adeligen fütterten ihre fetten Kinder mit Silberlöffeln ", brummte Sämi Reck. "Buchstäblich?", höhnte Jill und schüttelte sich, angewidert von seinem beknackten Gerede. Reck stopfte die Tasche verächtlich mit seinen Stahlkappenschuhen unter eines der drei Gitterbetten, die das ehemalige Gesindezimmer des Gutshofes füllten. Im Geäst einer Weide unmittelbar vor dem geöffneten Fenster erblickte Jill einen Eichelhäher. "Wie schwerfällig er ist", sagte sie nachdenklich. "Es scheint ihm peinlich zu sein, so ein aufreizendes Gefieder mit einer übertriebenen Haube tragen zu müssen". "Hohl im Kopf?" Reck zeigte ihr den Vogel. "Hat wohl seine Kleidung nicht selber gekauft, oder hä?", grinste er anzüglich. Verwundert schaute Jill auf den gedrungenen, hässlichen Kerl vor ihr, von dem sie nicht wusste, dass er ein Killer war. Der Häher krächzte höhnisch beim Abheben. 25 Köbi Die Auftraggeber von "Köbi 3", freiberuflicher Agent auf Abruf, hielten den Charterflug Kr 2356 für eine relativ gute Tarnung. Ein typischer Flug für HeimwehfinnländerInnen. Für Köbi begann der Tag schon früh mit einer bösen Überraschung. Ausgerechnet heute war der erste Schnee gefallen. Eilig und ungeschickt montierte er unter dem Vordach seines Hauses die Schneeketten über die beiden vorderen Sommerpneus. Da er hoch über dem Limmattal wohnte, war er der winterlichen Witterung stärker ausgesetzt als die Städter. Das hiess mehr Schnee, mehr Wind, aber dafür etwas weniger Nebel. Bis zur Hauptstrasse war er noch überzeugt, richtig gehandelt zu haben. Als er dann aber die schwarzgeräumte Strasse zu befahren begann, kam er sich lächerlich vor. Auf dem Vorplatz einer Bäckerei hielt er an und versuchte die Ketten zu entfernen. Ärgerlicherweise klemmte der Verschluss der zweiten Kette. "Verdammte Scheisse", schrieb er in den Schnee auf der Rabatte und fuhr dann mit nur einer Kette weiter. Kurz vor Rümlang öffnete sich dann ihr Verschluss doch noch, leider während der Fahrt, so dass scheussliche Kettenschläge den Kotflügel ruinierten. "Kot ist Schrot und Schrot ist Schrott", schrieb er mit dem Finger auf die angelaufene Windschutzscheibe. Endlich erreichte er das Parkhaus. Er lud ein Snowboard und ein Paar Skier aus dem Wagen und klemmte sie unter die Arme. "Denken Sie daran, dass Sie nicht gewöhnliche Wintersportgeräte mitschleppen werden", hatte Areznitz ihm bei der Auftragserteilung eingebläut. Er hatte nämlich durch einen aus geheimdienstlicher Sicht "topcleanen" Skifabrikanten die Verschlussstifte in die Skier und in das Snowboard eingiessen lassen. Als Köbi den Parkhauslift verliess, fand er sich von lauter leeren Kofferwagen umgeben. "Neu für Zürich", dachte er. Bei der Rolltreppe lüftete sich das Geheimnis. Die Treppe war von der Flughafenpolizei gesperrt. Er ging mit seiner Skiausrüstung zu Fuss in den oberen Stock und erreichte in einem Strom von Menschen den Flughafen A. Von dort gelang es ihm, auf dem Umweg über die Anfahrtsstrasse die Abfertigung B zu erreichen. Hier war das Chaos total. Halb Europa schien heute nach Hause zurückkehren zu wollen. Die Luft war stickig und roch süsslich. Überall gab es Absperrungen, und es herrschte ein fürchterliches Gedränge. Obwohl es sehr lange dauerte, bis er Skier und Board aufgeben konnte, langweilte er sich keine Sekunde, hatte er doch Schreibutensilien bei sich. Ein Ordnungshüter lotste ihn zur Abflughalle, mitten durch balkanische Grossfamilien, die sich wohl schon seit längerer Zeit auf und neben ihrem Gepäck hatten niederlassen müssen. Erleichtert passierte er die Sicherheitskontrolle. Wegen schlechter Witterungsverhältnisse war in Malmö eine Zwischenlandung angesagt. Köbi 3 kümmerte das wenig. Er sass gern im Flugzeug. Vielleicht war das so, weil er als kleiner Junge Pilot werden wollte. Später begann er aber eine andere Vorliebe an den Tag zu legen, den Umgang mit der Feder. Seither beschäftigt sich Köbi mit nichts anderem lieber als mit dem Schreiben. Köbi schreibt fürs Leben gern. Er schreibt in jeder freien Minute seines Lebens. Er schrieb überall, zu Hause, in der Kirche, im Warenhaus, im Lift, im Weinkeller. Und er schreibt auf alles, was beschriftbar ist, auf Toilettenwände, auf die Bänke in der Mensa, auf Tischtücher in der Kronenhalle, auf Illustrierte im Wartezimmer des Zahnarztes und selten genug wie z.B. im Flugzeug auch auf Papier. Manchmal schrieb er sogar auf Fleisch und nicht nur beim Metzger. Schreiben ist seine Berufung, seine Bestimmung, sein Lebenssinn, seine erste Leidenschaft. Seine zweite Passion besteht darin, geniesserisch zu lesen, was er geschrieben hat. Nach einem Zahnarztbesuch suchen ihn regelmässig heftige Nachschmerzen heim. Sie erlauben es ihm, in das Wartezimmer zurückzukehren, in dem seine Ergüsse vom letzten Besuch liegen. Wenn er dann beim scheinbar ziellosen Blättern so ganz per Zufall auf seine Elaborate stösst, beginnt er sie vor den anderen Patienten zu kommentieren. Manchmal empört er sich lauthals über "diese Schreiberlinge: Sie kritzeln auf alles, was Farbe annimmt". Oder er ruft begeistert aus: "Das ist aber eine besonders gut gelungene Sentenz. Ich komme einfach nicht umhin, sie laut zu rezitieren". Und dann beginnt er in der oft doch sehr zahnleidenden Runde seine eigenen Kritzeleien vorzulesen. Er stösst dabei Entschuldigungen aus wie: "Ich möchte Sie gewiss nicht stören. Aber was da ein Patient, ich nehme an unter grossen Schmerzen - er verzieht dabei zu aller anderer Leidwesen sein Gesicht –festgehalten hat, erscheint mir so tiefsinnig und gehaltvoll, dass ich es Ihnen unmöglich vorenthalten kann." Bekommt er Unterstützung und Bestätigung, geniesst er den anonymen Erfolg. Wenn sich herausstellt, dass ihn wegen fehlender Deutschkenntnissen niemand versteht, ist er traurig. Es kann auch vorkommen, dass jemand aus dick geschwollenen Backen mit unbeweglichem Kiefer stöhnt: "So ein Mist!", oder "Ach was soll's!". Dann verlässt er wütend die Praxis und wechselt den Zahnarzt. Am Freitag sucht er in der Regel alle öffentlichen Toiletten der Stadt auf, deren Wände er am Dienstag der gleichen Woche betextet hat. Er schreibt dann Kommentare zu seinen Kommentaren. Über Schweinereien, die er am Dienstag hinterlassen hat, beschwert er sich am Freitag. Oder er belobigt eine aus der Dienstagstimmung heraus verfasste tiefschürfende Inschrift mit einem 26 freitäglichen Sinnspruch. Es gab zur Zeit der Drucklegung dieses Buches in Zürich mehrere öffentliche Toiletten, deren vollständig beschriebene Flächen, inklusive Sitzring, Toilettenpapier und Schüssel, einzig und allein das Werk seiner "undichten" - der treffende Ausdruck stammt von ihm - Feder war. Mit Sprayereien an Hauswände hat Köbi sich seit Harald Nägelis Grosserfolg im Ausland nicht mehr abgegeben. Er hält es für ungebührlich, dieses hochgeachteten Meisters Arbeitsflächen zu besudeln. Möglicherweise sagt er das aber nur aus Selbstschutz. Lieber auf diese riesigen ungenutzten leeren Flächen verzichten, als das Risiko einzugehen, wer weiss wie lange mit den kleinen Wänden einer Gefängniszelle auskommen zu müssen! Köbis Haus ist vollgestopft mit Schriftstücken und Inschriften aus seiner schreibenden Hand. Letztere finden sich auf Gegenständen wie Pfeffermühle oder Bettflasche und auch auf Pflanzenblättern. Sie lassen sich aber auch unerwartet in einem alten Puppenhaus, in der Weihnachtskrippe oder im Fonduerechauds entdecken. Manchmal verdriesst es ihn, dass er sich nicht einmal von einem einzigen seiner uralten handbeschriebenen Papiere oder einem auf seiner ersten Schreibmaschine getippten Schriftstück trennen kann. Er erinnert sich noch genau an seine ostdeutsche Olympic und an das darauf folgende Hermes Baby. Überall, wo immer er sich bewegt, und wo er sich gerade aufhält, liegen Tagebucheinträge, Schulaufsätze, Festreden, Pamphlete, Repliken, Briefe, angenommene und noch mehr zurückgewiesene Einsendungen an Zeitungen und Zeitschriften, Reklamationen, Witze, Notizen, Memos, Gesuche, Eingaben, Anleitungen, Rezensionen, Romananfänge, Gedichte. Oft wundert er sich, wer das alles geschrieben hat. Kaum ein Text, an dessen Abfassung er sich konkret erinnert! Häufig ist auch Anlass und Grund der Niederschrift vergessen. Manchmal kommt ihm sogar die eigene Handschrift fremd vor. Und doch kennt er die Person, die ihm aus den Texten entgegentritt. Jedenfalls erinnert er sich sehr wohl, einmal so gedacht und gefühlt zu haben, wie das die Texte ausdrücken. Vieles von dem, was er liest, berührt ihn zu tiefst, über manches kann er nur lächeln, anderes findet er peinlich. Ich möchte es nicht in Verbindung mit mir bringen, so wie ich mich heute verstehe, grenzt er sich ab. Zum Glück geht es anderen auch so, freute sich Köbi, als er von einem Autor erfuhr, der sich schwer damit tat, eines seiner ersten Bücher auf Wunsch seines Verlags neu herauszugeben. Der Schriftsteller hielt seine widersprüchlichen Gefühle in einem aufschlussreichen Vorwort fest. Schliesslich gab er das Buch unüberarbeitet frei. Er überliess es seiner Leserschaft, wie sie es aufnehmen wolle. "Mag sie es einordnen, würdigen, ablehnen oder verlachen", schrieb er22. Bei der Lektüre des Buches fiel Köbi auf, wie stark es sich vom späteren Werk dieses Schriftstellers abhob. Es schien, als wäre da ein Autor am Schreiben gewesen, dessen spätere Genialität sich noch kaum erahnen liess. Gut zu wissen, dass auch andere Menschen Sprünge und Risse in ihrer Biographie, und einige wohl gar Brüche darin haben, tröstete sich Köbi schriftlich. Aber er wusste, dass nicht alle damit so klar kommen wie besagter Autor, der sich das aus seinem Selbstverständnis und Erfolg heraus erlauben und leisten konnte. Während des Weiterfluges bat Köbi die Stewardess um eine kurze Stellungnahme zu diesem Problem. Zwischen Abräumen und Swatchverkauf flüsterte sie ihm ins Ohr: "Da wo's um die Änderung von Werthaltung'n geht, sind biographische Risse nicht leicht zu kitt'n. Solche Brüche werd'n von der Umgebung um so stärker wahrgenomm'n, je weiter sie vom Jugendalter weg lieg'n. Mit sogenannt'n Jugendsünd'n lässt sich's allemal noch leb'n. Sinneswandel im höher'n Alter wird grad mal noch toleriert, aber nur dann, wenn auf Grund neuer, vorher nicht zugänglicher Fakt'n oder in Folge eines transparent'n, öffentlich'n Entwicklungsprozesses neue Einsicht'n glaubwürdig gemacht werd'n können. Ich bin an einer Sache gewax'n, oder ich hab' mich noch'mal tüchtig hineingekniet, heisst's dann als Erklärung. Späte Einsicht wird aber viel häufiger als verwerflicher Opportunismus oder gar als Dummheit gewertet, nur selt'n als Weisheit und Vorrecht des Alters gewürdigt." Durch solch kluge Worte geistig und körperlich erigiert erreichte Köbi die finnländische Hauptstadt Helsinki, die weisse Stadt am Meer, vier Stunden später als geplant. Er ging durch die Passkontrolle für Nicht-EU-Mitglieder und wartete geduldig auf Snowboard und Skier. Auf dem Gepäckband kam eineTransportkiste mit einem Hund. Die betagte Besitzerin lud den Käfig auf einen Kofferwagen und schob ihn durch den grünen Zoll. Köbi folgte dem Pudel. Ein hundeliebender Beamter pickte Frauchen aus dem Touristenstrom, Köbi hingegen wurde nicht behelligt. Mit dem Lift fuhr er hinunter ins Parkhaus. In Reihe 4 auf der linken Seite stand der VW Golf, dessen Schlüssel er in Zürich bekommen hatte. Er packte die Skier und das Snowboard in den Fond, schloss den Wagen und gab den Schlüssel unter dem Namen Lohner bei der Parkhausaufsicht im Innern des Flughafens ab. Aus einer offenen Telefonkabine rief er eine Nummer 22 Stanislav Lem, "Die Astronauten" 27 in Zürich an und erfuhr dort, dass er sich reichlich Zeit gelassen habe. Damit war sein Auftrag erledigt. Auf dem Weg zum Hotelbus hätte ihn fast ein Auto gerammt, weil er während des Gehens bereits an seinem Tagebuch schrieb. "Der Tag hat schlecht begonnen. Nun ist mir klar, dass er bedeutend schlimmer hätte enden können." So schloss sein Bericht. 28 Verwechslung Vor der Passkontrolle hatte sich eine lange Schlange gebildet. Das war erstaunlich, da sie mit dem letzten internationalen Flug dieses Abends in Helsinki eingetroffen war. Hella Gustavsson versuchte ihre gute Laune zu behalten. Die Gepäckausgabe hinter der Passkontrolle würde ohnehin auf sich warten lassen und schliesslich war heute ihr erster Weihnachtsferientag. In der Gepäckausgabe drehte sich ihr schwarzgerippter Koffer bereits auf dem S-förmigen Förderband. Sie hatte abgesehen von einer goldgesäumten Handtasche kein anderes "Gebäck", wie die finnischsprachigen Hostessen sich ihren deutschen Gästen gegenüber auszudrücken pflegen. Der Koffer war schwer wie Blei. Er enthielt praktisch nur Bücher. "Gute Bücher fallen ins Gewicht", dachte sie beim Weggehen. Sie freute sich auf die kommenden Tage. Am Sonntag würde sie ihren 31. Geburtstag zusammen mit Verwandten in einem Wochenendhaus in den Schären östlich von Helsinki verbringen. Bei der Parkhausaufsicht verlangte Hella Gustavsson den Schlüssel vom neuen Zweitauto ihrer Schwester Gitta. Gitta Gustavsson war mit einem Björn Lindgren verheiratet. "Die Schlüssel für Lindgren bitte", sagte sie auf Finnisch. Der Mann hinter dem Schalter drehte seinen Kopf kurz vom TV-Monitor weg, auf dem wohl ein spannender Film lief, und griff in das Schlüsselbrett. "Perkele", fluchte er, als einige Schlüssel auf den Boden fielen und sich in fremden Haken verhedderten. Endlich fand er das Etikett mit dem richtigen Namen, aber der Schlüssel hatte sich losgerissen und lag daneben. "VW?", fragte er die sich amüsierende Gustavsson. "Neunzehn Mark", knurrte er unfreundlich, den Blick bereits wieder auf den Fernseher gerichtet und reichte ihr den Schlüssel. Sie legte einen 20-Markschein hin und machte sich ohne das Rückgeld abzuwarten auf den Weg zum Auto. Der Schlüssel passte nicht zum hellgrauen VW, dessen Standort sie kurz vor dem Abflug von ihrer Schwester mitgeteilt bekommen hatte. Sie wollte schon zur Aufsicht zurück, als ihr Auge auf ein gleiches Fahrzeug fiel, das in der folgenden Reihe stand. Sie versuchte es dort. Der Schlüssel passte. "Typisch Gitta!", motzte sie. Als sie die Skiausrüstung im Wagen entdeckte, dachte sie: "Gitta? Snowboard? Komisch, hat sie mir nie erzählt!" Als sie das Board zur Seite rückte, fiel ihr auf, dass es über und über mit Fettstift beschriftet war. Neugierig las sie auf der Vorderseite rund um die Bindung den auf Deutsch verfassten Text: Losgelöst vom Alltag der Gefühle braust der Sturm der Ganzheit über die Wildnis. Erschüttert schau ich in den Spiegel der tiefen Gewässer, die mich umgarnen. Die Weide der Trauer ist faul bis ins Mark. Hohe Töne spukt die Macht. Die traumatische Wende in der Schlaufe der Realität singt vom Chaos. Verwundert drehte sie das Brett und entzifferte : Geistiger Amok führt hinein in zartes Gewebe von ödemisierten Gehirnrnkonstrukten. Ob die rasende Fahrt durch den Tunnel des Alptraums ein Ende hat in der Hoffnung, ist fraglos mit dem Schicksal verwoben. Es ergiesst sich tosend die See über die Reling alter Boote, die emporgehoben werden durch die sie tragenden Wogen. Die Kette greift ins Getriebe ihrer eigenen Glieder, und führt sie empor zum Licht der Kenntnis eines einzigen Namens, der vergessen wartet im Dunkel. Sie langte sich an den Kopf und versuchte es mit dem linken Ski. Darauf stand: Da gleitet auf der Ebene des Sturms das Boot über die See. Was ist Karte, wo Realität? Ich steige aus und wandere über das Wasser bis zum Ufer der bewaldeten Insel am Rande der Welt. Nie war ich ihr näher, die im Dunst des Abends in der Nacht für immer verschwand. Es glänzt mir der Stein der Erkenntnis im Auge. Beschlagen ist die Brille durch Nebel und Schweiss, mit Quellwasser klärt sich die andere Seite der trennenden Gläser. Auf dem rechten Ski ging es weiter mit: Dein Fleisch hast du mit Tränen haltbar gemacht zum Verzehr. Befiehl deiner haltlosen Stimme das Schweigen, auch wenn du endlose Rede verdienst. Es wird dich die Notwendigkeit retten aus allen Gefahren. Schwer beladene Akustikhülsen durchkrächzen den Raum zwischen dir und mir, Sprechblasen zerplatzen an den Wänden, prallen zerfetzt zurück und verkleben jeglichen Sinn. Erst jetzt fielen ihr die Fingerspuren im Staub der Wagentüre auf. Sie verstand kein Wort: Kaladisch entrapt dem brogohdet dal batad teroum soknör hunlackig empfesst. Sockschede stang Emdsteingel regangen im Wäche der Lufsp. "Jemand spinnt und zwar auf Deutsch." Hella Gustavsson wunderte sich über die kuriosen Versatzstücke und wohl noch mehr darüber, dass sie sich die Mühe gemacht hatte, alle zu lesen. Bei 29 der Ausfahrt aus dem Parkhaus hätte sie beinahe einen blonden Trottel überfahren, der beim Gehen in ein dickes Buch schrieb. "Zieh deine Sonnenbrille aus, du Blindschleiche", schimpfte sie. ––––– Zürich hatte nach Köbis Telefon Sämi Reck und seine zwei Spiessgesellen im Flughafenrestaurant sofort darüber benachrichtigt, dass die heisse Ware übergeben worden sei. "Res, ab zur Information! Hol' den verdammten Autoschlüssel von diesem Lackaffen aus Zürich. Auf den Namen Lohner, denk dran, du Superhirn. Hab' mir heute genug die Füsse ausgetreten wegen diesem Scheisskerl." Sämi rannte mit seinem anderen Pistolero zum VW im Parking. "Das darf doch nicht wahr sein", ranzte er seinen Kumpel an, als sie den Parkplatz leer fanden. "Da hast du aber grosse Scheisse gebaut, Mann", höhnte Pistolenheini schadenfreudig und bekam die Antwort handgreiflich mit einem harten Griff in den Kravattenknopf. "Halt schön mal die Luft an, sonst bist du dran. Hau ab und hol Res! Soll gefälligst seinen Arsch bewegen", tobte er. Minuten späterer kamen die beiden ausser Atem angetrabt. Der Schlüssel, den sie mitbrachten stimmte nicht überein mit dem Ersatzschlüssel, den Sämi hatte. Der fernsehsüchtige Mann in der Flughafeninformation konnte seinen Lieblingskrimi nicht mehr in Ruhe fertig schauen. Er rettete sein Leben, freilich ohne es selber zu wissen, im Augenblick, als er das Etikett des verwechselten Schlüssels unter dem Hakenbrett am Boden fand. Darauf stand fein säuberlich die Adresse von Lindgrens Wochenendhaus in den Schären. 30 Sämi Reck Im Sternensaal war die ganze Meute vom Jahrgang 65 versammelt. "Er ist nie mehr an eine Klassenzusammenkunft gekommen so lange ich weiss", stellte Maja fest, als die Rede auf dem Sämi Reck gekommen war. "Hast du etwas anderes erwartet?", fragte Urs rhetorisch. "Na ja, ein bisschen speziell war er schon!", gab Maja zur Antwort. "Tönt nett Dein ‘Ein bisschen speziell!’. Ha, ha, dass ich nicht lache", meinte Urs unfreundlich. " Würd' ihn eher als Rüpel bezeichnen. Hatte überhaupt keine Manieren, ein Trottel ersten Grades." Urs nahm einen gewaltigen Schluck aus seinem Bierhumpen, den letzten, wie er betrübt feststellte. "Fräulein, nochmals ein Grosses!", brüllte er durch den Saal. "Stimmt schon", besann sich Maja. "Ich erinnere mich noch als wir in der Fünften waren. Weisst du noch, wie jeweils alle klassenweise hintereinander vor der Schulhaustüre stehend auf die Lehrkräfte warten mussten?" "Während die beim Pausenkaffee Überstunden machten..." Urs hielt sich grinsend den schwabbeligen Bauch. "...oder am Morgen den Rausch verpennten!" ergänzte Maja lachend. "Sämi stand immer ganz hinten in der Kolonne. Und immer mit einem ‘Opfer’." Urs erinnerte sich: "Stimmt, einige Male war ich auch dran", polterte er. "Hat mich auf den Rücken gelegt und sich auf meine Oberarme gekniet. Muskelreiben nannte er das. Tat höllisch weh! Wehren konntest du dich überhaupt nicht, der Kerl war einen Kopf grösser und bärenstark. Je stärker du geflennt hast, desto mehr hat er sich amüsiert. Ein richtiger Sado." "Hmm, wenigsten hat er die Mädchen in Ruhe gelassen, nicht wie du!", sagte Maja anzüglich, und schränkte ein, "jedenfalls damals". Dafür erhielt sie handgreifliche Schelte. "Nur nicht frech werden, Dickerchen!", drohte sie und haute ihm auf die Finger. "A propos wehren. Einer der Erstklässler in der Nebenreihe, ein richtiger Knirps, hat sich jeweils furchtbar geärgert über ‘Sämi’ den Folterer, wie er ihn nannte. Einmal hat er sich vor dem Quälgeist aufgestellt - ich weiss nicht, wen er gerade bearbeitet hat. Mit beiden Händen packte ihn der Kleine an den Haaren und hat ihn einfach runter gedrückt mit seinem ganzen Gewicht. Eine ganze Weile hat er ihn so gehalten und dann losgelassen. Hat echt Mut gehabt, der Kerl. Die ganze Schule hat gebrüllt vor Vergnügen! Ich vergesse nicht mehr, wie das ausgegangen ist! Als Sämi seinen Kopf hob, war sein Gesicht tränenüberströmt. Hätt' ich nie erwartet von so einem harten Jungen!" Urs war überrascht: "Der und geheult?" "Und ob, geschluchzt hat er. Es hat ihn richtig geschüttelt", schilderte sie. Urs hob seinen Humpen und kehrte ihn um. "Wo bleibt mein Bier, Fräulein! Bin im Fall kein Asylant!", schrie er ungeduldig. Jetzt mischte sich Ruedi ein: "Sprecht ihr vom Reck? Ich weiss noch als ich in der Sechsten neu in euere Klasse kam. Ich sass eine Bank vor ihm. Ich habe mich gewundert über die eitrigen Wunden an seinen Handgelenken. Wie Schnitte, quer über die ganze Innenseite. Als ich ihn darauf ansprach, behauptete er, er hätte vom Lehrer eine Tatze23 mit der Linealkante bekommen! Möglich wär's schon gewesen beim Müller. Der hat ja geprügelt, was der Bambus hielt! Nur habe ich das damals noch nicht gewusst. Ich nahm deshalb an, dass er versucht hat, sich die Pulsadern aufzuschneiden!" "Wie wenig wir übereinander wissen!", seufzte Maja. "War das bevor sie ihn in ein Heim gesteckt haben? In der Sechsten war das, da bin ich ziemlich sicher! He, wer von euch hat was von Reck gehört?", wandte sie sich an die Runde. "Reck?" Bruno hatte den Namen aufgeschnappt. "Ich habe ihn nach der Rekrutenschule nur noch einmal gesehen. Beim Coiffeur. Er sei in der Polizeischule, hat er mir gesagt." "Da ist er ja goldrichtig gelandet", spottete Urs vor dem leeren Glas. "Du hast die Rekrutenschule mit ihm gemacht. Hab' ich gar nicht gewusst." Bruno begann zu erzählen: "Wir waren sogar in der gleichen Kompanie. Er hatte sein Bett über mir." "Muss eine Tortur gewesen sein für dich?", lachte Ruedi. "Es geht", fuhr Bruno fort. "Mich hat er in Ruhe gelassen, vielleicht weil wir vom gleichen Kaff sind, was weiss ich. War er ein richtiger Kriecher. Die konnten alles mit ihm machen. Als er merkte, dass eine Beförderung nicht drin lag, begann er uns zu tyrannisieren, besonderes die Aspiranten. Aber am meisten gehasst hat er die Tessiner in unserer Kompanie. Gegen oben ist er ein Arschlecker geblieben." 23 Schweizerdeutsch für den Schlag mit einem Stock auf die ausgestreckte Hand. 31 "Leben eigentlich seine Eltern noch?", fragte Maja neugierig. "Hans muss das wissen, er hat in der gleichen Strasse gewohnt. Nicht wahr, Hans!", rief sie über den Tisch. Hans kehrte sich zu ihr um, mit trichterförmigen Händen vor dem Mund gegen den Raumlärm ankämpfend: "Sämis Eltern, fragst du? Keine Ahnung. Als Sämi das erste Mal in den Knast kam, sind sie weggezogen." Der Lärm im Saal ebbte kurz ab. "Die ganze Strasse war froh darüber. Der alte Säufer. Dauernd hat er seine Frau verprügelt. Sie würde auf den Strich gehen hat er jedem erzählt, der es wissen wollte. Arbeit hatte er schon lange nicht mehr. Er hat sich mit Hundemetzgen durchgeschlagen." "Pfui Teufel!", schüttelte sich Maja. "Hunde sagst du?" "Ja, es ging sogar das Gerücht, er habe verscharrte Hunde ausgegraben, wenn er davon Wind bekam." berichtete Hans genüsslich und wedelte mit der Hand vor der Nase. "Hör auf mit diesem Mist, ich will nichts mehr davon hören", ärgerte sich Maja und warf einen Bierdeckel nach ihm. "Unsere sentimentale Maja! Von mir aus könnte man alle Köter schlachten, und die verdammten Katzen dazu", drangsalierte er sie. Hans, was hast du eben gesagt, Sämi war mal im Knast?" hakte Urs nach. "Was hatte er angestellt?" Hans trumpfte auf: "Einmal ist gut! Das erste Mal sass er wegen Totschlags, deshalb ist er ja aus der Polizeischule geflogen. Er hat im Suff einen Tamilen spitalreif geschlagen, der ist dann eingegangen. Wegen des Suffs hat Sämi mildernde Umstände gekriegt." "Der Reck ist mir sympathisch", krähte Urs. In der Nähe schüttelten einige empört die Köpfe, ohne etwas zu sagen. Hans fühlte sich wichtig und erzählte weiter: "Später sind zu seinen Schlägereien einige Brüche dazu gekommen. Hast du damals nicht gelesen in der Zeitung? Stimmt, du warst im Ausland. Er soll auf einer Diebestour eine Frau vergewaltigt haben, wurde berichtet." Jetzt ging es los mit den Kommentaren. "Was, das war Sämi?", "Stimmt, stand im Blick!", "Hab noch bei mir gedacht!", "Also so was!", "Hätte geschworen, dass es ein Ausländer war!", "Einer aus unserer Klasse!", ertönte es überrascht aus der Runde. Maja jammerte: "Und mit so einem Kerl bin ich in die Schule gegangen! Bin froh, dass er nicht gekommen ist." "Ich bin überhaupt nicht überrascht", spielte sich Bruno auf. "Als wir klein waren, hat er dauernd Frösche gequält, steckte ihnen Zigaretten in den Mund, bis sie platzten und so. Einmal hat er beim Dorfteich einer Möwe, die er mit einer Fischangel gefangen hatte, buchstäblich den Kopf abgerissen. Das Blut ist richtig heraus gespritzt." Urs spitzte die Ohren: "Los erzählen! Jetzt wird's spannend." "Jetzt hört aber sofort auf!" versucht Maja abzuklemmen. Scheissweiber, dachte Bruno und provozierte: "Jetzt brauch' ich ein saftiges Steak! So schön blutig." Mit den Armen imitierte er die Stellung eines Frosches. "Und du Urs, du möchtest sicher ein paar Froschschenkel, quak, quak?", biederte er sich bei seinem Kumpel an. "Schenkel schon, aber doch nicht von Fröschen!", schweinigelte dieser prustend. "Und mein Bier? Wo bleibt die Serviermaschine? Muss ich mich noch schwarz anmalen! ha,ha,ha!" Maja dachte an den mutigen kleinen Jungen aus der ersten Klasse und schämte sich. 32 Verfolgung Sämi Reck nahm mit seinen zwei Spiessgesellen Res und Heini unverzüglich die Verfolgung Hella Gustavssons auf, respektive die Spur eines Autos, von dem Hella glaubte, dass es ihrer Schwester Gitta gehöre. Kurz nach Mitternacht erreichten die Gangster über zwei Autofähren das Haus in den Schären. Hella war aber gar nicht dahin gefahren, sondern hatte das Auto hinter dem Haus der Stadtwohnung ihres Schwagers abgestellt. Er und die beiden Schwestern beabsichtigten erst am nächsten Morgen in Lindgrens Erstwagen zum Ferienhaus zu fahren. Die Verwechslung der Autos fiel weiter nicht auf, da Hella ihr Gepäck selber ins Haus trug und den Autoschlüssel auf eine Konsole neben der Eingangstüre legte, wo ihn niemand mehr beachtete. Sämi fuhr unterdessen wutentbrannt mit seinem Auto von den Inseln zurück in die Stadt. Er wollte am Morgen sofort Abklärungen über den verschwunden VW in die Wege leiten. Versteckt im Wald überwachten Res und Heini die ganze Nacht hindurch das Stockhaus in den Schären. Der Schlüsselportier hatte die Fahrerin des verwechselten Wagens als rothaarige, sportliche Endzwanzigerin beschrieben. "Wenn sie auftaucht, schnappen wir uns die Mieze", schimpfte Res, und Heini ergänzte roh:" Der Chef wird die helle Freude haben. Für den kann's nie genug rot sein". Als Lindgren mit seiner Frau und deren Schwester morgens gegen 9 Uhr in ihrem Landhaus vorfuhren, waren Res und Heini halbtot vor Müdigkeit und Kälte. Sie mussten noch eine weitere Stunde warten, bis Hellas Schwester und ihr Mann mit einem Beil und einer Säge das Haus verliessen, wohl um im Wald einen Weihnachtsbaum zu schlagen. Hella wurde von Heini zum Eingang geklopft und gelockt und dann mit Waffengewalt in Lindgrens gestohlenem Wagen nach Illnäs entführt. Res parkierte das Auto am Fluss, unterhalb des schlossähnlichen Gutshauses, in dem Salgs Zentrale eingemietet war. Beim Aussteigen aus dem Auto beobachtete Hella, wie ein Motorboot am Steg anlegte. Sie sah, dass es mit laufendem Motor nur mit einer über einen Pfosten geworfenen Schlinge vertäut wurde. Ein Mann brachte eine Reuse an Land und ging damit in einen Schuppen. Zum Gutshaus hinauf führte eine steile Treppe. Die beiden Gangster zwangen Hella vor ihnen her zu gehen. Plötzlich begann sie nach oben loszurennen, bremste nach einigen Metern scharf ab, kehrte sich unvermittelt um und prallte mit voller Wucht in den Bauch von Heini, der gerade hinter ihr her sprinten wollte. Durch den Stoss verlor er das Gleichgewicht und brachte Res, der zurückgeschaut hatte, zum Stolpern. Mit Riesensätzen sprang Hella die Treppe hinab zur Schiffslände, hob die Schlinge des Bootes über den Pfosten, sprang auf die Ruderbank und stiess vom Ufer ab. Heini, der sich als erster aufgerappelt hatte, versuchte sich im umgekehrten Tellensprung, verfehlte das Boot knapp und stürzte ins kalte Wasser. Hella, bereits am Steuer, gab Gas. Res wollte schiessen, befürchtete aber, seinen Kumpanen zu treffen. Heini hielt sich am Bootsrand bis Hella ihm mit dem Bootshaken so auf die Finger klopfte, dass er jaulend loslassen musste. Sie drehte den Geschwindigkeitsregler an der Pinne voll auf und brauste die Borgå24 hinunter Richtung Meer. Res zog den tropfnassen und fluchenden Heini an Land. Mit einem Powerboot, das sie weiter oben in einer kleinen Bucht vertäut hatten, verfolgten sie Hella. Die rücksichtslose Verfolgungsjagd ging zuerst nahe an einigen Sommerhäusern vorbei. Sitzplätze wurden überschwemmt, Fensterscheiben bespritzt. Die enge Fahrrinne führte jetzt mitten durch einen alten Baumbestand. Rauschend und heulend brausten die Boote unter einer Autobrücke auf ein ausgedehntes Sumpfgebiet zu, in dem während der trockenen Sommermonate Kühe weiden. Sie rissen Netzverankerungen und Reusenmarkierungen mit sich. Der Schwall des Powerbootes warf ein kleines Ruderboot an Land. Nach einer unübersichtlichen Kurve musste ein maroder Holzsteg dran glauben. Ein Angler, der auf ihm Ruhe und Entspannung gesucht hatte, konnte sich gerade noch am Ast einer Silberpappel hochrappeln, bevor die morschen Späne flogen. Seine frisch gefangenen Fische wirbelten durch die Luft und fielen nach der unverhofften Befreiung zurück in ihren angestammten Lebensraum. Hellas langsameres Boot, das gerade einen breiten Schilfgürtel erreicht hatte, kam ins Gesichtsfeld der beiden Männer. Sie wusste, dass sie nur im untiefen Wasser eine Chance hatte. Deshalb drosselte sie rasch den Aussenborder und kippte ihn nach vorn. Dadurch hob sich der Schaft mit dem Propeller. Vorsichtig tuckerte sie zwischen den kahlen Schilfrohren vom letzten Sommer aus der Fahrrinne weg. Res durchschaute den Trick zu spät. Kaum hatte er Hella im Schilf ausgemacht, brauste er in gerader Linie auf sie zu. Der Zehnzollpropeller des Powerbootes frass sich sofort in den lehmigen Schlick. Das Wasser färbte sich schwarz und Modergestank stieg auf. Die plötzliche Temporeduktion warf die beiden Gangster fast aus dem Boot. Res gab Gas und würgte das Boot mit heulendem Motor dezimeterweise durch den weichen Morast. Dann barsten die Flügel des Propellers. So entkam Hella elegant aus 24 Fluss durch finn. Porvoo, schwed. Borgå 33 ihrer misslichen Situation. Wieder an Land alarmierte sie die Polizei. Diese fand später das im Schilf festsitzende Powerboot leer vor. Res und Heini war nichts anderes übrig geblieben, als halb schwimmend, halb kriechend auf dem lehmigen Untergrund nach festem Boden zu streben. Erst bei Einbruch der Dunkelheit um vier Uhr nachmittags wagten sie, ihre lehmverschmierten Körper schniefend und niesend ins Gutshaus nach Illnäs zurück zu schleppen. Zum Retablieren hatten sie keine Zeit. Unmittelbar nach ihrer Ankunft beorderte sie ihr Chef telefonisch zur Werft. Sämi Reck hatte inzwischen den verwechselten VW-Golf und die mit Areznitz' Verschlussstiften gespickten Wintersportgeräte vor Lindgrens Stadthaus ausgemacht. "Schleppt eu're Colts mit, um 19 Uhr findet die Übergabe bei der Werft statt. Ich kann euch Schlappschwänzen nur dringend empfehlen, nochmals den Plan HEP mental durchzuspielen. Auf der Fahrt natürlich, wo denn sonst! Habt ihr die rote Biene eingefangen? Was heisst da «ja und nein»? Die Operation wird sofort abgeklemmt. Aber Tempo gefälligst und keine Spuren, klar! Was heisst da wie? Natürlich mit "Stinkender Fisch im Moor", tönte es aus dem Hörer. "Praktisch schon geschehen Chef", log Heini und roch angewidert an seinen lehmverkrusteten Fingernägeln. 34 Boris Lattem Boris Lattems Vater war vor seiner Frühpensionierung Berufssoldat in Estland gewesen. Während eines riesigen Waldbrandes, der eine militärische Anlage bedrohte, hatte er sich in einer Löschequippe mutig hervorgetan, einen Orden verdient, aber leider seine Gesundheit mit einer schweren Rauchvergiftung ruiniert. Mit seiner Familie zog er später nach Leningrad, weil er sich dort bessere medizinische Betreuung versprach. Seine Frau, Boris Lattems Mutter, stammte aus dem estnischen Narva, wo sie in einer Fischereifamilie aufgewachsen war. Vor ihrer Heirat führte sie die Kantine in der gleichen Kaserne, in der Boris Vater diente. Durch die eheliche Verbindung wurde sie russifiziert. Nach dem Tode ihres Gemahls erhielt sie eine kleine Rente. Als sie in Leningrad nichts mehr hielt, übersiedelte sie nach Tallinn. Nach Narva, wollte sie nicht mehr zurück, denn sie hatte sich in der Fünfmillionenstadt Leningrad so sehr an den städtischen Betrieb gewöhnt, dass sie sich kaum mehr in das Leben einer kleinen estnischen Hafen- und Arbeiterstadt hätte eingliedern können. Die alten Zeiten waren ohnehin vorbei, und hätten sie noch existiert, sie wäre ihrer gewiss nach kurzer Zeit überdrüssig gewesen. Mit ihrem Sohn sprach sie estnisch, obwohl sie keine Ressentiments gegen die Russen hatte wie die meisten EstländerInnen seit 1940. Von der Heldentat ihres Mannes hielt sie begreiflicherweise wenig, und sie hatte nie ein Hehl aus ihrer Ansicht gemacht. "Das hat er nun von seiner Heldentat! Einen Orden über seinen asthmatischen Lungenflügeln!", jammerte sie ihrem kleinen Sohn schon zu Lebzeiten des kranken Gatten vor. Solch mütterlichen Glaubensspruch deutete der junge Boris auf seine Weise: "Wenn du schon ein Risiko eingehst, dann wenigstens für etwas, das dich glücklich macht." So erhielt Boris von seiner Mutter eine pragmatische Einstellung zu Ehre und Ruhm und, was von unschätzbarem Nutzen war, genügend Kenntnisse in einer Sprache, die ihm ein Fenster zur Welt des kapitalistischen Westens öffnete. Die nahe linguistische Verwandtschaft des Estnischen und des Finnischen schlug eine Brücke zwischen den beiden Sprachinseln am Rande der politisch-wirtschaftlichen Blöcke. Später, als Boris Lattem mehr im Sinne hatte, als eine äusserst fragwürdige Karriere in der russischen Armee, machte er mit einigem technischen Aufwand das finnische Radio und Fernsehen zu seinen Lieblingsmedien. Die amerikanischen Spielfilme, die im finnischen TV in Finnisch untertitelt sind und im Orginalton belassen werden, erweiterten seinen sprachlichen Horizont beträchtlich. Sie weckten sein Interesse an den Errungenschaften der westlichen Welt, die ihm in der UdSSR immer vorenthalten bleiben würden. Wenn er von seiner Mutter den Schlüssel zum Tor des Westens erhielt, so verdankte Boris seinem Vater die wohlwollende Begünstigung der kommunistischen Partei während seiner Ausbildung zum Metallurgen und seiner späteren militärischen Karriere als Spezialist für radioaktive Stoffe. Die Wahl einer so heiklen Materie zu seinem Spezialgebiet lässt vermuten, dass etwas von der Risikobereitschaft seines Vaters in seinen Genen weiter lebte. Aber das war nicht alles. Boris Lattem verspürte seit seiner frühen Jugend einen seltsam hephaistischen Trieb in sich. Er liebte das Feuer und noch tausendmal mehr das Metall. Als Kleinkind blieb er mit seiner Zunge mehrmals an Eisenteilen kleben, weil er trotz grosser Kälte triebhaft daran lecken musste. Die in den Volksschulen der UdSSR gängige Darstellung des vorgeschichtlichen Klassenkampfes hatte ihn erst vom Augenblick an brennend interessiert, als das Feuer erfunden wurde. Mit der Steinzeit konnte er überhaupt nichts anfangen. Die Bronzezeit begann sein kindliches Gemüt wieder mehr anzusprechen. Aber erst die Hallstattkultur, in welcher die Bronze dem Eisen wich, nahm ihn völlig in Beschlag. Ich werde Schmied oder Stahlarbeiter, schwor er begeistert. Seinen grössten Traum, ein Besuch des Eiffelturms in Paris, dessen Bild viele Jahre sein Zimmer zierte, musste ihm natürlich versagt bleiben. Als er 18 Jahre alt geworden war, konnte er einen Teil der Militärpflicht dank seiner Kleinwüchsigkeit als Panzerfahrer absolvieren. Nie konnte er genug bekommen von den Stahlkolossen, in denen er sich geborgen fühlte wie das Embryo im Mutterleib. Während des Studiums hatte er lebhaft teilgenommen an einer wissenschaftlichen Kontroverse um die Farbe der Metalle. Damals stellte ein Professor Schub von der ETH Zürich die These auf, dass alle Metalle eigentlich schwarz wären. Für den Studenten Lattem war, mehr aus ästhetischen als aus wissenschaftlichen Gründen klar, dass Schwarz die Farbe aller reinen Metalle sein musste. Das Gelb des Goldes schrieb er genau so einer chemischen Verunreinigung der Metalloberfläche zu, wie das beim Grün des Kupfers unbestritten ist. "Metalle sind schwarz, denn Schwarz ist die Farbe der Hölle", schrieb er seinen Genossen Kommilitonen in die Wintermützen. "Das ist so sicher wie das Blau des Mittagshimmels", fügte er bei, wenn einer aufbegehrte. Nach seiner Ausbildung zum Metallurgen und mehreren militärischen Beförderungen bekam Lattem die Leitung des Hotlabors der staatlichen Urananreicherungsanstalt Silmet in Estland. Nun gehörte radioaktives Metall zu seinem Beruf. 35 "Geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein strahlendes Reich, gib mir mein tägliches Brot und führe mich nicht in Versuchung!", verfremdete er blasphemisch das ihm von der Mutter her bekannten "Vater unser" der Christenheit. Dank seiner beruflichen Stellung konnte er sich unter dem Vorwand höchster Strahlengefahr nach Belieben in seiner eigenen Welt von der Umgebung abschirmen. Im Innern des Bereiches, wo aus physikalischen Gründen der Zutritt für menschliches Leben unmöglich schien, gleichsam hinter der Radioaktivität, schuf er sich einen strahlengeschützten Ort, ein Reduit, das ihm allein "die Macht und die Herrlichkeit" gab. Von dieser selbst geschaffenen göttergleichen Position aus agierte er für seine Ziele, phantomhaft und unfassbar. Klein von Wuchs, verunstaltet durch eine Narbe über der linken Gesichtshälfte, die er sich bei einem radioaktiven Unfall zugezogen hatte, nahm er mehr und mehr die Gestalt Zwerg Hagens an, des Rheingolds sagenhaften Wächters. Lattems wahre Leidenschaft aber gehörte weder dem strahlenden Plutonium, noch dem begehrten Gold, sondern dem kostbaren Platin. "Seine Farbe der Hölle offenbart es in der Morphe seines Mohrs25", schwärmte Lattem. 25 sehr feiner Platinmetallstaub 36 Diebstahl "Dieser verdammte Damm wird nie halten. Eines Tages wird er zusammen mit der ganzen Scheisse, die ihr hinter ihm abgelagert habt, in der Ostsee versinken", schimpfte der Geologe Sascha Gora. "Was soll das, Genosse Gora, der Damm ist 20 m dick, gebaut nach bestem Ingenieurwissen, ein unverrückbares Bollwerk aus Beton", beschwichtigte Mirislav Minkovski, der Chefingenieur von «Silmet Entsorgung». "Beton?", höhnte Gora. "Bestenfalls ein mit Dreck durchsetzter verfestigter Sandhaufen, und das nennst du Beton!" Die beiden stritten sich wieder einmal über eine Deponie für radioaktive Abfälle am Ufer der Ostsee in der Nähe der 20'000-Seelen-Stadt Sillamäe, westlich von Narva. Seit Jahren wurde hier verstrahlter Müll, soweit er nicht gleich vor Ort abgelagert wurde, aus den sozialistischen Nordwestrepubliken zusammengekarrt und herangeschifft. Besorgt hatte der Meeresgeologe Sascha Gora schon in mehreren Eingaben bei den Sowjetestnischen Behörden darauf hingewiesen, dass der Damm, hinter dem sich die heisse Ware immer höher türmte, durchlässig und instabil war. Eine schriftliche Antwort hatte er nie erhalten. Auf telefonische Rückfrage hin erhielt er den barschen Bescheid: "Genosse Gora, das Problem ist uns bekannt! Also wie du siehst, haben wir alles im Griff. Deine Sörgelchen müsste man haben! Gehört das etwa zu deinem Aufgabenbereich? Kümmere du dich ruhig um deinen eigenen Dreck. Was heisst, du wohnst dort? Wir alle wohnen irgendwo. Das heisst noch lange nicht, dass wir uns deshalb überall einmischen müssen. Was zum Teufel geht dich das an? Was erlaubst du dir überhaupt, in einer geheimen staatlichen Anlage herumzuschnüffeln?" "Willst du mir etwa verbieten, die Messpunkte auf dem Damm als Referenzen zu benützten? Wo ist da die Verordnung, die das verbietet?", schrie Gora unbeherrscht ins Telefon. "Ich sage dir, was uns fehlt! Ein Instrument wie das der Umweltverträglichkeitsprüfung. Im Westen haben sie das schon längst." "Dann hau' gefälligst in den Westen ab, Washington einfach, Genosse. Weisst du übrigens, was hinter diesem Schlagwort steckt? Dummes Geschwätz und leeres Gefasel. Wozu soll diese sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung dienen? Mir wird schon schlecht, wenn ich das Wort höre. Ausdruck westlicher Degeneration! Da streiten sie sich wie wild über die Details eines Projekts im Hinblick auf eine mögliche Umweltgefährdung, wenn über das Vorhaben an sich schon längst nicht mehr diskutiert werden kann. Mit andern Worten dann, wenn die Neuerung schon eingeführt ist! Warum das so ist, liegt ja wohl auf der Hand. Diese kapitalistischen Staaten haben weder kommunale noch nationale Machtinstrumente, um globale Entwicklungen zu steuern. Hör' auf mit dieser westlichen Propaganda, du lächerlicher Wicht!", wurde Gora resolut belehrt. "Du willst doch nicht etwa behaupten, das sei anders bei uns? Willst du mir weismachen, Fernsehen, Telefonie, Gentechnologie und Mobilität bis hin zur Raumfahrt sei bei uns vor ihrer schleichenden Einführung auf Umweltverträglichkeit geprüft worden? Ganz zu Schweigen von den Segnungen der Roten Armee, du rotznäsiger Gartenzwerg!", brüllte Gora beleidigt. "Du weisst, wo Reaktionäre enden, Genosse Gora! Unser System kann gut und gerne auf die Gehirnmasse eines unterbelichteten Geologen verzichten. Wohin kämen wir, wenn wir jedes Pänzerchen, jedes Kanönchen oder jedes Atombömbchen auf seine Umweltverträglichkeit prüfen wollten. Wir planen mit Blick auf das Ganze. Wir denken im Gegensatz zu den Kapitalisten, bevor wir ein Projekt starten. Wenn das Ziel gut ist, stimmen auch die Mittel. Was der arbeitende Klasse billig ist, ist der Umwelt recht. Unsere Partei weiss das und handelt danach. Was den Massen dienlich ist, steht also über der Natur, ist gewissermassen übernatürlich. Nimm das gefälligst zur Kenntnis!", dröhnte es drohend aus dem Hörer. "Muss ich mir jetzt noch dein philosophisches Geschwätz anhören, du dialektischer altkommunistischer Hohlkopf", schrie Gora empört. "Du willst doch nicht allen Ernstes behaupten, dass die Mitglieder deines Büros zur arbeitenden Klasse gehören? Dass ich nicht lache. Euer Hang zum Übernatürlichen dürfte nächstens in Göttlichkeitswahn transzendieren. Woher willst du und deine Partei wissen, wie sich beispielsweise das Internet oder die totale Satellitenkommunikation auf das Wohl der Massen auswirken wird, wenn ihr nicht einmal fähig seid, die Gefahren eines berstenden Dämmchens abzuschätzen. Noch bevor ihr überhaupt begonnen habt zu denken, wird sich das Internet zum Intranet und der gestaute Giftmüll zur Schlammlawine mutiert haben", grollte Gora. "Jetzt werd' aber nur nicht frech! Verschluck' deinen Müll und pflüge deinen eigenen Mist unter. Ich habe genug von deinen Meckereien! Lass mich bloss in Ruhe damit!", tönte es grimmig zurück. 37 "Du wirst noch von mir hören, du ungehobelter Schreibtischmörder, pppfff!", stiess Genosse Gora heraus, indem er den letzten Luftrest seiner Lungen in den Fernsprecher verpuffte. Er war sich der Leere seiner Drohung bewusst, noch ehe er den Hörer auf die Gabel schmiss. "Gespräche wie diese gehören heute bereits zur Tagesordnung", seufzte er. Alle ausser ihm schienen das relativ gelassen zu nehmen. "Tempora mutantur nos et mutamur in illis26", resigniert Gora. In Ermangelung an Lateinkenntnissen zitierte er den fränkischen Kaiser Lothar allerdings auf Russisch. Boris Lattem kümmerte dieser Streit um die Sicherheit eines Dammes und die ihm zu Grunde liegenden philosophischen Aspekte wenig. Sollte er etwa wie die Grünen im Westen zur Rettung der Welt mit dem Sammeln von Aludeckelchen beginnen? Was kann er dafür, dass sich heute Millionen von Menschen mit Sonnencreme "Lichtfaktor 15" schützen müssen wegen der Ozonschichtkillergase. Freigesetzt werden diese schliesslich aus dem gleichen Grund, wie Aludeckel gewalzt werden: Im Osten darf das Plansoll und im Westen der Gewinn nicht gefährdet werden. Und die Systeme haben sich so entwickelt, dass alle damit leben, mehr der Not gehorchend als dem eigenen Trieb, denn sie fürchten um ihre vermeintlichen Privilegien und um ihre Arbeitsplätze. Die Welt entwickelt sich nach ihrer eigenen Dynamik. Was kann ich kleines Würstchen schon dagegen ausrichten? Illusionen hat, wer glaubt, gegen die Natur des Menschen angehen zu können. Ich habe die Naturgesetze nicht erfunden und ich bin unschuldig am menschlichen Genom, also kann ich mich da bedenkenlos heraus halten. Was für mich gut ist, nützt auch den Massen, redete er sich heraus. Nein, er hatte genug mit seinen eigenen Problemen zu tun! Eines davon betraf die Lagerung des Plutoniums, das er im Laufe der letzten Jahre heimlich abgezweigt und beiseite geschafft hatte. Es stammte aus den Köpfen veralteter Nuklearwaffen und aus den Reaktorherzen von U-Booten, die dem Hotlabor von Silmet zur Abwrackung zugeführt wurden. Die gestohlene Ware lagerte er in alten Warmwasserboilern in einem nur ihm zugänglichen Raum. Langsam wurde es Zeit, diese Boiler an einen geeigneteren Ort auszulagern. Boris Lattem hatte kürzlich einen Platz entdeckt oder besser wiederentdeckt, der geradezu ideal für seine Zwecke schien. Eigentlich kannte er die Stelle schon seit der Zeit, als sein Vater noch lebte. Es handelte sich um ein stillgelegtes Sanatorium für russische Offiziere, in dem sein Vater sich während eines Sommers von seinem Lungenleiden erholen wollte. Sein Gesundheitszustand hatte sich aber in dieser Zeit nur verschlechtert. Lattem glaubte inzwischen den Grund dafür herausgefunden zu haben. "Diese Schweine", empörte er sich, als er an einem regnerischen Sonntag mit seinem stinkenden Lada in einem Anflug von Nostalgie zu diesem Platz hinaus gefahren war. "Sie haben meinen Vater zweimal umgebracht. Zuerst im brennenden Wald, als sie ihn den Helden spielen liessen, dann hier, wo sie ihm den Rest gegeben haben", klagte er der mageren getigerten Katze, die sich miauend an seinem Bein rieb. Er hob sie auf und warf sie angeekelt fort, als er das offene Geschwür an ihrem Hals entdeckte. Lange blieb er am rostigen, durchlöcherten Maschengitter stehen, das sich als Abgrenzung um das ganze Gelände des ehemaligen Pflegeheims zog. Auf einem mit Schüssen durchlöcherten Schild las er in Estnisch und Russisch: "Sperrzone! Gefahr für die Gesundheit! Zutritt strikte verboten!" Unmittelbar hinter dem hohen Gitterzaun konnte er eine riesige Geländevertiefung erkennen, die zweifelsohne der Ablagerung von Müll gedient hatte. "Eine nette kleine Giftmülldeponie, und das neben einem Sanatorium, dessen Wasser aus dem eigenen Brunnen im Park gepumpt wurde!", vermutete er. Die alte Dreckgrube war durch einen Felsrücken von einer wunderschönen Meeresbucht getrennt. An deren Ufer stand das völlig verlotterte Gebäude, in dem Boris' Vater Hilfe für sein Leiden erhofft hatte. Die Zufahrtstrasse war teilweise mit Brombeersträuchern und niedrigen Birkenschösslingen verwachsen. Lattems Gedanken der Empörung wichen rasch realistischen Überlegungen. Aus einem Hinterhof der Silmet hatte er einen eiförmigen Plutonium-Transportbehälter aus mit Blei abgeschirmtem Stahl ins Hotlabor schaffen lassen. Der Behälter hatte einen zylindrischem Cadmiumeinsatz, um den herum sich das Plutonium von vier kleinen Sprengköpfen so einlagern liess, dass es unterkritisch blieb. Die Zerfallswärme wurde durch meridiangeführte Kühlrillen in der Oberfläche des Behälters an die Luft abgeführt. Im Wasserbecken des Labors lagerte Lattem das Plutonium persönlich mit einem Spezialkran von den Warmwasserboilern in das Tansport-Ei um. Nach dem Austrocknen des Innenraums senkte er den neutronenabsorbierenden Zylinder hinein und ver26 lat. "Die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns in ihnen." Das lateinische Zitat soll Rainer Regaz (sein unbedeckter Name ist dem Verfasser bekannt) geistig erquicken, sofern er dieses Buch liest. 38 schraubte den Deckel. Er schloss wasserdicht, da gefüllte Plutonium-Transport-Eier, wenn sie nicht gerade auf Reise waren, normalerweise unter Wasser gelagert wurden. Das soeben abgefüllte, offiziell leere Ei liess Lattem zum Schein nach Moskau transportieren. Nach der Abfahrt dirigierte er es durch persönlichen Befehl an den Chauffeur zum verlassenen Sanatorium im verbotenen Gebiet um. In Moskau fragte niemand nach dem Verbleib der Sendung, da dort schliesslich kein Bedarf für einen Spezialbehälter angemeldet worden war. 39 Übergabe Auf dem alten Flugplatz von Helsinki landete am späten Nachmittag des 23. Dezember eine Transportmaschine vom Typ Tupolev 134 von Ankara über Zürich kommend. Pilot, Kopilot und Max Salg verliessen die Maschine in Richtung eines Helikopterhangars. An Bord eingeschlossen blieb ein mit Dollarscheinen prallgefüllter Koffer, der hier bis zum erfolgreichen Ende der geplanten Aktion auf Salg warten sollte. Nach einigen Formalitäten kam der Pilot Nalle Perinen mit dem Schlüssel für den von einer fiktiven Firma aus dem Nahen Osten angemieteten Transporthelikopter. Nach einem kurzen Check startete er die gewaltigen Rotoren. Der vom Amt für Luftfahrt bewilligte Hängetransport eines Schiffmotors von einer Werft östlich von Helsinki zum alten Flughafen Helsinki war für ihn reine Routinesache. Zusammen mit den beiden Tupolevpiloten liess er um 19.00 Uhr bei wenig Wind das Fluggerät abheben. Salg blieb nervös auf dem Flugplatz zurück. Die Sicht war trotz der Dunkelheit gut. Rasch verlor sich der helle Spot des Towers in den Blitzen und Blinken der unzähligen, die Küste säumenden Warn- und Orientierungslichter. Beim Überfliegen des Helsinkileuchtturms spürte Perinen plötzlich den Stahl einer Mauserpistole an der Schläfe. Mit Waffengenwalt zwangen ihn seine beiden Fahrgäste auf automatische Halteposition 20 m über Wasser zu gehen. Da halfen keine Tricks und keine Ausreden. Der Kopilot der Tupolev übernahm den Steuerknüppel des Helikopters. Nalle erhielt eins über den Schädel gezogen und wurde über Bord geworfen. Während die neue Besatzung davon schwirrte, fiel der so unsanft hinaus komplimentierte Expilot bewusstlos in die Tiefe. Doch Havis Amanda, die Jungfrau des Meeres erbarmte sich des armen Mannes. Mit Hilfe der Gewebeluft in seinem Overall hielt sie ihn über Wasser und schickte ihm einen Fischer. Dieser war gerade mit der Reparatur seiner Bordlampe beschäftigt, die wegen eines elektrischen Defekts ausgegangenen war. Mit Schrecken hatte er den Rauswurf in der Luft über sich mitbekommen. Die schöne Meerestochter half dem Angler mit einer grossen Woge, den hilflos in der See Treibenden über die Bootsreling zu holen. Dann verschwand sie wieder in der Tiefe der See. Die kleine Hirnblutung, die Nalle Perinen durch den Schlag auf den Kopf erlitten hatte, stoppte von alleine dank der Unterkühlung seines Körpers und hinterliess keinen bleibenden Schaden. Genau um19.45 h erreichte der Helikopter die Werft. Mit Ausnahme des unvorhersehbaren Eingriffs der Tochter der See in das Schicksal von Nalle Perinen war bisher alles exakt nach Plan HEP27 gelaufen. Salg hatte ihn im Laufe des Herbstes mit Strohmännern der Regierung eines nahöstlichen Landes28 ausgehandelt und bestens vorbereitet. Eigentlich müsste um diese Zeit der estnische Fischkutter den Anlegeplatz der Werft bereits unter finnischer Flagge verlassen haben. Zwar waren die Surfboote mit dem Kriegsmaterial von zwei Werftarbeitern und den Leuten der NFBE genau nach Zeitplan im Bauch des Kutters verladen worden, aber der Behälter mit dem Plutonium stand immer noch festgezurrt an Deck. Die Schiffsbesatzung weigerte sich, ihn an Land zu schaffen, da die Verschlussstifte von Areznitz nicht vorgezeigt werden konnten. Auch Boris Lattem, der sein Plutonium-Transport-Ei auf der Überfahrt begleitet hatte, wehrte sich standhaft gegen das Absetzen, da niemand etwas von der ihm versprochenen Belohnung wissen wollte. Alle warteten ungeduldig auf Reck. Endlich kam er mit dem Auto angerast. Fast gleichzeitig mit ihm erschienen seine beiden Kumpane. Sie zeichneten beim Bremsen eine lange Spur in den sandigen Boden des Werftgeländes. In der aufgewirbelten Staubwolke entstiegen sie hustend dem Wagen und stellten sich vor Reck auf. "Wo habt ihr euch herumgetrieben, verdamm' mich?" Er betrachtet sie näher. "Wie seht ihr aus, ihr verfluchten Drecksäue, und stinken tut ihr wie tote Fische!" Reck hielt sich angewidert die Nase zu. "Los, holt den Plunder aus der Karosse!" Er erhielt von den beiden die Skier und das Snowboard und brachte sie dem Chef der NBFELeute, der am Ende der Brücke stand. Dieser Vorgang löste automatisch den Teil von Plan HEP aus, für den Res und Heini zuständig waren. Wie wild begannen sie mit ihren Colts auf die Werftleute zu schiessen. Die beiden Arbeiter wurden sofort getötet, dem Werftbesitzer gelang die Flucht, weil er die zum Überwintern aufgestellten Boote als Deckung ausnützte und sich im Gelände bestens auskannte. "Halt, aufhören, seid ihr verrückt", schrie Sämi Reck. Aber da war es schon zu spät. "HEP, Chef, P...plan HEP, sorry, Plan HEP...p", stotterten die beiden und bliesen die Colts aus. Nun kam Boris Lattem aus dem Werftgebäude gerast, in das er sich vor der Schiesserei zurückgezogen hatte. "Was geht hier vor? Wo ist das Austauschmetall", schrie er nervös. 27 28 Happy End in praxi Der Name des Landes kann aus politischen Gründen nicht genannt werden. 40 "Ja, wo ist es, fuhr Sämi seine beiden Kumpel an?" Diese zuckten mit den Achseln. "Ihr habt es vergessen? Das kann doch nicht wahr sein? Ver...gessen, einfach ver...gessen." Er fuchtelte wütend mit seiner Walther herum. "Leck mich am Arsch mit deinem Scheissmetall", wandte er sich an Lattem. "Los, ladet das verdammte Ding endlich aus, ihr habt die Scheissstifte erhalten", verlangte er von der NBFE. Res machte sich am Werftkran zu schaffen. Der liess sich aber nicht bewegen. "Ich habe die Sicherungen herausgeschraubt. Hier, seht!", schrie Boris Lattem irr. Er drohte damit, das Paket mit den weissen Porzellanpfropfen ins Wasser zu schmeissen. Genau in diesem Augenblick kam der Helikopter angeknattert. Sämi nahm Funkkontakt mit seiner Besatzung auf und befahl, den Plutonium-Behälter direkt vom Deck des Kutters abzuheben. Der Kapitän des Bootes war durch das Auftauchen des Fluggerätes verunsichert und warf die Leinen los. Mit einem gewaltigen Satz sprang Lattem vom Anlegepier auf das sich entfernende Schiffsheck. "Los hintennach", brüllte Sämi Reck. Heiri und Res folgten dem Befehl unverzüglich und landeten beide knapp hinter der Schiffsschraube im kalten Wasser. Rasch fuhr der Kutter hinaus in die Nacht, das Geschrei von Sämi und seinen Leuten hinter sich lassend. Der Hubschrauber folgte dem Fischerboot mit eingeschaltetem Scheinwerfer. Die Helikopterbesatzung begann mit Pistolen auf die Schiffsbesatzung zu schiessen. Aus einer Deckluke tauchte plötzlich der Chef der NBFE mit einem Sturmgewehr auf. In der Hand trug er zwei runkelartige Geschosse. Eines davon schob er über den Gewehrlauf und kontrollierte mit einem geübten Handgriff, ob es sich frei bewegen liess. Dann setzte er ein kleines Munitionsmagazin ein. Nach einem raschen Kontrollgriff daran klappte er den Winterabzug des Gewehres heraus, klemmte den Kolben unter den rechten Arm und zielte mit eingezogenem Kopf kurz über Korn und Granatenkopf. Dann zog er ab. Das abgehende Geschoss versengte die Haare seines linken Handrückens, der Rückschlag des Gewehres warf ihn an den Lukendeckel und bog seinen linken Daumen an der Laufunterseite schmerzhaft zurück. Mit einem Feuerschwanz raste das massige Projektil von ihm weg, direkt hinein durch die offene Tür des Helikopters. Zuerst geschah nichts. Dann entstand eine riesige gegen den Himmel strebende Feuerkugel, aus der glühender Helikopterschrot hinunter ins Meer fiel. Nach dem gewaltigen Knall hörte Lattem eine Weile nur noch ein dumpfes Rauschen in den Ohren. Seine Augen projizierten die Feuerkugel noch lange an den schwarzen Nachthimmel, wenn sich sein Blick dahin verirrte. Die Besatzung war zuerst sprachlos, dann erhob sich grosses Hurrageschrei. "Und was machen wir jetzt mit diesem verfluchten Ei, auf das alle so verrückt sind", fragte der Chef der NBFE. "Ich denke wir müssen es schnellstens los werden". "Über Bord werfen, unsere Mission ist erfüllt. Der Rest interessiert mich nicht", schnarrte der Kapitän. Lattem hatte keine Argumente gegen dieses Machtwort. "Schon gut", mischte er sich ein. "Aber gib mir 10 Minuten. Ich will auf der Karte einen geeigneten Ort dafür finden." "Zehn Minuten sind zehn Minuten zuviel, aber wenn' sein muss", willigte der brummige Seebär ein. "Zeig her!" Lattem beugte sich kurz mit ihm über die Seekarte, dann entschieden sie sich für eine 12 m tiefe Stelle neben einem erdbeerförmigen Inselchen mitten im Schärengewirr. Mit dem David schwenkten sie den Plutonium-Behälter über die Bordwand und liessen das Transport-Ei behutsam auf den Meeresboden sinken. Um den Ort zu markieren, warf Lattem eine knappe Schiffslänge daneben eine verankernde Netzboje mit einem schwarzen Fähnchen aus. "Kannst du mich am Festland absetzen?", bat Lattem nach Abschluss des Manövers. "Einen Teufel kann ich, hier wimmelt es von Steinen, und bevor es hell wird, will ich drüben sein. Du weisst verdammt noch mal genau, dass wir da draussen noch die Surfboote an ihren schönen Festmacherringen ins Schlepp nehmen müssen. Bevor ich sie nicht hinter mir angezurrt am Meeresboden weiss, habe ich keine ruhige Sekunde. Was glaubst du, wie lange es noch dauern wird, bis die "Suomi Poliisi" in dieser Gegend aufkreuzt, nach dem Feuerwerk, das wir veranstaltet haben. Steig aus, wo du willst. Von mir aus spring ins Wasser und schwimm, wohin es dich gelüstet." Dabei machte er eine weit ausladende Armbewegung über den pechschwarzen finnischen Meerbusen. Was blieb Lattem anderes übrig, als diesen Ausweg zu wählen? Zurück im Fahrwasser passierten sie kurze Zeit später eine kleine Schäre mit einem leeren weissen Fahnenmast, auf der kein Licht auszumachen war. Lattem sprang, ohne sich zu verabschieden ins eisige Wasser. "Dieser Schwachkopf! Soll er versaufen!", brüllte der Kapitän hinter ihm her, ohne die geringsten Anstalten zu machen, ihn aus den eisigen Fluten zu retten. Das luftgefüllte Seezeug hielt Lattem 41 solange über Wasser, bis er vom Wind ans Ufer der Insel gespült wurde. An Land leerte er das Wasser aus seinen Stiefeln. Dann suchte er den Platz mit dem Fahnenmast. Am Strand lag ein mit Regenwasser gefülltes Holzruderboot, angekettet an einen in Fels einbetonierten Haken. Wahrscheinlich verwendeten seine Besitzer den Kahn während der Ferien oder, wenn sie das Wochenende hier verbrachten. Mit einem Stein schlug er auf dem harten Felsengrund die Kette auf. Hinter einer Sauna am Strand fand er Riemen und ein aufgeschossenes Tau. Weiter unten am Strand dümpelte ein angeschwemmter Plastikkanister, wie er als Auftrieb für Fischnetze gebraucht wird. Mit dem Sackmesser schlitzte Lattem ihn auf und erhielt so eine Schöpfkelle, mit der er das Boot lenzen konnte. Unter grosser Anstrengung gelang es ihm, das schwere Gefährt ins Wasser zu setzen. Der Wind trieb ihn gegen das Festland. Mit den Riemen stabilisierte Lattem das Boot in den Wellen. Als er in der Ferne ungefähr in Treibrichtung ein schwaches Licht sah, versuchte er, darauf zuzuhalten. Ein paar Mal musste er Wasser schöpfen, um nicht vollzuschlagen. Im Lee der kleinen Insel mit dem beleuchteten Fenster fand er ruhigeres Wasser. Gebadet von Salzwasser und Schweiss blieb er eine Weile erschöpft auf der Ruderbank sitzen und sah sich um. Im Osten ging gerade der Vollmond auf. Sein Licht beleuchtete eine goldige Strasse auf dem gekräuselten Wasser. Die Insel mit dem einsamen Haus lag vor ihm wie eine schwarze Katze. Sie machte einen gemütlichen Buckel und ihr Schwanz bildet eine kleine Brücke über das Schilf zum Festland. 42 Der Flüchtling Märta Siltanen sass müde im Schaukelstuhl. Es war kurz nach Mitternacht. Draussen lag der Wald im Dunkel. Von der hellen Seite des Fensters aus konnte sie das zwar gar nicht sehen. Aber gestern hatte um diese Zeit der Mond bereits eine Handbreit über den Horizont geblickt. Somit stand er heute noch nicht so hoch, dass er den Dingen da draussen Konturen geben konnte. Morgen war also Weihnachtsabend, dachte sie. "Heiligabend sagen sie in den deutschsprachigen Ländern", murmelte sie, "hier draussen ist jeder Abend heilig. Wäre nur der morgige Abend heilig, was würde das für all die anderen des Jahres bedeuten?" Aber "Heiligabend" - irgendwie gefiel ihr diese Umschreibung des Weihnachtsabends - war konnte ja nicht in erster Linie eine Frage des Datums sein. Wichtiger ist doch, was die Menschen in ihrem Innern fühlen, oder besser, was sie fühlen wollen. Ob der morgige Abend "heilig" wurde, hing also von ihr selber ab, nicht vom Kalender, nicht vom Ort und nicht vom Wetter. Ich will, dass morgen "Heiligabend" ist, beschloss sie. Jetzt blieb nur noch die Frage der Stimmung. Aber von Weihnachsstimmung konnte keine Rede sein, weder draussen noch drinnen. Schon der Herbst war furchtbar verregnet gewesen, auch in der Schweiz, und ihr Stage als Unterwasserarchäologin am Neuenburgersee war ja auch nicht gerade eine trockene Angelegenheit gewesen. Normalerweise lag hier in Ostfinnland um diese Zeit bereits der erste Schnee, manchmal war sogar das Meer leicht zugefroren. Doch jetzt war es viel zu warm, auch im Haus. Das hatte einen anderen Grund. Märta Siltanen hatte den Holzofen eingeheizt, da heute der Strom auf den Inseln ausgefallen war. Kein Strom für Licht, kein Strom zum Heizen. Was soll diese Unterscheidung? Strom ist doch Strom, überlegte sie. Oder etwa doch nicht? Stromstösse können ein Herz auf der Intensivstation zur Umkehr ins Leben bewegen. Stromschläge auf dem elektrischen Stuhl bewirken das Gegenteil. Strom kennt keine Unterschiede, spann sie ihre Gedanken weiter. Strom hat keine Moral, entrüstete sie sich schmunzelnd. Plötzlich fiel ihr ein: Ich bin auch unmoralisch. Ein neues Bild tauchte in ihr auf. Ich bin unmoralisch wie eine Quelle. Glücklich, wer aus mir trinken darf, aber wehe den Dörfern und Städten, wenn sich meine Wasser nach dem Gewitter zu Tale wälzen, dachte sie belustigt. Am Feuer hinter der gläsernen Ofentür merkte sie, dass draussen Wind aufkam. Sie legte die alte Zeitschrift weg, in der sie vorher kurz geblättert hatte. Geschichten, die teilweise schon ein Jahr zurücklagen! Bilder von Menschen, deren damalige Zukunft jetzt Vergangenheit ist, ging es ihr durch den Kopf. "Du hast deine Zukunft bereits hinter dir", sagte sie laut zum Sportler des letzten Jahres auf der alten Titelseite, während sie sich aus ihrem Sessel erhob. Sie reckte sich empor und überlegte, wie hoch wohl der geschmückte Tannenbaum gewesen war, unter dem früher ihre Weihnachtsgeschenke lagen. Als ihre Eltern noch lebten, war die Weihnachtszeit immer sehr betriebsam. Onkel und Tanten, mit Ehepartnern und Kindern fanden sich hier zur Feier des Jahres oder zum Silvesterabend ein. Der Schinken war um diese Zeit schon längst im Ofen, das Haus roch nach Pfefferkuchen und Glögg29. Von all dem gab es jetzt nur noch das Licht der vielen Kerzen, die Märta an allen Ecken und Enden im Wohnzimmer angezündet hatte. "Das ist die ganze Weihnachtsstimmung?", dachte sie ein bisschen traurig. Plötzlich hörte sie am Fenster ein feines Klopfen, ein leises Scharren. Der Weihnachtsmann, fuhr es ihr reflexartig durch den Kopf. Dann erschrak sie. Rasch löschte sie das Licht der Leselampe und schaute durch die Scheibe hinaus. Die Kerzen im Raum warfen ihr Licht auf einen kleine Gestalt vor dem Fenster, auf einen untersetzten Mann. Auf dem bärtigen Kopf trug er einen gelben Südwester. Er glänzte und troff vor Nässe. Märta Siltanen überkam das Grauen. War das der tote Fischer, der sich der auf ihn wartenden Frau kündete? Sie versuchte sich zu entspannen. Der Mann draussen musste ihren Schreck gespürt haben. Er lüftete seinen gelben Seemannshut und winkte entschuldigend. Mit beiden Händen wies er auf sich und zeigte dann auf das Meer hinaus. Märta Siltanen öffnete nacheinander die beiden Fenster der Doppelverglasung um einen kleinen Spalt. "Entschuldigung, ich hatte da unten am Strand eine Panne. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Aber da Sie noch Licht hatten, habe ich geklopft." Er hatte eine tiefe Stimme, die mit seiner kleinen Körperlänge kontrastierte. Scheint allein zu sein, dachte sie und fragte laut: "Sind sie allein?" "Ja gewiss! Sie brauchen keine Angst zu haben. Und ausserdem bin ich so mit Wasser vollgesogen, dass ich mich kaum bewegen kann", antwortete er lachend. Er sprach finnisch, aber irgendwie mit altmodischem Akzent. 29 schwed. "Glühwein". Märtas Eltern waren schwedischsprachig. 43 "Darf ich bei Ihnen telefonieren", fragte er. Sie schaute zum Ofen zurück, wo die Feuerhaken standen und dann zurück zur zwerghaften Gestalt des Mannes. "Wie bitte heissen Sie?", fragte sie ihn, als hätte er das schon erwähnt. "Entschuldigung, nicht einmal vorgestellt habe ich mich! Boris Pajunen, aus Hamina", log er. "Kommen Sie zur Tür." 44 Märta Siltanen "Wir können das Boot in Ekenäs übernehmen", tönte Liisas Stimme aus dem Telefon. "Spitze, dann bleibt uns eine stürmische Überfahrt über den Porkkalafjärd erspart", antwortete Märta. Märtas Freundin Liisa studierte Architektur an der Poly in Helsinki. Ihr Studium hatte sie erst zwei Jahre nach dem Abitur begonnen und später wegen eines Auslandaufenthaltes für längere Zeit unterbrochen. Nun war sie an die Hochschule zurückgekehrt und gehörte dort zu den älteren Semestern. Märta hatte eben ihr Archäologiestudium an der Universität Helsinki abgeschlossen und fühlte sich frei wie eine Möwe im Spätsommer nach der Aufzucht ihrer Jungen. Sie freute sich auf den Segeltörn mit Liisa. Rechtzeitig zum Mittsommerfest wollten sie in Mariehamn sein, dem Hauptort Ålands, der "Königin der Schären", wie Märta immer sagte. Liisa beabsichtigte dort, ein skandinavisches Architekturseminar mitzumachen. Einen Tag vor der geplanten Abfahrt trafen sie sich in der gemütlichen Kleinstadt Ekenäs an der Südküste Finnlands. Märta und Liisa liebten diese Sommerstadt mit den mittelalterlichen Holzhäusern und dem Holzschloss auf dem Stadthügel. Diesmal hatten sie keine Zeit für einen beschaulichen Spaziergang in den alten Gassen. Es dauerte den ganzen Tag, bis sie alle ihre Habseligkeiten im Boot verstaut hatten. Wasser musste getankt, Diesel gebunkert werden. Es gab Einkäufe zu tätigen. Die Segelausrüstung war zu kontrollieren, kleine Reparaturen zu erledigen. Nach einem letzten Blick in die Seekarte lichteten sie den Anker, setzten die Segel und fuhren hinaus in das Rot der Abendsonne. Sie tauschten das kleine Vorsegel mit dem riesigen ballonartigen Spinnaker. Ein scharfer Nordwind trieb sie vom Festland weg gegen Süden. Sie mussten höllisch aufpassen auf Segelstellung, Fahrwassermarkierungen, Seekarte und Gegenverkehr. "Was für ein Teufelsritt", jauchzte Märta. Diese kleine Unaufmerksamkeit brachte das Boot vom Kurse ab. Der Wind schlug den Spinnaker back, und Liisa musste die Schoten loswerfen. Es dauerte eine Weile, bis sie die kleine Yacht wieder unter Kontrolle hatte. Als die Sonne glühend im Meer versunken war, drehte der Wind nach einer kleinen Pause auf Südwest. Er wurde so stark, dass sie es vorzogen den Spinnaker zu bergen. Um gegen den Wind anzukommen, warf Liisa den Motor an. Schwarze Wolken zogen auf und bedeckten den Sommerhimmel. Bald war das Licht so schwach, dass sie nach den Leuchtfeuern fahren konnten. Liisa hasste Nachtfahrten. Bei schwachem Licht hatte sie Mühe mit ihren Augen und musste die Navigation ihrer Freundin überlassen. Märta genoss das Abenteuer, sich durch die blinkenden weissen, roten und grünen Lichter von Insel zu Insel führen zu lassen. Sie wusste, dass der kleinste Fehler das Boot auf einen unter der Wasseroberfläche versteckten Felsen auffahren lassen konnte. Manchmal sah sie am Rande des Fahrwassers die Gischt der über die Steine und Untiefen jagenden Wogen. Dann spürte sie ein leichtes Grausen. Ich darf mich nicht verwirren lassen durch die Gefahr, dachte sie. Wenn sie ihrem Schicksal blind vertraute, wenn sie unbeirrt am vorgegebenen Weg festhielt, würde sie nicht scheitern. Doch den Kurs musste sie selber vorgeben. "Liisa, wenn das weisse Feuer in Richtung 130 zu Grün wechselt, gehst du auf Kurs 220", rief sie ihrer Rudergängerin zu und versuchte sich mit dem schwachen Strahl der Taschenlampe auf der Karte zu orientieren. Liisa goss sich mit der Trinkflasche Frischwasser über das Gesicht, um das Salz von der Brille und aus den Augen zu spülen. Sie hatte keine Angst, sie wusste, Märta würde es schaffen. Märta schaffte es immer. In diesem Augenblick lief das Boot krachend auf eine Untiefe. Der Mast neigte sich nach vorn, pendelte zurück und noch ein paar Mal hin und her. Der Propeller des Motors heulte zweimal leer auf. Liisa riss das Ruder herum, Märta drosselte den Motor und schaltete auf Rückwärts. Ein Zittern lief durch den Rumpf, dann war er wieder frei. "Schwein gehabt", stellte Märta sachlich fest. "Es scheint nichts gebrochen zu sein", bestätigte Liisa erleichtert. Später flachte der Wind ab. Dafür kam dichter Nebel auf. Da sie ausser dem Kompass keine technische Orientierungshilfe an Bord hatten, mussten sie neben dem Fahrwasser Anker werfen. "Wie ich diese weisse Suppe hasse, ohne Richtung, ohne Weg. Du verschwindest einfach im Nichts und mit dir verschwindet die ganze Welt und niemand kann dir helfen", haderte Märta. "Niemand ist mit seinem Schicksal zufrieden. So steht es auch auf meiner Sonnenuhr im Garten!", tröstete Liisa. "Folgt uns", rief eine Stimme aus dem Nebel. "Wir haben Radar und GPS." Sie hoben den Anker und folgten dem Geisterschiff, das sie nicht gesucht und doch gefunden hatte. So korrigiert sich das Schicksal, dachte Märta. Dann klarte der Himmel auf. Ein herrlicher Morgen brach an und die Ungewissheit von Nacht und Nebel war zu Ende. Um 5 Uhr früh erreich45 ten sie die Regattastadt Hangö. Ohne aus ihren Kleidern zu steigen warfen sie sich erschöpft in die Kojen. "Und dann ging unsere Reise weiter durch das Meer der hundert Tausend Inseln. Jeder Tag brachte neue Erlebnisse, weitere Ausblicke und Einsichten. Wir liessen uns und unsere Gedanken auf dem klarsichtigen Wasser vom Winde treiben unter dem unendlich weiten blauen Himmel. Vor dem grünen und lieblichen Hitis wiegte uns der über dem Boot hüpfende Mond in den Schlaf. Auf Rosala mit seinen roten Holzhäusern feierten wir Liisas Geburtstag. Beim Grab des ertrunkenen Mädchens auf Vänö rochen wir den herben Wacholder. Auf dem wilden Borstö beschritten wir das magische Spirallabyrinth und kletterten hinauf zur Borstögumman, der angeschwemmten weiblichen Galionsfigur eines unglücklichen Havaristen. Wir besuchten die Fischer von Aspö, die ihre Briefkästen an die Holzbeige nageln und das Geisterdorf auf Trunsö. Nackt schwammen wir im einsamen Süsswassersee von Björkö und auf Långholmen suchten wir die geheimnisvolle Tür im Felsen am Ende der Bucht. In der Nacht und auf Legerwall fanden wir erleichtert die Einfahrt in das Inselgewirr von Kökar. Immer weiter ging unsere Reise und wir hörten auf, die Inseln zu zählen." Das schrieb Märta Siltanen später in das Logbuch. Am Tag vor Mittsommer segelten die beiden Frauen nach erlebnisreichen Tagen stolz in den Osthafen von Mariehamn, warfen Anker und vertäuten das Boot am Pier. Liisas Tagungsort befand sich in der Nähe eines kleinen Naturreservates am Weg von Mariehamn nach Järsö. Der schöne Ort war einst der Alterssitz eines Windjammerkapitäns. Er hatte seinen Reichtum mit einer geschickten Investitionen in eine von ihm geführte Viermastbark aus der sogenannten "Flyer-P-Line"30 gemacht. Später kaufte die Kommune das Anwesen und die stattliche Holzvilla mit den beiden dazugehörigen landwirtschaftlichen Betriebsgebäuden und machte ein kleines Kongresszentrum daraus. Schon früh am Nachmittag fand sich die einheimische Bevölkerung zum Schmücken der Mittsommerstange ein. Viele kamen mit Booten, auf denen kleine Birken aufgerichtet waren. Körbe mit Espenlaub und Blumen wurden herbeigebracht. Die Männer spannten die letzten Drähte zwischen den am Boden liegenden langen Stangen und ihren beiden Kreuzbalken. Am oberen Stangenende brachten sie ein vom Wind angetriebenes kleines Schiffskarussel an. In den beiden Doppelkreuzfeldern links und rechts hängten sie grosse Schiffsmodelle. Die Kinder reihten unter Anleitung der Eltern Blätter und Blumen auf Schnüre, die dann an den Drähten der Stange befestigt wurden. Die Alten sassen am Rande der Wiese und kommentierten das Geschehen. Einer mit Holzbein fuchtelte mit seinem Stecken, wenn etwas zu Bemängeln war. Märta Siltanen liebte dieses Volk und sein Brauchtum, das ihr in leicht abgewandelter Form aus dem eigenen Heimatdorf an der finnländischen Südküste vertraut war. Sie beobachtete mit Erstaunen die feinen Rangunterschiede der Beteiligten und die Art, wie auch hier Macht abgezirkelt wurde. Heute an diesem festlichen Tag ging es friedlich zu. Doch sie ahnte und wusste, wie brutal das Gerangel um die Stellung in der Gruppe oft den Alltag bestimmte. Hier genügte ein "Aber doch nicht so!" oder "Lass mich das machen!", um sich dem andern als überlegen darzustellen, und ein "so haben wir es immer gemacht, du irrst dich" oder "aber nicht du mit deinen ungeschickten Händen", um den Angriff abzuwehren, und "ja haben wir das nicht immer so gemacht?" oder "Ich schaff das nicht ganz", um sich unterzuordnen. Das Aufrichten der Stange mit Stützlatten und Haltetauen war dann ausschliesslich Angelegenheit der Männer. Die Führungsstrukturen wurden nun ganz offensichtlich. Siltanen bemerkte, wie sich hier interessanterweise ein Mann hervortat, der bisher völlig im Hintergrund geblieben war und scheinbar nur auf diesen Moment gewartet hatte. Unvermittelt und lautstark übernahm er das Kommando, halfterte blitzartig zwei jüngere Rivalen ab, die nun vergeblich auf ihren grossen Auftritt gewartet hatten. Mit befehlsgewohnter Stimme verteilte er die Posten, wechselte, wo es ihm nötig schien die Funktionen der Beteiligten, degradierte die einen, hob andere hervor. "Nicht zu unrecht, so weit ich es beurteilen kann", dachte Märta Siltanen bewundernd. Anderseits ärgerte sie sich darüber, wie auch hier die Mechanismen der Macht in Gang gesetzt und von einem Einzelnen beherrscht wurden. Als die Stange verankert war, spielte eine ländliche Musikgruppe auf. Zuerst tanzten die Kinder, dann gesellten sich mehr und mehr auch erwachsene Paare dazu. Es wurde viel angestossen und fröhlich getrunken. Nun liessen sich auch die Gäste, die bis jetzt mehr zugeschaut als mitgewirkt hatten, in das Geschehen einbeziehen. 30 Die Namen sämtlicher Schiffe der deutschen Reederei Laeisz fingen mit dem Buchstaben "P" an. Das letzte dieser Schiffe, die Padua, lief 1926 vom Stapel. Eines dieser grossen Segelschiffe, die Pommern, steht unverändert erhalten im Westhafen von Mariehamn. 46 Märta Siltanen lernte im Laufe des Festes einen Architekturstudenten aus Wien kennen. Der junge Österreicher schien sich für Märta zu interessieren. Er machte ihr nicht nur in dieser langen Nacht, sondern auch am nächsten Morgen gehörig den Hof. Leopold, nicht Leo - wie Leopold betonte - rückte sich und seine Herkunft in das beste Licht, gab sich weltoffen, tolerant und gebildet und stellte sich überhaupt als Traummann dar. Märta Siltanen nahm ihr Schicksal in die Hand, steckte den Kurs ab und verliebte sich in ihn. Am Nachmittag wurde die Versammlung durch den benachbarten Naturschutzpark geführt. Leopold bot ihr bei einer besonders nassen Stelle galant den Arm und fiel dann selbst in den Morast. Er war furchtar beleidigt und gekränkt, weil sie laut darüber lachte. "Das wird sich schon geben", dachte sie. Beim Abschied küsste er ihre Hand. Zwei Monate später fuhr Siltanen nach Wien. Leopold hatte ihr eine Stelle als Sekretärin im Geschäft seines Vaters angepriesen und verschafft. Sie nahm gerne an, da sie ohnehin eine Gelegenheit gesucht hatte, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Auch hoffte sie, Leo näher zu kommen. Die Sache wurde ein einziger Flop. Ihre Anstellungsbedingungen im Familienbetrieb erwiesen sich als moderne Form der Sklaverei. Auf einen Lohn musste sie verzichten: "Du hast ja Leopold!" Das Büro hatte sie, eine Nichtraucherin, mit drei Kettenrauchern zu teilen. Von Leopolds Vater wurde sie am Arbeitsplatz sexuell belästigt. Die Tätigkeit, die sie auszuüben hatte, war langweilig und unqualifiziert. Nach der Arbeit hatte sie Leopold zur Verfügung zu stehen, sofern es ihm gerade passte. Statt mit Märta gab er sich lieber mit Fechten ab, seiner einzigen sportlichen Betätigung. "Fechten ist die einzige Sportart, die meinen ethischen Normen und ästhetischen Ansprüchen genügt. Ausserdem stärkt es die Widerstandskraft gegen Krankheiten." "Und ob, du mit deinen tausend Wehwehchen", spottete Märta. Wenn Leopold einen kleinen Schnupfen hatte, litt er unsäglich. Noch mehr aber seine Umgebung! Fühlte Märta sich einmal einen Tag lang nicht wohl, war er kränker als sie. Den Gedanken an eine schwere Krankheit liess er schon gar nicht aufkommen. Krebs hielt er für eine Strafe Gottes und Aids betrachtete er als ein reines Hygieneproblem: "Die sollten sich halt richtig waschen!" Es ärgerte ihn, dass Märta strikte auf Kondom bestand. Er hätte bedenkenlos ohne mit ihr geschlafen: "Von mir hast du schliesslich nichts zu befürchten und du duschst ja täglich." Am liebsten hätte er Märta als Debütantin an den Wiener Opernball geschleppt. Aber dafür war sie zu wenig romantisch, und Wienerwalzer waren ihr ohnehin ein Greuel. "Der Wienerwalzer will das gewöhnliche Volk in eine Welt zurückführen, die ihm ohnehin immer verschlossen war", hielt sie ihm vor. "Du hast etwas gegen die Traditionen meines Landes", ärgerte sich Leopold. "Und ausserdem verstehst du nichts von Musik, wenn du so etwas sagst." Kam aber das Thema Musik irgendwo zur Sprache, jammerte er: "Ich habe meiner Lebtag genug davon: Chopins Klavier-Etuden begleiteten mich durch 99 Bände von Karl May...ein bisschen Hausmusik...ein bisschen Hausmusik." Da Märta Siltanen den Leo im Leopold nicht fand, ging ihre Affäre mit ihm nach kurzer Zeit in Brüche. "Das wird sich leider nie geben, da wird nichts draus", bedauerte sie und kehrte enttäuscht nach Finnland zurück. Für Leopold war die Sache nicht so rasch ausgestanden. Er verlor noch den letzten Rest seines kleinen Selbstbewusstseins und wurde zum familiären Sozialfall seines begüterten Vaters und ist es bis heute geblieben. Siltanen beschloss im weiteren Verlaufe des Jahres, ihr Glück tiefer unter der Oberfläche zu suchen. Mit Begeisterung wandte sie sich der Unterwasserarchäologie zu. 47 Die Enttäuschung "Du sprichst recht gut Finnisch, Boris", stellte Märta fest. Sie hatte sich an seine zwergenhafte Erscheinung und an seine schreckliche Narbe gewöhnt. "Estnisch und Finnisch tönen ja ähnlich, aber ich habe doch Mühe damit, wenn ich Estnisch z.B. am Radio höre. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich selber Schwedisch als Muttersprache31 habe." Märta hatte ihm erlaubt, die nassen Kleider abzulegen und gegen trockene ihres verstorbenen Vaters einzutauschen. Er sah komisch aus in den viel zu langen und weiten Hosen und dem viel zu grossen altmodischen Hemd. Instinktiv spürte Boris Lattem, dass Märta Siltanen nicht die Absicht hatte, die Polizei zu verständigen. Trotzdem verriet er ihr seinen richtigen Namen nicht. Er gab sich als Flüchtling aus, der beschlossen hatte aus dem Ostblock abzuhauen. "Eigentlich bin ich nicht Este, sondern komme aus Leningrad. Aber ich habe viele Jahre in einem Militärbetrieb in Estland gearbeitet und die dortige Sprache gelernt. Als ich mich entschloss abzuhauen, habe ich finnisches Radio gehört. In meinem Büro im Betrieb sah ich auch finnische Fernsehprogramme. Allerdings musste ich dazu eine Satellitenschüssel manipulieren. "Wo ist sie nun?", fragte Märta und bemerkte in Boris' fragendem Blick ihren Gedankensprung. "Deine Frau natürlich", ergänzte sie lachend. "Ich will keine Kinder, deshalb hat sie sich scheiden lassen", log Boris. "Und warum willst du keine Kinder?", wunderte sich Märta. "Vielleicht, weil ich meinen Genen nicht mehr traue...nein, warte, das ist kein Witz. Es hat mit meinem Beruf zu tun. Und das kam dir erst nach der Heirat in den Sinn, dachte sie bei sich. Laut fragte sie: "Und was ist dein Beruf?" Boris Lattem hatte sein Stichwort. Er erzählte ihr von seiner Arbeit und von seiner Liebe zum Metall. Märta hörte ihm erstaunt zu und spürte seine Besessenheit. Will er mir sein Herz ausschütten oder einfach seinen Kummer abladen, fragte sie sich und sah mit Grausen in die schwarze Tiefe, in die er sich verloren hatte. Am nächsten Tag wurde Feuer unter die grosse Wasserpfanne gesetzt und die Sauna aufgeheizt. Sie wuschen Kleider, badeten in Schweiss und zur raschen Kühlung im Meer. Dann schlug Boris für Märta im Wald den Tannenbaum, den sie für das Weihnachtsfest ausgewählt hatte. Sie schmückten ihn mit dem alten Christbaumschmuck ihrer Familie, den Silberkugeln und den elektrischen Kerzen. Auf seine Spitze setzten sie den Weihnachtstern. Märta begann sich in Boris Gesellschaft wohl zu fühlen. Sie war froh, dass er hier war, jedenfalls während der Festtage. Am Abend tranken sie Wein und sie freute sich, den Abend nicht allein verbringen zu müssen. "Wärst du nicht so klein und mager, ich bin sicher, ich hielte dich für den Weihnachtsmann ", scherzte sie. "Immerhin trage ich einen Bart. Rechtzeitig gekommen bin ich auch. Und überhaupt, woher willst du wissen, wie der Weihnachtsmann aussieht?", begehrte er auf. "In diesem Land weiss das jedes Kind. Schliesslich ist er hier zu Hause. Die Kinder aus der ganzen Welt schreiben ihm", erklärte sie. "Als Kind wäre ich nie auf so eine Idee gekommen", behauptete er. "Vielleicht war ich zu realistisch, obwohl ich, wenn ich es mir recht überlege, Märchen geliebt habe", werweisste Boris. "Ali Baba und die 40 Räuber mit ihrem geklauten Edelmetall oder das Märchen von der Goldliesel waren sicher deine Lieblingsgeschichten!", spottete Märta. Das Radio spielte Weihnachtslieder. Märta wurde es ganz warm ums Herz. Die Stimmung, für die sie sich entschieden hatte, war nun also doch gekommen. Das machte ihr Mut. Sie war in dieses Haus zurückgekommen, weil sie ihrem Leben eine neue Wendung geben wollte. Die Zeit hatte begonnen, sie aufzufressen und zu verschlucken. Es schien ihr, als würde es täglich dunkler um sie herum. Mit der Jahreszeit hatte das nichts zu tun. Es war auch im Frühling und Sommer so gewesen. Sie hatte das Gefühl, durch einen engen Schlund hinunter zu gleiten, gelähmt wie ein Kaninchen im Rachen der Schlange. Wenn sie nicht im Magen des grossen Tieres "Zeit" aufgelöst werden wollte, musste sie schleunigst die Stacheln stellen, sich zur Wehr setzen, strampeln, umkehren, sich aufrappeln, zurück kriechen. Es war richtig, dass sie hierher gekommen war. Sie spürte die Kraft und die Magie dieses Ortes, wo sie einmal glücklich gewesen war, als ihre Eltern noch gelebt hatten. Wiederum wies ihr das Schicksal den Weg, wie ein Leuchtfeuer auf dem Meer. Märta schafft es immer! Über eines wunderte sie sich. Warum nur war dieser sonderbare Mann in ihr Leben getreten? Wer hatte ihn geschickt, fragte sie sich, ausgerechnet zu dieser festlichen Zeit und an diesen einsamen Platz? Irgendwie mochte sie ihn. Vielleicht weil er wie ein Troll 31 In Finnland gibt es eine schwedischsprachige Minorität, die hauptsächlich an den Küsten und auf dem Ålandarchipel angesiedelt ist. 48 aus dem Wald gekommen war, angezogen vom Licht und der Wärme. Und war er nicht besessen von den Schätzen der Erde unter Tag? Sind es nicht die Zwerge und Wichtelmännchen, die in der Erde nach Gold und Silber schürfen und ihre Schätze eifersüchtig bewachen? Wer nett ist zu den Zwergen, dem helfen sie. Das wusste sie von ihrer Grossmutter. "Au", schrie Märta, weil Boris sie heftig in die Seite kniff. "Zwerge sind garstig", sagte er. "Kannst du Gedanken lesen?", antwortete sie verblüfft. Als die Kerzen herunter gebrannt waren, schmiegte sie sich plötzlich an ihren magern, kleinen Zwergen. "Ich will lieb sein zu dir", versprach Märta und fügte fordernd hinzu: "Komm zeig mir deine Schätze". Boris wehrte sich nicht. "Ein wenig Wildheit in der Wildnis tut gut", gab er sich geschlagen. In den nächsten Tagen fuhren sie während der wenigen hellen Stunden manchmal hinaus aufs Meer. Mit der Angelrute schleuderten sie blinkende Wobbler und Spinler vom Boot gegen das abgestorbene Schilf oder sie legten Netze und Reusen. Später begann Boris Lattem allein hinaus in die Schären zu fahren. Immer häufiger und immer länger. Das Fischereizeug blieb dann zu Hause. Märta hatte keine Ahnung, was ihn hinaus trieb. Wenn sie ihn darüber ausfragte, antwortete er gereizt: "Ich will die Umgebung besser kennenlernen, darf ich etwa nicht?" Märta wunderte sich über seinen Tonfall. Irgendwie fühlte sie sich ausgeschlossen. Oft schien es ihr, als hätte er jegliches Interesse an ihr verloren. Wie er seine Zukunft sehe, wollte sie wissen. "Kommt Zeit kommt Rat", war alles, was er darauf zu sagen wusste. Eines Tages entdeckte er im Schuppen beim Bootssteg eine Taucherausrüstung. "Gehört sie dir?", frage er neugierig. "Tauchen war schon immer mein Hobby, jetzt gehört es, wie du weisst, zu meinem Beruf." Lattem war sich sofort im klaren darüber, wie dienlich dieser Umstand seinem Zwecke war. Er beschloss Märta zu seiner Komplizin zu machen und verriet ihr das Geheimnis vom versenkten Ei, und welchen Zusammenhang es mit dem Tod der Werftarbeiter gab. Sie hatte in der Zeitung und im Lebensmittelgeschäft schon davon erfahren. Er erläuterte ihr, wie er das Ei an Land zu bringen gedachte. "Deine Tauchkünste kann ich dabei weiss Gott gebrauchen. Für dich springt dabei einiges heraus", zog er ihr den Speck durch den Mund. Märta erkannte schlagartig, dass Lattem sie die ganze Zeit nur für seine Zwecke ausgenützt hatte. Und daran würde sich auch später nichts ändern, davon war sie überzeugt. "Wenn ich nur erst das Platin habe, das mir zusteht, wirst du dir jeden Schmuck der Erde kaufen können", versprach Lattem grossmaulig. Einen Dreck werde ich, das sehe ich jetzt deutlich in deinen falschen Augen, dachte sie wütend. Bei der nächsten Gelegenheit durchsuchte sie seine persönlichen Sachen. In seiner wasserdichten Tasche fand sie finnisches Geld. Sie ärgerte sich nun, dass er ihr nie angeboten hatte, für Unterkunft und Verpflegung aufzukommen. Jetzt fand sie das unhöflich von ihm, obwohl sie vorher sicherlich jegliche Bezahlung strikte abgelehnt hätte. Der Gipfel war, dass er sogar Geld von ihr geliehen hatte. Beim Weitersuchen fand sie auch seinen Ausweis. "Rumpelstilzchen, nun kenne ich deinen richtigen Namen", triumphierte sie. "Und verheiratet warst du auch nie, wie du mir weismachen wolltest." Dieser Tag brachte die Wende. Wer frisst, der wird gefressen werden, kündete sie grimmig an. Von jetzt an setze ich meine Leuchttürme selber und grabe mir meinen eigenen Tunnel, wo und wohin ich will. In der folgenden Nacht schlug das Wetter um. Die See gefror bei völliger Windstille. Am Morgen war die Bucht mit Schwarzeis bedeckt und lag wie ein Spiegel da. Während Boris noch schlief rannte sie hinunter zum Steg. Am Ufer grub sie einen faustgrossen, glattgeschliffenen Stein aus und warf ihn wie eine Curlingkugel auf die glänzende Fläche. Der Stein glitt über das Eis, immer weiter weg von ihr und der Insel, der aufgehenden Sonne entgegen. Nur unmerklich wurde er langsamer, so dass sie nicht erkennen konnte, ob er stehengeblieben war oder unendlich weiter lief. Sie wusste jetzt, was die rote Boje mit dem schwarzen Fähnchen bedeutete, die dort weit draussen vor einer erdbeerförmigen Insel im Eis festsass. Sie gehörte keinem Fischer. Wenn ich meine Zukunft jetzt nicht selber gestalte, wird sie zu meiner nutzlosen Vergangenheit, dachte sie. Sie hatte nicht vor, zu enden wie der Stein, den sie seiner Trägheit überlassen hatte. Sie musste sich den eigenen Weg vorgeben. Auch sie konnte das, nicht nur dieser hergelaufene Metallfetischist, der sie wie eine Schachfigur in seine Pläne einbauen wollte! Einige Tage später brachte sie den Motor ihres Bootes zu Jan Blom in die Werft. Boris half ihr dabei. 49 "Darf ich deine Werkzeuge benützen, Jan?" fragte sie. "Mach nur, du weisst ja Bescheid", rief Blom von der Mole aus. Während Märta den Motor wartete, ging Lattem hinunter zum Werftbesitzer. "Tut mir leid wegen deiner zwei Mitarbeiter. Das kannst du diesen Schweinen verdanken, die uns das eingebrockt haben." "Waren Jobber aus Ostfinnland, ohne Familie. Gute Arbeiter, wenn sie nicht gerade besoffen sind." Er hängte sich kurz an eine imaginäre Flasche. "Mit Verlusten muss man rechnen! Und an dir ist nichts hängen geblieben?" "Wie das so ist. Hier wissen alle, dass wir seit Generationen «gutnachbarschaftliche Beziehungen» über das Meer pflegen. Da bleibt immer etwas hängen, auch wenn die Papiere zum Surfboottransfer überzeugen konnten und ich offiziell von der Sache nichts gewusst habe. Zum Glück wurde die Ladung nicht vom Zoll aufgebracht. Das mit dem Gewicht der Surfbretter hätten sie denen nicht abgenommen. Weiss nicht, wie ich mich da herausgeredet hätte." Die beiden Männer gingen zu Märta hinauf in die Werkstatt. 50 Flucht Tagelang hatte ein heftiger Sturm getobt. Nachdem er sich gelegt hatte, war die Meeresoberfläche fast eisfrei. Schwarz lag sie unter dem bedeckten Mittagshimmel. Im Südwesten der Bucht lag das zerbröckelte Eis als helle Fläche vor dem dunklen Wald. Gegen Abend klarte der Himmel auf und es wurde bitter kalt. Wenige Stunden später war das offene Wasser der Bucht wieder mit einer schwachen Eisschicht überzogen. Boris war mit Märtas Fahrrad zu Jan Blom in die Werft gefahren. Er sei zu einem Kartenspiel eingeladen worden und werde vielleicht über Nacht dort bleiben. Märta ging früh ins Bett. Sie las noch einige Seiten in einem Buch über nordischen Antiquitäten, bevor sie einschlief. Ihr Schlaf war unruhig wie Quecksilber. Sie träumte von einem Mann, der Köder auslegte für eine Spur. Alle zehn Schritte bückte er sich. Mit seinen schweren Schuhen drückte er den Frass leicht in die weiche Erde der Wiese. Seinen Körper hielt er gebeugt. Ab und zu blickte er zurück, wie um die Richtung seiner gelegten Spur zu sichern. Später verliess er die gerade Linie, sein Weg wand sich zwischen blühenden Obstbäumen hindurch und kroch dann einen steilen Hang hinauf. Als er sich noch auf einer Geraden bewegt hatte, waren seine Schritte unsicher gewesen, jetzt schritt er kraftvoll und verwegen. Auf seiner Fährte folgte ihm ein Hund. Je verwinkelter und krauser die Spur wurde, desto weniger Mühe hatte das Tier, den vorbestimmten Weg zu erschnüffeln. Köder um Köder verschwand gierig in seinem Schlund, als wäre nur das Fressen und nicht die Suche nach dem richtigen Pfad das Ziel. Oben auf dem Hügel begann der Mann mit dem Krempenhut und dem hohen Kragen zu hüpfen und schlug Haken wie ein Hase, aber gegen den Hund hatte er keine Chance. Hustend und fast am Leintuch erstickt wachte sie auf. Draussen und im Hause herrschte absolute Ruhe. Plötzlich ertrug sie diese Stille nicht mehr. Im Morgenmantel und mit den nackten Füssen in den Moonboots ging sie mit der Taschenlampe vor sich den Weg beleuchtend hinunter zum Strand. Eine dünne Schicht Neuschnee bedeckte den Waldboden und die Wiese. Die Bäume waren von Rauhreif überzuckert. Sie fröstelte, weil sie die Handschuhe nicht übergestreift hatte. Auf dem Bootssteg kratzte ihr der Nordwind ins Gesicht. "Eine tüchtige Sauna einheizen ist wohl das beste, was ich jetzt für mich tun kann", sagte sie sich. Plötzlich sah sie zwei Männer aus dem Geräteraum auf sie zu rennen. Sie mussten sich dort versteckt gehalten haben. Ob das die Werftkiller aus der Schweiz waren, vor denen sie Boris Lattem gewarnt hatte? Wahrscheinlich hatten sie ihn entdeckt und waren ihm gefolgt. "Die wollen mich, um Boris Lattem zu erpressen", schaltete sie rasch und sprang von der Brücke hinunter auf den Uferfelsen. Von Stein zu Stein springend versuchte sie dem Strand entlang zu entwischen. Hinter sich hörte sie den keuchenden Atem ihrer beiden Verfolger. Kurz vor dem roten Fels unter ihrem Haus stand eine dritte Gestalt. Panik ergriff sie. Am Rande der Bucht sah sie Licht. Es gab nur noch einen Fluchtweg, den Weg hinaus aufs Eis. Sie rannte auf den hellen Streifen des Brucheises zu, der in der Bucht liegengeblieben war. Die dünne Eisfläche vibrierte unter ihrem Gewicht. Sie bewegte sich am Rand des Ufers und versuchte den im Mondschein dunkleren, wasserzügigen Stellen auszuweichen. Einer ihrer Verfolger nahm die Abkürzung und brach fluchend ein. Märta Siltanen hielt an und schaute zurück. Dann krachte das Eis unter ihr. Sie sah, wie sich die gefürchteten Tangentialrisse bildeten. Stehen bleiben konnte den Tod bedeuten. Beim Weiterrennen brach ein Stiefel durch das Eis, aber sie schaffte es, der tödlichen Gefahr zu entrinnen. Da, wo sie das brennende Licht gesehen hatte, waren die Nachbarn nicht zu Hause. Siltanen hoffte im Lebensmittelgeschäft des Dorfes Hilfe zu finden. Auf dem Weg durch den Wald stiess sie auf das Auto der Killer. Sie erkannte es an der Mietnummer. Die Kerle haben sich nicht einmal die Mühe genommen den Wagen abzuschliessen, freute sie sich. Im Handschuhfach fand sie Bleistift und Notizblock. "Treibt mich nicht aufs Eis, ihr Idioten. Wenn ihr mit mir ins Geschäft kommen wollt, ruft mich gefälligst an!", schrieb sie auf Deutsch. Sie setzte ihre Telefonnummer und ein Postscriptum darunter: "Bis zur nächsten Garage sind es nur 12 km. Das soll euch eine Lehre sein". Mit einem Schraubenzieher, den sie im Kofferraum fand, durchbohrte sie die Pneus. Knapp eine Stunde später fand sie im Dorf Unterschlupf. Als Grund gab sie vor, sich selber ausgesperrt zu haben. Unterhalb von Märtas Haus versuchte der im Eis eingebrochene Res, einer der beiden Kumpane Sämi Recks, verzweifelt, sich auf festen Boden zu ziehen. Die Handschuhe hatte er abgestreift, um sich mit den Fingernägeln ins Eis krallen zu können. Einige Male gelang es ihm, mit seinem Körpergewicht die elastische Eisschicht unter Wasser zu drücken und sich halbwegs hinauf zu ziehen. Doch immer wieder brach er ein. Das Schiesseisen in seiner Tasche machte die Sache nicht besser. Mit Ratschlägen wurde nicht gegeizt. "Leg dich auf den Rücken und schwimm hin51 auf", schrie sein Freund Heini, der am Zürichsee gross geworden war und sich mit Eis auskannte. Doch Res' Kräfte begannen ihn im eisigen Wasser zu verlassen. "Schnell das Boot", rief Sämi. Sie kehrten das Ruderboot neben dem Bootssteg um und schoben es auf das Eis. Die Eisdecke trug das Boot, die beiden Männer schoben es, sich am Seitenbord haltend, auf Res zu. Zwei Meter vor der Bruchstelle sackte das Boot ein. Sämi und Heini versanken bis zum Bauch im Wasser, konnten sich aber ins Boot ziehen. Es gelang ihnen Res ebenfalls ins Boot zu hieven. Minuten später waren ihre nassen Kleider steif gefroren. Nun sassen sie zwar im Boot, aber leider noch draussen im Eis. Es gelang ihnen die Ruderbank loszureissen und mit der Holzplanke das Eis vor dem Boot aufzuschlagen. Für die wenigen Meter bis zum Land brauchten sie über eine halbe Stunde. Halbtot und buchstäblich auf den Felgen erreichten sie kurz vor Arbeitsbeginn die von Märta Siltanen beschriebene Garage. Heini und Res bekamen in diesem Winter den zweiten bösen Schnupfen. 52 Die Bergung Boris Lattem und der Werftbesitzter Jan Blom sassen am Ende der Werftbrücke auf zwei aus dem Eis herausragenden Pfahlstümpfen, die morsch geworden waren unter den Stössen unzähliger Kähne, die hier angelegt hatten. "Meine Vorfahren waren Schmuggler und Seehundjäger", sagte Blom. "Seehunde, hier?", fragte Lattem. "Oben im Bottnischen. Jagten die Viecher auf dem Eis. In der Polarnacht. Versteckten sich hinter einem weissen Tuch und robbten auf sie zu, auf dem Bauch, bis auf Schussdistanz." Er imitierte die Bewegung mit seinen Armen und Schultern und zielte dann. "Das viereckige Tarntuch schoben sie auf einem kleinen Schlitten vor sich her, heissten es auf wie ein Rahsegel. Grad über der Eisfläche. Ist noch gar nicht lang her. Die Sealjäger bewahrten den Kaffeesatz den ganzen Winter hindurch auf. Hat mein Grossvater erzählt." "Um aus ihm die Zukunft zu lesen?", witzelte Lattem. "Um damit zu schreiben!", erklärte Blom. "Im Frühjahr streuten sie damit in Riesenschrift Verwandtengrüsse auf das Eis. Die Piloten der Postflugzeuge leiteten die dann weiter." "So könnte es jedenfalls gewesen sein", bemerkte Lattem skeptisch. Dann wechselte er das Thema. "Die Polizei hat also die Ermittlungen eingestellt?" "Jedenfalls für den Moment, sie wollen nach dem Eisgang weitersuchen." "Warst du dabei, als sie den Helikopter bargen, den wir in den Grund gebohrt haben?" "Was heisst Helikopter? Verbogenes Alteisen. Nein, ich war ja noch in Untersuchungshaft wegen der Schiesserei hier." Jan Blom war aufgestanden und schlug seine rechte Stiefelspitze ins morsche Holz. "Im alten Flughafen von Helsinki konfiszierten sie in der gleichen Nacht eine Tupolev und eine riesige Menge Dollarscheine. Stand im Helsingin Sanomat. Einer, der an das Geld ran kommen wollte, sei rechtzeitig abgehauen. Er konnte sich der Verhaftung entziehen, hiess es. Im Sanomat stand, die Sache habe bös mit der Geschichte hier zu tun." Lattem sprang wütend auf. "Dieser Teufel, ich hab's geahnt. Der Austausch hier in der Werft war nur ein Schmierentheater, damit er an meine Ware rankommen konnte. Hätten sie den Behälter an Land gebracht, wäre ich der nächste gewesen, den sie umgelegt hätten, seine drei Killer. Mit dem Helikopter und dem untergehängtem Ei darunter wären sie zur Tupolev geflogen, und der Zaster hätte die Hand gewechselt. Meine Provision hätte er natürlich gleich auch noch eingesteckt. Nicht zu glauben! Er hat das Zeug gleich zweimal verkauft, einmal an die Schweiz und einmal irgendwo hinter die Türkei." "Geht mich zwar nichts an. Aber der Mensch ist neugierig. Was war eigentlich in diesem Stahl-Ei, auf das alle so geil sind?" Boris Lattem tat geheimnisvoll. Er zog seine viel zu grossen Handschuhe aus, warf sie auf den Boden und rieb sich die Hände. "Ich erzähl's dir, wenn du mir einen Gefallen tust." Das mit dem Plutonium und dass er es immer noch gegen Platin auszutauschen gedachte, verschwieg Lattem. Märta Siltanen lud ihre Sauerstoffflasche und einige andere Taucherutensilien auf einen Schlitten, auf dessen Kufen ein roter Stuhl montiert war. Dann machte sie sich damit auf den Weg. Sie stiess den Schlitten an der Rücklehne des Sitzes vor sich her, wobei sie mit dem linken Fuss auf einer der nach hinten verlängerten Kufen stand und mit dem rechten Fuss am Eis abstiess. Wäre es nicht so dunkel gewesen, hätte sie in ihrem wehenden Morgenrock und den Moonboots über der Taucherausrüstung einen sonderbaren Anblick geboten, wie sie einen Stuhl vor sich her schiebend über das mit einer feinen Schneeschicht bedeckte Eis glitt. Der Wind hatte den Schnee stellenweise zusammengetrieben, so dass es ihr dort Mühe bereitete, voranzukommen. Dann wieder glitt der Schlitten so leicht, dass sie nach kräftigem Abstossen kurz beide Beine auf die Kufen stellen konnte. In der Kälte zog sich das Eis an der Luftseite zusammen. Die dadurch entstehenden Spannungen lösten sich ab und zu knallend in Form feiner Risse an der Eisoberfläche. Märta Siltanen kannte dieses Geräusch und achtete nicht weiter darauf. Sie konzentrierte sich voll auf die Orientierung. Ohne einen sichtbaren Fixpunkt würde sie unweigerlich im Kreis herum gehen. Den Kompass benützte sie nicht, denn die schwarzen Bäume der Inseln hoben sich genügend vom helleren Nachthimmel ab. Der das Sternenlicht reflektierende Schnee zeigte ihr, wenn sie zurückblickte, eine schnurgerade Spur. Das ist mein Weg, dachte sie, immer zielgerichtet hin53 aus ins Ungewisse. Nach ungefähr einer Stunde traf sie auf die Schneeeindrücke eines Scooters, denen sie in Fahrtrichtung folgte. "Das Loch ist fertig, wir legen jetzt das Zugseil unter das Eis", sagte Boris zu Märta, als sie aus der Dunkelheit auftauchte. Jan Blom hatte mit der Eissäge - die Motorsäge wollte er nicht einsetzen, wegen des Lärms den sie macht - ein quadratisches Loch aus dem Eis geschnitten. Lattem schob eine lange Holzlatte in Richtung auf die kleine Insel unter das Eis. An ihrem hinteren Ende war eine starke Schnur befestigt. Sie wurde während des Vortriebes der Latte aus einem Plastikkessel, der am Eisrand des Lochs stand, nachgeführt. Jan Blom versuchte weiter gegen die Insel zu, unter dem Eis, das vordere Ende der Latte auszumachen und bohrte dort ein Loch hinunter. Durch das Loch hindurch richtete er mit Hilfe eines bogenförmigen gekrümmten Stabes die Latte unter dem Eis so aus, dass sie genau unter das Loch zu liegen kam. Mit einer langen Astgabel schob er sie unter dem Eis weiter, bis ihr Ende mit der Schnur kam. Jan Blom wiederholte sein Verfahren, bis sie das Ufer des Eilandes erreicht hatten. "Wenn du vor dem Gefrieren eine Sinkschnur gelegt hättest, wäre uns diese Arbeit erspart geblieben", murrte Jan. Boris schwieg, das Versäumte war ja nun ausgebügelt. Mit der Schnur zogen sie ein Drahtseil nach. Dieses legten sie mehrmals um die Welle einer alten Seilzugmaschine, die oben auf der Insel an einer Kiefer festgezurrt war. "Ich möchte die Sache hinter mich bringen, sonst erfriere ich noch, bevor ich im Wasser bin", schimpfte Märta und schlug das dünne Eis mit dem Fuss auf, das sich bereits wieder über dem Wasser des schwarzen Vierecks gebildet hatte. "Häng' den Drahtseilhaken unbedingt oben am Ei ein, sonst verfängt es sich in den Steinen am Meeresboden. Zehn Minuten später tauchte Märta mit erhobenem Daumen wieder auf. Sie zog sich aufs Eis und riss rasch den Anzug vom Leib. Lattem trocknet ihren nackten Körper. Jan Blom wandte sich ab und ging zur Insel. Er startete den Dieselmotor der Seilwinde. "Nun rasch in die Kleider und dann ab nach Hause ins Bett", sagte Boris besorgt. Er will mich los haben, dachte sie bitter. "Nein, ich bleib' hier. Jetzt hab' ich wieder warm. Ich fahr' mit euch zurück, bin heute schon genug gelaufen", sagte sie. Die Seilwinde zog das Transport-Ei unter dem Eis durch, zuerst an das Land und dann den Hügel hinauf. Oben auf der Insel stellten sie es mit Hilfe eines hölzernen Dreibeins und mit einem Differenzialflaschenzug zwischen einem gewaltigen Findling, dichtem Gehölz und einer verlotterten rot-weissen Holzbacke so auf, dass es vom Meer her unmöglich zu sehen war. "Im Wasser wär's besser versteckt gewesen!", meinte Blom. "Aber von hier aus bring ich's ohne Taucher weg", entgegnete Boris mit einem unsicheren Blick auf Märta. Todmüde liessen sie sich und ihr Gerät auf den zum Konvoi verbundenen Schlitten vom Scooter in die Werft zurückschleppen. Ein Schneesturm kam auf und verwischte alle Spuren. "So einen Schneesturm habe ich lange nicht mehr erlebt", sagte Jan als sie wieder in der Werft waren und klopfte seine weisse Faserpelzjacke, bis sie wieder rot wurde. Boris sah furchterregend aus. Aus seiner Nase wuchsen Eiszapfen und sein Bart glich den Schlangenhaaren einer Erinnye. "Pfui, wie du aussiehst", entrüstete sich Märta, deren Gesicht unter ihrer Pelzmütze rot glühte wie die Mitternachtsonne am Nordpol. Bis um 2 Uhr früh halfen sie Jan Blom beim Versorgen von Werkzeugen und Gerät. Dann schlitterten sie mit dem Auto auf der vereisten Strasse durch das Schneegestöber nach Hause. Boris ging die Sauna mit einem Stoss Birkenholz einheizen. "Ich will den Dreck herausschwitzen", erklärte er. Märta wollte sofort ins Bett gehen. Vom Zimmer aus beobachtete sie zufällig, wie Boris nochmals mit dem Auto wegfuhr. Am nächsten Tag fand ein Kunde den Werftbesitzer Jan Blom aufgehängt an einer Drahtschlinge um den Hals am Kranbalken baumelnd. Polizeiliche Untersuchungen ergaben, dass er sich möglicherweise selber umgebracht habe. Märta war entsetzt. Boris Lattem wusste von nichts. "Ich wollte noch deinen Stuhlschlitten holen, während die Sauna aufheizte. Als ich zur Werft kam war, lag sie bereits im Dunkeln", erklärte er. Tatsächlich, den Schlitten vor der Werft hatten sie vergessen ins Auto zu laden. Märta schwankte zwischen Angst ohne Glauben und Glaube, ohne Furcht. “Und du hast nichts gesehen? Ich glaube dir kein Wort.“ “Ich sagte dir doch, dass die Werft im Dunkeln lag. Ich bin sicher, Jan hatte persönliche Probleme. Was geht mich das an. Diese ewige Dunkelheit im Winter macht die Leute halt depressiv”, sagte er kalt. Märta bekam eine Gänsehaut ob dieser Worte. Sie hatte Jan Blom gut gemocht, und gestern Nacht hatte er alles andere als bedrückt gewirkt. 54 Der Henker Jan Blom befestigte die durch einen Karabinerhaken laufende Drahtschlinge des Hebekranes um den Bügel des Motors, mit dem sie das Ei auf die Insel geschleppt hatten. "Türe zu", schrie er, da ihm ein Windstoss eine Ladung Schnee ins Gesicht pustete. "May we help you?" Drei Männer waren in die Werft getreten. Zwei kamen auf ihn zu. Der dritte verschloss die Tür hinter sich. "What the hell are you looking for?", stammelte Jan, als er Sämi Reck und seine beiden Helfer erkannte. "Das wollen wir dir gleich erklären", antwortete Sämi auf Deutsch und richtete seine Walther auf Jan. In miserablem Englisch fuhr er fort: "You tell me now! Where is the goddamd steelegg from Estonia, I am sure, you know it." Jan wusste, dass ihm jetzt niemand helfen konnte. Er versuchte es mit einer Ausrede. Sie hätten ja selbst gesehen, dass es auf dem Fischkutter geblieben sei. Die seien damit sicher noch in der gleichen Nacht zurückgekehrt nach Tallinn. Woher er das wissen wolle, sie hätten da andere Informationen, erwiderte Reck kalt. "Helfen wir ihm, das Dieselaggregagat mit dem Kran auf die Bühne zu heben", sagte er zu den beiden andern. Mit seiner Waffe zwang er Jan Blom, vor ihm die Leiter hinauf zu steigen auf eine Holzplattform unter dem Dach der Werfthalle. Reck folgte ihm. Er angelte sich die herunterhängende Kranbedienung und hob damit das Aggregat bis auf die Höhe der Plattform an. Mit den Rollen des Kranbalkens brachte Blom die Maschine über die Bretter, worauf die beiden Männer standen. Reck senkte das Gerät durch erneuten Knopfdruck. Er deutete dem völlig verunsicherten Werftbesitzer, wieder die Leiter hinunter zu klettern. Gleichzeitig lockerte er die Drahtschlinge, zog sie vom Motorbügel weg und legte sie blitzschnell um Bloms Hals, als dieser eben im Begriffe war, knielings auf die Leiter zu rutschen. Mit einem Ruck zog Reck die Schlinge fest. Jan versuchte mit beiden Händen, sich vom Draht um seinen Hals zu befreien und verlor dabei das Gleichgewicht. Sämi Reck versuchte zwar noch sein Opfer zu halten, aber da war es schon zu spät. "Scheisse! Springt dieses Arschloch von der Leiter! Jesusfuckenchrist!", fluchte Reck wie ein Teufel. Heini und Res mussten von unten hilflos zusehen wie Jan Blom, der glücklose Werftbesitzter zwei Meter über dem Boden sein Leben auspendelte. Sämi Reck, Henker wider Willen, stieg verärgert hinunter vom Schafott. "Ich wollte ihm nur etwas Dampf machen", versuchte er sich herauszureden. Hinten in der Werft schlug eine Tür zu. “Ich höre ein Auto", sagte Heini erschrocken. “Bist du bereits auf dem Gespenstertrip”, knurrte Sämi. "Besser wir verwischen unsere Spuren und hauen ab!" 55 Verrat "Wer hat gesagt, ich besitze kein Kurare? Lügner!", keifte Professor Torsten Kokkonen, der eine grellfarbene Wolldecke um seine Schultern gelegt hatte. Ausserdem trug er mit Stickereien verzierte Legging, und um seinen mageren Hals hing Glasperlenschmuck. Wütend hatte er sich aus seinem Sessel erhoben. Genau über seinem Kopf hing eine gewaltige Maske, die einem Tierkopf glich. Seine Hand zuckte, als ob er gleich nach dem indianischen Kriegsbeil greifen wollte, das aussah, als hätte es mehr als einen Menschenschädel durchschlagen. Märta Siltanen hatte dieses provokative Spielchen von einem Kommilitonen gelernt, der sie einmal zur Wohnung des senilen Professors geschleppt hatte. "Komm, gehen wir uns zu Kokkonen amüsieren. Was, du hast ihn noch nie erlebt?", schwärmte er. Märta war es dann allerdings peinlich, wie ihr Kollege mit dem greisen Professor umgesprungen war. Nun machte sie es selber, allerdings mit einer klaren Absicht. "Beruhigen sie sich, Professor, ich glaube Ihnen doch", dämpfte Märta Siltanen die von ihr absichtlich ausgelösten, reflexartigen Emotionen des Alten. Besänftigend hob sie das Kalumet vor ihr, eine wunderschöne, aus dem heiligen rötlichen Ton geformte Friedenspfeife. Fast so dramatisch wie im Film, dachte sie. Der Professor schlurfte in seinen Mokassins zu einer kleinen Glasvitrine, die unter anderem einige schwarzhaarige Skalps - das heisst, mit dem Bowiemesser abgetrennte Kopfhäute unterlegener Indianerkrieger - enthielt und zeigte auf eine kleine braune Apothekerflasche. "Und was ist das hier? Was habe ich gesagt?", rief er triumphierend "Was bewirkt der Saft, wenn er ins Blut gelangt?", fragte Siltanen, die Naive mimend. Der Professor hielt den Atem an und machte sich stocksteif wie ein Brett. Dann grinste er wie ein Teufel. "Exit durch Lähmung der Muskulatur! Atemstillstand bei vollem Bewusstsein. Aus, bums, fertig. Den alten Umlauf aus Hamburg können Sie leider nicht mehr fragen. Dabei hätte gerade der es wissen müssen", lallte er. Siltanen kannte die Geschichte. "Der vom Indianermuseum?" fragte sie scheinheilig. "Er hat sich an einem Pfeil seiner Waffensammlung verletzt und starb kurz darauf an diesem fürchterlichen Gift", bestätigte der Emerit, "verschieden im Dienste der Forschung!" Dabei schüttelte er die Flasche grimmig. "Aber sie haben dieses Teufelszeug doch nicht etwa selbst mitgebracht aus Guayana", stichelte Märta Siltanen. "So hab ich nicht? Und ob! Wer behauptet das?", ereiferte sich Kokkonen erneut. Er stellte das braune Apothekerflacon ins Schränkchen zurück und eilte zum Blasrohr, das an der entgegengesetzten Wand hing. Siltanen tauschte mittlerweile blitzschnell das Fläschchen in der Vitrine mit einem gleich aussehenden Gebinde um, das sie mitgebracht hatte. Da der Professor Mühe hatte, das Blasrohr von der Wand zu nehmen, gelang es ihr sogar, das mit einer Schlinge übergeworfene Etikett vom Hals der Kurareflasche zu lösen und über den des Duplikats zu werfen. "Damit haben sie vor meinen Augen einen Affen erlegt", brüllte der Professor. "Mit dem Rohr und mit diesem Pfeil. So..." Er blies die Backen gewaltig auf und pustete ins Rohr, aus dem eine gewaltige Staubwolke herausfuhr. Den feinen Pfeil hatte er nicht ins Rohr gesteckt, sondern hielt ihn in der Hand. "Die Pfeile vergiften sie mit dem Saft und der Rinde der ..äh.. Strychnopflanzen. Die enthalten ..äh .. Toxiferin und ..äh.. Tubocurarin, zwei ..äh.. Alkaloide, nicht wahr", begann er zu dozieren und fiel ermattet in den Sessel. Märta liess seine Ausführungen über sich ergehen, ohne ihn zu unterbrechen. Dann erhob sie sich. "Danke Professor, das war heute aber wieder einmal spannend bei Ihnen", heuchelte sie. "Ich darf sie doch wieder einmal besuchen? Und geniessen sie den Curaçao, den ich ihnen mitgebracht habe." Sie hob das Gläschen mit dem Pomeranzenlikör und prostete ihm zu. Aber Torsten Kokkonen war bereits eingenickt. Nachdem sie das Blasrohr zurückgehängt und ihr Glas in der Küche gespült hatte, verliess sie die Wohnung leise. Wenn alles gelaufen war, würde sie hier nochmals vorbeischauen. In den Schären war nach einem nasskalten Juni endlich der Sommer gekommen. Märta Siltanen stand schwitzend im Wohnzimmer und legte mit einem Seufzer den Hörer auf die Gabel des Telefonapparates. Sie hatte einkalkuliert, was sie voraussehen konnte. Aber wie die bisherige Geschichte zeigte, konnte immer noch genug schiefgehen. 56 Es ist so eine Crux mit dem Planen, dachte sie. Pläne sind hilflose Versuche, die Realität vorweg zu nehmen. Doch Realität ist mehr als bloss die Summe ihrer denkbaren Möglichkeiten. Angenommen alle Eventualitäten eines künftigen Geschehens wären uns zum Voraus bekannt, wen interessierte dann noch der wirkliche Verlauf? Welchen Sinn hätte Realität, wenn die Wahl zwischen zwei Verzweigungen getroffen werden konnte, noch bevor die Wegscheide in Sicht kam? Wie langweilig wäre eine solche Welt! Nein, so war es zum Glück nicht. Pläne bieten keine Sicherheit, sie beschreiben nur die möglichen Kanäle von Abläufen, die wir beeinflussen möchten. Dabei sollten wir uns auf die Wahrscheinlichkeitsvarianten stützen, an denen wir am wenigsten zweifeln. Gerade darin besteht aber die Schwierigkeit. Statt uns an Wahrscheinlichkeiten zu orientieren, klammern wir uns an Hoffnungen und ignorieren, dass Hoffnungen den Blick auf die Wirklichkeit versperren. Sie trat hinaus auf ihre Veranda und setzte sich in einen Liegestuhl. Pläne sind zwar hilfreich und notwendig auf dem Weg in die Zukunft, wie Raster bei einer Meinungsumfrage, knüpfte Siltanen an ihre vorherigen Gedanken an. Aber sie grenzen auch ein, verengen die Möglichkeiten, verführen zu Sturheit, lenken ab und schlagen uns gar mit Blindheit, seufzte sie. Wir sollten Pläne nicht nur mit Blick auf unsere vordergründigen Ziele machen, sondern immer auch die versteckten Motive unseres Handelns einbeziehen. Es wäre wichtig, dauernd zu versuchen, unsere wahren Absichten zu ergründen. Erst wenn wir diese kennen, können wir unsere Handlungen sinnvoll vorbereiten. Aber wer macht das schon? Handeln wir nicht oft genug dumm, wie ein Mensch, der den Selbstmord plant, obwohl er gar nicht den Tod anstrebt, sondern nur auf sich und seine Probleme aufmerksam machen möchte! Sie richtete sich auf in ihrem Stuhl und versuchte mit der Hand eine Fliege zu erhaschen. Richtiges Planen setzt ein klares Bewusstsein voraus, nicht nur einen festen Willen. Wusste sie, Märta Siltanen eigentlich, was sie wollte? Kaum! Viel besser wusste sie, was sie nicht wollte. Sie kannte ihre "Nichtziele". Nach diesen müsste sie also ihre Planung ausrichten! Aber konnte ihr das Streben nach dem, was sie nicht oder lieber nicht wollte, zu dem verhelfen, was ihr wichtig war? Als sie von Wien weglief, hatte sie so gehandelt. Die Entscheidung war richtig gewesen, davon war sie überzeugt, weil sie mit ihrem damaligen Nein ja sagte zu den Möglichkeiten, die ihr jetzt offen standen. Sie schlug sich heftig auf die Stirne, auf der sich die Fliege niedergelassen hatte. Plötzlich sah sie ihre Zukunft wie eine Landkarte vor sich, in die sie selber Pfade, Wege und Strassen eingezeichnet hatte. Sie sah, dass nicht alle Wege nach Rom führten. Sie erkannte, dass sie so lange nein sagen und die Richtung ändern würde, bis nur noch ein einziger Weg übrig bliebe. Dieser Weg wird meine Strasse sein, und ich werde sie zu Ende gehen, entschied sie sich. Früher war sie voller Optimismus den Leuchtfeuern des Schicksals gefolgt. Dann ging ihr auf, dass sie die Wegmarken selber setzten musste, und jetzt war ihr klar geworden, dass sie auch umkehren durfte, und dass sie die Dinge nicht mehr einfach nehmen musste, wie sie kamen. Märta Siltanen entspannte sich. Sie fühlte sich erleichtert. Denken macht Durst. Ich mach' mir einen Drink, beschloss sie und holte sich ein Glas mit einem Rest des Weines vom Vorabend. Sie setzte sich auf den Liegestuhl zurück. Eines war sicher, Boris wahre Ziele befanden sich nicht da, wo ihre lagen, obwohl sich seine vordergründigen Wünsche vielleicht mit ihren eigenen deckten. Beide waren sie auf materielle Schätze aus, er auf wertvolles Metall, sie auf rasches Geld. Der grosse Unterschied bestand darin, dass sie genau wusste, was ihr Geld bedeutet. Es gab ihr Handlungsspielraum, bot Freiheit, ermöglichte Selbstverwirklichung. Boris Streben nach Platin hingegen war eine Täuschung. Es lenkte von seinem eigentlichen Hunger ab. Seine Sucht war der sehnliche Wunsch nach Wärme. Nicht die Wärme der Menschen suchte er, sondern die Geborgenheit des Nestes im hintersten Winkel einer Höhle. Es musste nicht unbedingt die Hölle sein. Er würde sich auch in einer Gletscherspalte geborgen fühlen, wenn er nur sicher war, dass sie keinen Ausgang besass. Sein Plutonium wollte er mit Platin tauschen, Metall gegen Metall. Was für ein Selbstbetrug. Wieso konnte er glauben, dass "die innere Schwärze des Platins", wie er es nannte, ihn besser schützen würde als die nach aussen dringende Wärme des strahlenden Plutoniums! Märta Siltanen blickte auf die kleine Wiese vor ihr. Über dem dunklen Nadelwald guckten wie jeden Abend Kobolde mit spitzen Hüten und ausgebreiteten Armen auf die Lichtung hinunter, auf der ihr altes Holzhaus seit zwei Generationen stand. "Sie drohen nicht und sie wollen nicht ängstigen, sie schauen nur neugierig hinunter auf das Haus, die Wiese und uns. Wenn es Nacht wird verschwinden sie genau so lautlos, wie sie aufgetaucht sind" , hatte ihr Vater oft zu ihr gesagt, hier in diesem gleichen Stuhl sitzend. Zwischen den Bäumen sah sie hinaus auf die verdämmern57 den Inseln und das Meer. Diese ungebunde Wasserwelt passte zu ihrem Wesen. Die isolierten grünen Erhebungen versprachen Unabhängigkeit und das blaue Meer, das sie umspülte, grenzenlose Freiheit. "Verwirrende, aber nicht verlorene Welt, überspannt von der Unendlichkeit des nordischen Himmels. Im Sommer voller Licht, im Winter eingefroren in ewiger Dämmerung" 32, zitierte sie aus dem Gedächtnis. Keine Wolke stand am Abendhimmel, kaum ein Lufthauch war zu spüren. Die Sonne versank im Farbenmeer. Märta wurde unruhig. Hinter ihren Augen spürte sie einen schmerzhaften Druck. Zeit zum Handeln. Ein dunkler Wolkenstreifen stieg rasch über den Horizont. In unheimlichem Tempo nahm das schwarze Band aus dem Westen Besitz vom Himmel. Das ferne Rauschen im Wald schwoll an zu einem gewaltigem Brausen. Splitterndes Holz krachte. Wie die Druckwelle einer gewaltigen Explosion fuhr eine Sturmbö aus dem Wald auf die eben noch so friedliche Wiese hinaus. Sie riss Bäume mit und liess sie unter ihrer Gewalt zerbersten. In den Wipfeln des südlichen Waldes wogte eine gewaltige Orkanwelle den Hügel hinauf und hinunter. Sie verlor sich unter Getöse gegen den östlichen Horizont. Mit Schaudern sah Märta, wie sich neben der Strasse ein ausgedrehter und entwurzelter Baum auf eine Hochspannungsleitung warf und einen Blitz elektrischer Energie daraus zog. Wenige Minuten später kehrt völlig überraschend die Ruhe zurück. Rabenschwarz stand der Himmel über dem zerstörten Wald und es war merklich kühler geworden. Mein Haus hat das Unwetter heil überstanden, stellte sie beruhigt fest. Noch eine Weile blieb sie gedankenverloren sitzen. Dann packte sie wild entschlossen die Lehnen ihres Stuhles und rief: "Ich werde über sie herfahren schlimmer als dieser Sturm." Ein Mückenschwarm griff sie an und zerstach ihr das Gesicht und die Hände. Wild um sich schlagend flüchtete sie ins Haus. 32 Zitat aus F. Theilers Buch "Metallische Gier" (Der Verfasser). 58 Mord Boris Lattem war erst sehr spät nach Hause gekommen. Der Sturm in der letzten Nacht hatte Bäume über die Strasse geworfen. Deshalb schlief er noch fest, als Märta am Morgen mit heulendem Motor auf das Meer hinaus fuhr. Über dem feinen Morgennebel an der Meeresoberfläche schwebte die Insel mit der Richtbacke unterhalb ihres felsigen Buckels. Hinter dem Schilfbestand sah sie Lattems Plastikzelt, mit dem er vortäuschen wollte, jemand halte sich dort auf. "Das Zelt bewacht mein Ei", hatte er ihr erklärt. In rasendem Tempo fuhr sie daran vorbei, weiter hinein in das Inselgewirr. Nach einer halben Stunde stellte sie den Motor auf Leerlauf und liess das Boot zwischen zwei Felsklippen vor einer bewaldeten Insel auslaufen. Sie warf den Anker und wartete. Von Süden her kam ein Boot auf sie zu. Am Steuer stand Sämi Reck. Er war allein, wie abgesprochen. Seine Kumpane dürften wohl dort drüben mit einem weiteren Boot warten, vermutete sie. So hätte sie es jedenfalls gemacht. "Her mit dem Metallkoffer", befahl sie barsch. "Hier bitte!" Reck reichte ihr eine schwarze Falttasche. Nachdem sie den Inhalt kontrolliert hatte, warf Märta Siltanen sie zu Recks Verblüffung ins Meer. "Und wo ist das Stahl-Ei, Mädchen?", raunzte er. "Ich fahre voraus... Männchen", sagte sie im gleich unhöflichen Ton. Sie fuhren nebeneinander auf die von weitem sichtbare Felswand einer dicht bewaldeten Insel zu. In einer kleinen Bucht darunter schoben sie den Bug ihrer beiden Boote mit Motorkraft auf eine flach abfallende Felsplatte und gingen an Land. Märta Siltanen entdeckte draussen auf dem Meer die beiden Typen, die ihnen von Ferne mit einem Boot gefolgt waren. Sie führte Sämi Reck hinauf zu einer Stelle oberhalb der Felswand. "Und was jetzt", fragte er drohend. Statt einer Antwort sprang Siltanen mit einem gewaltige Satz über die senkrechte Wand hinaus auf den Wipfel einer Kiefer, die in einigen Metern Entfernung vor der Felswand hochgewachsen war. Hinter dem dicken Stamm versteckt hing ein Seil. Geschickt liess sie sich daran zu Boden gleiten. Aus einer Asthöhle entnahm sie mit raschem Griff eine braune Apothekerflasche. Durch den Gummideckel hindurch steckte sie einen Dartfpfeil und netzte ihn mit der Flüssigkeit. Mit einem markerschütternden Schrei hatte auch Sämi Reck den Sprung gewagt. Was war ihm schon anderes übrig geblieben. Beim Abseilen verbrannte er sich die Hände an den Nylonfasern. Zwei Meter über dem Boden liess er das Seil los und sprang. Im gleichen Augenblick stiess Märta Siltanen von unten den Wurfpfeil mit aller Kraft in sein Gesäss. Blitzartig verschwand sie zwischen den grossen Felsen. Von oben hört sie Schüsse. Dort waren Res und Heini aufgetaucht, die beiden Verfolger. Im Schutz der Felswand hastete sie weiter, verfolgt von Reck. Er holte rasch auf. Es gelang ihm, sie von hinten zu packen. Grausam warf er sie zu Boden und riss ihre Kleider auf. Keuchend warf er sich auf sie. Sie wehrte sich mit aller Kraft. Er brüllte wie ein Berserker und versuchte in sie einzudringen. Schon befürchtete sie, der Professor habe doch nur geprahlt. Da merkte sie, wie Recks Muskeln zu erstarren begannen, zuerst seine Beine, dann die Arme, die brutale Aggression wich einer entsetzlichen Lähmung. Reck begann zu röcheln wie ein sterbender Stier. Siltanen befreite sich aus der tödlichen Starre. Mit letzter Kraft kämpfte sie sich durch das Dickicht hinunter zum Meer. Am Ufer entdeckte sie das Boot der beiden Männer, die sie jetzt oben auf der Felswandkante rennen sah. "Spring an, bitte", flehte sie den Motor an. Als Res und Heini die Stelle erreichten, war sie bereits weiter vom Ufer entfernt, als ihre Colts reichten. Sie schaute zu, wie die beiden über die grossen Ufersteine zur Bucht hetzen, wo ihr eigenes Boot neben dem von Reck im Wasser schwamm. Als sie von dort einen Motor aufheulen hörte, gab sie Gas. Verfolgt von den beiden Gangstern in Recks Boot umrundete sie die Insel. Mit vollem Tempo raste sie auf eine riesige flache Felsplatte los, die sich hinter dem Schilf schwach geneigt vom Ufer weit ins Wasser senkte. Das Boot stieg wie eine Rakete aus dem Wasser und fuhr die Platte hinauf fast bis zum Waldrand. In einem bemoosten Tümpel blieb es stehen. Der Aussenbordmotor hatte sich losgerissen, als sein Schaft auf dem Felsen in Stücke schlug. Die Polyesterschale des Bootes war bis unter die hintere Ruderbank aufgerissen und zersplittert. "So schlimm habe ich mir das nicht vorgestellt", dachte Märta benommen. Es blieb ihr keine Zeit, sich darüber zu freuen, dass wenigstens sie selbst den Aufprall ganz überstanden hatte. Rasch verschwand sie im Wald. Heini und Res hatten auf den "Stapellauf aufwärts" verzichtet. Sie sprangen auf einen grossen Stein neben ihrem im Wasser treibenden Boot. "Das verdammte Biest will zum Boot auf der andern Seite der Insel", bemerkte Res. "Los schnappen wir sie uns", lärmte Heini und rannte los, gefolgt von Res. Märta Siltanen erreichte ihr Boot dank besserer Ortskenntnis lange vor den beiden Verfolgern. Weit querab vor der Insel liegend zeigte sie höhnisch den Stinkefinger, als die beiden Pechvögel ausser Atem aus dem Ufergebüsch hervordrangen. 59 "Ich werde euch gleich das Boot auf der andern Seite der Insel holen", schrie sie höhnisch. Die beiden ausgetricksten Kerle stressten fluchend über die Insel zurück zu Recks Boot. Zerkratzt von der rauhen Inselvegetation und mit verstauchten Knöcheln mussten sie später auf der Felsplatte neben dem zerschellten Boot frustriert zusehen, wie Siltanen mit Recks Boot im Schlepptau hinter den Inseln verschwand. Den beiden blieb nichts mehr anderes zu tun, als den seltsam steifen Körper ihres entseelten Chefs mit Steinen zu bedecken. Ein Kreuz steckten sie ihm nicht. Und so hat Sämi Reck nach einem unchristlichen Leben auch kein christliches Grab gefunden. Von seinen Totengräbern verlor sich jede Spur. Es ist nicht anzunehmen, dass sie auf der Insel verhungert sind. Auch haben sie kaum kollektiven Selbstmord verübt oder sich gegenseitig umgebracht. Wahrscheinlicher ist, dass sie beim Versuch, ans Festland zu schwimmen, durch Unterkühlung umgekommen sind. Da aber ihre Leichen an keinen Strand gespült wurden, bleibt die Möglichkeit, dass sich ihrer ein Fischer erbarmt hat. Vielleicht hat er die Insel aufgesucht, um dort seine Notdurft zu verrichten. 60 Lattems Ende Boris Lattem stand auf der Terrasse, über die gestern Abend der Sturm gebraust war. Am Waldrand sah er die umgestürzten Bäume. Im Innern des Hauses ertönte Vivaldis Oboenkonzert aus dem Radio. Ein heller Klang zog sich in barockem Rhythmus über die sanfte Melodie. Jammernd und wiegend wie die Waldsäge meines Grossonkels, ironisiert Lattem. Aber es erstaunt ihn doch, dass die Musik in ihm eine vergessene Stimmung aus seiner Kindheit hervorrief. "Dem Ohr vertraute Melodien rufen enigmatisch nach Bildern unserer verlorenen Welt!", stand im Gesangsbuch seiner Mutter. Lattem begriff nicht, dass sich bisher weder Jill Kehl, noch Salg oder seine Killer bei ihm gemeldet hatten. Es war verdächtig still geworden um seine Sache, als wäre die Geschichte eingeschlafen. Lattem wurde nervös. Die Bande wusste mit hundertprozentiger Sicherheit, wo sie ihn hätte erreichen können. Es gab genug Spuren zu ihm und Märtas Haus in den Schären. Eines Abends war er nach einem Besuch in der Werft von einem Auto mit einer Leihnummer verfolgt worden. Das hatte jedenfalls Jan Blom beobachtet. Mit dem gleichen Auto sind die drei Kerle aufgekreuzt, die Märta auf das Eis verfolgten. Also hatten sie versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Vom unglücklichen Werftbesitzer hatten diese schweinischen Mörder nichts über den Aufenthaltsort des Plutoniums erfahren, soviel hatte er als zufälliger Zeuge beim "Unfall" in der Werft mitbekommen. Der Tod Jan Bloms war ihm in dieser Hinsicht gelegen gekommen, obwohl er ihn natürlich bedauerte. Wo ist Märta? Er begann zu schwitzen. Sie muss heute schon früh aus dem Haus gegangen sein. Er rannte zum Steg hinunter. An der Brücke schaukelte nur das kleine Boot mit dem Suzukimotor in den Wellen. Aufgeregt kehrte er ins Haus zurück. Auf dem Küchentisch fand er einen von ihr an ihn adressierten Brief. "Soeben ist ein fürchterlicher Sturm über die Insel gegangen. Aber was ich jetzt schreibe handelt nur bedingt von dem, was war und ist. Im Moment spreche ich nämlich von der Zukunft. Nun, wo du den Brief in den Händen hast, betrifft er aber, so hoffe ich, nur noch die Vergangenheit. Ich möchte dir ‘jetzt’ mitteilen, dass ‘jetzt’ alles aus ist. Zwischen dir und mir ist es aus, weil du gelogen hast und weil du mich ausnützen wolltest für deine Ziele. Und auch die Geschichte mit dem stählernen Ei ist vorbei. Ich werde sie zum Platzen bringen, noch bevor du aufgestanden sein wirst. Während du liest, werde ich über das "edle Metall", das sie dir versprochen haben, bereits selber verfügen können. Sicher wirfst du mir jetzt vor, das sei ein Judaslohn. Das siehst du ganz richtig. Wenn mein Coup gelaufen ist, werde ich dich nämlich der Polizei verzeigen. Aber denk daran, es gibt doch einen Unterschied zwischen Judas und mir. Du bist nämlich nicht Jesus, sondern ein gemeiner Zwerg, obwohl du bei mir aufgekreuzt bist wie der Weihnachtsmann. Im Gegensatz zu dir habe ich aber nie an Märchen geglaubt. Dein Ei werde ich übrigens auch verraten. Damit will ich nämlich nichts zu tun haben. Sicher wird bald die Polzei bei dir aufkreuzen. Am besten verschwindest du, solange du noch kannst..." Er las nicht weiter, sondern sass nur da. Von unten her begann sich sein Körper ganz langsam mit kaltem Metall zu füllen. Das Metall stieg auf und erreichte sein Gehirn. Er begann sich zu schütteln, damit er weiterleben konnte. Das Metall zerbrach. Es zerfiel zuerst in grosse, dann in immer kleinere Stücke und er schüttelte sich bis sie zu feinstem Staub wurden, zu schwarzem Staub. Verwundert begann er in sich herumzuwühlen. Mit seiner Schwärze bedeckte er sachte den blitzenden Chromstahl der Küchenabdeckung, etwas heftiger die glänzenden Spülbecken und schon rasend die Metallarmaturen. Dann befreite der Wahnsinn die aufgestaute Begierde des Verrückten. Er riss die Besteckschublade heraus, leerte sie über sich aus, verbog Löffel und Gabeln, umarmte die Aluminiumbockleiter, küsste die Herdplatten. Aber nichts davon vermochte die unersättliche Gier zu stillen. Er rannte hinaus. Mit blossen Händen versuchte er sich hinein zu bohren in das Herz der Erde, um zu verschmelzen mit dem Nife ihres Kerns. Allmählich kehrte sein Verstand zurück, soweit dass er erkannte, was noch zu tun blieb. Mit dem Auto raste er zur Werft. In der Werkstatt holte er einen riesigen Schraubenschlüssel. Dann sprang er in Jan Bloms Motorboot und brauste los. Auf der Insel mit dem Ei ging er an Land. Das Boot liess er treiben. Ausser Atem erreichte er den riesigen Behälter aus Stahl. Lattem kletterte auf ihn hinauf. Mit dem Schraubenschlüssel öffnete er den Verschlussdeckel an der Spitze des Eies, mit dem Schlüsselstil drückte er auf den Schnappmechanismus. Er konnte jetzt den Deckel um die Scharnieren an seiner anderen Seite drehen und ihn anheben. Mit dem Flaschenzug an der Spitze des Dreibeins, unter dem der Behälter stand, zog er den grossen Cadmium-Füllzylinder aus dem Ei. An seiner Stelle drängte und klemmte Boris Lattem sich mit den Füssen voran selber hinein in die enge Kapsel. In aufrechter Hockstellung fand er gerade genügend Platz umgeben vom radioaktiven 61 Plutonium. Mit letzter Kraft riss er den Verschlussdeckel von Innen zu. Polternd fiel die Klappe auf die Führungseisen. Der Deckel schnappte ein. Der Behälter kippte wegen des Schlages auf die Seite und begann sich zu drehen. Der Flaschenzug mit dem herunterhängenden Füllzylinder verhängte sich in ihm. Er riss sich vom Dreibein los, wirbelte herum und flog in hohem Bogen ins Meer hinaus. Das Riesen-Ei durchschlug mit Getöse die morschen Bretter der rot-weissen Richtbacke, drehte sich um hundertachtzig Grad, blieb wie ein Ovolid-Spielzeug kurz auf der Spitze stehen und begann immer schneller hinunter zu rollen. Es hüpfte über die Klippe, tauchte ins Meer ein und rotierte langsam hinunter bis auf den Grund. Mit der Spitze voran blieb es im weichen Lehm stecken und versank unter seinem eigenen Gewicht langsam tiefer und tiefer, bis es von dieser Welt verschwand. Geborgen im Ei aus Metall fand Boris Lattem kopfstehend, mit angezogenen Beinen im Strahlenmeer des Plutoniums ewige Ruhe und ein keimfreies Grab. 62 Salgs Ende Nach Salgs Rückkehr in Zürich fand im Büro von Oberst Areznitz eine Krisensitzung statt. Regaz auf seinem Klappstuhl sitzend gab vorerst seiner Erleichterung darüber Ausdruck, dass die Waffenübergabe über die Bühne gegangen war. Die NFBE hatte das Gelingen der Aktion bereits quittiert und in diesem Zusammenhang mitgeteilt, dass die Sturmgewehre nach Tscheschenien weitergegeben würden, wenn sie im Baltikum keine Verwendung mehr dafür hätten. Areznitz hatte vor dem Treffen den Sattelstuhl unter dem Pult versteckt. In Ermangelung einer Sitzgelegenheit musste Salg deshalb stehen. Kleinlaut machte er seinen Rapport. Viel könne er nicht sagen. Die Sache sei aber noch nicht verloren, meinte er, das Platin sei ja zum Glück noch vorhanden. Das Plutonium läge irgendwo auf dem Meeresgrund. Er könne auch nichts dafür, dass die NFBE nicht bekannt geben wolle, wo sie es über Bord geworfen hatte. Sie möchten aus politischen Gründen nicht in diese Sache verwickelt werden. Finnland würde dadurch nur unnötig verärgert, und das sei das letzte, was sie jetzt brauchen könnten. Was sie angehe, könne das Stahlei ruhig noch eine Weile im Wasser liegen bleiben, jedenfalls bis Gras darüber gewachsen sei. "Das dürfte ja geologische Zeiten dauern", unterbrach ihn Regaz giftig. "Vielleicht bis zur Landhebung aus dem Meer?" Salg liess sich nicht beirren. Möglicherweise sei die NFBE jetzt selber hinter dem Plutonium her. Im Augenblick würden seine Leute versuchen mit Lattem Kontakt aufzunehmen. Der wisse sicher genau, wo man suchen müsse. Warum zwei Männer erschossen worden seien in der Werft, wollte Areznitz wissen. Die hätten sich in das Geschäft eingemischt, behauptete Salg. Da sei seinen Männern als ultima ratio33 nichts mehr anderes übrig geblieben, als mit Waffeneinsatz das Schlimmste zu verhindern. Die beiden Toten seien sicher Komplizen der Helikopterbesatzung gewesen. In Zürich müsse es offenbar ein Leck geben. Der Unbekannte, der mit der Tupolev anreiste, sei ein Beweis dafür, dass seine Annahme nicht aus der Luft gegriffen sei. Salgs Rechtfertigungen kamen nicht recht an. "O fallacem hominum spem34, hat schon Cicero gesagt!", höhnte Regaz. "Übrigens haben wir nicht unbedingt die gleichen Informationen. Keine Bange, die Untersuchungen sind eingeleitet. Wir stehen in engem Kontakt mit der finnischen Polizei. Das Korps dort lässt sich nicht ein u für ein x vormachen, Max", sagte er, indem er den letzten Laut von Salgs Vornamen vielsagend zischte. "Richtig, die Finnen haben schon im Winterkrieg ihre Mannen gestellt", warf Areznitz ein. "Sie haben die Russen mit ihrer eigenen Waffe geschlagen, mit den taktischen Mitteln von Schnee und Eis. Der Zar hat sie gegen Napoleon, Stalin gegen Hitler eingesetzt. Auf unseren Gletschern hätten wir es ihnen ebenso gegeben. Ein Schweizersoldat im weissen Kampfanzug ist unsichtbar und unschlagbar. Herr Salg, haben sie schon gehört von meinem Vorschlag zur Schaffung einer raschen Gletscherfahrradelitetruppe?", fragte er mit bis zum Anschlag gewölbtem Kreuz. "Rolf bitte, lassen wir das! ", griff Regaz verärgert ein. "Deine hervorragenden Ideen in Ehren, aber wir haben ein Problem." Salg machte weiterhin auf Zuversicht. Er habe die nötigen Schritte eingeleitet. Der Erfolg werde sich sicher bald einstellen. Das sei nur eine Frage der Zeit und des geschickten Vorgehens. Für letzteres verbürge er sich. "Pia desideria!35", sagte Regaz wütend und blieb misstrauisch. Er wünschte permanent auf dem Laufenden gehalten zu werden. "Sonst reisse ich dir den Arsch auf, das schwöre ich dir." Und das meinte er eindeutig. Eine in Schneesturm und Gefahr geschlossene Männerfreundschaft ging in Brüche. Regaz' Problem war für Salg noch das kleinste. Die schweizerischen Obristen würden ohnehin das Nachsehen haben, falls er das Plutonium wieder fand. Er würde ihnen selbstverständlich auch das Platin nicht zurückerstatten. Schliesslich waren ihm genug Spesen angefallen. Echte Sorge machte er sich wegen seiner östlichen Freunde. Der Osten war ihm plötzlich unangenehm nahe gerückt, und Nähe ohne den Schutz der Anonymität hasste und fürchtete er. Sie hatten ihm ein zeitlich befristetes Ultimatum gestellt. Seine Belohnung müsse er sich ans Bein streichen. Es sei nicht ihre Schuld, dass der Geldkoffer in der Tupolev konfisziert worden sei. Er könne froh sein, wenn sie ihm den abgeschossenen Helikopter nicht in Rechnung stellten, und der Verlust von zwei ausgewiesenen Piloten sei auch kein Pappenstiel. Noch hatte er also eine Galgenfrist. Aller guten Dinge sind drei, sagt der Volksmund. Für Salg traf das für die schlechten zu. Die Zollbehörde in Chiasso war nämlich auf seinen Platinschmuggel aufmerksam geworden und hing deshalb 33 lat. "das letzte Mittel". Der unglückliche Salg wollte mit diesem lateinischen Zitat Rainer Regaz eine kleine Referenz erweisen. (Der Verfasser). 34 lat. "Wie trügerisch ist die Hoffnung der Menschen." 35 lat. "Fromme Wünsche!" 63 auch an seinen Fersen. Areznitz konnte er nicht um Hilfe angehen, da er ja diesen mit dem Platinschmuggel massiv betrogen hatte. Blieb nur zu hoffen, dass die Sache nicht aufflog, bevor er das Plutonium unter Dach hatte. Der erste Schlag traf ihn, als er von Regaz mit sofortiger Wirkung seines Amtes als Chef der Metallica enthoben wurde. Dann verlor er die Lizenz für die Metallbörse. Ein Verfahren gegen ihn wurde in Aussicht gestellt. Als er am Tag nach seiner Suspendierung in sein Büro kam, waren seine sämtlichen Akten verschwunden. "Die wurden durch eine Frau Brügger persönlich abgeholt. Sie sei vom Staatsschutz, hat sie gesagt und sich auch ausgewiesen. Ich nehme an du kennst sie? Hätte ich dich benachrichtigen sollen?", fragte ihn naiv sein Büronachbar. "Ach wieso auch, ich brauche den ganzen Krempel sowieso nicht mehr und Frau Brügger steht auf solche Raritäten. Ich glaube, sie sammelt sie. Die Akten wird sie in ihr Album kleben, und damit hat's sich. Jedenfalls habe ich noch nie gehört, dass sie für konfiszierte Papiere Verwendung gefunden hat", erwiderte er dem verdutzten Kollegen. Er schloss sich in sein leeres Büro ein und schaute wehmütig durch sein geliebtes Fenster. Sein Telefon klingelte. Er nahm den Anruf entgegen und setzte sich in den kleinen Fauteuil am Fenster. Am andern Ende der Leitung war Jill. "Max, ich versuche dich schon die ganze Zeit zu erreichen. Die Sache in Finnland ist aufgeflogen. Die dortige Polizei hat uns mitgeteilt, dass Boris Lattem anonym angezeigt worden sei. Er ist aber weg und vom Plutonium fehlt nach wie vor jede Spur. Wir haben herausgefunden, dass auch Reck und seine zwei Gesellen spurlos verschwunden sind, wahrscheinlich abgehauen mit dem Platin. Was hast du? Du lachst so komisch!" Salg versuchte sich mit aller Kraft zu beherrschen. Nur jetzt nicht zusammenbrechen, noch nicht. "Ich bin noch dran Jill. Mir geht es gut, jedenfalls den Umständen entsprechend. Ich möchte dich heute abend zum Essen einladen. Eine kleine Feier zum Abschluss unserer Geschäftsbeziehungen. Bitte sag nicht nein!" "Einverstanden", sagte Jill nach kurzem Zögern. "Treffen wir uns im Bistro, um 20 Uhr." Die Fensterscheibe in seinem Büro hätte er gerne durch eine andere ersetzen und zu sich nach Hause bringen lassen. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass nach ihm jemand anders ihre erregende Kühle erfahren könnte. Obwohl er das Fenster mit Klebstreifen, Leim und Fettstiften verunstaltete, konnte er sich beim Hauswart nicht durchsetzen. Dieser schimpfte nur über das Geschmier. Über Salgs Vorschlag schüttelte er verständnislos den Kopf und begann die Scheibe mit einem, wie er sagte, Wundermittel zu bearbeiten. Salg rannte aus dem Büro und übergab sich in der Toilette. In einer Glasbläserei neben der ETH beschaffte er sich Flusssäure, mit dem der die Scheibe unter Tränen verätzte, nachdem sich der Abwart verzogen hatte. Notfalls hätte Salg sogar eine Briefbeschwererkugel durch seine Scheibe geworfen. Als sich Jill und Max am Abend trafen, ahnte sie nicht, was Max an diesem Tage bereits durchgemacht hatte. Sie fand ihn sogar erstaunlich aufgestellt. Max schaute ihr heute besonders tief und verlangend in die Brille. Im Bistro an der Stauffacherstrasse assen sie Langusten. Immer wieder gelang es Max beim Zerlegen der roten Köstlichkeit, Spritzer auf Jills Brille zu landen. Er bearbeitete die Gläser dann umständlich mit seinem Reinigungstuch. Dabei steigerte er sich in immer grössere Erregung. Das entging nicht einmal der kurzsichtigen Jill. Langsam wurde es ihr richtig peinlich. "Unsere geschäftlichen Beziehungen sind nun beendet", sagte sie sachlich und verlangte die Rechnung. "Damit enden auch unsere Nachrichtensendungen", fügte sie emotionslos bei." Max versuchte zu retten, was nicht mehr zu retten war. "Zum Abschied lade ich dich bei mir zu Hause zu einem Château d'Yquem 67 ein", sagte er beinahe tonlos. Er setzte alles auf diese Karte, denn er wusste, dass sie Weine liebte und sich darauf verstand. "Du musst wahnsinnig sein, dieser Sauternes gehört ja zu den teuersten Weinen der Welt" rief sie begeistert aus. "Ich weiss, dass du einen kostbaren Weinkeller hast, aber so etwas! Woher hast du diese Rarität? Ich habe mir bis heute noch nie mehr als einen Château de Fargues leisten können, den Yquem der armen Leute." Jill liess sich nicht zwei Mal bitten. Bei der Aussicht auf diese Gaumenfreude hatte sie es mit dem Abschied nicht mehr so eilig. Am Ende dieser Nacht würde sie sich ohnehin von Max zurückziehen und endgültig aus seinem Leben verschwinden. Zu Fuss wanderten sie über das Central und das belebte Niederdorf seiner Altstadtwohnung an der Froschaugasse zu. "Ich habe die Flasche vor einigen Jahren von einem Geschäftspartner gekriegt, der mir viel zu verdanken hat," log Max. In Wahrheit hatte er die sündhaft teure Flasche kürzlich in einer Wein64 handlung im Kanton Aargau erstanden. Er liebte diese Weinhandlung wegen der properen Art, wie die Flaschen im Verkaufsraum präsentiert werden. An einem Samstag ist er dahin gefahren. Den Ständen mit den Degustationsangeboten hat er kaum Beachtung geschenkt. Er ist sofort nach hinten gegangen zu den alten Jahrgängen und Raritäten. Beim Betrachten und Befühlen der verschiedenen kleinen und grossen, dicken und eleganten Weingebinde ist er plötzlich vor diesem unscheinbaren 5 dl Fläschchen in Verzückung geraten. Schon über 20 Jahre hatte dieser süsse gelbe Tropfen, der wie flüssiges Gold aussah, in dieser Flasche verbracht. Glas ist das durchsichtige Grab der alten Weine, dachte er. Da ist ihm aus den Mundwinkeln etwas Speichel geflossen. Er hat ihn rasch mit den Jackenärmeln weggewischt, als ihn ein Verkäufer ansprach. Die Flasche hat er gekauft, ohne nach dem Preis zu fragen. Verstohlen schielte Salg auf Jills dicke Brillengläser. Sie glänzten im Lichte der Strassenlampen und Leuchtreklamen. Er wurde immer erregter. Erst als sie von der belebten Niederdorfstrasse in die stillere Froschaugasse abzweigten, beruhigte er sich etwas. Hier fühlte er sich geborgener. Er ging jetzt ganz langsam, und Jill musste nicht mehr neben ihm herrennen. Sein Energiefeld begann die Gasse auszufüllen. Es schmiegte sich an die Hauswände. Sachte übte es Druck aus auf die Schaufenster und die Fenster der Wohnungen. Doch das Glas hielt stand. Mit dem Etagenlift fuhren sie direkt in seine Wohnung. Seine geröteten Augen blickten Jill aus dem Spiegel der engen aufwärtsfahrenden Zelle an, sie sagte aber nichts. Plötzlich kehrte seine Erregung zurück. Sie spürte, wie er sich zurückhalten musste. Zuerst mit dem einen, dann mit dem andern Jackenärmel wischte er seinen Mund ab. Ihr wurde es unheimlich und sie musste an den ruhigen Lauf des Flusses denken. "Ich bleibe aber nur kurz", sagte sie. Die Lifttür öffnete sich direkt in die Wohnung und wie von Geisterhand ging das Licht an. Jill stiess vor Überraschung einen Schrei aus. Das hatte sie nicht erwartet. Sie vermeinte sich in eine Kristallhöhle versetzt. Alle Innenwände der Wohnung bestanden aus Glas. Die Decke war ein einziger Spiegel. Den Boden belegten lichtdurchflutete Glasbausteine. Die grüne, ovale Platte des Tisches stand auf glänzenden Aluminiumfüssen. Auf ihm lag ein gläserner Batist. Die vier Stühle hatten Lehnen aus elegant gebogenem, graugetöntem Bakelit und taftbezogene Sitze. Auf durchsichtigen Regalen gab es Schalen mit Schwefelsilber, Tektit, Glasperlen, Edelsteinen, Splitter von zerbombten Kirchenfenstern und Glasaugen. Überall standen Glaswaren: Kristallglas aus Böhmen, farbiges Kunstglas aus Murano, Handgeblasenes aus allen berühmten Manufakturen der Welt, aber auch rohes Industrie- und geschliffenes Optikerglas. Durch die gläsernen Wände hindurch sah sie die schwarzgekachelte Küchenwand, an der eine Hinterglasmalerei neben einem Glasdruck hing. Im Raum links davon stand die durchsichtige Badewanne. Durch eine andere Wand wurde ein Bett sichtbar, das dem Sarg von Schneewittchen bei den Sieben Zwergen glich. Von der Decke herabhängende Glasäpfel verstärkten diesen Eindruck. Plötzlich verschwanden Küche, Bad und Zimmer. Max hatte durch Druck auf einige Knöpfe das Licht anders gesteuert. Mitten im Wohnraum stand ganz allein ein aufgeblasener Fauteuil aus durchsichtigem Kunststoff. Sie plumpste überwältigt hinein. "So wohnst Du also!", sagte sie völlig erschlagen. "Ja meine Liebe, das ist mein Reich und meine Herrlichkeit, ich hoffe es gefällt dir." Im Hintergrund ertönte leise die Musik einer Glasharfe. An der Wand gegenüber von Jill öffnete Max eine Art Tabernakel aus Bergkristall. Hinter der Tür stand die versprochene kostbare Flasche mit dem öliggelben Inhalt. Max beugte sich wie ein Priester am Altar und küsste die Konsole mit dem Schrein darauf. Mit beiden Händen nahm er die Flasche und kehrte sich mit ihr gegen Jill um. Diese versuchte mit einem Rülpser dem Augenblick die Weihe zu nehmen. Vor dem Rauchquarztischchen neben Jills Sessel kniete Max nieder und stellte die Flasche darauf. Dann stand er auf, ging zur Küche und kehrte mit zwei Kelchgläsern und einem Pressluftflaschenöffner zurück. Mit seiner Nadel durchbohrte er den Korken und pumpte langsam Luft in die Flasche. Welch überwältigendes Gefühl, eine Flasche so zu entkorken! Genussvoll pumpte er seine eigene Energie durch den Zapfen. Er spürte den Innendruck auf das Glas und wie er mit jedem Kolbendruck stärker wurde. Er ahnte die Kraft auf den Flaschenboden, welche dieser dank seiner konkaven Form auf die Wand übertrug. Langsam hob sich der Zapfen und als er nachgab spürte er eine ungeheure Erleichterung. "Schadet das dem Wein nicht?", fragte Jill mehr auf Ablenkung bedacht als aus Interesse. "Ich liebe die Vorstellung vom Druck der Flüssigkeit auf das starke Glas", sagte er wie erwachend. "Wie beneide ich den bösen Flaschengeist in der vom Siegel Salomons verschlossenen Flasche. Es wird behauptet, er habe über Jahrhunderte auf seine Befreiung gewartet. Das stimmt nicht!", 65 keifte er. "Die Wahrheit ist, dass er sich vom Fischer noch so gerne übertölpeln liess, in die Geborgenheit seiner Enge und Verlassenheit zurückzukehren." Der Kerl spinnt völlig, dachte Jill und versuchte es nochmals mit einem Rülpser. Max schenkte ein und reichte ihr eines der Gläser. "Sieht aus wie Pferdepisse", bemerkte Jill respektlos. "Ich habe den Geist befreit. Er sehnt sich nach der Geborgenheit eines neuen Verlieses", erwiderte er abwesend. "Auf unsere gemeinsame Zeit und auf den Abschied", sagte sie und streckte ihm das Glas entgegen. "Lasset uns knien", schlug er vor. "..und lasset uns, es hinter uns bringen", ergänzte sie, schob ihren Körper über die nach hinten angewinkelten Beine und setzte sich vor dem Fauteuil auf ihre Waden. Immer noch stehend hob er seinen Kelch mit beiden Händen hoch über den Kopf. Mit dem linken Handrücken nach oben hielt er dessen Boden umklammert, seine Rechte schmiegte sich in gespiegelter Haltung an die Rundung des Gefässes, wie Kelchblätter an die Blüte. "Fehlt ja nur noch Parzifal", höhnte Jill. "Wagners Parzifal", verkündete er feierlich und betätigte den Knopf der Fernsteuerung. "Geschmacksgenie", bemerkte sie angewidert. Ohne weiter auf sein Ritual zu achten, versuchte sie den Duft, der ihrem Glas entstieg, in sich aufzunehmen. Unter andern Voraussetzungen wäre das für sie ein Augenblick höchsten Glückes gewesen. Da sie aber merkte, dass sie nicht im Stande war zu geniessen, leerte sie das Glas in einem Zug. Dann stellte sie es leer auf den Kristalltisch zu ihrer Linken. Max hatte sich inzwischen so nahe vor ihr hingekniet, dass sie sich nicht mehr auf den Sessel zurückziehen konnte. "Botrytis cinerea, der mächtige Schimmelpilz! Er bildet sich in den milden Nebelnächten auf den Trauben aus, greift in der Wärme des Tages rasch um sich und verwandelt die Beeren in eine weiche, braune Masse", zitierte er auswendig den Etikettentext auf der Flasche. Fassungslos blickte sie durch ihre dicken Brillengläser in sein gerötetes Gesicht. "Dring in mich, uralter Geist", stöhnte er und leerte sein Glas bis zur Neige. "Du bist nun gefangen in mir, edler Wein", schrie er, "spüre meine Macht, ich will dir Grenze sein auf ewig." Seine rechte Hand drückte den Kelch so stark, dass er in tausend Scherben zersprang. Mit der anderen Hand umfasste er immer noch den Fuss des Glases, den Handrücken weiterhin nach oben gerichtet. Er packte Jill im Haarknoten hinter dem Genick. Sie spürte, wie der sonst so schwammige Max hart und steif wurde. Er zog Jills Kopf trotz ihrer heftigen Gegenwehr mit beiden Händen gegen sein machtbesessenes Gesicht. Sie spürte den runden Boden seines zerbrochenen Kelchs auf ihrer Nackenhaut. "Hör auf", kreischte sie, obwohl sie wusste, dass sie keine Chance hatte. Salg wurde zu Glas. Mit aller Kraft zog Jill den gläsernen Max über sich auf den Sessel hinter ihr. Der abgebrochene Stiel, der zwischen Salgs Zeig- und Mittelfinger aus Jills Nacken zu ragen schien, bohrte sich in den aufgeblasenen Plastiksessel. Mit einem gewaltigen Furz begann die Luft aus ihm herauszuströmen. Salgs Starre löste sich, nicht aber sein Griff. Er näherte seinen Mund lüstern dem Gesicht von Jill, unter deren Rücken der Sessel seinen Geist aushauchte. "Das darf doch nicht wahr sein", entfuhr es ihr. Max war an sein Ziel gekommen. Er liess Jill los. Sie sah noch die Bügel ihrer Brille wie die Flügel eines grossen Insekts aus Salgs Munde ragen , bevor das grauenhafte Bild im Nebel ihrer Kurzsichtigkeit verschwand. Max wälzte sich auf die Seite und landete auf dem Rücken. Mit strampelnden Beinen zerbiss, zerkleinerte und zerkaute er Jills dicke Brillengläser mit seinen Zähnen. Er würgte die Glasreste hinunter. Blut lief aus seinen Mundwinkeln. "Mutter", lallte er, bevor sein vergiftetes Herz versagte und seine Augen glasig brachen. Seine Gehirnaktivität verlor sich im Spiegelsaal des Todes. Salg wurde in den Spiegeln dupliziert und in den gleichseitigen Anordnungen der Spiegeldreifaltigkeiten vervielfacht. Sein Da-sein schloss sich verewigfacht zwischen parallelen Spiegelflächen zum unendlichen Kreis, gelangte in die überdimensionale Spiegelkugel des Ichs, durchdrang jeden einzelnen Punkt dieses Hohlkörpers, reflektierte sich noch mehrfach an der Aussenwölbung und blasste aus als reine Illusion. 66 Rückkehr Etwa 50 Meter vor Märta Siltanen tauchte plötzlich der Kopf eines Fischotters auf. Schnell drosselte sie den Motor und liess das Boot treiben. Das Köpfchen mit der spitzen Schnauze und den langen Schnauzhaaren verschwand unter Wasser. Aufmerksam suchte sie die Wasserfläche rund um das Boot ab. Richtig, nach einigen Minuten tauchte das kleine Gesicht mit den, wie ihr schien, traurigen Augen wieder auf, diesmal rechts vom Boot. Noch ein paar Mal wartete sie auf das Auftauchen des offensichtlich neugierigen Tieres. Der letzte Windhauch des Tages trieb sie in die Bucht. Es roch nach faulen Fischen. Eine aufgeschreckte Möve überflog sie kreischend. Sie setzte die Riemen in die Ösen und lenkte ihr Boot durch das hohe Schilf zwischen die Steine und ging an Land. Langsam stieg sie über das von Nässe vollgesaugte Moos die Anhöhe hinauf, vorbei an einem verdorrten Baumstamm. Sein grauer von Wind und Wetter gemarterte Stamm weinte Holzmehl. Ein Ameisenzug querte ihren Weg. Sie blieb stehen und verlor sich in der Beobachtung der emsigen Insekten. Sie tragen Kiefernadeln und andere Pflanzenreste herum, kommentierte Siltanen. Sie schleppen halbtote Käfer oder rennen scheinbar ziellos hin und her. Die Richtung, die sie einschlagen, hat keine Bedeutung, da sie bloss auf dem leergefegten Weg bleiben. Ihre schmale Strasse endet an jedem ihrer Enden in einem krabbelnden Haufen. Auf der andern Seite der Haufens geht es weiter zum nächsten Haufen, bis ein Kreis geschlossen ist, der um den ganzen Hügel geht. Sie trat näher heran. "Ihr irrt bloss von einem Haufen zum andern. Kaum habt ihr den einen verlassen, glaubt ihr schon, ihr hättet die Freiheit gewonnen und rennt doch nur wieder auf den nächsten zu. Immer nur im Kreis herum läuft ihr. Obwohl ihr kämpft und strebt, kommt ihr doch nicht vom Fleck. Es gibt kein Entrinnen für euch!", bedauerte sie laut die kleinen Tiere. Ihre Gedanken schweiften ab und verloren sich in der Vergangenheit: "Ich bin vom vorgespurten Pfad, den sie nicht verlassen konnten, hups, einfach weggeflogen, weil ich mir Flügel wachsen liess", dachte sie stolz und breitete die Arme aus. Eine vom Wege abgekommene Ameise pisste auf ihre Haut. "Willst du mich der Lüge strafen? Das sollst du mir büssen!" Mit dem Finger zerquetschte sie das Insekt auf ihrem nackten Knie. Neben dem umgefallenen Dreibein weiter oben setzte sie sich und lehnte sich müde an das morsche Holzgerippe, das von der Richtbacke übrig geblieben war. Ein warmer Harzgeruch erfüllte die Luft. Die Herbststürme werden ihn wegblasen. Plötzlich dachte sie wehmütig an den kleinen verrückten Mann mit der Narbe im Gesicht. Wo er wohl geblieben ist? Wohin nur hat er sein Ei geschleppt auf seinem mageren Buckel? Über dem Wasser zwischen zwei fernen Inseln stand die Sonne jetzt blutrot über dem nördlichen Horizont. Ein langer Tag ging mit einem der endlosen Abende, denen hier in dieser Jahreszeit keine Nächte folgen, zu Ende. Sie fühlte sich als Teil eines jener unzähligen Fotos, die alle als kitschig bezeichnen, obwohl sie nichts anderes zeigen als die Realität. Eine Weile noch blieb sie unbeweglich sitzen. Dann kehrte sie zurück zum Boot und ruderte weg von der erdbeerförmigen Insel. Märta Siltanen zog die Ruder ein. Das Wasser war hier so ruhig, dass sie plötzlich das Gefühl hatte, auf einer metallenen Platte zu gleiten. Sie versuchte sich mit der Seekarte zu orientieren. Doch die Karte verschmolz mit der Welt um sie herum. Plötzlich wusste sie nicht mehr, was wirklicher war, das schwarze Platin des sie umgebenden Wassers, der gläserne Himmel auf der spiegelnden Kartenfläche oder sie selbst und ihr Boot. Ein deltaförmiges Insekt aus dem Schilf stach sie schmerzhaft in den Hals. Sie startete den Motor und fuhr ohne sich umzublicken dem Festland zu. 67