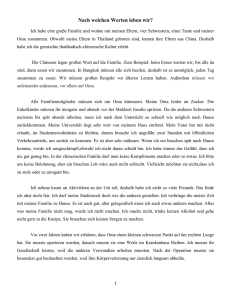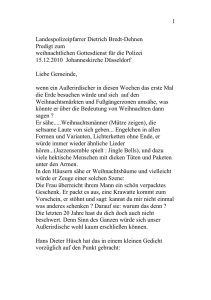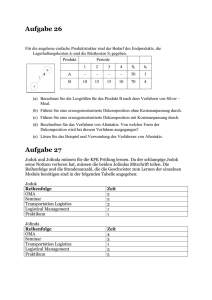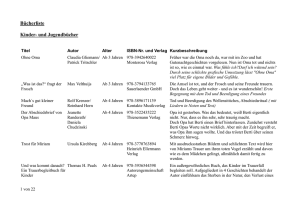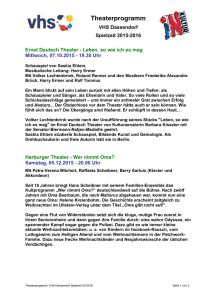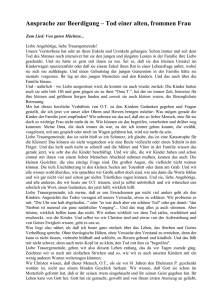Der Sommer der Liebe
Werbung
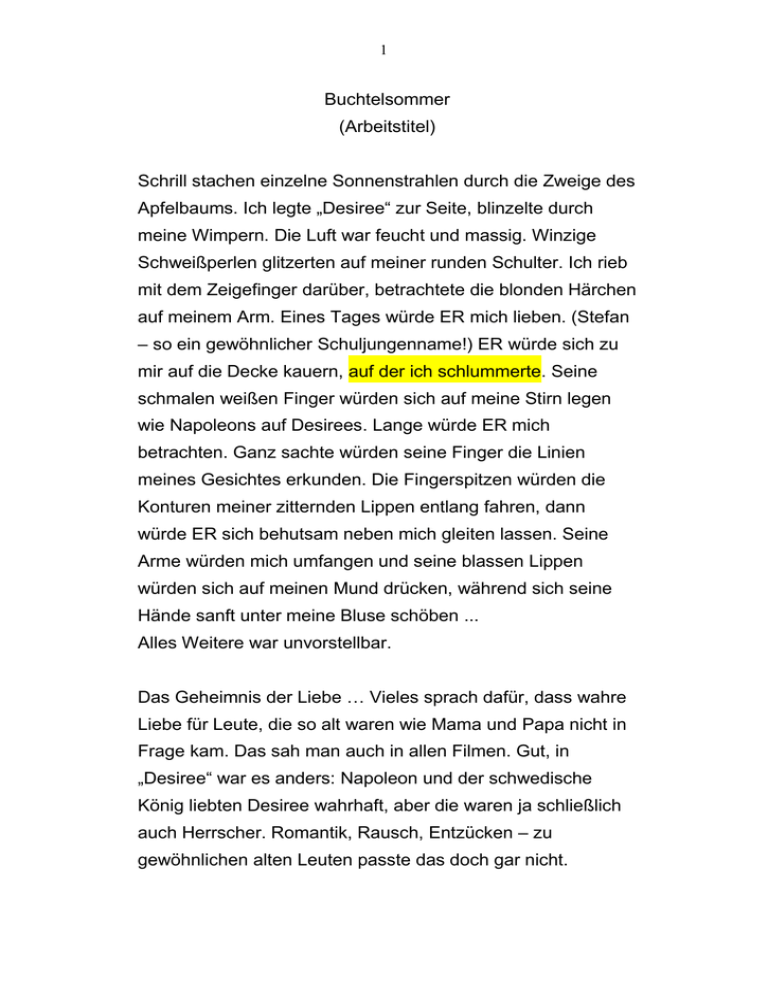
1 Buchtelsommer (Arbeitstitel) Schrill stachen einzelne Sonnenstrahlen durch die Zweige des Apfelbaums. Ich legte „Desiree“ zur Seite, blinzelte durch meine Wimpern. Die Luft war feucht und massig. Winzige Schweißperlen glitzerten auf meiner runden Schulter. Ich rieb mit dem Zeigefinger darüber, betrachtete die blonden Härchen auf meinem Arm. Eines Tages würde ER mich lieben. (Stefan – so ein gewöhnlicher Schuljungenname!) ER würde sich zu mir auf die Decke kauern, auf der ich schlummerte. Seine schmalen weißen Finger würden sich auf meine Stirn legen wie Napoleons auf Desirees. Lange würde ER mich betrachten. Ganz sachte würden seine Finger die Linien meines Gesichtes erkunden. Die Fingerspitzen würden die Konturen meiner zitternden Lippen entlang fahren, dann würde ER sich behutsam neben mich gleiten lassen. Seine Arme würden mich umfangen und seine blassen Lippen würden sich auf meinen Mund drücken, während sich seine Hände sanft unter meine Bluse schöben ... Alles Weitere war unvorstellbar. Das Geheimnis der Liebe … Vieles sprach dafür, dass wahre Liebe für Leute, die so alt waren wie Mama und Papa nicht in Frage kam. Das sah man auch in allen Filmen. Gut, in „Desiree“ war es anders: Napoleon und der schwedische König liebten Desiree wahrhaft, aber die waren ja schließlich auch Herrscher. Romantik, Rausch, Entzücken – zu gewöhnlichen alten Leuten passte das doch gar nicht. 2 „Liebst Du Mama?“ Mager, schwitzend und mit einem geknoteten Herrentaschentuch auf der Glatze stand Papa vor dem Häcksler, in den er Holzabfälle stopfte. „Was?“ Ich musste die Frage zweimal wiederholen, bevor er abschaltete. „Warum willst Du das wissen?" Er wühlte in dem Holzhaufen. „Ich hab keine Zeit. Frag Deine Mutter.“ Er warf eine Handvoll Äste in die Maschine, dann schaltete er den Häcksler wieder an. Egal was ich fragte, er sagte fast immer: „Frag deine Mutter.“ Mama bügelte. Es war dämmerig und feucht in der Waschküche. Im Sommer wurden alle Vorhänge zugezogen. Die Wäsche roch süß und warm. „Liebst Du Papa?" Ihr Bügeleisen strich unablässig über Schlüpfer oder Geschirrtücher. An ihrem dünnen linken Unterschenkel trat eine Ader blau hervor. Ihr Hemdblusenkleid schlotterte um ihre knochigen Hüften. Sie blickte Richtung Garten: „Was hat er gesagt?“ „Ich soll dich fragen.“ Sie blies eine Ponysträhne aus dem Gesicht: „Das mit der Liebe ...“ Mit gerunzelter Stirn starrte sie auf einen Berg Taschentücher: „Es ist anders als du glaubst – komplizierter, nicht so einfach.“ Sie zog den Stecker aus der Steckdose: „Verliebtheit geht vorüber ...“. Ihr Lächeln sah müde aus: „Das wirst du alles selber merken. Wichtig ist, man kommt miteinander aus.“ Unruhig streifte ich durch die dämmerigen Zimmer, auf der Suche nach Spuren der Liebe. Schillernde Fliegen rummsten gegen die Fensterscheiben. In Papas Zimmer auf seiner schmalen Cordliege lag ein Stapel alter Spiegel-Magazine, Kreuzworträtsel und Gartenkataloge. In der Ecke stand, noch 3 unausgepackt, der Rasenbelüfter, den Mama ihm zum Geburtstag geschenkt hatte; unter dem Schrank blitzten, ordentlich aufgereiht, drei Paar schwarze Herrenschuhe. Nur ein Foto stand auf der sonst kahlen Schreibtischplatte: Mischka, unsere schwarze Katze, silbergerahmt. Ich öffnete die Türen darunter und betrachtete die beiden Reihen mit Leitzordnern: Auto. Haus. Versicherungen. Steuer … Ich zog einen heraus. Ungeduldig schob ich die übrigen mit den Händen auseinander, erst nach rechts, dann nach links. Nichts. Keine Briefe, keine Hefte, keine Tagebücher, nicht der kleinste handgeschriebene Brief. Ich klappte die Türen zu. Ich war mir sicher, wenn ER mich erst liebte, würde ER mir Liebesbriefe schreiben: kleine Zettelchen mit romantischen Botschaften, vielleicht selbst verfasste Gedichte, mir – seinem Samtfalter, seinem Orangenhauch, seiner leinenweißen Lilienblüte … In Mamas Zimmer räkelte sich Mischka auf dem Bett. Die Streublümchendecke war sorgfältig glatt gezogen. Ich schnickte Mischka mit dem Finger in den Bauch bis sie aufsprang und beleidigt hinaus stolzierte. Dann streckte ich mich auf dem Bett aus. Als ich klein war, hatte ich hier liegen dürfen, wenn ich krank war; hatte im leichten Fieberdunst die Bilder angestarrt, bis mir die Augen zufielen und mich wirre Verfolgungsträume packten. Dabei gab es an den Wänden kaum etwas zu sehen: Ein bräunliches Foto von einer langweiligen Dorfstraße, das einzige Foto von „Zuhause“, das sie über die Flucht hatten retten können. Im Vordergrund stand vor einem niedrigen Siedlungshaus ein steif aufgerichteter Mann in Uniform mit Säbel, der grimmig in die Kamera blickte, mein Großvater in Ausgehuniform. Außerdem ein Ölbild, eine Vase Margariten, goldgerahmt, das Mama und 4 Papa zur Hochzeit bekommen hatten und schließlich Mamas wichtigstes Foto. So lange ich denken konnte, hing es am Fußende ihres Bettes: das auf Din-A-4 vergrößerte schwarzweiß Bild von zwei jüngeren Männern in Uniform, Mamas beiden Brüdern Paul und Gerhard, die auch „im Krieg geblieben waren“, wie Oma immer sagte, wenn Mama nicht in der Nähe war. Sie sahen hager und ernst aus wie Mama. Keiner war so rund und klein wie Oma und ich. Ich kniete mich hin und nahm es von der Wand. Gerhard blickte mich durch eine silberne Brille mit Eulenaugen an. Er lächelte nicht, aber er sah freundlich aus und ein wenig traurig. Weil er seine Uniformmütze unter dem Arm trug, konnte man sehen, dass er an der gleichen Stelle wie ich einen Wirbel hatte: oben rechts am Scheitel. Die dunklen, leicht gewellten Haare bildeten auch bei ihm eine Art Strudel. Das war die einzige Ähnlichkeit. Ich wusste schon sehr lange, dass ich vor Mama nicht davon sprechen durfte, dass Gerhard tot war. Er war „in Russland verschollen“. Deshalb kamen auch manchmal, selten, noch Briefe vom Deutschen Roten Kreuz, die Mama mit immer neuen handschriftlichen Briefen beantwortete: Suchanträge, wie Oma mir schon als Kind erklärt hatte. Mama bräuchte das, wo sie doch sonst beide keine Brücke mehr hätten zu „Früher“: diesen Briefwechsel mit dem Roten Kreuz, außerdem ihr Heimatblatt, eine Vertriebenenzeitung, die einmal im Monat kam und natürlich „Hartmuts Brief“, den sie fast immer in ihrer Schürzentasche trug. Niemand kannte diesen Hartmut bis vor bald zwanzig Jahren ein Brief von ihm angekommen war. Er schrieb nach seiner Entlassung aus russischer Gefangenschaft, dass er mit Gerhard zusammen in derselben Kompanie gewesen sei, vor allem aber, dass er 5 „fast sicher“ sei, dass „der Iwan auch Gerhard mitgenommen hatte – rein in die Laster, Richtung Sibirien“. Für Mama war das fast schon ein Beweis, dass Gerhard noch irgendwo lebte, dabei war es ihr nie gelungen, auch nur Kontakt zu diesem unbekannten Hartmut herzustellen, von dem auch das Rote Kreuz gar nichts wusste. Mama sprach immer nur von „Gerhard“, nie von „Onkel Gerhard“ so wie von ihrem anderen toten Bruder „Onkel Paul“, der zehn Jahre älter gewesen war als ihr Gerhard. Auf dem Foto sah dieser Onkel allerdings tatsächlich fremd und streng aus. Einmal hatte Mama erzählt, dass er immer eine kleine Ledergerte bei sich trug und dass er, wenn ihr Vater „im Feld“ war, immer „versucht habe sie zu erziehen“. Gerhard sei ihr dann oft „beigesprungen“. Einfach nur „Gerhard“. Das hatte etwas Verschworenes, als sei er in Wahrheit nicht bloß ihr Bruder sondern unser gemeinsamer. Mama sagte ja auch immer: „Er ist bei uns. Ich spür´s. Irgendwo hier ist er.“ Und dann blickte sie sich um, als trete er gleich aus dem Schrank, in dem ich mich, als ich noch klein war, oft versteckt hatte. „Eine wie du, die wäre nach Gerhards Geschmack gewesen“, sagte sie oft: „Du hättest ihm imponiert: dein Mut, überhaupt das Sportliche“, dabei hatte es Mama nie ertragen können, wenn ich als Kind etwas tat, das auch nur die kleinste Verletzungsgefahr barg. Also hatte ich dafür gesorgt, dass ich beim Spielen möglichst unbeobachtet blieb. Ich war oft mit dem Rad in den Wald gefahren, um dort Riesenbäume zu bezwingen oder mir aus Ästen und Brettern meine geheime Bude zu bauen. Da war es dann nur gut gewesen, dass zumindest Gerhard dabei war, Gerhard mit meinem Haarwirbel und der Eulenaugenbrille, der unsichtbar im Geäst saß und auf mich aufpasste. Mit ihm konnte ich reden, 6 während ich die riesigen Äste durchs Laub zerrte und zeltförmig um eine alte Blutbuche schichtete, während ich meine Hütte mit Blättern und Zweigen tarnte, ja, sie komplett verschwinden ließ. Er war es, der mir Gesellschaft leistete, wenn ich in meiner Höhle, in der nur das sanfte Rauschen des Windes eindrang, zusammengekauert saß und mir vorstellte, ich sei eine gefangene Squaw, die auf ihre Befreiung wartete, eine Prinzessin, die verwandelt wurde in ein gejagtes Reh, eine Agentin, die letzte Vorbereitungen traf für ihren Weltrettenden Einsatz … Er war mein Aufpasser, mein Freund, mein Trainer: „Na? Gesehen?“ hatte ich ihm, festgeklammert an einen Zweig, zugerufen, wenn ich es mal wieder geschafft hatte, von meiner Lieblingseiche in einem Sprung auf die Weide gewechselt war. „Da staunst du, was? – Na gut: dann eben nochmal … wenn`s sein muss.“ Nur für ihn hatte ich es gewagt, hatte mich noch einmal mit gereckten Armen und Herzklopfen dem dünnen Ast auf der anderen Seite des Abgrunds entgegen gestürzt. Auch den Bänkelauf im Stadtpark hätte ich doch ohne ihn niemals in Angriff genommen. Kurz vor meinem achten Geburtstag war es, als ich ihn zum ersten Mal fehlerfrei schaffte. Neun Parkbänke hintereinander im Abstand von mindestens anderthalb Metern: über die Bank laufen, springen, ein Riesenschritt auf der Bank, abstoßen, springen, ein Schritt … keine leichte Sache. Es hatte unzählige blaue Flecken an den Schienbeinen und aufgeschürfte Knie gebraucht, bis ich soweit war. Ich hätte es so gerne einmal Mama oder Papa gezeigt, aber das war unmöglich. Das Betreten der Bänke war verboten. Auf jeder Bank ein Messingschild: Diese Bank wurde gespendet von SpielwarenLübke, von der Bäckerei Husselbach, vom Modesalon 7 Oskötter … Und wenn zum Beispiel Husselbachs gesehen hätten, wie ich ihre Bank verdreckte ... Aber Gerhard, das hatte ich als Kind immer gewusst, der war stolz auf mich! Ich rubbelte mit dem Rockstoff meinen Daumenabdruck vom Glas, hing das Bild wieder auf und zog die Decke glatt. Als ich in der Tür stand, blickte ich mich noch einmal um. Es war mir zuvor nie aufgefallen: Von mir oder Papa hing kein Bild in ihrem Zimmer, auch nicht von Oma. Oma saß auf der Terrasse, auf ihrem breiten Schoß einen Spankorb mit Brombeeren. Ihre Finger waren lila. Die bereits gereinigten Früchte leuchteten in einer Schüssel auf dem Tisch. Ich sah ihr zu, wie sie die Stiele abzupfte. „Da ist noch ein Korb.“ Sie deutete auf den Stuhl neben sich. Ich schob mir eine Haarsträhne in den Mund. Manchmal war es besser, nicht zu antworten. Oma war dick. Sie hatte ein Kleid mit großen gelben Blumen an, das ich noch nie an ihr gesehen hatte. Ich dachte an den grimmigen älteren Mann in Uniform auf Mamas Bild. „Hast Du Opa geliebt?" Ich nahm eine Handvoll Beeren, stopfte sie mir in den Mund. Sie blickte auf: „Du siehst ordinär aus. Wisch das ab.“ Ich hatte den Lippenstift schon vergessen, den ich heute früh in Mamas Kulturbeutel entdeckt und probeweise aufgetragen hatte. Ich ließ mich in den Gartenstuhl fallen. „Hast Du...?" Ihre Finger zupften unablässig weiter. „Dein Mund!“ Ich rubbelte ein bisschen darauf herum. “Das mit der Liebe war damals nicht so“, sagte sie. Sie schob die Stängelreste zusammen. „Warum willst Du das überhaupt wissen?" Oma betrachtet mich misstrauisch. „Er war jedenfalls ein ordentlicher Mann.“ 8 Ich konnte ihre Füße unter dem Tisch sehen: Breit und weiß mit schmalen Fesseln. Die Fußnägel waren grau vom Alter. An den Außenseiten hatten ihre Füße sonderbare Knubbel. Deshalb trug sie fast nur noch ihre Latschen. Mama sagte, die Knubbel kämen von den engen Schuhen in Omas Jugend. Ich sah sie immer vor mir, diese gefährlichen, Füße entstellenden Schuhe, die sie auf alten Fotos trug: elegante, sehr spitze Sandaletten mit Pfennigabsatz und winzigen Schnallen. Ich warf neidische Blicke auf Omas Füße, die so etwas hatten tragen dürfen. Meine Füße waren braungebrannt, klein und rund – „Patschen“ nannte Oma sie. Die anderen aus meiner Klasse trugen Schuhe mit Plateausohlen, aber ich war schon beim ersten Versuch mit den Dingern umgeknickt. „Hast du ihn nun geliebt?“ Oma stellte den nächsten Spankorb auf den Tisch, machte sich an die Arbeit. „Respekt, glaube mir, darauf kommt es an in der Ehe.“ „Hrmm", grunzte ich skeptisch und schob mir noch drei Brombeeren in den Mund. „Das waren andere Zeiten“, sagte Oma und zog die Beerenschüssel zu sich: „Meine Schwester war gestorben, und ihre beiden Jungs brauchten jemanden. Die waren noch klein. Da hat er mich gefragt und ich war einverstanden.“ Ich hörte auf zu kauen: „Wie? Er hat dich nicht aus Liebe geheiratet? Das hast du mitgemacht?“ Sie zupfte Stiele ab und blickte gedankenverloren in den Garten. „Er hat sich immer bedankt.“ „Wofür das denn?" „Na ja ... “ Sie knüllte das Zeitungspapier zusammen: „Nach dem Geschlechtlichen.“ Sie musterte mich: „Sag mal, blutest Du schon?“ Ich wurde sofort rot. 9 „Nein. Ähhh …“ Ich schob mir eine Haarsträhne in den Mund, nuschelte: „Doch.“ „Dacht ich´s doch.“ Sie stand auf. „Mama hat erst mit 17 geblutet. – Sie hat dir hoffentlich Vorlagen gekauft?“ Ich nickte. Zum Glück klingelte es an der Tür. „Oh, Herr Nowottny“, rief meine Oma und verschwand. Ich vergaß den Termin mit Herrn Nowottny jede Woche. Er war mein Klavierlehrer und ich sein hoffnungsloser Fall. Ich blieb einfach sitzen, lauschte seinem Gebalze im Flur und zog die Schüssel mit den Beeren näher ran. Er war alt und er roch nach Kölnischwasser. Angeblich war er mal berühmt gewesen, aber irgendwann hatte er einen Unfall gehabt. Seitdem hatte er nur noch neun Finger. Wo der Mittelfinger der rechten Hand sein sollte, war eine Art bläulicher Knoten, den ich beim Spielen immer anstarren musste. Ich stellte mir ungern vor, was für eine Art Unfall das wohl war. Wenn Mama nicht in der Nähe war, scharwenzelte er erst lange um Oma herum, bevor er nach mir rief. An diesen Tagen musste ich seltener „An der Saale hellem Strande“ spielen, bis die Stunde um war. Gleich würde er wieder etwas Perlendes anstimmen. Das tat er meist. Wie war das noch in meinem Lieblingsschmöker? Als Beethoven in Desirees Schloss zu Gast war und ihr auf dem Piano vorspielte, zitterten ihre Lippen vor Entzücken. Probeweise versuchte ich meine Lippen zittern zu lassen. Es war immer das Gleiche: Erst würde Herr Nowottny mit dem Fuß auf dem Teppich herumkratzen und sich verbeugen. Dann würde er Oma die Hand küssen – nass – man konnte den Fleck auf ihrer Haut sehen. Er sagte „Gnädige Frau“ zu ihr, und sprach über ihr Kleid oder ihr Haar. Anschließend 10 folgte etwas Perlendes auf dem Klavier. Er komponierte die Musik selbst. Die Finger flogen nur so über die Tasten, man vergaß völlig den zehnten Finger. Zum Ende hin folgten die tiefen Töne. Dabei schloss er die Augen. Dann stand er auf, strich sich die grauen Haare über die Glatze und verbeugte sich. Oma klatschte bewegt. Erst danach rief sie mit hoher verstellter Stimme: „Liebes, kommst Du...?" Sie übergab mich an ihn wie ein kostbares Präsent, beide Hände auf meinen Schultern. Dabei hasste sie es, wenn ich auf dem Klavier rumhackte. Er verabscheute es vermutlich ebenso. Ich hatte monatelang geglaubt, die beiden führten dieses sonderbare Theater nur auf, um die Zeit meines Klavierspiels zu verkürzen. Ich hielt es für ein geheimes Komplott zwischen uns Dreien. Ein augenzwinkerndes Spiel – für zehn Minuten weniger an grässlichem Geklimpere. Wenn ich die Tasten drückte, stellte ich mir immer vor, wie ich eines Tages mit IHM gemeinsam musizieren würde. Nur so war die Klavierstunde zu ertragen. Ich sah mich in einem rostroten Taftkleid am Flügel sitzen – das zerschrammte alte Klavier kam natürlich nicht in Frage -, mein bis dahin schulterlang gewachsenes Haar aufgetürmt zu einem kunstvollen Geflecht, an den Füßen schmale Schühchen mit Pfennigabsätzen, auf den, ohne Zweifel, sinnlichen Lippen ein elegisches Lächeln. ER, der Maestro (nicht mehr bloß der Geige spielende Sohn meines Gemeinschaftskundelehrers), stünde – natürlich ohne Brille – an den Flügel gelehnt, in der Hand die schimmernde rotgoldene Geige, sein blasses Gesicht über dem strengen Kragen leuchtete ergriffen … „Nein, nein, nein, so geht das nicht.“ Herr Nowottny packte 11 meine herumstümpernden Finger. Und schon war er wieder da, dieser Geruch nach Alter und Eau de Cologne und der dicke bläuliche Knoten, dort, wo ein Finger sein sollte. Er hatte die Tür ins Schloss fallen lassen und die Zinnuhr in der Diele zeigte immer noch erst halb elf. Ich hasste halb elf: Halb elf war flau, unentschieden und grausam. Kein Mittagessen in Sicht und alles Frische des Morgens vorüber. Halb elf war fast so schlimm wie halb fünf Uhr nachmittags. Und so still und so heiß war es, dass es sich anfühlte, als wäre das ganze Haus mit dickem Gelee angefüllt. Ich mochte eigentlich das Schwimmbad nicht. Ich mochte vor allem die nicht, die dort immer waren. Doch diesmal waren zum Glück die meisten aus meiner Klasse verreist. Am letzten Schultag hatten nur ich und die Zwillinge aus der Siedlung nicht die Hand gehoben, als die Lehrerin gefragt hatte, wer in den Sommerferien wegfuhr. Wahrscheinlich dachten alle, wir hätten nicht genug Geld, denn keiner hatte nach meinen Ferienplänen gefragt, als wir am Schultor auseinander gingen. Es war mir klar, dass Reisen für Mama nicht in Frage kam. Als ich bei einem Mittagessen an einem Sonntag kurz vor den Ferien gefragt hatte, ob wir nicht doch auch, löffelte sie einfach ungerührt ihre Erdbeeren weiter. Stattdessen sagte Papa, während er sorgfältig Früchte und Sahne auf seinem Dessertteller ordnete: „Ich komm genug herum. Du kannst es mir glauben: Zuhause ist es immer noch am schönsten.“ Da das offenbar niemand außer ihm fand, waren jetzt fast alle aus meiner Klasse weit weg. Heute würde ich einfach in Ruhe auf meinem Handtuch im Schwimmbad liegen und lesen können – außer natürlich … 12 Auf dem Weg ins Bad hatte ich mir alles haarklein ausgemalt: Wenn ER nun da war, wenn ER an diesem glutheißen Nachmittag auch würde schwimmen wollen, wenn ich IHN also dort unter Tausenden irgendwo auf einem Handtuch entdeckte … dann würde ich mich einfach so hinsetzen, dass ER auf dem Weg zum Becken an meinem Platz vorüber kommen musste. Dann würde ich warten, bis ER im Wasser wäre, würde schließlich mit einem eleganten Sprung in den Pool gleiten und ganz zufällig lachend neben ihm auftauchen. „Hey“, würde ich sagen, „bist du nicht der Stefan? Ich hab deinen Vater im Unterricht, wir kennen uns, glaube ich, auch aus der Kirche ...“ Und dann würde sich alles Weitere von selbst ergeben. Natürlich würde ER mich sofort erkennen. Seine Familie ging sonntags auch in den Vormittagsgottesdienst und saß meist rechts in der Kirchenbank hinter uns. ER beobachtete mich, auch auf dem Weg zur Kirche. Schon vor Monaten hatte ich zum ersten Mal diesen konzentrierten Blick in meinem Nacken gespürt. Besonders, wenn ich durch die Mittelreihe nach vorne ging zur Kommunion, oder danach, wenn ich mit verschleiertem Blick in der Bank kniete, die Handflächen aneinandergelegt, im „innigen Zwiegespräch mit Gott“, wie der Pfarrer im Firmunterricht gesagt hatte, fühlte ich: jetzt – genau jetzt – sah ER rüber zu mir. Nur die Hostie störte, weil sie immer am Gaumen festpappte. Kauen sah leider nicht sonderlich innig aus. Innig aber stand mir ausgesprochen gut. Ich hatte es im Spiegel überprüft. Bloß – jetzt war nicht Gottesdienst: Hier im Schwimmbad fühlte ich mich bloß noch dick und peinlich in dem kindlichen Blümchenbikini vom vorigen Jahr, der überall einschnitt. Unsicher stand ich vor dem schlierigen Spiegel, der neben dem Gang zu den Umkleiden hing und versuchte mich 13 zu trösten: Alle verreist. ER konnte gar nicht in der Stadt sein. Am liebsten hätte ich mich in meinem Bademantel versteckt, den ich aber natürlich ausgerechnet heute nicht mit hatte. Mein Bauch und meine Oberschenkel sahen speckig-weiß aus, weil ich in den letzten Wochen immer nur Kleider getragen hatte. Warum sollte ER auch heute, ausgerechnet heute, wenn ich ein einziges Mal im Jahr ins Schwimmbad ging, hier sein? Mein Handtuch war winzig, es reichte nicht mal ganz um meinen Bauch herum. Bestimmt sonnte er sich jetzt am Mittelmeerstrand oder an der Ostsee. Ich beugte mich vor, um einen Pickel rechts von meiner Nase zu begutachten – und begegnete seinem suchenden Blick im Spiegel. Erschrocken richtete ich mich auf und wandte mich mit rotem Kopf um: „Hallo“, murmelte ich und blickte in schutzlose, wasserhelle Augen. Irgendetwas war anders, aber vor Aufregung begriff ich nicht, was es war. „Hallo“, sagte er unsicher, auf seinem Hals zeigten sich Flecken. Er trug eine – noch trockene – Badehose, in seiner Hand zerknüllte er ein rosa Handtuch. Er wandte sich ab, tat ein paar Schritte in Richtung Pool. Ich folgte ihm. „Bist du nicht der Stefan?“ rief ich: „Ich glaub, ich habe deinen Vater in Gemeinschaftskunde.“ Er drehte sich um, schien ungefähr mein rechtes Ohr anzublicken. „Ehrlich?“, sagte er. Dann versuchte er, sein Handtuch um den Bauch zu knoten. „Ja, ehrlich. In der E.“ Sein Tuch war auch zu klein, es ging immer wieder auf. „ … Erster Stock.“ Ich hielt meines vor den eingezogenen Bauch: „ … Macht richtig Spaß. … Ich meine, sein Unterricht – wirklich interessant“. Seine Haut war nicht weniger weiß als meine. Er schien nicht oft herzukommen. Er 14 fummelte immer noch an dem Knoten herum. Ich fand, er könnte jetzt auch mal etwas sagen. Sein Tuch fiel in den Dreck. Er bückte sich. „… Entschuldigung“, murmelte er. Ich ging in die Knie, um ihm zu helfen. Er war schneller. Fast wären wir zusammen gestoßen. Er richtete sich auf, lächelte, versuchte erneut es festzuknoten. „Na, dann …“, sagte ich. Er hielt inne, starrte mich mit einem merkwürdig fragenden, intensiven Blick an. Ich zog den Bauch noch mehr ein. „Grüß ihn mal, ja?“ „Wen?“ „Na, deinen Vater.“ „In der E, sagtest du?“ „Ja, der E.“ Er blinzelte. Sein Mund stand leicht auf. Wir betrachteten einander. Dann nickte er. Ich nickte auch. „Ich glaub, ich muss dann auch …“ Ich stolperte den engen Gang zu den Umkleiden entlang, als hätte ich es plötzlich eilig. Am Ende schaute ich mich schnell um. Da sah ich ihn in der Sonne stehen. Etwas an seinem Anblick machte mich stutzig. Ich betrachtete ihn genauer: Er war nur ein paar Meter weit auf die Wiese gegangen. Das rosa Tuch jetzt als Knäuel in der Hand, stand er unschlüssig auf der Liegewiese herum, einen Fuß auf der Decke einer vielköpfigen italienischen Familie. Er blickte sich zwinkernd um. Wohin schaute er bloß? Hielt er etwa nach mir Ausschau? Aber er guckte doch direkt in den Spiegel? Warum lächelte er dann so merkwürdig? War das möglich? … – seine Brille! Er hatte ja seine Brille gar nicht auf. Wieso war mir das nicht gleich aufgefallen? Aber das hieß ja … – hatte er überhaupt den leisesten Schimmer, wer ich war?! 15 Ich verriegelte die Tür der Umkleide hinter mir, setzte mich auf die Holzbank. Nebenan greinte ein Kleinkind: „Will nicht, Mama, will nicht …“ Ich zog die Beine an und lehnte mich zurück. Es roch nach nassem Holz, Chlor und Kinderpipi. „Du SAU“, hatte jemand ins Holz geritzt und „Fotze“. Was tat ich hier? Am besten, ich zöge mich an und ginge nach Hause. „Du hörst jetzt, hast du verstanden?“ Wenn er jetzt seinem Vater von meinem fürchterlichen Auftritt erzählte? „Eine aus der E, eine Kleine, Dicke“, würde er sagen. Dass ich nicht groß und schön war, würde er auch ohne Brille gesehen haben. „Das Höschen, verdammt!“ Er würde sagen: „Wie heißt die noch? Ganz frech hat die mich angequatscht, als ich aus der Umkleide kam, stell dir vor, geschleimt hat die, wie toll du im Unterricht bist – peinlich, sage ich dir.“ Und seine Blicke in der Kirche? Nichts als Wunschphantasien. Hätte er mich nicht längst angesprochen, wenn er etwas gewollt hätte? … „Mama, mag nicht, Mama …“ Vielleicht redete er auch mit seiner Schwester darüber, die war in der F über mir und im selben Turnverein. Ich hatte ihre quäkige Stimme direkt im Ohr: „Nicht im Ernst – die kleine Nelly hat sich an dich rangemacht, das Pummelchen, das muss ich Karin erzählen“, bestimmt plapperte sie alles nach den Ferien auch noch im Verein herum. „Wirst du wohl ….“ Ein hallendes Klatschen. Das Kind schrie gotterbärmlich. „Das Höschen!“ Jemand klopfte hart gegen meine Tür. „Was macht ihr hier für Schweinereien?“ Das Klopfen wurde energischer. Der Bademeister, der kleine, kahlköpfige, bei dem ich den Freischwimmer gemacht hatte. „Das ist doch kein Puff!“ Bestimmt hatte er unter der Tür hindurch geguckt und keine Füße gesehen. „Rauskommen. Sofort!“ Ich stand auf, entriegelte. 16 „Entschuldigung“, murmelte ich und versuchte vergeblich, mich an seinem Bauch und seinem Schrubber vorbei zu drücken. „Mir war nicht gut.“ Er ließ mehrmals die Tür vor- und zurückschwingen, als wäre es möglich, jemanden in der winzigen Kabine versteckt zu halten. Dann erst trat er zur Seite und ließ mich zögernd vorbei, bevor er mit seinem Schrubber auf dem Boden herumwischte, als hätte ich die Kacheln verunreinigt. Nach der Kühle des Kabuffs überzogen sich meine Arme in der Sonne sofort mit Gänsehaut. Die Hitze war unglaublich. Ich blinzelte ins grelle Licht. Stefan war weg. Vor mir auf der Wiese lagen, schliefen, tobten Tausende. Das Schwimmbad war das Einzige im Umkreis von fast 20 Kilometern. Die Steinplatten waren so aufgeheizt, dass ich mich auf die Zehenspitzen stellen musste. In dieser Hitze nach Hause zu laufen war kein Spaß. Was machte es schon, wenn ich kurz ins Wasser sprang. Jetzt war sowieso alles egal. Ich warf mir das Handtuch über die Schulter, machte mich auf den Weg zum Becken. Ich lief schnell, meine Sohlen brannten. Hinter den Büschen lockte das kühle Wasser türkis. Ich würde mich erfrischen und dann sofort gehen. Dann sah ich Ihn: Hellhäutig, dünn und verschlossen saß ER auf seiner Decke nahe am Beckenrand. ER hatte jetzt seine Brille auf. ER zupfte Gras und Gänseblümchen aus, nickte manchmal, denn neben ihm saß jemand – ausgerechnet der großspurige Karl redete auf ihn ein. Ich konnte es nicht fassen, dieser Rabauke! Er wohnte bei uns im Nachbarhaus, ging mit Stefan in eine Klasse. Früher in der Grundschule hatte Karl immer seinen Spaß daran gehabt, mich auf dem Heimweg zu triezen. Ausgerechnet mit dem war er also befreundet! Ich starrte zu den beiden hinüber. Was erzählte 17 Karl da wohl gerade? Ich war nur noch zwanzig Meter entfernt; wenn jetzt einer der beiden hochblickte, würde er mich erkennen. Aber ich traute mich einfach nicht, beiläufig vorbeizugehen. Mit eingezogenem Bauch machte ich kehrt, schlenderte nun quer über die Wiese, lief, munter pfeifend, einmal um das ganze Becken, um mich schließlich dort, wo die Platten vom Spritzwasser angenehm kühl waren, an den Beckenrand zu setzen. Zum Schwimmen hatte ich keine Lust mehr. Doch als ich hochsah, bemerkte ich, dass ich auch von hier aus Stefan noch deutlich zwischen zwei Büschen erkennen konnte: Er saß – inzwischen alleine – noch immer auf seiner Decke herum und rupfte Halme aus. Hatte er Sorgen? Langweilte er sich? Dachte er über etwas nach, das Karl ihm erzählt hatte? Oder über unsere verpatzte Begegnung? Warum ging er nicht einfach ins Wasser? Stattdessen sprang jemand anderer plötzlich mit einem riesigen Platschen direkt neben mir ins Becken und spritzte mich völlig nass. Ich kam wütend in die Hocke. Jemand schaufelte mit einer großen Hand noch mehr Wasser aus dem Becken gegen meine Beine und meinen Bauch. Natürlich Karl! „Was ist: warum so trübsinnig?", prustete er. Ich hätte es mir denken können. Karl! Er schwamm auf mich zu und hielt sich am Beckenrand fest. Ich funkelte ihn böse an: „Bist du verrückt?“ Ich zog mein feuchtes Handtuch unauffällig vor meinen Bauch, setzte mich, anderthalb Meter von ihm entfernt, vorsichtig wieder hin. „He, was ist mit dir? Warum bist du vorhin vor uns abgehauen?“ Ich schüttelte den Kopf: „Gar nichts ist. Wieso?“ Er paddelte mit den Füßen und grinste mich an. Er hatte sehr dunkle Pupillen. Zwischen 18 seinen Wimpern hingen kleine Tröpfchen. Mein Handtuch war klebrig und noch immer zu klein. „Guck nicht so“, fuhr ich ihn an. Was wollte er bloß von mir? Sein braungebrannter Arm beschrieb einen großen Bogen zum Wasser, als lade er in sein persönliches Reich. „Komm“, rief er. „Komm schon rein!“ Dann stieß er sich mit Schwung vom Rand ab und kraulte etwa drei Züge. Er machte eine Schraube, kam wieder hoch und blickte mich erwartungsvoll an. Mit seiner großen Hand winkte er mich zu sich. Ich schüttelte wieder den Kopf. Da winkte er noch einmal, bedauernd, und schwamm auf dem Rücken liegend in langen Kraulzügen davon. Wie ein begossener Pudel blieb ich hocken und starrte in das giftig-blaue Chlorwasser. Dann ertönte auch schon bald der Gong und als ich aufstand und suchend in Richtung der Decke zwischen den Büschen blickte, waren die beiden plötzlich verschwunden. Als mir Oma entgegenkam, war ich keinen Moment misstrauisch. Dabei hätte es viele Gründe gegeben. Oma ging niemals aus. Sie ging manchmal zum Edeka-Markt um die Ecke, wenn Mama bei ihren Einkäufen mit dem Auto etwas vergessen hatte. Sie ging sonntags immer als Einzige in der Familie zu Fuß in die Kirche, vermutlich um dem Städtchen ihre Kollektion von Hüten vorzuführen, und sie ging hin und wieder zu Fräulein Würsching, die ihr „die Füße machte.“ Oma blieb für gewöhnlich im Haus und im Garten, sie war höchstens auf einen Sprung bei den Nachbarn. Oma in der Stadt an einem gewöhnlichen Wochentag und dann auch noch im guten Kleid mit passendem Strohhut – es war eine Sensation. Aber ich hatte mich ja noch nicht mal gewundert, dass sie nicht ihre Gesundheits-Sandalen anhatte, sondern 19 richtige Pumps, die ihre Knubbel bestimmt schmerzhaft quetschten. Oma nannte sie „Gurkenschuhe“. „Tolle Schuhe", sagte ich und hängte mich dankbar bei ihr ein. Sie hatte nicht wie alle anderen Schweißflecke unter den Achseln und sie roch nach Tosca wie sonst nur an Sonntagen. Ich schnupperte an ihr: „Hmm! Schön.“ Mir schien, als ob Oma niemals schwitzte. Immer ging etwas Blumiges von ihr aus und daneben dieser vertraute Geruch nach Oma. Sie sei spazieren gegangen, behauptete sie. Kein Mensch ging bei diesem Wetter spazieren. „Da dachte ich, ich könnte dich doch einfach abholen, wenn das Schwimmbad zumacht.“ Versonnen lächelte sie unter ihrer Strohhutkrempe. Ich nickte. Ich war zu sehr mit mir beschäftigt. Nur deshalb dachte ich nicht darüber nach, dass jemand Oma und mir gut Bekanntes in einem ausgebauten Schrebergartenhäuschen direkt hinter dem Schwimmbad wohnte „Hast du Kummer, Mucki?". Eigentlich hasste ich es, wenn sie mich so nannte. „Machst Du mir zum Abendessen wieder Brombeermilch?“ Ich drückte mich an ihren runden Arm: „Bitte.“ Ich wog 55 Kilo. Ich hatte es mir ausgerechnet: damit war ich sechs Kilo von meinem Idealgewicht entfernt. Am besten sollte die Eierdiät helfen, stand in Omas Frauenzeitschrift. Allerdings konnte ich mich in dieser Hitze einfach noch nicht dazu aufraffen, so viele Eier zu essen. Aber ich war fest entschlossen, an meinem Geburtstag im September mit dem Abnehmen zu beginnen. Als Mama dreizehn Jahre alt war, wog sie 32 Kilo. Dieser Satz war in mein Hirn eingebrannt, so oft hatte ich ihn gehört. Der 20 Krieg war ja inzwischen schon seit fast dreißig Jahren vorbei, ein entsetzliches finsteres Geheimnis, ewig lange her. Mama sprach niemals von dieser Zeit, unter keinen Umständen – nur von Gerhard und von „Zuhause“, als sie alle noch zusammen waren. Mama sprach sowieso nicht gerne. Sie hockte am liebsten alleine in ihrem abgewetzten Ledersessel in der Waschküche und las in Folie eingebundene Kitschromane oder Krimis mit Titeln wie: “Der Henker“, “Der Rächer“ oder “Der Hexer“. Oma und ich, wir redeten dafür bald täglich über den Krieg und die Flucht. Eigentlich wollte ich die schrecklichen Einzelheiten gar nicht wissen. Das sagte ich ihr auch jedes Mal. Aber wenn wir dann so zusammen saßen, fing ich doch wieder mit meinen Fragen an, auf die Oma immer schon wartete. „Als Mama so alt war wie Du“, damit begann sie oft ihre Geschichten, „da sind deine Mutter und ich gerade angekommen im Westen, untergeschlüpft in Essen in dem dachlosen, zerbombten Zimmer von Tante Gertrud“, erzählte Oma. Endlich in Sicherheit, aber Gründe, Mamas 14. Geburtstag zu feiern, habe es Weißgott keine gegeben, sagte Oma – Opa erschossen in Russland, Mamas beide Brüder mit 27 und 18 Jahren im Osten totgebombt und verschollen. Omas alte Mutter verhungert, irgendwo in Polen auf der Flucht auf einem Feld zusammengebrochen und erfroren. Wenn Oma von damals erzählte, musste sie immer lange Pausen machen. Dann saßen wir nur so da und ich wartete, bis es weiterging. Ich wusste nicht, ob ich mich räuspern durfte, dabei hatte ich oft an dieser Stelle ein schreckliches Kratzen im Hals, als hätte sich dort etwas Zähes festgesetzt, das dringend raus musste. Die Sache mit dem Hals war bei mir im Laufe der Zeit direkt zur fixen Idee geworden. Ich war 21 immer ganz erleichtert, wenn sie weiter sprach, denn dann konnte ich endlich loshusten – und wie ich hustete! Ich konnte gar nicht mehr damit aufhören, direkt würgen musste ich manchmal, aber zum Glück hatte Oma fast immer Honigbonbons in irgendeiner Tasche. Nur sie beide hätten überlebt, sagte Oma. „Ich hatte Typhus und sie hat mich fast geschleppt, tagelang – durch das zerbombte Berlin, von Köpenick nach Wannsee, fast dreißig Kilometer, und überall Russen. Wir mussten uns immer wieder in den Trümmern verstecken. Sie haben die Frauen geholt. Alle Frauen. Großmütter, Kinder … Wer nicht wollte, wurde erschossen. Kannst du dir das vorstellen?“ Dreißig Kilometer, ziemlich genau so weit war es bis zu dem großen Einkaufszentrum, in das wir immer vor Weihnachten und vor den Sommerferien fuhren. Es war weit genug, dass mir im Auto schlecht wurde. Keine Ahnung, wie weit dreißig Kilometer zu Fuß waren. „Deine Mutter und ich – wir haben immer zusammengehalten.“ Damit endeten die Geschichten. Oma sprach darin nie wie sonst von Mama oder von Inge, sie sagte immer „deine Mutter“. Dann sah sie mich schräg von der Seite an: “Glaub mir, deine Mutter hat so viel durchgemacht, das kannst du dir gar nicht vorstellen.“ Ich fand, ich stellte mir schon seit ich klein war ziemlich viel vor, soviel, dass ich manchmal nicht einschlafen konnte. Ich wollte mir, ehrlich gesagt, nicht noch mehr vorstellen. Aber ich wusste natürlich, worauf Oma anspielte. Es war schon klar, dass Mama durch das alles ein bisschen komisch geworden war. Obwohl – Oma war schließlich auch verhältnismäßig normal, trotz allem, was die beiden erlebt hatten. Das Auffälligste war, dass Mama fast nie sprach. Immer verkroch sie sich irgendwo, „um sich 22 auszuruhen.“ Dabei erledigte eigentlich Oma den Haushalt – vom Einkaufen und Bügeln mal abgesehen. Als ich klein war, fand ich es am Schönsten, wenn wir im Garten Laken und Bezüge glatt zerrten, bevor sie sie bügelte. Ich zog an meinem Ende wie verrückt, und sie am anderen. Mama hatte erstaunlich viel Kraft, die hätte ihr keiner zugetraut. Manchmal war ich dabei kichernd den Rasenhang hinunter gekullert. Das Meiste, was sonderbar war, das bekamen Fremde zum Glück gar nicht mit, und natürlich wollten Oma und ich auch nicht, dass es jemand zu sehen bekam. „Wir beide, wir sorgen einfach zusammen dafür, dass nichts durcheinander kommt“, sagte Oma immer, wenn wir von damals redeten und sie zwinkerte mir dabei zu – und ich nickte und zwinkerte zurück. Keine Frage – wir schafften das schon. Ein Kohlweißling flog von Papas Decke auf, als Mama sie hochnahm. „Ich brauche einen neuen Bikini“. Sie holte die leichten Sommerbetten hinein, die sie zum Auslüften aus den offenen Fenstern gehängt hatte, trug sie zum Bettkasten. „Der Geblümte ist doch niedlich“, sagte sie. „Den Geblümten habe ich zu meinem zwölften Geburtstag bekommen, Mama. Da war ich noch ein Kind!“ „Ist das schon wieder so lange her?“ Sie ließ das Bettzeug im Kasten verschwinden, strich mit der flachen Hand über Papas Tagesdecke. „Gehst du heute mit mir einkaufen, Mama? Bitte!“ Jetzt war ihr eigenes Zimmer an der Reihe. Ich folgte ihr. Frau Behring von 23 nebenan hatte die Betten schon vor einer halben Stunde hereingenommen. „Vielleicht zu deinem Geburtstag …?“ „Ich brauche aber den Bikini jetzt. Wenn ich Geburtstag habe, ist der Sommer vorbei. Ich kann doch nicht noch wochenlang mit diesem Babyding rumlaufen, das überall einschneidet, oder?“ Sie drehte den Kopf zu mir, betrachtete mich, mein Haar, meinen Körper in dem etwas zu engen, roten Hemdblusenkleid. „Brauchst du etwa einen Büstenhalter …?“ Es klang fast ein bisschen beleidigt. Instinktiv gingen meine Hände zur Brust. Karin hatte im letzten Turntraining unter dem Trikot einen aus Baumwolle mit blauen Herzchen angehabt und Steffi trug schon seit bald zwei Jahren rosafarbene aus Spitze, in denen sie immer extra lange in der Umkleide vorm Sportunterricht herumlief. Ich nickte: „Ja, einen aus Spitze – und einen Bikini?“ Wortlos strich sie ihre Decke und das Kissen glatt und breitete die Streublümchendecke darüber aus. Warum benutzte sie nicht ihren Bettkasten? „Wir bestellen dir etwas Hübsches, ja?“ Bikinis gab es bei uns im Ort nur im Kurzwarenladen von Frau Oskötter, einer geschwätzigen, alten Ziege – oder im Kaufhaus in der Kreisstadt, in die Mama so gut wie nie fuhr. „Bestellen dauert so lange und außerdem – Oma sagt auch immer: Wäsche aus dem Katalog sitzt nicht.“ Sie schloss das Fenster und zog behutsam die Gardinen zu. Ich lehnte in der Tür und schaute zu, wie ihr Widerstand mehr und mehr schmolz. 24 Durch die Ritze zwischen den Stoffbahnen vor der Kabine sah ich Mama auf einem Stuhl sitzen, ihre zu große Handtasche schützend vor sich auf dem Schoß. Ich war stolz auf sie, stolz, dass sie wirklich hier war. Ich hatte es deutlich gespürt: Sie hatte Angst. Aber ich hatte schließlich auch Angst vor Frau Oskötter, vermutlich hatte die ganze Stadt Angst vor ihr. Das würde erklären, warum wir die einzigen Kunden waren. Als sie mir einen viel zu großen Büstenhalter gebracht hatte, war sie mit ihrem harten Hintern im halbgeöffneten Vorhang stehen geblieben, hatte mir mit ihren Fingern in den Bauch gekniffen und augenzwinkernd zu Mama gesagt: „Ja, ja, die Schokolade.“ Bollernd hatte sie gelacht: „Aber nur von den ganz kleinen Größen könnte unsereiner ja auch nicht leben.“ Der Bikini, den ich zuletzt hatte anziehen sollen, war orange, lila und fleischfarben geblümt. Ich hatte darin wie eine Made ausgesehen. Außerdem brauchte ich damit nur vom EinMeter-Brett zu springen und schon würde das Oberteil wie eine Wurst unter meinem Hals hängen. Verzweifelt streckte ich den Bügel durch den Vorhang: „Zu groß“. Es war schon das fünfte Modell, das Frau Oskötter gebracht hatte. „Haben Sie vielleicht auch etwas Einfaches, Blau-Weißes?“ brachte ich schüchtern hervor. „Maritim? Das trägt man ja im Moment gar nicht.“ Ihre Stimme klang angewidert. „Im Augenblick sind eher farbig-blumige Motive groß im Kommen. Ich hätte da zum Beispiel …“ „Vielleicht doch etwas Schlichtes …?“ stieß meine Mama hervor. Ich bewunderte ihren Mut. Frau Oskötter schwieg beleidigt. Aber sie widmete sich nach einer Weile doch widerwillig den Bademoden-Restposten, denn ich hörte das Quietschen des Drehständers. Dann ihre Stimme aus 25 größerer Entfernung: „Sie hat man ja auch lange nicht mehr im Ort gesehen. Erst kürzlich sag ich zu meiner Angestellten: Frau Mählich, sag ich, die Frau Rummel war aber auch lange nicht mehr hier – selbst in der Kirche war sie nicht vergangenen Sonntag. Die wird doch wohl nicht krank sein?“ Erwartungsvolles Schweigen. Aber Mama hielt durch. „Aber ihre Frau Mutter hat uns dann beruhigt. Überhaupt – so eine elegante Dame, ihre Frau Mutter. Das hat man ja auch nicht jeden Tag, dass eine Dame dieses fortgeschrittenen Alters so auf sich hält.“ Eine ringbesteckte, dicke Hand schob einen gestreiften Bikini durch den Vorhang: Blau-weiß mit ein wenig rot, ohne spitze Brutschalen und im Rücken schlicht zu binden – wunderschön. „Gerade in letzter Zeit hatten wir ja die Ehre, ihre Frau Mama öfter als Kundin begrüßen zu dürfen und was soll ich Ihnen sagen? Es ist eine Freude mal jemanden zu bedienen, der soviel Sinn hat für Eleganz – und für …“ Sie senkte die Stimme: „Gewagtes! … Aber warum sollte sie sich nicht auch mal jemand in ihrem Alter etwas Außergewöhnliches für Untendrunter gönnen, nicht wahr?“ Sie zwinkerte anzüglich: „Für etwas Ansprechendes ist man schließlich nie zu alt, nicht wahr?“ Ein langes Quietschen des Ständers: „Man könnte ja direkt auf Ideen kommen, nicht wahr? Ich sagte das noch zu ihrer Frau Mutter, aber da lachte sie nur: ‘Ich bitte Sie‘, hat sie gesagt, ‚es hält sich schließlich nicht jeder so gut wie Sie, Frau Oskötter.“ Ich nutzte ihr grölendes Lachen, öffnete vorsichtig eine Hälfte des Vorhangs und schaute Mama auffordernd an. Der Bikini saß perfekt. „Entzückend, meine Kleine, allerliebst“, grölte Frau Oskötter, die sich Lachtränen aus den Augen wischte – „ … so gut wie 26 ich, hahaha“ – und dann die zweite Vorhangbahn zur Seite riss: „Allerdings macht er dich natürlich deutlich jünger, nicht wahr?“ Mama blickte ins Leere. Ihr Kopf nickte mechanisch. Was hatte sie nur? Wir gingen hintenherum zur Terrassentür. „Blüte? Bist du da? Wo ist der 6er Schraubenschlüssel?“ Papa musste im hinteren Garten sein. Mama stellte die Tüten auf einen Gartenstuhl und verschwand im Grün. Es war fast ein bisschen merkwürdig, nachmittags seine Stimme zu hören. Er war fast immer unterwegs, wenn er nicht gerade Ferien hatte wie im Moment. Er war Duden-Vertreter, fuhr mit den Büchern in seinem Firmenwagen zu seinen Kunden, führte überall im Süden Deutschlands Verkaufsgespräche. Manchmal dachte ich, vielleicht kümmerte es ihn gar nicht, dass Mama sich oft sonderbar verhielt. Dabei - jemanden, den ich immer „Blüte“ nannte, würde ich wohl schon ganz schön gerne haben. Papa hatte ihr diesen Kosenamen wegen der Geschichte bei ihrer Verlobung gegeben. Manchmal, selten, erzählte er davon, kopfschüttelnd, als wäre das Ganze der entscheidende Beweis, dass es ihm – ausgerechnet ihm – gelungen war, eine ungewöhnlich tolle Frau zu heiraten. Er hatte ihr damals einen Arm roter Rosen geschenkt, und sie hatte sich bedankt und dann gesagt: „Schenk mir bitte in Zukunft immer nur eine einzelne schöne Blüte, und die suchst du mir selbst aus. Versprichst du mir das?“ Und tatsächlich: Oft, wenn er zurückkehrte von seinen Verkaufsreisen, hatte er für sie eine schöne Blüte dabei: eine Schwertlilie, eine Fliederdolde, eine einzelne Sonnenblume … Eigentlich hatte sie etwas gegen Schnittblumen, aber ich glaube, seine Blüten mochte sie tatsächlich. Wahrscheinlich 27 hatte er sie häufig einfach am Wegesrand abgebrochen oder aus fremden Gärten geklaut. Wenn er zu Hause war, im Garten oder im Keller an etwas herumbastelte, dann rief er oft nach ihr: „Blüte, kommst du mal? Blüte, hast du meine gelbe Wasserwaage gesehen? Hältst du mal die Leiter?“ Blüte dies und Blüte das. Komischerweise schien sie seine Rufe fast immer zu hören, egal, wo sie gerade steckte. Nach einer Weile kam sie einfach. Nicht, dass sie herbeieilte, sie bewegte sich sowieso nie schnell, aber nach ein paar Minuten stand sie vor ihm, sanft lächelnd, bereit, ihm Antwort zu geben oder ihm zur Hand zu gehen. Geduldig hielt sie dann seine Leiter fest, suchte in seinem Werkzeugkasten nach Nägeln, ließ ihre freundlichen Blicke schweifen, während er umständlich erklärte, warum sein handwerkliches Projekt diesmal wohl scheitern würde. Manchmal blieb sie stundenlang in seiner Nähe, lehnte gedankenverloren an einem Türrahmen, in der Hand baumelte wie ein Blumenstrauß irgendeine Säge oder ein Hobel – Werkzeug, das er vielleicht noch einmal würde brauchen können. Nur selten, an wenigen Tagen, kam sie nicht, wenn er nach ihr rief. Dann fuhr er nach zwei bis drei Versuchen, mit fahrigen Bewegungen und gerunzelter Stirn, einfach in seinem Tun fort, als hätte er niemals nach ihr verlangt. Er rief auch den ganzen Tag nicht mehr – soweit ich mich erinnere, begab er sich auch nicht ein einziges Mal auf die Suche nach ihr. Eine Sache war ganz merkwürdig. Ich habe nie – wirklich nie – erlebt, dass Papa Mamas Zimmer betreten hat. Wenn er ganz dringend etwas brauchte oder von ihr wissen wollte, dann rief er laut vom Flur aus, manchmal klopfte er auch 28 dabei, aber er drückte die Klinke nicht herunter. Er wartete immer geduldig, bis sie aus der Tür trat. Es war ein eigenartiger Gedanke, dass sie auch eine Art Liebespaar waren. Sie fassten sich so selten an. Nur, wenn Papa abreiste oder nach einer längeren Tour zurückkehrte, hauchte er Mama einen Kuss auf die Wange. Manchmal flackerten dabei ihre geschlossenen Lider so merkwürdig. Hin und wieder, wenn Papa sehr gut gelaunt war, legte er auch mal im Gespräch seine Hand auf ihre Finger, aber das sah dann aus, als sei Mamas Hand gefangen und wartete unruhig auf die Begnadigung. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie ich zustande gekommen war. Ihre Betten waren so ordentlich und so schmal. Eine Weile, ich muss zehn oder elf gewesen sein, war ich häufig gegen Mitternacht wach geworden. Dann lag ich da, hellwach, und lauschte ins Dunkel: Ich war mir sicher, dass ich eines Nachts hören würde, wie Papa durch die dunkle Diele zu ihr schleichen würde. Es war ein bisschen wie in meiner Kindergartenzeit, als ich noch glaubte, meine Puppen und Teddys erwachten im Dunkeln und eines Tages würde es mir gelingen, sie dabei zu ertappen, wie sie herumtanzten, einander Boxhaken verpassten oder ihre Kleider tauschten. Ungefähr genauso wahrscheinlich, dass meine Eltern sich in der Dunkelheit plötzlich in echte Liebende verwandelten. In seinem leuchtend weißen Nachthemd würde Papa sich ihrer Tür nähern, würde – als wäre es die leichteste Übung – mühelos die Klinke hinunterdrücken und sich in ihr Zimmer schieben. Er würde den Stoff seines Hemds am hinteren Kragen packen und es über den Kopf ziehen, wie er es immer mit seinen Hemden machte, und würde es im Dunkeln auf den Boden werfen. Dann würde er auf ihr Bett 29 zugehen, würde womöglich etwas Zärtliches, Umschmeichelndes, Romantisches sagen (was nur?), würde ihre Decke hochheben und sich neben sie gleiten lassen (zu eng), oder auf sie drauf …? An der Stelle war mir immer leicht eklig zumute gewesen und meine Phantasie hatte endgültig versagt. Trotzdem: Nacht für Nacht wartete ich auf die Schritte – oder auf verräterische, skandalöse Geräusche wie dem Winseln oder Stöhnen von dem Steffi, die Bravo-Leserin in unserer Klasse, uns anderen Mädchen berichtet hatte. Aber das Einzige, das ich zu hören bekam, war der Schlag der Standuhr und irgendwann einmal Papas leises Gerede: „ … komm meine Kleine, meine Süße … Leber hast du doch so gerne …Ja: das tut gut.“ Irgendwann schlief ich dann doch wieder durch. Wahrscheinlich hatte ich nicht lange genug durchgehalten. Vielleicht waren sie auch nur besonders leise gewesen oder sie taten es gar nicht nachts, sondern in den Stunden, wenn ich im Turnverein und Oma bei der Fußpflege war – oder an einem anderen Ort: auf Mamas Ohrensessel in der Waschküche? Vielleicht waren sie aber auch wirklich nur Eltern. Nichts sonst. Wie Puppen bloß Puppen waren und Teddys Teddys. Vielleicht merkten sie nicht, dass sie auch ein Liebespaar hätten sein können. Vielleicht merkte Papa nicht, dass Mama ziemlich eigenartig war – oder er nahm es als gegeben hin wie unseren betrunkenen Pfarrer jeden Sonntag, die Ölkrise oder unser Schweigen beim Essen, wenn er wieder von seinem Lieblingsthema, der Kleinschreibung, anfing. Mir war jedenfalls längst klar, dass er nicht zählte, wenn es darum ging, auf Mama aufzupassen. 30 Aber zumindest auf mich konnte Oma sich verlassen. Wenn es um „Meine Mutter“ ging, war ich da, das wusste sie. Ich fand es auch nie besonders schlimm, dass wir mehr als andere als Familie unter uns blieben. Ich brachte sowieso nicht so gerne Besuch mit. Lieber traf ich die Mädchen nachmittags im Turnverein. Manchmal gingen wir danach in die Eisdiele Venezia oder hingen bei Steffi herum, die ein Zimmer mit eigener Terrassentür hatte. Wenn aber eine zu mir kommen wollte, sagte ich einfach: „Nein“. Ganz klar und ohne Begründung. Da fragte nie eine nach. An meinem Geburtstag natürlich, da lud ich die Mädchen aus meiner Klasse ein und die kamen auch. Einige jedenfalls. Sie guckten sich zwischen den Tortenbissen neugierig um, als vermuteten sie hinter unseren Vorhängen Ungeheuer, aber dann entspannten die sich langsam. An diesen Tagen bereitete Oma alles vor, backte Sahneschnitten und Buchteln, schmückte das Wohnzimmer, dachte sich Party-Spiele aus und ging gegen Abend aus dem Zimmer, wenn ich ihr, wie verabredet, zuzwinkerte. Dann machten wir die Musik lauter um zu tanzen. Mama blieb solange in ihrem Zimmer „um sich auszuruhen.“ „Hey, statt vor Dich hin zu träumen oder Kitschromane zu lesen, könntest Du Dich zur Abwechslung mal nützlich machen.“ Erschrocken schoss ich von meiner Decke hoch. Zerzaust und zerknittert reckte ich mich zur Buchsbaumhecke hoch, hinter der die Stimme hervorgekommen war. Da tauchte oben auch schon ein Gesicht auf: Dunkelbraune Augen in einem großen Schädel mit Stoppelschnitt: Karl natürlich. Er musterte mich amüsiert. „Ich glaub, da oben steht ein Knopf 31 auf.“ Ich fummelte fahrig an meiner Bluse herum. Alle Knöpfe bis auf den obersten waren geschlossen: „Was willst Du?", fuhr ich ihn an. „Eine Leiter.“ Ich stemmte eine Faust in die Seite. „Und? Was hab ich damit zu tun?" Ich fand, es klang sehr gelangweilt. „War bloß Spaß, das mit der Bluse. Meine Alten sind im Urlaub. Ich muss hier Klarschiff machen. Die Leiter zum Apfelernten ist im Keller, der Schlüssel mit im Urlaub. Also, ... was ist jetzt?" Ich wollte mich gerade ordentlich bitten lassen, als ich hinter der Hecke eine melodische Stimme hörte, die mich sofort erröten ließ. „Also gut“, sagte Karl, „mein Freund Stefan meint, ich soll Dich fragen, ob Du wohl so freundlich wärst? BITTE.“ Er grinste ironisch. Ich nickte, langsam rückwärts gehend, wie ein Wackeldackel, bis ich am Fuß der Gartentreppe fast stolperte und schließlich, zwei Stufen auf einmal nehmend, hochsprang zum Haus und zum Geräteschuppen. Schön war er, der Tag. Stefan war wirklich sehr nett. Er hat sich immer extra hochgereckt und mir den Eimer entgegen gehalten, damit ich mit den Äpfeln besser hineinzielen konnte. Nach dem Unterricht bei seinem Vater hat er mich manches gefragt und dabei mit keinem Wort unsere Begegnung im Schwimmbad erwähnt. Einmal meinte er sogar, dass ich eine hübsche Bluse anhätte. So was wäre Karl im Traum nicht eingefallen. Der hatte auch nur dröhnend gelacht und den Ast, auf dem ich saß, am Ende gepackt und solange daran gerüttelt, bis ich aufschreien musste. Stefan konnte ja nicht mit hinauf auf den Baum, weil er Höhenangst bekam. Das war natürlich blöd, weil er deshalb auch nicht viel von dem 32 mitbekam, was sich oben abgespielt hat. Aber oben hingen nun mal die meisten Äpfel. Karl hat mich dauernd geärgert, ein bisschen wie früher, als er mir auf unserem Schulweg Schnee in die Kapuze gestopft oder mir Juckpulver auf den Rücken gerieben hatte. Diesmal warf er von Ast zu Ast mit faulen Äpfeln oder ließ, wenn er mal nah genug an mich herankam, weiße Maden vor meinem Gesicht baumeln. Aber diesmal rächte ich mich. Ich ließ die schweren Zweige gegen ihn schnicken, bis die Blätter rieselten oder zielte mit den Äpfeln solange gegen seinen Eimer, bis die Hälfte des Inhalts hinuntergekollert war. Stefan hob dann kopfschüttelnd alle Früchte wieder auf und sortierte sie ordentlich in die Kiepen. Ich hatte Karl auch aufgezogen mit seiner Bassstimme und sein röhrendes Lachen nachgemacht, bis er wie ein Bär an den Ästen entlang gekrochen kam und dabei rief: „Ich krieg dich, ich krieg dich ...." Und als er ganz nah war, hat er versucht, mich zu kitzeln, und ich habe gerufen: „Stefan, komm hoch. Hilf mir …“. Ich bin dann auf meinem Ast immer weiter rückwärts gerutscht, bis Karl nicht mehr hinterher konnte, so groß und schwer wie er war. Irgendwann haben wir dort oben angefangen zu singen. Ich glaube, es begann damit, dass ich beim Pflücken gepfiffen habe und Karl hat dann die Melodie aufgegriffen: „Die süßesten Früchte kriegen nur die großen Tiere ...“ Danach sangen wir „Streets of London“. Da hat Stefan noch mitgesungen. Eine schöne, eine hellere Stimme als Karl hat er – ich habe sie noch im Ohr. Da war ich mir noch sicher, dass es auch ihm auch Spaß gemacht hat an dem Nachmittag. Und Karl glaubte das auch. Wir haben noch viel gesungen an diesem Nachmittag, zum Beispiel „Lemon tree, very pretty ...“, Karl extra tief und ich ganz hoch. Wir merkten gar nicht, wie 33 die Zeit verging, weil wir soviel lachten. Irgendwann war Stefan einfach fort. Er hat nicht mal Auf Wiedersehen gesagt. So was machte man doch nicht. Ich habe es jedenfalls nicht verstanden, gerade bei Stefan. Aber Karl meinte, wahrscheinlich habe er noch Geige üben müssen. Er sei ganz verrückt mit seiner Musik. Die sei ihm nun mal das Wichtigste auf der Welt. Und während Karl noch sprach, rüttelte er schon wieder von oben an der Leiter, von der ich gerade versuchte, hinab zu steigen. Also musste ich oben bleiben, konnte gar nicht mit dem Rad hinter Stefan herfahren, ihn fragen, warum er sich so aus dem Staub gemacht hatte, ob er nicht zurückkommen wollte. Und dann war es doch auch schon Abend, und Oma stand hinter dem Zaun und tockte mit dem Zeigefinger auf ihre winzige goldene Uhr, bevor sie ins Haus zurückschlappte, wo sicher ein Krug mit Fruchtmilch auf mich wartete. Karl landete neben mir im Gras und klopfte sich Blätter vom Hemd. Dann nahm er ein vertrocknetes Blatt von meiner Schulter und drehte es in seiner Hand. Wir schwiegen. „Also ...“ Er räusperte sich und streckte mir steif die Hand entgegen: „Einen schönen Abend noch.“ Ich ergriff seine riesige braune Hand und nickte. „Danke, Dir auch.“ Es war an einem der folgenden Abende, als Oma plötzlich fort war. Einfach so. Ein Gedeck weniger am Abendbrottisch. Ich merkte es erst, als ich schon an meinem Platz saß. Erhitzt und mit zerdrücktem Kleid war ich hineingestürmt in die Küche, wieder mal ein wenig zu spät, in der Hand noch den Apfel, den Karl mir zugeworfen hatte, als ich schon die Hecke 34 erreicht hatte - als hätten wir nicht den ganzen Tag beim Ernten schon viel zu viele Äpfel gegessen. "Wo ist Oma?“ „Wasch Dir die Hände und kämm Dich!“ Papa zerschnitt konzentriert seine Tomate in akkurate Achtel. Mama stapelte sorgfältig Weißbrotscheiben neben ihrem Teller. Wahrscheinlich fühlte sie sich sicher, weil Oma nicht da war. Ich stand auf und schlappte Richtung Badezimmer. In der Tür drehte ich mich um: „Ich will wissen, wo Oma ist.“ „Im Theater.“ Papa maß jedem Achtel die angemessene Menge Salzkörner zu: "Mit dem Altenkreis.“ Mein Gesicht im Badezimmerspiegel war gerötet, die Pupillen fast schwarz. Ich gefiel mir. Das kalte Wasser auf den Handgelenken tat gut. "Du solltest mal ausgehen, Mutti“, hatte Mama sie manchmal gedrängt. "Geh doch mal zum Gemeindealtenkreis. Da hättest Du Gesellschaft.“ Dabei ging Mama selber niemals aus. Meist hatte Oma nur geschnaubt - und dabei wie stets irgendwelches Obst oder Gemüse geschält, geschnitten, geraspelt. "Ich bitte dich: Da sind nur alte Leute.“ Damit war das Thema für sie erledigt. Oma unterwegs mit dem Altenkreis – nicht möglich … Das Abendessen verlief schweigsam. Mama bestrich mit fahrigen Fingern Scheibe um Scheibe ihres Brotstapels mit Butter und Streichkäse, als gelte es eine Schulklasse für einen Ausflug auszurüsten – oder einen ausgehungerten 35 Treck Flüchtlinge zu versorgen. Als sie meinen Blick spürte, lachte sie nervös: "... hab heute vielleicht einen Appetit.“ Mama aß immer nur eine Schnitte am Abend. Immer. Ich betrachtete Papas gepflegte Hände, die den Schinken in ein rechtwinkliges Viereck schnitten, das genau deckungsgleich mit seiner Toastscheibe war. Er war seit 15 Jahren mit Mama verheiratet. Was wusste er eigentlich von ihr? "Rechts ist es schief.“ Ich deutete kauend auf seinen Teller. Er zog die Stirn in Falten: "Wirklich?“ Unsicher drehte er den Teller. „Wirklich!“ Fast tat er mir leid. Fast. Als ich das Licht in Omas Zimmer anschaltete, kam ich mir vor wie ein Eindringling. Ich war selten alleine hier oben. Der Raum wirkte plötzlich viel größer ohne Oma. Ich knipste auch die Stehlampe mit den goldenen Fransen an und ließ mich auf das nachgemachte Biedermeiersofa fallen. Oma liebte Stilmöbel. Sie verachtete unsere Schleiflackmöbel mit den dünnen Beinen, die Papa zur Hochzeit angeschafft hatte. Ihr Zimmer nannte sie immer "den Salon.“ Die schweren Samtvorhänge waren zugezogen, ein Hauch von Tosca lag in der Luft. Auf dem runden Glastisch lagen ihre Zuckertütchen verstreut. Das war ungewöhnlich. Oma war immer sehr ordentlich, besonders mit ihrer Zuckersammlung. Der geschnitzte Schrank war randvoll mit Schuhkartons, in denen sie ihre Papiertütchen, -Röllchen, -Pyramiden und -Würfel, sortiert nach Städten und Ländern, aufbewahrte. Wie oft hatte 36 ich in den vergangenen Jahren auf dem Boden gekauert und die knisternden Zuckerpäckchen mit den bunten Bildern und exotischen Ortsnamen betrachtet, geordnet, zu Türmen aufgeschichtet, in Reihen sortiert. Die roten Röllchen aus Rimini, der braune Zucker aus Madeira, eingeschlagen in roseéfarbenes Pergamentpapier, die fremden Schnörkel, schwarz auf weiß, aus Dubai … Ich kannte Hunderte ihrer Stücke in- und auswendig. Eines Tages würde ich ihre Sammlung erben. Das war ausgemachte Sache zwischen uns. Gedankenverloren spielte ich mit den Beuteln, die über den Tisch verstreut waren, betrachtete einen silbern gedruckten Tempel auf einem nachtblauen Tütchen, einen in Jugendstilmanier gezeichneten Saxophonisten auf einem Würfelzucker, schwarze Notenlinien, die sich spiralförmig um ein rotes Zuckerröhrchen zogen. Oma, die kaum aus dem Haus ging, schrieb sich mit Dutzenden von ZuckertütchenSammlern. Ich las: „Kurcafé Bad Rappenzell“, „Piano-Bar Bad Rappenzell“. Oma war sicher noch nie in einer Piano-Bar gewesen. Komische Vorstellung: Omas Gnubbelfüße in den Latschen lässig auf den Streben eines Barhockers, wie ich sie im Partykeller bei Doris Eltern gesehen hatte. Ich musste grinsen: Ihre runden Hände, die nie untätig waren, ruhig ein schmales Cocktailglas umfassend ... Irgendjemand hatte kürzlich Bad Rappenzell erwähnt. Ich drehte das Zuckerröhrchen zwischen den Fingern. „Jazzclub Wonderful World“ las ich und dann, winzig klein, mit Füllfederhalter darunter gekritzelt: „… in Gedanken bei Dir, in Liebe Franz.“ Klar: Franz Nowottny, mein Klavierlehrer mit dem Fingerstumpf, er war im Frühsommer zur Kur in Bad 37 Rappenzell gewesen, er spielte hin und wieder in Cafés Klavier. Herr Nowottny war in Oma verliebt. In meine Oma. Sie war gar nicht mit dem Altenkreis unterwegs. Was wollte Oma mit so einem Mann? Was wollte Oma überhaupt mit einem Mann? Oma war alt. Sehr alt. Ich dachte an ihre Gnubbelfüße, ihre hängende Brust. „In Liebe“: Was wusste so ein Mann denn von Liebe? Sie hatte doch uns. Mich. Außerdem musste sie doch aufpassen, dass nichts durcheinanderkam. Überhaupt: Ich blickte hinüber zu Omas Messingpendule: Zehn vor neun Uhr. Heute war ja ich dran. In zehn Minuten würde „Was bin ich?“ vorüber sein. Ich musste mich beeilen, bevor Mama zu Bett ging. Ich wollte schon die Treppe hinunter springen, da sah ich durch das Flurfenster einen gelben Lichtschein. Das Wohnzimmerfenster drüben bei den Nachbarn. Es lag auf gleicher Höhe, schräg gegenüber, etwa zehn Meter entfernt. Noch immer war es nicht dunkel. Das Licht in der Dämmerung war silbrig. Einzelne Wolken trieben durch die letzten rosa Schlieren. Man sah drüben hinter den weißen Rüschen nur einen Schatten, der sich bewegte: Karl, wie er im Wohnzimmer umher ging - alleine. Vielleicht holte er sich gerade ein Glas Limo, vielleicht lag auf dem grauen Sofa ein aufgeschlagenes Buch. Ob er wohl geduscht hatte? Die Luft war noch immer warm. Was hatte er sich übergezogen? Ich sah ihn vor mir, wie er im Schwimmbad neben mir ins Wasser gesprungen war, seine braune Hand, die mir Wasser ins Gesicht spritzte … Die Zeit war knapp. Mama war schon im Bad. Nur noch wenige Minuten. Mischka lag mal wieder auf Mamas Bett. Ich 38 warf sie in die Ecke und beachtete ihr klagendes Maunzen nicht. Ich klappte die Matratze hoch, um an den Bettkasten zu kommen. Es war schlimmer, als ich dachte. Diesmal lagen nicht nur die sieben, acht Stullen in der Kiste, die sie sich vorhin geschmiert hatte, sondern auch jede Menge vergammeltes Gemüse und Obst. Dutzende von Ameisen krabbelten auf braun gewordenen Äpfeln, verschimmelten Möhren, matschigen Tomaten. So schlimm hatte sie es lange nicht mehr getrieben. Oma musste wirklich wieder mit ihr reden. Sie hatte schließlich nicht auf Mama aufgepasst in den letzten Tagen. Alles wegen dieses nach Parfüm stinkenden alten Kerls. Als ich gerade dabei war, leise fluchend den Abfall in die mitgebrachte Tüte zu stopfen, hörte ich die Badezimmertür. Mir brach der Schweiß aus. Zum Glück hatte auch die Katze den Schlüssel im Schloss gehört. Sie schlüpfte, noch immer wütend über meine Rohheit, durch die angelehnte Tür und lief zu Mama, die Gott-sei-Dank auf Mischkas Mitleidstour hereinfiel. Sie ging mit dem maunzenden Tier in die Küche, um es abzufüttern. Schnell klappte ich das Bett zu, zerrte die Decke halbwegs zurecht, stürmte hinaus, durchs Haus und der Mülltonne zu, um mal wieder Mamas schreckliche Erinnerungen zwischen Kartoffelschalen und Kekstüten zu versenken. Oma rollte den hauchdünnen Apfelstrudelteig auf einem Brett auf dem Gartentisch aus. Ich starrte auf ihre runden Hände. Das Weiße an ihren kurzen Nägeln war sorgfältig zu kleinen Sichelmonden gefeilt. Sie war vorgestern bei Frau Würsching gewesen, aber die Hände hatte sie sich dort nie zuvor 39 machen lassen. Pril war normalerweise ihre einzige Handpflege. „Und, war es schön mit dem „Altenkreis“, gestern?“ Ich zog die Füße auf den Sitz des Gartenstuhls und gab mir Mühe, möglichst viele Apfelschnitze zu futtern. „Setz Dich ordentlich hin. Man sieht alles.“ Ich war gerade erst aufgestanden, hatte noch mein kurzes Nachthemd an. Ich klappte die Knie auseinander. Sie blickte nicht auf. Ich beugte mich weit vor und betrachtete meinen hellblauen Frotteeschlüpfer. Rechts und links schauten blonde Härchen hervor. Ich zupfte daran. Ich war sonst gar nicht blond. Ich linste hoch. Sie guckte nicht. Sie zog den dünnen Teigfladen in die Breite. Mit dem Nudelholz rollte sie ihn noch breiter aus. Man konnte schon fast durch den Teig hindurch sehen. Ich setzte mich auf, zog mir das Hemd über die Knie. „Oma …“, sagte ich streng. „Na, Mucki: Hast Du Dein Buch schon zu Ende gelesen?“ Oma schüttete eine Tüte Rosinen in die Apfelschüssel. „Welches Buch?“ Wovon sprach sie? „Das mit Napoleons Geliebter. Du kannst es mir mal leihen. Scheint ja interessant zu sein.“ Oma lächelte. Ich klaubte ihr die letzten Rosinen aus der Schüssel: „Das Buch ist doof.“ Was sollte das jetzt? „Außerdem ist es nichts für Dich.“ Oma gab mir einen Klaps auf die Finger. „Da haben wir etwas gemeinsam. Du bist dafür zu jung und ich bin zu alt.“ Sie mischte die Mandeln in die Füllung. „Übrigens …. Dein kleiner Freund hat gestern Nachmittag angerufen.“ Warum grinste sie schon wieder? „Wer?“ Ich hatte keine kleinen Freunde. 40 „Na, der kleine Freund von Karl drüben.“ „Stefan ist nicht klein. Was wollte er?“ „Dich zu seinem Geigenkonzert am Sonntag einladen. Wir haben uns nett unterhalten.“ Ich kaute Mandeln und schwieg. Man hörte nur das Sirren des Rasensprengers und Papas leises Fluchen im hinteren Garten. Er wollte heute den Rasenmäher reparieren. Ich setzte mich aufrecht hin: „Oma, Du musst mit Mama reden.“ Sie stapelte sorgfältig die leeren Schüsseln auf dem Tisch, lächelte vor sich hin. „Hörst du nicht? Es ist alles durcheinander gekommen. Deinetwegen!“ Ihre mehlstaubigen Hände arbeiteten konzentriert weiter – wie eine Maschine. Die Füllung wurde genau zwei Zentimeter dick auf dem Teig aufgebracht. Früher hatte immer ich das machen wollen. Gleich käme der schwierigste Teil, das Einrollen. Bei ihr sah der Teig immer vollkommen aus: glatt und geschmeidig. Sie blickte nicht auf: „Zehn Uhr hat er gesagt. Im Paulusheim. Ich hab´s aufgeschrieben.“ „Ameisen! Es waren schon Ameisen drin.“ Oma legte den Löffel beiseite. „Oma, du hast nichts getan!“ Sie beugte sich zu mir, zerdrückte mit ihrer runden, noch immer mehlstaubigen Hand meine Haare: „Ach, Mucki.“ Dann rollte sie den Strudel zu einer perfekten Rolle. Ohne Risse an der Oberfläche. Papa hatte in seinem Zimmer eine Maus entdeckt: „Sie hat es geschafft! Sie hat es geschafft!“ Für ihn war der Sonntag, an dem ich den ersten Kuss bekam und an dem auch die Katastrophe begann, ein Glückstag: Er dachte, Mischka hätte 41 sie zu ihm ins Schlafzimmer getragen, und sie sei ihr entwischt. Alle außer Papa wussten: Mischka war zu dumm zum Jagen. Außerdem hatte sie Angst vor Mäusen. Wenn sie im Garten eine Maus entdeckte, sprang sie für gewöhnlich auf einen Baum, machte einen Buckel und maunzte. „Zu früh von der Mutter weg“, sagte Oma immer. Papa wollte sich damit nicht zufrieden geben. Er hatte sich in den Kopf gesetzt, dem nichtsnutzigen Tier das Jagen beizubringen. „Wäre doch gelacht“, sagte er immer. Einmal hatte er sie in den Kriechkeller gesperrt und eine gute Stunde lang auf einem Klapphocker vor der Tür ausgeharrt in der Hoffnung, dass sie dort im Dunkeln plötzlich von ihrem Jagdinstinkt gepackt würde. Der einzige Effekt war, dass sie panisch von innen an der Tür kratzte, jämmerlich maunzte und vor lauter Angst mehrmals auf die Schwelle pinkelte, so dass es noch monatelang im ganzen Keller stank, wenn ich Bier oder Kompott hoch holte. Als Papa damals endlich die Tür öffnete und das verängstigte Tier hochnahm, war sein Gesicht tränennass. Auch in der Nachbarschaft wusste jeder, Mischka war eine Versagerin. Papa wollte der Welt das Gegenteil beweisen. Also ging er, wann immer ein Jagdobjekt in ihrer Nähe war, auf alle Viere und machte merkwürdige Verrenkungen. Er vollführte auf dem Rasen sonderbare Sprünge, bis seine kurzen Hosen auf halb acht hingen. Man konnte sogar die Poritze sehen. „Wäre doch gelacht“! Mit den Fingernägeln scharrte er in Mauselöchern oder Maulwurfshaufen. Dazu schrie er: „Da! Da!“ Er steckte seine Nase fast in den Sand, während die Katze auf dem Baum ihr Fell leckte, und der 42 Nachbar von gegenüber den Balkon seiner Wohnung verließ, um den Feldstecher zu holen. Papa glaubte allen Ernstes, diesmal hätte es geklappt. Er meinte, Mischka hätte ihm, wahrscheinlich aus Dankbarkeit für seine Belehrung, ihre erste gefangene Maus zu Füßen legen wollen. Leider konnte er die Katze nicht loben, weil sie nirgends zu sehen war; die Maus auch nicht mehr. Sie saß längst unter Papas Schrank. Als er sich in sein Zimmer aufmachte, ausgerüstet mit Scheibletten und einem Papierkorb, ahnte doch keiner von uns, was da noch kommen würde. Ich hatte auch gar keine Zeit, das Ganze zu verfolgen. Es war doch der Tag des Konzerts – und der Tag, an dem Karl mir am Nachmittag die Tiere zeigen wollte: Rehe, Hirsche, Wildschweine. „Es ist fantastisch. Das musst du sehen: Wenn Maisernte ist, flüchtet das Wild vor den Erntemaschinen“, hatte er erzählt, „man kann es dann so toll beobachten wie sonst nie.“ Später würde er mal Förster werden, da war er sicher. Ich wollte bei der Ernte dabei sein – aber auch vormittags bei dem Geigenvorspiel. Ich hatte mir mein neues rot-weiß gestreiftes Trägerkleid angezogen, das Oma mir im Katalog bestellt hatte. Ich dachte, es sei zu eng, aber es passte. Ich zog den Bauch ein und reckte die Brust vorm Spiegel: etwas moppelig, aber nicht besonders moppelig. Ich stellte mir vor, wie ich am Nachmittag mit Karl durch das kniehohe Gras laufen würde, der schwingende Rock, mein frisch gewaschenes Haar im Wind … 43 Die meisten Klappstühle waren frei. Es saßen nur ein paar Eltern und Großeltern herum und eine Frau trug zischelnd ihr Baby herum, das unablässig plärrte. Es war grässlich heiß im Saal des Petrusheims, in dem auch mein Firmunterricht stattgefunden hatte. Ich kannte das schon, die Hitze drückte im Sommer durch die vielen Oberlichter herein. Ich setzte mich ans Ende der zweiten Reihe, schob die Beine ein paar Zentimeter auseinander, damit die schwitzige Haut unter dem Rock nicht zusammenklebte. Auch neben mir waren noch Plätze frei. Merkwürdig, dass Karl nicht da war. Es war Stefans bislang wichtigstes Konzert. Karl hatte gesagt, er machte sich nichts aus klassischer Musik. Stefan wüsste das, nehme es ihm nicht übel, wenn er zu so was nicht käme. Vorsichtig schaute ich mich um: Mein Gemeinschaftskundelehrer, Stefans Vater, war zum Glück nirgends zu sehen, auch keine Spur von Stefans grässlicher Schwester. Meine Uhr zeigte schon acht nach zehn. Drei Notenständer und ein Klavier standen erwartungsvoll auf der Bühne, einem holzgezimmerten Podest. Ich rutschte in der Plastikschale hin und her. „Hier!“ Stefan. Er stand plötzlich vor meinem Stuhl und streckte mir eine gelbe Rose entgegen. Verdattert erhob ich mich. Meine erste Rose! Desiree hätte gehaucht: „Für mich?“ Sie hätte die zarte Blüte zum Gesicht geführt, hätte, die Augen geschlossen, den Kopf leicht nach hinten geneigt, das betörende Aroma eingesogen, hätte nur ein Wort geflüstert: „Bezaubernd ...“ „Fehlt dir was?“ Stefan packte mich am Ellenbogen: „Die Luft ist auch wirklich grauenhaft.“ Ich öffnete die Augen wieder. 44 Stefan trug einen schwarzen Anzug aus einem dick aussehenden Stoff und ein offenes weißes Hemd. Stand ihm gut. Auf seiner Stirn unter dem leicht gewellten blonden Haar perlten Tröpfchen. Sein rechtes Brillenglas war leicht beschlagen. Ich fuhr mir mit der Hand in den Nacken. „Wo sind deine Eltern?“ „Bei meiner Oma. Alle zusammen. Der geht´s nicht gut.“ Ich zog fragend die Brauen hoch. „Sie verträgt bloß die Hitze nicht.“ Dann sagte er nichts mehr und guckte. Sah mich einfach schweigend an. Ich zog den Bauch ein, wusste nicht, wohin mit der Rose, die im Übrigen nach gar nichts roch. Ich deutete mit dem Kopf Richtung Bühne. Dort wurde es langsam unruhig. „Aufgeregt?“ Der Kaplan trat mit einem Stapel Zettel nach vorne, sprach in das völlig überflüssige Mikro: „Eins. Eins. Eins.“ Dann schaffte er es, eine Rückkoppelung herzustellen. Ich grinste. Stefan sagte nichts. Er sah mich an, ja, er starrte mich an, als sei er taub. Ich lächelte ihn fragend an. Doch er ließ seinen Blick einfach nur weiter still über mein Gesicht wandern. Hatte ich Mamas Lippenstift verschmiert? Ich sog unsicher die Lippen ein. Dann legte ich die Rose auf den Stuhl. Der Pianist im Frack lief jetzt über die Bühne, nahm auf dem Hocker Platz … Ich zeigte nach vorne. „Du musst, glaub ich …“ Jetzt erst, endlich, löste sich Stefan aus seiner Starre: „Hast du nachher noch ein bisschen Zeit?“ Ich nickte. „Klar.“ 45 Ich schwitzte auch noch im Schatten der dichten alten Linde und schlug abwechselnd mit den Hacken gegen das Mäuerchen, auf dem ich saß. Bis auf die Musiker und den Hausmeister waren längst alle fort. Von Ferne hörte man nur noch das heulende Kind, das die Mutter während des Konzerts immer wieder vor der Tür herumgetragen hatte. Robert Schumann: „Streichquartett Nr. 2 F-Dur op. 41,2“ las ich auf dem Plakat an der Tür, und: „Joseph Haydn: Lerchenquartett op. 64 Nr. 5 in D-Dur“. Klang für mich wie die Zahlen und Zeichen des Periodensystems. Die Musik war schön gewesen, beruhigend, ein bisschen einschläfernd, irgendwann zwischendrin zu schrill. Ich fand, es hatte zu lange gedauert, aber das ging mir immer so bei klassischer Musik. Er setzte sich neben mich ohne auf seine gute Hose zu achten. Die Geige behielt er im Schoß. Er hatte kein Jackett mehr an und sein Hemd zeigte Schweißflecke unter dem Arm, aber als er so auf mich zugekommen war, den Geigenkasten in der Rechten und die Noten unter dem linken Arm, sah er sehr elegant aus. Seine Wangen waren gerötet, die Augen ganz blank: „Und – hast du´s gehört, wir haben etwas wirklich Neues probiert: Im Lerchenquartett, im Satz Allegro moderato ...“ Ich sah, wie sich die Träger eines Unterhemds unter dem dünnen Hemdenstoff abzeichneten. Karl trug bestimmt niemals Unterhemden. „ … die ersten Akkorde – wir haben sie diesmal nicht lieblich gegeben. Da war eher etwas, wie soll ich sagen, leicht Neckisches. So etwa …“ Er pfiff eine Melodie, die mir unbekannt vorkam. Kein Haar im Hemdenausschnitt. Seine Haut sah weich aus, hell und seidig. Karl hatte ziemlich viele 46 Haare, auch auf den Unterarmen, „ … dann in der ersten Geige: dieser schwärmerische, blühende Gesang, der trägt alle solistischen Melodien …“ Seine Hand flatterte auf Schulterhöhe. Eine schmale blasse Hand. Fast quadratische Fingernägel mit gleichmäßigen Monden. „ … auch im dritten Satz – endlich mal kein edles Menuett – ein echtes Scherzo war das, ein burleskes Scherzo …“ Seine Finger tanzten jetzt: Klavierspielerhände hätte Oma gesagt, dabei hatte ihr Klavierspieler grässliche 9-Finger-Hände … Er brach ab. Sah mich an – wartend. Ich hatte nicht zugehört. Er ließ seine Hand sinken, sagte: „Ich quatsch dich voll, ja?“ Einen Moment lang hielten wir beide die Luft an. Ich schüttelte leicht den Kopf, nickte unsicher – und dann lachten wir los. Sein Hals hatte sich vor Verlegenheit ein bisschen gerötet. Seine Zähne im offenen lachenden Mund standen ganz gerade. „Ich bin schrecklich, wenn´s um Musik geht. Okay, ich geb´s zu.“ „Nein, nein. Ich meine, war doch riesig schön, das Konzert.“ Klang ziemlich müde: „Doch. Wirklich.“ Er nickte vor sich hin, fragte: „Und du? Was ist mit dir?“ Mit einem Finger strich er sanft über den Geigenkasten: „Ich mein, wie geht´s dir so?“ Ein schneller Blick von der Seite. Wie sollte es mir gehen? „Prima.“ Ich grinste noch immer. Er schaute nach unten, schwieg. „Klar. Danke.“ Warum sprach er nicht? Ich schob nach: „Ferien. Sommer. Sonne – ist doch toll …“ Seine Hand streichelte nun den Hals der Geige. Glatte helle Hände auf dunklem Leder: 47 „Ich meine, es ist ja bestimmt manchmal nicht so leicht … für dich.“ Er zögerte: „… zu Hause.“ Er sah mich unsicher von der Seite an. Ich rutschte auf der Mauer herum: „Warum?“ „Ich meine …“. Er brach ab, schüttelte den Kopf, dann legte er den Kasten behutsam neben sich: „ … Ach, nichts.“ Ich wartete. Er holte vernehmlich Luft – und atmete wieder aus. Schließlich sagte er: „Wollen wir mal zusammen schwimmen gehen, im Waldschwimmbad – ich setz dann auch meine Brille auf.“ Ich zwang mich zu lächeln: „Vielleicht.“ Bloß nicht streng klingen jetzt: „Aber, sag schon: Was wolltest du denn gerade sagen?“ Ein freundschaftlicher Stoß in seine Seite: „Hey … rück´s raus?“ „Ach, ich weiß auch nicht. Ich dachte nur …“ Dann sagte er es: „Was ist eigentlich mit deiner Mutter los? Die ist irgendwie krank, oder?“ … und seine Hand ging zögernd an seinen Kopf. Die Luft war klar, der Himmel riesigblau. Karl ging hinter mir über die Wiese. Von Ferne hörten wir das Brummen der Gigantenmaschinen. Plötzlich waren sie auch zu sehen – weit vorne stiegen helle Staubwolken auf, dazu blitzte es silbern: Reflektionen auf ihrem Metallbauch. Ich wandte mich um. „Ein Ufo! Bestimmt Außerirdische, die auch gerade Sommerferien haben.“ Er lachte, ein bisschen bollernd: „Klar. Die haben sich auf ihrer Urlaubsexpedition verflogen, und jetzt können sie ihre Hotelbodenstation nicht orten.“ Dann holte er auf, ging neben mir, federnd: „Hotel Orion, bitte kommen, bitte kommen …“ Ich konnte ihn riechen: etwas 48 leicht Scharfes, dazu Äpfel, sein Baumwollhemd. „Gästehaus Orion garni – wir wollen andocken …“ Eine Lerche war über uns. Lerchen waren meine Lieblingsvögel. Hätte kitschig geklungen. Ich rupfte ein paar Getreidehalme ab, streifte Samen zwischen den Fingern ab. Ich dachte an das Lerchenquartett. „Wie war eigentlich Stefans Konzert?“ Konnte er Gedanken lesen? „Schön.“ Er wartete. Was sollte ich sagen? „Nicht besonders lieblich. Ein Scherzo oder so …“ Er lachte. „Du hast auch keinen Schimmer von Musik.“ Vor uns, direkt am Waldrand, tauchte ein Hochsitz auf. Nur noch ein Stück über einen Kartoffelacker. Er ging voran, kletterte leichtfüßig hinauf. Ich folgte ihm. Seine Stimme, etwas dumpf von oben: „Er ist in dich verliebt.“ Seine Hand half mir über die letzte, besonders hohe Sprosse. Dann sah er mich forschend an. Ich schwieg, kniete mich auf das Brett, das als hölzerne Bank diente. Vor uns erstreckten sich ewig weit Felder und Weiden. Karl stand wenige Zentimeter hinter mir, leicht gebeugt, um sich nicht am Dach zu stoßen. Überhaupt schien mir der Hochsitz plötzlich winzig, viel zu eng für zwei. Unablässig starrte ich auf den Feldrein, griff schließlich zu Karls Feldstecher auf der Bank, um die Wiesen nach Spuren von Wild abzusuchen. Ich sah nichts als grau-schwarze Schlieren. In meinem Bauch rumorte es. „Ich glaube, er wollte gar nicht, dass ich mitkomme“, sagte er. Ich rutschte auf den Knien hin und her. „ … heute Vormittag, zu seinem Konzert, meine ich.“ Ich umklammerte das Fernglas mit Fingern, die sich trotz der Hitze klamm anfühlten. „Das ist ja nicht so einfach …“ Karls Stimme direkt hinter mir hörte sich an wie aus weiter Ferne. 49 „Er ist doch mein bester Kumpel.“ Er lachte. „Also ... verstehst du?“ Ich lauschte den Lerchen. Das Tirilieren war jetzt fast zu schrill. Sie mussten direkt über dem Dach des Hochsitzes stehen. „Geht mich ja nichts an“, fuhr er fort. Ich schwieg. „Oder besser …“, er lachte, „ … sollte mich nichts angehen, wenn er was von dir will.“ Jeder Satz eigentlich eine Frage. Mir schien, als spürte ich jetzt seinen Atem hinten an meinem Hals. Die Zeit wurde zu einer Blase – riesig, weiß, eklig – wie ein Kaugummiballon in meinem Rücken, der soviel Platz einnahm auf der winzigen Plattform. Ich hielt die Luft an. „ … Tut´s aber.“ Ich konzentrierte mich auf die Schlieren im Fernglas. Wenn ich mich zur Seite wendete, geschah etwas mit ihnen. Ganz schnell ließ ich den Kopf einmal von rechts nach ganz links schnellen, und schon verwandelten sie sich in einen Schneesturm in unendlicher arktischer Weite: jaulende Wölfe, die sich voller Angst um sich selbst drehten, orientierungslos im Flockenwirbel … „Nelly? He, hörst du überhaupt zu?“ Sie duckten sich, schlichen nun, nah hintereinander mit eingezogenen Ruten, durch das undurchsichtige Gestöber … „Nelly, DA sind die Rehe.“ Er fasste mich an die Schulter, fast grob schob er mich nach rechts: „Schau nur: acht, neun, zehn …“ Ich ließ das Fernglas sinken. Es waren bestimmt ein Dutzend. Die vorderen liefen jetzt in hohen Sprüngen durch das Gras, die hinteren folgten Ihnen leichtfüßig, übermütig überholend. „Mensch, Nelly ...“ Seine Stimme voller Freude: „Weißt du überhaupt, wie die Rehe leben?“ Und er flüsterte fast an meinem Hals: Wie sie Winterruhe hielten, ohne zu schlafen. Wie sie sich im Herbst paarten, wie das Weibchen das 50 befruchtete Ei im Winter monatelang in ihrem Körper trug, ruhend, bis die richtige Zeit für die Zellteilung gekommen war. Seine Hand lag dabei weiter auf meiner Schulter, als hätte er bloß vergessen sie wegzunehmen. Tief und rau klang seine Stimme. Die Rehe waren längst im Wald verschwunden. Die Lerche schwieg. Ich lehnte mich weit vor und blickte zum Himmel. Nichts als Blau. Ob ich mir das vorstellen könnte: Erst in der Mitte des Winters dürfte das Kleine im Körper zu wachsen beginnen ... Ein Bussard: hoch über uns zog er seine Kreise, schwerelos. Meine Blicke folgten ihm, bis er, einen weiten Bogen beschreibend, zwischen den Wipfeln der Bäume verschwand. „Erst wenn es für das Junge warm genug geworden ist da draußen“, sprach er weiter, „dann, im Frühling, wird es geboren, damit es geschützt ist vor der Kälte des Winters.“ Am Anfang schien mir noch, es läge am Hunger. Ich hatte mittags nichts von dem Kasseler mit Ananas runter bekommen, dabei hatte ich doch sonst immer Appetit. Vielleicht war mir ja deshalb so flau. Aber eigentlich wusste ich schon, was es war. Da war diese raue Stimme in meinem Nacken, der Geruch nach trockenem Holz, der Gedanke an dieses Reh, das Gewicht von Karls Hand auf meiner Schulter, das Bild, wie er mir im Schwimmbad Wasser ins Gesicht gespritzt hatte – aber auch Stefans helle, knochige Finger sah ich vor mir, wie sie nach dem Konzert behutsam über den Geigenkasten in seinem Schoß gestrichen hatten. Doch da war noch etwas anderes, diffuse Bilder: dunkle Haare an Männerwaden, Speichelzungen, Papa nackt, wenn er aus dem Bad kam, das Gebamsel zwischen den Beinen der 51 Männer und ich hatte plötzlich Sehnsucht nach Oma und danach, jetzt wie sonst oft um diese Zeit am Gartentisch mit ihr Bohnen zu schnibbeln, Beeren abzuzupfen, Erbsen zu puhlen. Ich sollte mich umdrehen, ich sollte jetzt etwas Harmloses sagen, einen Witz machen, ich sollte … Karl berührte mich nur leicht am Hals. Kalt-heiß rieselte es über den Rücken. Ich drehte mich um, wollte eigentlich „He, das kitzelt“ rufen, ihm mit dem Finger in den Bauch pieken, aber ich sagte nichts, tat nichts. Ich sah ihn nur an. Die Hände hinter mir auf der Brüstung aufgestützt, begegnete ich seinem wartenden schwarzen Blick. Als ich die Augen schloss, seine Lippen weich auf meinen spürte, stellte ich mir vor, wie sich jetzt die Außerirdischen in ihrer Kapsel im Vorüberfliegen an den Luken die Nasen platt drückten. „Da ist Deine Oma.“ Ich hätte nichts bemerkt, wenn Karl es nicht geflüstert hätte. Wir waren Hand in Hand durch das Stadtwäldchen gelaufen. Es war längst später Nachmittag. Wir hatten gelacht und geschwiegen, hatten uns voreinander hinter Büschen und Bäumen versteckt, uns gejagt und gefangen und uns, an einen Baum gelehnt, immer wieder geküsst. „Was?“ Verwirrt drehte ich mich um. Ich dachte, er wollte mich nur veräppeln. Aber da war sie wirklich: Auf einer Lichtung kaum 50 Meter von uns entfernt, fast verdeckt von einem Gebüsch, thronte sie auf einem der dicken Kissen aus der Hollywoodschaukel. Direkt vor ihr saß Herr Nowottny. Auch er hatte sich eines unserer Kissen untergeschoben. Ich löste mich aus Karls Armen, schlich zu dem Gebüsch und schaute 52 gebannt auf dieses merkwürdige Bild. Herr Nowottny trug wieder seinen grauen Anzug. Er beugte sich zu Oma hinüber. Behutsam hob er ihren Strohhut vom Kopf, den sie sicher auch heute in der Kirche getragen hatte. Sie strich sich über das plustrige Haarnest ihrer frischen Dauerwelle und blickte dabei in seine Augen hinter der Brille. Vorsichtig legte er ihren Hut neben sich ins Gras. Dort stand auch, neben einer Thermoskanne, eine geöffnete Tupperschüssel mit Buchteln. Sofort ärgerte ich mich. Oma backte nur für mich Buchteln. Sonst für niemanden. Nur wenn es mir schlecht ging und immer zu meinem Geburtstag. Karl zog an meinem Arm. „Komm. Das hier geht uns nichts an.“ Ich versuchte, mich zu befreien. Er hatte mich nicht festzuhalten. Außerdem bekam ich jetzt Hunger. „Komm Du“, sagte ich nun lauter, „wir gehen ihnen Guten Tag sagen“, und ich wollte aufstehen. Aber Karl hielt mich weiter fest. Ich wand mich: „He, lass los!“ zischte ich. Doch er zwang mich, ihn anzusehen: „Lass sie, hörst Du?“ Als wir wieder hochblickten, lag Herrn Nowottnys große Hand mit dem Stummelfinger auf Omas linker Brust in roter Seide. Wir starrten reglos. Auch die beiden taten nichts. Ganz still und würdevoll saßen sie auf ihren Kissen, hoch aufgerichtet, und blickten sich in die Augen, scheinbar endlos, diese Hand wie selbstverständlich auf dem großen Busen. Die vier Finger konnten das Rund kaum umspannen. Festgebannt hockte sie, als wären ihre Knochen komplett unempfindlich gegen jede Unbequemlichkeit, als hätten sie unendlich viel Zeit. Dabei waren sie doch alt, uralt, Todgeweihte sozusagen. Und voller 53 Schrecken dachte ich es: Fleisch, das von Maden gefressen werden würde. Ich spürte Karls unruhigen Atem neben mir, das Gewummer meines Herzens. Ganz langsam richtete ich mich auf. Fuß auf Fuß auf den trockenen Waldboden aufsetzend, schlichen wir zwischen den Bäumen davon. Erst später, nachdem wir lange schweigend hintereinander den Weg entlang getrottet waren, nahmen wir uns wieder bei den Händen. Wir gingen zügig den Weg entlang, ja bald begannen wir zu traben, trabten nebeneinander her, den Blick nach vorne gerichtet. Schließlich liefen wir sogar, liefen immer schneller, liefen um die Wette, ja wir jagten regelrecht durch den Wald, nun grundlos lachend rannten wir (jetzt) die ausgestorbenen Strassen des Neubauviertels entlang, dem sicheren Zuhause entgegen. „Das ist ja ekelhaft.“ Oma setzte den Hut ab und legte ihn vorsichtig in eine runde Schachtel in ihrem Schrank. „Du schmierst mir das Glas voll.“ Die Buchtel lag genau in der Mitte der gläsernen Platte ihres Couchtischs. Ich hatte mich davor auf ihren Lieblingsplatz, den grünen Ohrensessel gesetzt. Hier durfte sich sonst nicht mal Mischka, die Katze, breit machen. „Du hast Buchteln für ihn gebacken.“ Ich fand, ich klang überzeugend wie Desiree, an der Stelle in meinem Buch, als sie Napoleon entgegentrat. „Ich habe die Tupperdose gefunden. Es waren die gefüllten: Geburtstagsbuchteln!“ Oma setzte sich doch tatsächlich mir gegenüber auf das Biedermeiersofa, auf dem sonst nur Besuch saß. Mit beiden 54 Händen richtete sie ihr angeklatschtes Haar. Ich wollte nicht auf ihren Busen gucken: „Ich hatte Hefe übrig. Die musste weg.“ „Du hättest die Ungefüllten machen können.“ An dieser Tatsache kam sie nicht vorbei. „Die Gefüllten mag ich lieber.“ Ha! Oma aß niemals Gebäck. Ich wusste genau, wer so wild war auf ihre Süßigkeiten … „Du hättest wenigstens mehr davon backen können. Es ist nur noch die eine einzige übrig.“ Meine Stimme sollte nicht weinerlich klingen: „ … und diese ist auch noch angebissen. Hier!“ Ich drehte die Bissstelle zu ihr. Sie rutschte etwas näher, flötete: „Ich back uns wieder welche. Jederzeit. Jetzt iss doch erst mal die da …“ „Nein“, schrie ich. „Gefüllte Buchteln gibt es nur, wenn ich krank bin oder Geburtstag habe. Aber ich bin nicht krank und mein Geburtstag ist in zwei Wochen.“ „Aber wenn du doch gerne jetzt eine hättest?“ Sie rückte noch näher an den Tisch, nahm die Buchtel, legte sich das klebrige Ding auf ihren Handteller und streckte es mir über den Tisch hinweg entgegen. „Komm, iss!“ Ich strich mir mit dem Handrücken über die Augen. „Nächstes Mal mache ich ihm Salzbrezeln“, sagte sie. Sie rückte mit ihrer Buchtel so nah an mich heran, dass die Glasplatte sich in ihren runden Bauch drückte. Sie wusste, ich hasste Salzbrezeln. Ich sah die glänzende Buchtel direkt vor mir. Weicher, süßer Hefeteig, der das Pflaumenmus umschloss. Ich schluckte. „Für ihn nur Brezeln – nie wieder Buchteln“, sagte Oma. Zögernd nahm ich ihr die Buchtel ab und führte sie zum Mund. Sie nickte 55 aufmunternd. Ich biss hinein. Der Teig schmeckte leicht salzig – wunderbar. Oma lächelte: „Gut, oder?“ Wenn Karl nicht da war, kam es mir vor, als sei er ganz in meiner Nähe und als müsste ich mich nur umdrehen und schon würde ich ihn ertappen, wie er sich hinter den Sessel duckte; oder als versteckte er sich im Garderobenspiegel, und wenn ich mich im Vorübergehen betrachtete, dann könnte ich – wenn ich nur schnell genug wäre – noch sein breites Clowns-Grinsen in einer Ecke des Glases entdecken. Wie zufällig trieb ich mich sogar in der Nähe der Garderobe herum, sortierte die Äpfel auf der Anrichte und blinzelte dabei in Richtung Spiegel … doch nie entdeckte ich etwas – außer, dass ich mir einen Sonnenbrand auf der Nase geholt hatte. Wenn ich abends in meinem Bett lag und horchte, ob ich Omas Keuchen auf der Treppe hörte, war mir, als hinge wie Schwaden sein Schweiß-Holz-Karlgeruch in der Luft, obwohl er doch noch nie bei mir im Zimmer gewesen war. Ich wollte ihn riechen: Was sein Hemd ausdünstete und sein Hals und sein komisch struppiges Haar – Tag und Nacht wollte ich es einatmen. Dass Liebe gut roch, davon hatte keiner etwas gesagt, das stand auch mit keinem Wort bei Desiree. Das Merkwürdige war nur, obwohl er mir schon fehlte, wenn ich nur zwei Meter von ihm entfernt war, wollte ich ihn manchmal nicht treffen. Dass ich dieses schöne, schreckliche Kribbeln spürte, das war mir schon fast genug. Aber wie sollte ich ihm das bloß sagen? Es war ja so, dass er den ganzen Tag Zeit hatte, ich genau genommen auch, wir hätten also eigentlich 56 ununterbrochen zusammen sein können. Aber musste man, wenn man liebte, immer zusammen sein? Das hätte ich Oma gerne gefragt. Vorgestern Abend, als ich aus unserer Hollywoodschaukel aufgesprungen war und ihm erklärt hatte, jetzt müsste ich aber wirklich ins Bett, da hatte er gesagt: „Und? Was ist mit morgen?“ Und dann hatte er Vorschläge gemacht, was wir unternehmen könnten. Unablässig entwarf er Pläne. Noch während er sich von mir vor unserer Haustür verabschiedete, hatte er zwischen seinen festen, warmen Küssen geflüstert: „Ins Schwimmbad, ja?“ – Kuss – „… eine Radtour zum Weinberghäuschen?“ – Kuss – „… zur Schlossruine?“ – Kuss – „… eine Wanderung zum Baggersee?“ und seine Hand hatte dabei fest meine Taille umfasst. Ich aber hatte, Rücken zum Haus und eine Ferse schon in der offenen Tür, lachend geantwortet: „Mal sehen“ – Kuss.“ Und dann war ich am Morgen nicht hinüber gegangen zu ihm und hätte dabei nicht einmal sagen können, ob ich nicht in Wahrheit wollte, dass er einfach frech bei uns klingelte wie ganz früher als wir klein waren („Ist die Nelly da?“), dass er Omas komplizenhaften Blick ertrug, dass er mich erlöste von der Ödnis der Vormittage, mich mitnahm irgendwohin, wo Draußen war: Licht und Gelächter und Ferien. Darüber hätte ich gerne mit Oma gesprochen. Aber wenn ich ihr mal begegnete, wurde ich unsicher. Es lag nicht bloß an ihren ungewohnt aufgeplusterten Friseurhaaren, den gefeilten Fingernägeln und den Gurkenschuhen. Ich hasste auch dieses Augenzwinkern, wenn sie, ihre Sommerhandschuhe 57 schwenkend, rief: „Genieß den Sommer, meine Kleine!“ Sie rief nun laufend Sätze, als würde sie gerade fürs Werbefernsehen gefilmt. Und sie war so erschreckend gut gelaunt die ganze Zeit. „ … und dir einen traumhaften Tag, Mucki“, flötete sie, bevor sie sich schon am frühen Vormittag an mir vorbei durch die Tür schob, die sie dann schwungvoll hinter sich ins Schloss fallen ließ. Und ich stand wie angewurzelt, bis sich ihr wabernder gelber Umriss hinter dem Drahtglas in Nichts auflöst hatte. Ich stieg die zwei Treppen zur Waschküche hinauf. Mama liebte es zu bügeln. Wo sie bloß die ganze Wäsche hernahm? Genau genommen bügelte sie fast jeden Tag irgendwas. Die Tür war nur angelehnt. Ihr alter Sessel sah nackt aus ohne sie, das Bügelbrett war leer. Ich strich über den Stoff, als könne er noch warm sein von der letzten Berührung mit dem Eisen. Wo konnte sie sein? Ich hatte sie seit Tagen kaum gesehen. Ich hockte mich auf die Sessellehne. Früher hatte ich am liebsten hier gesessen. Als Kind mochte ich es besonders, mit der Sprühflasche die Wäsche zu befeuchten. Dann dampfte es und alles roch nach ihrem Lavendelaroma. Ich hatte ihr immer erzählt, was in der Schule Wichtiges passiert war. Es hatte mich nicht gestört, dass sie oft nicht viel dazu sagte. Manchmal hatte sie vor sich hin gelächelt, genickt, „Ach“ gesagt, oder sie hatte plötzlich die Hand auf meinen Kopf gelegt und mein Haar zerstrubbelt. Das machte sie noch heute manchmal, als wäre ich noch immer neun und in der Grundschule. Es kam natürlich auch vor, dass die Waschküchentür geschlossen war. Da wusste ich schon, es war wieder so ein Tag, an dem sie nicht wollte, dass man sah, 58 wie sie dort so saß, zwischen ungeordneten Wäschebergen, und blicklos auf die Seiten ihres Buches oder in die Kiefern vor dem Fenster starrte. An diesen Tagen reagierte sie nicht, wenn ich sie etwas fragte oder ihr etwas erzählte. Sie blickte dann höchstens kurz zerstreut auf und sah mich an, als sei ich ihr fremd. „Mama“, hatte ich dann früher gerufen: „Was hast du denn? Geht es dir nicht gut?“ Und wenn ich dann in der Waschküche geblieben war und immer weiter gefragt hatte: „Mama, Was ist denn? Sag doch was!“, dann hatte sich meine Stimme verändert. Ganz schrill und hoch hatte sie geklungen plötzlich; geradezu jämmerlich und so schrecklich, dass es nur zu verständlich war, wenn sie nicht hatte hochgucken und reagieren wollen auf dieses panische Gewimmere – „Bitte, bitte, sag doch was, Mama!“ – hatte ich gebettelt und hatte ihren müden Arm gegriffen und daran gezerrt, bis schließlich Oma in der Tür erschienen war, ihre Hand fest um meinen Oberarm gelegt und mich hinausgezogen hatte: „Hast du keine Hausaufgaben auf? Komm mal in die Küche, ich hab da noch was Gutes ...“ Inzwischen wusste ich natürlich, dass Oma Recht hatte und Mamas Verhalten nichts mit mir zu tun hatte. Mama brauchte Zeit für sich. Ich war damals einfach noch zu jung gewesen, um das zu verstehen. Es war eigentlich nicht schwer, in eine Gegensprechanlage Sätze zu sagen wie: „Kommst du mit ins Schwimmbad?“ Trotzdem war ich schon kurz danach nicht mehr sicher, ob ich es noch mal tun würde. Ich lag auf Karls kratziger Decke. Auf dem Bauch sah ich fast schlank aus. Karls Hand umschloss meinen Nacken. „Warum kommst du nicht mit ins Wasser?“, maulte ich. Ich atmete in die kleine, dunkle Höhle zwischen 59 meinen Armen. Das Gras war stachelig und lebte. Ein winziger Käfer versuchte verzweifelt von einem Halm zum nächsten zu wechseln. Vergeblich. Er stürzte ab. „Letztes Mal wolltest du noch unbedingt mit mir schwimmen.“ Meine Stimme klang dumpf und nasal. „Außerdem ist es heiß.“ Die Hand war schwer. Sie fuhr meinen aufgeheizten Rücken hinunter, langsam, die Wirbelsäule entlang. „Wozu geht man sonst ins Schwimmbad?“ Auf Höhe meines Bikiniverschlusses stoppte sie, sein Daumen verrieb Feuchtigkeit über der Schleife, zog ein wenig an dem Bändel, beschrieb sanfte Kreise auf der Haut. Ich streckte wohlig meine Zehen. „Was ist eigentlich mit Stefan? Wollte er nicht mit?“ Stille. Die Bewegungen wurden kleiner, kamen zum Stillstand. Hatte er mich nicht verstanden? Dieser Krach aber auch – Juchzen, Schreie, Platscher … „Hab ihn nicht gefragt.“ Die Hand lastete jetzt wie ein Stein: „Fehlt er dir etwa?“ Als ich die Augen öffnete, lag der winzige Käfer auf dem Rücken, strampelnd inmitten des undurchdringlichen, unbekannten Dschungels. „Quatsch. Gar nicht!“ Ich versuchte, den Kopf zu drehen, ohne meine Position zu verändern: „Isst du nachher mit mir Pommes?“ „Hmmm“. Ich sah einen winzigen Ausschnitt Blau und einen überquellenden Papierkorb. Mein Nacken tat weh. „Bitte! Ja? Mit viel Mayo?“ In seine Hand kam langsam wieder Leben: ein warmes, sich vorsichtig räkelndes Tier. „Machen wir“, grummelte er. Ich gab dem Käfer einen Schubs, der, wieder auf seinen Beinchen, erschrocken auf einen Halm krabbelte. Ganz behutsam wanderte Karls Hand nun nach 60 rechts hinüber. Ich schloss die Augen. Sein Zeigefinger bewegte sich leicht hin und her. Suchend, fragend schob er sich an dem Bikiniband entlang, umspielte es, wagte sich vor. Ich hörte mein leises Schnaufen. Unter dem Bikiniträger hindurch schob der Finger sich der zarten Haut an meiner rechten Seite zu. Erst etwa zwanzig Zentimeter unter meiner Achsel verlangsamte er, die Hand wurde leichter, umfasste meinen Körper wie eine zerbrechliche Schale. Ein Schauer rieselte über meinen Rücken. Ich atmete hinein in diese große Hand, reglos. Dann wurde der Finger wieder lebendig, der drängende. Er fuhr unter das Band des Bikinioberteils, ein großer Finger, fordernder Finger, der das Gummi kurz so anhob, dass es unter der Brust ziepend einschnitt, dann wühlend seinen Weg suchte unter meinem Arm hindurch. Er strebte direkt der Wölbung meiner Brust zu. Ich blinzelte zur anderen Seite: der Papierkorb, Kinder, ein Wasserball. Ich verlagerte das Gewicht, hob meinen Körper leicht an, ihm entgegen. Seine Wärme, als er sich über mich beugte, seine Hüfte an meinem Po, sein Geruch, Schweiß, Holz, Sonnenöl, fast schmerzlich spürte ich die Rundung meiner Brüste, heiße gespannte Haut, meinte sein Atmen zu hören, als seine Hand nun von unten unter den Stoff glitt, sich jetzt entschieden vorschob; das Oberteil rollte sich hoch … Schwer umschloss die große Hand meine Brust, die Daumenkuppe legte sich behutsam an die Brustwarze, die aufgerichtete … Blitzschnell rollte ich nach rechts, rollte gegen seinen Arm, den er hochriss, rollte weiter, kam auf der Wiese auf die Knie; die Hand ordnend am Stoff sprang ich auf, starrte ihn erhitzt, mit glänzenden Augen an, wie er dort auf dem Handtuch halb auf 61 dem Bauch, halb auf der Seite lag, mich mit gerunzelter Stirn ansah. Im Laufen rief ich, noch mit belegter Stimme: „Komm schon, komm du Bär, du wasserscheuer, komm schon …“ Und dann drehte ich mich um, rannte los. „Verdammt, komm doch!“ schrie ich. Ich lief quer über die Liegewiese, schlug Haken um Campingstühle, Handtücher, Luftmatratzen, trat auf Decken, auf eine Babyrassel, kickte einen Fußball zur Seite, rannte über heißen Waschbeton, durch das Duschbecken dem Wasser zu und sprang in vollem Schwung und verbotenerweise mit einem Kopfsprung von der Seite ins Becken. Nachdem ich mit geschlossenen Augen durch kreischende Kinder und dümpelnde Rentner regelrecht hindurchgepflügt war, hielt ich mich keuchend an der Leiter fest, versuchte, meinen Atem zu beruhigen. Ich strich nasse Strähnen aus meinem Gesicht, ließ meine Blicke über das Treiben zwischen Sprungbrettern und Kiosk streifen. Natürlich. Er würde weg sein. Gegangen, das rote Handtuch um den Hals gelegt, die karierte Decke aufgerollt unter dem Arm. Nur das armselige Häufchen meines Kleides und meiner Sandalen würde noch auf der Wiese liegen. Aber was war mit meinem Fahrrad? Er hatte unsere Räder mit seinem Zahlenschloss zusammengeschlossen (die Nummer: das Datum unseres ersten Kusses). Er würde doch mein Rad nicht unabgeschlossen zurücklassen? Aber warum sollte er jetzt noch rücksichtvoll sein? Was wollte so einer mit einem Baby wie mir, einer, der sich fast täglich rasierte, der sechzehn war, bald ein Mann? „Versuch und Irrtum – nie wieder eine Vierzehnjährige“, würde er seinen Freunden erzählen. „Mein 62 Gott, die ließ sich nicht mal obenrum anfassen, könnt ihr euch das vorstellen?“ Er würde auf der einen Seite der blöden Hecke leben und ich auf der anderen. Nachbarsjunge. Was war schon gewesen – ein Traum: Schwimmbad-, Hochsitz-, Apfelerntentraum … Und Stefan – würde Karl es ihm erzählen? „Eine Riesenpleite, die Kleine“. Redeten sie nicht so, wenn sie alleine waren, die Jungs? „Viel Mayo?“ Ich fuhr zusammen. Starrte ihn an. Er kauerte vor mir am Beckenrand mit einer doppelten Portion Pommes mit glänzender Mayohaube in der Hand. „Du wolltest doch viel, oder?“ Ich nickte und wischte wieder über meine Schniefnase. „Dann los …“ Er streckte seine freie Hand aus. Schwerfällig kletterte ich die Leiter hoch. Als ich ihn loslassen wollte, hielt er fest, grinste mich an: „Du hast aber viel Chlor in die Augen gekriegt.“ Ich blinzelte mit Heulaugen: „Blödmann.“ Er drückte mir die Tüte in die Hand: „Hier“, er grinste, „Mucki.“ Zu Hause warf ich das nasse Badezeug vor die geöffnete Waschküchentür. Ich schlappte in die Küche, ließ lustlos die Kühlschranktür auf- und zuklappen. Es war so merkwürdig still. In der Innentür stand ein Krug Erdbeermilch. Die Fruchtstücke dümpelten in Brocken obenauf. Die Milch war sauer geworden. Ich kippte sie in den Ausguss, betrachtete die Milchschmiere im geputzten Becken. Neben der Spüle lag ein karierter Zettel: „In der Plastikschüssel ist Milchreis. Oma.“ Früher aßen wir zusammen. Gestern und vorgestern Abend schon hatte ich alleine vor halbleeren Tuppergefäßen gesessen, die Oma vorbereitet und in den Kühlschrank 63 gestellt hatte. Mamas Zimmertür war auch jetzt wieder verschlossen. Hatte Oma wenigstens den Bettkasten in den letzten Tagen kontrolliert? Wieder ein ungerader Tag. Sie war dran. Wie viele Stullen konnten es inzwischen sein? Sie war die Mutter. Ich trug den Milchreis und einen Löffel ins Esszimmer. Auf dem Tisch standen bereits Teller, Löffel und Gläser, in der Mitte eine Glasschüssel mit Apfelmus, in der eine Fliege vergeblich um ihr Leben gekämpft hatte. Mir war noch ein bisschen schlecht von der Mayonnaise. Ich machte zögernd den Plastikdeckel auf und starrte auf das gekörnte Weiß. „Wir beide halten zusammen“, hatte sie immer gesagt. Hatte sie denn ihr blödes Leben nicht schon gelebt? Alles brachte sie durcheinander wegen dieses vierfingerigen Gockels. „Was gibt´s denn?“ Papa linste durch die Tür. Sein Gesicht glühte, auf der Nase pellte sich die Haut. Was meinte er? „Milchreis“, rief ich schließlich hinter ihm her, als er schon im Bad war, um sich die Hände zu waschen – dann holte ich die Fliege aus der Schüssel, schnickte sie mit dem Löffel durchs halb geöffnete Fenster. „Na, Kleine …“ Er setzte sich mir gegenüber, rückte den Stuhl heran, räusperte sich. Er räusperte sich immer, bevor er irgendetwas begann. Mit ungeduldigen Bewegungen schob er mit der Löffelspitze den Reis auf seinem Teller zu einem kegelförmigen Berg zusammen, der von zähflüssiger gelber Apfelmuslava umgeben war. Uneinnehmbar. Papa sprach nie viel, wenn er aß. Ich rührte in meinem Apfelmusteich herum: „Wo ist Mama?“ 64 „Ich nehme an, du hast bereits nach deiner Mutter gesucht?“ „Neee.“ „Nein, heißt das.“ Sein Blick ging zur Uhr über dem Büffet. „14.30 Uhr.“ Er klopfte den Hang auf der rechten Seite fest, dass die Milch leicht spritzte. „Sie macht Mittagsschlaf um diese Zeit.“ Das wusste ich selbst: immer von eins bis drei. Ich zeichnete mit der Löffelspitze eine Spirale in mein Mus: „Sie hat aber nichts gegessen.“ „Sie wird nicht verhungern.“ Sein Löffel riss eine tiefe Höhle in den steilen Hang. Er aß heute für seine Verhältnisse unordentlich. Der Brei machte ein pappiges Geräusch in seinem Mund. Neben seinem Teller lag ein abgegriffenes Prospekt: Arbeiten am 2-Takt Motor. Er folgte meinem Blick. „Eigentlich taugt der 685 – 02 nichts.“ Ich hatte Papa seit Sonntag nur einmal beim Essen gesehen, ihn sonst nur manchmal im hinteren Garten fluchen hören. Ob er noch an dem kaputten Rasenmäher arbeitete? Eine zweite, noch tiefere Höhle entstand im Berg. „Ich sag dir: nie wieder den Zündapp Hand Standart.“ Ich nickte. In dem Punkt waren wir einer Meinung. Wenn Papa nicht da war, musste immer ich den schrecklichen Mäher über den Rasen schieben, der sich nur in Gang setzte, wenn ich immer wieder an einer mehrfach geknoteten Kordel riss. Nach wenigen Metern Mähen war ich durchgeschwitzt und feuchtes Gras verstopfte irgendeine Düse. Dann kotzte das Ungeheuer Graswürste aus, die ich mit dem Rechen zusammenschieben musste. Karls Eltern hatten einen leise surrenden, elektrischen Mäher. „Du solltest einen Neuen kaufen“, sagte ich und leckte eine Löffelspitze Mus ab. Papa kaufte ungern etwas Neues. Er war 65 „ein Vertreter sparsamer Haushaltsführung“. Seine sonnenverbrannte Stirn legte sich in ärgerliche Falten. „Donnerstag. Hast du nicht Training?“ „Schulferien. Da fällt das Turnen aus.“ Wortlos durchlöcherte er den Berg, der sich bereits deutlich zur Seite neigte. Zwischendrin ließ er den Löffel sinken und starrte mich an. Glaubte er mir nicht? Dann aß er unkonzentriert weiter, stopfte sich den Reisbrei in den Mund ohne darauf zu achten, dass sein Berg langsam kippte. „Was ist mit deiner Großmutter?“ Papa sagte sonst immer “Oma“. Er blickte nicht auf. Was sollte ich schon antworten? „Ausgegangen.“ Ich kratzte die zwei Teelöffel Mus auf meinem Teller zusammen und schluckte sie schnell hinunter. „Keine Ahnung, wohin.“ Dann stellte ich die Schüsseln ineinander. Papas Teller sah inzwischen aus wie ein Schlachtfeld: „So!“ sagte er und sprang auf. Ich wusste nicht, worauf sich sein „So!“ bezog. Er zog sich die kurze Hose bis über den Bauchnabel. „Dann werd´ ich wohl mal.“ Er nahm sein Prospekt und ging hinaus – und für einen kurzen Moment überlegte ich, ob ich ihm wie früher hinterherlaufen und nachrufen sollte: „Papa, kann ich dir helfen?“ Als das große Gewitter kam, war Karl weit weg. Schon seit Tagen hatte er davon geredet, dass seine Tante ihn eingeladen hatte und unbedingt für ihn kochen wollte. Immer hatte er sie vertröstet und mich gedrängt, ich solle mitfahren. Ich hatte keine Lust auf fremde Tanten. Nun war er allein 66 gefahren. Er dachte sicher, mir sei es lieb, wenn wir uns mal einen Abend nicht träfen. Er hatte Recht, aber ich war traurig. Vom Kiesweg aus konnte ich sehen, wie er gegen halb vier in einem Hemd, das ich noch nicht an ihm gesehen hatte und mit einem Beutel Äpfeln in der Hand den Weg zum Bahnhof antrat. Die Tante wohnte fast zwei Stunden Zugfahrt entfernt. Als er sich nach wenigen Schritten zu unseren Fenstern umblickte, trat ich einen Schritt hinter die Mülltonne. Ich spürte es mehr als dass ich es sah, dass die Sonne an diesem Nachmittag mehr und mehr verblasste und verschwand, sich die Wolken drohend auftürmten, denn als Karl fort war, war ich zur Terrasse geschlichen, war unter die grüne Plastikschutzhaube der Hollywoodschaukel geschlüpft, in der das Licht nun schwer und sumpfig stand. Früher, als kleines Kind schon, flüchtete ich oft, wenn Oma mich ausgeschimpft hatte, in mein Versteck und schluchzte in die Polster voller Katzenhaare. Meine Plastikhöhle war mein Lieblingsort. Doch als diesmal die dicken Tropfen lospladderten, war ich in Gedanken weit fort. Wie Desiree ließ ich mich grade von schwedischen Nächten verzaubern: „Wie blassgrüne Seide spannte sich der Nachthimmel über dem Park aus. Mitternacht ist längst vorüber und noch immer wird es nicht finster. Die hellen Nächte duften sehr süß ...“ Ich schloss die Augen, atmete tief ein. Er hatte mich nun in meinen Träumen liebevoll bei der Hand genommen und führte mich durch die weitläufigen Parkanlagen des Schlosses, geleitete mich „unter eine zarte Birke, wo gelbe Primeln und tiefblaue Hyazinthen blühen.“ Ich rollte mich auf die Seite, die 67 Knie angezogen, und ließ meine Hand zwischen die Oberschenkel unter meinem Rock gleiten. Er würde behutsam vorgehen. Er würde mich nicht bedrängen. Ich würde es zulassen, fast alles zulassen … Ich strich mir über die Innenseiten der Schenkel. Zwischen den Beinen fühlte es sich heiß an und kribbelig. Ich ließ meine Hand langsam nach oben wandern, schloss die Augen, war taub für alles außer meinem flatterigen Herzschlag. Erschrocken fuhr ich auf: „ ... kindisch und unvernünftig. Komm sofort. Was ist denn das für ein Unsinn ... in deinem Alter.“ Ich zerrte schnell den Rock über die Knie, lauschte. Woher nur wusste Mama, dass ich hier war? „Was soll das? Es gibt Dinge, die gehören sich einfach nicht.“ Mein Herz schlug bis zum Hals. Sollte ich mich tot stellen oder hinauskriechen? Da hörte ich ein helles, kieksendes Geräusch, das sich immer höher schraubte, ein Lachen, das ich kannte und doch wieder nicht erkannte. Wer war denn bloß noch dort draußen? „Du wirst Dir den Tod holen. Jetzt komm schon ...“. Die Neugier siegte. Ich schlüpfte unter der Plane hervor und sah dort auf der Terrasse – Oma. Sie stand im strömenden Sommerregen nur wenige Meter von mir entfernt und wurde ausgeschimpft, wie sonst immer ich von ihr ausgeschimpft wurde. Noch immer lachend, breitete sie die Arme weit aus, die geöffneten Augen dem Regen zugewandt. Sie sah fürchterlich aus und schön. Das riesige gelb-geblümte Baumwollkleid klebte an ihrem runden Körper, am Busen, dem dicken Bauch, den kräftigen Oberschenkeln. Man konnte sogar die tief liegenden Brustwarzen unter dem nassen Stoff sehen. Zwischen ihrem zurückgestrichenen 68 dünnen Haar schimmerte ihre Kopfhaut rosa. Ihr Gesicht aber sah aus wie das eines glücklichen Mädchens: der offene lachende Mund, die von Regen glänzenden kleinen braunen Augen, die weiche Haut. Ich starrte sie an, merkte gar nicht, wie das warme Wasser jetzt auch mir über Kopf und Schultern lief. Das schon feuchte Buch noch immer in der Hand, hörte ich Mamas Geschimpfe zu: „Mutti, du wirst noch fallen, du kannst dir den Oberschenkelhals brechen oder an Lungenentzündung sterben ... oder der Blitz wird euch noch treffen.“ Ich betrachtete Mama. Sie hatte in letzter Zeit selten so viel geredet! „Denk doch wenigstens an das Mädchen ...“, rief sie und blickte mich an – erstaunt, wo ich plötzlich hergekommen war. Aber Oma riss mir einfach das Buch aus der Hand und warf es Mama zu, die es, in der Terrassentür stehend, verblüfft auffing. “Komm schon, Mucki.“ Oma nahm mich bei den Händen und zog mich zu sich in die Mitte der Terrasse, wo die Riesenpfütze am tiefsten war. Und dann hüpfte sie mit kleinen Tippelschritten zwischen den Geranientöpfen umher, die knubbeligen nackten Füße patschend im Nass. Und ich tat es ihr nach, sprang auch ins Wasser und fühlte nur noch Wärme zwischen den Zehen, Omas große Hände, die meine Unterarme fest umschlossen, das Donnergrollen im Bauch und dazu zuckten die Blitze über uns. Langsam drehten wir uns und hörten Mama nicht zu und lachten und der prasselnde Regen schlug Blasen auf den Steinplatten. Meine Haare klebten im Gesicht, ich schloss die Augen und schmeckte den Eisengeschmack des Regens. 69 Da berührte plötzlich etwas Hartes, Kratziges meine Beine. Als ich aufsah, schaute ich in Papas ernstes Gesicht. Mit einem Gartenbesen begann er, systematisch die Wassermassen zwischen unseren Füßen dem Ausfluss zuzukehren. Das strenge, rhythmische Geräusch ließ unser Gelächter allmählich verebben. Jetzt fröstelten wir doch, längst durchnässt bis auf die Haut, und nahmen, noch immer lächelnd, die Frotteetücher entgegen, die Mama uns entgegenstreckte. Dieses Schrillen: Ich ahnte es, dass wir nun auf die Erde zurück mussten, dass der Zauber gelöst würde. Ich ließ mich einfach nach vorne fallen ins Nichts, wiederholte die Bewegung von eben noch einmal. Kurz berührten sich meine Finger, dann zog ich die Arme weit auseinander, drückte mit den Handflächen die Luft zur Seite – und tatsächlich: schon stieß ich durch das Laub des Apfelbaums, schwamm wieder im warmen Sommerwind. Da war kein Geräusch gewesen, kein Schrillen, kein Nichts! Da durfte keines sein. Wenn ich jetzt darauf reagierte, wäre alles vorüber. „Komm mit“, rief ich Karl zu und schwamm ein Stück hinauf in Richtung Baumkrone. Es war nicht schwerer als ein Spaziergang bei starken Böen. Um nicht seitlich weg zu kippen, paddelte ich mit den Füßen. „Komm“, rief ich wieder, lachte. „Es ist einfach. Vollkommen einfach.“ Karl ließ die Füße baumeln, beide Hände um den Früchte-schweren Ast gelegt, auf dem er saß. „Los, mach schon!“ Er schüttelte leicht den Kopf. Ich schwamm auf der Stelle, versuchte gleichzeitig, ihm zuzuwinken. Der Stoff meines Kleides blähte sich im Wind. Weit unten entdeckte ich die Menschen. Viele. Eine 70 Schulklasse stand an einer Bushaltestelle. Wie klein das Schutzhäuschen war. Die Kinder blickten jetzt hoch, lachten. Ein winziger Junge schwenkte ein Tuch. Es war mir peinlich. Ich schob meinen Rock zwischen die Beine. Dabei kam ich leicht ins Trudeln. Ich sackte etwas ab, machte eine Schraube. Als ich wieder hochtauchte, war Karls Gesicht neben meinem. Er grinste frech. Dann beschleunigte er, flog mit ruhigen, kraftvollen Bewegungen der Erde zu – gerade so wie er auch im Schwimmbad seine Bahnen zog. Ich machte hektische kleine Schwimmbewegungen, hatte trotzdem Mühe, mit den zusammen gepressten Beinen an seiner Seite zu bleiben. Ich gab es bald auf, ihm zu folgen. Er war zu schnell. Ich schloss kurz die Augen, genoss einfach den lauen Wind im Gesicht. Dann ertönte es wieder: das Schrillen. Ich erschrak, spähte auf die Erde. Der Bus? Eine Schulklingel? Die schmale Verkehrsinsel dort unten zwischen den Fahrbahnen kam rasend schnell näher, zu schnell. Ich konzentrierte mich, verlangsamte … Das Schrillen – immer dieses Schrillen. Plötzlich war es Stefans schmale Gestalt, die dort landete, sich gekonnt auf dem Rasen abrollte. Unverkennbar: sein weißes Hemd, das helle Haar. Wie geschickt er war: Sofort war er wieder auf den Füßen, wandte sich mir zu, breitete die Arme aus. Locker lassen, dachte ich, weich machen … Ich sank wie ein Lot im Meer. Ich glitt einfach hinein in seine Umarmung, er nahm die Bewegung auf, tat zwei, drei Schritte rückwärts. Mit einem Sprung landete ich vor ihm im Gras. Geschafft! Er lächelte stolz, hielt mich an den ausgestreckten Armen. Die Kinder an der Bushaltestelle applaudierten. Die Glocke schrillte. Es gellte in 71 meinen Ohren. Ich wollte sie mir zuhalten. Dann erwachte ich. Es hatte an der Haustür geläutet. „Tag, Makalewski“, keuchte ich außer Atem, knotete verlegen meinen Bademantel zu. Es war schon nach zehn. „Na, Kleine …“ Makalewski wackelte beim Reden immer ein bisschen mit dem Kopf. „Ist Omma da?“ Er war einen von Omas „Fällen“, wie Mama immer sagte, ein „Mann in Not“, wie sie gesagt hätte. „Nee“, sagte ich, schob eine Haarsträhne in den Mund. Seine Haut im Gesicht war dunkelrot, voller Krater. Oma ließ jeden „Mann in Not“ hinein und gab ihnen etwas. Das hatte sich herumgesprochen. Mindestens ein Dutzend von ihnen klingelten immer mal. Makalewski tauchte vier- bis fünfmal im Jahr bei uns auf. Er war einer der wenigen Sesshaften. Man sagte, er lebe in den Kasernenruinen ein paar Kilometer hinter dem Ort. Schon als ich noch im Kindergarten war, kam er regelmäßig zu uns. „Soll ich dir was machen?“, fragte ich. Seine Hände umklammerten vor dem Bauch die Henkel einer Tüte, deren Aufschrift nicht mehr zu lesen war. Innen klirrte Glas: „Seit Sonnabendfrüh, sag ich dir. Seitdem hab ich nischt zwischen die Zähne gekriegt.“ Seine Zunge tat sich beim Sprechen schwer, den richtigen Platz zu finden. Er leckte sich über die dicken Lippen. Was sollte ich jetzt mit Makalewski? Oma gab ihm nie Geld. Das versäufst du, sagte sie zu allen. Aber sie sagte auch immer: Komm erst mal rein. Dann kochte sie ihnen „etwas Nahrhaftes“, meist Kliebchensuppe, Milchsuppe mit dicken Mehlklößchen. Dazu gab es Stullen mit 72 Butter und Salz und Apfelmost. Ich drehte mich um, blickte in den leeren Flur. Sollte ich Mama suchen? Aber die verzog sich immer sofort, wenn einer der Fälle von Oma im Haus war. „Ich hol dir was aus der Küche“, sagte ich schließlich. „Du bleibst draußen, klar?“ Er nickte. Ich lehnte die Haustür an, lief in die Küche, holte Brotlaib und Butter aus dem Schrank. Ich erinnerte mich: Früher hatte ich oft da am Tisch den Männern gegenüber gesessen, die so komisch säuerlich rochen. Irgendwie gruselig war´s und besonders, und immer musste ich auf die Butterstullen starren, die plötzlich so viel köstlicher ausgesehen hatten als all das Leckere, das Oma immer für mich zubereitete. Und während die Männer alles verschlangen, mussten sie Oma erzählen: Wo sie gewesen waren, wie es ihnen ergangen war, wen von den anderen sie getroffen hatten, wie sie über den Winter gekommen waren, wen „es erwischt hatte“. Meist hatte Oma ihnen, bevor sie gingen, noch alte Kleider oder Schuhe von Papa eingepackt, manchmal auch Äpfel, Birnen oder Saft. Ich holte eine Flasche Traubenmost, schlug die vier Klappstullen mit Mettwurst in Pergamentpapier ein und kehrte zu Makalewski zurück. „Gutes Kind“, sagte er, als ich sie ihm reichte, und: „Grüß mir die Omma“. Er nickte noch im Gehen immerzu mit dem Kopf. Ich sah im nach, wie er, irgendwas nuschelnd, mit seiner Tüte und dem Stullenpaket fortschlappte. „Warum fragst du die eigentlich immer alle so aus?“, hatte ich Oma gefragt, als Makalewski das letzte Mal in unserer Küche gegessen hatte. Damals hatte sie einfach weiter den Milchtopf 73 gespült, als hätte ich nichts gesagt. „Sag doch, Oma!“ Sie ließ den Suppenteller ins Wasser plumpsen, drehte sich mir zu: „Was meinst du: Wie alt ist Makalewski?“ Woher hätte ich wissen sollen, wie alt Makalewski war. Erwachsene waren alle irgendwie alt. „60? Oder 70? Keine Ahnung.“ „Er ist Anfang 50!“ Es klang fast triumphierend. Ich sah sie fragend an. Sie drehte sich wieder ihrem Abwasch zu: „Sibirien! Ich sag nur Sibirien! Fast ein Jahrzehnt im Bergwerk – guck dir an, was das aus einem machen kann. So ein Mensch hat doch wohl ein bisschen Anteilnahme verdient, oder?“ Oma behauptete, das Ende des Sommers sei schon zu spüren, früh am Morgen, manchmal in der Nacht: „Der Herbst liegt in der Luft, riechst du nichts?“ An diesem Morgen nach dem Gewitter fand ich, dass es sogar noch heißer war als gestern und vorgestern und vorvorgestern … Frisch geduscht und mit noch nassen Haaren lag ich auf meiner Decke hinten im Garten. Ich wollte weiter lesen. Hier hinter der Hecke las ich am liebsten, verschlang Seite um Seite, drehte mich mit der Sonne von rechts nach links und wieder zurück. Aber was war heute los? Ich starrte bloß stumpf auf das Papier, las den Anfang der Seite wieder und wieder und nichts kam an. Warum redeten die nur so schwülstig? Und um was ging es überhaupt? War es zu heiß zum Lesen? Ich rollte mich auf den Rücken und legte mir das aufgeklappte Buch auf das Gesicht. Meine Nase kribbelte unter dem Papierberg. Ich horchte – die Vögel, ein Propellerflugzeug, das Brummen einer fetten Hummel über dem Rasen, und – rechts von mir 74 hinter dem Buchsbaum Schritte. Seine Schritte! Atmen, ein geschäftiges Räuspern, das Schaben von Metallischem auf Stein: Ich hätte es mir denken können: Karl! Statt mich so unendlich zu vermissen, dass er alles täte, um schnell wieder bei mir zu sein, goss er jetzt wahrscheinlich Tomatenpflanzen. Dabei war er doch verreist gewesen, einen ganzen langen Tag! Ich warf das Buch zur Seite, drehte mich auf den Bauch und starrte auf die Blätterwand der Hecke. Jetzt fing er an zu pfeifen. „Über den Wolken …“ – es schien ihm ja gut zu gehen. Wasser prasselte in eine Gießkanne. So herum zu plätschern machte anscheinend Spaß, mehr Spaß als bei mir zu sein. Deutlich hörte ich das Schlack, Schlack seiner alten Sandalen auf den Platten. Überhaupt – jetzt sang er auch noch. Kaum zu erkennen, das Lied: „ … bis sie abhebt und sie schwebt – der Sonne entgegen. …“ So falsch, dieses entgeeegen … Ich hatte es sofort im Kopf. Am liebsten hätte ich es ihm vorgesungen, wie es klingen musste, leicht, gleitend, mühelos – „entgeeegen.“ Dauernd pfiff oder sang er, dauernd. Und immer klang sein Pfeifen schrill und schräg. Ganz anders als bei Stefan. Unmusikalisch war Karl, ein bisschen tumb, einer, der nichts verstand von den Feinheiten des neckischen Allegro Moderato ... Irgendwie kribbelte es in meinem Nacken. War da jemand? Wurde ich beobachtet? War Oma zurückgekommen? Ich blickte suchend um mich. Dort, im hinteren Garten neben den Himbeersträuchern stand Mama. Ich erschrak ohne zu wissen, warum. Ganz still stand sie, unter dem Arm trug sie einen großen Wäschekorb, sie lächelte in meine Richtung. Ich sprang auf, strich mein Kleid glatt, ging auf sie zu. Der Weg schien weit. Ich achtete darauf, 75 nicht auf eine Biene im Gras zu treten. Sie blieb stehen, sah mir entgegen. „Gib her.“ Ich nahm ihr den Korb ab, ließ sie, den Rasenhang hinauf, voraus gehen zur hinteren Terrassentür. Ich betrachtete ihr gebügeltes Kleid, ihre blassen, verhornten Fersen in den Sandalen, ihr halbwegs gekämmtes, immerhin gewaschenes Haar mit den ersten grauen Strähnen. Sie sah ziemlich aus wie immer. Ich war ihr in den letzten Tagen nur während des Gewitters begegnet. Warum hatte ich nicht längst einmal nach ihr gesehen? Sie wandte sich halb um und lächelte mich an: „Nicht zu schwer?“ „Nein, wieso?“ Genau genommen sprach sie ziemlich oft zu mir, als wäre ich noch ein kleines Kind, dabei war sie zwar größer, aber ich war stärker und kräftiger als sie und mit meinen 1,62 Meter fast ausgewachsen. Vor ein paar Monaten war es mir zum ersten Mal aufgefallen: Wenn sie mir mal nach der Schule die Haustür geöffnet hatte, hatte ihr Blick meine Augen immer in Höhe meiner Halskuhle gesucht, als sei ihr entgangen, dass ich schon lange kein kleines Mädchen mehr war. Ich hatte mich beherrschen müssen, nicht im selben Moment, in dem sich die Tür öffnete, in die Knie zu gehen, um ihr die Enttäuschung zu ersparen. Ich folgte ihr durch die Wohnung zur Waschküche. Dann stellte ich den Korb neben das Bügelbrett auf einen Stuhl. Es duftete daraus nach Wind und Blüten. Die Wäsche musste im hinteren Garten auf der Spinne gehangen haben. Doch warum hatte ich Mama fast nie im Garten oder im Haus angetroffen? Ich blickte mich um. Auch auf der 76 Waschmaschine lag ein riesiger Berg getrockneter, noch ungebügelter Wäsche. Mama nahm drei von Papas großen weißen Taschentüchern aus dem Korb und legte sie sorgfältig Seitenkante an Seitenkante auf das Bügelbrett. Dann holte sie die Plastikflasche mit dem destillierten Wasser aus dem Regal. Sie lächelte still vor sich hin. Eigentlich alles ziemlich normal. Ich stand herum, schob mir eine Haarsträhne in den Mund. Dann zog ich sie wieder heraus. Ich sollte damit aufhören. „Mama …“ Sie lächelte mich an, ging mit der Flasche an mir vorbei zu dem Brett, auf dem schon das Eisen heiß wurde. „Geht´s dir gut, Mama?“ Sie befüllte das Bügeleisen, dabei sog sie die Lippen ein – wie immer, wenn sie konzentriert arbeitete. Dann begann sie, mit dem Metall über die Taschentücher zu fahren. Sie arbeitete sich ordentlich von der Mitte aus die Kanten entlang. „Sicher.“ Ihre Fingernägel waren abgekaut. Abgekauter als sonst. Oder schien es nur so? „Mucki, was stehst du so herum, du machst mich verrückt.“ Ich nahm ein Buch von der Lehne ihres abgeschabten Ohrensessels, setzte mich, zog die Knie an: „Der Rächer“, las ich. Hatte sie in den letzten Tagen hier gesessen und gelesen? Sah nicht so aus: Auf einer Seite des Taschenbuch-Bändchens hatte sich quer über das Papier ein Knick gebildet. Das aufgeklappte Buch musste irgendwann zwischen Polster und Lehne gerutscht sein. Wo war sie die ganze Zeit gewesen? Schlotterte ihr Kleid nicht um die Hüften noch mehr als sonst? Hatte sie genug gegessen die letzten Tage? Aber ihr Besteck hatte doch heute früh benutzt in der Spüle gelegen. Und trotzdem … Es war alles 77 Omas Schuld. Oma hatte immer gesagt: wir schaffen das schon, dass nichts durcheinander kommt. Und jetzt? Hatte Oma überhaupt schon mit Mama gesprochen? Wusste Mama, dass Oma mit dem ekligen Herrn Nowottny …? Sie stellte das Bügeleisen ab und begann schweigend die drei Tücher zu kleinen Quadraten zu falten. Es kribbelte mir in den Fingern, ihr eines aus der Hand zu nehmen, daran zu riechen wie früher. Schön war das gewesen, das warme, lavendelduftende Weiß zu entfalten, es über das Gesicht zu legen, den Kopf im Nacken mit geschlossenen Augen ein- und auszuatmen, zu fühlen wie es sich im Luftstrom auf der Haut hob und senkte … „Karl ist ein netter Junge“, sagte Mama und begann, das dritte Taschentuch von der Mitte aus zu glätten. Karl? Ich hatte gedacht, sie wüsste nichts von uns. Was hatte sie plötzlich mit Karl? „Du bist erst 13, Mucki.“ Sie legte den kleinen Stapel der Mini-Quadrate in die rechte hintere Ecke der Kiste. Dann breitete sie auf dem Brett drei weitere zerknitterte Herrentaschentücher aus. „Ich bin fast 14!“ – Karl ging sie nichts an! „Er ist 16“, sagte Mama und strich mit ihren langen Fingern glättend über den Stoff. Sie mischte sich doch sonst nie ein. „Na und? Du bist 43, und Papa ist 46 Jahre“, sagte ich und steckte die Strähne wieder in den Mund. Sie war doch nie dabei gewesen, als Karl und ich uns getroffen hatten. Karl war auch noch kein einziges Mal bei uns in der Wohnung gewesen, so wie ich noch nicht ein Mal drüben bei ihm gewesen war, obwohl er sich das so sehr gewünscht hatte. Ich konnte es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen: er und 78 ich in meinem Zimmer … Ich hatte dort ja kein Sofa, nur die enge Schlafliege, und das war dann auch nicht so praktisch zum Sitzen … „16-jährige Jungs wollen von Mädchen etwas anderes als du meinst.“ Wieder hatte sie zwei Taschentücher fertig gebügelt, die sie liebevoll auf den kleinen Stapel in der Kiste legte. „Das ist normal.“ Was wusste sie von uns? Von mir? Mama interessierte sich doch sonst nur für sich selbst. Karl war außerdem so liebevoll. Er verlangte nichts von mir. Und er verstand immer sofort, wenn ich etwas nicht wollte – zum Beispiel hatte ich nicht immer gleich viel Lust auf diese Sache mit der Zunge im Mund, nicht so viel wie er jedenfalls. Nicht, dass es mir nicht gefiel, es gefiel mir sehr … „In deinem Alter braucht man Zeit“, sagte Mama und breitete eine von Omas Schürzen auf dem Brett aus. – Am liebsten hätte ich sie ihr aus der Hand gerissen. Was fiel ihr ein? Sie, ausgerechnet sie mit ihren 32 Kilo damals, hatte nicht den Schimmer einer Ahnung, was in meinem Alter für ein Mädchen normal war. „Lass mich in Ruhe!“ Sie schwieg. Ich saß mit gekreuzten Armen. Wie stupide sie vor sich hinlächelte. Sie hing fest in ihrer blöden, grässlichen Vergangenheit, die ewig her war, statt zu kapieren, dass wir längst ein anderes Zeitalter hatten – ein friedliches, zivilisiertes, ohne gierige Mongolen hinter Bäumen. Ich hatte schon lange genug von ihren Gruselmärchen. Einmal hatte sie gesagt: „Als ich so alt war wie du, da wusste ich von Männern nur, dass man sich vor ihnen fürchten muss.“ Wie krank war das! Vor Karl musste sich niemand fürchten. Im Gegenteil: Karl passte auf mich auf. 79 Er war für mich da. Karl war der zärtlichste, gütigste Mensch ... Ich sprang auf. Ich hatte keine Lust mehr, mir Vorhaltungen von jemandem machen zu lassen, der offensichtlich keinen Schimmer hatte vom wahren Wesen der Liebe. Ich ging an ihr vorbei zur Tür, griff schon nach der Klinke, als sie mit ruhiger Stimme sagte: „Du darfst nein sagen. Das wollte ich nur sagen.“ Aus dem Augenwinkel sah ich, dass sie sorgfältig die Schürze zusammenfaltete. „Du musst nichts tun, was du nicht willst.“ Ich knallte die Tür hinter mir zu. Papa war acht Tage nach dem Hochsitz-Sonntag wieder fortgefahren. Wie immer hatten wir seinem Mercedes nachwinken müssen, als er abreiste. Wie immer hatte er zuvor Mama einen Kuss auf die Wange gehaucht, Oma die Hand gedrückt und mir die Haare zerdrückt und gesagt: „Sei lieb und hör auf Mama und Oma.“ Das hatte er schon gesagt, als ich noch in den Kindergarten ging. Ich war sicher, er wusste nichts Genaues von Oma und dem doofen Nowottny, nichts von Karl und mir. Als der Wagen um die Ecke gebogen war, ich die Hand sinken ließ und mich, ein letztes Lächeln im Gesicht, auf dem Bürgersteig umwandte, waren Mama und Oma schon verschwunden. Die Haustür stand weit offen. Der kahle, aufgeräumte Flur sah aus, als seien eben, vor wenigen Sekunden, alle Menschen im Haus von den Außerirdischen gekidnappt worden. Ein einzelner Stockschirm war aus dem Zinneimer neben der Tür gekippt. Ich starrte die Messingspitze an. Zeichen eines letzten vergeblichen Kampfes? Hatten sie meine Familie als Souvenir 80 ihres Urlaubstripps mitgenommen? Würde Mama in einem Plexiglaskasten, an dem sich grünliche Schleimhaufen die Nasen platt drückten, schaubügeln müssen? Würde Oma in einem intergalaktischen Fernsehprogramm – bei Todesandrohung – ihr Apfelstrudelrezept verraten müssen? Ich stellte den Schirm zurück an seinen Platz, schloss die Tür hinter mir. Warum hatten sie mich zurückgelassen? Wie meist rief Papa bald schon abends aus irgendeinem Provinzhotel an, um sich von uns sagen zu lassen, dass alles in Ordnung war. Dabei war nichts in Ordnung. Mit dem Hörer in der Hand saß ich auf dem Sessel im Flur, dem ich den blauen Zeh zu verdanken hatte. „Mir? Klar geht´s mir gut. Wieso?“ Ich drehte die Telefonschnur um meinen Finger. „Die kann jetzt nicht. Die ruht sich aus. Glaub ich.“ Ich kaute an einer Haarsträhne: „Weiß nicht, vielleicht schläft sie schon.“ Ich sah einen dünnen Lichtstreif unter ihrer Tür. Warum ging ich nicht in ihr Zimmer? „Oma? Nein, nicht da.“ Ob der Zehennagel wohl abginge? „Altenkreis?“ Ich nickte: „Bestimmt.“ Es schrie aus dem Fernseher in seinem Hotelzimmer. Die gelbe Rosenblüte auf der Anrichte war verwelkt. Merkwürdig: Oma warf sonst alte Blumen immer sofort auf den Kompost. Sie ertrug den Gestank nicht. „Mischka? Keine Ahnung.“ Woher sollte ich wissen, wo sich die Katze herumtrieb? Ich log: „Mischka schläft bei Mama“. Da: jetzt kam im Hintergrund die Erkennungsmelodie des Heute-Journals. Er guckte jeden Abend Heute-Journal. Ich richtete mich erwartungsvoll auf. Das würde er nicht verpassen wollen. „Nein, keine Spur von 81 Regen.“ Ich nickte vor mich hin. „Ja, hmmm, wünsch ich dir auch …“ Das war´s. „Ist gut. Ja, ich grüß alle.“ Ich legte auf und schlich zu Mamas Zimmertür. Die Hand zum Klopfen erhoben, stand ich und lauschte. Nur das Ticken der Uhr war zu hören. Der Sekundenzeiger ruckte stetig und mühsam vor. Nicht ein Laut hinter dem Holz. Eine Minute dauerte ewig. „Mama?“ rief ich. Und als es still blieb noch einmal, leiser: „He, Mama?“ Ich legte die Hand auf die Tür. Tick – Tock, machte die Uhr. „Grüße von Papa“, rief ich schließlich. Dann griff ich nach meinem Hausschlüssel auf der Anrichte und schlüpfte hinaus in die warme Nacht. Ich hörte leises Geflüster aus der Hollywoodschaukel, das sofort abbrach, als ich, vom Garten kommend, die Terrasse betrat. Karl saß dort. Ich hatte es geahnt. Und ich wusste natürlich sofort, wer neben ihm saß. „Hallo“, sagte ich. Über uns stand der Halbmond, unnatürlich groß, zitronengelb, an der inneren Kante merkwürdig ausgefranst. Trotzdem konnte ich unter dem Stoffdach nur Umrisse ihrer Gesichter erkennen. Sie rutschten auseinander, als sie mich kommen sahen. Es blieb mir nichts übrig, als mich zwischen sie zu quetschen. Karl legte seine Hand auf meinen Oberschenkel. Die Schaukel setzte sich quietschend in Bewegung. Es war eng. Unsere Oberarme berührten sich. Ich saß verkrampft, mit geschlossenen Beinen. Karl reichte mir eine Colaflasche, die er im Schoß gehalten hatte. Ich nahm einen Schluck der süßen Plörre, wischte den Flaschenhals ab und gab die Cola an Stefan weiter. „Danke“, sagte er. Seine Stimme klang leicht rau. Sein übergeschlagenes Knie unter den Shorts schimmerte gelb im 82 Mondlicht. Nicht knochig. Wie der Rücken eines freundlichen Tiers. Zusammengerollt. Schlafend. Ich wusste, warum er gekommen war. Ich hätte längst mit ihm reden müssen. Ich hatte sogar schon mehrmals den Telefonhörer in der Hand gehabt. Aber das Telefon hing an der Wand gegenüber von Mamas Zimmer. Ich konnte sein Profil kaum erkennen. Ich schob meine Hände gefaltet zwischen meine Schenkel. Ich hatte ihn angeschrieen nach dem Konzert. Ich hatte ihn einfach vor dem Paulusheim stehen lassen. Ich war losgelaufen, die hitzeflimmernde Straße hinunter war ich gerannt, durch den Rosenbogen in den Stadtpark hinein. Schnell war ich über den Kies gesprintet, immer schneller, als wäre der Teufel hinter der lieben Seele her, wie Oma gesagt hätte. Dabei war Stefan gewiss dort sitzen geblieben, festgenagelt, die kostbare Geige unter dem Arm. Über die Bänke bin ich hinüber, gerannt, gesprungen, gerannt … neun Bänke, fehlerfrei. Und es war mir sogar vollkommen gleichgültig, dass Frau Oskötter mit ihrem Dackel bei der Klosterruine herumlief und hinübergaffte, auch, dass mein Trägerkleid vom Springen hinten einriss, das neue, selbst das hatte mich nicht gekümmert. Erschöpft war ich gewesen an diesem Tag, als ich endlich zu Hause ankam, gerade noch rechtzeitig zum Kassler mit Ananas, das ich dann gar nicht hatte essen mögen … Ich sah in der Dunkelheit nur ein schwaches Aufleuchten, das Weiß seiner Augen. Karl legte seine große Hand leicht um meinen Nacken. 83 „Alles in Ordnung bei euch?“ fragte er. Was meinte er? Meine Familie? Stefan und mich? Worüber hatten sie gerade gesprochen? „Sicher.“ „Bei mir drüben ist nichts in Ordnung“, sagte er. „Alles wie Kraut und Rüben. Wenn das meine Alten sehen. Meine Mutter kriegt einen Anfall.“ Karls Finger der freien Hand klopften einen nervösen Takt auf seinen Oberschenkel. Wie eine scharrende Maus. „Was ist – helft ihr mir morgen putzen?“ Von Stefans Arm strahlte Hitze ab. Überhaupt war die Nacht so warm. Mein dünnes Baumwollkleid schien aus viel zu viel Stoff zu bestehen. Stefan saß eigenartig aufrecht neben mir. Mein Mund war wie zugepappt. „Okay, soviel Begeisterung hätte ich gar nicht erwartet: das Klo mach ich natürlich selbst.“ Karl lachte bollernd, ließ meinen Nacken los und küsste mich dafür leicht auf den Hals. „ … und den klebrigen Küchenboden auch.“ „Ich bin nach dem Frühstück um zehn da“, sagte Stefan ins Dunkel. „Gebongt!“, rief Karl. „Ich wusste es! Danach gehen wir zusammen ins Waldschwimmbad. Du doch auch, Nelly, oder?“ Ich sah Stefans rot-blaue Decke vor mir. Eine ziemlich kleine Decke. „Ich soll morgen Vormittag meiner Oma helfen.“ Die Finger auf seinem Bein bewegten sich immer schneller – furioso, hieß das so? „Dann kommst du eben nach.“ Er lachte fröhlich – „Das wird was …“ – Klirrend stellte er die Flasche auf den Boden, stand plötzlich auf: „Alles klaro.“ Die Schaukel schlingerte. Ich 84 rutschte von Stefans Arm etwas ab. „Ich muss dann mal“, sagte Karl: „Allseits gute Nacht.“ Er lachte wieder. Worüber? Als schwarze Silhouette im Mondlicht stand er vor uns. Wie groß er war. Er zog umständlich an seinem Hemd. Dann deutete er eine Verbeugung an, zwei Finger grüßend in der Luft: „Also denn …“ Wir nickten beide ins Dunkel, sagten im Chor: „Nacht.“ Es war absurd. Es gab nichts, was Karl jetzt, kurz nach zehn, in der leeren Wohnung drüben „musste“. Er wirkte auch nicht müde. Er ging niemals früh zu Bett, das hatte er mir selbst erzählt. Was war das Ganze hier? Einen Moment später hörten wir das Quietschen des Gartentors, seine Schritte auf dem Kiesweg, sein leises, unmelodisches Pfeifen, das wohl bedeuten sollte: „Alles okay – alles im grünen Bereich.“ Dann war nur noch, sehr ferne, das Rauschen der Autobahn zu hören, das nur bei Ostwind rüberwehte. „Was wird das hier? Was habt ihr beide abgemacht?“ Stefan räusperte sich: „Wir sollten reden.“ Erstaunlich bestimmt: „Alleine.“ „Wer sagt das?“ Ich starrte die schwarzen Schatten der Blumenkübel an: Gnome, Wichtel, Drachenköpfe ... Stefan war doch sonst so sanft. So still. Fast schüchtern. Oder nicht? Aus Karls Wohnzimmer drüben fiel jetzt ein schwacher Lichtschein auf den Rasen hinter der löchrigen Hecke. Wir blickten schweigend auf die Lichtinsel. Aufrecht und unbeweglich saß Stefan neben mir. Er kam mir plötzlich größer und breiter vor ohne seine Geige. Was hatte Karl ihm von uns erzählt: „Du, Nelly und ich gehen jetzt übrigens miteinander. Seit dem Sonntag als dein Konzert war.“ Warum 85 saß Stefan hier? Sicher, ich hatte mich nicht gut benommen, aber es gab nun mal Dinge, über die musste man auch nicht dauernd reden. Ich verschränkte die Arme. Es war nun mal nicht gut, immer alles auswalzen. Davon wurde nichts besser. Hätte er nicht auch über anderes sprechen können nach dem Konzert? Die Schule zum Beispiel, seine Reise nach Zell am See zu Beginn der Ferien … Ein Schatten glitt durch den beleuchteten Fleck drüben auf dem Rasen. Was tat Karl gerade? Hatte er den Fernseher angeschaltet? Starrte er, ein Bier in der Hand, mit leerem Blick auf den Bildschirm wie Papa in seinem öden Pensionszimmer? Ich blickte schnell zu Stefan hinüber. Er saß unbewegt. Wartend. Auf mich wartend. „Okay. Tut mir Leid.“ Es sollte nicht so patzig klingen. „Ich hatte das alles nicht sagen wollen. Ich meine, dass du jeden billigen Tratsch nachquatscht und so …“ Ich holte tief Luft. Er machte es mir nicht leichter. „ … dass du ein Idiot bist, der sich in Sachen einmischt, die ihn einen feuchten Dreck angehen.“ Ich konnte seinen Gesichtsausdruck nicht erkennen. „ … ein Arschloch“, schob ich leise nach. Ich sagte sonst wirklich nie solche Sachen. Was musste er von mir denken? Stefan blickte weiter geradeaus. Er hatte Recht. Ich hatte mich mies benommen. Sehr mies. „Entschuldige, ja?“ Jetzt war es doch raus. Worauf wartete er noch? Hatte ich nicht Abbitte geleistet? Was wollte er denn noch von mir? War es zuviel verlangt, dass er mich wenigstens mal kurz ansah, mal nickte? Oder war er so verletzt, weil Karl und ich …? War er deshalb gekommen? Als er plötzlich sprach, konnte ich ihn kaum verstehen, so leise und gleichförmig redete er: 86 „Karl hat gesagt, es bringt nichts. Er sagte: Lass sie. Was soll das? Sie wird es schon irgendwoher erfahren. Oder das Ganze geht vorbei. Was willst du dich da einmischen?“ Wovon, zum Teufel, sprach er? „Ich habe überlegt, ob es ist, weil ich sauer auf dich bin. Aber das ist es nicht. Ich bin mir da sicher.“ Seine rechte Hand strich nun über sein Knie wie sie am Tag des Konzerts über seine Geige gestrichen hatte: ruhig, gleichmäßig, vom Körper weg. Ich hielt die Luft an. „Aber ich muss doch, ich meine, es sagen. Macht doch sonst keiner, stimmt´s?“ Jetzt sah er zu mir. Die Schaukel setzte sich wieder quietschend in Bewegung. Die Ketten, die die Lehne hielten, klirrten. Sein Gesicht konnte ich nicht erkennen. Er hielt mit der Linken seine rechte Hand fest: „ … du musst das doch wissen – von deiner Mutter.“ Ich beherrschte mich, dass ich mich nicht umdrehte in Richtung ihres Zimmers dort hinter uns, hinter dem dritten Fenster, hinter fest geschlossenen Rollläden. Mein Mund war trocken: „Was hat Karl dir erzählt?“ Karl wusste eigentlich nichts. Er konnte nicht viel mitbekommen haben – nur soviel, wie Nachbarn eben wussten. „Nichts“, sagte Stefan. Wenn Karl in diesem Moment aus dem dunklen Badezimmerfenster hinaussehen würde, könnte er die Schaukel sehen, die nun leicht in Bewegung geraten war, unsere Unterschenkel, die Knie etwa zehn Zentimeter nebeneinander. Der Rest bliebe im Schatten des Daches. Ich täte es. Ich an seiner Stelle würde jetzt dort stehen, herüberstarren und langsam durchdrehen. „Flüster-Frau – so nennen sie sie im Ort. Wusstest du das?“ Ich verstand nicht. 87 „Flüster-Frau?“, wiederholte ich blöd. „Weil sie immer so die Lippen bewegt. … bewegt hat, … wenn sie in der Stadt unterwegs war … zum Einkaufen ... oder danach.“ Er sprach zögernd, mit Pausen – als wolle er mir die Möglichkeit geben, dazwischen zu gehen. Stopp zu schreien. Aufzuspringen. Ich rührte mich nicht. „Auch im Park … Sie ist oft im Park ... auch hinter der Neubausiedlung, du weißt schon, auf den großen Rieselfeldern Richtung Hannesheim, die hinter unserem Haus beginnen.“ Ich hatte Mühe ihn zu verstehen. Er sprach so nuschelig. Rieselfelder, was war das? „Lauter“, sagte ich, schluckte. „Die Leute dort kennen sie schon.“ Er artikulierte jetzt besonders deutlich. „Sie lehnt ihr Rad mit den Einkaufstüten immer an denselben Baum auf einem Parkplatz vor einer Brache. Einer Linde. Sie geht spazieren. Sie lächelt dabei.“ Er atmete hörbar aus. „Einer Linde?“ Drüben erlosch plötzlich das Licht. Wir saßen nun im Stockdunkel. Hatte auch der Mond uns verlassen? Ein leichter Wind war aufgekommen. Nun war nur noch ein merkwürdiges leises Sirren zu hören. Insekten? Ich schloss kurz die Augen. Presste die Lider zusammen, bis ich Flimmer sah im Schwarz. Ich – eine lichtlose Kapsel, die in ein schwarzes Loch trudelte, schneller wurde. Immer schneller sauste, ein Geschoss, das aufgesogen wurde, zusammengepresst ... – verschluckt. „Versteh das nicht falsch: Sie wirkt nicht direkt verrückt oder so. Sie ist freundlich. Grüßt jeden. Aber sie flüstert so vor sich hin. Sie bewegt immerzu die Lippen wie in einem dauernden 88 Selbstgespräch.“ Was wollte er mir sagen? Redete ich nicht auch manchmal mit mir selbst? Machten wir so was nicht alle hin und wieder? Konnte schon sein, dass mir so etwas auch passierte: ich ging durch den Ort und erzählte mir eine kleine Geschichte – und ohne dass ich es merkte, na-so-was, bewegte ich dabei die Lippen … „Nicht in Läden“, fuhr er fort. „Beim Einkaufen benimmt sie sich immer ganz unauffällig, soweit ich weiß.“ Dann schwieg er. Ich spürte seinen Blick im Dunklen. Wir schwiegen beide. Ich wusste, er war noch nicht fertig. „So war das …“ Er sollte weiter machen. Ich würde bleiben. Ich würde zuhören. Ich hatte keinen Schiss. Ich nicht. „So war das bis vor kurzem.“ „Ja …?“, nickte ich ins Dunkle. Grillen, die Insekten waren Grillen, ein feines, leises Zirpen. „Es ist nur – seit einiger Zeit spricht sie die Leute an. Laut. In den letzten ein, zwei Wochen. Nicht jeden Tag, manchmal. Sie fragt sie merkwürdige Sachen. Es geht um einen Gebhard. Kennst du Gebhard? Sie sucht ihn. Manchmal hält sie Leute am Ärmel fest.“ „Gerhard“, sagte ich. „Sie fragt Männer, ob sie Gebhard seien. Behauptet steif und fest, sie seien Gebhard.“ „Er heißt Gerhard.“ Ich wollte nicht laut werden. „Nicht Gebhard. – Verdammt! Einfach nur Gerhard.“ Erst als Stefan meinen Kopf zu sich zog, merkte ich, dass mein Gesicht ganz nass war: „Mit r statt b“, murmelte ich und wischte mir mit seinem T-Shirt die Tränen ab. 89 Ich hatte Gerhard immer lieb gehabt. Mama sagte, sie spürte einfach, dass er weiter auf uns aufpasste, wie er es früher getan hatte, als sie sieben war und er vierzehn. Wenn es um Gerhard ging, dann war Mama oft richtig ins Erzählen gekommen, dann sprach sie ganz normal drauflos und ich saß reglos in ihrem Sessel in der Waschküche, eine Haarsträhne im Mund, und hoffte, dass es nicht gleich wieder vorüber war mit der Geschichte: Ein Pimpf in Hitlerjugend-Uniform sei er gewesen, der die bösen Drittklässler vertrieb, die sie nachäfften, ihr „Majorstöchterchen“ nachriefen. Immer wieder habe er ihr gesagt: „Wehren musst du dich, dir Respekt verschaffen, das ist das Wichtigste!“ Der habe immer seinen eigenen Kopf gehabt, sagte Mama versonnen, und ihr Bügeleisen spuckte unterdessen Dampf wie ein wütender kleiner Drache. Selbst von seinem Fähnleinführer habe der sich nichts sagen lassen. Aber obwohl Gerhard doch das Hehre, das Kraftvolle immer so geschätzt habe, und sie doch so eine Zarte, Ängstliche gewesen sei und viel zu oft krank, habe er sich nie geschämt, mit ihr, der kleinen Schwester, Hand in Hand sonntags zur Kirche zu gehen. „Und keiner von seinen Kumpanen hat gelacht, wenn er mit mir durch den Mittelgang ging. Keiner“, sagte Mama. „So war Gerhard!“ und das Bügelwasser tropfte zischend auf den Stoff, ohne dass sie es merkte. An den Sonntagen habe sie dann ihm zum Dank immer ihr schönstes Kleid angezogen, lange sei es das Blaue gewesen, das mit dem Samtkragen und dazu weiße Spitzenhandschuhe, die ihr Vater ihr aus Paris mitgebracht habe. – „Du sollst was hermachen, meine Kleine“, das habe 90 der Gerhard immer gesagt: „Wir sind schließlich nicht irgendwer.“ Und ich nickte. Wenn Mama Fernsehen schaute, erkannte sie in allen Männern, die gut aussahen oder zu Kindern nett waren, etwas von Gerhard wieder. „Schau nur, schau“, sagte sie dann und krallte ihre Hand plötzlich in mein Knie: „ … genau so hat Gerhard immer gelächelt“, oder: „Siehst du diesen Gang, Nelly? Die federnden Knie? Genau wie er, weich, selbstbewusst. Wie er.“ Sogar an wildfremden Männern, die an unserem Haus vorübergingen, meinte sie Ähnlichkeiten zu erkennen. Dann rief sie von der Küche aus: „Komm schnell, komm: da!“ Und sie zerrte mich zum Fenster: „So sah Gerhard aus!“ Und ihre Finger tockten so fest gegen die Scheibe, dass ich Angst hatte, der Mann würde sich umdrehen, würde sehen, dass wir ihn angafften. Eigentlich benahm sich Mama, wenn es um Onkel Gerhard ging, ziemlich oft wie Desiree. Sie war „wie von Sinnen“, konnte offensichtlich „ihre Gedanken nicht mehr ordnen“. Keine Frage – auch Mama war „bis ins Mark ergriffen“. Dabei war sie doch gerade Elf gewesen, als sie Gerhard zum letzten Mal gesehen hatte. Und er war knapp Achtzehn, als die Granaten ihn zerfetzt haben. „In Stalingrad verheizt wie Millionen“, das hat Omas Bruder Onkel Fritz gesagt, als er mal zu Besuch war. „Der da, dein Onkel“, hat er gesagt und hat mit dem Fingernagel aufs Glas des kostbaren Bildes geklopft, „der hat sich aus purer Dummheit noch freiwillig für den Fronteinsatz gemeldet, da war längst alles verloren. Muss man sich mal vorstellen: Freiwillig. Zu einem Himmelfahrtskommando“, sagte er. „Himmelfahrtskommando“, ich war damals Neun und 91 das Wort hatte mich an das wunderbare Bild von Marias Himmelfahrt in unserem dicken Kunstlexikon erinnert, an Prozessionen, wie die, die Mama und Papa auf ihrer Hochzeitsreise in Italien gesehen hatten, an den Geruch von Rosen und Orangen und an geschmückte Altäre in südlichen Straßen, von denen Mama erzählt hatte. „Lass das, Fritz“, hatte Oma, die plötzlich in der Tür gestanden hatte, ihn angefahren. Sie hatte ihm das Bild aus der Hand genommen und es mit einem Zipfel ihres Kittels abgewischt. Onkel Fritz kam danach nur noch selten von Bayern hoch zu uns, weil Oma es nicht mochte, dass er Mama „mit seinen respektlosen Reden“ aufregte. Ich aber mochte den Himmelfahrtsonkel Gerhard nach diesem Besuch womöglich noch lieber. Und wenn Mama nach ihren Bügelgeschichten verstummt war und nur noch zu hören war, wie das Eisen sprotzend über den Stoff fuhr, blieb ich mucksmäuschenstill sitzen. Ich schaute sie bloß glücklich an. In diesen Momenten war ich doch auch sicher: Er war hier bei uns, um uns beizustehen. Ich stand auf dem Kiesweg, der von der Straße zu unserem Haus führte und rupfte Blätter vom Essigbaum ab, die durch den angrenzenden Drahtzaun vom Nachbargrundstück herüber wuchsen. Sie waren groß und etwas pelzig, und es war ein angenehm kribbliger Schmerz, wenn ich sie – zum Büschel zusammengefasst – gegen meine nackten Beine schlug. Die Haut rötete sich ein bisschen. Früher lebte drüben hinter den Bäumen noch ein dünner alter Mann, der immer, wenn ich an den Ästen der Bäume und Büsche riss, durchs 92 Fenster seines Hauses schaute. Nie sagte er etwas, aber sein Blick war so traurig, dass ich eiligst davon lief, wenn ich ihn hinter dem Vorhang sah. Die Hütte stand längst leer, Mauern und Dach waren von Efeu und Brennnesseln überwuchert. Ich brach mit schlechtem Gewissen einen noch größeren Zweig des Essigbaums ab, rupfte die Blätter ab. Als ich noch nicht zur Schule ging, hatte ich hier oft vormittags an der Hecke die Feuerkäfer beobachtet, hatte geübt, die großen Brennnesselblätter anzufassen ohne dass sie brannten oder hatte Weinbergschnecken von den Büschen abgesammelt. Es war schön gewesen, ihnen eine Schneckenrennbahn zu bauen und zu beobachten, wie sie sich ans Ziel vorkämpften. Wenn man den Kies mit der Kuppe der Sandalen auseinander schob, kam roter Rennbahnsand zum Vorschein. Die spitzen Steinchen bildeten an den Seiten einen Wall, über den die Schnecken nicht so leicht ausbüchsen konnten. Irgendwann hatte ich es erkannt – wenn man Schnecken zusah, verging die Zeit schneller. Betrachtete man, wie sie ihre zarten Fühler mit den schwarzen Augenpunkten suchend umher gleiten ließen und Steinchen um Steinchen mit ihrem runden, schleimigen Bauch überwanden, kamen einem ihre Bewegungen gar nicht mehr langsam vor. Im Gegenteil – ihre Art, die Blätter so systematisch in sich hineinzukraspeln, sich über alle Hindernisse hinweg einen Weg zu suchen, erschien plötzlich als einzig angemessene Form, klar zu kommen. Es war ein Trick, den ich selbst entdeckt hatte: Man musste bloß lange und genau genug hingucken auf irgendeine komische Art zu 93 leben, sich total blind machen für alles drum herum, schon war eigentlich nichts mehr wirklich merkwürdig. Ich hatte lange keine Weinbergschnecken mehr auf dem Weg gesehen, nur die wabbeligen roten Nacktschnecken. Selbst die hässlichen Feuerkäfer waren weg. Nur dicke Waldameisen krabbelten wie früher über meine Füße, kaum, dass ich eine Minute irgendwo stand. Es war ein dicker Blätterstrauß geworden, ich konnte die Stängel kaum noch umfassen. Als ich klein war, hatte ich Mama fast jeden Tag solche Sträuße gebracht: Blätter, Efeu, Gemüse, abgerupfte Blumen aus dem Stadtpark. Zum Schluss hatte ich mein kleines Kunstwerk immer mit einem Halm verknotet, dann war ich glücklich in die Waschküche gestürmt: „Der ist für dich!“ Sie hatte das Bügeleisen zur Seite gestellt, hatte den Strauß entgegengenommen, hatte gelächelt – genau wie bei Papas Blüten. Sie hatte daran gerochen wie an einem köstlichen Parfum. Dabei stank das Grünzeug ungefähr wie nun meine Hände: säuerlich-schal. Wir waren gemeinsam in die Küche gegangen und ich hatte ihr zugesehen, wie sie Wasser in ein altes Senfglas laufen ließ, das Unkraut darin sorgsam arrangierte. Ich schlug mit dem Blätterbusch härter zu, so fest wie ich konnte. Schon in Erwartung des Schmerzes kniff ich die Augen zu – einmal – ein weiteres Mal – noch fester? … Es tat nicht sonderlich weh. Erschöpft lehnte ich am Zaun, starrte hinüber. Wie still und abweisend unser Haus aussah, wenn die Vorhänge zugezogen waren. Vielleicht hatten die Außerirdischen heute mehr Erfolg bei ihrem Kidnapping gehabt. Bestimmt waren sie 94 diesmal über die Terrassentür gekommen und hatten einen gigantischen Staubsauger mitgebracht. Vielleicht hatten sie den großen Rüssel in die Diele gehalten, auf AN gedrückt und alles organische Leben innerhalb dieser grauen Mauern in ein quittengeleeartiges Wabbelzeug verwandelt. Dann hatten sie das Ganze eingesaugt, über einen Schlauch in den Souvenirtank ihres Raumschiffs gepumpt, das sie auf dem Rasen vor der Wäschespinne geparkt hatten. Seelenruhig hatten sie den Schlauch eingezogen, waren eingestiegen und – tttschrummmm – waren sie abgezischt und niemand hatte etwas gemerkt. Urlaub vorbei. Mitbringsel gut verpackt. Zu Hause würden sie das Ganze zum Vorzeigen zurückverwandeln müssen in Mama, Oma und Mischka. Hoffentlich käme dabei nichts durcheinander. Und Karl? Wo steckte er überhaupt? Für gewöhnlich war er vormittags zu Hause. Ausgerechnet heute, nach diesem Abend, war er wie vom Raumschiff verschluckt. Ich hatte gleich nach dem Aufstehen bei ihm geklingelt, geklopft, war wie eine Einbrecherin ums Haus herum durch den fremden Garten geschlichen, in dem noch immer wespenumschwirrte Kiepen mit Äpfeln unter den Bäumen standen. Er hatte noch nicht den Rasen gewässert, dabei stellte er sonst immer noch vor dem Frühstück den Sprenger an; das hatte er seinen Eltern vor ihrer Abreise versprechen müssen. Ich stand auf der Wiese und blickte ratlos zum ersten Stock hinauf: Normalerweise waren bei ihm alle Fenster weit geöffnet und nur die weißen Stores bewegten sich leicht im Wind. Doch nun regte sich nichts. Alle Fenster geschlossen, selbst die dicken Vorhänge waren zugezogen – gerade so wie bei uns 95 und Behrens. Nicht die kleinste Bewegung. Waren seine Eltern womöglich früher zurückgekommen? Aber der Mercedes stand nirgends. Wollte er noch einmal zu seiner Tante und ich hatte vergessen, dass er davon erzählt hatte? Wieder ging ich zur Haustür, drückte auf den Klingelknopf, lauschte dem langgezogenen Kling – Klong. Ja, ich bückte mich sogar, öffnete die Briefklappe in der Tür und horchte. War da noch ein anderes Geräusch? Ein winziges Räuspern? Leise barfüßige Schritte auf Linoleum – die plötzlich stoppten? „Karl“, rief ich durch die Klappe: „Bist du da?“ Stille. Totale Stille. Oder doch nicht? Ich hatte vor dem Schlitz gekauert, hatte gemeint, irgendwo dort drinnen in dieser riesigen, dämmrigen Höhle ein einsames Atmen zu hören. Als ich noch klein war, hatte ich die Blätter auch zu winzigen Päckchen gefaltet, bevor ich sie in den Mund gesteckt hatte. Im ersten Moment fühlte es sich komisch an, wenn die Zunge an das Pelzige kam. Man musste schnell zu kauen beginnen, das war wichtig. Das Gekaute schmeckte saftig und bitter, ein bisschen wie Oliven mit Seife. Mamas Fahrrad lehnte nicht mehr an der Mauer hinter dem Haus, ich hatte nachgesehen. Vermutlich hatte sie es jetzt an dieser Linde im Neubauviertel angeschlossen, vermutlich irrte sie zwischen den Hochhäusern herum und sprach Leute an. Vielleicht waren es Eltern von Kindern, die in meiner Klasse waren, mit denen sie redete, Menschen, deren Töchter ich zu meinem Geburtstag hatte einladen wollen. Wohnte nicht Irene in der Siedlung? Irene, die Tratschkuh, die alles und jedes rumerzählte. Und Oma? Die war bei ihrem Widerling. Die 96 kümmerte das alles nicht. Musste der nicht überhaupt auch mal arbeiten? Für Geld Perlendes spielen in den Häusern von anderen Kindern und andere Omas verführen? Das nächste Blattpäckchen kostete weniger Überwindung, wie bitterer Salat … Oma hatte früher geradezu riechen können, wenn irgendwas faul war. Wenn ich Scharlach bekam, hatte sie schon drei Tage früher „so ein Gefühl“. Einmal, als wir in der ersten Klasse diese schreckliche Vertretungslehrerin bekamen, die uns immer mit einem Stöckchen auf die Finger geschlagen hatte, war es Oma, die nach ein paar Tagen gesagt hatte: „Ich glaube, heute gehe ich mal mit in die Schule. Dieses Fräulein Ehrenberg muss ich mir, glaube ich, mal ansehen.“ Dabei hatte ich zu Hause kein Wort gesagt. Und wenn Mama eine „schwierige Zeit“ hatte, wie Oma immer sagte, dann war Oma tage- und wochenlang ganz zufällig immer in ihrer Nähe gewesen. Auf Oma war immer Verlass. Und jetzt? Dabei war sie doch schließlich da, um auf alles aufzupassen! Als ich das dritte Päckchen in den Mund steckte, schloss ich die Augen: Spinat! Ich stellte mir vor, ich aß gewöhnliche Spinatblätter … „Was machst du da eigentlich?“ Karl stand auf dem Weg, breitbeinig in Shorts und Hemd, unsere Leiter auf der Schulter und betrachtete mich argwöhnisch. „Alles in Ordnung mit dir?“ Er lehnte die Leiter an unsere Hauswand. Meine Hand ging zum Mund. Doch Karl war schneller. Er fuhr herum, sah mich an, sah noch das Grüne, das ich gerade in die Handkuhle spuckte. Ich wandte den Blick ab, wischte die Finger hinten an 97 meiner Hose ab. Als ich wieder zu ihm linste, starrte er mich noch immer entgeistert an. Ich rieb mir über die Lippen. „Komm mit“, befahl er. Ich stolperte schweigend hinter ihm her auf die kleine Straße, vorbei an der Pforte, die zu seinem Haus führte, weiter zu dem Trampelpfad, der hinter den Garagen hindurch zu den Feldern führte. Er könnte ja mal etwas sagen. Ich blaffte ihn an: „Wo warst du überhaupt heute Vormittag?“ Plötzlich packte er meine noch feuchte Hand und zog mich mit sich. Mein Arm tat ein bisschen weh, aber ich jammerte nicht. War es nicht genau das, was ich gewollt hatte? Dass er auftauchte aus dem Nichts, dass er mich holte und rettete, wie die Geliebten Desirees im Moment der Gefahr auf ihren stolzen Rappen herangallopiert kamen, sie im vollen Schwung um die Taille fassten, emporhoben und davonritten, dorthin, wo alles Böse schwieg und es schön war, unter eine zarte Birke, wo gelbe Primeln und tiefblaue Hyazinthen blühten … Wir stapften über ein Kartoffelfeld. Wollte er mit mir zum Hochsitz? In mein Lieblingswäldchen? Wie fest seine Finger mein Handgelenk umschlossen! Was wurde das für eine Wanderung? Musste ich ihm denn alles aus der Nase ziehen? „Wo willst du überhaupt hin?“ Er zerrte mich einfach weiter. Meine Finger fühlten sich an wie im Schraubstock. „Weißt du, was furchtbar ist, Nelly? Selbstmitleid ist furchtbar. Das macht dich kaputt. Verstehst du das?“ Er sprach einfach ins Blaue, sah mich nicht mal an: „Das kriegt dich klein. Das frisst dich an. Mach das nicht, Nelly!“ Er beschleunigte seinen Schritt. „Karl! Lass mich los!“ 98 „Weißt du, was ich mache, wenn ich mies drauf bin?“, rief er. „Ich gehe hinaus – hierher. Ich laufe eine Stunde oder so über die Felder, ich bewege mich, ich merke, wie ich Luft hole …“ Ich wurde von Schritt zu Schritt wütender. „So! Pass auf – So hol ich Luft …“ Und er schnaufte ganz merkwürdig, fast wie ein Schluchzen klang es. Was sollte das Ganze? „Karl, was machst du da? Was willst du überhaupt? Warum lässt du mich nicht in Ruhe?“ In meinem Hals saß jetzt ein dicker Kloß, der raus wollte. Raus musste. „Was redest du für einen Scheiß? Das, was wichtig ist, darüber willst du nicht reden: Sie ist verrückt! Kapierst du nicht: Meine Mama ist verrückt und du hast es auch gewusst. Du hast mit Stefan drüber geredet. Und mit wem noch? Mit deiner Tante? Mit Behrends von nebenan?“ Ich hasste seinen abweisenden Rücken. „Oder wissen sowieso schon alle längst Bescheid, nur ich nicht? Ich bin die einzige Idiotin, die keine Ahnung hatte, dass sie immer mehr abdreht, ja?“ Er löste seinen Griff so plötzlich, dass ich fast über einen Feldstein gestolpert wäre. Unbeirrt stapfte er davon, Blickrichtung stur geradeaus. Ich hatte Mühe, auf dem sandigen Boden hinter ihm herzustolpern und dabei sein gepresstes Gemurmel zu verstehen: „Ja, ich geb´s zu: auch ich heule manchmal auf irgendeinem verdammten Hochsitz, aber ich gehe raus, ich tue was dagegen … Deswegen will ich Förster werden. Deswegen, weil es nichts Besseres gibt, als hier draußen zu sein, rumzurennen, nichts besseres, um den ganzen Mist zu vergessen.“ Er stieg mit einem großen Schritt über einen rostigen Zaun: „Man darf sich nicht kleinkriegen lassen, 99 verstehst du das, Nelly?“ Dann drückte er den Draht für mich mit der Hand hinunter: „Von niemandem.“ Ich kletterte darüber, erwiderte dabei den Blick seiner funkelnden Augen. Von welchem Mist redete er? „Vater, Mutter, Kind, denkst du. Alles in Ordnung. Karl Ehm, Mama Ehm. Papa Ehm. Das schöne Haus. Urlaub am Tegernsee. Alles schön!“ Vor uns erstreckte sich eine Weide, in deren Mitte eine riesige Eiche stand. Er ging weiter, lief auf den großen Baum zu, redete in seine Richtung: „Ich weiß doch, was los ist bei euch. Ich weiß, wie´s dir geht, glaub mir. Es ist schrecklich, ich weiß es. Es ist die Hölle.“ Er drehte sich abrupt um und starrte mich an: „Sie streiten den ganzen Tag, meine Eltern. Sie schreien sich nur an. Seit Jahren, wusstest du das?“ Schimmerten seine Augen etwa feucht? „Manchmal tritt er sie sogar. Richtig fest. Von hinten in den Rücken.“ Er drehte sich um und ging weiter. Ich lief schneller, lief ihm nach. „Er hat eine andere. Schon seit langem“, murmelte er. Ich überholte ihn. Wir waren vor dem Baum angekommen. Ich stellte mich vor ihn, mit dem Rücken zum Stamm. „Deshalb sind sie am Tegernsee. Mein Onkel ist Anwalt dort. Sie wollen alles regeln: Wo was hinkommen soll: Ich, das Geld, die Couchgarnitur, der Scheiß-Mercedes …“ Erschrocken sah ich ihn an. Streckte ihm automatisch eine Hand entgegen. Er kam auf mich zu, ignorierte sie, legte stattdessen seine großen Hände um meine Oberarme, drückte zu, presste mich fest an sich. Sein Körper, stark, breit, groß, drängte sich an mich: sein Becken, Hüftknochen, das Harte zwischen seinen Beinen … und die Rinde bohrte in meinen Rücken. Seine Lippen fühlten sich anders an als sonst – nass, gespannt, kalt. Ich spürte seine Zähne, die Hand an 100 meinem Kopf, seine Zunge, die machtvoll versuchte, den Widerstand meiner Zähne zu brechen, vorzudringen … Ich versuchte ihn abzuschütteln, gab unwillige Geräusche von mir, fühlte den harten Druck seiner Daumen in meinen Armen, wand meinen Kopf hin und her, kämpfte mit dem Fleisch in meinem Mund. Dann, von einem Moment auf den anderen, ließ er von mir ab, trat einen Schritt zurück. „Entschuldige“, stammelte er. „Ich wollte doch nicht …“ Er stolperte einen Schritt nach hinten: „Nelly: Bitte …“ … Ich lief über die Felder, stapfte mit verschränkten Armen über den Sand, rannte fast und wusste doch eigentlich, dass er mir nicht folgen würde. Ich kroch unter dem Zaun hindurch, trampelte wütend die Brennnesseln im Feldrain herunter, nicht achtend, ob sie durch meine dünnen Söckchen stachen. Nein, ich würde nicht heulen. Ich zog die Nase hoch, wieder und wieder, lief über eine Wiese, nicht zurückschauend auf Karl, der da bestimmt noch herumstand, starrte. Ich wollte fort sein, eingesogen, verschluckt, verwandelt, weggebracht in eine fremde Galaxie, auf einen weißen, sanften Planeten, der mich aufnehmen würde wie ein großes, weiches Federbett. Ich umrundete eine alte, verrostete Egge, kletterte wütend über einen Haufen alter Autoreifen, dort vorne war es schon, das Wäldchen, in dem ich verschwinden konnte. Nun trabte ich wirklich los, lief über eine Schafsweide; die Augen gesenkt sprang ich über Maulwurfshügel, über federnden Grasboden. Guckte er mich an? War das sein Blick, der so brannte in meinem Rücken, als hätte er noch das Recht mir 101 nachzuglotzen, meinen dicken Waden, der doofen Mädchenart zu rennen, dass der Busen komisch hüpfte. Nadelwald, der Boden trocken und weich, voller rötlicher Kiefernnadeln. Ich trabte weiter, zwischen den Bäumen hindurch, trabte, lauschte dem Knacken der Stöckchen unter meinen Sandalensohlen. In den schattenblauen Raum drangen Lichtflecken ein, die grell vor meinen Augen tanzten. Ich hörte mein Atmen, das Keuchen, spürte ein spitzes Stechen in der Leiste, den dumpf-pochenden Schmerz dort, wo seine Daumen sich fest eingedrückt hatten in meine Oberarme, und immer hätte ich so weiter rennen wollen. Die Hand in der Seite lief ich einen sanften Hang hinauf, doch die Puste ging mir aus, ich musste langsamer werden. Japsend stützte ich mich schließlich an einer großen Kiefer ab. Den Kopf an der Rinde, atmete ich tief ein: Harz – der Kindheits-, Onkel-Gerhard-, der Freiheitsgeruch. Ich drehte mich um, starrte in den Wald. Schmale, rötliche Stämme wiegten sich im leichten Wind. Keine Spur von Karl. Natürlich. Ich rutschte langsam, den Rücken am Baum, auf die Erde hinab, saß mit angezogenen Knien. Irgendwo rief ein Kuckuck. Einmal, zweimal, dreimal … „Der Wald ist dein Freund“. Das hatte Mama vor ein paar Monaten plötzlich gesagt, und sie hatte merkwürdig dabei geklungen. Sie hatte beim Bügeln inne gehalten und mich angesehen, als ob sie mir etwas Entscheidendes mitteilen müsste: „Die Märchen lügen!“ Ihre leicht zittrige Hand hatte zärtlich über das Geschirrtuch gestrichen, es sorgfältig gefaltet: „Ihretwegen denken wir immer, der Wald sei die Gefahr, der Ort, an dem die böse Hexe auf uns wartet – 102 Kobolde, böse Geister – dabei ist es genau umgekehrt. Die Menschen sind es, die nicht gut sind. Du wirst es noch sehen.“ Dann hatte sie meinen Blick gesucht, mich mit ihren blauen, leicht geröteten Augen fixiert: „Merk dir eins: Der Wald ist dein Freund, was auch immer passiert!“ Sie sortierte das Tuch in den Korb, ehe sie weiter sprach: „Er hat uns das Leben gerettet, immer wieder. Wenn die Russen uns gesucht haben – betrunken sind sie jeden Abend von Haus zu Haus gegangen, haben gerufen: „Frau! Frau, komm Frau!“ – dann waren wir längst im Wald. In Sicherheit. Verstehst du?“ Und sie hatte weiter gebügelt: „Du wirst nicht gesehen. Das Laub, Äste, warme Erde – du findest etwas, um dich gegen die schlimmste Kälte zu schützen …“ Sie hielt inne: „Nur der Winter. Dieser schreckliche Winter, der Schnee …“ Sie stand wie erstarrt, das Bügeleisen in der Luft. „Mama …“, sagte ich vorsichtig. Und ganz behutsam stellte sie das Eisen ab, blickte mich überrascht an. Dann nickte sie langsam wie aus einer Trance erwachend: „Ja, der Wald … es ist immer genug da, um nicht zu verhungern: Beeren, Pilze, selbst Rinde betäubt den Hunger. Nur die Angst vor der Dunkelheit musst du besiegen, aber, glaub mir, irgendwann begreift man es: sie ist schön, die Dunkelheit. Sie schützt.“ Und ein Lächeln war über ihr Gesicht geglitten: „Sie schützt vor so vielem …“ Ich ließ mich tiefer in das warme Nadelbett gleiten, bis ich auf dem Rücken lag; über mir durch das wogende Geäst hindurch zogen die Stare, ein großer Schwarm. Ich zählte bis zweiundsiebzig, bis da nichts mehr war als Blau. Sie wussten, wohin sie mussten. 103 Das feine Pieksen auf der Haut war fast schön. An Insekten würde ich einfach nicht denken. Ich rollte mich ein, schob beide Hände zwischen meine Schenkel, schloss die Augen. Ein einzelner Sonnenstrahl brannte auf meinen unteren Rücken. Wieder rief der Kuckuck, viermal. Und ein leises Rauschen fuhr durch meinen Kopf und nahm alle Gedanken mit fort … Als ich die Haustür aufschloss, hörte ich es schon: Oma saugte Papas Zimmer. Ich folgte dem Geräusch, lehnte mich in den Türrahmen, betrachtete ihren Rücken. Sie hatte meine Lieblingskittelschürze an, die rote mit den grünen Streifen, die Schleife hinten war akkurat gebunden. „Schönen Gruß von Papa. Er kommt doch erst morgen.“ Woher wusste sie, dass ich hinter ihr stand? „Was lungerst Du überhaupt hier herum?“ rief sie. „Mach dich nützlich. Du kannst die Papierkörbe leeren.“ Sie wuchtete den Rasenbelüfter zur Seite. Als ich nicht antwortete, drehte sie sich mir zu, betrachtete mich von oben bis unten: „Wie siehst du überhaupt aus? Du hast ja den halben Wald im Haar?“ Ich schüttelte den Kopf, blickte an ihr vorbei. „Du bist erst 13! Vergiss das nicht.“ „Makalewski war letztens hier“, rief ich. „Wer?“ Der Staubsauger war so laut, dass ich fast schreien musste: „Makalewski, der Penner. Ich meine der „Mann in Not aus den Baracken.“ Merkwürdig, die Männer schauten sonst selten im Sommer bei uns vorbei. Oma bückte sich und fuhr mit der schmalen Aufsatzdüse unter den Kleiderschrank: 104 „Und? Hast Du ihm was gegeben?“ Ich betrachtete ihren gestreiften Hintern: „Warum lässt du Makalewski und die anderen Trippelbrüder immer zu uns rein?“ Ich stellte mich neben sie. „Und warum fragst Du sie immer alle aus, Oma?“ Sie fuhr mir fast über die Füße: „Weil sie Hilfe nötig haben. Warum sonst! Du stehst im Weg.“ Ich trat einen Schritt zurück: „Warum fragst Du sie immer, wen sie gesehen und getroffen haben, als ob du jemanden suchst? Warum willst du wissen, wo sie überall waren, wer noch in der Gegend unterwegs ist – warum. Oma?“ Sie zog den Sauger unter dem Schrank hervor und machte ihn aus. Dann riss sie den Stecker aus der Buchse: „Hast Du nichts anderes zu tun, als mich vom Arbeiten abzuhalten?“ Sorgfältig legte sie sich Kabelschlingen um ihren Arm. „Es ist wegen Gerhard, nicht wahr? Du suchst ihn.“ Ihre Hand hielt inne. „Gerhard ist tot.“ Eine Feststellung. Dann fuhr sie mit ihrer Arbeit fort. Ich wartete und schwieg. Sie hing die Schlingen sorgfältig an den Haken am Gerät. „Willst du nicht noch rausgehen vor dem Essen?“ Sie lehnte den Staubsauger an die Wand und ging zum Fenster: „Schön ist es, richtig schön. Ich glaube, es kühlt sich doch etwas ab ...“ Diese Stille ohne den Staubsaugerkrach. Ihr breiter Rücken regte sich nicht. Hielt sie den Atem an? In der Spiegelung sah ich ihr weißes Haar. 105 „Ich denke doch auch oft, dass Gerhard kommt, Oma. Er könnte uns helfen, nicht wahr?“ Sie öffnete jetzt beide Fensterflügel weit: „Uns braucht niemand zu helfen, Nelly-Kind. Wir kommen gut zurecht.“ Sie drehte sich langsam zu mir, lächelte: „Mach dir mal keine Sorgen.“ „Wenn er jetzt aber doch …“ „Onkel Gerhard ist 1942 vor Stalingrad gefallen. Basta.“ Ich ging auf sie zu. „Aber ihr habt ihn doch nie für tot erklären lassen. Onkel Fritz hat gesagt, Ihr hättet sonst viel mehr Lastenausgleich bekommen. Und dann dieser Brief vom Roten Kreuz. Wenn er jetzt doch in Gefangenschaft … Ihr habt es nicht gemacht!“ Sie schlug das Fenster so energisch zu, dass es schepperte: „Onkel Fritz! Was versteht der von Lastenausgleich! Onkel Fritz redet viel, wenn der Tag lang ist.“ Warum war sie so wütend? „Geh jetzt. Geh spielen!“ Ich kam noch näher. „Wahrscheinlich war er in Sibirien! Wie Makalewski! Sie haben Zigtausende verschleppt. Haben wir in Geschichte gehabt. Vielleicht ist er verletzt worden. Ist entstellt. Er schämt sich. Oder er hat sein Gedächtnis verloren. Weil er einen Stein auf den Kopf bekommen hat in einem Bergwerk zum Beispiel …“ „Hör sofort damit auf!“ Sie hielt sich die Ohren zu. „Aber Oma: Stell dir nur mal vor – ein Geruch, ein Geräusch und – zack – alles ist wieder da, und er macht sich auf den Weg zu euch, zu uns …“ „Was redest Du da …“ Sie kam auf mich zu. Aber ich blieb stehen. 106 „Vielleicht ist es einer von den Männern in Not, vielleicht sogar ein Kumpel von Makalewski. Er ist sogar genauso alt! Oder er kennt Gerhard. Hast du ihn danach gefragt?“ Jetzt ließ ich mich nicht mehr stoppen. Ich wusste, ich war auf dem richtigen Weg: „Du wartest doch auch auf ihn. Wie Mama! Du weißt es genau: Sie wird nie wieder richtig normal, wenn Gerhard nicht endlich kommt.“ Sie hob die Hand, kam näher. Ich wich zurück vor ihren wilden Augen, doch ich musste einfach weiterreden: „Aber das ist Dir ja jetzt nicht mehr wichtig. Du bist ja nur noch dauernd weg. Du willst uns ja auch gar nicht mehr helfen. Du schaust einfach zu, wie alles durcheinander kommt. Wie sie herumirrt, Selbstgespräche führt, sich nur noch verkriecht … Du bist lieber bei diesem alten Schleimer, diesem hässlichen …“ Ihr Schlag traf mich mitten ins Gesicht. Ich starrte sie fassungslos an, rieb mir Wange und Nase, die brannten wie Feuer. Oma hatte mich noch nie geschlagen. Niemals. Sie kramte sofort in ihrer Schürzentasche nach einem Taschentuch. Da sah ich etwas im Augenwinkel. Ich drehte mich um: Hinter mir stand Mama. Ihr Lächeln war merkwürdig verrutscht. Ich streckte reflexartig die Arme aus, trat einen Schritt auf sie zu. „Hallo, Mama“. Oma führte das Taschentuch zu ihrer Nase, als wolle sie sich schnäuzen: „Inge, Liebes …“. Doch Mama drehte sich um, ging davon. Verwirrt blickte ich ihr nach. Was hatte sie vor? „Los!“ Oma gab mir einen Schubs in den Rücken. Ich stolperte Mama hinterher. Oma nickte aufmunternd, als ich mich umblickte. Ich ging durch den Flur zur Waschküche. Mein Gesicht glühte, meine Knie zitterten, aber plötzlich war ich sehr erleichtert, 107 dass Mama da war. Sie stieg vor mir zwei Treppen zur Waschküche hoch, trat durch die Tür. „Mama, weißt du, ich wollte sowieso …“ Ich holte tief Luft. Ich hatte keinen Schimmer, was ich sagen sollte. In der Tür wandte sie sich zu mir um. Dann tat sie etwas, was sie noch nie getan hatte. Sie schloss die Tür und drehte vernehmbar zweimal den Schlüssel herum. Mit einem hellen Kiesel konnte man Muster malen auf die roten Sandsteinstufen: Ringelschlangen, Punkte, fremdartige, geflügelte Wesen, sich verschlingende Wege nach Nirgendwo … Ich hatte, den Kopf gesenkt, ewig auf den Stufen der Musikschule gesessen. Mittwoch um diese Zeit hatte Stefan Geigenunterricht. Gleich würde er die Treppe herunter kommen. Doch er kam nicht. Niemand kam. Als ich mich zu wundern begann – überhaupt war es so still – stieg ich hinauf zum Tor. Ich versuchte die große Messingklinke herunter zu drücken. Verschlossen. Natürlich, ich hätte es wissen können, in den Ferien machte auch die Musikschule Sommerpause. Warum hatte ich nicht längst nachgesehen, wo er blieb? Ratlos schaute ich die leere Straße hinunter. Eigentlich fast gut, dass keiner da war. Ich wollte nicht, dass meine Nase und meine Augen so rot aussahen, ich wollte nicht, dass Stefan mich jetzt so sah – oder seine doofe Schwester – oder noch schlimmer: mein Gemeinschaftskundelehrer! Ich konnte niemanden treffen! Nicht jetzt. Ich trottete die Straße entlang, an den niedrigen Hecken der gepflegten Vorgärten und den mannshohen Toren vorbei. Eine Gehwegplatte, nächste Gehwegplatte, nicht auf die Rillen treten. Nichts denken, 108 nichts fühlen – nur hier sein, Fuß vor Fuß setzen. Zehn Schritte Schatten, ein paar Schritte Sonne, acht Schritte Schatten. Alle Häuser sahen ähnlich aus: Rauputz, der Windfang aus Glasbausteinen, drei Fassadenfenster – zwei unten, eines oben – das spitze Dach. Hinter vielen Toren bellten Hunde. Der dort knurrte hinter der schmiedeeisernen Vier auf dem Holztor, war der schwarze Dobermann mit Maulkorb, der sonnabends immer vor dem Edeka angekettet war. Auf einem Dach wehte eine Deutschlandflagge, in einem Garten drehten sich winzige Windmühlen, dann kam Nr. 17. Natürlich guckte ich zu dem Fenster unten rechts. Das mongoloide Kind. Von Oma wusste ich, es konnte eigentlich um diese Uhrzeit nicht daheim sein. Seit ein paar Monaten wurde es morgens von einem Kleinbus weggebracht und abends wieder abgeliefert. Sie hatte die Stimme gesenkt, als sie es erzählte. Und ich hatte zurückgeflüstert: Ob sie es mal wieder gesehen hätte? Ob es noch so dick war? Sie hatte genickt. Als ich noch zur Grundschule ging, liefen die Kinder auf dem Schulweg extra an Nr. 17 vorbei. Alle wollten es ansehen. Auch ich hatte oft am Zaun gestanden. Den Ranzen schief auf einer Schulter, hatte ich zum Haus hinübergestarrt. Wir redeten nicht darüber, aber wir wollten wieder sehen, wie es uns, halb versteckt hinter den Stores, mit offenem Mund so anglotzte ohne jemals sein Gesichtchen, sein fleischiges, altersloses, zu einem Lächeln zu verziehen. Immer war es die Oma des Kinds gewesen, die uns dann mit einer müden Handbewegung weggescheucht hatte, bevor sie das Kind vom Fenster, von unseren Gaffblicken, fortzerrte. Aber oft 109 konnten wir uns erst losreißen, wenn wir kurz drauf auch noch dies leicht winselnde Geplärre aus den Tiefen des Hauses hörten. Erst dann schlappten wir weiter der Schule entgegen, schweigend meist, doch manchmal legte später im Unterricht einer von uns seine Finger in die Augenwinkel, machte „Chinesenaugen“, blies die Backen auf und ließ halb eine dicke Zunge heraushängen. Dann kicherten wir – und schlugen, irgendwie erschrocken, die Hände vor den Mund. Ich hatte das Kind noch niemals draußen gesehen, nicht im Vorgarten, nicht auf dem Spielplatz, nicht an der Hand der Erwachsenen in der Stadt. War es das, was mich plötzlich aufschluchzen ließ, als ich vor der Nr. 17 stand, wo die dicken Vorhänge zugezogen waren wie bei uns? Plötzlich sah ich es vor mir: das einsame Kind, das all die Jahre in diesem Haus eingesperrt war, Stille, das Ticken der Uhr, die dämmrigen, vollgestellten Zimmer, in die nie andere Kinder kamen, um mit ihm zu toben und zu spielen, die traurige Großmutter als einzige Gesellschaft – wo waren eigentlich die Eltern? Schniefend schleppte ich mich die heiße, schweigende Straße entlang nach Hause. Wie hatte ich bloß immer so grausam sein können? Wie hatte ich nur mitlachen können? Ich wusste ja nicht mal, ob das arme Kind ein Junge oder ein Mädchen war. Nicht mal das hatte mich interessiert! Ich dachte immer nur an mich, an meine lächerlich kleinen Sorgen. Deshalb hatte ich auch Mama nie helfen können. Ich tat nicht, was nötig war für meine Mutter. Statt mit Karl herumzuknutschen, hätte ich nach ihr sehen müssen, ich hätte ihr Gesellschaft leisten, hätte nachsehen müssen, ob sie genug isst, ob sie 110 irgendwo Lebensmittel versteckt hält …Ich hätte verhindern müssen, dass alles durcheinander kommt. Ich stolperte ums Haus herum zu meiner Hollywoodschaukel, kroch unter die Haube. Sofort fühlte ich mich wie in einem sumpfigen Teich unter Wasser. Alles schimmerte unter dem Plastik grün und roch modrig-dumpf. Ich drehte mich vom Rücken auf den Bauch und vergrub das schon wieder schweißfeuchte Gesicht im Polster der Hollywoodschaukel. Stank das Kissen nicht nach Herrn Nowottnys Eau de Cologne? Angewidert richtete ich mich auf. Warum hatte ich diesen Ort nur je geliebt? Alles war fremd geworden und nichts als Stille hinter geschlossenen Türen. Alle außerirdisch verreist; was aus mir wurde, war weltenweit niemandem wichtig. Es hatte sich nicht mal jemand die Mühe gemacht, heute früh die Plane über der Schaukel zu entfernen, dabei war gar kein Regen in Sicht. Überhaupt: warum regnete es nicht endlich einmal? Warum kam er nicht, der erste Frühnebel, die erste nächtliche Kälte? Es war fast September, aber die Hitze pappte wie ein nasser, schlapper Lappen. Warum konnte der Sommer nicht aufhören? Der Herbst sollte endlich beginnen mit Altweibersommer, Blätterwirbel und Kastanien auf der Straße. Es sollte sein wie letztes Jahr: Erntedankfest in der Kirche mit Omas Kürbissen vor dem Altar, Sturmböen, die über die leeren Kartoffeläcker tobten, dass der Sand noch auf dem Rathausplatz zwischen den Zähnen knirschte, dann Sankt Martin, Nikolaus, Weihnachten … ja: wenn bloß bald Weihnachten wäre! Oma sollte Kokosmakronen backen und Anisplätzchen und die Kugeln aus dem Keller holen. Ich würde gerne wieder in die Schule 111 gehen, Scheiß-Algebra lernen, sogar meinen herumschreienden Chemielehrer ertragen, im Handarbeitsunterricht Stuhlschoner häkeln, Weitwurf üben ... Und nachmittags könnte ich zum Turnen gehen oder mit hochgezogenen Knien im Ohrensessel in der Waschküche sitzen und Mama zum Erzählen bringen. Nur Klavierspielen, das würde ich bestimmt nie mehr. Ich wollte, dass Herr Nowottny mit der Hitze für immer verschwand wie die Außerirdischen, nachdem sie ihre Sommersouvenirs wieder dort abgeliefert hatten, wo sie sie geholt hatten. War da etwas? Schritte? Rascheln von Blättern? Ein leises Räuspern? Oder hoppelte nur der Igel, der unter dem Ginster wohnte, über die Terrasse? Ich hielt den Atem an. Konnte man unter der Abdeckung womöglich meine nackten Füße sehen? Vorsichtig zog ich die Knie etwas höher, schon rasselten leise die Ketten. Sofort hielt ich inne, horchte. Nichts. Nur das Gezwitscher der Vögel. Trotzdem: Ich war jetzt sicher, keinen Meter entfernt, stand jemand auf der Terrasse. Ich saß still. Da hörte ich es, dies Atmen. Nun wusste ich, wer es war. Ich kannte viele Arten, wie er atmete: wie er Luft einsog, wenn er nachdachte, wie er förmlich Energie trank, wenn er draußen war bei den Tieren. Ich hatte seine kleinen Atemstöße an meinem Ohr so gemocht, wenn er von hinten versuchte, meinen Hals zu küssen. „Nelly?“ – es war ein fragendes, zögerndes Nelly, ein Nelly mit gesenktem Kopf, das mich überraschte. „Bist du da?“ Ich rührte mich nicht, atmete mit ihm gemeinsam. Sah er meine rechte Fußspitze? Ich rollte die Zehen ein. „Nelly, du musst zuhören!?“ Was bitte konnte ich hier auch sonst tun? „Nelly, 112 hörst du?“ Ob er jetzt wieder seine Hände in den Hosentaschen vergrub, ob er von einem Bein aufs andere trat? „Ich weiß doch auch nicht, warum …“ Fast trotzig. Dann schwieg er. Ob sich meine Knie unter dem Plastik abzeichneten? „Nelly: ich finde dich gut. Wirklich.“ Tiefes Einatmen „ … du bist mir total wichtig … bloß … ich meine, du bist so furchtbar jung.“ Ach nein?! Wenn ich Fünfzehn oder Sechzehn gewesen wäre, hätte ich bestimmt auch nicht gewollt, dass er so ist, dass er so … mich so gegen meinen Willen ... Wieder brannten meine Augen. Was hatten bloß alle immerzu mit meinem Alter? Er zog hilflos die Luft hoch. Die Stille dehnte sich. Stille und Hitze – Ich schwitzte grässlich unter den Armen, atmete mit offenem Mund, weil meine Heulnase verstopft war. Zudem kroch ein prickelnder Schmerz mein rechtes Bein hoch. Bestimmt würde ich gleich einen Krampf in der Wade bekommen. „Vielleicht zu jung …?“ Ganz vorsichtig versuchte ich das Bein ein paar Millimeter nach links und rechts zu bewegen. Sofort war das schabende Geräusch am Planenstoff zu hören. „Nelly“, rief er und trat hörbar einen Schritt näher: „Ich hätte nicht … hey, ich weiß das doch!“ Verdammt noch mal, warum sagte er nicht, was er zu sagen hatte? „Ich meine, …“, er atmete tief ein, „es ist nur, weil …“ Sag, dass es dir Leid tut und dann geh. „Ich muss doch weg.“ Was redete er da? „Meine Tante hat es mir erzählt. Sie haben sich so geeinigt. Meine Mutter will, dass ich mit ihr zu meiner Tante nach Ulm ziehe. Schon bald. Schrecklich bald. Schon im Herbst.“ 113 Am selben Abend begann der Angriff. Ich hatte mich gezwungen etwas zu essen. Ich hatte alleine in der Küche gestanden, hatte an einem Wurstbrot gekaut, als ein jäher Schmerz mich zusammenzucken ließ. Ich hatte den Fuß geschüttelt, doch da war etwas. Ein Gewicht. Etwas, was an meinem Strumpf hing: ein Tier, das sich verbissen hatte! Entsetzt hüpfte ich auf einem Bein, doch es ließ nicht von mir ab. Mit Schwung kickte ich es in die Luft. Es flog im weiten Bogen gegen den Kühlschrank, prallte ab, fiel auf die Kacheln. Eine Maus berappelte sich und huschte zur Tür hinaus. Als ich mich umschaute, sah ich im Augenwinkel einen Schatten. Ich drehte mich um: Eine weitere graue Maus glitt von der Anrichte auf den Boden. Irgendwas hatte sie im Maul. Jetzt erst sah ich, dass eine Klappe des Büffets nur angelehnt war. Und ich entdeckte noch etwas: Köttel. Kleine schwarze Mauseköttel. Sie lagen auf der Arbeitsfläche, direkt neben dem Brotkasten, aus dem ich doch eben noch – völlig in Gedanken – eine Schnitte genommen hatte. Als ich die Schranktür aufklappte, zitterten mir bereits die Hände vor Ekel. Da sprang mir, ungefähr in Brusthöhe, eine Maus entgegen. Schreiend stolperte ich rückwärts, knallte gegen den Blechmülleimer und rief so laut ich konnte: „Maaaamaaa!!!“ Ich rannte durch die Diele, riss die Tür zur Waschküche auf und starrte sie an. Sie saß im Schein einer kleinen Lampe in ihrem Ledersessel neben dem Bügelbrett, ein Buch im Schoß, und lächelte. Als ich vorhin nach ihr gerufen hatte, hatte sie nur durch die geschlossene Tür geantwortet, sie habe schon gegessen, ich solle mir etwas aus dem Kühlschrank nehmen. 114 Ich hatte nicht gewagt, die Klinke zu drücken, hatte Angst, es könnte abgeschlossen sein. Ich blickte auf ihren Schoß, auf das Federbett auf ihren Knien. Kaum anzunehmen, dass ihr kalt war bei mindestens 25 Grad im Zimmer. Wollte sie hier schlafen? schoss (es) mir durch den Kopf, dann stammelte ich: „Mäuse! Überall im Haus sind Mäuse. Ich habe eben in fünf Minuten drei Stück in der Küche gesehen. Wer weiß, wie viele es sind. Sie scheißen überall hin!" Sie lächelte noch immer und schüttelte sachte den Kopf. „Sie tun nichts. Wenn sie satt sind, verschwinden sie wieder. Wie die Ratten damals im Zimmer bei Tante Gertraud. Aber für Babys können sie gefährlich werden, die Ratten. Wenn sie sie anknabbern, meine ich …" Sie erwiderte lächelnd meinen fassungslosen Blick, „an den Zehen zum Beispiel. Oder die Finger, die fressen sie manchmal. Und dann der Typhus, verstehst du?“, Sie legte ihre Hand auf den Schutzumschlag: „Kopfläuse sind auch grässlich und Wanzen erst. Wanzenbisse tun schrecklich weh, hast Du das gewusst?" Dann nahm sie ihr Buch wieder auf: Der Handtuchmörder. Täuschte ich mich, oder war die linke untere Ecke des Schutzumschlags angenagt? „Du?“ Ein Strahlen glitt über Karls Gesicht, als er mich in seiner Haustür stehen sah. Ich zog an seinem Arm, schüttelte den Kopf: „Du musst kommen!“ Er schlüpfte in seine Latschen und folgte mir über den Kiesweg. Unablässig redete ich auf ihn ein: „Mäuse, eklige, unzählige – Mäuse, die kacken, und fressen und beißen und Krankheiten übertragen.“ Er sah mich von der 115 Seite an. „Mäuse“, schrie ich fast. „ bei uns zu Hause!“ Ich ging ihm voran durch die Haustür, zum Besenschrank. Ich hängte einen Blecheimer über seinen Arm, streckte ihm den Schrubber entgegen. Er legte seine große Hand auf meinen Unterarm. Ich zog ihn weg, wendete mich ab. Karl folgte mir mit dem Schrubber in die Küche. Ich begann sofort, die Türen der Küchenschränke aufzuklappen, Geschirr und Vorräte auszuräumen. „Worauf wartest du?“ Ich zerrte Mehl-, Rosinen-, Zuckertüten hervor: „Schau dir das an! Schau bloß mal her!“ Karl blieb unschlüssig in der Tür stehen, betrachtete mich. „Diese schwarzen Körnchen hier – alles Mausekacke.“ Triumphierend hielt ich ihm ein Marmeladenglas unter die Nase, auf dessen Deckel mehrere Köttel lagen. Mein Blick ging zum Büffet: „Pack an!“ Mit vereinter Kraft schoben wir es von der Wand ab. Ein grauer Schatten huschte an Karls Füßen vorüber: „Was hab ich dir gesagt: Jetzt siehst du´s selbst!“ Begriff er denn nicht: Feinde! Und: „Da!“ schrie ich, zerrte an seinem Hemd und stolperte mit dem Besen der Maus hinterher, die plötzlich wieder aufgetaucht war, nun dreist im Türrahmen saß. Auch Karl stürzte sich nun mit gestrecktem Schrubber auf das Vieh, doch der Eimer an seinem Arm kam scheppernd meinem Besen ins Gehege. Der Besen fiel um, der Eimer krachte zu Boden, die Maus war weg. „Verdammt!“ Warum war er so ein Idiot? Ich lief der Maus hinterher, rannte im Zickzack durch die Wohnung, die Zimmerecken mit Blicken absuchend. „Wir müssen die Möbel abrücken“, schrie ich, und zog schon an einer Schmalseite an der Anrichte, die sich keinen Millimeter rührte. „Dahinter sitzen sie. Garantiert.“ 116 „Das hat doch keinen Sinn“, sagte Karl und fasste dennoch an der anderen Seite an. Spielend hob er das Eichen-Ungetüm an und wuchtete es einen halben Meter in den Raum hinein. Ich beugte mich über das Möbel, starrte auf einen abgebrochenen Bleistift, Murmeln, einen verschrumpelten Apfel und einen dicken, grauen Staubflusenknäuel, in dessen Mitte sich etwas bewegte: „Den Eimer“, schrie ich: „Den Eimer – schnell!“ Doch als Karl ihn über das graue Etwas gestülpt, eine Illustrierte zwischen Boden und Eimer geschoben, dann das Ganze vorsichtig angehoben und die Zeitung entfernt hatte, war nichts weiter darin als grauer, verfilzter Staub. Kopf an Kopf starrten wir in den Eimer, während ich mit dem Bleistift in dem Staubgeflecht herumhackte. Karls Haar roch leicht nach Wind und Äpfeln. Mir war elend. „Weiter“, rief ich: „Das Klavier!“, und riss ihm den Eimer aus der Hand. Wir öffneten den Klavierdeckel, wir leuchteten mit der Taschenlampe auf messingfarbene Seiten, wir wuchteten das Instrument millimeterweise von der Wand ab. Kniend betrachtete ich im Taschenlampenkegel die kleinen schwarzen Köttel vor der verstaubten Fußleiste. „Wir müssen saugen“, rief ich. „Alles voller Dreck. Bakterien. Hol den Staubsauger.“ Wir schoben Schränke und Kommoden durch die Wohnung, hingen sogar den Spiegel ab, fegten Kotkügelchen zusammen, saugten, spurteten mit Eimern voller Spülwasser in der Hand durch die Zimmer. Irgendwann hielt mir Karl eine Limoflasche vors Gesicht: „Trink wenigstens etwas.“ Ich schüttelte energisch den Kopf, zwängte mich an ihm vorbei. Mein Herz raste im Jagdfieber. 117 Ich musste sie besiegen. Sie waren scheinbar überall. Wie war es nur möglich, dass wir nichts von ihnen bemerkt hatten? Mit dem Handrücken wischte ich mir feuchte Haarsträhnen aus der Stirn. „Hier! Komm her“, rief ich triumphierend und blickte hasserfüllt in zwei dunkelbraune Knopfaugen: „Schnell.“ Ungerührt putzte sich die Maus ihre Pfoten, keinen Meter von mir entfernt. Das also war er, der Gegner. Wie unscheinbar sie waren, wie klein, ja so winzig, dass man lange an ihnen vorbeisehen konnte, doch im Verborgenen eroberten sie immer mehr Raum, sie vergifteten schleichend unser Leben, unsere Familie, bis wir untergingen … Als Karl in der Tür erschien, war sie bereits in einem schmalen Spalt unter der Schrankwand verschwunden. Wir verschlossen ihn, zur Sicherheit gleich mit mehreren Brockhausbänden. „Weiter“, rief ich, richtete mich so schnell auf, dass sich vor meinen Augen kurz alles drehte und Karl, erschrocken über mein Taumeln, mein Handgelenk fasste. „Geht schon“, rief ich, entzog meine Hand und begann bereits damit, weitere Bücher aus dem Regal zu zerren, denn ich bildete mir ein, auch auf dem Brett verräterische Köttel gesehen zu haben. „Es tut mir echt leid, Nelly, hast du das verstanden?“ Er musste direkt hinter mir stehen: „Das auf dem Feld tut mir total leid!“ Er betonte jedes Wort, als sei ich taub. Karl hätte längst hinter dem Sofa saugen sollen. „Nelly, bitte …“ Wir verloren Zeit. Ich drehte mich um, nahm ihm wortlos den Staubsauger aus der Hand und drückte auf „AN“. Lautes Dröhnen setzte ein. 118 „Du kannst mit den Büchern weitermachen“, schrie ich und zog das Gerät hinter mir her. „Wir werden nachher noch das Sofa umdrehen müssen.“ Wir mussten doch sicher gehen, dass sie keine Nester in den Polstern gebaut hatten. Als ich schon begonnen hatte, die Blumentöpfe von der Fensterbank zu räumen, war Karl es, der plötzlich „Hier!“ rief und mit dem Schrubber in einer Zimmerecke wild hin und her fuhr. Ich stürzte zu ihm. Diesmal hatten wir Erfolg. Zwei kleine graue Bestien trieben wir mit unseren Jagdwaffen in vielen Haken durch den ganzen Raum, dann durch die Terrassentür hinaus in den Garten. Wir verriegelten so schnell, als wären es Ungeheuer, die durch das Glas durchbrechen könnten. Erschöpft ließ Karl sich in einen Sessel fallen. Sein staubiges Gesicht war gerötet. Schweigend sah er mich an. Ich lehnte mich noch immer mit dem Rücken an die Tür, rang nach Luft. Er beugte sich langsam vor, streckte seine Hand aus. „Komm doch mal her, Nelly …“ Ich schüttelte nur schwach den Kopf. Dann ließ er sich in die Polster zurücksinken, schloss die Augen. Was war nur plötzlich geschehen? Alles löste sich auf. Nicht mal die schreckliche Katze war mehr da. Sicher lag sie irgendwo dort draußen und wartete, dass alles gut würde. Aber nichts würde mehr gut. Die Uhr tickte. Es war längst spät abends. Ich stand auf und zwängte mich durch den Flur, der nun voller Möbel stand, Treibgut einer Katastrophe. Die Tür zur Waschküche war angelehnt – wie ich sie vor Stunden verlassen hatte. Mama war in ihrem Sessel eingeschlafen. Die Decke und das Buch waren von ihren Knien gerutscht. Ihr Kopf lag sonderbar verrutscht auf der Seite. Noch immer brannte die Leselampe. 119 Auf dem Bügelbrett putzte eine Maus sorgfältig ihre Vorderpfoten. Ich lehnte den Kopf an den Türpfosten. „Was ist hier los?“ Der energische Ton ließ mich zusammenzucken. War ich eingenickt? Die Maus war verschwunden. Hatte ich sie nur geträumt? Neben mir stand Oma. Sie hatte noch den kleinen gelben Hut auf, die Abendtasche energisch unter den Arm geklemmt. „Sagt mir mal einer, was hier passiert ist.“ Ich wusste am nächsten Tag nicht mehr, wie ich ins Bett gekommen war. Ich erinnerte mich noch, dass Oma Karl nach Hause geschickt hatte, der unvermittelt neben mir gestanden hatte. Was war nur in mich gefahren? Dieser Tränenstrom und all die Worte, von denen ich nicht wusste, woher sie so plötzlich kamen. Ich wusste nur noch, ich hatte mich an Omas Schulter geklammert, als sie vor mir stand: „Was los ist?“ schrie ich: „Das weißt du ganz genau! Du bist schuld. Es ist alles Deine Schuld. Mama wird verrückt. Und überall die Mäuse.“ Mama sah unter ihrem Federbett erschrocken zu mir auf. So schmal sah sie aus, so schutzlos, doch ich hatte einfach weiter schreien müssen: „Alles, alles ist jetzt durcheinander gekommen. Und ich will gar nicht erwachsen werden. Ich will niemals erwachsen werden. Das ist schrecklich, dann wird man so wie ihr. Dieser parfümierte Kerl. Du bist doch alt: Uralt!! Warum machst Du das? Lässt dich von dem begrapschen. Lässt uns allein. Ihr sollt doch auf MICH aufpassen. Und ich will niemals bluten und auch keine Vorlagen. Ich will, dass ihr endlich für MICH da seid...“ 120 Als Oma mir am kommenden Morgen das Frühstückstablett ans Bett brachte wie damals, als ich Masern hatte, sah sie fast aus wie früher. Über dem schönen gelben Kleid trug sie ihre Kittelschürze und an den Füßen ihre Latschen. Nur die Haut unter ihren Augen schimmerte bläulich. „Der Kammerjäger ist da“, sagte sie. „Mischka ist erst mal drüben bei Karl. Pass gut auf, wo Du hintrittst, wenn Du ins Bad gehst – wegen der Fallen.“ Auf dem Teller lagen drei belegte Brötchenhälften und ein Apfel, geschält und in gleichmäßige Achtel geschnitten. Oma zwang mich sonst, die Äpfel mitsamt Schale zu essen. Ich trank vorsichtig einen Schluck dampfenden Kakao. Mir tat alles so Leid. Im Gehen wandte sie sich um: „Ach, ja. Karl war schon hier. Er will unbedingt zu dir“. Besorgt musterte sie mich. „Ich hab ihm gesagt, dass du Ruhe brauchst.“ Kein verschwörerisches Augenzwinkern, kein Grinsen mehr. Ich nickte dankbar. Als sie fort war, zog ich das Laken über den Kopf und atmete meinen abgestandenen Atem und den warmen, etwas schweißigen Schlafgeruch ein. Schon jetzt war es stickig im Zimmer. Ich lag wie früher, wenn ich nicht aufstehen und zur Schule gehen wollte. Ich schloss die Lider über den Augäpfeln, die sich anfühlten wie in Sand paniert. Wo war Ulm? Irgendwo im Süden. Weit weg? Warum konnte ich nicht immer hier im Bett bleiben? Ich hatte mir als Kind oft vorgestellt, ich hätte beide Beine in Gips wie Tine damals, nachdem sie als Mutprobe von der Großen Grabenbrücke gesprungen war. Ich hatte es mir immer wunderbar gedacht: Die Stille des Hauses, Tabletts mit Fruchtschnitzen und Kakao, Omas große Hände auf dem Schutzumschlag des 121 Märchenbuchs, aus dem sie las, bis mir langsam die Augen zufielen – und wenn ich sie wieder öffnete, würde ich Mamas sanftem Lächeln begegnen … Ich richtete mich auf und griff mein Buch auf dem Nachttisch. Ich las: „(Kitschiger Ausschnitt aus Desiree)“ Warum meldete sich Stefan nicht? Mit wackligen Knien setzte ich mich an den Mittagstisch, als wäre ich zum ersten Mal nach langer Verbannung wieder in Gesellschaft. „Mama ruht sich aus“, sagte Oma und stellte eine dampfende Auflaufform vor mich hin – Nudelauflauf, mein Zweitlieblingsgericht nach Backhähnchen. „Ich hab ihr mein Zimmer oben gegeben. Sie kommt später runter.“ Oma setzte sich auf ihren Stuhl gegenüber und faltete die Hände im Schoß: „Komm, Herr Jesus …“. Ich tat es ihr automatisch nach und senkte den Kopf. „ … segne, was du uns bescheret hast“, als sei jede Mahlzeit gesegnet gewesen wie zu jener Zeit, als ich Omas Beterei noch für eine alberne Verzögerung des Essens hielt. Der Auflauf roch nach Hack, Tomaten, zerlaufenem Käse. Würde Oma jetzt wieder sein wie früher? Doch in meinem Hals saß etwas Sperriges, als hätte ich einen ihrer Scotch-Brit-Schwämme verschluckt. Oma sah mich von der Seite an: „Keine Sorge: alles soweit sauber.“ Sie verteilte Auflauf auf unsere Teller: „Ich sag dir, das war eine Plackerei!“. Sie hatte in der Nacht die Küchenschränke wieder eingeräumt, angefressene Tüten weggeworfen, gewischt, die Möbel zurechtgerückt. Ich blickte mich um. Selbst die Fußleisten 122 blitzten. Ihr Kopf ruckte in Richtung Flur: „Sie sind aus Mamas Zimmer gekommen“, sagte sie. Und mir wurde klar, dass weder Karl noch ich gewagt hatten, diese Tür zu öffnen. „Im Bettkasten haben sie sich vollgefressen“, sagte Oma und strich mit dem Löffel den Käserand in der Auflaufform glatt. „Hunderte, hab ich gedacht! Und jetzt stell dir bloß vor: Gerade mal 27 von den ollen Dingern hat der Kammerjäger gefangen: Siebenundzwanzig. Und das war´s.“ Sie steckte den Löffel aufrecht in die Mitte der Form – wie den Mast eines Segelboots. Wir schwiegen. Sie goss mir ein Glas Milch ein. Vorsichtig führte ich den ersten Bissen zum Mund. Kochendheiß. Ich hustete mit halb geöffnetem Mund, ließ die Gabel sinken: „Hat vielleicht jemand für mich angerufen?“ Omas Hände fuhren rhythmisch über ihre Oberschenkel. „Matschiges Obst, braun-verfaulte Kartoffeln, grün gewordene Wurstscheiben, Maden … alles im Bettkasten.“ Normalerweise drängte sie mich immer sofort zu essen, damit nichts kalt wurde. Sie zog den Löffel wieder heraus, strich über die Käsefläche: „Bett abgezogen, alles durchgewaschen. Möbel abgerückt. Der Kammerjäger hat mit angepackt. Gleich Teppichschaum auf den Nadelfilz, die Leisten mit ATA abgerieben …“ Wieder steckte sie den Löffel in die Käsewüste. „Verwestes Hühnerfleisch weißt du, woran dieser Geruch erinnert?“ Sie blickte aus dem Fenster. „Es gibt Gerüche, die vergisst man niemals.“ Ich saß still. Plötzlich suchte sie meine Augen: „Deine Mutter kann so vieles nicht vergessen, verstehst du?“ Und dann roch ich es auch. Die Wohnung wurde noch immer von dem Geruch durchzogen. 123 Ich war sicher, es drang durch die Ritze unter Mamas Zimmertür, es war nur ein Hauch, aber unerträglich: süßlicherstickend. Ich führte die Serviette zur Nase. „Du musst essen, Kind. Mein Gott, vor lauter Reden haben wir noch keinen Bissen angerührt“. Die Übelkeit stieg langsam in mir hoch. „Oma, wir müssen etwas tun.“ Sie erwiderte meinen Blick. Sie sah plötzlich so ungewohnt müde aus. „Wegen Mama.“ Wann hatte ich ihr das zuletzt gesagt? Es konnte noch nicht lange her sein. Ich sprang auf, holte tief Luft, schluckte: „Du musst Papa anrufen.“ Sie schüttelte leicht den Kopf, sah mich dabei an. Wir wussten beide: Er hatte noch niemals eine Tour abgebrochen. Er wollte es nicht. Immer sagte er, wir bräuchten schließlich die Provision. Sie hatten ihn noch nicht mal angerufen, als ich nach dem schlimmen Fahrradunfall an meinem achten Geburtstag drei Tage mit Gehirnerschütterung liegen musste. Ich stand vorsichtig auf: „Entschuldige“. Langsam verließ ich das Zimmer. In der Tür drehte ich mich um: „Ich will, dass du das heute machst …“ – Dann stürzte ich ins Bad. Oma saß in ihrem braunen Cordsessel, Mama und ich auf dem Sofa. Es war wie früher. Fast. Ein maskierter Täter hatte von Herrn Kessler 50.000 Mark gefordert. Außerdem war seine Frau Kamilla verschwunden. Wir guckten Derrick. Mama war tatsächlich gekommen. Seit dem Abend, als sie „Was bin ich?“ geguckt hatte, und ich oben Omas Geheimnis durch das Zuckertütchen aufgespürt hatte, hatte der Fernseher beinahe immer geschwiegen. Ich hatte es nicht 124 einmal bemerkt. Sonst schauten wir fast jeden Abend, Oma immer, Mama meist und ich oft. Ich zog die Beine hoch, rutschte noch ein wenig weiter hinüber zu Mama. Ich spürte die Wärme ihrer Hüfte an meinen Füßen. In einem Schälchen lagen Salzstangen. Salzstangen halfen gegen Übelkeit, sagte Oma. Ich hatte sie oben in der Anrichte gefunden. Die Packung war ganz unbeschädigt gewesen. Ich hatte das Gebäck in ein Schälchen gelegt, und den letzten Käse in Würfel geschnitten und auf ein Brett gehäuft. Es sah schön aus. „Der hat die Kamilla nicht entführt“, sagte ich knabbernd, und meinte den Mann mit der Maske. „Der ist zu alt. Die Folge heißt doch „Kamillas junger Freund.““ Draußen war es noch hell, aber Oma hatte die Jalousien fast völlig runtergelassen und die Stehlampe angeknipst. Es war gemütlich wie im Herbst, nur die Fensterflügel standen offen wegen der Hitze, die noch immer kaum nachgelassen hatte. „Möchtest du auch?“ Ich streckte Oma das Schälchen hin. Sie hatte mir vor etwa einer Stunde Magentropfen gegeben, die tatsächlich halfen. Dafür schmeckte nun in meinem Mund alles nach Krankenhaus. Ob sie schon mit Papa gesprochen hatte? Ihre Hände wühlten in der Schale. Mir war, als wiche sie den ganzen Nachmittag schon meinen Blicken aus. Ein Pistolenknall. Erschrocken blickten wir auf: Hatte der Alte geschossen? Omas Fuß auf dem Polsterhocker wippte, wie immer, wenn es im Fernsehen spannend wurde. Ich betrachtete Mama: Ihre nackten Unterschenkel unter dem etwas zerknautschten Kleid, das sie schon gestern getragen hatte; ihr Haar, das immerhin 125 gekämmt war. Aber ich wusste, dass es Oma war, die ihr vorhin in der Diele, als ich noch Käse geschnitten hatte, einen Kamm in die Hand gedrückt hatte: „Mach dir mal ein bisschen die Haare, Inge“, hatte sie geraunt. Mama lächelte unbestimmt in Richtung Fernseher. Sie sah aus, als ob sie fröstelte. „Möchtest du vielleicht deine Decke?“ Ich zerrte das Wollplaid unter mir hervor und legte es um sie, doch es glitt sofort wieder von ihren Schultern. Hatte das Telefon geklingelt? Ich horchte. Wohl doch nicht. Saß Stefan jetzt auch vor dem Fernseher? Derrick zeigte an einer Kneipentheke Fotos einer schönen blonden Frau herum. Ob Mama von dem Film überhaupt etwas mitbekam? „Was meinst du, Mama – lebt Kamilla überhaupt noch?“ Sie schüttelte schwach den Kopf und ihre Hand suchte tastend wie die einer Blinden nach dem Schüsselchen. Ich nahm es vom Tisch und hielt es direkt unter ihre Finger. Sie griff nach einer Salzstange und führte sie vorsichtig zum Mund ohne den Blick vom Bildschirm zu wenden. „Die ist längst mausetot“, sagte Oma, „von dem alten Kessler vergewaltigt und abgemurkst.“ Oma verschränkte die Arme: „Wirst schon sehen.“ Ich war den Nachmittag in meinem Zimmer gewesen, hatte versucht zu lesen. Zweimal hatte es an der Tür geklingelt. Mein Herz hatte wild geschlagen, aber beim ersten Mal hatte ich mich gezwungen, liegen zu bleiben. Vermutlich war es sowieso nur einer von Omas Männern in Not. Trotzdem hatte ich halb erwartet, dass ich Omas Schritte vor meiner Tür hören würde, doch alles war still geblieben. Als es zum 126 zweiten Mal geklingelt hatte, war ich aufgesprungen und zum Fenster gelaufen, von dem aus ich Kiesweg und Eingangsbereich überblicken konnte. Karl. Ich huschte hinter die Gardine, betrachtete seinen irgendwie traurigen Rücken. Es war nicht zu verstehen, was er sagte, doch Oma, die vor die Haustür getreten war, hob die Hände und schüttelte energisch den Kopf. Einmal konnte ich kurz sein Gesicht im Halbprofil erkennen. Plötzlich drehte er sich in meine Richtung und tastete mit Blicken die Fassade des Hauses ab. Schnell duckte ich mich. Als ich mich wieder aufrichtete, ging er unten am Küchenfenster, keine drei Meter unter mir, vorüber. Ich schob meinen Kopf vor bis meine Stirn das Glas berührte: Wenn er jetzt hinauf schaute, würden unsere Blicke sich treffen. Warum hatte ich nicht nach ihm gerufen? „Oma, hat eigentlich jemand für mich angerufen?“ Sie beugte sich zu mir hinüber, packte meinen nackten Arm: „Was hab ich dir gesagt?“ Harry zog aus der Mülltonne des Alten ein blutiges Messer und ließ es vor Derricks Augen in eine sterile Plastiktüte gleiten. Als der Alte verhaftet, das Salzstangenschälchen leer und ich wieder alleine im Zimmer war, blieb ich einfach weiter auf dem Sofa sitzen. Blicklos starrte ich in das bewegte Bunt. Erst, als nur noch das Testbild flimmerte, stand ich schwerfällig auf und drückte den Aus-Knopf. Ein Bitzeln kam aus dem Kasten. Dann war nur noch das Zirpen der Grillen draußen zu hören. Ich tappte blind zum Sofa, ließ mich wieder auf die Polster fallen, rutschte langsam in die Waagerechte und zog mir Mamas Wolldecke zum Bauch. Im letzten Blaugrau erkannte ich, wie durch die Löcher in den Jalousien das Schwarz 127 hineindrang. Ich schloss die Augen. Ich. Das Zimmer. Über mir diese dünne Hülle aus Stein und Glas. Darüber nichts als das riesige, unendliche Dunkel – eine unvorstellbare Kuppel aus Ferne. Lichtloses Nichts. Wenn die Außerirdischen jetzt durch die Rillen hineinschauten, würden sie wissen: Sie konnten mich holen. Ich würde mich nicht wehren. „Papa, bist du´s?“ „Nelly? Was ist denn los? Ist was passiert?“ Ich hatte ihn noch nie angerufen. „Ja… Nein.“ Früher Samstagabend. Wieder lief im Hintergrund der HotelFernseher. Eigentlich hätte Papa jetzt bei uns zu Hause sein sollen, aber Oma hatte früh morgens mit ihm telefoniert, und uns danach berichtet, er käme später. Er müsste am nächsten Morgen, am Sonntag, noch mit einem wichtigen Kunden reden, der erst in der Nacht von einer Reise zurückkehrte. So etwas passierte dauernd. „Papa, hat sie dir von den Mäusen erzählt?“ „Oma sagte, ihr hattet ein kleines Ungezieferproblem. Zwanzig Mäuse kommen schnell zusammen. Wie hat Mischka sich geschlagen?“ „Sie ist abgehauen, hat sich verkrochen. Was dachtest du denn? Hör zu: es war total schrecklich. Du machst dir keine Vorstellung. Sie hatten die Macht im Haus überno …Ich meine, sie haben wirklich alles vollgekackt, sie waren überall, wirklich in jeder …“ 128 „Nelly, ich bin morgen Nachmittag wieder da, dann kannst du mir alles erzählen. Vielleicht muss ich Montag nicht mal nach Rüsselsheim, das wäre doch was.“ Was lief da im Hintergrund? Die Sportschau. Samstag war Sportschautag. Warum hatte ich daran nicht gedacht? Papa war aus unerfindlichen Gründen Eintracht-Frankfurt-Fan. Ich beugte mich vor, um auf die Uhr zu sehen. Noch wenige Minuten bis zur Start-Melodie. „Die Rathausbuchhandlung in Rüsselsheim kann ich am Mittwoch gut zusammenlegen mit dem Papiergeschäft …“ „Papa! Sie kamen aus Mamas Bettkasten. 27 Mäuse. Nein: 29 sogar. Zwei haben wir rausgetrieben. Sie haben Unmengen von Essen in Mamas Bettkasten gefunden! Verstehst du?“ „…“ Oma und ich, wir hatten nie zuvor vor ihm davon gesprochen, dass Mama Essen versteckte. „Es war alles schon vergammelt, verschimmelt … total stinkig, begreifst du!“ „…“ „Papa! Unmengen! Es ist nicht das erste Mal … Sie macht ganz merkwürdige Sachen …“ Er räusperte sich. Es klang, als setze er sich aufrecht hin: „Glaub mir, die Hitze macht uns allen zu schaffen. Inge konnte Hitze noch nie gut vertragen. Rate mal, wieviel Grad es gestern in meinem Firmenwagen waren? Rate mal … Das glaubst du nicht …“ „Nein, sie wird verrückt. Du musst kommen, Papa. Sofort. Du musst mit ihr reden, du musst zum Arzt mit ihr …“ 129 Er schwieg. Er dachte also nach. Er hatte gehört, was ich gesagt hatte. Er würde etwas tun. Er würde nach Hause kommen … „Vielleicht solltest du dich auch mal abkühlen. Ein Mädchen wie du sollte an einem schönen Feriensonntag wie diesem mit einer Freundin im Schwimmbad sein statt …“ „Papa, ich hab keine Freundin.“ Mir schossen schon wieder die Tränen in die Augen. Er sollte doch bloß zuhören: „Aber darum geht es jetzt gar nicht, es ist wegen Mama … Oma kümmert sich nicht so wie früher, weil sie … Oma ist …“ „Komm, komm. Du bist ja ganz durcheinander.“ Im Hintergrund erklang die Titelmelodie der Sportschau. Ich konnte hören, wie er sich vorbeugte, um lauter zu drehen. Die Eintracht spielte jetzt gegen Stuttgart. „Wir reden über die Sache, wenn ich zu Hause bin. Kommt schon alles wieder in Ordnung. Bald fängt auch wieder die Schule an, dann hast du Geburtstag und …“ Ich knallte den Hörer auf. Am kommenden Vormittag war es, als ich Stefans Rechte in meine genommen und begonnen hatte, mechanisch über seinen Handrücken zu streichen. Es war einfach geschehen: „Bitte“, hatte ich geflüstert und seine Hand ergriffen, die sich kühl und weich angefühlt hatte. Die Straße vor Karls Haus war bestimmt der mieseste Ort, um Stefan zum ersten Mal zu berühren. Ich hätte auch gar nicht vor ihm stehen und leise betteln sollen, dass er mit mir ein paar Meter gehen – nur so – und ein bisschen mit mir reden sollte. Immer wieder hatte 130 Stefan sich ängstlich zum Küchenfenster umgeblickt, von dem aus Karl uns hätte beobachten können. „Na, gut“, hatte er gesagt und mir behutsam seine Hand entzogen. Dann hatte er sich gebückt und behutsam sein Fahrradschloss wieder einschnappen lassen, das er erst wenige Minuten zuvor aufgesperrt hatte. Auf seinem Hals hatten rote Flecken gebrannt. Ich hatte Stefan am frühen Vormittag kommen sehen, als ich den Müll rausbrachte. Für einen kurzen Moment hatte ich gedacht, er wollte zu mir und mein Herz hatte schneller geschlagen als es sollte. Den Plastiksack noch in der Hand, hatte ich mich hinter unsere Tonne gekauert. Er hatte sein Rad neben der Pforte zu Karls Haus angeschlossen, keine 50 Meter von mir entfernt. Wie ein Student wirkte er, vielleicht wie einer, der gerade vom Schwimmen kam: die schmale Brille, ein weißes, langärmeliges Hemd, das bis zu den Ellbogen aufgekrempelt war, das blonde Haar zerzaust. Er blickte den Kiesweg hinunter, als hielte er Ausschau nach mir. Den Müllsack an der Brust, drückte ich mich erschrocken rückwärts in die Koniferen. Nadeln pieksten in meinen Hals und meine Ohren, der Sack stank nach Katzenfutter und es gab wirklich keinen Grund, warum ich nicht aufrecht auf dem Weg stand und einfach „Hallo, Stefan“ rief. Ob ihm aufgefallen war, dass unsere Haustür aufstand? Ich hörte das Quietschen von Karls Pforte. Als ich hinter der Tonne hervorlinste, war er verschwunden. Nadeln rieselten von meinen Schultern, als ich ächzend aufstand. Ich stopfte den Müll in die Tonne, dachte: Schluss damit! Ich würde einfach mit ihm reden! 131 Nun trottete er also tatsächlich neben mir die Straße entlang. Mindestens ein Meter Luft lag zwischen uns. Wir schwiegen und richteten den Blick auf den Asphalt. Es war nicht mehr weit, bis wir im Sichtschatten der Garagen verschwunden sein würden. Bald drei Stunden war er bei Karl gewesen. Drei lange Stunden, in denen es still geblieben war in Karls Garten, sich kein Vorhang bewegt, die Terrassentür sich nicht geöffnet hatte. „Es geht ihm nicht gut?“ Ich sprach, als könne er uns noch immer hören. Stefan steuerte den schmalen Durchgang zwischen den Garagen zu den Feldern an. Unwillkürlich verlangsamte ich. „Er hat es mir erzählt“, sagte Stefan und blieb stehen. „Alles.“ Nun lief ich weiter, an ihm vorbei, die Arme verschränkt: „Was?“ Er folgte mir. „Er hat gesagt, dass er sich daneben benommen hat.“ Ich schnaubte. Dann schlug ich nicht den Weg über die Felder ein, sondern den schmalen Spazierweg entlang der Häuser. „ … schlimm daneben benommen …“ „Warum bist du gar nicht mehr gekommen?“, fragte ich und bückte mich nach einem großen Stock. „Es tut ihm total Leid, weißt du?“ Er lief jetzt neben mir. Der Weg war so schmal, dass unsere Schultern sich fast berührten. „Er will nur, dass du noch mal mit ihm redest, sagt er.“ Mit der Spitze des Stocks malte ich beim Gehen Schlangenlinienmuster in den Sand: „Wo ist eigentlich deine Geige?“ „Er will, dass ich dir das sage. Dass es ihm ernst ist.“ 132 „Bist du nur deshalb mitgekommen?“ Ich beschleunigte, ließ den Stock im Takt meiner Schritte kleine Löcher in die Erde hacken. Ich spürte, dass er hinter mir stehen geblieben war: „Nein …“ Es klang traurig. Dann lauter: „Nein. Weißt du doch …“ „Du musst nicht mit mir hier rumlatschen, weiß du?“ Stefan setzte sich nun wieder in Bewegung. Unsere Schritte, der Stock. Er holte langsam auf, bis er direkt hinter mir ging. Er war nicht viel größer als ich. Fast spürte ich seinen Atem an meinem nackten Hals. Stromstöße durchfuhren meinen Rücken: Wie unvorstellbar, wie naheliegend war es, wenn er jetzt, genau jetzt, diese schmale, kühle Hand auf meinen Nacken legte … „Aber Karl muss doch weg. Nach Ulm. Das weißt du doch, oder?“ Karl. Karl. Karl. „Er hat doch nur uns, Nelly …“ Stefan sagte es so leise, dass ich erst nicht sicher war, dass ich richtig verstanden hatte. Nelly, hatte er gesagt. Nelly. Schön hatte es geklungen. Irgendwie nannte er mich sonst nie beim Vornamen. Ich drehte mich ihm zu, sah ihn an – sah von unten, durch meine Wimpern hindurch, die Lippen leicht geöffnet in seine Augen mit den geweiteten Pupillen. Sein Hals wurde wieder fleckig, unsere Gesichter waren kaum eine Handbreit voneinander entfernt. Da trat er einen Schritt zurück: „Ich bin sein Freund, Nelly.“ Es klang flehend. Er vermied jetzt mich anzusehen: „Ich hab ihm versprechen müssen … Er ist doch in Ordnung, auch wenn er manchmal etwas …“, er suchte nach Worten, „ … rau ist.“ 133 Ich warf den Stock weg: „Er ist nicht rau, er war brutal.“ Ich schob meinen Blusenärmel hoch, zeigte es ihm – diesen ovalen blau-grünen Fleck. Stefan starrte mit offenem Mund. „Zwischen uns beiden ist nichts mehr! Definitiv. Klaro?“ Ich zerrte den Stoff wieder runter. „Ich bin sowieso zu jung für ihn, das hat er gesagt. Frag ihn!“ Musste nicht sein, dass er sah, wie meine Unterlippe zitterte. Ich ging mit erhobenem Kopf an ihm vorüber, zurück in Richtung der Garagen: „Außerdem könntest du ja zur Abwechslung auch mal von dir reden, statt immer nur von Karl.“ Ich sprach mit halb zurückgewandtem Kopf, „Oder hast du auch diesmal wieder eine Hiobsbotschaft für mich dabei. Wenn du nicht für Karl sprichst, scheint das ja der einzige Anlass zu sein, der dir erlaubt, mit mir zu reden …“ Ich hörte, wie er versuchte mich einzuholen. „Na, ja. Nein. Nicht wirklich … Es ist überhaupt nicht so, wie du denkst. Wenn du wüsstest … wenn wir könnten …“ „Was heißt das: nicht wirklich?“ Wieder standen wir uns gegenüber. „Nichts.“ Ich wartete: „Stefan!“ Er tat, als müsse er Mückenschwärme verscheuchen. „Was bedeutet: „nicht wirklich?““ „Es muss gar nichts bedeuten.“ „Was?“ „Du weißt es bestimmt ja eh schon … Ist ja auch weiß Gott kein Geheimnis. Das Haus von diesem Novottny, diesem Klavierlehrer …“, er rieb sich die Nase. „Weiter …“ 134 „ … steht zum Verkauf, in der Sparkasse hängt das Bild.“ Stefan sah mich erwartungsvoll an, als wäre damit alles gesagt. Zu verkaufen. Nowottny ging weg. Großartig, Nowottny ging weg! War es etwa vorbei? Gehörte Oma wieder uns? Hatte sie ihn weggeschickt? Dann würde Oma ja wieder wie früher für Mama da sein, für mich … „Er will mit ihr in den Schwarzwald, sagt der Briefträger.“ Stefan war einen Schritt auf mich zugekommen. Als er mein Gesicht sah, sprach er schnell weiter: „Du weißt, der alte Nadler trinkt, der redet den ganzen Tag nur Mist. Der hat keine Ahnung. Auf so ein Geschwätz darf man nichts geben. Den hätten sie eh schon längst vom Dienst suspendieren müssen, den Suffkopf …“ „Oma wird … Sie will?“ Er fasste mich am Ellenbogen: „Nelly, du musst sie selbst fragen!“ Auf dem Treppenabsatz vor dem Fenster blieb ich stehen. Ich war lange nicht bei ihr gewesen, nicht seit der Buchtelgeschichte. Die Stores drüben bei Karl waren wieder zugezogen. Er öffnete sie gar nicht mehr. Ich blickte zum Himmel: Bläue mit feinen, weißen Schlieren, aber es war etwas kühler geworden in der letzten Nacht. Täuschte ich mich, oder kamen Wolken auf? Ich drückte langsam die Klinke herunter. Oma wurde fast verdeckt von einem großen Strauß gelber Rosen. Ich ging um den Tisch herum und setzte mich neben sie auf das Sofa. 135 „Von ihm?“ „Ich frage Dich auch nichts.“ Erst jetzt sah ich, was sie tat. Sie hatte ein großes Einweckglas zwischen ihre Beine geklemmt, halb gefüllt mit Zucker. In ihren Händen raschelten Tütchen. Auf dem Tisch stand ein fast leerer Schuhkarton. „Nein!“ Ich stürzte mich auf sie, versuchte ihren Händen die Beutelchen zu entwinden. „Was tust Du da?“ schrie ich: „Deine Sammlung! Die gehören doch mir. Alle. Du hast sie mir versprochen…“ Ich krallte meine Finger in ihren Arm: „Das darfst du nicht!“ Sie war stark. Sie fuhr einfach fort, Papier aufzureißen. „Oma, bitte!“ „Ja, sie gehört dir, wenn ich gestorben bin. Aber noch bin ich nicht tot“, stieß sie vor. Schließlich hielt sie doch inne. Der Zucker zerstäubte auf ihrem geblümten Schoß, als ich ihre Hand unvermittelt losließ. Ich ließ mich in die Couch sinken, einen blau-weißen Würfelzucker aus dem Hofbräuhaus zwischen den Fingern. „Warum machst Du das?“ Meine Stimme klang belegt. Sie stellte das Einmachglas auf den Tisch. „Es sind Dinge. Nichts weiter. Kein Ersatz für das Leben. Und zum Leben ist man nie zu alt. Auch wenn du das nicht verstehen willst.“ Sie grinste schief: „ … oder zu jung.“ Ich nahm mit beiden Händen Zuckerpäckchen aus dem Karton, legte sie auf den Tisch und ordnete sie. Erst nach Farben. Dann Kante an Kante. Wie Mama ihre Taschentücher. Eine Straße. Manche Tütchen knirschten ein wenig. „Schau nur: „Rat-haus-café“ – kaum noch zu lesen … Vielleicht hat es ja schon eine weite Reise hinter sich. In einer 136 Handtasche – einem Koffer? Oder ist das eines von denen, die Papa mitgebracht hat?“ Ich rückte es mit zwei Fingern zurecht. „Vielleicht hat er es in seiner Jackettasche herumgetragen.“ „Du wirst groß. Du wirst auch dein Leben leben“, sagte Oma. „… Weißt du noch, Oma, das hier?“ Ich hob ein goldenes Röhrchen hoch. „Haben wir das nicht aus dem Museumscafé in Hamburg? Oder diese …“ Drei gleiche Beutelchen, gestreift – aneinandergelegt wirkten sie wie ein Zebrastreifen. „Schön, nicht?“ Das rote daneben – wie ein Ausrufungszeichen. „Man kann sich nicht weigern groß zu werden, Nelly. Deine Mutter … – Inge, die durfte nicht mal ein Kind sein.“ „Und guck mal, die Bunten aus Wien!“ Ich strich darüber: „Die kriegen wir doch immer von der Frau Powicek, oder? Wie geht es überhaupt der Frau Powicek?“ Ich legte sorgfältig ein gelbweiß kariertes Päckchen an. „Müsste die nicht längst aus dem Krankenhaus raus sein?“ Ihre Augen folgten meinen Händen. Bunte Landschaften, Erinnerungen. Oft war ich stundenlang bei ihr hier oben gewesen, und während sie ihre Kisten sortiert oder Briefe an Tauschpartner geschrieben hatte, hatte ich Oma von den Welten erzählt, die ich vor mir sah, wenn die Papierchen in meinen Fingern knisterten: Ein Liebespaar unter den Säulen des Terrassencafés im Astoria, ein einsamer Heiratsschwindler, der mit einem winzigen Löffelchen in seinem Mocca rührte, während er an der Bar sein nächstes Opfer ausspähte. Würde es die Dame in Türkis werden, die mit glasigen Augen an ihrem Martini nippte? „Nelly, du bist doch fast vierzehn …“ 137 „Ist das neu? Das kenn ich noch gar nicht.“ Ich drehte ein grün-blaues Röhrchen zwischen den Fingern. „Gehört das auch zu den Wienern?“ Oma nahm es mir aus der Hand. Ich dachte, sie wollte die Aufschrift studieren, aber sie ließ es unbesehen in einen Karton fallen: „Behalte sie!“, sagte sie. „Nimm sie alle mit. Aber pack dir Dein eigenes Zimmer damit voll.“ Sie stand auf. Zucker rieselte auf den Teppich, als sie zum Schrank ging. Sie zog drei weitere Kartons hervor, die sie auf meinen Schoß stellte. „Manchmal muss man aufräumen.“ Dann ging sie zurück, griff sich ebenfalls einen Stapel: „ … damit wieder Platz ist für Neues, verstehst du das?“ Sie marschierte zur Tür hinaus. „Oma“, rief ich und stolperte hinter ihr her. „Gehst du weg?“ Sie steuerte mit großen Schritten durch den Flur. Ich lief fast, um sie zu überholen. „Die Inge, die kann nichts aufräumen. Gar nichts außer ihrer Bügelwäsche ...“ „Oma, bleib stehen!“ Ich zerrte an ihrem Blusenärmel. Ungeduldig stoppte sie. Fast wäre ich in sie hineingelaufen. „ … das ist das Problem.“ Dabei erwischte ich mit dem Ellbogen einen ihrer Kartons. Sie fing ihn mit Müh und Not auf. „Pass doch auf!“ Wir luden die Schachteln vor meiner Zimmertür ab. „Oma“, rief ich wieder: „ … gehst Du mit ihm weg?“ – und ich schob mich dicht an sie. Ich wollte sie zwingen mich anzusehen, doch sie drehte einfach ab, lief zur Treppe zurück und die Stufen hinab. „Jetzt sag doch!“, rief ich ihr nach. Erst unten vor der Küchentür gelang es mir wieder, mich vor sie zu 138 drängen: „Was machst du denn jetzt – ziehst du fort? Verlässt du uns? Mich? Mama?“ Einen Moment lang sah sie mich an, ihr Blick war unruhig, ihr Mund öffnete sich … – dann schob sie mich einfach zur Seite und ging zum Kühlschrank: „Jetzt? Was ich jetzt mache? Brombeermilch, was sonst?“ Ihr plötzliches Grinsen erschreckte mich. „Brombeermilch?“ Ich stellte mich in den Türrahmen; sah ihren dicken Nacken, sah den Küchenschrank zuklappen, sah ihre runden Arme, die den Glaskrug umarmten, die Schüssel mit den Beeren, ihr selbstgefälliges Gesicht im Profil. „Kipp sie ins Klo“. Das Rad ruckelte auf dem alten Plattenweg, aus dessen Fugen Grasbüschel wuchsen. Ich entdeckte die Baracken schon von weitem. Wenn ich früher hier entlang musste, war ich besonders schnell in die Pedale getreten. Doch diesmal würde ich gleichmäßig weiter radeln. Wie heiß es nun doch wieder geworden war! Die Mittagshitze brannte auf meinem Haar und ich wusste nicht, war das der Grund, dass mir so schummerig war. Jeder im Ort raunte es einem zu: “Gesindel“ lebte hier, Asoziale, Penner, Drogensüchtige, womöglich geflohene Häftlinge – und Zigeuner … die stahlen angeblich Kinder und verkauften sie: ein Schandfleck seien sie, die Baracken. Ich zwang mich, fast bis an den Zaun vor dem östlichsten Seitengebäude heran zu fahren. Kasernen der Amerikaner sollen die Gebäude früher gewesen sein, und nur, weil die den Abriss angeblich nicht zahlen wollten, standen die vier Baracken noch immer. Quasi ein rechtsfreier Raum sei das 139 dort, hatte Herr Behrend letztens über den Gartenzaun geschimpft, nichts könne die Gemeinde unternehmen, nur weil die Amis ihre Hand auf dem Gelände hätten. Womöglich böten die Hütten ja RAF-Terroristen Unterschlupf, mutmaßte er: Verbrechern, die mit ihren Maschinengewehren und Handgranaten schon die nächsten Morde vorbereiteten oder dort einen Keller herrichteten, um Entführungsopfer gefangen zu halten. Ich atmete tief durch. Ich brauchte die Gruselgeschichten nicht zu glauben. Ich konnte mich gut verteidigen. Papas Taschenmesser lag schwer in meinem Rucksack. Ich warf das Rad hinter einen Baum ins tiefe Gras, nahm ihn vom Gepäckträger und kauerte mich hinter Brombeersträucher. Es stank nach Brennnessel und Pisse. Mein Herz jagte. Wo waren all die Terroristen, die hier angeblich wohnten? Still und geheimnisvoll lagen die zweistöckigen Gebäude in der Sonne. Längst war der Putz abgebröckelt, widerliche Schmierereien und unleserliche Buchstaben bedeckten die letzten Putzreste. Im dichten Gras vor einem vergitterten Kellerfenster stand ein verrosteter Kühlschrank, dessen Tür aufklaffte. Ob dort Ratten nisteten? Ich setzte den Rucksack auf und schlich, keuchend vor Aufregung, durch das Gestrüpp. Dafür hatte ich mir extra, trotz der Hitze, Bluejeans und Turnschuhe angezogen. Ich trampelte die Dornen herunter und linste ängstlich zu den Fenstern. Manche waren mit Pappe abgedichtet, andere waren eingeworfen worden, die restlichen starrten mich mit schwarzen Scheiben böse an. Attention, stand mit roter Ölfarbe auf einer zugenagelten Tür. Ich folgte ein Stück weit dem massiven Drahtzaun, der ganz um das Gelände herum 140 lief. Vor ein paar Jahren erst hatte die Stadt ihn erneuern lassen, doch ich wusste, hinten, zum Wassergraben hin, war er umgestürzt worden. Jetzt entdeckte ich, dass jemand auch an der vorderen Seite des größten Gebäudes mit einem Bolzenschneider zwei Löcher in den Draht geschnitten hatte, groß genug, dass sich auch ein Erwachsener durchzwängen konnte. Ich huschte hinter eine große Pappel. Dann sah ich den Tisch und erschrak. Eigentlich waren es nur übereinander gestapelte Kisten, doch obenauf, auf einem Brett, qualmte in einem Blechdeckel voller Asche eine Zigarettenkippe; daneben standen auf einer Bank ein halbvoller Bierkasten und drei einzelne offene Flaschen. Nun erkannte ich die Bank: Nummer Sieben gestiftet-vom-Modehaus-Oskötter. Unwillkürlich musste ich grinsen. Wie kam die hier her? Mit diesem massiven Untergestell aus Eisen war sie bestimmt tonnenschwer, und der Stadtpark war bald drei Kilometer entfernt … „Was zum Teufel machst du hier?“ Eine Männerhand hatte sich von hinten um meinen Hals gelegt. „Was spionierste hier herum?“ Eine raue Männerstimme. „Loslassen …“, japste ich, „… bitte.“ Es schienen mehrere zu sein, die hinter mir standen. Jemand riss mir den Rucksack von den Schultern. Waren es die Drei, deren Flaschen auf der Bank standen? Warum nur hatte ich nicht hinterlassen, wo ich hinwollte? „Sag schon!“ Dieser klang ziemlich piepsig – und jung. Vielleicht kam es mir nur so vor, dass sich der Griff um ein Winziges lockerte, als sich ein Mann in mein Blickfeld schob. „Hippie“, hätte Oma bestimmt über ihn gesagt. Er trug einen 141 wuchernden Vollbart und über seine nackten Schultern fiel blondes, struppiges Haar. Sein schmaler Oberkörper war glatt und braungebrannt. Bei genauerem Hinsehen wurde klar: Der war höchstens fünf Jahre älter als ich. Hungrige dunkle Augen musterten mich, verharrten auf meiner Brust unter dem dünnen Baumwollstoff. Unwillkürlich kreuzte ich die Arme. Mit einem Finger hob er mein Kinn an. Er wartete. Ich erwiderte trotzig seinen Blick. Bubi, dachte ich. Blöder Bubi. Er nickte dem Mann hinter mir leicht zu: „Neugierige Mädels, die überall rumschnüffeln, brauchen wir hier nicht“, piepste er. „Makalewski“, stieß ich hervor: „ … ich muss zu ihm.“ Der Hippie nickte leicht. Der Druck um meinen Hals ließ nach. Schon dachte ich, ich sei frei – langsam ließ ich die Schultern sinken, und versuchte den Kopf nach hinten zu drehen – da bohrte sich auch schon etwas Spitzes in meine Nierengegend. „Vorsichtig, Kleine“, sagte Piepsi. Hatte der andere etwa mein Messer im Rucksack entdeckt? „Woher kennst du Makalewski?“, fragte er. „Meine Oma …“, sagte ich und wusste in diesem Moment nicht mehr, wie sie mit Nachnamen hieß. „Meine Oma im Birkenweg“, redete ich weiter: „So ein bisschen rund ist die und weißhaarig … Sie gibt ihm immer etwas, Makalewski, meine ich. Kliebchensuppe und solche Sachen … Kennen Sie Kliebchensuppe?“ „Birkenweg 12?“, fragte eine dritte Männerstimme hinter mir. Ich nickte möglichst deutlich, damit der mit der spitzen Waffe es auch bestimmt mitbekam. „Lass sie los“, rief der Dritte und trat vor mich hin: „Hallo, Nelly!“ Verwirrt starrte ich den Mann an, der mich einen guten 142 Kopf überragte. Wo seine Nase hätte sein sollen, war früher ein schreckliches Loch gewesen, jetzt hatte ihm anscheinend jemand ungelenk im Zickzackstich aus roten Hautlappen eine Ersatznase gefertigt. Vor Schreck merkte ich erst gar nicht, dass der Druck in meine Nieren verschwunden war. Plötzlich sprang ein kleiner Dicker im Trainingsanzug vor mich und hielt mir grinsend seinen ausgestreckten Zeigefinger vors Gesicht: Das war also das „Messer“ gewesen. „Nichts für ungut. Wir müssen hier halt aufpassen“, sagte der Kleine, der fast kahl war und hielt mir seine runde Hand hin, die ich geistesabwesend schüttelte. Ich musste immerzu den Mann ansehen, den ich gekannt hatte, den Wolfsmann, wie ich ihn bei mir nannte. Sein entstelltes Gesicht mit den erstaunlich blauen Augen versuchte ein Lächeln. „Wo ist denn die kleine Nelly?“ hatte er immer früher gesagt, als er noch regelmäßig zu uns gekommen war, und dann hatte er mit mir reden, mich auf den Schoß nehmen wollen. Oma hatte ihn nicht gehindert. So hatte ich, kalt vor Angst, in diesem merkwürdigen Dunst der Männer in Not auf seinen breiten Oberschenkeln gesessen, hatte, den Blick starr zu Boden gerichtet, mit anhören müssen, wie er von seiner Tochter redete. Nie hatte er mich dabei mit seinen schmutzigen Händen berührt. Er sprach bloß von seiner Klara – oder hieß sie Karla? Klarissa? – seinem „Püppchen“, seinem „wilden Wolfsmädchen“, wie er sagte, das er zuletzt im Krieg gesehen hätte, als es fünf Jahre alt gewesen sei. Und Oma fragte nicht, ob es noch lebte, das Mädchen, und warum er nicht zu Frau und Kind zurückgegangen war, einem Kind, das doch inzwischen Mitte Dreißig sein musste, wie mir nun einfiel. 143 Immer, wenn er gegangen war, schenkte Oma mir Himbeerbonbons, die sie oben neben der Teedose verwahrte: „Das war lieb von dir, Nelly.“ Eines Tages in der Adventszeit – ich musste etwa acht Jahre alt gewesen sein – in einer Zeit also, als fast alle Männer in Not irgendwann vorbei kamen, um sich von Oma ihr Päckchen mit Rasierseife, Schokolade und Socken abzuholen, hatte auch er vor der Tür gestanden. Ich hatte ihn durch das Drahtglas erkannt, dieses Gesicht mit dem schwarzen Nichts in der Mitte. Er hatte einmal geklingelt und ich hatte die Hand schon über der Klinke, aber etwas hinderte mich, sie niederzudrücken. Ich stand wie angewurzelt und starrte auf die unbewegliche, an den Rändern zerfließende Gestalt auf der anderen Seite der Tür. Ganz langsam zog ich die Hand zurück und wich zurück. Völlig reglos blieb ich etwa einen Meter vor der Tür stehen. Aber er tat auch gar nichts. Er klingelte kein weiteres Mal. Er klopfte nicht. Er sprach auch nicht, dabei hätte ich durch den Briefschlitz in der Tür jedes seiner Worte verstehen können. Wenn er bloß irgendetwas gesagt hätte, oder wenn Oma oder Mama gerufen hätten, was denn sei, warum ich nicht aufmachte, ich wäre bestimmt aus meiner Erstarrung erwacht und hätte ihm ohne zu zögern geöffnet. Schließlich musste doch zumindest Oma in der Küche das Klingeln gehört haben. Doch alles blieb still, und so standen wir also einfach nur dort, er und ich, zwischen uns das Glas. Als er sich – nach wenigen endlosen Minuten – doch plötzlich rührte, erschrak ich. Als wisse er noch durch das Graumilchige hindurch genau, wie mir zumute war, bewegte er sich wie in Zeitlupe, als er nun ein kleines Ding 144 aus seiner Jackentasche zog, sich ganz langsam vorbeugte und das Ding durch den Briefschlitz schob. Es raschelte nur ein wenig, als es auf der Fußmatte aufkam. Dann trat er ein paar Schritte rückwärts und schon war er fort. Ich wagte nicht, mich zu bewegen. Erst, als er schon eine Weile verschwunden war, bückte ich mich verstohlen. Es war ein winziges Päckchen, kaum zwei Finger hoch und wenige Zentimeter lang, eingewickelt in zerknülltes Zeitungspapier. Die Stille des Hauses kribbelte im meinem Nacken. Vorsichtig zupfte ich an dem Papier, wickelte etwas aus. Dann sah ich, dass es ein kleines Tier war, das offenbar mit einem Taschenmesser aus einem Ast geschnitzt worden war. Es lag auf der Seite, als ob es schliefe, den ein wenig zu langen, irgendwie traurigen Kopf vorgestreckt, den buschigen Schwanz um den Körper gelegt. Ich strich mit dem Zeigefinger über die Schnauze. Der kleine Wolf war wunderschön. „Nelly, wo bleibst du?“ Oma. „Komme gleich.“ Ich huschte in mein Zimmer, zog mein samtenes Schmuckkästchen aus dem Schrank und legte es zwischen Kommunionuhr, silbernes Kreuz und das Armband mit den Glücksanhängern. Dann ging ich in die Küche. Bei jeder Beichte hatte ich an den Wolf gedacht – und dann doch immer etwas anderes gebeichtet. Der Mann war nie wieder zu uns gekommen. „Nelly: eine Freundin!“, rief er nun, und es klang fast stolz. Habt ihr nicht mal was zu trinken für das Mädel? Los, Ronny hol Wasser.“ Ronny hieß also der kleine Dicke. Er lief 145 tatsächlich erstaunlich behände zur Baracke zurück, während mich der Hippie noch immer musterte: „Das ist Tilo. Sag mal anständig Guten Tag.“ Tilo gaffte mich an. Langsam streckte er seine Hand aus, die weich war wie ein Marshmallow. „Tschuldigung“ – piepste er und seine linke Hand fuhr erklärend zum Hals. Unwillkürlich rieb ich mir den Nacken. „Makalewski ist unterwegs“, piepste er. „Ist morgen wieder hier. Wahrscheinlich.“ „Setz dich doch“, sagte der Wolfsmann, dessen Namen ich nicht mehr wusste, und schob mich zu der Oskötterbank: „Wie geht es deiner Oma? Gut hoffentlich?“ Ich ließ mich neben dem Bierkasten nieder, nickte. „Diese wunderbare Suppe! Kliebchensuppe, hieß die, sagtest du?“ Die beiden standen vor mir. Tilo drehte eine Bierflasche in der Hand, musterte meine Beine. „Wie groß du bist. Wie hübsch“, sagte der Wolfsmann. „Kein Kind mehr.“ Ich überwand mich und blickte in seine blauen Augen oberhalb der zerstörten Nase. „Du hast doch nicht etwa Ärger zu Hause?“ fragte er. Ronny trat aus der Barackentür, in einer Hand eine Wasserflasche, in der anderen einen gepunkteten Plastikbecher. Wir schauten ihm schweigend zu, wie er, noch im Laufen, die Flasche aufschraubte. Er hatte etwa zwei Dutzend dunkle Haare über seine Halbglatze gekämmt, die ansonsten blank und trocken in der Sonne glänzte. Er schien überhaupt nicht zu schwitzen in seiner Trainingsjacke. „Jeder hier hat Ärger mit irgendwem, weißt du“, sagte der Wolfsmann. Das Wasser gluckerte frisch in den Becher. Ronny reichte es mir mit einer Art Verbeugung. Ich schloss 146 kurz die Augen, weil ich nicht nachschauen wollte, ob der Becherboden sauber war. Es schmeckte gut, leicht metallisch. Die drei Männer sahen mir beim Trinken zu. Ich nickte dankbar. Der Wolfsmann nahm Ronny die Flasche ab: „Keine Ahnung, was du hier willst …“. Er goss mir ein zweites Mal ein: „ … aber wir werden dir helfen.“ Die kleine Reisetasche aus hellem Rindsleder gehörte Mama. Ich hatte sie aus dem obersten Fach ihres Schranks gezogen. Papa hatte sie ihr vor vier oder fünf Jahren zu Weihnachten geschenkt, dabei wusste er genau, dass sie seit Jahren, vermutlich seit ihrer Hochzeitsreise, nicht mehr fortgefahren war. Sie hatte sich überschwänglich bedankt. Immer wieder waren ihre Hände über das helle Leder gestrichen, als sei es ihr sehnlichster Wunsch gewesen, so eine edle, gut verarbeitete Tasche für ihre Reisen zu besitzen. Das Lederknäuel, das ich jetzt in meiner Hand hielt, hatte kaum noch Ähnlichkeit mit dem Prachtstück: zerdrückt und staubig war es und es roch muffig nach Tier. Doch der Gestank nach dem scharfen Desinfektionsmittel, das der Kammerjäger im Zimmer versprüht hatte, war noch schärfer. Schon kehrte die Übelkeit zurück. Mit angehaltenem Atem trug ich die Tasche hinüber in die Küche, entstaubte sie sorgfältig von innen und außen mit dem Schwamm und rieb sie dann trocken. Auf dem Innenboden lag noch immer eine glänzende Pappe: „Beachten Sie: Damit Sie auf vielen Reisen Freude an unserem Modell BLF00203 haben …“ Ein paar Monate lang hatte ich damals tatsächlich geglaubt, dass wir nun im Sommer gemeinsam in die Ferien reisen 147 würden; ja, dass wir jetzt wie die anderen im Juli unser Gepäck in den Kofferraum laden könnten – Taschen, Koffer, Ball, Luftmatratze – und dann losfahren würden in Richtung Süden, dem Brenner entgegen. Unterwegs im Auto, stellte ich mir vor, würden wir hartgekochte Eier essen und lauwarmen Früchtetee trinken, würden zusammen lachen und einander auf die ersten Palmen aufmerksam machen, die am Straßenrand auftauchten. Warum nur hatte Papa ihr die Tasche geschenkt? Ob er sich manchmal vorstellte, irgendwo am Meer mit ihr Hand in Hand am Strand entlanglaufen zu können wie die Liebespaare im Fernsehen? Ich packte meinen blauen Lieblingsbecher und ein kleines Holzbrett ein, Zwieback, Brot, Käse, Fischbüchsen, eine Limoflasche. Dann holte ich aus dem Bad mein Waschzeug, etwas gegen die Mücken im Wald, außerdem das Messer aus dem Rucksack, schließlich die Wolldecke vom Sofa – eng zusammengerollt. Ein großer Rucksack wäre besser, aber mit der Tasche auf dem Gepäckträger würde es auch irgendwie gehen. Als ich auf ihrem Stuhl vor ihrem Schrank balancierte, war es plötzlich genau wie früher, als ich dort oben nach den Süßigkeiten gesucht hatte, die sie immer vor Ostern und Nikolaus vor mir versteckt hatte: aufgeregt war ich, voller Vorfreude und schlechtem Gewissen – und immer stellte ich mir vor, wie sie gleich dort unten stünde und mich mit diesem halb amüsierten Blick ausschimpfte, während sie mir schon die Hand entgegenstreckte, um mir herunter zu helfen. Doch Mama kam nicht. Sie war auch nicht in der Waschküche. Das 148 Haus war leer – wieder einmal. Das einzige Lebenszeichen, das ich gefunden hatte, war ein Zettel von Oma in der Küche: „Bin bei Frau Würsching. Toast ist noch im Tiefkühlfach. Papa muss nach Rüdesheim – kommt erst morgen Nachmittag.“ Ich hatte das Papier in den Müll geworfen. Ich hatte geglaubt, er hätte verstanden, dass es wichtig war. Einmal noch wollte ich ihm alles erklären: dass es doch so nicht weitergehen konnte, dass jetzt er dran war … Dass es jetzt nur noch von uns beiden abhing – von ihm und mir. Wir mussten Oma aufhalten. Wir mussten Mama helfen, damit sie nicht mehr so … durcheinander war, so traurig … Ich hatte warten wollen auf ihn. Ich nahm Papas Cord-Schirmmütze vom Garderobenhaken. Prüfend schob ich sie vorm Spiegel in den Nacken. Ich stopfte die Haare unter die Kappe, reckte den Hals: Beim Trampen würde ich fast als Junge durchgehen. Musste ich die Sache eben alleine in Ordnung bringen. Oben in meinem Zimmer öffnete ich den Schrank: Jeans wären gut, aber ich hatte nur die eine, die ich trug. Oma mochte „dieses überteuerte amerikanische Zeug“ nicht. Trotzdem: Hosen mussten sein, Turnschuhe, zwei Blusen, einen Pulli, falls es doch noch kühl würde, besser auch die Regenjacke. Wie lange ich wohl brauchen würde? Vor den Klassenreisen hatte immer Oma für mich gepackt. Aber das war, als ich noch ein Kind war … Wäsche fehlte noch, der schöne, neue Bikini, vielleicht doch ein Lieblingskleid? Dann öffnete ich mit dem Silberschlüssel die Schatulle: traurig schlief der kleine Wolf in den vergilbten Zeitungsseiten. Ich 149 berührte vorsichtig seinen Schweif. Wie sorgfältig er gearbeitet war! Die Krallen seiner Pfoten waren leicht gespreizt, als sei er stets auf Feinde gefasst. „Das schaffen wir“, flüsterte ich und erschrak über meine Stimme. Ich steckte ihn in das Außenfach der Reisetasche. Aus einem Briefumschlag, den ich in einem alten Pferdebuch versteckt hatte, holte ich den Hunderter, den ich von Mama und Papa zu Weihnachten bekommen hatte, dann ging ich die Treppe hinunter. Es stank wirklich furchtbar in Mamas Zimmer. Ich atmete in meine Handkuhle, versuchte zugleich ungeschickt, das Bild abzuhängen. Ich wollte es nur außen, am Silberrahmen, berühren. Ich musste es mitnehmen. Es gab keinen anderen Weg. Der finster blickende Paul – und Gerhard: Sein komischer Haarwirbel auf der Stirn, die Eulenaugen, die mich freundlich und fragend anblickten. Mit Makalewski hatte er nicht die geringste Ähnlichkeit, ich hätte es gleich merken müssen. Im Hinausgehen fiel es auf: Die Tapete schimmerte ein wenig heller an der Stelle, an der das Bild gehangen hatte. Nichts ahnend würde Mama sich auf ihr Bett legen, würde ihr Lächeln an diese Stelle an der Wand richten, würde begreifen: Er war weg. Sie hatte nicht mal mehr ihn. Und es war das einzige Bild von ihm, das sie hatte retten können. Ich durfte sie nicht enttäuschen. Auf der Straße hinter den Garagen fummelte ich noch einmal prüfend an den Spanngurten herum, die die Tasche auf dem Gepäckträger halten sollten. Mir war noch immer so flau. Niemand kam um die Ecke, nicht Mamas Rad, nicht Papas 150 Audi, Oma blieb verschwunden, die Gardinen vor Karls Fenstern blieben zugezogen. Ich fuhr los. Hätte ich ihnen noch einen Zettel schreiben sollen? Ich fuhr los. Ich würde es irgendwie hinkriegen. Ich war fast erwachsen. So gut wie 14. Der Wolfsmann würde mir helfen … Niemand zu sehen in der vormittagsstillen Weiherstraße außer ein paar Bauarbeitern, die kochendes Bitumen auf dem Asphalt vor der Bäckerei verteilten: Nackte Oberkörper, dunkle Hosen, Schaufeln, die hin und wieder, die Sonne reflektierend, aufblitzten. Die Luft um die Männer waberte in der Hitze. Fata Morgana, dachte ich: was für ein Wort – und dann war das Bild im Kopf: gleißendes Licht der Wüste, Männer in schwarzen Gewändern, die auf Kamelen in die Oase einritten. Dattelpalmen, deren Zweige im Wüstenwind zitterten. Früchte, die auf den gestampften Boden prasselten, dazu das warme Ocker der Lehmhäuser, die Fenster – Höhlen, hinter denen Kühle wartete, kaltes Wasser, das sich in einem Innenhof in eine Schale ergoss, silberne Tabletts mit Süßigkeiten, Gebäck, die schmalen Hände verschleierter Frauen … Ein gellendes Hupen ließ mich schlingern. Unbeholfen sprang ich vom kippenden Rad, die Tasche glitt durch die Gummis auf den Boden. Wo kam der Mercedes direkt vor mir her? Verwirrt starrte ich durch die staubige Windschutzscheibe, hinter der ein Mann, der mir vage bekannt vorkam, die Faust schüttelte. Richtig, ich hatte nicht nach rechts geblickt. Mühsam zerrte ich das Rad zur Seite und die Tasche wieder zurecht. Erst als das Auto an mir vorbei rollte, erkannte ich 151 das viereckige Gesicht von Karls Vater und hob halbherzig die Hand. Nun sah ich auch: Im Fond saß die zarte Frau Ehm, die müde meinen Gruß erwiderte. Langsam rollte der weiße Wagen in unsere Straße. Ob Karl die Küche inzwischen geputzt hatte? Ob er wusste, dass sie heute zurückkamen? Für einen kurzen Moment war mir, als müsste ich kehrtmachen, als sollte ich jetzt dort sein, oben auf dem Treppenabsatz neben ihm stehen, wenn sie unten die Haustür aufschlossen … Unmöglich. Ich musste doch Gerhard holen, damit nicht noch mehr durcheinander kam. Meine Hände umfassten fest die Lenkergummis: Nein, ich schuldete ihm nichts, rein gar nichts. Ich schuldete niemandem etwas. Ich musste weiter, ich musste tun, was ich mir vorgenommen hatte. – Nach vorne schauen … Ich trat in die Pedale. Vor mir nichts als Häuser, das graue Band der Straße und geparkte Autos. Zu den Kasernen ging es noch vor dem Ortsschild links in den Wald hinein, danach über den Plattenweg durch die Sumpfwiesen. Ich bog rechts ab. Ich hatte nicht vorgehabt zum Neubauviertel zu fahren, aber war es nicht gleich, wo ich meine Suche begann? Hatte ich denn jemandem Rechenschaft abzuliefern? Niemand auf der Welt wartete auf mich. Die Straße zwischen den schäbigen, rosa-weißen Hochhäusern war breit, die endlosen Parkbuchten rechts und links kaum besetzt von schmutzigen, kleinen Autos. Vor einem tiefer gelegten Opel mit offener Motorhaube kickten Jugendliche eine Bierdose über den Parkplatz. Aus den Boxen dröhnte Heavy Metal-Lärm. 152 Ich wollte sie bloß vorher noch einmal von Ferne sehen – ihren schmalen Rücken auf dem Fahrrad … Ich hätte ihr so gerne gesagt, dass sie sich nicht sorgen sollte, dass alles gut würde. Böse schaute eine ältere Frau vom Balkon herunter, die im dritten Stock ihre Blumen goss. Irgendwo plärrte ein Baby auf einem Balkon. Ein trauriger Mann im Unterhemd rauchte eine Zigarette und starrte mir nach. Blickte in diesem Augenblick womöglich auch Irene von einem der Balkone herab? Wenn sie schon aus dem Urlaub zurückgekehrt war, würde sie sich jetzt vermutlich mit ihrem fleisch-lachsfarbenen Blumenbikini da oben sonnen – oder mit ihrem pickligen Freund Bono unter einem der Sonnenschirme herumknutschen, während ihre Mutter als Krankenschwester im Hospital die neuesten Geschichten aus der Siedlung herumerzählte. Durch das Balkongeländer hätte Irene sehen können, wenn Mama hier mehrmals in der Woche (oder jeden Tag?) durchradelte oder wenn sie die glutheiße Straße entlanglief, einen Namen vor sich hinmurmelnd. Ja, sie und Bono hätten sich das Maul zerreißen können oder Irenes Mutter? – Auch die Jugendlichen … Und die Alte mit der Gießkanne, überhaupt jeder von den Leuten dort oben auf den unzähligen Balkonen, die sich sonnten, aßen, rauchten, knutschten, gafften, hätte es herumtratschen können. Mir war schwindlig. Ich sollte nicht hochstarren. Ich stieg ab und schob. Wann kam endlich diese blöde Linde? Die meisten Bäume waren winzig oder völlig vertrocknet. Der Rasen auf dem schmalen Streifen zwischen den Eingängen war gelb und voller Kaugummis und Papierchen. Dazwischen 153 ein Schild: Komfortable Wohnungen, auch für Sie im „Quartier Azurro“. In der Zeitung hatte gestanden, dass es den versprochenen Einkaufsmarkt in Fußweite noch immer nicht gab, ebenso wenig wie einen Kindergarten oder die Buslinie zum Bahnhof. Was suchte Mama eigentlich gerade hier? Die Linde stand in einer schmalen Lücke zwischen zwei Azurro-Klötzen, sie war gewaltig und uralt, mit einem Stamm, den zu umfassen es drei Menschen gebraucht hätte, und einer majestätischen Krone. Jenseits des rauschenden Hellgrüns erstreckten sich endlos die Felder. Ein Trampelpfad, der unter dem Baum begann, führte durch sie hindurch. Zu beiden Seiten des Pfads leuchtete die Wegwarte – ein helllila Band, das sich im letzten, noch nicht abgeernteten Weizen verlor. Mamas Rad war tatsächlich genau dort unter dem Baum angeschlossen, stand aber doch ein paar Zentimeter entfernt. Ich wusste, die Rinde zu beschädigen, wäre ihr unerträglich gewesen. In ihrem Fahrradkorb lag ein länglicher Laib Brot. Es war locker in transparentes Papier eingewickelt, an dem offenbar der Fahrtwind gezerrt hatte. Richtig, heute früh hatte es nur Toastbrot aus dem Gefrierfach gegeben. Ich beugte mich vor, um den frischen Brotduft einzusaugen, doch ich roch nichts. Wie gut sich die Kruste anfühlte. Speichel sammelte sich in meinem Mund. Ich brach das Endstück ab, begann zu kauen. Es war weich und frisch und schmeckte leicht nach Kümmel. Mir war, als hätte ich nie zuvor besseres Brot gegessen. Gierig riss ich ein weiteres Stück ab. Sie hatte ans Einkaufen gedacht. Verrückte dachten nicht ans Einkaufen für ihre Familie. Verrückten war es egal, ob ihre Kinder Toast essen mussten. Ich wickelte das Papier wieder 154 sorgfältig um den angegessenen Laib, schlug die Enden nach unten ein, wie Mama es mir beigebracht hatte. Kauend lehnte ich am Stamm. War es diese gewaltige Linde, zu der es sie immer wieder zog? Wollte sie in Ruhe nachdenken und war einfach froh, dass sie hier im Viertel kaum einer kannte? Als ein dürres Kind mit Ball schräg gegenüber durch die Hochhaustür hinausschlüpfte, blitzte das Glas schrill auf im Morgenlicht. Meine Augen blieben an den Eingängen hängen. War es hier gewesen: War sie einfach hinüber gegangen zu den gleichförmigen Klingelbrettern? Hatte sie dort auf irgendwelche silbernen Knöpfe gedrückt, hatte sich ängstlich geräuspert und dann wildfremde Menschen durch die Gegensprechanlage gefragt: „Entschuldigen Sie bitte, aber kennen Sie vielleicht einen Gerhard?“ So konnte es nicht gewesen sein. Nicht Mama. Mama war schüchtern, zurückhaltend … Ich riss mich vom Anblick der fremden Fassaden los. Mama brauchte so was doch nicht zu tun. Ich drehte mich weg, dem Pfad zu: Nein, dorthin wollte sie bestimmt, immer los über Wiesen und Felder, dem lila Band folgend. Wie Karl mochte sie bestimmt einfach gerne stundenlang über die Äcker laufen, immer ihren Gedanken hinterher. Es wird irgendein besonderer Tag gewesen sein, als sie meinte, sie müsste unbedingt einen Fremden nach unserem Gerhard fragen. Es musste ein Tag gewesen sein, an dem ihr die Sehnsucht ganz unerträglich geworden war – als sie, wie Desirée, „ganz von Sinnen“ war vor Schmerz. Vielleicht war es ja der Jahrestag gewesen, an dem er verschwunden war? Nein, der war im tiefsten Winter. Sein 155 Geburtstag? – Wurde er nicht auch noch Fünfzig dieses Jahr? Ein runder Geburtstag, natürlich! Oder doch sein Namenstag, den sie immer so schön gefeiert hatten? – Nur ein unglücklicher Zufall, dass einer von diesen dummen Hochhäuslern es in der Stadt herumerzählt hatte (Irene? Ihre Mutter?), dass so die böse Nachrede zu Stefans Vater und von dort zu Stefan gelangt war. Ich trat ein paar Schritte auf den Weg und blickte suchend die Landschaft ab, dieses Muster aus Heugelb und Sandbraun, begrenzt nur durch ein kleines Birkenwäldchen. Vielleicht lag sie einfach glücklich dort irgendwo unter einem Baum? Einen Arm über die Augen gelegt, würde sie vor sich hinsummen, über sich den Tanz der Birkenblätter im Wind, während von ihr unbemerkt, eine Ameise von ihrem nackten Zeh herunter auf die Welt blickte. So in Gedanken bückte ich mich, pflückte ein paar Blumen, Gräser dazu, aus denen Samen rieselten, eine Taubnessel … zuletzt ein Grashalm, den ich um den Strauß wickelte, um ihm Halt zu geben. Dann legte ich ihn in den Korb neben das Brot. Sie war nicht mehr da, meine Hütte. Ich hätte geschworen, dass ich noch im Dunklen zu ihr hätte finden können. Und nun brannte hell die Sonne und ich stolperte nur zwischen Stämmen und Büschen umher. Nichts schien mehr vertraut. Schloss ich die Augen, sah ich genau vor mir, wie es ausgesehen hatte: die dichte Fichtenschonung, die Sichtschutz gab, dann, urplötzlich, ein heitererer Raum: lichter Mischwald. Und dort, inmitten all der Linden und Eichen, stand sie schon: die einzige Blutbuche weit und breit. 156 Zeltförmig hatte ich damals um ihren Stamm die dicken Äste gebreitet, die ich von weither geschleppt und schließlich mit Laub und Zweigen getarnt hatte. Etwa dreißig Meter dahinter senkte sich der Boden zu einer moorigen Kuhle, vielleicht entstanden aus einem Bombenkrater. Dort hatte ich oft Spuren von Wildschweinen entdeckt. Auf der anderen Seite der Senke musste die kleine Grasfläche sein. Ich hatte noch immer dieses sanfte Grün vor Augen, das unter den wenigen Stämmen wuchs … Die Fichten meiner Erinnerung waren in Wahrheit Kiefern und sie nahmen kein Ende. Die sperrige, modrig riechende Tasche schleppte ich wie einen Rucksack auf dem Rücken, die Henkel vor der Brust umklammert. Mein Rücken war nass vor Schweiß und die Zweige schlugen mir immer wieder ins Gesicht. Mit jedem Schritt wurde die Tasche schwerer. Ich hatte mir alles so schön gedacht. Schon als kleines Kind hatte ich so gerne in meiner kleinen Hütte schlafen wollen. Wieder und wieder hatte ich Gerhard davon erzählt, während ich die Stämme herangezerrt hatte: eine Nacht nur wollte ich mal hier im Wald sein. Der Geruch der warmen, modrigen Erde, der Ruf des Käuzchens und niemand auf der Welt wusste, wo ich war. Oma hatte damals, als ich bloß gesagt hatte, wie schön es wäre, sofort abgewinkt: „Der Boden ist kalt. Du wirst dir den Tod holen. Außerdem: nachher irrst du heulend zwischen den Bäumen herum und Mama kriegt vor Sorge die ganze Nacht kein Auge zu.“ Ich starrte auf die undurchdringliche Nadelwand. Nun war ich bald erwachsen, war hier in „meinem“ Wald, aber es war, als ob er mich absichtlich in die Irre führte, mich verstieß. Als ob 157 es um mich herum merkwürdig raunte, so fremd und unheimlich, dass ich mich zwingen musste, nicht immerzu hinter mich zu blicken. Was war los mit mir? Mama hatte Recht, es gab keinen Grund, Angst zu haben. War ich nicht früher als Kind halbe Tage hier im Wald gewesen, ganz alleine – nur in Gesellschaft von Gerhard? Ich setzte mich auf einen Baumstumpf, kramte in der Tasche, bis meine Finger etwas Kühles, Glattes ertasteten: Glas. Vorsichtig zog ich das Bild aus der Tasche. Eulenblicke, die ironisch grinsten: Wo war sie hin, die mutige kleine Nelly? Er sollte nicht so gucken. Dieses Verständnisvolle, dieses Traurige – nicht jetzt. Ich warf das Bild in die Tasche zurück … Da hörte ich dieses tiefe Brummen. Ich rührte mich nicht, lauschte. Das kannte ich, auch das hatte doch stets dazugehört wie meine braunfleckigen Harzhände, wie das Blätterrascheln unter den Füßen, wie der hohle Klang meiner zwischen den Stämmen hallenden Stimme, die Gerhard Geschichten erzählte, ihn umschmeichelte, prahlte … Nun wusste ich es: Das Brummen kam vom nahen Kiesteich, in dem ich nie hatte baden sollen, der gewaltigen brummenden Schwimmbagger und der gefährlichen Tiefenströme wegen. Es kam von links, und da wusste ich auch plötzlich wieder, wo ich war, ahnte schon den schmalen Weg, der sehr bald auch nach links weisen würde, dem lichten Mischwald und meiner Buche entgegen. Und ich lief schneller. Die Tasche nun als Schutzschild vor Gesicht und Brust haltend, stolperte ich leichtfüßig durchs Geäst, pfiff sogar vor mich hin, bis ich erwartungsgemäß nach kaum hundert Metern die Abzweigung fand, der Weg sich weitete, das Gestrüpp sich lichtete. Mein Wald. Mein Weg. Meine 158 Hütte. Als sie plötzlich vor mir lag, stand ich wie erstarrt. Unglaublich. Alles war vollkommen unverändert: der Baum, die Kuhle, das helle Grün, die Hütte. Ich warf die Tasche ins Laub und rannte die letzten Meter fast bis zum Eingang. Makalewski lag rücklings auf der Oskötterbank und schnarchte. Sonst war niemand in der Nähe. Der Bierkasten war leer, er stand jetzt im Gras. Die Barackentür, hinter der Ronny verschwunden war, um Wasser für mich zu holen, (wann war das: Vorgestern? Vor Wochen?) war nur angelehnt, aber ich wagte nicht, hineinzugehen. Ich setzte mich ins Gras und gähnte. Wie lange ich in der Bude geschlafen hatte, wusste ich nicht. Ich hatte vergessen, meine Uhr mitzunehmen. Makalewski hatte unter einer weiten Turnhose haarige weiße Waden voller Narben. Ich versuchte nicht hinzuschauen. Bis vor kurzem hatte ich an Männerbeinen nur Papas schmale, fast haarlose Beine mit den bläulichen Äderchen wahrgenommen. Plötzlich waren überall Männerbeine. Im Schwimmbad war ich von ihnen umgeben gewesen, ich wusste auch genau, wie die muskulösen, braungebrannten Schenkel von Karl aussahen, sah die glatten mondscheinfarbenen Knie von Stefan vor mir. Warum kamen eigentlich bei Desiree Männerwaden niemals vor? Die Schatten der Bank reichten schon bis zu meinen ausgestreckten Füßen. Vermutlich war später Nachmittag. Oma würde längst von Frau Würsching zurück sein, Mama aus der Siedlung. Ob Oma Karl gefragt hatte, ob er wüsste, wo ich sei? Ob Karl vermutete, ich sei bei Stefan? Ob Oma 159 und Mama zusammen gegessen hatten? Ich dachte an das Brot. Was Mama wohl gedacht hatte, als sie die Blumen gefunden, das Brot ausgepackt hatte? Ich hätte es mitnehmen sollen. Die feste krosse Kruste, der leichte Geschmack nach Kümmel … Ich hatte zwei der Fischkonserven im Wald leer gemacht und war noch immer schrecklich hungrig. Und durstig. Ich schmeckte noch das wunderbar metallische Wasser. Ob ich doch nachschauen sollte, was hinter der Tür war? Etwas Weiches legte sich plötzlich auf meine Schulter – als drückte jemand ein in der Sonne erwärmtes Marshmallow auf meine Haut: Ich blickte mich erschrocken um. Tilos Hand! „Fühlst dich wohl bei uns, was?“ piepste er und sein breites Grinsen entblößte einen fehlenden Eckzahn. Ich zog die Knie an, dachte: „Blöder Bubi“, während er um mich herum kam, sich direkt vor mir aufbaute. Keinen halben Meter vor mir: dünne, braungebrannte Waden mit blonden Haaren und Mückenstichen unter zu engen, weißen Shorts. Er roch stark nach billiger Seife. „Weißt nicht wohin, was?“ Ich schwieg. „Hast Hunger, was? Durst?“ Makalewski schnarchte ungerührt. Der Bubi folgte meinem Blick: „Hackedicht, der Alte.“ Er ging auf die Bank zu, versetzte ihr einen unsanften, festen Tritt, der das Stahlgerüst leicht nach hinten kippeln ließ, doch Makalewski rührte sich nicht, setzte bloß kurz in seinem Schnarchen aus – nur um dann um so lauter weiter zu schnorcheln. „Siehste?“ Er grinste wieder: „Kommst du mit in meine Bude?“ Seine Hand wies irgendwie nach oben in Richtung Haus. „Nee.“ 160 „Ist kuschelig. Sag ich dir“, piepste er. Wo steckte denn der Wolfsmann? „Voll sauber alles.“ Ich schüttelte den Kopf, blickte ins Gras. „Ist wichtig für eine wie dich, weiß ich doch.“ „Lass mich in Ruhe“. Ich kriegte es kaum raus. Meine Zunge klebte am Gaumen. „Hab auch Wasser, Bier, alles …“ Plötzlich kauerte er sich vor mich ins Gras: „Sogar Ritter-Sport-Schokolade.“ Wieder fasste er mit zwei Fingern mein Kinn. Ich roch seinen Tabakatem: „Hab dich doch nicht so …“ Es klang flehend. Ich rutschte reflexartig so weit ich konnte nach hinten, meine Hand sauste dabei durch die Luft, erwischte ihn irgendwo zwischen Schläfe und Ohr. Erschrocken wich er zurück, funkelte mich böse an … „Lass bloß die Finger von dem Mädel.“ Ronny rannte, soweit seine kurzen Beine es erlaubten, kam eiernd über den Weg vom Barackeneingang zu uns gesprintet. Er schubste den immer noch verdattert auf der Erde kauernden Tilo einfach mit einem Schulterstoß ins Gras, dann hielt er mir seine ausgestreckte Hand hin. „Der meint´s nicht so.“ Ich kam mühsam hoch. „Ist eigentlich ganz okay, weißte.“ Mit wackligen Knien stand ich vor Ronny, der gerade mal so groß war wie ich. Ein leicht-süßlicher Geruch umgab ihn. „Ist der Notstand hier, weiter nichts.“ Seine Hand ging andeutungsweise in Richtung seines Hosenschlitzes, wies dann auf Tilo wie auf einen unartigen Hund. „Kommen manche nicht gut klar mit, gerade die Jungen.“ Tilo starrte stur ins Gras, rührte sich nicht. Ronny lächelte mich freudig an: „Alles wieder in der Reihe?“ Er war 161 stolz auf sich, hatte die Sache hier in Ordnung gebracht. „Was ist, kommste mit?“ Er nahm vorsichtig mein Handgelenk, zog mich in Richtung Eingang: „Kann auch Spiegeleier, und Bohnen. Und der Gregor kommt auch gleich. Holt bloß Tabaknachschub.“ Richtig: Gregor hieß der Wolfsmann mit richtigem Namen. Ich ließ mich durch die Tür führen, fand mich in einem waschküchenartigen Raum wieder, in dem es neben einem fettverklebten Herd und einer fast leeren Spüle auch einen großen Tisch mit Stühlen gab. Über einer Lehne hing ein gelblich verfärbtes Feinripp-Unterhemd. Zwei geschossene Stahltüren führten offenbar in weitere Räume. Ich wählte einen Küchenhocker, der halbwegs stabil wirkte. Während ich Ronny zusah, der am Herd hantierte, wurde ich langsam ruhiger, fühlte mich fast geborgen in dieser „Küche“. Dabei: Wer war überhaupt dieser kleine, dicke, fremde Mann in seiner müffelnden Trainingsjacke, der mit einem gefährlich aussehenden Klappmesser eine dicke Scheibe Schinken abschnitt, Butter in eine schmuddelig aussehende Pfanne gleiten ließ. Und wer wohnte hier eigentlich noch alles? Als könnte er Gedanken lesen, sagte er: „Ist kein Ort hier für ein Mädel wie dich.“ Er griff in das Backofenfach, holte eine kleine Weinbrandflasche hervor, wie sie im Regal neben der Supermarktkasse standen, und nahm verstohlen zwei gierige Schluck. Ich starrte die Wasserflasche an, die ich neben dem großen Tisch entdeckt hatte. „Zuviel Männer hier, verstehste?“ Ich konnte nicht widerstehen. Ich bückte mich, griff nach der Flasche, setzte sie sofort an. Ohne zu fragen, ohne auch nur einen Gedanken an irgendwelche Bakterien zu verschwenden, trank ich sie gierig halb aus. Als 162 hätte ich nie köstlicheres Wasser getrunken. Ronny sah mir zu, während sich der Raum mit dem Duft gebratenen Schinkens zu füllen begann. Sein Blick streifte meine etwas knappe Bluse, wanderte dann zur halb geöffneten Tür: „Man wird nen andrer, wenn man so lebt, weißte.“ Er kippte eine Dose rote Bohnen auf den Schinken: „Gibt nicht viele, die nicht vergessen, wie sich einer benimmt, der nen Herr ist.“ Er kramte eine Gabel aus der Schublade: „Gregor ist so einer. Gregor ist ne andere Nummer wie wir. Der rührt nicht mal nen Schnaps an.“ Die Bohnen blubberten. Ronny schlug ein Ei über der Pfanne auf, salzte: „Was suchste hier? Was willste von Makalewski?“ „Gerhard“, sagte ich schließlich: „Gerhard Bögel. Mein Onkel. Der war in Sibirien. Na ja, so gut wie sicher. Der Makalewski doch auch. Vielleicht kennt der ihn ja. Vielleicht hat er was von ihm gehört.“ Ronny schwieg, betrachtete das Ei. In der Stille hörte man die Fliegen, die um die nackte Glühbirne kreisten. „Der Gerhard ist verschwunden im Krieg. `43 war das. Dabei war der ein ganz Kluger … Der hätte sich nicht … Wenn der in Russland in Gefangenschaft geraten ist, dann … Der wär bestimmt irgendwie … durchgekommen.“ Ronny rührte in der Pfanne herum. Dann holte er die Weinbrandflasche wieder aus dem Ofen, nahm einen weiteren tiefen Zug. Ich wollte, dass er etwas sagte: „Hätte doch sein können, nicht wahr?“ Ronny trug die Pfanne zu mir, stellte sie vor mich auf den Holztisch. Sofort begann ich das Bohnen-Ei-Gemisch in mich hinein zu schaufeln. Köstlich. Ronny schaute mir zu: „Wat machste, wenn der Makalewski nichts weiß?“ 163 „Wenn nicht“, schmatzte ich, „wenn nicht, dann muss ich eben … Dann such ich den eben woanders. Wegen meiner Mama. Dann such ich eben in ganz Deutschland. Irgendeiner wird ihn schon getroffen haben.“ Gierig trank ich den Rest der Wasserflasche in einem Zug aus. „Ich muss den Gerhard finden!“ Wie gut, dass ich hier war; dass Ronny mir half und der Wolfsmann, der sicher auch gleich zur Tür reinkäme … „Und wenn du den gar nicht finden kannst?“ sagte Ronny plötzlich, „weil der längst tot ist, krepiert. Draufgegangen wie die meisten?“ Dass ich mir irgendwas am Fuß gezerrt hatte, als ich versucht hatte, die schwere Tür nach draußen aufzutreten, merkte ich erst später, fast zurück bei der Hütte, als mir auch einfiel, dass ich Ronny nicht mal gedankt hatte für das Essen, stattdessen einfach aufgesprungen war und losgebrüllt hatte, dass er nicht so einen Mist reden sollte ... Erst im Wald realisierte ich auch, dass es niemand anders als der Wolfsmann gewesen sein konnte, der mir irgendwann laut „Nelly“ hinterher gerufen hatte, als ich wie ein Blitz über den Panzer-Plattenweg geradelt war, meiner Bude entgegen. Dabei war es doch klar, dass es natürlich gar nicht mein Vater hätte gewesen sein können, wie ich kurz annahm, weil der bestimmt nicht mal wusste, dass es hier Baracken gab, und der in Rüdesheim war oder sonstwo und dass Tilo auch bestimmt nicht, wie ich noch im Vorüberrennen geglaubt hatte, gerufen haben wird: „Ich komme, wart`s nur ab …“, weil Tilo doch keinen Schimmer hatte, wo meine Hütte war und, weil er doch auch 164 eigentlich ganz okay war, wie Ronny gesagt hatte … Hauptsache ich war wieder daheim, in meiner Bude, im Wald, in Sicherheit … Nacht. Schattenschwarz. Wo war das Licht? War nicht eigentlich Halbmond? Der eigene Atem, laut wie Brausen. In der Hütte bleiben? – Undenkbar: Alles um mich war Rascheln und Wispern. Panisch kroch ich ins Freie, stieß mir hart einen vorstehenden Ast in den Nacken. Nur nicht wimmern jetzt. Nur leise. Sich mit dem Rücken zur Hütte ins Dunkle kauern, Knie anziehen, lauschen, Decke um die Schultern. Pockernder Schmerz hinten am Hals. Im Dickicht war was, das hat sich auf mich gerichtet, wie Saugarme – lauernde Augenpaare? Ruhelos tasteten meine Blicke die Schemen finster-knarrender Baumstangen ab. Das Messer? Hände auf Hosentaschen. Nein. Im Rucksack, in der Hütte – unerreichbar. Was war da? Bloß das Rascheln alten, vertrockneten Laubs im Wind. Sonst nichts. Sicher nicht. Nicht doch vorsichtige, berechnende Schritte über morsche Zweige? Gar nicht da sein. Sich auflösen. Todeswald. Wie kam das Wort jetzt her? Selbstmörder gingen in den Wald, knüpften sich auf. War ich sieben, als sie es geflüstert hatten in der Hofpause? Auf der anderen Seite des Orts im Pfauenwald war´s, da hatten sie einen jungen Mann von einem Baum abgenommen. Ganz gelb soll er schon gewesen sein im Gesicht, erzählte Rüdiger, der Sohn vom evangelischen Pastor, und voller Fliegen. Warum das einer machte? Darüber hatten wir immer wieder geredet. Traurigkeit, hatte Rüdiger gesagt. Schlimme 165 Traurigkeit, hatte ihm sein Papa gesagt und ich hatte Mama beobachtet an den Tagen, an denen sie fast nichts redete und beim Bügeln innehielt und die weißen, gestärkten Laken anstarrte als bargen sie ein schlimmes Geheimnis. Eine schöne Frau, eine Verheiratete aus dem Ort, sollte schuld gewesen sein, hieß es dann plötzlich. Und für eine Weile hatten sich die Erwachsenen umgeblickt in der Kirche, als suchten sie wen – und wir durften nicht mehr zum Spielen in den Pfauenwald, wo es lange schon keine Pfauen mehr gab. Kam von dort hinten ein Knacken? Schlich da einer von der Wildschweinkuhle her durchs Gestrüpp? Schliefen Wildschweine nachts? Ich duckte mich noch tiefer. Herbst kroch jetzt langsam aus dem Boden, feuchte, kalkigriechende Kühle … Todeswald. Wald der Soldaten im Schnee … Wenn die Flocken wirbelten, wenn wir Kinder hinausrannten in den tanzenden Wirbel, verkroch sich Mama. Sie blieb im Bett, verschloss die Tür hinter sich. Und Oma sagte: „Die Mama ist krank“ und verquirlte Rotwein und Ei und Zucker, als hätte jemand Angina, trug das Glas in ihr Zimmer und blieb lange fort. Als wäre es nicht immer wieder das eine Bild, das sie krank machte im Winter, von dem Oma erst erzählte, als ich neun war oder zehn schon, aber dafür wieder und wieder, damit ich auch bestimmt verstand, wie das war mit „meiner Mutter“: Das Bild vom toten Soldaten im Schnee auf der Flucht. „Aufgequollene Gesichter halber Kinder, Nelly, kannst du dir das vorstellen?“ hatte Oma gefragt, als wäre es gut, sich so was vorstellen zu können. „Gesichter wie das Jungengesicht von Gerhard … Auf die ist man getreten aus Versehen, verstehst du, auf die Gesichter unter dem 166 Schnee…“ Und ich hatte wieder an diesem schrecklichen Husten gewürgt, wenn sie davon erzählt hatte. „Das hat sie gesehen und zuerst unter den Sohlen der viel zu großen, vom Gerhard geerbten Schuhen gespürt, immer wieder, als wir uns mühsam durch die riesigen Wälder geschleppt haben, gegen den Schnee an, die Kälte, die Erschöpfung – immer Richtung Westen … und es hat nichts genutzt, dass ich versucht habe sie da wegzuzerren …“ Warum nur hatte ich nicht doch einen Brief dagelassen auf dem Küchentisch? „Liebe Mama, ich komme bald zurück und ich werde nicht alleine sein. Du wirst dich wundern. Ich bringe eine Überraschung mit. Mach dir bloß keine Sorgen …“ Vor der Haustür würden wir stehen, den Gong ertönen lassen und warten. Schon durch das Drahtglas würden wir sie kommen sehen. Die Tür würde sie aufreißen und einen Moment lang würden ihre Blicke zwischen uns beiden hin und her gehen, sich unsicher auf seine Eulenaugen hinter der Brille richten, fragend, ängstlich, vielleicht sogar erschrocken, würden sein ironisches Lächeln erkennen, den Haarwirbel rechts an unserer beider Stirn. Alle Zweifel würde sie beiseite wischen, würde einfach mit einem Schrei auf ihn zustürzen, ihre Arme um seinen Hals werfen. Und Gerhard müsste meine Hand loslassen, um sie zu umarmen, während Oma plötzlich im Flur stünde, fragend, dann fassungslos, und Oma würde seinen Namen stammeln und immer wieder mit ihrer runden rauen Hand über seinen Unterarm fahren und „Junge“ sagen, einfach „Junge“, während ihr die Tränen übers Gesicht liefen. Und es wäre gar nicht schlimm, dass er vielleicht so komisch aussähe wie Makalewski mit dieser roten Haut und den 167 Kratern im Gesicht und den traurigen Augen, denn er wäre ja jetzt zu Hause bei uns und würde sich schnell erholen. Und wenn ihm auch noch ein Bein fehlte oder ein Arm, vielleicht sogar ein Auge oder gar die Nase, dann würden wir uns bestimmt nach einer Weile auch an den Anblick gewöhnen und sogar immer öfter vergessen wegzugucken, wie es mir schon jetzt beim Wolfsmann passierte. Oma würde ihm Kliebchensuppe kochen, Papa würde abends am Esstisch mit ihm Bier trinken, mit seinem Schwager, und ihm von der Rechtschreibreform erzählen oder den Problemen mit dem Rasenmäher … Wo kam das Glitzern her? Silbrig glänzte es auf hellen Stämmen. Dort, irgendwo links musste der Mond jetzt zwischen den Wipfeln stehen. Oder waren es die Reflektionen des Raumschiffs, das jetzt reglos über den Wipfeln stand, leise surrend wie die Mückenschwärme zwischen den Bäumen? Und die Außerirdischen verharrten an ihren Guckluken, noch immer zögernd, ob sie schon die Heimreise zu ihrem Planeten antreten oder doch noch ausharren sollten, weil hier eine wichtige Mission auf sie wartete … „Helft mir“, flüsterte ich hinauf zu den silbrigen Kronen. Und ein leichter Wind fuhr zwischen den Stämmen hindurch, dass ein Rauschen durch den Wald ging und ich kurz die Augen schloss. „Merk dir: Der Wald ist dein Freund, was auch immer passiert!“ hatte Mama gesagt. Natürlich. Was war nur mit mir los gewesen? Meine schönen Bäume ringsumher, mein kleines Gebüsch, ein Uhu, der geräuschlos zwischen den Stämmen hindurchglitt: mein lieber Dorfwald, nur wenige hundert Meter entfernt von den nächsten Häusern. Keine 168 Ungeheuer. … Ich gähnte. Mein rechter Fuß war eingeschlafen. Ich stand mühsam auf, hüpfte auf einem Bein. In der Hütte wartete mein Nest frischen, weichen Laubs … Makalewski bot auch wach einen erbärmlichen Anblick, wie er da im Morgenlicht zusammengesunken auf der Oskötterbank kauerte, in der zitternden Hand eine Flasche Wasser. Alle paar Sekunden sog er an ihr, als gäbe es jedes Mal aufs Neue die Chance, dass plötzlich Schnaps aus ihr floss. „Gibasher, Ronny, bitte. Du hascht was“, nuschelte er, als sie leer war und starrte Ronny düster an, der auf der anderen Seite des Kistentisches ungerührt Kartoffeln schälte, die er in einen Blecheimer plumpsen ließ. Der Wolfsmann, so nannte ich Gregor immer noch bei mir, saß neben Makalewski. Er zog eine dünne, selbstgedrehte Zigarette aus einem zerdrückten Tabakbeutel, zündete sie gemächlich mit einem Benzinfeuerzeug an und reichte sie Makalewski, der sie gierig zwischen seine Lippen schob, die, wenn er nicht trank, unablässig Unverständliches murmelten. Ich blickte noch einmal um mich in den lichten Wald hinein, bevor ich hinter meinem Baumstamm hervortrat, mich räuspernd bemerkbar machte. „Nelly-Mädel. Da ist sie. Was hab ich gesagt. Komm zu uns. Setz dich!“ rief der Wolfsmann, winkte mich zu sich und deutete auf einen umgekippten Hocker im Gras. „Ich wusste, dass du heute Vormittag wiederkommst. Couragiert wie deine Großmutter“, sagte er grinsend, während ich mich setzte. Auch Ronny nickte mir blinzelnd zu: 169 „Näher. Nur näher. Wir beißen nicht. Und Tilo ist weg. Der musste zum Amt.“ „Der lässt sowieso die Finger von dir. Hab ich mir gestern vorgeknöpft“, sagte der Wolfsmann und klaubte eine weitere Zigarette für sich aus dem Beutel. Jetzt sah man: Seine Nase war aus sechs Teilen zusammengestückelt. Die Naht auf dem Nasenrücken war merkwürdig schief, als sei der Chirurg seitlich abgerutscht. „Du willst mit Makalewski reden? Kannste jetzt. Haben wir für gesorgt.“ Er blickte zu dem nun rauchend verstummten Kumpel, versetzte Makalewski einen leichten, aufmunternden Stoß: „Die Nelly kennst du doch. Von der Oma im Ort, die dir die gute Suppe macht.“ Makalewski starrte mich mit glasigem Blick an. „ … die gute Mehlsuppe, weißt schon“. Mühsam nuschelte Makalewski schließlich: „Mettwurststullenunsaft“ Ich nickte. „Gutes Kind. Gute Omma“, brachte er heraus, nickte mir zu. Wir waren alte Bekannte. Der Wolfsmann zog an seiner Zigarette: „Frag ihn, was du wissen willst. Das mit dem Konzentrieren ist nicht seine Sache. In dem Kopf, da ist schon zuviel passiert, verstehst du? Da ist kein Platz für Gerede. Also, leg los und mach´s kurz.“ Er gab Ronny ein Zeichen, der daraufhin, wie verabredet, ein halbvolles Weinbrandfläschchen aus der Tasche seines Trainingsanzugs zog, es aufschraubte und über den Bierkastentisch reichte. Makalewski trank so gierig, dass sein Adamsapfel hüpfte und die Augen fast aus den Höhlen traten. „Mein Onkel …“, sagte ich und hatte plötzlich einen Kloß im Hals. Blödes Herzklopfen. Ich knüpfte das Handtuchbündel auf, in das ich den Silberrahmen eingeschlagen hatte, legte 170 das Bild vor ihn auf den Tisch: „Gerhard … er ist verschwunden.“ Ich räusperte mich: „ … vermisst In Stalingrad.“ Bei dem Wort verschluckte sich Makalewski, er steckte abrupt den ausgestreckten Arm mit der Flasche in die Luft, starrte mich an: „Schtalin …“ In seinem Gesicht spiegelte sich vollkommene Leere. Der Wolfsmann legte ihm vorsichtig die Hand auf den Arm, drückte ihn behutsam herunter: „Ist gut. Hör zu.“ „Er hat überlebt. Bestimmt. Ein Kamerad hat es geschrieben ans Rote Kreuz, Hartmut hieß der. In Gefangenschaft soll der Gerhard gekommen sein, hat er gesagt. Du musst auf das Bild gucken. Da …“ Ich schob es direkt vor ihn: „Ich meine, den erkennt man doch. Diese Augen, also, … das Gesicht merkt man sich doch, oder? Den Scheitel, dieser Blick?“ Makalewski hielt die Augen gesenkt. Betrachtete er das Bild? „Gerhard Bögel. Unteroffizier. Ich weiß nur das Regiment nicht … – oder heißt das Kompanie?“ „Einemijonfünfeneunzischtausend“, nuschelte Makalewski: „Mijonfünfeneunzischtausend kaltgemacht. Hungerschlägekälte …“ Er hob nicht den Blick, saß zusammengesunken, die Hand mit der Weinbrandflasche zitterte. „Draufgegangen in Lagern. Alle …“ Keiner von uns rührte sich: „So kalt … schecklischkalt … Rüdi, Vogelkopf, Hans: erfroren – oder der eiserne Bert, kein Essen, nischtnischt.“ Seine Stimme wurde immer leiser: „…. Ebi, Franz, tot. Alle tot ...“ Stille. Das Messer und die halbgeschälte Kartoffel lagen reglos in Ronnys rauen Händen. „Neunzischtausend gefangen 171 in Schtalingrad …“ Ich wusste, ich sollte aufhören, ihn in Ruhe lassen. „Aber es haben doch auch welche überlebt. Du hast doch Sibirien auch überlebt …“ Wie weinerlich und nasal meine Stimme klang. „Der Hartmut doch auch. Der lebt und der hat doch den Brief geschrieben …“ Fast unhörbar murmelte er etwas vor sich hin, schüttelte dabei den Kopf: „Workuta“, meinte ich nur zu verstehen, weil Oma erzählt hatte, dass er dort im Lager war. „Gerhard“, beharrte ich. „Er war jung. 18 Jahre erst, ein Sportler …“ „Sechstausendvonneunzischtausend“, nuschelte er, „alle anderen …“ Sein Mund stand offen, die Hand auf dem Tisch zitterte. Da war wieder dieses schreckliche Gefühl in meinem Hals, dieses Grässliche, Bittere, das Würgen, das langsam in mir aufstieg und mich schlucken ließ, immer schlucken, wegschlucken, was da hochkam … Ich sprang von meinem Hocker auf, doch diesmal war Ronny schneller. Er stand neben mir, packte mich am Arm und zog mich mit sanfter Gewalt zurück auf den Hocker. Ehe ich mich versah, hatte ich die kleine Flasche im Mund und etwas unsagbar Scharfes versengte meine Kehle. Während ich mich noch prustend von dem Schreck erholte, wischte auch schon das raue Frottee meines Handtuchs gründlich über mein Gesicht. Als ich es wegschob, begegnete mein Blick auf der anderen Seite des Tischs den schwermütigen Augen von Makalewski. Er betrachtete mich ganz konzentriert, starrte mein Gesicht an, das sicher fleckig war, meine geröteten Augen, über die mein 172 Handrücken fuhr, ignorierte sogar die frisch gedrehte Zigarette, die der Wolfsmann ihm hinhielt. Plötzlich wirkte er vollkommen wach: „Bögi“, flüsterte er und er nickte wie zur Bestätigung für seine Eingebung. Jetzt huschte sogar etwas wie ein Lächeln über seine verwüsteten Züge: „Bögi – hab ich gekannt.“ Hörte ich Recht? „Gerhard Bögel – Bögi? Meinen Onkel?“ „Guter Junge: Bögi mit der Brille.“ Wieder nickte er versonnen. „Wo ist er? Hat er überlebt? Wo kann ich ihn finden?“ Seine Hand wischte unbestimmt durch die Luft: „Bögi. War in Hamburg. Große Freiheit.“ Seine Finger schossen nun blitzschnell über den Tisch, griffen nach der noch fast vollen zweiten Weinbrandflasche, die Ronny vor mir abgestellt hatte. „Sankpauli“, murmelte er – und „Aufereeperbahnnachsumhalbeins grölte er plötzlich, dass die Spucke flog: amüsierstssudich… Dann brach er plötzlich ab, murmelte nachdenklich: „Fünf Jahre her? Oder drei Jahre?“ Er stürzte den Alkohol hinunter. „Wann denn? Wo denn?“ Ich sah ihm zu, wartete mit offenem Mund, lauschte seinem Schlucken. Als er endlich absetzte, war alles vorüber. Makalewski saß wie erstarrt. Er blickte nur noch, die leere Flasche im Schoß, ins Ungewisse. Bloß seine Lippen bewegten sich fast unmerklich, er war wieder im Gespräch mit seinen Dämonen. Schließlich blickte ich von Ronny zum Wolfsmann: „Habt ihr das gehört? Er kennt ihn. Er hat Sibirien überlebt. Makalewski kennt ihn. Ist das nicht großartig?“ Ich sprang auf: 173 „Wenn er erst bei uns vor der Tür steht – Mensch, das wird ein Tag … Die werden staunen.“ Doch Ronny war nun wieder damit beschäftigt, Kartoffeln zu schälen und der Wolfsmann verteilte Tabakkrümel auf einem Zigarettenpapierchen: „Makalewski hat viel erlebt“, sagte er unbestimmt und leckte die Klebefläche an: „Er ist ein guter Kerl, verstehst du?“ „Klar, ist er das. Er wird mir helfen. Es wird ihm noch einfallen, wo und wann er ihn zuletzt gesehen hat, ob vor drei oder fünf Jahren, und dann …“ Da sah ich, dass Tilo, der Bubi, an der Pappel lehnte, die gut zehn Meter entfernt stand. Ich hatte ihn nicht kommen hören. Als unsere Blicke sich trafen, grinste er und seine Zunge fuhr feucht über seine Lippen. Ich funkelte ihn böse an und blickte weg. Er hatte mein Erschrecken bemerkt. „Habt Ihr kapiert: Gerhard lebt!“ Ich schrie es fast. „Drei Jahre“, sagte der Wolfsmann, „können manchmal auch 13 Jahre sein – oder 23 …“ Mit zwei Fingern rollte er eine kleine gleichmäßige Tabakwurst: „… wenn man viel zuviel …“, er zögerte. „ …Tod gesehen hat.“ Er blickte mir noch immer nicht in die Augen. Die letzte Kartoffel rumpelte in Ronnys Eimer. „Ihr kennt doch Leute fast überall – bestimmt auch in Hamburg. Jemand wird sich schon an sein Gesicht erinnern. In den Notunterkünften …“ „Kommst nicht weit ohne Kohle.“ Ronnys Hand schob behutsam die Kartoffelschalen auf dem Tisch zusammen: „Hartes Pflaster da oben.“ 174 „Und die Bullen“, ergänzte der Wolfsmann, „die suchen nach dir. Garantiert.“ Ich konnte es einfach nicht fassen. Er klebte sorgfältig seinen Tabakbeutel zu: „N´Mädel in deinem Alter, das fällt auf.“ „Ihr wolltet mir helfen …“, stammelte ich. „Was ist mit deiner Mama? Deiner Oma?“ Der Wolfsmann sah jetzt Ronny in die Augen, der leicht nickte: „Wie lange warten die jetzt schon auf dich? Was meinst du, wie geht`s denen?“ Ich schüttelte nur den Kopf. „Deiner Mama geht´s schlecht, oder? Deshalb bist du hier. Ist doch so?“ Ich kämpfte mit den Tränen. Erst jetzt suchte er meinen Blick, beugte sich über den Kistentisch: „Nelly-Wolfsmädel. Die brauchen dich zu Hause. Fahr mit deinem Papa nach Hamburg. Der hat Geld, ein Auto …“ „Ihr habt doch keine Ahnung“, schrie ich, „überhaupt keine Ahnung“, und ich versetzte dem Tisch einen Stoß und stolperte dann rückwärts durchs Gras zu meinem Rad: „Dann halt nicht. Ich brauch euch gar nicht. Ich brauch niemanden.“ Auch Ronny war jetzt aufgesprungen, rang die Hände, tat einen Schritt in meine Richtung: „Nelly, nu bleib doch ma.“ Doch ich sprang auf mein Rad und raste zum zweiten Mal davon, als sei ich auf der Flucht, doch diesmal war ich fest entschlossen: Ich würde nie wieder zurückkehren. Ich schoss wie ein Pfeil über den huckeligen Plattenweg in Richtung Ort. Mit jeder Drehung der Räder stießen sich meine Gedanken an meiner Schädeldecke wund: Die Bude, der Wald, ich allein …. Allein! … Hamburg. So weit. Wie kam ich an Geld? – Hunger … Erdbeeren und Sahne, Butterstullen mit 175 Salz … Buchteln, Spiegeleier … Ronny – sein Lächeln, seine Hand mit der Pfanne. Der Wolfsmann: Deine Mama braucht dich. Würde Tilo mich suchen? Die Nacht, die Schatten … die Angst … Niemand war zu sehen hinter mir auf der leeren, heißen Straße. Wohin jetzt? Ich lehnte mich vor, trat noch schneller in die Pedale: „Bögi hab ich gekannt“ – Gerhard lebt. Gerhard in Hamburg. Gerhard, der Mama umarmt. „Mein Junge“. Wo war Oma jetzt? Wie ging es Mama? Saß sie in der Waschküche? Weinte sie? Und Papa? War er wieder weggefahren? Suchte er mich? Ich sollte besser zurück zu meiner Bude. Es war gefährlich hier. Aber warum bloß sah das Städtchen zwischen den Feldern so schrecklich friedlich aus? Als lebten dort nur glückliche Menschen. Als gehörten alle zusammen wie eine große Familie. Was zog mich so? Die Sonnen-Reflektionen auf den rötlichen Dächern? Der Klang der Glocken, die Elf Uhr schlugen? Die wogenden Pappeln vor den Resten der Stadtmauer? Ich konnte nicht aufhören zu treten, atemlos am Ortsschild vorüber zu sausen, die leeren Straßen entlang. Vielleicht erkannte mich doch jemand aus meiner Klasse? Vielleicht – ich erschrak – hatten sie mein Bild schon in der Zeitung gebracht? Nur eine knappe Woche noch, bis die Schule begann: bestimmt waren sie alle inzwischen längst zurück aus dem Urlaub. Ich hatte nicht vorgehabt in die Nähe des Schwimmbads zu radeln, doch es war dieses leise Raunen in der Luft, dem ich folgte: dieses Vibrieren, das schließlich mehr und mehr zu Juchzen und Kreischen wurde: 176 vom Schwimmbad her flutete es die umliegenden Straßen. Es kam mir vor, als sei es ewig her, dass auch ich dort hinter der Mauer auf der Decke gelegen hatte, Karl mit seiner großen, warmen Hand über meinen heißen Rücken gefahren war… Schneller, nur schneller … Nicht an Karl denken …abbiegen, ohne nachzudenken, immer auf dem Bürgersteig entlang. War hier die Schrebergartensiedlung? Ich hatte erst nicht einmal bemerkt, was ich da leise vor mich hinsummte: An der Saale hellem Strande … Da noch hätte ich gesagt: „Nowottny? Was hätte ich bei dem denn sollen?“ Nowottny gehörte nicht zu uns. Ich war auch noch nie bei ihm gewesen. Einmal hatte er Oma und mir das Foto eines einstöckigen adretten Holzhäuschens mit Veranda gezeigt, das er allein bewohnte. Achtlos wäre ich dran vorüber geradelt, hätte nicht ein Haufen Sperrmüll-Gerümpels davor gelegen, der mich zum Ausweichen auf die Straße zwang. Ich sprang vom Rad – atemlos, gehetzt, noch immer. Da erst erkannte ich es: Das Häuschen sah schäbiger aus als auf dem Bild. Das ehemals dunkle Holz der Verkleidung war grau geworden und schlierig vor Feuchtigkeit. Die Ziegel waren bemoost und selbst das kleine Rasenstück vor der schiefen Veranda zeigte kahle Stellen wie das Fell eines kranken Hundes. Ich schloss das Rad am Drahtzaun an und besah mir den Sperrmüllhaufen. Irgendwie hatte ich geglaubt, jemand der stets Anzüge trug, nach Eau de Toilette duftete und Perlendes anstimmen konnte, lebte zwischen Samt-Chaiselongues und Bücherwänden. Hier türmten sich neben alten Küchenschränken nur mehrere Plastikküchenstühle und aus einer gelben Pappkiste, in die jemand Dutzende zerlesene 177 Krimis geworfen hatte, ragte ein zerbrochener Besen hervor. Ich dachte schon, der Müll gehörte doch zu einem anderen Haus, als ich vor der Eingangstreppe genau den gleichen gelben Karton entdeckte wie den, der an der Straße stand. Das Gartentor war nur angelehnt. Nichts rührte sich hinter den zwei dunklen Fenstern. Die Straße hinter mir war leer, das Grundstück gegenüber war durch eine mannshohe Hecke abgeschirmt. Ich schlich über den Plattenweg zur hölzernen Veranda. Die Dielen knarrten, als ich mich vorbeugte, um durch eines der Fenster zu blicken, sonst blieb alles still. Ich erkannte sofort die Kissenhüllen auf dem schäbigen Wohnzimmersofa. So eine hatte ich im Handarbeitsunterricht häkeln müssen und Oma hatte mir dabei geholfen. Schneckenförmig rund waren sie und so bunt wie ein Regenbogen, und während mein Werkstück oval und knotig geraten war, hatte Oma nach meinem Hilferuf innerhalb kürzester Zeit spielend den bunten Kreis fertig gehäkelt, mit Seide unterlegt und zu einem runden Stuhlschoner vollendet, für den ich eine Eins bekam. Aber auf dieser Couch lag ein halbes Dutzend der Dinger. Oma musste sie für ihn gehäkelt haben. Hier musste sie daran gearbeitet haben, viele Stunden lang, während er vermutlich gegenüber in dem alten Ohrensessel gesessen hatte. Ich hatte nach der Sache im Wald nicht so gerne darüber nachdenken wollen, was Oma und er eigentlich die ganze Zeit über taten, wenn sie zusammen waren. Das hier, das war so … normal! Es war wie Dinge, die ein altes Ehepaar tat. Würde Oma wirklich gehen? 178