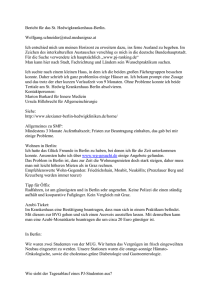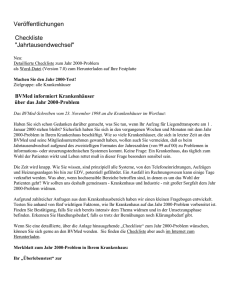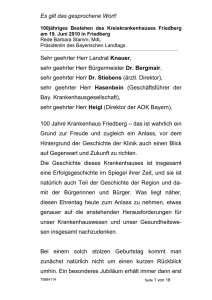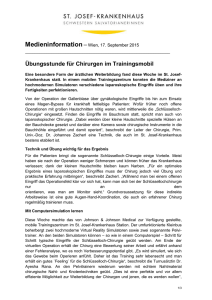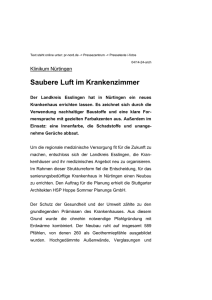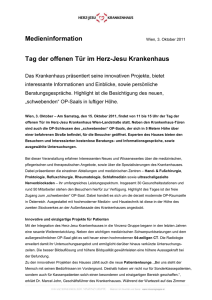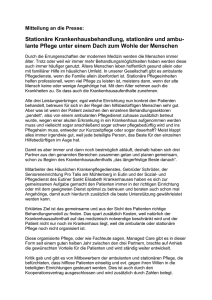Organisationale Aspekte des Sterbefalls im Krankenhaus
Werbung
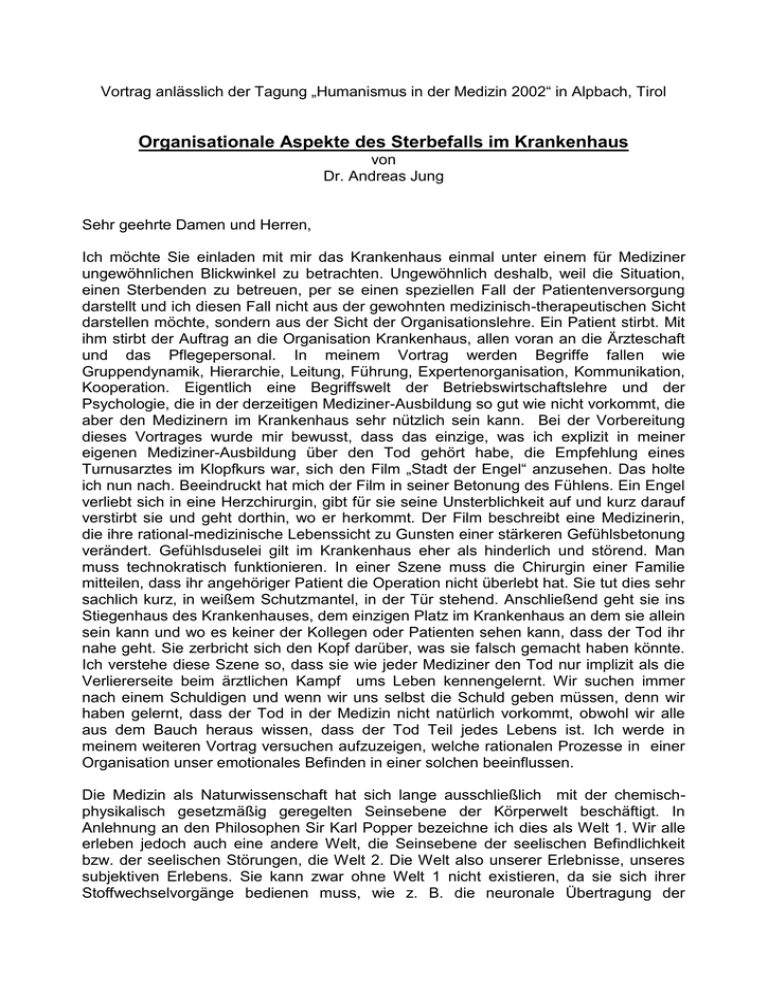
Vortrag anlässlich der Tagung „Humanismus in der Medizin 2002“ in Alpbach, Tirol Organisationale Aspekte des Sterbefalls im Krankenhaus von Dr. Andreas Jung Sehr geehrte Damen und Herren, Ich möchte Sie einladen mit mir das Krankenhaus einmal unter einem für Mediziner ungewöhnlichen Blickwinkel zu betrachten. Ungewöhnlich deshalb, weil die Situation, einen Sterbenden zu betreuen, per se einen speziellen Fall der Patientenversorgung darstellt und ich diesen Fall nicht aus der gewohnten medizinisch-therapeutischen Sicht darstellen möchte, sondern aus der Sicht der Organisationslehre. Ein Patient stirbt. Mit ihm stirbt der Auftrag an die Organisation Krankenhaus, allen voran an die Ärzteschaft und das Pflegepersonal. In meinem Vortrag werden Begriffe fallen wie Gruppendynamik, Hierarchie, Leitung, Führung, Expertenorganisation, Kommunikation, Kooperation. Eigentlich eine Begriffswelt der Betriebswirtschaftslehre und der Psychologie, die in der derzeitigen Mediziner-Ausbildung so gut wie nicht vorkommt, die aber den Medizinern im Krankenhaus sehr nützlich sein kann. Bei der Vorbereitung dieses Vortrages wurde mir bewusst, dass das einzige, was ich explizit in meiner eigenen Mediziner-Ausbildung über den Tod gehört habe, die Empfehlung eines Turnusarztes im Klopfkurs war, sich den Film „Stadt der Engel“ anzusehen. Das holte ich nun nach. Beeindruckt hat mich der Film in seiner Betonung des Fühlens. Ein Engel verliebt sich in eine Herzchirurgin, gibt für sie seine Unsterblichkeit auf und kurz darauf verstirbt sie und geht dorthin, wo er herkommt. Der Film beschreibt eine Medizinerin, die ihre rational-medizinische Lebenssicht zu Gunsten einer stärkeren Gefühlsbetonung verändert. Gefühlsduselei gilt im Krankenhaus eher als hinderlich und störend. Man muss technokratisch funktionieren. In einer Szene muss die Chirurgin einer Familie mitteilen, dass ihr angehöriger Patient die Operation nicht überlebt hat. Sie tut dies sehr sachlich kurz, in weißem Schutzmantel, in der Tür stehend. Anschließend geht sie ins Stiegenhaus des Krankenhauses, dem einzigen Platz im Krankenhaus an dem sie allein sein kann und wo es keiner der Kollegen oder Patienten sehen kann, dass der Tod ihr nahe geht. Sie zerbricht sich den Kopf darüber, was sie falsch gemacht haben könnte. Ich verstehe diese Szene so, dass sie wie jeder Mediziner den Tod nur implizit als die Verliererseite beim ärztlichen Kampf ums Leben kennengelernt. Wir suchen immer nach einem Schuldigen und wenn wir uns selbst die Schuld geben müssen, denn wir haben gelernt, dass der Tod in der Medizin nicht natürlich vorkommt, obwohl wir alle aus dem Bauch heraus wissen, dass der Tod Teil jedes Lebens ist. Ich werde in meinem weiteren Vortrag versuchen aufzuzeigen, welche rationalen Prozesse in einer Organisation unser emotionales Befinden in einer solchen beeinflussen. Die Medizin als Naturwissenschaft hat sich lange ausschließlich mit der chemischphysikalisch gesetzmäßig geregelten Seinsebene der Körperwelt beschäftigt. In Anlehnung an den Philosophen Sir Karl Popper bezeichne ich dies als Welt 1. Wir alle erleben jedoch auch eine andere Welt, die Seinsebene der seelischen Befindlichkeit bzw. der seelischen Störungen, die Welt 2. Die Welt also unserer Erlebnisse, unseres subjektiven Erlebens. Sie kann zwar ohne Welt 1 nicht existieren, da sie sich ihrer Stoffwechselvorgänge bedienen muss, wie z. B. die neuronale Übertragung der Gedanken und Gefühle in unserem Gehirn, aber die Welt 2 kann sich diesen biologischen Gesetzmäßigkeiten auch mehr oder weniger entziehen. In unserem medizinischen Alltag ist dies der Lebensbereich der Psychosomatik, wo nicht primär die ausgewogene Steuerung des chemisch-physikalischen Stoffwechsels, sondern die wohltemperierte Ausgewogenheit der subjektiven Erlebnisse die Basis des Wohlbefindens darstellt. Der gravierende Unterschied liegt darin, dass wir die physikalisch chemisch-biologischen Vorgänge weitgehend objektiv erfassen können, aber die Seele weder begreifen, noch messen können. Und dennoch erleben wir sie sehr realistisch, wenn uns ein Erlebnis in der Seele wehtut, wenn unsere Seele jubelt, wenn sie nach Liebe dürstet, wenn uns die Sucht zerstört oder unser Glaube uns gesund macht. Und wir können auch mehr oder weniger wissenschaftlich die Auswirkungen seelischer Gesundheit oder Krankheit beobachten und analysieren. So dürfen wir uns also auch die Frage stellen: Welches Enzym, welcher Katalysator, welche Triebfeder stimuliert und steuert denn auf dieser Seinsebene der subjektiven Erlebnisse die Homöostase des seelischen Wohlbefindens bzw. welches Defizit führt zu Störungen? Eines können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass das Erleben immer auf Kommunikation beruht, auf zwischenmenschlicher oder anderer Beziehung zu Tieren, zur Natur oder zu Gott. Nehmen wir einmal als Gedankenexperiment in symbolischer Analogie zur Welt 1 an, dass die Kommunikation das seelische Grundnahrungsmittel, das Substrat darstellt. Dann fehlt uns aber noch immer das Enzym, der Katalysator, der als heilsame Quelle die glückliche Homöostase der Erlebnisse zum seelischen Wohlbefinden steuert oder bei Enzymmangel tiefe existentielle Not und sprachloses Leid verursachen kann. Ganz unbewusst entlehnen wir ja für diesen enzymatischen Prozess der Kommunikation im seelischen Bereich einen Ausdruck aus der Welt 1: „Es muss die Chemie stimmen“. Dieses Enzym nenne ich mit Prof. Kurz das psychosomatische Enzym. Hier wird hier also Beziehung als Enzym ja sogar als Medikament eingesetzt. Dieser kleine Exkurs in die Psychosomatische Medizin verdeutlicht den Stellenwert der zwischenmenschlichen Beziehung im Arzt-Patienten-Verhältnis. Die Welten 1 und 2 existieren aber für jeden von uns, gleichgültig in welcher Rolle oder Funktion wir im Krankenhaus sind. Der Organisationale Blick nun beschäftigt sich mit dem Zusammenspiel dieser Rollen und Funktionen. Anders formuliert optimiert die Organisationsentwicklung im Krankenhaus die Rahmenbedingungen damit die Chemie zwischen dem Helfenden und dem Patienten auch weiterhin stimmen kann. Organisationsentwicklung ist ein Begriff der Betriebswirtschaftslehre aus der Arbeits- und Betriebspsychologie, der die fortschreitende Prozessoptimierung und Anpassung an sich ändernde Rahmenbedingungen beschreibt. Wir, als Berufstätige im Gesundheitswesen, können viel lernen aus den Theorien der Wirtschaft, die zwar kapitalistisch motiviert entstanden sind, uns nun aber Verständnis vermitteln können, um effizient mit unseren eigenen Ressourcen hauszuhalten. Diese Ressourcen und der bewahrende Umgang mit ihnen rettet uns zum Beispiel vor einem Burn-Out-Syndrom. Oft fällt es uns schwer unsere Rolle als Helfer so patientenorientiert, also so gut wie möglich, zum Wohle des Patienten auszuüben. Der Tod gehört dabei genauso zum Leben eines Patienten wie seine Geburt. Einerseits sind da unsere persönlichen seelischen Konflikte bei der Betreuung Sterbender, wie z.B. eigene Erfahrungen mit dem Tod der Eltern oder anderen Nahestehenden, und andererseits die persönliche Betroffenheit in der Situation, der Zeitmangel, die fehlenden Räumlichkeiten, differierende Vorstellungen zwischen Betroffenen, deren Angehörigen und dem Personal bezüglich der Gestaltung der letzten Lebenszeit und scheinbar unerfüllbare letzte Wünsche der Betroffenen. Letztlich fordern alle diese Ansprüche Energie aus unseren ureigenen Ressourcen, sie bedrohen damit auch unsere Identität. Wir stehen damit vor der Frage: Bin ich immer noch ein guter Arzt/Schwester/Therapeut etc., wenn ich an meine Grenzen stoße und mich nicht darüber hinaus überlasten will? Meine Antwort lautet Ja. Es nützt weder dem der Hilfe gibt noch dem der Hilfe bekommt, wenn der der gibt, mehr gibt als gut für ihn ist. Einfacher ausgedrückt lernt das jeder im Rettungsdienst Tätige: Selbstschutz geht vor Fremdrettung. Während diese Erkenntnis in der Ärzteschaft eher Berücksichtigung findet, trifft man in der Pflege immer noch auf das historische Vorbild der Pflegehelfer aus dem Dienstbotenstand mit Kraft, Ausdauer, Dienstwilligkeit und Anspruchslosigkeit und dem Leitbild der selbstlosen, aufopfernden Krankenschwester aus den gebildeten Ständen, die sich den Ärzten also Männern unterzuordnen hat. Die Rolle der Frau und die des Mannes als Angehörige des Krankenhaus möchte ich an dieser Stelle ihrer Fantasie überlassen und nicht noch näher darauf eingehen, obwohl dies auch ein wichtiger Aspekt der Zusammenarbeit ist. Mein Thema sind heute die organisationalen Aspekte einer speziellen Situation im Krankenhaus. „Organisational“ deshalb, weil ich keine „organisatorischen“ Abläufe hier skizzieren will, sondern ihnen einen theoretischen Zugang zum Phänomen Organisation eröffnen. Organisatorisch bezeichnet eher die Beschreibung eines Status Quo, wie Dinge ablaufen, ohne Hypothesen über zugrundeliegende Mechanismen zu bilden. Dazu ein Beispiel: „Der Patient kann nicht mehr.“ Er gilt als austherapiert – die Krankheiten sind nicht mehr zu bremsen. Das ist oft der Moment, da auch der Arzt festgestellt hat: Therapeutisch kann er hier nichts mehr tun – also Schluss mit Chemo, Operationen und eingreifenden Untersuchungen. Die Anweisung lautet nur noch: Luft geben, Schmerzen nehmen, Wohlbefinden schaffen. „Wir bereiten dann das Feld drum herum, damit der Mensch sich verabschieden kann“, sagt die Stationsleiterin. Sie organisiert ein Einzelzimmer, auch wenn dafür mal ein frisch eingelieferter Erste-Klasse-Patient kurzzeitig in ein Mehrbettzimmer muss. Sie sorgt für Ruhe und für eine gute Atmosphäre. Aber ist das nicht viel zu wenig angesichts all der seelischen Not in den Zimmern? Zu wenig – wer so der Stationsleiterin kommt, kriegt was zu hören: „Dass wir morgens auf der Station ein gemeinsames Kaffeetrinken anbieten für Angehörige und Patienten – das ist auch was für die Seele! Dass hier der Stationsarzt jederzeit ansprechbar ist und nicht erst nach Termin, dass die Patienten sogar ins Schwesternzimmer reinkommen können – das sind alles Dinge, die wir uns auferlegen. Gehen Sie mal ein paar Tage auf die Chirurgie oder in andere Krankenhäuser, dann sehen Sie, was wir hier für die Seele tun!“ Betrachten wir nun die Situation dieser Stationsleiterin: Sie erlegt sich und ihrer Station Dinge auf, die nicht in ihrem Arbeitsvertrag stehen und die auch nicht in der Hausordnung oder dem Leitbild der Klinik erscheinen. Warum tut sie das also und wie kann das ganze Krankenhaus von ihrer Vorreiterrolle profitieren? Auf solche und ähnliche Fragen sucht und findet die Organisationstheorie Antworten. Identität Die Wurzel der Entwicklung von Organisationen in der menschlichen Gesellschaft liegt in jedem einzelnen von uns, nämlich das Streben nach Identität. Identität wird von jedem Menschen gesucht, gefunden und aufrechterhalten. Identität beantwortet zwei elementare Fragen an uns selbst: Wer bin ich? Was will ich? Die Beantwortung ist aber nicht unabhängig von unserer Umwelt, d.h. auch von den uns umgebenden Menschen. Wir brauchen andere Menschen um unsere Annahmen über uns selbst zu bestätigen oder zu widerlegen, als Korrektiv oder psychiatrisch ausgedrückt als Realitätsprüfung. Nach Lothar Krappmann braucht Identität eine Darstellung nach außen, eine Art Marketing meiner selbst. Die Bestsellerlisten werden derzeit angeführt mit etlichen Büchern darüber. Weiterhin braucht Identität sowohl Empathie als auch Rollendistanz, d. h. sowohl die Fähigkeit sich in jemanden hineinfühlen zu können als auch Rollen, die man übernommen hat, von seinem selbst trennen zu können. Diese Ambivalenz erfordert auch ein gewisses Maß an Ambiguitätstoleranz um Uneindeutiges aushalten zu können. Wir erleben auch unsere grössten Glücks und Unglücksmomente in der Bestätigung oder Widerlegung unsrer Identität. Zwei Felder in denen wir nach diesen Momenten jagen sind einerseits unsere Liebesbeziehungen und andererseits unsere Arbeitsbeziehungen. Es wird also deutlich, dass ich arbeite damit ich wer bin und weil ich was will. Und das ist nicht nur bei mir so sondern bei uns allen. Haben sie gemerkt, was gerade passiert ist? Gruppe Wir sind gerade eine Gruppe geworden. Wir sind deshalb eine Gruppe geworden, weil ich als Individuum mein Risiko, angegriffen zu werden für meine etwas flapsige Aussage, mit ihnen teile. Noch deutlicher wird diese Risikoverschiebung bei risikoreicheren Entscheidungen: Ich als Individuum entscheide unriskanter, da ich ja meine Identität schützen will, als wenn ich mit ihnen als Gruppe gemeinsam die gleiche Entscheidung treffen müsste. Bezogen auf den Sterbefall im Krankenhaus bedeutet das, dass eine Teamentscheidung ein grösseres Risiko tragen kann als die Entscheidung eines Einzelnen. Die Gruppendynamik nennt diesen Vorgang „Risk-Shift“. Aber leider gibt es keinen Vorteil ohne Nachteil. Um sich einer Gruppe zugehörig zu machen muss das Individuum einen Teil seiner individuellen Identität zu Gunsten der Gruppe aufgeben. Beobachtet hat man das sehr deutlich bei Jugend-Gangs in den USA, die sich sogar eine Art Uniform auferlegt haben. Gefährlich bei dieser Risikoübernahme durch die Gruppe ist das Abschieben der Verantwortung: Es sind plötzlich alle verantwortlich und damit plötzlich niemand mehr. Die Verantwortung löst sich in Luft auf, sie diffundiert. Wenn zusätzlich zu dieser Verantwortungsdiffusion auch noch eine Emotionalisierung einer Entscheidung passiert, wird die Gruppenentscheidung lt. Prof. Krainz dann „blöd“, weil rationale Argumente plötzlich „stören“. Genannt wird dieses Phänomen „Groupthink“ und wurde anhand von politischen Entscheidungen untersucht. Dabei wurde der Weg einer „blöden“ politischen Entscheidung rekonstruiert und genau diese Emotionalisierung festgestellt, die dann ausschlaggebend letztlich war, obwohl alle rationalen Argumente, die man im Nachhinein gesammelt hat, vorher schon bekannt waren. Wo liegt nun aber der Vorteil einer Gruppe und der daraus abgeleiteten Organisation? Der sogenannte Gruppenvorteil liegt in der sicheren Bestätigung der eigenen Identität: Wir sind wer und wir wollen was. Gemeinsam können wir mehr leisten als die Summe unserer Individualleistungen. Unsere Gruppe bietet Schutz gegen Anfeindungen von Nichtzugehörigen, denen wir individuell schutzlos gegenüberstünden. Somit tritt ein neues Phänomen auf: der Außenfeind. Alle nicht zur Gruppe Gehörigen werden von der Gruppe als Feinde betrachtet, da sie jedem Individuum der Gruppe wahrscheinlich nicht helfen würden, da sie sich ja nicht der Gruppe angeschlossen bzw. unterworfen haben. Diese Abgrenzung nach außen macht die Gruppe nach innen geschlossener und fördert deren Zusammenhalt. Man spürt das oft, wenn man z.B. als Arzt auf einer fremden Station auf die „einheimische“ Gruppe der Schwestern trifft. Organisation In der Organisation wird nun versucht diese Vorteile der Gruppe zu nutzen ohne allzu viele Nachteile übernehmen zu müssen. Organisation ist also eine von Menschen geschaffene Kunstwelt, deren soziale Struktur mit ihren zentralen Leistungsprozessen, vom jeweiligen kulturellen Hintergrund abhängig ist. Seit 1945 hat der Grad der weltweiten Organisiertheit stetig zugenommen. Obwohl es für den inneren Zusammenhalt einer Gruppe förderlich ist, einen Außenfeind zu haben, bringt ein Friedensabkommen mit einer anderen Gruppe noch größere nämlich langfristigere Vorteile. In Mitteleuropa hat noch nie so lange Frieden geherrscht wie im letzten Jahrhundert. Diese Verflechtung der Staaten zur Friedenssicherung stößt natürlich auf innere Feinde, wie z.B. die österreichische Diskussion des EU-Beitritts zeigt. An diesem Beispiel wird deutlich, dass ab einer gewissen Größe die persönliche Beziehung der Gruppenmitglieder als Verbindung nicht mehr ausreicht. Es müssen Regeln der Interessenvertretung aufgestellt und Abläufe Institutionalisiert werden. Dadurch entfernt sich das Gruppenziel bzw. jetzt das Organisationsziel immer mehr von den Individualzielen der Mitglieder. Anschaulicher wird diese Diskrepanz im Krankenhaus als Organisation. Hier arbeiten sehr viele unterschiedliche Berufe nebeneinander. Organisationsberater nennen dies eine Expertenorganisation: Experten sind aufwendig ausgebildet und haben viel Zeit und Geld investiert, um einen hohen Spezialisierungsgrad zu erreichen. Die Leistungsfähigkeit des Experten ist das Kapital der Organisation. Das wichtigste Produktionsmittel - das Wissen - befindet sich in der Hand der Experten. Die Organisation muss daher Arbeitsbedingungen schaffen, die dem Mitarbeiter die Entwicklung seiner Professionalität ermöglichen und seine Leistungsbereitschaft sicherstellen. Der Experte liefert sehr komplexe, nicht triviale Produkte bzw. Dienstleistungen, die technologisch nur sehr bedingt erzeugbar und kontrollierbar sind. Zentrale Leistungen der Organisation werden von einzelnen Experten meist direkt für "Kunden" (Patienten, Studenten etc.) erbracht und haben somit die Form einer Beziehung. Die Qualität dieser Beziehung wirkt sich auf die Qualität der Produkte aus. Die Reputation des einzelnen Experten ist zudem von großer Bedeutung für die Reputation der Gesamtorganisation. Gleichzeitig haben Expertenorganisationen aber oft Schwierigkeiten im Umgang mit Experten, die die Standards der eigenen Profession missachten oder wenig eigenes Engagement und Motivation in ihre Arbeit einbringen. Es erscheint höchst schwierig zu sein, hier Gegenmaßnahmen zu treffen. Durch ein Dienstrecht, das starke Aspekte der Sicherstellung aufweist und wenig Leistungsanreize bietet, wird diese grundsätzliche Schwierigkeit noch verstärkt. Der Experte identifiziert sich weniger mit der Organisation, in der er arbeitet, sondern stärker mit seiner Profession, der er angehört. Man sieht sich eher als Vertreter eines bestimmten Faches (z.B. Onkologie, Psychologie), denn als Mitarbeiter eines bestimmten Krankenhauses. Diese mangelnde Identifikation mit der Organisation und deren Zielen führt auch dazu, dass es wenig Engagement für die Interessen des Gesamten gibt. Jeder Experte versucht, sich um das Funktionieren seiner Arbeit und seiner unmittelbaren Umgebung zu kümmern, jedoch nicht um übergeordnete Gesamtziele. Er sieht die Organisation eher als ein notwendiges Übel an, das er in Kauf nimmt, um an bestimmte Ressourcen (Gelder, wissenschaftliche Einrichtungen, wie Labors und Bibliotheken, Patienten, Austausch mit anderen Kollegen usw.) gelangen zu können. Ein Experte hat in seiner Ausbildung vor dem Eintritt in die Organisation eine fachspezifische Sozialisation durchlaufen. Er hat gelernt, sich auf einen bestimmten Teilbereich der Wissenschaft zu konzentrieren und andere Bereiche anderen Experten zu überlassen. Charakteristisch für Expertenorganisationen ist der Widerspruch zwischen dem Fachsystem der Profession und dem sozialen System der Organisation. Auf der Ebene des Faches finden häufig Innovationen statt und Fortschritte werden schnell umgesetzt, hier gibt es eine große Anpassungsfähigkeit an neue Entwicklungen. Die Organisation als ganze hingegen verhält sich in ihrer Struktur und Innovationsfähigkeit sehr träge. Größere, tiefgreifende institutionelle Veränderungen sind selten und ergeben sich eher aus veränderten externen Anforderungen, denn aus strategiegeleiteten Prozessen der Selbstorganisation. Es ist schwierig, Energie für die Entwicklung der Organisation zu mobilisieren, vor allem bezogen auf die Gesamtorganisation. Der Widerspruch wird vor allem auch durch die Karrierelogik der Experten gefestigt. Der Experte hat mehr die unabhängige Anwendung und Pflege seiner eigenen Profession und die daraus resultierende Anerkennung durch seine Kollegen und damit seine eigene Karriere vor Augen. Sie ist durch wesentlich andere Faktoren bestimmt, als die interne Stellung und Funktionstüchtigkeit der Person in ihrer Rolle in der Organisation oder gar das reibungslose Funktionieren der Organisation selbst. Aufstiegschancen hat der Experte, der (internationale) Reputation durch Forschung und Weiterentwicklung der Fachexpertise erlangt hat. Dagegen werden gute Organisations-, Management- und Koordinationsleistungen für die eigene Organisation zumeist weder finanziell noch durch einen verbesserten Status honoriert. Es ergibt sich daher aus dem Engagement in diesen Bereichen wenig persönlicher Nutzen für den einzelnen, solange individuelle Karrierechancen und die Entwicklung der Organisation weitgehend entkoppelt bleiben. Die Macht der Subsysteme Da die Reputation sehr von der Originalität des eigenen Expertentums abhängt, arbeiten auch viele Experten am Aufbau eines eigenen Spezialfeldes mit eigenständigen Inhalten und Methoden, um der ausgewiesene Experte eines neuen Feldes zu werden. Die Spezialisierung ist auch ein sehr bewährtes Medium des Konkurrenzkampfes um Positionen, Prestige und Ressourcen. Auf der Organisationsebene drückt sich die fachliche Spezialisierung in einer fortschreitenden Ausdifferenzierung in Organisationseinheiten aus, wie etwa medizinische Abteilungen/Institute. In dieser Unterteilung der Organisation in kleinere Einheiten also Untergruppen liegt viel gruppendynamischer Sprengstoff. Solche Abteilungen sind gut zusammenzuhalten, indem sich die Führung das Phänomen des Außenfeindes zunutze macht: Nur Angehörige der eigenen Gruppe sind unreflektiert „gut“, alle anderen sind per se „schlecht“, aber eigentlich nur deswegen, weil sie nicht zu uns gehören. Die verschiedenen Spezialdisziplinen und Einheiten verfügen über jeweils unterschiedliche Arbeitsformen und Kulturen. Auf der Ebene der Gesamtorganisation wirkt das natürlich eher abgrenzend statt integrierend. Als Regel lässt sich daraus ableiten, dass je fester der Zusammenhalt in der Subgruppe ist desto schlechter ist das für die Gesamtorganisation und umgekehrt je besser der Zusammenhalt in der Organisation desto schlechter ist er in der Subgruppe. Expertenorganisationen werden traditionellerweise von der Verwaltung zusammengehalten. Administrative Fachkräfte und mit Einschränkung auch Techniker sind in Expertenorganisationen, wie dem Krankenhaus, oft die einzigen Berufsgruppen mit einem wirklichen fachlichen Interesse an der Gestaltung der Gesamtorganisation. Diese Gruppen sind in ihrer Arbeitstradition allerdings historisch und strukturell mit der Verwaltung verbunden. Für die Experten repräsentieren sie die Limitierungen durch die Gesamtorganisation, die zumeist als störend für die fachliche Arbeit empfunden wird. Sie werden als verlängerter Arm der Zentralgewalt erlebt, der Bundesministerien, der Gesundheits- oder Wissenschaftsverwaltung der Länder und Kommunen oder anderer Trägerorganisationen, die ständig versuchen, sich mit untauglichen Mitteln in die fachliche Arbeit einzumischen. Hier stoßen radikal unterschiedliche Organisationskulturen, Arbeitsweisen und Referenzsysteme aufeinander, deren Spannung die Organisation zusätzlich desintegriert. Vielfältige sichtbare und unsichtbare Trennlinien prägen Expertenorganisationen. So werden im Krankenhaus die Arbeitsprozesse durch die parallelen Hierarchien der Berufsgruppen Medizin und Pflege zerteilt. Horizontal existiert durch die Trennung von Verwaltung und Experten und vertikal durch die parallelen Hierarchien eine meist sehr strikt gegliederte Hierarchie. In den Bereichen Technik und Administration, als Teil staatlicher Verwaltung, ist die steile hierarchische Struktur sehr deutlich sichtbar. Die Hierarchie der Experten verläuft dagegen flacher aber sozial oft sehr streng angelegt und hüllt sich in das Gewand der Kollegialität. Zusätzlich weisen die Organisationen auch noch ein deutliches Hierarchiegefälle zwischen den Berufsgruppen auf, zwischen den eigentlichen Experten und den anderen, also den Medizinern und den sogenannten medizinischen Hilfsberufen im Krankenhaus. Kooperation Für die zu erbringende Leistung (Forschung, Patientenbehandlung, Lehre etc.) ist die Motivation des Experten von immenser Bedeutung. Wenn man also versucht, dem Experten Vorschriften zu machen, die seinen eigenen Vorstellungen und den Regeln seiner eigenen Profession nicht entsprechen und ohne seine Mitsprache beschlossen und durchgeführt werden, so riskiert man Widerstände, auch wenn es sich um durchaus sinnvolle Maßnahmen handelt. Dies führt in der Regel zu einer Störung des Alltagsbetriebes der entsprechenden Einrichtung. Auch wird der Experte seine ganze Autorität verwenden, um institutionelle Entscheidungen abzuwenden, die ihn möglicherweise einschränken. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen den Professionalitätsvorstellungen und der Organisationsentwicklung. Die Experten müssen sich und auch ihr professionelles Selbstverständnis also ändern, um eine organisationale Weiterentwicklung zu ermöglichen. Gewünschte Veränderungen scheitern fast immer, wenn sie nicht zu einem Teil der herrschenden Organisationskultur werden. Die Experten sollten ihre fachliche Arbeit auf Organisationseinheiten beziehen, und dabei die Entwicklung des jeweiligen Systems, dem sie angehören, mit im Auge behalten. Das Wissen der Experten muss auch im notwendigen Maße zum Wissen der Organisation werden, damit sich die Organisation an eine veränderte Umwelt anpassen kann. Hierzu ist es besonders wichtig, den Experten Erfahrungen darüber zu ermöglichen, in welchem Ausmaß die Entwicklung des Systems, in dem sie arbeiten, die Qualität der Arbeit beeinflusst. Im Krankenhaus ist dies beispielsweise sehr offensichtlich. Die Kooperation der verschiedenen Gruppen, deren Behandlungskonzepte und Ausrichtung haben unmittelbare Konsequenzen auf die Qualität der Arbeit. Die Art und Weise, wie die Arbeit organisiert ist, hat Rückwirkung auf die Leistung und die Qualität der Leistung des einzelnen. Die Experten müssen sich auch mit Überlebensfragen der Gesamtorganisation beschäftigen. Erst wenn sich eine Abteilung als organisationale Einheit eine Meinung über die aktuelle Situation der Umwelt der Organisationseinheit und die geeignete eigene Reaktion darauf bilden kann, erst dann kann die Gesamtorganisation Krankenhaus darauf gezielt reagieren. Das bedeutet, es muss gelingen, die Gedanken der einzelnen Experten in eine Antwort der Organisation zu übersetzen, um ihre Funktionsfähigkeit zu stärken. Solange Verwaltung und Management als fachferne Bürokraten abgewertet werden, fallen sie auch als Ressourcen im Sinne der Steuerung des Systems aus. Konzepte, wie sie stärker in die Organisation integriert werden können, fehlen aber derzeit noch. Managementarbeit wird in Zukunft zu einem ganz wichtigen Element der Expertenorganisation werden. Dazu müssen aber auch entsprechende Leitungsrollen, die es teilweise, z.B. im Gesundheitswesen, auch rechtlich noch nicht gibt, ausgestaltet werden. Es kommt zu einer notwendigen Doppelrolle von Fachmann und Manager bzw. Leitungskraft. Gleichzeitig müssen auch neue Karrierefelder gefunden werden. Komplexe Organisationen brauchen auch spezialisierte Funktionen in ihrer Leitung. Es muss zu einer Trennung von Fach- und Leitungskarrieren kommen. Beispielsweise muss ein leitender Oberarzt, der etwas von Krankenhausorganisation versteht und die Integrationsleistung zwischen Fach und System als seine Aufgabe sieht und dafür vielleicht bei den neuesten fachlichen Entwicklungen nicht mehr vorne dabei ist, auch entsprechende Reputation und Bezahlung erhalten. Leitung wird zu einem relevanten Subsystem der Organisation. Es stellt sich dabei nicht nur die Frage nach geeigneten Einzelpersonen, sondern vor allem nach geeigneten Leitungsteams mit einer konsequent interprofessionellen Ausrichtung, also zwischen Ärzten, Pflegekräften und Fachkräften der Verwaltung als eine wichtige Steuerungsvoraussetzung. Das Krankenhaus steht, verglichen mit anderen Expertenorganisationen wie der Universität und der Schule, unter dem höchsten Druck, bereichsübergreifend zu arbeiten, weil Patientenversorgung nur so angemessen möglich ist. Innenorientierung Expertenbetrieben fällt es schwer, die eigene Arbeit aus einer Außenperspektive wahrzunehmen. Die Leistungen werden nach den eigenen fachlichen Kriterien beurteilt. Da zumeist ein klares Feedback über den Markt fehlt, verschärft sich diese Problematik der Innenorientierung. "Kunden" müssen stärker mit ihren Bedürfnissen wahrgenommen und auch in der Qualitätsbeurteilung einbezogen werden. Prof. Pendl hat das anlässlich meiner Promotionsfeier in seiner Rede so ausgedrückt: „Richten Sie sich in Ihrer Arbeit nach dem, was der Patient braucht, aber auch nach dem, was der Patient will!“ Das fällt Expertenorganisationen jedoch schwer. Gründe hierfür sind die Unorganisiertheit der meisten Kunden und ihre gleichzeitig große Abhängigkeit von der Organisation. Oft fallen Zahler und Kunden auseinander. Das Selbstbewußtsein der Kunden und auch die Wahlmöglichkeiten der Kunden nehmen jedoch stetig zu. Es kommt nicht so selten vor, dass alle Mitarbeiter eines Krankenhaus ganz gut beschäftigt wären, ohne dass es dazu einen einzigen Patienten braucht. Ein bekanntes Bonmot besagt, dass Krankenhäuser wunderbar funktionieren würden, wäre da nicht der unkalkulierbare Störfaktor Patient und seine Angehörigen. Patientenorientierung Mit Ausnahme von Unfallopfern, den Opfern von Gewaltverbrechen oder von unvorhersehbaren natürlichen Todesfällen befinden sich die meisten Sterbenden in ärztlicher Behandlung. Ein Großteil von ihnen stirbt im Krankenhaus. Das durch medizinische Interventionen begleitete Sterben ist also in der westlichen Welt der Regelfall. 70 % der Menschen, die jährlich in Deutschland an Krebs sterben, verbringen die letzte Lebensphase im Krankenhaus. Daher ist es vielmehr notwendig zu prüfen, wie weit die Anwendung des heutigen Potentials medizinischer Möglichkeiten in bestimmten Situationen überhaupt sinnvoll ist und wo die humanen Grenzen der modernen Medizin liegen. Die Frage aber, welches Leiden als sinnlos oder sinnvoll empfunden wird, ist kein Problem des medizinischen Fortschritts, sondern der religiösen oder weltanschaulichen Einstellung und der persönlichen Lebensumstände Gleiches gilt für die Diskussion um die ethische Relevanz der Unterscheidung zwischen Tun und Unterlassen. Das eigene Sterben und der Tod von Angehörigen wird in der Gesellschaft vielfach verdrängt und ist mit großen Ängsten belastet, mit denen sich die Menschen alleingelassen fühlen: mit der Angst, unerträgliche Schmerzen erleiden zu müssen; mit der Angst, den Angehörigen und der Gesellschaft zur Last zu fallen; mit der Angst im Sterben alleingelassen zu werden; mit der Angst, ausgeliefert zu sein und der Würde beraubt zu werden; mit der Angst, auch gegen den eigenen Willen unnötig lange am Leben erhalten zu werden, was keiner Lebens-, sondern einer Sterbeverlängerung gleichkommt; mit der Angst, dass das Leben fahrlässig verkürzt wird durch mangelnde medizinische und pflegerische Hilfe oder gar durch vorsätzliche Tötung. Es wird deutlich, dass die Menschen Angst vor dem Sterben haben und nicht vor dem Tod. Die gesellschaftliche Aufgabe besteht darin, der Einsamkeit der Sterbenden entgegenzuwirken und eine neue Kultur der Solidarität mit den Sterbenden zu entwickeln. Eine mögliche organisationale Umsetzung dieser Forderung liefern folgende Beispiele: „Wenn das Essen nicht kommt, funken die Stationen die 607 an, und wenn einer durchdreht, funken sie eben die 308 des Pfarrers an“, sagt dieser nicht unzufrieden. Aber langfristig soll Sterbebegleitung nicht nur Sache der Seelsorger sein, sondern aller Krankenhausangestellten. Wirklich zufrieden wäre der Pfarrer erst, wenn dem Sterben eine ähnliche Aufmerksamkeit zuteil würde wie einer komplizierten Operation. „Schließlich stirbt hier – wie in anderen Krankenhäusern auch – jeder 50. Patient. Das ist die Realität.“ Auf dem 12. Krebskrankenpflegesymposium in Heidelberg zum Thema: „Leben bis zuletzt ...“ zeigte der Klinikpfarrer Thomas Wigant mit dem Ethik-Konsil einen Weg auf, um in schwierigen Situationen und Konflikten die richtige Entscheidung treffen zu können. Ein Ethik-Konsil biete die Gelegenheit, mit anderen über die problematischen Situationen und ggf. über Alternativen und Lösungsmöglichkeiten zu sprechen und nach einem Konsens zwischen den Beteiligten zu suchen. Das Florence-Nightingale-Krankenhaus der Kaiserswerther Diakonie in Düsseldorf will demnächst zum Beispiel: •eine Ethikberatung einrichten, die interdisziplinär klärt, ob und wie viel Chemotherapie, künstliche Beatmung und Ernährungssonde im Einzelfall am Lebensende sein soll •Sitzwachen für Sterbende anbieten – mit Hilfe örtlicher Hospizvereine •die Schmerzbehandlung am Lebensende (Palliativmedizin) verbessern Jürgen Krauth von der Universitätsschwesternschule Heidelberg geht noch einen Schritt weiter: Er hob die persönliche Anleitung und Unterstützung eines Mentors in der Sterbebegleitung als Vorbild hervor, gegen die häufige Aussage „Ich möchte da am liebsten gar nicht reingehen...“, auf das man nicht nur bei Auszubildenden in der Krankenpflege sondern auch bei gestandenen Chefärzten in der Betreuung sterbender Menschen stößt. Dieser Verdrängungsstrategie der Scheuklappen lässt sich wohl am besten in einem interdisziplinären Leitungsteam begegnen, da man sich gegenseitig unterstützen kann im Sinne eines Risk-Shift. Aber für die Weiterentwicklung der eigenen ExpertenSpezialisierung braucht man leider eher nur die anderen Spezialisten der gleichen Disziplin - egal wo in der Welt sie tätig sein mögen - als den Kollegen nebenan, der einer anderen Spezialisierung angehört. Grossmann et al. schlagen deshalb auf der Ebene des Leistungsprozesses Kooperation und Koordination vor, da viele aktuelle gesellschaftliche Problemlagen nur auf der Ebene der Forschung sowie interdisziplinärer Kooperation erfolgreich bearbeitet werden können. Abschließend möchte ich wieder an den Anfang meines Vortrages anknüpfen und das psychosomatische Enzym die Beziehung als das Wesentliche einer interdisziplinären Kooperation betonen, sei sie nun organisatorisch gelebt oder organisational angelegt. Ich sehe den Einsatz des psychosomatischen Enzyms als medizinischen Grundsatz an, als eine ethische Grundhaltung, als evidente heilsame Anwendung eines generellen ubiquitären Wirkungsprinzips in und außerhalb der Medizin und möchte als Schlusspunkt dieses Prinzip auch für die Forschung angewandt sehen : „Amor perfecit scientiam“. Literatur: Christine Holch: Großer Zorn, kleines Glück; Sterben im Krankenhaus – Horrorvision oder würdiger Abschied? Chrismon 2002 „Es gibt Lachen und Weinen nebeneinander, auch im Sterben“ 12. Krebskrankenpflegesymposium in Heidelberg zum Thema: “Leben bis zuletzt ...“ 2002 Ulrich H.J. Körtner: Ethische Probleme beim Sterben an der Intensivstation, Vorlesung am AKH Wien, 12.6.2002 Ronald Kurz: Das psychosomatische Enzym, Vortrag als Geschenk für Herrn Professor Dr. Peter Scheer zum 50. Geburtstag anlässlich der Tagung 20 Jahre Psychosomatik und Psychotherapie an der Univ.-Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde Graz, 5./6.10.2001 Ralph Grossmann, Ada Pellert, Victor Gotwald: Krankenhaus, Schule, Universität: Charakteristika und Optimierungspotentiale, Was unterscheidet Expertenorganisationen von anderen Institutionen? Ewald Krainz: Arbeits- und Betriebspsychologie, Vorlesungsmitschrift Uni Klagenfurt SS 2002