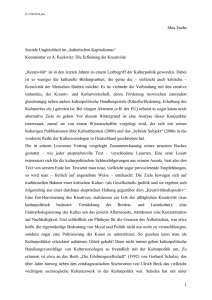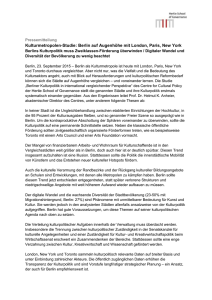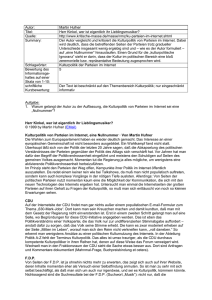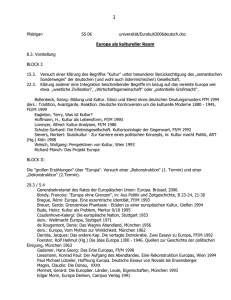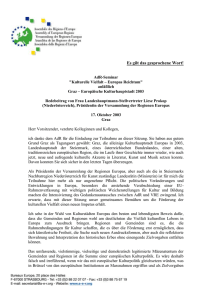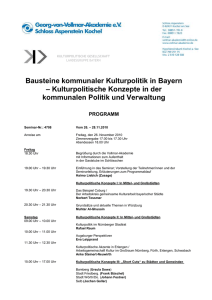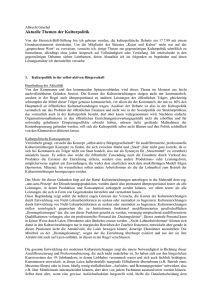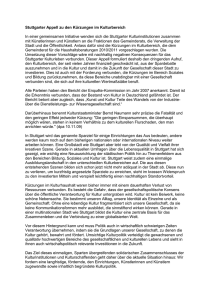Vorlesung - Hochschule Merseburg
Werbung
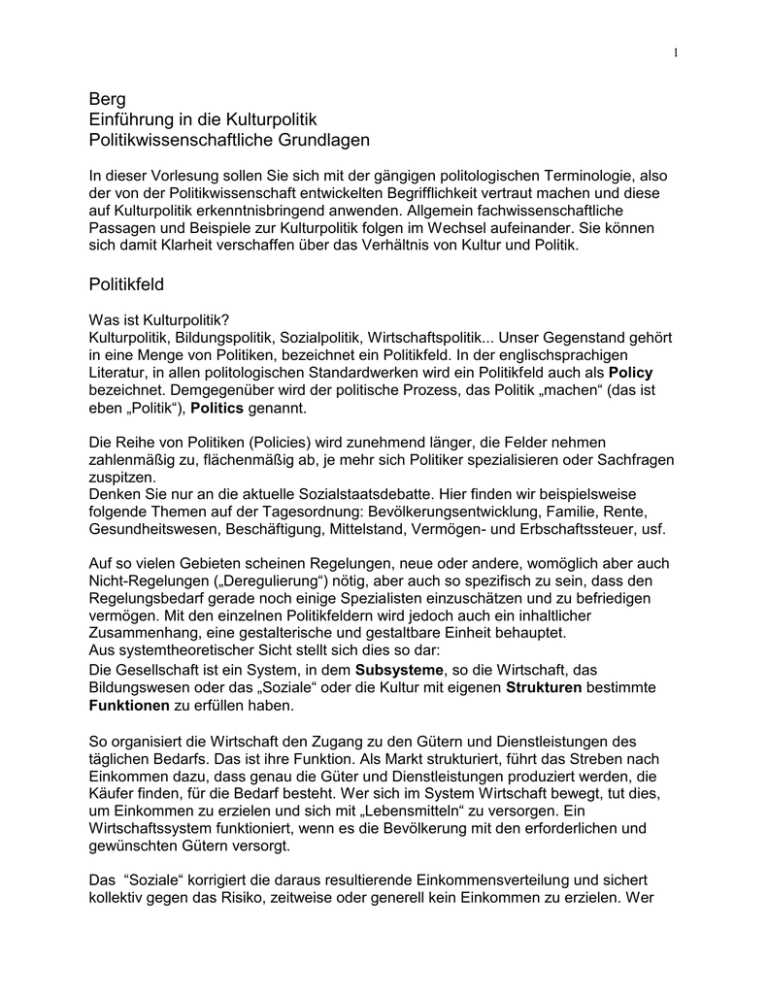
1 Berg Einführung in die Kulturpolitik Politikwissenschaftliche Grundlagen In dieser Vorlesung sollen Sie sich mit der gängigen politologischen Terminologie, also der von der Politikwissenschaft entwickelten Begrifflichkeit vertraut machen und diese auf Kulturpolitik erkenntnisbringend anwenden. Allgemein fachwissenschaftliche Passagen und Beispiele zur Kulturpolitik folgen im Wechsel aufeinander. Sie können sich damit Klarheit verschaffen über das Verhältnis von Kultur und Politik. Politikfeld Was ist Kulturpolitik? Kulturpolitik, Bildungspolitik, Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik... Unser Gegenstand gehört in eine Menge von Politiken, bezeichnet ein Politikfeld. In der englischsprachigen Literatur, in allen politologischen Standardwerken wird ein Politikfeld auch als Policy bezeichnet. Demgegenüber wird der politische Prozess, das Politik „machen“ (das ist eben „Politik“), Politics genannt. Die Reihe von Politiken (Policies) wird zunehmend länger, die Felder nehmen zahlenmäßig zu, flächenmäßig ab, je mehr sich Politiker spezialisieren oder Sachfragen zuspitzen. Denken Sie nur an die aktuelle Sozialstaatsdebatte. Hier finden wir beispielsweise folgende Themen auf der Tagesordnung: Bevölkerungsentwicklung, Familie, Rente, Gesundheitswesen, Beschäftigung, Mittelstand, Vermögen- und Erbschaftssteuer, usf. Auf so vielen Gebieten scheinen Regelungen, neue oder andere, womöglich aber auch Nicht-Regelungen („Deregulierung“) nötig, aber auch so spezifisch zu sein, dass den Regelungsbedarf gerade noch einige Spezialisten einzuschätzen und zu befriedigen vermögen. Mit den einzelnen Politikfeldern wird jedoch auch ein inhaltlicher Zusammenhang, eine gestalterische und gestaltbare Einheit behauptet. Aus systemtheoretischer Sicht stellt sich dies so dar: Die Gesellschaft ist ein System, in dem Subsysteme, so die Wirtschaft, das Bildungswesen oder das „Soziale“ oder die Kultur mit eigenen Strukturen bestimmte Funktionen zu erfüllen haben. So organisiert die Wirtschaft den Zugang zu den Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs. Das ist ihre Funktion. Als Markt strukturiert, führt das Streben nach Einkommen dazu, dass genau die Güter und Dienstleistungen produziert werden, die Käufer finden, für die Bedarf besteht. Wer sich im System Wirtschaft bewegt, tut dies, um Einkommen zu erzielen und sich mit „Lebensmitteln“ zu versorgen. Ein Wirtschaftssystem funktioniert, wenn es die Bevölkerung mit den erforderlichen und gewünschten Gütern versorgt. Das “Soziale“ korrigiert die daraus resultierende Einkommensverteilung und sichert kollektiv gegen das Risiko, zeitweise oder generell kein Einkommen zu erzielen. Wer 2 sich im Sozialsystem bewegt, tut dies, um existentiell gesichert zu sein. Ein Sozialsystem ist danach zu beurteilen, ob es Risiken minimiert und Einkommen „gerecht“ verteilt. Der Bildungsbereich, womöglich als Schule institutionalisiert, vermittelt Wissen und Fertigkeiten, die erforderlich sind, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, insbesondere auch Zugang zum Wirtschaftssystem zu haben. Dazu kommt es also darauf an, zu lernen, sich zu qualifizieren. Das Bildungssystem funktioniert, wenn es die gesellschaftlich erforderlichen Kompetenzen vermittelt. Zu den großen Subsystemen zählen neben Wirtschaft, Soziales, Bildung sicherlich auch Religion, Wissenschaft, Justiz, Familie. Zweifellos haben aber auch kleinere Subsysteme gesellschaftliche Bedeutung. So ist Mobilität/Verkehr zwar eng mit Wirtschaft verbunden, aber doch ein System eigner Charakteristik. Jedes Subsystem lässt sich durch Strukturen (Institutionen) und (deren) Funktionen charakterisieren. In jedem Subsystem gelten andere Maximen und Regeln des Handelns. Geht es um Wahrheit, Profit, Gerechtigkeit, Schönheit oder Schnelligkeit? In jedem Subsystem wird über andere Medien kommuniziert, in der Wirtschaft über Geld, in der Wissenschaft über Wahrheit, in der Justiz über Recht. 3 Politikfeld Kultur Nach dieser Skizze sollen sich komplexe Fragen aufdrängen: - Ist Kultur ein Politikfeld, eine inhaltliche Einheit, ein gesellschaftliches Subsystem? - Was ist die innere Logik, was das Regelwerk dieses Handlungsfeldes? - Was ist die Funktion, was sind die Strukturen von Kultur? - Wie nimmt Politik gestalterischen Einfluss auf Kultur? Dabei müssen wir jedoch zwei Momente in Rechnung stellen: 1. Über das, was Kultur ist, gibt es höchst unterschiedliche, interessens- und standpunktbezogene Auffassungen, die sich im Laufe der Zeit wandeln und gerade auch unter politischem Einfluss verändern können. Diejenigen, die sich im Subsystem Kultur bewegen, bestimmen es nicht weniger mit als diejenigen, die „Politik machen“. 2. Sodann müssen wir auch noch auf unsere Annahme zurückkommen, Kultur sei ein einziger, einheitlicher Handlungszusammenhang, ein eigenständiges Politikfeld. Dies ist schon auf den ersten Blick zweifelhaft. Kultureinrichtungen, so eben das klassische Stadttheater oder das Rundfunkorchester, (überwiegend) über Steuern oder Gebühren finanziert, sind öffentliche Dienstleistungen, während es doch nahe läge, die freiberufliche Gauklertruppe oder die Konzertagentur, also die Kulturwirtschaft, dem Wirtschaftssystem, letztlich also der Wirtschaftspolitik zuzuordnen. Wir tun dies nicht, und zwar aus zwei Gründen: - Menschen, die sich im Handlungsfeld der Kultur bewegen, orientieren sich (auch) an den Maximen von Kultur, ob sie damit nun wirtschaftliche Ziele verfolgen oder auch nicht. Solche Maximen sind mit Sicherheit: Die Produktion muss „gut“ sein, d.h. handwerklichen Standards und ästhetischen Ansprüchen (so umstritten die sein mögen) genügen und beim Publikum (welchem auch immer) ankommen. - Eine klare Grenze zwischen öffentlichen Dienstleistungen und Kulturwirtschaft lässt sich nicht ziehen, aller Voraussicht nach in Zukunft weniger denn je. Viele öffentliche Museen, so wird schon humorvoll gesagt, sind Poster- und T-Shirt-Shops mit anliegender wissenschaftlicher Sammlung... Öffentliche Kultureinrichtungen sind mit Geschäftstätigkeit im Bereich von Gastronomie, Souvenirs, Erlebniswelten etc. verbunden, die erstere mitfinanzieren. Das Britische Museum verzichtet bewusst auf Eintrittsgeld, einerseits um mehr Besucher anzuziehen, andrerseits darauf vertrauend, dass stattdessen über den Museumsshop (mehr!) Einnahmen erzielt werden können. Fuchs hebt, um sich von der elitären kulturphilosophischen Betrachtung einerseits, der angeblichen kulturpolitischen Ignoranz gegenüber der Kulturwirtschaft abzuheben, die Tatsache hervor, dass die Umsätze letzterer „ein Vielfaches der öffentlichen Kulturausgaben betragen“ (Fuchs, S. 215). Was sich daraus jedoch kulturpolitisch ableiten ließe, verrät er uns nicht. 4 Aus unserer Sicht stellt sich für Kulturpolitik, wie übrigens auch für viele andere Policies freilich die „Systemfrage“: Wenn wir von den beiden Polen „öffentliche Kultureinrichtung“ und „Kulturwirtschaft“ ausgehen, natürlich alle Zwischenstufen und Kombinationen in Betracht ziehend, dann besteht beständiger Regelungsbedarf, nicht allein unter den Sparzwängen der öffentlichen Haushalte, sondern auch konzeptionell bedingt, also aus dem Verständnis von Kultur heraus. Der Regelungsbedarf muss sich nämlich an der Frage festmachen, wieweit ein kulturelles Produkt vermarktbar ist oder aus konzeptionellen Gründen in staatlicher Regie bleiben muss. Manches „rechnet sich“ zwar, erreicht die Zielgruppe aber nicht. Die „Systemfrage“ ist also die, welche kulturellen Inhalte marktfähig sind und dem Markt überlassen werden können, welche nicht. Dabei ist durchaus auch Druck von privatwirtschaftlichen Kulturbetrieben zu verspüren, die sich z.B. dagegen wehren, dass Landestheater gut verkäufliche Musicals produzieren, mit denen sie selbst auch gutes Geld verdienen könnten. Wieso muss ein Museum (sei es für Schuhe, Wein, Schokolade oder Fototechnik usf.) von der Kommune betrieben werden, wenn es für die lokale Wirtschaft Verkaufsförderung leisten kann? Demgegenüber ist (noch?) unumstritten, dass musisch-kulturelle Bildung (auch) finanziell gefördert werden muss, damit alle Kinder und Jugendlichen Zugang haben. Die Kulturpolitische Gesellschaft – ein wichtiger Akteur! - hat mit ihrer Hagener Erklärung (1996) „Leitlinien einer Demokratischen Kulturpolitik“ formuliert, die sowohl auf die kulturelle Infrastruktur und „breite kulturelle Grundversorgung“ hinweisen, als auch Kreativität, Ausdrucksvielfalt, kulturelles Deutungsvermögen und Aufnahmefähigkeit, also „Kultur als Bildungsmittel“ postulieren, ohne zu vergessen, dass auch „die Spitzenleistungen der Künste zu fördern seien. Damit sind zwei Hinweise gegeben, „wieviel Kultur“ öffentlich finanziert werden muss: - Es gibt eine kulturelle Infrastruktur, die die öffentliche Hand zu garantieren hat. Auch wenn viele ein Auto besitzen, der Nahverkehrszug muss fahren. Für die Kultur ist dieser Grundbestand programmatisch zu formulieren („Kultur für alle“). - Die kulturelle Grundversorgung muss als Teil der Bildungsangebote gesehen werden, die über den offensichtlichen Qualifizierungsbedarf (Sprachangebote der VHS) hinaus auch gesellschaftlich wichtige Kompetenzen (Kreativität, Sensibilität, Interkulturelles Lernen) vermittelt. 5 So elegant diese Formulierungen auch erscheinen mögen, so sind sie doch Leerformeln. Was gehört denn nun zur Grundversorgung? Wie vermittle ich die wichtigen Kompetenzen bildungsfernen Schichten? Das ist die kulturpolitische Aufgabe, genau diese Vorgaben, mit welchen Angeboten welche Zielgruppen erreicht werden sollen, zu bestimmen. Das ist womöglich strittig, kontrovers – gerade deshalb politisch, d.h. entscheidbar. Was haben die bisherigen Überlegungen gebracht? Sehen Sie die Funktion von Kulturpolitik klarer? Im Grunde muss sich Kulturpolitik genau die Fragen stellen, die wir hier formuliert haben. Sie muss ein Konzept haben. Dieses Konzept sagt etwas aus über die Funktion von Kultur: Welche Angebote soll es geben, welche Kompetenzen sollen vermittelt werden? Dieses Konzept sagt etwas aus über die Struktur, in denen Kultur gestaltet wird: Was muss durch die öffentliche Hand angeboten oder angeschoben werden, was ist dem Markt (oder Privatinitiative) zu überlassen? Politische Akteure Unter den Subsystemen, die Gesellschaften herausbilden, um spezifische Funktionen zu erfüllen, ist das politische System ein besonderes. In der englischsprachigen und politikwissenschaftlichen Terminologie wird es übrigens meist als Polity bezeichnet, womit eine weitere Bedeutung von Politik („er/sie geht in die Politik“, „die Politik ist hier gefragt“ etc.) ausgedrückt werden kann. Die deutsche „Politik“ haben wir damit in Policy, Politics und Polity aufgedröselt, je nachdem, ob das Handlungsfeld, der Prozess oder das System gemeint ist. Politik ist ein Subsystem, das Regelungen für alle anderen Subsysteme hervorzubringen hat. Wir sprechen daher vom politischen System (eigentlich: Subsystem), das Gesellschaft, genauer also deren Teilbereiche gestaltet, steuert, regelt. Diese Funktion wird in der Politikwissenschaft und zunehmend auch im öffentlichen Sprachgebrauch als Governance bezeichnet. Um diese Steuerungs-Funktion erfüllen zu können, braucht das politische System einerseits die Legitimation, andrerseits geeignete Strukturen. Für moderne Gesellschaften gibt es keine andere als die demokratische Legitimation, die sich auch in den Prozessen der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung wiederfinden muss: Beteiligung, Transparenz, kurzum Governance by the People Ein politisches System, das für alle – hochdifferenzierte – Subsysteme „zuständig“ ist, wäre überfordert, sachgerechte Regelungen aktuell zu treffen, wenn es nicht offen wäre für alle Anforderungen aus dem Subsystem heraus. Das politische System ist funktional darauf angewiesen, solche Anforderungen (Demands), den sog. Handlungsbedarf wahrzunehmen und befriedigende Regelungen zu schaffen, also auf die Anforderungen angemessene Antworten (Responses) zu geben. Es ist klar, dass von dieser Antwort- 6 Fähigkeit , der Responsiveness, langfristig die Legitimation des politischen Systems insgesamt abhängt. Der Untergang der DDR ist auf diesem Hintergrund gut erklärbar: Das politische System hatte weder Demands (d.h. konkrete Kritik, Vorschläge, Diskussion von Alternativen, Konkurrenz politischer Konzepte) zugelassen noch als solche interpretierbare Fakten wahrgenommen. Schon deshalb, ungeachtet der Frage, ob das System generell dazu fähig sei, blieb die Responsiveness suboptimal: Die Unzufriedenheit wuchs, die Legitimation schwand. Politische Systeme sind also auf Dauer nur funktionsfähig, wenn sie in der Lage sind, Regelungsbedarf zu erkennen und sachgerechte Regelungen (Good Governance) zu entwickeln. Beides ist grundsätzlich nur möglich, wenn die politischen Akteure das Handlungsfeld kennen, Handlungsbedarf erkennen, den Sachverstand der Betroffenen einbeziehen, kurzum: mit den Akteuren im Feld kommunizieren. Die Akteure können dabei Sachverständige, Wissenschaftler, Individuen, aber auch organisierte Interessen (Verbände, Lobbies) sein. Lobby ist keineswegs negativ gemeint, sondern bezeichnet recht anschaulich, dass die Interessensvertreter in der Lobby, also den Wandelgängen im Parlament, im Umfeld des politischen Systems aktiv sind. Die Akzeptanz, die „die Politik“ (das politische System) für ihre „Politik“ (die konkrete Regelung) erfährt, ergibt sich daraus, wie sie die Expertise und Interessen in ihre „Politik“ (d.h. den Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess) einbezogen hat, ist aber gesamtgesellschaftlich wie im Politikfeld nur solange legitimiert, als nicht einseitig Einzelinteressen bedient werden. Umgekehrt können wir – was übrigens für alle Politiken (Policies) gilt – nur dann von Kulturpolitik sprechen, wenn sich das Handlungsfeld politisch artikuliert, also als Politikfeld definiert. Ohne Kulturverbände, Künstlerorganisationen, Tagungen und Manifeste aus der „Szene“ gibt es keine Kulturpolitik, bestenfalls Kulturverwaltung. Was also ist Kulturpolitik? Wir könnten jetzt Kulturpolitik begreifen als die Kommunikation zwischen zwei gesellschaftlichen Subsystemen. Das eine, die Politik nämlich, hat u.a. auch für Kultur Regelungen zu treffen, das andere, die Kultur nämlich, formuliert aus der eigenen Handlungskompetenz heraus (wie sie sich in Professionalität und Wissenschaft ausweist), was sie von der Politik geregelt haben will. Ist das Kulturpolitik? Dies ist ein weitgehend realistisches Bild von Kulturpolitik, aber ein elitäres, technokratisches: Kulturpolitik machen diejenigen, die politische Ämter haben oder/und als Experten, Verbandsfunktionäre, Betreiber eines Kulturbetriebs, Künstler etc. an der Regelung eines bestimmten Sachverhaltes, an Förderung oder Finanzierung interessiert sind, also Demands zielsicher formulieren. Die Lobby-Landschaft ist ausgesprochen vielgestaltig. Gewicht haben die nach Sparten und Status einheitlichen Organisationen wie z.B. der Deutsche Bühnenverein, in dem 7 sich die Intendanten der öffentlichen Bühnen versammeln, um regelmäßig die finanziellen Engpässe und Pressionen zu beklagen (u.a. MZ 27.5.2003, S.8). Als Arbeitsgemeinschaft kultur- und medienpolitischer Organisationen 1981 gegründet, versammelt der gemeinnützige Deutsche Kulturrat inzwischen mehr als 180 Bundesverbände in acht Sektionen, vom Deutschen Musikrat über die deutsche Literaturkonferenz bis zur Sektion Design. Er versteht sich als Ansprechpartner der Politik und Verwaltung für spartenübergreifende Fragen der Kulturpolitik. Ein reichhaltige publizistische wie auch lobbyistische Tätigkeit entfaltet die Kulturpolitische Vereinigung – auf deren Statements wiederholt Bezug genommen wird. Kulturpolitik in der Demokratie? Kultur bietet eine besondere und untrügliche Form von Abstimmung, nämlich die „mit den Füßen“. Wenn Tausende das Stadtfest goutieren, aber sich niemand ins Stadtmuseum verirrt, liegt eine Aussage vor, auf die Kulturpolitik reagieren muss, etwa mit aktiver Museumspädagogik oder der Schließung des Hauses. In der aktuellen Spardebatte, die in deutschen Kommunen geführt wird, ist – keineswegs zynisch oder überwollend - schon mal vorgeschlagen worden, zur Bedarfsklärung Kultureinrichtungen zu schließen oder dies zumindest anzukündigen: Wenn sich der Widerstand der Bürgerschaft regt, ist es gut (d.h. ein Signal für den Erhalt der Einrichtung), wenn nicht, kann man sie einsparen. Wir erleben derzeit, dass sozusagen in einer Top-Down-Demokratisierung, ein “aktivierender Staat“ die Bürgerschaft wieder zu kulturpolitischen Akteuren promoviert. Solche gibt es natürlich in wachsender Zahl, ob nun als Freiwillige (Mitarbeiter) oder Stifter und Sponsoren. Jedenfalls scheint eine Form der Zurück-Vergesellschaftung von Kultur stattzufinden und wünschenswert zu sein. Während es für manche neoliberaler Grundüberzeugung entspringt, für andere Konsequenz aus der Verschuldung der öffentlichen Hand ist, den Staat aus (kostenträchtigen) Dienstleistungen herauszunehmen, ist der Bezug zur „Bürgergesellschaft“ (Civil Society) viel grundsätzlicher: Kultur ist nicht zuerst als Grundversorgung der Bevölkerung, sondern, ob rezeptiv oder produktiv, als bürgerschaftliches Grundbedürfnis zu begreifen, das die Bürgerschaft denn auch soweit realisiert, wie sie es ohne Staat tun kann. Auf die Vorlesung zur Bürgergesellschaft wird hier verwiesen. Was also ist Kulturpolitik? Kulturpolitik ist die Entscheidung der Bürger und Bürgerinnen darüber, welche kulturellen Angebote und Aktivitäten sie selbst auf den Weg bringen bzw. entfalten wollen, welche sie dem Markt und welche sie der öffentlichen Hand überlassen wollen. Treffen die Bürger/innen tatsächlich diese Entscheidung? Grenzen der Politik 8 Die Regelungsfunktion von Politik, deutlicher noch: die Gestaltung und Steuerung gesellschaftlicher Subsysteme durch Politik, ist freilich Gegenstand mancher Kontroverse. Generell haben wir es in der öffentlichen Debatte wie in der politikwissenschaftlichen Diskussion mit zwei Thesen zu tun, die sich nur auf den ersten Blick widersprechen, im Grunde aber verstärkend ergänzen: - Subsysteme entziehen sich der politischen Steuerung, da sie „von selbst“ funktionieren, sich am besten selbst regulieren; jede Intervention wäre „systemwidrig“. Anhaltende politische Steuerung würde das Subsystem vielmehr in einer Weise verändern, die nicht erwünscht ist. Die Akteure im System widersetzen sich überdies jedweder Intervention mit dem Argument, sie (allein) hätten den nötigen Sachverstand. - Das politische System verfügt nicht über die Instrumente, Subsysteme effektiv, d.h. nachhaltig zu verändern. Governance hat nicht die erforderliche Reichweite, nicht die Instrumente, um auf Herausforderungen (Demands) zu reagieren. Beide Überlegungen lassen sich am besten für die Wirtschaft und die Wissenschaft aufzeigen. Markt und Wettbewerb, so neoliberale Ökonomen und selbstbewusste Unternehmer, funktionieren am besten, wenn sich der Staat nicht einmischt. Das Kapital investiert da, wo es sich lohnt. Subventionen lenken es nur davon ab. Staatliche Beteiligungen an Unternehmen oder Subventionen verzerren den Wettbewerb. So ähnlich argumentiert und handelt übrigens auch die Europäische Union, die die Privatisierung der Telekommunikation, der Energieversorgung und des Personen- und Güterverkehrs auf den Weg gebracht hat. Die Regulierung von Löhnen, Arbeitszeiten oder Kündigungsschutz ist allenfalls Verhandlungssache der Tarifpartner oder besser noch innerhalb der Unternehmen, keinesfalls aber politisch zu entscheiden – so die strenge Version der Unternehmerseite, während auch die Gewerkschaften sich der „Flexibilisierung des Arbeitsmarktes“ nicht grundsätzlich verschließen wollen. Die Steuerungsunfähigkeit ist ausführlich diskutiert, zuletzt unter dem Vorzeichen der Globalisierung. Während politische Systeme territorial beschränkt handeln, können sich Finanz- und Währungsspekulanten ebenso wie multinationale Konzerne der nationalstaatlichen Kontrolle leicht entziehen. 9 Die Krise der Arbeitsgesellschaft, d.h. die schier unaufhaltsame Massenarbeitslosigkeit in Deutschland und anderen postindustriellen Ländern illustriert beide Thesen aufs Neue: Die computerisierte Massenproduktion setzt Arbeitskräfte frei, die irgendwie vorübergehend auf einem zweiten oder dritten Arbeitsmarkt geparkt werden können (der aber letztlich gar nicht finanzierbar ist). Das politische System ist also mit einer technologisch-ökonomischen Entwicklung, auf die sie kaum Einfluss hat, konfrontiert und antwortet darauf mit Regulierungen, die nicht wirklich das Problem lösen, womöglich sogar (über Staatsquote, hohe Steuern und Abgaben) verschärfen. Die Steuerungsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat das politische System bislang überall dort, wo es über Leistungsgesetze oder Staatstätigkeit unmittelbar gestaltet und verteilt. Das gilt natürlich besonders für den Sozialstaat, wo sich politische Entscheidungen unmittelbar auf die Lebensverhältnisse von Menschen auswirken: Das Arbeitslosengeld beträgt 61% vom pauschalierten letzten Nettolohn, der Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall besteht 6 Wochen lang, der Beitrag zur Rentenversicherung beträgt je 9,75% von Brutto... Allerdings, wie seit Jahren immer offenkundiger, ist das politische Subsystem hier (Ausnahme Lohnfortzahlung: Verpflichtung der Arbeitgeber) selbst, als Leistungs- und Dienstleistungssystem Regelungsgegenstand, insbesondere aber von der Einnahmeseite abhängig, die sich aus der Wirtschaftspolitik ergibt. Die daraus resultierende Gestaltungs- und Steuerungsunfähigkeit wird noch mal verstärkt durch die Interessen aller, die von den Leistungen und Dienstleistungen profitiert haben (diejenigen, die existentiell darauf angewiesen sind, sind schlecht organisiert und kaum handlungsfähig). Etwas anders liegen die Probleme im Bereich der Wissenschaft, die – bei aller Drittmittelförderung, sprich Wirtschaftsabhängigkeit – nicht ohne staatliche Zuwendung, also Zuweisungen durch das politische System überleben kann. Dennoch behaupten die Akteure im Subsystem, die möglichst globalisierten Haushalte am besten selbst verteilen, verwalten und kontrollieren zu können. Sie handeln sich damit aber unweigerlich die Verpflichtung ein, interne Verteilung transparent und nachvollziehbar zu machen, insbesondere aber am Output, also den Leistungen in Lehre und Forschung gemessen zu werden, zumindest Rechenschaft abzulegen, also letztlich die wissenschaftliche Rationalität damit einzuschränken, dass sie sich nun gegenüber der organisierten Öffentlichkeit, in keiner Weise legitimierten Interessenvertretern rechtfertigen. Für Kultur gelten im Grunde beide Überlegungen, da sie teils dem wirtschaftlichen Subsystem, teils wie Bildung und Wissenschaft dem öffentlich finanzierten Dienstleistungsbereich zuzuordnen ist. Solange Kulturpolitik darin besteht, öffentliche Dienstleistungen zu produzieren, d.h. Museen, Theater und Stadtfeste zu alimentieren, ist sie unmittelbar wirksam – aber angesichts etablierter Einrichtungen und Besitzstandswahrer kaum beweglich. So konzipierte Kulturpolitik verliert ihre Wirkung aber mit jedem Euro, den der öffentliche Haushalt nicht mehr hergibt. 10 Kulturpolitik kann und soll Kultur gar nicht wirklich gestalten, dies ist die Sache der Produzenten und Rezipienten. So sehr aber Kulturpolitik bestimmte Zielgruppen und bildungsmäßige Standards erreichen will, so sehr hängt sie von den Einstellungen und Moden ab, die die Freizeitindustrien vorgeben. Theater konkurriert mit der TV- Soap Opera im Vorabendprogramm, Kammerkonzert mit Disko, Museum mit Souvenirshop. Es stellt sich also für die Kulturpolitik die Frage nach der Reichweite und Regelungstiefe, ja auch Legitimität und Opportunität von Regelungen. Ist Kulturpolitik nur Finanzierung und Förderung? Sie wird oft darauf verkürzt. Förderung und Finanzierung sind unter dem Gesichtspunkt der Kulturpolitik zugegebenermaßen von großer Aussagekraft, da sie Strukturen und Zuständigkeiten, Konzepte und Konditionen von Kulturpolitik veranschaulichen. Im Laufe der Lehrveranstaltung werden wir jedoch die nicht-monetären Gestaltungsmöglichkeiten, nach den politischen Akteuren (Ebenen des politischen Systems) differenziert, im Detail aufzeigen. Es trifft zu, dass der Gespaltenheit des Gegenstands wegen die politischen Instrumente in Intensität und Reichweite, insbesondere auch auf Interventionsmöglichkeiten stark variieren. Fuchs versucht jedoch, daraus quasi zwei Kulturpolitiken abzuleiten, nämlich eine, überaus wirkungsvolle als Teil von Rechts- und Wirtschaftspolitik, und eine zweite spezialisierte, wenig einflussreiche Kulturpolitik im engeren Sinne (Fuchs, S. 316). Man kann sich diese Auffassung gut veranschaulichen, wenn man sich die gleichzeitigen Sitzungen des Wirtschaftsausschusses und des Kulturausschusses einer Stadt vorstellt: Während die Kulturpolitiker lange und bedächtig die Möglichkeiten erörtern, aus dem schmalen Kulturetat einen Zuschuss zum Alternativkino einer Studenteninitiative zu gewähren, genehmigt der Wirtschaftsausschuss den Bau eines Multiplexkinos mit 1000 Plätzen. Gerade an diesem Beispiel wird deutlich, dass es eben doch um die Kultur (in diesem Fall die cinematographische) geht. Selbstverständlich muss Kulturpolitik gerade das Verhältnis zwischen Kommerz- und Spartenkino definieren. Nun kommt für die Kultur, nicht nur aus neoliberalen Überlegungen zur Selbststeuerung von Subsystemen, sondern aus normativen Gründen, eine weitere Schwierigkeit hinzu, das Handlungsfeld politisch zu bestimmen, also Regelungen zu treffen. Kulturpolitik ist prinzipiell unmöglich, so könnte man zuspitzen, weil sich die Politik von der Kultur fernhalten muss. Kultur als individuelles Schaffen, künstlerische Gestaltung persönlicher Anschauungen und Empfindungen, individualistische Ausdrucksform, insbesondere aber auch gesellschaftskritische Manifestation muss sich gegen jede Form der Vereinnahmung durch Politik wehren, so wie sich Politik der Kultur fernhalten muss: Legitime, verbindliche Regelungen zur Kultur kann es nicht geben, wenn Kultur individualistisch, subjektiv, kritisch, provokativ, subversiv ist. Art 5.3.GG: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.“ 11 Wenn wir die Förderungspraxis in dieser Kommune, bei jenem Wettbewerb betrachten: Sobald Kultur auf Förderung angewiesen ist, ist sie nicht mehr frei. Wenn Politik nur rechtliche Rahmenbedingungen (z.B. Eigentums- und Verwertungsrechte) regelt, ist sie nicht Kultur-, sondern Wirtschaftspolitik. Ohne Zweifel ist Kultur immer und überall politisch vereinnahmt, instrumentalisiert worden. Ob kommerzieller Kulturbetrieb, Künstlerkolonie oder Kleinkunstakteur – wenn das politische System die Funktion von Kultur bestimmt, Kulturfunktionäre einsetzt, die Kriterien „guter“ Kultur definiert und gegen „entartete“, rückständige“, dekadente usf. Kultur exekutiert, ist Kultur am Ende, kein Subsystem mehr, sondern politisches Instrument. Kulturschaffende selbst sind höchst sensibel für jede Tendenz zum Hofnarrentum, wenn auch nicht immer resistent genug. Die Konsequenz für Kulturpolitik? Aus alledem kann für Kulturpolitik eigentlich nur der Schluss gezogen werden, dass es sich dabei um ein Politikfeld handelt, welches möglichst frei von Steuerung und Gestaltung bleiben, aber gleichwohl „irgendwie“ gesichert, also schonend weitläufig geregelt sein sollte. Mehrebenen-Systeme Aus der klassischen Staatsrechtslehre kennen wir die Trias Volk – Staat - Staatsgebiet. In der heutigen Terminologie besagt dies, dass sich Herrschaft, also die Reichweite eines politischen Systems, territorial und personell beschränkt, nämlich auf das Territorium und die Personen, für die bzw. auch durch welche dieses System legitimiert ist. So erstreckt sich beispielsweise die strafrechtliche Verfolgung, aber auch die staatliche Schutzfunktion (einschließlich des Asylrechts) auf die Personen, die sich auf dem Staatsgebiet befinden sowie die eigenen Staatsangehörigen, die sich außerhalb des Territoriums aufhalten. Diese territoriale Zuordnung politischer Systeme drückt sich im bekannten Begriff der „Gebietskörperschaft“ aus: Sie regelt die Verhältnisse in einem bestimmten Gebiet, als Gemeindeverwaltung oder Landkreis. Soweit für ein Territorium genau ein politisches System legitimiert und zuständig ist, ist – selbst wenn dann Funktionen auf Substrukturen wie Präfekten oder Landräte oder Wachtmeister delegiert werden – die Situation für alle Beteiligte, auch das Individuum einfach und eindeutig. Das System als Ganzes muss sich demokratisch legitimieren, auch durch den Output, also seine Kompetenz zur Regelung und Leistungserbringung. Umgekehrt geben die Staatsbürger dem System ihre Unterstützung (Support), auch in Form von Steuern und Abgaben. Moderne Staaten, selbst wenn sie sich als unteilbares Ganzes definieren, haben über die Delegation von Aufgaben hinaus „Ebenen“, d.h. territorial gebundene, das Staatsgebiet untergliedernde Strukturen eingerichtet, die eigene Funktionen erfüllen. 12 Da auf den unteren, d.h. territorial betrachtet kleineren „Ebenen“ die politischen Systeme ganz ebenso funktionieren wie auf der gesamtterritorialen, spricht man in der Politikwissenschaft von Mehrebenensystemen. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein klassisches Mehrebenensystem, wie auch leicht daran erkennbar ist, dass die politischen Systeme auf kommunaler, Länder- und Bundesebene ihr Personal separat bestellen (Wahlen), eigenständig Regelungen treffen und Leistungen erbringen wie auch Ressourcen besorgen, d.h. Steuern und Abgaben erheben können. Für den einzelnen Bürger, die Bürgerin ergibt sich daraus die interessante Situation, dass er/sie von Regelungen betroffen ist, die von unterschiedlichen Sendern ausgehen, so wie auch alle politischen Inputs (Demands, Expertise) an verschiedene Adressaten gerichtet werden. Damit ist nicht die horizontale Gliederung in Fachgebiete, Handlungsfelder, letztlich Policies gemeint, sondern deren vertikale Anordnung. Tatsache ist freilich, dass in der Bundesrepublik die Kompetenzen nicht nur recht ungenau und feingliedrig separiert sind, sondern miteinander eng verbunden, verflochten sind. Beispiel: Die Kommunen sind als Schulaufwandsträger für den Unterhalt der Schulen, das Land für Personal und Unterricht zuständig – für Unterhalt wie Neubau von Schulgebäuden gibt es jedoch wiederum Zuwendungen des Landes usf. Gerade eben hat der Bund ein Programm aufgelegt, das die Ausstattung von Ganztagschulen befördern soll. Die Tatsache der Politikverflechtung wird in der Politik wie in der Wissenschaft recht unterschiedlich bewertet. Über die letzten Jahrzehnte hinweg dominierte wohl die Anerkennung des kooperativen Föderalismus (Zusammenwirken von Bund und Ländern), während in den letzten Jahren gerade die „unteren Ebenen“ erkannten, dass sie mit Zuweisungen und Zuwendungen von oben eigene Handlungsspielräume verlieren. Die Länder(regierungen) erkennen immer deutlicher, dass sie eigene Leistungen (Output-Legitimation) kaum noch vermitteln können, da sie in Rahmengesetzgebungen, Gemeinschaftsaufgaben etc. eingebunden sind. Zugleich haben die Ebenen immer weniger die Möglichkeit, sich eigene Ressourcen zu erschließen, da die ertragreichen Steuern (auf Einkommen, Mehrwertsteuer) nach ausgeklügelten Berechnungsmodellen verteilt werden, größere Ungleichgewichte dann noch durch den Länderfinanzausgleich eingeebnet werden. Die Forderung, den föderalen Wettbewerb oder kompetitiven Föderalismus zu stärken, kommt nicht von ungefähr. Die Bundesländer konkurrieren heute schon durch ihre Leistungen, präsentieren sich als attraktive Standorte (vgl Imagekampagnen BadenWürttembergs oder Sachsen-Anhalts). Das Gleiche gilt für die Kommunen, die längst in einem Standortwettbewerb untereinander stehen, nicht nur im Hinblick auf Touristen oder Kongresse, sondern gerade auch als Standorte für Unternehmen, Behörden oder Hochschulen. 13 Die Kultur im Mehrebenensystem Wer ist für die Kultur zuständig? Für das Politikfeld der Kultur treffen die bisherigen Feststellungen, auch zur Politikverflechtung, in besonderem Maße zu. Beginnen wir bei den Gemeinden: Nach dem Grundgesetz und dem traditionellen Verständnis von Subsidiarität haben die Gemeinden so etwas wie eine AllZuständigkeit. Alles, was sich auf der örtlichen Ebene regeln lässt, soll auch dort geregelt werden. Das ist der Kern der kommunalen Selbstverwaltung nach Art. 28.2 GG. Diese wird durch die Gemeindeordnungen in aller Form bestätigt: „Die Gemeinde ist in ihrem Gebiet der ausschließliche Träger der gesamten öffentlichen Aufgaben, ..“ (§2.1. der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt). Allerdings werden hier bereits die ersten und grundlegenden „Systemfehler“ deutlich: - Nicht die Gemeinden selbst, sondern die Bundesländer bestimmen per Gesetz die Gemeindeordnung - Die Zuständigkeit des § 2.1. gilt nur, „... soweit die Gesetze nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmen“. Damit sind die Gemeinden und Städte (das Gleiche gilt für die Landkreise) für Kultur also in dem Maße zuständig, in dem dies nicht anderweitig geregelt ist. Die Zuständigkeit für das Politikfeld Kultur könnte als nächstes auf der Ebene der Länder vermutet werden. Hier treffen wir auf die gleiche Gedankenfigur, nicht jedoch auf eine explizite Kompetenzzuweisung: „Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zulässt.“ (Art. 30 GG). Diese Gedankenfigur entspricht ganz dem bundesstaatlichen Prinzip und der Gründungsgeschichte der Bundesrepublik sowieso, da ja die Länder früher verfasst waren als die Bundesebene und das Grundgesetz durch die mehrheitliche Zustimmung der Bundesländer zustande kam. In gewisser Weise wiederholte sich dieser Vorgang mit der deutschen Einigung, die bekanntlich durch Beitritt der neu verfassten Bundesländer zum Grundgesetz operationalisiert wurde. Art. 30 enthält also eine Zuständigkeitsvermutung zugunsten der Länder. Die Bundesländer sind für die Gesetzgebung generell zuständig, sofern diese nicht ausdrücklich dem Bund übertragen wurde Dieses föderale Prinzip unterscheidet sich also von Dezentralisierung, Regionalisierung, Devolution in der Richtung, vielleicht nicht immer im Ergebnis. 14 „Kultur ist Ländersache“ – so oder so ähnlich lautet der entsprechende Grundsatz, der wohl allgemein anerkannt ist. Materiell, um es noch einmal zu wiederholen, leitet er sich zunächst lediglich aus der Tatsache ab, dass die Bundesebene (von wenigen Ausnahmen abgesehen, die noch diskutiert werden) eine Gesetzgebung auf dem Gebiet der Kultur nicht beansprucht und die Gemeindezuständigkeit nur solange besteht, wie gegensätzliche Regelungen fehlen. Die Bundesländer haben jedoch in aller Regel das Politikfeld positiv besetzt. Artikel 36 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt besagt: (1) Kunst, Kultur und Sport sind durch das Land und die Kommunen zu schützen und zu fördern. (2) .. (3) Das Land und die Kommunen fördern im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten die kulturelle Betätigung aller Bürger insbesondere dadurch, dass sie öffentlich zugängliche Museen, Büchereien, Gedenkstätten, Theater, Sportstätten und weitere Einrichtungen unterhalten (4) Das Land sorgt, unterstützt von den Kommunen, für den Schutz und die Pflege der Denkmale von Kultur und Natur... Demgegenüber ist Art. 3 der Bayerischen Verfassung weitaus knapper gefasst: (1) Bayern ist ein Rechts-, Kultur- und Sozialstaat.... (2) Der Staat schützt die natürlichen Lebensgrundlagen und die kulturelle Überlieferung. Am Beispiel Sachsen-Anhalt werden einige Probleme der Kulturpolitik im Mehrebenensystem deutlich (die reichlich unglückliche Verquickung mit dem Sport sei vernachlässigt): - Das Land nimmt die Gemeinden strikt in die Pflicht. Die Kulturförderung ist als Staatsziel etabliert, aber unter den Finanzvorbehalt gestellt. Als Instrument der Kulturpolitik wird ausdrücklich benannt, kulturelle Einrichtungen zu unterhalten. Die Kulturpolitik des Landes ist dem demokratischen Anspruch eines Angebots „Kultur für alle“ verpflichtet. Dieser deutlichen und substantiellen inhaltlichen Festlegung angestrebter Outputs des politischen Systems steht im zweiten Fall, der „alten“ (im Kern 1946 entworfenen) Verfassung Bayerns eine knappe Formel gegenüber, die weitaus mehr Interpretationen offenhält. Sie enthält allerdings den Terminus “Kulturstaat“, den manche Autoren, insbesondere aber die kulturpolitische Lobby gerne als substantielle Verpflichtung verstanden wissen will, aus der unmittelbar Leistungen des Staates abgeleitet werden könnten. In diesem Zusammenhang sind auch die Bestrebungen zu sehen, das Kulturstaatspostulat im Grundgesetz zu verankern. Zuletzt hat die Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ sich dafür ausgesprochen, einen Artikel 20b ins Grundgesetz einzufügen, der da lautet: „Der Staat schützt und fördert die Kultur“. 15 Die Vorstellung, dass sich daraus eine finanzielle oder inhaltliche Verpflichtung der Bundesebene beziffern ließe, ist nicht nur illusionär (s. Sozialstaatspostulat), sondern auch anti-föderalistisch. Die obige sachsen-anhaltische Version ist ein gutes Beispiel auch dafür, wie das Verhältnis zwischen Kommunen und Land bestimmt werden kann, nämlich gar nicht, jedenfalls nicht präzise. In der Praxis sind es oft kooperative Lösungen, wenn z.B. ein Theater von der Stadt, dem Landkreis und dem Land zu etwa gleichen Teilen subventioniert wird (mit allen Komplikationen für den Fall, dass einer der Partner diese Leistungen nicht mehr erbringen kann/will). In anderen Bundesländern, um bei der Sparte zu bleiben, finden wir fast flächendeckend reine Landestheater, so in Baden-Württemberg, oder Theater überwiegend in kommunaler Trägerschaft wie in Nordrhein-Westfalen (vgl. Heinrichs, S.67). Ergänzend sei noch darauf hingewiesen, dass die Rechtssprechung, insbesondere auch das Bundesverfassungsgericht ganz ebenso die Kulturpolitik der Ebene der Länder zuordnet. Als Beleg diene das sog. Fernsehurteil vom 28.2.1961: "Soweit kulturelle Angelegenheiten überhaupt staatlich verwaltet und geregelt werden können... fallen sie in die Kompetenz der Länder“. Kulturpolitik ist damit einzuordnen in den deutschen Föderalismus, die Verfassung Deutschlands als Bundesstaat. Der erste Staatsminister für Kultur und Medien sah das durchaus strapazierte und aufwändige Föderalismusprinzip „als Antwort auf die totalstaatliche Herrschafts- und Gewaltkonzentration und auf die traditionsfeindliche kulturelle Gleichschaltung des ‚Dritten Reiches’“, wies aber die Bedenken gegen eine Bundeskulturpolitik schroff zurück: „Die grundgesetzliche Legitimation einer Bundeskulturpolitik wurde anfänglich unter Hinweis auf die ‚Kulturhoheit der Länder’ infrage gestellt. Doch der barocke Begriff der ‚Kulturhoheit’ taucht im Grundgesetz nicht auf. Er gehört zur Verfassungsfolklore.“ (Naumann, S.59). Das Wort von der „Verfassungsfolklore“ hat wiederum heftige Debatten ausgelöst. Naumann hat jedoch damit einige bedenkenswerte Argumente verbunden: - Bundesförderung für die Kultur der Neuen Bundesländer haben diese wie auch die Alten durchaus akzeptiert. - Diejenigen, die den Kulturföderalismus hochhalten, erwarten aber durchaus Zuwendungen des Bundes, z.B. Bayern für die Bayreuther Festspiele - Die Furcht vor dem Zentralstaat ist absolut unbegründet, die politischen und ökonomischen Machtzentren sind über das ganze Land verteilt. - Deutschland muss in der EU kulturpolitisch präsenter und aktiver werden, z.B. um der Kommerzialisierung des Rundfunks entgegenzutreten. - Mit dem entsprechenden Bundestagsausschuss wird Bundeskulturpolitik, die vorher irgendwie doch, nämlich vom Innenministerium betrieben wurde, wieder transparent und verhandelbar, im Gegensatz zur undurchsichtigen Konferenz der Länder-Kultusminister (KMK). - Kultur ist ohnehin unregierbar, will frei sein. Diese Freiheit ist in jedem Falle zu bewahren – „auch gegen den Staat, ob Bund, Länder oder Kommune“ 16 (ebd., S.60). Was ist Ihre Meinung? Wenn die Bundesländer darauf bestehen, dass Kultur ihre Sache sei – ist das richtig? Ist dies einfach historisch so? Ist dies praktischer, praktikabler? Oder gibt es Kultur immer nur als „Kulturland Sachsen-Anhalt“, „Bayerische Kultur“? Wenn also Kultur – wie die Länder nicht müde werden zu betonen – „eigentlich“ Ländersache ist, sollte ja die Bundesebene außer Betracht bleiben können. Nach dem Grundgesetz gibt es jedoch Zuständigkeiten des Bundes für den Bereich der Kultur sehr wohl und ausdrücklich, wenn auch klar umgrenzt: - Art 74.(konkurrierende Gesetzgebung): 5. Schutz vor Abwanderung deutschen Kulturgutes ins Ausland; - Art 73.(ausschließliche Gesetzgebung): 1. auswärtige Angelegenheiten, - Art 73.(ausschließliche Gesetzgebung): 9. das Urheberrecht und das Verlagsrecht Im Zusammenhang der Jugendhilfe, nämlich der Jugendarbeit, wie von den Jugendverbänden und anderen freien Trägern gestaltet und angeboten wird, ist auch von kultureller Jugendbildung die Rede: Kinder- und Jugendhilfe, SGB VIII, § 11 (3)1. Über den Kinder- und Jugendhilfeplan des Bundes könne dabei auch zentrale und Fortbildungsveranstaltungen der kulturellen Kinder- und Jugendbildung gefördert werden. Spätestens an dieser Stelle ist ein ausführlicher Exkurs zur Medienpolitik geboten, wobei wir diese eben als Teil von Kulturpolitik begreifen. Medienpolitik (media policy) Medien sind Mittel der Kommunikation. Mediennutzer sind damit diejenigen, die sie als Mittel einsetzen, um eine Message abzusetzen (Produktion), aber auch diejenigen, die sozusagen auf Botschaften warten, „sich berieseln lassen“ (so die passivische Lesart) oder nach Inhalten suchen, Informationen abrufen (aktive Rezeption). Lange Zeit herrschte die Ansicht vor, Rezeption sei immer passiv - faktisch und begrifflichwissenschaftlich hat sich dies nun deutlich geändert (s.u.) In politischen Systemen, die auf der demokratischen Legitimation beruhen, in politischen Prozessen, in denen die Kenntnisse und Interessen möglichst vieler eingebracht werden sollen, insbesondere aber auch zur Kontrolle gegenüber jeder Form von Herrschaft, der politischen Akteure im Konkreten, ist es unabdingbar, dass sich jedes Individuum informieren kann. Verschiedentlich sind - auf das politische System bezogen - die Medien, d.h. der politische Journalismus, als die „vierte Gewalt“ bezeichnet worden, die neben Parlament, Regierung und Justiz waltet. 17 Journalisten beschaffen Informationen und verbreiten sie mit technischen Mitteln (Infomationsmedien). „Jeder hat das Recht,... und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten.“ (Art 5.1). Dies steht im Kontext der Meinungsfreiheit: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten“ (Art 5.1.). Und wenn wir weiterlesen, wird klar: hier haben wir eine institutionelle Garantie der Presse- und Rundfunkfreiheit, also die Garantie freien journalistischen Handelns: „Eine Zensur findet nicht statt“. Daran schließen sich natürlich einige Fragen an: a) Wenn es eine solche Garantie gibt, ist es ein Grundrecht gegenüber dem Staat, also ein Schutz vor dem Staat - wer wie durchsetzbar/einklagbar ? Immerhin sind wichtige Regelungen standardisiert, so das Zeugnisverweigerungsrecht (für Journalisten), zuletzt indirekt allerdings gefährdet durch den „großen Lauschangriff“ b) Wenn -s.Art 5.2 GG - die allgemeinen Gesetze (einschließlich Jugendschutz, Recht der persönlichen Ehre) diesem Grundrecht Schranken setzen, wieweit können diese Schranken gehen? Braucht der Staat bloß -per allgem.Gesetz- z.B. Notstand oder Geheimhaltung zu dekretieren, um die „allgemein zugänglichen Informationen“ auf ein harmloses Minimum zu reduzieren? - Immerhin steht dagegen die -einklagbareWesensgehaltgarantie des Art. 19.2.! Das historische Beispiel hierzu ist die SPIEGEL (besser: STRAUSS-)-Affäre 1962: unter dem Vorwurf des „Landesverrates“ wurden die Redaktionsräume durchsucht, nachdem das Nachrichtenmagazin NATO-interne Informationen verbreitet hatte... c) Dass die Meinungsfreiheit Grenzen hat (Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung), die sich aus den Grundrechten (andrer) logisch ergeben und strafrechtlich relevant sind, ist klar - auch die Verantwortlichkeit (und letztlich Kontrolle eines Herausgebers bzw. Intendanten etc. ). Was aber im Falle einer unbotmäßigen Meinung, die ich als Privatperson, als Lehrer, Wissenschaftler, als Journalist, Fernsehkommentator äußere? Soweit der „innere Pluralismus“ angesprochen ist, ist dies für eine öffentlich-rechtliche Anstalt unabdingbar, für privatwirtschaftlich organisierte Medien, insbesondere auch Tendenzmedien nicht justitiabel - d.h. alle Formen von Kritik, Zurechtweisung, Mobbing, Karrierestop usf. sind denkbar. d) Die Freiheit der Meinungsäußerung ist natürlich nur dann auch meinungsbildend, wirksam, wenn Meinungen durch Medien verbreitet werden. Insofern ist es die Meinungsfreiheit der Medien-Nutzer (Verleger, Redakteure, Reporter) auf der produzierenden Seite und derjenigen, die sich ihrer bedienen (i.S. von Öffentlichkeitsarbeit), als politische Akteure in der Öffentlichkeit stehen (politics). Medienpolitik heißt aus diesem Zusammenhang heraus also: Normen (durch)setzen in Bezug darauf, wer wie Medien nutzen darf/kann und 18 zugleich die Stärke eines Eckpfeilers im politischen System bestimmen. Die Kompetenz (s.polity) liegt dabei schon nach Art 30 und 70 GG, also auf Grund der Zuständigkeitsvermutung zugunsten der Länder, bei den Bundesländern und fügt sich in die Aussagen zur Kulturhoheit nahtlos ein. Die Zuständigkeit für das Fernmeldewesen, die Telekommunikation (Art 73.3.) obliegt dem Bund nur in technischer Hinsicht (Manche erinnern sich noch an die Versteigerung der UMTS-Lizenzen). Der Regelungsbedarf ist nach Art des Mediums höchst unterschiedlich (gewesen). Nach anfänglicher Lizenzierung von Zeitungen (Entnazifizierung, Papiermangel) sind die Printmedien nicht weiter normiert, die Kommunikation per Druckerzeugnis ist also eine normale wirtschaftliche Tätigkeit. Meine Meinungsäußerung muss ich „verkaufen“ können. Die Logik ist überzeugend: wenn diese Kommunikation nach Inhalt und Gestaltung nicht ankommt, verschwindet sie vom Markt. Oder anders formuliert: um auf dem Markt zu reüssieren, muss der Produzent das Medium so gestalten (Inhalt, Design), dass es den Wünschen der (potentiellen) Käufer, also der vorgestellten rezeptiven Nutzer entspricht. Der Wettbewerb um den Abonnenten/Käufer erzwingt geradezu, gut aufgemachte und relevante/interessante/aktuelle Inhalte zu „kommunizieren“. Der Markt ist auch offen für unterschiedliche Meinungen i.S. von Richtungen, Weltanschauungen, gesellschaftspolitische Vorstellungen usf., die miteinander um die Gunst des Publikums buhlen. Das wirtschaftliche Unternehmen „Medienproduktion“ ist somit ein geniales System, um Meinungsvielfalt zu ermöglichen bzw. ihr Ausdruck zu verleihen. Der (äußere) Pluralismus , also die Wahlfreiheit zwischen, der Zugang zu verschiedenen Druckerzeugnissen, die auf dem Markt sind, gibt dem Bürger (Käufer/Rezipient) ein Optimum an Informationen, Meinungen und damit Möglichkeit der selbständigen Meinungsbildung. Soweit das Prinzip. Prinzipiell wie faktisch enthält dieses System jedoch folgende Probleme: a) Wirtschaftliche Macht kann sich in Medienmacht umsetzen, ohne dass dies (anfangs) durch die Rezipienten sanktioniert worden ist: ein Unternehmer hat mit Immobilien soviel Geld verdient, dass er in Medien investieren kann und kraft dessen Marktanteile erobern kann - vgl. Berlusconi. b) Die Marktmacht wird auf Dauer größer als es der Rezipientenmeinung entspricht, da die Konkurrenz nicht bestehen kann: Auflage zu klein, um noch rentabel zu sein. Tatsächlich sind - unter kapitalistischen Gesichtspunkten - Konzentrationsprozesse normal, die auch an Medien-Unternehmen nicht vorbeigehen können. In der Zeit von 1950 bis 1975 verringerte sich die Zahl der selbständigen Zeitungen um ein Drittel, die Zahl der Verlage wie der Vollredaktionen von 1954 bis 1990 fast um die Hälfte. Bei den Publikumszeitschriften teilen sich vier große Verlage (Bauer, Springer, Burda, Bertelsmann/Gruner&Jahr) 2/3 des Marktes auf. 19 Fakt ist, dass in der BRD mehr als die Hälfte aller lokalen/regionalen Zeitungen Monopole haben, d.h. die Bürger sich über das örtliche Geschehen nur aus einer Tageszeitung informieren können. c) Wie nach der Niederlage des NS durch die Lizenzen der Besatzungsmächte haben auch nach der Wende einige Unternehmer Startvorteile erhalten, die schwer aufzuholen sind: die Treuhand (media policy!) hat die vormaligen SED-Bezirkszeitungen verschiedenen westdeutschen Verlagen verkauft, die damit praktisch bis heute ein Monopol haben: MZ im vormaligen Bezirk Halle. Die politischen Akteure, z.B. auch Interessensgruppen müssen sich mit dieser Redaktion schon „gut stellen“, wenn sie über dieses Medium kommunizieren wollen (that is politics!). d) Der Printmedien-Unternehmer braucht nicht sosehr Rezipienten (Leser), sondern Käufer, d.h. Auflage, um so durch Anzeigen, Annoncen - sei es von Privat (Wohnungssuche etc.), sei es von der werbenden Wirtschaft - überhaupt bestehen und Profit machen zu können. Der Zusammenhang mit dem redaktionellen Teil ist offensichtlich:„Meinungsäußerungen“ über die Gefahren der Atomenergie oder Konsumismus würden Energiekonzerne oder Warenhäuser ungern auf der gleichen Seite mit ihrer Annonce sehen wie auch umgekehrt manche Redaktion/Herausgeber die Werbung für ein Produkt ablehnten. Ein besonderer Fall sind die elektronischen Medien. Dazu mehr im Seminar. Hier nur soviel zur Rundfunkpolitik: : Nach 1945 haben die West-Alliierten als Besatzungsmächte die E-Medien-Landschaft skizziert, wie sie bis in die 80er Jahre bestand: nicht private, aber auch nicht staatliche, eher etwas staatsferne, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten regionalen Zuschnitts, also weitgehend analog den Bundesländern: regionale Monopole, gesellschaftlich kontrolliert (polity-policy). Als über den Hörfunk hinaus das Fernsehen bundesweit eingeführt werden konnte, blieb die öffentlich rechtliche und föderale Struktur erhalten: die ARD als Länderverbund und 1961 auch das ZDF als gemeinsame Anstalt der Bundesländer (das BVerfG hatte den Plänen Adenauers, eine zentrale, staatsnahe Fernsehgesellschaften zu gründen, eine klare Absage erteilt). Für das ö-r. Konstrukt waren historisch-politische Gründe (vs. Gleichschaltung) maßgeblich, aber auch die technischen Bedingungen: Neben der (angeblichen) Erfordernis der öffentlichen Kontrolle der Frequenzen war es vor allem (in Hinsicht auf das Fernsehen) die Ansicht, dass wegen der hohen Investitionsleistungen und der begrenzten Sendekapazitäten ein Wettbewerb verschiedener Sender nicht wahrscheinlich sei. Anstelle des - wohl auch tatsächlich nicht realistischen äußeren Pluralismus - trat daher der innere Pluralismus, einerseits im Rahmen der ARD, dann zwischen ARD und ZDF, zwischen den Dritten Programmen, insbesondere aber auch innerhalb jeder Anstalt. Verweis auf Rundfunkräte (polity) 20 Mit der Zugängigkeit (Wirksamkeit, Verbreitung) von Medien außerhalb des Territoriums (RTL), neuen technischen Möglichkeiten (Kabel, Satellit) und den Erfahrungen in anderen Ländern (z.B. Italiens Privatrundfunk, USA), insbesondere auch durch das Drängen der Verleger, Produzenten und der Werbewirtschaft war das öffentlichrechtliche Monopol nicht mehr haltbar.. Die Landes-Rundfunkgesetze wurden entsprechend geändert, das BVerfG hat mehrfach Urteile gesprochen (so das „Niedersachsen-Urteil von 1986: Bestandsgarantie für ö.r. wegen „Grundversorgung“). Grundlegend ist der Staatsvertrag zur Neuordnung des Rundfunkwesens vom 12.3.87, 1992 noch einmal ergänzt. Er besagt im Wesentlichen Folgendes: Die öffentlich-rechtlichen Anstalten sind für die Grundversorgung, insbesondere im Bereich von Information und Nachrichten zuständig. Sie haben flächendeckend und inhaltlich umfassend die politische Meinungsbildung („öffentliche Meinung“) zu ermöglichen und die kulturelle Vielfalt (einschließlich der Minderheiten) der Republik abzubilden. ARD und ZDF werden deshalb weiterhin durch Gebühren finanziert, können jedoch bis zu 20 Minuten werktäglich Werbung bringen, also Einnahmen daraus erzielen. Private Anbieter können sich lokal, regional, überregional etablieren, wobei die Landesmedienausschüsse und -anstalten die technischen und inhaltlichen Verantwortungen regeln. Sie können sich aus Werbeeinnahmen finanzieren. Neben den Landesmediengesetzen, die den sorgsamen Umgang mit Informationen etc. vorschreiben, gibt es kaum politische Regelungen. Nennenswerte Ausnahme: die Vereinbarung der Ministerpräsidenten der Länder vom März 1996, das sog. Marktanteilsmodell. Es besagt, dass die Länder Programmanbieter/private Sender im Prinzip unbeschränkt zulassen, aber darauf achten, dass kein Unternehmen einen Zuschaueranteil von mehr als 30% erreicht. Wir können diesen Exkurs abschließen mit der Feststellung, dass Kulturpolitik, soweit sie die Medien betrifft, tatsächlich Ländersache ist. Gibt es also keine Bundes-Kulturpolitik? Kulturelle Außenpolitik Von erheblicher, ja grundsätzlicher Bedeutung ist seit jeher die Kulturpolitik des Bundes als Teil der auswärtigen Angelegenheiten. Bis heute betont das Auswärtige Amt, praktisch unanhängig von der parteipolitischen Konstellation, den Status der Auswärtigen Kulturpolitik als eine der drei Säulen der deutschen Außenpolitik, neben der klassischen Diplomatie und den wirtschaftlichen Beziehungen. Die Bundesländer haben diesen Anspruch stets mit erheblicher Skepsis und Vorsicht betrachtet, obwohl der Bund schon aus praktischen Gründen gar nicht anders konnte, als die Länder stets zu beteiligen: bilaterale Kulturabkommen, die beispielsweise Ausstellungen, Fremdsprachenunterricht, Jugendaustausch oder Städtepartnerschaften 21 apostrophierten, konnten ja nur vermittels der Länder und Kommunen umgesetzt werden. Aus der Praxis etwa der sog. Fachausschüsse für den Jugendaustausch (an denen ich selbst beteiligt war) ist zu berichten, dass regelmäßig Vertreter der Länder (Landesjugendämter) vertreten waren. Das Problem lag eher in der Konkurrenz zwischen dem Auswärtigen Amt, das sozusagen die Gesamtverantwortung hatte, und dem Bundesjugendministerium, das nicht nur die Sitzungen einberief, sondern dann auch die finanzielle Förderung au den Mitteln des Bundesjugendplans bzw. Kinder- und Jugendhilfeplan des Bundes bereitstellte. Die Länder hatten übrigens selbst darauf gedrängt, die Förderverpflichtung des Bundes für den Internationalen Jugendaustausch feststellen zu lassen (was das BVerfG auch 1961 tat). Ähnliche Mechanismen können bis heute, gerade in letzter Zeit beobachtet werden. Wenn Bundesmittel zu erwarten sind, nehmen die Bundesländer dafür auch eine Verschiebung der Zuständigkeit zum Bund hin in Kauf. Dies gilt für die Bundeskulturstiftung wie auch die Sicherung der kulturellen Infrastruktur in den Neuen Bundesländern. Es sollte jedoch auch nicht übersehen werden, dass der Bund bereits in den 1980er Jahren eigene kulturelle Einrichtungen geschaffen hat, so etwa das Haus der Deutschen Geschichte in Bonn. Interessanterweise sind der/die Beauftragte für Kultur und Medien der Bundesregierung wie die Bundeskulturstiftung mit der internationalen Handlungsfähigkeit begründet worden, während die Auswärtige Kulturpolitik nach wie vor, im Kern unverändert beim Auswärtigen Amt liegt. Einige Autoren, namentlich aus der Kulturpolitischen Gesellschaft, haben wiederholt versucht, für die Bundesebene sowohl eine kulturpolitische Zuständigkeit als auch eine Art Leistungsverpflichtung zu konstruieren. Die Argumentation reagiert auf den Finanzierungsvorbehalt, der – wie wir für Sachsen-Anhalt gesehen haben – selbst bei erklärtem Staatsziel Kulturpolitik nicht aus den Haushaltsdebatten heraushalten kann. So sind, in Zeiten der Haushaltsdefizite mehr denn je, die sog. freiwilligen Leistungen, die also nicht unmittelbar auf einer gesetzlichen, womöglich monetär klar definierten Leistungsverpflichtung beruhen, die ersten, die zur Disposition stehen. Diese Versuche sind nicht nur unrealistisch und letztlich unpolitisch, sie verwenden auch untaugliche Mittel. Gemeint ist dabei die Charakterisierung der Bundesrepublik Deutschland als „Kulturstaat“. Tatsache ist, dass das Grundgesetz (Art. 20 und Art 28) zwar die Essentials Rechtsstaat, Bundesstaat und Sozialstaat benennt, nicht aber Kulturstaat. Dass der Einigungsvertrag dessen Erwähnung tut, hat einen anderen Zusammenhang, nämlich den der kulturell begründeten Einheit Deutschlands, auch während der und über die staatliche Teilung hinweg. Die Argumentation hebt letztlich auf die Kulturnation ab, also die seit Herder bestehende Auffassung, die Deutschen verbinde eine gemeinsame Kultur, auch wenn sie damals noch nicht in staatliche Einheit, einen Nationalstaat umgesetzt werden konnte. 22 Innerhalb des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschlands kann die kulturpolitische Bedeutung der einzelnen Ebenen, gerade wenn die ordnende Funktion in Rechnung gestellt wird, nicht allein an den Haushaltsmitteln allein festgemacht werden. Hinzu kommt, dass die Zurechnung öffentlicher Mittel zum Kulturhaushalt nicht einheitlich und nachvollziehbar ist. Unter diesen Einschränkungen liest sich eine Erhebung des Arbeitskreises Kulturstatistik des Deutschen Kulturrates vom Dezember 2002 so, dass die öffentliche Kulturförderung zu 10% vom Bund, zu 47% von den Ländern und zu 43% von den Kommunen kommt. Der Gesamtbetrag ist dabei nominell 8,249 Mrd. Euro. Söndermann (Jahrbuch 2002/03, S. 393) stellt die Verhältnisse ähnlich dar: Gesamtsumme 8,279 Mio. Euro (2002) Kommunen: 43 % Flächenländer: 36 % Stadtstaaten: 11 % Bund: 10 % (zusätzlich noch kulturelle Angelegenheiten im Ausland, noch mal halb soviel wie Bundesausgaben). Das politische Mehrebenensystem ist nicht zuletzt in den Mittelpunkt der fachwissenschaftlichen Debatte gerückt, weil die Bedeutung der supranationalen Ebene unübersehbar wurde: Europarat, Europäische Union. s.dazu Vorlesung Europa; Die Instrumente und Funktionen der Kulturpolitik Die grundlegende Spannung zwischen der Autonomie der Kultur, herkömmlich als Freiheit der Kunst garantiert (Art 5.3 GG), auch in Hinsicht auf Informations- und Meinungsfreiheit (Art 5.1 GG) einerseits und der irgendwie gearteten Regelung, Einflussnahme, Gestaltung von Kultur durch Politik ist für jedermann offensichtlich. Die künstlerische Ausbildung, Produktion, Rezeption von Kunst ist Individualrecht, ihre wirtschaftliche Verwertung (Kunstmarkt, Entertainment) Privatsache. Kultur ist insofern erst einmal staatsfreier Raum, von Politik freigehalten. Reglementierungen durch den Staat verbieten sich im Grunde von selbst. Kulturpolitik, sofern sie nicht eben diesen Freiraum garantiert, ist ein Widerspruch in sich. Dies gilt jedenfalls für Produkte, die für sich beanspruchen können, Kunst zu sein. Auch die Rechtsprechung entscheidet regelmäßig für die Freiheit der Kunst, es sei denn, Persönlichkeitsrechte wären betroffen. Dieser Betrachtung steht eine Argumentation gegenüber, die gerade auch von Akteuren aus der Kultur heraus vertreten wird. Sie leiten aus der Freiheitsgarantie des Art 5 (Freiheit vom Staat) die Verpflichtung des Staates ab, Kunst und Kultur „behutsam in seine Obhut“ zu nehmen (Hilmar Hoffmann)! 23 Richtig ist natürlich, dass sich gesellschaftspolitisch begründete Erwartungen an Kunst und Kultur nicht notwendig von selbst erfüllen. Wenn „Kultur für alle“ zugänglich, auch im aktiven Sinne „von allen“ (aus)geübt werden soll, ist dies auch zielgerichtet zu fördern. Dies gilt in gleicher Weise für die aktuelle, meines Erachtens völlig legitime Forderung, Kulturpolitik solle die ethno-kulturelle Vielfalt der deutschen Wohnbevölkerung abbilden und gerade Menschen mit Migrationshintergrund zum künstlerischen Ausdruck ihrer Lebenserfahrungen animieren. Konkret drückt sich dies dann zum Beispiel dadurch aus, für die selbstverwaltete Förderung von Initiativen durch den Fonds Soziokultur eine entsprechende Förderungspriorität vorzugeben oder im Rahmen der Auswärtigen Kulturpolitik allochthonen ( d.h. in Deutschland lebenden, aber nicht hier geborenen) Künstlern die Gelegenheit zur Ausstellung in Goethe-Instituten weltweit zu bieten. Diese plakative Diskussion kann nur sinnvoll geführt werden, wenn wir betrachten, was Politik mit „Kultur“ macht, welche Instrumente sie überhaupt zur Verfügung hat. Heinrichs hat an dieser Stelle eine Unterscheidung der Funktionen vorgeschlagen: Er betont dabei vor allem die ordnende Funktion der Kulturpolitik (Heinrichs, S.63). Damit sind die gar nicht immer kulturspezifischen Rahmenbedingungen professionellen Handelns gemeint, insbesondere das Urheberrecht, das Steuerrecht, das Arbeits- und Sozialrecht, das Zuwendungsrecht, Teile des Baurechts. So wie die Kulturwirtschaft an Bedeutung gewinnt, sind diese Rahmenbedingungen gestalterisch wirksamer als etwa direkte Subventionen, die vielmehr abgebaut werden könnten (ebd., S.72). Die Wirkung rechtlicher Bedingungen auf die kulturelle Praxis kann an einem kleinen Beispiel illustriert werden: Dass klassische Dramen häufig neu bearbeitet und aufgeführt werden, könnte ja damit zusammenhängen, dass für solche Neubearbeitungen Tantiemen bezahlt werden. Folgt man dieser Argumentation, so müsste tatsächlich die Bundesebene mehr ins Zentrum kulturpolitischer Interessen rücken. Im Unterschied zur ordnenden Funktion steht die inhaltliche Dimension, also die entweder fördernde oder unmittelbar operative Kulturpolitik. Die Förderung von Vereinen oder Künstlern (durch Stipendien oder Kunstpreise) einerseits, das Betreiben eigener Einrichtungen oder die Durchführung von Veranstaltungen durch eine Kommune ist ohne eine inhaltliche Ausrichtung, also eine Beurteilung von Vorhaben und Produkten nicht denkbar. Kulturpolitik wird hier unter der Vorgabe des Art. 5 immer der Selbstverwaltung und Selbstorganisation den Vorzug geben, etwa durch Berufung einer unabhängigeren Jury. Eine interessante Form der Selbstverwaltung von Fördermittel ist mit den Fonds geschaffen worden. Wir tun also gut daran, in der kulturpolitischen Diskussion die drei Dimensionen oder auch Instrumente auseinander zuhalten: - Gestaltung von Rahmenbedingungen, insbesondere durch Recht - Betrieb von Einrichtungen, Veranstaltungstätigkeit - Förderung "freier" Aktivitäten durch Preise, Stipendien, Zuschüsse an kleine private Theater, Kunstvereine... 24 Die Bundesebene setzt die (bundesweit einheitlichen) Rahmenbedingungen gerade in Hinsicht auf die Kulturschaffenden, die Ausübung und den Ertrag von Kulturberufen. Hier trifft sich das Kulturpolitische Interesse sogar mit dem Sozialstaatspostulat, wenn man folgende Fakten bedenkt: - Die Studie „Kulturberufe in Deutschland“ (2004) stellte fest, dass 63% der Freiberufler im Kulturbereich einen Jahresumsatz erwirtschaften, der unter 16.617€ und damit unter der Umsatzsteuerpflichtgrenze liegt. - Aus den Daten der Künstlersozialkasse (140.000 Versicherte) geht hervor, dass das Durchschnittseinkommen der Selbständigen bei 11.091 € liegt (Erhebung 1.1.12005). Nur 6.500 Versicherte erzielen ein Jahreseinkommen von über 30.000 €. Kulturpolitik, so können wir schließen, hat sich also letztlich auch damit zubefassen, unter welchen Bedingungen die Bürger und Bürgerinnen an Kultur teilhaben, auch als Produzenten.