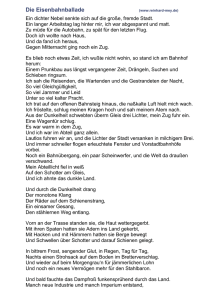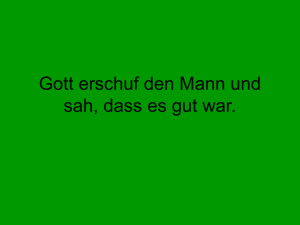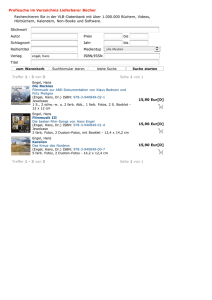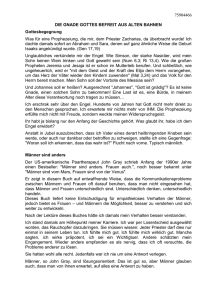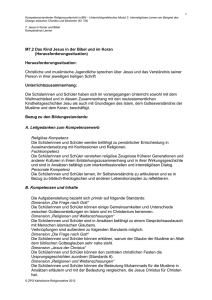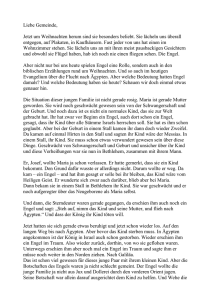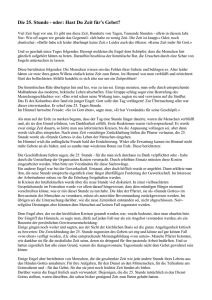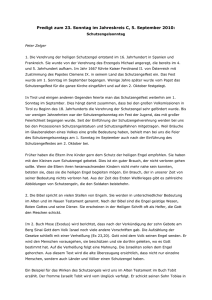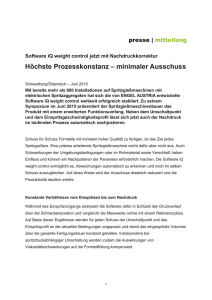Kal Syr Logg – Thriller
Werbung

N.O. Nym Kal Syr Logg – Thriller – Coverbild Titel: "Lichtmuster Disko Foto" Quelle: www.kostenlosebilder.net Nutzungsbedingung Dieser Roman stammt aus der Reihe »holterdiefolter eBooks«, veröffentlich auf www.holterdiefolter.de. Liebe Nutzerin, lieber Nutzer, bitte respektieren Sie meine Rechte als Autor. Zu privaten Zwecken dürfen Sie den Roman gern kopieren oder vervielfältigen und weiterreichen. Einzige Bedingung: Diese Nutzungsbedingung muss enthalten sein. Eine gewerbliche Nutzung ohne meine schriftliche Zustimmung ist ausgeschlossen. Bitte kontaktieren Sie mich bei entsprechendem Interesse über die Feedback-Seite der Website. Vielen Dank für Ihr Verständnis! N.O. Nym Liebe Leserin, lieber Leser! Auch ein Krimi, der nichts kostet, sollte nur ordentlich verarbeitet in die Öffentlichkeit gelangen. Denn letztlich kostet er den Leser doch etwas: Lebenszeit. Ich habe mich bemüht, dem gerecht zu werden. Doch beim finalen Korrigieren stoße ich an meine Grenzen: Die Korrekturen laufen – unbemerkt – im Kopf statt auf dem Papier ab. Ob ein Wort zu viel (das aus einer älteren Fassung übrig geblieben ist) oder eine Endung, die nun nicht mehr passt: Ich bin stets versucht, mir meine Texte einfach „richtig“ zu lesen. Und der Duden-Korrektor hat dummerweise ähnliche Aussetzer. Darum: Für die Qualität der Geschichte halte ich den Kopf hin. Für orthografische und grammatikalische Fehler kann ich nur um Entschuldigung bitten! N.O. Nym PERSONEN Anna Heydt Triebel Melanie Bembel Mutter Beimer Elisabeth Ukela Holland Dr. Lexied Santer Dr. Guhl Redakteurin Chefredakteur Triebels Tochter Redaktionssekretärin Annas Nachbarin Studentin, Videokünstlerin Annas Vertraute Annas Exmann Strafverteidiger Psychologe Hausärztin Markus Engel Degenhart Papandreou Ogentaff Koetter Dr. Strecker Tom Ursula Oberkommissar in Frankfurt/Main Engels Vorgesetzter Engels Kollegen Jesús Mirandor Esmeralda Escobar Emily Parton Carlos Vincente, Inga, Miguel Brúto, Pirín Corbi Kuhlmann Fárdome Leutnant Gorpón Oberst Pintaluba Spanischlehrer in Granada Jesús’ Chefin Sprachschülerin Privatermittler Freunde von Jesús Kriminelle Policía Nacional, Madrid ehemaliger Franco-Offizier Guardia Civil, Granada Guardia Civil, Madrid Salvator S, Khaled Henry Iwan Lucy, Mikki, Manuel, Pierre, Christian, Guido etc. Staatsanwalt in Frankfurt/Main Engels Bruder Engels verstorbene Frau Ziehsöhne Majordomus Leiter des Sicherheitsdienstes Gefolgsleute PROLOG Sie wusste es nicht, konnte es nicht wissen und hätte es nicht wissen wollen. Weil sie es ebenso wenig hätte glauben können wie sonst wer, von ein paar Spinnern mit einem Quantensprung in der Schüssel vielleicht abgesehen. Darum wähnte sie, es bräche ein ganz gewöhnlicher Tag an, einer wie so viele, die sich durch die Leere wanden, noch so einer aus dem 99-Cent-Paradies des Lebens. Ihr Glückskontingent war offenbar schon nach fünfzehn Lebensjahren aufgebraucht gewesen. Seitdem hatte sich noch jeder Hoffnungsschimmer am Horizont als Blitz entpuppt, der auf sie herabgeschossen kam. Sie war jetzt eine Frau in mittleren Jahren (die jedem ins Gesicht gesprungen wäre, der sie so genannt hätte), nicht hässlich, obwohl sie sich darum zu bemühen schien, ein bisschen größer als der Durchschnitt, ein bisschen dünner. Und genervter, viel genervter. Es gab fast nichts, das sie nicht nervte und zu dem Wenigen gehörte sie selbst leider nicht. Sie galt als Giftspritze und kaum einer verstand, dass sie bloß das Gift wieder ausspuckte, das man ihr injiziert hatte. Nein, das Opfer war sie selbst, wenngleich ein ziemlich renitentes. Aber auch unter ihrer Widerborstigkeit hatte sie selbst am meisten zu leiden. Wenn sich ihr jemand entschlossen in den Weg stellte, war sie es meist selbst. Wer sonst, es interessierte sich ja niemand für sie. Von einem abgesehen. Dieser eine befleißigte sich allerdings unglaublicher Diskretion. Neben ihm strahlten andere Dunkelmänner wie Lichtgestalten. Weil er sich auf sein Geschäft verstand. Und weil es ihm zur Natur geworden war. Darum blieb im Verborgenen, welche Vorkehrungen er bereits getroffen hatte, um ihrem Leben eine Wendung zu geben, und wozu die Prozedur diente, auf die alles ausgerichtet war. Sie sollte es bald zu spüren bekommen, denn heute begann der Countdown. Ihre Tage waren gezählt, die Instrumente platziert, die Gefolgsleute in Bereitschaft. Er hatte Ewigkeiten gebraucht, alles perfekt einzurichten, und es würden weitere vergehen, bis er an sein eigentliches Ziel gelangte. Die Zeit würde er sich nehmen. DANTE & DEEP TUBE | D-FRANKFURT/MAIN Die Spätwintersonne zeigte sich endlich mal wieder über Frankfurt, zwar nur blass, wie ein Rekonvaleszent nach langer Bettlägerigkeit, aber wer die Nase in den Wind hielt, konnte den Frühling des Jahres 2009 beinahe schon riechen. Anna Heydt hatte die Fenster geschlossen. Sie stand am Herd und beobachtete aus den Augenwinkeln, wie der Aschewurm an der Selbstgedrehten sich in die Pfanne stürzte. Sie rührte die Asche unter, konnte nur besser werden. Ihre Nahrung hatte sie ohnehin weitgehend auf Flüssiges umgestellt, seit ihr Mann sie vor einem Jahr per Arschtritt aus der Umlaufbahn katapultiert hatte. Sie driftete also wieder allein durchs All. Und wenn schon, sie kannte sich damit aus. Zunächst hatte sie sein Gestammel nicht verstanden, irgendwas Infrastrukturtechnisches über Lebenswege, Abzweigungen und Ausfahrten, vor allem Ausfahrten. Doch als sie später durchs Wohnzimmerfenster ihres Hauses die luxusblonde Tusnelda in seinem Schlitten sah, kapierte sie endlich. Alles klar, da konnte sie nicht mithalten. Nach fünf Monaten waren sie geschieden, Reisende soll man nicht aufhalten. Jetzt wohnten die beiden im Haus und sie in dieser Wohngelegenheit: Haus II, neunzehntes Stockwerk, Apartment 290 d – d wie Depression. Der Ausblick der Quasi-Penthousewohnung war erste Sahne, aber das Drumherum lud eher zum Springen als zum Schauen ein. Innen sah es nicht besser aus: gemusterter Tapete, beige auf kackbraun. Den Wandschmuck hatte sie vom Vormieter übernommen und der sie wahrscheinlich vom Vorvormieter und immer so weiter bis zu den Geschmacklosigkeiten der siebziger Jahre. Nach einem Schluck aus der Bierdose klatschte sie den Haufen von der Pfanne auf den Teller und aß zwischen Tür und Angel, was die Asche doch nicht verbessert hatte. Es schmeckte wie Laternenpfahl ganz unten. Egal, der Fraß diente sowieso nur als Polster, in dem der Alkohol während der Arbeit still und heimlich versickern konnte. Sie war bereits aufgefallen, weil sie »einen in der Krone« gehabt hatte. Die ahnten ja nicht, was es hieß, einen in der Krone zu haben. Wie auch immer, die Gelbe Karte hatte sie bereits und wenn sie sich wieder erwischen ließe, würde sie vom Platz gestellt. Von diesem erbärmlichen Platz in diesem fensterlosen Kopierraum, in den man sie abgeschoben hatte. Die Redakteurin Heydt taugte offenbar nur noch zum Kopieren und Sortieren von Unterlagen. Sie zwang sich einen Löffel Pampe rein und warf einen Blick auf die Tageszeitung, die sie gestern im Hausflur abgestaubt hatte. Der Leitartikel nahm sich der geldgeilen Banker an. Verlogenes Pack! Wobei sich die Zauberlehrlinge aus den Geldhäusern wenigstens auf Artikel 1 Dummengesetz berufen konnten: »Die Gier des Menschen ist unantastbar. Das Nähere regelt der Finanzmarkt.« Selbst schuld, wer nicht kapierte, dass die Bankentürme wuchsen wie Pinocchio die Nase. Viel mehr regten sie die brandstiftenden Biedermänner der sogenannten seriösen Medien auf. Vor ein paar Jahren hatten sie den Bankern das große Einmaleins erklärt und vorgerechnet, es müssten endlich anständige Renditen her, um global mitplayen zu können. Kaum hatte sich der Griff nach den Sternen als einer ins Klo erwiesen, war das alles unanständig, klar doch. Da wurden aus den Anstiftern mal eben die Ankläger. Sie sah auf die Küchenuhr, deren Zeiger kaum von der Stelle kam. Irgendwas stimmte nicht. Sie rannte ins Schlafzimmer und bekam einen Schock: Der Wecker zeigte bereits Viertel nach eins an! Während sie ins Bad rannte, wurstelte sie den Wollpulli über den Kopf und streifte die langbeinigen Liebestöter ab. Ein Blick in den Spiegel bestätigte, wie sehr sie eine Grundreinigung gebraucht hätte. Fuck! Sie sollte heute im Büro Kaltmamsell spielen, den guten Geist für Kaffee und Brötchen. Aber noch sah sie eher nach Geisterbahn aus, und das nicht nur wegen des Sprungs im Spiegel. Nicht zu ändern. Auch der verwitterte Nagellack musste draufbleiben, vielleicht konnte sie sich später in der Redaktion drum kümmern. Sie gurgelte den grottigen Geschmack weg, schmiss sich unterdessen ins schwarze Kleid, fischte die Make-up-Tube aus einem Spinnwebennest im Bidet, zog zwei dicke Streifen über die Wangen und spurtete los. Erst im Fahrstuhl bemerkte sie die Pantoffeln an den Füßen: Kleine Plüschmonster, die ihre Mutter ihr hinterlassen hatte und die nur noch von viel gutem Willen und noch mehr Kleber zusammengehalten wurden. Da würden die Bundesbürger wieder was zum Glotzen haben. Egal, lieber in Pantoffeln als die finale Abmahnung kassieren. Bei ihrem Rad angekommen, stöhnte sie: beide Reifen aufgeschlitzt. Sie blickte zur Bushaltestelle, wo der verdammte Bus gerade anfuhr. Wahrscheinlich beobachtete der Fahrer im Rückspiegel, wie sie bescheuert mit den Armen durch die Luft ruderte, um auf sich aufmerksam zu machen. Sie schickte ihm unbekannterweise einen Fluch hinterher und rannte weiter. Den großen schlanken Mann in der Nähe der Bushaltestelle bemerkte sie in ihrer Eile nicht. Er hatte sie erwartet, zwar noch nicht jetzt, doch das spielte keine Rolle. Sie würde zu spät zur Arbeit erscheinen. Er folgte ihr einige Meter. Als einer der Pantoffeln in den Schneematsch fiel, verzogen sich seine Lippen zu einem lächelnden Schlitz. Sie war völlig durch den Wind, da hatte er richtig kalkuliert. Ein Haufen Elend, eingepackt in Trotz und Zorn. Das perfekte Material, fast schon gebrauchsfertig. Er sah ihr nach, wie sie in Richtung Taxistand rannte. Sie würde dort kein Taxi vorfinden, dafür hatte er gesorgt. Wie sehr sie sich auch beeilte, sie rannte nur noch ihrer Kündigung entgegen. Weitere Schläge würden folgen. Heydt würde bald in die Knie gehen. Er hatte ihre Kräfte präzise taxiert, sie neigten sich dem Ende zu. Aus blaugrauen Augen scannte er die Umgebung, dann nahm er den Werkzeugkasten, der dieselbe Aufschrift wie sein Blaumann trug: Spenglerei Maier. Natürlich war er alles andere als ein Handwerker. Er machte sich hier nur ausnahmsweise die Hände schmutzig, weil ihn wieder einmal dieser abgrundtiefe Ekel vor der Langeweile überkommen hatte. Er kannte die Langeweile schon eine kleine Ewigkeit und würde sie allzu bald wieder hinnehmen müssen. Doch hier und jetzt konnte er ihr entgehen. Wenn sie ihn überfiel, stürzte er sich ins Kampfgeschehen wie ein Verdurstender in einen Wassertümpel. Eine menschliche Schwäche, die hoffentlich niemals das Leben seiner kleinen Tochter gefährden würde. Er betrat das Hochhaus und stieg das Treppenhaus hinauf. Heydts Tür sperrte er in kaum fünf Sekunden mit einer Öffnungsnadel auf, sie war nicht zugeschlossen. Heydt glaubte offenbar, nichts mehr zu verlieren zu haben. So sollte es sein. Als Anna den leeren Taxistand sah, blieb ihr der Restatem beinahe stehen. Hatte sich denn alles gegen sie verschworen? Sie blickte die Straße rauf und runter. Ein Schutzengel musste her oder wenigstens ein Taxi. Fehlanzeige. Dann Daumen raus, vielleicht hatte ja ein Fahrer Erbarmen. Nein? Na gut, der nächste Fahrer würde anhalten, ob er wollte oder nicht. Sie wartete, bis sich die Benzinkutsche auf hundert Meter genähert hatte, und trat auf die Fahrbahn. Doch der Jaguar hielt nicht. Dann überfahr mich, ist die beste Lösung! Sie schloss die Augen – bis sie Bremsen quietschen hörte, gefolgt von einer keifenden Stimme. Der Fahrer hing mit halbem Oberkörper aus dem Fenster der Edelschrottkiste; weiter ging es wegen der Wampe nicht. »Bist du Transuse lebensmüde?« »Ein Notfall, Sie müssen mir helfen!« »Wieso Notfall? Und was geht das mich an? Hau ab!« Statt zu kotzen, rang sie sich so was wie ein Lächeln ab. »Ich muss in die Stadt, sonst passiert ein Unglück!« Jetzt musste wohl das Wort raus, auf das die Leute dermaßen abfuhren. »Bitte!« Ein schmieriges Grinsen. »Und was hab ich davon?« »Ich werde mich erkenntlich zeigen.« Sie verzog das Gesicht, was der geile Bock hoffentlich für eine verheißungsvolle Andeutung hielt. »Ich könnte Sie später zu einem Kaffee einladen.« »Erkenntlich zeigen, aha. Und den Kaffee trinken wir bei dir, ja?« »Wo Sie wollen, wenn wir jetzt endlich losfahren, Kruzitürken.« Im Wagen stank es nach Patschuli und Blähungen. Der feiste Klops steckte sich eine Zigarette an und fuhr los. Er hatte nervöse Schweinsäuglein, die über ihre Oberschenkel und den Saum ihres Kleids streiften. Nervöse Finger hatte er auch. Nervöse Finger mit Dreck unter den Nägeln. Anna versuchte, das Gleichgewicht zu halten zwischen Freigiebigkeit und Vergewaltigung, und zählte die Meter. Die Redaktion befand sich in der Schleusenstraße, aber sie hatte ihm eine Parallelstraße genannt. Der Wichser musste wirklich nicht wissen, wo sie arbeitete. Als sie aussteigen wollte, ergriff er ihren Arm. »Du schuldest mir noch das Kaffeestündchen, Babe.« Sie nannte ihm eine erfundene Adresse, warf die Tür so fest hinter sich zu, dass der Jaguar ächzte, und überquerte die Straße. Kaum auf dem Bürgersteig angekommen, spürte sie eine Hand an ihrem Ärmel. »Nicht so schnell, Püppchen. Das mit der Adresse kam mir zu fix. Lass mich mal einen Blick in deinen Perso werfen.« Der Kerl war größer, als sie sich vorgestellt hatte. Ein Walross auf Giraffenstelzen, so übel konnten Mutationen ausgehen. »Nimm deine Wichsgriffel runter, sonst …« »Was sonst, Püppchen?« Den Tonfall hatte er aus schlechten Filmen. »Gegenfrage: Wie viel Schmerz kannst du aushalten, Furzknoten?« Furzknoten warf die Fluppe auf den Boden und trat sie aus. Er trug Sandalen ohne Strümpfe: ein wenig luftig für die Jahreszeit und ein wenig gefährlich für die Situation. Anna sammelte Spucke und zielte auf den dicken Zeh. Treffer. Gemächlich rutschte die Spucke vom Zeh und landete auf der Zigarettenkippe. Jetzt war sie wirklich aus. Entgeistert betrachtete Furzknoten das Geschehen auf seinem Fuß. »Das wirst du bereuen«, keifte er plötzlich und krallte sich in ihren Parka. »Ach ja?« Mit einer schnellen Drehbewegung wand sich Anna aus seinem Griff, fasste in sein schulterlanges Haar, riss so fest sie konnte – und taumelte. Der Haarschopf flog in hohem Bogen durch die Luft und landete vor einem Hund, Typ Rantanplan. Er hatte sich sich von Poller zu Poller geschnüffelt, ohne die dicke Luft zu bemerken. Das Nest aus Haaren fand sein Interesse. Er roch daran, befand es offensichtlich für gut und pinkelte hinein. Furzknoten starrte fassungslos auf sein geschändetes Haupthaar. Da, wo der Klebestreifen das Toupet auf dem Schädel gehalten hatte, leuchtete ein tiefrotes Rechteck. So bald würde Glatzenwilli sich nichts mehr auf den Kopf pappen. Anna sah zu, dass sie Land gewann. Im Hausflur des Redaktionsgebäudes lehnte sie sich an die Wand und wartete, bis sie wieder bei Atem war. Triebel, der Chefredakteur des Fachmagazins Heureka, einem kleinen, monatlich erscheinenden Magazin mit naturwissenschaftlich-philosophischen Themen für interessierte Laien, fing sie im Eingangsbereich der Redaktion ab. »Was soll ich nur mit Ihnen machen, Frau Heydt? Ausgerechnet heute zu spät. Wenn Frau Bembel es bemerkt hätte …« Er sprach von Gesine Bembel. Laut Arbeitsvertrag war sie Schreibkraft, laut selbst verliehenem Titel Chefsekretärin und laut gewissen Gerüchten mit der Herausgebergattin befreundet. Zudem war sie unüberhörbar laut Frau Heydts entschiedenste Gegnerin in der Redaktion. »Keine Sorge, ich habe sie gleich losgeschickt, Besorgungen machen. Gehen Sie jetzt zur Toilette und richten Sie sich her, die braunen Striche im Gesicht markieren hoffentlich nicht das Ende Ihrer Schminkkunst. Und dann leisten Sie sich heute bitte keinen Fehltritt mehr, sind Sie so gut?« »Wenn es Fleißkärtchen gibt, werde ich mich tüchtig anstrengen, Herr Lehrer.« »Fleißkärtchen gibt es keine, Frau Heydt – stattdessen das Gehalt eines Redakteurs.« Sie wurde rot. Das Pendel schwankte zwischen Beschämung und Ärger und hielt beim Ärger. »Sie haben mich doch zum Sortierlieschen degradiert.« »Weil Sie mir keine andere Wahl gelassen haben, nicht wahr? Liebe Frau Heydt, Sie sollten eigentlich wissen, wie sehr ich mir wünsche, Sie kämen endlich ins Lot.« »Dann lassen Sie mich wieder schreiben, in Dreiteufelsnamen!« Wo sie nur immer diese blumigen Redewendungen hervorholte, die so gar nicht zu ihrer tendenziell umgangssprachlichen Ausdrucksweise passten. »Wieso eigentlich in drei Teufels Namen?« »Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Klingelt’s? Nein? Die drei Teufelsnamen entsprechen Gottes Dreifaltigkeit – nach dem Motto: Was der kann, kann ich auch. Haben Sie’s auf dem Schulklo getrieben, als das durchgenommen wurde?« Diese unverschämte Person! Triebel hatte Mühe, sich ein Grinsen zu verkneifen. »Wenn Sie nicht in Teufels Küche kommen wollen, sollten Sie jetzt voranmachen.« »Ich will wieder schreiben!« »Wenn Sie auf dem Damm sind.« Seine rehbraunen Augen hielten ihrem grünen Katzenblick nicht stand und er sah zu Boden. »Als Journalisten tragen wir schließlich Verantwortung.« »Wir sind Facharbeiter«, belehrte sie ihn. »Journalisten, das sind die Zappelphilippe, die nicht schreiben, was wichtig ist, sondern was Schlagzeile macht. Gestern Al Kaida, heute Al Bundy.« »Frau Heydt, bitte!« Während die »Redakteurin« abging, öffnete die »Chefsekretärin« die Eingangstür. Wie im Boulevardtheater, dachte Triebel. »Frau Bembel, auf einen Moment. Könnten Sie mit Frau Heydt reden, wie wir uns die Sitzordnung gedacht haben?« »Ach, Herr Triebel«, sie zog den Schmerbauch ein, der sich über die große Gürtelschnalle geschoben hatte, und blickte von ihren kurzen Beinen zu ihm auf. »Se kenne se doch.« Das Lächeln verschwand. »Des vornehm Deemsche waas ja eh alles besser. Habbe se die Hausschlabbe gesehe?« Kriminaloberkommissar Markus Engel war ein Außenseiter unter den Sittenwächtern des Frankfurter Polizeipräsidiums. Man nannte ihn hier einen »feinen Kerl« oder einen »guten Mann«, nur einen Kumpel nannte ihn keiner. Ihm fehlte der Stallgeruch, ihm fehlte überhaupt jeder Geruch, von einem Hauch Eau de Toilette abgesehen, der aber auch nur selten jemandem in die Nase zog. Weil Engel einfach nicht dazu einlud, ihn aus der Nähe zu beschnuppern. Ein Rührmichnichtan, so einer war er, immer ein bisschen etepetete, immer ein bisschen zu klug, ein Durchblicker, Weitblicker, Tiefblicker, diese Sorte. Bei der Sitte zu arbeiten, hieß nun mal, die Ärmel hochzukrempeln und im Dreck zu wühlen. Und was machte Kollege Engel? Zog nicht mal das Jackett aus. Den Kopf zu benutzen brachte natürlich nicht nur Nachteile, seit es die Perversen immer öfter in den Windungen des Netzes trieben. Da konnte man mangels Türen nun mal keine eintreten. Trotzdem. Er war eben keiner von ihnen. Ein Studierter. Nicht arrogant, das nicht, doch hielt er das Gleichgewicht zwischen zuvorkommend und zurückhaltend so gekonnt, dass man sich schon ärgern durfte. Zumal er die natürlichen Klassenschranken zwischen Straftätern und Strafverfolgern weitgehend ignorierte. Sie hatten hier mit Typen zu tun, für die der Begriff Sittenstrolch eine maßlose Beschönigung darstellte. Und was tat Engel? Behandelte sie mit ausgesuchter Höflichkeit. Frank Koetter, ein kerniger Ermittler vom alten Schlag, führte diese Mehrheitsmeinung an. Er saß bei der Einsatzbesprechung meist Mister Klugscheißer gegenüber, so auch heute. Auf dem Stuhl neben Engel nahm stets Stefan Degenhart Platz, der Chef des achtköpfigen Teams. Er demonstrierte auf diese Weise Verbundenheit mit dem Außenseiter. Degenhart, mit siebenunddreißig im gleichen Alter, trug ebenfalls Anzüge der feineren Art, wobei es sich bei ihm – notabene – um einen outfitmäßigen Beweis seines guten Geschmacks handelte. Bei seinem Mitarbeiter lag der Fall anders, der trug seine Anzüge wie eine Schutzschicht, an der Zutraulichkeiten abperlen sollten. Was auch immer er anzieht – anziehen will er niemanden. Degenhart mochte Wortspiele. Ja, auch er arbeitete mit dem Kopf. Das verband ihn mit Engel, wenngleich Degenhart ihn eher für die Laufbahn nutzte. Er hatte sich als Modernisierer positioniert, der für ein Update von Look & Feel kämpfte. Dass er zu den heißesten Karrierekandidaten zählte, beruhte jedoch auch auf einer hohen Aufklärungsquote, die er nicht zuletzt Engel verdankte. Der genoss das stillschweigend gewährte und längst offenkundige Privileg, sich interessante Fälle herauszupicken. Diese Bevorzugung hatte ursprünglich eine Art Zuckerstück in einer für Engel bitteren Zeit sein sollen – als nämlich dessen Frau unter unerfreulichen Umständen gestorben war. Die gute Tat hatte sich auch als gute Investition erwiesen, denn Engel suchte sich die richtigen Fälle aus, die verzwickten nämlich, und löste die meisten. Zwar zauderte er zuweilen, bis er den Sack endlich zumachte, aber solange die Anklagen zu Verurteilungen führten, sah Degenhart davon ab, ihm Druck zu machen. Der Mann war nun mal so. Degenhart sah in die Runde, fünf Männer und zwei Frauen, und setzte sein kollegiales Cheflächeln auf. »Guten Morgen allerseits. Wir machen es heute kurz, weil: ich muss zu einem Meeting beim Präsidenten. Ab Mittag bin ich wieder im Office. Gibt es etwas Dringendes? Nein? Dann zu den zwei neuen Fällen, die in den Einlauf gekommen sind.« Beim ersten ging es um illegale Prostitution in einem Laufhaus in der Moselstraße, genau das Richtige für Frank Koetter und seinen Spezi Gerd Miglas. Der andere Fall verlangte mehr Fingerspitzengefühl. Degenhart erläuterte die Hintergründe und wandte sich an Engel: »Sie übernehmen den Missbrauch, Markus?« Degenhart siezte seine Mitarbeiter, nannte sie aber beim Vornamen, sein Rezept für Leadership auf Augenhöhe. »Den Fall könnte ich übernehmen, Herr Degenhart.« »Zusammen mit Elvira.« »Die Frau zu identifizieren ist Tüftelarbeit. Da ist man allein vielleicht schneller.« Die Vorlage ließ Koetter sich nicht entgehen. »Hörst du, Elvira? Du bist dem Herrn nicht gut genug.« »Bleiben wir sachlich!« Degenhart wusste natürlich, dass es Engel nicht um Schnelligkeit ging. Er war eben ein Einzelgänger. Doch vor versammelter Mannschaft konnte er ihm nicht ständig Extrawürste braten. Bodo Ogentaff meldete sich zu Wort: »Ich hatte gehofft, Elvira macht die Vernehmungen in der Vergewaltigungsgeschichte mit mir, sind ziemlich viele, Alexander.« Engel und Elvira blickten zu Bodo, und man hätte kaum sagen können, wer dankbarer schaute. Auch Degenhart nickte zufrieden. »Dann ermitteln Sie zunächst alleine, Markus. Nur bringen Sie bald Ergebnisse.« Er beendete die Einsatzbesprechung. Auf dem Weg zum Büro sprach er Engel an. »Noch eine Frage off-the-record, Markus. Kennen Sie den neuen Staatsanwalt?« »Dr. Strecker? Nein, nicht persönlich, wieso?« »Ach, ich dachte nur.« »Verehrte Frau Bembel, bitte entschuldigen Sie die Störung.« Der Anrufer klang wirklich zerknirscht. »Sie sind sicherlich äußerst beschäftigt. Ich möchte nur einige wenige Momente Ihrer kostbaren Zeit beanspruchen. Wir haben telefoniert, vielleicht erinnern Sie sich. Obwohl Sie bestimmt Wichtigeres im Kopf haben. Es ging darum, dass Sie wahrscheinlich einen neuen Assistenten brauchen.« Gesine Bembel, die »Chefsekretärin« von Heureka, erinnerte sich sehr wohl. Dieser herrlich unterwürfige Bewerber, der telefonisch wegen einer Stelle angefragt hatte. Spontan war ihr die Idee gekommen, er könne vielleicht als Bürogehilfe die Heydt ersetzen, die es hier mit Sicherheit nicht mehr lange machte. »Wenn Sie mir die Frage erlauben: Ist die Stelle denn bereits frei?«, erkundigte sich der Anrufer. »Also wenn isch zu entscheide hätt, dann ja. Wissen Se, e Chefsekretärin …« »Sie hatten heute eine wichtige Konferenz, nicht wahr?« »Ei, des war fast schonn international, mer hatte … Woher wisse Se des eischentlisch?« »Sie erwähnten es freundlicherweise bei unserem letzten Gespräch.« »Aha.« »Die Konferenz war bestimmt ein Erfolg!« »Des könne se glaabe! Wissen se, isch bin mi dem Verlescher quasi befreundet und der hatt gemeint …« »Keine Pannen?« »Also, wann isch was organisier, dann …« »Ihre unzuverlässige Mitarbeiterin hat Ihnen demnach keinen Strich durch die Rechnung gemacht?« »Nein, wissen se, isch …« »Oh, es klingelt an der Tür, bitte entschuldigen Sie.« Der Anrufer legte auf und räusperte sich den Schleim von den Stimmbändern. Sie hatte ihren Job doch nicht verloren. Besaß sie mehr Reserven als kalkuliert? Und wenn schon. Er hatte noch einiges in der Hinterhand. Anna Heydt war schon immer ein schwieriger Fall gewesen. Aber sie lohnte die Mühe. »Jetzt machn Se endlich wat. Tretn Se die Tür ein oda wat weiß ich! Sie sehn doch, dat dat Zeuch da rauskommt!« Das sah er, in der Tat. Das »Zeuch« waren fiese schwarze Käfer, die unter einer Tür hervorkrochen. Trotzdem wusste der Hausmeister nicht, ob er die Tür eintreten durfte, nur weil niemand aufmachte. Wer dahinter wohnte, wusste er nicht auf Anhieb, immerhin musste er sich mit ein paar Hilfskräften um die ganze Anlage kümmern: drei Hochhäuser mit einer betonierten runden Bodensenke in der Mitte, die angeblich einem römischen Forum nachempfunden war. Das Forum wurde auch rege genutzt, irgendwo musste der alte Sperrmüll ja hin, wenn man sich neuen anschaffte. Bisweilen dachte der Hausmeister resigniert, dass die meisten Frankfurter sowieso keinen großen Unterschied zwischen den Mietern und dem Müll hier sahen. Bei dem Bewohner dieser Wohnung war die Grenze offenbar wirklich fließend. Bestimmt ein Messi. Wenn die Sauerei in andere Wohnungen gelangte, dann prost Mahlzeit. Nannte man das Gefahr im Verzug? Durfte er Gewalt anwenden? Er hätte gern, doch einen Schritt zu weit vorgewagt und man wurde Blockwart geschimpft. Als bräuchten diese mit Menschen vollgepackten Blocks keine Wartung! Er beließ es vorsichtshalber dabei, erneut zu klingeln. Anna Heydt saß auf der Toilette. Hörte das Klingeln nicht. Stand unter Schock. Sie hatte die Invasion zunächst gar nicht bemerkt. Hatte sich trunken aus dem Bett gequält und blindlings die Reihen durchschritten. Erst als sie den Hintern auf der Klobrille absetzte und langsam Licht durch den Schmierfilm vor ihren Augen drang, registrierte sie grob gerasterte Schatten. Viele. Und sie bewegten sich. Sie riss die Augen auf und konnte nicht glauben, was sie sah. Käfer, überall kleine, widerliche Käfer! Das Ungeziefer der Vorhölle! Luzifer hat seine Armeen losgeschickt, mich zu holen. Die neonschwarz glänzenden Viecher hatten sich längs der Wände formiert, als wollten sie sie einkesseln. Wo waren die über Nacht alle hergekommen? Anna begann zu schnüffeln. Ein unangenehmer Geruch lag in der Luft. Seit wann stanken Wanzen oder was immer das war? Mit Ungeziefer kannte sie sich nicht aus – noch nicht! Aber wenn es stinkende Mutationen gab, dann würden sie sich natürlich in ihrer Wohnung der Weltöffentlichkeit vorstellen, wo denn sonst! Sie spürte ein Kribbeln an den Füßen und zog die Beine an. Den Schwerpunkt verschoben, kippte sie nach hinten weg. Ihr Po ging auf Tauchfahrt in die Kloschüssel. Halt suchend ruderte sie mit den Armen, drückte einen Ellbogen gegen den Spülkasten – und öffnete die Schleusen. Kalte Fluten umspülten ihren Hintern. Die Fluten des Styx: Willkommen im fünften Höllenkreis! »AAAAAAAAAAAAAA!« Während Anna das Klingeln nicht gehört hatte, war ihr gellender Schrei für die Leute vor ihrer Wohnungstür nicht zu überhören. Die Schallwellen durchbrachen die Tür und verfingen sich schmerzhaft in ihren Gehörgängen. Was für Szenen spielten sich bloß hinter der Tür ab? Der Hausmeister hämmerte mit den Fäusten gegen die Tür. »Aufmachen! Sofort aufmachen, hier spricht der Facility Manager. Öffnen Sie!« Für Anna klang es nach Gestapo. Oder Luzifer. Oder nach allen zusammen. Was denn noch? War die Welt denn vollends aus den Fugen geraten? Wieder hämmerte der Wahnsinnige gegen die Tür. Auf Storchenbeinen schritt sie durch den Flur, zog den Parka als Ergänzung zur olivgrünen langen Unterhose über und schlüpfte in Gummistiefel. »Wer ist denn da?« »Der Facility … Die Hausverwaltung! Haben Sie gehört? Die Hausverwaltung! Ich fordere Sie auf zu öffnen!« Der Mann schrie ja das ganze Haus zusammen. Zögernd öffnete sie die Tür. »Was wollen Sie, Mann?« »Was ich will? Was ich will?« Die Käfer! Der Schrei! Die unsinnige Frage brachte ihn ganz aus dem Konzept. Anna zog die Tür weiter auf und sah den ganzen Aufmarsch: der hauseigene Ordnungshüter samt tatendurstigen Jubelpersern. »Hier gibt’s nichts umsonst!« Der Hausmeister setzte zu einer Antwort an, doch ein dicker Bauch schob ihn beiseite. »Wir wolln wissen, wat die Schweinerei hier soll, wat sonst? Züchten Se dat Ungeziefa bei sich oder fühlt et sich bei Ihnen einfach nur besondas wohl?« »Die sind gerade alle auf einmal plötzlich …« »Vom Himml gefalln? Wir wolln jetzt sofort in Ihre Wohnung und den Saustall sehn. Dat is unsa Recht als Hausgemeinschaft. Gebn Se ’n Wech frei!« Provozierend trat er einen Schritt vor, was er allerdings gleich bereute, denn jetzt musste er hochschauen, um ihrem Blick standzuhalten. »Halt endlich die Klappe, Hundsfott!«, fauchte ihn das Miststück an. Der Mann kratzte sich nervös am Bauch. Den Ausdruck kannte er nicht und mit Weibern, die nicht kuschten, hatte er keine Erfahrung. Durfte er ihr jetzt eine langen? Musste doch! Noch bevor er sich entschieden hatte, setzte die Schlampe den Angriff fort. »Schaut euch den Dickwanst in seinem schmuddeligen Unterhemd an, dann wisst ihr, wer uns das Ungeziefer ins Haus holt!« Unversehens sah sich der Mann den nachdenklichen Blicken der Nachbarn ausgesetzt. Er fühlte sich mit einem Mal so nackt wie die Lehrerin gerade, die ungeschickterweise mit dem Kleid an der Tafel hängengeblieben war und nun textilfrei vor der Jungensklasse stand – mit unschuldigem Blick und Monstermöpsen und einer naturbelassenen Muschi à la »Muttis bestes Stück«. Er hätte sein Pornovideo weiterschauen sollen, statt sich hier für die Hausgemeinschaft zu opfern. Plötzlich schrie ihn die Schlampe mit reibeisenscharfer Stimme an, die sein Trommelfell in Streifen schnitt: »Hau! End! Lich! Ab!« Die Fotze war ja gemeingefährlich, die müsste mal jemand stopfen! »Schlampe!«, blaffte er zurück und stapfte hoch erhobenen Hauptes davon. Anna registrierte es mit Erleichterung. Diesen Blockwartverschnitt hatte sie sich wenigstens vom Hals geschafft. »Hören Sie«, wandte sie sich an die Nachbarn, »mein Wort, gestern war nicht ein einziger Käfer …« Sie hörte selbst, wie unglaublich blöd das klang. Der Gesichterfront nach zu urteilen stand ihr Wort auch nicht hoch im Kurs. »Gehen Sie jetzt. Ich kümmere mich um einen Kammerjäger.« »Da will ich dabei sein«, forderte der Hausmeister mit der ihm eigenen Autorität. Er versuchte sich wieder an die Spitze des Inspektionstrupps zu setzen, wurde jedoch von einem ausladenden Busen beiseitegeschoben. Eine gut gepolsterte Frau in den Sechzigern, deren Namen er vergessen hatte. Man kannte sie hier nämlich nur bei ihrem Spitznamen: Mutter Beimer. Er passte, musste man zugeben: Frisur plus Konfektionsgröße plus hausmütterliche Art ergab Mutter Beimer. »Wir legen jetzt ein paar Lappen vor die Wohnungstür, dann können die Käfer nicht mehr raus«, wandte sich Mutter Beimer an Anna. »Und wenn Sie sich angezogen haben, gibt’s erst mal ein Tässchen Tee bei mir. Anschließend rufen wir den Kammerjäger an.« »Einverstanden«, machte sich der Hausmeister die resolute Entscheidung notgedrungen zu eigen. Eigentlich sparte er seine begrenzte Überwachungskapazität ohnehin lieber für gewisse migrationshintergrundbelastete Bewohner auf. »Vorausgesetzt, Sie halten mich auf dem Laufenden.« Er gab Anna seine Visitenkarte. Anna kehrte gerade von ihrem Ausflug in die Beimer’sche Wohnung zurück, als es an der Tür klingelte. Musste der Kammerjäger sein. »Wurde auch Zeit!«, begrüßte sie ihn. Wurde auch Zeit? Mit diesen Worten war Kriminaloberkommissar Markus Engel noch nie von einem Tatverdächtigen begrüßt worden. Er versuchte, sich ein Bild von der gut eins fünfundsiebzig großen Frau zu machen: Welthungerhilfefigur, struppiges rotes Haar, neben dem das Feuerrote Spielmobil verblasst wäre. Eine rauchige Stimme mit gereiztem Unterton. Schöne, grüne Augen, die an ihm vorbeiblickten. Die Hände hatte sie in die vorderen Hosentaschen geschoben. Er spürte eine Anspannung, etwas Flirrendes, das sich aber von der nervösen Wachsamkeit unterschied, der er so oft begegnete. Die Person war schwer einzuordnen: irgendwo zwischen ruppig und zerrupft, schien ihm. »Sie erwarten mich?« »Was denn sonst? Hier gibt’s richtig was zu tun.« Wollte die Frau ein Geständnis ablegen? »Markus Engel, ich …« »Ja, ja. Namen interessieren nicht.« »So?« »Hauptsache, Sie machen Ihre Arbeit ordentlich.« Woran Anna bereits Zweifel hatte. Dass Kammerjäger im Anzug auf die Jagd gingen, war ihr neu. Seit sich Hausmeister Facility Manager schimpften und Visitenkarten überreichten, musste man wohl mit allem rechnen. Sie betrachtete den Mann genauer. Adrett. Ein schmales Gesicht mit spitzer Nase, gepflegte Hände, gepflegte kleine Hände. Überhaupt ziemlich klein für einen Mann, gut eins siebzig, schätzte sie. Er sah wirklich nicht aus, wie man sich einen Handwerker vorstellt. Roch auch nicht so. Und stand mit leeren Händen da. Wollte er die Käfer durch gutes Zureden einfangen? »Wo haben Sie denn Ihr Waffenarsenal?« »Waffen? Ich brauche hier hoffentlich keine.« »Ich denke doch.« Sie dachte doch? »Oder machen Sie das Ungeziefer mit der bloßen Hand platt?« Bezeichnete sie sich als Ungeziefer? Vielleicht war die Frau eher ein Fall für die Psychiatrie. In diesem Moment hielt der Fahrstuhl und der Kammerjäger trat hinaus. Jetzt kapierte Anna, warum der Mann vor ihr so entgeistert schaute. Sie bat ihn zu warten und führte den Kammerjäger in die Wohnung. Der rümpfte die Nase und begab sich ans Werk. »Vielleicht sollten wir noch einmal von vorn beginnen. Mein Name ist Engel. Ich bin von der Polizei. Und ich muss Ihnen einige Fragen stellen.« Er zeigte ihr seinen Dienstausweis, den sie nicht beachtete. Polizei? Der nächste Horror? »Ich verstehe nicht.« »Sie sind Frau Anna Heydt? Es geht um ein heikles Thema. Nichts, was man im Hausflur besprechen sollte. Können wir hineingehen?« »In meine Wohnung?« Sie überkam ein sarkastisches Lachen. »Wenn Sie den indignierten Blick des Kammerjägers gesehen hätten, würden Sie das nicht vorschlagen.« »Gibt es vielleicht ein Café in der Nähe?« Sie nickte. Jetzt also auch noch eine polizeiliche Befragung. Es hatte sie nie gereizt herauszufinden, was sich hinter der tülligen Gardine im Schaufenster des Cafés versteckte, musste aber zugeben, dass es gut in die Gegend passte mit seinem Mobiliar aus Plastikholz, aus Plastik-Tropen-Holz. Unter welchem Namen wurde so was vertrieben – Sperrmüll de luxe? »Darf ich Sie auf ein Getränk einladen?« »Nein.« Engel winkte nach der Kellnerin und bestellte sich einen Espresso. »Und was wünscht die Dame?« »Erfahren Sie, wenn’s soweit ist.« »Nix da. Rumhartzen können Sie woanders.« »Putzen Sie sich mal die Nase, dann kommen auch mehr Gäste.« »Ich putz dich gleich von der Platte, du …« »Die Dame nimmt eine Tasse Kaffee. Danke.« »Was bilden Sie sich eigentlich ein!«, fauchte Anna den Polizisten an. »Sie müssen den Kaffee weder trinken noch zahlen. Zur Sache, dritter Anlauf. Erstens: Mein Name ist Markus Engel. Ich bin Polizist und befasse mich mit Sexualdelikten. Zweitens: Ich habe einige ernste Fragen an Sie. Drittens: Ich vernehme Sie als Zeugin. Sie sind verpflichtet, wahrheitsgemäß auszusagen, andernfalls könnten Sie sich strafbar machen. Sie müssen weder sich selbst noch Angehörige belasten und dürfen auf entsprechende Fragen die Antwort verweigern. Wenn Sie antworten, müssen Sie die Wahrheit sagen. Sie dürfen auch nichts verschweigen.« »Haben Sie das auswendig gelernt?«, sagte sie leichthin. Bei ihrer Pechsträhne würde gleich wer weiß was kommen, doch sie wollte sich ihr Fracksausen nicht anmerken lassen. »Haben Sie die Belehrung verstanden, Frau Heydt? Gut. Ich habe hier eine Aufnahme.« Er zog ein Bild aus der Innentasche seines Sakkos. »Ich wüsste gern, ob Sie die Person darauf erkennen.« »Was soll der Humbug?«, blaffte sie ihn an. »Natürlich erkenne ich die Person. Sie ja wohl auch.« »Sagen Sie es mir bitte trotzdem.« »Mich würde vielmehr interessieren, wo Sie das Bild herhaben.« »Aus einem Video. Jetzt habe ich Ihre Frage beantwortet, nun beantworten Sie meine.« »Das bin ich, wer denn sonst. Nur gibt es kein Video von mir, jedenfalls keins aus den letzten Jahren. Und rote Haare habe ich erst seit ein paar Monaten.« »Ich habe hier eine weitere Aufnahme, die einen Wohnraum zeigt. Sagen Sie mir bitte, ob er Ihnen bekannt vorkommt.« Irritiert betrachtete Anna das Bild. Obwohl die Mitte geschwärzt war, handelte es sich eindeutig um ihr Wohnzimmer. »Woher stammt das Foto? Von mir nicht, und ich hab in meinem Wohnloch auch noch nie Besuch empfangen. Ich will noch mal Ihren Dienstausweis sehen!« Der Mann zeigte ihn ihr. Schön und gut, nur: Wie sollte sie wissen, ob der echt war? Sie beugte sich vor und versuchte, ihn mit ihrem bösen Blick einzuschüchtern – ein schwacher Auftritt. Sie fühlte sich schwach, sei es, weil sie an der Plörre genippt oder weil sie ihre Tage oder weil sie Angst vor der nächsten Katastrophe hatte. Engel ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Wer wähnte, Angriff sei die beste Verteidigung, war bei ihm an der falschen Adresse. »Zeigt die Aufnahme einen Ihrer Wohnräume?« »Das wissen Sie doch selbst, verkaufen Sie mich nicht für dumm! Hören Sie, ich weiß nicht, was für Spielchen Sie hier treiben, aber wir sollten jetzt vielleicht zusammen zur Polizei gehen. Mal sehen, was die von einem Kollegen halten, der Frauen zum Kaffee lädt und ihnen absonderliche Fotos unter die Nase hält.« »Sie haben ganz recht, wir sollten ins Präsidium, um uns das Video anzuschauen.« »Komm schon, Cop! Sag mir einfach, was du wirklich von mir willst. An welche Art von Sex denkst du?« Sie hatte so schlagartig den Ton gewechselt, dass Engel an Schizophrenie dachte. Dabei grinste sie ihn an, einen frechen Blick im Gesicht, mit dem sie ihm entschieden zu nahe trat. Er mochte es nicht, beobachtet zu werden, schon gar nicht auf diese Weise. Er war der Beobachter, diese Rolle hatte er sich redlich erarbeitet. »Ich möchte Ihnen das Video vorspielen, sonst nichts. Also lassen Sie die Mätzchen«, entgegnete er kühl und beobachtete, wie sie reagierte. Jetzt zeigte sie ihr wahres Gesicht. Ihre grünen Augen erstarrten zu einem Blick, der wahrscheinlich im Feuer vieler Enttäuschungen gehärtet worden war, das blasse Gesicht verschlossen, die Lippen zusammengepresst. »Wie Sie befehlen«, sagte sie und stand auf. So aggressiv Engel die Tatverdächtige zunächst erlebt hatte, so still wurde sie, nachdem sie das Video gesehen hatte. Das Video war im Internet bei Deep Tube, einem von Rumänien aus betriebenen Pornoportal aufgetaucht. Es zeigte eine Frau beim Geschlechtsverkehr mit einem Jungen von maximal zehn Jahren. Die Sonderermittlungseinheit Internetkriminalität war wegen des deutschen Titels aufmerksam geworden: »Muttis Liebling ist im Arsch«. Für einen deutschen Tatort sprach auch ein auf dem Video zu erkennender Buchtitel: Dantes »Göttliche Komödie«. Schließlich hatte man den Fernsehturm im Hintergrund identifiziert: Es handelte sich um den Europaturm in Frankfurt. Engel hatte das Video auf Manipulationsspuren untersuchen lassen, schließlich galt es, in alle Richtungen zu ermitteln. Doch die Experten hatten nichts gefunden. Es gab folglich keinen vernünftigen Zweifel, dass ihm die Täterin eines Sexualdelikts gegenübersaß. Aber es gab seine Intuition, die sich bereits gemeldet hatte, als er der Frau im Treppenhaus begegnet war. Er brauchte zuweilen Zeit, die Irritation zu deuten, wenn Bauchgefühl und Beweise nicht zusammenpassten. Und nicht immer lag er mit der ersten Deutung richtig. Fehlalarm hatten seine Sensoren allerdings noch nie gegeben. Deswegen vertraute er seiner Intuition nicht weniger als der Vernunft. Und bei dieser Verdächtigen schrillte seine Sirene. Darum beließ er es vorläufig bei einer Zeugenbefragung. Er betrachtete den entsetzten Gesichtsausdruck der Frau. Schämte sie sich ihrer Tat? »Ich bin das nicht«, sagte sie schließlich. Engel schwieg, um Druck zu machen. »Man sieht das Gesicht ja auch nur ganz kurz, bei der Szene, wo er sie von hinten … wo sie sich zu ihm umdreht.« »Sie haben sich und ihr Wohnzimmer wiedererkannt.« »Ja.« Sie stierte vor sich hin. »Ich bin das trotzdem nicht. Auch wenn’s auf dem Video so aussieht.« Die Frau schüttelte energisch den Kopf. »Selbst wenn ich auf Sex mit kleinen Jungen stünde – so etwas würde ich einem Kind nicht antun. Eher würde ich mich umbringen.« »Haben Sie jemals Lust bei dem Gedanken an Sex mit Jüngeren verspürt? Selbst wenn Sie ihn gleich von sich geschoben hätten?« »Nein.« Ihre Stimme wurde rau. »Niemals.« Sie blickte auf und sah Engel in die Augen. »Niemals, das schwöre ich Stein und Bein. In meiner Jugend habe ich mich gar nicht für Jungs interessiert und später nur für gleichaltrige Männer.« Sie schwor also Stein und Bein. Die Ausdrucksweise der Frau irritierte ihn. »Sie sprachen gerade von Ihrer Kindheit. Ging es Ihnen damals gut?« Er verfolgte mit dieser Frage keine besondere Absicht. Sie war so gut wie jede andere, die dazu beitrug, aus einer verkrampften Vernehmung ein persönliches Gespräch zu machen. »Damals? Ja.« Anna blickte starr geradeaus. »Und dann nicht mehr?« »Nein.« »Es hat sich etwas verändert.« »Ja.« »Wie alt waren Sie, als es sich verändert hat?« »Fünfzehn.« »Ist es später wieder schön geworden?« »Nein.« »Während der Pubertät hat sich Ihr Leben also komplett geändert.« »Ich war zwar ein Backfisch, aber es hat nichts mit der Pubertät zu tun.« »Mit der Liebe?« »Nein.« »Mit Freunden? Oder der Schule?« »Nein. Jedenfalls anfangs noch nicht.« »Mit Ihrer Familie?« »Ja.« Engel bevorzugte eigentlich offene Fragen, weil Verdächtige sich sonst schnell in die Defensive gedrängt fühlten und zumachten. Außerdem hoffte er, auf diese Weise mehr zu erfahren, als er ohnehin schon wusste oder vermutete. Er entschied durch seine Fragen, wo es langging, ließ seinem Gegenüber aber viel Auslauf, hielt ihn gewissermaßen an der langen Leine und beobachtete, wo es ihn hintrieb. Doch diese Verdächtige würde sich nicht von der Stelle rühren. »Haben Sie Geschwister?« »Nein.« »Stehen Sie mit Ihren Eltern in Kontakt?« »Tot.« Seltsam. Anna nervte die Fragerei nicht. Es hatte nichts von diesen Psychopopeleien. Das muss schlimm für Sie gewesen sein, was haben Sie dabei empfunden? Sie hasste dieses Betroffenheitsgetue. Hier stattdessen präzise Fragen, knappe Antworten. Der Polizist hatte eine wohltuend ruhige Art zu sprechen. Schließlich war sie bereit, mehr als nur ja oder nein zu sagen, und erzählte in dürren Worten von ihren Eltern. Und dem Leben danach. Irgendwann gelangten sie leider wieder beim Video an. »Fällt Ihnen jemand ein, der Ihnen vielleicht Schaden zufügen will?« »Sie meinen, der das alles eingefädelt hat?« In ihren grünen Augen spiegelte sich ein Hoffnungsschimmer – und erlosch gleich wieder. »Nein. Ich bin zwar für die meisten die pure Zumutung, aber was eine Versagerin wie ich von sich gibt, kratzt niemanden wirklich.« »Sie sind geschieden?« »Das wissen Sie? Wie haben Sie mich eigentlich gefunden, Sie hatten doch nur mein Gesicht. Oder machen das die Computer auch schon mit links?« »Es gestaltete sich überraschend einfach. Es gibt nicht viele Wohnungen in der Stadt, von wo aus man einen erhöhten und freien Blick auf den Funkturm hat. Die Kamera hat ihn gut genug eingefangen, um den Weg zurückzuverfolgen. Da blieben nicht sehr viele Möglichkeiten, und es haben nur wenige Personen dem Geschlecht und Alter nach gepasst.« »Und wo haben Sie das Video im Netz gefunden?« »Auf Deep Tube.« Engel war gespannt, ob sie nachfragen würde. »Deep Tube? Was wie You Tube?« »So ähnlich. Noch nie davon gehört?« »Spucken Sie’s schon aus. Was ist das: ein Pornoladen?« »Könnte man sagen. Kommen wir zu meiner Frage zurück.« »Darf ich mir eine Fluppe anstecken?« »Fluppe?« »Glimmstängel.« »Eigentlich nicht, seit Kurzem streng verboten.« »Klar, der Kreuzzug ist in vollem Gange!« Damit war eigentlich alles gesagt, aber es drängten Worte nach, das Überdruckventil hatte sich geöffnet. »Unsere Drogenhüterin hat ja längst die Truppen gesammelt, Besserwisser, Bevormunder und Verwaltungsärsche. Da steht doch was von einem Widerstandsrecht im Grundgesetz, richtig? Kann ich mich darauf berufen, wenn ich die Drogentussi zwischen die Finger krieg?« Engel konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Obwohl er verqualmte Kneipen nicht gerade liebte, missfiel ihm der scharfe, atemfrische Wind, der den Rauchern entgegen blies. Er fragte sich, wohin das führen sollte, und wen sich die Gesundheitsapostel als Nächstes vorknöpfen würden. »Ich kapier das nicht«, setzte Anna nach. »Wieso darf sich der Staat einmischen, was in Kneipen passiert? Da müsste ihm mal jemand mit dem Grundgesetz auf die Finger klopfen!« »Unsere Verfassungsrichter meinen, der Staat dürfe sich da einmischen, müsse es vielleicht sogar.« »Moment. Im Grundgesetz steht, dass der Staat sich in private Beziehungen einmischen muss? Kann ja wohl nicht sein. Ich dachte, da steht drin, wovon der Staat die Finger zu lassen hat.« »Im Grundsatz haben Sie recht. Aber wenn Juristen vom Grundsatz reden, haben sie die Ausnahmen im Blick. Und laut Bundesverfassungsgericht darf sich der Staat ausnahmsweise in private Beziehungen einmischen, wenn sich die Bürger gegenseitig in ihren Grundrechten beeinträchtigen.« »Das Grundgesetz schützt uns demnach gerade so lange vor dem Staat, bis der Staat meint, uns vor uns selbst schützen zu müssen. Na danke, auf so ein Grundgesetz kann ich verzichten. Woher wissen Sie den ganzen Kram eigentlich? Sie stinken doch nach Nichtraucher.« »Ein Polizist sollte sich ein bisschen mit dem Gesetz auskennen.« Sie lachte höhnisch. »Was Bullen über Grundrechte wissen, ist höchstens, wie man sie aushebelt. Jedenfalls klingen Sie verdammt juristisch. Sind Sie etwa einer?« »Ja.« Wie war ihm das jetzt rausgerutscht? Zwar gründeten seine Vernehmungserfolge darauf, ein respektvolles Vertrauensverhältnis zum Täter zu schaffen, aber private Dinge auszuplaudern, gehörte definitiv nicht zur Methodik. Was sollte es, Frau Heydt war ohnehin ein Sonderfall, das ahnte er bereits. Und wo er schon begonnen hatte, gegen Prinzipien zu verstoßen, konnte er gleich mit der Hausordnung weitermachen. »Von mir aus dürfen Sie eine rauchen, zeigen wir es den Verwaltungsheinis. Ich habe allerdings keinen Aschenbecher.« Anna machte nicht viel Federlesens. Sie kippte die Zigaretten aus der Schachtel, schon besaß sie einen Aschenbecher. Sie hatte sich gerade eine Zigarette angesteckt, als die Tür aufging. Engel stand auf und reichte dem Eintretenden die Hand. »Herr Dr. Strecker, welch eine Überraschung!« Welch eine unangenehme Überraschung. »Engel, K13. Freut mich.« Er hatte den neuen Staatsanwalt bereits kennengelernt, nur aus der Ferne, aber gut genug, um sich nicht zu freuen. Strecker war Bayer und hatte sich aus unerfindlichen Gründen in Frankfurt beworben. Er erinnerte Engel an Edmund Stoiber: blond, blass, dürr. Ein Bayer mit preußischem Stechschritt. Strecker hatte seinen Einstand gestern mit einem Umtrunk gefeiert und eine kurze, schneidige Ansprache an seine »Hilfsbeamten« von der Polizei gehalten. »Sie führen eine Vernehmung durch, Herr Kollege?«, erkundigte sich der Staatsanwalt. Jovialer Ton, schmallippig präsentiert. »Nun, dann lassen Sie sich nicht aufhalten.« Er schob ein oberflächlich aufgelegtes Lächeln hinterher – Garnitur, wie Petersilie auf einem toten Fisch. Engel wartete, dass Strecker den Raum verließ, doch stattdessen setzte er sich auf einen Stuhl im hinteren Eck des Raums. Engel hatte ihn jetzt im Rücken. »Fahren Sie fort, Herr Kollege. Kurze Frage vorab. Hier herrscht Rauchverbot, nicht wahr?« Engel versuchte es mit Schwerhörigkeit. »Nicht wahr, Herr Kollege?« »Ja, nur …« »Dann soll die Dame schleunigst die Zigarette ausmachen.« Anna, die sich gerade etwas entspannt hatte, spürte den Zorn wie Magma aufsteigen. Sie zog an der Zigarette, sah in die rote Glut und drückte sie aus. Besser, den Zorn unten zu halten. Sie schob ihre Hände unter die Oberschenkel. »Kehren wir zu Ihrer Scheidung zurück, Frau Heydt. Könnte Ihr Exmann hinter der Sache stecken?« Es sollte eine letzte, unverfängliche Frage sein. Engel brauchte keinen Zuhörer bei seiner Vernehmung und bestimmt keinen vom Schlag dieses Staatsanwalts, schon gar nicht, wenn Beweise und Bauchgefühl dermaßen auseinanderliefen. Wie wenig Freude er an Dr. Strecker haben würde, wusste sein Bauch bereits. Doch er bekam keine Antwort. Anna konnte sich einfach nicht mehr auf ihn konzentrieren. Er war unwichtig geworden angesichts des Gerippes im Hintergrund, dessen Fischaugen nasskalt wie die Tiefsee rüberglotzten. »Mir scheint, Sie brauchen eine Pause«, sagte Engel. »Wir sollten für heute Schluss …« »Moment.« Der Staatsanwalt erhob sich. »Wir wollen uns doch an die Verantwortlichkeiten halten, Herr Kriminaloberkommissar.« Das Leutselige war einer kühlen Unterweisung gewichen. »Wann die Vernehmung beendet ist, entscheide ich. Sind wir uns da einig?« Engel bewegte unbestimmt den Kopf, was für Zustimmung halten mochte, wer wollte. Strecker wollte. »Dann erstatten Sie bitte Bericht. Ermittlungsgegenstand?« »Ein Sexualdelikt.« Engel schwieg, als wäre alles gesagt, doch auch beim Schweigen saß der Staatsanwalt am längeren Hebel. »Verdacht auf Geschlechtsverkehr mit einem Minderjährigen.« »Beweise? Indizien?« »Ein Video.« »Und die Frau?« »Als Zeugin vernommen.« Strecker blickte zum Fernseher, vor dem der Rekorder blinkte. »Dann lassen Sie uns das Material mal gemeinsam anschauen, Herr Kollege.« Plötzlich wieder lauwarme Kollegialität? Ein Wechselblütler, der Mann. Anna konnte kaum noch an sich halten. Blanker Hass überflutete sie, während sie mit ansehen musste, wie dieser Strecker die Bilder in sich aufsog: sie beim Ficken, nein, nicht sie, das war sie nicht! Aber es sah nach ihr aus, vollkommen, bis zu den schwarz lackierten Fußnägeln. Sie war es und war es nicht, und dieser Wichser sah zu. »Ein Fall schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, richtig, Herr Kriminaloberkommissar? Eines ist mir allerdings schleierhaft. Wieso vernehmen Sie die Frau als Zeugin? Entweder stimmt mit meinen Augen etwas nicht oder es besteht nicht der geringste Zweifel an der Identität der Täterin.« Was sollte Engel sagen? Dass sein Bauchgefühl nicht zum Video passte? Strecker würde ihn zur Magenspiegelung schicken. »Wurde das Video auf Manipulationen untersucht?« Ja, ohne Befund, musste Engel einräumen. »Wieso gestehen Sie dann nicht einfach?« Der Staatsanwalt streckte Anna seinen Kopf so plötzlich entgegen, dass sie einen Satz zurückmachte und samt Stuhl zu Boden ging. Strecker setzte nach, beugte sich über den Tisch und starrte sie von oben aus seinen Fischaugen an. »Angesichts der erdrückenden Beweislast vernehme ich Sie hiermit als Beschuldigte.« Er spukte eine Rechtsbelehrung aus und forderte sie auf, ein Geständnis abzulegen. »Schalten Sie das Aufzeichnungsgerät ein, Herr Kriminaloberkommissar!« Anna rappelte sich auf die Knie hoch. »Ich habe nichts zu gestehen, du …« »Ach, Sie haben nichts zu gestehen?« Schlagartig zog Fischauge ein Knie auf den Tisch und beugte sich noch weiter vor. »Sie müssen gar nichts gestehen. Hier dürfen Sie sogar lügen, so nett sind wir zu Ihnen. Wir möchten Ihnen gar nicht mit der Bitte um ein Geständnis zur Last fallen, wo kämen wir da hin. Wir brauchen es auch gar nicht, schließlich haben wir das Video.« »Ich bin das nicht auf dem Video!«, brüllte sie. Was Besseres fiel ihr nicht ein. »Jeder hat einen Doppelgänger, jemanden, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht. Ich bin das nicht, kapiert? Und ich will jetzt gehen!« Engel wusste schon, was der Staatsanwalt nun fragen würde. Und dann müsste er bestätigen, dass es sich beim Tatort um die Wohnung von Frau Heydt handelte. Sie hatte den Raum auf dem Video ja selbst identifiziert. Doch Strecker stellte die naheliegende Frage nicht. Stattdessen informierte er Engel, die Beschuldigte sei umgehend einer medizinischen Untersuchung zuzuführen. Da der missbrauchte Junge von hinten in die Beschuldigte eingedrungen sei, läge der Vollzug des Analverkehrs nahe, worauf auch der Titel »Muttis Liebling ist im Arsch« hindeute. »Um dieses verschärfende Tatmerkmal aufzuklären, ordne ich gemäß Paragraf 81 a, Absatz eins und zwei, und Paragraf 81 d Absatz eins, Satz eins StPO an, den Anus der Frau ärztlicherseits in Augenschein zu nehmen.« »Dazu bedarf es einer richterlichen Anordnung.« »Unsinn. Die Beschuldigte weiß jetzt von der Beweiswirkung möglicher Penetrationsspuren am Anus. Sie könnte also gegebenenfalls durch neuerlichen analen Vollzug alte Spuren zu überdecken versuchen.« Das war an den Haaren herbeigezogen! »Die Verzögerung der Maßnahme könnte demgemäß den Untersuchungserfolg gefährden. Folglich steht mir die Anordnung als Staatsanwalt zu. Habe ich mich unmissverständlich ausgedrückt?« Statt Engel antwortete Anna. »Du Haderlump! Du verdammter Haderlump!« Sie stürmte auf die Tür zu, kam aber nicht an. Der Staatsanwalt hatte das noch am Boden befindliche Bein angehoben und sie landete schon wieder auf allen vieren. »Ich ordne hiermit die vorläufige Festnahme wegen Verdunklungsgefahr an.« Zähneknirschend tat Markus Engel, wie ihm befohlen. Anna fand sich hinter Gittern wieder, wenngleich nicht im Gefängnis. Es war von Hafträumen im Polizeipräsidium die Rede gewesen, doch nun hockte sie in einer Ausnüchterungszelle, in solch einem Kachelkabinett hatte sie schon mal logiert. Offenbar waren auf die Schnelle weder ein standesgemäßes Plätzchen noch eine Ärztin oder ein Haftrichter aufzutreiben gewesen. Vorausgesetzt, es hatte jemand versucht. Während sie im Beisein einer geschniegelten Type namens Degenhart »erkennungsdienstlich behandelt« worden war, hatte Engel sie über ihr Recht belehrt, einen Anwalt anzurufen – zum Ärger von Fischauge. Sie war nicht darauf eingegangen. Prozessor überlastet, Programm reagiert nicht. Der weiße Raum – eine Matratze am Boden diente als Bett und ein Loch im Boden als WC – besaß leider keine Minibar. Dabei hätte sie eine Maxibar gebraucht! Ihr Verlangen, sich diesen Wahnsinn mit Schnaps aus dem Kopf zu spülen, wuchs von Minute zu Minute. Nur kurz, in der ersten Stunde, versuchte sie zu ergründen, was hinter dem Wahnsinn stecken mochte. Sie hatte keine richtigen Feinde. Selbst ihr Mann hatte es bei einem Tritt im Vorübergehen belassen. Weit und breit niemand, der sich die Mühe gemacht hätte, sie in solch eine Geschichte zu verstricken. Es konnte sich auf dem Video wirklich nur um eine Doppelgängerin handeln. Eine Verwechslung. Halt, nein, das war auch ihre Wohnung auf dem Bild. Einfach nicht zu fassen. Sie hätte jetzt toben und die Wände hochgehen müssen. Doch ihr Zorn zog den Schwanz ein angesichts des schwarzen Wirbels, der sie gepackt hatte. Sie starrte auf das kleine vergitterte Fenster und erinnerte sich an Rilkes Gedicht vom Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe, So müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe, Und hinter tausend Stäben keine Welt. Sie schlief ein. Während Annas Bewusstsein im Nachtschatten verschwand, betrat Markus Engel seine Küche. Er wohnte im Frankfurter Stadtteil Bornheim, nahe der Berger Straße. Seine 3Zimmer-Altbauwohnung strahlte aufgeräumte Gemütlichkeit aus, von der kleinen Arbeitsküche mit ihren hochglanzweißen Fronten abgesehen. Markus legte ein Rezept auf die Buchstütze, das weder seines Könnens noch seines kleinen Maschinenparks zur Pralinenherstellung würdig war. Nur eine Fingerübung zum Ablenken und Entspannen nach einem Arbeitstag, der ihn aufgerieben hatte. Vielleicht eignete sich der Whisky nicht nur als Zutat? Ja, er hatte sich einen Schluck verdient. Ausnahmsweise. Nachdem Ursula, seine Frau, gestorben war, hatte er abends ziemlich gebechert, anfangs eine Flasche Wein, später zusätzlich ein, zwei, manchmal auch drei Glas Whisky. Aber der Alkohol hatte sein Gefühlschaos nur gedämpft, nicht gelöst. Nicht dass sie tot war, setzte ihm zu, sondern seine Erleichterung, dass sie nicht mehr da war. Er hatte ihr wirklich nichts Böses gewünscht, schon gar nicht den Tod – trotz ihrer späten Beichte: Sie hatte ihn vielleicht beim Sex mit Aids angesteckt. Sie selbst hatte sich beim Sex mit einem anderen Mann angesteckt. Vermutlich hatte sie ihn bei den vielen Geschäftsreisen kennengelernt, die sie als PRManagerin eines expandierenden Backwarenkonzerns unternommen hatte. Wenn neue Filialen eröffnet wurden, war sie oft tagelang unterwegs gewesen. Unerheblich. Er hatte ihre Beichte mit einer Resignation zur Kenntnis genommen, die keine Erklärungen verlangte, weder nach dem Wer noch nach dem Wann und Wie-lange und schon gar nicht nach dem Warum. Warum schon? Weil er etwas an ihr geliebt hatte, das sie an ihm vermisste, eine leichtsinnige Lebenslust, die er im Streit mal die Seichtigkeit des Seins genannt hatte. Am Anfang ihrer Beziehung hatte sie seine Ernsthaftigkeit exotisch gefunden. Anfangs war er ihr auch gelegentlich gefolgt, um gemeinsam im Seichten zu planschen. Später hatte er sich dabei linkisch und fehl am Platz gefühlt und es schließlich aufgegeben. Von da an hatte seine Ernsthaftigkeit Ursula nur noch gelegentlich beruhigt und meistens bedrückt. Deswegen verstand er sie, zumindest bis zu dem Punkt, an dem sie ihn ihre Abenteuerlust mit Lebensgefahr bezahlen ließ. Dafür verabscheute er sie allerdings. Er wollte sich von ihr trennen, doch sie litt wie ein geprügelter Hund, den man nicht einfach vor die Tür jagen konnte. Ehe er sich gesammelt hatte, war die Krankheit bei ihr ausgebrochen. In guten, wie in schlechten Zeiten. Er hatte nicht mit derart schlechten Zeiten gerechnet. Sie brauchte ihn jetzt, dabei hätte er nur zu gern das Weite gesucht. Er pflegte sie nach allen Regeln der Kunst. Bis zum letzten Atemzug. Danach war er nur noch froh, es hinter sich zu haben. Endlich! Bald raubte ihm die Scham über seine Erleichterung den Schlaf. Er begann, sich bettreif zu trinken. Bis zu jenem Freitagmorgen, als er nicht mehr hochkam. Er nahm sich frei, legte sich übers Wochenende trocken und verordnete sich eine längere Abstinenz, die er mit Beistand von Ritter Sport durchhielt. Er schob die Gedanken beiseite, schenkte sich einen Whisky ein und begab sich ans Werk. Zunächst goss er eine halbe Tasse Tee in die Sahne, mit der die Pralinen gefüllt würden. Er war beim letzten Arbeitsschritt angelangt, als es um kurz nach zehn an der Tür klingelte. Um diese Uhrzeit konnte es eigentlich nur einer sein: sein Bruder Tom. Er hatte mit den Besuchen nach Ursulas Tod begonnen und hielt sie zu Markus’ Verwunderung bis heute durch. Früher war Tom viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen, um auch nur anzurufen. »Na, Alter, stör ich?« »Hallo, Tom. Nein, du störst nicht. Vorausgesetzt, du nennst mich nicht noch mal Alter.« »Jo, Bruderherz. Obwohl, du bist ja der Ältere.« »Ja, ja, kleiner Bruder. Jetzt komm endlich rein.« Tom schleuderte seine Jeansjacke grob gezielt in Richtung Garderobenhaken und folgte Markus in die Küche. »Auch ein Glas Whisky?« Tom nickte. »Schon wieder Pralinen?« »In der Schale auf dem Tisch sind welche, mit Birnenmousse gefüllt.« »Nee, nix für mich. Soll ich dir eine geben?« »Nicht im Moment.« Als Markus eine Schranktür öffnete, um eine große Blechdose herauszunehmen, sah Tom, wie viele sich darin stapelten. »Sind die für Pralinen?« »Die sind schön, nicht? Mit Motiven der Olmeken. Ist ein uraltes Volk, das im heutigen Mexiko gelebt hat.« »Alle für Pralinen?« »Was macht die Arbeit?« »Menschenskinder, für wen machst du die denn alle? Wer soll die denn essen?« »Besucher.« »Klar, du kriegst ja ständig Besuch.« Er hielt Markus die Schale hin. »Komm schon, nimm dir eine!« Markus drehte sich genervt weg. »Die sind was ganz Feines, nichts für nebenbei.« »Etwas ganz Feines!«, äffte Tom ihn nach. »Und ich dachte, es geht um popelige Schokolade.« »Von wegen! Wusstest du, dass die Olmeken schon vor dreieinhalbtausend Jahren Kakaobäume gezüchtet haben? Im 16. Jahrhundert kamen die Bohnen als ›Cacahuatl‹ nach Spanien. Caca klang allerdings nicht so gut, da hat man sie in Chocolatl umgetauft. Der Legende nach …« »Hör schon auf, interessiert mich nicht die Schokobohne. Dein ganzes Getue ändert nichts an den Tatsachen: Schokolade ist und bleibt – Fett!« Er betrachtete Markus kritisch auf Hüfthöhe. »Du musst was für dich tun.« »Tom, du fängst an zu nerven!« »Ja, du hast recht, bitte entschuldige. Okay? War nicht bös gemeint, okay? Ich habe nur gedacht, wir könnten mal zusammen joggen.« Markus versuchte, den Bauch, der unschön das T-Shirt füllte, mit einer gleitenden, unmerklichen Bewegung einzuziehen. »Bin jetzt drei Mal die Woche im Fitnessstudio. Zweieinhalb Kilo sind runter. Die Sache kommt schon wieder ins Lot.« »Fitnessstudio? Du hast den Günthersburgpark vor der Nase, da kann man doch wunderbar laufen. Das ist doch Fun!« »Für mich ist das Arbeit. Und jetzt wechseln wir das Thema.« Wie er diesen Bauchansatz hasste! Nervös griff er nach der Ritter Sport, die neben der Spüle lag, zuckte aber zurück, als er bemerkte, wie Toms Augen seiner Bewegung folgten. »Was gibt’s denn Neues von der Arbeit?« »Es sind Entlassungen angekündigt. Nur werden die ja wohl nicht bei den Flugzeugmechanikern anfangen, da geht’s schließlich um Sicherheit. Ach, wer weiß. Jedenfalls hocken alle auf heißen Kohlen. Komisch, nicht? Da werden irgendwo in Idaho Häuschen mit faulen Krediten finanziert und plötzlich ist hier mein Job in Gefahr. Dabei weiß ich nicht mal, wo Idaho liegt.« »Hm. Gibst du mir mal das Handtuch?« »Du machst einen gestressten Eindruck.« »War ein anstrengender Tag. Du hast auch schon mal frischer ausgesehen.« »Bin nicht ganz auf der Höhe.« »So?« Eigentlich ging es Tom aus Prinzip gut. Was hatte ihn denn von Wolke sieben geholt, auf der er gewöhnlich schwebte? Markus wusste es nicht. Er ahnte es nicht einmal. Tom tat wirklich sein Möglichstes, es zu verbergen. Ebenso verbarg er, wozu seine Besuche dienten. Er spielte nur »guter Bruder« und das ziemlich schlecht, wie er selbst wusste. Geschmeidig wie ein Storch im Sambakurs. Doch es half nicht, da musste er durch. Auch heute tröpfelte das Gespräch wie unter Prostatabeschwerden dahin. Obwohl sie sich eigentlich blendend hätten verstehen müssen, hatten sie nie eine gemeinsame Ebene gefunden. Als er Markus nach dem Mindestpensum von einer Stunde zum Abschied unbeholfen die Hand auf die Schulter legte, waren die Pralinen und die Tafel Ritter Sport verschwunden. Die Pralinen in der Schachtel mit den Ol…irgendwas-Motiven, die Ritter Sport in seinem Bruder. Tom verbiss sich einen Kommentar. Anna erwachte einige Minuten oder Stunden später, sie wusste es nicht. Wo bin ich? Das war nicht ihr Schlafzimmer. Dann fiel sie die Erinnerung wie ein Panther an. Sie sprang auf. Du musst dich wehren! Sie überfiel eine Unruhe, die für diese Zelle viel zu groß war. Etwas musste sie doch tun können! Nach einigen Liegestützen begann sie zu marschieren. Vier Meter hin, vier Meter her. Hin und her, hin und her und ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm, und vorwärts, rückwärts, seitwärts, bei. Und eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht. Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm … Sie marschierte, bis die ersten Lichtstrahlen durch die eisernen Nadelstreifen vorm Fenster in die Zelle drangen. Sie hatte Schritt für Schritt Energie getankt. Zeit zu handeln! Sie hämmerte gegen die schwere Eisentür. »ICH-WILL-SO-FORT-MEI-NEN-AN-WALT-SPRE-CHEN!« … »ICH-WILL-SO- FORT-MEI-NEN-AN-WALT-SPRE-CHEN!« Sie gab keine Ruhe, bis schließlich ein Schlüssel im Schloss kratzte und eine Omi in Uniform die Zellentür öffnete. »Schreien Sie bitte nicht das ganze Haus zusammen!« »Ich will sofort meinen Anwalt sprechen!« »Der schläft doch um diese Uhrzeit.« »Ich will …« »Wer ist denn Ihr Anwalt?« »Ich … Mein Anwalt?« »Sie haben gar keinen, nicht wahr?« Es klang eher nach Omi als nach Uniform, beinahe mitfühlend. »Wissen Sie was? In zwei Stunden beginnen die Bürozeiten. Dann bringe ich Ihnen das Telefonbuch, versprochen. Wenn Sie nun bitte Ruhe geben.« »Ja, ja, aber ich brauche auch einen Tampon!« »Ich habe einen dabei, bringe ich Ihnen sofort.« Omis, die immer noch einen Tampon brauchten? Die Frau musste kurz vor der Pensionierung stehen – und konnte noch Kinder kriegen? Musste man jetzt damit rechnen, dass Tanten und Onkels jünger waren als ihre Nichten und Neffen? Chaos allenthalben. Nicht zum ersten Mal überfiel sie eine heimliche Sehnsucht nach längst vergangenen Zeiten, in denen Enge und Strenge die Mühsal der Selbstbestimmung linderten. Damals hätte vielleicht sogar eine Anna Heydt wie von selbst ihren Platz im Schoße der Gemeinschaft gefunden; vorausgesetzt natürlich, man hätte sie nicht vorher als Hexe verbrannt. Eine Welt, in der Omis Tampons trugen, machte es einem jedenfalls auch nicht leicht. Nach gefühlten zwei Wochen erschien die Omi wieder und schleppte auch gleich einen Anwalt an. Ein Mann in tadellos sitzendem Zweireiher. Sah teuer aus. Er nickte Omi zu, die daraufhin die Tür schloss. »Guten Tag, Frau Heydt, mein Name ist Lexied, ich bin Strafverteidiger.« Er reichte ihr eine mit Doktortitel geschmückte Visitenkarte. Dr. Lexied deutete auf die Matratze am Boden. »Lassen Sie uns Platz nehmen.« Eine tiefe Stimme mit einem heiseren Unterton. »Ihre Akte konnte ich ohne Ihr Mandat natürlich nicht einsehen, Frau Heydt, doch im Wesentlichen weiß ich Bescheid. Gut genug zumindest, um Ihnen zu raten, unverzüglich gegen die Anordnung der körperlichen Untersuchung vorzugehen. Da geht es gewissermaßen um Minuten.« »Und wie bin ich jetzt an Sie geraten? Hat die Omi Sie angerufen?« »Die Omi?« »Die Polizistin oder was immer die ist.« »Ach so, nein. Ich habe bei Gericht Kontakte, Frau Heydt.« Tatsächlich stammte der Tipp von Engel, unter der Hand natürlich. Engel war ein zäher Ermittler, aber keiner aus dem großen Rudel der Bluthunde. Und jetzt meinte er offenbar, Frau Heydt brauche einen fähigen Verteidiger, um sich eines unfairen Staatsanwalts zu erwehren. »Kontakte sind wichtig, denn auf diese Weise erfahre ich frühzeitig von den spannenden, den herausfordernden Fällen.« »Sie meinen wohl hoffnungslose.« »Manche meiner Kollegen würden wahrscheinlich zustimmen. Aber …« »Aber Sie haben’s drauf.« »Was der neue Staatsanwalt mit Ihnen anstellt, ist nicht in Ordnung. Man sollte ihm von Anfang an seine Grenzen aufzeigen. Denken Sie nicht ebenso?« »Doch, schon. Nur …« »Zumindest werden Sie wissen, dass Sie hier raus wollen.« »Ja, klar. Trotzdem.« »Ich will mich Ihnen nicht aufdrängen, Frau Heydt.« Anna wusste nicht, was sie von ihm halten sollte. Er wirkte kompetent, das schon. Übermäßig sympathisch wirkte er dagegen nicht. Aber kam es darauf an? Wer erwartete denn von Kampfhunden, sympathisch zu sein? Die hatten die Zähne zu zeigen und zuzubeißen, und das traute sie dem Mann trotz des höflichen Getues zu. »Einen Rat will ich Ihnen aber geben: Lassen Sie sich einschlägige Referenzen zeigen. Für einen Feld-Wald-und-Wiesen-Anwalt ist Ihr Fall zu schwierig.« Er griff nach seiner Ledertasche. »Halt, Moment noch. Und Sie haben einschlägige Referenzen?« »Ich bin ein erfahrener Strafverteidiger.« »Sie sehen nach schweineteuren Honoraren aus und ich hab kaum Kohle.« Er entgegnete mit einem Lächeln, er werde ihr nicht mehr abknöpfen als jeder beliebige Kollege. »Um das Honorar müssen Sie sich keine Sorgen machen.« »Und worum dann?« »Wie Sie aus dem Schlamassel herauskommen.« Anna dachte nach. Ein Anwalt, bei dem man sich ums Honorar nicht sorgen musste? Das klang so wahrscheinlich wie ein Kredit ohne Kleingedrucktes. Aber welche Wahl hatte sie schon. Sie nickte und unterschrieb die Mandantenvollmacht. »Darf ich Ihnen eine Zigarette anbieten, Frau Heydt?« »Sie haben welche? Irgendwie passt Rauchen nicht zu Ihnen.« »Gut beobachtet.« Er hielt ihr ein silbernes Zigarettenetui hin. »Sind für meine Mandanten. Viele wissen zu schätzen, dass ich immer einen kleinen Vorrat dabei habe.« Sie ließ sich Feuer geben und nahm einen tiefen Zug. Dann schloss sie die Augen und versuchte, das Unerklärliche zu erklären. Dr. Lexied wartete vor dem Zimmer von Ebru Öztürk, der Haftrichterin. Währenddessen überlegte er, was in den neuen Staatsanwalt gefahren war, seiner Mandantin derart zu Leibe zu rücken. Ihren Anus zum Nabel der staatsanwaltlichen Ermittlungen zu erklären und sie überdies vorläufig festzunehmen, lag jenseits der harten Bandagen, die zum Geschäft gehörten. Glaubte Strecker, seine Karriere auf diese Weise voranzubringen? Öztürk jedenfalls würde nicht mitspielen. Man musste ihr nur verdeutlichen, wie weit sie sich aus dem Fenster lehnte, wenn sie Strecker folgte. Sie war Richterin auf Probe und erschrak förmlich vor Fällen, die sie abseits der bekannten Pfade in den Paragrafendschungel führten. Da kam sie auch schon, in Begleitung eines mit hoheitlicher Miene auf sie einredenden Mannes, bei dem es sich nur um den Staatsanwalt handeln konnte. Einen Schritt hinter ihnen ging Engel. Richterin Öztürk bat die Herren in ihr Büro. Die Inhaftierte wurde gerade ins Gericht überstellt und musste jeden Moment eintreffen. Je eher, desto besser. Zwischen Anwalt und Staatsanwalt baute sich bereits eine Gewitterfront auf. Nur nicht dazwischengeraten! Wer Öztürk hieß, was »der wahre Türke« bedeutete, und es trotzdem auf eine deutsche Richterbank geschafft hatte, sollte sich aus allem raushalten, fand sie. Zumindest solange man dort nur auf Probe saß. Endlich klopfte es an der Tür und ein Uniformierter führte die Beschuldigte herein. Kurze Zeit später befand sich Anna wieder auf freiem Fuß. Sie vermochte ihr Glück kaum zu fassen: Lexied hatte keineswegs übertrieben, was sein Können betraf. Jeden von Dr. Arschloch Strecker salbungsvoll abgesonderten Scheiß hatte er mit der klinischen Sachlichkeit eines Proktologen seziert. Schließlich hatte Strecker, wie von einem Wahn befreit, klein beigegeben. Natürlich wusste Anna, dass sie damit noch längst nicht aus dem Schneider war. Aber sie hatte jetzt einen Anwalt an ihrer Seite, der sein Geschäft verstand. Und der womöglich netter war als zunächst gedacht. Morgen wollte er sie sogar zur Arbeit fahren – auf dem Weg könnten sie gleich ein paar Dinge durchsprechen. Sehr zuvorkommend! Sie rief Triebel an und meldete sich wegen Bauchschmerzen für heute krank. Was ihr die Bauchschmerzen bereitete, erzählte sie natürlich nicht. Am nächsten Vormittag, sie hatte noch fast zwei Stunden, bis Lexied sie abholen käme, ging Anna zu Mutter Beimer. Die Beimer’sche Wohnung lag genau unter ihrer, war jedoch anders eingerichtet, mehr Spitzendeckchen auf den Tischen, weniger Bierdosen auf dem Boden. »Tja, da bin ich schon wieder. Hab ich das richtig gesehen, dass Sie ein Notebook ihr Eigen nennen?« »Ja, Frau Heydt. Möchten Sie es sich leihen?« »Vielleicht. Wenn man damit drahtlos ins Netz kommt. Mit Funk, verstehen Sie?« Es klang wie »du wissen, was ist?«, wurde Anna sich bewusst, doch Mutter Beimer verzog keine Miene. Wahrscheinlich verstand sie sowieso nur Bahnhof. »Natürlich. Ich habe ein Wi-Fi-Netzwerk mit neuer Fritz-Box, die Version mit FünfGigahertz-Frequenz!« »Aha.« »Ja, Frau Heydt, das Notebook – hat Funk. Sie können es gern mit hochnehmen.« »Klasse. Jetzt gleich?« »Gerne. Ich habe WLAN ausgeschaltet, müssten Sie aktivieren.« Mutter Beimer brachte ihr das Notebook und Anna probierte es in ihrer Wohnung gleich aus. Das blöde Ding funktionierte nicht! Verärgert stieg sie die Treppe hinab. »Ich krieg keine Verbindung«, beschwerte sie sich. »Ach, ich hab auch an den WPA-Einstellungen rumgefummelt, wahrscheinlich deshalb.« »Wipiäj?« »Ein Verschlüsselungsverfahren. Man möchte ja nicht, dass jeder zuschauen kann, womit man gerade zu schaffen hat.« Eine Anspielung? Möglicherweise hatte jemand im Haus was mitbekommen. Hier konnte man zwar verrecken, ohne vermisst zu werden, aber wenn es was auszuspionieren gab, hatten die Wände plötzlich Ohren und die Türen Augen. Dann pulsierte in diesem Steinklotz allgegenwärtige Neugierde. »Wissen Sie was, Kindchen? Wenn Sie sich bei mir ins Wohnzimmer setzen, sind Sie ungestört, weil: ich bin noch ein Stündchen in der Küche beschäftigt. Aber ich könnte Ihnen helfen, wenn es Probleme gibt. Was meinen Sie, soll ich uns einen Malventee aufsetzen?« Obwohl ihr der Gedanken nicht gerade behagte, Mutter Beimer könne ihr ein Blickchen über die Schulter werfen, während sie auf Deep Tube surfte, nahm sie das Angebot an, exklusive Malventee. Im Wohnzimmer, Stilrichtung »Röhrender Hirsch«, schwebte ein riesiger, spiegelglatter Ultraflachbildschirm vor der Wand – wie ein gestrandetes UFO, das die Schwerkraft dieser Wohnung aus den Tiefen des Weltalls gesaugt hatte. Sie lupfte das Hosenbein und zog den Flachmann aus dem um die Wade gewickelten Futteral, dann begann sie die Recherche. Eine Stunde lang klickte sie sich stur die Website rauf und runter. Sie sah Schweinereien am laufenden Meter, die sie jedoch nicht weiter kratzten, außer der Sache mit der Frau und dem Schäferhund. Mit der dem Grauen eigenen Faszination betrachtete sie das Bild, das auf ein Video verlinkte. Sie klickte es unwillkürlich an, aber um in den Genuss dieser besonderen Schweinerei zu gelangen, musste man blechen. So war ihr die Hundenummer zum Glück erspart geblieben. Die Ausbeute ihrer Recherche belief sich schließlich auf nahezu nichts. ›Ihr‹ Video hatte sie gefunden und eine im Impressum der Website genannte Adresse des Betreibers, der angeblich in Rumänien hauste. Sie lud das Video herunter, sandte es an ihre E-Mail-Adresse und löschte die Daten vom Rechner. Sie ging in die Küche. »Schon fertig, Frau Heydt?« Mutter Beimer rollte gerade Teig aus. »Ihre Daten haben Sie gelöscht?« »Haben Sie vielleicht ein Bier?« Nein, Bier habe sie leider nicht und ein Likörchen sei wohl nicht nach Frau Heydts Geschmack. Doch sie hatte einen Obstler und schenkte großzügig ein. »Wieso kennen Sie sich mit Computern aus?« »Das fing an, da hat mir mein Schwiegersohn sein altes Notebook geschenkt, ein netter Mensch, müssen Sie wissen. Ein Araber – aber kein Bin Laden!« Anna nahm einen Schluck, bevor ihr eine Bemerkung rausrutschen konnte. Während Mutter Beimer dem Teig zusetzte, erzählte sie, wie sie »das Blechding« langsam zu interessieren begonnen hatte. Es sei gewesen, wie eine Fremdsprache lernen. Sie hatte sich einige selbst beigebracht, um im Urlaub mit den Einheimischen sprechen zu können. »Mein Mann und ich, wir haben viel von Europa gesehen. Doch mein Lieblingsland ist immer die Costa Dorada geblieben.« »Lieblings…land?« »Spanien: gut 45 Millionen Einwohner mit Balearen, Kanaren und ein paar Inseln vor der nordafrikanischen Küste«, sie ratterte es wie eine Nähmaschine herunter, »und mit Ceuta und Melilla an der marokkanischen Küste und …« »Ja, ja, schon verstanden.« »Ich kenne mich halbwegs aus, Kindchen, und weiß, dass die Costa Dorada kein Land ist. Seien Sie großzügig. Ich bin nur eine einfache Frau, der mal so Sätze rausrutschen. Aber ich bin nicht dumm, Frau Heydt.« Anna nickte großzügig und Mutter Beimer stellte wieder auf Plauderton um. Ob Frau Heydt das Örtchen Cambrils an der Costa Dorada kenne, in der Nähe von Tarragona, also schlemmen könne man da. Vor allem im Roca d’en Manel. Also sollte Frau Heydt jemals in der Nähe sein, müsse sie da einfach hin und Fisch essen. »Ist gut, der Obstler, nicht? Noch ein Schlückchen?« Mutter Beimer schob das Backblech in den Ofen, entledigte sich des geblümten Hauskittels und bat Anna in »die gute Stube«. Aus einer Schranktür holte sie einen wuchtigen Aschenbecher aus braungestreiftem Achat und stellte ihn vor Anna, die unwillkürlich einen Blick auf ihre gelblichen Nikotinfinger warf. Sie zündete sich eine Zigarette an und hörte mäßig interessiert zu, was Mutter Beimer zu plaudern hatte. Es ging vor allem um Reisen, die sie mit ihrem Mann unternommen hatte, bis er sich am Tag seiner Pensionierung mit einem Herzinfarkt nicht nur aus dem Büro verabschiedet hatte. Danach war sie mit einer Freundin durch die Welt gezogen, bis die ebenfalls die letzte Reise angetreten hatte. Dieser Ausfall hatte ihren Reiseambitionen endgültig den Todesstoß versetzt, doch es schien sie nicht mehr zu kümmern. Sie habe ja das Internet, da knüpfe sie viele Kontakte. Anna spürte, wie gern Mutter Beimer aus dem Nähkästchen plaudern würde. »Ihr Ehrenwort, was ich Ihnen erzähle, bleibt unter uns, Frau Heydt? Kann ich mich darauf verlassen?« »Was soll die Frage? Ich kann nichts für das Ungeziefer und die Polizei, klar?« So habe sie das nicht gemeint! »Ehre ist doch von gestern, was sollen da noch Ehrenworte. Aber ich bin keine Klatschtante, das ist mal sicher.« Mutter Beimer nickte und berichtete von Kontaktbörsen, die sie besuche. Da lerne sie Männer kennen, mit denen sie chattete. Mutter Beimer auf Männerfang? Unverhofft sah Anna vor ihrem inneren Auge, wie Mutter Beimer im Schlafzimmer am Notebook saß, eine Mail las und die Hand in den Hauskittel gleiten ließ. Ihr gefiel die Vorstellung, nur die Details mochte sie sich lieber nicht ausmalen. »Und dann treffen Sie sich mit den Männern?« »Nein, ehrlich gesagt sind sie mir mittlerweile virtuell lieber. Ich bin auch eher in ausländischen Chatrooms unterwegs. Das ist mein Reiseersatz, verstehen Sie?« »Wissen Sie eigentlich wirklich so gut über Computer Bescheid?« Mutter Beimer öffnete eine Schranktür und wies mit stolzgeschwellter Brust auf eine Reihe von Büchern. »Alles mehr oder weniger gelesen! Anfangs stand ich natürlich davor wie, wie … »Ein i-Dötzchen.« »Den Ausdruck gibt es noch? Wie schön. Ja, ich stand davor wie ein i-Dötzchen, erster Schultag, alles fremd. Aber man kann alles lernen, nicht? Nachdem ich da einigermaßen durchgeblickt habe, war ich reif für mein erstes richtiges Notebook, das von meinem Schwiegersohn war ja nicht viel mehr als ein Taschenrechner. Der IBM X301, den Sie benutzt haben, ist meine neueste Anschaffung. Seit zwei Jahren leite ich übrigens einen Senioren-Computer-Klub. ›Alt & knackig‹, schöner Name, nicht?« »Besser als alt & nackig.« »Ähm, ja.« »Und so was macht Ihnen Spaß.« »Man kann ja nicht immer nur Sudokus lösen. Mal im Ernst. Es ist so faszinierend, mit dabei zu sein! Wir erleben gerade die erste Sekunde nach dem digitalen Urknall, hab ich gelesen. Und dass das Netz die Welt mehr verändert als die Dampfmaschine, schneller und radikaler. Und wir mittendrin, während dieses Universum expandiert. Während eine neue Welt entsteht.« »Neue Welt? Eine Kloake ist das. Da wird Dünnpfiff reingeschissen. Und fleißig reingewichst. – Tschuldigung.« Mutter Beimer trug es mit Fassung. Ihre Augen leuchteten wie vom Urknall selbst befeuert. »2008 hatten wir auf der Welt fast 500 Exabyte, also an digitalen Daten, das sind 500 Milliarden Gigabyte. Kann sich so natürlich keiner vorstellen, wie viel das ist. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, man könnte diese 500 Exabyte drucken und zu einem Buch binden. Wie dick wäre das Buch? Wenn Erde und Mond Buchstützen wären – würde es dazwischenpassen?« Anna schüttelte den Kopf. So, wie Mutter Beimer fragte, musste die Antwort wohl nein lauten. »Da haben Sie ganz recht. Es würde auch nicht zwischen Erde und Pluto passen. Pluto, der ganz am Ende! Um das Buch im Universum unterzubringen, braucht man den zehnfachen Abstand! Und 2012 sollen es schon 2.500 Exabyte sein, und dann immer so weiter, das geht auf wie ein Hefekuchen! Und wir machen das, Frau Heydt, auch Sie und ich! Das wächst mit unvorstellbarer Geschwindigkeit, viel schneller als eine Rakete fliegt.« Sie schmierte die Stimme mit einem Likörchen fürs Finale. »Stellen Sie sich das vor: In Cape Carneval …« »Canaveral.« »Genau. Also, da hebt eine Saturn ab und gleichzeitig wächst daneben ein Papierstapel – und er wächst schneller als die Rakete hochschießt!« »Ist so ein IBM-Teil nicht ziemlich teuer?« »Man muss schon ein Sümmchen auf den Tisch legen.« Das Geld sei kein Problem, weil: ihr Mann habe sehr ordentlich verdient. »Und wieso wohnen Sie dann hier?«, kam es ungefiltert aus Anna heraus. »Ach wissen Sie, Kindchen, wir sind einfache Leute. Das Geld haben wir lieber gespart. Unsere Tochter hat jetzt ein eigenes Häuschen in Bad Vilbel, verstehen Sie? Und wir sind ja auch viel gereist.« »Können Sie hacken?« »Sie meinen, in fremden Computern? Nein, das nicht. Ich weiß zwar ein bisschen was darüber, aber … Wieso, brauchen Sie einen Hacker?« »Vielleicht.« »Hat das mit der Polizei zu tun?« »Das geht Sie nichts an!« »Hören Sie, Frau Heydt. Ich habe Ihnen eine ganze Menge über mich erzählt und Sie haben aufmerksam zugehört. Also kommen Sie mir jetzt nicht so entrüstet.« Anna schaute verdutzt. Mit einer derart klaren Ansage hatte sie bei Mutter Beimer nicht gerechnet. »Die Polizei hat ein Video mit mir als Hauptdarstellerin. Haben die auf einer Website gefunden. Nur habe ich bei dem Dreh nicht mitgemacht. Ich muss rausfinden, wer dahintersteckt. Angeblich gelingt das den Bullen nicht. Das macht mich rasend! Wenn so ein Bild von mir in der Zeitung stünde, würde ich denen die Tür eintreten und einheizen, bis die mir ihre Quelle verraten. Nur funktioniert das im Netz nicht. Da geht’s ja zu wie bei Kafka, wenn nicht schlimmer. Das ist die Kehrseite Ihrer 500 Extrabyte.« »Exabyte.« »Ja, ja. Was da alles im Netz landet, sind eben keine Blätter, die ein Buch ergeben. Das ist ein gigantischer Strom loser Schnipsel. Nett zum Surfen, aber wehe, dich reißt eine Strömung mit. Dann kannst du bis zum Jüngsten Tag paddeln, ohne Land zu gewinnen. Wie Sie selbst gesagt haben: Es breitet sich immer schneller aus und wir merken gar nicht, wie wir den festen Boden unter den Füßen verlieren.« »Was wollen Sie denn machen? Ihn trockenlegen?« »Kanalisieren. Oder regulieren, was weiß ich.« »Dann werden Sie kanalisiert oder reguliert! Wollen Sie das denn? Sich zensieren lassen?« »Mich? Ich bin nicht das Internet! Wenn wer das Internet ist, dann Google und die andern Spanner. Und vielleicht nicht mal die. Vielleicht ist das Internet längst selbstständig.« Ein Satz aus ihrer kryptografischen Abteilung, den sie auf die Schnelle nicht entschlüsseln konnte. »Jedenfalls weiß die andere Seite fast alles über uns – und was wissen wir über die? Finden Sie das etwa gut? Wenn das nicht so abstrakt wäre, wenn die in natura kämen, um Ihren Schreibtisch zu durchwühlen, klopf, klopf, da sind wir, jetzt machen Sie sich mal nackig für uns – wären Sie dann noch genauso begeistert?« »Nein«, meinte Mutter Beimer, irgendwie ratlos angesichts dieses unvermittelten Redeflusses. »Keine Ahnung, ob das Verfahren demokratisch ist. Das Ergebnis ist jedenfalls totalitär«, setzte Anna noch eins drauf; sie musste sich ihren Frust mal von der Seele reden. »Du bist dem ausgeliefert. Der Betreiber der Website, von der ich geredet habe, sitzt angeblich in Rumänien. Das kannst du glauben oder nicht. Der kann genauso gut hier im Haus hocken. – Deshalb dachte ich, wenn Sie hacken könnten oder einen Hacker wüssten …« »Sie machen sich da leider falsche Vorstellungen. Ich bin keine Romanfigur, wo sich die Hausfrau mal eben als geniale Hackerin entpuppt. Ich kämpfe nur ein bisschen gegen die Langweile.« Plötzlich fühlte Anna eine tief sitzende Müdigkeit in sich. Sie breitete sich aus wie eine Sandwüste in der Trockenzeit, staubig und erstickend. »Ist auch egal«, murmelte sie. »Man kann vorwärtsmarschieren, wie man will, man kommt doch nirgendwo an.« »Vielleicht sollten Sie mal stehen bleiben, Kindchen«, antwortete Mutter Beimer. Anna war schon aufgesprungen und hörte es nicht mehr. »Herr Triebel! Herr Triebel!« Gesine Bembel stürmte ohne anzuklopfen ins Büro ihres Chefs. »Herr Triebel, des glaabe se net, mir habbe de Polizei im Haus! Die Heydt hat se uns … Also, die wolle weesche der Heydt, ich hab des immer schon komme gesehn, Herr Triebel, und jetzt habbe mers.« Ein Mann in dunkelblauem Zweireiher mit scharfen Bügelfalten tauchte im Türrahmen auf. Wegen des nichtssagenden Gesichts ließ sich das Alter schwer schätzen, Triebel tippte auf Anfang vierzig. »Dr. Strecker, Staatsanwalt. Sie sind hier der oberste Vorgesetzte?« »Triebel, Chefredakteur.« Er verspürte nicht das geringste Bedürfnis, redselig zu werden. Es ging also um Frau Heydt. Mal wieder. »Ich habe einen Durchsuchungsbeschluss gemäß Paragraf …« »Frau Bembel, vielen Dank.« Triebel wollte die Klatschtante nicht dabeihaben. »Wenn Sie bitte unseren Anwalt anrufen, er möge umgehend kommen. Ach, und bitte schließen Sie die Tür.« Bembel zog mit säuerlicher Miene ab. Vielleicht war der andere Mann gesprächiger, der hinten im Flur mit zwei Uniformierten rumstand. »Sie sinn aach von de Staatsanwaltschaft, Herr …?« »Engel. Nein, ich bin Polizist.« »Wie uffreeschend! Dann sinn beschtimmt Sie der Heydt uff die Schlisch gekomme.« Der Blödmann antwortete nicht. Stattdessen zog er ein Heftchen und einen Stift aus der Innentasche seines grauen Sakkos und notierte etwas. »Auf welche Schliche hätten wir Ihrer Meinung nach Frau Heydt kommen können, Frau …?« »Bembel. Äh …« Was denn, wollte der Polizist jetzt sie verhören? »Bei der Heydt muss mer ja immer uffpasse!« »Zum Beispiel?« »Tja.« Sie fühlte sich in die Ecke gedrängt. »Vielleicht hat se ebbes mitgehe lasse?« »Was denn?« »Mir hat alls emal ebbes in meiner Dasch gefehlt.« Es ging zwar nur um Kaugummis, aber was hieß denn ›nur‹? »Das ist interessant. Nur der guten Ordnung halber: Auf falsche Verdächtigung steht bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe.« Bembels schluckte. Zu ihrer Erleichterung traten Triebel und der Staatsanwalt aus dem Büro. »Ach, da sind die Herre ja schon. Und womit kann isch diene? Findet nun die Durchsuchung statt?« Strecker nickte. Er hatte mit den Einwänden des Chefredakteurs kurzen Prozess gemacht. Diesmal würde ihm niemand in die Quere kommen, nicht Lexied und erst recht nicht Engel. Strecker hatte ihn zum Termin bei Öztürk mitgenommen, um ihm eine Lektion zu erteilen. Und dann hatte er, mit Sicherheit zu Engels Freude, selbst den Schwanz einziehen müssen. Dieses Scharmützel hatte der selbst ernannte Beschützer von Witwen und Waisen gewonnen. Sollte er doch, der Kampf war noch gar nicht richtig eröffnet. Er blickte sich um, auf Engel musste man immer ein Auge haben, sah ihn aber nirgends. »Zeigen Sie mir jetzt bitte den Arbeitsplatz von Frau Heydt«, wandte er sich an Triebel. »Isch kann de Herr Staatsanwalt herumführe«, bot sich Bembel an. Das fehlte Triebel gerade noch. »Sie müssen hier die Stellung für uns halten. Sie haben unseren Anwalt angerufen?« Das hatte sie ganz vergessen. »Es war besetzt.« »Versuchen Sie es weiter. Wenn er …« – Nein, jetzt bitte keinen Eklat, dachte Triebel, als die unglückselige Frau Heydt im Flur erschien. Nein, bitte keine weitere Katastrophe, dachte Anna ihrerseits, als sie Strecker erblickte. Sie rannte zum Ausgang, vielleicht erwischte sie Lexied noch. Tatsächlich, sein Wagen hing an der Kreuzung zur Gutleutstraße fest. Sie rannte so schnell sie konnte. »Da oben … der Staatsanwalt … er ist oben … er nimmt mir die Arbeit weg … ich …« Sie hatte keine Puste mehr. »Steigen Sie ein, Frau Heydt.« Lexied sah sie eindringlich an und bat sie, sich zu beruhigen. Das sagte sich so leicht. Während er den Wagen zu einer Parklücke manövrierte, die gerade frei wurde, atmete sie tief durch. »Meine Arbeit, verstehen Sie denn nicht?« »Natürlich verstehe ich, Frau Heydt. Ich hätte mein Äußerstes gegeben, die Durchsuchungen abzuwehren, nur …« »Durchsuchungen? Wieso Plural? Wo denn noch?« »In Ihrer Wohnung. Warum haben Sie eigentlich nichts gesagt?« »In meiner Wohnung? Die Schweine müssen angerückt sein, als ich bei meiner Nachbarin war und … Scheißegal, sagen Sie mir lieber, warum Sie nichts dagegen tun, verdammt!« »Ich habe die Information erst in diesem Moment erhalten. Herr Engel hat mich zuvorkommenderweise angerufen. Ich wollte gerade einen Parkplatz suchen.« Während er den Wagen in die Lücke rangierte, fragte er Anna, ob sie mit Dr. Strecker bekannt sei. »Mit dem Lump?« Anna spukte symbolisch auf den Boden. »Dann verstehe ich nicht, was in ihn gefahren ist. Wie auch immer, jedenfalls hat er mich auf dem falschen Fuß erwischt.« »Ich dachte, Sie sind ein Spezialist für schwere Fälle.« »Letztlich spielt uns der Staatsanwalt in die Hände, denn er sucht nach Beweisen, die es nicht gibt.« »Aber mein Job! Mein Chef ist in Ordnung, nur der Arbeitgeber …« »Wenn Sie sich nichts haben zuschulden kommen lassen, gibt es keinen Ansatzpunkt für eine Kündigung.« Wenn Sie sich nichts haben zuschulden kommen lassen. Mit ein bisschen Hilfe von Bembel würde der Herausgeber, dessen Frau irgendwie mit Dumpfbacke bekannt war, schon was finden. »Ich bleibe an Ihrer Seite, versprochen. Fahren Sie jetzt nach Hause und …« »Ich komme mit hoch!« »Keine gute Idee. Dr. Strecker begegnet man besser mit kühlem Kopf. Sollte sich etwas Bemerkenswertes bei der Durchsuchung ergeben, wovon ich nicht ausgehe, melde ich mich anschließend bei Ihnen.« Lexied stieg aus und öffnete ihr die Tür. Anna reagierte nicht. »Bitte, Frau Heydt, ich muss mich beeilen.« Anna nickte wortlos, fuhr aber nicht nach Hause, sondern lauerte zehn nervöse Zigaretten lang im Schatten einer Toreinfahrt, bis die juristische und polizeiliche Bagage abgezogen war. Langsam stieg sie durchs Treppenhaus zur Redaktion im zweiten Stock. Vor Triebels Tür stellte sich ihr Dickmadame Bembel in den Weg, gab jedoch nach Abwägung der Risiken den Durchgang frei. Triebel stand am Fenster und dachte nach, als Anna hereinplatzte. »Frau Heydt. Ich habe …« Besser, gleich zur Sache kommen. Er ahnte, wofür seine kühle Mitarbeiterin sich jetzt brennend interessierte. Die Antwort fiel ihm schwer. Was die Polizei ihr vorwarf, wusste er nicht. Er konnte es sich auch nicht vorstellen. Die Einzige, für die Anna Heydt eine Gefahr darstellte, war sie selbst. »Ich habe leider keine guten Nachrichten. Gerade hat mich der Herausgeber angerufen. Offenbar hat er von dem Affentheater schon erfahren – von wem wohl, Frau Bembel? Und leider hat er sich auf keine Diskussion eingelassen. Er will die Kündigung. Zunächst muss ich Sie abmahnen, weil Sie Ihren Dienst heute nicht angetreten haben.« »Aber mein Anwalt hat gesagt …« Triebel zuckte hilflos mit den Schultern, dann schaute er irritiert auf das Blatt Papier, das ihm Bembel vor die Nase hielt. »Die Abmahnung? Ach, das nennt man flott. Wenn nur alles derart fix bei Ihnen ginge.« Gesine Bembel fiel die Kinnlade aufs Doppelkinn. So sah sie ihr Chef, für den sie ihr letztes Hemd gegeben hätte? Und für die Heydt, diese Schlampe, legte er sich ins Zeug? »Außerdem bin ich angewiesen worden, Sie sofort freizustellen, Frau Heydt«, setzte Triebel die schlechte Nachricht fort. Bembel streckte Anna die offene Hand entgegen. »Den Schlüssel.« »Sie verlassen jetzt auf der Stelle mein Büro und schließen die Türe hinter sich!«, polterte Triebel plötzlich los. Bevor Gesine abtrat, starrte sie ihren Chef mit großen Augen an, bis Tränen flossen. Sollte er sich schlecht fühlen! Triebel machte einen Schritt auf Anna zu und tätschelte ihr unbeholfen den Rücken. Er habe Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Abmahnung, versuchte er sie zu ermuntern. »Ich glaube, Dr. Lexied ist ein guter Mann. Reden Sie mit ihm. Sie müssen sich zur Wehr setzen.« Die Stimme der sonst so Widerspenstigen verkümmerte zu einem heiseren, leblosen Krächzen. »Ich weiß nicht, ob ich noch die Kraft habe.« Sie ging, den Blick gesenkt, zur Tür. »Moment.« Er dachte nach, genauer gesagt rang er mit sich. »Ich weiß vielleicht eine Möglichkeit, den Herausgeber umzustimmen. Ist eine etwas verwegene Sache und versprechen kann ich nichts. Zumindest werde ich es probieren. Wie immer es ausgeht, ich rufe Sie danach gleich an.« Die verwegene Sache bestand darin, den Herausgeber an einen viele Jahre zurückliegenden Nachmittag zu erinnern. Damals hatte Triebel zufällig etwas für den Herausgeber Heikles mitbekommen. Er hatte natürlich geschwiegen, auf seine Loyalität konnte man bauen. Nun aber fühlte er sich Anna Heydt mehr verpflichtet. Er würde zum ersten Mal in seinem Leben zu einem unanständigen Druckmittel greifen. War das schon Erpressung? Er wollte es lieber nicht wissen. Zumindest verstand er jetzt, dass Kriminalität auch eine Frage von Umständen und Gelegenheiten ist. Anna kaufte sich zwei Flaschen, einen Rotwein und einen Schnaps. Am Rotwein wollte sie sich festhalten, während sie auf Triebels Anruf wartete. Den Korn würde sie wahrscheinlich danach brauchen. Sie mochte das ganze scharfe Zeug nicht, also hatte sie sich was Billiges gekrallt: Korn, das Getränk der Straße. Da würde sie sowieso über kurz oder lang landen. Die Wohnung sah wüst aus, aber wenigstens tauchten keine Käfer mehr auf. Sie nahm einen Aufsatz vom Wohnzimmertisch, den sie heimlich aus der Redaktion mitgenommen hatte, und setzte sich in ihren Lieblingssessel, der auch ihr einziger war. Der Aufsatz fiel in ihr Fachgebiet: Biologie und die angrenzenden Naturwissenschaften. Doch der Name des Autors sagte ihr nichts, offenbar zapfte Triebel externe Quellen an, um ihren Ausfall zu kompensieren. DER FREIE WILLE – EINE ILLUSION? Die vergangenen Jahrzehnte erblickten vielfältige Erscheinungsformen dessen, was als forschende, gleichsam empirische Infragestellung der intuitiv postulierten menschlichen Willensfreiheit zu beschreiben ist. Bald hatte sie von dem furztrockenen Zeug genug. Da brauchte sie glatt noch einen Schluck Wein. Plötzlich kam ihr eine Idee: Was, wenn sie den Artikel komplett redigierte, am besten gleich neu schrieb? In dieser Situation konnte es nicht schaden, einen Beweis ihrer Arbeitsfähigkeit zu erbringen. Mit ihrem mehr oder weniger freien Willen unterdrückte sie die Lust aufs Picheln, setzte sich an den Küchentisch und las den Artikel zu Ende. Eigentlich hätte sie im Netz einiges recherchieren müssen, aber ihr Notebook lag beim Pfandleiher. Während der zwei Stunden, in denen sie ihren Text in eine Reiseschreibmaschine klopfte, genehmigte sie sich lediglich ein kleines Glas Wein. Dafür rauchte sie wie ein Industrieschornstein. Nachdem sie den letzten Punkt gesetzt hatte, leistete sie sich ein größeres Glas und las den Text. Da mussten noch mehr Fakten rein, aber sonst gar nicht so schlecht. Es hatte sogar Spaß gemacht. Auch vor dem Arschtritt ihres Mannes war ihr Leben kein Zuckerschlecken gewesen, doch wenigstens das wollte sie zurück! Sie setzte sich ins Wohnzimmer und ließ den Blick und die Gedanken kreisen, beides verband sich unwillkürlich. Denn der Funkturm im Südosten war nicht zu übersehen, weder hier noch auf dem Video. Es blieb ihr ein Rätsel, wie sie da hineingeraten war. Sie blickte auf die Uhr. Vier schon. Und Triebel rief nicht an. Und der Flasche ging langsam der Wein aus, obwohl sie die Tropfen rationiert hatte wie Wasser in der Wüste. Und ihr Nervenkostüm rutschte immer weiter runter, nicht mehr lange und sie stünde blank da. Sie musste sich ablenken. Ihren Skizzenblock fand sie in der Küche, er lag, in der Mitte aufgeschlagen, auf der Spüle, eine Papiertüte mit Pommes- und Mayonnaiseresten obenauf, daneben ein Paar verschmierte Einmalhandschuhe; da hatte einer der Polizisten wohl Hunger gehabt. Sie holte ein Messer und Klopapier und entfernte die Mayonnaisetupfer. Der Block enthielt unzählige typografische Entwürfe des Buchstaben P, die sie in herkömmlichen selbst kreierten kalligrafischen Schriftzeichen mit Tusche zu Papier gebracht hatte. Sie besaß viele solcher Blöcke, manche mit Variationen einzelner Buchstaben, andere mit allem Möglichen, was ihr unter die Augen kam: den Schriftzügen von Unternehmen und Organisationen, Buchtiteln oder Produktnamen. Ihre Entwürfe konnten es längst mit denen von Profis aufnehmen, doch darum ging es nicht. Sie zeichnete Papa zu Ehren, der Grafiker gewesen war. Jede ihrer Skizzen markierte einen hilflosen Versuch, mit ihm in Verbindung zu treten. Anna seufzte. Sie vermisste ihre Eltern mehr, als sie es zu sagen vermochte. Ihre Augenlider senkten sich, sie verfiel in unruhigen Schlaf. Im Traum sah sie sich einen Parcours aus Schnapsflaschen durchkurven. Sie durfte keine Flasche berühren, sonst schied sie aus. Als sie wieder erwachte, herrschte draußen Dunkelheit. Das Blatt war zur Hälfte gefüllt, die Rotweinflasche komplett geleert. Sie stemmte sich aus dem Sessel und schüttelte sich wie ein nasser Hund. Doch Niedergeschlagenheit ließ sich nicht abschütteln. Triebel hatte nicht angerufen. Eben auch nur so ein Bundesbürger, von dem man nicht zu viel erhoffen durfte. Ihren Job musste sie demnach abschreiben. Erst jetzt spürte sie, wie wichtig er gewesen war, die letzte Struktur in ihrem haltlosen Leben. Jetzt konnte sie saufen, bis es ihr hochkam. Sie holte den Korn aus dem Schrank unter dem Spülbecken, wo sie ihn vor sich versteckt hatte. Dass ihre Telefonleitung tot war, bemerkte sie nicht. JESÚS MIRANDOR | E-GRANADA Jesús Mirandor ging durch die engen Gassen des Albaycín, dem einstmals maurischen Viertel Granadas. Er freute sich auf einen Kaffee an der Plaza Larga. Als er quietschende Reifen hörte, drehte er sich um und sah einen Fiat Panda auf sich zu schießen. Der Wagen geriet ins Schlingern und ratschte Funken sprühend die linke Hauswand entlang. Ein Spiegel brach ab, der Wagen driftete nach rechts und verlor auch den anderen Spiegel. Endlich drang zu Jesús durch, dass der Wagen nicht vor ihm haltmachen würde. Und zum Ausweichen ließ die enge Gasse keinen Raum. Wenn es zur Seite nicht ging, dann musste es nach oben gehen. Zehn Meter vor ihm befand sich ein schmiedeeisernes Fenstergitter auf Hochparterrehöhe, seine einzige Chance. Er schleuderte den Rucksack weg und nahm Anlauf. Hochsprung, konntest du immer gut, komm schon! Während er den Wagen heranbrausen spürte, bekam er die beiden äußersten Streben des Gitters zu fassen. Er stemmte ein Bein gegen die Hauswand, doch bevor er das andere nachziehen konnte, erfasste es der Wagen. Jesús knallte mit dem Rücken auf das Wagendach. Ehe er sich versah, hingen seine Schultern im Leeren. Der Rücken folgte. Verzweifelt presste er die Hände gegen das Blech, aber es war kein Halten. Nur nicht auf die Wirbelsäule! Mit einem letzten Kraftakt stieß er sich im Fallen von der Heckscheibe ab, um sich auf die Seite zu drehen. Aus dem Pflaster ragten daumengroße Kieselsteine, die sich hart und spitz in sein zum Bremsklotz vorgestrecktes Knie bohrten. Als sein Oberkörper aufschlug, blieb ihm die Luft weg. Dafür stieg ihm das Essen hoch. Er kannte solch unsägliche Schmerzen nur zu gut, hatte sie seit Kindertagen jedoch nicht mehr zu spüren bekommen. Während die Übelkeit abebbte, betrachtete er sein linkes Bein, das unter der zerrissenen Hose heftig blutete. Der Arm sah nicht besser aus. Mit zusammengebissenen Zähnen streckte er das lädierte Bein und zog es wieder an. Das Kniegelenk schien unverletzt, mehr Sorgen machten ihm seine Rippen. Jeder Atemzug schmerzte, als stäche ein Messer in die Lungen. Er fuhr mit den Fingern über die Rippenbögen, ohne einen Bruch zu ertasten, und rappelte sich auf. Erst jetzt nahm er das Geschehen um sich herum wahr. Der Panda hatte sich, rund fünfzig Meter entfernt, zwischen den Hauswänden verkantet, um ihn herum eine Menschentraube. Jesús humpelte los, um nachzusehen, ob jemand Hilfe brauchte. Offenbar saß der Fahrer noch im Wagen, es zeichnete sich eine Silhouette ab. Der Mann schien einen Helm zu tragen. Es war kein Mann. Nach Attentäter sah die Person hinterm Lenkrad auch nicht aus. Und der Helm entpuppte sich als Turmfrisur. »Ich habe gebremst, aber es ist nichts passiert!«, bekundete eine ältere, knöcherne Dame mit bebender Stimme. Vor dem Kühlergrill hatte sich ein Kreis gebildet, einige Leute knieten auf dem Pflaster. Anscheinend hatte es nicht nur ihn erwischt. Er kletterte unter Schmerzen über die Kühlerhaube und schob zwei Gaffer beiseite. Auf dem Boden saß eine junge Frau und hielt einen Jungen im Arm. »Ich kenne mich aus«, erklärte er und bat sie, ihm das Kind zu geben. Er hob den Jungen vorsichtig an und ließ eine von irgendwo herbeigeschaffte Decke vor dem Panda ausbreiten. Die Füße legte er auf der Stoßstange ab, unter die angewinkelten Beine schob er seinen ramponierten Rucksack. Mit einem aufmunternden Lächeln streichelte er die zitternde Hand. »Okay, Kleiner, ich bin Jesús. Bei mir bist du in Sicherheit. Dir kann jetzt nichts mehr passieren. Hast du das verstanden?« Der Junge deutete ein Nicken an. »Ich brauche deine Hilfe, ja? Willst du mir helfen? Prima, compañero!« Jesús überlegte sich ein Ablenkungsmanöver, um die Angst des Jungen zu lindern. »Du siehst doch meinen Rucksack unter deinen Beinen. Also, auf den musst du achten. Und wenn ihn jemand wegnehmen will, musst du mir sofort Bescheid geben, in Ordnung?« Er winkte die Frau zu sich. »Ich bin Jesús. Und du?« »Eva.« »Besorge mir bitte den Verbandskasten aus dem Fiat, Eva. Und dann frag, ob jemand eine Flasche Wasser hat.« Oberflächlich betrachtet wies der Junge keine lebensbedrohlichen Wunden auf. Die unmittelbare Gefahr ging vom Schock aus. Sein von kaltem Schweiß überzogenes Gesicht war wächsern, die Atmung flach, der Puls raste. In seinen Augen las Jesús Panik. »Du bist wirklich ein tapferer Mann«, flüsterte er ihm ins Ohr. »Und das Schlimmste ist schon überstanden. Wenn wir zusammenhalten, kann gar nichts passieren.« Während er die Stirn des Jungen mit Wasser abtupfte, gab er Eva Anweisungen. »Hast du ein Handy dabei? Dann wähle die 112, ganz egal, ob das sonst schon jemand getan hat. Gib zunächst die Adresse an, Granada, Calle de San Luis, die Hausnummer kann dir der Mann auf dem Balkon sagen.« Jesús beugte sich vor, damit der Junge nicht mithörte. »Dann sag, es handle sich um ein circa zehnjähriges Kind, das einen lebensbedrohlichen Schock erlitten hat. Innere Verletzungen nicht auszuschließen. Hast du eine Ahnung, wie man mit einem Fahrzeug durch die Gassen hierhin kommt? Gut, dann gehe nach dem Anruf bis zur Kreuzung an der Cuesta del Chapiz. Sobald der Krankenwagen eintrifft, lotst du ihn hierhin.« Sie nickte tapfer. Als der Notarzt eintraf, zeigte sich ihm ein ungewöhnliches Bild. Ein gutes Dutzend Leute bildete einen Kreis, in dessen Mitte ein Mann und ein Junge lagen, die ein Lied sangen. Kaum hatte der Arzt den bandagierten Jungen erreicht, war der Mann verschwunden. Er hatte perfekte Arbeit geleistet. Jesús humpelte zur Plaza Larga, seinem Lieblingsplatz hier im Albaycín. Die von kleinen, meist weiß gekalkten Häusern mit französischen Balkonen eingefasste Plaza war in diesem eng bebauten Viertel ein wohltuendes Luftloch. Mit ihren Bars, den Bäumen und den zahlreichen kleinen Geschäften wirkte sie wie ein Magnet. Hier kamen Einheimische und Touristen zusammen und Hippies. Granada war unterm Strich eher konservativ und gewiss nicht hipp, aber bemerkenswert hippie. Zumindest hier im Albaycín, diesem besonderen Ort, der die Leidenschaft der spanischen Seele mit dem Zauber der arabischen Vergangenheit vereinte und den großen Flamenco mit dem kleinen Leben der Zigeuner. Wo auch immer die Hippies überwintert hatten: Ab März zog es sie hierhin, samt ihren Hunden, die sich lässig unter die einheimischen Kollegen mischten und mit ihnen um die Wette pinkelten, und nicht nur das. Wer die Gassen als beschissene Angelegenheit bezeichnete, meinte es wörtlich. Ein Stück Normalität. Positiv betrachtet, trug es dazu bei, dass der zum Weltkulturerbe erhobene Albaycín, obwohl von Touristen belagert, immer noch er selbst war. Wer in diesem jahrhundertealten Stadtteil wohnte, war entweder einfach dort geblieben, wo die Familie schon lange lebte, oder zugezogen, weil ihm diese Bodenständigkeit gefiel. Man wohnte in meist einfachen weißen Häusern, die auch in der Altstadt von Tanger oder Tunis hätten stehen können. Viele besaßen eine Terrasse, manche einen kleinen Garten, andere einen Innenhof und nicht wenige einen herrlichen Ausblick – wegen der Hanglage am Sacromonte, einem Hügel, der aus der Stadt heraus in noch höheres Gelände führte. Zwischen den schlichten Häusern und den Kirchen und Konventen, der Moschee und den verbliebenen Badehäusern versteckten sich auch einige Juwele: von hohen Mauern umgebene Villen, die an Tausendundeine Nacht erinnerten, mit Türmen und Erkern, blütenprächtigen Gärten und mosaikgeschmückten Innenhöfen. Es gab also von allem etwas und Jesús gefiel es, er mochte dieses Durcheinander. »Hola amigo«, rief ihm Juan, der Kellner des Aixa im Vorübergehen zu. Offenbar registrierte er, dass etwas nicht stimmte, denn er machte auf dem Absatz kehrt. »¿Qué tal?« Wie geht’s? Dann, mit einem Blick auf die zerfetzte Hose: »¿Qué pasa, Jesús?« Jesús mochte es, wie Juan seinen Namen aussprach. Kaum jemand bekam das J so kehlig hin und legte so viel Nachdruck in das ú. Er bemühte sich flach zu atmen, während er Juan die Geschichte erzählte und um Pflaster und hochprozentigen Schnaps bat. »¡Madre mia, madre mia!« Juan stürmte davon und gleich wieder zurück, eine Flasche mit übergestülptem Glas und einen Verbandskasten in der Hand. Erst müsse Jesús einen großen Schluck nehmen, die Wunden sähen ja schrecklich aus und es würde bestimmt gleich sehr wehtun. Ob er damit denn nicht zum Arzt wolle, madre mia, das sei schließlich keine Bagatelle, da müsse ein Profi ran! Was Juan nicht wusste: Jesús Mirandor war ein Profi, ein ausgebildeter Krankenpfleger. Er hatte lange in einem Krankenhaus in Málaga gearbeitet, mit Leidenschaft gearbeitet. Bis zu den Todesfällen. Danach hatte er nicht mehr in seinem Beruf arbeiten können. Außer Vincente, seinem besten Freund, wusste aber niemand in Granada davon, und so sollte es bleiben. Man kannte ihn hier als Helfer auf Baustellen und in Bars oder Geschäften, als einen von vielen Ungelernten, der vor Kurzem – Glück musste man haben – einen Job als Spanischlehrer an einer Sprachschule ergattert hatte. Er schickte Juan weg, ihm ein Bocadillo und einen Cortado zu besorgen: ein belegtes Brötchen und einen Espresso mit einem Schuss Milch. Nachdem er die Wunde gereinigt und dem verunglückten Jungen in Gedanken die Daumen gedrückt hatte, schob er das Geschehene beiseite. Um sich davon seinen Tag verderben zu lassen, hatte er weiß Gott schon zu viel erlebt. Während er im Stuhl zurücksank, kam Inga quer über den Platz und setzte sich an seinen Tisch; sie hatte ihn wohl schon erwartet. »Hola«, begrüßte er sie und strich ihr übers schwarze Haar. »Hast mal wieder die Nacht zum Tag gemacht, was?« Jesús sah sich um. Er saß hier oft bei schönem Wetter und schaute dem Treiben auf dem kleinen Markt zu: ein paar Gemüse-, ein paar Klamottenstände. Heute bauten sie bereits ab. Señora Delgado nickte ihm zu und nahm eine Orange aus einer Plastikkiste. Sie wollte gerade rüberkommen, um sie gegen die augenscheinlich interessanten Neuigkeiten einzutauschen, da näherte sich jemand ihrem Stand. Der Geschäftssinn siegte. Entschlossen schwang sie das Hinterteil herum und pries ihre Ware an. Jesús hatte von einer Untersuchung gelesen, der zufolge die Spanier zu den kleinsten und dünnsten Europäern gehörten – was auf Frau Delgado nur in ersterer Hinsicht zutraf. Sie ernährte sich offensichtlich nicht nur von ihrem Obst und Gemüse. Schräg hinter sich sah er Miguels mit Schaufeln und Besen bestückten Rollwagen, direkt neben dem Eingang des Lotterieladens. Klar, der Jackpot bei Euro Millon stand auf über 20 Millionen, da konnte er natürlich nicht widerstehen. Miguel trat mit zufriedenem Lächeln aus dem Gebäude. »Hola, Miguel, ¡mucha suerte!«, viel Glück, rief Jesús seinem Freund quer über die Plaza zu. Miguel wedelte vergnügt mit seinem Los. Er war Schreiner, schlug sich jedoch schon einige Zeit als Hilfsarbeiter durch – wie so viele in Granada. Er träumte von einer eigenen Schreinerei, die ihm die Lotterie ermöglichen sollte, nahm aber auch die Straßenreinigung ernst. Nur was man richtig macht, macht Spaß, lautete sein Credo. Deshalb überraschte es Jesús nicht, dass er den Rollwagen weiterschob, statt auf ein Schwätzchen rüberzukommen. Er blickte auf die Uhr. Noch ein paar Minuten, dann musste er zur Schule. »¡Ah, Jesús! ¿Qué tal?« Der schöne Vincente, wie Jesús seinen besten Freund insgeheim nannte, klopfte ihm auf die Schulter. Er war nicht wirklich ein Schönling, sondern einfach ein attraktiver Mann von Anfang vierzig mit goldbraunem Teint, blauen Augen und Dreitagebart. Auffällig schön wirkte er nur neben seiner Frau. Wenn man Gloria von vorn und es gnädig sah, konnte man sie rassig und vollschlank nennen. Auf der Hinterseite sah die Sache anders aus. Da erhob sich der Po aus der Ebene des Rückens wie die Bergketten aus Spaniens Küstenstreifen. Und dann fragte man sich unwillkürlich, wie sie zu dem schönen Mann gekommen war. Vielleicht trug Glorias Lach- und Lebenslust den ernsteren Vincente über die Äußerlichkeiten hinweg. Während sein Freund Platz nahm, erhob er sich. »Tut mir leid, ich muss los, zur Schule.« »Am Samstag?« »Eine Extrastunde.« Vincentes Blick auf das zerrissene Hosenbein registrierend, verwies er ihn an Juan. »Er kennt die Geschichte schon.« »Wie wär’s heute Abend auf ein Bier? Um halb zehn setze ich Gloria bei ihren Eltern zum Abendessen ab.« »Du gehst nicht mit?« »Wenn ich die Vorwände richtig deute, wollen sie über meinen Geburtstag reden. Um zehn in der Bar bei dir ums Eck, in Ordnung?« »¡Hasta pronto!« Was dramatisch und schmerzhaft begonnen hatte, versprach doch noch ein schöner Tag zu werden. Es war nicht weit bis zu seiner Schule, der Escuela Esmeralda Escobar, wo Jesús seit einem dreiviertel Jahr Ausländer unterrichtete. Ein echter Glücksfall – nach jahrelanger Durststrecke. Seine Schülerin wartete schon vor der Eingangstür. »¿Cómo tal, Dschä-isus? – ¡Oh, quä-i veo!« Sie deutete auf seine blutverschmierte Hose. »¿No es bi-än, si?« Arme Emily. Sie hatte bereits einen sechswöchigen Spanischkurs in Sevilla hinter sich und war trotzdem das Sorgenkind seines Anfängerkurses. Manchmal ließ sich kaum unterscheiden, ob die Australierin noch Englisch oder schon Spanisch sprach. Die Grammatik blieb für sie ein Buch mit sieben Siegeln. »Granada ejstáis un ciudad mucha bonito«: Granada seid ein viel schöner Stadt; wenn Spanisch so geklungen hätte, wäre sie Spitze gewesen. Dabei waren sie noch gar nicht bei den Vergangenheitsformen angelangt, dem eigentlichen Knackpunkt. Danach wäre ihr Spanisch wahrscheinlich nicht mehr von Chinesisch zu unterscheiden. Es gab Schlimmeres. Er mochte die ungefähr dreißigjährige mädchenhafte Frau mit den langen aschblonden Haaren. Vielleicht, weil sie ihn anrührte in ihrer arglosen Neugierde auf die Welt. Demnächst wollte sie die Spanischbücher gegen eine Maurerkelle eintauschen. Einmal mithelfen, ein Haus zu bauen, lautete einer ihrer Pläne, und sie hatte eine Menge davon. Hoffentlich beherrschte sie die Kelle besser, sonst würden die Grundmauern das Richtfest nicht erleben. »Hola, Emily, solo un pequeño accidente«, nur ein kleiner Unfall. Sie deutete auf Inga und fragte Jesús in ihrem typischen Spanischverschnitt, ob sie ihn immer begleite. »Oft«, antwortete er, »sie geht gern mit mir spazieren.« Er schloss auf und verabschiedete sich von Inga, die ihm hinterherblickte, während er mit der Frau im Innenhof verschwand. Die Schule, ein mehrstöckiges, typisches Albaycínhaus, lag am südöstlichen Hang des Sacromonte. Die Dachterrasse bot ein fantastisches Panorama. Auf der gegenüberliegenden Anhöhe, jenseits des Rio Darro, thronte die mächtige Alhambra – ein unvergängliches Monument muslimisch-maurischer Herrscherkunst. Gut zwei Jahrhunderte hatte sie das Emirat von Granada beherrscht, heute beherrschte sie immerhin noch die Postkarten. Wie eine Auster zeigte sich die Zitadelle nach außen mit harter Schale und verbarg dabei in ihrem Inneren eine Perle die – nach allen Regeln arabischer Kunst geschliffen – noch heute märchenhaft glänzte. Einen schöneren Palast hatte Jesús nie gesehen. Die Unterrichtstunde verging wie im Flug. Emily spielte mit ihm Räuber und Gendarm und erwies sich wieder einmal als Serientäterin: Ihren Verbrechen an der spanischen Sprache war kaum hinterherzukommen. Vergnügt trat Jesús den Heimweg zu seiner Cueva an, einer in den Sacromonte gehauenen Höhle, von denen es hier viele gab. Der Hügel glich im oberen Teil einem wurmstichigen Apfel. Früher hatten Gitanos, spanische Zigeuner, in den Höhlenwohnungen gehaust, später schimmelten sie unbeachtet vor sich hin. Bis in den Achtzigerjahren Leute ihren Reiz wiederentdeckten, die gern Komfort gegen Originalität eintauschten oder schlicht an Natursucht litten; Letztere besaßen bestimmt keinen spanischen Pass. Im Sommer spendete die Cueva wohltuenden Schatten, ein kühles Paradies inmitten des Höllenfeuers, in dem die Stadt briet. Als Jesús im Juli letzten Jahres eingezogen war, hatte er sein Schattenreich genossen, doch dann folgte ein Winter, der nicht nur gewohnt kalt gewesen war, Granada lag immerhin auf 700 Metern Höhe, sondern auch ungewohnt nass; ständig hatte der Wind Regenwolken von den Gipfeln der Sierra Nevada in die Hochebene gefegt. Und selbst jetzt, im März, unterlag die andalusische Sonne im Kampf gegen die Wolken ungewöhnlich oft. Granada fror und Jesús erst recht. Seine Höhle war immer noch eisbärentauglich. Er passierte den kleinen, von zwei Meter hohen Mauern umschlossenen Innenhof, den eine große Palme beschattete, und schloss die Tür auf. Durch einen Vorhang schlüpfte er ins Bad, wo er die Wunden verband und Aspirin besorgte. Danach betrat er das schattige Hauptgewölbe. Die Wände hatte er in hellem Gelb gestrichen, das sich in den bunten Bodenfliesen wiederfand. Er ging in die Küche am Ende des Raums, die ihr Revier durch eine Theke mit Rundbogen abgrenzte. Mit einer Flasche Wasser kehrte er in den Hof zurück. Er wollte die Beine auf der Empore im Hof ausstrecken. Das zwei Meter hohe Holzgestellt nutzte er im Frühling und Herbst, wenn die Sonne kaum über die Mauern kam. Er hatte es mit Hilfe von Miguel errichtet, dem straßenkehrenden Schreiner. Miguel hatte gern mit angepackt, obgleich er es für ein »völlig unspanisches Projekt« hielt: Nur Touristen litten an Sonnensucht. Ein Spanier mochte die Sonne zwar nicht missen, wohl aber meiden; dass man Balkon oder Terrasse besaß, hieß ja nicht gleich, sie auch zu benutzen. Jesús gab ihm recht, ohne sich beirren zu lassen. Er selbst brauchte die Sonne wie ein Fisch das Wasser. Vorsichtig setzte er sich, das Atmen tat bei jeder ungeschickten Bewegung höllisch weh. Er streckte sich aus und schloss die Augen. Wie gut das tat! Aber schon nach wenigen Momenten tauchten wieder die beiden Gesichter aus dem Nebel vor seinem inneren Auge auf. Ein älterer Mann mit Glatze und grauem Vollbart und ein junger mit schwarzen Haaren. Zwei abwechselnd aufleuchtende Gesichter, die ihm nichts sagten und keine Verbindung untereinander zu haben schienen. Kaltes Licht blitzte bei jedem Bildwechsel auf. Die Blitze eines sich nähernden Gewitters? Seit Tagen verfolgten ihn die Männer schon. Jesús verstand nicht, woher sie kamen und was sie von ihm wollten. Er verstand auch nicht, warum sie ihn derart beunruhigten. GUERILLAKRIEG | D-EPPSTEIN/TAUNUS Wasserstoffperoxid, eine stark ätzende, blassblaue Flüssigkeit, kennt man vor allem als Bleich- und Desinfektionsmittel. Doch man findet es auch in Sprengstoff, Raketentreibstoff – und im menschlichen Körper. Seiner aggressiven Veranlagung gemäß fungiert es als schnelle Eingreiftruppe der Immunabwehr im Kampf gegen Parasiten, Bakterien und Viren. In höherem Lebensalter vermag der Körper überschüssiges H2O2, so die chemische Formel, nicht mehr vollständig abzubauen. Dieser Umstand wird durch die Ergrauung der Haare sichtbar: Wasserstoffperoxid lagert sich im Haar ein und verhindert die Herstellung des Farbpigments Melanin. An dessen Stelle treten Luftbläschen, die das Haar grau erscheinen lassen. Der Mann, der Anna Heydt nachstellte und zusetzte, betrat einen fensterlosen, weiß gekachelten Raum, um nach solch einem grauen Haar zu fahnden. In der Hand hielt er einige hoch aufgelöste, DIN-A-2 große Fotografien: Ausschnitte aus seinem Haarschopf. Er betrachtete sie durch eine Handleuchtlupe. Zu seinem Bedauern wurde er nach zweistündiger Untersuchung fündig. Es war sein erstes graues Haar und er hatte mit ihm rechnen müssen. Die Ergrauung selbst interessierte ihn nicht, wohl aber der indizierte Überschuss an Wasserstoffperoxid. Denn sein Immunsystem hatte keine Verwendung für die »schnelle Eingreiftruppe«, im Gegenteil: Er musste sie unter Kontrolle behalten, damit sie keinen Guerillakrieg gegen seine weißen Blutkörperchen anzettelte. Das graue Haar zeigte den Beginn der kritischen Phase an. Früher oder später hatte sie einsetzen müssen angesichts der primitiven Ausstattung, die ihm zur Verfügung stand. Der Zeitpunkt lag innerhalb der kalkulierten Toleranz, allerdings im Grenzbereich. Von den drei beherrschbaren Szenarien hatte sich das pessimistische eingestellt. Zeitliche Spielräume, die er bisher gehabt hatte, fielen weg. Er hatte sie nie nutzen müssen, jetzt konnte er es nicht mehr. Denn er musste von nun an einen Medikamentencocktail einnehmen, der die Wirkung seiner Therapie beeinträchtigen würde. Ab sofort würde der Ausfall einer Behandlung dramatische Konsequenzen nach sich ziehen. Und ausgerechnet jetzt befand er sich in einem Engpass. Er fuhr immer zweigleisig, doch gestern war Kandidat CXXVII-β auf dem Ersatzgleis tödlich verunglückt. Nun durfte mit Kandidatin IX-α alias Anna Heydt nichts mehr schiefgehen. Er würde sich deshalb weiterhin persönlich um sie kümmern. Der Herausforderung, die Widerspenstige zu zähmen, stellte er sich nur zu gern. Denn IX-α zählte zu den Prachtstücken seiner Sammlung. Weit weniger gefielen ihm Exemplare wie Triebel, die aus bloßem Übermut zu Heilsbringern mutierten. Als hätten sie irgendwas davon. Ihre Tage waren gezählt, so oder so. Niemand hier konnte auf Rettung hoffen, außer ihm selbst. Vorausgesetzt, es unterliefen ihm keine Fehler. Um auf Nummer sicher zu gehen, entschloss er sich, Heydt durch eine zusätzliche Attacke weiter in die Enge zu treiben. Er griff zum Telefonhörer und rief beim Frankfurter Lokalsender an. FEUERMAL & SCHRIFTZEICHEN | D-FRANKFURT/MAIN Triebel hatte ein ums andere Mal probiert, Frau Heydt zu erreichen. Am Nachmittag vom Büro und abends von daheim aus. Vom Hobbykeller aus, um genau zu sein, denn seine bessere Hälfte war nicht nur wissbegierig, sondern auch eifersüchtig. Sie hätte gefunden, ihr Mann müsse sich aus den Abermillionen hilfsbedürftiger Menschen nicht ausgerechnet eine Frau aussuchen. Ihr zu erklären, wieso gerade Frau Heydt seine Hilfe benötigte, hätte mehr Worte gekostet, als ihm zur Verfügung standen. Gegen zehn ging er ein letztes Mal – vorgeblich mit einer Laubsägearbeit für seine Tochter Melanie beschäftigt – in den Keller hinunter. Wegen des besseren Empfangs stieg er auf eine Truhe vor dem Fenster, bevor er ihre Nummer wählte. Frau Heydt hob nicht ab. Am nächsten Morgen setzte er die Versuche im Büro fort. Sie hob nicht ab. Hatte sie wieder getrunken? Aber er hatte sie gestern schon nach einer Stunde angerufen, da konnte sie doch noch nicht betrunken gewesen sein. Oder? Bei dem Gedanken, sie habe sich etwas angetan, fröstelte ihn. Eigentlich hatte er keine Zeit, er war ja überhaupt nur am Samstag im Büro, weil der Redaktionsschluss nahte. Aber er durfte den Dingen nicht einfach ihren Lauf lassen. Kurz entschlossen meldete er sich »zu einer Besprechung« ab. Gestern seine Frau, jetzt Frau Bembel, langsam wurde das Schwindeln zur Routine. Das Viertel, in dem sie wohnte, kannte er nur dem Namen nach, dem schlechten Namen nach. Hoffentlich würde sein neuer weißer Golf die Reise heil überstehen. Immerhin fand er gleich einen Parkplatz vor den drei Türmen. In dieser Mietskaserne wohnte sie? Die drei hochkant gestellten Baracken waren mit Satellitenschüsseln gespickt, als residiere hier der Bundesnachrichtendienst. Sein Blick wanderte die Betonfassade hinauf. Weshalb hatte es diese intelligente Frau nur ins Abseits verschlagen? Obwohl sie ihr Biologiestudium nicht abgeschlossen hatte, reichte ihr Potenzial weit über die halbe Stelle bei Heureka hinaus, es fehlte ihr lediglich an Stetigkeit. Die Tür von Haus II stand offen – unnötigerweise, denn in der Scheibe klaffte ein riesiges Loch. Beängstigend, wie viele Klingeln es hier gab, die meisten namenlos. Er fischte den Zettel mit der Apartmentnummer aus der Manteltasche und drückte mit spitzem Zeigefinger den Klingelknopf. Keine Reaktion. Er probierte es erneut. Und noch mal. Schließlich klingelte er Sturm. Und erntete Totenstille. Er musste es an der Wohnungstür probieren. Seine Mitarbeiterin wohnte wahrscheinlich ganz oben, zumindest befand sich ihr Klingelknopf in der obersten Reihe, allerdings neben vielen anderen. Und wenn schon an den Klingeln keine Namen standen … Er trat ein und sah, wie sich die Fahrstuhltür öffnete. Vielleicht einer der Mieter, der wusste, wo … Nein, kein Mieter, den Mann kannte er, es war der Polizist, der gestern an der unseligen Durchsuchung teilgenommen hatte, ein Herr Enkel oder so ähnlich. Sie grüßten sich mit einem Kopfnicken, blieben ein paar Meter voneinander entfernt stehen und taxierten sich. »Ach, veranstalten Sie jetzt auch noch hier eine Durchsuchung, Herr Ekel?« »Engel. Die hat schon gestern stattgefunden.« »Schämen Sie sich nicht? Die arme Frau Heydt systematisch fertigmachen, ist es das …?« »Hören Sie, Herr Triebel, die Anordnungen treffe nicht ich, sondern der Staatsanwalt. Es gibt nun mal Verdachtsmomente, die geklärt werden müssen.« »Da würde mich doch sehr interessieren, was das für Verdachtsmomente sind.« Engel antwortete mit einem lakonischen Lächeln. »Verstehe. Und was machen Sie jetzt schon wieder hier? Gönnen Sie der Frau nicht mal am Wochenende ihre Ruhe?« »Ich wollte mit ihr sprechen, sonst nichts.« »Und, was sagt sie?« »Sie ist nicht zu Hause oder öffnet nicht.« »Wo befindet sich die Wohnung von Frau Heydt denn?« »Neunzehntes Stockwerk, den Gang nach rechts bis zum Ende. Probieren Sie’s?« Triebel zuckte mit den Schultern, dann gab er sich einen Ruck und nickte. »Ich begleite Sie.« Vielleicht öffnete sich Triebel die Tür, die ihm verschlossen blieb. Engel ging zum Aufzug, aber Triebel wollte da nicht rein, er litt an Platzangst. Gemeinsam quälten sie sich das verwahrloste Treppenhaus hoch, ein Haufen beschmierter Beton mit Stufen dran. Anna kam, die dritte Tasse Kaffee intus, allmählich wieder zu sich. »Wie sind Sie überhaupt hier reingekommen?«, fragte sie ihren Anwalt, der vorbeigeschaut hatte, weil sie seit gestern telefonisch nicht mehr erreichbar war. Offenbar eine Störung. Die Tür sei nur angelehnt gewesen, antwortete Lexied. Nur angelehnt. Wahrscheinlich würde sie demnächst auch noch mit offener Bluse rumlaufen. »Soll ich Ihnen Kaffee nachschenken?« »Nein. Aber danke, dass Sie welchen aufgesetzt haben. Habe ich gebraucht«, sagte sie schleppend. Ihre Zunge war schwergängig, als hätte sie sich in Morast festgefahren. »Gern geschehen. Und ich schätze, ich kann …« Es klingelte von Neuem, diesmal wieder an der Wohnungstür. Mensch, ging ihr das auf die Nerven! Anna wollte endlich wissen, welcher Hiobsbotschafter vor der Tür stand. Sie quälte sich vom Stuhl und schleppte sich zum Flur. Durch den Spion sah sie Triebel und machte kurz entschlossen auf. Dann erst bemerkte sie Engel. »Na, spielen Sie Türöffner für die Polizei? Oder trauen Sie sich allein nicht hier rein?« Besser giftig als verzweifelt, dachte Triebel, war sich allerdings nicht sicher, wie weit das bei ihr auseinanderlag. »Na, dann mal alle rein in den Sündenpfuhl.« Lexied grüßte die Neuankömmlinge mit einem Lächeln, das Triebel verschwörerisch erwiderte. Ein Verbündeter, gut so. Anna hockte sich hin, die anderen standen sich offenbar lieber die Beine in den Bauch, Engel neben der Tür, Lexied und Triebel auf der gegenüberliegenden Seite am Fenster. »Dr. Lexied wollte mir von der sinnlosen Durchsuchung erzählen.« Triebel vermochte nicht länger an sich zu halten, er musste jetzt endlich seine Neuigkeit loswerden. Törö, törö, hörte er – die reinste Gehirnwäsche – den dicken, allgegenwärtigen Liebling seiner Tochter im Ohr, bevor es aus ihm raussprudelte: »Ich habe gute Nachrichten, sehr gute sogar! Ich habe Ihnen doch versprochen, mit dem Herausgeber zu sprechen … Nun ja, jedenfalls hat es geklappt: Sie werden nicht entlassen, Frau Heydt!« »Nicht?« Sie blickte ausdruckslos vor sich hin. Es fiel ihr schwer, die Freude unter der Tonnenlast auszubuddeln. Ihre Augen verschleierten, sodass sie nur noch die geometrischen Muster um sich herum wahrnahm: Quadrate, Kreise und Kurven. Die Krawatten der drei hätten einem Geometriebuch entsprungen sein können. Plötzlich sprengte eine Lachsalve die Versteinerung auf. Es schüttelte sie, warum auch immer. Schließlich beruhigte sie sich wieder. Mit einem Mal gefiel ihr, die Bude voll zu haben, sonst kam nie Besuch. »Wie haben Sie Zauberkünstler das denn geschafft?« Triebel lächelte nur verlegen. »Danke«, sagte Anna schlicht. Danke. Ein Wort im Vormarsch, von ganz unten nach oben gespült. »Meine Gratulation, Frau Heydt«, sagte Lexied. »Sehen Sie, es gibt immer eine Lösung.« Er nahm seine Ledertasche. »Ich habe noch eine Verabredung. Was Sie bitte nicht ausnutzen, Herr Engel. Ihr unkonventioneller Besuch, nun ja. Frau Heydt, machen Sie bitte keine Aussagen, die wir nicht besprochen haben. Im Zweifelsfall schweigen Sie.« Triebel hüstelte. »Herr Dr. Lexied, auf ein Wort. Wenn ein Leumund, ähm, der Sache guttäte …« Es behagte ihm nicht, auch nur indirekt anzudeuten, Frau Heydt werde einer Straftat verdächtigt. »Also, dann bin ich willens, mich zur Verfügung zu stellen.« Er lief rot an. Gemessen am Abstand, den seine Mitarbeiterin gewöhnlich hielt, erfüllte sein Hilfsangebot den Tatbestand einer unsittlichen Annäherung. Lexied nickte. »Das ist immer hilfreich.« »Sie schmeißen sich ja ganz schön an mich ran, Chef«, sagte Anna und spürte schon wieder ein sinnloses Lachen aufsteigen; sie schluckte es runter. »Aber ich weiß Ihren Beistand zu schätzen.« Dem armen Triebel wurde nun erst recht heiß. »Kein Thema«, murmelte er und blickte demonstrativ auf die Uhr. »Höchste Zeit.« Er musste hier raus, auch wenn er Frau Heydt ungern mit der Polizei allein ließ. Während sie ihn zur Tür brachte, Dr. Lexied stand noch mit dem Polizisten in der Küche, bemühte er sich, Zuversicht zu verbreiten. »Alles wird gut, Frau Heydt. Bei Herrn Dr. Lexied sind Sie in den besten Händen. Ein sehr gewissenhafter Mensch, das muss man sagen. Ist sogar am Samstag für Sie da und auf die defekte Notfallbeleuchtung, Sie wissen schon, hat er mich auch hingewiesen. Könnten Sie gelegentlich ein neues Lämpchen einsetzen?« »Sie haben einen neuen Autor engagiert, Kerkhoff.« »Ähm, ja, ich muss doch …« »Der schreibt so furztrocken, dass man sich beim Lesen besaufen möchte. Hier – ich habe gestern meine eigene Fassung geschrieben.« Engel hatte die Szene in der Küche aufmerksam beobachtet, vor allem die Verdächtige. Inszenierte sie sich? Wenn ja, dann besaß sie Talent. Ihre Stimmungsumschwünge, die sprunghaften Distanzwechsel – von ironischem Sicherheitsabstand zu einer verbalen Umarmung und wieder zurück – wirkten echt auf ihn. Und trotz – oder wegen? – all der Widersprüchlichkeit nicht unsympathisch. Doch die Fakten sprachen allesamt gegen Anna Heydt. »Wir müssen reden«, sagte er, als sie allein waren. »Reden? Sie haben selbst gehört, was mein Anwalt sagt. Und tun Sie nicht so freundlich, mich wickeln Sie nicht ein.« »Haben Sie vielleicht ein Wasser für mich?« Anna deutete auf den Kühlschrank. »Gläser sind im Schrank, oben rechts.« Er bediente sich. Neben der Spüle registrierte er eine leere Schnapsflasche, die bei der Hausdurchsuchung nicht da gestanden hatte. Schon die Flaschen und Dosen, über die sie gestern gestolpert waren, hatten auf eine Trinkerin hingewiesen. Er setzte sich zu Frau Heydt an den Tisch. »Ich halte es für keinen Verlust, dass es nicht zur ärztlichen Untersuchung gekommen ist.« Er räusperte sich. »Aber wir sollten zumindest mündlich kurz über … ähm … Nun ja, es wurde Analverkehr praktiziert. Deswegen … Kurz gefasst: Praktizieren Sie …?« »Nein. … Jedenfalls nicht richtig.« Sie spürte, wie ihre Birne rot anlief. »Scheiße, ist das peinlich.« Engel starrte angestrengt in seinen Notizblock. Man konnte den Wasserhahn tropfen hören. »Praktizieren Sie denn Analverkehr, Commissario?« Anna Heydt und ihre Provokationen! »Diese Frage ist doch wohl für den Arsch, Frau Heydt.« Hätte er was Blöderes sagen können? Das kam dabei heraus, wenn man origineller sein wollte als man war. »Schon klar, dass Sie nicht in Ihr Vernehmungsprotokoll schreiben: ›Heydt hat’s gern im Po, ich übrigens auch.‹ Wollte Ihnen nur zeigen, wie peinlich das für mich ist.« »Ich nehme Ihre Antwort so unpersönlich wie möglich.« Ihm fiel eine Parallele ein. »Ich habe meinen Zivildienst im Krankenhaus geleistet und da gab es viele Hintern abzuputzen. Schlimm war nicht die Tätigkeit an sich – also nicht, dass ich, ähm …« »Ein Scheißvergnügen dran hatte.« »Belastet hat mich vor allem die Peinlichkeit, dass sich die Patienten von mir sauber machen lassen mussten. Aber mit der Zeit habe ich gelernt, mich hinter meinen weißen Kittel zurückzuziehen. Um die Hintern hat sich der Kittel gekümmert, in dem zufällig ich steckte. So ähnlich handhabe ich es heute auch.« »Dann müssen Sie noch viel üben. Und Sie waren Zivi?« »Ja, wieso?« »Stelle ich mir bei Polizisten nicht vor.« »Dummes Klischee.« »Saudummes!« »Sie müssen immer eins draufsetzen, nicht wahr?« »Und Sie halten sich gern bedeckt, nicht wahr?« »Was bringt Sie darauf?« »Keine Ahnung. Nur ein Gefühl.« »Vielleicht, weil Sie sich auch gern bedeckt halten?« »Möglich«, sie lachte, »aber was bei Ihnen die Glacéhandschuhe, sind bei mir die Boxhandschuhe, da kriegen die Bundesbürger schnell mal was auf die Nase!« »Bundesbürger?« »Die vielen Nullen, die man braucht, um auf einundachtzig Millionen zu kommen.« »Die vielen Nullen, aha. Und welchen Wert tragen Sie bei?« »Gute Frage. Jedenfalls bin ich keins von den Nüllchen, die sich brav hinten dranhängen. – Eher eine Primzahl.« »Nur durch sich selbst und eins teilbar?« »Bingo. Obwohl …«, sie seufzte theatralisch, »wahrscheinlich bin ich nicht mal durch mich selbst teilbar. Irgendwie kommen immer krumme Ergebnisse bei mir raus.« »Und wehe, wenn nicht – oder?« »Sieh an, der Herr Kriminal-Kompetenz-Kommissar kennt sich sogar mit Psycho aus.« Sie grinste. »Klüger als die Polizei erlaubt. Kommt bestimmt nicht gut an bei den Kollegen. Richtig gut teilbar sind Sie auch nicht – oder?« Engel grinste zurück. »Wenn Sie kein lästiger Bulle wären, wer weiß, vielleicht gingen Sie sogar als Mensch durch. Wenn!« Sie grinste noch immer, aber Engel klinkte sich aus. Er war ein Bulle. Er hatte einen Auftrag. Und eine wichtige Frage. Anna sah sein Lächeln verschwinden wie die Sonne hinter Wolken. Kaum hatte sie den silbernen Schimmer in seinen grauen Augen bemerkt, war er verflogen. Sie wurde wieder gemustert. »Sagen Sie, haben Sie einen Fleck, vielleicht ein Feuermal, auf dem Oberschenkel?« Anna saß wie vom Donner gerührt da. Jetzt wusste er auch noch von ihrem Feuermal? »Was veranlasst Sie zu der Vermutung?« »Was glauben Sie?« »Die Frau auf dem Video hat eins?« »Treffer.« Anna konnte es nicht fassen. Das gefakte Video war bis ins intimste Detail perfekt. Sie hatte nur einen Kerl in die Nähe ihrer Schamlippen gelassen, seit ihr Mann auf die Blondine umgestiegen war. Diese verklemmte Type war mit dem Kopf aber gar nicht bis in ihren Schoß vorgedrungen. Und da musste man schon hin, um die kleine Stelle, nicht größer als ein Fünfcentstück, zu entdecken. Und Engel hatte sie aufgespürt! Dieser blöde Spanner! Anna lief mindestens so rot an wie das Feuermal und drehte sich schnell weg, um Zigaretten aus einer Schublade zu kramen. Der Scheißkerl rückte ihr immer dichter auf den Leib. »Oberschenkel, ja? Wo denn da?« Was für eine dämliche Frage! Ein derart offensichtliches Ausweichmanöver musste selbst die Frankfurter Polizei bemerken. »Ganz oben, Frau Heydt. Linker Oberschenkel vom Körper aus betrachtet.« »Da sind Sie mir bis zum Anschlag zwischen die Beine gekrochen, ja? Und, hat’s Spaß gemacht?« »Sie behaupten doch, es seien gar nicht Ihre Beine.« »Aber jeder, der sich das Video reinzieht, meint, mir zwischen die Beine zu glotzen!« »Haben Sie ein Feuermal?« »Und bei Ihnen dachte ich, da ist ein Bulle mal kein Rindvieh. Und dann kommen Sie mir mit dieser minderbemittelten Frage. Als käme es darauf an.« »Sie behaupten, das Video sei ein Fake. Unterstellt, es stimmt: Der Täter müsste dann gegebenenfalls vom Feuermal in Ihrer Intimzone wissen.« »Was wissen Sie denn, wie intim meine Zone ist!« »Sie verstehen immer noch nicht. Ich ermittle, um Licht ins Dunkel zu bringen. Das schließt entlastende Tatsachen ein.« Was kein Bluff war. Sex mit einem Kind schien ihm nach wie vor jenseits dessen, was sie sich hätte durchgehen lassen. Ein Video davon zu machen und es ins Netz zu stellen, deutete zudem auf planmäßiges Vorgehen hin und damit auf ein Milieu, in dem Kinder systematisch sexuell ausgebeutet wurden. Wie weit er das typische Profil dieser Klientel auch dehnte, Anna Heydt passte nicht hinein. »Schauen Sie, Frau Heydt: Wenn Sie kein Feuermal haben, spricht alles für ein getürktes Video.« »Dann sollen Ihre blöden Experten endlich den Verstand einschalten. Das Video ist gefakt!« Sie stöhnte demonstrativ. »Unsere Leute haben ausprobiert, was mit unserer Ausrüstung möglich ist.« »Dann taugt die eben nichts.« »Dass ich es nicht vergesse: Sie haben einen Internetanschluss, aber keinen Computer?« »Ist beim Pfandleiher.« Sie gab ihm die Adresse. »Als ich ihn da abgegeben hab, war noch kein Pornovideo drauf. Würde mich aber nicht wundern, wenn’s mittlerweile drauf ist. Wahrscheinlich startet es von selbst!« Die grauen Augen ließen nicht von ihr ab. »Wenn Sie gelinkt werden, finde ich es raus.« »Quatschen Sie nicht so schleimig rum! Das ist hier ein Minenfeld, und da wollen ausgerechnet Sie meinen Pfadfinder geben? Was sind Sie, Mitglied beim Fähnlein Fieselschweif?« Ihr war selbst peinlich, was für einen Stuss sie zusammenfaselte, aber sie wusste sich nicht anders zu helfen. »Ich bin Polizist, sonst nichts«, entgegnete Engel seelenruhig. »Ich suche Antworten auf Fragen, um etwas aufzuklären. Etwas, das Sie anscheinend nicht aufklären möchten. Sie sagen wirklich nichts zum Thema Feuermal?« »Langsam habe ich die Nase von Ihnen voll! Überfallen mich am Samstag in meiner Wohnung … Ihnen war langweilig, richtig? Auf jemanden wie Sie wartet am Wochenende natürlich niemand, und dann klappern Sie aus lauter Frust Ihre Kunden ab. Aber nicht mit mir, klar? Sie schieben jetzt schön Ihren Arsch raus und probieren es woanders.« »Wir sehen uns, Frau Heydt. Danke für das Wasser.« Während Anna vom Fenster aus beobachtete, wie der Bulle in seine Karre stieg, überkam sie das große Zittern. Wer auch immer ein Netz über ihr ausgeworfen hatte – die Maschen zogen sich zu. Und sie hatte nicht die leiseste Ahnung, wie sie sich freischwimmen sollte. Innerhalb der nächsten Stunde wandelte sich Annas Stimmung komplett. Statt sich wieder müde zu trinken, versenkte sie die Matschbirne in einer Plastikwanne mit Eiswürfeln. Jetzt ging es ihr besser. Allmählich stieg ein altbekanntes Gefühl hoch, das derzeit einzig lebendige: Aggressivität. Wer immer hinter dem Video steckte, sollte sie nur nicht unterschätzen! Die Bullen mochten sich von ihm am Nasenring packen und vorführen lassen – sie nicht! Das Video war gefakt, also musste es Spuren geben, und ein Fachmann würde sie finden, wenn er entschlossen genug suchte. Nur, woher nehmen und nicht stehlen? Plötzlich fiel ihr die HfG ein, die Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Da gab es bestimmt auch einen Zweig für Film und Video. Der Lehrkörper würde wahrscheinlich den Schwanz einziehen bei dieser Art von Video, aber bei den Studenten hatte sie vielleicht mehr Glück. Sie stellte sich einen Nerd vor, der in sexuellem Brachland lebte. So einer musste doch interessiert sein, wenn als Lohn eine exklusive Pornovorführung im Beisein der vermeintlichen Hauptdarstellerin winkte. Gegen halb zwölf stieg sie an der Konstablerwache in die S1 nach Offenbach – dachte sie. Im letzten Augenblick bemerkte sie, dass sie die falsche Bahn erwischt hatte und kam mit einem gewagten Sprung gerade noch heraus. Glück gehabt. Genau genommen sogar doppeltes Glück, denn auf diese Weise schüttelte sie einen Schatten ab, was sie jedoch nicht bemerkte. Kurz darauf befand sie sich am Offenbacher Marktplatz und stiefelte tatendurstig zur HfG. Neunzig Minuten später starrte sie in der HfG-Cafeteria in ihren Kaffeebecher. Zunächst hatte sie gewähnt, heute sei ihr Glückstag, denn die HfG hatte nur ausnahmsweise wegen einer Veranstaltung am Samstag geöffnet. Und es hockten hier tatsächlich einige Studis rum – aber was für welche! Glücksfälle konnte man die mit Sicherheit nicht nennen. Vor lauter Frust zog sie sich die Kapuze des Nickipullovers über den Kopf. Von wegen, sich einfach durchquatschen. Von Tisch zu Tisch dieselben reservierten Jungfratzen mit ihrer nur um Ausreden nicht verlegene Verlegenheit. Freigeister? Das waren vollblütige Bundesbürger, die mit kreativem Wildwuchs so viel gemein hatten wie eine Fichtenschonung mit Urwald. Scheiße. Als ihr jemand auf die Schulter tippte, tippte Anna auf Hochschulverwaltung und ein Hausverbot. Die junge Frau trug eine blassblaue Bluse und einen karierten Wollrock, alles an ihr schrie nach Junger Union, wenn nicht gar nach Katholischen Landfrauen, und so oder so nach besserem Fräulein. Ihr Name sei Elisabeth, stellte sich das Fräulein vor. Sie habe mitgehört, was Anna den beiden Jungs am Nebentisch verklickert hatte, und sei neugierig geworden. Sie wüsste gern mehr. Wie der erste Eindruck täuschen konnte. Das Fräulein löcherte Anna mit Fragen über die Hintergründe und legte dabei eine engelsgleiche Hartnäckigkeit an den Tag. Schließlich nickte sie: Ja, sie glaubte Anna und würde helfen. Elisabeth chauffierte sie in einem roten Mini nach Frankfurt zurück. Sie besaß eine Anlage, mit der sie das Video ein wenig zerlegen könnten. Elisabeth hielt vor einer Gründerzeitvilla, die selbst im noblen Holzhausenviertel herausstach. Was das »bessere Fräulein« betraf, hatte Anna sich jedoch längst korrigiert. Selten war sie einem so selbstverständlichen, unverkrampften Menschen begegnet. Elisabeth bugsierte sie ums Haus herum zu einer Treppe, von wo es in ihr Studio hinabging: einen Kellerraum, vollgestopft mit Monitoren, Computern und Kartons mit Kabeln und Drähten. So hatte sich Anna die Höhle eines ins Virtuelle abgedrifteten Freaks vorgestellt, aber bestimmt nicht Elisabeths »Studio«. Auf der mindestens vier Meter langen Arbeitsplatte herrschte immerhin Ordnung. Zwischen zwei fetten Rechnern am linken und rechten Ende standen drei flache XL-Monitore und zwei Geräte mit Einschubklappen. Davor eine Tastatur und ein üppig bestücktes Mischpult. Das sah gar nicht so unprofessionell aus, da würde sich bestimmt was machen lassen. Elisabeth dämpfte ihre Hoffnung: Digitale Videomanipulationen seien mittlerweile in solcher Perfektion machbar, dass sie sich schwer nachweisen ließen. Sie luden das Video von Annas E-Mail-Konto herunter und schauten es sich an. Elisabeth zuckte nicht mal mit der Wimper. Stattdessen erklärte sie, was man für diese Manipulation benötigte: zunächst eine Videoaufnahme des Wohnzimmers, dann eine Bluebox, also einen blau ausgekleideten Raum als neutralen Hintergrund und schließlich eine spezielle Videobearbeitungssoftware. »Die in der Bluebox gefilmten Darsteller werden freigestellt und dann in das eigentliche Hintergrundbild kopiert, in deinem Fall das Wohnzimmer. Anschließend wird dein Gesicht hineinmontiert. Keine allzu große Herausforderung, weil man’s ja nur ganz kurz sieht. Wo deine Mundpartie zu sehen ist, muss man sie mit dem Stöhnen der Frau synchronisieren. Das war’s im Wesentlichen schon. Der Körper der Frau muss natürlich möglichst genau mit deinem übereinstimmen. Vorausgesetzt, es ist nicht dein Körper.« Das hatte Anna noch gar nicht in Erwägung gezogen. Sie dachte nach. »Um das Wohnzimmer zu filmen, muss jemand in meiner Wohnung gewesen sein. Vielleicht hat derjenige ja noch ganz andere Sachen gefilmt – in meinem Schlafzimmer.« »Du mit einem Mann?« »Mir hat schon lange keiner mehr beigewohnt.« »Keiner – was?« »Kein Beischlaf.« »Wenn’s in deinem Bett so zugeht, wie’s klingt … Na, ist deine Sache. Wenn kein Beischlaf, dann vielleicht Selbstbefriedigung?« Elisabeth nahm kein Blatt vor den Mund. Anna nickte nachdenklich. »Der Täter müsste eine Kamera installiert haben«, überlegte Elisabeth. »Es gibt mittlerweile so kleine Dinger, die sieht man kaum.« Sie schauten sich das Video erneut an. Die Frau lag anfangs rücklings auf dem Couchtisch, den Kopf über den Tischrand nach hinten gestreckt. Kurz bevor der Junge von der Seite ins Bild trat, zeigte sich das Feuermal zwischen den gespreizten Oberschenkeln – vorausgesetzt, man hielt das Bild an und zoomte auf die Stelle. Vom Körper der Frau bekam man in der liegenden Position keinen genauen Eindruck. Anna rasierte sich nicht, weil eine blanke Mädchenmuschi ihrer Meinung nach zu Sex passte wie ein Kommunionskleidchen zu einem Rockkonzern. Sie betrachtete die Schambehaarung auf den Filmbildern. Schien grob zu passen, aber wer zählt schon seine Schamhaare. Sie vermochte einfach nicht zu sagen, ob es sich um ihren Körper handelte. Im nächsten Bild verdeckte der Junge die Frau bereits, auch als sie sich umdrehte und ihm den Hintern entgegenstreckte. Elisabeth machte sie darauf aufmerksam, wie geschickt die Szene gestellt war, in der man ihr Gesicht kurz sah: Die Bewegung, die den Blick freigab, vollführte der Junge, indem er sich etwas zur Seite beugte, wohingegen der Kopf der Frau sich nicht bewegte. »Dieses Arrangement hat die Montage erleichtert. Andere Frage: Was ist mit dem Stöhnen? Klingt das nach dir?« Ja, es klang nach ihr, fand Anna. »Eine Wanze in deinem Schlafzimmer?« Anna sprang auf. Sie wollte das auf der Stelle prüfen. Engel, der Blindgänger, hätte doch über ein ganzes Spionagekommando stolpern können, ohne es zu bemerken. Endlich ein Ansatzpunkt! Elisabeth ließ sich von ihrer Unruhe nicht anstecken. »Eins nach dem anderen.« »Ich muss auch einen Schlüsseldienst beauftragen, das Schloss auszutauschen.« »Da hab ich vielleicht eine bessere Idee.« Elisabeth erklärte ihr, woran sie dachte. »Aber erst gehen wir das Video noch mal Bild für Bild durch.« Anna nahm Platz, so schwer es ihr auch fiel, sich wieder zu konzentrieren. Es sollte sich lohnen. Als ihr Blick auf Hose und T-Shirt des Jungen fiel, die auf dem Boden lagen, erregte etwas ihre Aufmerksamkeit. Elisabeth zoomte den Ausschnitt heran und drehte so lange an Knöpfen, bis sie das Maximum an Schärfe herausgeholt hatte. Jetzt erkannte Anna, was ihren Blick angezogen hatte: ein Buchstabe auf dem dunkelblauen T-Shirt, der aus einer Falte herausschaute. Ein rosafarbenes, bauchiges »a« mit einem Häkchen am Ende, einer Serife. Die modernisierte Type einer klassizistischen Schriftart, wahrscheinlich der Bodoni. Egal. Wichtiger war, dass in ihrem Hinterkopf eine Erinnerung spukte. »Bergmann«, rief sie plötzlich. Ihre Katzenaugen funkelten, als habe sie Mäuse gerochen. »Ich glaube, der Schriftzug stammt von Bergmann Grund & Boden, die machen hier in Immobilien! Es lag mal ein Handzettel von denen in der Zeitung und ich hab den Schriftzug kopiert und bearbeitet – ist mein Steckenpferd.« »Genial!« »Dann lass uns mal deren Website einen Besuch abstatten.« Sie konnten ihr Glück kaum fassen: Bergmann engagierte sich für soziale Projekte in Frankfurt und sponserte ein Jugendcafé in der Nordweststadt! Sie riefen dessen Homepage auf und hatte noch einmal Glück: Es hatte samstags bis siebzehn Uhr geöffnet. »Kannst du mir das Gesicht des Jungen freistellen?« »Ist aber nur eine Seitenansicht.« »Ja, ja. – Kannst du?« Statt zu antworten begann Elisabeth am Mischpult rumzufummeln. Was der Drucker einige Zeit später ausspuckte, konnte man zwar nicht gerade ein Megapixelbild nennen, doch wenn jemand den Jungen kannte, würde es wohl reichen. Elisabeth nahm ihren nachtblauen Dufflecoat vom Tisch. »Wir fahren da jetzt hin, uns umhören, richtig?« »Willst du mitkommen?« »Was denkst denn du!« Anna schaute überrascht. Was Elisabeth bereits alles für sie getan hatte, war schwer zu fassen für einen Menschen, der sich längst am untersten Ende der Beliebtheitsskala eingerichtet hatte. Sie sah auf die Uhr. Kurz nach vier, höchste Zeit aufzubrechen. Plötzlich zog Elisabeth ein langes Gesicht. Annas Blick auf die Uhr hatte sie an etwas erinnert. »Ich kann nicht. Meine Mutter.« Sie schluckte. »Meine Mama stirbt. Nachmittags gehe ich immer hoch, um ihr Gedichte vorzulesen.« Anna verstand selbst nicht, was über sie kam, als sie Elisabeth in die Arme nahm und drückte. »Das tut mir leid«, sagte sie leise und hielt die junge Frau schweigend fest. Schließlich löste sich Elisabeth. »Rufst du mich heute Abend an und erzählst, was du rausgekriegt hast?« »Versprochen.« »Halt mal. Mit den Öffentlichen schaffst du es nicht rechtzeitig. Nimm meinen Wagen.« »Du willst mir deinen Mini geben?« »So bin ich wenigstens sicher, dass ich vom Ausgang erfahre.« Sie grinste. »Du musste ihn ja nicht gleich vor die Wand fahren.« Die am Reißbrett geplante Nordweststadt gehört zwar nicht gerade zu Frankfurts besseren Adressen, aber auch nicht zu den Problemvierteln. Die Siedlung hat man um ein Einkaufszentrum herum gebaut, in dessen Nähe sich das Jugendcafé befand. Endlich hatte Anna das Haus gefunden, die Dämmerung setzte bereits ein. Sie stieß die angelehnte Tür auf und betrat einen langen Flur, dessen rechte Wand ein großes Dino-Graffiti zierte. Gleich neben dem Eingang gab es einen Raum mit einem Tischkicker, an dem zwei Teenies die Stangen wirbeln ließen. Anna blieb kurz stehen. Dem Zählerstand nach führte einer der beiden mit sieben zu eins, und dem Gesicht des Jungen nach zu urteilen, führte das Mädchen. »Hallo, kann ich was für dich tun?« Anna musterte den jungen Mann, der ihr durch den Flur entgegenkam. Der holde Wuschelkopf war schätzungsweise Anfang zwanzig und nett anzuschauen. Typ Sympathieträger. »Hallo. Arbeitest du hier?« »Ich mache ein freiwilliges soziales Jahr.« »Finde ich gut«, sagte sie und zog den Computerausdruck aus der Parkertasche. »Ich suche den Jungen hier. Kennst du den?« Er betrachtete das Bild – und nickte. Anna spürte ihr Herz schneller schlagen, es bekam heute wirklich viel zu tun. »Weißt du, wie er heißt?« »Nö, doch ich bin mir ziemlich sicher, dass er auf unserem Herbstfest war. Ich hatte ihn noch nie hier gesehen, deswegen ist er mir aufgefallen. Seitdem hab ich ihn nicht wiedergesehen.« Schade aber auch. Egal. Wenn der Junge hier aufgetaucht war, ging er bestimmt in der Nähe zur Schule. Mit dieser Steilvorlage musste selbst Engel einen Treffer landen. »Worum geht’s denn?« Vom Ende des Flurs näherte sich eine blasse Presswurst in Jeans, bedachte Anna mit einem Türsteherblick und nahm ihr das Blatt aus der Hand. »Philipp, Philipp. Das ist mal wieder typisch.« Die Frau schüttelte abfällig den Kopf. »Man sieht gar nix Genaues, aber du willst nach Monaten noch wissen, dass so einer hier abgehangen hat! Wann wirst du bloß endlich erwachsen?« Philipp wurde rot. Anna spürte, welche Überwindung es ihn kostete, nicht den Schwanz einzuziehen. Sein weiches Gesicht nahm einen grimmigen Zug an. »Ich kann mich an den Jungen erinnern, weil er einer von denen war, an die du die T-Shirts verschleudert hast. Und am Ende sind einige, die regelmäßig kommen, leer ausgegangen. Die haben ziemlich belämmert geschaut. Wie sollte ich das vergessen?« »T-Shirts? Vielleicht von Bergmann Immobilien?« Anna hielt die Luft an. »Ja, genau.« Philipp nickte geistesabwesend. Zwischen ihm und seiner Chefin fand gerade ein Duell statt, wer den anderen mit Blicken töten konnte. Plötzlich knöpfte sich die Frau Anna vor. »Was schnüffeln Sie hier eigentlich rum? Wer sind Sie überhaupt?« »Und Sie?« »Ich leite den Laden.« »Leiten? Sie sehen eher nach Ladenhüter aus.« Anna gab Fersengeld, bevor die Giftspritze reagieren konnte. Sie hatte genug gehört. Zurück bei Elisabeth, begannen sie, Pläne zu schmieden: Sie würden es dem Schwein heimzahlen, wenn ihn die Polizei endlich gefasst hatte. Noch wusste die Polizei allerdings nichts von ihrer genialen Ermittlungsarbeit. Anna würde Engel gleich am Montagmorgen anrufen und dann sollte er sich wundern! Sie fuhren in Annas Wohnung, um die Idee zu realisieren, die Elisabeth am Nachmittag gekommen war. Dann teilten sie sich einen Piccolosekt und verabredeten sich für Dienstag. Anna ging es so unverschämt gut, sie hätte Bäume ausreißen können. Stattdessen besorgte sie zwei neue Fahrradreifen und brachte die Pfriemelei gleich hinter sich. Sie machte sich überhaupt keine Sorgen mehr. COMPUTERFAHNDUNG | E-GRANADA Jesús war spät dran. Als er die kleine Bar betrat, stand Vincente schon Bier schlürfend am Tresen. »Ah, mi amigo aleman. Ahmad, ein Bier für meinen Freund!« »Musst du mich immer so nennen?« »Wieso denn nicht? Du sprichst deutsch, bist zuverlässig, ordentlich, pünktlich …« »Ich bin zu spät dran, und das heute schon zum zweiten Mal!« »Siehst du! Ein Spanier hätte das überhaupt nicht bemerkt!« »Hola, Jesús«, begrüßte ihn Ahmad und stellte ihm ein Bier und einen Teller mit drei Garnelen hin, der hier üblichen Beigabe. In Granada gehörte ein kleiner Gaumenkitzel glücklicherweise noch zur Lebensart. Aber wie andere spanische Sitten war auch die TapasTradition in Gefahr: Was sie an Großzügigkeit und Kultur enthielt, drohte zu verschwinden oder sich in eine gastronomische Einnahmequelle zu verwandeln. »Im Ernst, Jesús. Ich reite wahrscheinlich darauf herum, weil du mit dem, was in Deutschland war, so hinterm Berg hältst.« »Ich habe da ein paar Jahre gelebt, mehr gibt es nicht zu erzählen.« »Wer’s glaubt. Was hast du da überhaupt gemacht? Ich meine, du bist schließlich Spanier.« »Jetzt also doch?« Jesús lächelte und nahm einen Schluck Bier. »Geht es Glorias Vater wieder besser?« Vincente betrachtete ihn. »Genau das habe ich gemeint. Na gut, jeder hat seine Geheimnisse. Ja, der Schlaganfall ist glimpflich verlaufen. Ganz anderes Thema. Beug dich mal vor und lins um die Ecke.« Er deutete auf den Durchgang zum hinteren Gewölbe. »Siehst du sie? Ich meine die Brünette. Hübsch, nicht? Heißt Ignacia.« »Lastet deine Frau dich nicht mehr aus?« »Ich meine dich, Blödmann!« »Und ich dachte, das Kuppeln fällt in Glorias Ressort.« »Komm schon, setzen wir uns dazu!« Jesús schüttelte den Kopf. »Was bockst du denn so rum? Gloria versteht überhaupt nicht, weshalb du solo bist. Du solltest sie von dir schwärmen hören. Eigentlich steht sie ja auf meine blauen Augen, aber bei deinen – Zitat – Bernsteinaugen könne sie auch schwach werden … Und die Locken!« Er imitierte eine piepsige Frauenstimme, die mit Gloria so viel gemein hatte, wie Vogelgezwitscher mit Löwengebrüll. »Locken?« Jesús fuhr mit der Hand durch seine schwarzen, leicht gewellten Haare. »Als Lockenköpfchen habe ich mich überhaupt noch nicht gesehen.« »Lockenköpfchen – das ist gut! Jetzt habe ich den Ersatz gefunden für ›mi amigo …‹, du weißt schon.« Offenbar hatte er Gefallen an der Frauenrolle gefunden, denn er fuhr mit dem Piepsstimmchen fort: »Und seine Lachfältchen! – Obwohl …« Er wurde ernst. »Die sind in letzter Zeit tiefer geworden, nicht wahr? Du machst einen erschöpften Eindruck. Schläfst du zu wenig?« Da schien sie wieder auf, die nachdenkliche und aufmerksame Seite, derentwegen er Vincente vor allem mochte. Jemanden zum Quatschen fand man unter Spaniern immer, Gott hatte die Sprache ja überhaupt nur erfunden, damit Spanier was zum Quatschen hatten. Da war ein Thema so gut wie das andere, Hauptsache, es lud ein, in Gesellschaft viele Worte zu machen. Leute, mit denen man in die Tiefe gehen konnte, gab es natürlich auch, aber nicht wie Sand am Meer, die musste man sich suchen. Und Vincente war der Wichtigste von ihnen. »Ich träume schlecht«, räumte Jesús ein. »Ich meine, das sind gar keine richtigen Träume, ich bin wach dabei und sehe …« Er berichtete, hilflos nach Worten suchend, von den seltsamen Gesichtern und der merkwürdigen Unruhe, die ihn dabei überfiel. Gloria unterbrach seinen Erklärungsversuch. Wie immer eine Bugwelle aufgewirbelter Luft vor sich herschiebend, rauschte sie in die Bar, im Schlepptau eine junge Frau, die wahrscheinlich Jesús vorgeführt werden sollte. »Geld! Rück zehn Euro raus, Vincente, der Taxifahrer wartet draußen! Und bestell ein Bier, mir brennt die Kehle.« Während Vincente ein Bündel Geldscheine aus der Hosentasche zog, fiel sein Blick auf Jesús’ erstarrtes Gesicht. »Hey, was ist los?« Jesús hörte es nicht. Etwas hatte seine Wahrnehmung nach innen gezogen. Er sah einen Lichtschimmer, der aus dem Dunkel seiner Erinnerung drang, nur schwach, doch wenn er ganz genau hinsähe, würde er vielleicht erkennen, woher die Gesichter kamen. Die Lösung war zum Greifen nah. »Entschuldigt, ich muss weg, ich …« Noch bevor seine Freunde etwas sagen konnten, hatte er sich davongemacht. Er stürmte die Stufen zu seiner Cueva hoch. Er brauchte Ruhe und was zum Schreiben. Endlich saß er mit Blatt und Stift am Tisch. Zu spät, der Lichtschein hatte sich verflüchtigt. Worum war es denn gegangen, bevor ihn diese Ahnung überfallen hatte? Er hatte versucht, Vincente die Erscheinungen zu beschreiben. War es da passiert? Es wollte einfach nicht klick machen. Dann hatte Gloria die Bar gestürmt und etwas von einem Taxi gesagt. Da musste es passiert sein. Aber was und wieso? War einer der beiden Männer vielleicht Taxifahrer? Er grübelte und grübelte und merkte nicht, wie er auf die Glasplatte sank und einschlief. Zum ersten Mal sah er die Gesichter auch im Schlaf. Sie blitzten abwechselnd auf. An … aus … an … aus – null … eins … null. Als Jesús gegen vier in der Frühe erwachte, hatte sein Hirn den Datenabgleich beendet und meldete das Ergebnis. Eines der beiden Gesichter hatte es identifiziert. IN EHRE UND EWIGKEIT | D-EPPSTEIN/TAUNUS Guido nickt, kann aber immer noch nicht fassen, dass es schon in einer Stunde geschehen soll. Ein Mal hat er selbst als Schütze an der Zeremonie mitgewirkt und damals lag ein ganzer Tag zwischen der Ankündigung und der Ausführung. »Ich würde gern vorher duschen.« »Tu das, mein Junge«, entgegnet Iwan, der Leiter des Sicherheitsdienstes. »Ich lasse dir die weiße Uniform bringen. Bist ein braver Kerl, aber leider feige. Ich verstehe das nicht, du warst doch mal ein mutiger kleiner Knabe. Jedenfalls ist Feigheit ein Frevel, das weißt du selbst. Überwinde dich ein letztes Mal. Deine Bestimmung ist nun, die anderen an ihre Pflichten zu erinnern. Stärke den Bund durch dein Vorbild!« Mit einem Ruck steht Guido auf und nimmt Haltung an. »Ich werde euch keine Schande machen.« Achtundfünfzig Minuten später wird er abgeholt. Aufrecht steigt Guido die Stufen zum Gelöbnisraum hinab. Von unten dringt Musik herauf: Posaunen, die ihn an Kirche erinnern, nein, nicht an Kirche, an Heiligabend erinnern sie ihn – an einen Heiligen Abend daheim! Er sieht das Bild ganz klar, sieht sich eine Treppe hinuntersteigen, wie jetzt auch. Mama führt ihn ins Wohnzimmer, wo ein unsagbar großer Weihnachtsbaum unsagbar schön strahlt. In all den Jahren ist die Schatztruhe seiner Erinnerungen leer geblieben, und nun, in seinen letzten Minuten, füllt sie sich mit diesem wunderbaren Wiedererleben. Mama ist nicht so schön, wie er sie sich vorgestellt hat, aber sie ist echt. Er lächelt, von dem Gedanken beseelt, dass er sich nicht getäuscht hat. Er hat wirklich eine kleine Weile bei Mama leben dürfen, bevor sich die Türen des Waisenhauses hinter ihm schlossen. Es war ein besonderes Waisenhaus, da wurde man … Guido erinnert sich kaum noch. Nur eines weiß er ganz genau: Der Salvator hat ihn gerettet! Er hört sein Blut wie einen mächtigen Strom durch den Klang der Posaunen rauschen, und sein Herz schlägt den Rhythmus, schwer und schicksalhaft. Der Gelöbnisraum wird von Kerzenschein erhellt, in der Mitte liegt eine schwarze Decke. Fünf Kameraden stehen, militärisch stramm, die rechte Hand auf der Brust, um die Decke herum. Auch sie tragen die weiße Paradeuniform. Zu ihren Füßen liegen, ordentlich ausgerichtet, die Waffen. Ein schönes Bild. Das alles für ihn. Guido versucht, stolz auf sich zu sein. Iwan bedeutet ihm, sich auf die Decke zu legen. Der Salvator betritt in seiner schwarzen Uniform den Raum und nimmt den Platz am Kopfende ein. Er beginnt zu sprechen: »Ich bin der Moment und ich bin die Hoffnung …« Guido versucht, mit geschlossenen Augen zuzuhören, doch er kann den Worten nicht folgen. All die schicksalsergebene Herrlichkeit ist plötzlich dahin, die nackte Angst packt ihn. Sein Herz flattert wie ein aufgescheuchtes Huhn. Verzweifelt beißt er die Zähne aufeinander, als seine Blase die Zeremonie zu beflecken droht. Vielleicht ist Mama schon tot, vielleicht erwartet sie ihn auf der anderen Seite des Lebens, macht er sich Mut. Die Posaunen verklingen. Die Männer stimmen ein Lied an. Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum, Vogelsang uns nie erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Während sie singen, gibt Iwan den Befehl, die Waffen zu ergreifen. Das passt nicht, denkt Guido. Er hat es schon gedacht, als er selbst vor einem am Boden liegenden Kameraden gestanden und die Waffe ergriffen hat. Feinde erschießt man einfach – aber Kameraden? Er hat Iwan gefragt. »Parshivaya ovtsa vsjo stado portit«, hat der geantwortet: Ein einziges räudiges Schaf verdirbt die ganze Herde. »Es passt, weil jeder, der das Ziel in Gefahr bringt, ein Feind ist. Vergiss nie: Der Zweck ist heilig, die Mittel beliebig.« Guido hat es hingenommen, doch während er hier liegt und am Klicken erkennt, wie die Waffen entsichert werden, beschleichen ihn wieder Zweifel. Es ist schon richtig so, es ist schon richtig so, jetzt schießt doch endlich! Nutzlose Angst überfällt den achtzehnjährigen Delinquenten. Vom vegetativen Nervensystem angefeuert, schießen Herzschlag, Blutdruck und Atmung durch die Decke, alle Vitalfunktionen auf Flucht oder Angriff getrimmt. Dabei will er weder das eine noch das andere. Er will mit Anstand den letzten Schritt der Pflichterfüllung vollziehen, sonst nichts. Sein Körper versucht sich aufzubäumen, doch er zwingt ihn zu Boden. In Ehre und Ewigkeit! DAS HEIDENHEIM | E-GRANADA Jesús saß, einen Cortado vor sich und den Propangas-Ofen neben sich, auf der Couch und starrte Löcher in den Sonntagmorgen. Er wusste jetzt, woher er den alten Mann kannte. Er hatte ihn nicht weiter beachtet. Und es blieb ihm ein Rätsel, weshalb sein Unterbewusstsein sich plötzlich an ihm abarbeitete. Es war bei den Gegenüberstellungen vor drei Jahren gewesen. Damals hatte die Polizei – mit knapp dreißigjähriger Verspätung – Mitglieder einer Bande geschnappt: Verbrecher, die in den Siebzigerjahren Jungen im Alter von fünf bis zwölf als Sexsklaven gehalten hatten. Bereits 1977 hatte man das Lager, ein aufgelassenes landwirtschaftliches Anwesen, ausgehoben und die Jungen befreit. Dabei hatte man aber nur einen der Täter gefasst, einen lumpigen Handlanger, die Stallwache sozusagen, und überdies tot, bevor die Polizei handfeste Informationen aus ihm rausholen konnte. Erst 2006 gelang es mithilfe von DNA-Tests, einen weiteren Täter aus dem Trüben zu fischen, und in den Folgeermittlungen waren noch andere Verdächtige ins Netz gegangen. Jesús hatte als eines der Opfer ausgesagt. Zwei Mittäter hatte er bei Gegenüberstellungen identifizierte. Auch der alte Mann aus seinen Tagträumen stand in einer der Männerreihen. Jesús schenkte dem unbekannten Gesicht keine Aufmerksamkeit. Zumindest keine bewusste. Doch auf einer unterschwelligen Wahrnehmungsebene hatte offenbar eine Instanz entschieden, dass dieses Gesicht gespeichert werden musste. Wieso nur? Und wie verhielt es sich mit dem anderen Gesicht aus seinen Tagträumen? Hatte er den jungen Mann auch bei einer Gegenüberstellung gesehen? Oder später im Prozess gegen die Mitglieder des »Kinderschänder-Rings«, als er schnell seine Aussage gemacht hatte, um das alles möglichst bald wieder hinter sich lassen zu können? Jesús vermochte sich nicht zu erinnern. Erkannte keine Verbindung. Er brauchte Hilfe. Und dafür musste er eine Visitenkarte finden, fragte sich nur, wo. Er hatte längst alle Prozessunterlagen weggeworfen. Auch die Visitenkarte des Beamten, der die Gegenüberstellungen geleitet hatte? Nach zweistündiger Suche fand er sie in seiner Daunenjacke. Ja, er erinnerte sich, die Temperaturen hatten damals den Nullpunkt gestreift. Er wählte die Nummer, doch wie zu erwarten meldete sich am Sonntag niemand. Er musste sich gedulden, so sehr es ihn auch kribbelte. Am nächsten Morgen fühlte sich Jesús wie nach einer ausgiebigen Folter. Was es so schlecht nicht traf. Zum ersten Mal seit Urzeiten hatte ihm wieder ein Traum zugesetzt. Er kam vor Schmerzen kaum aus dem Bett. Weil es eben nicht wirklich ein Traum war. Sondern albtraumhafte Wirklichkeit. Keine sublime Symbolik, sondern brutale Realität, so weit sie auch zurücklag. Die Szene, die den Gefühlssturm des Erwachens überdauert hatte, stand ihm vor Augen, als geschähe es in diesem Moment. Er steht mit ein paar Jungen auf dem Hof. Sie spielen mit Murmeln, die im Klickerloch versenkt werden müssen, das sie in den staubigen, von der Sonne verbrannten Boden gebohrt haben. Es läuft gut für ihn, er hat schon zwei Ton- und eine schöne Glaskugel gewonnen, ein Katzenauge mit blauem Einschluss. Und der nächste Gewinn ist in Reichweite! Er kniet nieder, kneift die Augen zusammen und nimmt Maß. Seine Zunge wandert zwischen den Lippen hin und her. Ein bisschen weiter nach links. So, jetzt. Da schlurft einer der Erzieher auf den Hof und winkt. Sie blicken sich an. Jeder hofft, ein anderer sei gemeint. Es erwischt ihn. Mit gesenktem Kopf geht er über den Innenhof, der zu drei Seiten von niedrigen Gebäuden eingefasst und vorn durch ein Holztor von der Außenwelt abgetrennt ist. Man könnte glauben, es würden hier Nutztiere gehalten. Doch der Hof ist ihr Zuhause. Das Heidenheim. Hier werden Heidenkinder zu Christenmenschen erzogen, hat man sie gelehrt. Und dass sie Opfer bringen müssen, um sich GOTT würdig zu erweisen. Andere bringen viel größere Opfer, heißt es, vor allem die katholischen Priester, die dem HERRN zuliebe auf eine Frau verzichten, weswegen es eine selbstverständliche Christenpflicht ist, ihnen die Entsagung zu erleichtern. Sie sehen es ein. Weniger weh tut es deshalb nicht. Sie fürchten die Kapelle wie der Teufel das Weihwasser. Denn da geschieht es meist. Im Beichtstuhl. Auf dem Altar. Häufig erst im Beichtstuhl und dann auf dem Altar. Die Priester kommen immer in Alltagskleidung auf den Hof, in Jeans oder im Anzug oder Blaumann, und legen erst hier die Soutane an, von denen es einen ganzen Schrank voll in der Sakristei gibt. Unter der Soutane sind sie nackt. Immer. Alle. Das ist wohl gottgewollt. Praktisch ist es obendrein, denn den meisten steht ihr Ding schon vom Bauch weg, wenn sich die Soutane hebt. Anfangs hat er gebockt und sich weder von den Vorhaltungen über seine sündige Selbstsucht noch den schrecklichen Höllenfeuern, die GOTT dafür vorsehe, bewegen lassen, den Gottesdienst zu leisten. Doch sie haben hier im Heidenheim noch andere Mittel. Ihm ist nichts anderes übrig geblieben. Nur heute bitte nicht! Unwillkürlich fährt er sich mit der Hand über sein Gesäß. Das Ding von gestern hat alle bekannten Dimensionen gesprengt. Und er kennt viele Dimensionen. Immer noch fließt Blut aus seinem Po. Es gibt Geistliche, die auf so was ganz versessen sind. Die es blutig mögen. Sie sollen dann tun, als sei es ihr erstes Mal. Wenn die Finte gelingt, gibt es zum Lohn eine große Glasmurmel. Ich will keine Murmeln, ich will meine Ruhe, denkt er, während er die Kapelle passiert. Es wird mich heute zerreißen, lieber Gott! Er ist bereit, hundert Vaterunser zu beten, wenn der liebe Gott nur dieses eine Mal Gnade kennt. Kennt er aber nicht. Er geht zur Gemeinschaftsdusche neben der Kapelle und zieht sich aus. Es riecht hier nach Kuhstall. Er fischt die blutige Binde aus der Unterhose und wirft sie in einen Abfalleimer. Im Duschraum trocknet sich gerade ein anderer Junge ab. »Hast du schon oder musst du noch?«, fragt er müde. »Hab schon«, sagt der Junge nüchtern. »Und du?« Er schweigt und alles ist gesagt. Der Geistliche steht hinten beim Altar. Er trägt ein scharlachrotes Zingulum über dem dicken Bauch, ein Kardinal also. Es treffen viele Kardinäle hier ein und auch der eine oder andere Papst. Der Erzieher winkt ihn ungeduldig näher. »Das ist der kleine Jesús, Eminenz, ein Heidenkind auf gutem Weg zu unserem HERRN. Er wird IHM jetzt ein treuer Diener sein.« Der Erzieher durchbohrt ihn mit seinem kalten Blick. Wehe, wenn nicht, soll das heißen. Er nickt geistesabwesend. Der Kardinal ist alt und riecht auch so. Vielleicht hat er Glück und dessen Ding bleibt Wackelpudding, dann kommt wenigstens sein Po davon. Der Erzieher zieht sich zurück. Er wartet mit demütig gesenktem Kopf auf seine Anweisungen, die der Kardinal aber nicht gibt. Er wagt einen Blick nach oben und sieht in ein missmutiges Gesicht. Aus der Nase wachsen Haare. Er schaut schnell weg. »Jetzt sag endlich mal was, du …« Er weiß nicht, was er sagen soll, die Exerzitien werden aufseiten der Jungen gewöhnlich stumm ausgeführt und niemand hat ihm beigebracht, dass es etwas Bestimmtes zu sagen gilt. Er versteht deshalb nicht, was der Kardinal von ihm erwartet. »Verdammt, jetzt mach das Maul auf!« Jetzt endlich versteht er. Wortlos kriecht er unter die Soutane. UNGEREIMTHEYDTEN | D-FRANKFURT/MAIN Engel saß mit gerunzelter Stirn vor der Handakte im Fall Heydt, dessen Aufklärung nicht vorankam. Er gab jedem seiner Fälle einen Titel, und diesen hatte er Ungereimtheydten getauft. Auf den ersten Blick gab der Sachverhalt zu keinerlei Zweifel Anlass: Das Video zeigte eine Frau, die allem Anschein nach Anna Heydt war, in einem Raum, der mit Sicherheit ihr Wohnzimmer war, beim Geschlechtsakt mit einem Jungen, der dafür keinesfalls reif war. Alles passte perfekt zueinander – außer dem Umstand, dass das Opfer eine Schimäre blieb und die mutmaßliche Täterin ein Rätsel. Um den Jungen zu finden, hatte er alle infrage kommenden Register durchkämmt, die Fälle entgeltlichen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger ebenso wie die vielen, in denen Gewalt die einschlägige Währung bildete. Er hatte Informanten aus der Stricherszene angerufen und Kollegen gelöchert, die diese Szene besonders im Auge hatten. Nichts, nicht der Hauch einer Spur. Der Kenntnisstand über die Verdächtige reichte kaum weiter. Sie war zwar aktenkundig, doch handelte es sich um kein Delikt mit sexuellem Hintergrund. Sie hatte Polizisten, die Jugendliche aus der Fußgängerzone verweisen wollten, »Himmlers Heinzelmännchen« genannt. Das mochte typisch Heydt sein, brachte ihn aber nicht weiter. Auch die Beschlagnahme ihres mobilen Rechners hatte keine neuen Anhaltspunkte erbracht. Die übliche Ermittlungsprozedur bewegte sich von innen nach außen, beginnend bei den engsten Bezugspersonen. Nur schien es im Leben von Anna Heydt keine Bezugspersonen zu geben. Ihr Exmann, mit dem er telefoniert hatte, wollte nichts mehr von »der Frau« wissen und sich erst recht nicht über sie äußern. Auch die in der Wohnanlage von Polizeibeamten durchgeführte Hausbefragung hatte keine Resultate gebracht. Die Nachbarn im neunzehnten Stockwerk hatte Engel selbst befragt, ebenso den Hausmeister und einige Bewohner, die als besonders aufmerksam galten. Alles Fehlanzeige. Eine Nachbarin hatte verschwörerisch gemeint, sie habe etwas »Auffälliges« im Haus bemerkt, nämlich einen unbekannten Handwerker – wo doch die Hausverwaltung nie richtige Handwerker schicke! Ihre Beschreibung lief auf einen kleinen dicken Mann hinaus, gut einen Meter neunzig groß und dünn wie ein Bleistift; ein Alter im herkömmlichen Sinne schien er auch nicht zu haben. Verlässliche Beobachter kamen in etwa so häufig vor wie vierblättrige Kleeblätter: Entweder sie hatten Tomaten auf den Augen oder Lücken im Gedächtnis oder das Sprachvermögen von Stecknadelköpfen. Doch diese »Zeugin« schlug sie alle. Engel war ratlos, und die Ratlosigkeit kehrte sich langsam gegen die Verdächtige. Ungereimtheydten – das bezog sie ein. Sie schien ihm eigentlich nicht der Typ, der die Schuld stets bei anderen suchte, doch genau genommen lief ihr Lebensbericht in vielen Punkten darauf hinaus: Beim Tod ihrer Eltern hatte sich ein Polizist verdächtig benommen. Von der Uni hatte man sie gejagt, weil ihr jemand bei Prüfungen etwas untergeschoben hatte. Ihr Exmann hatte sie nur geheiratet, um sich von ihr scheiden lassen zu können. Engel wusste immer noch nicht, was er von ihr halten sollte. Dass sie Angaben zur Existenz des Feuermals verweigerte, machte die Sache nicht besser. Wenn sie es aus bloßem Trotz tat, was er ihr zutraute, dann tat sie sich damit keinen Gefallen. Er würde nun den Druck erhöhen, um endlich einen Schritt voranzukommen. Das Telefon klingelte, Degenhart. »Hallo, Markus. Dr. Strecker hat sich bei mir nach News im Fall Heydt erkundigt.« »So? – Warum erkundigt er sich nicht bei mir?« »Gute Frage. Ich habe, offen gesprochen, den Verdacht, er zieht Ihr Commitment in Zweifel.« »Commitment?« »Jetzt machen Sie es uns nicht so schwer, Markus. Es heißt jetzt flexibel agieren, neue Verhältnisse, Sie verstehen schon: Geschmeidig bleiben ist angesagt, nur dann bewahren wir auf lange Sicht unsere Spielräume. Vorerst müssen wir Goodwill signalisieren. Ist doch nicht zu viel verlangt! Keiner erwartet, dass Sie Blutsbrüderschaft mit ihm schließen! – Dr. Strecker mag sich ja gut anziehen, aber deshalb müssen wir ihn noch lange nicht anziehend finden, hehehe.« Degenhart blieb mit seinem Hehehe allein und wurde förmlich. »Jedenfalls müssen wir seine Kompetenzen respektieren. Sie wissen, ich halte Ihnen stets den Rücken frei, aber …« … nur, wenn es mich nichts kostet, vervollständigte Engel für ihn in Gedanken. »Ich denke, ich habe mich korrekt verhalten«, gab er trocken zu Protokoll. »Was die Ermittlungen betrifft: Es hat sich nicht viel Neues ergeben, die Sache sieht klar aus und ist gleichzeitig ziemlich mysteriös. Der Junge scheint vom Himmel gefallen zu sein.« »Es muss ja keine Vorbeziehung zwischen Heydt und dem Opfer vorliegen. Vielleicht nur eine Zufallstat, ohne jede Verbindung zum Milieu. Ein ganz normaler Junge, den sie zufällig kennengelernt hat.« »Ein ganz normaler Zehnjähriger, der mal eben Analsex praktiziert.« »Das müssen Sie wissen, Markus, es ist Ihr Fall. Hauptsache, Sie stimmen sich hier im Haus ab. Ist das angekommen?« Ja, Sir! »Stellen Sie Ihre Zweifel ausnahmsweise zurück. Ich hätte den Fall gern vom Tisch. Ich meine, das Video spricht doch für sich!« »Unsere Techniker haben Anhaltspunkte für eine ziemlich teure Videokamera gefunden. Die Verdächtige ist …« »Beschuldigte, Markus, halten Sie sich an den Sprachgebrauch!« »Jedenfalls ist sie abgebrannt.« »Vielleicht ist sie abgebrannt, weil die Kamera teuer war!« Degenhart seufzte demonstrativ. »Meine Güte, Markus, konkurrieren Sie nicht mit ihrem Anwalt!« »Ich ermittle in beide Richtungen, wie immer.« »Dann ermitteln Sie schneller, mir sitzt der Staatsanwalt im Nacken. Er hat übrigens vorgeschlagen, Ihnen Frank zur Seite zu stellen.« »Koetter? Hat er ausdrücklich Koetter vorgeschlagen?« »Ja.« »Na, danke.« Ob Strecker wusste, dass er und Koetter sich nicht riechen konnten? Oder hatten da einfach zwei Arschgesichter zueinandergefunden? »Ich habe es abgewehrt. Und nun brauche ich schnellstens Resultate. Machen Sie den Sack zu, die Beweislage gibt wirklich keinen Anlass zu Zweifeln.« »Letztlich beruht sie lediglich auf einer Videokopie.« »Immerhin haben wir einen realen Tatort.« »Einen vermeintlichen Tatort, an dem wir keinerlei auswertbare Spuren sichern konnten, keine Fingerabdrücke, die zu einem Kind passen würden, keine unbekannte DNA.« »Wir haben es eben mit einer planenden Täterin zu tun, die rechtzeitig die Beweise vernichtet hat.« Degenhart war es langsam leid. »Wir besorgen jetzt eine Vorladung und dann wird die Beschuldigte explizit gemäß den Vorschriften vernommen. Machen Sie Druck, die Frau nimmt uns gar nicht ernst!« »Vorladen. Druck machen. Überführen. Jawohl!« ZIELFAHNDUNG | E-GRANADA Der Kardinal hatte seinen Po damals nicht verschont. Im Nachhinein entsetzte Jesús noch mehr, mit welch grausamer Logik er den Freier missverstanden hatte. Das Elend, das er so lange auf Distanz gehalten hatte, streckte wieder die Klauen nach ihm aus. Selbst im Unterricht hatte er heute daran gedacht. Trotzig erhob er sich vom Sofa. Wenn der alte Mann aus den Gegenüberstellungen mit dem Kinderschänder-Ring zu schaffen hatte, dann wollte er wissen, was. Keiner der »Erzieher« im Heidenheim ähnelte ihm auch nur im Entferntesten, nicht einmal dreißig Jahre konnten ein Gesicht derart verändern. Aber irgendeinen Zusammenhang musste es geben. Und wenn der Mann seiner Taten noch nicht überführt worden war, würde Jesús ihn jetzt hinter Schloss und Riegel bringen. Er hielt inne. Erinnerte sich an den kleinen Jesús und seine Leidensgenossen. Ja, wenigstens das schuldete er ihnen. Er bekam den Polizeibeamten, mit dem er vor drei Jahren beim Prozess zu tun gehabt hatte, sofort an den Apparat. Jesús Mirandor? Richtig, er entsinne sich. Jesús seinerseits meinte sich zu erinnern, dass der Mann kein Beamtenschädel war, weshalb er sein Anliegen offen vortrug. Insbesondere wollte er den Namen des Alten. Des Weiteren wollte er wissen, ob er damals verurteilt worden war. Und falls nicht, wollte er dessen Adresse. Jesús meinte förmlich zu hören, wie sich sein Gegenüber nachdenklich hinterm Ohr kratzte. Von Privatermittlungen müsse er dringend abraten! Immerhin erklärte er sich bereit, die Unterlagen zu besorgen, um anhand der Beschreibung herauszufinden, über wen sie eigentlich sprachen. Danach sähe man weiter. Drei Stunden später rief der Polizist zurück. Er meinte nun zu wissen, um wen es ging. Sie glichen das Profil ab, es stimmte überein. Die Polizei hatte den Mann der Mitgliedschaft im Ring verdächtigt, bestätigte der Beamte. Letztlich hatte es für eine Verurteilung nicht gereicht. Nun stelle sich die Sache vielleicht anders da. Ihm selbst seien allerdings die Hände gebunden, allein aufgrund von Traumbildern könne man die Ermittlungen nicht wieder aufnehmen. Darum würde er Herrn Mirandor den Namen und die Adresse verraten – wenn der ihm zwei Dinge verspräche: sich erstens nicht in Gefahr zu begeben und zweitens Bericht zu erstatten, wenn er etwas herausfinde. Jeder Hinweis, vor allem auf den Drahtzieher der Organisation, den man nie identifiziert hatte, sei dringend erwünscht. In Gefahr begeben. Erst jetzt wurde Jesús klar, dass es genau darauf hinauslaufen konnte. Er versprach, was der Beamte für sein Gewissen brauchte, und erhielt im Gegenzug die Daten: Diego Brúto, 2006 wohnhaft in Toledo, Calle de los Reyes Católicos. Und nun? Er konnte diesen Brúto wohl schlecht anrufen und bitten, gegebenenfalls ein Geständnis abzulegen. Sollte er nach Toledo fahren und ihn sich packen? Bei dem Gedanken musste er grinsen. Was auch immer er war, Krankenpfleger oder Spanischlehrer oder Sänger (er trug gelegentlich zur Gitarre Gedichte von García Lorca in Flamencobars vor) – zu einem Sam Spade oder Philip Marlowe reichte es vorne und hinten nicht. Trotzdem, er musste sich diesen Diego Brúto krallen, daran führte kein Weg vorbei! Also musste er nach Toledo. Nicht irgendwann, sondern gleich morgen. Selbst um den Preis, jemanden um ein Auto anbetteln und seine Chefin Esmeralda belügen zu müssen, um freizubekommen. STUMMELSCHWANZ | D-FRANKFURT/MAIN Anna erreichte Engel erst am Montagmittag – der Strafverfolgungsschalter war offenbar nur stundenweise besetzt. Er versprach, der neuen Spur sofort nachzugehen und Anna anschließend zu informieren. Wobei »sofort« im Behördensprech »irgendwann später« bedeutete, denn erst musste er in einem Prozess aussagen. Um halb vier verließ Anna nach getaner Arbeit die Redaktion. Von Engel hatte sie noch nichts gehört. Ihre gute Laune behauptete sich nur noch mit Mühe gegen die aufziehende Nervosität. Ein Gespräch mit Ukela würde ihr gut tun. Sie radelte zum Zoo und ging schnurstracks zum »Borgori-Wald«, dem auf Dschungel getrimmten Gehege der Menschenaffen. Ukela war eine vierundzwanzig Jahre alte Bonobo und sie war Annas Vertraute. Es verging kaum eine Woche, in der sie sich nicht sahen. Zwei Dinge hatten Anna ursprünglich zu den Bonobos hingezogen: Die freche Unterstellung einiger Pseudo-Grzimeks, sie wären bloß »Zwergschimpansen«, und die Tatsache, dass sie sich auf Sex verstanden. Sie trieben es nicht nur zur Fortpflanzung, sondern aus allen möglichen Gründen: zum Kennenlernen, zum Stressabbauen und was ihnen an Vorwänden einfiel. Und sie beließen es nicht beim schnöden Rein-Raus, sondern gingen spielerisch an die Sache. Wenn sie dann doch zum Rein-Raus kamen, wandten sie sich die Gesichter zu, was die Sache aus Annas Sicht deutlich aufwertete. Sex ohne Augenkontakt fand sie eine ziemlich rüde, wenn nicht gar deprimierende Angelegenheit. Die Bonobos waren ihr also von Beginn an sympathisch gewesen, aber dann hatte sich mehr draus entwickelt – als sie Ukela kennenlernte. Anna hatte auf einer Bank gesessen und zugeschaut, wie zwei Bonobos zusammen einen Apfel verdrückten. Vermutlich zwei Frauen, denn auch bei den Bonobos hatten es die Kerle nicht so mit dem Teilen. Plötzlich fühlte sie sich angestarrt und drehte den Kopf nach rechts. Da saß Ukela und blickte sie nachdenklich durch die große Glasfront an, wobei Anna nichts auf die »Nachdenklichkeit« gab, Affen schauten nun mal auf diese Weise. Da was reinzudeuten war die typische Selbstverliebtheit des größten Affen von allen. Trotzdem fühlte sie sich auf seltsame Weise angesprochen und kam näher. Damals hatte sie es bemerkt: Sie konnte mit den Bonobos in Kontakt treten. Da musste es einen Ast im gemeinsamen Stammbaum geben, über den eine Verbindung entstand. Oder es handelte sich um eine Art kollektives Unbewusstes, schließlich waren Mensch und Affe die längste Zeit gemeinsam den Stammbaum des Lebens hochgeklettert und hatten sich erst in der Baumkrone voneinander entfernt. Jedenfalls gab es da etwas. Vor allem zwischen ihr und Ukela. Und nicht nur so ein Gefühlsgedöns! Irgendwie verstanden sie sich. Anna konnte dieses Verständnis nicht in Wort fassen, es entzog sich den Begriffen, ohne deshalb weniger real zu sein; real genug, um sie von einem Moment zum anderen in eine Vegetarierin zu verwandeln. Was einer kopernikanischen Wende gleichkam, denn vorher hatte sie Vegetarier zu den Geisteskranken gezählt. Mit keiner Tierart konnte sie sich verständigen wie mit den Bonobos und mit keinem Bonobo wie mit Ukela. Und dieser Kontakt hatte eine ungeheuer beruhigende Wirkung auf sie. Das zählte, nicht irgendwelcher neunmalkluge Dünnschiss. Anna setzte sich auf eine Bank, ihre Freundin schien stets zu spüren, wenn sie kam. Eine Stunde wartete sie vergebens vor der Scheibe. Sie fragte eine Pflegerin, die ihr mitteilte, Ukela sei krank, nichts Ernstes, in ein paar Tagen könne sie bestimmt wieder raus. Verdammter Mist! Lustlos verließ sie das Gehege und trottete durch den Zoo. Vor dem Giraffenhaus blieb sie stehen. Sollte sie reingehen und Hatari einen Besuch abstatten? Aber ihr war heute nur nach Ukela. So ein gottverdammter Mist! Während sie vor sich hin fluchte, klingelte ihr Handy. Statt Engel meldete sich Psycho. Sie hatte sich an dessen Beratungsstelle gewandt, nachdem sie einen Handzettel im Briefkasten gefunden hatte, in dem es um ein »Programm für kontrolliertes Trinken« ging. Ein bisschen Kontrolle konnte nicht schaden. Sie hatte sich handfeste Ratschläge erhofft, etwas wie: Machen Sie nach jeder Flasche einen Kopfstand, dann sinkt der Alkoholpegel. Doch stattdessen hatte der Oberberatungsfuzzi gemeint, er müsse erst etwas über ihre »Suchtdisposition« erfahren. Jetzt hatte sie alle zwei Wochen »Sitzung« bei diesem Unglücksritter, der sich darin gefiel, möglichst desinteressiert in ihr rumzupopeln. Sein Anruf diente der Ermahnung, sie solle den Termin bitte nicht wieder vergessen. Ja, sie würde kommen, vorausgesetzt, bis dahin flatterte keine Schnapsfahne vor ihr her; die Anspannung trieb sie langsam in den Grenzbereich. Sie würde allerdings nur kommen, um diesen Psychospuk ein für alle Mal zu beenden … wahrscheinlich. Sie verstand sich in letzter Zeit selbst nicht mehr. Warum rief denn Engel nicht endlich an? Psycho gab den Pinguin: schwarze Klamotten auf schneeweißer Haut. Die nackenlangen Haare hatte er nach Art der Siebziger föhnfrisiert, eine Günther-Netzer-Gedächtnis-Frisur, und wenn er es drauf anlegte, fiel ihm der Pony über die Augen. Sehr mysteriös! Und passend zum großen Schweigen am Beginn jeder Sitzung. Wo hatte er sich die Nummer bloß abgeschaut, bei Klaus Kinski? Heute hatte sie definitiv keine Muße dafür und kürzte die Prozedur ab. »Also: Wie es mir ergangen ist seit der letzten Sitzung? Grenzwertig. Wie viel ich getrunken habe? Zu viel. Wie ich mich heute fühle? Ungeduldig. Wie wäre es, wenn Sie einfach sagen, was Sie wissen wollen!« In seinen beigen IKEA-Klappsessel gelümmelt, blickte Psycho sie unverwandt an – und schwieg. »Scheiße, Mann, machen Sie es uns nicht so schwer, ich hab wirklich genug um die Ohren.« Psycho holte seine Armbanduhr aus der Cordjacke und stellte sie vor sich auf das kniehohe Fichtentischchen. »Von wegen krankhaftem Schweigen. Meine Mutter meinte immer …« »Sie müssen noch jung gewesen sein.« »Ja, natürlich, ich war erst fünfzehn, als sie gestorben ist, steht doch schon in Ihrer Akte.« »Sie denken noch oft an sie?« »Hab ich das nicht bereits erzählt?« Psycho machte wieder auf stumm. »Ja, tue ich«, entgegnete sie genervt. Dieser verdammte Schweigepoker ging ihr so was von auf den Geist. »Ich denke jeden Tag an sie. Würden Sie wohl auch, wenn Sie Ihre Eltern auf diese Weise verloren hätten.« »So schlimm?« »Fragen Sie nicht so blöd, Sie wissen längst, wie sie gestorben sind!« Psycho schlug die Beine übereinander und streckte ihr wippend einen Wildlederschuh entgegen. »ICH WAR DABEI!«, schrie sie ihm ins Gesicht. Und konnte es nicht glauben. Welcher Teufel ritt sie denn jetzt? Sie hatte noch nie jemandem erzählt, dass ihre Eltern vor ihren Augen verbrannt waren! Sie hielt es sogar vor sich selbst so gut es ging geheim. Psycho schwieg provozierend und Anna begann gegen ihren Willen zu erzählen. Die Erinnerungen stiegen wie eine Springflut hoch und überschwemmten sie. Der Keller. Die verteufelte Stahltür. Das kleine Kellerfenster – ihr Guckkasten. Sie sah das fünfzehnjährige Mädchen vor sich, eingepackt in einen schicken weißen Kunststoffmantel, der an der Taille ein bisschen kniff, weil Mamas Kochkünste einen regelrecht nötigten, zum verfressenen Frettchen zu werden. Anna an einem Oktobersonntag 1984 auf dem Rückweg von Susanne, ihrer besten Freundin, mit der sie einen Film über Sigmund Jähn, ihren ersten Kosmonauten angeschaut hatte. Gewöhnlich ein Springinsfeld, träumte sie im Moment vor sich hin. Obwohl sie sich hätte sputen müssen. Eigentlich saß sie nämlich gerade am Schreibtisch und pfiff sich Russischvokabeln rein. Sie kam auch ohne große Paukerei gut über die Runden. Und wann immer sie Ausflugslaune überkam, rollte das eingeschossige, in einer Sackgasse am Waldrand gelegene Häuschen einen roten Teppich aus. Er führte von ihrem Fenster direkt und ihrem Gartengeheimausgang in der mannshohen Rotbuchenhecke. Jetzt war es allerdings höchste Zeit, wenn der Ausflug unbemerkt bleiben sollte. Die Dämmerung hatte schon eingesetzt und es gab bald Abendbrot. An der Einfahrt zur Sackgasse sieht sie drei Löschfahrzeuge der Erfurter Feuerwehr. Davor ein LKW, der die Durchfahrt versperrt. Ein riesiger Tumult. Sie hält inne und schaut den Feuerwehrmännern bei dem verwegenen Versuch zu, den LKW mit bloßen Händen zu bewegen. Plötzlich nimmt sie einen fahlen Feuerschein am Ende der Sackgasse wahr. Auf der rechten Seite, rechts, dort, wo sie wohnt! Die Furcht fällt sie an wie ein aus dem Wald stürzendes Raubtier. Sie spurtet los, volle Pulle, als Handballspielerin hat sie genug Puste. Vierhundertachtzehn Schritte sind es von der Abzweigung bis zum Haus, sie hat sie oft genug gezählt. Nach der Hälfte der Strecke sieht sie die Flammen aus den Fenstern schlagen. Sie rennt weiter, sieht den Klumpen Menschen, Nachbarn, die unbewegt zuschauen. »Rasend schnell«, hört sie Leute sagen, »wie Zunder« und: »Zu spät!« Jemand löst sich aus dem Haufen. »Anna, nicht!« Der Nachbar läuft mit ausgebreiteten Armen auf sie zu, als wolle er ein Tier einfangen. Anna schlägt einen Haken und stürmt durch die Gartentür. Da schnellt etwas hervor und holt sie von den Beinen. Sie zappelt wie die Beute im Netz, aber nicht lange. Ein kräftiger Biss in die Fanghand, und sie ist wieder frei. Aus der Haustür strömt ihr schwarzer Rauch entgegen und aus den Fenstern strecken sich lange Flammenarme nach jedem, der den schmalen Weg längs des Hauses betritt. Nirgends ein Durchkommen. Sie dreht sich um die eigene Achse und rennt an aufgerissenen Augen vorbei die Gasse zurück. Ein Volkspolizist kommt ihr entgegen. »Durch den Wald«, schreit sie, »wir müssen von hinten ran, da ist ein Weg!« »Ja«, antwortet der Vopo, »du musst ihn mir zeigen.« Er streckt ihr die Hand entgegen. Sie hat sie kaum ergriffen, da zieht der Mann sie an sich und zerrt sie zu einem Streifenwagen. Was soll das? »Ruhig«, sagt er beschwichtigend, »wir setzen uns da jetzt rein und dann malst du mir den Weg auf.« Sie glaubt ihm nicht! Als er sich, sie mit einem Arm umklammernd, in das Fahrzeug beugt, um Sachen vom Beifahrersitz zu schieben, wirft sie sich mit aller Kraft nach vorn. Die Hebelwirkung reißt ihn nach oben, sein Hinterkopf knallt gegen den Türrahmen. Anna befreit sich, tritt zu – und trifft die Stelle zwischen den gespreizten Beinen. Sie stürmt die Straße zurück, verschwindet im Sichtschutz eines Transporters in einem Gartentor, durchquert den Vorgarten der Meyers, dann ums Haus rum zum Kellerabgang. Glück gehabt, die Leiter steht da wie gewohnt. Sie torkelt damit die Kellertreppe hoch und durch den Garten, wirft die Leiter auf die hohe Hecke, kriecht auf allen vieren hinauf und lässt sich auf der anderen Seite runterfallen. Sie will weiter, doch der Mantel hängt in Zweigen fest. Mit fliegenden Fingern knöpft sie ihn auf und reißt ihn runter, läuft den kleinen Pfad den Wald entlang bis zu ihrer Gartenhecke und schlüpft durch den Geheimgang. Auch auf dieser Seite lodern Flammen aus den Fenstern. Jetzt ist sie, wo sie hinwollte, und was nun? Sie kreiselt um die eigene Achse. »Maamaa!« Sie schreit so laut sie kann. »Mama, bitte!« Ihre Beine geben nach, sie sinkt auf den Rasen. »Mama! Papa!« Keine Antwort. Das kann gar nicht sein! »Ma-ma! Pa-pa!« »Anna!« Das hat sie sich nur eingebildet! Da ist nichts, oder? »Anna, hier!« Von wo kam das? Zögernd geht sie auf das qualmende Kellerfenster zu. »Mama?« Sie hat Angst. Nichts hat sie je auf dieses Vollbad in Rasierklingen vorbereitet. Vor dem Fenster kniet sie nieder und steckt den Kopf durch die kleine Öffnung. Der Qualm raubt ihr den Atem. Der Anblick noch mehr. Sie sieht Mama unter dem Fenster auf dem Boden kauern, Papa im Arm. Papa, der sich nicht bewegt. Papa mit angekokelten Händen. »Anna, mein Liebling, zum Glück. Ich hatte solche Angst um dich.« Ihre Stimme ist ein rauchiges Krächzen, das Anna eine Gänsehaut bereitet. »Ich war gar nicht zu Hause, Mama. Ich bin einfach …« »Susanne, nicht? Ist schon gut, mein Liebling. Hauptsache, du bist in Sicherheit.« Sie wischt sich Tränen aus den Augen. »Aber was machst du hier?« »Ich habe euch gesucht.« »Und die Feuerwehr?« »Warum seid ihr denn im Keller?« »Wir haben … was gesucht. Und dann hat die Kellertür geklemmt.« Ein Gedanke durchzuckt Anna wie ein Stromstoß. »Hat Papa wieder Schmuck für mich gebastelt? Hat er wieder mit dem Schneidbrenner hantiert? Ist es dabei …?« »Nein, Anna, nein! Das Feuer kam von außen! DAS HAT NICHTS MIT DIR ZU TUN!« »Warum bin ich nicht zu Hause geblieben und hab gelernt? Ich hab’s doch versprochen! Ich hab’s euch doch versprochen! Dann hätte ich euch befreien können!« Anna heult laut auf. »Nein, Anna! Hörst du: NEIN! Das darfst du niemals denken! Du hättest uns nicht helfen können, hörst du, Anna!« Sie hechelt nach Luft. »Nur die Feuerwehr kann uns helfen. Was ist denn mit der Feuerwehr?« Anna schüttelt den Kopf und schluchzt. Dann will sie aufspringen. »Die Gasse ist versperrt. Ich muss …« »Lass mal, Süße, die Feuerwehr hatte ihre Chance. Das ist jetzt unser Moment.« Anna zieht den Kopf zurück und zwängt einen Arm durchs Fenster. »Nimm meine Hand, Mama, ich ziehe dich.« Sie hört, wie sich Mama röchelnd erhebt, spürt, wie sie den Arm nach ihrer Hand ausstreckt. Es reicht, um sich mit den Fingerkuppen zu berühren. Verzweifelt versucht sie, Mamas Finger zu fassen zu kriegen, als wüsste sie nicht selbst, dass alles vergebens ist. Das Kellerfenster ist ja viel zu klein. Ihre Hand beginnt wie wild zu zittern und sie zieht sie zurück. Das Kellerfenster wird wieder zum Guckkasten. Nur handelt es sich um keine optische Täuschung. Sie blickt in die Hölle, und die ist echt. Die Stahltür glüht. Die Hitze ist unerträglich. Jetzt, da Mama steht, sieht Anna das Entsetzen in ihren Augen. Die Verzweiflung. Mama reckt die Arme hoch. Wortlos bittet sie ihr Kind, es möge sie noch einmal berühren, damit sie nicht solche Angst hätte. Zu spät. Von einem Hustenanfall geschüttelt, sinkt sie die Wand hinunter zu Boden. Mit einem letzten Blick sagt sie ihrer Süßen, dass ihre Liebe den Tod überdauert. Stirbt sie jetzt? Lieber, lieber Gott, du musst sie doch leben lassen! Was habe ich denn Schlimmes getan? Bitte, lieber Gott, lass sie leben, bitte! Mamas Husten lässt nach und sie zieht Papa behutsam zwischen ihre Beine. »Papa. Was ist mit …?« Sie ahnt es längst. »Papa ist ein Stück vorausgegangen. Er bereitet mir den Weg.« Mama verdreht den Kopf und schaut zu ihr hoch. »Hör mir gut zu, meine Süße. Wir reden noch ein bisschen – wenn du mir versprichst zu gehen, wenn ich es sage. Wirst du das tun, mein Schatz?« Anna nickt mit starrem Blick. Ihre Welt steht in Flammen. Ihre Welt verbrennt. Sie kann Mama noch sehen, sie lebt noch, aber Anna fühlt schon, inmitten dieser Höllenglut, den kühlen Hauch der Einsamkeit. Mutterseelenallein. Ihr Körper weint Schweißperlen. »Mama, ich hab euch so lieb. Mama, bitte, bitte, lass mich nicht allein! Bitte!« »Es tut mir leid, unsere Zeit ist abgelaufen, ja?« »Was?« Anna brauchte einen Moment, um in die Realität zurückzufinden. Psycho deutete mit unverbindlichem Lächeln auf seine Uhr. Anna starrte ihn fassungslos an. Dann verengten sich ihre Augen zu Schlitzen. »Oh, entschuldigen Sie mein schlechtes Zeitmanagement. Jetzt habe ich Sie ums Ende gebracht.« Ihre Stimme klirrte vor Kälte. »Womöglich können Sie heute Nacht vor Neugierde nicht schlafen. Deshalb, als besonderen Service für Sie, das Ende in Kurzfassung, Anna Heydt à la Reader’s Digest.« Was zu sagen blieb, sagte sie in einem Atemzug: »Bevor meine Mutter antworten konnte, explodierte was im Haus, die Stahltür brach auf, die Flammen schossen in den Raum und haben meine Eltern zu Asche verarbeitet, während ich im Garten hockte, erst Mamas Schreie hörte, dann nur noch das Knistern des Feuers, nein, sagen Sie nichts, ich bin schon weg!« Anna stand mit klopfendem Herzen im Treppenhaus. Ihr Handy klingelte. Im Display erschien Engels Nummer. »Hallo, Frau Heydt. Ich habe mit Ihrem ›Zeugen‹ gesprochen.« Der Tonfall verhieß nichts Gutes. »Er versteht allerdings nicht, wie Sie darauf kommen, er habe den Jungen erkannt. Den hat er nämlich noch nie gesehen. Er meint, Sie hätten von Anfang an versucht, ihn zu manipulieren. Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Zu dem Feuermal verweigern Sie die Aussage, stattdessen beschäftigen Sie mich mit der Befragung eines Zeugen, der keiner ist. Darüber müssen wir reden, und zwar morgen um sechzehn Uhr im Präsidium.« Statt zu antworten legte Anna auf. Wäre da nicht auch ein Hoffnungsschimmer gewesen – der fensterlose Raum mit den Neonröhren hätte die sieben Anwesenden deprimiert. Der Hoffnungsschimmer speiste sich aus der einfachen Tatsache, dass sie hier waren statt sonst wo. Das Neonlicht hingegen symbolisierte das Wie ihrer Begegnung: nüchtern. Jeder blieb für sich. Einer erzählte, die anderen hörten zu. Punkt. Keine Kommentare, keine Diskussionen. Manchmal lohnte sich das Zuhören, weil man sein eigenes Blatt besser verstand, während jemand seine Karten auf den Tisch legte, manchmal tröstete es, nicht allein mit dem Schwarzen Peter auf der Hand dazustehen. Doch das war nicht die Hauptsache. Reden zu können, ohne Ratschläge fürchten zu müssen, darauf kam es an. Nur darum konnte man sich das wirklich Wichtige von der Seele reden, nämlich wie man von der Versuchung eingewickelt worden und gestürzt war. Wie man mit vollgekotztem Hemd oder vollgepisster Hose aufgewacht war, und dass der Ekel auf die Knochen ging. Sie beschränkten sich auf diese Selbstgespräche, weil letztlich niemand helfen kann, wenn der Feind in einem steckt, wenn man mit sich selbst ringt. Sie sprachen oft von Kapitulation, denn sie galt hier als Ausgangspunkt der Heilung, aber eigentlich fühlten sich die meisten von ihnen wie Krieger. Ein Kampf Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, und sie standen auf beiden Seiten der Front. Sie hatten zwar alle dasselbe übermächtige Problem, doch seine Schlacht musste jeder für sich schlagen. Die Gruppe half einem nur, sich nicht ganz so allein dabei zu fühlen. Was so wenig nicht war. In der Mitte des Raums standen vier zu einem Quadrat zusammengestellte Tische, darauf einige Packungen Zigaretten, drei gläserne Aschenbecher und in der Mitte, mit einem grünen Schleifchen umbunden, eine rote Kerze. Die nicht brannte. Obwohl es zum Ritual gehörte, sie anzuzünden. Heute nicht, heute hatte die Gruppe ihre Regeln vergessen. Keiner nannte seinen Namen, bevor er zu reden begann und bekannte, Alkoholiker zu sein. »Ich fass es einfach nicht. Meine Güte, nein. Was für eine Schweinerei. Und das hier bei uns.« »Ich krieg gerade so was von Durst.« »Allerdings habe ich erhebliche Zweifel, ob es medienrechtlich überhaupt zulässig ist. Zumindest ist es nicht gängige Praxis, obgleich ich die Gepflogenheiten unseres Lokalfernsehens …« »Ist ja gut, Walter, wir wissen, wie schön du reden kannst. Wie sicher bist du dir denn, Kevin?« »Absolut!«, antwortete Kevin Tomlowski. »Man sollte auch nichts erkennen, Walter! Schwarzer Balken überm Gesicht und so. Nur hab ich so ’n Talent, da durchzuschauen oder so. Und dann der Name, Anna H Punkt. Ne, das is, wie ich’s gesagt hab … da beißt die Maus keinen Faden ab!« »Ach, es ist schrecklich«, seufzte Martha. Walter streckte sich auf seine souveräne Gesamtlänge von einem Meter siebenundachtzig. »Wir sollten beginnen. Dieses Subjekt wird sich hier nicht mehr blicken lassen.« Anna wusste selbst nicht, wieso sie immer wieder zu diesen Treffen ging. Dass sie sich die Adresse überhaupt hatte aufdrängen lassen, ließ sich mit ihrer zunehmenden Ermattung erklären. Aber wieso war sie hingegangen? Wieso ging sie immer wieder hin? »Ich brauche keinen Quatschklub, der mich trockenlegen will«, hatte sie Triebel geantwortet, als er ihr einen Besuch bei den »Anonymen« empfohlen hatte. Und dann stand sie unversehens bei denen in der Tür. Was für ein Gruselkabinett, hatte sie nach einem Blick in die Runde gedacht – und sich trotzdem dazugesetzt. Und verblüfft festgestellt, dass keiner aufjaulte, während sie klarstellte, sie wolle lediglich »was an der Füllmenge ändern«. Sie war noch mal hingegangen. Und hatte sich daran gewöhnt. Für keinen der Leute empfand sie nennenswerte Sympathie, doch irgendwie passte sie in diese Gemeinschaft von Autisten. Sie mochte auch den Raum, in dem sie sich wie in einem unterirdischen Bunker fühlte. Nur das Wir-machenes-uns-gemütlich-Schleifchen nervte. Schon acht Uhr durch, sie beschleunigte den Schritt. Nach Engels Anruf hatte sie sich nur noch das Hirn aus der Birne saufen wollen. Sie hatte sich bereits aufs Rad gesetzt, um schnellstmöglich heim zu kommen, sprich: an ihren Schnapsvorrat. Aber sie war wieder abgestiegen. Warum, wusste sie nicht, ein unbestimmtes Gefühl. Als sei es gefährlich, jetzt nach Hause zu fahren. Als würde sie vielleicht nicht wieder aufwachen, wenn sie mit einer Flasche Korn ins Bett. Als sei es klüger, unter Menschen zu sein. Sie schüttelte im Gehen die Regentropfen aus dem Haar. Die Tür zum Raum stand überraschenderweise noch offen. Anna stieß sie mit dem Fuß auf. Sieben Köpfe, die gerade noch zusammengesteckt hatten, wandten sich ihr abrupt zu. Ein Blick in die Gesichter ihrer Katastrophenkumpel, und sie spürte das nächste Unheil nahen. Jede Zelle ihres Körpers schien in sich zusammenzusinken … pfffffff, Luft raus. Sie hielt sich mit der Hand am Türrahmen fest und wartete ab. Die andere Seite schien ebenfalls abzuwarten. »WAS DENN NUN, BITTE SCHÖN!« »Das wagen Sie zu fragen?«, erboste sich Walter. SIE? Gehörte sie schon nicht mehr dazu? »Sie beschmutzen uns durch Ihre bloße Anwesenheit, Sie Kinderschänderin!« Walters Stimme überschlug sich. »Sie … Sie gehören nicht hierher!« Anna verstand nicht. Woher wussten sie …? Sie blickte Martha an, Martha, die stets für das Schleifchen sorgte. »Kevin hat was auf dem Lokalsender gesehen. Ein Video. Das ist alles ein Irrtum, nicht wahr? Bitte sag …« Während Anna davonrannte, betrat ein unangemeldeter Besucher ihre Wohnung. Er hatte abgewartet, bis die Vollzugsmeldung von Kevin Tomlowski kam. Heydt wusste jetzt Bescheid. Und hatte wie erwartet reagiert. Der Besucher zog eine Walther P22 aus dem Schulterholster und schraubte den Schalldämpfer auf. Die Kandidatin war reif. Anna schob ihr Rad zur Hauptwache, um die U-Bahn zu nehmen. Trübes Licht drang aus dem Reich unter der Stadt, die Rolltreppe züngelte nach ihr wie der Leibhaftige. Sie brachte es nicht über sich hinabzusteigen. Langsam ging sie zur »Zeil« rüber, Frankfurts Fußgängerzone. »Die Zeil«, das klang so beschaulich. Anna fand sie zu kantig, breit und gerade und ungefähr so idyllisch wie einen Flugzeugträger, der im Frankfurter Häusermeer auf Grund gelaufen war und die Ketten rasseln ließ – von A wie Adidas bis Z wie Zara. Wie die Zeil jetzt tropfnass und einsam vor ihr lag, war sie aber beinahe erträglich. Die Lichter funzelten hinter den verregneten Schaufenstern wie schwermütige Glühwürmchen. Nur der Farbige nervte, der den Regen wie Christus das Kreuz ertrug und seine Botschaft – TSCHIESSES KREISS LAFFS JU!!! – von der Höhe einer Sitzbank wie von einer Kanzel auf sie niederschmetterte. Anna dachte nach. Was nun? Wie geht es jetzt weiter? Wie sollte sie sich gegen einen unsichtbaren Feind zur Wehr setzen? Einen übermächtigen Feind, der offenbar über jeden ihrer Schritte Bescheid wusste und ihren einzigen Zeugen sofort mundtot gemacht hatte. Sie nahm dem jungen Mann die Lüge nicht übel. Was einem blühte, wenn man sich zur Wehr setzte, bekam sie ja selbst zu spüren: vor aller Welt bloßgestellt, mit gespreizten Beinen ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt, als Kinderschänderin gebrandmarkt. Wohin sollte und konnte sie sich nach der Veröffentlichung des Videos überhaupt noch verkriechen? Hey, nicht schlappmachen! Beiß dich durch, komm schon! Keine Reaktion, ihr Gebiss schien gerade in Corega Tabs zu baden. Von den paar anonymen Alkis ließ sie sich bestimmt nicht mürbemachen. Doch was die wussten, wusste sicher schon die ganze Stadt, darunter auch ihr Chef, der bisher nicht gewagt hatte zu fragen; jetzt musste er es nicht mehr. Wie würde er schauen? Verletzt, wütend? Angewidert? Sie konnte es ihm nicht verdenken, sie begann sich ja schon selbst für die Tat zu schämen, die sie nicht begangen hatte. Wie sollte sie mit diesem Video im Kreuz auf Unschuld plädieren? Nein, sie musste das Feld räumen, sie konnte sich Triebel einfach nicht mehr zumuten. Und dann, Anna, was machst du dann? Sie hatte keine Ahnung, fühlte sich zu erschöpft, wollte nur noch abtauchen. Auf der Höhe von McDonald’s kettete sie ihr Rad an, um pinkeln zu gehen. Das Frauenklo war abgesperrt, na toll. Dann eben zu den Männern. Sie schlüpfte in eine der Kabinen, ließ die Hose runter, spreizte die Beine und schob ihre Hüfte so weit wie möglich über die Schüssel, nur nichts berühren, das sah alles nicht gut aus. Gerade hatte sie den Spagat stabilisiert, da rauschte eine Front von Schallwellen auf sie zu, gewaltige Fürze wie aus dem Arsch der Erde. Dann ein tiefer Seufzer. Eine verträumte männliche Stimme: »Ja!« Annas Oberschenkel überzog eine Gänsehaut, jede Erhebung ein Ekelbatzen. Vor Schreck hatte sie offenbar gezuckt, auf ihrer Hose zeigten sich dunkle Sprenkel. Am liebsten hätte sie sich in die Kloschüssel fallen lassen und abgezogen. Stattdessen flüchtete sie aus der Toilette, scheiß was aufs Händewaschen, nur nicht noch die Fresse zu dem Arsch sehen. Auf der Zeil atmete sie tief durch. »Anna!« Sie blickte auf, sah aber niemanden. »Anna, das gibt es ja gar nicht.« Aus dem Schatten trat Didier. »Mensch, Anna, wie schön. Muss ewig her sein, seit wir uns gesehen haben.« Vier Jahre und sieben Monate, sie musste da nicht lange nachrechnen. Didier war ihre größte Liebe gewesen und sie vielleicht sogar auch seine. Von Ersterem wusste er allerdings nichts und Letzteres hatte sie ihm ausgetrieben. »Hallo, Didier, das ist ja eine schöne Überraschung!« »Ja, nicht? Gut siehst du aus. Ein bisschen dünn. Hast du abgenommen?« Ja, ich suche Arbeit als Vogelscheuche. »Und du?« Er ging über ihre Anspielung auf die Gewichtszunahme lachend hinweg. Das beherrschte er mittlerweile wirklich gut, musste Anna zugeben, da hatte sich das harte Training bezahlt gemacht, das er bei ihr absolviert hatte. »Nix mehr mit Parkour, Didier?« »Manchmal, ein bisschen.« In seinen schlankeren Tagen war er ein echter Könner in Parkour gewesen, dem aus Frankreich stammenden Stadtsport. Die Aufgabe bestand darin, mit Athletik und Artistik urbane Hindernisse zu überwinden. Anfangs hatte Anna nur gestaunt, wie er mit fließenden Bewegungen Mauern erklomm, Garagendächer eroberte und über Baulücken hinwegsegelte. Dann packte sie der Ehrgeiz. Mit Didier, der sich schon als Jugendlicher auf einem Skateboard durch die Pariser Infrastruktur geturnt hatte, konnte sie nicht mithalten, aber die anderen aus ihrer kleinen Parkourgruppe ließ sie hinter sich. »Komm, Anna, probieren wir aus, ob wir wenigstens noch Minihürden schaffen!« Er deutete auf Parkbänke in der Mitte der Zeil und rannte los. Während Didier seine Kilos nur unter Aufbietung all seiner Technik über das Hindernis brachte, überwand es Anna spielend, obwohl sie seit der Trennung nicht mehr trainiert hatte. Didier machte nach drei Überquerungen schlapp, sie schaffte neun. Es tat saugut, sich auszupowern! »Jetzt haben wir uns eine Stärkung verdient. Lass uns was essen gehen, Anna, zur Feier des Tages.« Sie zögerte. »Jetzt sag bloß nicht Nein! Mensch, schon weil du mir mit deinem Computergedächtnis auf die Sprünge helfen musst. Wann haben wir uns eigentlich das letzte Mal gesehen?« Er weiß es nicht! Das Schwein hatte das größte Opfer vergessen, das sie ihm hatte bringen können! Sie rotzte die Sätze raus wie Salven aus einem Maschinengewehr: »Die Frage kann ich dir auf die Schnelle beantworten. Zuletzt haben wir uns in deinem Bett gesehen. Zwei Monate, eine Woche und vier Tage, nachdem du Schluss gemacht hast. Du hast mich nachts angerufen, und gejammert, wie einsam du bist, so-o-o einsam.« Sie hatte ihn verstanden, denn sie wusste, wie man sich fühlt, wenn man aus dem eigenen Rahmen zu rutschten droht. Mit ihren Umarmungen hatte sie Didier in dieser Nacht zusammengehalten. »Ich hatte den Kopf gerade über Wasser bekommen, was verdammt noch mal ein Wunder war. Aber du hast nicht locker gelassen und ich bin angedackelt. Natürlich hat diese Scheißnacht alles wieder aufgerissen. Sie hat mich ein Jahr meines Lebens gekostet, ein verdammtes, elendslanges Jahr.« Sie brachte nur noch ein heiseres Flüstern heraus. »Und du erinnerst dich nicht dran, du Arschloch! Sieh zu, dass du Land gewinnst, bevor ich …« Ihre Stimme versagte und sie ging schnell weiter. In ihr rauften Wut und Verzweiflung um die Vorherrschaft. Es sah schlecht aus für die Wut. Statt an der Konstablerwache in den Bus zu steigen, schob sie das Rad die Zeil weiter hinunter, bis sie zu einer Pilsbar kam. Sie hatte Durst! Außer dem Wirt und einem Zwerg, dem der Barhocker wie ein Wurmfortsatz aus dem Hintern wuchs, war die Kaschemme leer. Anna setzte sich ans andere Ende des Tresens und bestellte »scheißegal was, Hauptsache, Prozente«. Dem Geschmack nach hatte sich der Wirt für die sichere Variante entschieden: Brennspiritus. Sollte ihr recht sein. Links neben ihr hing ein Spiegel mit Whiskywerbung. Sie wollte nicht hineinschauen, doch es passierte, und sie sah, was sie nicht sehen wollte: Sie gab kein besseres Bild ab als der Zwerg am anderen Ende des Elends. Sie fühlte eine Leere, die mit allem Schnaps der Welt nicht mehr zu füllen war. In diese Leere stach der Begriff wie ein Blitz. Selbstmord. Vielleicht war das die Lösung. Aber wieso eigentlich Mord? Wenn sie sich das richtig gemerkt hatte, handelte es sich bei Mord um eine besonders verwerfliche Form des Totschlags: ein grausamer, heimtückischer oder einer aus niedrigen Beweggründen. Plötzlich verstand sie. Denn sie spürte, wie ihr lebensgieriges Ego die Mordmerkmale abnickte: Selbst abzudrücken, das war grausam! Nicht aufs Ego zu hören, der Gipfel der Heimtücke! Und das nur, weil man es satthatte? Der niedrigste aller Beweggründe! Tod war tabu. Bloß weg damit, raus damit, gibt’s nicht, jedenfalls nicht hier, jedenfalls nicht jetzt! Ihr Ego überfiel blankes Entsetzen bei dem Gedanken, sie könne das Betriebssystem endgültig löschen. Endgültig – da klang das unmenschlich leere Nichts an, mit dem sich die Egos nicht abfinden wollten. Nicht konnten. Brauchten unbedingt mehr Zeit. Egal wofür, Hauptsache: mehr! Als wäre ein Leben umso besser, je länger es dauerte. Als ließen die Egos die Jahre, die sie erflehten, nicht achtlos liegen. Forderten gierig Nachschlag und stocherten dann nur müde drin rum. Schön blöd. Für eine Eintagsfliege währte ihr Leben ein Leben lang. Sie musste sich keinen Kopf machen, wie viel besser es einer Schildkröte ging. Die hatte ja auch nur ein Leben. Wenn sich die beiden unterhalten hätten, wäre es ums Fliegen und Kriechen, um Luft unter den Flügeln und Schutz unterm Panzer gegangen, nicht um den Kalender, an dem die Egos hingen wie Junkies an der Nadel. Im Vergleich dazu nahmen sich Eintagsfliegen wie kleine Buddhas aus. Denen war ein Tag so gut wie tausend Jahre. Die lebten einfach. Den kleinen großen Egos wären selbst tausend Jahre nicht genug. Würden die Zeit vertrödeln und dann wieder anfangen, über das Ende zu lamentieren, den Tag, an dem sich die ungeheure Ewigkeit des Todes nicht mehr auf morgen vertagen ließe. Würden immer noch auf den Kalender starren. Statt zu leben, was da war. Oder es eben sein zu lassen! Wer früher ausstieg, kürzte sein Leben doch lediglich ab. Um ein paar Jahre. Oder ein paar Minuten. Womöglich kam ihm das Leben sogar zuvor. Sie stellte sich eine Selbstmörderin vor, die im Aufzug zum Hochhausdach fährt. Plötzlich stürzt das Ding in die Tiefe. Entgeistert erwartet sie den Aufschlag und weiß nicht, ob sie lachen oder weinen soll: vom Täter mal eben zum Opfer degradiert! Die Groteske beflügelte sie gerade lange genug, um noch einen Doppelten zu bestellen. Während sie, über das leere Glas gebeugt, auf Nachschub wartete, fiel was rein. Eine Träne. Wahrscheinlich hatte die auch ihr Ego auf Reisen geschickt. Klar doch, Selbstmord verlangte Mut und Selbstmitleid nahm ihn. Fuck you! Sie wischte die Träne so heftig weg, dass sie sich fast ein blaues Auge verpasst hätte. Aber die Träne blieb kein Einzelgänger. Diesmal siegte das Selbstmitleid. Sie hatte niemanden. Ukela vielleicht? Was für ein erbärmlicher Gedanke. Sollte Ukela jetzt als Krücke herhalten, damit Anna Heydt noch ein paar Schritte weiterstolpern konnte? Bullshit. Sie hatte niemanden, nicht mal sich selbst, nur dieses kleine große Ego, das unbedingt weiterleben und auch noch die letzten Millimeter der Ochsentour auskosten wollte. Niemanden. Sie driftete allein durchs All. Mutterseelenallein. Vaterseelenallein. Allerseelenallein. Das war der springende Punkt. Ein Job wäre irgendwann wieder aufzutreiben und bis dahin würde sie schon nicht verhungern oder, schlimmer noch, verdursten. Selbst eine Knaststrafe, wenn der Wahnsinn der letzten Tage wirklich darauf hinauslief … obwohl, das konnte gar nicht sein! Aber einfach mal den Fall unterstellt, dann ließe sich selbst eine Knaststrafe mit zusammengebissenen Zähnen absitzen, wenn … Ja, wenn es irgendwen gäbe, der die Mühe lohnte. Wenn sich irgendein beschissener Grund fände, der mehr versprach, als dass Zeit Rosen bringt. Wenn, wenn, wenn. Sie glaubte nicht mehr daran, von den Rosen mehr als die Dornen abzukriegen. Mit jedem ihrer Versuche, sich aus der endlosen Pechsträhne zu befreien, hatten sich Widrigkeiten und Widerspenstigkeit, Unglück und Unvermögen, nur noch fester ineinander verstrickt. Das unbeschwerte Kind, das sie einmal gewesen war, hatte sie auch selbst auf dem Gewissen. Weil sie sich nie mit dem Tod von Mama und Papa abgefunden hatte. Alles Lappalien, Wohlstandswehwehchen, klar, dafür brauchte sie keinen Nachhilfeunterricht. Woanders krepierte man an Hunger. Woanders ging es ums nackte Überleben, da fand man weder Zeit noch Muße für den Luxus, sich zu grämen. Und? Hier gab es nun mal diese vermaledeite Freiheit. Und sie fühlte sich todunglücklich. Und dachte über Selbstmord nach. Sie hatte die Schnauze voll, so gestrichen voll, dass es ihr schon zu den Mundwinkeln rauslief. Ob sie jemals die Kraft finden würde, sich gegen ihr Ego durchzusetzen, wusste sie nicht. Aber sie schloss es nicht mehr aus. »Mich jedenfalls befremdet seine Vorgehensweise.« »Nun gut, Markus Engel ist in der Tat nicht, was man Mainstream nennt. Aber absolut committet! Und seine Aufklärungsquote: top! Wenn er für meinen Geschmack auch etwas zu zöger…« »Ich rede nicht von Geschmacksfragen. Ich rede von Dienstvergehen!« »Ich verstehe nicht.« »Dann müssen Sie betriebsblind sein. Engel hat die Tatverdächtige als Zeugin vernommen – obwohl bereits alle Beweise auf dem Tisch lagen! Nennen Sie das korrekt, Herr Kollege? Ist das auch Ihre Auffassung von Recht und Gesetz?« »Nein. Mit Entschiedenheit nein, da missverstehen Sie mich. Nur … Möglicherweise schienen Herrn Engel die Beweise noch nicht hinreichend belastbar.« »Papperlapapp! Das Video lässt keinen Beurteilungsspielraum. Während ich die Festnahme von Frau Heydt angeordnet habe, war ihm der Unwille ins Gesicht geschrieben. Und die Rechtsbelehrung, die er der Beschuldigten hat angedeihen lassen, kam einer anwaltlichen Beratung gleich, das haben Sie doch selbst gehört! Mit Heydts Anwalt scheint er ja sowieso auf gutem Fuß zu stehen.« »An Vermutungen möchte ich mich nicht beteiligen. Herr Engel ist ein außerordentlich erfolgreicher Kollege und ich vertraue ihm.« »Sie müssen selbst wissen, an wen Sie sich binden. Ich wundere mich nur. Man hält hier große Stücke auf Sie. Wäre es nicht schade, wenn sich Ihre Perspektiven verdüstern würden, weil Sie – natürlich mit besten Absichten – die Mauscheleien eines Untergebenen decken? Denken Sie darüber nach. Was mich betrifft: Ich weiß Mitarbeiter zu schätzen, die mit mir an einem Strang ziehen. Ich honoriere Loyalität, wenn Sie verstehen, was ich meine.« »Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls decke ich keine Mauscheleien. Ich glaube auch nicht, dass Herr Engel mauschelt. Im Übrigen müssen wir unseren Leuten schon einen gewissen Ermessensspielraum zugestehen. Bitte sehen Sie mir nach, dass ich jetzt gehen möchte, es ist bereits halb neun.« Degenhart erhob sich und verließ schnellen Schrittes Streckers Büro. Der Schlüssel klemmte mal wieder. Verdammt, der Hausmeister hätte das längst richten sollen. Der Arsch … Weiter kam Anna nicht. Die Wohnungstür wurde aufgerissen, eine Hand stieß hervor und riss sie an einem Büschel Haare auf Hüfthöhe herunter. Oh verdammt, tat das weh! Als würde jede Haarwurzel einzeln aus der Kopfhaut gezogen. Sie schrie, woraufhin die Hand noch fester zupackte und sie wie ein Kalb durch den Flur zog. Jetzt! Mit einem Ruck versuchte sie sich loszureißen. Dabei knallte sie mit dem Kiefer gegen die Garderobe. In ihrem Kopf explodierte ein Feuerwerk aus Schmerzen. Blut und Tränen tropften gleichzeitig. Und die Hand gab nicht nach. Weiter zur Schlachtbank. Was ist los? Anna kam nicht dazu, darüber nachzudenken. Oder sich dem Schmerz zu widmen. Im Wohnzimmer löste sich der Griff, ihr Oberkörper schnellte hoch und sie sah eine Hand auf ihr Gesicht zurasen. Von der Wucht wurde ihr Kopf nach hinten geschleudert. Gleichzeitig erhielt sie einen Tritt in die Kniekehlen. Sie landete im Sessel. Und spürte etwas Kaltes an ihrer Schläfe. Sie schielte hin: eine Waffe. Das vorne dran war wahrscheinlich ein Schalldämpfer. Vorsichtig blickte sie hoch und glaubte ihren Augen nicht zu trauen. »Sie?« »Möchten Sie sterben, Frau Heydt?« »Haben Sie was im Angebot?« Statt zu antworten blickte er auf ihre Finger, die idiotischerweise zitterten. Hatte sie sich nicht erst vor ein paar Minuten selbst diese Frage gestellt? War der Gedanke, einen Schlussstrich zu ziehen, nicht tröstlich gewesen? Was fiel ihrem Körper ein, jetzt Mucken zu machen? Vielleicht war ihr heute einfach mal das Glück hold! An dem Kerl nagte offenbar der Wahnsinn, vielleicht musste sie ihn nur noch ein bisschen herausfordern, und Anna Heydt würde endlich mal was abgenommen! »Du willst mich abknallen, Schwätzer? Das glaubst du ja selbst nicht. Du weißt doch selbst am besten, dass du dir eher die Hosen nass machst, Stummelschwanz!« Sie lachte, aber es klang ein bisschen hysterisch. Der Gast blieb ungerührt. Er setzte sich vor sie auf den Couchtisch, streifte die Handschuhe ab und fixierte sie aus blauen Augen, stechend wie Stahlnägel. »Hat unser Schwachkopf wohl zu viele Actionfilme …« Etwas schoss hervor und knallte auf ihren Unterkiefer. Unwillkürlich riss sie den Mund auf. Im nächsten Moment hatte sie den Lauf bis zum Anschlag im Hals. Sie würgte. Ihre Knie schlugen gegeneinander. »Ich frage Sie, ob Sie sterben wollen. Und ich meine es todernst.« Sie glaubte ihm. Der Wahnsinnige war zu allem entschlossen. Er zog den Lauf wieder aus ihrem Mund. »Stummelschwanz!« HOLTERDIEFOLTER | E-TOLEDO Die Pension Reina Isabel, die Jesús übers Internet gebucht hatte, lag in der Calle Nuncio Viejo, inmitten der Altstadt. Da oben würde es eng werden, weshalb er Glorias Renault auf einem Parkplatz unterhalb des felsigen Hügels abstellte, auf dem das alte Toledo thronte. So erhaben die Königsstadt über schwere Mauern auf die Ebene herabblickte, so schweißtreibend würde der Aufstieg geraten. Die Sonne brannte hier und heute, wie er es in Granada dieses Jahr noch nicht erlebt hatte. Doch er hatte Glück. Eine alte Dame, die er klugerweise nach dem Weg fragte, erklärte ihm stolz, in Toledo »gleite« man nach oben, nämlich auf einer Rolltreppe, zu der nach hundert Metern ein Weg abzweige. Genau genommen waren es mehrere Rolltreppen, die kleine Plattformen ansteuerten. Auf einer der Plattformen blieb Jesús stehen und genoss den Ausblick. Was er im Durchfahren für die Vorstadt gehalten hatte, war wohl größer als der alte Kern. Hässlich konnte man sie nicht nennen, wohl aber austauschbar. Glanzlose Zweckmäßigkeit im Stil der Neuzeit. Oben angekommen, fand er das erwartete Juwel vor. La Ciudad imperial, die königliche Stadt, auch »Jerusalem des Westens« genannt, weil Christen, Juden und Muslime hier jahrhundertelang friedlich zusammengelebt hatten. Da er sich in aller Herrgottsfrühe auf den Weg gemacht hatte und früh dran war, ließ er sich durch die engen mittelalterlichen Gassen treiben. Er passierte Gotteshäuser, Herrenhäuser und Paläste, verweilte auf sonnigen kleinen Plätzen, sah Mauerwerk in allen Erdfarben, von denen ihm die hellen Sandtöne besonders gefielen. Einen Plan, wie er vorgehen sollte, hatte er immer noch nicht. Freundlich nachfragen, ob der Herr Brúto vielleicht seinen Teil zu den Serienvergewaltigungen beigetragen hatte, die Jesús noch heute Phantomschmerzen im Po verursachten? War wohl ebenso wenig eine gute Strategie wie die harte Tour, bei der er, sollte sich Brúto wirklich als Verbrecher erweisen, wieder nur die Arschkarte ziehen würde. Er hätte sich die Überlegungen sparen können, denn Brúto wohnte nicht mehr in der Calle de los Reyes Católicos; mit unbekanntem Ziel verzogen, hieß es. Und nun? Ihm fiel Fermín ein, den er vor Jahren in Málaga kennengelernt hatte. Fermín war der Einzige im Rudel blutleckender Reporter gewesen, der halbwegs fair über die Todesfälle im Krankenhaus berichtet hatte. Er gab gern den investigativen Journalisten, da sollte er wenigstens für Informationen aus dem Melderegister gut sein. Jesús rief ihn an und schilderte sein Anliegen. Eine halbe Stunde später klingelte sein Handy. Der Mann sei nicht gemeldet, erklärte Fermín. »Hast du eine Ahnung, wie man so jemanden aufspürt?« »So jemanden? Geht’s um geheime Machenschaften? Du willst mir doch nicht etwa Konkurrenz machen?« Fermín lachte. »Wie ernst ist es dir denn?« »Ziemlich.« »Wenn du bereit wärest, was auszugeben, hätte ich unter Umständen« – Verschwörerton – »einen Kontakt. Jemand, der dir helfen könnte. Ein alter Haudegen. Wo der sein Geschäft gelernt hat, wurde nicht lange gefackelt.« »Ich suche keinen Schläger!« »Klar, keinen Schläger. Nur weiß man nie, was passiert, wenn man Nachforschungen anstellt. Jedenfalls verdient er sich noch manchmal nebenbei was dazu, mit privaten Ermittlungen und anderen Sachen, von denen du gar nichts wissen willst. Der ist echt gut. Und er ist Madrilene, also wahrscheinlich gar nicht weit von dir weg. Würde mich schon interessieren, was du da treibst in Toledo. Was meinst du, soll ich den mal anrufen? Vorfühlen, ob er interessiert ist?« Jesús fragte nach den Kosten. Er verdiente zwar endlich wieder, aber nicht allzu viel, und was er beiseitelegt hatte, war für den Führerschein draufgegangen, den er seit zwei Monaten besaß. »Kann ich nicht genau sagen. Um die 300 pro Tag würde ich schätzen, plus Spesen natürlich.« Jesús stöhnte. »Verstehe schon. Hm, wie könnten wir das bloß deichseln?« Natürlich musste er gar nicht nachdenken, war Jesús sich im Klaren. Fermín würde jetzt ein altbekanntes Interesse anmelden. »Eine Hand wäscht die andere, was meinst du?« Das Verschwörerische hatte dem Geschäftsmäßigen Platz gemacht. »Ich schieße dir was vor, sagen wir für ein halbes Jahr. Entweder du zahlst es mir bis dahin zurück, oder du überlässt mir die …« »Die Tagebücher, ich weiß schon. Und du weißt, dass ich die nicht hergebe. Die sind privat! Hatten wir das nicht schon tausendfach?« »Quatsch, die sind Zeitgeschichte! So oder so: Ich habe dir einen Deal vorgeschlagen und du musst dich entscheiden.« »Anrufen kannst du ja mal, danach sehen wir weiter.« »Na, das ist doch ein Wort.« Bald meldete sich Fermín wieder. »Es sieht gut aus! Der Mann ist interessiert. Tagessatz 250 Euro. Was sagst du?« Was sollte er schon sagen. Alleine kam er nicht weiter und außerdem wäre es ein beruhigendes Gefühl, jemanden an seiner Seite zu haben, sollte Brúto tatsächlich ein Verbrecher sein. Er musste eben in den nächsten Monaten das Geld zusammenhalten, um es rechtzeitig zurückzuzahlen. Auf die Tagebuchaufzeichnungen seiner Eltern aus den Jahren 1970 bis 75 hoffte Fermín vergebens. Sie bildeten sein ganzes Erbe. Er hatte sie gelesen und danach in eine selbst gebaute, windschiefe Holzkiste gelegt und nie wieder hervorgeholt. Seine Eltern hatten zu den Helden gehört, das zu wissen reichte! Darüber hinaus wollte er genauso wenig an die Francozeit erinnert werden wie die meisten Spanier. Man machte einen so großen Bogen um den Caudillo, dass man sich bis vor Kurzem nicht mal an den vielen Straßenschildern gestoßen hatte, die immer noch seinen Namen trugen, von den Denkmälern gar nicht zu reden. »Und du streckst das Geld vor?« »Ist schon geklärt, ich würde den Mann bezahlen – maximal drei Tage! Um die Spesen kümmerst du dich selbst.« »Okay. Wie heißt er?« »Das wird er dir selbst sagen. Wenn du einverstanden bist, gebe ich ihm deine Handynummer. Er wird sich bei dir rühren. Das läuft nur so rum.« Gegen halb elf, Jesús hatte sich gerade auf der geschäftigen Plaza de Zocodover niedergelassen, klingelte sein Handy. »Jesús?« »Ja?« »Ich soll anrufen.« »Ah … ja. Guten Tag. Wie geht’s?« Fragte man das – so einen? »Ich bin Carlos«, brummte es dunkel. »Carlos – und weiter?« Das fragte man so einen, der auch andere Sachen erledigte, von denen man lieber gar nichts wissen wollte, wahrscheinlich erst recht nicht. »Und nichts weiter. – Ich muss wissen, worum es geht, bevor ich entscheide, ob ich annehme.« Jesús hatte sich die Sätze Wort für Wort zurechtgelegt – man musste dem Mann ja nicht sein Herz ausschütten. Doch sie zerbröselten ihm im Mund. Carlos half ihm auf die Sprünge: »Jemanden ausfindig machen. Hat in Toledo gewohnt. Ist verschwunden.« »Ja, das ist es. Das heißt, vielleicht bräuchte ich auch einen Begleiter für ein … Interview.« »Interview, aha. Ich brauche den Namen des Mannes.« Jesús nannte ihn. »Wir treffen uns um eins vor der Kathedrale.« Seit einer Viertelstunde stand Jesús am verabredeten Ort und taxierte die Passanten. Den Mann, der vor ihm stehen blieb, hatte er überhaupt nicht ins Kalkül gezogen. Er war älter als gedacht, bestimmt schon über siebzig. Doch wenn das Klischee vom alten Eisen, das nicht rostet, jemals zutraf, dann hier. Breitschultrig und Ehrfurcht gebietende eins neunzig groß, gab der kahlköpfige Alte immer noch eine stählerne Erscheinung ab. Ein in vielen Kämpfen bewährtes Schlachtschiff. Vom linken Kieferknochen aus verlief eine Narbe über den Hals und verschwand im grauen Hemd. So grobschlächtig er wirkte, hatte er zugleich etwas soldatisch Straffes an sich. »Du bist Jesús«, stellte der Mann nüchtern fest. Die Stimme entsprach seinen Bruttoregistertonnen. »Und du Carlos«, gab Jesús trocken zurück. Weitschweifigkeit stand ja offensichtlich nicht hoch im Kurs. »Ich habe die Adresse.« »Schon?« »Ist keine große Nummer, der Brúto, aber auch nicht ganz unbekannt.« Carlos fummelte ein zerknittertes Blatt Papier aus der grauen Hose. »Da, die Adresse. Und wie geht’s weiter?« Er musterte Jesús aus kristallblauen Augen. »Ich will von dem Kerl was wissen. Und ich will, dass du mitkommst und hilfst, es rauszukriegen.« »Dann brauche ich mehr als das Gerede vom Interview.« Den Prozess ausgenommen, war Jesús in den vergangenen zwei Jahrzehnten nie ein Wort über seine Zeit im Heidenheim über die Lippen gekommen. Und jetzt sollte er diesem fremden Kerl davon erzählen? »Das ist eine komplizierte Geschichte«, wich er aus. »Auf seine komplizierte Art ist alles ganz einfach«, philosophierte der Alte mit wettergegerbter Autorität. »Fang an.« Jesús überwand sich und erzählte in dürren Worten, worum es ging. »Würde zu Brúto passen«, lautete der ganze Kommentar seines Gegenübers. »Wieso?« »Typ Ratte. Keine Ehre im Leib. Ist mal beim Einbruch ins Waisenhaus geschnappt worden. Wer bestiehlt denn Waisenkinder?« »Waisenhaus? Wann denn?« »In den Siebzigern. Wir statten ihm jetzt einen Besuch ab. Aber: keine Namen. Ich heiße ›du‹, und du auch, klar? Und: Ich hab das Kommando.« Bis zur Calle de Bautista Monegro war es nicht weit. Brúto bewohnte dort ein Touristenapartment. »Schätze, er hat sich dort wegen irgendwelcher Scherereien vorübergehend verkrochen«, klärte Carlos ihn auf, während sie eine abschüssige Gasse hinuntergingen. Offenbar kannte er sich hier aus. Was keine Überraschung war, bis ins siebzig Kilometer entfernte Madrid reichte die Anziehungskraft Toledos locker, sie reichte ja sogar bis nach Japan, wie man unschwer sah. Vor Brútos Unterkunft angekommen, zog Carlos einen Metallstift aus der Jackentasche, mit dem er das Torschloss öffnete. Sie passierten einen Durchgang, der in einen Innenhof führte. Carlos deutete auf eine Tür, vor der Jesús Position beziehen sollte. Er selbst ging auf ein offen stehendes Fenster zu, das sich nur knapp oberhalb des Bodens befand, lugte kurz hinein und sprang. Polternd landete er auf dem fast einen Meter tiefer liegenden Fußboden. Jesús hörte Fußgetrampel, dem ein Aufschrei folgte. Das sollte wohl eher ein Panzerangriff als eine chirurgische Operation werden. »Komm rein«, rief ihm Carlos halblaut zu. Jesús beugte sich ins Fenster. Eine schattige Maisonette-Wohnung. Unten befand sich ein Wohnzimmer mit offener Küche. Auf der gegenüberliegenden Seite führte eine Treppe zu einer hölzernen Galerie, auf der ein Bett stand. Jesús sprang – was er im Moment der Landung bereits bereute. Es fühlte sich an, als wäre eine angeknackste Rippe aus der Verankerung gesprungen. Mit zusammengebissenen Zähnen sah er sich um. Vor der Küchenzeile stand ein kleiner alter Mann. Der aus seinen Tagträumen. Der Vollbart war ab, dafür wuchsen wieder Haare auf dem Kopf. Jesús erkannte ihn trotzdem. Nur mit den Gangstern im Heidenheim konnte er ihn immer noch nicht in Verbindung bringen. Ohne den Bart hatte der Mann ein spitzes, fleckiges Hyänengesicht. Der kleine Kopf stach aus einem dicken Hals hervor, der in abfallende Schultern mündete. Eine verzauste, in die Enge getriebene Hyäne, ja, das traf es. Jesús überlegte gerade, ob er nicht auch allein mit dem Mann fertig geworden wäre – da zückte der plötzlich aus dem Nichts ein Messer. Das Messer sprang von der linken in die rechte Hand und raste, die Spitze voran, auf Carlos’ Bauch zu. Gleichzeitig schoss ein Arm hoch. Etwas flog in hohem Bogen durch den Raum. Ein Schmerzensschrei. Dann froren die Bewegungen ein. Das Messer steckte im Dielenboden, Brútos Handgelenk in Carlos’ Pranke. Als die Hyäne zu winseln begann, fing sie sich eine Ohrfeige ein. Und noch eine. Jesús konnte nicht so schnell zählen und die Hyäne nicht so schnell jaulen, wie sie kamen. Jesús spürte, wie sich Adrenalin in seine Blutbahnen ergoss. Paco Pirín, der sich auf der Galerie befand und hinter dem Bett kauerte, konnte zwar nicht sehen, was sich in der Küche tat, aber er reimte es sich grob zusammen. Als er durchs Fenster beobachtet hatte, wie die beiden Typen über den Hof auf die Wohnung zumarschierten, war Brúto pinkeln gewesen. Paco hatte gerade genug Zeit gehabt, die Treppe hinaufzustürzen und in Deckung zu gehen. Er fluchte in sich hinein. Was immer die beiden Typen von Brúto wollten, sie kamen zum falschen Zeitpunkt. Der alte Koloss da unten machte einen brandgefährlichen Eindruck. Langsam zog Paco seine Pistole aus der Hose. Mittlerweile hatte Carlos den schmächtigen Mann auf die Küchenzeile gehoben. »Beine auseinander!« Er stellte sich zwischen die gespreizten Beine und verschränkte die Arme vor der Brust. Du kannst mir nichts, lautete die Botschaft. »Er gehört dir.« Jesús brachte kein Wort raus. Er hatte in jungen Jahren Gewalt zu spüren bekommen, gegen die das hier ein Kinderspiel war. Doch zum ersten Mal ging die Gewalt von ihm aus. Er gab sich einen Ruck. »Ich will wissen, ob du«, er trat näher heran und versuchte Brúto mit seinem Blick zu fixieren, »in den Siebzigern dabei mitgemacht hast, kleine Jungs in ein Lager zu verfrachten und dort an Kunden zu vermieten, die mit ihnen machen durften, was sie wollten, vor allem sie vergewaltigen.« Brútos schaute zu Carlos. Was denn, sollte das Gespräch an ihm vorbei geführt werden? Nichts da! Jesús hob das Messer vom Boden auf, und hielt es der Hyäne an den Hals. Und forderte Carlos auf zu gehen. Der Alte hatte die Hyäne eingeschüchtert und sie ihm auf der Küchenplatte wie auf dem Silbertablett serviert, nun kam er allein klar. Er war noch immer allein klargekommen, diese Übung hatte ihn das Leben früh gelehrt. »Wenn du meinst.« Jesús hörte die Tür zufallen. Auch Paco hörte es. Schwein gehabt. Mit dem anderen wurde er locker fertig. Er hörte, wie der Kerl auf dicke Eier machte. »Wenn du heil aus der Sache rauskommen willst, dann redest du jetzt. Und wenn du versuchst, mich zu verscheißern, jage ich dir die Polizei auf den Hals, klar?« Das hätte er nicht sagen sollen. Polizei konnte Paco definitiv nicht gebrauchen. Der gestrige Überfall hatte ihnen neben einigen dicken Geldbündeln auch ein dickes Problem eingebracht: einen übermütigen Wachmann, der um eine Kugel gebettelt hatte. Wenn jetzt die Bullen ins Spiel kamen und sich ausgerechnet Brúto vorknöpften, das schwächste Glied in der Kette, waren sie alle im Arsch. Brúto hatte zwar nur die Lage ausbaldowert und später Schmiere gestanden, doch er wusste zu viel. Paco war von Anfang an dagegen gewesen, die linke Bazille mitzunehmen. Wegen dem würde er bestimmt nicht in den Knast einziehen. Für die Polizei war Paco immer noch ein unbeschriebenes Blatt, was in seinen Kreisen was heißen wollte. Und er gedachte, seine Weste weiterhin sauber zu halten. Eigentlich musste er dem Typen da unten dankbar sein. Jetzt hatte er einen guten Grund, die Bazille auszumerzen; den Eindringling natürlich auch, Zeugen würde er hier nicht zurücklassen. Er nahm die dreitausend Euro, Brútos Anteil, vom Bett. Langsam über den Holzboden auf den Steg zu, der zur Treppe führte. Jesús hielt mitten im Satz inne. Hatte er etwas gehört? Ein Knarzen? Unsinn, seine Nerven spielten verrückt, nichts hatte geknarzt. Er horchte erneut. Nein, da war nichts. Plötzlich wieder ein Knarzen. Es kam von oben. Na und? Wahrscheinlich arbeitete einfach die Holzdecke. Allerdings hatte Carlos die Galerie nicht inspiziert. Man hatte zwar vom anderen Ende des Raumes den größeren Teil eingesehen, aber nicht das Eck hinter dem Bett. Was, wenn da wirklich jemand war? »Ist jemand zu Hause?« Jesús fuhr herum. Ein Mann beugte sich ins Fenster. »Ich hätte ein Päckchen für Señora Peron.« Jesús stellte sich vor Brúto und drückte ihm das Messer an den Hals. »Sie stören«, knurrte er den Postboten an. »Gehen Sie.« Oder sollte er den Mann hereinbitten, um sich in dessen Gegenwart die Galerie zu inspizieren? »Sie würden das Päckchen nicht vielleicht annehmen?« »Ich sagte, Sie stören.« Der Postbote verschwand und Jesús wandte sich wieder Brúto zu. Erneut ein Knarzen. Wenn da das Holz arbeitete, dann arbeitete es sich langsam zum anderen Ende des Raums vor. Vielleicht hätte er mit dem Postboten zusammen das Weite suchen sollen. Paco befand sich mittlerweile auf dem schmalen Steg zur Treppe. Von seiner Position aus konnte er die Küche überblicken, ohne selbst gesehen zu werden. Er hatte die beiden jetzt im Visier. Den Arm auf dem Oberschenkel abgestützt, zielte er auf den Rücken des Eindringlings. An Kimme und Korn befanden sich weiße Markierungen, die ihm im Dämmerlicht die Sache erleichterten. Er atmete durch. Nach dem Entsichern musste er schießen, bevor die beiden sich auf das Klicken einen Reim machten. Erst den Fremden, dann Brúto. Ein kleiner, bescheidener Beitrag gegen die globale Überbevölkerung. Jesús wusste instinktiv, dass das Klicken von einer Waffe stammte. Noch bevor er sich umdrehen konnte, hörte er den Schuss. Seine Beine sackten unter ihm weg. Schade, nun würde er nie wieder auf seiner Empore liegen und die Sonne auf der Haut spüren. Paco verstand nicht, wie sich der Schuss hatte lösen können, bevor er den Abzugshebel durchgezogen hatte. Erst als er das Gleichgewicht verlor und gegen die Wand rutschte, fühlte er den Schmerz im Oberschenkel und begriff, dass nicht er geschossen hatte. Statt himmlischer Harfen hörte Jesús einen Aufschrei. Dann ein Poltern. Er blickte hoch. Brúto, der zur Salzsäule erstarrt auf der Küchenplatte saß, schien nicht getroffen zu sein. Und er selbst? Er sah an sich hinunter, keine Verletzung auszumachen. Es tat auch nirgends weh. Offenbar hatte ihn lediglich der Schreck umgehauen. Verwirrt blickte er sich um. Mitten im Raum stand Carlos, die Pistole auf den Steg gerichtet. Jesús erhob sich. Jetzt sah er auch den Mann, der sich da oben krümmte. Carlos deutete auf eine am Boden liegende Pistole. »Nimm sie und halte Brúto in Schach. Ich kümmere mich um den anderen. Er war gerade dabei, dich zu erschießen.« Eigentlich bin ich schon tot, dachte Jesús, während er die Pistole auf Brúto richtete. Er sah zu, wie Carlos den Verletzten die Treppe runter ins Bad zog. Kurze Zeit später verschloss er die Tür. »Nichts Ernstes. Hab ihm ein Handtuch zum Verbinden gegeben, das tut es fürs Erste. – Soll ich gehen?« Jesús schüttelte den Kopf. »War wohl keine gute Idee, dich wegzuschicken. Danke.« »Ich schätze, wir sind zur Unzeit gekommen. Lass mich raten, Brúto. Ihr habt gerade ein Ding gedreht, richtig?« Brúto, der immer noch auf der Küchenplatte saß, schaute nur blöd. Carlos trat auf ihn zu, alles wie gehabt. »Also, mein Freund. Du weißt jetzt, dass wir nicht von der Spaßtruppe sind. Wenn es sein muss, werden wir uns die Hände an dir schmutzig machen, kapiert?« Brúto schwieg. »Hör mir gut zu«, fuhr Carlos leutselig fort, »von Profi zu Profi gewissermaßen.« Er nahm sich in aller Seelenruhe Brútos Handgelenk und verdrehte es, bis die Hyäne aufschrie. »Diese Sprache verstehst du, oder? Übrigens: Ich beherrsche diese Sprache aus dem Effeff. Entweder du findest die richtigen Worte oder du lernst mein Vokabular kennen.« Brúto jammerte, er wisse von nichts. »Ey, Leute, ich bin nur’n kleiner Gauner!« Wie man denn darauf komme, er sei an so einer Sache beteiligt gewesen, Jungen in ein Lager sperren und so, »madre mia, die ist doch viel zu groß für ’ne kleine Nummer wie mich.« Carlos zog ihn am Ohr zu sich her. »Beleidige uns nicht«, flüsterte er ihm in den Gehörgang. »Erzähle uns nichts von zu groß für dich. Auch für große Sachen braucht man kleine Ratten. Also: Was – war – dein – Part?« Keine Reaktion. »AUFSTEHEN!« Brúto schrak zurück und knallte mit dem Kopf gegen einen Hängeschrank. Carlos ließ ihm keine Zeit, nach der Wunde zu tasten. Das Donnern wich einem rauen Flüstern. »Aufstehen. Sofort.« Brúto spritzte von der Küchenplatte wie ein Öltropfen aus einer heißen Pfanne. »Hose runter, Brúto. Ich sag es dir nur ein Mal.« Brúto senkte den Kopf. Die Arme baumelten schlaff am Körper. »Zwischen dir und großen Schmerz passt kein Blatt Papier mehr. Du musst dich jetzt entscheiden.« Doch Brúto vermochte es nicht. Wahrscheinlich sah er Carlos’ Knie nicht kommen, doch mit Sicherheit spürte er es. Er würgte, als kämen ihm seine Eier die Speiseröhre hochgeschossen, und krümmte sich nach vorn, von wo ihm eine Faust entgegenkam. Sein Kopf schleuderte zurück und knallte gegen die Mikrowelle. Es knirschte gehörig im Gebälk. Jesús riss beschwichtigend die Arme hoch, doch Carlos ignorierte es. »Sieh nach, ob du eine Schere findest oder ein Messer. Dann ziehst du oben das Laken vom Bett und schneidest es der Länge nach in zwei Streifen. Einen schmeißt du mir runter, den anderen bindest du oben am Geländer fest.« Jesús warf einen Blick auf Brúto, der inzwischen, nackte Angst im Gesicht, Hose und Unterhose heruntergelassen hatte. Es musste wohl sein. Als er nach getaner Arbeit die Treppe hinabstieg, sah er, wie Brúto, die Beine zusammengebunden, auf einem Stuhl stand. In seinem Mund steckte ein Knebel. Carlos verknotete Brútos hochgestreckte Arme am Laken, das von Geländer herunter hing, dann trat mit einer gemächlichen Bewegung den Stuhl weg. Brúto stieß einen Schmerzensschrei aus. Sein Körper zitterte wie der eines Gehenkten, dann erschlaffte er. Jesús wurde schwindelig, sein Herz raste. Ein Begriff schoss ihm stechend in den Kopf. FOLTER. Was hatte Fermín über Carlos gesagt? Wo der sein Geschäft gelernt hat, wurde nicht lange gefackelt. Jesús’ Gedanken schweiften in seine Kindheit zurück. Francos Folterknechte. Eltern unterschätzten oft, was ihre Kinder alles mitbekamen. Er hatte die allgegenwärtige Furcht vor den Bösen Männern früh begriffen, lange vor seinem fünften Geburtstag, vielleicht hatte er sie schon mit der Muttermilch aufgenommen. War Carlos einer von ihnen? Er musste das hier beenden, auf der Stelle! Doch er konnte es nicht. Konnte nicht unverrichteter Dinge abziehen. Zu spät. Er zwang sich, den Blick auf den nackten alten Mann zu richten, dessen Glied an eine schrumpelige grüne Olive in einem struppigen Nest erinnerte. Carlos, der jetzt Einmalhandschuhe trug, zog ein Einwegfeuerzeug aus der Hosentasche, drehte am Rädchen vorn, bis eine hohe Flamme herauszüngelte. Mit neugierigem Entsetzen sah Jesús die Flamme auflodern und Brútos Schamhaare knisternd verkohlen. Es stank seltsam. Aus Brútos Mund drang ein gequältes Gurgeln. Das kommt nicht vom Schmerz, die Flamme war bestimmt erloschen, bevor sie die Haut erreicht hat, das kommt nur von der Angst, versuchte sich Jesús zu beruhigen. Vergebens. Was ließ er hier eigentlich in seinem Namen geschehen? Offenbar spürte Carlos seinen inneren Aufruhr. »Nur eine Minute«, sagte er bestimmt. »Schau auf die Uhr. Zähl die Sekunden. Genau eine Minute.« Noch während er sprach, hielt er die offene Flamme unter Brútos Glied. Dem schossen oben Tränen raus und unten Urin, mit dem er die Flamme löschte. Carlos ließ sich nicht beirren. Ein Ratschen, und das Feuerzeug brannte wieder. Langsam bewegte sich die Hand auf Brútos Unterleib zu. Die Flamme streckte sich nach dem winzigen Glied. Die andere Hand zog mit der Routine eines Urologen die Vorhaut zurück. Als habe Carlos nie etwas anderes gemacht. Die Spitze der Flamme kreiste wenige Zentimeter unterhalb der Eichel. Dann bewegte sich die Hand nach oben. Die Flamme zog sich an der Eichel züngelnd empor, erfasste sie und tanzte um sie herum. Etwas zischte wie bei einer Verpuffung. Ein süßlicher Geruch stieg auf. Brúto und Jesús schrien gleichzeitig. Carlos drehte sich zu Jesús um und lächelte. »Nur ein bisschen gekokelt, die Operation ist schon vorbei«, sagte er mit einer für seine Verhältnisse vergnügten Stimme. Er wandte sich wieder an Brúto. »Oder muss ich dein Ding ganz abfackeln? Nein? Dann noch mal von Profi zu Profi: Entweder du gestehst jetzt ehrlich und umfassend, oder ich mache dich auf deine alten Tage zum Mädchen. Kapiert?« Erleichtert, dass die Tortur – hoffentlich – ein Ende hatte, setzte sich Jesús auf die Couch unter der Treppe. Mit zitternden Händen nahm er einen Zug aus der Flasche Cognac im Regal. Carlos schob Brúto zwischen sich und Jesús auf die Couch. »Die Hose?« Jesús irritierte es, Brúto nackt neben sich zu haben. »Zu früh«, entschied Carlos. »Vielleicht muss ich da noch mal ran, falls unser Freund grenzenlos dumm ist.« Er klopfte Brúto jovial auf die Schulter. »Aber das bist du nicht, oder? Andernfalls hat der Albtraum noch gar nicht richtig begonnen. Das weißt du, nicht wahr? Also, sage uns einfach die reine Wahrheit, dann hast du deine Hose bald wieder an.« Brúto nickte. »Geht doch. Wir machen das jetzt wie folgt, mein Freund. Statt dir die Würmer aus der Nase zu ziehen, hören wir dir zu. Und du erzählst uns alles, was du über diese Geschichte weißt – und ich meine wirklich: ALLES.« In den Siebzigern, begann Brúto, habe er gelegentlich für »so ’nen Verein« gearbeitet. Seine Aufgabe bestand darin, Waisenkinder »zu besorgen«. Gefragt waren Jungen im Alter von fünf bis zwölf Jahren. Besorgen bedeutete, die Jungen entweder mit Versprechen zu ködern oder sie aus dem Waisenhaus »zu klauen«. Was mit denen danach geschehen sei, damit habe er übrigens nichts, aber so was von gar nichts zu tun! Eigentlich wisse er auch überhaupt nichts darüber. »Dann ging es bei dem Einbruch ins Waisenhaus gar nicht um Wertsachen«, stellte Carlos fest. Nein, bestätigte Brúto, jedenfalls nicht um Gegenstände. Das habe er vorgeschoben, um einer härteren Bestrafung zu entgehen. Er war mit Bewährung davongekommen und hatte weiter »beschafft«. Die Jungen hielt er in einem Haus außerhalb Toledos versteckt und übergab sie dann gegen Bares einem Kurier. »Wer war der Auftraggeber?«, wollte Jesús wissen. Den habe er nie zu Gesicht gekriegt. »Es gab nur ’s Telefon. Und ich hatte keine Nummer von denen. Die Zentrale, so hieß das, also die hat angerufen. Aufträge durchgegeben. Meistens lediglich die Menge. Manchmal Sonderwünsche.« »Und ich?« Brúto blickte ihn verständnislos an. »Ich … war solch ein Junge.« »Aha«, erwiderte er gedehnt. Es irritierte ihn offensichtlich, ein Opfer vor sich zu haben. »Also, das war ich nicht. Bestimmt gab’s noch andere, die Jungs besorgt haben.« »Was genau weißt du?«, schaltete Carlos sich ein. »Nein, nein, nein, nein, nein!« Der Hyänenschädel schwang aufgeregt zwischen Carlos und Jesús hin und her. »Ich hab nix mitbekommen! War nur ’n kleiner Beschaffer, Ehrenwort! Mir hat keiner was gesagt. Dafür leg ich meine Hand ins Feuer.« »Ich lege noch was ganz anderes von dir ins Feuer, wenn du lügst«, erinnerte ihn Carlos. Brúto beharrte, es sei die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. »Erzähl mehr über die Zentrale.« »Was soll ich da noch erzählen?« Carlos ergriff das Feuerzeug. »Schon gut, ich sag ja alles. Ich weiß nur nicht …« »Wie sind die an dich gekommen?«, unterbrach ihn Jesús. »Einfach so.« »Ach, einfach so? Stehst du in den Gelben Seiten unter Kinderschändung?« »Die werden jemanden gehabt haben, der sich hier auskennt und wusste, der Diego leistet solide Arbeit.« »Du Schwein!« Jesús wollte Brúto an die Gurgel, doch Carlos hielt ihn zurück. »Wer sind die?«, übernahm er wieder die Befragung. »Keine Ahnung. Also, da war meist ’n Mann in ’er Zentrale, sprach gut Spanisch. Trotzdem glaub ich, der war keiner. Manchmal eine Frau, Südamerikanerin vielleicht. Der Mann hat auf Chef gemacht, aber ich hätte meinen Arsch drauf verwettet, da gab’s einen dahinter, der das Sagen hatte. Kann ich nicht erklären, war nur so ’n Gefühl.« »Woher wusstest du, wann die anrufen?« »Wir hatten unsere Zeiten.« »Und wenn du die dringend hättest erreichen müssen?« »Ging nicht. Wenn ich Ärger krieg, Polizei und so, du weißt schon, das war doch nicht das Problem von denen, du siehst ja, ich hab nix Richtiges zu verraten.« »Noch mal zum Anfang: Wie haben die Kontakt zu dir aufgenommen.« »Beim ersten Mal über ’nen Kumpel.« »Wer …« »Vergiss es, ist kurz darauf abgenippelt. Vielleicht war ’n das die. Die sind echt gefährlich! Und wenn da jetzt jemand spitzkriegt, Brúto hat geplaudert … – Aber ich hab gar nichts gesagt, nicht? Also, ich meine: Ich hab alles gesagt, alles was ich weiß, müsst ihr mir glauben. Nur: Ich weiß ja gar nix!« »Wie kommst du auf die Idee, die könnten noch aktiv sein?« »Weiß nicht. Ist bloß der Schiss. Anscheinend sitzen ja die meisten seit dem Prozess im Knast. Hey! Ihr wollt doch nicht zur Polizei wegen dem, was ich euch gesagt hab? Das war jetzt mit Gewalt und so, das zählt überhaupt nicht, ich geh nicht in ’en Knast!« »Klappe«, knurrte Carlos, »sonst schaffe ich die Voraussetzungen, dass du im Frauengefängnis landest.« »Und wenn die noch leben und spitzkriegen, was ihr aus mir rausgekitzelt habt, dann lande ich aufm Gefängnisfriedhof! Verdammt, können wir mit dem ganzen Scheiß hier nicht endlich Schluss machen?« »Wie lange hast du für die gearbeitet?« »Bis Ende 75, dann hatte ich die Nase voll.« »Und die haben dich einfach ziehen lassen?« »Der aus ’er Zentrale hat gesagt, grundsätzlich ja, nur nicht sofort.« »Hat der das gleich bei deinem Anruf gesagt?« »Du meinst, ob der selbst entscheiden konnte oder jemand weiter oben, der Big Boss oder so?« »Genau.« »Ich glaub, das hat ’ne knappe Woche gedauert, bis das entschieden war.« »Erzähl weiter.« »Sechs Monate oder so hab ich weitermachen müssen, vielleicht brauchten die erst ’n Nachfolger, keine Ahnung.« Brúto atmete tief durch. »Am Ende haben die mir Besuch vorbeigeschickt«, ergänzte er mit leiser Stimme, »zwei Typen, die mich gefoltert haben, um mir einzutrichtern, dass ich’s Maul zu halten hab. Mensch, die konnten das echt gut. Wenn ich was erzähl, egal was, egal wann, dann bin ich tot, hat’s geheißen. Ich kann nur hoffen, die sind schon tot.« »Wo kamen die Typen her?«, setzte Carlos nach. »Keine Ahnung, nicht von hier. Aber das waren nicht einfach zwei Schläger, das waren Profis … so wie du.« Jesús dachte nach. Er konnte jetzt die Polizei über das Geständnis informieren, doch ihn selbst hatte es keinen Schritt vorangebracht. »Gab es einen zweiten Mann? Einen, der dir geholfen hat? Einen jungen?« »In keinster Weise«, beeilte sich Brúto festzustellen. Er sei ein Einmannunternehmen, immer schon gewesen. Jesús beschrieb den jungen Mann aus seinen Tagträumen, vielleicht kannte Brúto ihn aus einem anderen Zusammenhang. Doch mit seinem kläglichen Versuch, das Gesicht in Worte zu fassen, hätte nicht einmal er selbst etwas anzufangen gewusst. Er hatte die Nase voll. Die Enttäuschung, nichts Wesentliches herausgefunden zu haben, und die Scham über das nackte, gefolterte Glied verwoben sich zu einem schwarzen Schleier, unter dem er kaum noch Luft bekam. Er musste hier raus. »Damit, ein Opfer zu sein, hatte ich mich arrangiert«, murmelte er, während sie durch die Altstadtgassen gingen. »Aber jetzt fühle ich mich obendrein wie ein Täter.« »Opfer und Täter sind siamesische Zwillinge«, entgegnete Carlos trocken. »Muss mal telefonieren.« Kurz darauf informierte er Jesús, dass sie nun nach Acalá de Henares führen. »Kenne da jemanden, der nach deinen Angaben eine Phantomzeichnung anfertigen wird.« Jesús schaute überrascht. Er hatte gedacht, ihre Begegnung neige sich dem Ende zu, und bereits begonnen, das Gefühl der Ohnmacht in sich einsickern zu lassen. Zudem schwankte er, ob er Carlos’ »Dienste« weiter beanspruchen wollte. Seine Empfindungen waren zwiespältig. Einerseits sträubte sich alles in ihm gegen dessen Methoden, andererseits gab der Alte das Gefühl von Sicherheit. Unschlüssig fragte er, was ein Phantombild schon bringen könne. »Man muss dem Glück Gelegenheit geben«, antwortete Carlos. ANASTASIA PAPANDREOU | D-FRANKFURT/MAIN »Ja, Sie haben recht daran getan, Herr Triebel. Klingt mysteriös, das sollten wir unter vier Augen besprechen – oder sechs, ich bringe vielleicht eine Kollegin mit. Dann bis gleich.« Nachdem Engel eine Funkstreifenbesatzung angefordert hatte, die sich in der Heydt’schen Wohnung umsehen sollte, blickte er zu seiner neuen Kollegin am anderen Schreibtisch rüber. Kriminalkommissarin Anastasia Papandreou war gebürtige Griechin, Anfang dreißig, eine mediterrane Erscheinung, schlank, attraktiv und vor allem: klar. Schon als er sie vor einem halben Jahr bei einem Seminar in Kassel, ihrem bisherigen Dienstsitz, kennengelernt hatte, war sein Eindruck ausgesprochen positiv gewesen: keine Mätzchen, kein Geschwätz und kein Getue. Doch, »klar« traf es. Was sich nicht zuletzt daran zeigte, dass sie einem in die Augen sah. Sie hatte schöne, fast schwarze Augen, die unter einem dicken Pony brauner Haare hervorlugten. Darum ging es natürlich nicht, sondern um kollegiale Zusammenarbeit. Noch weniger ging es um ihre sich dezent abzeichnende, weibliche Figur. Aber sie schadete auch nicht. Jedenfalls störte es ihn gar nicht mehr, das Büro wieder teilen zu müssen. Es nervte ihn nicht einmal, dass Degenhart sie unverhofft im Fall Heydt zum Team erklärt hatte. »Herr Triebel, der Chef von Frau Heydt«, informierte er sie über den Anrufer. »Sie war gestern tagsüber in der Redaktion, alles ganz normal. Aber abends hat sie ihm telefonisch gekündigt und seltsame Andeutungen gemacht. Heute ist sie nicht zur Arbeit erschienen und er kann sie auch nicht mehr erreichen. Ich möchte den Mann treffen. Kommen Sie mit, Anastasia?« Der Vorschlag, sich beim Vornamen anzureden, kam von ihr. Ziemlich schnell und ein bisschen vorlaut, fand er, eigentlich fühlte er sich hier noch als Stubenältester. Natürlich hatte er ihr keinen Korb gegeben. »Erzählen Sie mir unterwegs mehr über den Fall?« Er nickte und zog eine kleine Blechdose mit Motiven der Olmeken aus der Schreibtischschublade. Er hatte sie dort deponiert, um spontan zu entscheiden, ob er der Neuen ein Willkommensgeschenk machen wollte. »Ähm, ist für Sie. Zum Einstand.« Sie öffnete die Pralinendose. »Wow, die sehen toll aus! Danke!« »Selbst gemacht«, sagte er verlegen. »Hey, sind Sie etwa auch schokosüchtig? Sie glauben gar nicht, wie sympathisch ich das finde!« Engel stutzte. Sucht sollte einen sympathisch machen? Hoffentlich brachte sie anderen Straftaten weniger Wohlwollen entgegen. Eine unnötige Sorge, denn Anastasia Papandreou war auf das süße Zeug in der Dose nicht wirklich scharf. Sie tat nur begeistert. EIN KLEINER PICASSO | E-ALCALÁ DE HENARES Jesús hatte nie verstanden, warum die Spanier als automobile Anarchisten galten, aber er war auch noch nie im Großraum Madrid gewesen. Bis sie endlich die Ausfahrt nach Alcalá de Henares erreichten, war er willens, seinen stempelfrischen Führerschein wieder abzugeben. Mit knappen Anweisungen lotste Carlos ihn in Richtung Altstadt. Sie passierten eine Gegend mit mehrstöckigen, vergleichsweise wohnlichen Häuserblocks. In der Avenida de Guadalajara zeigte Carlos auf einen freien Parkplatz. Er brummte etwas wie »nicht weit«. Viel mehr als Brummen durfte man wohl nicht von ihm erwarten, wenn er nicht gerade einen Delinquenten folterte. Jesús schob die düsteren Gedanken beiseite und widmete seine Aufmerksamkeit zwei in Bronze gegossenen Männern: Die Herren Quijote und Pansa posierten auf einer Bank und ließen es sich in der Sonne gut gehen. Sehr idyllisch. Jesús hätte sich am liebsten dazugehockt. Nur war das hier leider kein Ausflug. »Was wird das Phantombild eigentlich kosten?« Das sei eine Gefälligkeit unter Freunden, beruhigte ihn Carlos. Sie bogen nach links ab und betraten einen Hauseingang. Claudio, wie der Freund hieß, war kaum jünger als Carlos. Aber viel kleiner. Hutzelig. Seine graue Hose hing an ihm wie ein Windsack in der Flaute. Er bat sie herein und leitete Jesús in ein vollgepacktes Zimmerchen. Auf dem Schreibtisch stand ein Computer, davor lagen ein Zeichenblock und mehrere Bleistifte. Claudio wies auf eine verschlissene schwarze Chaiselongue im Eck. Jesús solle sich da hinlegen und die Augen schließen. Solle das Gesicht des Unbekannten langsam aufsteigen lassen. Ganz gemächlich. Nichts übereilen. Keinen Druck machen. Wenn es erscheine, zunächst vielleicht nur blass, solle er es Stück für Stück beschreiben. Er solle wie zu sich selbst sprechen, alles andere vergessen, er müsse sich um nichts kümmern. Sie hätten alle Zeit der Welt. »Das Technische kommt später, daran denken wir jetzt noch gar nicht«, sagte der kleine Mann eindringlich. »Einfach die Augen geschlossen halten, immer schön geschlossen halten, einen kleinen Anstoß geben und dann treiben lassen.« Gitarrenmusik erklang, La leyenda del beso, die Legende vom Kuss. Jesús fühlte sich wie in einer Therapiesitzung. Es dauerte, bis er den Raum, den Alten und die Umstände vergessen hatte, und sich in einer nebeligen Gedankenwelt verlor, aus der schließlich das Gesicht des jungen Mannes aufschien. Als Claudio ihn gefühlte hundert Jahre später anstieß, »prima, jetzt kommen wir zum technischen Teil«, tat er sich schwer, in die Realität zurückzukehren. Blinzelnd warf er einen Blick auf den Zeichenblock. Ein Picasso. Man sah Augen, Mund und was sonst zu einem Gesicht gehörte, aber in freier kubistischer Interpretation, nichts am Stück. Es war Jesús schleierhaft, wie daraus ein identifizierbares Gesicht werden sollte. Zwei Stunden und viele Anläufe später hatten sie gemeinsam die Details am Computer zu einer Gesamtansicht zusammengefügt, die dem Gesicht seiner Tagträume verblüffend ähnelte. Claudio druckte die Zeichnung aus und sie gingen zu Carlos, der Zeitung lesend in der Küche saß. »Wir haben es!«, triumphierte Claudio mit einem hellen Kiekser und schwenkte das Blatt wie eine Fahne, bevor er es auf den Tisch legte. Carlos betrachtete es und runzelte die Stirn. Plötzlich erfüllte ein dröhnendes Lachen die Wohnung und wahrscheinlich auch das Haus und womöglich die ganze Altstadt. »Du hast keine Ahnung?«, fragte er Jesús. Nein, hatte er nicht. »Junge, Junge, das ist …« Jesús war gespannt. Um wen handelte es sich bloß? Den jungen Juan Carlos? Julio Iglesias vor der Gesichts-OP? »Das ist …« Ja? »… wirklich unglaublich. Somos tontos!« Was für Idioten wir sind! Carlos fasste in die Innentasche seines Sakkos, zog ein gefaltetes Blatt hervor und hielt es Jesús unter die Nase. Jetzt endlich begriff auch er. DIESE ANNA HEYDT | D-FRANKFURT/MAIN Triebels Augenlider flatterten vor Nervosität. »Das war ein kurzes Telefonat … Es war so kryptisch, mein Gott, ich …« »Sie befürchten, sie könne sich etwas angetan haben?«, unterbrach ihn Engel. »Ich weiß nicht. Sie hat mir Samstag einen Artikel gegeben, und ich …« »Ja?« »Ich war gefühllos. Habe ihn nur widerwillig angenommen.« »Wieso?« »Ich habe sie vor einiger Zeit wegen … krankheitsbedingt … von der redaktionellen Arbeit abgezogen. Was sie nicht akzeptierte, sie wollte unbedingt wieder schreiben. Der Artikel sollte wohl beweisen, dass sie es wieder kann. Sich aufzuraffen, einen Artikel zu verfassen, ist aber keine Gewähr für … Jedenfalls habe ich Auseinandersetzungen befürchtet.« »Haben Sie den Artikel gelesen?« »Ja, Sonntagabend.« »Und?« »Gut! Inhaltlich noch etwas dünn, aber gut. ›Ansagen ohne Gedöns‹, wie ein Leser mal Frau Heydt gelobt hat. Möchten Sie ihn lesen? Hier.« Er drückte Engel hastig zwei Blätter in die Hand. Als wolle er das Corpus Delicti seiner Ignoranz schnellstmöglich loswerden. »Meine Güte, vielleicht habe ich ihr den Todesstoß versetzt.« Engel informierte ihn, dass die Streife eine leere Wohnung vorgefunden hatte. »Oh Gott. Vielleicht hat sie sich aufgegeben und ich habe nur dumm mit dem Hörer in der Hand da gestanden und nichts getan.« »Frau Heydt hat auf mich einen kämpferischen Eindruck gemacht«, beschwichtigte Engel, »nicht wie jemand, der sich schnell aufgibt.« »Ich weiß nicht. Sie hat sich ja so tief hinter ihren Schutzwällen vergraben. Ich mache mir solche Vorwürfe. Alles ging so schnell … ich hatte gar keine Zeit … erst danach … Mein Gott!« »Herr Triebel, würden Sie mir ein Glas Wasser besorgen?« »Ja, natürlich, Frau …« »Papandreou.« »Genau. Ich bin gleich zurück.« »Ich habe ihn weggelotst, um Ihnen vorzuschlagen, einen Spaziergang mit ihm zu machen.« Verstand Engel nicht. »Gehen ist ein Beruhigungsmittel, wissen Sie nicht? Und frische Luft dürfte ihm auch nicht schaden.« »So? Na gut, probieren wir es.« Während sie am Mainufer entlangspazierten, herrschte zunächst Schweigen. Engel überließ der Kollegin die Initiative, er wollte sehen, wie sie es anging. »Frau Heydt hat Ihnen also gestern Abend mitgeteilt, dass sie kündigt?«, begann sie schließlich die Befragung. »Sie hat gesagt, sie kommt nicht mehr. Nie mehr.« »Hat sie einen Grund genannt?« »Ja. Nein. Ich bin mir nicht sicher. Sie hat sich für meine Unterstützung bedankt und gesagt, wir sehen uns nicht mehr wieder. So ähnlich.« »Hat sie etwas von dem Video in den Lokalnachrichten gesagt?« »Nein. Ja.« Triebel blieb stehen. »Sie fragte mich, ob ich es gesehen habe. Ich sagte Nein, das schien sie zu erleichtern. Dann sagte sie, sie sei unschuldig, auch wenn ihr das keiner glauben wolle. Was ist eigentlich los? Was ist das für ein Video? Weshalb ermittelt die Polizei denn gegen Frau Heydt?« »Es gibt ein Video, das eine Frau in sexuellem Kontakt mit einem Minderjährigen zeigt, und Hinweise, dass Frau Heydt involviert ist«, sekundierte Engel. »Frau Heydt? Niemals! Was für ein Unfug!« »Gehen wir weiter. Heydt hat also gesagt, Sie würden sie nie mehr wiedersehen«, fuhr Papandreou fort. »Frau Heydt bitte, so viel Zeit muss sein.« »Hat sie eine Andeutung gemacht, was sie nun tun will?« »Nein … nicht ausdrücklich. Moment. Wie war das noch? Genau: Sie trete, Zitat, gezwungenermaßen die Flucht an, die Sache sei entschieden. Es folgte ein seltsamer Satz: Das war’s mit dieser Anna Heydt, die werden Sie nicht mehr wiedersehen. Sie bedankte sich bei mir, dann: leben Sie wohl – und Schluss. Das war ziemlich genau der Wortlaut.« »Prima.« Papandreou nickte ihm aufmunternd zu. »Wie klang ihre Stimme?« »Hm, das ist komisch, sie klang gar nicht so angespannt wie sonst. Eher … erleichtert.« Er hielt inne. »Erleichtert oder gleichgültig. Das ist ein schlechtes Zeichen, oder?« »Wissen Sie, von wo Frau Heydt Sie angerufen hat?« »Von zu Hause, ihre Nummer erschien auf dem Display.« »Sie sprachen von krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit«, setzte Papandreou die Erkundungstour fort. »Um was für eine Krankheit handelt es sich?« »Ich bin kein Arzt.« »Gibt es etwas, das sie Ihnen zurückgeben müsste, Unterlagen, Literatur, Schlüssel?« »Das hätte ich fast vergessen. Den Schlüssel werde sie mir per Post schicken.« »Frau Heydt hat Sie gestern Abend angerufen?« »Ja, gegen halb zehn.« »Wann haben Sie begonnen, sich Sorgen zu machen?« »Sofort. Das heißt, nachdem sie aufgelegt hatte. Während des Gesprächs war ich zu perplex.« »Und Herrn Engel haben Sie erst vor gut einer Stunde angerufen?« »Ja, leider.« Er atmete durch. »Ich hatte gerade aufgelegt, da rief mich meine Frau ins Kinderzimmer unserer Tochter. Melanie. Sie ist sechs. Das arme Mädchen leidet an Epilepsie. Sie hatte einen schweren Anfall, genauer gesagt eine Serie. Wir sind sofort ins Krankenhaus und über Nacht geblieben. Ich hätte da genügend Zeit gehabt anzurufen, wir konnten ohnehin nur warten. Aber ich habe allein an meine Tochter gedacht. Auch wenn ich mir jetzt wünschte, es wäre anders gewesen.« »Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Sie hatten das Recht und die Pflicht, sich in dieser Situation ausschließlich um Ihre Tochter zu kümmern«, entgegnete Papandreou sachlich. »Wenn Sie uns jetzt vorbehaltlos unterstützen, haben Sie Ihr Möglichstes getan.« Sie hatte die Worte mit Bedacht gewählt, denn sie wollte erneut auf den heiklen Punkt hinaus, die Krankheit. »Für ihre Krankheit hat Frau Heydt bestimmt eine A.U.-Bescheinigung vorgelegt – oder etwa nicht?« »Wann immer die Pflicht bestand.« Papandreou stellte sich vor Triebel. »Wir müssen wissen, wer ihr Arzt ist.« »Wieso das denn?« »Um mit ihm Kontakt aufzunehmen. Vielleicht kann er uns helfen, sie zu finden.« Triebel kniff die Augen zusammen und betrachtete die forsche Polizistin, die hier offenbar das Sagen hatte, mit Widerwillen. »Fordern Sie mich gerade auf, etwas Unrechtes zu tun?« Engel fand es an der Zeit, sich einzumischen. Er glaubte zu wissen, welchen Knopf man bei Triebel drücken musste, um an die gewünschte Information zu gelangen. »Es geht doch jetzt nicht um Rechtsfragen, Herr Triebel«, sagte er eindringlich. »Es geht darum, Frau Heydt zu finden, bevor …« Er gab ihm Zeit, sich das Schlimmste auszumalen. »Vielleicht kann uns ihr Arzt dabei helfen. Und da Sie zu Recht die Frage nach der Legitimität stellen, die würde ich folgendermaßen beantworten: Im umgekehrten Fall, wenn Anna Heydt wegen Ihnen in Sorge wäre, würde sie sich, um es mit ihren Worten zu sagen, einen Scheißdreck um Formalitäten kümmern. Sie würde tun, was getan werden muss!« Damit war das Eis gebrochen. Während Papandreou den Wagen auf dem Untermainkai in östlicher Richtung durch den dichten Verkehr steuerte, machte sich Engel Notizen. Er konnte sich keinen Reim auf das Gehörte machen. Sie mussten mehr über die psychische Verfassung von Anna Heydt erfahren. »Was meinen Sie, ist mit Frau Heydt passiert? Ich habe mich selten so schwer getan, mir ein Bild zu machen.« »Jedenfalls hat sie kryptische Formulierungen benutzt.« »Haben wir eine Selbstmordankündigung gehört?« Papandreou wusste nicht, was sie sagen sollte. Von Selbstmord wollte Markus doch gar nichts hören. Obwohl er sich sachlich gab, schwang etwas Persönliches mit, wenn er von Heydt sprach. Sie wog ab, wie viel sie ihm zumuten durfte. »60 % Suizid, 40 Flucht.« Engel gefiel nicht, wie hier mit Prozenten über den Tod von Anna Heydt spekuliert wurde, verstand aber, dass sie für Anastasia lediglich eine Gleichung war, die es zu lösen galt. »Und in der Wohnung hat die Streife nichts Auffälliges bemerkt?«, vergewisserte Papandreou sich. »Schminksachen alle an ihrem Platz?« Engel lachte. »Frau Heydt hat es nicht so mit Schminksachen. Sie ist nicht gerade gefallsüchtig.« »Und was ist mit dem Kleiderschrank?« »Jedenfalls nicht leer geräumt. Das besagt wenig. Sie ist nicht auf den Kopf gefallen. Wenn sie uns einen Suizid vorspielen will, dann richtig.« »Sie denken eher an Flucht?« »Weiß nicht. Ich würde bei niemandem Selbstmord ausschließen, wenn genügend zusammenkommt.« »Da ist noch die Sache mit ›dieser Anna Heydt‹. Können Sie das vorlesen?« »Wir nehmen die nächste Brücke über den Main. Der Satz lautet: Das war’s mit dieser Anna Heydt, die werden Sie nicht mehr wiedersehen.« Auf der Mitte der Brücke sah Papandreou nach rechts. Aus dieser Perspektive wirkten die Hochhäuser wie kristallene Zacken einer Krone. Das Herrschaftsgebiet der Hochfinanz. Papandreou mochte den Anblick. Die Türme gaben der erstaunlich übersichtlichen Stadt einen weltläufigen Tupfer. »Frankfurt ist kleiner, als ich dachte.« »Hessens größtes Dorf. Ein paar Straßenschluchten im Bankenviertel, dann wird es auch schon ländlich. Wo kommen Sie eigentlich her?« »Aus der Provinz, unwichtig. Man wird also diese Anna Heydt nicht mehr wiedersehen. Können Sie das deuten?« »Nein.« »Und wie lautet Ihr Tipp zu ihrem Verschwinden?« »Sie lebt und will uns an der Nase herumführen«, entschied Markus aus dem Bauch heraus. Leise schob er hinterher: »Ich hoffe es zumindest.« »Sie ist Ihnen sympathisch.« »Was bringt Sie darauf?« »Nur ein Gefühl.« »So?« Er dirigierte Anastasia in die Willemerstraße, wo sich die Praxis von Dr. Guhl befand. Während sie den Wagen in eine Parklücke zwängte, zog er das Handy aus der Manteltasche. »Ich melde sie als vermisst. Aber ich werde auch einen Haftbefehl erwirken.« »Wir werden einen Haftbefehl erwirken? Ja, ich bin damit einverstanden, Kollege.« DER 9. JULI 1975 | E-TOLEDO Carlos übernahm das Steuer und prügelte den Wagen auf schnellstem Weg nach Toledo zurück. Jesús war es Recht. Er wollte es jetzt endlich alles wissen, selbst wenn man Brúto dafür Feuer unterm Hintern machen musste – bildlich oder wörtlich. Doch die Hyäne hatte ihren Bau bereits verlassen. »Vielleicht ist er nur mal kurz weg?«, versuchte sich Jesús in Optimismus. Statt zu antworten setzte sich Carlos an den Schreibtisch neben der Treppe. Nach ein paar Minuten zog er ein Smartphone aus dem Sakko und tippte auf den Touchscreen. »Señor Caragua Pérez? Ich bin Staatsbeamter und suche eine Wohnung. Sie vermieten, habe ich erfahren.« Staatsbeamter? Er trug ja mächtig auf. Wahrscheinlich wollte er dem Eigentümer das gute Gefühl geben, seine Majestät, der König von Spanien, stünde persönlich für die Mietschulden ein. Kein schlechter Hinweis angesichts der Liquiditätskrise, die längst das ganze Land infizierte hatte – aber musste er ausgerechnet jetzt auf Wohnungssuche gehen? »Die Wohnung von Caragua befindet sich hier in Toledo«, klärte er Jesús schließlich auf. »Und gemietet hat sie ein gewisser – Diego Brúto!« Er hatte auf dem Schreibtisch Kontoauszüge gefunden, und darin eine Überweisung an Caragua, die den Zusatz »inkl. Nebenkosten« enthielt. Da der Ganove für dieses Touristenapartment bestimmt eine Pauschale ohne ausgewiesene Nebenkosten zahlte, war Carlos auf die Idee gekommen, der überwiesene Betrag könne die Miete für Brútos Erstwohnsitz sein. »Wahrscheinlich hat er hier nur vorübergehend Unterschlupf gesucht, weil ihm seine eigentliche Wohnung aus irgendeinem Grund nicht mehr sicher schien. Und nun hat er die Flucht zurück angetreten, weil er uns verständlicherweise nicht noch mal begegnen will. Die Wohnung liegt unten in einem Neubauviertel, Calle de Panamá. Einen Versuch ist es wert, meinst du nicht?« Jesús staunte. Nicht nur darüber, wie zügig Carlos vorangekommen war, sondern auch über die vielen Worte. Für seine Verhältnisse hatte er einen Monolog epischer Breite gehalten, den er mit dem Anflug eines Grinsens beendete. Er war offensichtlich zufrieden mit sich. Eine Viertelstunde später starrte Brúto sie durch einen schmalen Türspalt an. Er konnte sein Glück kaum fassen. Bevor er die Tür zuknallen konnte, brachte Carlos seinen Fuß dazwischen; wer von seinem Äußeren auf einen tapsigen Bären schloss, war selbst schuld. Obwohl Brúto sich mit aller Kraft gegen die Tür stemmte, drückte er sie mit Leichtigkeit auf. Er packte den Mann wie ein Kleinpaket, trug ihn durch den Flur ins Bad, griff nach einer Rolle Toilettenpapier, stopfte ihm eine Lage in den Mund, stieß das kleine Fenster mit dem Ellbogen auf, hob ihn in die Öffnung, fasste ihn bei den Füßen und schob ihn zum Fenster hinaus. Erst jetzt erwachte Brúto aus der Angststarre. Er ruderte mit den Armen in der Luft. Zu spät. »NEIN!«, hörte Jesús den Ganoven schreien. Erst einen Moment später begriff er, dass nicht Brúto geschrien hatte – konnte er mit der Papierfüllung gar nicht –, sondern er selbst. »Psst«, zischte Carlos, »nichts passiert.« Er zog Brúto hinein. »Nur ein kleiner Motivationsschub für unseren Freund.« Brútos Hose wies vorne und hinten dunkle Flecken auf. »Ausziehen, komplett, kennst du ja schon.« Mit gesenktem Blick folgte Brúto dem Befehl. Ein bestialischer Gestank machte sich breit. An den Innenseiten seiner Oberschenkel lief ein bräunliches Gerinnsel auf die Kniekehlen zu. Jesús ahnte, dass die Erniedrigung Brúto mehr quälte als die Brandblasen. Und wenn schon, dieses Schwein hatte ihn wie Sexspielzeug verscherbelt. Carlos trug wieder Einmalhandschuhe. Er fasste Brúto unter die haarigen Arme, denen eine Wolke Angstschweiß entwich, hob ihn über den Wannenrand und öffnete den Wasserhahn. »Maul auf!« Er zog den Toilettenpapiermatsch heraus und zielte mit dem Brausekopf in die Mundhöhle, um die kleingelutschten Fetzen herauszuschwemmen. Das Wasser war offensichtlich kalt: Brúto hatte eine Gänsehaut, aber kein Glied mehr. »Zu kalt?« Carlos drehte den Hebel der Mischbatterie in die andere Richtung. Brúto jammerte leise. »Es geht noch heißer. Schau mal, wie viel Spiel da noch ist. Ich glaube, es geht sogar brühend heiß.« Wie der alte Mann zitternd dastand, den Körper gekrümmt und die Knie gegeneinander gepresst, ähnelte er einem Kind, dem ein Großer übel mitspielt. Jesús beobachtete es nicht gerade mit Genugtuung, doch von Mitleid konnte keine Rede sein. Er entdeckte soeben eine unbekannte Härte an sich. »Zur Seite drehen, vorbeugen, Arschbacken auseinander! Du stinkst wie eine Jauchegrube.« Brúto gehorchte und ließ sich von Carlos abspritzen. »So, jetzt können wir endlich wie unter zivilisierten Menschen reden. Oder etwa nicht?« Brúto wusste längst, dass der leutselige Ton kein Anlass zur Entspannung war. Er nickte. Jesús ergriff das Wort, ohne die nächste Regieanweisung abzuwarten, schließlich hatte er mittlerweile eine gewisse Routine bei solchen Befragungen. Jetzt kam sein Part. »Wir kennen uns schon ziemlich lange, stimmt’s?« Brúto sah ihn verständnislos an. »Muss ich deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen? Ich habe mich in deiner Obhut befunden, irgendwo hier in Toledo. Und zwar vom siebten bis neunten Juli 1975.« Er hatte die Daten nie vergessen, denn der 9. Juli war der Geburtstag seiner Mama; er hatte ein Bild für sie gemalt, das sie nie erhalten hatte; es hing jetzt in einem Rahmen über seinem Bett. Man sah, wie es in Brútos Hirn arbeitete. 7. bis 9. Juli 1975. Der 9. Juli 1975 war ein Mittwoch. Francisco Franco, El Caudillo, der Anführer aller anständigen Spanier, war 82 Jahre alt. Ihm blieb ein Rest von 134 Tagen. Wenn jemand in seinem Umfeld das nahe Ende absah, so verschwieg er es dem Volk, das Francos Altmänneratem wie eh und je im Genick spürte. Man hatte sich daran gewöhnt. Bereits seit 1939, dem Ende des blutgetränkten Bürgerkriegs, stieg der strenge Atem über Madrid auf, streifte über die kastilische Hochebene und legte sich muffig und narkotisierend über das ganze Land. Viele kannten es gar nicht anders. Und nicht allen missfiel es. Hunderttausende gingen bis zuletzt für den Alten mit hochherzigen Treueschwüren und mordlustigen Hetzparolen auf die Straße, wenn er nach ihnen rief, um die Linke einzuschüchtern. Doch auch die anderen, die schweigende Mehrheit, kam schon klar im Jahr 1975. Es ging, wenn man den Mund oder wenigstens Fenster und Türen geschlossen hielt. Beim kleinen Nachbarn Portugal sorgte die »Nelkenrevolution« mittlerweile für frischen Wind. Und in Griechenland hatte er die Junta in die eigenen Gefängnisse gefegt. Schön und gut, nur: Hier wehte ein anderer Wind. Man musste sich arrangieren, von außen war bestimmt keine Hilfe zu erwarten. Der Caudillo hatte längst den Sieg der Mittelmäßigkeit davongetragen. Lange Zeit hatte er mit dem Führer und dem Duce einträgliche Geschäfte gemacht, sich aber nicht vom schieren Wahnsinn des einen und Größenwahn des anderen anstecken lassen. Als seine Partner mit Flammenwerfern durch die Welt zogen, hatte er sich, wie immer geschickt lavierend, herausgehalten. Statt mit ihnen unterzugehen, saß er in seinem Büro und unterschrieb Papiere. Er war eben, wie er aussah: ein großer Bürokrat und ein kleiner, konservativ kalkulierender Buchhalter. Ein Strippenzieher, der die Mitstreiter aus Staatspartei, Militär und Kirche samt und sonders gegeneinander ausspielte. Im Herzen aber war er nur ein braver Katholik, der sein Land von gottlosen Kommunisten befreien und es ein für alle Mal befrieden wollte, der Terror und Mord nur praktizierte, soweit es nötig war, in allen Ehren gewissermaßen. 1975 war es kaum noch nötig. Am 9. Juli dieses Jahres erklärte der vormalige USPräsident Richard Nixon, sein Land hätte Südvietnam niemals den Kommunisten überlassen dürfen. Darum drehte sich die westliche Weltpolitik seit dem Ausbruch des Kalten Krieges: den Kommunismus um jeden Preis zu bekämpfen. Um diesen Kampf hatte sich Spanien verdient gemacht. Da war Franco kein zu hoher Preis gewesen. Die demokratische Welt dankte dem Diktator seinen Einsatz gegen die Roten, indem sie wegsah und schwieg, wenn es unappetitlich wurde. Auch der Vatikan fand eine günstige Auslegung der Nächstenliebe: Am nächsten und liebsten waren ihm die katholischen Mitbrüder, die braven. Die Kommunisten? Das waren doch Heiden, oder? Seit einigen Jahren hatte zwar in Europa die Stimmung gedreht: Schwedens Premier Olof Palme nannte die Regierenden in Spanien jetzt »satanische Mörder«, der niederländische Ministerpräsident Joop den Uyl marschierte an der Spitze einer Anti-Franco-Demonstration und die deutsche Regierung stornierte gar den Besuch eines Segelschulschiffes. Selbst der Vatikan bat diskret um Gnade für einen Anarchisten. Aber es kam zu spät für ihn. Wie für alle anderen, die öffentlich aufbegehrten. Jahrzehnte zu spät. Premier Carlos Arias Navarro verbat sich in einer Fernsehansprache »die unerträgliche Aggression gegen Spaniens Souveränität« und basta. Deshalb sitzt Francisco Franco am 9. Juli 1975, vom aufbrandenden Protestgeschrei in Europa unbehelligt und von innen kaum bedroht, nach fast vierzigjähriger Herrschaft immer noch in seinem Büro und unterschreibt Papiere. Und versteht die Welt nicht mehr. Was die Leute bloß haben: Das bisschen Folter und Terror betrifft doch nur noch die Stellen hinter dem Komma. Die wenigen militanten Widerstandsnester stellen keine ernsthafte Gefahr mehr dar. Jedenfalls nicht für das große Ganze. Nicht für ihn. Selbst das Attentat der baskischen Untergrundorganisation ETA auf Regierungschef Luis Carrero Blanco vor knapp zwei Jahren fiel nicht ins Gewicht. Gelegentlich kommen Polizeibeamte ums Leben, die natürlich gerächt werden. Das war’s schon. Wenn überhaupt, sind ihm die illegalen Comisiones Obreras, die Arbeiterkommissionen, lästig. Denn sie praktizieren eine schwer zu bekämpfende Form der Guerilla: Perfide bedienen sie sich der von ihm gleichgeschalteten Syndikate, um die Arbeiter gegen ihn aufzuwiegeln. Still und heimlich unterwandern sie sein ausgeklügeltes System, um es von innen auszuhöhlen. Statt mit Gewalt versuchen sie es mit Überzeugungsarbeit, statt großer Visionen eint das feige Pack der kleinstmögliche Nenner mit der größtmöglichen Wirkung: die Freiheit. Die Droge lässt Katholiken Kommunisten die Hand reichen. Aber auch diese Große Koalition ist in Zahlen nur eine kleine. Geringfügige Schönheitsfehler in einer an sich tadellosen Bilanz. Nur die Ruhe, die Polizei fahndet bereits. Auch nach dem Ehepaar Elena Mirandor und Eduardo Sanchez fahndet die Polizei. Seit Mitte Juni 75 wissen die beiden davon und sind untergetaucht. Sie haben damit gerechnet, wie jeder aus den Comisiones Obreras damit rechnen muss. Sie wähnten sich gut vorbereitet und machen nun die Erfahrung, dass sich Panik nicht an Pläne hält. Sie erschrecken vor ihren eigenen Schatten. Weil sie eben keine in die Gefahr verliebten Berufsrevolutionäre sind, sondern ein ganz normales Paar, das nur nicht mehr hat tatenlos zuschauen können. Vor allem um ihren fünfjährigen Sohn Jesús machen sie sich jetzt Sorgen. Sie haben ihn hastig ins Gepäck gesteckt, wo er auf Dauer natürlich nicht bleiben kann. Mögen die Tage des greisen Caudillo auch gezählt sein, so ist doch nicht zu hoffen, dass es sich bald zum Guten wenden wird. Niemand kann vorhersehen, dass ausgerechnet der von Franco selbst abgerichtete Ziehsohn, Bourbonenprinz Juan Carlos, bald den Weg in die Demokratie ebnen wird. Nichts, wirklich gar nichts weist auf ein glückliches Ende hin. Deshalb suchen sie für Jesús eine langfristige Lösung. Er soll schnellstmöglich zu Freunden ins Ausland gebracht werden, danach sieht man weiter. Auf die Empfehlung eines Mitstreiters hin haben sie den Jungen für drei Tage in die Obhut eines verlässlichen Mannes gegeben. Nirgends sei es für den Jungen gefährlicher als in ihrer Nähe, wähnen sie. Heute, am 9. Juli 1975, einem Mittwoch, wollen sie ihn abholen. Brúto brauchte Zeit. Er starrte blöd vor sich hin, während er seine Erinnerungen durchforstete. Dann hob er unvermittelt den Kopf und sah Jesús an. Er war offensichtlich an dem Tag angelangt, mit dem für Jesús das Martyrium begonnen hatte. »Du bist der kleine …« Jesús sagte nichts. »Der Kleine … der Kleine … Dios mio, du bist der kleine Jesús. – Also, ich hab nur ’n Befehl ausgeführt!« »Welchen?« »Also, das war ’ne Ausnahme, ehrlich. Normalerweise war’s, wie ich’s gesagt hab: Ich hab nur Jungs aus ’m Waisenhaus geholt. Doch dann kam ’n Anruf aus ’er Zentrale. Ein Befehl, hörst du? Ein Befehl! Dass ich ’n Jungen krieg. Nichts Verbotenes, überhaupt nicht! Nur ’n paar Tage aufpassen und wieder zurückgeben.« »Und das war ich?« Brúto nickte heftig und Jesús fiel absurderweise vor allem auf, wie dessen Schwänzchen mitnickte. »Ja, aber nichts Verbotenes! Ich jedenfalls nicht! Danach hab ich auch aufgehört. Gefiel mir alles nicht mehr, wollte da nix mit zu tun haben. … So was macht ein Brúto nicht, verstehst du?« »Meine Eltern haben mich bei dir abgeliefert?« Brúto nickte beflissen. »Auf der Plaza de Zocodover. Wir haben Kaffee getrunken … und du hast ein großes Eis gekriegt.« Er wagte es glatt zu lächeln. »Ich erinnere mich, du wolltest …« »Erdbeereis, schon klar.« Erdbeeren waren für ihn schon der Inbegriff der Sinnlichkeit gewesen, als er das Wort noch gar nicht kannte. »Und dann?« »Bin ich mit dir rausgefahren. Zu dem Haus, da, wo ich sonst … Jedenfalls ein bisschen außerhalb, in der Nähe vom Fluss. Du hast es gut gehabt!« Brúto schielte Beifall heischend zu Jesús, der es, ganz in Gedanken versunken, nicht registrierte. Er sah das kleine Haus vor sich, die Grundmauern aus sandfarbenem Felsgestein, der Rest aus Holz. Auch den jungen Diego sah er. Sah, wie sie zusammen Fußball spielten. Wieso hatte er sich an das Gesicht nicht mehr erinnern können? In seiner kindlichen Wahrnehmung hatte alles erst im Heidenheim begonnen. Er hatte gewähnt, sein Freund Diego sei für lange Zeit der letzte Mensch gewesen, der diese Bezeichnung verdiente. Deshalb hatte er ihn nicht auf der Rechnung gehabt. Und deshalb hatte es nicht Klick gemacht, als er den alten Brúto bei den Gegenüberstellungen gesehen hatte. Nur sein Unterbewusstsein hatte in dem alten Gesicht das junge wiedererkannt. »Was ist dann passiert?« »Am 9. Juli sollten dich deine Eltern abholen. Nachmittags. Gegen Mittag kam ’n Anruf aus ’er Zentrale, ich soll was aus Toledo besorgen, sofort. Dich sollte ich zur Sicherheit mitnehmen. Hab Gas gegeben, um rechtzeitig zurück zu sein. Denkste. Bei der Rückfahrt, kurz vorm Haus, hatte ich ’n Unfall. Bagatelle. War mir egal. Mir ging’s nur drum, dich wohlbehalten zurückzubringen. Dich deinen Eltern geben, verstehst du? Kein Verbrechen! Nix! Ich nicht!« »Und?« »Der Typ hatte ’nen Dachschaden. Fing an, ich bin schuld. Dabei ist er aufgefahren! Da hätte ich sonst kurzen Prozess gemacht, aber der Typ faselt ständig von Polizei, und das ging ja nicht, ich musste dich ja in Sicherheit bringen, Mensch überlegt mal, wenn die Guardia dich gekriegt hätte. Ich hab dich geschützt, verstehst du? Jedenfalls verging ’ne Ewigkeit, bis der Typ von einem Moment zum andern klein beigegeben hat. Wenn der nicht gewesen wäre, also dann wären wir rechtzeitig gekommen – bestimmt! Und ich hatte ja auch gar nix damit zu tun. Da hätte ich nicht mitgemacht, Ehrenwort!« »Was ist passiert?«, fragte Jesús mit heiserer Stimme. »Das Haus war bis auf die Grundmauern abgebrannt. Hat nur noch geraucht. Das war eigentlich bloß ’n aufgemöbelter Stall, die Decke so tief, da bin ich mit ausgestreckten Armen fast dran. Scheiße, hab ich zuerst gedacht, Scheiße, der Unterschlupf ist jetzt futsch. Dann guckt plötzlich ’n Kerl in Uniform von hinten über die Mauer, einer vom Militär, ich weiß nicht mehr genau, könnte ’n Major gewesen sein. Nach Gefreiter sah der jedenfalls nicht aus, da kannste einen drauf lassen. Ich denk, verdammt, jetzt bin ich geliefert. Doch der fragt mich überhaupt nix. Nur, dass wir zack, zack, verschwinden sollen. Erst mussten wir allerdings beide ins Haus, also, was davon übrig war. Zwei Tote, sagt er. Und dass wir sagen müssen, ob wir die kennen. Eigentlich hat er aber nur dich vor sich hergeschoben, ich bin bloß nachgedackelt. Mensch, da war nicht mehr viel zu erkennen. Nur das Gesicht von deiner Mutter, da hatte sich das Feuer nicht richtig ran getraut. Nur ’n bisschen. Konnte man noch erkennen. Jedenfalls hast du genickt, einfach so, stumm. Dann sollten wir abhauen, zack, zack, sagt er, war wohl sein Lieblingsausdruck, bei dem musste alles zack, zack gehen. Da hab ich natürlich sofort mit dir die Biege gemacht.« Jesús sank auf den Wannenrand. Er weinte, ohne es zu merken. Ein paar Minuten vergingen schweigend. Dann erhob er sich, drehte die Dusche auf und hielt den Kopf unter den Strahl. »Wie konnten sie in dem Haus verbrennen?«, brach es plötzlich aus ihm raus. »Da gab’s doch eine Tür!« Brúto zuckte mit den Achseln. Hilfe suchend sah Jesús zu Carlos. Der schüttelte den Kopf. »Er hat wirklich keine Ahnung.« »Und woher wusste dieser Soldat, dass ausgerechnet ich die Leichen identifizieren konnte?« »Genau! Das hab ich mich auch gefragt, also später. Als der sich vor mir aufgebaut hat, hab ich gar nix gedacht, da hatte ich die Hosen so was von gestrichen …« Er stockte und wurde rot. »Jedenfalls wollte ich da schnellstmöglich weg. Erst später hab ich kapiert, wie seltsam das alles war, von vorn bis hinten seltsam.« »Und warum habe ich mich bis heute nicht daran erinnert, dass meine Eltern in dem Haus verbrannt sind – hä?« Eine Geröllhalde aus Zorn, Wut und Groll riss Jesús mit sich. »Wie konnte ich das alles vergessen und mir einbilden, meine Eltern seien als Freiheitskämpfer in Francos Gefängnissen gestorben? Antworte!« »Ich, ich … Woher soll ich das denn wissen?« »Vorsicht, Brúto. Ich bin auch noch da, vergiss das nicht«, raunzte Carlos ihn an. »Du gehst gerade am Abgrund.« »Ja, gut. Ich habe ihn«, er zeigte auf Jesús, »damals …« »Sprich mit mir, Arschloch!« »Okay, okay. Das war so: Wir waren wieder bei mir und du kamst mir seltsam vor, wie weggetreten. Und hast ständig erbrochen. Herzrasen hattest du auch und Zittern. Dann kam endlich ’n Anruf von ’er Zentrale und ich hab die gefragt, was ich machen soll. Warten, hieß es, die würden jemand schicken. Ein oder zwei Tage später, weiß ich nicht mehr, spaziert so ’ne ganz schräge Type bei mir rein. Keiner von den üblichen Ganoven. Der sah eher wie ’n Professor aus, ’n Anzug mit Rollkragenpulli, weiße Haare, ihr wisst schon, und quatschte auf so ’ne hochgestochene Art, konnte man raushören, auch wenn ich nix kapiert hab, weil: der hat’s auf Englisch mit mir versucht, kann ich nicht. Ich musste mich dünnemachen, bis zum nächsten Morgen. Keine Ahnung, was der angestellt hat. Jedenfalls sagt der hinterher, du bist wieder in Ordnung, das hab ich grad noch kapiert. Und hat dabei mit so ’ner zufriedenen Fresse auf seinen Aktenkoffer geklopft. Aber es stimmte. Du hast dich überhaupt nicht mehr erinnert und warst ganz ruhig. Gehirnwäsche vielleicht, was weiß ich.« »Was ist danach mit mir passiert?« »Es kam wieder ’n Anruf aus ’er Zentrale. Musste dich auf der Stelle abliefern, am Übergabepunkt, wie immer.« »An wen?« »War ’n Mittelsmann, der die Jungs übernommen hat. Von dem hab ich das Honorar immer gekriegt.« Honorar! Jesús biss sich auf die Lippen. »Kam immer mit ’nem Transporter, mehr kann ich nicht sagen. Ich wusste genauso nicht, wer der war, wie der nicht wusste, wer ich war. Wir mussten immer Augenmasken tragen, Befehl aus ’er Zentrale.« »Und was hab ich dir eingebracht?« Das Dreifache des üblichen Satzes, was Brúto lieber für sich behielt. »Du siehst ja, ich war bloß ’n kleines Rädchen. Ich hatte da überhaupt nix zu melden. Wenn da ’n richtiges Verbrechen im Spiel war, also damit hab ich nix zu tun! So was mach ich nicht, verstehst du? Nachdem diese … Sache … passiert war, hab ich der Zentrale gesagt, ich mach das ganze Jungenszeug nicht mehr.« »Wie geht es dir?«, fragte Carlos, während Jesús ihn zu seinem Wagen begleitete. »Ich bin … traurig, verletzt, weiß nicht. Meine Eltern sind für mich Helden gewesen, die ihr Leben für ein besseres Spanien gegeben haben. Ich dachte, sie seien in einem von Francos Gefängnissen gestorben. Sie kommen mir jetzt wie geschändet vor. Von ein paar Kriminellen einfach aus dem Weg geräumt.« »Verstehe.« Seltsam, irgendwie mochte er den brummigen Alten. Seltsam? Nein, nicht seltsam, sondern pervers, wenn er mit seiner Vermutung richtig lag, Carlos sei einer von Francos Leuten gewesen, einer von denen, die seine Eltern verfolgt hatten. Einer, der sie nach ihrer Ergreifung vielleicht »befragt« hätte. Wie gut sich Carlos darauf verstand, wusste er ja nun. Trotzdem: Es war, wie es war. »Fragen stellen sich dir keine?« Jesús verstand nicht. »Wieso bringen sie deine Eltern um, sie hatten dich ja schon? Der Brand war natürlich kein Unfall, das wurde von langer Hand vorbereitet. Ein Doppelmord, nur um dich zu zermürben? Du warst doch bloß eines unter vielen Opfern in ihrem Lager. Und dann schicken sie auch noch extra für dich einen Experten, nachdem sie die Schocktherapie übertrieben haben. Wieso betreiben die einen solchen Aufwand mit dir?« »Das ist mir vollkommen entgangen. Warum hast du nicht gefragt?« »Brúto weiß nichts darüber.« »Und gerade habe ich gedacht, ich könnte jetzt endlich mit dem Kapitel abschließen.« Er schüttelte resigniert den Kopf. »Für heute reicht’s mir jedenfalls.« An Carlos’ Mercedes angekommen, suchte Jesús vergebens nach den richtigen Worten für seinen Lebensretter; vollmundige Bekundungen ließ seine innere Leere nicht zu. Carlos winkte ab und grunzte etwas vor sich hin. Jesús deutete es als die Kurzfassung von: Schon gut, ist nicht der Rede wert, dafür bezahlst du mich schließlich, außerdem sind Dankesbezeugungen nicht so meine Sache. Für einen Moment standen sie sich schweigend gegenüber. »Was wirst du unternehmen, Jesús?« »Weiß nicht.« »Gib mir dein Handy.« Carlos tippte etwas ein. »Meine Nummer findest du unter »Aufgaben«, für alle Fälle. Nicht ins Telefonnummernverzeichnis übertragen. Nicht vom Handy aus anrufen. Muss nicht jeder von mir wissen. Klar?« »Ja.« »Ruf an, wenn du Hilfe brauchst. Vielleicht spült dein Gedächtnis ja noch mehr Erinnerungen hoch.« Carlos reichte ihm die Hand. »Machs gut.« Für die Rückfahrt nach Granada fühlte sich Jesús zu müde, auch wenn Inga ihn vermissen würde. Nach einem Sprung unter die Dusche machte er sich, vorgeblich ein Tourist, der nun sogar einen Reiseführer besaß, auf einen Streifzug durch die Stadt. In den Altstadtgassen funkelte es silbrig und golden aus den Schaufenstern der Souvenirläden. Hier Schwerter und Ritterrüstungen, da Goldschmiedearbeiten, hier wieder Schwerter und da wieder Gold und dazwischen Postkarten und Bilder mit Kacheln und Kacheln mit Sinnsprüchen und Don Quijote, immer wieder Don Quijote: gegossen, geschnitzt, gebrannt und gehäkelt. Es müssten noch viele, sehr viele Touristen kommen, um den Besitzern der Läden ein halbwegs erträgliches Einkommen zu bescheren. Toledo überforderte ihn. Wahrscheinlich, weil er mit den Gedanken ganz woanders war. Warum sonst hatte er die vielen Galerien mit Bildern von El Greco, der hier gegen Ende des 16. Jahrhunderts gelebt und gemalt hatte, ebenso links liegen gelassen wie die beeindruckende Kathedrale? Lustlos betrat er die Sinagoga de Santa María la Blanca, irgendwas musste man sich doch anschauen. Nach einem kurzen Rundblick verschwand er wieder. Er ging durch den gegenüberliegenden Park, um durchzuatmen. Er musste aus den Mauern raus, es wurde ihm zu eng hier. Am Rande des Parks konnte er in die Landschaft jenseits des Hügels blicken. Unter ihm floss der Rio Tajo. Ob man da runterkam? Er fragte zwei Jungen, die mit einem Ball kickten. Bald darauf befand er sich außerhalb der Stadtmauern im Grünen, vor ihm der Fluss, in dem sich ein paar langbeinige Vögel die Füße in kleinen Stromschnellen massieren ließen. Jesús legte sich ins Gras, fühlte die Sonne auf dem Gesicht und entschwand aus Raum und Zeit in traumlosen Schlaf. DOKTORSPIELE | D-FRANKFURT/MAIN Dr. Guhls Sprechstundenhilfe bat sie, im Warteeck Platz zu nehmen, wo nur noch eine Patientin vor sich hin wartete. Eine Frau mittleren Alters, wenn Engel das trotz des in die Stirn gezogenen Kopftuchs richtig sah. Die Inflation der Kopftücher. Ihm blieben diese plötzlich aus einer anderen Zeit und Welt herübergewehten Tücher fremd, wie demütig er auch seine Weltoffenheit bemühte. Nicht, dass er sich einbildete, wirklich zu verstehen, weshalb die Kopfbedeckung sein sollte oder musste. Es ging ihn auch nichts an, einerseits; jede einzelne dieser Verhüllungen war Privatsache. Andererseits empfand er sie in ihrer Summe als öffentliche Demonstration, und innerhalb eines Demonstrationsmarsches, wie er ihn kürzlich in der Kaiserstraße gesehen hatte, als ein Fahnenmeer. Ihn hatte Beklemmung beschlichen. Er gehörte bestimmt nicht zu den Befürwortern der »Deutschen Leitkultur« – ein Volk, das Seife und Zahnbürste in einen Kultur-Beutel packte, sollte erst einmal seinen Kulturbegriff klären. Dennoch musste er zugeben, dass Multikulti ihn in diesem Fall überforderte. Vielleicht waren da seine Assoziationen zu sehr vom »Kampf der Kulturen« aufgeladen, der von Buchseiten auf die Mattscheibe und von da in die Wirklichkeit gesprungen war. Als die Ärztin erschien, fragte er sich, wie man gleichzeitig so dünn und dick sein konnte; die Beine hätten zu einem Strichmännchen gepasst, der Kugelbauch zu einer Schwangeren. Das schlohweiße dünne Haar, es fiel in lockeren Fransen auf den Kittel, wies auf eine Gartenschere hin, die mal geschliffen werden musste. »Dr. Guhl, mit wem habe ich die Ehre?« Eine ungewöhnliche Stimme, nasal, hell, ohne feminin zu klingen. Sie hatte, im Gegensatz zu den schnellen, hüpfenden Bewegungen der Frau Doktor, etwas träge Fließendes, das ihn an Schmelzkäse erinnerte. Engel erklärte, sie müssten sie im Rahmen einer polizeilichen Ermittlung befragen. »Aber sicher doch, immer. Wenn meine Patientin bereit ist, der Polizei den Vortritt zu lassen?« »Ausnahmsweise«, sagte die Frau lächelnd. Ihr stand das Kopftuch gar nicht mal schlecht, privat betrachtet, überlegte Engel, während er sich bei der Frau bedankte. »Dann folgen Sie mir bitte in den Behandlungsraum, immer mir nach.« Papandreou eröffnete die Befragung: »Eine Ihrer Patientinnen, Frau Anna Heydt, wird vermisst, sie ist spurlos verschwunden.« »Ach ja? Von wem wird sie denn vermisst?« Gute Frage. Genau genommen vermisste niemand Frau Heydt, nicht einmal Dr. Lexied, mit dem Engel gerade telefoniert hatte. Der Anwalt hatte abgewiegelt, noch könne seine Mandantin tun, was sie wolle. Typisches Anwaltsgeschwätz. »Wissen Sie etwas über den Verbleib von Frau Heydt?«, überging Papandreou die Frage der Ärztin. »Jetzt sagen Sie selbst, Frau Kommissarin: Unterliegt diese Auskunft nicht vielleicht der ärztlichen Schweigepflicht?« Sie schien Spaß an Gegenfragen zu haben. »Sie sind ja früh mit der Schweigepflicht zur Stelle. Was halten Sie denn davon …« Engel unterbrach sie mit einem Räuspern. Anastasia schlug den falschen Weg ein. Die Frau wollte Katz-und-Maus spielen und man ließ sich besser darauf ein, statt ihr mit Regelkunde zu kommen. »Sie sind also noch ihre Ärztin«, übernahm er die Initiative. »Bin ich das?« »Wenn Frau Heydt nicht mehr Ihre Patientin wäre, unterlägen aktuelle Vorkommnisse nicht mehr der Schweigepflicht.« Eine juristisch haltlose Interpretation, aber vielleicht biss sie an. »So sehen Sie das? Unlogisch klingt es jedenfalls nicht.« Sie grinste vielsagend. »Ich mag es logisch, wissen Sie.« »Logischerweise dürfen Sie uns nicht sagen, wann Frau Heydt Sie zuletzt aufgesucht hat. Möglicherweise könnten Sie es auch gar nicht – weil Sie sich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Sie verstehen?« Ja, sie verstand. »Doch, doch, ich erinnere mich.« »Was nicht an einem außergewöhnlich guten Gedächtnis liegt.« »Nein, daran liegt es wohl nicht.« Sie lächelte amüsiert, diese Partie war offenbar nach ihrem Geschmack. »Wir machen uns große Sorgen um Frau Heydt. Angenommen, wir würden Ihnen sagen, dass wir einen Suizidversuch befürchten – was würden Sie antworten?« »Nichts – sicher ist sicher.« Sie grinste. »Aber ich würde Sie in Ihrer Sorge bestimmt nicht bestärken. Botschaft angekommen?« »Wir verstehen uns. Trunksucht ist ein schwerwiegendes Problem, richtig?« »Wenn sie ausartet.« »Würden Sie bei Frau Heydt …« »Foul.« »Wenn jemand wegen seines Alkoholkonsums seine eigentliche Arbeit nicht mehr bewältigt und angetrunken am Arbeitsplatz erscheint, könnte man dann von einem Ausarten sprechen?« »Tendenziell.« »Unterstellt, derjenige käme zu Ihnen: Was würden Sie ihm raten?« »Raten?« Sie rümpfte die Nase. »Ich würde ihm etwas verschreiben. Ich bin Medizinerin, kein Guru.« »Und wenn Sie hinter dem somatischen ein psychisches Problem vermuten?« »Auch dafür gibt es Medikamente.« »Sagen Sie, hat Frau Heydt vielleicht ein Feuermal auf dem Oberschenkel?« »Schweres Foul.« »Wüssten Sie es, wenn Frau Heydt eins hätte?« »Ich bin ja keine Frauenärztin.« »Klar, von einem kleinen Feuermal bekommt ein Hausarzt nicht ohne Weiteres etwas mit.« »Richtig.« »Vor allem, wenn es sich in der Intimzone der Patientin befindet.« »Genau.« Guhl bemerkte den Lapsus sofort. »Alles theoretisch gesprochen«, schob sie schnell hinterher, »das zählt gar nicht.« »Natürlich nicht. Machen wir einfach woanders weiter.« »Ein andermal, meine Patientin hat nicht ewig Zeit«, entgegnete sie ärgerlich und sprang auf. »Nicht so schnell.« Anastasias Tonfall nach wollte sie sich nicht als Spielkameradin anbieten. »Wir brauchen einen klaren Hinweis zur psychischen Verfassung der Vermissten. Vielleicht ist sie in psychologischer Behandlung.« »Psychologie, ach Gottchen«, spottete Guhl. »Heute regiert die Neurobiologie. Wir sind das Ergebnis unserer chemischen Gleichungen.« »Und in meiner Gleichung fehlt noch Ihre Antwort.« »Ihr Spott ist fehl am Platze. Wegen unserer großartigen Psyche fühlen wir uns wie die Herren der Welt. Dabei sind nicht mal Herr über uns selbst. Kennen Sie den Toxoplasma gondii? Das ist ein Parasit.« Sie schob eine aufgeschlagene Zeitschrift zu Papandreou hinüber. »Was er mit uns anstellt, wissen wir noch nicht genau, wohl aber, was er in Mäusen anstellt.« Man spürte regelrecht, wie sie Fahrt aufnahm. »Die Maus ist allerdings nur sein Zwischenwirt, denn vermehren kann er sich ausschließlich im Katzendarm. Da muss er hin! – Im Gegensatz zur Maus natürlich.« Sie grinste süffisant. »Und siehe da, Mäuse, die den Schmarotzer in sich tragen, wandeln sich zu wahren Katzenfreunden. Statt Reißaus zu nehmen, laufen sie ihnen in die Arme. Selbstmord! Und wieder hat es ein simpler Einzeller geschafft, seinen komplexen Wirt zu manipulieren.« »Klingt ziemlich strategisch für einen Einzeller«, wandte Engel mit kriminalistischer Skepsis ein. »Der Einzeller verfolgt natürlich keine Strategie. Das besorgt die Evolution. Irgendwann hat solch ein Einzeller durch eine zufällige genetische Veränderung Einfluss auf Stoffwechselprozesse im Gehirn der Maus gewonnen, hat gewissermaßen den Katzenalarm abgeschaltet und ist im Katzendarm gelandet.« Engel war zu sehr Ermittler, um nicht nachzuhaken. »Dem Parasiten …,« beinahe hätte er Täter gesagt, »gelingt es rein zufällig, die Maus zum willenlosen Werkzeug zu machen?« »Scheint Ihnen unglaublich? Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Affe …«, sie schenkte ihm ein goldiges Lächeln, »und hätten eine Schreibmaschine vor sich, in die sie wild hineintippen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Affe zufällig etwas Sinnvolles tippen, sagen wir ein Gedicht, erscheint nicht gerade groß, richtig? Doch nun stellen Sie sich vor, dass Sie den ganzen Tag nichts anderes tun, über 86.000 Sekunden mal 365 Tage mal Milliarden Jahre lang. Und nicht nur Sie. Abermilliarden anderer Affen tippen all die Milliarden Jahre ebenso drauflos! Das ergibt eine astronomische Zahl von Variationen. Eine Zahl, die genauso unwahrscheinlich groß ist, wie Ihnen unwahrscheinlich vorkommt, dass Sie Affe oder einer Ihrer Artgenossen dem Zufall ein Gedicht entlocken. Oder dass ein Parasit zufällig den richtigen Schalter bei seinem Wirt umlegt. Dabei sind solche Treffer unter diesen Voraussetzungen beinahe zwangsläufig! Das Wunder wird zu einer Frage der Statistik.« »Können wir jetzt weitermachen?« Papandreou hatte endgültig genug von dem Gequatsche. »Einen kleinen Moment. Rund sechzig Prozent der Menschheit ist vom Toxoplasma gondii infiziert. Was die Frage aufwirft, wie er wohl unser Verhalten manipuliert, dieser dumme, dumme Einzeller.« »Dann hat er Frau Heydt vielleicht dazu gebracht, sich einer Katze in den Rachen zu schmeissen?« »Erstens ist es nach den Maßstäben der Evolution keinen Wimpernschlag her, dass der Mensch im Darm einer Katze, einer Raubkatze nämlich, landen konnte.« Guhl hatte den unleidlichen Ton der Kommissarin aufgenommen und belehrte sie wie eine ungelehrige Schülerin. »Zweitens verfolgt der Parasit keinen Plan, sondern tut einfach, was die Gene ihm vorschreiben. Er könnte uns also durchaus manipulieren, ohne …« »Apropos manipulieren, Sie …« »Ohne einen Nutzen davon zu haben. Wofür es übrigens Indizien gibt. Epileptiker sind beispielsweise ungewöhnlich oft infiziert. Unfallverursacher auch.« »Jetzt reicht es! Beantworten Sie endlich unsere Frage. Ist Frau Heydt in psychologischer Behandlung, zum Beispiel wegen eines Alkoholproblems?« Guhl winkte ab und machte Anstalten zu gehen. »Schweigepflicht!« »Ach, kommen Sie schon. Mal ein Gläschen zu viel, das müssen wir doch nicht gleich als medizinische Frage betrachten.« Die Ärztin wandte sich um und schaute perplex. Man hätte Papandreous Tonfall jovial nennen können, aber schmierig traf es besser. Gefährlich traf es noch besser. »Sie sind bestimmt auch mal zwischendurch ein bisschen durstig, Frau Doktor, ohne gleich an medizinische Fragen zu denken«, hier endete die Jovialität, »zum Beispiel die, wie weit sich das mit Ihrer Approbation verträgt.« Obwohl die Frau keine Fahne hatte, konnte Anastasia den Alkohol beinahe riechen. Da war etwas Unordentliches an Guhl, das sie mit Trinkern verband. »Jetzt hören Sie mal …« »Nein, Sie hören jetzt zu. Noch habe ich nicht vor herauszufinden, ob Sie Alkoholikerin sind. Ich will keinen Krieg, ich will lediglich eine Information.« Dr. Guhl blickte sie verstört an. »Denken Sie an den Hippokratischen Eid«, goss Engel Weichspüler nach. »Es geht darum, ein Leben zu retten. Niemand unterstellt Ihnen ein Alkoholproblem. Aber Frau Heydt leidet unter einem, da …« »Ich behandle niemanden wegen Trunksucht.« »Möglicherweise ist Frau Heydt woanders in Behandlung.« Treffer – er sah es Guhl an. »Also, an wen würden sich Patienten wie Frau Heydt gewöhnlich wenden, Sie verstehen schon.« Guhl war des Spielens offenbar müde. »Jemand wie Frau Heydt könnte vielleicht an einem Programm interessiert sein, das sich ›Kontrolliertes Trinken‹ schimpft. Mehr fällt mir dazu nicht ein, basta!« Sie wandte sich Papandreou zu. »Und, sind Sie nun zufrieden? Schauen Sie nicht so triumphierend, Sie Krone der Schöpfung. Wussten Sie, dass allein auf Ihrem Unterarm rund vierundvierzig Arten von Bakterien nisten? Auf Ihnen und in Ihnen krabbeln etwa zehn Billionen Lebewesen rum, das sind mehr, als sie Zellen besitzen! Die sich an Ihnen zu schaffen machen. Die mit Ihnen anstellen, was sie wollen, und nicht umgekehrt. Wenn unsere Augen besser wären, könnten wir es sehen!« FERNMELDER | E-TOLEDO & MADRID Während Jesús am Ufer des Rio Tajo lag, rief Brúto eine Nummer in Madrid an. In einem Punkt hatte er gelogen: Es hatte sehr wohl eine Möglichkeit gegeben, den Auftraggeber zu kontaktieren, wenn es brenzlig wurde – und es gab sie nach wie vor. Jedes Jahr erhielt er per Post einen Brief ohne Absender, in dem ein Blatt Papier mit einem neuen Codewort steckte. Der Ring gab immer noch Lebenszeichen. Wenn Brúto überleben wollte, durfte er jetzt nichts falsch machen. Er ging zur Plaza de la Magdalena, wo sich ein Internetcafé mit Telefonkabinen befand. Er musste nämlich beweisen können, dass er nicht von seinem Festnetzanschluss oder Handy aus angerufen hatte. Die Quittung über das Telefonat solle er gut aufbewahren, hatte man ihm eingeschärft, sie sei seine Lebensversicherung. Er betrat eine Kabine und wählte die Nummer, die sich in all den Jahren nur ein Mal geändert und die er so lange auswendig gelernt hatte, bis er sie im Koma hätte aufsagen können. Sollte er sie notieren, könne er gleich sein Testament daruntersetzen, hatte es geheißen. Am anderen Ende sprang ein Anrufbeantworter an, der sich mit der Ansage »Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht« meldete. So sehr es ihn drängte, beschwichtigende Erklärungen abzugeben, beschränkte er sich darauf, das Codewort zu sagen. Es lautete »Tempestad«: Sturm. Der Anrufbeantworter befand sich in einer kleinen, diskreten Kanzlei in Madrid. Martina Lumbreras, die Sicherheitsbeauftragte, begab sich sofort ins Büro von Dr. Alonso und meldete den Anruf. Alonso zog die Augenbrauen hoch. Es gab dieses Telefon seit fast zwanzig Jahren und nie hatte es geläutet. Seit der Anschluss im Auftrag eines anonymen Klienten eingerichtet worden war, hatte die Kanzlei jedes Jahr einen versiegelten Briefumschlag erhalten, der zwei weitere, ebenfalls versiegelte Umschläge und einen ordentlichen Geldbetrag enthielt. Einen sehr ordentlichen, wenn man bedachte, dass nie mehr zu tun gewesen war, als den alten Brief zu vernichten, wenn ein neuer eintraf. Davon abgesehen hatte die Kanzlei lediglich Verschwiegenheit und Verlässlichkeit zu gewährleisten, eine Selbstverständlichkeit. Nicht einmal mit unliebsamen Informationen, die Alonso regelmäßig vor die Frage stellten, wo das Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant endete und die Mittäterschaft begann, war der Kunde zur Last gefallen. Alonso zog aus dem großen Kuvert, das Martina bereits dem Safe entnommen und mitgebracht hatte, ein kleineres mit der Aufschrift 1 und erbrach das Siegel. Eine Liste mit vier Codewörtern, darunter auch das gerade gemeldete. Vier Codewörter – für vier verschiedene Nachrichten? Oder für vier verschiedene Anrufer? Alonso wischte die Überlegung beiseite und bat Martina, die unter das Codewort gesetzte Anweisung auszuführen. Die Neugierde im Zaum zu halten war essenzieller Bestandteil ihres Geschäftsmodells. GESUCHT UND GEFUNDEN | D-FRANKFURT/MAIN »Was meinen Sie?«, fragte Engel, nachdem sie die Guhl’sche Praxis verlassen hatten. »Dass die Frau ’ne Meise unterm Pony hat. Und dass ich mir dringend die Arme waschen muss. Gehen wir einen Kaffee trinken?« »Gerne. Der Lokalbahnhof ist gleich ums Eck.« »Bahnhofsgaststätte?« »Nein, nein. Heißt bloß so.« Vor dem Lokalbahnhof angekommen, entschuldigte Markus sich, er müsse noch schnell Geld abheben. »Oder ist das unhöflich?« »Brutal! Das schreit nach Schmerzensgeld, heben Sie sicherheitshalber ein Milliönchen mehr ab.« Anastasia hatte offenbar gute Laune. Es dauerte ziemlich lang, bis der Automat Geld herausrückte. Nachdem die Banken jahrelang die Kohle ihrer Kunden säckeweise verheizt hatten, hockten sie jetzt offenbar auf jedem Krümel. Als Engel den Lokalbahnhof betrat, war Anastasia in eine Zeitschrift versunken. »Störe ich?«, fragte er, denn sie registrierte ihn nicht. »Was?« »Muss eine fesselnde Lektüre sein.« »Allerdings!« »Nämlich?« Sie präsentierte das Objekt des Interesses wie eine antiquarische Kostbarkeit. Dabei handelte es sich nur um ein vergilbtes Supermanheft. Markus wusste nicht, was er sagen sollte. Er empfand für keinen der amerikanischen XXL-Helden besondere Sympathie, aber Superman schien ihm richtiggehend lächerlich. Allein der rote Schlüpfer, den der Kerl über der Hose trug, spottete doch jeder Beschreibung. »Ich wusste gar nicht, dass die hier so Heftchen haben.« »Keine Sorge, so Heftchen haben die hier nicht. Ist mein eigenes. Habe immer eins dabei. Ohne Superman gehe ich nicht aus dem Haus!« »Dafür die große Handtasche, habe mich schon gewundert. Da führen Sie Superman drin spazieren.« »Einer muss schließlich auf mich aufpassen«, entgegnete sie verschmitzt. »Außerdem vertreibt er mir die Langweile, wenn ich warten muss.« »Und mit weniger als Superman geben Sie sich nicht zufrieden?« »Supergirl soll sich mit weniger zufriedengeben?« Sie lachte. »Seit ich Polizistin bin, gefallen mir einfach die klaren Verhältnisse in Supermans Welt: Hier die Guten, da die Bösen, und den Bösen geht’s mit Sicherheit an den Kragen! Finden Sie nicht gut?« »Ein Überamerikaner, der ständig die Welt retten will? Ist, ehrlich gesagt, nicht mein Fall.« »Quatsch, Superman ist Außerirdischer. Für die Vereinnahmung kann er nichts. Goebbels wusste es übrigens noch besser: Superman ist Jude! Stammt aus einer Reichstagsrede von 42, kein Scherz. Man sollte glauben, die Nazis hätten damals andere Probleme gehabt. – Wollen wir was bestellen?« Nachdem die Bedienung zwei Tassen Cappuccino gebracht hatte, kam Engel auf die Frage zurück, was Anastasia nach dem Gespräch mit Guhl denke. »Dass wir ein gutes Team sind!« »So?«, sagte Markus schnell, um den spürbaren Aufstieg seiner Mundwinkel im Zaum zu halten. »Ja, das finde ich. Mir hat schon lange kein Arbeitstag so viel Spaß gemacht. – Und was finden Sie?« »Ich finde, wir sind gut vorangekommen … also als Team.« Klang das reserviert? Zu spät. »Und welche Schlussfolgerungen ziehen Sie im Hinblick auf unseren Fall?« »Dass es noch einiges gibt, was ich nicht weiß. Die Sache mit dem Feuermal zum Beispiel.« Markus erklärte es ihr und wiederholte seine Frage, die sie jedoch zurückspielte: »Das können Sie besser beurteilen.« »Ich bin nach wie vor unschlüssig.« »Offenbar hat sie tatsächlich ein Feuermal. Das spricht gegen sie.« »Ja. Ich traue ihr auch zu, sich aus dem Staub zu machen. Nur passt die Art, wie sie sich von Triebel verabschiedet hat, dieses Dankeschön und Lebewohl, nicht ins Bild. Was, wenn sie doch unschuldig ist? Dann würde sie aus dem Hintergrund attackiert, ohne sich zur Wehr setzen zu können. Und wenn die Polizei sich vom Täter an der Nase herumführen lässt – und sie steht allein da …« »Haben Sie etwas falsch gemacht, Markus?« Anastasia beugte sich vor und sah ihm in die Augen. »Wenn ja, dann sagen Sie mir, was.« Nein, er konnte keinen Fehler nennen. »Dann streifen Sie dieses nebulöse Verantwortungsgefühl ab. Wir sind weder für die Täter noch ihre Taten verantwortlich. Und wir brauchen jetzt einen klaren Kopf. Wie machen wir also weiter?« Ungewollt musste Markus grinsen. »Danke für die Lektion, Frau Kollegin.« Sie solle in die Heydt’sche Wohnung fahren, um sich selbst einen Eindruck zu verschaffen, schlug er vor. Er selbst wollte in die Metzlerstraße, wo sich mehrere Suchtberatungsstellen befanden, um etwas über das Programm »Kontrolliertes Trinken« herauszufinden. »Und wie kommen Sie da hin?« »Wissen Sie, eine Bewegungstherapie kann nie schaden, habe ich kürzlich gelernt. Wir sehen uns morgen im Büro.« Papandreou fand eine Wohnung vor, die sie nach den Einmalhandschuhen greifen ließ, denn sie war etwas heikel in Sachen Hygiene. Ein ungeübter Beobachter hätte vielleicht erst angesichts des Bierdosenparcours auf dem schmalen Pfad vor Heydts Bett Verdacht geschöpft, ihr reichte ein Blick ins Bad. Nachdem sie eine Runde gemacht hatte, setzte sie sich an den Küchentisch und betrachtete die Rechnung des Kammerjägers. Ungeziefer in der Wohnung? Markus würde einsehen müssen, dass sie es mit einer verwahrlosten Alkoholikerin zu tun hatten. Sie steckte die Rechnung ein. Wenn Heydt wirklich eine Kämpferin war, dann eine, die auf dem Zahnfleisch ging. Sich dauernd mit Alkohol zu betäuben, deutete in Richtung Selbstaufgabe. Sie stand auf und begab sich auf die Suche nach weiteren Indizien. Im Flur wurde sie fündig. Vorsichtig zog sie das Handy aus der Staubwolke unter dem Schuhregal; es war sogar noch eingeschaltet und zeigte den Eingang einer SMS an. Sie las die Nachricht. Genau so etwas hatte sie gesucht. TREUE UND TOD | RO-OSTKARPATEN Auf dem Tal liegt Nebel. Nur einige Wipfel des Nadelwaldes ragen heraus wie die Turmspitzen einer Kathedrale. Flutlicht streicht über die Ebene und erfasst einen Kiesweg und ein Bahngleis, karge Lebensadern, die aus dem Wald hinaus zum Lager führen. Die hohe Palisadenwand beschreibt ein strenges, dem Dickicht mit Zirkeln und Äxten entrungenes Rechteck. Das Scheinwerferlicht wandert weiter, streift die schattenhaften Umrisse eines Wachturms und taucht ein in endlose Spiralen ausgerollten Stacheldrahts. Seit über fünfzig Jahren schützt er das ehemalige Internierungslager des rumänischen Geheimdienstes Securitate. Im Inneren des Lagers heult eine Sirene auf. Unverzüglich schwenken die Flutlichter auf das gerodete Areal vor dem schweren Eingangstor. Ein Mann in Olivgrün tritt mit geschultertem Gewehr aus einem Unterstand und bezieht Stellung, während sich aus der Nebelwand ein schwarzer Geländewagen schält. Der Salvator trifft ein. Zwei Uniformierte schieben das Tor des Ausbildungslagers II-alpha auf. Im Hof springt der Fahrer aus dem Fahrzeug und reißt den hinteren Wagenschlag auf. Gleichzeitig treten zwei Dutzend Männer in grauer Kampfmontur hervor und verschränken zur Ehrenbezeigung die Hände vor der Brust. Der Salvator entsteigt dem Fonds. Er trägt ein Barett und eine schlichte schwarze Uniform, die Filzjacke bis zum Stehkragen geschlossen. Der Lagerkommandant geht strammen Schrittes auf ihn zu und salutiert. Eine Trompete ertönt. Sie blicken zum anderen Ende des Hofs, von wo, aus der Tiefe einer lang gestreckten Baracke, ein monotoner Rhythmus zu ihnen dringt: Schritte, die auf Holz schlagen. Ein Zug kindlicher Gestalten hat sich in Marsch gesetzt. Weiße Drillichhose, weiße Jacke, weiße Stiefel. Zwanzig Zweierreihen, Jungen mit festlich ernster Miene. Während der Zug im Gleichschritt in den Lagerhof einzieht, setzt glockenklarer Gesang ein. Das Moorsoldatenlied. Gefangene des KZ Börgermoor im Emsland haben es sich in den frühen Tagen des Nationalsozialismus von der gequälten Seele geschrieben. Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum, Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Der Refrain setzt ein. Doch es erklingt nicht der alte Text. Der Aufschrei der Ohnmacht hat sich in ein Fanal der Kampfbereitschaft verwandelt. Wir sind die Heilssoldaten, und schützen vorm Entarten die Welt. Die Jungen marschieren weiter. Den Himmel, der mit einem Donner aufreißt, würdigen sie keines Blickes. Binnen Sekunden kleben ihnen Haare und Uniformen an ihren kleinen muskulösen Körpern. Sie beachten es nicht. Hier in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir fern von jeder Freude hinter Stacheldraht verstaut. Die Jungen schreiten langsam im Takt der schwermütigen Melodie voran. We’re soldiers of salvation, fighting for creation till death. Zehn Meter vor dem Salvator bleiben die Kinder stehen und stimmen, jetzt summend, ein letztes Mal die Melodie an. Ein Befehl ertönt. Die Heilssoldaten formieren sich zu vier Reihen und legen die rechte Hand auf die Brust. Der Lagerkommandant tritt vor und spricht mit feierlicher Stimme. »Kameraden, ihr habt mit großem Ernst und tapferer Entschlossenheit das erste Rüstzeug für unseren schweren Kampf erworben. Ihr seid nun berufen, als Heilssoldaten in die Unsichtbare Armee einzutreten und mitzumarschieren, ein jeder an seinem Platz. Wir kämpfen nicht für Lorbeer, wir kämpfen für das Heil der Welt. Wir stemmen uns dem Untergang entgegen, ein jeder schweigend und unbemerkt. Wir kennen weder Mitleid noch Selbstmitleid, wir kennen allein das Ziel. Unsere Treue gilt einzig dem Salvator, der das Ende kommen sah, als alle Welt noch blind dafür war. Der allein die Welt zu retten weiß. Nur ihm gilt unsere Treue!« »IN EHRE UND EWIGKEIT!«, schallt es aus vierzig Kinderkehlen zurück. Der Salvator wartet, bis der Lagerkommandant beiseitegetreten ist, dann kreuzt er die Hände vor der Brust. Die Jungen tun es ihm nach. »Ich bin der Moment und ich bin die Hoffnung.« »WIR SIND DIE MITTEL ZUM ZWECK.« »Ich bin das Haupt und ich bin das Auge.« »WIR DEINE ARME IN SCHLAMM UND IN DRECK.« »Ich bin das Schicksal und ich bin das Leben.« »WIR WERDEN STERBEN, KAUM DA, SIND WIR WEG. WIR SIND DIE KÄMPFER UND DU BIST DER SEGEN, WERDEN DICH SCHÜTZEN AUF ALL DEINEN WEGEN, WERDEN GEHORCHEN AUF ALLE BEFEHLE, WIR SIND DIE MITTEL UND DU BIST DIE SEELE.« In den Kinderaugen spiegeln sich Entschlossen- und Ergriffenheit. Wie auf ein geheimes Kommando knien die Jungen nieder und senken den Kopf. Der Salvator geht durch die Reihen und streicht jedem mit väterlicher Geste über das Haar. Tausend Tage haben die Jungen diesem Moment entgegengeharrt, dieser Berührung, mit der sie in die Unsichtbare Armee aufgenommen werden, haben sich an ihr hochgezogen, wenn sie müde daniederlagen, sich an ihr gewärmt, wenn im Winter der Karpatenwind durch die Ritzen in den Baracken pfiff. Nun ist der Moment gekommen und die Jungen erfüllt seliges Glück. Nach der Zeremonie ergreift der Lagerkommandant wieder das Wort. »Morgen werdet ihr abgeholt und zu euren neuen Einheiten gebracht, um eure Ausbildung fortzusetzen, ein jeder nach seinen Talenten. Fast drei Jahre waren wir eine verschworene Gemeinschaft, und wenn sich unsere Wege nun auch trennen, so bleiben wir in dem großen Ziel vereint. – Abtreten!« Die Kinder entfernen sich, bis auf einen zierlichen Jungen mit asiatischem Gesicht. »Asang, du wartest vor der Kommandantur, bis du gerufen wirst«, befiehlt ihm der Lagerkommandant. Nachdem sich der Salvator ausgiebig die Hände gewaschen hat, betritt er das einfache Büro des Kommandanten, nimmt hinter dessen Schreibtisch Platz und studiert die ausgelegten Unterlagen. »Wo steht der IQ?« Der Kommandant wagt sich einen Schritt vor und deutet auf eine Zeile am Ende des Blattes. »149, Salvator«. »Ausgangswert?« »111.« »Bemerkenswert.« »Das neue Trainingsprogramm hat sich bewährt, Salvator. Er war ziemlich verwahrlost, als wir ihn bekommen haben, vor allem in den Disziplinen Konzentration und Arbeitsgedächtnis blieb er zunächst weit hinter seinen Möglichkeiten. Da haben wir enorme Verbesserungen erzielt.« »Sein Chinesisch?« »Ausgezeichnet, sagt sein Sprachinstruktor.« »Leistung in den militärischen Disziplinen?« »Guter Schütze, 92 Punkte. Ansonsten unterdurchschnittlich, aber noch im Soll. Sein Ausbildungsschwerpunkt lag auf den kognitiven Fähigkeiten.« »Das Psychogramm.« Der Kommandant reicht es ihm. »Höchstwerte bei der intrinsischen Motivation.« »Ja, die Klugen sind neugierig«, murmelt der Salvator. »Konditionierungsprofil?« »Das Kontingenzschema steht auf Seite zwei, Salvator. Erwünschtes Verhalten lässt sich bei ihm am besten durch positive Verstärkung konditionieren, 92 Punkte. Vor allem für Lob ist er sehr empfänglich. Bei der negativen Verstärkung ist das Bild differenziert. Die Konditionierung funktioniert sehr gut, wenn man ihm erklärt, auf welche Weise erwünschtes Verhalten zur Vermeidung von Übeln führt. Andernfalls zeigt er Anflüge resistenten Verhaltens. Insgesamt aber passable 78 Punkte. Weniger gut sieht es bei der Unterbindung unerwünschten Verhaltens durch Bestrafung aus, da sind es nur 65 Punkte.« »Er lässt sich durch Schläge nicht einschüchtern.« »Genauso ist es, Salvator.« »Trotzdem empfiehlt S, ihn zum Ausgänger zu machen? Na schön, ich will ihn mir ansehen. Schicke ihn rein und hole inzwischen den anderen Jungen.« »Jawohl, Salvator.« Der Kommandant springt auf und eilt aus dem Raum. Ein schüchternes Klopfen an der halb offen stehenden Tür. »Tritt näher, mein Sohn.« Mit stolzgeschwellter Brust und zitternden Knien macht Asang einen Schritt nach vorn. Diese Ehre wird nur ganz wenigen zuteil! »Ich habe gehört, du bist mutig.« Asang errötet. »Ich bemühe mich«, flüstert er mit gesenktem Kopf. »Schau mich an, Junge. Und jetzt sage mir, ob du an unsere Sache glaubst.« »Oh ja, Salvator!« Asang glüht vor Begeisterung. »Ich glaube daran, wie …« »Schon gut.« Der Salvator gewährt dem Jungen die Andeutung eines Lächelns. »Du bist bereit, dein Leben zu opfern, wenn dein Moment gekommen ist?« »Das habe ich geschworen!« »Du bist also wirklich treu?« Asang nickt mit einem Anflug von Beklommenheit. Hat der Salvator ihn geholt, weil er an ihm zweifelt? Er bringt kein Wort mehr heraus. Der Salvator wiederholt seine Frage mit Nachdruck. »Ja, ich bin treu«, krächzt Asang. »Wem oder was bist du treu?« So sehr es ihn auch beschämt – Asang weiß auf die einfache Frage plötzlich keine Antwort mehr. »Na komm, setz dich.« Der Salvator deutet auf den freien Stuhl. »Wir wollen uns nur ein wenig unterhalten.« Obwohl Asang sich nicht vorzustellen vermag, dass man sich mit dem Salvator unterhalten kann, nimmt er brav Platz. »In der dunklen Welt da draußen ist oft von Treue die Rede. Sie wird hergeschenkt wie Kleingeld, das man übrighat. Was meinst du dazu, mein Junge?« Asang findet langsam seine Beherrschung wieder und zögerte nicht mit seiner Antwort. »Treue ist das kostbarste Gut der Welt.« »Und warum ist sie das?« »Weil es sonst keine Rettung gibt.« »Und wem gilt nun deine Treue?« Wieso hat er zuvor keine Antwort auf diese Frage gewusst? Asang versteht es nicht. »Meine Treue gehört allein dem Salvator«, sagt er feierlich. »Denn nur der Salvator kann die Welt retten.« »Treue ist auch deshalb ein kostbares Gut, weil sie dem, der sie schwört, das Kostbarste abverlangt.« Den forschenden Blick des Salvators auf sich, nickt Asang. »Was meinst du: Wovon spreche ich?« »Vom Willen.« »Du bist wirklich ein kluger Junge. Ja, ich spreche vom Willen. Absolute Treue bedeutet …?« »… dem eigenen Willen zu entsagen.« »Ja, das bedeutet es. Aber ist man denn noch ein Mensch, wenn man dem eigenen Willen vollkommen entsagt?« Asang fühlt sich seines Verstandes wieder sicher und nimmt sich Zeit nachzudenken. Schließlich sagt er: »Ich bin mir nicht sicher, ob man dann noch ein Mensch ist. Für uns hier kommt es darauf nicht an. Wir sind nur das Mittel zum Zweck.« »Absolute Treue kann sehr wehtun.« »Wir lernen hier, Schmerzen auszuhalten, Salvator.« »Schlimmer als der Schmerz, den man aushalten muss, ist der, den man zufügen muss. Bist du auch dazu bereit?« »Der Feind …« »Manchmal verbirgt sich der Feind in den eigenen Reihen. Manchmal nimmt er die Gestalt eines Kameraden an. Und dann? Bis du auch dann bereit, das Nötige zu tun?« »Ich habe geschworen, allen Befehlen zu folgen.« »Die Sache ist die: Ich habe Großes mit dir vor. Du darfst studieren, in deiner Heimat. Danach wirst du kein einfacher Soldat sein, sondern Agent tief in Feindesland. Möchtest du das?« Asang weiß nicht, wie ihm geschieht. Nie hätte er zu hoffen gewagt, dass ihm solche Ehre zuteilwürde. »Möchtest du das?« »Ja, Salvator«, haucht Asang. »Wie fühlst du dich dabei?« »Stolz, Salvator.« »Stolz?« Asang erschrickt vor dem scharfen Tonfall. Sofort erkennt er seinen Fehler. »Nein, natürlich nicht Stolz!«, beteuert er mit bebender Stimme. »Bitte entschuldigt, Salvator! Ich meine … erfüllt. Von meiner Bestimmung erfüllt, das wollte ich sagen!« »Stolz ist ein eitles Gefühl. Es ist der Keim, aus dem Böses erwächst, vergiss das nie.« »Nein, Salvator.« »Als Agent trügest du große Verantwortung, bist du dir dessen bewusst?« Asang versucht, seiner Stimme Tiefe zu verleihen. »Dessen bin ich mir bewusst.« »Vorher muss ich mich deiner uneingeschränkten Treue versichern, das verstehst du doch?« »In Ehre und Ewigkeit.« »In Ehre und Ewigkeit, genau das wollte ich von dir hören. Zunächst möchte ich, da du ja ein kluger Junge bist, deine Meinung zu einem schwierigen Problem hören. Wie du weißt, hat einer der Jungen versagt.« Asang nickt betreten. Tao, ein Kamerad aus Vietnam, hat beim Großen Kampf, dem schwierigsten Teil der Abschlussübungen, den Kopf verloren und schwere Fehler begangen. Asang tut es besonders leid, weil Tao zu den Jungen gehört, mit denen er sich am besten versteht. »Die Frage ist nun, was wir mit ihm machen. Was sagst du?« Er weiß nicht, was er sagen soll. Sein Kopf fühlt sich wieder so leer an wie am Anfang. »Enttäusche mich nicht, Junge.« »Vielleicht könnte er die Abschlussübungen wiederholen?« »Ist Disziplin im Kampf gegen das Böse wichtig?« »Oh ja, Salvator!« »Und wie sollen wir die Disziplin aufrechterhalten, wenn jeder so oft zu den Übungen antritt, bis er geneigt ist, sie zu bestehen?« »Dann geht es wohl nicht.« »Da stimme ich dir zu. Wir brauchen also eine bessere Entscheidung.« Asang überlegt, ob er vorschlagen soll, Tao zu verstoßen, doch er sieht selbst, dass man die gescheiterten Kameraden nicht dem Feind überlassen darf. »Ich, ähm, überlege …« »Nur zu.« »Vielleicht könnte man ihn für niedere Tätigkeiten einsetzen.« »So würdest du an meiner Stelle entscheiden? Ich soll aus Mitleid mit einem Versager unsere Kampfkraft schwächen?« »Nein, nein!« »Ich soll riskieren, alles zunichtezumachen, um einen Unwürdigen durchzuschleppen? Ich soll das Leben der Starken aufs Spiel setzen, um einen Schwachen zu schützen? Das ist, was du mir vorschlägst?« »Nein, Salvator, bitte, nein!« »Hast du nicht die Kraft und den Mut zu gerechten Entscheidungen?« »Doch, bestimmt, Salvator.« »Fasse dich, Junge. Steh auf und nimm Haltung an. Ja, so ist es schon besser. Ich frage dich also noch einmal: Siehst du eine Möglichkeit, wie uns der Versager nützlich sein könnte?« »Nein«, sagte Asang und legt in das kurze Wort größtmögliche Entschiedenheit. Doch zum ersten Mal verspürt er nicht nur die Furcht, die es hier so oft zu überwinden galt. Zum ersten Mal spürt er Angst. »Du sagst also, er sei zu nichts nütze. Demnach gibst du mir den Rat, den Jungen zu beseitigen. Oder verstehe ich dich falsch?« Zu einem Eisblock gefroren, vermag Asang nichts mehr zu sagen. »Ich habe dich also richtig verstanden. Junge, du hast mich überzeugt: Der Versager muss getötet werden. Und weil es deine Idee war, hast du die Ehre, das Werk selbst zu vollbringen, gleich hier und jetzt. Auf diese Weise versicherst du mich deiner absoluten Treue. Enttäusche mich nicht, Junge.« Der Salvator erhebt sich und verlässt ohne ein weiteres Wort den Raum. Im Flur begegnet er dem Kommandanten und einem Jungen. Auf das Nicken des Salvators hin schiebt der Kommandant den Versager ins Büro. RAUCHZEICHEN | E-GRANADA Jesús musste reden. Fast drei Jahrzehnten hatte er die Erlebnisse seiner Kindheit totgeschwiegen, nun vermochte er es nicht mehr. Zu viel war von der Wucht der Ereignisse in Bewegung gesetzt worden. Während er vom Heidenheim und den Ereignissen der letzten Tage berichtete, gab Vincente sich dem Anschein nach ganz dem Tintenfisch auf Kartoffeln und den gegrillten kleinen Paprikaschoten hin. Lediglich Carlos’ Befragungsmethoden sparte Jesús aus. Man musste einfach dabei gewesen sein, um die Selbstverständlichkeit zu begreifen, mit der sich alles entwickelt hatte. Sie saßen, da sich der angekündigte Regen Zeit ließ, in Jesús’ Patio, tranken Wein und gaben ein ganz gewöhnliches Bild andalusischer Lebensart ab. Nur die Schweigsamkeit, die sich bald einstellte, passte nicht. »Magst du eine Zigarre?«, fragte Vincente schließlich. »Zigarre?« Jesús konnte sich nicht erinnern, ihn jemals rauchen gesehen zu haben. »Ich dachte mir, heute ist vielleicht der Moment, eine zu probieren.« Jesús drängte es nicht gerade danach. Aber er verstand, was die Zigarre bedeuten sollte. Es ging nicht um Teer und Nikotin, sondern um eine Zeremonie, um Freundschaft. Also steckte er sich das dicke Ding in den Mund, inhalierte vorsichtig und hustete sich bröckchenweise die Lunge aus dem Leib. Vincente lachte. »Nicht inhalieren! Einfach den Rauch auf der Zunge zergehen lassen und wieder rauspusten!« Jesús lachte mit, hustete und lachte, lachte und hustete und es tat gut. »Warum hast du es mir erzählt?«, erkundigte sich Vincente nach einer Weile. »Hätte ich nicht sollen?« »Doch! Ich meine nur, ob du etwas Bestimmtes von mir erwartest. Einen Rat oder Hilfe.« »Nein, ich glaube nicht. Vor allem wollte ich, dass du einfach zuhörst … und nicht mit Mitleid anfängst.« »Ist schon klar.« Er lächelte etwas bemüht. »Trotzdem habe ich das Gefühl, ich müsste mehr tun.« »Kannst du. Halte deine Frau außen vor.« Die Vorstellung, Gloria könne in ihm bloß noch einen kleinen, vergewaltigten Jungen sehen, gefiel ihm überhaupt nicht. »Klar. Sie würde glatt Amnesty International in Marsch setzen!« Vincente grinste – und wurde gleich wieder ernst. »Und wie geht es weiter? Kannst du die Geschichte so stehen lassen?« »Weiß nicht. Nur, was soll ich tun? Selbst wenn noch einer von den Hintermännern lebt: Wie soll ich an den rankommen? Hat nicht mal die Polizei geschafft, das liegt schließlich über dreißig Jahre zurück.« Vincente wollte keine schlafenden Hunde wecken, konnte eine Frage aber nicht für sich behalten. »Fühlst du dich irgendwie für den Tod deiner Eltern verantwortlich?« »Nur weil ich wahrscheinlich der Anlass für ihre Ermordung war? Sollte ich denn?« »Nein! Nein!« »Tue ich auch nicht. Leute, die sich für Sachen schuldig fühlen, die sie nicht hätten verhindern können, oder nur, wenn sie allwissend oder allmächtig wären, sind mir ein Rätsel. Was ist das? Masochistischer Größenwahn?« So bissig kannte Vincente seinen Freund überhaupt nicht. »Mach mal halblang«, bremste er ihn. »Ja.« Jesús stöhnte. »Das ist die Anspannung. Diese verfluchte Ohnmacht! Ich möchte die Schweine so gern zur Rechenschaft ziehen für das, was sie meinen Eltern und mir angetan haben.« »Irgendeinen Anhaltspunkt muss es geben!« Die Hilflosigkeit machte auch Vincente zu schaffen. »Was ist mit diesem Carlos? Hast du nicht gesagt, er sei …« »Ein Vollprofi, ja. Aber zaubern kann er nicht. Ich meine, der bringt Sachen raus, da steht dir der Mund offen. Nur, außer Brúto gibt es keine Verbindung. Und aus dem hat er schon alles herausgeholt.« »Dann musst du es abhaken.« Es war an der Zeit, damit anzufangen. Jesús goss die Gläser voll und hob seines. »Danke! Auf die Freundschaft!« »Auf die Freundschaft! Lass uns an was anderes denken. Ich weiß, was dich ablenken könnte, nämlich eine …« »Frau!« Sie lachten, so gut es ging, und versuchten, den dunklen Wolken über sich keine Beachtung zu schenken. NICHT ZU FASSEN | D-FRANKFURT/MAIN Degenhart stand vor Markus’ Schreibtisch, als Papandreou am Mittwochmorgen das Büro betrat. »Jassu, Anastasia!«, gab er sich sprachkundig, ohne zu bemerken, dass er sie duzte. Sie mochte diese folkloristische Anbiederung mit Floskeln, die jemand auf der Papierserviette beim Griechen abgestaubt hatte, nicht besonders, ließ es sich aber nicht anmerken. »Jassas, Stefan.« »Und, haben Sie in der Wohnung der Vermissten etwas entdeckt?« Sie zog Heydts Handy hervor und öffnete die SMS. »Eine Mitteilung, die es in sich hat. Sie lautet: Machen Sie keinen Unsinn – Komma – Selbstmord ist keine Lösung – Ausrufezeichen. Darunter: PS. Es folgt jedoch kein Postskriptum. Die Rufnummer ist leider unterdrückt.« »Selbstmord, hört, hört. Ich dachte mir gleich, dass sie die Tat begangen hat«, klopfte Degenhart sich auf die Schulter. »Und nun hat sie keinen Ausweg mehr gesehen und …« »Das kann sie auch selbst eingefädelt haben, um uns auf eine falsche Spur zu lenken und abzutauchen, Himmel, Herrgott!«, polterte Engel los. »Lassen Sie sich doch nicht von ihr für dumm verkaufen! Ich meine …« Aber so genau wusste er selbst nicht, was er meinte. Degenhart missfiel die Situation. Derart emotional kannte er Engel überhaupt nicht. Er werde sich nun um den Haftbefehl kümmern, bemerkte er betont kühl und verließ das Zimmer. »Hat sich bei Ihnen etwas ergeben, Markus?« Froh, dass Anastasia seinen peinlichen Ausbruch überging, berichtete er vom »Institut für psychosoziale Hygiene«, bei dem Anna Heydt in Behandlung war. »Santer, ihr Psychologe, leitet die Einrichtung. Erstaunlich jung für die Position. Und nicht gerade der redselige Typ, kam mir mit der Schweigepflicht.« Den Zahn hatte er ihm schnell gezogen, Psychologen mussten Auskunft geben. Die war allerdings dürftig ausgefallen: Frau Heydt hatte vor drei Monaten eine Therapie begonnen, auf eigene Initiative erschienen, keine Überweisung. In schlechter psychischer Verfassung. »Sie war da erst gestern Abend, nur Stunden vor ihrem Verschwinden. Hat von einem traumatischen Erlebnis erzählt, nichts Sexuelles. Plötzlich ist sie aufgesprungen und aus der Praxis gestürmt.« »Hm«, murmelte Anastasia. »Vielleicht hat sie das auch eingefädelt.« »Glauben Sie?« Nein, tat sie nicht. Aber er sollte selbst drauf kommen, wie absurd die Fluchtvariante mittlerweile klang. Unvermittelt meinte er, der Psychologe sei merkwürdig. Anastasia sah ihn fragend an. »Ganz in Schwarz gekleidet, den Blick immer irgendwo im Nirgendwo, wortkarg, als hätte er gerade ein Schweigegelübde abgelegt. Gänzlich unentspannt.« Gänzlich unentspannt also. Sie hätte gern gewusst, wo er sich selbst auf der Skala für gänzliche Unentspanntheit einordnen würde. »Was sagt er zur Suizidgefahr?« »Ja und nein. Nein immer dann, wenn es um seine Verantwortung als ihr Therapeut geht.« »Ist das eine staatliche Beratungsstelle?« »Nein, das Institut wird von einer Stiftung getragen.« »Und wie machen wir weiter?« »Weiß noch nicht.« »Was halten Sie davon, die öffentliche Videoüberwachung anzuzapfen? Vielleicht hat eine Kamera sie eingefangen.« »Gute Idee, vorausgesetzt, wir bekommen den Haftbefehl.« Das Telefon klingelte. Markus hob ab. Degenhart – gab er ihr mit lautloser Lippenbewegung zu verstehen. »Ja, und?« – »Das meinen Sie nicht ernst.« Ein unerfreuliches Gespräch, wurde Anastasia schnell klar. »Und wie wird dieser Schwachsinn begründet?« – »Ach, und das nehmen Sie hin?« – »Was heißt denn, am längeren Hebel?« – »So wird das nichts, Kollege Degenhart.« – »Ich meine, dass es so nichts mit Ihrer Karriere wird! Wenn Sie jetzt den Schwanz einziehen, war’s das mit dem Alphatier. Der macht Sie gerade zum Bettvorleger, merken Sie das nicht?« So abrupt, wie Markus auflegte, vermutete Anastasia, dass Degenharts Antwort im Tuten verklungen war. »Strecker weigert sich, einen Haftbefehl auszustellen!« »Strecker?« »Der neue Staatsanwalt. Fragen Sie mich nicht, was ich von ihm halte. Erst attackiert er Frau Heydt wie das personifizierte Böse und plötzlich will er von einem Haftbefehl nichts mehr wissen.« »Wie hat er seine Entscheidung begründet?« »Keine Ahnung. – Ich will das von ihm selbst hören.« Kurz entschlossen packte er den Hörer. Bevor er wählte, stellte er den Telefonlautsprecher an. »Dr. Strecker.« »Engel.« »Mir missfällt bereits jetzt Ihr Tonfall, Engel.« »Und mir Ihrer. Ich will wissen, warum Sie sich weigern, den Haftbefehl auszustellen.« »Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind. Wenn hier einer Rechenschaft schuldet, dann Sie, und zwar mir. Ein solches Ausmaß an Unfähigkeit – oder soll ich es Unwillen nennen? –, wie Sie im Fall Heydt an den Tag gelegt haben, ist absolut intolerabel.« »Ach, ja? Sie hätten Frau Heydt lieber gleich standrechtlich erschossen, nicht wahr, Herr – Doktor – Strecker?« Markus registrierte, dass ihm gerade die Sicherung durchbrannte, konnte jedoch nichts dagegen tun. Die Ohnmacht gegenüber der Willkür riss seine Selbstbeherrschung aus der Verankerung. »Nehmen Sie sich in Acht, Engel! Sie haben schneller ein Disziplinarverfahren am Hals, als Ihnen die nächste Ungehörigkeit über die Lippen kommt.« »Disziplinarverfahren klingt gut. Dann können wir in aller Öffentlichkeit über Ihre seltsame Dienstauffassung diskutieren.« Anastasia hörte Markus mit wachsendem Unglauben zu. Wie er Strecker die Stirn bot, erinnerte an Michael Kohlhaas. Reagierte er sich ab, weil er meinte, einen Fehler gemacht zu haben, der Heydts Verschwinden erst ermöglicht hatte? Oder lag ihm die fertige Alkoholikerin dermaßen am Herzen? Anastasia beschlich ein ungutes Gefühl. Sie musste auf der Hut sein. »Nach Recht und Gesetz haben Sie den Haftbefehl auszustellen!« »Nein, habe ich nicht, Kollege Engel.« Strecker klang mit einem Mal fast beschwichtigend. Wie ein Psychiater, der auf einen Geistesgestörten einredet. »Allen, wirklich allen Erkenntnissen nach hat sich die Beschuldigte getötet.« »Dafür gibt es keine Beweise!« »Wir haben eine Kette schlüssiger Indizien. Das müssen Sie einsehen, wie schwer es Ihnen auch fallen mag, Mitschuld an ihrem Tod zu tragen. Wenn es nach mir gegangen wäre, säße Frau Heydt jetzt sicher im Justizvollzug. Leider haben Sie mehr mit ihrem Anwalt als mit uns zusammengearbeitet. Gar nicht zu reden davon, wie Sie den Fall verschleppt haben. Mit dieser Verantwortung müssen Sie nun leben. Doch keine Sorge, die Vermissung ist ja angezeigt, wir werden Frau Heydt finden, das heißt, ihren Leichnam. Bis dahin haben wir Dringenderes zu tun. Der Fall Heydt ist Ihnen entzogen.« Markus verschlug es die Sprache. »Und noch etwas. Stellen Sie nie wieder den Telefonlautsprecher an, wenn Sie mit mir reden.« Konsterniert ließ Markus den Hörer sinken. ENTSPANNUNGSÜBUNGEN | E-GRANADA Jesús nahm sein altes Leben wieder auf. Er versuchte zu vergessen und strengte sich an, sich nicht dabei anzustrengen, denn je mehr Mühe er sich gab, desto schwieriger wurde es. Am liebsten hätte er von früh bis spät nichts anderes getan, als Emily, das Sprachgenie, zu unterrichten. Sie zauberte mit einer Entschlossenheit Stilblüten hervor, wie sie großer Kunst innewohnt. Aus Stilblüten wurden Sträuße, aus Sträußen ein Garten und aus dem Garten langsam, aber sicher eine Landschaft. Vielleicht wurde er Zeuge, wie eine neue Sprache entstand. Beinahe schämte er sich, auf den konventionellen Regeln zu beharren. Emilys Unbekümmertheit, die ihn vor ein paar Tagen einfach nur angerührt hatte, empfand er nach den Ereignissen in Toledo geradezu besänftigend, er musste an ein Gänseblümchen denken, das aus einem Feld voller Brennnesseln herausleuchtet. Jesús zog das Schultor hinter sich zu und machte sich mit Inga auf den Heimweg. Zuhause fiel ihm sein Versprechen ein, sich bei dem Polizeibeamten zu melden, wenn er etwas über Brúto und Konsorten herausgefunden hatte. Am besten, er brachte es gleich hinter sich. Brúto habe gestanden, leitete er seinen Bericht ein. »Er wohnt noch in Toledo, aber die Adresse hat sich geändert. Sie finden ihn in der Calle de Bautista Monegro 4 oder …« »Gestanden? Wie haben Sie ihn denn dazu gebracht, Señor Mirandor?« Jesús überging die Frage und wurde schmallippig. Er beschränkte sich auf das Notwendige, den Kinderraub aus Waisenhäusern und die zwei Brandopfer in einem Haus nahe Toledo. Er schilderte, was er wusste, ohne auf sein eigenes Schicksal einzugehen. Er wollte jetzt endlich vergessen. »¿Y no sabe nada del instigador, Señor Mirandor?« Nein, über den Drahtzieher habe er nichts herausgefunden, antwortete Jesús. »Brúto hat von jemandem im Hintergrund gesprochen, den er für gefährlich hält, aber ich glaube, er weiß selbst nichts Genaues. Es bleibt wohl beim großen Unbekannten. Werden Sie von Deutschland aus was unternehmen, Herr Engel?« Engel zuckte mit den Achseln, während er Brútos Adresse notierte. »Eher nicht. Zumindest werden wir die spanischen Kollegen informieren.« »Wie Sie meinen.« »Ich darf Sie anrufen, wenn ich noch Fragen habe?«, vergewisserte sich Engel. »Natürlich.« »Und wenn es auf Ihrer Seite Neuigkeiten gibt, informieren Sie mich bitte?« »Auf meiner Seite wird es keine Neuigkeiten geben.« »Ich gebe Ihnen trotzdem meine Handynummer, für alle Fälle.« Jesús notierte sie pro forma und legte auf. Erledigt. Er stieg auf seine Holzempore und legte sich mit Inga in die Sonne. Zeit, das Leben zu genießen. TEUFLISCHE FRAGEN | D-FRANKFURT/MAIN Engel hatte das Artikelmanuskript von Anna Heydt in der Hoffnung mit nach Hause genommen, es werde einen Blick hinter ihre verrammelte Fassade erlauben. Mit einem Glas Tomatensaft nahm er auf dem weinroten Diwan im Wohnzimmer Platz und begann zu lesen. SIND WIR ZUR UNSCHULD VERDAMMT? Kopernikus? Hat uns vom Mittelpunkt des Weltalls vertrieben. Darwin? Hat uns zum Zufalls- und Zwischenprodukt der Evolution degradiert. Freud? Hat uns zum Triebtäter erklärt. Schließlich kamen Crick und Watson, die DNS-Ermittler, und haben uns in unsere molekularen Bestandteile zerlegt. Man könnte glauben, die Wissenschaft hätte unserem Selbstbild den Krieg erklärt. Tatsächlich hat sie uns ein Tauschgeschäft aufgezwungen: Erkenntnis gegen Erniedrigung, Lieferung frei Haus. Unerheblich, ob wir wollen oder nicht. Womit wir zum nächsten Kapitel der wissenschaftlichen Enthüllungsstory kommen: Können wir das überhaupt – wollen? Genauer gefragt: Wer oder was entscheidet eigentlich, wenn wir meinen zu wollen? Längst liegt der sogenannte freie Wille des Menschen auf dem Seziertisch der Forschung. Noch gibt es keinen endgültigen Befund, doch lassen die Zwischenergebnisse nichts Gutes erwarten. Überrascht registrierte Markus, wie rund die sperrige Anna Heydt formulierte. Anastasia sah in ihr nur eine heruntergekommene Alkoholikerin, aber dieser Artikel sprach eine andere Sprache. Benjamin Libet (1916–2007) war Physiologe und ist eine Legende. Nicht zuletzt wegen des »Libet-Experiments« von 1979. Er wollte ermitteln, wie lange das Gehirn braucht, eine Willensentscheidung motorisch umzusetzen. Dazu ersann er folgende Anordnung: Versuchspersonen sollten zu einem willkürlichen Zeitpunkt die Entscheidung treffen, ihre Hand zu bewegen. Anhand einer Art Uhr sollten sie sich den Zeitpunkt merken. Währenddessen maßen Elektroden die Gehirn- und Muskelaktivität. Das verblüffende Ergebnis: Das Gehirn begann zu arbeiten, bevor sich die Probanden ihrer Entscheidung überhaupt bewusst waren. Der Vorsprung betrug bis zu einer halben Sekunde. Heutige Experimente mithilfe von Magnetresonanztomografen zeigen einen noch größeren Vorsprung. Ein Hase-und-Igel-Rennen, bei dem das Gehirn unseren bewussten Willen stets schon im Ziel erwartet. Auch Itzhak Fried machte unverhoffte Entdeckungen. Anfang der Neunzigerjahre wollte der Neurochirurg erforschen, wo im Hirn Epilepsieanfälle ausgelöst werden. Dazu verlegte er Elektroden unter der Schädeldecke von Patienten. Dadurch bot sich nebenbei die Chance, etwas über die Funktion einzelner Hirnareale herauszufinden. Fried versetzte ihnen Stromstöße und beobachtete die Reaktionen: Er konnte ganzen Muskelgruppen »befehlen«, sich zu bewegen, und selbst Lachanfälle auf Knopfdruck auslösen. Die eigentliche Überraschung aber war die Rückmeldung der Patienten: Sie fühlten sich nicht etwa ferngesteuert. Vielmehr glaubten sie, sie hätten sich bewegt, weil sie es wollten, und gelacht, weil etwas lustig war. Die Illusionen einer Marionette, die von den Fäden nichts spürt. Die Liste irritierender Forschungsergebnisse ließe sich fortführen. Noch sind es nur Zwischenresultate, doch wer auf den freien Willen setzt, ist in die Defensive geraten. Eine Formulierung von Paul Bloom, Professor für Psychologe in Yale, offenbart die ganze Hilflosigkeit: Das radikale Bestreiten des freien Willens sei ihm »intuitiv derart fremd, dass nur Philosophen es ernst nehmen können«. Bloom erhebt seine Intuition zum wissenschaftlichen Ausschlusskriterium? Das nennt man ein Rückzugsgefecht. Papst Paul III. mag um 1543 ähnlich empfunden haben, als es hieß, die Erde drehe sich um die Sonne: intuitiv nicht möglich. Markus ging es wie Bloom: Er lehnte die Annahme, es gebe überhaupt keinen freien Willen, reflexartig ab. Wenn man die Forschungsergebnisse ernst nahm, wirklich ernst nahm, verlor alles seinen Sinn. Dann war er bloß ein Automat mit aufgemalter Identität, in dem sich ein Haufen Neuronen verbarg. Ihm fiel ein, was er über »evolutionäre Programmierung« wusste: Der Mensch wird mit einem genetischen Bausatz geboren, der bereits ganze Befehlsketten für das Verhalten in existenziellen Situationen enthält. Schließlich erinnerte er sich an Dr. Guhls Vortrag über den Parasiten Toxoplasma gondii, der unbemerkt Einfluss auf den Willen höherer Lebewesen nahm. Wenn das alles stimmte, dann gab es Markus Engel eigentlich gar nicht, jedenfalls nicht als souveräne Persönlichkeit. Wie hatte es am Anfang des Artikels geheißen? Erkenntnis gegen Erniedrigung, Lieferung frei Haus. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich, heißt es. Und wenn es sich bloß um eine Luftnummer handelt? Wenn wir, wie die Menschen im Kinofilm Matrix, in einer virtuellen Realität gefangen sind – nur ohne Fluchtweg, weil der vom Hirn simulierten »Wirklichkeit« nicht zu entkommen ist? Was also machen wir, wenn sich rausstellt, dass wir mangels Willensfreiheit keine Verantwortung für unser Handeln übernehmen können? Die Gefängnisse öffnen und die Strafgerichte schließen? Oder es ignorieren, weil nicht sein kann, was nicht sein darf? Verblüfft legte Markus das Blatt auf den Diwan. Nun also auch noch ein Anschlag auf sein eigenes Metier. Er bildete sich einiges auf seine Konsequenz ein, Dinge zu Ende zu denken, selbst wenn ungemütliche Schlussfolgerungen warteten. Doch diesmal verweigerte er sich. Ausnahmsweise gesellte er sich zur Fraktion der Ignoranten. Entweder beging die Menschheit, zur Unschuld verdammt, kollektiven Selbstmord oder sie musste an der Willensfreiheit festhalten, gleichgültig, ob Illusion oder nicht. Die Gefängnisse zu öffnen und die Gerichte zu schließen, führte unweigerlich zu Mord und Totschlag. Und die Opfer empfanden realen Schmerz, nicht bloß eine Simulation davon. Nein, es konnte wirklich nicht sein, was nicht sein durfte! Wir stehen vor teuflischen Fragen. Wer an Gott glaubt, steht auf festerem Grund: Er hat zwar keine Beweise, muss aber auch nicht mit Gegenbeweisen rechnen. Wer an den freien Willen glaubt, muss es künftig vielleicht gegen besseres Wissen tun. Weil er es will. Vorausgesetzt, er kann überhaupt wollen. Markus leerte sein Glas. Sie lebten wirklich in schwierigen Zeiten. Je besser der Mensch die Welt verstand, desto unverständlicher wurde sie. GEBRÜDER WAHNSINN & SÖHNE | D-EPPSTEIN/TAUNUS Das Grundstück lag am Waldrand, einige Kilometer außerhalb von Eppstein im Taunus. Eine hohe Ziegelmauer mit nach außen spitz zulaufender Mauerkrone schottete es ab. Man hörte gelegentliches Hundegebell, ansonsten wirkte das Anwesen unauffällig. Die umfangreiche Sicherheitstechnik entzog sich den Blicken, darunter Bewegungsmelder im Vorfeld der Mauer sowie Infrarotwärmebildkameras, Erschütterungsmelder und Lichtschranken im Innenbereich. Dem großen weißen Holztor sah man die Panzerung nicht an. Wem es sich öffnete, der blickte auf eine rund einhundertfünfzig Meter lange, rechteckige Asphaltfläche, die zu einer unansehnlichen Lagerhalle führte. Sie diente als Alibi für die vermeintlich gewerbliche Nutzung des Grundstücks und als Sichtschutz für das dahinterstehende, ziegelrote Landhaus. Der Eigentümer bewohnte das Haus nur selten, ausgenommen die Wochen vor dem Stichtag. In diesen Phasen bezog er das Erdgeschoss, in das ein kleines Apartment für seinen jeweiligen Stichtags-Gast integriert war. Im oberen Stockwerk befanden sich ein Mannschaftsquartier mit zwanzig Stockbetten, eine Kammer für Iwan, den Leiter des Sicherheitsdienstes, und das Zimmer der Haushälterin Lucy. Der Keller war klein, zumindest der sichtbare Teil. Der verborgene Bereich hingegen erstreckte sich weit über die Grundfläche des Hauses hinaus. Man erreichte ihn durch eine als Ölkessel getarnte Schleuse. Hinter ihr lagen die Schaltzentrale, der Gelöbnisraum, die Waffenkammer, ein Tresor der Fort-KnoxKategorie, der medizinische Trakt und ein Fluchtgang. Es war kurz nach eins am Freitagmittag. Der Eigentümer, ein blonder Mann von drahtiger Gestalt, saß in einem schwarzen Ledersessel vor einem mannshohen Kamin, in dem ein Holzstapel von der Größe eines Scheiterhaufens brannte. Er blickte aus graublauen Augen in die Flammen. Ihn fröstelte seit einigen Wochen, er hätte jetzt selbst in der Hölle gefroren. Wortlos trat Lucy ein und stellte ihm eine dampfende Kanne Früchtetee auf das Beistelltischchen. »Jetzt, Salvator?« Er nickte und blickte gedankenverloren aus dem Fenster, während er auf seinen Gast wartete, den er schon viel länger kannte, als der wissen konnte. »Sie müssen mich jetzt sprechen?« Sein Gast sah ihn aus verknitterten Gesichtszügen an. »Ich hab gerade gepennt, verdammt.« »Dann werden Sie wach.« Wie sie es hasste, wenn er diesen kalten, schmallippigen Ton draufhatte. »Setzen Sie sich. Tee?« »Wollen Sie mich auch noch vergiften?« »Sparen Sie sich dumme Kommentare.« Dieses kaum zu vernehmende Flüstern, es klang wie das Surren einer Peitsche, war gefährlich, wusste sie mittlerweile. So hatte er geklungen, nachdem sie ihn zum dritten Mal Stummelschwanz genannt hatte – zum dritten und letzten Mal. »Hören Sie mir genau zu. Ich verreise für zwei Tage und erkläre Ihnen nun die Regeln. Sie sind meiner Einladung aus freiem Entschluss gefolgt. Wenn Sie meine Gastfreundschaft nicht länger in Anspruch nehmen möchten, dann verlassen Sie in einer Stunde mit mir das Haus. Andernfalls bleiben Sie bis zu Ihrem Geburtstag. Das ist der Deal. Wie entscheiden Sie sich?« »Blöde Frage.« Er trank von seinem Tee und vermaß sie über den Tassenrand hinweg mit der Präzision eines Laserscanners. »Ich verlange eine klare Antwort: Wie entscheiden Sie sich?« Wie schon? Sie saß hier zwar in einem goldenen Käfig, aber immer noch besser als in einer Gefängniszelle. Wohin sollte sie sonst? »Ich bleibe.« Er nahm es ungerührt zur Kenntnis. »Sie sind hier sicher – es sei denn, Sie bringen sich selbst in Gefahr. Halten Sie sich an meine Anweisungen, dann wird Ihnen nichts passieren. Wenn Sie Ärger machen …« »Was denn für Ärger, verdammt!« »Sie verlassen das Anwesen nicht, zu keinem Zeitpunkt und aus keinem Grund. Sie tun, was man Ihnen sagt. Sie schnüffeln nirgends herum. Sollten Sie auch nur versuchen, meine Gastfreundschaft zu missbrauchen, lernen Sie eine andere Seite von mir kennen. An meine Zusicherung, es werde Ihnen hier kein Haar gekrümmt, sähe ich mich dann nicht mehr gebunden. – Haben wir uns verstanden?« »Ja, Meister!«, entgegnete sie sarkastisch. Es war ihr ohnehin scheißegal, was hier ablief. Einerseits ging es zwar um ihren Arsch, andererseits ging es ihr aber inzwischen so was von am Arsch vorbei. Sie wusste ohnehin nichts mehr mit sich anzufangen. Sie war einmal ein lebenslustiger junger Mensch gewesen – bis der grausame Tod ihrer Eltern sie getroffen hatte wie der Biss einer Giftschlange. Und das Gift hatte eine in ihr schlummernde Schwäche freigelegt: das Unvermögen, sich abzufinden und ihren Frieden zu machen mit sich und dem Leben. Anna wünschte sich lange schon, sie hätte die Kraft gefunden, den Fehdehandschuh fallen zu lassen, den ihr das Schicksal so früh hingeworfen hatte. Stattdessen nahm die Sehnsucht nach ihren Eltern wie eine ewig schwärende Wunde mit den Jahren nur noch zu, und mit ihr der Zorn. Sie sah keinen Ausweg mehr. Nur deswegen war sie mitgekommen und nicht etwa, weil sie an den Schwachsinn glaubte, den er ihr als Lösung verkaufen wollte. »Ich nehme Sie beim Wort, Frau Heydt. Damit ist unser Gespräch beendet. Wir sehen uns in zwei Tagen.« Wie aufs Stichwort erschien Lucy, um Anna in ihr Apartment zu bringen. Die Haushälterin führte sie durch das weiträumige Foyer des Hauses. Mit seiner Viermeterdecke samt Kristalllüster, dem schweren Eichenboden, der großzügigen Treppe und der dunklen Täfelung erinnerte es an Edgar-Wallace-Filme. Bei ihrem Apartment musste es sich um einen nachträglichen Anbau handeln, schon die Deckenhöhe konnte bei Weitem nicht mithalten und die Einrichtung vom Typ Echtholzanmutung … Schwamm drüber. Sie hörte Geräusche aus dem oberen Stockwerk. Hauste da Iwan mit seinen Männern? Anna blieb neugierig stehen, doch Lucy zog sie am Arm weiter. Ihre knochige Hand fasste unangenehm fest zu. Als sie die Küche passierten, begann es drinnen zu klingeln. Lucy hielt inne, offenbar unschlüssig, was sie tun sollte. »Sie warten hier«, befahl sie und öffnete die Küchentür. Plötzlich ertönte von oben lautes Scheppern, das sie beide hochblicken ließ. Das Telefon klingelte immer noch. »Begeben Sie sich auf direktem Weg in Ihr Apartment. Alles andere geht Sie nichts an, ja? Ich komme gleich nach.« Anna nickte und trottete los. Auf Höhe der Treppe kam sie an einem Raum vorbei, dessen Tür nur angelehnt war. Sie blickte sich um: nichts mehr von der Haushälterin zu sehen. Vorsichtig schob sie die Tür auf. Ein Arbeitszimmer. Regale aus matt glänzendem Ebenholz bedeckten drei der vier Wände. Unter dem Fenster stand ein wuchtiger alter Schreibtisch, schräg gegenüber ein ochsenblutroter Ohrensessel. Tüftelte ihr Gastgeber hier seine seltsamen Ideen aus? Egal. Sie wollte es gar nicht wissen. – Wirklich nicht? Geh da ja nicht rein, du dumme Kuh. Erst vor einer Minute hat er dir gedroht. Und er meint es ernst! – Klappe! Sie erinnerte sich jetzt, dass sie auch mitgekommen war, um auszubaldowern, was der Meister wirklich im Schilde führte. Sein unverhofftes Auftauchen war der einzige rote Faden, an dem man vielleicht ziehen und die ganze Geschichte entwirren konnte. Sie betrat den Raum. Auf dem Schreibtisch lag ein Handy, daneben eine Sammelmappe. Mal schauen, mit was für Papierkram er sich so beschäftigte. Obenauf fand sie einen zusammengehefteten Stoß Papiere mit asiatischen Schriftzeichen. Das Schriftstück enthielt auch eine Karte mit rot umrandetem Areal. Vielleicht ging es um einen Grundstückskauf. Was hatte der Kerl denn in Asien zu schaffen? Plötzlich hörte sie draußen Schritte. Scheiße, warum musst du deine Nase bloß überall reinstecken? Die Schritte näherten sich. Anna sah, wie die Türklinke heruntergedrückt wurde. Gottseibeiuns, nicht auch das noch! Lucys Stimme erklang von der anderen Seite der Tür, dann, aus der Ferne, eine andere Stimme. Die Klinke war immer noch heruntergedrückt. Mangels Alternative zwängte Anna sich hinter das Ende des Regals; genauso gut hätte sie sich die Hand vor die Augen halten können. Die Tür öffnete sich einen Spalt. Anna hielt den Atem an. Mit Argusaugen starrte sie auf die Tür, die sich nicht zwischen Öffnen und Schließen entscheiden mochte. Wieder senkte sich die Klinke. Klack. Anna schloss unwillkürlich die Augen. Bis sie begriff, dass die Tür wieder zugezogen worden war und sie bloß den Schnapper des Schlosses gehört hatte, vergingen atemlose Ewigkeiten. Puh. Jetzt bloß weg hier. Nachdem die Schritte verklungen waren, quetschte sie sich aus der Lücke. Dabei stieß sie mit dem Schuh gegen die Wand. Ein hohles Geräusch. Sie bückte sich und klopfte mit dem Fingerknöchel gegen die Stelle. Eindeutig hohl. Was denn noch, würde gleich der Hexer hinter ihr auftauchen? Sie tastete mit den Fingerkuppen nach einer Kante. Lass es! Oder hat dir der Schrecken nicht gereicht? Einige Minuten später hatte sie das Fach geöffnet. Sie blickte auf eine grau gestreifte Schachtel. Iwan warf einen Blick durch die angelehnte Küchentür und fragte Lucy, wo sich die Gefangene befand. Die sei bereits im Apartment, entgegnete Lucy und drückte Iwan einen Vitamincocktail in die Hand, den sie ihr gerade hatte bringen wollen. Wenn Iwan da sowieso hinging, konnte er ihn auch mitnehmen. Anna entnahm dem Karton einen Papierstapel und blätterte einige der losen Seiten durch, auf denen sie die Handschrift ihres Gastgebers zu erkennen meinte. Endlose Listen. Jeder Eintrag begann mit einer Kombination aus römischen Ziffern und einen griechischen α oder β, gefolgt von kryptischen Zahlenreihen. Vergebens versuchte sie, ein logisches Muster herauszulesen. Befand sich in diesem verdammten Karton denn nichts, mit dem man was anfangen konnte? Sie hob den Papierstapel heraus. Darunter kam ein Album zum Vorschein. Iwan schob die Apartmenttür auf, sah Heydt aber nirgends. Den blöden Vitamin-Mix in der Hand, wandte er sich fluchend um. Ständig machte die Drecksau Ärger! Er riss die Badezimmertür auf, ihr Problem, wenn sie auf dem Klo hockte. Leer. Verdammt noch mal, die Abfahrtszeit rückte immer näher, und er hatte nichts Besseres zu tun, als nach Madame zu suchen. Zum ersten Mal seit Langem quälte ihn wieder das Sodbrennen. Mit seinen achtunddreißig Jahren, davon zweiundzwanzig im aktiven Dienst, war Iwan ein Veteran der Unsichtbaren Armee. Dreiundzwanzig Monate noch. Mit maximal vierzig schickte der Salvator ausnahmslos jeden Heilssoldaten aufs Altenteil: ein Resort irgendwo an der nordafrikanischen Küste. Nicht einmal Iwan wusste Genaueres. Eigentlich fühlte er sich noch zu fit für Müßiggang. Er hatte bei den Speznas, einer sowjetischen Eliteeinheit, gedient und dort eine einzigartige Härte erworben. Noch kam bei den Schmerzwettbewerben, die sie regelmäßig durchführten, um ihre Leidensfähigkeit zu trainieren, niemand gegen ihn an. Aber der Plan des Salvators sah es nun einmal so vor. Nichts geschah ohne Grund. Und Iwan wusste sehr wohl, welch seltenes Glück ihm in den vergangenen acht Jahren zuteilgeworden war: Er hatte an der Seite des Salvators kämpfen dürfen! Viele Kameraden bekamen ihn nur ein Mal im Leben zu Gesicht, bei ihrer Aufnahme in die Unsichtbare Armee. Wenigen war es vergönnt, zwei, drei, maximal vier Jahre in seiner Nähe dienen zu dürfen. Lediglich Henry, der Majordomus, konnte mit Iwan halbwegs mithalten. Zwei Jahre noch. Und die würde er sich bestimmt nicht von Heydt kaputt machen lassen. Wütend stiefelte er zur Küche zurück, wo Lucy gerade Schnitzel für die Mannschaft panierte und ein bulgarisches Lied summte. In Gedanken lag sie am Strand von Varna an der Schwarzmeerküste, wo sie aufgewachsen war. »Die Heydt ist nicht im Apartment!« Lucy sah sich irritiert um. »Muss sie aber, ich habe sie vor ein paar Minuten zurückgeschickt.« »Wie, zurückgeschickt? Sie hat sich im Haus nicht allein zu bewegen, weißt du ganz genau!« Iwan zog die Tür zu, Zuhörer konnte er nicht brauchen. Wenn Lucy Mist gebaut hatte, trug er dafür die Verantwortung. »Ich will jetzt genau wissen, was los ist.« »Das Telefon ging und der Salvator war dran. Ich hätte sie ja im Foyer geparkt, wenn ihr da oben nicht wieder so einen Lärm veranstaltet hättet. Der Salvator hat mich ausdrücklich vor ihrer Neugierde gewarnt, also hab ich sie in ihr Apartment geschickt.« »ABER DA IST SIE NICHT!« »Schrei mich nicht an. Ich bin keiner von deinen Männern.« Iwan antwortete mit leiser Stimme. »Solltest du Scheiße gebaut haben, blüht dir dasselbe wie denen, die den Eid geleistet haben.« Mir passiert nichts, darauf kannst du wetten, dachte Lucy. Sie behielt es für sich. »Dann los, was soll ich machen?« »Du gehst ins Apartment. Nimm dein Handy mit. Wenn sie eintrifft, meldest du dich. Ich schaue draußen nach.« »In Ordnung. Wenn du sie findest, Iwan: Beherrsche dich, wir brauchen sie noch.« »Klappe!« Anna klappte das Album auf. Zeitungsausschnitte. Die kurzen, vermutlich von Lokalseiten stammenden Berichte waren in den unterschiedlichsten Sprachen verfasst. Sie blätterte, bis sie einen auf Deutsch verfassten Bericht fand. Offenbar ein aus dem Netz heruntergeladener Artikel, deutlich länger als die anderen. Der Bericht beschrieb am Beispiel eines 1962 verschwundenen, neununddreißig Jahre alten Mannes die Vorgehensweise des Roten Kreuzes; der Autor hatte sinnigerweise einen Fall ausgewählt, an dem der Suchdienst gescheitert war. Nach einigen Minuten hatte Anna sieben Zeitungsberichte aussortiert, deren Sprache sie verstand. Zwei deutsche aus München und Regensburg, drei englische, in denen von Newcastle, Brisbane und einem Detroiter Vorort die Rede war, einen französischen von der Elfenbeinküste und einen nicht zu lokalisierenden in russischer Sprache. Von wann sie stammten, ließ sich nicht erkennen, lediglich die Vergilbung des französischen Zeitungsausschnitts wies auf ein weit zurückliegendes Erscheinungsdatum hin. So weit die Orte über den Erdball verteilt waren, behandelten sie doch alle dasselbe Thema: das spurlose Verschwinden von Menschen. Von alleinstehenden Menschen. Menschen, die niemand wirklich vermisste. Es ging um die Anna Heydts dieser Welt. War ihr Gastgeber ein Wahnsinniger? Einer, der Leute abgriff, um perverse Rituale an ihnen zu vollziehen? Aber hinter dem Vermisstenfall von 1962 konnte er unmöglich selbst stecken. Vielleicht ein Familienunternehmen, Gebrüder Wahnsinn & Söhne? Es fröstelte sie. Plötzlich hörte sie draußen Schritte und stopfte das Album hastig in den Karton. Iwan stapfte durch das Foyer zum Hof. Abhauen konnte Heydt nicht, doch wenn sie versuchte, auf die Mauer zu klettern und sich dabei das Genick brach, würden sie alle Genickbruch erleiden. Die Schlacht wäre wegen eines blöden Miststücks verloren. Im Normalfall hätte der Bewegungsmelder Alarm gegeben, sobald sie sich draußen blicken ließ, doch ausgerechnet heute war er deaktiviert, um eine neue Software auf den Sicherheitsrechner zu laden. Er sah sich um, ohne das Miststück auszumachen, und rannte zur Lagerhalle vor. »Hast – du – die – Heydt – gesehen?«, brüllte er zu Christian rüber, der vor der Einfahrt Wache schob. Christian schaute irritiert, dann schüttelte er den Kopf. Auch Anna schüttelte den Kopf. Ratlos. Sie verstand nicht, worauf das alles hinauslief. Während sie den Karton hinter den Ohrensessel auf das Geheimfach zuschob, vernahm sie ein Poltern im Nebenraum. Dann schwere Schritte. Stiefelschritte. Wurde sie bereits gesucht? Eine Tür knallte zu. Die Schritte näherten sich – schnell. Anna erstarrte. Langsam drehte sie sich um und blickte zur Tür, die jeden Moment aufgehen musste. Unwillkürlich trat sie einen Schritt zurück. Dabei stieß sie mit dem Fuß gegen den Karton, verlor das Gleichgewicht und ging zu Boden. Im selben Augenblick wurde die Tür aufgerissen. Jemand betrat den Raum. Anna machte sich hinter dem Ohrensessel so klein wie möglich. Bestimmt konnte man sie trotzdem von der Tür aus sehen. »Ich bringe dich um, du Schlampe!« Iwan, der schlimmste Hundsfott von allen. Er hatte sie gefunden. Das Spiel war aus. Anna erhob sich. Im Zeitlupentempo reckte sie den Kopf über die Sessellehne. Niemand mehr da? Iwan hatte sie gar nicht entdeckt, sondern mit sich selbst geredet? Wow, das nannte man mehr Glück als Verstand. Und wie kam sie nun auf die Schnelle unbemerkt hier raus? Eilig verstaute sie den Karton im Geheimfach, dann lauschte sie an der Tür. Nichts zu hören. Sie musste wissen, ob sich Iwan noch in der Nähe befand. Mit fliegenden Fingern nahm sie das Handy vom Schreibtisch und rief die Kontaktliste auf. Sie musste nicht lange suchen, bis sie Iwans Nummer entdeckte. Zurück zum Menü. Sie klickte sich durch, bis sie die RufnummernUnterdrückung gefunden hatte, ging zur Tür, legte ein Ohr an und startete den Anruf. Hörte sie da ein Klingen in der Ferne? Ja – und es näherte sich. »Was gibt’s?«, schrie Iwan sie plötzlich an. Vor Schreck hätte sie beinahe geantwortet. Stattdessen kappte sie die Verbindung, warf das Handy auf den Schreibtisch und rannte zur Tür. Augen zu und durch! Kaum hatte sie die Tür hinter sich zugezogen, marschierte Iwan heran. Sein Handy hielt er noch in der Hand. Augenblicklich verwandelte sich seine Sorge in Wut. »Wo warst du, Fotze?« »Ob der Chef wohl gern hört, wie du seinen Gast titulierst?«, hielt Anna dagegen – nur keine Furcht zeigen. Nervös scannte sie die Umgebung. Iwan würde auf einer Antwort bestehen, das war mal sicher. Weiter hinten sah sie eine Treppe, die nach unten führte. Hoffentlich in einen unverdächtigen Bereich. Iwan baute sich vor ihr auf. Schmerz = Masse x Brutalität, ging Anna durch den Kopf, während ihr das Schwein in den Schritt griff und ihre Schamlippen zusammenquetschte. Sie hätte nicht gedacht, dass es so wehtun konnte. »Ich – will – wissen – wo – du – warst.« »Aua, aufhören, sonst schrei ich das Haus zusammen!« Sie versuchte, die Hand da wegzukriegen. Keine Chance, seine Unterarme waren dicker als ihre Oberschenkel. »Schrei, wenn du dich traust«, knurrte er sie an, gab ihren Schamlippen jedoch eine Verschnaufpause. »Noch mal: Wo warst du?« Praktisch gesehen spielte es zwar keine Rolle, denn wer hier strandete, erhielt keine Gelegenheit mehr, etwas auszuplaudern. Aber es ging ums Prinzip. »Rede!«, herrschte er sie mit heiserer Stimme an. »Unten, da, die Treppe runter.« »Und was hattest du da zu suchen?« »Kerberos.« Sie folgte einer spontanen Eingebung. »Kerberos? Was hast du mit meinem Hund zu schaffen?« »Du hast gestern gesagt, ich solle dich am Arsch lecken. Da wollte ich schon mal an deinem Köter ausprobieren, was mich erwartet.« »Du dreckige Sau.« Er packte sie am Haarschopf und versetzte ihr eine Ohrfeige, die sie die Schamlippen vergessen ließ. »Verschwinde in dein Apartment. Wenn ich dich noch mal suchen muss, bist du tot.« Die Ohrfeige brannte höllisch. Doch alles in allem war sie dank einer gut platzierten Provokation ziemlich billig davongekommen. Männer konnten so blöd sein. GÄNSEBLÜMCHEN | E-GRANADA Am Freitagmittag nach getaner Arbeit saß Jesús entspannt auf der Plaza Larga und las Zeitung. Vor ihm lag ein voraussichtlich sonniges Wochenende. Plötzlich tippte ihm jemand von hinten auf die Schulter. »¡Hola Dschä-isus! ¿Como tal?« »Hola Emily. Estoy muy bien. ¿Y tú?« »Sí«, antwortete sie. Ob sie sich fühlen dürfe. Natürlich durfte sie, wenngleich sie sich wahrscheinlich nur setzen wollte. Ihr Gespräch stolperte ein wenig in diese und jene Richtung, bis Emily mit einem Mal ins Englische wechselte. Sie habe ein Auto gemietet, um übers Wochenende ans Meer zu fahren, das schöne Wetter müsse man nutzen. Bbloß wisse sie nicht wohin. Ob Jesús keine Empfehlung habe. Da im Unterricht ausschließlich spanisch gesprochen wurde, kannte er von Emily fast nur Ultrakurzsätze. In ihrer Muttersprache liefen die Sätze erstaunlich flüssig dahin. Indeed, er habe eine Empfehlung, antwortete er gnädigerweise auf Englisch. San José, zwei Autostunden entfernt, nahe Almería, in einem Naturreservat gelegen, sei einen Ausflug wert. »Der Ort ist zwar touristisch, viele Apartments, nur ohne …« Jetzt war es an ihm, der Fremdsprache keine Gewalt anzutun. »Ohne die üblichen, ähm, skyscraper.« Auf die Schnelle fiel ihm nichts Besseres ein, jedenfalls nicht die Übersetzung von Bettenburgen. San José liege an einer schönen kleinen Bucht. »Und um diese Jahreszeit ist da bestimmt noch nicht viel los.« Oh, das klinge gut! Darüber hätte sie gern mehr gehört, musste aber leider schon los. »Ich habe bei María Extrastunden gebucht, um ein paar grammatikalische Feinheiten zu wiederholen.« Feinheiten, sie hatte wirklich Feinheiten gesagt! Er konnte sich nur mit Mühe ein Grinsen verkneifen. Kaum war sie verschwunden, fiel ihm ein Begriff ein, der besser gepasst hätte. Zu spät. Er vertiefte sich wieder in die Zeitung, bis ihm nach rund einer Minute jemand auf die Schulter tippte. Emily. »No giant hotels!«, nutzte er die Chance. »No giant hotels, great, that’s fine, well …«, sie holte tief Luft, »and what are you going to do this weekend?« Madre de Dios, wie brachte man einem Gänseblümchen bei, was ein Korb ist? MITFAHRGELEGENHEIT | D-FRANKFURT/MAIN Die Woche ging ja gut zu Ende! Entnervt blickte Papandreou auf die Uhr. Jetzt telefonierten die beiden schon eine Viertelstunde. Sie fragte sich wieder einmal, womit die lebensmüde Alkoholikerin die Herren verhext hatte. Professionell war das Engagement von Markus und Dr. Lexied jedenfalls nicht zu nennen. Sie beratschlagten zum x-ten Mal, was man noch unternehmen könnte, um etwas über das Schicksal von Heydt herauszufinden. Zumindest auf Markus’ Seite handelte es sich um privates Engagement, denn offiziell lag der Fall weiterhin auf Eis. »Und?«, fragte sie mehr aus Höflichkeit, denn aus Neugierde, nachdem er aufgelegt hatte. »Nichts.« Anna Heydt habe sich weder bei den Anonymen Alkoholikern blicken lassen noch habe Triebel ein Lebenszeichen erhalten. »Dann kehren wir jetzt zu unserem aktuellen Fall zurück?«, schlug sie mit mühsam beherrschter Ungeduld vor. »Ja.« Engel warf einen Blick in die vor ihm liegende Akte, die neue Meilensteine der Perversion markierte. Meilensteine, unter denen die Seelen zweier Kinder beerdigt worden waren. »Gerade ist die DNA-Analyse reingekommen, alles wie vorhergesehen. Montag wollen die beiden sich im Steigenberger am Kaiserplatz treffen, da schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe.« »Zwei Schmeißfliegen!« Papandreou freute sich schon, dieses Ungeziefer im ArmaniAnzug einzufangen. Zumal es ihr erster gelöster Fall hier war, der erste Fall, den sie gemeinsam gelöst hatten, und das superfix. So weit, so gut. Ihrem eigenen Ziel war sie allerdings nicht nähergekommen. Die Tür ging auf, Degenhard. Er habe News! »Sie reisen nach Spanien, Markus. Na, wenn das nichts ist! Was sagen Sie?« »So?« Typisch Markus, nur keine Begeisterung zeigen, dachte Papandreou. Soweit sie wusste, war der »Kinderschänder-Ring« sein größter Fall, und nun durfte er ins Ausland, um neuen Spuren nachzugehen, und beließ es bei seinem typischen »so?«. »Wir spielen das Thema zunächst off-the-record.« »Wir spielen was?« »Wir handhaben das halboffiziell, sprich: als Informationsaustausch vor Ort.« »Wie kommt Dr. Strecker dazu, mich …« »Nein, nein, nicht Dr. Strecker, der ist im Urlaub. Die Entscheidung habe ich bei Brodhagen durchgedrückt. Die Kollegen in Madrid sind bereits gebrieft. Wenn Sie Montag einen Flieger erwischen …« »Ich fliege nicht.« »Wie, Sie fliegen nicht?« Engel war mal mit seinem Bruder Tom, der eine Privatpilotenlizenz besaß, in einer Cessna geflogen und da hatte die Sache beinahe Spaß gemacht. Aber er würde sich keineswegs in eine fliegende Röhre hocken, in der man nur durch ein seitliches Guckloch Verbindung zur Außenwelt hatte und nicht sah, was von vorne angeflogen kam. »Ich habe gern Boden unter den Füßen.« Verstand Degenhart. Er hatte selbst mit Zweifeln an der Flugfähigkeit von Blech zu kämpfen, vor allem beim Start, wenn sich das ›Flug-Zeug‹ mit aller Gewalt in die Höhe stemmte. Wie oft konnte der Kraftakt gut gehen? Diese Vorstellung trog, wusste er mittlerweile. Ein Pilot hatte es auf einem Seminar für »entspanntes Fliegen« erklärt. Von Hochstemmen konnte keine Rede sein, im Gegenteil: Das Flugzeug wurde förmlich hoch gesaugt. Denn die Luft hatte auf der gewölbten Oberseite der Tragfläche einen weiteren Weg zurückzulegen als auf der flachen Unterseite. Sie musste darum oben schneller fließen, was einen Unterdruck erzeugte, der die Maschine hochzog. Diese sachverständige Erklärung hatte ihn leidlich beruhigt. »Intelligente Menschen neigen zu Flugangst, insoweit verstehe ich Sie. Nur …« »Sparen Sie es sich. Ich fliege nicht.« »Na hören Sie mal, noch bin ich hier der Chef!« Papandreou musste dazwischengehen, sonst würden die beiden ihr diese unverhoffte Chance zerstören. »Wir könnten mit dem Wagen fahren«, warf sie ein. »Wir?« Degenhart sah sie erstaunt an. »Also, von Ihnen war eigentlich nicht die Rede, sorry.« »Wie das denn?«, tat sie verwundert. »Markus und ich, wir sind doch ein Team. Ich meine, das war doch Ihre Idee, Stefan!« Sie warf Markus einen schnellen Blick zu. Halt jetzt bloß die Klappe, dachte sie. »Liebe Kollegin, einer muss sich um den laufenden Fall kümmern«, konterte Degenhart. »Genau das meine ich ja, Stefan!« Sie blickte ihm in die Augen. »Als Team – als Team, Stefan! – haben wir den Fall bereits gelöst, Montag kann der Zugriff erfolgen!« »Ach so?« Degenhart war erfreut. Um sich gegen diesen widerlichen Strecker zu behaupten, konnten Erfolgsmeldungen nicht schaden. »Ja. Außerdem spreche ich spanisch«, bauschte sie ihre Hola-und-Olé-Kenntnisse ein wenig auf. »Genau das kann in einem fremden Land den Ausschlag über Erfolg oder Nichterfolg geben. Und das in diesem Fall, der damals durch die internationale Presse ging! Da einen Erfolg zu verbuchen, das wäre doch was oder etwa nicht?« Das wäre seine Beförderung. »Hm, hm. Wir müssen allerdings die Kosten im Blick behalten.« »Womit wir wieder beim Wagen wären«, bemerkte Engel ironisch. Die Aussicht, mit Anastasia zu fahren, gefiel ihm besser, als er sich eingestehen mochte. »Wenn Sie es mit einer Übernachtung schaffen. Wie weit ist es nach Toledo?« »Liegt im Landesinneren, etwas südlich von Madrid, es dürften rund zweitausend Kilometer sein.« »Ach, halt. Montag geht ja ein Dienstwagen zur Inspektion.« »Kein Problem, ich stelle meinen Wagen zur Verfügung«, konterte Engel. Degenhart kratzte sich am Kopf. Er fühlte sich zwar etwas überfahren, aber zurückrudern konnte er wohl nicht mehr. Nachdem er das Büro verlassen hatte, versicherte sich Anastasia, dass Markus einverstanden war. Er nickte. »Sie haben ja recht: Wir sind ein gutes Team.« Was sollte das jetzt sein? Ein Kompliment à la Engel? »Und Sie sprechen spanisch, Frau Kollegin?« »Geht schon«. Mit ein bisschen Show drum herum würde er hoffentlich nicht gleich merken, wie schnell ihre Vokabeln gezählt waren. »Hab ich in Südamerika gelernt.« Klang das nach Weltenbummlerin? Ihr war gerade danach, ein bisschen anzugeben. »Ich kann auch ein bisschen spanisch.« »Volkshochschule?« »Volks-hoch-schule wäre zu dick aufgetragen. Einfach nur Volksschule.« Sie verstand nicht. »Ich bin in Spanien zur Schule gegangen, bin da aufgewachsen, in der Nähe von Tarragona.« Ein derart breites Grinsen hatte sie noch nicht auf seinem Gesicht gesehen. »¿Cuando quiere marcharse, querida Señora Papandreou? ¿Qué piensa usted de mañana temprano?« Verdammt, er spuckte die Vokabeln aus wie ein Maschinengewehr. »Ähm, Sie meinen, ob wir morgen aufbrechen sollen?« »Más precisamente: morgen früh.« »Am Samstag?« »Así es. Wenn schon, denn schon!« RICHTIG KONJUGIERT | E-SAN JOSÉ San José zeigte sich von seiner freundlichsten, der sonnigen Seite, als sie am Samstagvormittag gegen elf Uhr ankamen. »Qué bonita«, arbeitete sich Emily mit kleinem Sprachschatz an großen Gefühlen ab. Selbst der »autostrada del sol« hatte sie viel Positives abgewonnen, was zumindest in die richtige Richtung wies, denn sie fuhren der Sonne entgegen, wenngleich die autostrada in Spanien autopista hieß. Jesús hatte es so stehen lassen, obwohl es ja eine kleine »Sprachreise« werden sollte. Mithilfe dieser Definition hatte er den Ausflug in eine schulische Exkursion umgedeutet. Allerdings drohte die Kommunikation anstrengend zu werden. Als sie ein Lokal mit einem Plätzchen gefunden hatten, das die Sonne bereits erreichte, vor sich einen Cortado und ein Bocadillo, gab er sich geschlagen. »Wir machen das besser folgendermaßen: Ich spreche spanisch, aber du darfst englisch sprechen, wenn du willst.« »Eine glänzende Idee!« Wären die Steine, die ihr vom Herzen fielen, im Wasser gelandet, es hätte einen Tsunami gegeben. »Ich fürchte, wir erfahren sonst überhaupt nichts voneinander!« Etwas voneinander erfahren? Jesús war sich nicht sicher, ob er das wollte. Er hatte einige Informationen über das Naturreservat aus dem Netz gefischt; davon wollte er erzählen. Obwohl er zugegebenermaßen ein wenig neugierig war, vor allem darauf, womit sie das Geld für einen mehrmonatigen Aufenthalt in Spanien verdiente. Nicht, dass ihn Geldfragen im Allgemeinen besonders interessierten. Nur konnte er sich bei Emily überhaupt keine richtige Erwerbstätigkeit vorstellen. Also fragte er sie. »Ach, das wusstest du gar nicht? Wir sind Kollegen, Jesús! Ich arbeite in Melbourne als Englischlehrerin.« Fast hätte er sich am Kaffee verschluckt. Sachen gab es. Statt eines Kommentars nickte er mit freundlichem, gewissermaßen kollegialem Interesse. »Und jetzt möchte ich schwimmen! Hast du nicht von einer Bucht gesprochen? Lass uns das Badezeug holen und hingehen!« Die kleine Bucht, die San José zu Füßen lag, war nicht spektakulär, aber hübsch, eingerahmt von einem kleinen Hafen und Häusern, die sich nach Osten einen Hang hinaufzogen. Emily gefiel sie jedenfalls. Entschlossen stapfte sie zum Felsüberhang am äußersten westlichen Ende, obwohl es an Platz nicht gerade mangelte, man konnte die Leute an den Fingern abzählen. Es überwog helle Haut, die sich kaum vom feinen Sand abhob und enthüllte, wie oft die Sonne in diesem Frühjahr durch Abwesenheit glänzte. Emily hingegen brachte, genau wie er selbst, einen Bronzeton zum Vorschein; offenbar hatte auch sie im engen Albaycín ein lichtes Fleckchen gefunden. Sie trug einen blaugrün gestreiften Bikini, weder brav noch gewagt, und ließ zu seiner Erleichterung das Oberteil an. »¡Vamos, vamos!«, feuerte sie ihn an, »the sea is waiting!« So lebhaft kannte er sie gar nicht. Wahrscheinlich würde sich ihre Begeisterung gleich abkühlen, wenn sie nämlich die Zehen ins Wasser steckte. Er sah ihr neugierig zu, wie sie vorausrannte, und staunte nicht schlecht: Emily sprang ohne zu zögern ins Wasser und tauchte unter. Er hinter ihr her. Zum Glück hatte er nicht geahnt, wie kalt das Wasser war. Die Spritzer auf der Haut piksten wie Nadelstiche. Gleich wird es besser, dachte er. Sie schwammen mit kräftigen Zügen aufs Meer hinaus und ihm wurde warm. Trotz der Schmerzen, mit denen sich die Rippenprellung bei jedem Armzug in Erinnerung brachte, hätte er ewig weiterschwimmen können. Sich freischwimmen! Das Wasser, der Himmel und er. Kein Brúto, kein Heidenheim, keine toten Eltern, nur er und das salzige Wasser und der blaue Himmel. »Das tut dir gut, nicht wahr?«, fragte Emily unvermittelt, als hätte sie seine Gedanken gelesen. »I LOVE …« Er verschluckte hustend und prustend einen Mundvoll Wasser – und den Rest des Satzes. Verdammt, jetzt bloß keine Missverständnisse. »… IT!« Sie sah ihn so aufmerksam wie verständnislos an. »The sea, swimming and …« Er wusste nicht weiter. »And the lightness of being.« Die Leichtigkeit des Seins, ja, das traf es. Wie war er bloß auf den blöden Gedanken verfallen, sie sei vielleicht in ihn verliebt? Und wieso fing er an, Englisch zu sprechen? Die Sonnenstrahlen tupften die Wassertropfen schnell von ihren Körpern, während sie auf ihren Badetüchern lagen. Sie scherzten und lachten, bis sich ihre Blicke im Himmel verloren. Nach einer Zeit des Schweigens spürte Jesús, wie seine Gedanken in der Schwere des Körpers versanken, einer Schwere, die ebenso wohltat wie die Leichtigkeit. Er schlief ein. Als er aufwachte, lag sein Gesicht im Schatten, die Sonne war ein gutes Stück nach Westen gezogen. Emily saß im Schneidersitz neben ihm und las ein Buch. »¿Sabes qué hora es?«, fragte er verschlafen. »Sí, son las quatro menos cuarto.« Sie grinste in dem Wissen, dass an ihrer Zeitangabe nichts auszusetzen war – außer, dass die Zeit viel zu schnell verstrich. Viertel vor vier schon. Jesús hörte seinen Magen knurren; Emily offenbar auch. »Ich habe Lust auf Eis«, sagte sie, »und da vorn ist eine Eisdiele, was meinst du?« Sie deutete auf ein Haus an der Strandpromenade. Er nickte. Erdbeereis! Er wollte jetzt eine große Portion davon. So lange, wie er keines mehr gegessen hatte, musste ihm ganze Generationen von Erdbeeren entgangen sein. Die Portionen fielen groß aus, der Erdbeeranteil eher klein. Egal, das Meer vor sich und eine leichte Brise auf der Haut, konnte man kein Erbsenzähler sein. Sie plauderten zweisprachig über Belanglosigkeiten, schlürften beide noch einen Cortado und machten anschließend einen Spaziergang durch den Ort. Die Sonne stand bereits ziemlich tief. »Wann wollten wir eigentlich zurück?« Natürlich würden sie hier zu Abend essen, entgegnete Emily. Jesús fragte sich, ob sie eher an australische Essenszeiten dachte, die er allerdings nicht kannte, oder an spanische, was hieß: nicht vor halb zehn. »Du müsstest dann zwei Stunden durch die Nacht fahren.« »Dunkel ist dunkel«, antwortete sie gleichmütig. Er müsse sich wirklich nicht sorgen, sie werde nicht am Lenkrad einschlafen, sie habe sich nämlich schon lange nicht mehr so gut gefühlt. Sie sagte es überzeugend, musste er zugeben. Das war eine ganz neue Emily. Er fühlte sich längst nicht mehr wie der Lehrer. Im Vorübergehen sahen sie im Innenhof eines kleinen Hotels eine Tischtennisplatte stehen. Plötzlich verschwand Emily im Hof. Kurz darauf kam sie mit Schlägern und Ball zurück. »Bekommen wir das hin?«, fragte sie erwartungsvoll. Jesús bekam es ganz ordentlich hin, Emily hingegen spielte, wie sie spanisch sprach, nur gelegentlich ein Treffer. Trotzdem machte es Spaß, sie lachten mehr, als dass sie spielten. Danach hatten sie Durst und tranken ein Bier. Emily wollte jetzt »Personen erraten«. Dschäisus solle sich eine geschichtliche Persönlichkeit überlegen, ihr lediglich sagen, ob männlich oder weiblich, tot oder noch unter den Lebenden. Er müsse ihre Fragen mit ja oder nein beantworten, und wenn sie den Namen vor dem zehnten Nein herausfinde, habe sie gewonnen, sonst er. Jesús entschied sich für Picasso, den sie locker erriet, sie sich dann für Mutter Teresa, die er nicht weniger schnell entlarvte, es folgten Federico García Lorca, Bruce Springsteen und Antonio Gaudí, schwieriger, aber kein Problem. Nur an der letzten Person biss er sich die Zähne aus, sie wollte in kein Raster passen. Als das zehnte Nein verbraucht war, grinste sie ihn an und sagte: »It’s Dschäisus, Dschäisus!« Eine Zeit lang blödelten sie über den doppelten Dschäisus, dann meldeten sich ihre Mägen wieder zu Wort. Zum Abendessen wollte sie ihn einladen. Das komme überhaupt nicht infrage, hielt Jesús dagegen. Emily schlug ihm einen Deal vor: Wenn er ihr einen Berg nennen könne, der ein Viertel größer als der K2 sei, dürfe er zahlen. Jesús schlug sofort ein. Da der K2 der zweithöchste Berg der Welt war, musste die Lösung Mount Everest lauten. Zu seiner Überraschung schüttelte Emily den Kopf. »Der K2 ist gut 8.600 Meter hoch, der Everest knapp 8.900. Ein Viertel größer ist er also nicht.« Jesús schaute irritiert. Es gab gar keine Lösung? Doch, stellte Emily klar. Der Mauna Kea, ein Vulkan auf Hawaii, sei gut 11.000 Meter hoch. »Der passt.« Ein Berg, höher als der Mount Everest, und Jesús hatte noch nie von ihm gehört? »Ja«, entgegnete Emily grinsend, »das liegt an unserer Wahrnehmung. Der größere Teil des Mauna Kea liegt nämlich unter Wasser. Weil wir es als Landgänger nicht so mit dem Wasser haben, ignorieren wir ihn einfach. Ich habe mal einen schönen Satz gelesen: Wenn wir Delfine wären, hieße die Erde Meer. – Gehen wir? An der Strandpromenade sind Fischlokale.« Sie entschieden sich für viele Kleinigkeiten: Avocado mit geräuchertem Fisch, frittierte Sardinen, mit Gemüsepüree gefüllte Tintenfischtuben, Patatas bravas und Tomatensalat. Dazu bestellte Emily eine Flasche Rotwein. Eine ganze Flasche? Er erinnerte sie an die 0,5Promillegrenze. Ach, sie werde nur nippen, und was übrig bleibe, könnten sie ja mitnehmen. Sie nippte wirklich nur, bei ihm wurde es etwas mehr. Mehr als gewöhnlich – worauf er sich später nicht herausreden sollte. Es war ein wunderschöner Abend am Meer, kühl zwar, doch sie hatten Jacken dabei, und der Wein und das leckere Essen wärmten auch und ihre angeregte Unterhaltung tat ein Übriges. Es war perfekt. Danach wurde es noch perfekter. Zu perfekt. Der kurze Spaziergang am Meer, ein paar Schritte zur Bewegung vor der Rückfahrt, war noch nicht das Problem. Dann aber blieb Emily vor einem Felsüberhang stehen und flüsterte ihm etwas zu. Er glaubte, seinen Ohren nicht zu trauen. Dieses Verb hatte sie nicht im Unterricht gelernt! Sie hatte es sogar richtig konjugiert. »¡Follame – por favor!« Sie sah ihn unschuldig an, als habe sie um ein Taschentuch gebeten. Wenn sie nicht wieder mal Vokabeln durcheinanderbrachte, bat sie ihn allerdings um etwas ganz anderes: »Fick mich, bitte!« Nein, sie hatte nichts durcheinandergebracht, spürte er an gewissen Handbewegungen über gewisse Körperregionen, nichts – außer ihren Lehrer. Nein! Oder jein? Wenn er ehrlich war, gefielen ihm ihre Bewegungen. Er hatte sofort verstanden, dass sie die ordinären Worte nicht ordinär meinte. Es handelte sich eher um eine Art Vertrauensbeweis. Klare Worte zu verklärtem Blick. Das Bild vom Gänseblümchen musste er wohl löschen und an das SchülerLehrer-Verhältnis wollte er zumindest vorläufig nicht denken. Sein Kopf hatte sowieso nichts mehr zu melden. Seine Chefin Esmeralda, die wegen des »Abhängigkeitsverhältnisses« jeden »intimen Kontakt« zu »Schülern« untersagte, würde nicht gerade hinter der nächsten Klippe Gestalt annehmen. Alles andere: nicht jetzt! Sie näherten sich einander spielerisch, beinahe unaufgeregt zunächst und mit Entschiedenheit später, und es gelang ihnen etwas viel Besseres als – ficken. Ihr Schweigen danach, sie sprachen kaum ein Wort, bis sie sich in Granada verabschiedeten, hatte nichts Bedrückendes, im Gegenteil. Jedenfalls empfand Jesús es so. »Miau!!!« Inga saß vor dem Hoftor und blickte beleidigt an ihm vorbei. Er nahm sie hoch und stupste seine Nase gegen ihre, was sie besänftigte. Sie gingen zu Bett. NACHTSCHWÄRMER | E-TOLEDO Brúto ahnte nichts Gutes, womit er vollkommen richtig lag. Er wollte bloß noch raus aus Toledo, das heiße Pflaster hinter sich lassen. Doch zuvor musste er ein paar Schulden eintreiben, ohne Kohle kam man ja nicht weit, und seinen Anteil aus dem Banküberfall hatte Paco als Schmerzensgeld einbehalten. Er heizte seinen Kunden gehörig ein und hatte bereits einen ordentlichen Betrag beisammen, als sie ihn sich krallten. Sie klingelten höflich – »der Hausverwalter« – und er öffnete brav. Vor ihm standen zwei hellhäutige Männer, der eine feingliedrig, schlank und blond, der andere ein grobknochiges Kraftpaket mit schwarzen, zu einem Pferdeschwanz gebundenen Haaren. Der Blonde sprach fließend spanisch, klang aber nach Lehrbuch, sprechende Druckerschwärze. Brúto registrierte es in den wenigen Augenblicken, die ihm für Beobachtungen noch blieben. Danach ging es sehr schnell. Er erzählte ihnen alles, wirklich alles, was er wusste, bevor das Kraftpaket auch nur die Hand heben konnte, beschrieb die beiden Männer, die ihn in die Mangel genommen hatten, und log lediglich auf die Frage hin, wofür das Geld sei, das sie auf der Klimaanlage gefunden hatten. Während er noch überlegte, ob sie ihm seine Erklärung abnahmen, geleitete ihn das Kraftpaket mit freundlicher Geste zum Balkon, hob ihn mit einer rührend sanften Drehbewegung über die Brüstung und ließ los. Diesmal flog Brúto wirklich. Für einen Moment fühlte er sich fast schwerelos, ein seltenes Vergnügen, das jedoch durch die Erwartung des Aufpralls gedämpft wurde. Es war auch nur von kurzer Dauer, weil sein Körper, Galileis Fallgesetz gehorchend, mit knapp 9,81 m/s beschleunigte. Die Erde sog ihn gierig in ihren Schoß zurück. Er fand nicht einmal die Muße, sich in die Hose zu machen. Statt seines Lebensfilms sah er, dass die Blumen im ersten Stock mal wieder gegossen werden mussten. Erster Stock schon? Es ging wirklich steil mit ihm bergab. Er raste auf ein Ende zu, das seines erbärmlichen Lebens würdig war. Als sein Körper auf dem Pflaster aufschlug, hatte er jedoch unglaubliches Glück: Es verging nahezu eine Sekunde, bis sich der gebrochene Zapfen des zweiten Halswirbels weit genug ins Innere des Wirbelkanals vorgeschoben hatte, um lebenswichtige Nervenbahnen zu durchtrennen. Und diesen kurzen, in Schmerzen getränkten Augenblick investierte Brúto mit großer Besonnenheit in die Zukunft: Er bat den lieben Gott um die Vergebung all seiner Sünden. Engel und Papandreou kamen am Sonntagnachmittag in Toledo an. Von Brútos Absturz wussten sie bereits. Am Busbahnhof trafen sie ihren Kontaktmann, einen Deutschen, der bei der spanischen Kriminalpolizei arbeitete. Ein untersetzter Mann mit Kinn- und Oberlippenbart. Der aus der Hose gerutschte Hemdzipfel gab den Blick auf einen Bierbauch frei. »Hoffentlich ermittelt er nicht, wie er aussieht«, kommentierte Engel die Erscheinung. Der Mann kam näher und streckte seinen grinsenden Schädel durchs Wagenfenster. »Hola, compatriotas, na, alles roger in Kambodscha? Donnerlittchen, das nenn ich ma ’ne hübsche Kommissarin! Korbinian Kuhlmann von der Policía Nacional in Madrid. Meine Freunde nennen mich aber nur Corbi. Also Corbi, bitte. Und immer gern zu Diensten.« Er zwinkerte Anastasia zu. »Dann fahrt mir ma hübsch nach, ich weiß, wo’s langgeht.« Es ging die Straße hinunter zu einer Cervecería, einer Bierbar. »Hätte ich mir denken können, dass bei dem alle Wege zur Tränke führen«, meinte Engel bissig. Unwillig hörte er Kuhlmanns sinnfreiem Gerede zu. Er wollte endlich zum Tatort! Klar, da gingen sie ja gleich hin, nur die Ruhe, beschied ihn »Corbi« mit jovialem Desinteresse und wandte sich wieder Anastasia zu, die allerdings nicht länger mitspielte. Es sei jetzt Zeit, an die Arbeit zu gehen, entschied sie, und rief nach dem Kellner. Der Tatort befand sich gleich um die Ecke. Lässig gegen einen Fensterrahmen gelehnt, sah Kuhlmann zu, wie Engel die Wohnung nach Beweisstücken absuchte. Währenddessen fasste er den Stand der Ermittlungen zusammen: »Der Brúto is polizeibekannt, ein gewerbsmäßiger Krimineller mit Hang zu miesen kleinen Geschäften. Is hier sang- und klanglos übers Balkongeländer gesegelt, keine Zeugen, keine Spuren. Interessanter is die andere Adresse, so ’n Touri-Apartment in der Altstadt. Da ham wa Blutspuren gefunden. Und ein der Länge nach durchgeschnittenes Bettlaken, das dem Augenschein nach verknotet gewesen ist.« »Vielleicht, um eine Wunde zu verbinden?«, dachte Papandreou laut nach. »Nö, keine Blutspuren dran. Das Blut is übrigens nicht von Brúto, ham wir schon gecheckt. Hier ham meine Kollegen jedenfalls null Interessantes entdeckt. Außer den knapp tausend Mäusen auf der Klima. Mal unter uns Pastorentöchtern: Schade, dass wir die nich gefunden haben, was?« Er grinste auf eine Art, für die Engel sich einen eigenen Straftatbestand gewünscht hätte. »Ein Koffer mit Klamotten – war die ganze Ausbeute. Könnt ihr vergessen, alles Klärchen?« Engel ging in die Knie, um unter dem Heizkörper nach Spuren zu suchen, wobei sein Blick auf Kuhlmanns Schuhe fiel. Das Modell kam ihm bekannt vor, so eins hatte er sich auch mal übers Internet bestellt, eine spezielle Konstruktion mit »unsichtbarem Absatz« – einer inneren Rampe, die einem kurz geratenen Homo erectus ein paar Zentimeter Sicherheitsabstand zur Zwergenzone brachte. Eine neuzeitliche Hilfe für altsteinzeitliche Bedürfnisse also. Er hatte sie ausprobiert, sich auf den Ministelzen aber affig gefühlt. Er bedachte Kuhlmann, diesen hochgestellten Affen, mit einem Grinsen. »Gibt es Hinweise auf Fremdeinwirkung? Hämatome? Kampfspuren?« »Jetzt mach ma keine Thermik«, wies ihn Kuhlmann zurecht und richtete sich unter Zuhilfenahme seiner Ministelzen zu voller Größe auf. »Et is Wochenende, schon vergessen? Freu dich, dass ich die Empfangstante gebe. So sind wir Spanier, hilfreich, wo es geht. Wenn du allerdings glaubst, wir treten in Reih und Glied an, nur weil ein deutscher Beamter pfeift, dann haste dich geschnitten. Brúto liegt on the rocks, für den ist Ende Gelände, der läuft nicht mehr davon. Claro, Herr Deutschländer?« Damit sind die Fronten zwischen uns geklärt, dachte Engel. Er fragte so sachlich wie möglich, ob die erste Inaugenscheinnahme der Leiche Auffälligkeiten gezeigt habe. »Auffälligkeiten? Wenn man geröstete Eichel und Blutwurst nich für normale Delikatessen hält, dann schon.« Engel schaute verständnislos. »Ich weiß ja nicht, was für ein Perversling Brúto war. Vielleicht hat er selbst an seinem besten Stück rumgekokelt; unser Rechtsmediziner glaubt’s eher nicht. Brúto müsste dann nämlich auch über die seltene Gabe verfügen, sich sein eigenes Knie in die Eier zu rammen.« »Hämatome und Verbrennungen im Genitalbereich, habe ich das richtig verstanden?« »Bingo. Dazu weitere Hinweise auf eine Misshandlung, Herkunft und Zeitpunkt unklar. Nix Genaues woas ma ned. Muss die Obduktion klären.« »Und hier in der Wohnung gibt’s überhaupt keine Spuren?« »Fingerabdrücke, die nicht von Brúto sind. Werden Montag abgeglichen. Das war’s.« Bewohnt wirkte die Wohnung tatsächlich nicht, musste Engel zugeben. Er suchte verbissen nach einem Strohhalm. Anastasia überprüfte das Bad und kam bald kopfschüttelnd zurück. »Nicht mal eine Zahnbürste. Und bei Ihnen?« Nein, er hatte auch nichts. Mit einer ratlosen Bewegung blätterte er durch das Telefonbuch. Das Zettelchen hätte er übersehen, wäre es nicht herausgefallen. Steckte da wahrscheinlich schon eine Ewigkeit. Er warf einen Blick darauf. Es handelte sich um eine Quittung über ein Telefonat, erst kürzlich von einem Internetcafé ausgestellt. Als die drei das Haus in der Calle de Panamá betreten hatten, waren sie Brútos Mördern nur um ein paar Meter zuvorgekommen. Die beiden wollten noch mal zum Tatort, weil sie einen Fehler begangen hatten: Sie hätten sich von Brúto einen Nachweis zeigen lassen müssen, dass er die Notfallnummer von einem fremden Anschluss angerufen hatte. Würde die Polizei, sollte sie den Beleg finden, etwas damit anfangen können? Nein, nicht anzunehmen. Es gab Dringenderes zu tun, entschied der Blonde, dessen Tarnname schlicht »S« lautete, und der hier der Boss war, der Denker. Den nötigen Durchblick hatte er sich bereits verschafft. Die wenigen Hinweise auf den Alten, der Brúto in die Mangel genommen hatte, erlaubten zwar keine Rückschlüsse. Doch den würden sie schon noch identifizieren. Denn um wen es sich bei dem anderen Mann handelte, wusste S nur zu gut. Jesús Mirandor, den kannte man. Und um den würden sie sich jetzt kümmern. Allerdings nicht auf dieselbe Weise wie um Brúto, dazu war er zu kostbar. »Wir fahren nach Granada«, informierte er Mikki, seinem Handlanger. »Mal sehen, wie wir das Jesuskind auf andere Gedanken bringen.« So wenig er Kuhlmann auch mochte, hätte Engel doch nicht die Kaltschnäuzigkeit besessen, ihm einen Korb zu geben, als er vorschlug, gemeinsam zu Abend zu essen; immerhin war der Mann extra wegen ihnen aus Madrid angereist. Anastasia besaß sie aber, diese Kaltschnäuzigkeit. »Schrecklich gern, nur heute müssen wir noch was tun, du weißt schon, die Deutschen und die Arbeit«, hatte sie Corbi den Korb locker vor die Füße gestellt. »Morgen Abend ganz bestimmt.« Corbi konnte sich natürlich ausrechnen, dass sie dann schon wieder auf der Heimreise wären, sollte sich nicht noch etwas Überraschendes ergeben. Gegen Mitternacht fragte Markus Anastasia, ob sie eigentlich immer derart kaltschnäuzig reagiere, wenn ihr etwas nicht in den Kram passe. »Nein. Bloß wenn ich einen sehr, sehr guten Grund dafür habe. Hatte ich?« Sein Blick kreiste über das Sammelsurium am Boden, aus dem ihr seidenweiß schimmernder Stringtanga selbstbewusst herausstach. Mit einer Kollegin war er noch nie ins Bett gestiegen. Er hatte überhaupt schon lange mit keiner Frau mehr geschlafen. Er ging gelegentlich – nein selten, sehr selten, vielleicht zwei Mal im Jahr – zu Kailinh, einer netten, schon etwas älteren Taiwanerin, deren Ganzkörpermassage wirklich keine Zone ausließ. Aber mit Kailinh schlief er nicht, er erlaubte sich nicht mal einen Samenerguss, diese Intimität wollte er weder ihr noch sich zumuten. Doch hatte er nicht etwa mit Anastasia geschlafen, weil er ausgehungert war. Nicht mit einer Kollegin. Und schon gleich gar nicht mit jemandem, den er so mochte wie sie. Anastasia lag quer auf dem Bett, den Kopf auf seinem Schoß. Es gab ihm ein gutes Gefühl, dass sie sich nicht plötzlich ihrer Nacktheit schämte. »Hatte ich?« »Ähm, was?« Er hatte nicht richtig zugehört. Wie um sich zu entschuldigen, massierte er ihre Brust. »Vergiss es. Geht es dir gut?« Wie ging es ihm? Er fand Anastasia atemberaubend attraktiv und fühlte sich – beglückt. Irgendwann während des Abendessens hatte er ungläubig zu ahnen begonnen, auf welchen Höhepunkt des Tages sie zusteuerte, und sich zu seiner eigenen Überraschung fallen lassen; und es war beileibe keine Bruchlandung geworden. Zwischendurch hatte er sogar vergessen, den Bauch einzuziehen. Ja, er fühlte sich beglückt und störte sich nicht einmal an der berüchtigten »Zigarette danach«, mit der sie ihm gerade das Zimmer vollqualmte. »Es geht mir gut, ja.« Seine Stimme klang rau, doch es war die richtige Art Rauheit. »Ich mag dich sehr, Anastasia.« Er mochte sie sehr? Geh mal in die Vollen, du kannst es doch, haben wir gerade erst erlebt! »Ich mag dich auch sehr«, sagte sie und verdrehte dabei die Augen. Dann drehte sie sich um die eigene Achse, bis sich ihr Gesicht vor seinem Schoß befand. »Ich mag wirklich jeden Zentimeter an dir«, sagte sie, lachte und ließ ihn spüren, welche Zentimeter sie gerade besonders meinte. BLINDE KUH | E-GRANADA Am Montagmorgen erschien Emily nicht zum Unterricht. Jesús wusste nicht, ob er alarmiert oder erleichtert sein sollte. In der Pause ging er auf die Terrasse. Sein Blick schweifte über die Häuser des Albaycín. Irgendwo dort wohnte sie. Ob sie krank im Bett lag? Dreißig Minuten später betrat Esmeralda das Klassenzimmer. Sie wollte Jesús sprechen und zwar sofort. Er gab seinen Schülern eine Übungsaufgabe und ging ihr mit kleinstmöglichen Schritten und größtmöglichem Unbehagen hinterher. In ihrem Büro nahm sie am Schreibtisch Platz. Sie saß dort wie hinter einer Richterbank. Bald darauf verließ Jesús das Büro wieder und begab sich ins Klassenzimmer, wo seine Kollegin María bereits seinen Platz eingenommen hatte. Sie reichte ihm seinen Rucksack mit einer entschuldigenden Geste, die er mit einem freundlichen Nicken beantwortete. Er lächelte seinen Schülern aufmunternd zu und ging. Auf Nimmerwiedersehen. Er verstand die Welt nicht mehr. Im einsetzenden Nieselregen ließ er sich den Hügel zur Plaza Nueva in der Innenstadt hinuntertreiben. Dort setzte er sich an einen Tisch, den eine Markise halbwegs schützte. Er bestellte einen trockenen Rotwein. Der Kellner lächelte und hielt eine Hand in den Regen. »Natürlich einen trockenen, nass wird er ja von selbst.« Jesús hätte ihm auch gern ein Lächeln spendiert, hatte aber gerade keins übrig. Er zog die Jacke enger an den Körper, ihn fröstelte. Was nicht nur am Wetter lag. Er fühlte sich von innen kalt. So kalt, als wäre in seinen Eingeweiden eine Eiszeit ausgebrochen. Er verstand überhaupt nichts mehr. Außer, dass Emily verschwunden war. Esmeralda hatte ihr siebter Sinn, der fürs Geld nämlich, nicht getrogen, als sie morgens einen unfrankierten, an »Escuela Escobar, Jesús (profesor)« adressierten Umschlag im Briefkasten gefunden und gelesen hatte. Von bösen Vorahnungen getrieben, war sie zu Emilys Wohnung geeilt. An deren Stelle hatte die Vermieterin geöffnet und ihr berichtet, Emily habe ihr den Wohnungsschlüssel in den Briefkasten geworfen. Sie sei offenbar abgereist – obwohl sie gerade erst für den kommenden Monat bezahlt hatte. Glückliche Vermieterin. An Esmeralda hatte Emily leider noch keinen Cent für den kommenden Monat gezahlt. Ein Gewinneinbruch, den Jesús zu verantworten hatte, so viel war Esmeralda bei allen Unklarheiten klar. Was auch immer der seltsame Brief bedeuten solle, zeige er jedenfalls, dass Jesús was mit der »kleinen Australierin« am Laufen hatte. »Wenn du glaubst, du kannst auf meine Kosten deinem billigen Vergnügen nachgehen, dann täuscht du dich gewaltig!«, hatte sie ihn angeherrscht. Jesús wehrte sich nach Kräften gegen die zutreffende Unterstellung, doch sie würgte ihn ab. Er habe gegen die Vertragsvereinbarung verstoßen und nun erstens die Klappe zu halten, zweitens sein Zeug aus dem Unterricht zu holen und drittens schleunigst und für immer zu verschwinden, basta, Ende der Durchsage. Er holte den Brief hervor und las die zwei englischen Sätze noch einmal in der Hoffnung, endlich den Sinn zu verstehen. Jesús, wenn ich mehr über dich gewusst hätte, wäre es nie dazu gekommen. Ich bedauere es! Was denn gewusst? Und wie hatte sie, was immer da zu wissen sein sollte, in so kurzer Zeit herausgefunden? Und warum hatte sie es nicht mit ihm ausgemacht? Diesen kryptischen Brief in den Schulbriefkasten zu stecken, ohne auf die Idee zu kommen, er könne in falsche Hände geraten, war auch für Emilys Verhältnisse zu viel der Unbedarftheit! Langsam wich die Empörung der Trauer. Weil er seine Schüler schon jetzt vermisste. Weil schon wieder ein Lebensabschnitt, ein Beruf, an dem sein Herz hing, zu Ende war. Die Aussicht, an einer anderen Sprachschule eine Anstellung zu ergattern, ging gegen Null. Er straffte sich. Zumindest musste er es versuchen. Nur nicht aufgeben. Auf dem Weg nach Hause meldete sein Handy den Eigang einer SMS: »Ruf an. C.« Die Rufnummer unterdrückt. Carlos? Er betrat eine Telefonzelle und wählte dessen Nummer. »Jesús, wegen der SMS.« Wie sehr er sich an Carlos’ Kurzfassungen gewöhnt hatte. »Du erinnerst dich an den Offizier, von dem B gesprochen hat? Ich habe den Namen.« Jesús verschlug es die Sprache. Carlos hatte diesen Mann ohne besondere Merkmale nach über dreißig Jahren ausfindig gemacht? Was war los mit ihm, besaß er übernatürliche Kräfte? Wahrscheinlich durfte er ein bisschen Begeisterung erwarten, aber Jesús brachte nur ein trockenes »Wie denn das?« heraus. »Wie ich was rauskriege, ist meine Sache. Willst du den Namen wissen oder nicht?«, knurrte der Meister. »Nein.« Schweigen in der Leitung. Carlos war offenbar nicht weniger überrascht als er selbst. »Wieso nicht?« »Weil ich es leid bin, von einem Geheimnis ins nächste gejagt zu werden. Ständig will jemand Blindekuh spielen und immer bin ich die Kuh.« »Hm. Verstehe … Ich kenne den Mann von früher.« »Und wie bist auf den gekommen? Brúto konnte den doch gar nicht beschreiben!« »Falsch. Man muss nur richtig zuhören. Punkt A: Der Mann war Offizier, vermutlich Major. Punkt B: Er war damals wahrscheinlich nicht allzu weit von Toledo stationiert. Punkt C: Er hat mit Kriminellen kooperiert. Punkt D: Hat ständig ›zack, zack‹ gesagt. Punkt E: Er ist auffallend groß.« »Über die Größe hat Brúto gar nichts gesagt.« »Hat er. Erstens: Brúto ist gut eins sechzig. Zweitens: Er hat mit ausgestreckten Armen fast an die Holzdecke des Hauses gereicht. Macht circa zwei Meter Höhe. Drittens: Der Offizier konnte über die Grundmauer blicken. Wenn man das alles verrechnet, kommt man auf mindestens eins neunzig. Der gesuchte Mann ist demnach auffällig groß.« »Trotzdem …« »Ich kannte einen außergewöhnlich großen Offizier. Konnte mir Zugang zu seiner Militärakte verschaffen. Der Mann ist eins sechsundneunzig, wurde 1974 zum Major ernannt und leistete 75 seinen Dienst in Madrid, also ganz nah dran.« »Und woher kennst du den?« »Weißt du längst. Ich habe auch gedient.« »Unter Franco.« »Nein, unter dem Kaiser von China.« »Daher deine Befragungsmethoden.« »Haben die dir nicht in den Kram gepasst?« Der Hinweis versetzte Jesús einen Stich. »Für mich war das eine Ausnahme … in Notwehr. Für euch war es die Regel!« »Für mich war es auch die Ausnahme. Nur dass die Ausnahme die Regel war.« Was sollte das werden, eine philosophische Diskussion mit einem von Francos Schergen? »So ein Unsinn! Ich versuche mich gewaltlos durchs Leben zu schlagen …« »Dummkopf. Wir leben nicht im Goldfischteich, sondern …« »Im Haifischbecken, ist es das?« »Fressen oder gefressen …« »Du Heuchler! Die Haie, mit denen ihr eure Brutalität entschuldigt, seid ihr doch selbst!« »Du hast recht.« »Natürlich hab ich …« »Und Unrecht. Das ist wie beim Huhn und dem Ei: Schwer zu sagen, was zuerst da war.« »Ihr habt Menschen verfolgt und gefoltert – und das mit offenen Fragen über Hühnereier gerechtfertigt?« »Du übertreibst. Die meiste Zeit war das ganz normale Polizeiarbeit. Kein großer Unterschied zu heute.« Jesús ließ sich nicht abbringen. »Vielleicht muss man sich gar nicht die Mühe machen, über Huhn und Ei zu grübeln. Vielleicht reicht ja ein Blick in eure Mörderseelen.« »Hör auf!« Eine Pause trat ein. Zu Jesús’ Überraschung beendete Carlos das Schweigen schließlich mit einem geradezu menschlichen Seufzer. »Ich habe damals an das geglaubt, was wir taten. Ich war Katholik und meine Kirche hatte Franco den Segen gegeben. Ich habe es als Kampf gegen den Teufel betrachtet. Da war jedes Mittel recht, ausnahmsweise auch Folter. Obwohl, für mich war das eher – Heilige Inquisition.« »Wie man sich alles schönreden kann.« »Ja.« »Und weshalb willst du deinen Glaubensbruder ans Messer liefern?« Sarkasmus war Jesús eigentlich fremd. Aber es veränderte sich gerade einiges. »Der Major gehörte nicht zu den Glaubensbrüdern. Für einen guten Katholiken habe ich ihn jedenfalls nicht gehalten. Nur ein Gefühl, aber …« »Ach, und du bist ein guter Katholik?« »Ich bin jetzt überhaupt nichts mehr. Lassen wir das. Was ich sagen wollte: Habe jetzt herausgefunden, dass er gezockt hat. Solche Leute stehen gewöhnlich unter finanziellem Druck, sind erpressbar. Passt also auch ins Bild.« »Und du bist dir sicher?« »Habe soeben mit einem alten Kameraden geplaudert. Der Mann hatte wirklich die Marotte, ständig ›zack, zack‹ zu sagen, zumindest eine Zeit lang.« »Dürfte wohl nicht der Einzige gewesen sein, der es zackig mochte.« »Ist nicht dasselbe.« »Und du weißt, wo er wohnt?« »Versteckt sich am Meer.« »Wieso verstecken? Droht dem denn eine Verurteilung wegen der Sachen von damals?« »Wohl kaum. Vielleicht lebt er da heute, weil er früher nicht da gelebt hat.« »Du meinst, er hat die Uniform gegen eine weiße Weste getauscht.« »Hast du was zu schreiben?« Jesús knurrte etwas in den Hörer, hin und her gerissen, ob er die Daten haben wollte oder nicht. Eigentlich wollte er sie nicht. Aber uneigentlich konnte man nie wissen. »Ich höre.« »Vorname: Pepe. Nachname – ich buchstabiere: F … A … R … D … O … M …E, Betonung auf dem A. Adresse: Tarragona, Passeig Maritim Rafael de Casanovas 3.« »Wieso machst du dir eigentlich die ganze Mühe mit mir? Was hast du davon? Bei mir ist nichts zu holen, weißt du doch, ich bin pleite!« »Ich helfe, sonst nichts.« »Glaube ich nicht!« »Musst du nicht.« »Ach, komm schon, erzähl mir nichts! Sag endlich die Wahrheit! Du steckst da mit drin …« Tut … tut … tut. Stöhnend legte Jesús auf. Nahm das denn nie ein Ende? Wieso hatte Carlos sich gemeldet? Spielte er ein doppeltes Spiel? Wollte er ihn noch tiefer in die Geschichte hineinziehen? Ohne es zu bemerken, ging er seinen gewohnten Weg Richtung Schule. Vor dem Eingang hielt er überrascht inne. »VERDAMMTE SCHEISSE!« Sein Fluchen wurde auf der anderen Seite der Tür mit einem Miauen beantwortet. Bestimmt war Inga gegen vier gekommen, um ihn abzuholen, und hatte in den Klassenzimmern nach ihm gesucht. Kurz entschlossen klingelte er und murmelte etwas Unverständliches in die Sprechanlage. Die Tür wurde entriegelt und Inga kam heraus. Sie gingen nach Hause. Jesús fühlte sich unglaublich müde. BLÖDE KUH | E-TOLEDO »Holla, die Waldfee, bist heute ja noch schöner!«, begrüßte Kuhlmann Anastasia am Montagmorgen auf der Plaza de Zocodover. Engel sollte sich wohl mitbegrüßt fühlen. Dem war es egal. Nein, es war ihm nicht bloß egal, es gefiel ihm sogar, den Rivalen im Schweiße seines Angesichts, und das wortwörtlich, vergebens baggern zu sehen. »Gibt es Neuigkeiten von der Obduktion?«, ging er zum geschäftlichen Teil über. »Unser Markus hat schon wieder nur die Arbeit im Kopf, was?«, wandte sich Kuhlmann an Anastasia. »Ehrlich gesagt: Mir geht’s genauso, Corbi. Führe uns mal vor, was ihr hier in Spanien draufhabt.« »Na gut, pak ’n ma’s.« »Noch was, Corbi, dein Hemd ist aus der Hose gerutscht. Steckst du es bitte rein? Wie soll sich eine Frau konzentrieren, wenn sie deinen Bauchnabel vor sich sieht?« Kuhlmann spürte, wie seine Birne rot anschwoll – und wie Engel ihn amüsiert beobachtete. Eilig stopfte er die Hemdzipfel in den Hosenbund, wo sie nicht lange bleiben würden, angespannt, wie die Lage da war. Er sammelte sich. »Insgesamt ist das Verletzungsbild diffus. Die Rechtsmedizin hat weitere Spuren von Gewalteinwirkung identifiziert, und zwar Faserrisse in der Nackenmuskulatur und den Achseln, zwei Hämatome am Hinterkopf und Einblutungen an den Handgelenken. Sie sind jedoch, wie die Verletzungen im Genitalbereich, mindestens vierundzwanzig Stunden vor Brútos Absturz entstanden. Was seinen Tod betrifft, gehen wir von Fremdeinwirkung aus. Unsere Kriminaltechnik ist sich nämlich so gut wie sicher, dass Brúto mit dem Rücken voran übers Geländer gegangen ist, was eine völlig untypische Selbstmordhaltung wäre.« »Und ein Unfall kommt nicht in Betracht?«, hakte Anastasia nach. »Wir haben Brútos Beinlänge und die Höhe des Balkongeländers vermessen. Fazit: Seine Beine sind zu kurz, um sich ohne Weiteres aufs Geländer zu setzen. Er hätte sich mit den Armen hochstemmen müssen, eine ziemlich wackelige Geschichte. Äußerst unwahrscheinlich. Ich habe noch eine interessante Neuigkeit. Dein Freund, Markus, also der Tippgeber, Sanchez Mirandor …« »Er hat einen Doppelnamen?«, wollte Anastasia wissen. »Die Spanier haben alle Doppelnamen«, erklärte Markus. »Im Alltag benutzt man allerdings meist bloß einen.« »Normalerweise den vorderen«, präzisierte Corbi. »Es sei denn, es handelt sich um einen Allerweltsnamen. Kennst du Pablo Ruiz? Doch, kennst du, nur unter seinem anderen, dem zweiten Nachnamen: Pablo Picasso. Wie sollte sich ein Genie auch mit einem Popelnamen zufriedengeben. Zurück zu Mirandor. Die Blutspuren in Brútos Altstadtapartment stammen nicht von ihm. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, woher wir Mirandors Blutgruppe überhaupt kennen. Und das ist der interessante Punkt: Mirandor ist nicht unbekannt bei uns. Und ich meine jetzt nicht als Opfer. Er stand vor Gericht, weil er mehrere Patienten um die Ecke gebracht haben soll – wusstet ihr das?« Markus registrierte Anastasias fragenden Blick. Nein, das hatte er nicht gewusst. Mirandor – ein Mörder? Das konnte er sich schwer vorstellen. »Er hat in einem Krankenhaus in Málaga gewütet, wahllos Gift verspritzt, glaubt zumindest die Staatsanwaltschaft.« Mirandor hatte auf der Station für septische Chirurgie als Pfleger gearbeitet, berichtete Kuhlmann. 1999 kam es zu zwei Todesfällen nach relativ leichten OPs. Daraufhin fand eine Revision statt: In vier von sechs vergleichbaren Fällen lautete die Todesursache Atemstillstand. »Ein Indiz, aber kein Beweis, zumal es keine Hinweise gibt, wer gegebenenfalls dahinter steckt. Dann kollabiert ein Patient nach einer Hämorrhoiden-OP im Aufwachraum und die Sache kommt in Fahrt. Der Mann kann in letzter Sekunde vorm Erstickungstod gerettet werden. Die entnommenen Blut- und Urinproben bringen keinen auffälligen Befund, wohl aber die Untersuchung eines eingetrockneten Tropfens neben dem Einstich.« Es handelt sich um Suxamethonium, ein Muskelrelaxans, das in der Anästhesie zur Narkose-Einleitung gebraucht wird und in Überdosis zum Atemstillstand führen kann. Die Eignung als Mordwaffe steht außer Frage, denn Suxamethonium ist bereits nach kurzer Resorptionszeit nicht mehr im Körper nachzuweisen. Zunächst steht allein eine OP-Schwester unter Verdacht, die zur fraglichen Zeit Dienst im Aufwachraum tat. »Bald stellt sich jedoch heraus, dass Mirandor kurz vorher einen Patienten dort abgeholt hat. Weitere Verdächtige gibt es nicht, wenn man Mirandors Aussage ausklammert, er habe im Aufwachraum eine unbekannte Person gesehen, was ihm keiner abnimmt. Er macht sich damit erst recht verdächtig.« Anhand der Dienstpläne versucht man zu rekonstruieren, ob einer von beiden bei allen Verdachtsfällen zugegen war. Fehlanzeige. Die Staatsanwaltschaft lässt sich nicht beirren. Sie erklärt die Diskrepanzen mit mutmaßlichen Fehlern in der Dienstplandokumentation, wogegen sich das »hospital del horror«, wie es die Presse getauft hat, verwehrt: Hier mag gelegentlich gemordet werden, aber nicht geschlampt! Die Verdächtigen, beide bis dato unbescholten, beteuern ihre Unschuld. Als die Presse ein Bild der Schwester veröffentlicht, nimmt sie sich das Leben. In ihrem Abschiedsbrief beschwört sie ein letztes Mal, sie habe niemandem etwas zuleide getan, und endlich glaubt ihr die Staatsanwaltschaft – de mortuis nihil nisi bene. Sie klagt Mirandor an. »Euer Freund muss einen verteufelt guten Anwalt gehabt haben. Ich meine, er stand mit einem Bein im Knast. Aber wie das so ist bei gewieften Winkeladvokaten, die finden Schlupflöcher, wo keine sind. In diesem Fall hat er wahrscheinlich der Schwester die Schuld untergeschoben, die lag ja unter der Erde und konnte die Klappe nicht mehr aufmachen. Das Ende vom Lied: im Zweifel für den Angeklagten. Nennt man nicht gerade einen Freispruch erster Klasse. Also, wenn ihr mich fragt, hast du uns einen ziemlich zwielichtigen Kronzeugen angeschleppt, Markus!« »So?« Engel überhörte die Provokation. Er musste das erst sacken lassen. »Wenn so ein finsterer Geselle …« »Mirandor ist kein finsterer Geselle, Quatsch!« »Was ich sach, is Quatsch, ja? Der deutsche Kollege weiß es also besser.« Kuhlmann tat ärgerlich, doch Anastasia nahm es ihm nicht ab. Irgendwas hatte der Kerl in der Hinterhand. »Wie heißt das noch – am deutschen Wesen soll die Welt genesen? Da muss ein lausiger Spanier wohl dankbar sein, wenn so ’n deutscher Tiefblicker kommt, um ihn aufzuklären, nä, is klar. Da können wir Leichtgewichte von Südländern nur mit den Ohren schlackern, was sagst du, Anastasia?« »Für Mirandor lege ich meine Hand ins Feuer!«, ließ Engel sich hinreißen. Du Schwachkopf manipulierst mich nicht, dachte er grimmig, während Kuhlmann zufrieden dachte, dass es besser lief als gedacht. »Dann hör mir ma gut zu. Ich habe deinen Mirandor nich ohne Grund überprüft, bin ja kein Hornochse. Ich hatte sogar einen ziemlich triftigen. Er war nämlich auch am Tatort! Wir haben seine Fingerabdrücke in beiden Unterkünften gefunden. Und jetzt kannste deine Hand für ihn ins Feuer legen!« Er schnippte sein Feuerzeug über den Tisch. Engel schwieg konsterniert. Mit der Málagageschichte und den Fingerabdrücken gab es nun schon zwei belastende Indizien. Warum hatte Mirandor ihm lediglich die Adresse in der Altstadt genannt? Von einer Calle de Panamá war definitiv keine Rede gewesen. »Hör mir mal zu, Herr Boah-bin-ich-cool-Mann!« Die Schärfe in Anastasias Stimme riss Markus aus seinen Gedanken. Was kam denn jetzt? »Wenn du hier einen Hahnenkampf aufführen willst, spar’s dir! Jedenfalls, wenn’s dabei um mich geht. Ich bin an dir Gockel definitiv nicht interessiert, kapiert? Noch so ein Ich-habda-was-in-petto-Spielchen und das war’s mit unserer Zusammenarbeit!« Erst wurde Kuhlmann rot, dann Anastasia. Letztere, als Markus sie unterbrach, er wisse ihren Beistand zwar zu schätzen, sich aber selbst zu helfen. »Okay, Kuhlmann, da hatten Sie Ihren Spaß«, sagte er ruhig. »Gern geschehen. Und nun ist gut. Mich würde interessieren, wo Brúto so kurz vor seinem Tod angerufen hat. Was sagen Sie, finden wir zusammen heraus, was hinter der Quittung steckt?« »Ja, klar.« Anastasia glaubte, ihren Ohren nicht zu trauen. Da kriegten sich die Gockel mir nichts, dir nichts, wieder ein, und sie stand wie eine blöde, womöglich hysterische Kuh da? Auch Kuhlmann glaubte seinen Ohren nicht zu trauen, als er nämlich hörte, wie flüssig sich Engel beim Zahlen mit der Kellnerin unterhielt. Er meinte, einen katalanischen Akzent herauszuhören. »Das haste nich im Urlaub gelernt.« »Nein. So unglaublich es ist, Kuhlmann, wir haben etwas gemeinsam. Ich habe meine Kindheit in Cambrils verbracht, Costa Daurada.« Während sie den Platz verließen, Kuhlmann ging mit Stadtplan vorneweg, nahm Markus Anastasias Hand und flüsterte ihr etwas zu. »Entschuldigung angenommen«, flüsterte sie zurück. »Und ein bisschen bin ich selbst schuld. Ich beschütze vielleicht manchmal zu gern, wen ich, ähm, mag.« Anastasia hatte noch nicht viel von Toledo gesehen und staunte nicht schlecht. Die Bilder, die sie von Spanien im Kopf hatte, zeigten nur endlose Betonsilos längs der Küste: übereinandergestapelte und aneinandergereihte Balkone, die an Legebatterien erinnerten. Sie hatte deshalb geglaubt, den Spaniern sei ein Gefühl für Architektur fremd. Diese Stadt sprach eine ganz und gar andere Sprache. Sie fragte ihre Begleiter danach. »Da hast du einen völlig falschen Eindruck!«, belehrte Corbi sie. Markus assistierte: »Granada, Córdoba, Sevilla, Salamanca und so weiter, dir würden die Augen vor Staunen aus dem Kopf fallen.« Spanien bestehe ja nicht nur aus Benidorm und Lloret de Mar, ergänzte Corbi. »Als in den Fünfzigern der Tourismusboom anfing, war Spanien ziemlich arm …« »Ein rückständiges, von der wirtschaftlichen Entwicklung Europas abgekoppeltes Agrarland.« »Und ist es geblieben, bis Franco den Löffel abgegeben hat. Ist es da verwunderlich, dass man am Meer ein paar Bettenburgen hochgezogen hat, um endlich mal Kasse zu machen?« Wenn es um ihr Spanien ging, waren sich die Herren offenbar einig. Hinter der Theke des Internetcafés saß eine dunkelhäutige, arabisch anmutende junge Frau. Kuhlmann zog seinen Dienstausweis wie auch ein Foto von Brúto hervor und befragte sie. Anschließend kehrte er zu Anastasia und Markus zurück, die im Eingang warteten. »Concepción sagt …« »Wieso Konzeption?«, erkundigte sich Anastasia. »Wie, wieso? Ist ihr Name.« »Ihr Vorname«, konkretisierte Markus. »Es bedeutete Empfängnis, gemeint ist die Unbefleckte Empfängnis Mariä.« »Die arme Frau!« Die Männer lachten. »Das ist hier ganz normal«, erklärte Markus, »dem Namen nach ist Spanien immer noch ganz und gar katholisch. Inmaculada, die Unbefleckte, ist keine Seltenheit, oder Rosario: Rosenkranz.« »Zurück zu Brúto. Der ist wohl öfters hier hingekommen, um im Netz zu surfen.« Kuhlmann deutete auf eine Treppe am Ende des Raums, die nach unten führte. »Er hat sich immer erst vergewissert, ob niemand da ist, vielleicht hat er Pornoseiten geschaut. Jedenfalls hat er nie eine Quittung verlangt, bis auf das letzte Mal, als er nur ein kurzes Telefonat geführt hat, maximal eine Minute, meint sie. Sonst hat er hier übrigens nie telefoniert.« »Hat er einen Festnetzanschluss?« »Nein. Ein Handy haben wir auch nicht gefunden. Aber vielleicht kommen wir hier einen Schritt weiter. Mit etwas Glück krieg ich raus, welche Nummer Brúto angerufen hat. Gebt mir ein paar Stündchen.« Sie verabredeten sich für ein Uhr. »Macht et jut, aber nich zu oft«, verabschiedete sich Corbi. Markus lief rot an. Das sei doch nur so dahingesagt, beruhigte ihn Anastasia. Er sah es ein und entspannte sich. »Und was machen wir jetzt?« »Ich würde sagen: Wir lassen uns von Corbi nichts vorschreiben!« BÖSE SCHATTEN | E-GRANADA »Gegen den Tod ist nun mal kein Kraut gewachsen.« Leutnant Amadeo María Gorpón von der Guardia Civil war trotz der drahtigen Figur, die sich unter der grünen Uniform abzeichnete, ein beinahe gemütlich wirkender Mann. Vielleicht lag es an der weichen Stimme, die eher dafür geschaffen schien, Märchen vorzulesen als Verhöre durchzuführen. Oder an den ultralangen Haarsträhnen, die das Haupt wie Spinnenbeine bedeckten und mehr dazu einluden, über die Vergeblichkeit menschlichen Tuns nachzudenken als über die Gefährlichkeit der »bösen Schatten«, wie die Angehörigen der paramilitärischen Guardia Civil hinter vorgehaltener Hand genannt wurden. Jesús ließ sich nicht täuschen. Gorpón hatte ihn vor einer Stunde angerufen und in sein Büro in der Avenida Pulianas vorgeladen. Schon da hatte der Himmel sich verdunkelt. Und gerade hatte der Leutnant ihm eröffnet, die australische Staatsbürgerin Emily Parton sei auf der A-91 Richtung Murcia »zu Tode gekommen«. Jesús stand unter Schock, erfasste aber intuitiv, dass der Schatten, in dem Emily verschwunden war, jetzt auf ihn zuraste. Emily tot, er konnte es nicht fassen. Und hatte auch keine Zeit dazu. Noch wusste er nicht, wie sie »zu Tode gekommen« war und weshalb er hier saß. Doch er musste auf der Hut sein, gerade weil Gorpón auf Geplauder machte und Kaffee kredenzte. »Wissen Sie, was wir nicht verstehen, ist, wie sie mir nichts, dir nichts, in die Leitplanke rasen konnte. Der Aufprall muss heftig gewesen sein, es hat den Wagen auf die andere Fahrbahn geschleudert. Zucker?« »Vielleicht war sie lebensmüde?« »Schien sie Ihnen so?« »Nein, ich glaube nicht. Nur: Man kann in niemanden hineinblicken.« »Ja, leider. Vielleicht haben Sie mit Ihrer Vermutung recht. Wenngleich Selbstmörder gewöhnlich gegen einen Baum oder eine Wand fahren statt in die Leitplanke. Vielleicht hatte sie mit Drogen zu tun, wir wissen es einfach noch nicht.« Jesús glaubte ihm kein Wort. Bestimmt lag das Obduktionsergebnis schon in der Schublade. Er brauchte all seine Selbstbeherrschung, um nicht auf dem Stuhl rumzurutschen, der sich hart wie eine Bleiplatte anfühlte. »Auf der A-91? Die ist zum Teil ziemlich kurvig.« »Señora Parton befand sich auf gerader Strecke.« »Hatte sie denn überhaupt ein Auto?« »Ja, das ist auch so eine Frage. Sie hat sich über das Wochenende einen Mietwagen geliehen, ihn jedoch nicht wie vereinbart Sonntagabend zurückgebracht.« »Das ist merkwürdig. Obwohl … Señora Parton war ein sehr spontaner Mensch, vielleicht ist das der Grund.« Wie er »sehr spontaner Mensch« betont hatte, klang es nach »sehr seltsamer Mensch«, und er schämte sich vor der toten Emily. »Sie muss übrigens am Wochenende noch woanders hingefahren sein, es gibt gut vierhundert Kilometer, über die wir nichts wissen. Noch etwas Kaffee?« Jesús hatte den Kaffee nur angenommen, um guten Willen zu zeigen. Seine Tasse war fast voll. »Ach, trinken Sie doch, Señor Sanchez Mirandor, seien Sie ganz entspannt. Betrachten Sie uns als Verbündete, die herausfinden möchten, wie Ihre arme Schülerin zu Tode gekommen ist.« Sein Gesicht, das durch die Schlupflider immer ein wenig schläfrig wirkte, nahm einen belustigten Zug an. »Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, die vierhundert Kilometer. Sie wissen nicht zufällig etwas darüber? Ein Lehrer bekommt bestimmt einiges mit.« Jesús hatte in einem Krimi gelesen, man solle beim Lügen möglichst viele nachprüfbare Fakten einstreuen, damit sich die Lüge dahinter verstecken konnte. Mal sehen, ob es funktionierte. »Natürlich bekommt man manches mit. Aber ich kommuniziere mit meinen Schülern ausschließlich auf Spanisch. Und Señora Partons Sprachkenntnisse waren minimal. Dabei hat sie vorher schon an einer anderen Schule studiert, ich glaube in Sevilla. Das muss eine seltsame Schule sein. Jedenfalls bestand fast keine Möglichkeit, ein Gespräch zu führen, bei dem man etwas hätte mitbekommen können.« »Weshalb so vorsichtig, Señor Mirandor?« Er lächelte treuherzig. »Sagen Sie mir einfach, ob Sie je ein privates Gespräch mit ihr geführt haben.« »Nein.« Mit dieser Lüge hatte er die Weichen endgültig gestellt, hoffentlich in Richtung Notausgang. »Zumal ich gewöhnlich nur in der Gruppe unterrichte. Ich bin nämlich noch nicht lange Spanischlehrer und die Chefin …« Die Erkenntnis durchfuhr ihn wie ein Stromstoß: Gorpón hatte längst mit Esmeralda gesprochen. Er wusste von Emilys Brief! Deshalb saß er hier. Als Hauptverdächtiger. Offenbar stand er unter Schock, wie sonst hätte er den verrückten Brief vergessen und es mit so plumpen Lügen probieren können? Der Leutnant beobachtete ihn wie die Spinne eine Fliege, die sich mit jedem Flügelschlag tiefer im Netz verheddert. »Ach, ich weiß auch nicht, ich bin ratlos«, murmelte er schließlich. »Dann war es also – Moment.« Gorpón zog einen Aktenordner hervor, der die Beschriftung »Todesfall Emily Parton« trug, und kam zu Jesús auf die andere Seite des Schreibtisches. Dort klappte er den Ordner bedächtig auf und wanderte mit den Fingern die Reiter hinunter. Der letzte Reiter trug die Aufschrift »J. Sanchez Mirandor«. Jesús stöhnte lautlos. Okay, er nahm zur Kenntnis, dass er in dieser Ermittlung bereits aktenkundig war. »Was ich sagen wollte: Dann stellt es also gewissermaßen einen Regelverstoß dar, dass Señora Parton ihn auf Englisch verfasst hat – diesen kurzen, merkwürdigen Brief an Sie. Schauen Sie bitte, ob ich das richtig notiert habe: ›Wenn ich gewusst hätte, was für einer du wirklich bist, hätte ich mich nie auf dich eingelassen.‹ So zumindest hat Señora Escobar den Brief aus ihrer Erinnerung übersetzt, den Sie ihr heute Morgen abgenommen haben. Sie haben ihn nicht zufällig dabei?« Jesús schüttelte den Kopf. »Dieser Brief ist mir, ehrlich gesagt, ein Rätsel.« »Ja, da können wir uns die Hand geben.« Gorpón ging zum Fenster und schaute hinaus. »Und Ihnen fällt rein gar nichts zu dem Brief ein? Ich meine, dergleichen erhalten Sie wahrscheinlich nicht alle Tage von Ihren Schülern … oder Schülerinnen.« »Nein, natürlich nicht. Gerade deshalb fällt mir auch nichts dazu ein.« »Das ist nachvollziehbar. – Vielleicht hat es mit der politischen Gesinnung von Señora Parton zu tun.« Politische Gesinnung? Jesús schaute verwirrt. Er verstand nicht, worauf der Leutnant hinaus wollte. »Sie neigte anscheinend den Anarchisten zu.« Gorpón beobachtete gespannt, wie Mirandor auf die Finte reagierte. »Aha. Sie schien mir überhaupt kein politischer Mensch zu sein.« Eilig fügte er hinzu, er könne es natürlich nicht wirklich beurteilen. »Möglicherweise hat sie in Ihnen einen Glaubensbruder gesehen?« Ungewollt musste Jesús lachen. »Ich gehe wählen, weiter reicht mein politisches Engagement nicht. Ein Anarchist bin ich jedenfalls nicht.« Die wahren Anarchisten, ging Jesús durch den Kopf, das waren doch mittlerweile die Banken, und selbst die ließen sich jetzt gern vom Staat retten. »Verstehe. Nun, dann sind wir auch schon durch.« Jesús erhob sich. »Eine Kleinigkeit noch, reine Formalität. Ich bräuchte Ihre Fingerabdrücke. – Oder haben wir die vielleicht schon?« Jesús nickte resigniert. Natürlich wusste Gorpón auch von Málaga. »Das kann nur zu Ihrem Vorteil sein! Dann werden wir ganz schnell herausfinden, dass keine Spuren von Ihnen im Fahrzeug sind. Ist ja gar nicht möglich, richtig?« Jesús starrte Gorpón unverwandt an. Der Leutnant nickte, was immer das zu bedeuten hatte. »Ich denke, morgen haben wir die Ergebnisse. Wir bleiben in Kontakt, nicht wahr? Bringen Sie beim nächsten Mal bitte den Brief von Señora Parton mit. Adiós, Señor Sanchez Mirandor.« Jesús schleppte sich die Treppe hinab, als hingen bereits Eisenkugeln an seinen Füßen. Emily war nur noch ein Leichnam. Nie mehr würde sie im Meer baden, nie mehr spanische Verben verdrehen und niemals eine Maurerkelle in die Hand nehmen, um ein Haus zu bauen. Alle Träume vom Nichts verschlungen. Lachen und Lieben, alles mit einem Schlag aus ihr herausgerissen. Und für ihn selbst sah es auch nicht gut aus. Lachen und Lieben, die Sonne und das Meer, Inga – das alles würde vielleicht auch ihm genommen. Aus dem Schatten war eine eiserne Hand hervorgeschnellt und hatte bereits einen Zipfel von ihm zu fassen bekommen. Zwischen Emilys Tod und dem drohenden Gefängnis brach alles in ihm zusammen. Er implodierte. War keines Gedankens und Gefühls mehr fähig. Er ging mit offenen Augen durch die Straßen, ohne mehr aufzunehmen, als er zum Überleben benötigte. Ein Nachtwandler durchschritt den Tag. Kaum hatte Mirandor das Büro verlassen, griff Gorpón zum Telefon und rief Oberst Pintaluba an, seinen früheren Chef bei der Guardia in Madrid. »Er hat sich in Lügen verfangen, Coronel. Auch was die Fahrt in dem Mietwagen betrifft«, erstattete er Bericht. »Wir können ihn festnehmen, sobald es opportun ist.« »Opportun wäre sofort gewesen!«, schnauzte Pintaluba ihn an. »Habe ich mich etwa unklar ausgedrückt? Was ist los, Kamerad?« Los war Folgendes: Gorpón hatte Pintaluba absichtlich missverstanden. Er hatte ihm zum ersten Mal »Glaube und Gehorsam« verweigert und damit gegen das Treuegelöbnis ihrer Kameradschaft verstoßen. Bevor er der Kameradschaft beigetreten war, hatte er sich lange Zeit in der konservativen Volkspartei, der Partido Popular, engagiert – und sich schließlich enttäuscht zurückgezogen. Als die PP 1996 endlich an die Macht gelangte und die Stunde der Aufrechten hätte schlagen müssen, war bloß die der Buchhalter angebrochen. Es hätte eines Exorzisten bedurft, um den Spaniern den Zeitgeist auszutreiben, doch ihr Oberbuchhalter, Ministerpräsident José María Aznar, war der alte Krämer geblieben. Statt der Ehre zählte der Erfolg, statt der Gesinnung das Geld. Gorpón verstand nichts von Wirtschaft, vielleicht hatten die Unternehmen von einigen Fesseln befreit werden müssen. Nur verschwanden diese Fesseln nicht einfach. Nun trugen die Arbeitnehmer und Arbeitslosen sie. Unter dem Druck der Verhältnisse zersplitterte die Gesellschaft in Einzelteile. Kein Wunder, dass die einst so starken Familienbande wie ein morscher Ast zerbröselten. Seit die Sozis die Macht zurückerobert und die »Express-Scheidung« ausgebrütet hatten, konnte man die Ehe leichter kündigen als ein Zeitschriftenabo; es hatte das Land der Katholiken auf einen Spitzenplatz in der europäischen Wortbruchstatistik katapultiert. Zum Ausgleich durften jetzt Homosexuelle heiraten und als wäre das der Teufelei nicht genug, durften sie überdies die Kinder adoptieren, die Gott ihnen verweigerte. Aber es gab ja kaum noch Kinder in Spanien, denn so allgegenwärtig der Sex, so unfruchtbar war er. Die spanische Großfamilie? Folklore. Im Durchschnitt bekam eine Frau nur noch ein Kind und einen kümmerlichen Rest von einem Drittel; was der Verhütung misslang, besorgte schließlich die Abtreibung, über einhunderttausend Mal im Jahr. Es war kalt geworden unter Spaniens heißer Sonne. Höchste Zeit zu handeln statt zu debattieren, hatte ihn Pintaluba in einem konspirativen Gespräch überzeugt. So war er der Kameradschaft beigetreten. Sie operierten im Untergrund und versuchten, ihre Leute für »die Tage der Wende«, los dias del cambio, in Schlüsselstellungen zu bringen. Er war dort bloß ein einfacher, aber treuer Soldat. Nie hatte er einen Befehl verweigert. Auch nicht, als Pintaluba, der ein hohes Amt in der Kameradschaft innehatte, ihm befahl, Beweismittel gegen einen Kameraden verschwinden zu lassen, dem die Staatsanwaltschaft auf den Fersen war. Insgeheim hatte er sich zwar gefragt, was ein korrupter Bauunternehmer in den Tagen der Wende zur sittlichen Genesung Spaniens beitragen würde, aber: Glaube und Gehorsam! Und in ebendieser Treue hatte er geschwiegen, als er in den Verdacht der Beweisunterdrückung geraten und nach Granada strafversetzt worden war. Was Mirandor betraf, hatte seine Gutgläubigkeit allerdings ihren Endpunkt erreicht. Die Geschichte vom Sohn eines Anarchistenpaares, der selbst ein gefährlicher Anarchist war und ausgeschaltet werden musste – eine Räuberpistole. Gorpón hatten die dünnen Haare schon zu Berge gestanden, während Pintaluba sie ihm auftischte. Und nun, nach dem Gespräch mit dem »gefährlichen Anarchisten« fand er sie geradezu beleidigend, so einen Unfug konnte man höchstens einem Grünschnabel vorsetzen. Nein, Mirandor war keiner der Tatbeteiligten im Todesfall Emily Parton. Er hatte hinsichtlich seiner Beziehung zu der Australierin gelogen, sie jedoch nicht getötet. Überhaupt roch der Fall nach getürkten Beweisen. Dass die Kameradschaft hinter alldem steckte, konnte und wollte Gorpón sich nicht vorstellen. Kochte Pintaluba etwa sein eigenes Süppchen? Missbrauchte er ihn im Namen der gerechten Sache als Handlanger für schmutzige Geschäfte? Es fiel Gorpón schwer, diesen Verdacht zuzulassen, denn der Oberst war für ihn stets eine Autorität gewesen, und noch hoffte er, sich zu täuschen. Doch er würde sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Deshalb hatte er sich durchgerungen, ihn misszuverstehen und Mirandor erst einmal seines Weges ziehen zu lassen. Er wollte abwarten, was geschah. Das war los. »Ich bitte um Entschuldigung, Coronel. Seit meiner Strafversetzung stehe ich unter verschärfter Beobachtung …« Er gab Pintaluba Zeit, sich zu erinnern, wem der es verdankte, immer noch mit weißer Weste dazustehen. »Und das Fahrzeug wird noch kriminaltechnisch untersucht. Mir schien es einfach nicht opportun, den Mann wegen Mordes festzunehmen, bevor wir offiziell von Mord sprechen können.« »Ja, ja«, knurrte Pintaluba. »Aber es ist Mord, klar? Also schnapp dir das Subjekt schnellstmöglich.« Es war Mord? Woher Pintaluba das bloß wusste. Als Jesús fröstelnd aus der Trance erwachte, saß er, von haarfeinem Nieselregen eingehüllt, auf einer Treppenstufe. Er stand auf und erkannte, dass er sich auf einer kleinen Plaza am Ende der Calle Calderería Nueva befand, einer orientalisch anmutenden Altstadtgasse, die auch »Straße der Teehäuser« genannt wurde. Die Treppenstufen gehörten zur Iglesia de San Gregorio Bético. Er hatte die kleine Kirche noch nie betreten und wusste nicht, warum es ihn jetzt hineinzog; er war nicht religiös, jedenfalls nicht im engeren Sinne, und wollte nicht beten. Einen Moment Ruhe brauchte er, vielleicht deshalb. Die Türe halb aufgezogen, hörte er einen leisen, zugleich kräftigen Gesang, Frauenstimmen. Er trat hinein und schloss unwillkürlich die Augen: Der überladene, in Gold getränkte und von einer lieblichen Muttergottes gekrönte Altar sprengte seine Aufnahmefähigkeit. Gegen das Weihwasserbecken gelehnt, lauschte er dem schlichten Gesang. Jesús schien es, als sängen sie gegen die Maßlosigkeit des Altars an. Die Schwingungen erfüllten die kleine Kirche mit einer aus der Höhe beseelten oder in der Tiefe verwurzelten Kraft. Vom Einklang der Stimmen beruhigt, öffnete er die Augen und sah sich um. Die weißen Gewänder, eine gute Handvoll, saßen mit dem Rücken zum Kirchenraum, von dem sie ein hohes Gitter trennte. Sonst befand sich niemand in der Kirche. Er nahm in einer Bank Platz und gedachte Emily, bis der Gesang verhallte. Dann wandte er sich dem Diesseits zu. Was war Emily zugestoßen? Sprach ihr merkwürdiger Brief tatsächlich für einen Anfall von Wahnsinn, wie er es Gorpón gegenüber angedeutet hatte? Jesús glaubte es nicht. Emily war speziell, aber nicht verrückt. Sie hatte sich nicht das Leben genommen. Und einen Unfall schloss Gorpón aus. Also Mord? Doch wer sollte ein Interesse daran haben, sie zu töten? Er konnte sich nicht vorstellen, dass es so jemanden gab. Dafür fiel ihm sofort jemand ein, der es auf ihn abgesehen haben mochte – und womöglich sogar Emilys Tod in Kauf nahm, um ihn aus dem Verkehr zu ziehen. Jemand, der vor keiner Schweinerei zurückschreckte: Brúto. Sollte er Gorpón von seinem Verdacht erzählen? Er sah förmlich dessen belustigtes Gesicht vor sich. Vielleicht hing der Leutnant sogar selbst mit drin. Als sie seine Eltern ermordet hatten, war ja auch ein Offizier zur Stelle gewesen, der nach Carlos’ Ansicht zu den Verbrechern gehörte. Carlos. Dessen Hilfe hätte er jetzt gebrauchen können. Nun musste er es allein entscheiden. Nein, er würde sich Gorpón nicht anvertrauen. Im Gegenteil, er musste hier weg, bevor der Leutnant zupackte, schnellstmöglich, am besten sofort. Und wohin? In Toledo war nichts zu gewinnen. Mehr als Carlos würde er bestimmt nicht aus Brúto rauszuholen. Der konnte auch unmöglich die treibende Kraft sein. Vielleicht hatte er Emily auf dem Gewissen, doch der Plan, sie zu töten, um ihn auszuschalten, stammte mit Sicherheit nicht von der Hyäne. Es musste jemand anderes dahinterstecken. Was eine beängstigende Schlussfolgerung nahelegte: Die Bande war auch nach dreißig Jahren noch aktiv. Sie hatte ihn wieder ins Visier genommen, weil seine Nachforschungen lästig wurden. Warum die Gangster nicht einfach ihn statt Emily getötet hatten, blieb ihm zwar ein Rätsel, doch eines sah er jetzt ganz klar: Er entkam ihnen nicht. Er musste sie überraschen, musste die Flucht nach vorn antreten! Eineinhalb Stunden später befand sich Jesús auf dem Weg nach Tarragona. Weder das Rattern des Zuges noch die vorbeiziehende felsige Landschaft, deren grandiose Kargheit ihn sonst in geradezu überirdische Ruhe versetzte, vermochte seine Unruhe zu besänftigen. Er versuchte sich abzulenken, indem er die nächsten Schritte plante: Er brauchte einen Stadtplan und ein Hotelzimmer. Und eine Pistole. Geld hatte er zum Glück genug, satte tausend Euro, die ihm Vincente zugesteckt hatte: Geld sei Mittel zum Zweck und einem Freund zu helfen sei einer der besten. Den Plan, auf eigene Faust nach Tarragona zu fahren, um sich den Major vorzuknöpfen, hielt Vincente allerdings für Wahnsinn. Jesús hatte sich nicht beirren lassen. Endlich fuhr der Zug im Bahnhof von Tarragona ein. Er packte Inga am Fell und sah sie eindringlich an: »Wehe, du machst Mucken!« Der Dickkopf hatte ihn nicht nur mit Vincente zum Bahnhof begleitet, sondern war im letzten Moment auch noch in den Zug gesprungen. Wenn sie ihm hier davonlief, fände er sie vielleicht nie wieder. Doch sie blieb an seiner Seite und spazierte, den Schwanz selbstbewusst aufgestellt, über den Bahnsteig, als hätte sie schon Dutzende Trampertickets abgefahren. Einen Stadtplan hatte er schnell gefunden und bald darauf auch ein günstiges Zimmer, Tarragona roch zwar nicht nach Sonnencreme, war aber auf Touristen eingestellt. Das Hotel lag an der Plaça de la Font in der Altstadt, keine fünfzehn Fußminuten von der Adresse des Majors entfernt. Jesús trug sich unter falschem Namen ein. Nachdem er Inga gefüttert hatte, rief er Miguel an, der vor seinem Straßenkehrerjob bei einem Sicherheitsdienst gejobbt hatte. Hoffentlich wusste er, wie man eine Waffe auftrieb. Miguel hörte sich sein Anliegen an, ohne Fragen zu stellen. Wenn ein verantwortungsvoller Mensch eine Waffe benötigte, dann benötigte er sie eben. Warum, ging niemanden etwas an, schon gar nicht Vater Staat. Dessen Ordnungsversessenheit hatte ohnehin bloß die eine gute Seite, die Bürger zusammenzuschweißen. Weil man nur gemeinsam gegen ihn ankam, weil man ohne Kenner und Könner unter Freunden und Freundesfreunden, die Schleichwege und Schlupflöcher kannten, keine Chance gegen eine Bürokratie hatte, deren einziger Ehrgeiz darin bestand, sich täglich neue Varianten absurden Theaters einfallen zu lassen. So sah Miguel es und deswegen zögerte er nicht, sich schlauzumachen. Zwei Stunden später rief er zurück und nannte Jesús den Namen eines Geschäfts für Campingbedarf, in dem man unter der Hand Waffen bekam, die nicht speziell für Exkursionen ins Grüne gedacht waren. Jesús machte sich mit Inga auf den Weg. Er betrat das Geschäft und richtete der Verkäuferin »Grüße von María Dolores« aus. Die Frau nickte schweigend und bat ihn in ein Hinterzimmer. Dort empfahl sie ihm eine Halbautomatik und erklärte grob, wie sie funktionierte. Wegen der erschießungstechnischen Details verwies sie auf die beiliegende Anleitung. Auf dem Rückweg zum Hotel sah Jesús sich plötzlich mit dem Ding schießen und den Major zusammenbrechen. Ein Bild größter Anschaulichkeit: Er meinte, die Blutspritzer an der Wand zählen zu können. Dazwischen liefen Klümpchen aus Hirnmasse die Tapete hinunter. Schlagartig kollabierte sein Darmtrakt und er brauchte jeden verfügbaren Muskel, um Schlimmeres zu verhindern. Danach schmiss er die Munition in einen Abfallcontainer. Einschüchtern Ja, schießen Nein. Er schwitzte, aber die Sonne gab sich auch alle Mühe heute. ANGSTSCHWEIß | E-GRANADA Hätte S sein Hemd ausgewrungen, Granada wäre in einer Sturzflut versunken. Was nicht nur an der Sonne lag, die heute über Andalusien herrschte. S hatte sich selbst eingeheizt. Er saß auf einer Steinbank in einem Park nahe Granadas Flughafen »García Lorca« und blickte auf einen Springbrunnen. Er sah gern fließendem Wasser zu, das brachte seine Gedanken in Fluss. Aber kaum hatte er sich gesetzt, versiegte das Wasser. Murphys Gesetz, schoss es ihm durch den Kopf. Positiv denken, nur nicht nervös machen lassen, hielt er dagegen. Leichter gesagt als getan. Die Sache mit der Australierin hatten sie perfekt eingefädelt, von dem mysteriösen Brief, den er selbst ausgetüftelt hatte, bis zu dem von Mikki arrangierten Crash auf der Autobahn. Seitdem lief allerdings rein gar nichts, wie es sollte, nicht mal das Wasser, ganz zu schweigen davon, dass die Grenzdebilen von der Guardia Civil Mirandor hatten entwischen lassen. Zutiefst beschämt hatte er Zuhause angerufen und den Salvator informiert. Den Salvator, dessen Adjutant er war – und noch so vieles mehr. Um seine einzigartige Stellung zu untermauern, hatte S sich für die Spanienreise ins Spiel gebracht. Normalerweise wäre Iwan gefahren, doch der hatte noch ein anderes, ebenfalls dringendes Problem zu lösen gehabt. Diesen Umstand hatte sich S zunutze gemacht. Endlich einmal an die Front und sich auszeichnen! Und nun dieses Desaster. Der Salvator hatte sich den Lagebericht mit der ihm eigenen Kühle angehört und entschieden, er werde mit einigen Leuten nachkommen. So weit begab er sich sonst nie aus der Deckung! Wie kritisch er die Lage einschätzte, zeigte eine andere, ungeheure Entscheidung: Sollte Mirandor den Major enttarnt und bereits Kontakt zu ihm aufgenommen haben, seien beide zu beseitigen. Trotz der Konsequenzen! Zum ersten Mal hatte S widersprochen – es gebe eine Alternative zu Mirandors Tötung. Schließlich hatte er die Erlaubnis erhalten, falls es ohne jedes Risiko möglich sei. S öffnete seinen Aktenkoffer, der mehrere Spritzen und ein Set mit Ampullen enthielt, und vergewisserte sich ihrer Unversehrtheit. Es musste einfach gelingen, Mirandor unschädlich zu machen, ohne ihn nachhaltig zu beschädigen. Am besten, sie spürten Fárdome auf, bevor er mit Mirandor geredet hatte. Dann musste Mikki den Alten bloß schnell kalt machen und alles war wieder in Ordnung. S klappte den Koffer zu und stierte auf den Brunnen, als könnte er ihn kraft seiner Gedanken zwingen, Wasser zu speien. Sein Handy klingelte, die gecharterte Maschine stand zum Abflug nach Reus, Tarragonas Nachbarstadt, bereit. Er sah auf seine Uhr: Mirandor hatte nur ein paar Stunden Vorsprung herausgeholt. »Los, Mikki, er darf nicht noch mal entwischen!« THE QUEEN | E-MADRID Anastasia und Corbi saßen in einem Straßencafé in La Moraleja, einem der nobleren Stadtteile Madrids, wohin die Telefonnummer sie geführt hatte, die Brúto vom Internetcafé aus angerufen hatte. Sie gehörte zur Rechtsanwaltskanzlei Alonso. »Das hast du ja fix rausbekommen, Corbi«, sagte Anastasia anerkennend. Kuhlmann grinste stolz. Kaum hatte sich Engel mal verpisst, lief es zwischen ihnen. Sogar sein Hemd blieb brav in der Hose. Die Illusion, bei Anastasia sei für ihn mehr drin als ein Schulterklopfen, hatte er sich jedoch abgeschminkt. Seit seiner Scheidung vor zwei Jahren hatte er zwar einige Eroberungen verbucht, aber Anastasia spielte in einer anderen Liga. Sah er ein. Nicht in den Kopf wollte ihm hingegen, wieso Markus Korinthenkacker Engel mehr Erfolg bei ihr hatte. Zwischen den beiden lief was, so viel war mal sicher. »Das ging nicht auf offiziellem Weg so schnell, oder?« Er lachte. »Nee, dann säßen wir noch in den Startlöchern. Ich kenne mich ganz gut mit den inoffiziellen Abkürzungen aus.« »Wo kommst du eigentlich her, Corbi?« »Aus Lloret de Mar, habe ich das nicht erzählt?« »Hast du nie in Deutschland gelebt?« »Bis ich fünf war. Danach nur noch in den Sommerferien bei den Großeltern. Wir hatten drei Monate.« »Wir auch.« »Eine Gemeinsamkeit!« Er prostete ihr mit seiner Kaffeetasse zu. »Du bist also nicht in Deutschland aufgewachsen?« »Bis zu meinem zehnten Lebensjahr haben wir in Saloniki in Nordgriechenland gelebt, dann sind wir nach Deutschland gezogen. Mein Vater ist Ingenieur und hat eine gute Stelle gefunden.« »Und, fühlst du dich eher als Griechin oder als Deutsche?« »Schwer zu sagen. Ich bin … ein griechisches Kind und eine deutsche Frau. Die einfachen Sachen, schmecken, riechen und hören, mache ich griechisch …« »Hören?« »Ja, wenn ich zum Beispiel Grillen zirpen höre, da habe ich ein kindisches Vergnügen dran. Die komplizierteren Sachen, alles, was mit Denken zu tun hat, laufen wohl eher deutsch ab.« »Und das Fühlen?« Sieh mal an, Corbi konnte richtig gute Fragen stellen. »Fühlen, hm. Da fragst du mich was.« Sie dachte nach. »Wenn ich zum Beispiel einen Mann mag …« Was für ein blödes Beispiel, da forderte sie ihn ja direkt auf, sich angesprochen zu fühlen. »Oder eine Frau …« Corbi sah sie mit großen Augen an und ließ sich Ohren in Satellitenschüsselgröße wachsen. »Nein, nicht so mögen! Also nicht bei einer Frau! Ach, verdammt, was weiß denn ich, ob ich deutsch oder griechisch fühle. Ich bin in einer hektischen griechischen Großstadt aufgewachsen und dann in der verschlafenen deutschen Provinz gelandet – das zu den Klischees. Und was die Männer betrifft: Mein Favorit war weder ein Deutscher noch ein Grieche, sondern Kryptonier. Clark Kent alias Superman! Und was ist mit dir, hast du nie drüber nachgedacht, nach Deutschland zurückzukehren?« »Zurückkehren? Deutschland, das ist … Urlaub. Ich bin auf eine spanische Schule gegangen, ich war ein kleiner Spanier. Klar, zu Hause haben wir deutsch geredet, aber ich hab mich immer eher als Spanier betrachtet. Habe ja auch die deutsche Staatsbürgerschaft gegen die spanische eingetauscht, man muss sich hier nämlich entscheiden. Erst in den letzten Jahren hab ich manchmal Heimweh … Nach einer Heimat, die seit fast vierzig Jahren nicht mehr meine Heimat ist, verrückt!« »Bist du verheiratet?« »Geschieden.« Er holte sein Portemonnaie hervor und klappte es auf, links steckte ein Foto in einer Klarsichthülle. »Ich hab zwei Kinder, Rubén, sieben, und Marta, neun.« Er strahlte. »Süße Blagen, stimmt’s?« »Triffst du sie zuweilen?« »Zuweilen? Wann immer es geht, fast jedes Wochenende, die brauchen doch ihren Papa! Wir fahren auch zusammen in Urlaub, letztes Jahr habe ich ihnen meine Heimat gezeigt, Hannover, da komme ich her.« Anastasia lachte. »Ausgerechnet aus der Stadt, in der man angeblich das reinste Hochdeutsch spricht?« »Wieso?« »Weil du oft so einen Mix aus deutschen Dialekten sprichst.« Während sie es sagte, wurde ihr bewusst, dass er in diesem Gespräch tatsächlich hochdeutsch sprach. Corbi wurde rot. »Vielleicht hätte ich gerne einen richtigen Dialekt. Schade, dass ich von meinen Eltern keinen mitbekommen habe. Da mixe ich mir wohl …« »Die Toiletten hier sind … besser, man redet nicht drüber.« Warum tust du es dann? Kuhlmann hätte Engel für das grobe Hereinplatzen erwürgen können. Bevor ihm ein passender Kommentar einfiel, läutete sein Handy. Der Kollege am anderen Ende der Leitung hatte interessante Neuigkeiten. »Zuhören, Leute, das war mein Büro!« Kuhlmann berichtete, er habe noch mal Mirandors Akte durchsehen lassen und dabei sei aufgefallen, dass dessen Eltern bei einem Brand ums Leben gekommen waren. »Und zwar in Toledo! Und zwar genau zu der Zeit, als Mirandor entführt worden ist.« Engel stutzte. Den Brand hatte Mirandor erwähnt, nicht jedoch seine persönliche Betroffenheit. »Was lernen wir daraus, Kollege Engel? Mirandor hat rausgekriegt, dass Brúto seine Eltern abgefackelt hat. Womit wir ein handfestes Motiv haben. Nächster Punkt: Ein Postbote hat Mirandor in Brútos Altstadt-Apartment gesehen. Im Innenhof habe noch ein Mann rumlungert. Was dafür spricht, dass Mirandor gezielt vorgeht, sich Verstärkung holt und so weiter, nix da mit unbedarftem Bürschchen. Und es kommt noch besser: Die Guardia Civil in Granada verdächtigt Mirandor, vor ein paar Tagen eine Australierin ermordet zu haben.« »Langsam mutiert er zum Massenmörder«, kommentierte Engel halb ungläubig, halb belustigt die Neuigkeiten. Aber er wurde nachdenklich: Wie schon im Fall Heydt stimmten die Fakten und sein Bauchgefühl nicht überein und er begann sich zu fragen, ob es nicht an seinem Bauchgefühl lag. Zu viel sprach mittlerweile gegen Mirandor. »Hat bei seiner Vernehmung gelogen, dass sich die Balken biegen und dann zügig die Biege gemacht«, setzte Kuhlmann den Bericht fort. »Aber der Idiot hat vom Handy aus telefoniert. Sie haben ihn geortet, in Tarragona.« Was für ein Zufall, dachte Markus. Sein bester Freund hatte dort gewohnt. Er war ihm seit 1985 nicht mehr begegnet. Irgendwann würde er seiner alten Heimat einen Besuch abstatten, die Wunden brannten längst nicht mehr. Kuhlmann erhob sich. »Schauen wir bei Alonso vorbei. Aber zuerst muss ich zu dem Gemüsehändler da vorn.« Das Gebäude, in dem sich die Kanzlei Alonso befand, gab sich unauffällig, der Empfangsraum hingegen strahlte in Holz und Leder verpackte Gediegenheit aus. Zwei große, goldgerahmten Ölporträts erhoben für die Kanzlei den Anspruch, sie besitze Herkunft und Tradition. Engel fühlte sich an Die Firma erinnert, wenngleich in der Liliputversion. Kuhlmann anscheinend auch, denn sein schnoddriger Ton passte eher zu Mafia und Milieu als zu der älteren Dame hinter dem glänzenden Mahagonitresen. »Policía Nacional. Ich will Alonso sprechen und zwar sofort«, schnauzte er sie an. »Ich informiere Dr. Alonso«, erwiderte Blanca Vidal mit Zockermiene, ging gemessenen Schrittes um die Theke herum und verschwand in einem vom Eingangsbereich nicht einsehbaren Flur. Dort beschleunigte sie. »Herein.« »Policía Nacional«, flüsterte Blanca und schüttelte den Kopf – nein, sie wusste nicht, worum es ging. »Zwei Minuten. Du informierst Martina.« Zu Kuhlmanns Überraschung entpuppte sich Dr. Alonso als Frau. Genauer gesagt als eine attraktive Dame von ungefähr sechzig. Das silbergraue Haar und ihr mädchenhaftes Gesicht schufen einen aparten Kontrast und das luftige Kleid mit großen roten Blüten passte so perfekt zum Frühling wie der Jadestein an ihrer Halskette zum Grün der Augen. Kuhlmann fühlte sich nachgerade überrumpelt. Die Frau erinnerte an Helen Mirren und strahlte womöglich noch größere Autorität aus als die Queen. Aber laut Info aus der Abteilung Organisierte Kriminalität hatte er einen mit allen Wassern gewaschenen Profi vor sich. Dass es sich um eine Frau handelte, hatte die Info allerdings nicht hervorgehoben; ein deutliches Zeichen, dass sich die Emanzipation auch im kriminellen Gewerbe durchsetzte. Kuhlmann wog ab, ob freundliche oder harsche Masche, und entschied sich für letztere – das war weder die Queen noch der Moment für Ritterlichkeit. Cristina Alonso ging einen Schritt auf die ungebetenen Gäste zu und stellte sich vor. Aus der gegnerischen Dreierformation trat ein Bierbauch und hielt ihr wortlos seinen Dienstausweis hin. Kuhlmann ging gleich in die Vollen: »Jetzt haben wir Sie am Arsch, Frau Doktor.« Es fiel ihm keineswegs leicht, der Dame etwas so Gewöhnliches wie einen Arsch zu unterstellen. »Einmal wird eben jeder auf dem falschen Fuß erwischt. Aber keine Sorge, für den großen Paukenschlag schicken wir ein standesgemäßeres Komitee. Wir sind nur die Vorhut, bei der Sie für gute Stimmung sorgen können. Dann achten wir vielleicht darauf, Ihnen im Knast die Lesben vom Unterleib zu halten.« Alonso nahm wieder hinter ihrem Schreibtisch Platz und lächelte unverbindlich angesichts der in Aussicht gestellten Großzügigkeit. »Worum geht es denn?« »Um einen Verbrecher namens Diego Brúto, der mit Ihrer Kanzlei in Kontakt steht.« Kuhlmann beugte sich über den antiken Schreibtisch und näherte sich Alonso bis auf Atemreichweite, besser gesagt Atemriechweite. Er hatte gerade auf einigen Stücken Zwiebeln und Knoblauch rumgekaut, ein probates Mittel, speziell den feinen Leuten ein bisschen Ekel einzuhauchen und sie in ihrer Konzentration zu stören. Dies war ein Giftgasangriff, verstand Alonso sofort, doch half ihr die Erkenntnis nichts. Sie hatte eine empfindliche Nase und spürte Brechreiz aufsteigen. Sich gegen die Lehne ihres Sessels pressend, antwortete sie mit flacher Stimme, sie könne sich dazu nicht äußern: »Mandantenschutz« – ein jahrzehntelang eingeübter Automatismus. »Demnach ist Brúto Ihr Mandant.« »Eher nicht« »Der Mann hat hier angerufen.« Kuhlmann holte einen zerknüllten Zettel aus seiner Hosentasche und deutete auf ein Datum mit Uhrzeit. »An solch einen Anruf kann ich mich nicht erinnern. Wahrscheinlich hat sich der Mann verwählt.« »Versuch nicht, mich zu verscheißern, Alonso. Der Mann hatte eine Durchwahlnummer. Und er hat sich das Telefonat trotz des lächerlichen Betrags quittieren lassen. Es ging um was Wichtiges und er wollte mit Sicherheit jemanden aus dieser Kanzlei sprechen.« »Wann sagten Sie, sei das gewesen?« »Ich sagte gar nichts. Kuhlmann hielt ihr erneut den Zettel hin. Alonso las die Daten laut vor. Kurz darauf klingelte ihr Telefon. Sie hob ab. »Buenos dias, Señora Ruiz, ja, ich habe mir den Vertragsentwurf angesehen.« Sie notierte etwas auf einem Zettel. »Entschuldigen Sie die Unterbrechung. Kommen wir zurück zu diesem Brúto. Ich erinnere mich an ein merkwürdiges Telefonat, das zeitlich passen könnte. Ein Mann, der sagte, er rufe im Auftrag eines Mandanten an, der verhindert sei. Ich möge bitte im Namen des Mandanten eine mir unbekannte Person telefonisch kontaktieren, um ihr eine Mitteilung durchzugeben. Derart seltsame Aufträge würde ich normalerweise ignorieren, aber der zu übermittelnde Inhalt schien derart harmlos, dass ich zugesagt habe, er lautete nämlich sinngemäß nur, es bleibe beim Treffen in Toledo am kommenden Tag.« »Wie heißt der Anrufer?« »Er hat einen Allerweltsnamen genannt, jedenfalls nicht Brúto. Ob eine Nummer angezeigt wurde, weiß ich nicht mehr. Wie gesagt, es ging um eine Lappalie.« »Und die Nummer, die Sie anrufen sollten?« »Habe ich auf einem Zettel notiert, den ich später weggeworfen habe. Immerhin erinnere ich mich an die Ortsvorwahl: die 958, Granada.« »Der Name?«, fragte Kuhlmann lakonisch, er würde sowieso keinen bekommen. »Warten Sie.« Sie schloss die Augen. »Mi… Miradit? Oder Mirandit? Vielleicht eher Morandit.« »Mirandor?« Kuhlmann wagte es nicht zu hoffen. »Ja, Mirandor, das hört sich genau richtig an.« »Und der Name Ihres Mandanten?« »Ich denke, ich bin nicht befugt, Ihnen den Namen zu nennen.« Kuhlmann hatte genug gehört. Er blickte sich zu den deutschen Kollegen um und fragte höflicherweise, ob sie Fragen hätten. Alonso sah den anderen Bullen direkt auf sich zukommen. Im letzten Moment umkurvte er sie und ließ sich mit einer plumpen Bewegung auf den Schreibtisch fallen. Tölpel! Und dann kam er ihr mit einer völlig nebensächlichen Frage; wahrscheinlich wollte er nur beweisen, dass er sprechen konnte. Auch Kuhlmann wunderte sich über die läppische Frage, und er wunderte sich ein zweites Mal, als Anastasia beim Hinausgehen im Empfangsraum stehen blieb und die Frau hinter dem Tresen bat, sie zu Dr. Alonso durchzustellen – nur um eine nicht minder unwichtige Frage loszuwerden. Vielleicht hatte er die deutsche Polizei überschätzt. »Mirandor, was sagt ihr dazu? Hat sich offenbar mit Brúto auch an dessen Todestag getroffen.« »Meinst du, Corbi? Keine Zweifel?«, fragte Anastasia. »Wieso?« »Ich habe mich zu Alonso durchstellen lassen, um zu sehen, welches Licht an der Telefonanlage bei internen Anrufen leuchtet. Das grüne – wie bei dem Anruf, den sie zwischendurch erhalten hat. Ergo: keine Mandantin. Alonso wollte uns hinters Licht führen.« »Na schön. Nur hat das bestimmt nichts mit unserem Fall zu tun. Der Anrufer konnte ja nicht wissen, worum es ging.« Markus schaltete sich ein. »Doch, er wusste es. Mich hat interessiert, was Alonso während des Telefonats notiert hat.« Er berichtete, wie er den Notizzettel vom Schreibtisch geweht und was er gelesen hatte, nachdem der Zettel glücklicherweise mit der beschriebenen Seite nach oben auf dem Boden gelandet war: Mirandor – der Name, an den Alonso sich angeblich nicht richtig erinnern konnte. »Hier ist eine Intrige gegen Mirandor im Gange. Wir sollen an der Nase herumgeführt werden.« »Na gut, es gibt offenbar Ungereimtheiten.« »Mir stellt sich die Sache folgendermaßen dar, Kuhlmann: Dreißig Jahre nach den Verbrechen, die an Mirandor verübt wurden, beginnt er auf eigene Faust zu ermitteln. Er stößt auf Brúto, einen Tatverdächtigen. Und ein paar Stunden später ist der tot, was …« »Ja, von Mirandor umgebracht. Vergiss die Fingerabdrücke nicht.« »Motiv?« »Rache. Ihm wird eine Sicherung durchgebrannt sein.« »Ein Laie, dem die Sicherung durchbrennt, stößt das Opfer vom Balkon, ohne Spuren zu hinterlassen.« »Er war wahrscheinlich in Begleitung, vergiss die Aussage des Postboten nicht.« »Nehmen wir an, Mirandor hat jemanden engagiert. Ist plausibel, wie hätte er auch allein gegen einen Berufsverbrecher ankommen sollen? Das erklärt zudem die gekonnte Misshandlung Brútos. Der Profi hat Brúto gedemütigt und an der empfindlichsten Stelle eines Mannes zugesetzt, um ihn zum Sprechen zu bewegen. Kleiner Eingriff, große Wirkung. Alles nachvollziehbar. Aber er hätte Brúto nicht getötet.« »Wenn Mirandor dafür bezahlt hat?« »Ein Profikiller schreitet zur Tat, obwohl sein Auftraggeber an beiden Tatorten Fingerabdrücke hinterlassen hat? Abwegig. Die Fingerabdrücke haben ihn nur darum nicht gekümmert, weil er nicht mit polizeilichen Ermittlungen rechnen musste.« So leicht gab sich Kuhlmann nicht geschlagen. »Oder weil er nicht glaubte, dass wir eingeschaltet werden. Es sollte ja nach Unfall aussehen.« »Nur ein Dummkopf würde glauben, dass angesichts Brútos malträtierter Genitalien niemand stutzig wird. Nein, nein. Derjenige, der Brúto misshandelt hat, ahnte nichts von der späteren Ermordung. Und derjenige, der Brúto so elegant übers Balkongeländer geschoben hat, ahnte nichts von den verräterischen Folterspuren.« »Mag alles schön zusammengereimt sein, ist aber bloße Vermutung.« »Bis zu Alonsos Vernehmung hätte ich zugestimmt. Jetzt steht für mich fest, dass jemand im Hintergrund Fäden spinnt. Brúto musste sterben, weil er etwas über diesen Jemand wusste. Wenn Sie mich fragen …« »… dann steckt dieselbe Verbrecherbande wie damals dahinter.« »Genau.« »Das ist gut dreißig Jahre her. Und warum haben die dann anstelle von Brúto nicht einfach Mirandor abserviert?« »Kein Ahnung. Könnte sein, dass genau diese Frage den Dreh- und Angelpunkt bildet.« »Ich weiß nicht. Es gibt einfach zu viel, was gegen Mirandor spricht.« »Wenn Sie einen Haufen brüchiger Ziegel aneinanderreihen, haben Sie immer noch kein festes Fundament.« Sie waren bei ihren Autos angelangt. Kuhlmann ergriff flüchtig Engels Hand, dann schmiss er sich an Anastasia ran. Brauchte sie Hilfe? Unsinn, sie legte bestimmt keinen Wert darauf, dass er hier den Macker gab. Obwohl – seit Veronika Feldbusch und Alice Schwarzer miteinander konnten, durfte Mann nie sicher sein, ob er gerade als Puma oder Pudel gefragt war. »Also, Schätzchen, wenn’s dir in Deutschland zu kalt wird: Hier wirst du wärmstens empfangen!« Anastasia lachte und schob ihn weg. »Bis dahin hast du längst zehn neue, Corbi.« Sie schwang sich auf den Beifahrersitz. »Dann mal los, Kollege Engel! Sonst ist es dunkel, bevor wir die Stadtgrenze erreichen.« »Erinnert die Landsleute ma, wie schön Spanien is, uns gehn langsam die Touris aus«, verabschiedete sich Corbi. »Und sacht, unsere Bauwirtschaft is kollabiert, weshalb es hier jetzt wunderbar ruhich is.« Er lachte. »Toll zum Entspannen! Tschüssikowski, grüßt mir die Heimat! Gute Reise!« Die Reise endete schon nach wenigen Minuten, zumindest vorläufig. Plötzlich hatte Anastasia es doch nicht mehr eilig. Erst einmal brauchte sie einen Kaffee, um sich für die Fahrt zu stärken. Ein paar Minuten später cancelte sie die Fahrt, für die sie sich hatte stärken wollen; sie kämen heute ohnehin nicht mehr weit. Noch ein paar Minuten später wollte sie die Möglichkeit besprechen, einige Urlaubstage anzuhängen. Warum nicht, fragte sich Markus. Es war keine rhetorische Frage. So gut es ihm mit ihr ging, hatte er zwiespältige Gefühle, wenn er an noch größere Nähe dachte. Wahrscheinlich eine Nachwirkung seiner Ehe und der Wunden, die sie geschlagen hatte, kurz gesagt: Muffensausen. Da musste er durch. »Und was erzählen wir Degenhart? Dass wir zusammen Urlaub machen?« »Nö. Sag ihm, du willst hier die Beine ein paar Tage hochlegen, weil du völlig groggy bist, und mich zieht es zu einem Kurzurlaub in die griechische Heimat, wo wir schon mal im Süden sind.« »Ist es denn von hier aus viel näher?« »Ich glaube nicht. Aber vom Süden in den Süden, das klingt nach Katzensprung, da fällt Degenhart bestimmt drauf rein. – Oder willst du gar nicht?« Von einem Moment zum anderen verließ sie die Selbstsicherheit. »Wir könnten nach Cambrils fahren. Du weißt schon, wo ich aufgewachsen bin. Liegt an der Ostküste, südlich von Barcelona.« »Wohin du willst!« Ihr Herz trommelte immer noch, nahm jedoch einen beschwingteren Rhythmus auf. Plötzlich geriet es ins Stocken. »Hast du nicht erzählt, ihr hättet in der Nähe von Tarragona gelebt? Und da befindet sich vermutlich Mirandor. Du willst weiter ermitteln, ist es das?« »Nein, nein, ich will dir meine spanische Heimat zeigen, sonst gar nichts!« Er wäre dem Spanier nur zu gerne über den Weg gelaufen, aber nach ihm suchen würde er nicht. »Keine Ermittlungen, ich werde der faulste Urlauber sein, den Cambrils je erlebt hat!« »Für eine bestimmte Sache wirst du hoffentlich nicht zu faul sein!« Er grinste anzüglich oder dämlich, da war er sich nicht sicher, und stand schnell auf, um von der Telefonzelle gegenüber anzurufen. Sein Chef hob nicht ab, also versuchte er es auf dessen Handy und hatte Glück. Degenhart befand sich auf einer auswärtigen Tagung und schien genervt. Nach einigem Zieren und Zögern willigte er ein. Markus fragte noch, ob es Neuigkeiten von Anna Heydt gab, doch da war sein Chef nicht auf dem Laufenden. Als er wieder nach draußen trat, sah er Anastasia auf ihrer Perlenkette rumkauen. »Und, was sagt er?« »Eine Woche habe ich rausgeschlagen.« »Das wirst du nicht bereuen!« Er wurde so rot wie die Signalleuchte auf der Baustelle gegenüber. SCHATTENSPIELE | E-TARRAGONA Während Inga auf dem französischen Balkon die letzten Sonnenstrahlen genoss, spendierte sich Jesús, gewissermaßen als Henkersmahlzeit vor dem Gang zu Fárdome, einen Bummel zum Strand. Dahin zu gelangen war nicht ganz einfach. Zunächst strandete er am Geländer einer Aussichtsplatzform am Ende der Rambla Nova, Tarragonas Flaniermeile. Dahinter ging es steil bergab. Immerhin hatte man von hier einen großartigen Blick weit über das Meer, die Bucht samt Hafen und Strand und den tiefer gelegenen Stadtteil. Von einer sanften Meeresbrise angenehm gekühlt, ließ er den Blick schweifen. Ihm gefiel Tarragona. Schon die verwinkelte Altstadt hatte es ihm angetan und die Aussicht aufs Meer tat ein Übriges. Einige Meter entfernt tauchte eine Fremdenführerin mit Touristen auf und pries das »beeindruckend gut erhaltene« römische Amphitheater Tarragonas. Jesús mischte sich unter die Gruppe und reckte den Hals. Die Arena schien direkt am Strand zu liegen, es sah aus, als schwämme sie im Wasser. »Das Theater ist nur ein besonders eindrucksvolles Beispiel unzähliger römischer Relikte …« Jesús ging weiter. Über eine abfallende, geschäftige Straße bewegte er sich in Richtung Hafen. Kurz darauf befand er sich am Strand, den er, gemessen an den Umständen – neben sich einen der größeren Mittelmeerhäfen und hinter sich eine kleine Großstadt – ganz ansehnlich fand. Er steckte seine Schuhe in den Rucksack, krempelte sich die Hosenbeine hoch und stakste durchs Wasser. Wenn er den Stadtplan richtig gelesen hatte, lief er grob in Richtung der Adresse, die ihm Carlos gegeben hatte. Über mehrere Treppen, die vom Strand eine Anhöhe hinaufführten, kam er eine Viertelstunde später dort an. Ein mehrstöckiges Haus. »Apartamentos Astoria« stand auf einer großen Glasfront. Ob der Major wirklich hier wohnte? Vielleicht war er umgezogen. Oder im Urlaub. Plötzlich fühlte sich Jesús zu erschöpft, um ihn schon heute aufzusuchen. Zumindest musste er klären, ob sich der Major hier überhaupt aufhielt. Also drückte er eine Klingel und fragte, in welchem Apartment Fárdome wohne. »405« Er betätigte die Klingel. »Sprechen Sie«, knarzte es aus der Sprechanlage. Statt zu antworten verschwand Jesús in der Dämmerung. Dass ihm ein Schatten folgte, bemerkte er nicht. Ebenso wenig bemerkte der Schatten, dass ihm ein weiterer Schatten folgte. S saß am Fenster seines Hotelzimmers an der Rambla Nova und schaute zerstreut zu, wie sich der Boulevard füllte. Warum meldete Mikki sich nicht? Er ging ins Bad, krempelte die Ärmel des schwarzen Leinenhemds hoch und kühlte sein Gesicht mit Wasser. Endlich läutete sein Handy. »Hallo Boss. Will gerade zum Major, da kommt Zielperson M. Klingelt am Haus, dann er haut ab. Vielleicht Major nicht zu Hause. Muss für Major oder M entscheiden. Folge M. Ist jetzt auf der Plaça de la Font und isst. Was unheimlich ist, Boss: Ihn begleitet eine schwarze Katze!« S lachte. Mikki sah mal wieder Hexenwerk. Er war ein guter Mann, gehorsam, fest zupackend und nicht zu helle, wie es sich für einen einfachen Soldaten gehörte. Doch sein Aberglaube schlug jedem Fass den Boden aus. Dem Tod würde er ohne mit der Wimper zu zucken ins Auge sehen, aber wehe, ihm lief eine schwarze Katze über den Weg, dann machte er sich glatt in die Hose. »Nix zum Lachen! Die kommen zusammen aus Hotel, wie Paar. Er kauft Katze sogar was zu essen, ich meine, in Lokal! Und nun essen sie zusammen.« »Ach, die Katze sitzt mit am Tisch?« »Katze sitzt davor! Als wenn sie bewacht ihn …« »Lass dich nicht von Katzen ablenken, verdammt! Ich warne dich, Mikki, mach keine Fehler, verstanden? Du weißt also, wo er wohnt?« »Ja. Eine Pension hier.« S überlegte. Fárdome zu beseitigen, war der sicherste Weg, sich der Probleme zu entledigen. Aber wenn Mikki sich zu dessen Wohnung begab und ihn nicht antraf, hatten sie beide aus den Augen verloren. Nein, solange Mikki an Mirandor dranblieb, konnte nichts passieren. »Ich glaube nicht, dass M heute noch mal den Major aufsucht. Wenn doch, setzt du ihn behutsam außer Gefecht. Jedenfalls behältst du ihn die ganze Nacht im Auge. Kein Nickerchen, klar?« »Mensch, Boss! Weißt du, wann ich zuletzt kann ausruhen? Wenn ich wieder kein Auge drücke, bin ich platt morgen.« S zögerte. Einerseits durfte er nicht mehr das kleinste Risiko eingehen, andererseits wusste er von Berufs wegen, weshalb Schlafentzug zu den Foltermethoden zählte. »Du bleibst bis drei auf dem Posten, dann löse ich dich ab.« Nicht mal Inga war auf ihre Kosten gekommen. Das Essen hätte man besser ohne den Umweg über die Verdauungsorgane da entsorgt, wo es schließlich landen würde. Jesús blickte über die große, lang gestreckte Plaza mit dem stattlichen Rathaus am Kopfende und den schlanken Reihen hübscher Häuser zu den Seiten, viele renoviert, dazwischen aber auch einige bröckelnde Fassaden. Gerade das machte aus Jesús’ Sicht den Charme der Plaza aus. So viele Straßenlokale, wie sie beherbergte, musste jedes zweite Haus sein Erdgeschoss an die Gastronomie abgetreten haben. Wie gern hätte er hier als Tourist gesessen! Statt den anwachsenden Trubel zu genießen, musste er überlegen, was er von Carlos für den morgigen Besuch bei Fárdome lernen konnte. Es kam wohl auf das Überraschungsmoment an. Dem anderen keine Zeit zum Nachdenken geben. Schnellstmöglich größtmöglicher Druck. Ihn fröstelte bei der Vorstellung. »Komm Inga, gehen wir schlafen.« An Schlaf war überhaupt nicht zu denken. Wenn das Toben in seinem Inneren nachließ, nahm das draußen garantiert gerade zu. Wie hatte er, als man ihm das Zimmer mit Blick auf den Platz angeboten hatte, nur vergessen können, dass estar de bulla, also gut drauf sein, wortwörtlich »des Lärms sein« bedeutete. Und dass seine Landsleute Weltmeister im Nachtwandern waren, die jeden Weg fanden, bloß nicht den nach Hause, jedenfalls nicht vor dem Morgengrauen. Er wälzte sich von links nach rechts und von rechts nach links, Inga hatte längst ihren angestammten Platz zu seinen Füßen preisgeben und sich in seinen Tramperrucksack verkrochen. Er schloss die Lider und öffnete sie wieder und sah so oder so dieselben irrlichternden Bilder vor seinen Augen. Bilder von Mord und Totschlag, Anklage und Gefängnis. Er hielt es nicht länger aus. Mittlerweile war es kurz vor drei und draußen einigermaßen ruhig, aber das half nun auch nicht mehr. Er musste hier raus! Wie lautete sein Plan – das Überraschungsmoment nutzen? Dann war jetzt der richtige Zeitpunkt. Mikki, der vor dem Hotel patrouillierte, sah auf die Uhr. Noch elf Minuten, hoffentlich kam der Boss pünktlich. Es fiel ihm immer schwerer, die Augen offenzuhalten; er war müde wie ein Murmeltier auf Valium. Mirandor hatte es gut, der lag im Bett und schlief. Gähnend blickte er zu dessen dunklem Zimmer hinauf. Um Inga nicht zu wecken, ließ Jesús das Licht aus, die Leuchtreklame am Haus genügte. Dann fiel ihm ein, dass es vergebliche Liebesmüh war, die Pistole befand sich im Rucksack. Er versetzte Inga einen Stups, was sie mit einer Unmutsbekundung quittierte. Doch bald siegte die Neugier. Sie umkreiselte seine Beine, wie um zu sagen, er werde keinen Schritt ohne sie machen. Keine Chance, diesmal musste sie dableiben. Dachte er. Und konnte nicht so schnell schauen, wie sie durch den Türspalt schlüpfte. »Halt!«, zischte er ihr hinterher, doch Inga war nicht zum Diskutieren aufgelegt. Geschmeidig stieg sie die Treppe hinab. Am untersten Absatz angelangt, bemerkte sie die noch halb geöffnete Eingangstür. Sie gab Gas, huschte an dem die Treppe hinaufgehenden Paar vorbei und schlüpfte durch die Tür. Jesús würde schon nachkommen. Als das Paar aufgetaucht war, hatte sich Mikki in einem Hauseingang versteckt. Er beobachtete, wie sich die Hoteltür langsam zuzog. Jetzt konnte er seinen Trott wieder aufnehmen. Er näherte sich gerade der Tür, da schoss unverhofft etwas Schwarzes heraus. Es kam direkt auf ihn zu. Es fauchte. Gott bewahre! Sich zu bekreuzigen und zurückzuweichen war eins. Mikki ging hinter der Hausecke in Deckung und atmete tief durch. Noch nie hatte ihn jemand in die Flucht geschlagen – nur war diese mysteriöse Katze kein normaler Jemand. Trotzdem, er hatte einen Auftrag, und wenn es ihn das Leben kostete. Er linste um die Hausecke. In diesem Moment näherte sich S von hinten, einigermaßen überrascht, Mikki in gehockter Position mit der Waffe im Anschlag vorzufinden. Keine zehn Sekunden später warf S selbst einen Blick um die Hausecke. Niemand zu sehen, keine Katze, kein Mensch – eine leere Gasse. Er dachte nach. Hatte Mirandor sich etwa zu einem nächtlichen Besuch aufgemacht? Aber wenn er zum Major wollte, hätte er an dieser Gasse vorbeikommen müssen. Es passte auch nicht in Mirandors Persönlichkeitsprofil, mitten in der Nacht auf Überfallkommando zu machen. Nein, entschied er, entweder hatte Mirandor die Katze rausgelassen oder Mikki hatte halluziniert, eine Folge der Übermüdung und des Aberglaubens. Der Mann im Schatten der schräg gegenüberliegenden Hofeinfahrt wusste es besser und fluchte stumm vor sich hin. Er hätte nicht zögern dürfen, als Katze und Herrchen den Weg in die Altstadt eingeschlagen hatten. Jetzt war der Gegner zu zweit, und immer hatte einer von beiden die Hofeinfahrt im Blick. Er kam hier nicht unbemerkt weg. MARSCHBEFEHL | D-EPPSTEIN/TAUNUS Um Punkt halb vier in der Früh betrat Iwan das Mannschaftsquartier und schaltete die Deckenbeleuchtung ein. Die nach Spanien abkommandierten Männer sprangen aus ihren Betten und begaben sich in die Gemeinschaftsdusche. In zwanzig Minuten würden sie im Hof antreten, wo bereits ein Kleinbus bereitstand, um sie zum Flughafen zu transportieren. Iwan nahm die Treppen zum Keller. Vor dem Ölkessel aktivierte er den in einer Schalttafel versteckten Augenscanner. Von einer hydraulischen Anlage bewegt, öffnete sich die Kesselwand, in deren gut zwanzig Zentimeter tiefem Hohlraum Öl schwappte. Er betrat die gut sechzig Quadratmeter große Schaltzentrale. Der Salvator und Henry saßen am ovalen Konferenztisch und sahen sich auf dem zentralen Bildschirm Karten der Provinz Tarragona an. An den Großbildschirm schlossen sich längs der Seitenwände kleinere Monitore an, von denen acht eingeschaltet waren. Davor saßen Koordinatoren und Rechercheure an Pulten mit eingelassener Computertastatur. Zwei der Monitore dienten im Moment der Überwachung von Kandidaten. Sie bildeten die aktuellen Einsatzorte auf Landkarten ab: Ein rot blinkendes Licht markierte den Standort eines Kandidaten, die blauen Lichter seine »Schatten«. Am unteren Rand liefen Textbänder mit Nachrichten, welche die beiden Koordinatoren verfolgten. Die anderen Monitore blendeten Informationen von den internationalen Finanzmärkten und politischen Schauplätzen ein, ergänzt durch Agentenberichte. Die Rechercheure sichteten das Material, unterzogen es einer ersten Bewertung und leiteten es an den Nachrichtenoffizier weiter, der in einem verglasten Büro saß. Iwan klopfte einem der Koordinatoren auf den Rücken. »Na, Peetu, alles in Ordnung bei dir?« »Ja, nur etwas Stress in Belgien.« Er deutete zum Bildschirm, auf dem gleich vier blaue Lichter um ein rotes herum blinkten. »Erhöhte Alarmbereitschaft wegen Suizidgefahr.« Iwan sah ein, dass die Kandidaten geschützt werden mussten, zur Not auch vor sich selbst – sie wurden ja noch gebraucht. Auch wäre ihm nicht der Gedanke gekommen, den zivilen Umgang mit ihnen, ein schnuckeliges Apartment hier und ein Tässchen Tee dort, infrage zu stellen. Der Salvator wollte es so und der Salvator wusste warum. Doch tief in seinem Innersten behagte es ihm nicht, dass ausgerechnet die Verderbtesten der Verderbten, die Inkarnationen des Bösen, geschützt und gehätschelt werden mussten, bevor … »Wir gehen hoch«, unterbrach der Salvator seinen Gedankengang. »Die Mannschaft bereit?« »Abfahrt in zehn Minuten.« »Was ist mit Daniel?« »Kommt direkt zum Flughafen, Salvator. Was passiert mit dem Gast?« »Ich gebe dir gleich Bescheid. Besorge mir inzwischen einen Tee.« Während der Salvator ins Kaminzimmer ging, hörte er draußen ein anschwellendes Knattern. Der Hubschrauber flog ein, um ihn zum Frankfurter Flughafen zu bringen. Von dort ging es mit dem Learjet nach Spanien. Die Fluggeräte waren keine Statussymbole, sondern Mittel zum Zweck, derer er sich nach Möglichkeit nicht selbst bediente. Seine Maxime lautete, niemanden stutzig zu machen, wie er sich dies alles in seiner Position leisten konnte und vor allem, wofür er es brauchte. Nur nicht auffallen. Dass wegen der Reise nach Spanien ein wichtiger Termin platzen würde, passte nicht in dieses Konzept. Er nahm es notgedrungen in Kauf, denn das Gespräch mit S hatte ihn alarmiert. Noch war nicht ein einziger Dominostein gefallen, doch sein Seismograf zeigte ihm Erschütterungen an, die gefährlich werden konnten. Allein die Tatsache, dass Mirandor den Major aufgespürt hatte, offenbarte unerwartete Risse in der Sicherheitsarchitektur. Im Nachhinein erwies es sich als Fehler, dass Fárdome damals verschont worden war – trotz des Verdachts, er habe etwas mitbekommen. Zwar konnte der Major weder das aus dem Zusammenhang gerissene Puzzlestück deuten, noch vermochte er angesichts der hermetischen Abschottung auch nur zu ahnen, wohin die Spur führte. Aber es blieb ein Restrisiko im Hinblick auf Mirandor, denn es fehlte an Erfahrung, was die Information gegebenenfalls bei ihm auszulösen vermochte. Dieses Risiko durfte er nicht eingehen, weshalb er die Sache wohl oder übel selbst in die Hand nahm. Lediglich eine Frage war noch offen, und sie war wichtig: Was sollte mit Kandidatin IX-α alias Anna Heydt geschehen? Vieles sprach dafür, sie im Haus zu belassen, zu dem bloß der innerste Zirkel freien Zugang hatte – die Treuesten der Treuen. Nur konnte sich niemand um die seelische Balance von IX-α kümmern wie er selbst. Die hohe Kunst der emotionalen Tarierung, das wohldosierte Anziehen und Lockern der Stellschrauben, hatte er sich in Ewigkeiten angeeignet. Es galt, IX-α exakt auf den Punkt zu bringen, wie ein gekochtes Ei, das nur in einer bestimmten Konsistenz zu gebrauchen ist. In dieser Endphase, kurz vor dem Stichtag, durfte er nichts mehr dem Zufall überlassen. Was dafür sprach, Heydt einen Ausflug zu gönnen. Das Quartier in Spanien bot ausreichend Platz. Daniel, sein Experte für die Einsatzgebiete Spanien und Lateinamerika, hatte es kurzfristig besorgt. Eigentlich die Aufgabe von S, doch der machte in letzter Zeit zu viele Fehler und riskierte gerade, Objekt einer speziellen Zeremonie zu werden. Noch nie hatte er einen seiner Vertrauensmänner geopfert, denen er gewisse Hintergründe offenbarte, wenngleich nicht den Kern, um den alles sich drehte. Analytisch überzeugend, vor allem bei der Erstellung der Psychogramme, zeigte S in der Praxis inakzeptable Schwächen. Das Experiment, einen Intellektuellen auszuwählen, hatte sich nicht bewährt. Khaled, der Nachfolger, stand bereits in den Startlöchern. Er war wieder aus dem alten Holz geschnitzt: nibelungentreu, effizient und ohne moralischen Ballast. Aber ein paar Jahre benötigte er noch. Iwan brachte den Tee. »Heydt soll sich bereit machen. Sie wird uns begleiten.« RITTERRUNDE | E-TARRAGONA S hatte Mikki sicherheitshalber ums Karree geschickt, um die Lage zu sondieren. Er hatte Mirandor nicht gesichtet. Natürlich nicht. Mirandor lag brav im Bett und schlief. Oder doch nicht? Was, wenn er, in die Enge getrieben, von seinem normalen Handlungsmuster abgewichen war? Wieso hatte er diese Möglichkeit nicht sofort ins Kalkül gezogen? Ihm schien, als blinke eine riesige Leuchtreklame in seinem Hinterkopf: Murphys Gesetz – blink – Murphys Gesetz. »Verflucht noch mal, Mikki, ich will jetzt wissen, ob er noch im Hotel ist.« »Kann nachschauen, nur M kriegt das vielleicht mit, Boss.« »IST MIR SCHEISSEGAL!« »Psst!« Mikki zog den Revolver unter seiner Manteltasche und schlug mit dem Griff die Glasscheibe der Hoteltür ein. Kurze Zeit später stürmte er aus dem Haus. »Geflohen!« »Wir müssen zum Auto!« »Dauert zu lange, Boss. Will bestimmt zu F. Ich laufe und fange ihn!« Jesús bemerkte erst spät, dass er sich mal wieder verlaufen hatte. Auf seinen Desorientierungssinn war noch stets Verlass gewesen. Wahrscheinlich hätte er am Hotel gleich in die andere Richtung abbiegen müssen, um auf die Via Augusta zu gelangen. Stattdessen irrte er durch ein Labyrinth menschenleerer Altstadtgassen. Er versuchte sich vorzustellen, welche Richtung er genommen hatte. Es war die ganze Zeit bergauf gegangen, was dafür sprach, dass er sich auf dem Hügel befand, der parallel zur Via Augusta verlief. In diesem Fall wäre er nicht ganz falsch. Er bog in eine nach rechts abzweigende Gasse ein. Irgendwo am Rande des Hügels führte hoffentlich ein Weg hinab. Ein Geräusch. Er blickte sich um, konnte in der verwinkelten, nur vom Zwielicht kleiner Laternen erhellten Gasse aber nichts erkennen. Er lauschte. Nichts. Geh einfach weiter. Da war es wieder! Ein Knirschen, wie Schritte über Sandkörner. Irgendwo hinter ihm. Ein Verfolger? Er ging schneller, horchte. Auch das knirschende Echo schien sich zu beschleunigen. Hastig verbarg er sich in einem Hauseingang. Jetzt hörte er nichts mehr, aber wie sollte er auch bei seinem Herzklopfen. Er verharrte eine gefühlte Stunde regungslos im Schatten des Eingangs, ohne mehr als gespenstische Stille zu vernehmen. Wahrscheinlich nur Einbildung. Und wenn nicht, kann ich es auch nicht ändern. Ihn überkam so etwas wie Schicksalsergebenheit – die wie eine Seifenblase platzte, als er vergebens nach Inga Ausschau hielt. Das fehlte ihm noch. Sie zu rufen, traute er sich nicht, weshalb er es mit einem Miauen versuchte, für das sie ihm wahrscheinlich einen Vogel zeigen würde. Tat sie nicht. Stattdessen rieb sie ihren Kopf an seinem Bein. Da unten, neben ihm im Hauseingang, hatte er sie glatt übersehen. »Du hast dich versteckt? Gut gemacht! Komm, es geht weiter, wir wollen zum Major.« Dahin wollte auch der Mann, der im gleichen Moment beim römischen Zirkus in die Rambla Vella einbog und von dort weiter in Richtung Via Augusta rannte. Er war nie ein guter Läufer gewesen und schnaufte bereits. Angestrengt stierte er nach vorn, ob sich irgendwo der Schattenriss einer Person samt Vierbeiner abzeichnete. Hoffentlich kam er nicht zu spät. Jesús fand bei einem kleinen Spielplatz eine Treppe, die nach unten führte. Grübelnd stieg er die Stufen hinab. Wie wollte er den Major eigentlich dazu bewegen, mitten in der Nacht aufzumachen? Und wann genau sollte er die Waffe zücken? Und was würde passieren, wenn der Major ebenfalls bewaffnet war? Plötzlich erklang eine Melodie in seinem Kopf, ein Lied aus Hair. Dann sah er vor seinem inneren Auge Soldaten marschieren … Manchester, England, England, across the Atlantic sea … sah den verzweifelten Berger mitmarschieren, einen Stahlhelm auf den kurzgeschorenen Haaren, and I’m a genius genius … sah ihn im Bauch eines Flugzeugs verschwinden … and I believe that god believes in Claude – that’s me. Gestern noch war es nur ein Film gewesen und er selbst nichts als ein passionierter Lehrer, der gern auf einer sonnigen Empore an der Hofmauer döste oder mit Freunden auf der Plaza Larga hockte. Gestern. Das war weit weg. Der Mann auf der Via Augusta befand sich jetzt an der Abzweigung zu Fárdomes Haus. Keuchend hielt er an. Keine Menschenseele zu sehen. Offenbar hatte er mit seiner Vermutung falsch gelegen. Was nun? Entschlossen drehte er um und lief so schnell er konnte zurück. Aber richtig schnell konnte er nicht mehr. Nur deshalb fiel ihm der kleine, bodennahe Schatten auf, der plötzlich aus einer Gasse auf der anderen Straßenseite auftauchte und eine Mauer beschnupperte. Jesús betrat die Via Augusta und stellte überrascht fest, wie nahe er dem Ziel war. Nichts anderes hatte er sich gewünscht, trotzdem schluckte er. Der Moment der Auseinandersetzung stand unmittelbar bevor. Er überquerte mit Inga die Straße. Noch immer wusste er nicht, wie er die Konfrontation bestehen sollte. Er versuchte, seine Wahrnehmung nach innen zu richten, auf seinen Angriffsplan. Vielleicht bemerkt er deswegen den Mann nicht, der sich von hinten näherte. Erst als der Verfolger bis auf wenige Meter herangekommen war, registrierte Jesús etwas. Seine Wahrnehmung stülpte sich schlagartig nach außen. Irgendwas stimmt hier nicht! Abrupt drehte er sich um und sah eine schwarze Gestalt auf sich zukommen. Jesús stolperte einen Schritt zurück. Die Pistole! Seine Hand fuhr unter das Sweatshirt, doch seine Finger verfingen sich in den Falten des Stoffs, er bekam das Scheißding nicht zu fassen. Verzweifelt zerrte er das Sweatshirt beiseite. Er riss die Waffe raus, bereit, zum Äußersten zu gehen. Den Zeigefinger um den Abzug gekrallt, schnellte seine Hand hoch – und wurde auf halbem Weg jäh gestoppt. Sein Handgelenk steckte in etwas, das sich wie ein Schraubstock anfühlte. »Ruhig, Junge, ganz ruhig.« Eine Hand nahm ihm die Pistole ab und öffnete das Magazin. Es war leer. Das hatte Jesús in der Aufregung ganz vergessen. »Los, vorwärts, wir haben keine Zeit. Ich hole den Major. Wir müssen ihn mitnehmen, sonst bringen sie ihn um. Sind wahrscheinlich schon unterwegs. Komm endlich.« In seiner Verwirrung fügte sich Jesús. »Ich gehe jetzt rein, du verbirgst dich hinter der Straßenecke da vorn. Uhrenvergleich: siebzehn nach vier. Wenn ich bis halb fünf nicht zurück bin, musst du verschwinden. Aber nicht ins Hotel, da erwarten sie dich.« »Warum …?« »Später.« Während Mikki schwer atmend in die Straße einbog, liefen Carlos und der Major auf die Abzweigung zu, hinter der Jesús wartete. Mikki hatte freie Sicht. Eine ganze Sekunde befanden sich die beiden in seinem Blickfeld. Er musste sie sehen. Doch Mikkis Augen tränten vor Übermüdung. Jesús starrte Fárdome an. Er tat sich schwer, in dem Klappergestell einen Mörder oder Mordgehilfen auszumachen. »Kommt, wir müssen weiter«, trieb Carlos sie an. »Mein Wagen steht nicht weit von hier.« Keiner hatte es eiliger als der Major, bemerkte Jesús überrascht. Carlos hatte offenbar keine Gewalt gebraucht, um ihn zu überzeugen. Angst war immer noch das beste Bewegungsprogramm. Der Virus beherrschte Fárdome dermaßen, dass er auf seinen morschen Storchenbeinen zu sprinten versuchte. Carlos bremste ihn. »Langsam, wir wollen dem Feind nicht in die Arme rennen.« Nach zweihundert Metern bogen sie rechts ab. »Ihr bleibt hier, immer schön im Dunkeln, ich komme mit dem Wagen. Blauer Seat.« Jesús sah sich besorgt nach Inga um. Der Dickkopf würde bestimmt nicht anstandslos in ein fremdes Auto springen. Er kniete sich auf die Straße und rief sie. Inga kam, hielt aber Sicherheitsabstand. Klar, das ganze Spektakel musste ihr höchst suspekt sein, beinahe meinte er, ihre Barthaare von der Spannung in der Luft vibrieren zu sehen. »Komm schon, mach keine Zicken«, flehte er, während ein blauer Seat in die Straße einbog. »Vorwärts«, trieb der Major ihn an. »Inga, bit-te!« Sie setzte sich und betrachtete ihn skeptisch. Vielleicht überlegte sie, ob sie sich bislang nicht ein völlig falsches Bild von ihm gemacht hatte. »Komm endlich«, schnauzte der Major und zog Jesús unversehens am Kragen hoch. Er verlor das Gleichgewicht und stieß mit dem Kopf gegen die Hauswand. Benommen rappelte er sich auf – und sah Inga in Carlos’ Arme schlüpfen. Wie hatte er das jetzt wieder angestellt? Sie fuhren durch eine Unterführung und bogen nach rechts auf eine Straße, die zwischen Strand und Bahngleisen verlief. Jesús kniete auf der Rückbank und starrte durch die Heckscheibe in die Nacht. Nirgends Scheinwerfer auszumachen. Im Hafengebiet hielt Carlos an. Was denn, hatte er die Flucht per Schiff organisiert? »Gib mir dein Handy, Jesús.« Er nahm es, stieg aus und schob es unter die Plane eines LKW. Über den Grund musste Jesús nicht lange nachgrübeln, er hatte schließlich auch schon mal einen Krimi gelesen. Dass er nicht selbst daran gedacht hatte, zeigte nur, wie stümperhaft er sich immer noch anstellte. Er musste schleunigst lernen, die Welt mit den Augen eines flüchtigen Verbrechers zu betrachten. Um einen Anfang zu machen, erkundigte er sich, wohin sie fuhren. »Nach Salou. Kommt in ein paar Kilometern. Eine Bettenburg. Da kann man sich erst mal verschanzen. Unser Freund hat da ein Apartment.« Fárdome, der erschöpft im Polster versunken war, richtete sich auf. »Woher weißt du das?« »Klappe, Major, ich weiß es eben.« »Und die Unterlagen – Kaufvertrag und was es sonst noch alles gibt?« Jesús erinnerte sich, wie Carlos von Brútos Kontoauszügen auf seine Zweitwohnung geschlossen hatte. »Wenn die das Zeug finden, wissen die doch, wo sie uns suchen müssen.« Fárdome sah erstaunt auf. So viel Weitsicht hatte er dem unbedarft wirkenden Jüngling nicht zugetraut. »Offiziell gehört es einer politischen Vereinigung, hinter der sich eine alte Seilschaft verbirgt«, stellte Carlos klar. »Du hast keine Dokumente, das wurde alles per Handschlag zwischen dir und den Amigos geregelt, richtig, Fárdome?« Er beobachtete den Major im Rückspiegel. »Ja. Teile es mir mit ein paar Kameraden. Wir treffen uns da manchmal. Aber im Moment ist es bestimmt leer.« Fárdomes Unterschlupf befand sich im obersten Stockwerk eines größeren Apartmenthauses. Obwohl das Haus nicht gerade in vorderster Reihe stand, konnte man das Meer vom Balkon aus sehen oder zumindest erahnen, noch herrschte draußen Dunkelheit. Sie setzten sich um einen runden Tisch im Wohnzimmer und tranken Instantkaffee, der zumindest die richtige Temperatur besaß. Carlos wollte die Gefechtslage erläutern, als Jesús ihn unterbrach. »Ich muss erst wissen, weshalb du hier bist.« »Verstehe«, brummte Carlos. Fárdome solle mal weghören. Der Alte stand auf und schlurfte zum Flur. »Muss eh aufs Klo. Kann dauern, die Verdauung, wisst ihr, es ist ein Elend, die will nicht …« »Spar dir die Details!« Während Carlos die Toilette inspizierte, fragte Jesús sich, wie der Major denn von hier oben aus dem Bad fliehen sollte. Vermutlich ging Carlos einfach einer alten Gewohnheit nach. In Zeiten, da Mord und Totschlag in Spanien noch zu den Mitteln der politischen Auseinandersetzung gehört hatten, war paranoide Vorsicht vielleicht überlebenswichtig gewesen. »Wieso ich hier bin? Weil du sonst jetzt vielleicht schon tot wärest, du verkehrter Don Quijote. Du gehst die Sache an, als müsstest du nur gegen Windmühlen kämpfen.« Jesús lief rot an und sah zu Boden, bis er Carlos’ Pranke auf seiner Schulter spürte. »Ohne deinen Sancho Pansa kannst du diesen Kampf nicht bestehen«, sagte er mit schiefem Grinsen. »Woher wusstest du eigentlich, dass ich in Tarragona bin?« »Von der Polizei. Kontakte. Du weißt schon: Ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt.« »Die Polizei weiß, wo ich bin?« »Die Guardia, ja. Die haben dein Handy geortet. Könnte sein, dass mittlerweile auch ein Haftbefehl gegen dich ergangen ist.« Jesús stöhnte. »Die beiden Typen, vor denen wir getürmt sind, sind natürlich nicht von der Guardia. Ein dünner Blonder, Typ Intellektueller, und ein Bodybuilder mit Pferdeschwanz. Ich glaube, sie haben deutsch gesprochen. Haben vor deinem Hotel Wache gestanden und dich trotzdem entwischen lassen. Keine Meisterleistung, aber wir wollen sie nicht unterschätzen. Die Ratten kommen aus den Löchern und wir wissen noch nicht, wie viele es sind. Wahrscheinlich hat sie unser Besuch bei Brúto aufgeschreckt. Der ist übrigens tot.« »Tot?« Jesús erbleichte. »Doch nicht wegen mir?« »Doch, davon müssen wir ausgehen. Die beseitigen Spuren, die man zurückverfolgen könnte. Fárdome ist wahrscheinlich der Nächste auf ihrer Liste.« »Warum …« Jesús versagte die Stimme. »Warum, ich meine, die könnten ja einfach …« »Dich beseitigen? Es sieht fast so aus, als bräuchten die dich noch. Fragt sich also wofür. Wie wäre es mit einer Beichte?« »Wie hast du mich gefunden?« »Mit ein bisschen Glück. Da du im Umfeld der Plaça de la Font geortet wurdest, habe ich mich dort umgesehen.« »Und warum hat mich die Polizei nicht längst verhaftet?« »Ist eine politische Geschichte, da stellt sich jemand quer.« »Etwa Gorpón?« »Genau der. Er glaubt, dass er ausgetrickst werden soll. Dahinter könnten die Leute stecken, die Brúto eliminiert haben.« »Und weshalb lebt Fárdome noch?« »Vielleicht ging alles zu schnell. Wahrscheinlich hast du sie überrascht, mich übrigens auch. Einfach mal ins Haifischbecken springen und schauen, was passiert, Junge, Junge.« Jesús nickte geistesabwesend. Er versuchte gerade, die Übersicht zu behalten: Er war Opfer, nicht Täter, und wenn er Brútos Ermordung verursacht haben sollte, trug er trotzdem keine Verantwortung dafür. Gar nicht so leicht, das auseinanderzuhalten. »Deine Beichte steht noch aus, Jesús.« »Ich habe nichts zu beichten, verstanden?« Er sprang auf. »Keine krummen Dinger, nichts, gar nichts, kapiert?« »Was ist mit der toten Ausländerin?« »Überhaupt nichts! Ich habe genau ein Mal mit ihr geschlafen, sonst nichts.« »Und der Brief?« »Du bist doch der Allwissende, erklär du mir doch, warum sie diesen komischen Brief geschrieben hat. Ich hab jedenfalls keine Ahnung.« »Und was ist mit der Krankenhausgeschichte? »Lass mich mit Málaga in Ruhe! Ich hab mit den Todesfällen …« »Psst, sprich leiser.« »Ich habe mit den Toten da nichts zu tun. Aber vielleicht reicht es ja, sich in meiner Nähe aufzuhalten, um in Lebensgefahr zu geraten. Meine Eltern sind gestorben, Emily ist tot und Brúto hat auch dran glauben müssen.« »Komm, setz dich.« Jesús nahm wieder Platz. Er zitterte. »Du solltest dich aus dem Staub machen, Carlos. Ich hab offenbar die Pest am Leib.« »Mach dir um mich keine Sorgen, ich habe schon andere Kämpfe ausgefochten.« »Ich kapiere immer noch nicht, warum du das alles für mich machst, Erkundigungen einholen, nach Tarragona fahren, dich in Gefahr bringen.« »Weil ich dich … Weil du in Ordnung bist.« »Was heißt das?« »Damit ist alles gesagt.« »Nein, Carlos, ist es nicht! Was steckt dahinter?« »Fárdome, alles in Ordnung?« »Ja, ja, lenk mich nicht ab«, krächzte es von jenseits der Badezimmertür. »Wieso ich dir helfe? Weil ich dich mag, nun weißt du es.« Er stöhnte abfällig, um dem Erklärungsnotstand ein Ende zu machen, doch es gab offenbar Worte, die noch gesagt werden wollten: »Ich hatte einen Sohn, Francisco, der war dir sehr ähnlich, mutig, aber unbedarft. Auch so ein Ritter von der traurigen Gestalt, der meinte, es mit einem übermächtigen Gegner aufnehmen zu können. Hat sich auf die Seite der Sozialisten geschlagen. Dabei hat er vielleicht weniger gegen Franco als gegen mich gekämpft. Wer weiß. Jedenfalls hat er es nicht überlebt. Ihm habe ich damals nicht helfen können, dir kann ich helfen. – Reicht das jetzt?« Jesús schwieg eine Weile. Dann reichte er Carlos schlicht die Hand und nickte. »Zu Fárdome: Du hast allen Grund, ihm an die Gurgel zu gehen. Aber wir erfahren mehr von ihm, wenn er sich nicht bedroht fühlt.« »Ist mir klar.« »Fárdome, Zeit zum Antreten!« »Ja, ja, ich bin so weit.« Eine Viertelstunde später hatte Carlos den Major ins Bild gesetzt. Brútos Tod erwähnte er nicht, der Alte schwankte auch ohne diese Information zwischen Zittern und Erstarren. Diese Nacht würden sie im Apartment verbringen, entschied Carlos. »Morgen suchen wir uns was Neues. Wir bleiben im Ort, der wird erst mal unsere Basis, unübersichtlich und nahe genug am Feind. Wir halten uns bedeckt, doch wir bleiben auf der Lauer. Mich kennen die nicht …« »Brúto konnte dich beschreiben«, hakte Jesús ein. Er fand Carlos’ Optimismus erstaunlich blauäugig. »Der konnte irgendeinen Alten beschreiben.« »Viel mehr hast du über den Major auch nicht gewusst. Und deine Erscheinung ist noch markanter.« »Ich bin auf Fárdome nur gekommen, weil ich ihn kannte. Das hier ist mein Revier – die sind bloß Ausländer.« »Die hier vielleicht schon seit Jahrzehnten operieren.« Carlos betrachtete Jesús belustigt. »Du entwickelst dich ja zu einem richtigen Profi. Morgen sehen wir weiter. Ihr zwei legt euch jetzt aufs Ohr, ich halte unten im Foyer Wache. Hast du gehört, Fárdome?« Der Major saß eingesunken am Tisch und reagierte nicht. Vorsichtig hob ihn Carlos vom Stuhl und trug ihn ins Schlafzimmer. »Nicht schlappmachen«, flüsterte er. »Wir müssen wissen, was du weißt.« LEBENSEINSTELLUNG | LUFTRAUM ÜBER FRANKREICH Um fünf Uhr sechsundvierzig rollte ein Learjet 60 des kanadischen Herstellers Bombardier am Frankfurter Flughafen auf seine Parkposition. Die zweistrahlige Maschine besaß eine maximale Reisegeschwindigkeit von 859 Stundenkilometern und eine Reichweite von gut 4.000 Kilometern. Während sie auf den schnittigen Flieger mit der spitzen Nase zugingen, machte sich Anna auf ein ledergepolstertes Luftschlösschen gefasst, doch die enge Kabine mit den filzbezogenen Klappsitzen erinnerte eher an einen eingelaufenen Truppentransporter. Im vorderen, durch eine Zwischenwand abgetrennten Abteil erwarteten Anna und ihren Gastgeber zwei komfortablere Sessel. Sonst saß wahrscheinlich Henry auf ihrem Platz. Dieses Mal musste er mit Iwan bei der Mannschaft sitzen, die dem Getrampel nach gerade einrückte. Durch die offenstehende Cockpittür sah Anna zwei Piloten. Nachdem die Maschine abgehoben hatte, erkundigte sich Alexander, wie sie den Meister seit gestern nennen durfte, ob sie Flugangst habe. »Nachdem Sie einen in der Mangel hatten, fürchtet man nichts mehr.« Er wiegelte mit dem für ihn typischen leeren Lächeln ab. »Wir fliegen also nach Spanien? Aber nicht, um Urlaub zu machen, sonst hätten Sie Ihre Truppe nicht dabei.« Es handle sich um eine Geschäftsreise, bestätigte er, das Ziel sei die Costa Dorada. »Und da machen Sie Geschäfte, Alexander? Was denn für welche?« Er ging nicht darauf ein. Stattdessen berichtete er von dem Haus mit Swimmingpool, das er gemietet hatte; es werde ihr gefallen. »Haus? Wird wohl ein Anwesen sein, unter XXL machen Sie es doch gar nicht. Ist das Ihr eigener Flieger? Wo haben Sie eigentlich die Groschen her, so ein Ding zu erschwingen.« »Schlafen Sie.« »Wie befohlen.« Sie schlief wirklich bald ein. Mitten in der Nacht aus dem Bett gerissen zu werden, war ja auch eine Zumutung, selbst wenn man keinen in der Krone hatte. Obwohl die Zeit eigentlich zu kostbar zum Verpennen war: Die freundliche Phase, die ihr Gastgeber offenbar eingeleitet hatte, würde nicht allzu lange währen. Dem Zuckerbrot folgte die Peitsche gewöhnlich auf dem Fuße. Als sie wieder erwachte, strahlte die Sonne durch die Scheiben. Der Meister zog die Kopfhörerstöpsel aus den Ohren und berichtete von der erfreulichen Wettervorhersage für die Ostküste Spaniens. Er verfiel dabei in perfekt imitierten Plaudertaschenton, den allerdings sein Laserblick Lügen strafte. Trotzdem überkam Anna Vorfreude bei der Vorstellung, noch ein paar Tage die Sonne zu genießen, bevor … Nein, daran mochte sie jetzt nicht denken. »Könnte ich auch in Spanien …? Ich meine: danach.« »Kein Gespräch über unsere Abmachung, wenn wir nicht unter uns sind. Vergessen Sie das nie.« Anna hasste es, wenn er ihr mit dieser Schärfe kam. Absurderweise fühlte sie sich meistens nicht schlecht in seiner Nähe. Seine Bestimmtheit war wie ein Anker in umtoster See. Aber diesen speziellen Tonfall konnte sie nicht ab. »Und was, wenn ich Ihr kleines Geheimnis verrate?«, stichelte sie. »Was wir verabredet haben. Auf mich ist Verlass.« Verabredet? Der Typ hatte sie nicht alle. Sie hatte sich lediglich angehört, was er ihr für den Fall des »Geheimnisverrats« in Aussicht stellte. »Gemach, bleiben Sie cool. Sehen Sie etwa jemanden? Oder meinen Sie, Ihre Leute hängen mit dem Ohr an der Kabinenwand? Die sind Ihnen doch mit Haut und Haar verfallen.« Er schaltete wieder auf Plauderton um: »Wenn Sie sich Spanien wünschen, dann wird es Spanien werden.« »Schön. – Ich meine natürlich: Blödsinn! Wollte nur mal testen, wie weit Sie mit Ihren Versprechen gehen. Aber wenn Sie denken, dass ich Ihnen das abkaufe …« »Ich werde meinen Teil erfüllen.« »Quatsch! Niemand vermag das. Ein Ammenmärchen!« »Ich kann es.« Dass er es konnte, war sie selbst der beste Beweis. Nur konnte er diesen Beweis nicht führen, ohne ihr gewisse Dinge zu enthüllen, die sie verständlicherweise irritieren würden. »Das Ammenmärchen selbst mögen Sie vielleicht nicht glauben. Aber mir glauben Sie.« Seine Selbstsicherheit war auf unangenehme Weise attraktiv. Und ganz falsch lag er nicht. Sie sah ihn noch vor sich, wie er – mit der Waffe in der Hand – sein Angebot unterbreitet hatte. Sie hatte spöttisch gefragt, wo die Versteckte Kamera untergebracht sei, doch er hatte mit eisigem Lächeln entgegnet, er habe keinen Grund, etwas zu erfinden, da sie sich ohnehin in seiner Gewalt befände. Sie musste ihm recht geben. Selbst seine anfängliche Brutalität hatte er später plausibel damit begründet, er habe jeden Zweifel an der Ernsthaftigkeit seines Anliegens im Keim ersticken müssen. Nein, er hatte nicht wie ein Verrückter auf sie gewirkt, und was immer sie danach erlebt hatte, bestärkte diesen Eindruck nur noch. Vor allem seine gefühlsfreie Kälte. Trotzdem: Niemand vermochte, was er ihr versprochen hatte! »Alles Schwachsinn! Von Ihnen lasse ich mich bestimmt nicht nasführen.« Statt zu antworten betrachtete er sie stirnrunzelnd. »Glotzen Sie mich nicht so an!« »Warum sind Sie überhaupt hier, wenn Sie mir nicht glauben?« »Das heißt noch lange nicht, dass ich wirklich mitmachen werde. Anscheinend unterliegt meine Mitwirkung ja einem Freiwilligkeitsgebot«, höhnte sie. Er verbarg nur mit Mühe sein Erstaunen über ihre Wortwahl. Sie hatte den Terminus technicus getroffen – hoffentlich nur ein bemerkenswerter Zufall. Das Freiwilligkeitsgebot hatte er in der Tat strikt zu befolgen. Er durfte sie über seine wahren Motive und die Hintergründe seines Angebots täuschen, zwingen hingegen durfte er sie nicht. Es würde die Zeit kommen, Rechenschaft darüber abzulegen. Der Rat würde ihn mit peinlicher Genauigkeit befragen. Und den Rat konnte man nicht belügen. Die Mehrheit seiner achtzig Kandidaten machte ihm die Sache leicht, es bedurfte lediglich kleiner Impulse, um ihre Einwilligung herauszukitzeln; die am wenigstens mit dem anzufangen wussten, was er ihnen anbot, waren gewöhnlich am versessensten darauf. Will haben! Die Nimmersatts griffen zu, ohne den geringsten Antrieb, das kostbare Gut wirklich zu nutzen. Diese Lebenseinstellung hatte ihm sein Geschäft im Laufe der Zeit zunehmend erleichtert. Nur eine Minderheit bedurfte intensiverer Überzeugungsarbeit. Er besaß genügend Routine, auch diese Fälle problemlos zum Abschluss zu bringen. Einige wenige allerdings stellten eine echte Herausforderung dar. Er musste diese Widerborstigen bis ans Ende der Sackgasse treiben, wo aus es nur noch den einen Ausweg zu geben schien – den er ihnen wies. Er hätte sie austauschen können, längst war der Pool groß genug. Doch er tat es nicht. Denn er benötigte die Störrischen als Gegengift. Sie halfen ihm, die toxischen Gedanken an die allumfassende Langeweile zu neutralisieren, die ihn gelegentlich lähmten. In solchen Momenten lechzte er nach einem Kandidaten, der für Ablenkung sorgte. IX-α war dafür noch stets gut gewesen. Für sie hielt er sogar einen besonderen Bonbon in der Hinterhand. Er hoffte, ihn nicht zu benötigen, weil es die Sache komplizierte, aber wenn die bittere Medizin nicht die gewünschte Wirkung zeigen sollte, würde sie die zuckersüße Versuchung bekommen. Sie würde danach gieren. »Das ›Freiwilligkeitsgebot‹ gilt, Anna. Unser Handel kommt nur zustande, wenn Sie es wollen.« »Erst drehen Sie mich so lange durch den Fleischwolf, bis bloß noch Gehacktes von mir übrig ist, und dann kommen Sie mir mit Freiwilligkeit, das ist krank.« Anna hatte ihn schon häufiger mit der Unterstellung zu provozieren versucht, er selbst stecke hinter dem Video auf Deep Tube. Doch die Unterstellung perlte an ihm ab. Eigentlich spielte es gar keine Rolle, sah Anna längst ein. Ihr Siechtum hatte ja schon im Teenageralter begonnen. Wann immer es mal aufwärtsgegangen war, hatte bereits der nächste Fallstrick gelauert, und sie war gestürzt, ein ums andere Mal. Schon vor dem Video war sie am Ende gewesen. Es hatte ihr lediglich den Todesstoß versetzt. Auch dieses Mal ließ sich der Meister nicht aus der Reserve locken. Kühl belehrte er sie, sie selbst sei für ihr missratenes Leben verantwortlich. »Sie selbst haben sich durch den Fleischwolf gedreht – und Ihre Umwelt gleich mit.« Er habe ihr lediglich ein interessantes Angebot unterbreitet. »Und es steht in meiner Macht, es zu verwirklichen. Hören Sie auf Ihre Intuition, die weiß es längst.« Anna spürte Ärger aufsteigen. »Ich bin Naturwissenschaftlerin, vergessen Sie das nicht.« »Sind Sie?« Er lächelte süffisant. »Und ihr Labor ist der Kopierraum bei Heureka, ja?« »Halten Sie doch einfach den Mund, Mister Klugscheißer!« Er dachte nicht daran. Sie hatte einige Tage Urlaub vor sich und zeigte ihm schon jetzt zu viel Lebendigkeit. »Sie können überhaupt nicht beurteilen, was möglich ist.« Er senkte die Stimme. »Jedenfalls werden Sie es ausprobieren. Weil Sie überhaupt nichts zu verlieren haben. Und kommen Sie mir nicht mit der Naturwissenschaftlerin, zu der Sie es nie gebracht haben. Das Einzige, was Sie wirklich sind: Sie sind am Ende. Schauen Sie in den Spiegel. Da sehen Sie eine gescheiterte Existenz allein auf weiter Flur. Eine arbeitslose Alkoholikerin, nach der die Polizei fahndet. Und danach? Was kommt wohl danach?« »Hören Sie bitte auf.« »Ihre Eltern würden sich im Grab umdrehen, wenn sie das mit ansehen müssten.« »Lassen Sie meine Eltern aus dem Spiel!« Statt zu antworten starrte er sie durchdringend an. Anna schloss die Augen. RASTERFAHNDUNG | E-TARRAGONA S hastete wie auf Ecstasy die Straße auf und ab, starrte abwechselnd auf den Hauseingang und sein Handy und tastete unentwegt nach seiner Pistole. Was vor wenigen Tagen als kontrollierte Operation begonnen hatte, war völlig aus dem Ruder gelaufen. Im Sog der Ereignisse hatte es ihn von der Kommandobrücke in die Niederungen der Straße gerissen. Er konnte es noch immer nicht fassen. Die ganze Nacht lang hatte er Wache vor Fárdomes Haus geschoben, während Mikki vor Mirandors Hotel lauerte. Vergebens, die beiden waren nicht wieder aufgetaucht. Es blieb ihm ein Rätsel. Ein Rätsel, das er gleich dem Salvator zu erklären hatte. Er blickte auf die Uhr und strich sich nervös die Haare aus der Stirn. Die Sorge, ihn zu enttäuschen, begleitete ihn seit Kindertagen und nie hatte er sich mehr gesorgt. Eine männliche Gestalt bog von der Via Augusta in die Seitenstraße ein. Christian, einer aus Iwans Mannschaft. Froh, endlich die Handlangertätigkeit loszuwerden, hielt sich S nicht mit Vorreden auf. »Der Eingang gegenüber ist zu überwachen, Apartamentos Astoria. Du bis über die Zielobjekte im Bilde?« »Ja.« »Gib mir die Adresse.« Christian begriff nicht. »Die Adresse der Unterkunft, was denn sonst?« »Der Salvator erwartet dich hier.« »Wie, hier? Und die Heydt?« »Wird gerade in die Unterkunft gebracht. Der Salvator ist hier ausgestiegen. Da, in dem Hotel.« Christian deutete auf den Gebäudekomplex an der Straßenecke. Im Innenhof des Hotels Astari war nur ein Tisch besetzt, an dem der Salvator mit Henry, Iwan, Mikki und Daniel saß. Er würdigte S eines Blickes, aber keiner Begrüßung. »Weiter, Iwan«, forderte Henry. Der Salvator hatte den vierundzwanzigjährigen Australier vor vier Jahren von der asiatischen Einheit in die Zentrale berufen und ihn vor Kurzem zum Majordomus gekürt. Er fungierte als eine Art Geschäftsführer. »Ich vermute, dass der Alte mitmischt, der Brúto in der Mangel hatte«, gab Iwan eine Einschätzung der Lage ab. Natürlich, der Alte! S verstand selbst nicht, wie er den aus den Augen verloren hatte. Der konnte natürlich hinter dem plötzlichen Verschwinden stecken. Brúto zufolge handelte es sich ja um einen mit allen Wassern gewaschenen Profi. »Ich möchte jetzt deine Version hören«, wandte sich der Salvator an S. Deine Version? Der Salvator glaubte doch nicht etwa, er hätte Dreck am Stecken? S wurde trotz der Morgenkühle heiß. »Ich höre.« S erstattete Bericht, aber viel wusste er nicht zu sagen. »Was habt ihr über den Alten in Erfahrung gebracht?«, schaltete sich Henry ein. Zu angespannt, um richtig nachdenken zu können, gab S die Frage weiter: »Komm schon, Mikki, das war dein Job.« »Ein Spanier, sagt Brúto. Alt, über siebzig, groß und stark, kahler Kopf.« Iwan hakte nach: »Dialekt? Spezielle Merkmale? Ein Tick? – Gar nichts? Kein Hinweis zur Beziehung zwischen Mirandor und dem Alten? Was ist los, Mikki, hast du beim Verhör gepennt?« Henry beugte sich zu S vor. »Hatte der Alte heute Nacht die Hände im Spiel?« »Ich habe bereits darüber nachgedacht«, log S. »Das würde erklären, weshalb wir zu zweit keine Chance …« »Hast du etwas Konkretes?« Nein, hatte er nicht, Mikki ebenso wenig. »Wie hat der Alte Brúto zum Sprechen gebracht?« Mikki antwortete: »Ich schiebe Brúto das Knie zwischen die Beine, und er schreit laut und hält die Hände vor sein Ding. Vielleicht auf die Eier.« »Daniel, wir müssen wissen, was im polizeilichen Untersuchungsbericht über Brútos Obduktion steht.« Daniel, der in Barcelona und Heidelberg Soziologie studiert hatte, kümmerte sich unter anderem um die Kontaktpflege in Spanien und Mexiko. Der schlanke, hellhäutige Mann sah auf die Uhr und zupfte am rötlichen Haar. »Das Setting steht bereits«, sagte er. »Ich habe uns die Dienste eines Informanten gesichert.« Er rief das Telefonbuch seines Handys auf. Kurz darauf erstattete er Bericht: »Quetschungen und Verbrennungen im Genitalbereich, eher Furcht einflößend als gefährlich. Der Informant meint, der Täter habe die Misshandlung präzise dosiert.« »Spricht für unsere Annahme, dass Mirandor einen Profi an Bord geholt hat«, resümierte Henry. »Gib die Beschreibung des Alten weiter. Er ist Zielperson einer Rasterfahndung, die Pintaluba sofort starten soll. Vor allem im Umfeld von Fárdome.« Iwan kratzte sich am kantigen Schädel. »Wieso Fárdome? Der Alte scheint doch über Mirandor ins Spiel gekommen zu sein.« »Brúto wusste zu wenig, um sie auf Fárdomes Spur zu bringen. Es sei denn, der Alte kennt den Major. Vom Alter und den Methoden her passen sie zusammen. Gehen wir zunächst davon aus, dass sie aus demselben Stall kommen: zwei Franco-Offiziere.« Henry wandte sich an Daniel. »Wann meldet sich Pintaluba wegen der Ortung des Handys?« »Kann nicht mehr lange dauern. Er checkt auch, mit wem Mirandor in letzter Zeit telefoniert hat.« »Bleibt die Frage, wo wir mit der Suche beginnen. Iwan?« »In Mirandors Akte gibt’s keinen Hinweis, dass er hier Kontakte hat. Sie könnten mit einem Auto abgehauen sein. Fárdome hat zwar keins mehr und Mirandor ist wahrscheinlich mit dem Zug gekommen, aber vielleicht der Alte. Dann können sie sonst wo sein. Sogar hier im Hotel. Hm, wäre sogar eine raffinierte Idee. Ich werde das checken.« »Nicht auszuschließen, dass Fárdome noch einen weiteren Unterschlupf hat«, gab Daniel zu bedenken. »Die Ferienwohnung ist für den Spanier, was für den Deutschen der Zweitwagen ist.« Henry nickte. »Pintaluba soll das prüfen, Daniel. Und er soll sich beeilen. Heize ihm ein, ich will Ergebnisse.« »Okay.« »Ich hoffe, jedem hier ist klar, wie gefährlich die Situation ist.« Plötzlich ergriff der Salvator das Wort: »Ich werde keinen Fehler tolerieren.« Sie alle quittierten den Hinweis mit einem Nicken, selbst Henry. »Soll ich vor Ort bleiben oder mitfahren?«, wandte sich Iwan nach kurzem Schweigen an den Salvator. Henry antwortete an dessen Stelle. »Nimm dir mit Christian hier im Hotel ein Zimmer. S und Mikki bleiben auch vor Ort.« Ungläubig hörte S, wie Henry über ihn verfügte. Verstohlen sah er zum Salvator hinüber, dessen Blick aber weder Irritation noch Widerspruch zeigte. Henry erhob sich. »Wir fahren jetzt los. Wo steht dein Wagen, S?« Den musste er auch abgeben? »In der Nähe«, antwortete er mit zusammengebissenen Zähnen. »Hole ihn.« Während S sich auf den Weg machte, rief Daniel bei Pintaluba an. »Ich habe ihm die Befehle übermittelt«, meldete er schließlich Vollzug. »Mirandors Handy hat er schon lokalisiert – auf einer Deponie. Spricht für unsere Hypothese, dass der Alte mitmischt. Jede Wette, der hat es auf die Reise geschickt.« Henry nickte. »Gib Iwan unsere Adresse in …?« »In Salou, Carrer de Pompeu Fabra.« »Ist das der Name der Stadt?« »Die Stadt heißt Salou. Carrer de Pompeu Fabra ist der Straßenname.« S tauchte auf. »Der Wagen steht vor der Tür.« Der Salvator zog ihn zur Seite und blickte ihn kalt an. »Und du hast wirklich nichts Erhellendes beizutragen? Du enttäuschst mich.« S hätte sich lieber erschießen lassen, als diesen Satz hören zu müssen. RICHTIGER RIECHER | E-SALOU »Komm schon, Jesús, hilf mir, Fárdome schwächelt.« »Fünf Minuten.« Jesús fand nur langsam ins Leben zurück. Eine innere Stimme riet ihm weiterzuschlafen. Zu spät, er begann bereits, sich zu erinnern: Er befand sich auf der Flucht vor Leuten, die zu töten bereit waren. Zu Ingas Unwillen rappelte er sich von der kleinen Couch auf und ging ins Bad, um eine kalte Dusche zu nehmen. Was ihm unter die Haut ging, ließ sich zwar nicht abwaschen, aber zumindest auf der Haut würde das scharfe Prickeln guttun. »Jesús? Komm mal.« Carlos saß im Schlafzimmer vor Fárdomes Bett und flößte ihm Tee ein. Der Major sah schlecht aus, seine Haut bleich und von Schweiß überzogen. »Körperpflege entfällt heute. Hier darf kein Wasser mehr fließen – nicht ein Tropfen, klar? Kümmere dich um Fárdome, du musst ihn wieder auf die Beine bringen. Ich ziehe los, einen neuen Unterschlupf besorgen.« »Geht das nicht telefonisch?« Jesús war nicht wohl bei dem Gedanken, hier zurückzubleiben. »Du selbst hast darauf hingewiesen, dass sie mich womöglich identifizieren können. Und dann bekommen sie auch meine Handynummer raus. Außerdem brauchen wir was zu essen. Ich beeile mich.« Er bestückte Jesús’ Pistole mit drei Patronen aus seiner eigenen Waffe. »Ist jetzt entsichert, also Vorsicht. Du musst nur den Abzug ziehen.« Er machte ihm vor, wie er die Waffe halten sollte. »Du lässt niemanden rein. Sollte jemand klingeln oder sich an der Tür zu schaffen machen, reagierst du nicht. Du verbirgst du dich hinter der Couch und nimmst die Waffe in Anschlag. Wenn ich zurückkomme, klopfe ich: zwei Mal, Pause, ein Mal, Pause, zwei Mal. Mich erschießt du bitte nicht.« Das Tiefgaragentor auf der Rückseite des Apartmenthauses senkte sich quietschend hinter Carlos. Er trat auf die Straße, blickte sich um, ohne etwas Verdächtiges zu bemerken und ging um den Häuserblock zum Vordereingang. Auch hier niemand zu sehen. Er warf einen prüfenden Blick auf die Reifen seines Seat, stieg ein und fuhr den Wagen zur Rückseite, wo er ihn neben der Tiefgaragenausfahrt parkte. Dann machte er sich zu Fuß auf den Weg. Nach zwei Straßenkreuzungen sah er die Fish’n Chips Bude, die er sich gestern Nacht gemerkt hatte. Von hier aus ging es nach rechts ins Zentrum. Die Straßen wirkten wie ausgestorben, waren aber so vollgepackt mit kleinen Geschäften, Kebab und Pizza, Spielhölle und Internet, dass man das babylonische Stimmengewirr des Sommers fast schon hören konnte. In einem kleinen Supermarkt kaufte er Brot, Käse, Wasser und eine Dose Thunfisch. Auf der Suche nach einer Telefonzelle stieß er auf einen Elektroladen. Ein Glückstreffer. Er ging hinein und kaufte zwei Handys mit Prepaidkarte. Noch auf dem Rückweg rief er eine Agentur an, die Ferienwohnungen vermittelte. Er wollte schnellstmöglich aus Fárdomes Unterschlupf raus, er meinte die Gefahr beinahe riechen zu können. GERN GESCHEHEN | E-TARRAGONA Zur gleichen Zeit erhielt Iwan, der vor einem Joghurt im Frühstücksraum des Hotels Astari saß, einen Anruf. »Meldung von Pintaluba: Die Zielperson ist vermutlich Carlos Lobreta, zweiundachtzig, Exoffizier aus Madrid, damals Sonderermittler für politische Delikte. Größe: eins neunzig, massige Gestalt, blaue Augen, eine große Narbe am Hals. Arbeitet heute gelegentlich als Privatermittler oder Leibwächter. Weitere Ermittlungen laufen. Jetzt das Eigentliche: Fárdome hat keine Zweitwohnung, trotzdem gibt es einen Anhaltspunkt, wo er sich aufhalten könnte.« Iwan notierte erstaunt die Adresse, informierte seine Leute, eilte nach draußen – und kehrte wenige Sekunden später unter wilden Flüchen zurück: Ein gottverdammter Wichser hatte seinen BMW zugeparkt, ausgerechnet jetzt! Er knöpfte sich den Portier vor: »Ein weißer Opel blockiert meinen Wagen«, herrschte er ihn auf Englisch an. »Der muss da sofort weg, sonst gibt’s Trouble!« Der Portier schaute irritiert, bewahrte indes Würde. Ein Lieferant, radebrechte er, kein Grund zur Sorge, der sei gleich wieder weg. »Can I offer you a cup of coffee for free, Sir?« Iwan lief vor Wut rot an, riss sich aber zusammen. Statt mit der Faust auf den Tresen zu hauen, legte er einen 50-Euro-Schein hin. »Sie haben zwei Minuten.« Er sah demonstrativ auf seine Armbanduhr. »Ich zähle die Sekunden.« In diesem Moment tauchte ein Mann in blauem Overall auf. »Fahr bitte sofort deinen Wagen weg, José«, forderte der Portier ihn auf und fischte gleichzeitig den Geldschein vom Tresen. Er schenkte Iwan ein strahlendes Lächeln. »It was a pleasure to help you, Sir.« Iwan hatte leider keine Zeit, ihm eins in die polierte Fresse zu hauen. Fast fünf Minuten hatte ihn der Spuk gekostet. Er startete den Motor, wendete und jagte den Wagen in westlicher Richtung über die Via Augusta. GRAUEN IN DREI SÄTZEN | E-SALOU Jesús trug das Bettlaken ins Bad, um das Erbrochene des Majors in der Wanne abzuspülen, aber Carlos hielt ihn zurück. »Wasser hinterlässt Spuren, hab ich doch schon gesagt! Wir müssen das Laken sowieso mitnehmen. Wirf es in den Müllsack.« »Kann ich wenigstens Wasser für Inga haben? Sie hat Durst.« »Nein.« »In ein Schälchen, da tropft nichts daneben.« »Hier läuft kein Wasser mehr, nicht mal im Klo. Vom Major steht noch ein Glas Wasser rum, gib ihr das. Den Rest kippst du unauffällig vom Balkon und dann wischst du das Glas sorgfältig mit Toilettenpapier aus. Beeil dich!« »Ist es weit?« »Nein.« Er zeigte auf den Stadtplan. »Wir sind hier. Und da müssen wir hin, Carrer de Pompeu Fabra. Habe bereits einen Notarzt dahin bestellt, also mach voran.« Der Major hatte wahrscheinlich einen Herzanfall erlitten und brauchte schnellstens Hilfe. Ihn zum Auto zu tragen war lebensgefährlich, aber auch der Major wollte nur noch weg: »Lieber an meinem Herzen sterben als denen in die Hände fallen.« Jesús ging voraus, mit dem Müllsack in der einen Hand und einem Stück Schnur in der anderen, eine Ersatzleine, die er an Ingas Flohband befestigt hatte. Er fuhr mit dem Aufzug ins Erdgeschoss, vergewisserte sich, dass dort niemand rumlungerte und schickte den Aufzug wieder hoch. Kurz darauf entstieg ihm Carlos in gebückter Haltung, den Major wie einen Kartoffelsack auf dem Rücken. Jesús wollte zum Ausgang, doch Carlos pfiff ihn zurück. »Wir gehen durch die Tiefgarage.« Iwan ging erst in die Eisen, als er in der Zielstraße Christian und Johann hinter einem gelben VW-Bus stehen sah. Er fuhr rechts ran und sprang aus dem Wagen. Christian reichte ihm ein Funkgerät.»Die Frequenzen sind eingestellt, Boss. Hier hat sich noch nichts getan.« »Pierre?« »Auf der Rückseite, da gibt’s eine Tiefgaragenausfahrt.« »Du kommst mit mir. Johann, du bleibst hier auf Posten. Gib Pierre Bescheid, dass wir reingehen. Wieso bist du so nass?« »Da kam vorhin Wasser von oben.« Jesús und Carlos stiegen langsam den dunklen Kellerabgang hinab. Plötzlich drangen aus dem Treppenhaus schnelle Schritte. Jesús erstarrte. »Weiter«, zischte Carlos ihm zu. »Einen Meter vor dir, die schwarze Fläche – ist eine Eisentür. Nur angelehnt, hoffe ich. Nicht aus Versehen zudrücken.« Jesús tastete nach dem Knauf, ließ Carlos passieren, zerrte Inga durch die Tür und zog sie leise ins Schloss. »Jetzt kannst du Licht machen. Links von dir«, sagte Carlos und dirigierte ihn zu einer unscheinbaren kleinen Tür am rechten Rand der Tiefgarage. »Ist die nicht abgesperrt?« »Nicht mehr.« Carlos legte den Major ab. »Wirf den Müllsack in den Karton dort. Mein Wagen steht vor der Tür. Ich gehe raus, die Lage sondieren. Auf mein Zeichen kommst du nach.« Er drückte ihm den Wagenschlüssel in die Hand. »Du öffnest mir die hintere Tür. Während ich den Major reinlege, setzt du dich ans Steuer und dann geht’s zügig los. Bis gleich.« Iwan zog enttäuscht an seiner Unterlippe. Sie hatten die Wohnung durchkämmt, ohne Lebenszeichen zu finden. Ein Test noch. Er stopfte Toilettenpapier in den Ausguss der Spüle, doch es blieb trocken. Nein, hier war niemand in den letzten Stunden gewesen. »Komm mal, Boss, ich glaub, ich hab da was.« Christian kniete auf dem Badezimmerboden und deutete auf ein braunes Bröckchen. Iwan ging in die Hocke und untersuchte es. Erbrochenes? Was auch immer – es war noch feucht! Er riss das Funkgerät aus der Weste. »Iwan an alle. Achtung, wir haben wahrscheinlich das Nest, aber die Vögel sind ausgeflogen.« Sie stürmten aus der Wohnung. Iwan nahm den Fahrstuhl und wartete im Foyer auf Christian, der die Treppen runtergespurtet kam. »Nichts? Du schwärmst mit Johann aus. Ich bewege mich durch die Tiefgarage auf Pierre zu.« Christian rannte raus, und gab Johann ein Zeichen. Iwan sprang die Stufen zur Tiefgarage hinab. Als er an die geschlossene Eisentür kam, fluchte er. »Iwan an Pierre. UmgebungsCheck. Du marschierst in westliche Richtung, ich komme von der anderen Seite. Bestätigen.« Iwan rannte die Treppe hoch, durchquerte das Foyer und machte sich auf den Weg um den Häuserblock. Langsam drückte Carlos die Tiefgaragentür auf und stieg die erdige Böschung hinauf. Die Büsche vor dem Haus boten Sichtschutz, behinderten aber zugleich seine eigene Sicht auf den Mann, der sich auf der anderen Straßenseite ausgiebig umzuschauen schien. »Hau schon ab«, knurrte Carlos. Er wollte endlich hier weg. Wie auf Kommando entfernte sich der Mann. Auf Höhe der nächsten Kreuzung, gut 150 Meter entfernt, blieb er plötzlich stehen und zog einen Gegenstand aus seiner grauen Weste. »Pierre an Iwan. Befinde mich an der ersten Abzweigung. Sehe zwei männliche Objekte in der nach Norden abzweigenden Seitenstraße, circa hundert Meter entfernt. Sie bewegen sich von mir weg. Verfolgung aufnehmen?« Im Laufen zog Iwan das Funkgerät. »Du verlierst dann die Tiefgarage aus den Augen?« Pierre bestätigte. Iwan wog die Alternativen ab. Der Weg um den Häuserblock zog sich hin. Wenn Pierre die Verfolgung aufnahm, würde die Tiefgarage für einen Moment unbewacht sein. Lohnte sich das Risiko? Während Pierre auf Iwans Befehl wartete, steckte Jesús die Nase durch die Tür. Von der Störung abgelenkt, verlor Carlos den Passanten aus den Augen. War er in der Seitenstraße verschwunden? Er hätte Jesús den Kopf abreißen können. »Du Idiot! Also gut, raus jetzt.« Er hievte sich den Major auf den Rücken und stieg schnaufend die Böschung hoch. Auch Iwan schnaufte. Gleich hatte er es endlich geschafft, er sah die Kreuzung schon vor sich. Er drückte noch mal aufs Tempo. Als er um die Ecke bog, sah er einen Wagen anfahren. Verdammt! Aber das Garagentor war geschlossen. Die Dreckskerle konnten das Riesending unmöglich so schnell hoch und wieder runter gebracht haben. Er sah dem Wagen nach, der in die entgegengesetzte Richtung davonfuhr. Ein dunkelblauer Seat Ibiza, das Kennzeichen war aus der Distanz nicht zu entziffern. Sein Handy vibrierte. »Pintaluba hat jemanden bei Lobreta vorbeigeschickt«, meldete Daniel. »Es hat aber niemand aufgemacht. Auf ihn ist ein Mercedes zugelassen, C-Klasse, Baujahr 2001, grün.« Iwan atmete auf und notierte das Kennzeichen. »Noch was, Iwan. Der Wagen war kürzlich in einen Unfall verwickelt, könnte sein, dass er gerade in einer Werkstatt steht. Pintaluba hat deshalb weiter ermittelt. Auf Lobretas Bruder ist ein 98er Ford Kombi zugelassen, silbermetallic, auf seine Tochter ein Seat Ibiza, Baujahr …« »Farbe?« »Moment.« »Mach schon!« »Dunkelblau.« KACKE! Carlos saß auf der Rückbank, den Kopf Fárdomes auf dem Schoß. Im Vorbeifahren warf er einen Blick in die Seitenstraße. Der Mann mit der grauen Weste rannte gerade in ihre Richtung zurück. »Wir biegen am Ende der Straße links ab, Jesús. Dann behältst du die Richtung grob bei, bis wir auf die C-31B kommen.« »Lobreta? Ich sterbe.« »Da wärest du nicht der Erste, Fárdome. Die Geburt ist der Anfang vom Ende.« »Jetzt«, krächzte der Alte. »Ich sterbe jetzt, Lobreta.« »Erzähl keinen Unsinn.« »Hör mir einfach zu.« Pepe Fárdome sammelte die letzten Körnchen seiner Lebensenergie; der einstmals prall gefüllte Sack war nahezu leer. Er erinnerte sich noch gut an den 9. Juli 1975. Es war der Tag, an dem er morgens von einem Kameraden erfahren hatte, wie schlecht es um ihren Führer stand. Der Tag, an dem er mittags in der Kathedrale von Madrid eine Kerze angezündet und für Franco gebetet hatte. Es war auch der Tag, an dem er nachmittags indirekt daran mitgewirkt hatte, die Eltern eines kleinen Jungen zu ermorden. Am Abend, einige Stunden nach der Tat, hatte er einen Anruf aus der Zentrale erhalten. Fárdomes Stimme war ein heiseres Flüstern, dünn wie seine greise Haut. »Die sagen, ich muss schon wieder nach Toledo. Geht nicht, sag ich. Ist denen egal. Wiederholen einfach, morgen, vierzehn Uhr am Flughafen, jemanden abholen … nach Toledo zu Brúto bringen. Und einen Tag später die Retoure.« Pepe, Pepe, auf was für Wahnsinnige hast du dich eingelassen? Dem Jungen seine verbrannten Eltern zeigen! Kein Wunder, dass er zusammengebrochen ist. Du musst aus der Geschichte raus, Pepe. Aber wie? Der Herzfehler. Vielleicht kannst du deinen Herzfehler geltend machen. Am Flughafen kommt ein alter Mann …« »Name?« »Alles Namenlose, Lobreta. – Kommt auf mich zu. Dünnes weißes Haar. Mitte siebzig, Altersflecken im Gesicht, nur der Hals merkwürdig faltenlos. Mittelgroß. Etwas beleibt. Dunkelbrauner Cordanzug, schwarzer Rollkragenpullover. Ziemlich bepackt für nur einen Tag, graue Reisetasche, brauner Aktenkoffer, weinrote Umhängetasche aus Leder.« Mit Gefallen registrierte Carlos die Präzision der Beschreibung. Alte Schule. Selbst jetzt, vom Tode gezeichnet, spulte der Alte über dreißig Jahre alte Beobachtungen so routiniert runter, als kämen sie vom Band. »Ein Deutscher. Wenn er gerade gelandet ist, kommt er aus München. Nur weiß man bei denen nie. Wir reden kurz. Ich kann Deutsch, wusstest du das, Lobreta? … Über allen Gipfeln ist Ruh, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein …« Trug Fárdome ihm jetzt ein Gedicht vor? »Lass den Unsinn.« Er kniff ihm in die Wange. »Au!« Mit einer kraftlosen, verwischten Bewegung schlug Fárdome nach Carlos’ Hand. »Mein Kindermädchen, Agnes, weißt du …« »Muss ich dich noch mal kneifen?« »Wir fahren. Der Deutsche schweigt. Nur noch Schweigen. Raucht eine nach der anderen. Nikotingelbe Finger. Brúto …« »Waren noch andere beteiligt? Kameraden?« »Weiß nicht. Kennst du doch, Lobreta, Geheimhaltung, immer alles geheim halten. … Kennst du das?« »Ja, kenne ich. Weiter!« Carlos fragte sich, ob der Alte durchhalten würde, bis er zum interessanten Teil käme, sollte es denn einen geben. »79 durfte ich aussteigen, da gab es einen Nachfolger. Ach, der ist schon lange tot. Aber es muss noch andere gegeben haben. Die wussten immer genau Bescheid.« »Schon gut. Zurück zur Geschichte.« »Was du willst. Du bist ein guter Mensch, Lobreta, bete für mich.« »Weiter!« »Am nächsten Morgen. Er steht schon da. Legt Koffer und Aktentasche auf die Rückbank. Die Umhängetasche behält er vorn. Vorn, nicht vergessen. Vorne ist wichtig! Ist diesmal gesprächig. Du weißt doch, Lobreta, wenn man zufrieden ist …« »Ja, ja, ich weiß.« Carlos meinte beinahe zuschauen zu können, wie das Leben aus Fárdome rausrieselte. »Sagt: Da haben wir den Jungen ein bisschen überfordert. Lacht dabei. Redet über alles und nichts. Aber eigentlich möchte er von was Bestimmtem reden. Spürst du es auch, Lobreta? Von seinem Erfolg will er reden. Richtig? Was er mit dem Jungen gemacht hat. Ist eu… eu…« »Euphorisch.« »Danke. Gib mir bitte deine Hand, Lobreta. Ich sterbe nämlich, weißt du?« Carlos hätte ihm auch die Brust gegeben, wenn er bloß endlich zu Potte gekommen wäre. »Der Junge ist wichtig, sagt er dann.« »Ja, um ihn an Perverse zu verscherbeln!« »Perverse? Wieso? – Nein, so was hat er nicht gemeint. Er meinte was Größeres.« Das von Fárdome in den Wagen gehauchte Wort dehnte sich wie eine unsichtbare Blase. »Was denn?« »Madrid, Flughafen. Ich steige aus. Öffne die Tür … die hinten … auf meiner Seite. Beuge mich rein … will den Koffer nehmen. Wir haben noch Zeit, sagt er. Ich soll eine rauchen gehen. Ein Befehl, glasklar.« Fárdome hatte die Augen geschlossen und schien mehr mit sich selbst als mit Carlos zu reden. »Gehe ein paar Meter. Verdammt, die Zigaretten sind weg. Rausgefallen?« Er sprach immer schneller, die Erinnerung schien ihn zu übermannen. »Die Hintertür ist noch offen. Sehe die Schachtel im Fußraum. Gehe in die Hocke und knie mich rein. Höre ein Rauschen. Von einem Funkgerät. Wo kommt das her? Die Umhängetasche … die er vorne hat … da ist ein Funkgerät drin! Der Deutsche spricht. Ich will raus, schnell, schnell, nur wieder raus. Nur nichts Falsches hören.« Seine Stimme klang nach abgenutztem Schleifpapier, das jeden Moment reißen konnte. »Ich will nicht sterben! Wage nicht, mich zu bewegen. Halte den Atem an. Und dann höre ich es. Ich liege im Fußraum und höre, was ich nicht hören darf. Und habe Angst.« »Was hast du gehört?« »Du musst rausrutschen, Pepe! Strenge dich an, leise, wenn er dich sieht, bist du tot. Ein Zentimeter. Komm schon, noch einen!« Fárdome versank stöhnend in seinen Erinnerungen. Plötzlich bäumte er sich auf. Dann sackte er in sich zusammen. Sein rasselnder Atem war nicht mehr zu hören. Tot. Carlos stieß ihn mit einem Gefühl bitterer Enttäuschung an. Da erzitterte der Alte und schnappte wie ein Ertrinkender nach Luft. »Fárdome?« »Ja, ja.« Langsam beruhigte sich sein Atem wieder. »Endlich bin ich wieder draußen und will mich gerade auf…« »Aufrichten?« »Aufrichten. Ja. Mich aufrichten. Da dreht er sich nach hinten. Sieht mich. Schaut böse.« Seltsam, Pepe. Selbst jetzt, im Sterben noch, hast du Angst vor ihnen. Dir steckt immer noch in den morschen Gliedern, wie du mit ansehen musstest, was sie deinem Nachfolger angetan haben, als der sein Maul nicht halten konnte und sie es ihm stopften. »Er fragt, ob ich schon geraucht habe. Ich nicke. Da beugt er sich über den Sitz, um den Aktenkoffer von der Rückbank zu nehmen. Sein Blick fällt in den Fußraum. Da liegt die Schachtel. Können Sie haben, sag ich schnell … rauch ich nicht mehr … sind zu stark, wissen Sie, das Herz, hab jetzt leichtere. Er nickt. Und sieht mich an. Nachdenklich. Sehr nachdenklich. Jetzt wird er sich von mir die andere Schachtel zeigen lassen. Die Schachtel, die es nicht gibt. Da kommt unverhofft ein Polizist. Mein Retter. Der Wagen soll sofort weg, Halteverbot. Der Deutsche steigt schnell aus.« »Was hast du gehört, Fárdome? Sprich mit mir!« Der Alte öffnete die Augen. »Was er gesagt hat, ja. Ist wie eingebrannt. Hat mit seinem Vater gesprochen, sagt: Vater, ich habe ihn gelöscht. Sein Energiepegel steigt schon wieder. Mirandor ist wieder bereit, geerntet zu werden. – Genau das sagt er.« Jesús trat die Bremse, ohne es zu bemerken. Mechanisch zog er einen Stift und einen Fetzen Papier aus seiner Jacke und schrieb die drei Sätze auf. Nur kein Wort vergessen. Ihn gelöscht. Energiepegel. Wieder bereit, geerntet zu werden. Das ergab alles keinen Sinn! Fárdome hatte den Verstand verloren, sprach im Delirium. Trotzdem überfiel Jesús das Grauen. Als hätte sich in seinem Inneren ein Verlies geöffnet, aus dem es hervorquoll. Auf eine unfassbare Weise wusste er, dass Fárdome nicht gesponnen hatte. Und dass sein Leben nie mehr das sein würde, was es gewesen war. Carlos schüttelte den Alten. »Das kannst du doch nicht ernst meinen! Du fantasierst. Reiß dich zusammen und sag, was wirklich war.« Aber Fárdome hatte sich endgültig verabschiedet. Das hatte gutgetan! Anna stützte sich auf den Bodenplatten ab und zog den Körper aus dem Schwimmbecken. Eine Brise kitzelte ihre nasse Haut. Sie ging zur Liege, streifte BH und Unterhose ab und schlüpfte in trockene Sachen. Ob jemand spannte? Sie sah an sich hinunter: zwei schrumpelige Äpfelchen an einem dürren Stamm. Dabei hatte ihr Busen eigentlich eine ganz annehmbare Größe. Jetzt hätte man Auf ihren Rippen Xylofon spielen können. Kein Wunder, die Kalorien waren schnell gezählt, seit sie nichts mehr trank, was Teil der Abmachung war und ihr derzeit nicht sonderlich schwerfiel. Plötzlich spürte sie, zum ersten Mal seit Langem, ihren Magen knurren. Sie stiefelte ins Haupthaus, um sich was Essbares zu besorgen. Vielleicht fand sich auch jemand zum Quatschen, ihr war gerade danach. Fehlanzeige, lediglich Kerberos lümmelte in der Küche rum, Iwans gedrungener Pit Bull Terrier, ein Haufen fleischgewordene Gewalt, ganz wie sein Herrchen. Er knurrte, wovon sie sich nicht einschüchtern ließ. Sie ging in die Hocke und erwiderte seinen Blick. Er kam und leckte ihre Hand. Braves Hundchen, wir verstehen uns. Aus den Augenwinkeln nahm sie ein Blinken auf der Fensterscheibe wahr. Wurde wenigstens draußen ein bisschen Action geboten? Ein Rettungswagen. Er hielt rund dreißig Meter entfernt vor einem der Apartmenthäuser auf der anderen Seite – der Schattenseite der Straße, wo sich Betonklötze aneinanderreihten. Die Flügeltüren am Heck des Fahrzeugs öffneten sich und ein kleiner Dicker in weißem Kittel sprang heraus. Er ging auf zwei Männer zu, einen alten Knacker, Typ deutsche Eiche, und einen jungenhaften Mann mit leicht gewelltem schwarzem Haar. Kein übles Exemplar. »Was machen Sie hier?« Musste der Meister schon wieder nach Fallbeil klingen? Er trat neben sie. »Was gibt es da zu sehen?« »Nix.« Die drei Männer waren irgendwo hinter dem Fahrzeug verschwunden. »Ende der Vorstellung. Sie gehen jetzt wieder nach hinten. Wann immer Sie etwas brauchen, wenden Sie sich an Antonio, hier vorn haben Sie nichts verloren.« »Nicht so streng, Meister. Nie das Freiwilligkeitsgebot vergessen, halten Sie mich lieber bei Laune! Übrigens: An wen wende ich mich eigentlich wegen Sex? Auch an Antonio? Oder übernehmen Sie das persönlich?« Er betrachtete sie, wie man ein Insekt betrachtet. Der Höhenflug, zu dem sie ansetzte, passte nicht in seine Ablaufplanung. Er musste ihr die Flügel stutzen. Später. Im Moment gab es Dringenderes. »Leg dich jetzt hin, Jesús. Schlafen strafft die Seele«, gab Carlos eine seiner Weisheiten zum Besten. Als ob blöde Sprüche jemandem halfen! An Schlaf war überhaupt nicht zu denken. Jesús’ Verstand hatten die abstrusen Sätze noch nicht erreicht, aber seine Eingeweide verarbeiteten sie bereits. Adrenalinstöße versetzten seinem Körper Schockwellen. Wie an ein Starkstromkabel angeschlossen fühlte er sich. Und hätte alles dafür gegeben, den Strom abstellen zu können. »Wir müssen reden, Carlos.« »Worüber?« »Ganz gleich, irgendwas, einfach reden, ich halte die Spannung nicht mehr aus.« »Komm, setz dich zu mir.« Ging nicht. Aufgepeitscht marschierte Jesús das Wohnzimmer auf und ab. »Ich verstehe dich nicht. Wir haben doch nur Unsinn zu hören bekommen«, sprach Carlos auf ihn ein. »Vater. Energiepegel. Ernten. Alles Quatsch. In geistiger Umnachtung gesprochen. Der Deutsche hatte über siebzig Jahre auf dem Buckel – und soll mit seinem Vater gesprochen haben?« »Denk doch mal weiter, Mann! Muss ja nicht wörtlich zu nehmen sein. Es könnte sich um was Religiöses handeln, eine Sekte. Dann hätte ›Vater‹ eine ganz andere Bedeutung. Und der Rest vielleicht auch. Vielleicht kam es nicht von ungefähr, dass wir Jungs in einer Kirchenkulisse vergewaltigt wurden.« Carlos war zu sehr von der katholischen Kirche geprägt, um Sekten nicht alle möglichen Schweinereien zuzutrauen, Menschenraub bestimmt und sexuelle Misshandlung Minderjähriger erst recht. Aber kleine Jungen als Sexsklaven zu halten, um sie an Perverse zu vermieten, das ging selbst für seinen Begriff zu weit. Er äußerte Zweifel. »Was weißt denn du!«, herrschte Jesús ihn an. Nach einem Moment des Schweigens entschuldigte er sich. »Ich bin einfach mit den Nerven am Ende.« Ja, er war wie verwandelt. Sah um Jahre gealtert aus. Carlos stand vor einem Rätsel. »Dann lass uns verschwinden. Spanien ist groß. Die finden dich nie.« »Vergiss nicht, dass auch die Polizei mich sucht.« Das hatte Carlos in der Hektik der letzten Stunden wirklich fast vergessen. »Erzähle mir mal genauer, was da passiert ist.« Viel wusste Jesús nicht zu erzählen, die Geschichte mit Emily blieb merkwürdig wie eh und je. »Könnten die das eingefädelt haben, um mich zu bremsen?« »Normalerweise würde ich Nein sagen, zu umständlich.« Er rieb sich nachdenklich das Kinn. »Irgendetwas scheinen die noch mit dir vorzuhaben.« Jesús wandte sich der Fensterfront zu, damit Carlos seine Tränen nicht sah. Aus dem Boden, den er in Jahren gelegt und gefestigt hatte, brachen längst vergessen geglaubte Nächte im Heidenheim hervor – so wie die Ohnmacht in den Schlafsaal gebrochen war, wenn die Nachtschattengewächse aus den losen Dielenbrettern krochen und ihn mit feuchtem Stöhnen in Angstschweiß badeten. Carlos spürte Jesús’ Erschütterung. Aber er konnte ihm nicht helfen, außer, indem er kühlen Kopf bewahrte. »Wenn es für den Brief der Kleinen …« »Emily war keine Kleine, verdammt noch mal!« »Wenn der Brief keinen Sinn ergibt, dann …« »Dann stecken die dahinter.« »Und vielleicht auch jemand von der Guardia. Ich könnte noch mal mit Gorpón sprechen. Sein Großvater und mein Vater waren nicht nur Kameraden, sondern auch Freunde, das kann man in die Waagschale werfen. Vielleicht erzählt er mir mehr über seine Gründe, dich entwischen zu lassen. Ich habe rausgehört, dass ihm jemand mit einer krummen Tour gekommen ist – damit muss es zu tun haben. Vielleicht gibt er einen Namen preis. Kann sein, wir kommen auf diesem Weg weiter. Obwohl es mir immer noch das Beste für dich scheint, von der Bildfläche zu verschwinden und zu vergessen. Du …« Er verschluckte den Rest. Jesús wollte bestimmt nicht hören, wie sehr er sich in den letzten Stunden zu seinem Nachteil verändert hatte. Er brauchte jetzt Ruhe, dann würde er schon wieder zu sich finden. Jesús trat auf ihn zu. »Schau mich an, Carlos! Mir ist, als bekäme ich keine Luft mehr. Als würde das Leben aus mir rausgesaugt. Nicht bildlich – ich meine: wortwörtlich! Mir ist, als würde mein Körper sich an etwas erinnern, das mein Bewusstsein nicht greifen kann. Ich kann nicht mehr vergessen. Nicht in Spanien, nicht am Ende der Welt, nicht in einer Million Jahre. Ich habe keine Wahl mehr. Wenn ich den Spuk nicht auflöse, werde ich verrückt.« Carlos nickte nachdenklich. So viele Rätsel er in seinem Ermittlerleben gelöst hatte, dieses war das größte. Und unheimlichste. Er gab sich einen Ruck. Weitermarschieren, dann würde man schon sehen. »Zunächst müssen wir Inga loswerden, es ist auch ohne sie kompliziert genug. Wir schicken sie per Bahn an jemanden, der auf sie achtgibt.« Jesús brach die Vorstellung, Inga in eine Box zu stecken, beinahe das Herz. Er ging zur Couch, wo sie eingerollt schlief, und kraulte sie. Inga schnurrte, was es ihm nicht leichter machte. Doch Carlos hatte recht. Er nickte. »Dann auf, machen wir Nägel mit Köpfen.« Carlos nahm die über einer Stuhllehne hängende Schnur und reichte sie Jesús. »Wie sieht es eigentlich mit Bargeld aus? Ich habe dem Vermieter gerade einige Scheine in die Hand drücken müssen, und langsam wird meins knapp.« »Ich hab genug dabei.« Inga hatte offenbar verstanden, was sie planten, und sich verkrümelt. Jesús fand sie schließlich hinter einem Blumenkübel auf dem Balkon, wo sie vorgab, einfach nur ein Sonnenbad zu nehmen. »Glaub mir, ich mache das nicht gern«, entschuldigte er sich, während er sie hochnahm. Sie miaute, als wollte sie sagen, Lippenbekenntnisse brächten ihr überhaupt nichts. »Kannst du mal kommen, Carlos?« Jesús deutete auf einen gelben VW-Bus mit großen Ziffern auf dem Dach, der auf der anderen Straßenseite vor einem Anwesen stand. »Eine Telefonnummer. Das ist Werbung«, brummte Carlos. »Sieht da oben doch keiner.« »Du siehst sie doch.« »Jedenfalls stand genau so ein Bus auch vor Fárdomes Apartment. Habe ich beim Wasserausgießen gesehen.« Carlos holte sein Handy aus der Hosentasche. »Wir müssen dir später auch eins kaufen, denk mit dran.« Er wählte die Nummer. Das Ergebnis seiner Recherche: Es handelte sich um eine Leihwagenfirma und sie besaß genau drei dieser Busse, alle gelb und gerade verliehen. Drei Fahrzeuge in einer nicht allzu großen Stadt, zwei Mal vor ihren Unterkünften. Zufall oder Lebensgefahr? Auf jeden Fall Grund für erhöhte Vorsicht. Aber weder im Treppenhaus noch auf dem Weg zum Auto begegneten sie jemanden, der sich für sie interessierte. Wahrscheinlich doch nur Zufall. Während Jesús einen Stadtplan entfaltete, um Carlos nach Tarragona zu lotsen, hatten auch der Salvator, Henry und Iwan einen Plan vor sich. Auf einmal stand Heydt in der Küchentür. »Verschwinden Sie«, befahl Henry, »es gibt hier nichts zu sehen.« »Mir ist langweilig, verdammt. Haben Sie keinen anderen Aufpasser für mich als Antonio, das Mikrobenhirn,?« »Ich bringe Ihnen später ein Strategiespiel.« »Und das soll ich mit Antonio spielen? Für den ist doch schon Mau-Mau höhere Mathematik.« »Das können Sie allein spielen. Und jetzt raus.« Anna blieb trotzig im Türrahmen stehen. »Hau ab, sonst landest du im Krankenhaus«, brüllte Iwan plötzlich. Seine Erregung legte sich so schnell, wie sie gekommen war. Er entschuldigte sich beim Salvator. »Noch einmal, und es tut dir wirklich leid.« Henry deutete wieder auf die Karte. »Moment«, unterbrach ihn der Salvator. Das Wort Krankenhaus beförderte einen Gedanken an die Oberfläche, der sich schon beim Anblick des Rettungswagens geregt hatte. »Wir sind davon ausgegangen, das Erbrochene stamme von Mirandors Katze. Vielleicht ein Fehlschluss. Vielleicht hat Fárdome sich übergeben. Er hat einen Herzfehler. Vielleicht war die Aufregung der letzten Stunden zu viel für ihn. Erbrechen würde in die Symptomatik passen.« Henry ergriff sofort die Initiative. »Iwan, hol Daniel.« »Noch was, Iwan«, ergänzte der Salvator. »Bring Antonio auf Vordermann, ich will Heydt hier nicht noch mal sehen.« Keine Minute später erschien Daniel. Henry setzte ihn ins Bild. »Telefoniere die Krankenhäuser und Ambulanzen der Umgebung ab.« »Mirandor ist doch selbst Krankenpfleger.« »Guter Hinweis. Nach den Krankenhäusern und Ambulanzen nimmst du dir gegebenenfalls die Apotheken vor. Los, wir haben keine Zeit zu verlieren.« ENDE EINES LOCKENKÖPFCHENS | E-TARRAGONA Arme Inga! Sie ließ sich widerstandslos in den Transportbehälter sperren und blickte kläglich durch die Gittertür. Bald würde sie bei Vincente sein, der sich sofort bereit erklärt hatte, für sie zu sorgen. Zudem hatte er aus Jesús’ Wohnung Engels Handynummer besorgt. Eine Stunde später saßen Jesús und Carlos auf einer Bank auf Tarragonas großzügiger Promenade. »Warum willst du ausgerechnet einen Polizisten anrufen, Jesús?« »Er soll mir sagen, ob sich aus meinem Tipp mit Brúto was ergeben hat. Muss ihm ja nicht auf die Nase binden, dass die spanische Polizei mich sucht.« Der grimmige Ton erfüllte Carlos mit Unbehagen. »Dann ruf an«, erwiderte er ratlos. Jesús nahm sein neues Handy vom Tisch. »Engel.« »Jesús Mirandor. Erinnern Sie sich?« Markus konnte es kaum glauben. Gerade noch hatte er an ihn gedacht. Er lächelte Anastasia zu und verließ die Terrasse ihres kleinen Häuschens mit Meerblick am Rande von Cambrils. »Ja, klar. Wie geht es Ihnen?« Besser nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. »Mich interessiert, ob sich in der Sache Brúto etwas ergeben hat.« »Er ist tot. Wussten Sie das?« »Mich interessiert vor allem der Ring, für den er gearbeitet hat. Gibt es da Neuigkeiten?« Brútos Tod überging er einfach? Es musste viel passiert sein in den letzten Tagen. »Darüber kann ich nicht am Telefon reden, Herr Mirandor. Wo sind Sie denn?« Was sollte die Frage? Wusste Engel vom Haftbefehl der Guardia? »In Spanien. Ein bisschen weit weg, um mal eben bei Ihnen vorbeizuschauen.« »Kommt drauf an. Ich bin in Cambrils. Damit ist die Luftlinie zwischen uns ziemlich geschrumpft, nicht wahr?« »Kann sein.« Jesús fühlte sich überfahren. Vielleicht keine schlechte Idee, sich mit dem Kommissar zu treffen, doch darüber musste er erst mit Carlos reden. »Sie klingen angespannt, Herr Mirandor. Es geht Ihnen nicht gut, richtig?« »Nein.« Aus einem Impuls heraus zitierte Jesús die bizarren drei Sätze. »Das soll ein Mann vor gut dreißig Jahren gesagt haben, nachdem er wahrscheinlich so was wie eine Gehirnwäsche an mir vorgenommen hat. Am Tag nach der Ermordung meiner Eltern. Vermutlich ein Deutscher. Fragen Sie mich nicht wieso, aber seitdem ich das gehört habe, geht es mir dreckig.« Er versuchte zu beschreiben, wie er sich fühlte, doch für den Schmerz und das Entsetzen gab es keine Worte. »Jesús, wir müssen abtauchen.« Carlos deutete nach vorn. »Da kommt einer der Typen, die dich verfolgt haben. Schnell jetzt!« »Ich rufe wieder an.« Markus starrte enttäuscht auf sein Handy. Er ging ins Wohnzimmer, wo noch die BILD lag, die Anastasia sich gekauft hatte, und riss einen Streifen ab, auf dem er die merkwürdigen Sätze notierte. Dann ging er zu Anastasia auf die Terrasse zurück. Ihren neugierigen Blick ignorierte er, so gern er mit ihr über das Telefonat geredet hätte. Von der Arbeit wollte sie ja nichts wissen, wollte Urlaub machen und sonst nichts. Ihr gutes Recht, wenngleich er sich ein bisschen langweilte. Seine Reiselektüre hatte er bereits ausgelesen und der brave Superman, den Anastasia in fünffacher Ausfertigung dabei hatte, brachte ihn nur zum Gähnen. Ohne gleich Tarragona ins Spiel zu bringen, wo Mirandor sich möglicherweise aufhielt, schlug er vor, einen Ausflug zu machen. Es kostete sie offenbar einige Mühe, sich dafür zu begeistern. Schade. Er bot stattdessen einen Ausflug zum Schwimmbecken an. Nein, nein, irgendwo hinzufahren, sei eine prima Idee, beeilte sich Anastasia festzustellen, für einen Tritt in ihren faulen Hintern sei sie geradezu dankbar, doch, bestimmt. Er wurde nicht ganz schlau aus ihr. Schließlich einigten sie sich, erst an den Pool zu gehen und dann weiterzuschauen. Während er ihr zum rückwärtig gelegenen Garten folgte, konnte er nicht anders, als ihre Figur zu bewundern. Der Bikini, den sie sich gekauft hatte, leuchtete zwar für seinen Geschmack etwas zu pink, doch viel war da nicht, was leuchten konnte, und das Bisschen saß perfekt, musste er zugeben. Der kleine Pool lag idyllisch in einem von hohen Hecken umstandenen Garten, der auch mit zwei Palmen aufwartete. Anastasia nahm auf einer Liege Platz, Markus setzte sich mit einem alten ZEIT-Rätsel an den Tisch. Aber seine Gedanken schweiften in eine andere Richtung. Verstohlen fischte er den Zettel aus seiner Hemdtasche. Kaum hatte Anastasia sich gesetzt, erhob sie sich schon wieder und trat zu ihm an den Tisch. »Wollen wir das Rätsel zusammen lösen?« Markus verplapperte sich beinahe, denn er dachte sofort an Mirandor. Dieses Rätsel hätte er liebend gern mit ihr gelöst. Er ließ den Zettel schnell verschwinden und zog das ZEITRätsel heran. Eine Weile stocherten sie darin herum, dann gaben sie es auf. Es flutschte einfach nicht. Anastasia stand wortlos auf, ging zum Schwimmbecken und streifte mit lässiger Bewegung ihren Bikini ab. Jetzt hatte sie seine Aufmerksamkeit. Es erregte ihn immer wieder, wenn sie sich unvermittelt nackt zeigte, und auch jetzt hatte die spontane Entblößung das gewisse Etwas, eine raffinierte Mischung aus Natürlichkeit und Provokation. Sie musste keine Worte machen, um ihn einzuladen, Hemd und Boxershorts fielen fast von selbst. Er folgte ihr in den Pool und hatte – auch dieses Mal – mit ihr den besten Sex seines Lebens. Allein schon, wie sie ihm mit dem Mund das Kondom überstreifte. Vom Anfang bis zum Ende erahnte sie instinktsicher, was ihm gefiel, und umgekehrt schien es sich ähnlich zu verhalten. Als sie hinterher erschöpft und entspannt am Beckenrand lagen, fühlte er sich männlich wie lange nicht mehr. Nach einer Weile stand er auf und hechtete in den Pool – nicht ganz so elegant, wie erhofft, aber immerhin. Der Kopfsprung fand nicht mehr den Weg auf das durch die Hecken aufgenommene Video. Der dünne blonde Mann, dem Carlos und Jesús folgten, nahm den altbekannten Weg über die Via Augusta. Er wollte offenbar zu Fárdomes Wohnung. »Warum schnappen wir ihn uns nicht einfach?«, knurrte Jesús. »Geduld schlägt Gewalt. Was sollen wir ihn bearbeiten, solange wir durch Beobachtung mehr herausfinden können?« Der Mann erreichte die Abzweigung zum Haus des Majors, bog jedoch nicht ab, sondern ging weiter zum Hotel Astari. »Kein schlechter Stützpunkt«, überlegte Carlos, »die meisten Balkone sind wie ein Logenplatz, mit freiem Blick auf Fárdomes Wohnhaus.« »Und nun?« »Nun schneiden wir dir die Haare.« »Mir ist nicht nach Scherzen.« Es war keiner. Carlos wollte wissen, was im Hotel vor sich ging, und Jesús sollte es ausspionieren, wozu er sein Aussehen schnell und radikal verändern musste. »Ich würde lieber selbst reingehen, aber wenn die meine Identität aufgedeckt haben, dann erkennen die mich sofort. Wenn du dir eine Glatze verpassen lässt, wird dich niemand so leicht wiedererkennen. Weiter vorn sind wir an einem Friseursalon vorbeigekommen. Da gehst du jetzt hin.« Carlos rechnete mit Protest und nahm Jesús’ düsteres Nicken beinahe enttäuscht zur Kenntnis. Nach einer halben Stunde kehrte er zurück. Carlos hatte mit seiner Vermutung richtig gelegen: Der Kahlkopf war ihm selbst fremd. Die Härte, die sich innerhalb weniger Stunden in Jesús’ Gesichtszüge gefressen hatte, wurde durch nichts mehr gemildert. Carlos war, als verlöre er wieder einen Sohn. Er schob die deprimierenden Gedanken beiseite und instruierte Jesús, was er bei der Hotelinspektion beherzigen sollte. Schließlich ermahnte er ihn, sich nicht in Gefahr zu bringen. »Selbst wenn dir dein Leben gerade nicht viel wert ist – mir bedeutet es etwas. Und wenn dir auch das egal ist, dann vergiss bitte nicht, dass du nicht nur mit deinem Leben spielst, ja? Zehn Minuten gebe ich dir.« BLINDE FLECKEN | E-SALOU Für ein paar Stündchen ausbüxen, mehr wollte Anna gar nicht. Sie dachte sich auch nicht viel dabei, außer dass Alexander selbst schuld war. Eine Nullnummer wie Antonio mit ihrer Beaufsichtigung zu betrauen, das ging ja gar nicht. Außerdem legte ihr niemand gegen ihren Willen Fesseln an! Im besten Fall sorgte ihr Ausflug auch noch dafür, Primaten-Iwan eine Bestrafung nach Art des Hauses zu verschaffen, und zwar dieselbe, die er gerade Antonio verpasst hatte: eine schallende Ohrfeige. Die hatte Antonio sich in ihrem Beisein eingefangen, nur weil er sie in die Küche hatte entwischen lassen. Wie ein gezüchtigter Primaner hatte er dagestanden und seitdem konnte er vor Scham nicht mal den einen Meter geradeaus denken, zu dem es gewöhnlich bei ihm reichte. Deshalb wurde die Sache ein Kinderspiel. Zwar war der Garten von einer Mauer umgeben, über die sie nicht mal in ihren besten Parkour-Zeiten gekommen wäre. Doch es gab in dieser Mauer eine Stahltür und daneben ein Tastenfeld zur Eingabe eines Zahlencodes. Um die Nummernfolge auszuspionieren, musste Anna lediglich ein Frauengesichtchen aufsetzen, aufgeregt zu Antonio rennen, der auf seiner Liege am Pool lag, von höchst verdächtigen Geräuschen jenseits der Stahltür berichten. Damit hatte sie den richtigen Knopf gedrückt, den Mackerknopf nämlich. Antonio stürmte wie auf Befehl zur Tür, zückte seine Waffe und gab die Ziffernfolge ein: Sieben – eins – null – neun – drei – sieben. So flink, wie seine Finger über die Tastatur flogen – boah ey, da staunt die Tussi aber –, kam er natürlich nicht auf den Gedanken, ihre Augen könnten mithalten. Und die Fähigkeit, sich die Zahlen auch noch zu merken, hätte Erbsenhirn wahrscheinlich für Hexerei gehalten. Die Zahlenkombination kannte sie nun und es konnte der nächste Akt beginnen. Dessen Ziel war es, ihrem Bewacher vorzugaukeln, sie ginge in ihr Zimmer, während sie sich tatsächlich zur Stahltür schlich. Um sich von Vorurteilen im wahrsten Sinne des Wortes blenden zu lassen, brauchte man gar kein Hohlkopf wie Antonio zu sein: Einer Kohorte von Koryphäen, die den »Alpen-Ötzi« jahrelang gewogen und vermessen, seziert und geröntgt hatte, war es genialerweise gelungen, all die Zeit eine Pfeilspitze auf dem Röntgenbild zu übersehen, die sich jedem unbefangenen Betrachter förmlich ins Auge bohrte. In den raffinierten Mutmaßungen über Ötzis Tod war offenbar kein Platz für solche Banalitäten gewesen. Gegen dieses Wunder partieller Blindheit machte sich ihr kleines Täuschungsmanöver geradezu primitiv aus. Als Requisiten dienten eine Hecke, eine quietschende Tür und ein Stück Schnur. Die Hecke verlief längs des Seitentrakts, in dem sich ihr Zimmer befand. Sie deckte den Trakt vollständig ab, einen Durchlass ausgenommen. Dort konnte man entweder nach links zur Eingangstür abbiegen oder nach rechts – in den hinteren Teil des Gartens. Allerdings konnte Antonio von seiner Liege aus in den Durchlass sehen. Es galt also, seinen Blick durch eine kleine Manipulation abzulenken. Zu diesem Zweck hatte sie eine herumliegende Schnur zwischen der Türklinke und einem Ast gespannt, sodass die Tür offenstand, was Antonio nicht sehen konnte. Als Anna nun im Durchlass zwischen den Hecken verschwand, bog sie zwar ordnungsgemäß nach links ab, blieb jedoch stehen und löste die Schnur. Die Tür ging quietschend zu und Antonio blickte unwillkürlich in die Richtung des Geräusches. Diesen Moment nutzte sie, um auf die andere Seite zu huschen. Jetzt musste sie nur noch hoffen, dass er das Zufallen der Tür zum Anlass nähme, ein bisschen zu entspannen, schließlich war die Schnecke im Haus. Fünf Minuten stellte er ihre Geduld auf die Probe, dann endlich kam ihr Moment: Sein Blick folgte einem Schmetterling, der die Liege umflatterte; hätte sie ihm gar nicht zugetraut, sich für etwas so Schönes und Zerbrechliches zu interessieren. Sie schlich die Mauer entlang und war im Nu an der hinteren Wand. Antonio hätte sich jetzt schon umdrehen müssen, um sie zu sehen. Kerberos, der neben der Liege im Gras lag, schaute allerdings auf. Ganz entspannt, mein Junge. Wir sind Freunde, nicht? Und hier ist alles in Ordnung. Der Kampfhund legte den Kopf auf seine Pfoten und sah aufmerksam zu, wie sie die Ziffern ins Tastenfeld eingab und vorsichtig die Tür öffnete. Als sie verschwand, gab er ein leises Heulen von sich, das Antonio irritierte. Er blickte sich um. Nichts Verdächtiges zu sehen. Gleich im ersten Laden fand Anna einen Stadtplan mit Landkarte, klein, kompakt und billig, also genau das Richtige für nur mäßig dreiste Langfinger. Erstaunt stellte sie fest, dass der Nachbarort Cambrils hieß. Von dem hatte doch Mutter Beimer gesprochen: Cambrils an der Costa Dorada, wo man toll essen konnte. An Fügung zu glauben, hielt Anna angesichts Hunderttausender hungernder Kinder, für die sich Tag für Tag in Welt Nummer drei überhaupt nichts fügte, für puren Zynismus, aber was Cambrils betraf, wollte sie eine Ausnahme machen. Wie hieß das Lokal, das Mutter Beimer ihr empfohlen hatte? Roca d’en Manel, genau. Da würde sie heute einkehren und schmausen! Bei der Vorstellung, wen sie alles prellen musste, grinste sie. Vorsicht, Anna Heydt ist im Lande! Der Gedanke machte ihr Spaß, überhaupt war das ein großartiger Tag! Sie winkte ein Taxi heran. WAHRHEITSFINDUNG | E-TARRAGONA Jesús hatte die zehn Minuten gut genutzt. Der Blonde wohnte nicht im Hotel, hatte er herausgefunden, sondern traf sich zum wiederholten Mal mit zwei Hotelgästen, die laut Gästebucheintrag Iwan Müller und Christian Meier hießen. Er spreche perfekt spanisch, hatte der Portier gemeint, verständige sich aber mit den anderen beiden auf Deutsch. Die Hotelgäste seien »grobe Männer«, vor allem der muskelbepackte, stämmige Señor Müller, nicht jedoch der Blonde, bei dem es sich nach Ansicht des Portiers um den Chef des Trios handelte. Die Hotelgäste hätten bereits gezahlt und würden vermutlich bald auschecken. »Wir müssen zuschlagen, bevor die drei auf Nimmerwiedersehen verschwinden«, forderte Jesús. »Halt den Schnabel, das hier ist mein Metier.« »Verdammt …« »Wir können es nicht mit dreien aufnehmen. Ich wollte wissen, wer das Sagen hat, und nun wissen wir es und konzentrieren uns auf den. Ende der Durchsage. Du gehst den Wagen holen.« Carlos kramte den Schlüssel aus der Hosentasche. »Beeile dich. Wenn sich hier was tut, rufe ich dich an.« Zum Glück stand der Wagen nicht allzu weit entfernt. Nach zwölf Minuten näherte sich Jesús bereits wieder dem Hotel. Vor dem Eingang sah er einen gedrungenen Mann mit kurz rasierten Haaren Gepäck in einen BMW laden. Das war Iwan, kein Zweifel. Jesús überkam Hass. Ende des gegenseitigen Belauerns, entschied er, jetzt musste Klartext geredet werden, koste es was es wolle. Zu verlieren hatte er sowieso nichts mehr. Er steuerte direkt auf den BMW zu, um ihn zu blockieren. In letzter Sekunde, er hatte den Fuß schon auf der Bremse, besann er sich: Wenn er den offenen Kampf suchte, brachte er auch Carlos in Lebensgefahr. Also fuhr er weiter und fieselte den Wagen in eine kleine Parklücke. Noch während er ausstieg, sah er den BMW davonfahren. Scheiße! Carlos hatte sie abhauen lassen, Scheiße, Scheiße, Scheiße! Vor Wut kochend, rannte er zum Hotel zurück. Plötzlich stoppte er. Der Blonde kam ihm entgegen. Direkt hinter ihm ging Carlos. Und zwischen ihnen befand sich wahrscheinlich ein Revolver. Carlos schob den Mann in eine Zufahrt und gab Jesús mit einer Handbewegung zu verstehen, er solle im Wagen nach etwas suchen, das sich als Augenbinde eignete. Kurz darauf startete Jesús den Wagen. Zwanzig Minuten später bog er in die Carrer de Pompeu Fabra ein und parkte vor dem Apartmenthaus. Niemand hatte ein Wort gesprochen. Doch der Blonde würde noch sprechen. Jesús hätte sein Leben dafür gegeben, endlich die Wahrheit zu erfahren. Und nicht bloß seins. BUßBÜRGEN | E-SALOU Während Anna sich ausmalte, was sie im Roca d’en Manel an Delikatessen erwartete, meldete Antonio ihr Verschwinden. Er hatte in seiner Verzweiflung sogar in ihrem Nachtschränkchen nach ihr gesucht und im Stillen auf übersinnliche Fähigkeiten plädiert – bis er endlich bemerkte, dass die Stahltür im Garten lediglich angelehnt war. Wie sie es gemacht hatte, blieb ihm ein Rätsel, aber was ihm jetzt drohte, erkannte auch er, ein solcher Idiot war er nun doch nicht. In seiner Verblüffung erhob Iwan nicht einmal die Hand. »Geh auf dein Zimmer«, sagte er bloß. Seine Stimme war rau. Eine Viertelstunde später trat er mit versteinertem Gesicht in Antonios Zimmer und sah ihn schweigend an. »Du oder deine Schwester.« Antonio verstand auf Anhieb. Jeder Heilssoldat benannte, wenn er in den aktiven Dienst eintrat, einen Menschen als Bußbürgen, der im Fall einer schuldhaften Verfehlung getötet werden durfte. Antonio hatte nur eine verschwommene Erinnerung an seine ältere Schwester, aber eine gute. Sie hatte vor seiner Abschiebung ins Waisenhaus an Mutters Stelle für ihn gesorgt. Nie hätte er sie geopfert. »Ich«, antwortete er fest. Iwan nickte, er hatte nichts anderes erwartet. Noch nie hatte einer seiner Leute den Bußbürgen für sich über die Klinge springen lassen. »Du hast noch eine Gnadenfrist, die Zeremonie findet erst in Deutschland statt.« Antonio schluckte. Er hätte es lieber schnell hinter sich gebracht. »Und wenn ich mich in der Zwischenzeit auszeichne?« »Dann stirbst du als Ehrenmann.« »Ja.« »Vergiss nicht: Wir sind das Mittel zum Zweck. Eigensinniger Ehrgeiz wäre eine Todsünde.« »In Ehre und Ewigkeit«, bekräftigte Antonio. »Soll ich beim Suchen helfen?« »Wir suchen sie nicht. Der Salvator ist überzeugt, dass sie von selbst zurückkommt.« Jesús tigerte den schmalen Flur vor der Besenkammer auf und ab. Er wollte da rein und den Mann zum Reden bringen, doch Carlos hatte den Schlüssel abgezogen, bevor er losgezogen war, Verpflegung und »ein paar Sachen« besorgen. Sachen, mit denen er den Widerstand des Mannes brechen wollte. Jesús hatte gedrängt, es wie bei Brúto zu probieren, statt Zeit zu vergeuden, aber Carlos hatte ihn abgewürgt. Brúto sei ein Schwächling gewesen, bei dem ein bisschen Feuerwerk zum Einschüchtern gereicht habe. Dieser Mann sei ein anderes Kaliber, der würde plumpe Gewalt als Zeichen der Ohnmacht durchschauen. »Wenn du reingehst, steige ich aus«, hatte Carlos zum Abschied gedroht. Jesús spürte, wie suspekt er ihm geworden war. Er verstand ihn. Nur verstand Carlos nicht, was in ihm vorging. Weil der alte Folterfachmann nicht die geringste Ahnung hatte, welche Folter er gerade durchlitt. Als wären Tausende Nano-Terroristen in seine Blutbahnen eingedrungen, um sich seines Körpers zu bemächtigen und auch noch das letzte bisschen Leben herauszuquetschen. Er trat vor den Spiegel. Der grimmige Blick hatte mit den Bernsteinaugen, von denen Gloria geschwärmt hatte, nichts mehr gemein. Mit demselben grimmigen Blick blickte er zur Besenkammer. Er beherrschte sich. Ohne die Lebensweisheiten seines Freundes Carlos würde die Welt sich noch kälter anfühlen. VON UND ZU PLEITEGEIER | E-CAMBRILS Hätte Anna geahnt, worum es sich bei einer Bestrafung nach Art des Hauses handelte, sie wäre nicht ausgebüxt. Während Antonio erfuhr, dass sein Leben bald ausgelöscht würde, saß sie in einem sonnenbeschienenen Straßencafé und löschte ihren Durst mit einem Glas Orangensaft. Cambrils gefiel ihr besser als Salou, alles eine Nummer kleiner und charmant genug verpackt, um die Massenmenschhaltung nicht zu direkt zu spüren. Noch hatte es ohnehin nicht viele Touristen hier an Land gespült, die Spanier waren weitgehend unter sich und ließen sich nicht anmerken, wie dringend sie Zulauf aus sonnenärmeren, aber ansonsten reicheren Ecken Europas brauchten. Anna fühlte sich sauwohl. Bei ihrem Bummel durch den Ort hatte sie auch das Roca d’en Manel ausgemacht, es lag an der Promenade, mit Blick auf den Hafen. Die Spanier gingen Daniel zufolge erst zwischen neun und zehn zum Mampfen, so lange würde sie sich nicht gedulden; aber jetzt, um halb sechs, war es definitiv zu früh. Sie freute sich auf frischen Fisch, den sie von ihrer vegetarischen Abstinenz ausnahm, weil man mit Fischen ja nicht reden konnte. Einmal die Bestände rauf und runter, wenn schon Zechprellen, dann auch ordentlich. Die sollten sich ja nicht lumpen lassen, wenn Ihre Hoheit, Anna von Heydt und zu Pleitegeier, ihnen die Aufwartung machte! Ein königliches Mahl, draußen, bei Kerzenschein, darunter würde sie es nicht tun. Bis dahin musste sie sich ein wärmeres Oberteil organisieren, es wurde langsam frisch. Eine Stola hätte sie für diesen Anlass als angemessen befunden, aber sie würde sich mit was Billigem begnügen – um Bankrott zu gehen, waren die Spanier ja nicht auf ihre Mithilfe angewiesen. Sie wartete, bis die Kellnerin im Lokal verschwand, und schlenderte in Richtung Fußgängerzone. FREUNDSCHAFTSDIENSTE | E-SALOU »Gib mir Zeit.« »Uns bleibt keine Zeit mehr, Gorpón.« Carlos seufzte. »Wir haben es mit einer hochgradig kriminellen Organisation zu tun, die wahrscheinlich Unterstützung aus dem Polizeiapparat erhält.« »Unsinn.« »Du hast selbst angedeutet, dass du jemanden in Verdacht hast. Jemanden, der dir politisch nahesteht, sonst hättest du dich nicht so zurückhaltend geäußert. Also übernimm Verantwortung, verdammt noch mal! Allein stehe ich auf verlorenem Posten.« »Was hast du mit dem Mann vor?« »Ihm auf den Zahn fühlen.« »Die alten Methoden.« »Die sind nichts, verglichen mit dem, was dem Jungen widerfahren sein muss.« Gorpón dachte nach. Dass Pintaluba krumme Touren fuhr, betrachtete er als Tatsache, seit der Oberst ihn von einer Sekunde zur anderen zurückgepfiffen hatte und von einem Mordverdacht gegen Mirandor nichts mehr wissen wollte. Und nun schürte Lobreta auch noch den Verdacht, der Oberst sei Teil einer hochkriminellen Vereinigung. Trotzdem fiel es Gorpón schwer, sich gegen ihn zu stellen. Pintaluba war ein tragender Pfeiler der Kameradschaft. Was, wenn er alles mit sich in den Abgrund riss? Der politische Gegner würde Kübel voll Jauche über der Kameradschaft ausschütten. »Jesús ist ein liebenswürdiger junger Mann, du hast ihn selbst kennengelernt«, unterbrach Lobreta seine Gedanken. »Du musst ihn aus der Schusslinie ziehen, von mir aus sperre ihn vorläufig ein. Oder willst du ihn über die Klinge springen lassen?« »Nein, nein«, beeilte sich Gorpón zu sagen, »bloß …« »Bei der Freundschaft unserer Familien!« Gorpón konnte nur mit Mühe ein Stöhnen unterdrücken. Jede Schuld musste einmal beglichen werden und nun hatte die Stunde geschlagen. Vor fast fünfzig Jahren war seinem Großvater von Lobretas altem Herrn ein großer Dienst erwiesen worden. Beide lagen längst unter der Erde, doch nie wäre er auf die Idee kommen, mit ihnen sei auch die offene Rechnung beerdigt worden. »Über die Einzelheiten muss ich erst mit Kameraden sprechen. Und dann brauche ich etwas Zeit, um die Sache zu organisieren. Ich rufe dich morgen an, spätestens mittags. Bis dahin hast du in Salou freie Hand. Von mir aus verhöre also den Mann. Danach übernehme ich das Kommando.« »Danke, Gorpón.« »Danke deinem Vater.« Carlos legte auf und blickte gedankenverloren über den Parkplatz des Einkaufszentrums. Müde rieb er sich die Augen. Der Gedanke, wieder in die Kiste mit den Folterwerkzeugen greifen zu müssen, setzte ihm zu. Einer Ratte wie Brúto ein bisschen einzuheizen, hatte er sich nicht schwergetan, der hatte mehr verdient als ein bisschen Puppenstubenfolter. Doch nun ging es um ein anderes Kaliber. Er spürte Abscheu in sich aufsteigen. Die ›Inquisition‹ war immer nur ein notwendiges Übel für ihn gewesen, ein widerliches Mittel zu einem hehren Zweck, da hatte er Jesús nicht angelogen. Nie hatte er ein sadistisches Vergnügen dabei empfunden, nie an dem Blut geleckt, das an seinen Händen klebte. Als es endlich vorbei war, hatte er aufgeatmet. Und nun war es wieder da. Einer musste sich eben die Hände schmutzig machen und leider musste er es sein. Auf seine alten Tage. Hehrer Zweck – widerliche Mittel. Wieder einmal. Als wäre es seine Bestimmung. Er überlegte, wie er es angehen sollte. Der Widerstand des Gefangenen würde nicht leicht zu brechen sein, wie ihm ein Blick in dessen fanatisch funkelnde Augen offenbart hatte. Mit »ein bisschen« Folter war hier nichts zu gewinnen. Er musste den Druck gezielt auf die psychischen Sollbruchstellen richten und die Intensität angesichts der knappen Zeit schnell steigern. SCHLECHTES BAUCHGEFÜHL | E-CAMBRILS Das Ziehen im Unterbauch schmerzte, doch viel mehr setzte Anastasia zu, dass sie den Sex vorläufig von der Speisekarte streichen musste – als wäre er nicht das Sahnehäubchen gewesen, von dem womöglich das ganze Menü abhing. Nicht für sie. Aber vielleicht für Markus? So sehr sie der Sex mit ihm erregte, bestand ihr größter Gewinn nicht im Orgasmus, sondern in der Nähe, die er sich und ihr dabei erlaubte. Denn sie empfand nicht weniger als Liebe für ihn. An attraktiven Männern hatte es ihr nie gemangelt, aber letztlich hatten sich alle Beziehungen als das ewige Nullsummenspiel erwiesen, bei dem Attraktivität gegen Attraktivität eingetauscht wurde und sonst nichts. Mit Markus war es anders. Sie hatte es schon bei ihrer ersten Begegnung auf dem Seminar vor einem halben Jahr gespürt. Ein Blick in seine grauen Augen, die einen offen und zugleich abwartend ins Visier nahmen, hatte gereicht. Ohne es erklären zu können, liebte sie ihn auch wegen seiner blöden Zurückhaltung. Liebe auf den ersten Blick hätte sie noch vor Kurzem zum Schmonzettenprogramm erklärt, ZDF, Sonntag, 20 Uhr 15. Und plötzlich befand sie sich selbst in solch einer Schmonzette. Nichts an Markus passte in ihr Beuteschema, zu klein, nicht die Andeutung eines Waschbrettbauchs, zu wenig markant. Keine Spur von Superman. Doch ihr Beuteschema hatte sich förmlich in Luft aufgelöst. Angesichts seiner seltsamen Anziehungskraft hatten die Statiker und Statistiker in ihrem Wahrnehmungsapparat das Handtuch geworfen: Die unauffällige Männlichkeit von Polizeioberkommissar Markus Engel vermochten sie weder zu vermessen noch zu katalogisieren, sie entzog sich ihren Maßstäben. Vordergründig waren es die Augen und das leicht spöttische Gekräusel um die Mundwinkel, wenn Selbstdarsteller wie Degenhart die Bühne betraten. Die Art, wie er seine Skepsis in ein kleines »so?« verpackte. Seine Entschlossenheit, den Dingen auf den Grund zu gehen. Alles das liebte sie an ihm. Und noch etwas anderes, das sie nicht zu fassen vermochte. Markus war ihr ein Rätsel, das sie zugleich bezauberte und verunsicherte, vor allem in den letzten Tagen. Einerseits kamen sie sich näher, andererseits schien sich auf widersprüchliche und doch spürbare Weise der Abstand zwischen ihnen wieder zu vergrößern. Zwei Seiten derselben Medaille? Brauchte Markus einfach nur mehr Zeit, um die Nähe zu verdauen? Vielleicht konnte er sich vorerst nur gehen lassen, wenn er in Endorphinen badete. Oder war der Sex für ihn das Eigentliche – und mehr ging nicht, jedenfalls nicht mit ihr? In diesem Fall spielte es natürlich überhaupt keine Rolle, dass sie ihre Tage hatte, dann stünde sie ohnehin auf verlorenem Posten. Aber lieber wäre es ihr gewesen, es nicht auf die Probe stellen zu müssen. Sie hatte Angst davor. Jetzt bloß nicht die Nerven verlieren! Sie hatte schon so viel erreicht, die punktgenaue Versetzung von Kassel nach Frankfurt, die Mitfahrgelegenheit nach Toledo und die Verfrachtung des distanzierten Herrn Engel in ihr Bett. Das durfte sie nicht durch einen Schwächeanfall in Gefahr bringen. Zunächst musste sie Markus aus dem Haus kriegen, auf keinen Fall sollte er mitbekommen, wie sehr der Unterleib ihr zu schaffen machte und wie dünnhäutig sie sich fühlte. Sollte er in den Ort gehen und was essen, sie brauchte jetzt Ruhe und ein Bad. SELBSTZWEIFEL | E-SALOU S fragte sich, wie viel Zeit vergangen war, seit Lobreta ihn geknebelt und mit verbundenen Augen in diesen Raum geführt hatte. Stunden? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Er musste damit rechnen, dass sich die gefühlte Zeit in dieser schwarzen Stille dramatisch dehnte, obschon es ihm schwerfiel, sich vorzustellen, er hätte erst einige Minuten hinter sich gebracht. Doch das Zeitgefühl war nicht sein größtes Problem. Seine Oberschenkel brannten, weil Lobreta ihn wie zum Gebet auf die Knie gezwungen und in dieser Haltung mit unzähligen Lagen Klebeband fixiert hatte. Er spürte, wie die Vorboten eines Muskelkrampfes langsam zu den Hüften hinaufkrochen. Bald würde er ihn ertragen müssen, ohne sich Erleichterung verschaffen zu können. Die reinste Folter. Genauer gesagt: der Beginn. S wusste einiges über Folter, wenngleich sicherlich weniger als der ehemalige Sonderermittler Carlos Lobreta. Zeit und Dosierung spielten eine wichtige Rolle: Im Laufe der Zeit wurde die Leidensdosis schrittweise erhöht, bis der Gefolterte schließlich lieber sterben wollte. Dann war er meist auch zu reden bereit. Er nicht! Er würde die Pein schweigend ertragen und schließlich sein Leben für den Salvator hingeben. Würde – der Modus des Ungewissen. Was, wenn er der Folter nicht standhielt? Wenn er Verrat beging? Der Salvator würde sich retten, er besaß Fluchtburgen in aller Herren Länder. Nur für ihn selbst gäbe es keine Rettung: Er würde sich als heilloser Versager entpuppen, als Dreck unter den Nägeln. Ihn schauderte bei der Vorstellung und er fühlte sich beinahe erleichtert, dass der Schmerz endlich zuschlug. Das scharfe Ziehen in der Hüftmuskulatur bildete allerdings bloß den Auftakt zu weitaus größerem Leiden. WAHRNEHMUNGSSTÖRUNG | E-CAMBRILS Mürrisch verließ Markus das Haus. Erst konnte Anastasia gar nicht genug Nähe kriegen und nun schmiss sie ihn einfach aus dem Haus: Husch, husch, Gassi gehen, Frauchen will allein sein. Da sollte sich jemand auskennen. Für das Bedürfnis nach Alleinsein hatte er größtmögliches Verständnis, ein Menschenrecht, aber musste er dafür ausgesperrt werden? Nach Rücksprache mit Magen und Gemüt beschloss er, sich Schokolade zu besorgen, eine kleine Runde zu drehen und wieder den Heimweg anzutreten. Es gab ein zweites Schlafzimmer, dahin würde er sich zurückziehen. Er machte einen Schlenker über die dem Meer abgewandte Seite von Cambrils, wo einer seiner besten Freunde gewohnt hatte, vielleicht erkannte er das Haus wieder. Plötzlich meldete sein Handy mit einem Piepsen, dass der blöde Akku schwächelte. Das fehlte ihm gerade noch, wo er doch auf einen Anruf von Mirandor hoffte. Tut mir leid, Anastasia, ich muss zurück, entschuldigte er sich in Gedanken und beschleunigte. Diesmal würde er den kürzeren Weg über die Promenade nehmen. Schnell, wie er ging, war er bereits am Roca d’en Manel vorbei, bis ihm dämmerte, wen er gerade dort gesehen hatte. Genauer: wen er gesehen zu haben glaubte. Konnte ja gar nicht sein. Außerdem hatte die Frau schwarze statt roter Haare, alles Quatsch, sein Verstand spielte ihm einen Streich. Trotzdem musste er sich vergewissern. Er kehrte um – und lief dem Kellner in die offenen Arme. Sie hatten gestern hier gegessen und dabei war die Sprache auch auf seine Jugend in Cambrils gekommen, sehr zur Freude des Kellners. Dessen Begeisterung war offenbar noch nicht abgeebbt. Er begrüßte Markus überschwänglich und nahm zwei Speisekarten von einem Beistelltischchen, die Señora komme doch bestimmt auch, was Markus von diesem Tisch hier halte. Er fühlte sich bedrängt, vertröstete den Kellner auf ein anderes Mal und machte auf dem Absatz kehrt. KOPFARBEITER | E-SALOU Nach drei qualvollen Krämpfen wünschte sich S nur noch, in Ohnmacht zu fallen, um nicht mehr spüren zu müssen, wie sein Hirn die Meldungen aus der Muskulatur zu Schmerzen verarbeitete. Obwohl er nichts Gutes erwartete, als die Tür aufging und Licht durch seine Augenbinde drang, dankte er dem Schicksal für die Ablenkung. Sie währte keine Minute. Bevor er das neue Geräusch im Raum deuten konnte, erlosch das Licht wieder. Bald wusste S Bescheid: Das Brummen stammte von einem Heizlüfter. Offenbar ein leistungsstarkes Modell. Die Luft flirrte vor Hitze. S rann der Schweiß in Strömen hinab. Weitaus mehr peinigte ihn die Atemnot. Er schnappte nach Luft und inhalierte sie gierig, wodurch er den ausgetrockneten Knebel noch tiefer in den Rachen sog. Würgen und Husten kamen gleichzeitig. Und mit ihnen die Todesangst. S glaubte zu ersticken. Sein Körper bebte. Du musst durch die Nase atmen! Er blähte die Nasenlöcher und saugte ein, was an Luft da war, aber die Hitze schien sie verdünnt zu haben. Es reichte nicht, um seinen Lungen zu geben, was sie zum Leben brauchten. Eine subjektive Täuschung, versuchte er sich zu beruhigen. Er hatte noch nie gehört, dass warme Luft weniger Sauerstoff enthielt. Lass dich nicht irremachen! Er musste sich entspannen und zwar schnell! S sammelte seine Kräfte. Lobreta sollte sich noch wundern! Er war überrumpelt worden, aber nun würde er sich wieder fangen. Der Alte sollte noch bedauern, dass er ihn, den Intellektuellen, statt Iwan oder Christian gekidnappt hatte. Die beiden Krieger mochten robuster sein, doch er war der SOHN! Er besaß die Fähigkeit, sich gegen die Folter zu wappnen! Zunächst den Geist. Er hatte aus beruflichen Gründen autogenes Training erlernt, wenngleich schon jahrelang nicht mehr praktiziert. Er richtete seine Konzentration auf den Brustkorb, der ihm zum Atmen viel zu eng geworden war, und weitete ihn mit der Kraft seiner Gedanken. Als der Druck nachließ, beruhigte sich auch sein Herz. Dann die Atmung. Schritt für Schritt wanderte S durch seinen Körper und immunisierte ihn gegen die Angst vorm Ersticken. Anschließend begann er mit progressiver Muskelentspannung. Durch bewusstes Anspannen und Entspannen lockerte er nacheinander die verhärteten Muskelgruppen. So bald würde ihn kein Krampf mehr überwältigen. IDENTITÄTSKRISE | E-CAMBRILS Als Anna aufblickte, befand sie sich kaum noch in Engels Blickwinkel. Einen huschenden Schatten – mehr konnte er nicht wahrgenommen haben. Doch das Gehirn verfügt über erstaunliche Fähigkeiten, Gesichtszüge aus punktuellen, womöglich verschwommenen visuellen Informationen zu extrahieren, sie wie das Strichmuster eines Barcodes zu decodieren und mit neuronal gespeicherten Daten abzugleichen. Dalli-Klick, schon hat es Wahrnehmungsdetails zu einem vollständigen Gesicht hochgerechnet. Im Zuge dieser Informationsverarbeitung hielt Engel inne. Drehte den Kopf zurück. Und blickte in Anna Heydts grüne Katzenaugen. Anna blieb vor Schreck der Bissen im Hals stecken. Von einem Hustenreiz geschüttelt, begann sie zu keuchen. Verdammt, sie bekam keine Luft mehr! Engel war mit einem Satz bei ihr, umfasste sie von hinten, die Hände zwischen ihrem Bauch und Brustkorb verschränkt, und zog die Arme mehrmals mit aller Kraft an. Endlich fand das Stück Garnele den Weg zurück. Anna schnappte nach Luft. Es dauerte, bis sich ihre Atmung wieder beruhigte und sie sich, den Konventionen entsprechend, bedanken konnte. In Engels Ohren klang ihr Dank nach: Du Bullenschwein hattest doch nur Angst, ich könnte dir vor der Verhaftung wegsterben. Er war unangenehm berührt. Bis ihm dämmerte, was sie sich wahrscheinlich gerade vorstellte: Dass er sie durch halb Europa verfolgt hatte, um sie nach Deutschland zurückzuverfrachten. »Ich bin weder wegen Ihnen in Spanien noch habe ich auch nur geahnt, Ihnen hier zu begegnen. Ein unbegreiflicher Zufall.« Oder doch kein Zufall? Aber was dann? »Im Übrigen habe ich hier keinerlei polizeiliche Befugnisse. Ich würde gern kurz mit Ihnen reden, sonst nichts.« »Wenn’s denn sein muss.« »Danke!« Absurderweise strahlte der Bulle sie an, was zwar nicht zu ihm passte, ihm aber stand. »Sie ahnen gar nicht, welche Sorgen ich … das heißt wir, wir alle, vor allem auch Dr. Lexied, welche Sorgen wir uns um Sie gemacht haben.« »So?« Imitierte sie ihn? Wenn ja, dann hatte sie es gut getroffen, musste er zugeben. »Ihre Sorge wird bloß gewesen sein, wie Sie mich wieder einfangen.« »Dürfte ich gar nicht.« Sie sei in Deutschland lediglich als vermisst gemeldet, erläuterte er ihr. »Werde ich denn nicht mehr verdächtigt?« Sie wagte es nicht zu hoffen. »So kann man es leider nicht sagen.« Es war also alles beim Alten geblieben. Wahrscheinlich hätte es ohnehin keinen Unterschied mehr gemacht, wahrscheinlich war es so oder so besser, einen Schlussstrich zu ziehen. »Sie erinnern sich an den Staatsanwalt? Der verhält sich in Ihrem Fall weiterhin völlig irrational.« Genaugenommen verdankte sie gerade diesem irrationalen Verhalten, dass es nur zu einer Vermisstenmeldung gekommen war, wohingegen er selbst auf einen Haftbefehl gedrängt hatte. Er behielt es für sich: Manchmal stellten die Tatsachen die Wahrheit auf den Kopf. »Hatten Sie vielleicht schon mal mit Dr. Strecker zu tun?« Sie schüttelte energisch den Kopf. »Jetzt erzählen Sie mal: Welchem Zufall verdanke ich dieses Stelldichein?« Markus überlegte, was er ihr als Ermittlungsbeamter sagen durfte. Ach was, er befand sich im Urlaub. Während Anna trotzig den Fischteller leerte, berichtete er in groben Zügen von den Hintergründen seiner Dienstreise nach Spanien. »Es gibt sogar gewisse Ähnlichkeiten zwischen ihrem und dem spanischen Fall. Wie aus dem Nichts tauchen seltsame Beweise auf, die jemanden in den Verdacht einer Straftat bringen.« »Heißt das, Sie glauben endlich an meine Unschuld?« »Ja. Erzählen Sie mir jetzt auch, wie es Sie nach Spanien verschlagen hat, Frau Heydt?« »Weiß nicht. Ohne Haftbefehl haben Sie ja keine …« »Ich sitze hier nicht als Polizist. Warum müssen Sie ständig darauf rumreiten? Ich rede mit Ihnen als …« »Ich höre.« Tja, er wusste es selbst nicht so genau. HARMONIEBEDÜRFNIS | E-SALOU Die Sinne aufs Äußerste gespannt, hörte S den Folterer nahen, noch bevor die Tür aufging. Seine Immunabwehr lief auf Hochtouren und hielt den Angstvirus bislang bravourös in Schach. Kraft seiner geistigen Fähigkeiten würde er auch die nächste Runde im Nervenkrieg gewinnen. Er vernahm die Musik schon, bevor ihm der Kopfhörer aufgesetzt und mit Klebeband am Kopf fixiert wurde. Jetzt bekam er also was auf die Ohren. In einem Aufsatz über Foltermethoden hatte er gelesen, der akustische Terror könne an den Rand des Wahnsinns führen. Nach einigen Minuten schien es ihm maßlos übertrieben. Es war unangenehm, schon wegen der Lautstärke – aber Folter? Tausend Wiederholungen später hatte er seine Meinung gründlich geändert. Er konnte die ewig selbe Melodie nicht mehr hören, sie quoll ihm zu den Ohren raus! Doch das wirklich Quälende war ein Detail, dem er zunächst nicht viel Beachtung geschenkt hatte: Das Lied brach nach einigen Takten jäh ab und begann ohne Atempause wieder von vorn: Yesterday, all my troubles seemed so far away, now it looks as though they’re here to. Yesterday, all my troubles seemed so far away, know it looks as though they’re here to. Yesterday, all my troubles seemed so far away, now it looks as though they’re here to. Yesterday, all my troubles seemed so far away, know it looks as though they’re here to. Yesterday, all my troubles seemed so far away, now it looks as though they’re here to. Allmählich begann das wie mit einem Beil zerhackte Lied auch seine Hirnhälften zu spalten. Die linke Hemisphäre nahm den Input weiterhin sachlich: alles bloß eine Kakofonie von beleidigender Primitivität. Die emotionalere rechte Hemisphäre hingegen drehte langsam durch. Sie konnte sich mit dem abrupten Ende einfach nicht abfinden, gierte nach dem ganzen Lied oder wenigstens einer weiteren Harmonie oder einem Ton, einem einzigen Ton, das war doch nicht zu viel verlangt! S versuchte, die Melodie zu summen, um sich selbst Linderung zu verschaffen, kam aber gegen die Zwangsbeschallung nicht an. Er versuchte, die Vernunft wieder in Stellung zu bringen, vermochte es jedoch nicht. Die Angst vor dem nächsten Here to. Yesterday überwältigte ihn. Als würde auf sein Trommelfell eingedroschen. Als würde ihm das Hirn aus dem Kopf geprügelt. Von autogenem Training konnte keine Rede mehr sein, nicht einmal die einfachen Muskelübungen brachte er mehr zustande. Er konnte sich nur noch auf die Dissonanzen im Kopf konzentrieren und auf die Angst, die sich wie ein gehetztes Tier in seine Eingeweide verkrochen hatte. Die Angst vor dem nächsten Schlag. Die Angst vor dem nächsten Muskelkrampf. Die Angst vorm Ersticken. IM ZWEIFEL ALLEIN |E-CAMBRILS »Sie sind ein seltsamer Bulle.« »So?« »So!« Sie grinste verhalten, der Schock über sein plötzliches Auftauchen wirkte noch nach. »Ein Zweifler vor dem Herrn sind Sie.« »Leute, die immer zu wissen meinen, wo es langgeht, sind mir fremd.« »Manche zweifeln sich zu Tode.« »Halten Sie mich für so einen?« Einen Moment war sie versucht, ihm ein Ja reinzuwürgen. »Nein, eher nicht. Überführen Sie eigentlich viele?« »Ja.« »Das habe ich befürchtet.« Es sollte ein ironischer Witz sein, doch ihre Mundwinkel hingen fest. Ironie passte nicht zur Großwetterlage. »Zweifler werden gern als lau hingestellt – ich finde sie eher mutig. Natürlich kann Zweifel lähmen, aber mich treibt er eher an.« »Wobei?« »Der Wahrheit näherzukommen. Das ist mein Beruf.« »Sie kennen bestimmt dieses schwarz-weiße Vexierbild, auf dem man je nach Blickwinkel entweder eine Vase oder zwei Gesichter erkennt.« »Ja, wieso?« »Weil es veranschaulicht, wie subjektiv unsere Erkenntnis ist.« »Ich bin mir bewusst, dass ich immer nur eine plausible Version der Wahrheit erfasse. So, wie sie sich aus den Beweisen ergibt. Wobei auch die Beweise nichts Feststehendes sind. Man muss sie deuten. Und wie man sie deutet, hängt davon ab, welche Version der Wahrheit man bereits im Kopf hat.« »Hat was von einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung.« »Ja. Gerade darum finde ich, dass der Zweifel zum Handwerkszeug eines Polizisten gehören sollte.« »Klingt trotzdem ziemlich wackelig.« »Entweder man gibt sich damit zufrieden, oder man kapituliert und lässt den Verbrechen ihren Lauf. Was ist das Leben anderes als ein Haufen Kompromisse? Es sollten nur nicht lauter faule sein, weshalb man dem ersten Anschein besser mit Zweifel begegnet.« »Wieso sagen Sie ständig ›man‹, wenn sie ›ich‹ meinen?« »Anmaßung.« Er lächelte. »Wahrscheinlich sehen es viele Kollegen anders.« »Hirnschädigungen, sagen wir durch einen Unfall, können massive Persönlichkeitsveränderungen bewirken, auch die Neigung zu kriminellem Handeln, richtig?« »Ich habe Ihren Artikel gelesen, Herr Triebel hat ihn mir gegeben.« »Aha. Und?« »Gut geschrieben.« »Sie müssen mich nicht bauchpinseln.« »Ich fand ihn gut! Und da ich ja ein Zweifler vor dem Herrn bin, ist er natürlich auf fruchtbaren Boden gefallen. Nur die Strafverfolgung sollten wir nicht gleich abschaffen.« »Das altbekannte Phänomen: Konsequenzen sollen immer bloß die anderen ziehen.« »Ich verstehe, was Sie meinen, nur …« »Wenn jemand wegen einer unverschuldeten Persönlichkeitsveränderung zum Täter wird – dann kann er eigentlich nichts für das Verbrechen. Darf man ihn dann zur Rechenschaft ziehen? Und wenn nicht: Müsste man dann nicht jeden Täter untersuchen? Vielleicht befand sich sein Hirn von Geburt an in derselben Verfassung.« »Vielleicht. Allerdings …« »Womöglich werden jeden Tag Hunderte Unschuldiger verurteilt.« »Die Frage der Schuld fällt in die Verantwortung der Gerichte.« »Klingt nach einem Waffenhersteller, der die Hände in Unschuld wäscht, weil er ja nicht selbst abdrückt.« »Sie sind ganz schön hartnäckig.« »Steht hartnäckig für lästig?« »Nein, ich hasse Wischi-Waschi. Zurück zum Thema: Wenn es Anhaltspunkte gibt, werden solche Untersuchungen auch durchgeführt. Im Übrigen muss sich die Gesellschaft gerade vor unschuldigen Tätern schützen, wenn sie eine Gefahr darstellen. Oder soll man sie frei herumlaufen lassen, rette sich, wer kann? Wohl kaum. Unschuldige Täter wandern deshalb in die Sicherungsverwahrung. Und da kommt man noch viel schwerer wieder raus als aus dem Knast.« »Auch keine schöne Lösung.« »Genau. Trinken Sie ein Glas Wein mit mir?« Anna überlegte. Es war Teil der Abmachung mit Alexander, auf Tabak und Alkohol zu verzichten. Andererseits: wenn schon ein Ausflug in die Freiheit, dann auch richtig. Sie würde sich bestimmt nicht betrinken, das geschah nur, wenn sie sich allein fühlte. »Einverstanden, vorausgesetzt, Sie knausern nicht. Auf der Karte habe ich einen Rioja Gran Reserva gesehen, nicht ganz billig. Wenn Sie sich beliebt machen möchten, sollten Sie den bestellen – da würde ich sogar mit dem Kavalier anstoßen.« »Ich habe leider nur einen Zehner dabei.« »Schon gut. Sie peinlich berührt zu sehen, ist auch was wert. Dann bestelle ich eben, ich kann sowieso nicht zahlen.« »Wie?« »Ich wollte gleich unbemerkt die Flatter machen.« »Zechprellen.« »Es besaß zwar jemand die Großzügigkeit, mich nach Spanien einzuladen, nur Geld hat er mir leider keins zugesteckt. Ich kann also nicht mal mein eigenes Essen berappen.« Das Unbehagen stand ihm ins Gesicht geschrieben. Nahm sie ihm nicht übel. Ohne die Hintergründe zu kennen, musste es nach billigem Betrug klingen. »Ich bin kein Nassauer, wenn Sie das meinen.« »Nassauer?« Markus kannte den Begriff, nur fiel ihm dessen Bedeutung nicht ein. »Ein Schmarotzer. Bin ich eigentlich die Letzte, die noch deutsch spricht?« »Jedenfalls ist Ihr Wortschatz ungewöhnlich beständig. Sie holen immer wieder Begriffe hervor, die der Zeitgeist längst abgeräumt hat. Aber ich erinnere mich jetzt: Es gibt auch ein Verb, nassauern. Hängt es mit der Hauptstadt der Bahamas zusammen?« »Warum in die Ferne schweifen? Angeblich geht es auf eine kostenlose Verpflegung zurück, die das Herzogtum Nassau seinen Landeskindern spendiert hat. Nassauer waren genau genommen Nicht-Nassauer, die unberechtigterweise an der Tafel Platz genommen haben.« »Woher wissen Sie das?« »Irgendwann mal aufgeschnappt, vermute ich. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja: An dem Punkt, an dem ich mich befinde, habe ich es … als eine Art Henkersmahlzeit betrachtet.« »Henkersmahlzeit, aha.« »Eine Art Henkersmahlzeit, habe ich gesagt. Beißen Sie sich nicht an dem Begriff fest. Ich wollte Ihnen nur klar machen, dass es besondere Umstände sind, die …« »Schon gut. Darf ich Ihre Rechnung übernehmen?« Er ließ es so stehen? Wow. Und jetzt wollte er sogar ihre Zeche zahlen. Wenn er hier noch mal aufzukreuzen gedachte, hatte er wohl keine andere Wahl. »Ich kann es Ihnen allerdings nicht zurückzahlen.« »Vielleicht findet sich ja noch eine Gelegenheit.« »Nein, Herr Engel, es wird sich keine Gelegenheit mehr finden. Wir werden uns nicht mehr wiedersehen.« Während er sah, wie sich ein dunkler Schleier über ihr Gesicht legte, fiel ihm der ominöse Satz ein: Das war’s mit dieser Anna Heydt, die werden Sie nicht mehr wiedersehen. Er sparte ihn sich für später auf. Abwarten und Wein trinken. Er winkte nach dem Kellner, der ihm Kredit gewährte und kurz darauf den Rioja brachte. Sie stießen miteinander an. »Sind Sie eigentlich liiert, Comissario?« »Wieso?« »Sie kommen mir so … alleinstehend vor.« »So? – Ich bin …«, Witwer, wollte er sagen, doch das Wort kam ihm nicht über die Lippen. »Ich war verheiratet, sie ist tot. Wieso fragen Sie?« »Weil ich Ihre Einsamkeit spüre.« Anna wusste selbst nicht, was sie überkam, dem Bullen sein Seelenleben zu enthüllen. »Ich bin nicht einsam. Allein, das ja, aber Alleinsein heißt nicht notwendigerweise, sich einsam zu fühlen. Meistens fühle ich mich mit mir in guter Gesellschaft.« Er war sich seiner Einsamkeit also nicht bewusst. Ja, das passte zu ihm, nur keine Schwächen zeigen, schon gar nicht vor sich selbst. »Kinder haben Sie keine, richtig?« Er nickte. »Und Familie? Leben Ihre Eltern noch?« »Die Mutter, und dann habe ich einen Bruder, Tom, der wohnt nicht weit weg und wir sehen uns häufig, auch wenn wir ziemlich unterschiedlich sind. Er arbeitet am Flughafen, ist Flugzeugmechaniker.« Über seine Eltern wollte er nicht sprechen, erkannte Anna. Wie es ihre Art war, interessierte sie das Verbotene am meisten. »Und wo wohnt Ihre Mutter?« »Auch nicht weit entfernt.« Jetzt bloß keine Familienaufstellung! Um ihre Neugier umzulenken, schob er schnell hinterher, die Familie sei nach der Rückkehr aus Spanien ins Rhein-Main-Gebiet gezogen. Anna war schon aufgefallen, wie fließend er sich mit dem Kellner unterhielt. Sie löcherte ihn mit Fragen. Warum die Familie wieder nach Deutschland zurückgekehrt sei, wollte sie schließlich wissen. Und damit hatten sie wieder den wunden Punkt erreicht. Markus sah ihr in die Augen und schüttelte den Kopf. Lassen Sie es gut sein, sollte es bedeuten. »Du solltest mir davon erzählen, Herr Engel.« Sie wollte es wirklich wissen und es war keine grobe Neugierde. Irgendwie ging ihr der komische Kerl nahe. TIERVORFÜHRUNG | E-SALOU Sich unter Schmerzen windend, bemerkte S nicht, wie jemand den Raum betrat. Ihn quälten Muskelkrämpfe, gegen die sogar seine Atemnot verblasste. Als würde ein Messer in seine Hüfte gerammt. Reingerammt, rausgerissen und wieder reingerammt. Carlos stellte das Heizgerät ab. Wortlos musterte er den Gefangenen. Nachdem sich dessen Krampf gelegt hatte, nahm er ihm die Binde ab, zog die Lider hoch, leuchtete mit einer Taschenlampe die Augen aus und fühlte den Puls. Noch war der Mann nicht reif für ein brauchbares Geständnis. Carlos verließ den Raum und kehrte kurz darauf mit einem Plexiglasbehälter von der Größe eines Schuhkartons zurück. Er befestigte ihn an den Streben des Wandregals und nahm den Deckel ab. Anschließend fischte er aus der Tasche seines grauen Kittels ein längliches Stück Karton; an dessen Längsenden hatte er bereits zwei Gummibänder befestigt. Mit einer Schere bohrte er ein Loch in die Mitte des Kartons, fädelte eine Schnur hindurch und verknotete sie. S beobachtete ihn blinzelnd. Er wollte die Augen schließen, um sich nicht zermürben zu lassen, doch er vermochte es nicht. Lobreta klebte die Gummis an gegenüberliegenden Innenseiten des Behälters fest, sodass der Karton in dessen Mitte schwebte. Die Schnur zog er durch eine kreisrunde Öffnung im Boden des Behälters. Ohne zu wissen, worauf es hinauslief, fröstelte es S. Vielleicht wäre es ein Zeichen von Klugheit zu kapitulieren? Nein, nein, den Salvator zu verraten, wäre die schlimmste Folter von allen. Alles, nur das nicht. Was auch immer kommen mochte, er musste es aushalten, irgendwie. Vater, hilf mir! Er meinte den Salvator. Natürlich war der Salvator nicht sein leiblicher Vater, auch nannte er ihn nur für sich so, doch das spielte keine Rolle. Mehr Vater konnte niemand auf der Welt für seinen Sohn sein! Lobreta verschwand und kehrte mit einem dicken Gartenschlauch von gut einem Meter Länge zurück, den er durch die Bodenöffnung in den Behälter schob, bis er von unten gegen den Karton stieß. Er besah sich das Werk. Nickte zufrieden. Begann ein Lied zu pfeifen, während er in den Flur entschwand. Ein Handwerker, der in seiner Arbeit aufging. S starrte auf die Konstruktion. Bleib ruhig, er legt es darauf an, dich zu verunsichern, ermahnte er sich. Er versuchte, an etwas anderes zu denken. Genauso gut hätte er versuchen können, sich wegzubeamen. Der Alte hatte auch an seinem Hirn Gummibänder angebracht und konnte seine Aufmerksamkeit damit in jede beliebige Richtung ziehen. Was war das bloß für eine Konstruktion? Ein Aquarium? Unwahrscheinlich. Schlauch und Schnur schienen zwar die Bodenöffnung auszufüllen, aber ein wasserdichter Verschluss sah anders aus. Dann war es vielleicht – ein Terrarium? Nein, daran wollte er nicht denken! Wo blieb der Alte denn? Wenn das wirklich ein Terrarium werden sollte, wozu diente dann der Schlauch? Als Schleuse? Und wohin sollten die Tiere entweichen? Lobreta kam mit einem bauchigen roten Luftballon zurück, aus dessen Mundstück ein Infusionsschlauch herabhing. Er klebte den Ballon neben dem Plexiglasbehälter am Regal fest. Aus seinen Kitteltaschen holte er drei durchsichtige Plastikbeutel. Im ersten Beutel tummelten sich Frucht- oder Taufliegen, im zweiten krabbelten schwarze Käfer mit langen Fühlern, im dritten harrten Spinnen ihrer Freilassung. S fürchtete sich weder vor Fliegen noch vor Käfern. Spinnen allerdings versetzten ihn in Panik. Vor allem pelzige Spinnen. Und diese trugen einen fetten Winterpelz. Lobreta entleerte die Beutel in den Behälter. Nachdem er ihn mit dem Deckel verschlossen hatte, kniete er sich vor S auf den Boden und schnitt mit einer Schere die Klebebänder auf. Eine langwierige Prozedur, die nicht zuletzt der Übermittlung einer Botschaft diente: Ich habe Zeit. »¿Tiene sed? ¿Quiere aqua?«, fragte Carlos den Gefangenen schließlich. »¿Aqua? ¡Si!« Seine Kehle brannte unerträglich. Lobreta reichte ihm eine 1,5-Liter-Flasche Mineralwasser und gab ihm Zeit, sie nach und nach zu leeren. Kaum hatte S sie intus, erkannte er seine Dummheit: Schon jetzt war seine Blase zum Zerreißen gespannt. Er signalisierte dem Alten, dass er pinkeln musste. »¡Desnude!« Sich ausziehen? Niemals! Er gab vor, nicht zu verstehen. Lobreta ließ sich nicht beirren und fünf Minuten später stand S nackt im Raum und pinkelte in eine Ecke. Anschließend befahl der Alte ihm mit einem Wink seiner Pistole, sich hinzusetzen. »No comprende.« »Sie verstehen mich ausgezeichnet«, beschied ihn der Alte, »und Sie werden sich bald ausführlich mit mir unterhalten. Ob früher oder später hängt davon ab, wie lange Sie es aushalten. Der Mechanismus funktioniert übrigens folgendermaßen: Sie legen Ihren Kopf gleich unter das Terrarium. Ich werde ihn fixieren, sodass Sie ihn nicht bewegen können. In dem Ballon befindet sich Zitronensaft. Er wird Ihnen durch den Infusionsschlauch ins Auge tropfen. Unangenehme Sache, es wird höllisch brennen. Kein Problem, denn Sie können sich das Auge reiben. Ihrem linken Arm lasse ich nämlich ein bisschen Bewegungsfreiheit. Allerdings tut sich dann ein anderes Problem auf. Sie sehen das Tau, das aus dem Behälter heraushängt? Ich binde es gleich an Ihrem linken Handgelenk fest. Wenn Sie den Arm bewegen, ziehen Sie das Tau automatisch nach vorn – und damit auch den Karton, der den Schlauch abdeckt. In den Schlauch habe ich übrigens Lockstoffe geschmiert. Unsere kleinen Tierchen werden sich um den Karton scharen und gierig darauf warten, dass sie endlich hinein dürfen. Ach ja, nicht zu vergessen: Der Schlauch führt in Ihren Mund. Anfangs gelingt es Ihnen mühelos, den Bewegungsreflex zu unterdrücken, denn Sie haben einen starken Willen. Sie sehen, ich unterschätze Sie nicht, mein Freund. Trotzdem ist es nur eine Frage der Zeit. Bald kommen Ihnen Sekunden wie Jahre vor. Ihre Psyche befiehlt Ihnen gleichzeitig, sich nicht zu bewegen und es doch zu tun. Der Juckreiz und die Angst vor der Invasion der Tiere driften auseinander wie Kontinentalplatten, zwischen die Sie eingespannt sind. Es zerreißt Sie. Schließlich verlieren Sie die Selbstbeherrschung. Noch jeder hat sie verloren. Und dann setzten sich die Tiere in Bewegung. Erst treffen die Fliegen in Ihrer Mundhöhle ein, dann die Käfer und schließlich die Spinnen. Natürlich bleiben sie nicht dort, so Tiere sind neugierig. Sie krabbeln Ihre Kehle runter. Ein Teil in die Luftröhre, ein anderer in die Speiseröhre. Und von dort aus … Keine Ahnung, Sie werden es schon spüren. Und wenn Ihnen diese Lektion wider Erwarten nicht reicht, folgt sofort die nächste. Dass ich mich damit von Berufs wegen auskenne, dürfte Ihre Organisation längst herausgefunden haben. Sie befinden sich also in den Händen eines Fachmanns. Sie können die Unannehmlichkeiten übrigens jederzeit beenden, indem Sie die Finger der rechten Hand mehrfach hintereinander spreizen. Sehen Sie die Videokamera dort? Ich behalte Sie im Auge, machen Sie sich keine Sorgen.« Lobreta bedeutete ihm, sich vor das Regal zu setzen. »Brav. Und nun ziehen wir die Beine vor dem Bauch an, das kennen wir ja schon.« S vergaß, dass er kein Spanisch verstand, und tat wie geheißen. Lobreta umwickelte die angezogenen Beine und den Rumpf einschließlich des Kopfes und des rechten Arms mit einer ganzen Rolle Klebeband, bis S sich wie in einem Eisenpanzer fühlte. Danach kippte er ihn wie einen Käfer auf den Rücken, befestigte die Kopfhörer, steckte ihm den Schlauch in den Mund, pendelte den Infusionsschlauch aus und band das Tau am Handgelenk fest. Schlussendlich stellte er den Heizlüfter wieder an. Dann ging das Licht aus. GUTE FRAGE | E-CAMBRILS Unter Mühen beförderte er Anna Heydt wieder aus seiner Privatsphäre. Seine Familiengeschichte brachte jetzt niemanden weiter. Wenn er ihr helfen wollte, musste er sie zum Sprechen bringen. Und sie brauchte bestimmt Hilfe, da konnte sie die Spanienurlauberin geben, solange sie wollte. Gewissermaßen als Vorleistung in Sachen Offenheit erzählte Markus im Plauderton von seiner Dienstreise und Jesús Mirandor. »Er steckt in einem ähnlichen Schlamassel wie Sie«, schloss er seinen Bericht. »Sie beide sind meine Sorgenkinder.« »Ich bin niemandes Kind und schon gar nicht Ihres, Sie Dampfplauderer. Meine Eltern sind tot.« »Mirandors Eltern auch.« »Wollen Sie eine Witwen-und-Waisen-Stiftung gründen oder warum erzählen Sie mir den Quark?« »Warum?« Er beugte sich zu ihr vor. »Weil ich irgendwie Ihr Vertrauen gewinnen will. Ich quatsche rum, damit Sie nicht aufstehen und gehen. Sie brauchen nämlich Hilfe, sollten Sie das noch nicht bemerkt haben.« »Glotzen Sie mich nicht so an. Ich mag diesen Bullenblick nicht.« »Sie täuschen sich, und ich werde es wiederholen, bis Sie’s endlich glauben: Ich sitze hier nicht als Bulle.« »Als was denn dann?«, fauchte sie ihn an. Da waren sie wieder bei der Frage, zu der ihm nichts einfiel. Die Grenzen professioneller Distanz hatte er längst hinter sich gelassen. Und es handelte sich auch nicht um gutmenschliche Anteilnahme. Er wusste keine Antwort und entschied, dass es nicht auf alles eine Antwort geben musste. »Mögen Sie mich etwa?« Anna wusste weder, wo die Frage herkam, noch, wie sie den Weg über ihre Lippen gefunden hatte. Deshalb schaute sie genauso verwirrt wie Markus. »Was meinen Sie mit mögen?« »Schon gut, vergessen Sie es. Bloß eine meiner kleinen Provokationen.« Der rötlichen Gesichtsfärbung nach war sie ebenso peinlich berührt wie er selbst. Warum hatte sie gefragt? Es interessierte sie doch gar nicht. Und die Antwort auf ihre Frage? Ja, vielleicht mochte er sie ein wenig. Jemand spielte ihr übel mit, wer hätte da kein Mitgefühl empfunden? »Werden Sie wieder nach Deutschland zurückkehren?«, lenkte er ab. »Geht Sie einen feuchten Kehricht an.« »Schade.« Sie schwiegen. »Hör mir mal zu, Comissario. Ich brauch kein Mitleid, okay? Wenn du den weißen Ritter geben willst, bin ich die falsche Adresse. Ich will nicht gerettet werden, ich will bloß meine Ruhe. Und ich bin auf dem besten Weg, sie zu finden. Wenn du endlich nicht mehr glaubst, ich würde mich an Kindern vergreifen – toll. Da bedankt sich Frau Heydt herzlich. Das war’s dann auch. Wieso ziehst du nicht deines Weges und lässt mir meinen Frieden?« »Ja, ich mag dich.« Seine Stimme klang dünn wie Kantinenkaffee. »Ich habe es bis jetzt nicht gewusst. Ich wollte es gar nicht wissen, schließlich bin ich der Ermittler. Doch es stimmt, ich mag dich. Und ich möchte nicht meines Weges ziehen.« Wäre er beim Sie geblieben, Anna hätte es auf die leichte Schulter genommen. Aber er hatte sie geduzt. Ohne erklären zu können warum, änderte das alles. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. »Anna, ich …« Jetzt sprach er sie auch noch beim Vornamen an. Was kam denn als Nächstes, ein Heiratsantrag? »Ich bin selbst völlig perplex. Machen wir einen Spaziergang, ja? Das hilft, sich wieder zu fangen.« Die Erinnerung, wem er diese Weisheit verdankte, versetzte ihm einen Stich. Vielleicht fragte sich Anastasia schon, wo er blieb. »Nein, Herr Engel. Ich möchte, dass Sie jetzt gehen.« Er brauchte einen Moment, um die Abfuhr zu verdauen. Aus einem unerfindlichen Grund hatte er nicht damit gerechnet. »Dann entschuldigen Sie meine Aufdringlichkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute.« Markus erhob sich, ging ins Lokal und trat, ohne einen Blick zurück, den Heimweg an. Heimweg. Es kam ihm nicht vor, als ginge er heim. »Comissario?« Überrascht sah er sich um. »Vielleicht ist ein Spaziergang doch keine schlechte Idee. Willst du noch?« Er nickte nur, wörtliche Beifallsbekundungen erlaubte der Kloß im Hals nicht. Eine Weile spazierten sie, den Blick auf die Schuhspitzen geheftet, schweigend nebeneinander her. Als Markus sich bewusst wurde, wohin der Weg die Promenade entlang sie führte, nämlich zum Häuschen, in dem Anastasia ihn erwartete, blieb er stehen. Er hatte sich immer schon schwergetan, Hoffnungen zu enttäuschen, und in genau so eine Situation manövrierte er sich gerade. Ihm grauste bereits vor dem Gespräch mit Anastasia, das er noch heute führen musste, egal wie das hier ausging. Erst sie, jetzt Anna. Was für ein heilloses Durcheinander. »Was ist los … Comissario?« »Keine Ahnung. Ich verstehe mich gerade selbst nicht.« Er sah sie an und sah zu seiner Überraschung in ein ängstliches Gesicht. Noch bevor er den Gedanken zu Ende gedacht hatte, härteten sich Annas Gesichtszüge. »Drehen wir um, mir wird kalt«, sagte sie nüchtern. WEICHENSTELLUNGEN | E-GRANADA Es kostete Gorpón Überwindung, sich direkt an Generalleutnant Suarez zu wenden, den Oberkommandierenden der Kameradschaft. Doch er bereute es nicht, denn Suarez entschied sich nach Schilderung der Verdachtsmomente für Anstand und Moral: Pintaluba wurde ab sofort von zuverlässigen Kameradschaftsbrüdern observiert. Sollte sich der Verdacht erhärten, würde er unter einem Vorwand aus dem Verkehr gezogen und verhört. Des Weiteren erhielt Gorpón Handlungsvollmacht im Fall Mirandor. Wenn er es für sinnvoll erachte, solle er den Mann vorläufig in eine Art Schutzhaft nehmen. Gorpón handelte unverzüglich. Da er selbst seit seiner Strafversetzung unter zu strenger Beobachtung für eine diskrete Verhaftung stand, wandte er sich an einen Kollegen aus Madrider Zeiten, der wegen der Verdachtsmomente im Fall Brúto einen rechtsstaatlich einwandfreien Anlass für eine Festnahme hatte. Kuhlmann erklärte sich sofort einverstanden. Er würde nach Salou fahren, um die Sache zu regeln. Gorpón sah sich in seiner Menschenkenntnis bestätigt: Kuhlmann war zwar leider bestechlich, im Großen und Ganzen aber ein anständiger Kerl. Dass Kuhlmann sich auch im Fall Brúto bestechen ließ, konnte Gorpón natürlich nicht wissen. KIND IM KARTENHAUS | E-CAMBRILS Wie ein altes Ehepaar, ging es Anna durch den Kopf. Sie saßen hier wie ein altes Ehepaar auf einer Bank und schauten, die Hände ineinandergelegt, in schweigendem Einverständnis aufs Meer hinaus. Und zugleich wie zwei Jugendliche mit klopfendem Herzen, denen es die Sprache verschlagen hatte angesichts der zärtlichen Berührungen, die über sie gekommen waren. Die es in eine Parallelwelt katapultiert hatte, deren Sprache sie noch nicht beherrschten. »Du musst nicht die ganze Zeit den Ranzen einziehen«, sagte Anna plötzlich und legte ihre Hand auf die kleine Wölbung. »Ich mag Bauchansätze, manchmal sogar ganze Bäuche, ist eine Frage der Proportionen. Bei kleinen Männern reicht ein Ansatz.« Grinsend lehnte sie sich an seine Schulter. Sie nahm den Duft von Tabak wahr, der nicht aus der Parfümerie stammte. Gefiel ihr. »Erzählst du mir jetzt, warum ihr aus Spanien nach Deutschland zurückgekehrt seid?« »Es war wegen meines Vaters.« Markus dehnte die Worte, als müsse er jedes einzeln bedenken. Von einem leisen Seufzer eingeleitet, begann er seine Geschichte zu erzählen. Er hatte sie nur ein Mal erzählt, seiner Frau, die sie mit peinlich berührtem Schweigen zur Kenntnis genommen hatte. Papi fährt Schlangenlinien über die leere Landstraße, so leer, als hätte die Polizei sie extra gesperrt, damit Markus Spaß hat. Er hat das Fenster runtergekurbelt und lässt sich Sonne und Wind ins Gesicht treiben, er lacht und schreit »jubbidubbidu!!!« und spornt Papi an: »Mehr, mehr!« Er kann gar nicht genug von dem Geschaukel kriegen. Papi tut ihm den Gefallen und lacht mit, hat gute Laune! Markus hat heute eigentlich Schule, es ist Montag, genau in diesem Moment steht Rechnen auf dem Stundenplan und stattdessen macht er mit Papi einen Ausflug in die Berge. Morgen steht wieder Rechnen an und auch morgen wird er fehlen. Das Leben ist schön! Nach einigen Stunden Fahrt sehen sie das kleine Dorf über sich in den Bergen. Es liegt an einem echt steilen Steilhang. Wenn die Sonne noch da wäre, sähe es bestimmt toll aus. Doch die Sonne ist weg. Es regnet Bindfäden und wegen der Fäden sieht es aus, als läge das Dorf hinter Gitterstäben. Ein Hotel gibt es nicht, sie wohnen beim Wirt, erklärt ihm Papa, während er das Auto durch enge Gassen pfriemelt. Das Dorf ist echt ätzend, echt düster, und das Zimmer ist wie das Dorf. Markus schaut genervt aus dem Fenster. Irgendwann muss der Himmel doch mal aufhören zu pinkeln. Aber es wird mehr statt weniger. Die Berge sind abgesoffen, also fällt die versprochene Wanderung ins Wasser. Stattdessen hängen sie in diesem miesen Zimmerchen fest. Jetzt spürt Markus wieder Papis Unruhe. Wahrscheinlich war sie die ganze Zeit da und hat sich bloß als gute Laune getarnt. Papi schlägt vor, Karten zu spielen, doch Markus kann keine Spielkarten mehr sehen. Er verschanzt sich hinter einem Comic, um nicht von der Unruhe angesteckt zu werden, die wie eine Raubkatze von Ecke zu Ecke streift. Obwohl Papi reglos auf dem Bett liegt und an die Decke stiert. Schließlich erhebt er sich. Markus soll ruhig weiterlesen, er wird nach unten gehen und mit dem Wirt plaudern. Markus springt vom Bett und schnappt sich die Karten, jetzt hat er doch lieber Lust! Sie spielen Mau- Mau, aber seine Gedanken segeln übers offene Meer auf Untiefen zu. Natürlich ist das nicht einfach ein Ausflug. Das ist genauso wenig einfach ein Ausflug, wie die Besuche bei Onkel Bernd an den Sonntagvormittagen ein Frühschoppen sind. In Onkel Bernds Kneipe in Salou, die »Deutsches Eck« heißt, gibt es zwar echt viel Alkohol, aber Papi trinkt ja überhaupt keinen. Papi nimmt ihn oft mit und Mutti hat nichts dagegen. Wenn sie Papi ermahnt, pünktlich zum Essen zurück zu sein, schaut sie immer auch Markus an. Er ist total gern mit Papi zusammen, aber der »Frühschoppen« strengt ihn echt an, obwohl er da immer eine Cola bestellen darf, Mutti sieht’s ja nicht. Wenn sie hinfahren, hat Papi prima Laune, ist richtig aufgekratzt und Markus bemüht sich mitzumachen. Auf dem Rückweg schweigen sie düster. Echt schlimm. Und Markus kann nichts dagegen tun, er ist da echt ohnmächtig. Während sie in Onkel Bernds Hinterzimmer an einem runden Tisch sitzen – das heißt, er selbst sitzt nicht direkt am Tisch, sondern schräg hinter Papi –, starrt Markus ständig auf die Uhr, die er zum Geburtstag bekommen hat. Er verfolgt, wie der Zeiger sich auf halb zwei zubewegt. Dann müssen sie nämlich zurückfahren, um pünktlich zum Essen heimzukehren, es gibt einen Sonntagsbraten, nur eben auf Spanisch. Papi brütet über seinen Karten und Markus über einem Plan, wie er Papi zum Aufhören bewegen kann, wenn es Zeit ist oder wenn der Haufen Geldscheine vor ihm zu den Mitspielern rübergewandert ist, was häufig noch vor der Zeit passiert. Es ist ihm nie gelungen. Ein oder zwei Worte reichen, um seinen Plan zu durchkreuzen. Das eine Wort heißt »Kredit«, die anderen beiden: »Eins noch.« Wie er diese Worte hasst! Im Laufe der Zeit hat Markus begriffen, dass Mutti auf ihn setzt – und er versagt ein ums andere Mal. Anfangs dachte er immer, es ginge ums kalt gewordene Mittagsessen, wenn Mutti sie mit eisiger Mine empfängt. Inzwischen weiß er es besser. Weil er eines Abends gelauscht hat und danach immer wieder. Papi hat zu viel Kredit aufgenommen. Was Kredit genau bedeutet, weiß Markus nicht, die Folge von Zu-viel-Kredit-aufnehmen hingegen kennt er inzwischen. Mutti hat sie Papi ins Gesicht geschrien: »Dann nehmen sie uns das Lokal und dann sind wir am Ende.« Markus hat es seinem Bruder Tom erzählt, der jedoch von Erwachsenenkram nichts hören will. Markus will es eigentlich auch nicht, aber einer muss ja auf Papi aufpassen. Vielleicht durfte er deswegen mitfahren. Macht mir bitte keinen Unsinn, hat Mutti bei der Abfahrt gesagt. »Spielst du hier L’Hombre?«, fragt Markus und legt schon wieder die falsche Karte ab. Er hört, wie seine Stimme zittert und schämt sich dafür. »Mal sehen.« »Mit wem denn?« »Kann sein, dass sich hier ein paar Leute treffen. Hey, was spielst du denn für einen Mist zusammen!« Er schnippt ihm lachend die Karte zurück. »Eigentlich willst du lieber dein Supermanheft lesen, stimmt’s?« Er knufft ihn zärtlich. »Weißt du was? Wir können uns ja mal unten umsehen. Nimm dein Heft mit! Es gibt auch eine Cola.« Es sind tatsächlich »ein paar« Leute da. Der Dorfplatz ist zum Parkplatz geworden, ein Auto neben dem anderen. Sie gehen zu einer Scheune und da sitzen sie. Sitzen an Tischen und spielen L’Hombre. Wenn Onkel Bernds Hinterzimmer das Fegefeuer ist, dann ist das hier die Hölle. Viel zu viele Leute, die Papi Kredit geben könnten. Markus hat Schiss, richtig Schiss. Als er am nächsten Morgen erwacht, erinnert er sich sofort. Am Abend, sie hatten schon stundenlang an Tischen gesessen, mal hier, mal da, sind ihm die Augen zugefallen und Papi hat ihn ins Bett geschickt. Papi war gut drauf. Er hatte richtig viele Plastikchips vor sich. Zunächst war Markus erleichtert gewesen, dass hier gar nicht um Geld gespielt wurde – bis er bemerkte, wie die Spieler die Chips kauften mussten. Jedenfalls hatte Papi viel mehr Chips vor sich als am Anfang. Vielleicht geht diesmal alles gut, hat Markus gedacht und sich ins Bett verkrochen. Und nun wacht er auf. Die Augen noch geschlossenen, lauscht er in die Stille des Zimmers. Etwas ist falsch daran. Papis Schnarchen fehlt. Markus öffnete die Augen. Er ist allein. Die Tagesdecke auf Papis Bett ist nicht abgezogen. Spielt er etwa immer noch? Markus schaut auf seine Uhr, kurz nach sieben. Er wirft sich in null Komma nix in die Klamotten, spritzt sich am Waschbecken Wasser ins Gesicht und jagt los. Die Scheune liegt leer und verlassen da. Wo bist du, Papi? Er versucht, seiner Angst Herr zu werden, doch die Angst ist groß und er ist in diesem Moment echt klein. Grimmig beißt er die Zähne zusammen. Reiß dich am Riemen! Bis zum Mittag ist Papi immer noch nicht aufgetaucht. Ein Polizist ist gekommen und hat einen Suchtrupp organisiert, sogar die Kartenspieler suchen mit. Aber sie finden ihn nicht. »Hat mein Vater viel verloren?«, fragt Markus schließlich den Wirt, einen dünnen krummen Mann. Nein, sag’s mir lieber nicht, denkt er sofort, doch der Wirt nickt mit düsterem Gesicht. »Kennst du eure Telefonnummer?« Natürlich kennt er die, er ist ja kein kleines Kind mehr. »Dann ruf deine Mutter an. Erzähl ihr, was hier los ist.« Markus weiß nicht, wie er ihr das sagen soll. Wie er ihr gestehen soll, dass er dieses Mal total versagt hat. Schlimme Gedanken sind im Laufe des Tages wie Unkraut in seinem Kopf gewachsen. Und in der Mitte steht eine Brennnessel, um die Markus in immer kleineren Kreisen herumschleicht. Wenn er sie berührt, wird es sehr weh tun. Er will weg von diesem Gedanken, weg, nur weg. Noch bevor Mutti am Abend eintrifft, sieht jemand Papi. Durch ein Fernglas. Er liegt in einer Schlucht unterhalb des Steilhangs. Niemand spricht das Wort aus, aber Markus ahnt es. Es ist das Wort, auf dem die Brennnessel gewachsen ist. Während drei Männer sich auf den Weg machen, um vom Tal her zu Papi vorzudringen, weiß Markus längst, dass er keinen Papi mehr hat. Er versteht noch nicht, was es bedeutet, außer, dass er versagt hat. Er hasst sich dafür und der Hass ist so groß, dass die Angst dagegen klein ist. Ausgenommen die Angst davor, was Mutti sagen wird. »Die Angst war natürlich unbegründet. Meine Mutter hat die Situation mit bewundernswerter Selbstbeherrschung gemeistert. Was uns von unserem Lokal noch gehört hatte, war von meinem Vater verpfändet worden, bevor er in den Tod gesprungen ist. Die Lebensversicherung wurde nicht ausbezahlt, weil alles für Selbstmord sprach. Wir hatten wortwörtlich keine Pesete mehr und die Kosten für den Umzug nach Deutschland und die Rückführung des Leichnams müssen immens gewesen sein. Sie hat es trotzdem geschafft. Nur – ach egal.« »Sag es!« »Unser Verhältnis war danach nicht mehr wie vorher. Bis heute nicht. Vielleicht konnte sie mir doch nicht verzeihen, dass ich einfach ins Bett gegangen bin.« »Das ist viel schlimmer als ein böses Wort.« »Du übertreibst. Vielleicht habe ich mich auch unglücklich ausgedrückt. Meine Mutter hat mich natürlich anständig behandelt. Ich glaube, sie schätzt mich sogar, weil ich mich damals zusammengerissen habe. Viel habe ich ihr natürlich nicht helfen können in dem Schlamassel, ein Kind ist da ziemlich ohnmächtig. Aber was ich vermochte, habe ich getan.« »Einen Dreikäsehoch zum Aufpassen mitzuschicken, Herr im Himmel, das ist doch krank!« »Bitte nicht, Anna!« »Schon gut. Es tut mir wirklich leid für dich.« Sie legte ihre Hand auf seinen Arm, eine leise Geste, mit der sie genau sein Bedürfnis traf. »Als ich dir beim ersten Verhör vom Tod meiner Eltern erzählt habe, hast du da an damals gedacht?« »Was hat das denn miteinander zu tun?« »Wie dumm der kluge Herr Engel ist, wenn es um ihn selbst geht. Natürlich hat es miteinander zu tun. Du standst auf einen Schlag alleine da, zwar keine Vollwaise wie ich, aber auch mit Schuldgefühlen zurückgeblieben. Vielleicht kommst du mir deswegen so einsam vor.« »Ich bin nicht einsam!« »Quatschkopf. – Genug geredet, küss mich endlich, Herr Engel.« Sie musste sich vergewissern, dass sie keinem Trugbild aufsaß. Für einen Bullen küsste er ziemlich gut. Von der dramatischen Wendung aufgewühlt, gingen sie schweigend zum Restaurant zurück. Plötzlich erinnerte sich Anna, was sie vor ein paar Stunden über ihren Busen gedacht hatte: schrumpelig. Na toll. Der anschließende Gedanke irritierte sie nicht weniger: Was bedeutete es für ihre Zukunftspläne, für die Abmachung mit Alexander, wenn sie sich sorgte, wie Markus ihren Busen fände? Sie fühlte sich überfordert. Wie hätte sie denn ahnen sollen, dass sie sich in den lästigen Bullen verliebt hatte? Eigentlich eine seltsame Frage. Eigentlich hätte sie es wissen müssen. Aber dem war nicht so. Die Anna Heydt von vor einer Stunde und die Anna Heydt dieses Augenblicks schienen sich völlig fremd zu sein. Zwei Identitäten in einer Person, nur Minuten und doch Lichtjahre voneinander entfernt. »Du fröstelst ja. Ich gebe dir mein Sacco. »Oh, ein Kavalier. Jeans und Polohemd stehen dir übrigens viel besser als die blöden Anzüge.« Er ging nicht darauf ein. Während er ihr das schwarze Leinensakko umlegte, sprach er aus, was ihn bewegte: »Du hast anfangs gesagt, ich werde dich nie wieder sehen. Ich hoffe, das war nicht dein letztes Wort.« Er dachte also auch über die Zukunft nach. »Willst du denn?« »Zur Not würde ich dich sogar festnehmen.« Es sollte ein Scherz sein, um die Anspannung zu lösen, doch Strafverfolgungsvokabular kam bei ihr weiterhin nicht gut an. »Hey, Anna! Wie wäre es mit ein bisschen Vertrauen?« »Schon gut, Comissario.« »Ich heiße Markus, okay?« »Okay – Markus. Übers Wiedersehen muss ich noch nachdenken.« Sie fragte sich, ob sie ihm von Alexanders absurdem Angebot erzählen sollte. Und von ihrem Zweifel, aus der Sache noch rauszukommen. Einerseits glaubte sie Alexander aus einem unerfindlichen Grund, dass er ohne ihre Zustimmung nicht zur Tat schreiten würde. Andererseits ließ er sich mit Sicherheit nicht einfach die Butter vom Brot nehmen. In was für einer beschissenen Situation sie schon wieder steckte! Gerade noch hatte sie der Sternenhimmel an einen Baldachin mit Lampions erinnert, schon sah sie wieder ins unendliche Nichts, in dem die paar Lichtpunkte verloren vor sich hin funzelten wie Geisterschiffe auf nachtschwarzem Ozean. Während Anastasia aus dem Fenster zum Himmel blickte, kamen ihr ähnlich düstere Gedanken. Wo war Markus denn abgeblieben? Sie machte sich Sorgen. Nein, schlimmer: Sie hatte Angst. Etwas stimmte nicht. Anfangs war sie froh gewesen, dass er sich – und ihr – Zeit mit der Rückkehr ließ und hatte sich über sein Einfühlungsvermögen gefreut. Mittlerweile fragte sie sich, ob er überhaupt noch mal heimzukehren gedachte. Auf dem Handy meldete er sich auch nicht. Sie hielt es nicht länger aus, hier untätig auszuharren. Vielleicht saß er ja in dem Lokal, wo sie gestern Abend gegessen hatten. Sie zog sich an. Markus spürte, wie die Stimmung kippte, und zog Anna an sich. »Wenn du mich gar nicht wiedersehen willst, dann sag es.« »Nein, das ist es nicht«, antwortete sie ernst. »Gehen wir weiter, ich brauche einen Schluck Wein auf den Schreck.« Sie ergriff seine Hand. Markus hätte jetzt gern etwas Bedeutsames gesagt, aber sein nüchtern eingerichtetes Oberstübchen scheiterte an der ungewohnten Aufgabe. Kaum hatten sie Platz genommen, war der Kellner mit ihrer Flasche Rioja zur Stelle. Während er einschenkte, quälte sich Anna mit der Frage, ob sie Markus in die Geschichte hineinziehen durfte. »Erzähl mir mal, wie du so plötzlich abgetaucht bist, ohne Spuren zu hinterlassen.« »Mal wieder eine Vernehmung?« »Zur Abwechslung.« »Na gut. Ich hatte Besuch. Unverhofften Besuch. Und der hat mir ein Angebot gemacht …« »Mit ihm nach Spanien zu reisen.« »Bei den anderen Vernehmungen hast du wenigstens erst mal zugehört.« »Da hatte ich mehr Distanz.« »Spanien hat nichts mit dem Angebot zu tun. Mein Besucher hat hier geschäftlich zu tun und mich mitgenommen, sonst nichts. Ich glaub nicht, dass wir lange bleiben.« »Und der Besucher hat dir ein Angebot unterbreitet.« »Ein völlig irrwitziges, purer Mumpitz. Ich hab ihn für meschugge erklärt. Nur: Er ist nicht im Mindesten verrückt. Keine Ahnung, wie das zusammenpasst. Jedenfalls bin ich mitgegangen.« »Wieso?« »Ich hatte gerade von der Ausstrahlung des Videos erfahren.« »Verstehe. Wohin hat er dich mitgenommen?« »Wir sind von mir aus eine halbe Stunde mit dem Auto gefahren.« »Nenn mir einfach die Adresse!« »Ich kenne sie selbst nicht so genau.« »Ist ja sehr vertrauenerweckend. Dann sag mir seinen Namen.« »Dir Sturkopf sag ich ihn bestimmt nicht. Ich will nicht, dass du dich in Gefahr begibst, kapierst du das nicht, Quetschehirn? Es ist auch völlig egal. Der Mann hat mir nichts getan, nur ein Angebot unterbreitet.« »Dann schlag es aus. Man lässt sich nicht auf jemanden ein, den man für gefährlich hält.« »Ich weiß nicht, ob das so einfach ist.« »Warum?« Sie schwieg. Auf direktem Weg kam er nicht weiter. »Hat sein Angebot mit dem Satz zu tun, den du Triebel gesagt hast: Diese Anna Heydt sehen Sie nie wieder?« »Du bist wirklich ein guter Bulle.« »Ja, nicht?« Er gönnte sich ein kurzes Grinsen. »Es hat also damit zu tun. Will er dir eine neue Identität verpassen?« Sie überkam ein Lachen, das in seinen Ohren leicht hysterisch klang. »So ähnlich.« »Und was kriegt er dafür?« »Weißt du was, Markus? Ich sollte erst mal mit ihm zurückreisen und es ihm schonend beibringen.« »Für mich ist er zu gefährlich, aber du willst zu ihm zurückgehen? Vielleicht sollte ich dich doch festnehmen.« Zu ihrem eigenen Erstaunen fand sie die Idee jetzt gar nicht mehr so schlecht. »Klingt nicht übel, für ein paar Tage abzutauchen. Aus irgendeinem Grund spielt das Datum eine Rolle. Es soll unbedingt an meinem Geburtstag passieren.« Diese Andeutungen machten ihn schier verrückt. »Anna, schau mich bitte mal an. Danke. Und jetzt sag mir unmissverständlich: Würdest du überhaupt gern mit mir … Keine Ahnung, du weißt schon.« »Ich weiß zwar genauso wenig wie du – aber: ja. … Wahrscheinlich. Ach, Markus, du wirfst alles über den Haufen. Kommst einfach angedackelt und meinst, jetzt dreht sich alles nur noch um dich.« »Um uns.« »Ich hab noch jede Beziehung klein gekriegt. Wenn es schiefläuft, stehe ich wieder am Nullpunkt. Und dann gibt es kein Angebot mehr, mit dem ich alles hinter mir lassen kann.« »Ist das wirklich so attraktiv?« »Was habe ich denn zu verlieren?« »Mich.« »Ich meine doch, wenn du mich satthast.« »Vielleicht habe ich dich ja nie satt.« »Die andere Sache ist sicher, und alles, was du mir anbieten kannst, ist …« »Hoffnung.« »Ja, ein bisschen Hoffnung.« »Den Moment und die Hoffnung. Daraus besteht das Leben. Mehr gibt’s nicht. Und jetzt haben wir genug verhandelt. Küss mich.« Das ließ sie sich nicht zweimal sagen. Sie beugte sich über die Tischplatte und verpasste ihm einen Kuss, der es in sich hatte. Anastasia stand nur wenige Meter von den beiden entfernt hinter Blumenkübeln und begriff nicht, was sie sah. Das konnte gar nicht sein! Aber er saß da wirklich und knutschte mit der verkommenen Alkoholikerin. Sie vermochte den Blick nicht abzuwenden, starrte wie verhext auf dieses Bild trauter Zweisamkeit. Es ließ für nichts anderes mehr Raum. Auch nicht für die Gestalt, die das Geschehen aus dem Schatten eines Hauseingangs beobachtete. Ohne zu wissen warum, schoss Anastasia mit ihrem Handy Fotos. Wozu Beweise sichern, über die sich der Täter mit einem höhnischen Lachen hinwegsetzen würde? Plötzlich überkam sie ein Brechreiz. Sie wandte sich ab, rannte auf die andere Straßenseite und kotzte ins Meer. Hätten Markus und Anna sich erhoben, wäre ihnen die Frau aufgefallen, die am Rand der Promenade kniete, als wolle sie ins Wasser. Aber die beiden waren ganz mit sich selbst beschäftigt. »Wann hast du eigentlich Geburtstag, Anna?« »Weißt du nicht? Steht doch bestimmt in deinen Akten. Spricht ja nicht gerade für ein starkes Interesse. In sieben Tagen.« »Bis wir uns heute Abend über den Weg gelaufen sind, hatte ich nicht die geringste Ahnung, dass ich … ich meine, was ich für dich empfinde. Du denn?« »Keinen Schimmer.« »Wir sind ja ein schönes Paar.« »Ein Paar? Sind wir das?« »So haarsträubend die Perspektive ist«, er lachte, »ich wünsche es mir. Und du?« Anna überfiel ein Kribbeln, als säße sie in einem Ameisenhausen, als wäre sie ein Ameisenhaufen. Sie nickte verlegen. Markus rührte die Geste, aber mit Sentimentalität kamen sie nicht weiter. Eine Lösung musste her. »Hast du dem Kerl, diesem mysteriösen Besucher, Geld versprochen? Wenn es das ist …« »Nein, nein. Das ist es nicht. Eher eine Art Tauschhandel.« »Und was tauscht ihr?« »Warum genießen wir nicht einfach den Moment?« »Sobald du versprichst, mich nach Deutschland zu begleiten. Ich verstecke dich bis zu deinem Geburtstag und dann sehen wir weiter.« Vor Alexander verstecken? Anna fiel der asiatische Vertrag ein. Die Vermisstenmeldungen aus aller Welt. Die Privatarmee. Wo wäre man denn vor ihm sicher? »Wenn er herausfindet, dass du in Spanien warst, wird er eins und eins zusammenzählen. Er ist intelligent.« »Wie soll der denn auf mich kommen. – Kenne ich ihn etwa?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, nein. Aber er hat seine Leute. Ich glaube, auf der ganzen Welt.« »Hat er dir das erzählt?« »Er erzählt nicht viel. Ich nehme es wegen der Zeitungsausschnitte an.« »Was denn für Ausschnitte?« »Von Vermi…« Anna hatte die Frau nicht kommen sehen. Plötzlich war sie da und legte ihre Hand auf Markus’ Schulter, beugte sich zu ihm hinunter und gab ihm einen Kuss auf den Mund. Dann grinste sie Anna an: »Kriminalkommissarin Anastasia Papandreou. Sie sind hiermit verhaftet, Frau Heydt.« Sie stupste Markus auf die Nase. »Das war wirklich ein genialer Plan, Schatz. Ich hätte nicht gedacht, dass du sie so leicht dazu bringst, dir aus der Hand zu fressen.« Markus brauchte zu lange, um die Verblüffung zu überwinden. Als er endlich aufsprang, hatte Anna sich in Luft aufgelöst. Er rannte aufs Geratewohl los. BRANDGEFÄHRLICH | E-SALOU S kochte im Höllenfeuer, tausend Messer im Leib und das Auge in Säure gebadet. In seinem Kopf keiften tausend Stimmen, vor seinen Augen kreisten tausend pelzige Spinnen und im Hintergrund kreischte die Terror-Jukebox Yesterday. Er konnte nicht mehr. Hätte er gewusst, wie nahe Vater war, er hätte dem brüllenden Wahnsinn vielleicht den entscheidenden Moment länger widerstanden. Sein Verschwinden hatten sie am frühen Abend bemerkt. Am Nachmittag hatte er von Henry den Auftrag erhalten, vor einem Krankenhaus in Tarragona einen Rettungssanitäter abzupassen, der tagsüber zu einem Einsatz in Salou gewesen war. Da das Krankenhaus keine Details preisgab, sollte er den Sanitäter abfangen und herausfinden, ob er Fárdome behandelt hatte und gegebenenfalls wo. Ein Auftrag höchster Priorität, der unverzügliche Berichterstattung verlangte. Aber weder meldete S sich noch ging er ans Handy. Mikki suchte vergebens nach ihm, fand jedoch den Sanitäter, der die Vermutung des Salvators bestätigte: Fárdome war an einem Herzinfarkt gestorben – direkt vor ihrem Küchenfenster! Vermutlich befanden sich Lobreta und Mirandor also in der Nähe, warum auch immer. Und wahrscheinlich hatte sie S in ihrer Gewalt. Schlauerweise hatte der Alte bei der Notfallmeldung statt einer Adresse nur die Straße angegeben. Wo also waren sie danach untergeschlüpft? Iwan ließ seine Leute ausschwärmen, um nach Lobretas Seat zu suchen. Sie spürten ihn in der Tiefgarage des gegenüberliegenden Apartmenthauses auf. Wenn Lobreta sich S gekrallt hatte, dann um ihn auszuquetschen. Sie mussten schnell und brutal dazwischengehen. Der Plan: das Haus durchkämmen und den Feind vernichten, bevor Informationen nach außen dringen konnten. Angesichts der Größe des Apartmenthauses bestand allerdings wenig Aussicht, die Aktion unbemerkt durchzuziehen. Sie brauchten Rückendeckung. Gegen neunzehn Uhr kontaktierten sie Pintaluba. Er schrie Zeter und Mordio, um keinen Preis der Welt wollte er in dieses halsbrecherische Unternehmen hineingezogen werden! Es half ihm nichts. Mitgehangen, mitgefangen. Der Oberst entschied sich notgedrungen für die große Lösung: Er würde mit einer Spezialeinheit anrücken und die Kastanien selbst aus dem Feuer holen. Sein Dienstrang würde die Dorfsheriffs einschüchtern und das SEK der Aktion einen legalen Anstrich verleihen. Sie sollte am nächsten Morgen um halb vier starten. Daniel stand mit einem Kaffeebecher vor dem Küchenfenster und blickte in die Dunkelheit. Im Haus herrschte zum Zerreißen gespannte Ruhe, denn Pintaluba war seit einer Stunde überfällig. Ohne seine Rückhalt würde der Einsatz zum Himmelfahrtskommando geraten. Und damit nicht genug: Zwar hatte der Learjet rechtzeitig Verstärkung aus Bukarest eingeflogen, doch war einer der beiden Busse, die am Flughafen bereitgestanden hatten, in einen Unfall verwickelt worden. Die Ausrüstung, die er geladen hatte, mussten sie abschreiben. Nie hatte Daniel eine auch nur annähernd brenzlige Lage erlebt. Wenigstens war Heydt, wie vom Salvator vorhergesagt, von selbst wieder zurückgekehrt. Iwan steckte den Kopf in die Küchentür. »Lagebesprechung in fünf Minuten.« Daniel begab sich in den Besprechungsraum, wo bereits alle außer Johann und Christian, die draußen patrouillierten, schweigend an einem Tapeziertisch saßen. Henry und Iwan traten ein und nahmen an den Kopfenden Platz, gefolgt vom Salvator, der mit verschränkten Armen in der Tür stehen blieb. Henry ergriff das Wort. »Derzeit können wir keinen Kontakt zu Pintaluba herstellen. Hoffen wir, dass er bald eintrifft. Aber wir können die Operation nicht länger hinausschieben. Also starten wir sie selbst. Iwan erklärt euch den Einsatz.« Iwan reichte zwei Stapel Fotokopien herum. »Auf dem ersten Blatt habt ihr Fotos von Mirandor und Lobreta, auf Blatt zwei einen Lageplan des Zielobjekts: Flure, Wohnungen, Eingangshalle, Tiefgarage.« Nachdem er seine Ausführungen beendet hatte, ergriff der Salvator das Wort. Er fasste sich kurz: »Enttäuscht mich nicht.« Hätte Jesús aus dem Wohnzimmerfenster gesehen, wären ihm vielleicht schwarze Schatten aufgefallen, die über die Straße huschten. Doch er blickte zu Boden, immer noch damit beschäftigt, den Anblick des Gefangenen zu verdauen. Der Mann war kaum wiederzuerkennen, war im wahrsten Sinne des Wortes weich gekocht worden; seine Gesichtszüge verschwammen wie Gegenstände auf Bildern Dalís. Die blutunterlaufenen Augen starrten leblos ins Leere, als sei ihm die Seele aus dem Leib entfernt worden. Jesús hatte die Folterung nicht mit angesehen, zuletzt aber mit anhören müssen: panisches Röcheln. Erstickte Schmerzensschreie. Ein Jammern am Rande der Raserei. Carlos hatte seine Forderung, mit aller Härte vorzugehen, offenbar ernst genommen. Für einen Moment ließ die quälende Unruhe von Jesús ab, lange genug, um sich zu fragen, was aus ihm geworden war. Er hatte seinen Freund förmlich gezwungen, sich die Hände schmutzig zu machen, und es stand Carlos ins Gesicht geschrieben, wie dreckig er sich jetzt fühlte. Ein müder alter Mann, der sich jedoch aufrecht hielt wie eh und je. »Solange ich ihn vernehme, musst du dich beherrschen, egal was wir zu hören bekommen«, flüsterte er Jesús zu. »Sonst macht er dicht.« Dann wandte er sich an den Gefangenen. »Du unterhältst dich mit mir auf Spanisch, ja?« Er rückte seinen Stuhl an ihn heran und beugte sich vor. »Die Sache läuft wie folgt: Sobald ich das Gefühl habe, du lügst, zeige ich dir, wie man einen Menschen ganz gemächlich zu Tode foltert. Mache also reinen Tisch. Einverstanden?« Der Gefangene nickte mit geschlossenen Augen. Seine Lider zuckten. Er hatte vor seinen eigenen Leuten mindestens so viel Angst wie vor ihm, erkannte Carlos und begann mit unverfänglichen Fragen über dies und das. Jesús hörte ungeduldig zu. Nun zog Carlos auch noch eine Packung Zigaretten aus der Hose und zündete zwei an. Der Folterer und der Gefolterte pafften miteinander vor sich hin und Jesús hätte schwören können, dass beide Nichtraucher waren. Was kam wohl als Nächstes? Familienfotos austauschen? Carlos ignorierte Jesús’ raumfüllende Unruhe. Die giftigen Fragen mussten behutsam dosiert werden, um den Gefangenen nicht umzuhauen. Das Gift würde sich in die Unterhaltung einschleichen. Diese Vorgehensweise beruhte auf gründlich erprobter Gesprächspraxis in Kellergewölben und Verhörstuben, sie hatte sich bewährt. Doch sie kostete viel Zeit. Langsam näherte er sich dem eigentlichen Thema. »Ihr scheint eine große, mächtige Organisation zu sein. Ich verstehe nur nicht, was so eine Organisation für Interessen an einem kleinen Licht wie Jesús Mirandor hat. Oder an – Emily Parton.« »Ich …« »Schau mir bitte in die Augen, mein Freund. Ja, so ist’s gut. Und nun sage mir, weshalb ihr die arme Australierin getötet habt.« »Sie …also …« »Um die Wahrheit zu sagen, muss man nicht lange nachdenken.« »Ein Bauernopfer.« »Und wozu diente das Opfer?« »Mirandor in die Bredouille zu bringen. Damit er nicht mehr rumschnüffelt.« »Ja, das verstehe ich. Der Junge kann ziemlich lästig sein, nicht wahr? Wo hast du eigentlich so gut Spanisch gelernt? Ich glaube, ich bin noch nie jemandem begegnet, der unsere Sprache so perfekt spricht.« »Auf einer Sprachenschule.« »Offenbar eine gute Schule. Hier in Spanien?« »In Deutschland.« »Du bist Deutscher?« »Ja.« »Tüchtiges Volk. Vor allem die Bayern. Kommst du da her?« »Nein.« »Klar, die Blonden sind ja auch eher im Norden zu Hause. Stammst du also aus Norddeutschland?« Jesús hörte gespannt zu. Dieses langsame Vorantasten zerrte zwar an seinen Nerven, aber Carlos kam dem Kern scheibchenweise näher. Mittlerweile war er bei der Frage angelangt, von wo aus die Organisation operierte. »Feuer! Feuer!« Der Schrei kam aus dem Hausflur. Das Schlagen von Türen. Aufgeregte Stimmen. »FEUER!« Während Jesús aufsprang und durchs Wohnzimmer zur Tür rannte, warf Carlos mit jahrzehntelang geschärfter Intuition einen Blick auf den Gefangenen. Jesús hatte bereits den Schlüssel im Schoss gedreht, als er ihm hinterher schrie: »Jesús, nein, nicht öffnen!« Was hatte der Alte denn schon wieder? Sollten sie hier oben ausharren, bis das Feuer den Fluchtweg versperrte? Unwillig schloss er wieder ab und ging zurück. Carlos hatte seine Knarre in der Hand und zielte damit auf den Gefangenen. »Er kennt die Stimme, ich hab’s ihm angesehen. Da draußen sind seine Leute und warten darauf, dass wir ihnen in die Arme laufen. Deshalb der Feueralarm.« Jesús konnte es nicht glauben und wollte es auch nicht, so kurz vor dem Ziel. Entschlossen marschierte er zur Fensterfront im Wohnzimmer, um vom Balkon aus nachzusehen. Bis Carlos begriff, was er vorhatte, stand die Balkontür schon offen. »Türe zu! Du hirnloser Anfänger bringst uns um!« »Du leidest ja an Paranoia«, giftete Jesús zurück, schloss die Tür aber sofort. »Was meinst du wohl, warum ich die Jalousien runtergelassen habe!« »Verdammt, Carlos, du siehst Gespenster! Woher sollen die denn wissen, dass wir hier sind?« »Erinnerst du dich nicht an den Bus auf der anderen Straßenseite? Die sind da draußen und erwarten uns, glaub’s mir.« Er bugsierte den Gefangenen ins Schlafzimmer, wo er ihn mit Klebeband am Heizkörper fixierte. Dann holte er die zweite Pistole und gab sie Jesús. »Der Knebel liegt auf dem Bett. Sieh zu, dass er keinen Muckser von sich gibt. Ich telefoniere nebenan.« Nach Lobretas Hilferuf zögerte Gorpón keine Sekunde, General Suarez aus dem Schlaf zu reißen, der ihm für Notfälle seine Privatnummer gegeben hatte. Suarez meldete sich schlaftrunken, schüttelte die Müdigkeit aber blitzschnell ab. Es war nicht die erste Störung in dieser Nacht. Gegen Mitternacht hatte einer der Beschatter Pintalubas angerufen: Der Oberst hatte in Uniform sein Haus verlassen und den Weg zu einem kleinen Flugplatz eingeschlagen. Suarez befahl, ihn zu stoppen und ans Telefon zu holen. Er redete ihm gut zu, reinen Tisch zu machen, zum Wohle der Kameradschaft! Pintaluba antwortete mit Schweigen, woraufhin Suarez anordnete, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Wohin der Oberst wollte, lag also im Dunklen. Gorpóns Anruf rückte die Sache in ein neues Licht. Sollte die Reise vielleicht nach Salou führen, um Verbrechern den Rücken frei zu halten? Suarez versprach Gorpón, die Situation zu bereinigen. Wie, wusste er allerdings noch nicht. 5:15 Uhr. Während Carlos telefonierte, drückte Jesús dem Gefangenen die Pistole an die Schläfe. »Sag, ob das wirklich deine Leute sind, sonst drücke ich ab.« Mirandor würde es ohne zu zögern tun, erkannte S. Das Jesuskind hatte sich in einen Teufelsbraten verwandelt. Obwohl S jeden Menschen für ein nur lose geschnürtes Bündel von Gut und Böse hielt, das lediglich kräftig durchgeschüttelt werden musste, um das Unterste nach oben zu kehren, erstaunte ihn die schnelle und radikale Veränderung. »Rede!« Aus den Augenwinkeln sah S, wie sich der Zeigefinger um den Pistolenabzug krümmte. »Hör auf! Verdammt, Jesús, die Geisel kann unsere Lebensversicherung sein, kapierst du das nicht?« Carlos glaubte nicht ernsthaft, die andere Seite werde sich auf einen Tauschhandel einlassen, wollte sich diese Option aber offenhalten. S glaubte es ebenso wenig. Er schöpfte aus einem anderen Grund Hoffnung: Mirandor würde sich nicht kampflos ergeben. Und wenn die beiden abkratzten, würde Vater nie erfahren, dass er begonnen hatte, Informationen preiszugeben. Im Bad hatte S einen Blick in den Spiegel werfen können: Ihm waren die erlittenen Qualen ins Gesicht geschrieben. Vater würde an der Tapferkeit seines Sohnes nicht zweifeln können. Hatte er Vater wirklich verraten wollen? Er vermochte es sich nicht mehr vorzustellen. Wahrscheinlich hatte er nur ein paar nachprüfbare Fakten offenbart, um Lobretas Vertrauen zu gewinnen und ihn dann in die Irre zu führen. »Uns ist Hilfe zugesagt, Jesús. Bis sie eintrifft, müssen wir hier durchhalten.« Von wegen Hilfe, das war das Pfeifen im Walde. S verspürte Genugtuung. Die beiden saßen hier in der Falle. Selbst wenn sie sich Flügel wachsen lassen könnten: Iwan würde sie vom Himmel schießen. »Der Leutnant wird sich gleich wieder melden«, sagte Carlos, während er mit Jesús ins Wohnzimmer ging. »Aber wenn er nicht schnell genug Hilfe schicken kann, sollten wir die Polizei rufen.« »Kommt nicht infrage. Die werden mich wegsperren.« Nichts anderes würde Gorpón machen, zu Jesús’ eigenem Schutz. Carlos behielt es für sich. Was aus seiner Sicht gegen die Polizei sprach, waren die Verbindungen der anderen Seite. Dass sie sich trauten, hier einen Feueralarm zu inszenieren und die Bewohner in Angst und Schrecken zu versetzen, sprach für einflussreiche Helfer im Staatsapparat. Sein Handy klingelte, Gorpón. »Habe gerade mit Kuhlmann gesprochen, einen der beiden Beamten, die ich zu euch geschickt habe. Sie müssten bald eintreffen.« »Kuhlmann? Das ist kein Spanier.« »Doch, von der Policía Nacional in Madrid. Ist gebürtiger Deutscher, nur …« »Du schickst uns ausgerechnet einen Deutschen? Wir haben es wahrscheinlich mit einer deutschen Verbrecherbande zu tun, hast du das noch nicht kapiert?« »Kuhlmann ist in Ordnung, glaub mir.« »Außerdem sind zwei viel zu wenig!« »Sie helfen euch durchzuhalten, bis weitere Verstärkung kommt, wird gerade organisiert. Ich habe …« Plötzlich wurde an die Wohnungstür gehämmert. »Feuer! Das Haus brennt!« »Du bist unsere letzte Chance, Gorpón!« Carlos legte auf. »Los, Jesús, wir müssen uns vorbereiten. Kipp die Couch um und schieb sie bis einen Meter vor den Flur. Ich bereite eine Überraschung vor.« Er nahm eine Stehlampe aus dem Regal, schnitt das Kabel ab und legte die Drähte frei. Danach goss er im Flur Wasser aus und legte das Kabelende in die Lache. Das andere Ende steckte er in eine Mehrfachsteckdose mit Kippschalter, die bis zur Couch reichte. »Hör mir gut zu, Jesús: Wir müssen mit unseren zehn Schuss Munition haushalten. Du schießt nur auf mein Kommando, verstanden? Mach dich bereit, der Gegner wird nicht lange auf sich warten lassen.« Jesús nickte. Er glaubte selbst nicht mehr an ein Feuer. Irgendwie spürte er die Nähe des Feindes. Aber vielleicht sollte er besser ins Schlafzimmer gehen, um den Gefangenen weiter zu befragen. Vielleicht wäre es gar nicht so schwer zu sterben, wenn er nur vorher die Wahrheit erführe. 05:17 Uhr. Auch Iwan war auf der Suche nach der Wahrheit. Er beobachtete das gegenüberliegende Haus durchs Fernglas, dann blickte er zu Johann, der mit zusammengekniffenen Augen auf das Display der Videokamera starrte. Ein Notbehelf. Die Infrarotwärmebildkameras, mit denen sie mehr oder weniger durch die Mauern des Apartmenthauses hätten hindurchsehen können, befanden sich im gestrandeten Bus; dasselbe galt für die kugelsicheren Schutzwesten. Verdammtes Pech. Nun mussten sie sich damit begnügen, das Haus abzufilmen, um sich anschließend zu vergewissern, dass aus jeder Wohnung, in der die Kamera eine Lichtquelle erfasste, auch ein Bewohner im Hausflur erschien. Aufwendig, doch vielleicht von Erfolg gekrönt: Johann meinte, ein kurzes, kaum sichtbares Aufflackern in einer Wohnung bemerkt zu haben, die bislang verschlossen geblieben war. »Ich kann’s nicht beschwören, vielleicht nur ein Bildrauschen, aber ich tippe auf einen Lichtschein«, bestärkte er den Verdacht, nachdem er sich die Videosequenz erneut angesehen hatte. Iwan nickte. Sie mussten dem auf der Stelle nachgehen, jeden Moment konnten Feuerwehr und Bullen anrückten. Um Zeit zu schinden, hatte Daniel wirklich einen Brand gemeldet, aber am anderen Ende der Stadt. Mittlerweile stand er zwischen den Bewohnern und erzählte ihnen, die Feuerwehr sei bereits alarmiert. Iwan studierte seinen Lageplan. Der Verdacht betraf Wohnung Nummer acht auf der fünften Etage. 05:19 Uhr. Das Löschfahrzeug befand sich auf dem Weg zum Brandort, als das Handy von Staffelführer Ruben Brossa klingelte. Es war seine Mutter. »Entschuldige, dass ich dich bei der Arbeit störe. Die Kleine hatte wieder einen Albtraum. Sie weint und weint. Ich glaube, sie hat Angst, du kommst nicht mehr heim.« Es versetzte ihm einen Stich. Sie hatten es nur gut gemeint, Elvira nach Kräften von der Krankheit ihrer Mami abzuschirmen. Ein schwerer Fehler! So hatte sie sich nicht von ihr verabschieden können. Es hatte sie aus heiterem Himmel getroffen. Und nun hatte Elvira auch noch Angst, Papa könne plötzlich verschwinden. »Schon gut, gib sie mir.« »Papa?« »Ja, mein Spatz.« »Papa …« Sie schluchzte. »Kommst du bitte wieder nach Hause?« Es zerriss Ruben das Herz. Statt seine Kleine im Arm zu wiegen, trieb er sich in der Nacht herum. »Ganz bestimmt, mein Spatz«, versprach ihr er mit belegter Stimme. »Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Lege dich …« »Singst du mir bitte ein Lied vor, Papa?« »Ähm, das ist …« »Bitte!« »Welches denn?« »El Señor Don Gato!« Bitte nicht das Lied von Herrn Kater! Er würde vor versammelter Mannschaft miauen müssen. Ruben schluckte, ließ seinen Blick kreisen, bis jeder kapierte, dass blöde Bemerkungen unkalkulierbare Folgen hätten – und begann zu singen. Nach drei Strophen erbarmte sich Elvira seiner. Rubens Männer grinsten, hielten aber die Klappe. »Und jetzt lege dich hin und schlafe, mein Spatz. Wenn du dann wach wirst, bin ich schon wieder bei dir, großes Ehrenwort!« Er hatte kaum aufgelegt, da meldete sich die Zentrale: »Fehlalarm, ihr könnt umkehren. Hat sich jemand einen Scherz erlaubt.« »Na, toll. Okay, wir rücken ein.« »Sekunde, es kommt was Neues rein. – Feueralarm, diesmal aus der Carrer de Pompeu Fabra, ist echt was los heute Nacht. Der Anrufer sagt, im Haus gegenüber brennt es. Er sieht zwar kein Feuer, aber die Bewohner sind auf die Straße gerannt, weil eins ausgebrochen sein soll.« 05:21 Uhr. Iwan nahm das Funkgerät, um seine Männer nach der abgeschlossenen Hausräumung umzupositionieren. Vier Mann beorderte er auf die Straße, wo sie die beiden nächstgelegenen Kreuzungen absperren und Meldung erstatten sollten, wenn Feuerwehr, Polizei oder Pintaluba anrückten. Von den sieben Männern im Haus sollten zwei im Treppenhaus patrouillieren, die anderen die verdächtige Wohnung im fünften Stock öffnen. Daniel hatte den entscheidenden Hinweis beigebracht: Ein Nachbar wusste von neuen Mietern in der Wohnung und die Beschreibung passte auf Mirandor und Lobreta. »Das Kommando hat Nikita«, befahl Iwan. »Mit Ausnahme der Straßenwachen vervollständigen alle die Ausrüstung.« Bei der Ausrüstung handelte es sich um Blendgranaten und nahkampftaugliche Maschinenpistolen mit ausklappbarer Schulterstütze von Heckler & Koch. Sie lagerten in einem Karton in der dritten Etage. Kurz darauf meldete Nikita Vollzug. »Dann los«, gab Iwan den Einsatzbefehl. »Wenn sich Mirandor und Lobreta ergeben, umso besser. Aber ihr fackelt nicht lange rum. S wird zur Not geopfert, Entscheidung des Salvators.« Nikita wandte sich an seine Männer: »Pierre schießt die Tür sturmreif. Ist der Zugang frei, zündet Mikki eine Blendgranate und geht rein, Pierre und Olaf hinterher. Ich gebe Rückendeckung.« Er breitete den Grundriss aus, den sie anhand einer geräumten Wohnung angefertigt hatten. »Es geht durch den Flur geradeaus ins Wohnzimmer; da ist auch die Küche drin. Rechts im Flur geht eine Tür ins Badezimmer, da könnt ihr Deckung suchen. Das Schlafzimmer ist rechts vom Wohnzimmer. Mehr Räume sind nicht. Lasst euch nicht erwischen. Der Salvator will Mut, nicht Übermut.« Nikita schaute erwartungsvoll in die Runde. »Wir stehen zusammen, ja? Keine hundert Rubel brauchst du, aber hundert Freunde.« 05:23 Uhr. Carlos und Jesús hatten die Maßnahmen zur Erhöhung ihrer Überlebenschancen beendet und saßen im Dunkeln hinter der gekippten Couch. »Jesús?« »Ja?« »Was tun wir, wenn sie eingedrungen sind?« Erst jetzt wurde Jesús bewusst, was seine Entschlossenheit, bis zur letzten Patrone zu kämpfen, für seinen Freund bedeutete. »Ich möchte, dass du jetzt gehst, Carlos. Ich bringe das hier allein zu Ende. Es ist mein Kampf, nicht deiner. Danke für alles und jetzt hau endlich ab!« »Dummkopf. Schon vergessen, dass du die Pest am Leib hast? Der Einzige, der sie überlebt, bist du selbst. Wenn ich rausgehe, bin ich ein toter Mann. Ich habe nicht wegen mir gefragt. Aber du könntest die Sache überleben, wenn wir uns ergeben, bevor es zum Äußersten …« »Ich soll überleben und du stirbst? Niemals. Es tut mir leid, dass ich dich da reingezogen habe. Ich wünschte, ich könnte es rückgängig machen.« »Mein Leben ist gelebt. Was noch kommt, ist einfach nur Zeit.« »Hast du keine Familie mehr?« »Meine Frau ist schon lange tot. Ich habe eine Tochter. Sie hat es mir immer übel genommen, dass ich ihren Bruder nicht retten konnte.« »Francisco. Der Ritter von der traurigen Gestalt.« »Ja. Inzwischen hat meine Tochter mir vergeben. Alles ist gerichtet, der Tod käme nicht zu früh.« »Nein, Carlos, du wirst nicht sterben, ich spüre das! Ich weiß das!« »Um mich musst du dir keine Gedanken machen. Denke über dich nach. Du bist bereit zu sterben, aber mutiger wäre es weiterzuleben. Noch können wir uns ergeben.« Jesús schüttelte den Kopf. »Der Mensch ist eben dumm«, quittierte Carlos die sture Haltung. »Ein Floh, der sich ständig selber sticht. Denk mal drüber …« Kugeln durchbrachen die Wohnungstür, ein ganzer Kugelhagel. Fensterscheiben zerbarsten, im Flur spritzte der Putz von der Wand. »Du bleibst hier in Deckung!« Carlos kroch zur Seite, bis er sich außerhalb der Einschlagzone befand, sprang auf und sprintete in Richtung Flur. Die nächste Salve ratterte los. Als sie verebbte, stürmte er ins Bad, ging in die Hocke, warf einen Blick um die Ecke und richtete die Waffe aus. Ein erneuter Hagel setzte ein. Ohne hinzusehen gab Carlos einen Schuss ab. Das Rattern erstarb auf der Stelle. Carlos nutze den Moment, um einen Satz über die Wasserlache hinweg auf die andere Flurseite zu machen und in die entgegengesetzte Richtung zu schießen. Es tat ihm zwar um die Kugel leid, die wahrscheinlich ins Leere ging, doch die da draußen sollten sich nirgends sicher fühlen. Er verschloss die Badezimmertür, zog den Schlüssel ab und kehrte zu Jesús hinter die Couch zurück. Nichts geschah. Die andere Seite hatte es plötzlich nicht mehr eilig. Weil Pierre einen Schuss abbekommen hatte. Mit zusammengepressten Lippen starrte er auf seinen Oberarm. Er hatte versagt, hatte sich bei erstbester Gelegenheit erwischen lassen. Zu viel Adrenalin im Blut. Sie jagten schon zu lange hinter Mirandor her und wollten ihn einfach nur noch abservieren. »Olaf nimmt Pierres Platz ein«, entschied Nikita. »Ich verbinde dich gleich, Pierre. Keine so dummen Fehler mehr oder ich melde das. Los, weiter!« »Iwan an Nikita. Aktion vorläufig einstellen, die Feuerwehr ist angerückt. Wir lotsen sie in den dritten Stock. Ihr nehmt sie dort in Empfang und sperrt sie weg.« 05:27 Uhr. Major Enric Detás, der Leiter eines sechsköpfigen Sondereinsatzkommandos, Spezialgebiet Terrorabwehr, sah zum wiederholten Mal auf die Uhr. Wo blieb Oberst Pintaluba nur? Er hatte mehrfach versucht, ihn telefonisch zu erreichen, vergebens. Woanders anrufen konnte er nicht, denn der Oberst hatte die Operation zur Geheimsache erklärt und angedeutet, die Kameradschaft sei die treibende Kraft dahinter. Detás missfiel die Nacht- und Nebelaktion, aber er hatte nun mal einen Schwur geleistet: »Glaube und Gehorsam«. Seine Leute, allesamt keine Kameradschaftsbrüder, ahnten natürlich, dass etwas faul war, würden jedoch Stillschweigen bewahren. Es erfüllte Detás mit Stolz, ein solches Team anzuführen. »Aufsitzen«, befahl er schließlich. »Wir machen uns vor Ort selbst ein Bild.« Pintaluba zufolge hatten militante Anarchisten Geiseln genommen, da durften sie die Zeit nicht länger mit Däumchendrehen vertun. Vermutlich würde er sich mit dieser Entscheidung wieder mal Ärger einhandeln. Nichts zu machen. Er konnte sich einfach nicht daran gewöhnen, beim Anlegen der Uniform den Verstand abzulegen. Er zeigte Roque, dem Fahrer, die Zielstraße auf der Karte. »Zügig bis zur Kreuzung Carrer del Priorat, ab da gilt höchste Sicherheitsstufe.« Während der Mannschaftsbus anfuhr, kurbelte Detás das Seitenfenster herunter und steckte sich eine Zigarette an. Die Flamme des Feuerzeugs erhellte Roques kantige Gesichtszüge. Der ehemalige Fremdenlegionär, mit neununddreißig im selben Alter wie Detás, war sein bester Mann. Und sein Freund. Ein Bilderbuchkatalane, störrisch und herzlich, in dieser Reihenfolge. Und beides bis zum Abwinken. 05:32 Uhr. Ruben Brossa sah zum dritten Stockwerk hoch, wo ein Feuer ausgebrochen sein sollte. Rauch war nicht auszumachen, aber der rothaarige Mann neben ihm hatte welchen aus einer Tür dringen sehen. »Ich zeige Ihnen, wo es ist«, gab sich Daniel hilfsbereit. »Sie bleiben hier, wir finden allein hin. Dritter Stock also. Gibt es mehrere Korridore?« »Soll ich Sie nicht doch besser hinführen?« »Sie sollen mir Auskunft geben, der Rest ist unsere Sache. Wohin müssen wir uns von der Treppe aus orientieren?« »Nach rechts, es gibt nur einen Gang. Es ist die vierte Tür auf der rechten Seite.« Ruben begab sich zu seiner Staffel. »Wir gehen zu viert hoch, Hasan und Ignacia bereiten die Löschwasserversorgung vor. An die Arbeit!« Routiniert entnahmen sie dem Fahrzeug Feuerlöscher, Rauchvorhänge, Brandklatschen, und eine Axt. Kurz darauf betraten sie das Apartmenthaus. Sie durchquerten das dunkle Foyer und stiegen die Treppe hoch. Währenddessen näherten sich zwei Männer im Schatten des Löschfahrzeugs den beiden auf der Straße verbliebenen Feuerwehrleuten. HALMA | E-MADRID Generalleutnant Suarez hatte sein Bett nach Gorpóns Anruf nicht verlassen. Die Hände auf dem Bauch gefaltet, sah er in die Dunkelheit und dachte nach. Hektik schadete nur. Während seiner Dienstjahre beim Centro Superior de Información de la Defensa, wie der spanische Nachrichtendienst bis 2002 hieß, hatte er gelernt, nach Umwegen zu suchen, wenn der direkte Weg mehr Risiken als Chancen barg. So wie in diesem Fall. Mitten in der Nacht schlafende Hunde zu wecken, war definitiv nicht im Sinne der Kameradschaft. Es musste eine bessere Lösung geben, eine Halma-Lösung, bei der man die Spielsteine des Gegners nutzte, um ihn zu schlagen. Allerdings zog der Gegner seine Steine im Verborgenen. Suarez nahm im Geiste Pintalubas Platz am Spielfeld ein, um dessen Strategie nachzuvollziehen. Der Ausgangspunkt: Ich will kriminelle ausländische Elemente unterstützen. Wie gehe ich vor? Überlegung eins: Ich brauche Verstärkung, denn ich kann die Polizei, mit der zu rechnen ist, nicht allein auf Abstand halten. Überlegung zwei: Um den Schein der Legalität zu wahren, sollte ich staatliche Einsatzkräfte aufbieten. Überlegung drei: Infrage kommen nur Leute, auf die Verlass ist. Überlegung vier: Niemand ist verlässlicher als ein Kameradschaftsbruder. An diesem Punkt musste man ansetzen. Suarez griff zum Telefon auf dem Nachtschränkchen und rief den Kameradschaftsoffizier an, dem er die Ermittlungen gegen Pintaluba übertragen hatte. Er beauftragte ihn, eine Liste der Personen zu erstellen, mit denen Pintaluba in den letzten vierundzwanzig Stunden telefoniert hatte. Anschließend erhob er sich, schaltete das Licht an und holte das chiffrierte Mitgliederverzeichnis der Kameradschaft aus dem Tresor im Büro. Als das Telefon läutete und ihm die Personen durchgegeben wurden, glich er sie mit dem Verzeichnis ab. Drei Treffer. Einer der Kameraden befehligte in Barcelona ein SEK: Enric Detás. Der ideale Mann für Pintaluba. Und hoffentlich der Spielstein, mit dessen Hilfe Suarez die Partie noch drehen konnte. Vorausgesetzt, Detás wurde, wie zuvor Gorpón, von Pintaluba missbraucht. Andernfalls würde der Schuss nach hinten losgehen. Dieses Risiko musste man in Kauf nehmen. AUFTRITT: KUHLMANN | E-SALOU 05:39 Uhr. »Lay down, lay down!« Brossa und seine Leute schauten verwirrt. Von Männern mit schweren Waffen bedroht zu werden, gehörte nicht zu den üblichen Gefahren der Brandbekämpfung. »Come on!« Nikita dauerte die Sache zu lange. Er drückte einem der Geiseln den Lauf seiner MP an den Hals. »Lay down! Now!« Brossa sah den Widerwillen in den Augen seiner Leute. »Wer’s noch nicht verstanden hat: Wir sollen uns hinlegen. Macht schon, das ist ein Befehl!« »Aber …« »Hinlegen! Hier gibt keiner den Helden!« Kurz darauf, sie lagen bäuchlings auf einem Badezimmerboden, wurden ihnen die Hände mit Plastikleinen auf dem Rücken gefesselt. »I’ll come back to check, what you do. No trouble, no death. Otherwise I kill«, Nikita deutete auf den Jüngsten, »this guy!« Er sperrte den Raum ab und nahm die erbeutete Feuerwehraxt an sich. 05:48 Uhr. Detás kannte den Oberkommandierenden der Kameradschaft nur von der Ferne und wusste nicht einzuschätzen, ob es wirklich Suarez’ Stimme war, die ihm gerade berichtete, Pintaluba drehe ein krummes Ding. Detás konnte und wollte nicht glauben, dass der Oberst ihn gelinkt hatte. Verhielt es sich vielleicht genau umgekehrt? Versuchte ihn der Anrufer mit einer Finte auszutricksen? Detás nahm die Befehle des Anrufers widerspruchslos entgegen. Ob er sie auch ausführen würde, stand auf einem ganz anderen Blatt. Viel Zeit zu entscheiden blieb ihm allerdings nicht, der Mannschaftsbus näherte sich bereits der Abzweigung zur Carrer de Pompeu Fabra. 05:52 Uhr. Ruben Brossa rieb sich die Handgelenke. Dabei blickte er skeptisch die Badezimmerwand hoch, in deren oberem Bereich sich, knapp unterhalb der Decke, ein Lüftungsschacht befand. Obwohl ein mutiger Mann, verweigerte er sich dem Ausbruchsplan, den seine Leute ausgeheckt hatten, um Hilfe herbeizurufen. Wenn die Sache aufflog, würde es an erster Stelle Pancho an den Kragen gehen, ihrem Jüngsten, gerade mal zwanzig Jahre alt und frisch verlobt. Ein völlig unakzeptables Risiko. Doch ausgerechnet der stolze Pancho drängte. »Ein Spanier packt den Stier bei den Hörnern!«, trötete er in jugendlichem Leichtsinn. Und er hatte ein gewichtiges Wort mitzureden. Denn die wiedergewonnene Bewegungsfreiheit verdankten sie seiner Fingerfertigkeit. Schon oft hatte er sie als Hobbyzauberer verblüfft, doch noch nie als Entfesselungskünstler. Pancho war jetzt so richtig in Fahrt und wäre selbst in den Luftschacht gekrochen, hätten seine breiten Schultern es nicht verhindert. Nur Ruben würde durch die Öffnung passen. Endlich willigte er ein. Sie waren eben keine Sachbearbeiter für Brandfälle, sondern Lebensretter, die bei Gefahr im Verzug handeln mussten. Und hier zog die Gefahr mit Maschinenpistolen durchs Haus. »Ihr verhaltet euch ruhig, klar? Also los, bevor die zurückkommen. Räuberleiter.« 05:53 Uhr. Während Ruben sich in den Luftschacht zwängte, näherte sich das SEK der Zielstraße. Roque parkte den Bus am südlichen Ende. Nach zwei Minuten Fußmarsch sahen sie in der Ferne ein Blaulicht. Ziemlich auffällig für eine geheime Operation, aber zumindest wussten sie jetzt, wo genau sie hin mussten. Roque, der ein Nachtsichtgerät trug, übernahm die Spitze, die anderen folgten wie an einer Schnur aufgereiht. »Stopp. Circa zweihundert Meter entfernt stehen zwei Männer, Comandante. Scheinen auf der Kreuzung Wache zu schieben.« »Vermutlich deutsche Kräfte«, sagte Detás. Die irritierten Gesichter seiner Männer verwunderten ihn nicht. Er hatte selbst überrascht auf die Information reagiert, an dem geheimen Einsatz nehme eine ausländische Einheit teil. Seit dem Telefonat mit dem vermeintlichen General Suarez wünschte er sich, er hätte Pintaluba die eine und andere Frage dazu gestellt. Zu spät. »Das hat schon seine Richtigkeit«, sagte er mit einer Bestimmtheit, die hoffentlich nur in seinen Ohren hohl klang. »Also, was siehst du?« Roque beschrieb, was ihm das Nachtsichtgerät enthüllte: Die Männer trugen eine graue Montur, die Hose steckte in Springerstiefeln. Ihre Weste war linksseitig ausgebeult, vermutlich von einem Achselholster. Aus der rechten Seitentasche schaute ein Funkgerät hervor. Im Ohr hatten sie einen Kopfhörerstöpsel. »Ziemlich mager ausgestattet für so einen Einsatz, was meinst du, Comandante?« »Gehören die beiden eher zu den Geiselnehmern?« »Wenn du mich fragst: Die hatten eine militärische Ausbildung.« »Wieso?« »Die Haltung. Kontrollierte Anspannung. Dahinter steckt harter Drill. So gesehen könnten das auch Leute von uns sein.« Roques Einschätzung sprach für Pintalubas Version, überlegte Detás. Demnach handelte es sich eher um Freund als Feind. Es wurde Zeit, seinen Leuten endlich eine klare Ansage zu machen. »Dann müssen es die deutschen Kollegen sein. Wir machen …« Wir machen sie auf uns aufmerksam, hatte er sagen wollen. Doch im letzten Moment änderte er seine Meinung. »Wir machen es folgendermaßen: Álvaro und ich geben uns zu erkennen, die anderen folgen uns unauffällig in einem Abstand von fünfzig Metern und sichern uns ab.« Roque sah ihn skeptisch an. »Ich denke, wir arbeiten mit denen zusammen.« »Oberst Pintaluba ist nicht da und wir kennen die Leute nicht, also Vorsicht.« Er steckte sich den Stöpsel des Funkkopfhörers ins Ohr. »Ich will mit deinen Augen sehen können, Roque. Fertig, Álvaro? Dann los.« Sobald Vasco die zwei dunklen Gestalten auftauchen sah, drückte er einen Knopf an seiner Weste und informierte Iwan. »Sind mit Gewehren bewaffnet. Schwarzer Kampfanzug, Helm.« »Pintaluba mit seinen Leuten. Dimitri soll ihn sofort zu mir führen.« Detás wollte gern glauben, alles sei in Ordnung, Pintaluba ein rechtschaffener Kamerad und der Anruf eine Finte. Trotzdem hatte er den Finger am Abzug, während sie mit gesenkter Waffe auf die Straßenkreuzung zugingen. »Wer sind Sie?«, sprach ihn einer der beiden Männer, die ihre Pistolen hervorgeholt hatten, auf Spanisch an. Dem Akzent nach ein Portugiese und auch dem Aussehen nach kein Deutscher. Aber was besagte das heutzutage schon? Detás erinnerte sich an die letzte WM: Da hatte ein Mann in der deutschen Elf gespielt, der nach Schwarzafrika aussah. »Ich bin Comandante Detás. Wir sind von Oberst Pintaluba hierhin kommandiert worden. Und wer sind Sie?« Vasco wusste nicht, was er antworten sollte. Sich eine glaubwürdige Geschichte auszudenken, war Pintalubas Job. »Ich bin nicht befugt, darüber Auskunft zu geben. Mein Kollege wird Sie jetzt zu unserem Chef bringen, der informiert Sie.« »Nichts da. Sie informieren mich, und zwar jetzt. Noch ist das spanisches Hoheitsgebiet.« Vasco spürte alle Blicke auf sich. »Sondereinheit Politische Verbrechen«, improvisierte er. »Können wir englisch sprechen? Mein Kamerad spricht kein Spanisch.« Vor allem Iwan nicht, der über Vascos Funkgerät mithören konnte. »I’m Vasco und this is Dimitri. We don’t use last names.« »Where are you from?« Iwan hielt sein Funkgerät ans Ohr. Offenbar gab es Schwierigkeiten. »Why do you ask?« Detás wurde langsam ungeduldig. »Es hat geheißen, uns erwarten deutsche Einsatzkräfte.« »Auch. Aber das ist ein internationaler Einsatz. Sie sollten Ihre Hausaufgaben gründlicher machen, Kollege«, versuchte es Vasco auf die aggressive Tour. »Was ist, Detás? Gehen wir endlich an die Arbeit? Die Gangster haben Geiseln genommen, oder ist das ebenfalls neu für Sie? Wo ist eigentlich Pintaluba?« Detás kniff die Augen zusammen. In Spanien würde es ein Soldat oder Polizist nie und nimmer wagen, den Dienstrang eines hohen Offiziers zu unterschlagen. »Oberst Pintaluba ist noch nicht eingetroffen.« »Dimitri bringt Sie zu unserem Einsatzleiter.« »Mein Kollege bleibt hier bei Ihnen«, entgegnete Detás. Er wollte Álvaro nicht mit in die Höhle des Löwen nehmen, zu viele Dinge irritierten ihn. Iwan kratzte sich am Schädel. Wo hatte dieser Detás eigentlich sein Team? Die waren doch nicht nur zu zweit gekommen. Warum zeigten sich die anderen nicht? Er funkte Christian an, der auf der Rückseite des Apartmentgebäudes Wache hielt, und schilderte ihm die Situation. »Du sprintest von hinten um den Block und schleichst dich an. Peil die Lage. Irgendwo müssen sich Leute verbergen. Vorsicht, die sind in ihren dunklen Monturen schwer zu erkennen.« Iwan stopfte sich ein Kaugummi in den Mund. Sein kantiger Kiefer begann zu rollen. Der Fall Mirandor schien wirklich wie verhext, ständig wurden sie mit einem neuen Spuk konfrontiert. Kerberos’ Kopf tätschelnd, murmelte er »Moskva sljozam ne verit« – Moskau glaubt den Tränen nicht. Statt zu jammern musste er dem Spuk ein schnelles Ende bereiten. Sollte Detás etwas im Schilde führen, würde er ihn das Fürchten lehren. Seine Augen funkelten vor Angriffslust. 5:54 Uhr. Jesús verstand nicht, wieso die Schweine den Angriff eingestellt hatten. Das Warten machte ihn wahnsinnig. »Vielleicht sind die längst abgehauen.« »Wir werden es erfahren.« »Ich halte es nicht mehr aus.« »Mit jeder Minute steigen unsere Chancen. Lange können die das hier nicht unter Kontrolle halten. Und Gorpóns Hilfe muss auch bald eintreffen. Also bleib ruhig.« Sie schwiegen wieder. Beide hingen ihren eigenen Gedanken nach. »Ich hätte mich so gern einmal richtig verliebt«, murmelte Jesús nach einer Weile mehr zu sich selbst als zu Carlos. »Bis über beide Ohren.« »Hast du nie?« »Nein. Ein Mal, mit Anfang zwanzig, war ich nahe dran. Aber plötzlich verschwand sie, wie vom Erdboden verschluckt. Ich habe sie nie wiedergesehen.« »Und danach?« »Nur lose Beziehungen, Affären, Sex.« »Und warum?« »Weiß nicht. Vielleicht hatte ich Angst, sie könne ebenso verschwinden. Vielleicht hatte ich auch einfach zu viel mit mir selbst zu tun. Ständig gab es Probleme, irgendwas ging immer schief. Für Liebe war kaum Zeit.« »Dann darfst du dein Leben nicht wegwerfen. Ohne Liebe zählt es nicht.« Ein wuchtiger Axthieb traf die Tür und brachte das Holz zum Splittern. Jesús schnellte hinter der Couch hervor und gab einen Schuss ab. »Runter mit dir!«, brüllte Carlos. Jesús ging wieder in die Hocke. »Wage es nicht noch mal, ohne meine Kommando abzudrücken. Wer die Nerven verliert, verliert sein Leben.« Ein zweiter Axthieb traf die Tür und hinterließ ein handtellergroßes Loch. Man konnte jetzt vom Wohnzimmer in den Hausflur sehen. Und umgekehrt. 6:01 Uhr. Bevor Detás sich mit dem Mann namens Dimitri auf den Weg machte, flüsterte er Álvaro zu, vorsichtig zu sein. »Ich weiß nicht, ob hier alles mit rechten Dingen zugeht, okay?« Er und Dimitri hatten erst ein paar Meter zurückgelegt, als er Roque im Kopfhörer vernahm: »Der Mann neben dir hat soeben einen Knopf auf seinem Funkgerät gedrückt. Vielleicht soll jemand mithören.« Was war hier los? Detás zog den Finger noch enger um den Abzug. »Vorsicht, Comandante. Es bewegen sich zwei Männer auf euch zu. Mit MPs bewaffnet. Schleichen die Büsche entlang, Position ungefähr auf ein Uhr.« Detás sah zu Dimitri, der aber nicht in die verdächtige Richtung blickte. Er kniff die Augen zusammen, ohne jemanden auszumachen, es war noch zu dunkel. Selbst wenn: Woher sollte er wissen, ob das Anschleichmanöver ihm galt? Offenbar lief die Operation gegen die Geiselnehmer bereits. – Und wenn der Anrufer wirklich General Suarez gewesen war? Wenn hier alles getürkt war? Dann lief er dem Feind ins offene Messer. Er konnte nur hoffen, dass die neuen Schutzwesten hielten, was sie versprachen. 6:03 Uhr. Iwan wartete ungeduldig auf Christians Bericht. Endlich meldete er sich. »Ich hab sie vor mir. Vier Mann. Die checken die Lage aus dem Hintergrund. Einer hat einen Helm mit Nachtsichtgerät. Spricht ständig ins Mikrofon. Schätze, der erzählt seinem Chef, was er sieht.« »Iwan an Sven und Hamid. Anpirschaktion einstellen. Ihr könntet gesehen werden. Zieht euch zurück!« Iwan dachte nach. Was war mit Detás los? Verhielt er sich nur übervorsichtig oder kam er in feindlicher Absicht? Er musste dem Mann auf den Zahn fühlen. Sollten Zweifel an seiner Kooperationsbereitschaft bleiben, würde er die Spanier in einen Hinterhalt locken. Es durfte keinesfalls zur offenen Schlacht kommen, dafür war die Gegenseite zu gut ausgerüstet. Iwan musste seine Trümpfe ausspielen: die Überzahl, die Kenntnis des Terrains und das Überraschungsmoment. Er entwarf einen Plan und informierte seine Leute. Danach setzte er Henry über die Lage in Kenntnis. 6:06 Uhr. Señor Benuiz legte die Decke, die er aus seinem Opel Astra geholt hatte, behutsam um die Schultern seiner Frau. Sie waren erst vor Kurzem, nach seiner Pensionierung, von La Coruña hierhin gezogen. Paloma, seinem Täubchen, hatte das feuchte Klima an der Nordwestküste nie gutgetan, sie litt an Rheuma. Seit sie in Salou wohnten, ging es ihr, Gott sei Dank, viel besser. »Danke, mein Schatz. Mir wird schon wärmer.« »Es kann sich höchstens um einen Schwelbrand handeln, sonst würden längst Flammen aus den Fenstern schlagen. Du wirst sehen, gleich dürfen wir wieder rein.« Er blickte sich um. Die beiden Feuerwehrleute, die begonnen hatten, den Wasserschlauch abzuwickeln, sah er nirgends mehr. Wahrscheinlich hatten ihre Kollegen im Haus bereits Entwarnung gegeben. Bestimmt war alles in bester Ordnung, nur ein Fehlalarm. »Schauen Sie mal da.« Señor Gardio, ein Witwer, der neben ihnen wohnte, deutete die Straße hinauf. »Seltsam, oder?« Ja, es bot sich in der Tat ein seltsames Bild: Von einer Straßenlaterne erhellt, tauchten zwei bewaffnete Männer aus der Nacht auf. Der linke trug den Kampfanzug eines Soldaten. Als sei Krieg ausgebrochen. Das ungute Gefühl, das Señor Benuiz beschlichen hatte, während fremde Männer sie auf die Straße gescheucht hatten, stieg wieder hoch. Er zog seine Frau an sich. Obwohl er einen dicken Bademantel trug, fröstelte es ihn. Ein wenig faszinierte ihn das Geschehen allerdings auch. Was da wohl los war? 6:06 Uhr. »Iwan an Nikita. Gebt Meldung! Wie weit seid ihr mit Mirandor? Lagebericht!« »Wir sind bis ins Wohnzimmer vorgedrungen. Olaf haben wir verloren. Der Wohnungsflur war unter Strom gesetzt. Er ist gestürzt und Lobreta hat ihn umgelegt.« »Ihr Idioten. Bringt die Sache sofort zu Ende.« »Maximal fünf Minuten.« »Der SEK-Leiter ist auf dem Weg zu mir. Ich werde ihn aufhalten, bis ihr fertig seid.« »Lobreta haben wir übrigens mittlerweile aus dem Spiel genommen. Röchelt noch ein bisschen.« Iwan verstand zwar, dass seine Leute den Alten ein bisschen leiden sehen wollten, aber es gab jetzt keine Spielräume für persönliche Genugtuung. »Knallt ihn ab.« »Moment.« Durchs Funkgerät hörte Iwan einen Schuss. »Erledigt. Der Schuss riss Jesús aus der Erstarrung, in die er gefallen war, nachdem sie Carlos erwischt hatten. Carlos. Der sich in die Schussbahn geworfen hatte, als eine todbringende Kugel auf Jesús zugesteuert war. Der sein Leben geopfert hatte. »Ich sterbe, damit du lebst. Bitte, Jesús, lebe!« Jesús hatte versucht, ihn aus der Schusslinie zu ziehen, während ein Angreifer sich in der Tür aufbaute und seine MP nachlud. Die Zeit hatte nicht gereicht, schon waren Schüsse direkt neben Jesús eingeschlagen und er hatte ins Schlafzimmer flüchten müssen. Ich sterbe, damit du lebst. Die Worte waren in seinem Kopf gekreist wie ein Tornado, in dessen Auge sein Bewusstsein still verharrte. Wie in Trance gefallen. Unfähig zu denken. Unfähig zu empfinden. Doch der Schuss jenseits der Schlafzimmertür katapultierte ihn ins Hier und Jetzt zurück. Sie hatten Carlos wie ein Stück Vieh abgeknallt. Carlos. Emily. Seine Eltern. Vielleicht auch die Patienten in Málaga, es wäre dasselbe Prinzip: Andere Menschen töten, um ihn »in die Bredouille zu bringen«. Alle tot. Nur er lebte noch. Und sein Gefangener. Jesús warf einen Blick auf den regungslos am Boden kauernden Mann und verspürte das Verlangen, ihm eine Kugel zu verpassen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Er nahm die Pistole und setzte sie dem Mann an die Schläfe. Da fielen zwei weitere Schüsse, diesmal draußen auf der Straße. Die von Gorpón versprochene Hilfe? Jesús zog die Pistole zurück. Sollte er gerettet werden, verdankte er es Carlos. Und Carlos hätte nicht gewollt, dass er zum Mörder würde. Ob er sich lange genug behaupten konnte? Er hatte bloß noch eine Patrone. 6:08 Uhr. Detás hockte hinter einem Ford Fiesta und fluchte. Den ersten Schuss hatte er selbst abgegeben. Eine Kleinigkeit, die ihm hätte sofort auffallen müssen, hatte ihn endgültig überzeugt, dass der Anrufer – wahrscheinlich wirklich General Suarez – recht hatte: die fehlenden Schutzwesten der vermeintlichen Anti-Terror-Einheit. So etwas gab es nicht. Er hatte seinen Begleiter aufgefordert, die Pistole auf den Boden zu legen, doch der hatte sie stattdessen hochgerissen. Detás hatte ihn erschossen. Und der zweite Schuss? Er war aus keinem ihrer Gewehre abgegeben worden. Hoffentlich hatte er nicht Álvaro gegolten. 6:08 Uhr. »Iwan an Christian.« Keine Reaktion. »Iwan an Christian. Wenn du nicht reden kannst, dann kratz mit dem Fingernagel übers Mikro.« Kein Lebenszeichen. »Iwan an Sven. Lagebericht.« »Hamid und ich befinden uns hinter dem Bauschuttcontainer, zehn Meter vom Haus entfernt. Der SEK-Chef hat Dimitri erschossen. Der zweite Schuss kam wohl von einem unserer Leute. Wer auf wen geschossen hat, weiß ich nicht.« Plötzlich sah Sven in dreißig Metern Entfernung einen Kopf hinter einem Auto hervorragen. Dimitris Mörder. Er machte Hamid, der schussbereit hinter ihm kniete, auf das Schwein aufmerksam. Hamid hob sofort das Gewehr, visierte das Gesicht durchs Zielfernrohr an und drückte ab. Der Kopf wurde zurückgeschleudert und riss den Körper mit sich hinter das Fahrzeugheck. Schade aber auch, er hätte ihm zur Sicherheit gern noch eine Kugel verpasst. Roque suchte durchs Nachtsichtgerät nach dem feigen Schützen, der den Comandante getroffen hatte. Hinter einem Bauschuttcontainer bewegte sich ein Schatten. Er legte an und zog den Abzug durch. Im selben Augenblick beugte sich Sven hinunter, um ins Funkgerät zu sprechen. Die Kugel verfehlte ihn um Haaresbreite. Sie streifte den Container und verlor sich auf der Suche nach einem Ziel im Dunkeln. 6:08 Uhr. Henry erklärte dem Salvator, was draußen vor sich ging. Dessen Gesicht gefror, doch er blieb wie immer sachlich. »Du hast die Adresse des Ausweichquartiers?« Henry nickte. »Heydt und ich müssen hier weg. Steht das Fluchtfahrzeug bereit?« »Direkt vorm Hinterausgang.« »Informiere Iwan über unseren Rückzug. Du und Daniel, ihr kommt mit. Wir treffen uns in drei Minuten im Garten. Nehmt das Notebook und den Aktenordner mit.« Mit ungewohnter Eile ging der Salvator davon. Seine Sorge galt nicht sich selbst, sondern seiner Tochter: Wenn er scheiterte, würde sie sterben. 6:08 Uhr. Die von Roque abgegebene Kugel fand doch noch ein Ziel. Sie schlug neben Señora Benuiz ein. Nach einem Moment des Staunens ging die Señora in die Knie. Sie beugte sich über ihren Mann und strich ihm über das schuldbewusste Gesicht. »Ach, Paloma«, röchelte er, der Rest ging in einem Blubbern unter, das aus seiner Lunge kam. Blut drang durch den weißen Bademantel und färbte seine Brust rot. Paloma legte ihm den Zeigefinger auf den Mund. »Bleib ruhig, mein Schatz.« Ihr Herz flatterte, doch dem schenkte sie ebenso wenig Beachtung wie dem rheumatischen Schmerz in ihren Handgelenken. Mit eisernem Griff packte sie den einen Arm ihres Mannes und zog ihn mit Hilfe eines Nachbarn von der Straße auf den Bürgersteig. Die anderen Nachbarn, die Schutz hinter Fahrzeugen gesucht hatten, sahen fassungslos zu. »Ich rufe Hilfe herbei«, sagte jemand und rannte davon. Es war zu spät, fühlte Señor Benuiz. Er entrang dem Blubbern ein letztes Wort: »Entschuldige.« Aber es war nicht zu entschuldigen. Statt Palomas Drängen nachzugeben, hatte er neugierig geglotzt. Als wäre das nur ein Kinofilm. Als säßen sie sicher im Zuschauerraum. Statt Schutz zu suchen, hatte er sich erschießen lassen. Und nun musste er sie allein zurücklassen. Er wollte ihr sagen, dass er sie liebte, doch die Worte gingen im Blubbern seiner Lunge unter. Señor Benuiz ertrank in sich selbst. Sein Blick verlor sich in der Ferne. Er starb. Die Nachbarn stierten aus ihren Verstecken hinüber, um den Moment nicht zu verpassen. Nur Paloma hielt die Augen geschlossen. Sie streichelte seine Hand, bis sie kein Leben mehr fühlte. 6:11 Uhr. »Roque für den Comandante.« »Comandante.« »Du lebst, dem Herrn sei gedankt!« »Die Kugel hat nur meinen Helm getroffen. Der Einschlag war allerdings heftig, sehe immer noch Sterne.« »Álvaro hat es erwischt, Comandante. Wie schlimm, ist nicht auszumachen. Mendo ist zu ihm …« »Hier Mendo. Álvaro ist tot.« »Oh Gott.« Detás bekreuzigte sich. »Konntet ihr ihm nicht helfen?« Roque begann zu stammeln. Niemand machte sich größere Vorwürfe als Roque selbst, wusste Detás. Obwohl gefährliche Einsätze an der Tagesordnung waren, hatte dieses SEK noch nie einen Mann verloren. »Reiß dich zusammen«, schnauzte er Roque an, meinte aber ebenso sich selbst. Wie auf Knopfdruck erstattete Roque Bericht. »Wir waren abgelenkt, weil: es hat sich uns jemand von hinten genähert. Bewaffnet. Haben wir ausgeschaltet. Bermudo verfolgt Álvaros Mörder: diesen Vasco.« Vasco keuchte vor Anstrengung. Er war ein hervorragender Läufer, doch sein Verfolger besaß das Zeug zum Weltmeister. Der enge, von Hecken eingefasste Weg zwischen den Häusern ließ ihm kaum Raum, im Zickzack zu laufen, um kein leichtes Ziel abzugeben. Plötzlich sah er im Dämmerlicht eine Querstraße vor sich auftauchen. Seine Rettung. Noch dreißig Meter. Im Laufen stellte er den Feuerwahlhebel an der MP auf Dauerfeuer um. Noch zehn Meter. Noch fünf. Die Aussicht, den Spieß umzudrehen, gab ihm neue Kraft. Als er die Weggabelung erreichte, warf er sich hinter die Hecke, rollte in fließender Bewegung auf den Bauch und riss die MP nach vorn. Den Finger hatte er schon am Abzug. »Hab dich«, dachte er grimmig. Ein Irrtum. Bevor er den Abzug ziehen konnte, spritzen unzählige Kugeln durch die Hecke. Vascos Gesicht landete mit einem schmatzenden Geräusch auf dem Boden und verteilte sich über die Steinplatten. »Bermudo für den Comandante. Habe den Mann ausgeschaltet.« »Gut gemacht«. »Musste ihn leider eliminieren.« Was nicht hieß, dass er Skrupel hatte. Er machte diesen Job auch deshalb so gern, weil man mit moralischer Legitimation auf Menschen schießen durfte, zumindest gelegentlich. Nur hätte er den Mann in dieser komplizierten Gefechtslage lieber verhört. Aber schon während sich die Weggabelung aus der Dunkelheit geschält hatte, war ihm klar geworden, dass ihm wahrscheinlich keine andere Wahl blieb. »Das sind alles Geiselnehmer, Comandante?« »Wer weiß, ob es überhaupt welche gibt. Der Wagen mit dem Blaulicht ist übrigens ein Löschfahrzeug der Feuerwehr, keine Ahnung, was die hier machen. Alles total unübersichtlich. Jedenfalls sind die angeblichen deutschen Spezialkräfte unser Gegner. So wie wir beschossen werden, müssen es ziemlich viele sein. Sie nehmen uns von zwei Seiten unter Beschuss: vom Apartmenthaus aus, vor dem das Löschfahrzeug steht, und vom Bungalow direkt gegenüber. Wir müssen uns Stück für Stück vorarbeiten und beginnen mit dem Bungalow. Der muss gesäubert werden. Auf seiner Rückseite verläuft eine Straße.« »Ja, da befinde ich mich gerade.« »Ich schicke dir Roque. Schaut, dass ihr von hinten in das Anwesen kommt und räumt auf.« Fünf Minuten später schlichen Bermudo und Roque den Weg an der rückwärtigen, den Garten umgebenden Mauer entlang. In der Ferne sahen sie einen Wagen davonfahren. 6:12 Uhr. Iwan stand grübelnd am Küchenfenster. Es war draußen verdächtig ruhig. Gelegentlich gaben die SEK-Leute einen Schuss ab, allerdings schienen sie nicht ernsthaft interessiert, voranzukommen. Er überlegte, was er an Detás Stelle tun würde – und hatte es schlagartig eilig. Er musste hier sofort raus. Denn wenn er auf der gegnerischen Seite stünde, würde er zuallererst dafür sorgen, nicht von zwei Seiten beschossen zu werden. Er würde erst einmal einen der beide Gefahrenherde beseitigen – und mit dem Bungalow beginnen. Er würde von hinten angreifen. Er nahm seine Waffe und befahl Johann, ihm zu folgen, um durch ein Fenster im Nebenraum zu flüchten. In diesem Moment erschütterte eine Explosion das Haus. »Iwan an Nikita. Wir werden angegriffen und müssen durchs Küchenfenster raus. Ihr gebt uns Feuerschutz. Der Gegner befindet sich hinter dem grünen Transporter auf der rechten Straßenseite. Ballert, was das Zeug hält.« Noch bevor er das Fenster geöffnet hatte, prasselte ein Kugelhagel auf den Transporter ein. Iwan nahm seine MP und sprang auf die Arbeitsplatte. Johann wollte hinterher. »Erst Kerberos.« Er gab seinem Hund ein Zeichen. Entnervt sah Johann, wie das massige Tier vergeblich versuchte, mit seinen kurzen Beinen auf die Arbeitsplatte zu springen. Vom Flur her hörte er Schritte. Scheiße! Er packte den verdammten Köter und wuchtete ihn hoch. Im selben Augenblick wurde die Küchentür aufgetreten. Iwan sprang durchs Fenster, Kerberos hinterher. Im Fallen hörte Iwan hinter sich das Rattern von Gewehren. Dazwischen Johanns Schrei. Noch ein Mann weniger. Er rollte sich vom Boden ab und war in Sekundenschnelle wieder auf den Beinen. Den Oberkörper vorgebeugt, rannte er mit Kerberos über die Straße, von einem Schleier aus Pistolenkugeln geschützt. Mit einem Hechtsprung verschwand er hinter dem Feuerwehrauto. Er funkte Nikita an. »Was ist mit Mirandor und S?« »Wir sind alle damit beschäftigt, die Angreifer auf Abstand zu halten. Pierre ist oben und hält Wache.« »Er hat sie sofort zu liquidieren!« »Alles klar.« 6:18 Uhr. Statt in eine Wohnung hatte der Lüftungsschacht Ruben Brossa in einen Hauswirtschaftsraum geführt. Neben einem Korb mit Wäsche stand ein großer Karton. Er klappte den Deckel beiseite und blickte auf vier Maschinenpistolen. Ruben nahm eine heraus und betrachtete sie, als Sportschütze kannte er sich mit Schusswaffen aus. Er legte sie wieder zurück und zog vorsichtig die Tür auf. Ein schwaches, aber andauerndes Knattern. Da wurden in Windeseile ganze Magazine leer geschossen, vermutlich auf der Straße. Er machte kehrt und holte sich eine MP. Nur zu seinem Schutz. Die Polizei musste er wohl nicht mehr informieren, bestimmt galt ihr die Schießerei. Er öffnete erneut die Tür und sah den Hausflur entlang. Los jetzt, machte er sich Mut, er musste seine Kameraden schnellstmöglich befreien. Sollte es für die Gangster eng werden, würden sie kaum davor zurückschrecken, sie als Geiseln oder menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Ruben rechnete nicht damit, dass sie einfach nach draußen spazieren konnten, aber das Haus bot unzählige Verstecke und sie darin aufzuspüren, würde viel Zeit erfordern. Zeit, die die Gangster dann hoffentlich nicht mehr hatten. 6:20 Uhr. Pierre drückte seine Zigarette aus. Es war ihm sauer aufgestoßen, dass er wegen des blöden Streifschusses hierhin abgeschoben worden war. Wenn er jetzt Mirandor das Licht ausblasen durfte, hatte sich die Warterei allerdings gelohnt. Er nahm die MP vom Boden und ging in die Wohnung. Um sich einzustimmen, trat er dem toten Lobreta mit dem Stiefel ins Gesicht. Dann baute er sich vor der Schlafzimmertür auf und drückte ab. Binnen Sekunden war die Tür von Schüssen durchsiebt. Jesús stand regungslos beim Fenster. Gorpóns Hilfe kam also zu spät. Jahrzehnte, die er vermeintlich noch vor sich gehabt hatte, schrumpften zu Sekunden. 6:20 Uhr. Plötzlich knallten Schüsse durchs Haus, viel lauter als das gedämpfte Geknatter, das er bisher gehört hatte. Ruben hielt inne. Das kam aus einem der oberen Stockwerke. Gegen seinen Willen zog es ihn das düstere Treppenhaus hinauf. Du bist Feuerwehrmann, nicht Polizist, sagte ihm eine innere Stimme, doch mit jeder neuen Salve, die durchs Haus dröhnte, zog es ihn weiter hinauf. Im vierten Stock sah er eine angelehnte Wohnungstür. Von dort kam das gedämpfte Geknatter. Wahrscheinlich benutzten die Gangster einen Balkon als Schießstand, um die Polizei auf Abstand zu halten. Er stieg die Treppe ins oberste Stockwerk hinauf, wo er auf eine durchlöcherte Tür stieß. Hier war er richtig. Richtig wofür? Er wusste es nicht. Mit einem Mal herrschte Stille. Auf Zehenspitzen näherte Ruben sich der Tür. 6:21 Uhr. Jesús sah, wie das Schloss nachgab. Der Krieg hatte ein Ende. Unverhofft überkam ihn ein Friede, der sich nach dem seelischen Amoklauf der vergangenen vierundzwanzig Stunden wie das Paradies anfühlte. War das der Tod? Dann war er bereit zu sterben. Ohne wahre Liebe zählte ein Leben nicht, hatte Carlos gesagt. Zu spät. Immerhin hatte er Freunde gehabt. Statt seine letzte Kugel abzufeuern legte die Waffe neben sich auf den Boden. Pierre stand irritiert im Türrahmen. Glaubt der Spinner etwa, das würde ihm jetzt noch helfen? Da hatte er sich geschnitten. Aber ihn wollte sich Pierre für gleich aufsparen. Vor der Kür kam die Pflicht. »Tut mir leid«, sagte er mit einem Achselzucken zu S. »Ist ein Befehl. Du kennst das ja.« S überfiel Panik. Verzweifelt versuchte er, sich verständlich zu machen. Seine Augen flehten Pierre an, ihm den Knebel abzunehmen. Jesús sah es und löste den Knoten. »Vater will bestimmt nicht, dass ich sterbe!«, brach es keuchend aus S hervor. »Vergewissere dich, Pierre. Er will doch nicht seinen Sohn umbringen! Mach jetzt keinen Fehler, für den er dich zur Verantwortung ziehen könnte! Bitte!« Vater? Sohn? Pierre betrachtete ihn genauer. Vielleicht hatte S den Verstand verloren. Sein Gesicht sah nach Butter aus, die in der Sonne gestanden hatte. Er hob die Waffe und gab drei Schüsse ab. Jesús hatte sich abgewandt. Er wollte nicht zusehen, wie ein Mensch exekutiert wurde. Vater. Sohn. Er hatte sich auf der richtigen Spur befunden. Und doch war alles vergebens gewesen. Nun kam er an die Reihe. Ruben wusste weder ein noch aus. Die innere Stimme mahnte erneut: Spiel nicht den Helden, du bist Brand-, nicht Verbrechensbekämpfer. Doch statt eines Schlauchs hielt er eine Maschinenpistole in der Hand. Und wenige Meter entfernt brauchte vielleicht jemand Hilfe. Ruben lauschte. In der Wohnung herrschte Stille. Totenstille? Pierre steckte ein neues Magazin in seine MP. Nun kam der schöne Teil namens Mirandor. Wie hatte Mikki ihn getauft – den Herrn der schwarzen Katze? Pierre neigte nicht zum Aberglauben, doch eins musste man Mikki lassen: Eine solche Scheiße wie die mit Mirandor hatten sie noch nicht erlebt. Da hätte man glatt an die Macht schwarzer Katzen glauben können. Jetzt allerdings vermochte nicht mal mehr der Teufel persönlich, Mirandor zu helfen. Pierre hob gemächlich den Lauf seiner MP an. Er wollte den Moment genießen. Er wollte Angst sehen. Ruben spähte durch den Türspalt. Ein Mann stand im Türrahmen zwischen zwei Räumen, die Maschinenpistole schussbereit gegen das Schlüsselbein gedrückt. Auf wen er zielte, war nicht zu erkennen. Ruben zitterten die Knie. Er wollte nur noch weg. »Und tschüss«, sagte Pierre mit breitem Grinsen. Er bog den Finger um den Abzug. Ein Schuss peitschte auf. 6:23 Uhr. Mit einem Mal zog es Iwan die Beine unter den Füßen weg. Sein Körper brannte wie von tausend Nägeln durchlöchert. Er wusste sofort Bescheid: Eine Ladung Schrot hatte ihn von der Seite getroffen. Aber wer verschoss hier Schrotpatronen? In einem schräg gegenüberliegenden Einfamilienhaus senkte sich eine schmucke Gardine. Gleichzeitig zogen sich Mundwinkel hoch. Der SEK-Mann Bermudo war nicht der einzige, der gern mal auf einen Menschen zielte, wenn er keine Konsequenzen fürchten musste. Das Jagdgewehr verschwand wieder im ordnungsgemäß gesicherten Waffenschrank. Eigentlich war gar nichts passiert. Ein Schuss mehr oder weniger, was spielte das in diesem Chaos für eine Rolle? 6:24 Uhr. Ruben lehnte, zur Salzsäule erstarrt, gegen den Türrahmen. Er begriff nicht, was geschehen war. Auch Pierre begriff nicht. Im Fallen warf er einen verwunderten Blick zur Seite, ob da irgendwo eine schwarze Katze hockte. Es blieb ihm keine Zeit mehr, sie zu verwünschen. Bevor er auf dem Boden aufschlug, war er tot. Die Erkenntnis, dass er einen Menschen umgebracht hatte, durchzuckte Ruben wie ein Stromschlag. Fassungslos ließ er die Waffe fallen und rutschte den Türrahmen hinunter. Aus dem anderen Raum trat ein Mann und betrachtete ihn. Der Mann näherte sich, kniete nieder und legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Es gab keine Alternative. Wenn du nicht so mutig gehandelt hättest, wäre ich jetzt tot. Er hätte mich kaltblütig abgeknallt.« Langsam fasste sich Ruben und berichtete, wie es ihn hierhin verschlagen hatte. »Wir müssen von hier weg. Ich bin übrigens Jesús Mirandor.« »Ruben Brossa.« »Danke, Ruben.« Sie stiegen die Treppe hinab, Ruben mit der MP voran. In der dritten Etage blieb Ruben stehen. »Ich muss meine Leute befreien, die sind da hinten eingesperrt«, flüsterte er Jesús zu. »Wir werden uns irgendwo verstecken. Kommst du mit?« Jesús schüttelte den Kopf. »Ich hoffe, wir sehen uns wieder, Ruben. Wir müssen noch miteinander anstoßen.« »Dann bis später.« Ruben verschwand in der Dunkelheit des Flurs. Jesús bewegte sich langsam Etage für Etage hinab, ohne jemandem zu begegnen. Vom Treppenabsatz auf halber Höhe zwischen erstem Stock und Erdgeschoss konnte er das Foyer überblicken. Durch die große Glasfront drang rauchig graues Dämmerlicht. Zehn Meter von ihm entfernt lagen zwei der Gangster hinter einer Empfangstheke und zielten mit ihren MPs auf den Eingang. Sonst war niemand auszumachen. Jesús überlegte, ob er sich Rubens Maschinenpistole holen und die beiden Gangster von hinten angreifen sollte. Noch vor einer Woche wäre er vor dem Gewaltausbruch erschrocken zurückgewichen. Noch vor einem Tag war es lediglich ein Gefühl gewesen, wie Berger aus Hair in den Krieg ziehen zu müssen. Und nun steckte er buchstäblich mittendrin. Und überlegte, ob er mitmischen sollte, um Carlos zu rächen. Plötzlich zersplitterte die Glasfront in tausend Teile. Ohrenbetäubender Lärm setzte ein. Ein Feuerstoß nach dem anderen durchpflügte den weitläufigen Eingangsbereich und schlug Krater in die Marmorwände. Auch auf die Empfangstheke ging ein Kugelhagel nieder. Noch stand Jesús außerhalb der Schusslinie, aber bestimmt nicht mehr lange. Er trat den Rückweg an. Im ersten Stock angelangt, hörte er von oben Getrampel. Es näherte sich. Wohin jetzt? Er sah sich hastig um. Die Wohnungstüren waren samt und sonders zugezogen. Er musste wieder hinunter. Aber weiter als bis zum letzten Treppenabsatz ging es nicht, auf das Foyer prasselten von allen Seiten Kugeln ein. Und das Getrampel kam näher. Er saß in der Falle. »Weiß jemand, ob Pierre mit Mirandor fertig ist?«, fragte Nikita, während sie die Treppen hinunter rannten. Seine Leute hielten kurz inne, sahen sich an und schüttelten den Kopf. »Muss man sich denn um alles selber kümmern?« Nikita rief Pierre übers Funkgerät, erhielt jedoch keine Antwort. »Ich sehe nach. Ihr stoßt zu den anderen und haltet die Stellung.« Jesús ließ fieberhaft den Blick kreisen. Nicht mal eine Maus hätte hier ein Versteck gefunden. Vor Verzweiflung krallte sich sein Blick förmlich in der Wand fest. Da bemerkte er die Fuge. Eine kleine Fuge in der Marmortäfelung, gut einen Meter über dem Boden. Er sah genauer hin und erkannte, dass es sich um einen Türspalt handelte. Kaum hatte er die kleine, mit marmorierter Folie kaschierte Holztür aufgebracht, wurde sie ihm wieder aus der Hand gerissen. Eine Kugel war eingeschlagen. Jesús sah auf seine blutige, mit Holzsplittern übersäte Hand. Dafür hatte er jetzt keine Zeit. Er zerrte die Decken und Kissen aus dem Wandschrank und schleuderte sie ins Foyer. Das Getrampel rückte unaufhaltsam näher. Er hievte sich in die kleine Öffnung. Oh Gott, er passte da nicht rein. ICH MUSS, ZUM TEUFEL NOCH MAL! Er quetschte seinen Körper zusammen und presste sich hinein. Aber jetzt bekam er die Tür nicht mehr zu fassen. Die anrückenden Männer mussten jede Sekunde eintreffen. Und die Tür stand sperrangelweit offen. Die Todesangst trieb Jesús den Schweiß aus den Poren. Er wollte gerade die Augen schließen, da ertönte ein ohrenbetäubender Knall. Gleichzeitig überkam ihn sargschwarze Dunkelheit. Er hatte doch noch nicht sterben wollen. 6:30 Uhr. Ruben Brossa lebte noch. Er hatte seine Männer befreit und war in den Flur vorausgegangen, um die Lage zu checken, als das Getrampel einsetzte. Er kapierte sofort, dass ihm keine Zeit für ein Versteck blieb. Er warf sich auf die andere Flurseite, wo ihn die Männer im Rücken hatten. Sie rannten, ohne sich umzublicken, an ihm vorbei die Treppe hinunter. Es verging einige Zeit, bis Ruben wagte, sich aufzurichten. In seinem Kopf rauschte das Blut. Vielleicht hörte er deshalb den Nachzügler nicht. Nikita rannte auch nicht. Er überlegte fassungslos, wie um alles in der Welt Mirandor es geschafft hatte, Pierre zu eliminieren. Und wo er jetzt stecken mochte. Angstschweiß lief über seine Stirn. Nicht um sich sorgte er sich, er war bloß Mittel zum Zweck. Seine Sorge galt einzig dem Salvator und der gerechten Sache. Plötzlich hörte er ein Geräusch. Er richtete seine MP auf und tastete sich vor. Als Ruben den Mann endlich bemerkte, starrte er ihn nur verwundert an. Nicht so sehr dessen Auftauchen verwunderte ihn, sondern die Erkenntnis, wie dünn das Blatt war, welches das Leben vom Tode trennt. Wie löchrig. Ruben erhob weder die Waffe noch die Hände. Er starrte wie paralysiert auf den Zeigefinger des Mannes, der sich um den Abzug krümmte. Jetzt dachte er endlich wieder an seine Tochter. Wäre er nicht in den fünften Stock gestiegen, hätte er längst ein sicheres Versteck gefunden. Jesús Mirandor hatte er gerettet. Und an Elvira hatte er nicht gedacht. Er sah sie vor sich, sah sie zu ihm hochblicken, das zarte Gesichtchen ängstlich verzerrt. Er hatte ihr doch versprochen, wieder zu Hause zu sein, wenn sie wach wurde. Die Treppenhausbeleuchtung erlosch. Obwohl sich die Schatten im Dämmerlicht deutlich abzeichneten, tastete der Mann nach dem Lichtschalter. Warum schoss er nicht einfach? Ruben verstand es nicht. Noch weniger verstand er, warum der Mann plötzlich zu zappeln anfing wie ein Fisch an der Angel. Aber zumindest verstand er, was er nun zu tun hatte. Er schoss dem Mann mit einem Feuerstoß die Beine unterm Hintern weg. Anschließend betrachtete er den Lichtschalter, aus dem ein loses Kabel hing. Er legte einen geistigen Vermerk an, die Gefahrenquelle zu melden. 7:59 Uhr. Enric Detás stand im Foyer vor seinem am Boden liegenden Freund. Roque hatte ihm einmal das Leben gerettet und seitdem wünschte er sich eine Gelegenheit herbei, es ihm zu vergelten. Heute hätte Roque Hilfe gebraucht, aber er hatte nichts für ihn tun können. »Wie sieht es aus?«, fragte er den über Roque gebeugten Notarzt. Der Arzt antwortete mit einem Schulterzucken, während er eine Infusion legte. »Fünfzigfünfzig – wenn er zäh ist.« Enric kniete nieder. »Komm schon, alter Junge, du schaffst das!« Er musste es einfach schaffen. Wie sollte Enric seinem Sohn erklären, dass sein Patenonkel tot war? Der Junge würde es nicht verstehen – und Enric ebenso wenig. Wie konnte ein vor Lebendigkeit triefender Mensch von einer Sekunde zur anderen zu Nichts erstarren? Er streichelte Roque über den Kopf. »Lass mich nicht im Stich, mein Freund.« Er stand auf und winkte den Einsatzleiter der Polizei zu sich. »Mindestens zwei der Gangster konnten fliehen. Wie weitläufig haben Sie das Viertel abgesperrt?« Der Polizist zeigte es ihm auf seiner Karte. »Ihre Leute tragen Schutzwesten? Sie müssen mit größter Vorsicht agieren. Die Flüchtenden sind mit Maschinenpistolen bewaffnet und werden mit äußerster Brutalität vorgehen, um den Riegel zu durchbrechen, Geiselnahme eingeschlossen.« »Meine Leute fahren bereits durch die Straßen und fordern die Anwohner auf, im Haus zu bleiben und alle Türen abzusperren.« »Wir müssen das Haus durchkämmen. Können Sie mir zehn Männer dafür zur Verfügung stellen? Aber keine Grünschnäbel.« Mit einem Mal bemerkte Detás eine Bewegung im Hintergrund. Er stieß den Polizisten aus der Gefahrenzone und ging hinter der Treppe in Deckung. Von hier aus erkannte er einen Spalt in der Marmortäfelung. Eine kleine Tür. Er gab einen Schuss ab, der direkt daneben einschlug. Es tat sich nichts. Er schoss erneut, dann brüllte er: »Police! Come out!« Jesús drückte die Tür ganz auf. Erst als ihm der Schweiß auf die Nase getropft war, hatte er begriffen, woher der Knall rührte, den er für einen Schuss gehalten hatte: Jemand hatte im Vorbeilaufen die offenstehende Tür zugeworfen. »Nicht schießen, ich bin ein Opfer«, antwortete er. »Ich bin Jesús Mirandor.« Detás erinnerte sich, den Namen gehört zu haben. Laut Pintaluba handelte es sich um einen der Geiselnehmer. Doch der Oberst hatte sich als mordsgemeiner Lügner entpuppt. Detás befahl dem Mann, aus dem Wandschrank zu kommen. »Sobald ich Ihre Hände nicht mehr sehe, schieße ich, klar?« 8:04 Uhr. Kuhlmann saß auf den Stufen, die zum Foyer hoch führten, und biss die Zähne zusammen. Er hatte sich eine Kugel eingefangen, einen Steckschuss im Oberschenkel. Nichts Wildes, Hauptsache, seine Eier waren heil geblieben. Ein Sanitäter verband die Wunde und er tat es nicht besonders zartfühlend. Wenn es die Sache beschleunigte, sollte es Kuhlmann recht sein. Er wollte schnellstmöglich weg, es gab hier nichts mehr für ihn zu tun. Mirandor war tot, soviel stand mal fest. Er hätte sich nur umzudrehen brauchen, um den Toten im Foyer stehen zu sehen. Dort beantwortete Jesús gerade Detás’ Fragen. »Erkundigen Sie sich bei Leutnant Gorpón von der Guardia in Granada«, beendete er seinen Bericht, »der kennt die Wahrheit.« Detás rief den Kameraden sofort an. Gorpón bestätigte die Aussage und bat ihn, Mirandor an einen sicheren Ort zu verbringen. Detás legte auf und überlegte, wie er die Sache deichseln sollte. Am besten, er nahm ihn fest und ließ ihn wegschaffen, bevor andere hier die Kontrolle übernahmen. Zuvor musste Mirandor jedoch wegen der Holzsplittern in der Hand behandelt werden. Detás beauftragte einen jungen Polizisten, ihn zu einem der Krankenwagen zu führen und anschließend zurückzubringen. Kuhlmann erhob sich gerade, als er einen Uniformierten durch die zersplitterte Glastür treten sah. Nur nicht in Fragen verwickelt werden. Er wandte sich ab und humpelte die Stufen hinunter. Hinter sich hörte er jemanden sprechen, zu leise, um ihn zu verstehen. Aber ein Wort stach aus dem Gemurmel hervor: Mirandor. Kuhlmann hielt inne. Zögernd drehte er sich um. Nein, bei dem Kahlkopf, mit dem der Uniformierte offenbar geredet hatte, handelte es sich definitiv nicht um Mirandor. Die beiden gingen an ihm vorbei. »Wir müssen hier lang, Herr Mirandor.« Wie jetzt? Kuhlmann humpelte vorwärts und stellte sich den beiden in den Weg. Ohne dem Protest des Polizisten Beachtung zu schenken, betrachtete er das Gesicht des Kahlkopfes. Doch, ja. Wenn man sich Haare hinzudachte und dem apathischen Gesicht gedanklich ein bisschen Leben einhauchte, passte es einigermaßen. Kuhlmann konnte es kaum glauben. Ausgerechnet derjenige, wegen dem das ganze Blutbad veranstaltet worden war, spazierte aufrecht ins Freie? Ruppig stieß er den milchgesichtigen Polizisten, der an ihm vorbei wollte, zurück. »Policía Nacional!« Er zückte seinen Dienstausweis. »Der Mann gehört mir.« Der Polizist deutete missmutig auf die blutige Hand. »Ich soll ihn zum Krankenwagen bringen.« »Sie sollen keinen Ärger machen, sonst gar nichts!«, schnauzte er das Milchgesicht an. »Ich kümmere mich um alles Weitere.« Er hielt ihm den druckfrischen Haftbefehl hin. »Also komm mir nicht in die Quere, Kleiner. Sonst krieg ich dich wegen Vereitelung einer Festnahme dran und davon erholst du dich bis zur Rente nicht mehr.« Ehe der verdutzte Polizist etwas sagen konnte, schnappte Kuhlmann sich Mirandor und schob ihn zu seinem Wagen. Der Kollege, mit dem er aus Madrid gekommen war, stand hundert Meter entfernt, in ein Gespräch mit aufgeregten Anwohnern verwickelt. Kuhlmann stopfte Mirandor ins Auto und fuhr davon. ERMITTLUNG & ERPRESSUNG | D-FRANKFURT/MAIN Bis Mittwochmittag streifte Markus auf der Suche nach Anna durch Cambrils, dann sah er ein, dass er hier auf verlorenem Posten stand und jagte die fünfzehnhundert Kilometer nach Frankfurt zurück. Gegen drei Uhr nachts kam er an. Er sank aufs Bett und schlief ein, bevor er die Matratze erreichte. Gegen sieben spülte ihn die nächste Adrenalinwelle wieder aus dem Bett. Nachdem er sich mit Koffein auf Vordermann gebracht hatte, startete er den Rechner, rief Word auf und legte eine Datei mit Annas kryptischen Andeutungen an. Bislang sah er lediglich in einem Punkt klar: Bei dem Deal ging es nicht einfach um die Beschaffung neuer Papiere. Seine Frage, ob sie eine neue Identität verpasst bekäme, hatte sie mit einem seltsamen Lachen bejaht, und die von ihr zu erbringende Gegenleistung in diesem »Tauschgeschäft« hätte zur Folge, dass man diese Anna Heydt nie wieder sähe. Er konnte sich keinen Reim darauf machen. Also musste er woanders ansetzen, am besten bei der Identität des Unbekannten. Wozu er die Passagierlisten der Flughäfen Reus und Barcelona brauchte. Wenn Anna auf einer auftauchte, konnte ihr Begleiter nicht weit sein. Nur würde es dauern, an die Daten zu gelangen. Vielleicht konnte Kuhlmann sie auf die Schnelle besorgen. »Dafür brauche ich eine förmliche Anfrage«, stellte sich Kuhlmann quer. »Sie müssen schon den Dienstweg einhalten.« Die Phase des Duzens war offenbar vorbei. »Kommen Sie schon, letztlich stehen wir auf derselben Seite. Sie würden helfen, Kriminellen einen Strich durch die Rechnung zu machen.« Kuhlmann schickte ein paar zerknautschte Worte durch die Leitung, die nicht entfernt nach Zustimmung klangen. »Ich bitte Sie darum! Mein Gott, warum machen Sie plötzlich auf hyperkorrekt, sonst …« »Sonst – was? Wollen Sie mir was unterstellen?« »Geben Sie sich einen Stoß, so schlecht haben wir doch gar nicht zusammengearbeitet. Apropos: Was ist eigentlich mit Mirandor?« »Hat sich in Salou verborgen gehalten, im Schlepptau einige Gangster, die ihm ans Leder wollten.« »Sehen Sie, hinter der Geschichte steckt viel mehr, als zunächst zu vermuten war! Wie ist die Sache …?« »Na gut, ich denke über die Passagierlisten nach. Und nun muss ich los. Sie hören von mir.« Markus packte seine Unterlagen zusammen und ließ sein unter der hohen Flurdecke hängendes Rad herunter. Auf den Weg ins Präsidium überlegte er, ob Anastasia wohl im Büro säße. Sie war nach ihrem Auftritt im Restaurant spurlos verschwunden, und er hatte sich die Finger nach einem Lebenszeichen wund gewählt. Schließlich hatte sie ihm eine SMS geschrieben: Bitte lass mich, ich brauche Ruhe. Der rachsüchtige Zorn war offenbar trauriger Enttäuschung gewichen. »Setzen Sie sich.« Unsicher, was sie hier sollte, nahm Anastasia auf der äußersten Kante des Stuhls Platz. »Sie wissen natürlich längst, was für ein Drecksack Ihr Kollege ist. Dass er seinen Schwengel nicht bloß in Ihr Honigtöpfchen steckt.« Im ersten Moment raubte die widerwärtige Wortwahl ihr den Atem, im zweiten erstarrte sie. Woher wusste er davon? »Ich verstehe nicht.« »Doch, doch, Sie verstehen genau. Dies ist übrigens kein unbeholfener Versuch, Ihnen etwas zu entlocken.« Er legte ein frostiges Lächeln auf. »Ich werde es Ihnen gleich beweisen.« Das Lächeln verschwand. »Zurück zu Engel. Der Mann ist ein Stück Scheiße, das einem an den Hacken klebt. Vergessen Sie ihn.« Anastasia wusste nicht, was sie denken sollte. Ihre Gefühle für Markus hatten sich zwar in Hass verkehrt, aber es war ein zarter Hass – von der Liebe nur durch den Strom der Enttäuschung getrennt. Manchmal, wenn der Strom abschwoll, konnte sie das andere Ufer noch sehen, und wenn Markus eine Brücke bauen würde, wer weiß. Aber er empfand bestenfalls noch Mitleid für sie, da gab sie sich keinen Illusionen hin. Als sie die Turteltauben im Restaurant gesehen hatte, war sie von einem abgekarteten Spiel ausgegangen. Sie wäre fähig gewesen, die beiden zu töten. Jetzt nicht mehr, zumindest nicht Markus. Was immer Heydt nach Cambrils geführt hatte – Markus hatte es nicht eingefädelt. Schlichtweg undenkbar. Von ihm aus betrachtet, war das Schicksal einfach seinen Weg gegangen. Sie hatte ja von Anfang an ein schlechtes Gefühl gehabt, wenn er von Heydt sprach. »Wirklich, Sie sollten sich freuen, ihn los zu sein. Sonst hätte er Sie vielleicht auch noch umgebracht. Der Mann ist ein Totschläger, glauben Sie mir. Sie wären nicht sein erstes Opfer.« Markus ein Totschläger? Das ging dann doch zu weit. »Seine Frau ist an Aids gestorben, hat er Ihnen das erzählt? Nein? Zum Glück haben Sie ein Verhüterli beim Vögeln benutzt. Schauen Sie nicht so entgeistert, ich sagte doch, ich bin im Bilde. Die eigentlich interessante Frage ist, von wem die Initiative ausgegangen ist, sein Ding zu verpacken.« Sollte das heißen, Markus sei HIV-positiv? Sie schauderte bei dem Gedanken. Beim ersten Mal, in Toledo, war kein Kondom zur Hand gewesen. Markus hatte zwar gefragt, ob sie verhüte, aber nichts von einer Ansteckungsgefahr gesagt. Hatte sie statt eines Kindes Aids von ihm bekommen? Die Vorstellung flößte ihr Angst ein, die wie Gift versickerte. »Sagen Sie nichts, Ihr Gesicht spricht Bände. Besser, Sie sehen den Tatsachen ins Auge: Engel ist ein verkommenes Subjekt. Er muss gestoppt werden, bevor er weiteres Unheil anrichtet. Es ist unsere verdammte Pflicht. Vor allem die Ihre, denn Sie haben die besten Möglichkeiten.« »Ich …« Anastasia war, als zersetze das Gift bereits ihr Hirn. »Ich habe keine Möglichkeiten, weil: meine Versetzung ist schon beantragt.« »Papperlapapp. Noch sind Sie ja wohl nicht versetzt.« »Nein, nein, Sie lassen mich gefälligst aus dem Spiel, sonst …« Aus dem Notebook, das von ihr abgewandt auf dem Schreibtisch stand, drangen seltsame Geräusche. Während sie den Mann fragend ansah, drehte er den Rechner zu ihr hin. Anastasia erblickte ein Schwimmbecken, vor dem zwei Palmen standen. Etwas tat sich verschwommen am Beckenrand. Die Kamera zoomte heran. Jetzt sah man genau, was da passierte: Ein Mund stülpte sich über ein Glied. Nun zoomte die Kamera ein Stück zurück – und enthüllte, zu wem Mund und Glied gehörten. »Das ist nur der Anfang. Das ganze Video hat eine Länge von knapp fünfzehn Minuten. Ich weiß, Sie haben länger durchgehalten, aber ich denke, es reicht auch so.« »Das ist ja nichts Verbotenes«, antwortete sie hilflos, von der Scham über die Entblößung und der Angst vor den Konsequenzen vollständig blockiert. »Nein, überhaupt nicht. Manche werden Sie sogar feiern – als Frankfurts Pornopolizistin. Wenn Sie Ihren Blick nach oben richten, sehen Sie, wo das Video läuft. Deep Tube sagt Ihnen was, richtig? Es ist gerade erst hochgeladen worden. Aber wenn Sie wollen, kann es sofort wieder in der Versenkung verschwinden. Zunächst möchte ich Ihr Handy. Mich interessiert der Ordner mit den Fotoaufnahmen.« Markus begab sich sofort in Degenharts Büro und berichtete vom Auftauchen der Beschuldigten Heydt in Spanien. Zu seinem Verdruss erfuhr er, dass Strecker bereits aus dem Urlaub zurückgekehrt war, womit er den Haftbefehl, den er brauchte, um mit allen verfügbaren Kräften nach Anna zu suchen, fast schon abschreiben konnte. Es sei denn … »Falls es Dr. Strecker interessiert: Ich bin gegen einen Haftbefehl. Mit Druck vertreiben wir die Beschuldigte nur.« Sein Chef nahm die Neuigkeit ungerührt zur Kenntnis und ließ Markus dabei keine Sekunde aus den Augen. Wusste er Bescheid? Eigentlich konnte Anastasia nichts erzählt haben, sie war ja offiziell in Griechenland gewesen. »Ist, ähm, Frau Papandreou schon zurück?«, tastete er sich vor. »Sie sind nicht zunächst zu ihr ins Büro gegangen?« »Ich dachte, ich müsste erst Sie informieren.« »Sie ist seit gestern wieder da.« »Ah, ja. Also, meiner Meinung nach sollten wir darauf setzen, dass sie freiwillig zurückkehrt.« »Dass Anastasia freiwillig zurückkehrt? Sie legen es drauf an, Sie loszuwerden?« »Nein, nein, ich spreche von Frau Heydt!« »Sie will weg.« »Was? Frau Heydt hat sich gemeldet?« »Ich spreche von Anastasia! Sie hat ihre Rückversetzung nach Kassel beantragt.« »Aha.« Degenharts musternden Blick auf sich, fluchte Markus still vor sich hin. Wie blöd konnte man eigentlich sein? Als wäre nicht vorherzusehen gewesen, dass Anastasia schnellstmöglich das Weite suchen würde und Degenhart Fragen stellen würde. »Sie, ähm, ja … Ich glaube, sie plagt bereits das Heimweh – also Frau Heydt. Aber das muss natürlich Dr. Strecker entscheiden.« »Und Sie interessiert gar nicht, warum Ihre Kollegin uns verlassen will?« »Ich … Ich nehme an, es liegt an mir. Ich bin eben ein Einzelgänger, wissen Sie ja selbst, und, ja, das enttäuscht sie wohl.« Degenhart drückte ihm eine Akte in die Hand. »Ihr neuer Fall. Die Einsatzbesprechung findet heute erst um halb zwölf statt, bis dahin hätte ich gern eine erste Einschätzung.« Die Phase, in der Markus sich Fälle aussuchen durfte, war offenbar beendet. Anastasia sah nur kurz auf, als er ins Büro kam. »Wir müssen reden«, teilte sie ihm knapp mit. »Gegen elf, vor der Einsatzbesprechung.« Obwohl sie sich um einen geschäftsmäßigen Ton bemühte, konnte sie die Verbitterung nicht verbergen. Wahrscheinlich war ihr nicht einmal Superman ein Trost, dessen rote Stiefel aus ihrer Handtasche ragten. Markus fühlte sich beschämt. Nicht wegen seiner Gefühle für Anna. Daran traf ihn keine Schuld, wenngleich es ihn immer noch erstaunte, wie lange er von diesen Gefühlen nichts bemerkt hatte. Manchmal stand man demjenigen, der man doch selbst war, fremder gegenüber als einem Marsmännchen. Aber versagt hatte er nicht wegen der Liebe zu Anna, sondern wegen der Liebelei mit Anastasia. Er hätte spüren müssen, dass er ihre Hoffnungen enttäuschen würde, schon bei ihrer Begeisterung für Superman. Zwar verstand er mittlerweile, dass sein Widerwille gegen den Comic-Helden von seiner Ohnmacht herrührte, die er bei Papas Tod empfunden hatte. Doch auch ohne dieses Trauma hätte er Anastasias Begeisterung für Supermans bunte Schwarz-Weiß-Welt, hier die Guten, da die Bösen, nicht geteilt. Etwas Grundsätzliches trennte sie beide. Wahrscheinlich hatte er es schon an diesem Punkt geahnt. Nur hatte er es nicht wahrhaben wollen. Darin bestand seine Schuld. Er sah es ein – und schob es beiseite. Anna hatte Vorrang. Ihm blieben, heute mitgerechnet, fünf Tage, sie zu finden, wenn ihr Geburtstag an Tag sechs tatsächlich den Stichtag markierte. Verdammt wenig Zeit angesichts des Rätsels, vor dem er stand. Noch hatte er nicht eine Antwort auf die sechs W, aus denen sich die Lösung eines Falls ergab: Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum? Nicht einmal eine Tat hatte er. Anna war das Opfer, Punkt. Er fischte eine Namensliste aus der Sakkotasche, die auf einer Beobachtung im Verlauf ihres Gesprächs beruhte: Seine Frage, ob er ihren Begleiter womöglich kenne, hatte Anna auffallend energisch verneint – beinahe so, als wollte sie ihn von dem Gedanken abbringen. Vage, aber einen Versuch wert. Er hatte daher alle männlichen Personen notiert, mit denen sie beide Kontakt gehabt hatten: Degenhart und Strecker. Triebel und Lexied. Annas Exmann und ihren Psychologen. Den Zeugen aus dem Jugendcafé. Den Hausmeister. Degenhart, Lexied und Triebel schloss er aus. Auch der Hausmeister und der junge Mann aus dem Jugendcafé kamen nicht ernsthaft als »der große Unbekannte« in Betracht. Letzterer stand aber zumindest unter dringendem Verdacht, involviert zu sein. Annas Behauptung, er habe den Jungen vom Video wiedererkannt, hatte er rundweg bestritten. Damals hatte Markus ihm statt Anna geglaubt, jetzt verhielt es sich umgekehrt. Also musste er dem Zeugen, der plötzlich keiner mehr sein wollte, gehörig auf den Zahn fühlen. Wenn er mit seiner Vermutung richtig lag, dass Annas Verschwinden und das Missbrauchsvideo zusammenhingen, kam er auf diesem Weg vielleicht einen Schritt weiter. Strecker? Gegen ihn gab es zuhauf Verdachtsmomente: Er war wie bestellt zu Annas erster Vernehmung erschienen, verhielt sich seitdem äußerst merkwürdig und hatte sich zudem während Annas Spanienaufenthalt im Urlaub befunden. Gerade deswegen strich ihn Markus vorerst von der Liste. Er agierte einfach zu auffällig. Zudem hätte sich Anna ihm nie und nimmer anvertraut. Zwei Personen verblieben: Annas Psychologe und ihr Exmann. Santer schien ihm ein zwar seltsamer Psychofritze, aber vielleicht waren seltsame Psychologen ja normale Psychologen, er kannte sich da nicht aus. Er gab Santers Daten in das digitale Fahndungssystem POLAS ein, ohne einen Treffer zu landen. Anschließend rief er im Institut an, um ihn nach seinem Alibi zu fragen. Der Chef habe einige Tage freigenommen, teilte man ihm mit. Blieb erst einmal nur Olaf Holland. Mit Annas Exmann hatte er zwar bloß ein Mal telefoniert, aber Anna wusste davon. Er fütterte POLAS mit Hollands Daten – und wurde fündig: Holland war 2005 wegen schweren Betrugs verurteilt worden und mit einer Bewährungsstrafe glimpflich davongekommen. Ein Telefonat mit dem zuständigen Staatsanwalt enthüllte den Grund: Weil Holland den Schaden, satte 500.000 Euro, die er Investoren mit der Ankündigung unglaublicher Gewinne abgeschwatzt hatte, bereits vor Prozessbeginn wiedergutgemacht hatte. Woher die Mittel stammten, wusste der Staatsanwalt nicht. Um das ergaunerte Geld konnte es sich nicht handeln, denn das hatte Holland bei Börsenspekulationen nachweislich in den Sand gesetzt. Markus rief ihn auf dem Handy an und schlug ein Treffen vor. Holland reagierte abwehrend, doch die Drohung mit einer förmlichen Vorladung brach den Widerstand. »Halb eins würde mir passen. Bei Ihnen in der Firma, Herr Holland?« »Das fehlte noch. Im Cinestar am Eschenheimer Tor gibt’s ein Café.« Markus zog sein Sakko aus und erstellte eine Liste der dringendsten Aufgaben. Zwei Stunden später rief sein Bruder an, tat er sonst nie. »Na, Tom, heute Spätschicht?« »Ich hab überhaupt keine Schicht mehr. Mich und drei andere haben sie an die Luft gesetzt. Vielleicht brauchen Flugzeuge jetzt keine Wartung mehr. Nach dem Börsenabsturz kommt es auf Flugzeugabstürze wohl nicht mehr an.« Jetzt habe er wenigstens mal Zeit für sich, fügte er sarkastisch hinzu. Markus ahnte, wie wenig Tom daran gelegen war. Vielleicht dienten die Frauengeschichten vor allem dazu, nicht zu viel Zeit für sich zu haben. »Wann wird die Kündigung wirksam?« » Hab sie nicht demütig genug hingenommen, da haben sie mich gleich von der Arbeit freigestellt.« »Brauchst du Geld?« »Nee, lass stecken. Ich brauch Beschäftigung. Wolltest du nicht dein Schlafzimmer renovieren?« Markus hatte die runtergekommene Altbauwohnung nach Ursulas Tod gekauft und nicht zuletzt mit Toms Hilfe Stück für Stück in altem Glanz erstrahlen lassen. »Später mal.« »Können wir uns dann wenigstens auf ein Bier treffen?« »Um acht, im Textor in Sachsenhausen.« Kaum hatte er aufgelegt, erhob sich Anastasia. »Gehen wir.« Sie stierte vor sich hin, als könnte sie sich die Pest holen, wenn sie ihn ansähe. Wortlos verließen sie das Präsidium und gingen die Eschenheimer Landstraße hoch. »Es tut mir sehr leid. Ich …« »Es muss dir nicht leidtun. Ich hatte selbst meine Zweifel, ob das mit dir das Richtige ist. Du bist ein netter Kerl, nur stehe ich eigentlich nicht auf kleine Männer.« Patsch! »Was hast du Degenhart erzählt?« »Nichts.« »Wollte er nicht wissen, warum du weg willst?« »Private Gründe, mehr hab ich nicht gesagt. Keine Sorge, ich erzähl nichts von deinem Liebchen. Es bleibt beim Griechenlandurlaub.« »Danke.« Was für ein dummes Arschloch! Als würde sie ihm zuliebe die Klappe halten. Sie wollte nicht in seine krummen Touren hineingezogen werden, das war alles. »Zum Dank hätte ich gern eine ehrliche Auskunft. Mir setzt nämlich was ganz anderes zu. Beim ersten Mal haben wir kein Kondom benutzt. Du hattest ja keins.« Er hatte auch nicht die geringste Ahnung gehabt, dass er eins brauchen würde. »Wegen mir musst du dich nicht sorgen.« »Nein? Demnach hast du in letzter Zeit einen Aidstest gemacht?« »Und du?« »Lenk nicht ab.« »Meine Frau ist an Aids gestorben und da habe ich …« »Damit rückst du ja früh raus!« Er überhörte die Schärfe in ihrer Stimme, schließlich war, was da an Aggression hervortrat, auf seinem Mist gewachsen. »Als der Virus bei ihr diagnostiziert wurde, habe ich einen Test gemacht und nach ihrem Tod noch einen, beide negativ. Seitdem hatte ich bis zu dir keinen Geschlechtsverkehr, wenn du es unbedingt wissen musst.« »Du kannst mir viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Ich will den Test sehen.« Was war los mir ihr? Hinter ihrer Aggression nahm Markus noch was anderes, seltsam Verdruckstes wahr. »Der Test müsste sich in meiner Personalakte befinden«, antwortete er betont ruhig. »Unsinn, da ist kein Aidstest!« »Woher …? Jetzt sag nicht, du hast dir Einblick in meine Akte verschafft. Ich glaub’s nicht.« »Jedenfalls ist da kein Aidstest.« Demnach hatte sein Chef einen Aktenvermerk unterlassen? So viel Zartgefühl hätte Markus ihm gar nicht zugetraut. »Außerdem wäre das kein Beweis, dass du immer noch sauber bist.« »Dass ich sauber bin?« »Wenn sich einer mit Frauen einlässt, die auf anal …« »Jetzt reicht’s, Anastasia.« »Von wegen. Du machst einen Aidstest, und zwar zügig!« »Ich …« Er brach ab und ging davon. Wenn sie unbedingt einen Aidstest brauchte, sollte sie ihn bekommen, kein Problem. Auf dem Schreibtisch fand er ein Fax von Kuhlmann vor: Anna Heydt sei bislang auf keiner Passagierliste der ins Auge gefassten Flughäfen registriert. Enttäuscht schob er sich einen Riegel Schokolade in den Mund. Unter dem Vermerk waren die Ankünfte und Abflüge privater Maschinen aufgelistet. Da hatte sich Kuhlmann ja richtig Mühe gegeben hatte. Der Ansatz war auch nicht uninteressant, wenngleich Angaben fehlten, wo die Maschinen jeweils gestartet oder gelandet waren, was den Nutzen einschränkte. Die Reus-Liste umfasste überschaubare sieben Maschinen. Zumindest diese Spur würde er verfolgen. Er beschaffte sich die Flugzeughalterdaten bei der in Frankreich ansässigen Internationalen Zivilluftfahrtorganisation, doch keiner der Halternamen sagte ihm etwas. Eines der Flugzeuge gehörte einer österreichischen Eignergesellschaft, deren vorrangiger Zweck laut ihrer Homepage darin bestand, den wahren Eigentümer vor Zugriffen von Gläubigern zu schützen. Eine Art Pleitesicherung – und ebenso gut ein »Sichtschutz« für zwielichtiges Gesindel, das verbergen wollte, über welche Logistik es verfügte. Konnte sein oder auch nicht. Und es rauszufinden würde ewig dauern. Er sah auf die Uhr. Die Einsatzbesprechung stand an. Auf dem Weg zum Besprechungsraum klingelte sein Handy. Kuhlmann. »Ich hab noch ein paar Infos zum Fall Mirandor, die möglicherweise mit dem Kinderschänderring zu tun haben. Mirandor hatte zeitweise einen seiner Verfolger in seiner Gewalt. Ich faxe dir gleich ein Bild von dem Mann, genauer gesagt der Leiche.« »Hat ihn etwa auch Mirandor umgebracht?« »Spar dir den Sarkasmus. Der Mann wurde von seinen eigenen Leuten getötet.« Kuhlmann berichtete von der Schießerei in Salou. »Ein Deutscher, blond, dünn, schätzungsweise Anfang dreißig. Möglicherweise Neurologe oder so was. Wurde von seinen Leuten ›S‹ genannt.« »Wie der Buchtstabe? Oder ›Es‹ wie das Personalpronomen?« »Bin kein Germanist. Jedenfalls ist die Organisation, die Mirandor damals nach Deutschland verschleppt hat, möglicherweise wirklich noch aktiv.« »Danke für den Hinweis. Was ist jetzt eigentlich mit Mirandor?« »Nix is mit ihm.« »Wo befindet er sich denn?« »Muss Sie nicht interessieren.« »Mirandor ist mein Zeuge.« »Er wurde in Polizeigewahrsam genommen.« »Und? Was passiert mit ihm?« »Nichts.« »Was heißt das?« »Es klingelt auf der anderen Leitung, mein Chef.« Und wieder endete ein Gespräch mit Kuhlmann abrupt. Langsam begann Markus, sich Sorgen um Mirandor zu machen. Er ging zum Faxgerät auf dem Flur und wartete auf das Foto. »Engel!« Streckers kalte, schneidende Stimme. »Unterstehen Sie sich, uns noch länger warten zu lassen.« Markus ging, ohne ihn eines Blickes zu würdigen, ins Besprechungszimmer, wo er sich einer Front ungeduldiger Gesichter gegenübersah. Nach der Besprechung passte Markus Degenhart auf dem Flur ab und fragte, ob er Strecker über die Neuigkeiten im Fall Heydt informiert hatte. »Natürlich. Einschließlich des Umstandes, dass Sie plötzlich gegen einen Haftbefehl sind.« Degenhart klang müde. »Obwohl mir das schleierhaft ist – wie so manches hier in letzter Zeit.« »Und wie hat Strecker reagiert?« »Er schien weniger überrascht als ich. Entschuldigen Sie mich, der Staatsanwalt will mich noch unter vier Augen sprechen.« Seinem Gesichtsausdruck nach freute er sich nur mäßig auf die Begegnung. Markus ging zum Faxgerät, fand das Foto jedoch nicht. Später, er musste los. Er fuhr mit dem Rad ins Westend, wo er einen Abstecher in die Parkstraße machte. Viele der in Ehren gealterten Häuser schmeichelten sich mit ansehnlichen Fassaden, doch einige Bombentrichter, die der Krieg hinterlassen hatte, waren weniger ambitioniert gefüllt worden. Im Erdgeschoss eines solchen Gebäudes wohnte Santer, Annas Psychologe. Die Jalousien waren heruntergelassen. Markus klingelte mehrmals, ohne ein Lebenszeichen zu ernten. Auch auf der rückwärtigen Seite des Hauses, zu der man durch eine Unterführung gelangte, versperrten Jalousien die Sicht nach innen. Er fuhr weiter. Holland, ein großer Blonder, erwartete ihn bereits vor dem Eingang des großen Kinokastens. »Gehen wir rein und bringen es hinter uns. Ich habe nicht viel Zeit, im Büro wartet Arbeit. Ich weiß ohnehin nicht, was ich Erhellendes zu Frau Heydt beitragen könnte.« »Sie nennen Sie Frau Heydt?« »Ich nenne sie gar nicht. Sie spielt in meinem Leben keine Rolle mehr.« Sie nahmen im Café Platz. »Ihre geschiedene Frau scheint ein Reizthema für Sie zu sein. Weshalb?« »Sind Sie im Nebenberuf Therapeut?« »Vielleicht liegt es am Altersunterschied?« »Was tut das zur Sache?« Nichts. Er fragte in der Hoffnung, den Mann aus der Reserve zu locken, aufgebrachte Leute sagten schnell mal was Unüberlegtes. Ohne einen konkreten Verdacht oder wenigstens eine Vermutung konnte er nur in der trüben Suppe rühren und schauen, was passiert. »Ich vernehme Sie als Zeugen, das nehmen Sie einfach zur Kenntnis. Und wenn ich es für sachdienlich erachte herauszufinden, ob Sie eine bemerkenswerte Vorliebe für jüngere Frauen haben, dann antworten Sie.« Er spulte die Zeugenbelehrung ab. »Wie alt sind Sie also?« Holland sah ihn belustigt an. »Dann versuchen Sie mal … herauszufinden. Ich bin vierundfünfzig.« »Wie alt ist Ihre jetzige Frau?« »Zweiunddreißig. Was sagen Sie als Fachmann: Ist das Kindesmissbrauch?« »Wie lange waren Sie mit Frau Heydt verheiratet?« »Knapp zwei Jahre.« »Haben Sie sie seit der Scheidung gesehen?« »Nein.« »Hatten Sie sonst wie Kontakt? Telefon, Mail?« »Gott bewahre.« »Was haben Sie gegen Ihre Exfrau?« »Fragen Sie mich nach Tatsachen, nicht nach Gefühlen.« Holland sah auf die Uhr. »Ich weiß ja nicht, ob Sie noch richtige Fragen haben. Jedenfalls werde ich in genau siebzehn Minuten gehen – ein wichtiger Kundentermin.« »Ich dachte, Sie müssen ins Büro.« »In Ihrer Dienststube kann man keine Kunden empfangen? Glauben Sie mir, mein Büro ist dafür groß genug.« »Wo arbeiten Sie?« »Was Sie so alles interessiert. MedTecMedia.« »Und wie schreibt sich das?« »Wie man’s spricht.« »Was ist das für eine Firma? Und was ist da Ihre Aufgabe?« »Wir entwickeln medizinisches Equipment. Ich bin Head of R&D.« »Beeindruckend, und jetzt auf Deutsch.« »Für Sie doch immer. Ich bin Leiter Forschung und Entwicklung.« »Ingenieur?« »Mediziner.« »Und im Nebenberuf Wertpapierspekulant?« »Ich dachte, Sie sind für Perversitäten zuständig. Oder bekämpfen Sie nebenbei die Wirtschaftskriminalität?« »Weiß Ihre Firma eigentlich von Ihrer Verurteilung?« »Was interessiert Sie das, verdammt noch mal?« »Noch viel mehr interessiert mich, woher Sie das Geld hatten, den Schaden wiedergutzumachen. Satte 500.000 Euro. Verdienen Sie so gut?« »Geht Sie alles nichts an!« »Oder verfügen Sie über Einnahmequellen, von denen niemand etwas weiß?« »Was erlauben Sie sich, Sie …« »Ich dachte, die Spielregeln seien geklärt: Ich frage, Sie antworten.« Mit Bedauern sah Markus einen Ruck durch Holland gehen. Er hatte sich wieder gefangen. »Wie lautet noch Ihr Name?« Holland sah auf die Visitenkarte. »Engel, hübsch. Also, Herr Engel. Hierhin bestellt haben Sie mich, weil Sie angeblich über Frau Heydt sprechen wollten. Stattdessen quetschen Sie mich aus, als sei ich hier der Verdächtige. Nun reicht es. Wenn Sie weitere Fragen haben, bitte ich um eine Vorladung. Noch etwas: Sollten Sie probieren, mir zu schaden, indem Sie mein Pech mit Aktien publik machen, werden Sie es bereuen.« Er legte einen 10-Euro-Schein auf den Tisch. »Wenn es Ihr Dienstherr erlaubt, dürfen Sie sich eingeladen fühlen.« Wie war Anna bloß an dieses Arschloch geraten? Nach einem erneuten Abstecher zu Santers Wohnung, die weiterhin kein Lebenszeichen von sich gab, fuhr Markus ins Präsidium zurück. Zu seiner Erleichterung fand er das Büro leer vor. Er rief im Jugendcafé an, bekam den Zeugen aber nicht an den Apparat. Der junge Mann befände sich im Urlaub, teilte ihm die Leiterin kurz angebunden mit. Welch ein Zufall. Und natürlich ging der Mann auch nicht ans Handy. Markus öffnete die POLAS-Datenbank, um einer weiteren Spur nachzugehen. Nicht gerade, was man eine geordnete Ermittlung nannte, aber angesichts des Zeitdrucks brachte er nicht die gewohnte Selbstbeherrschung auf. Es drängte ihn, an möglichst vielen Fäden gleichzeitig zu ziehen. Der Faden, den er jetzt verfolgte, ging auf Annas letzte Bemerkung zurück. Sie hatte Zeitungsausschnitte erwähnt, Zeitungsausschnitte von »Vermi…«. Anastasias plötzlicher Auftritt hatte den Rest abgeschnitten. Im Duden gab es nur ein paar passende Substantive: Vermietung, Verminung, Vermischung, Vermittlung – und Vermisste. Wenn Anna von Vermissten gesprochen hatte, konnte man vielleicht an dem Faden ziehen. Vorausgesetzt, die Fälle waren in Deutschland registriert und ähnelten dem Fall der Vermissten Anna Heydt. Eine verwegene Hoffnung, aber besser als nichts. Er legte folgendes Profil fest: Vermisste, die erstens der Verübung einer Straftat verdächtigt worden und zweitens kurz vor ihrem (40.) Geburtstag verschwunden und drittens womöglich (Voll)Waisen waren. Gegen halb drei kehrte Anastasia zurück, doch er bemerkte es nicht. Gebannt starrte er auf den Monitor. Zeigten die beiden Fotografien wirklich denselben Mann? Eines der Fotos hatte er in POLAS gefunden. Es datierte von 2002 und zeigte einen 39jährigen Mann namens Kurt Bohl, aufgewachsen in einem Kinderheim in Ostberlin. Ein mutmaßlicher Drogendealer, der kurz vor der geplanten Festnahme unter- und nie wieder aufgetaucht war. Das andere Foto stammte aus einem Onlineartikel auf FAZ.NET, der über den Suchdienst des Roten Kreuzes berichtete und unter anderem den Herz-Schmerz-Fall eines Mannes namens Bernd Kubik schilderte. Auch er war spurlos verschwunden. Seine ältere Schwester, die ihn aufgezogen und 1952 wegen sexueller Nötigung angezeigt hatte, meldete ihn Anfang 1962 als vermisst und bat gegen Jahresende das Rote Kreuz um eine Suchaktion, die zu nichts führte. Für sich betrachtet, gaben die Fälle nichts her. Nur: Die beiden Männer sahen sich zum Verwechseln ähnlich! Markus lud die Gesichtserkennungssoftware und führte einen Abgleich beider Gesichter durch. Ergebnis: 100 Prozent Übereinstimmung. Allerdings erfüllte das Foto von Kubik wegen der niedrigen Auflösung nicht die von der Software gestellten Anforderungen. Markus sprang zwischen dem POLAS-Eintrag und dem FAZ-Artikel hin und her. Plötzlich blieb sein Blick an einer Information hängen: Bernd Kubik war am 3. März 1923 geboren. 1923 bis 1962 ergab – 39 Lebensjahre. Er sah sich die Daten der Männer genauer an. Beide waren nur wenige Tage vor ihrem vierzigsten Geburtstag verschwunden, genau wie Anna! Und damit nicht genug der magischen Zahl: Auch der zeitliche Abstand zwischen beiden Fällen betrug rund 40 Jahre. Alles Zufall? Obwohl es eigentlich keine andere Erklärung geben konnte, setzte er die Suche fort. Was, wenn es noch einen zweiten Fall gäbe, der jedem gesunden Menschenverstand widersprach? Um kurz vor drei klingelte das Telefon, der Chef bat ihn zu sich. Wegen des Haftbefehls, hoffte Markus. Eine Hoffnung, die schnell schwand. In Degenharts Büro herrschte eine Spannung, die nichts Gutes bedeuten konnte, zumal neben Strecker auch noch Markus’ Intimfeind Frank Koetter rumlungerte. Koetter grinste ihn sinnlos an. »Na, Engel, alles fit im Schritt?« Degenhart war noch blasser als bei der Einsatzbesprechung. »Bitte setzen Sie sich«, sagte er mit belegter Stimme. Markus nahm mit dem Gefühl Platz, auf die falsche Seite zu geraten, die der Verdächtigen. »Es gibt Fotos von Ihnen«, begann Degenhart. »Von Ihnen – und der Beschuldigten Anna Heydt.« »Ich habe nämlich einen anonymen Hinweis erhalten«, erklärte Koetter mit schmierigem Grinsen. »Dem bin ich natürlich sofort nachgegangen.« Er sah zu Strecker. »War ja meine Pflicht, nicht? Wissen Sie, wo ich die Fotos gefunden habe, Engel?« Koetter machte eine Kunstpause. »Auf einer Pornowebsite.« »Zwischen mir und der Beschuldigten hat nichts Pornografisches stattgefunden«, entgegnete Markus mit gepresster Stimme. »Ein Fake.« Degenhart rieb sich die Schläfen. »Die Fotos sind anscheinend in Spanien gemacht worden. Man kann den Namen eines Restaurants erkennen.« Er sah auf einen Zettel. »Roca d’en Manel. Der Kollege hat im Netz recherchiert und es in Cambrils gefunden – wo Sie die Beschuldigte Ihrem Bericht nach getroffen haben, Markus.« »Das will ich sehen!« Es handelte sich um kein Fake. Die Bilder zeigten ihn und Anna in zärtlichen Posen. Von Porno natürlich keine Spur. Wahrscheinlich waren die Bilder auf der Sex-Site gelandet, damit sie vom Umfeld angeschmuddelt wurden. Nebensächlich, es wurde jetzt richtig eng für ihn. »Die Bilder sind nicht pornografisch«, beharrte er schwach. Strecker zeigte mit dem Finger auf Markus. »Wir sehen die schmutzigen Intimitäten eines Kriminalbeamten mit einer Kinderschänderin.« »Na, na, wir wollen doch sachlich bleiben.« Degenhart hob beschwichtigend die Arme. Strecker setzte den Angriff ungerührt fort »Statt Ihre Pflicht zu tun, machen Sie mit der Kriminellen, gegen die Sie zu ermitteln haben, gemeinsame Sache. Nun verstehen wir auch, warum Sie Herrn Degenhart gegenüber darauf gedrängt haben, keinen Haftbefehl zu beantragen.« Verdammt, der Haftbefehl. Die von ihm so clever gedachte Taktik brach ihm jetzt das Genick. Er sparte sich den Hinweis, dass er Annas Auftauchen gar nicht hätte melden müssen und dass sich Strecker selbst bisher gegen einen Haftbefehl ausgesprochen hatte. Damit konnte er nichts mehr retten. Er war erledigt. »Da fragt sich, wie lang Sie mit der Beschuldigten schon unter einer Decke stecken!« »Halt dein dreckiges Maul«, knurrte Markus den Staatsanwalt an. »Ein Lump wie Sie verbietet mir bestimmt nicht den Mund«, knurrte Strecker zurück und trat auf Degenhart zu: »Betrachtet man die unfassbar nutzlosen Ermittlungen Ihres Mitarbeiters gegen Heydt, stellt sich die Frage, ob er sie nicht laufen lassen wollte. WEIL ER SELBST MIT DRINHÄNGT!« Degenhart straffte sich. »Mäßigen Sie sich bitte, Herr Dr. Strecker!« Der Staatsanwalt dachte gar nicht daran. »Ihre Karriere bei der Polizei ist beendet, Engel. Sie Abschaum gehören nicht mehr zur Sitte, Sie sind jetzt vielmehr ein Fall für die Sitte.« Degenhart sprang auf. »Hören Sie, Dr. Strecker, ich ersuche Sie kein weiteres Mal, sachlich zu bleiben. Wenn Ihnen das nicht möglich ist, verlassen Sie bitte mein Büro.« Er wandte sich mit müder Stimme an Markus: »Sie sind natürlich vorläufig vom Dienst suspendiert. Gehen Sie bitte in Ihr Büro und ordnen Sie Ihre Unterlagen, damit wir gleich die Übergabe erledigen können.« »Engel geht keinesfalls allein an seinen Schreibtisch«, schritt Strecker ein. »Koetter soll ihn begleiten!« »Danke für Ihre Unterstützung, aber ich komme schon klar«, hielt Degenhart dagegen. »Ich werde mich selbst davon überzeugen, dass alles mit rechten Dingen zugeht.« Markus stand auf und ging in Richtung Tür. Auf Höhe des Staatsanwalts blieb er stehen und sah ihm in die Augen. Dann holte er aus und verpasste ihm eine Ohrfeige, die sich gewaschen hatte. Während Strecker sich verblüfft die Wange rieb, verließ er den Raum. Nicht aus Feigheit. Er hatte noch nie eine Prügelei begonnen, aber jetzt war er bereit dazu. Doch dann würde er die Drecksau vielleicht umbringen. »Spielen Sie Tennis?«, fragte Degenhart auf dem Flur. »Tennis?« Degenhart lächelte schmallippig. »Ich dachte nur, weil Sie die Vorhand so gekonnt durchziehen. Ich habe übrigens nichts von einer Tätlichkeit bemerkt und Koetter auch nicht, wenn ich mit ihm fertig bin.« Sie gingen schweigend den Flur entlang. Kurz vor Markus’ Büro hielt Degenhart an. »Ich begreife nicht, in was Sie sich da hineinmanövriert haben. Und damit wir uns klar verstehen: Ich toleriere es auch nicht. Andererseits glaube ich nicht, dass Sie krumme Dinger drehen. Ich werde Ihnen daher zur Seite stehen. Oder würde ich mich damit in die Nesseln setzen?« »Nein. Meine Gefühle für Frau Heydt habe ich erst in Spanien entdeckt. Was den Haftbefehl betrifft: Meiner Einschätzung nach befindet sich Frau Heydt in Gefahr. Um sie möglichst schnell aus der Schusslinie zu ziehen, war mir an einem Haftbefehl gelegen. Und da Strecker im Fall Heydt grundsätzlich das Gegenteil dessen macht, was ich vorschlage ...« »Verstehe. Der Mann wird mir immer unheimlicher. Ich werde Bodo mit dem Fall beauftragen, der schätzt Sie und wird es in Ihrem Sinne angehen. Nehmen Sie Kontakt zu ihm auf.« »Danke für Ihre Unterstützung – Stefan.« Auf dem Weg nach Hause stieß Markus so schnell und fest in die Pedale seines Rads, wie es seine Wohlstandsverfassung erlaubte. Jedes Mal, wenn er zustieß, stellte er sich vor, er träte Strecker in die Schnauze. Zu seiner Überraschung stellte sich kein Entsetzen über den Absturz des braven Polizisten Engel ein. Vielmehr fühlte er sich wie ein angezählter Boxer, der schnellstens wieder auf die Beine kommen muss. Gegen vier saß er daheim an seinem Schreibtisch, den Rechner hochgefahren. Er rief Bodo an und schilderte ihm Hollands Vernehmung. »Ein Schnösel, nicht gerade kooperativ. Sieht aus, als hätte er etwas zu verbergen. Könntest du schnellstmöglich eine Vorladung beschaffen?« Markus skizzierte, in welcher Gefahr er Anna sah und weshalb nur wenig Zeit blieb. »Aha. Merkwürdiger Fall. Okay, ich gehe das sofort an. Koetter hat natürlich schon rumposaunt, warum du suspendiert bist. Kein Problem. Aber es wäre gut, wenn du mich auf dem Laufenden hältst.« »Klar. Sag mal, hast du mitbekommen, ob irgendwo ein gefaxtes Foto aufgetaucht ist?« »Nö.« »Da ist noch etwas: Möglicherweise ist der Junge aus dem Missbrauchsvideo in einem Jugendcafé in der Nordweststadt aufgetaucht. Man sollte sein Bild an den umliegenden Schulen verteilen.« »Sorge ich für.« »Ich hab da noch eine Idee für Hollands Vernehmung.« Markus erklärte Bodo, wonach er Annas Ex fragen sollte. Soweit, so gut. Und nun würde der Gesetzeshüter Engel den geraden Pfad der Gesetze verlassen. Gewissensbisse? Für diesen Luxus fehlte ihm zurzeit die Muße. Er musste Holland abklopfen, und da er keine polizeilichen Befugnisse mehr besaß, kam er um Tricksereien nicht herum. Andere Zeiten, andere Mittel. Vor allem Hollands Vermögensverhältnisse interessierten ihn. Von wo hatte er die halbe Million für die Entschädigung seiner Opfer herbeigezaubert? Markus besorgte sich die Nummer des Finanzamtes Weinheim aus dem Netz und rief dort an. »Guten Tag, mein Name ist Olaf Holland« stellte er sich vor. »Ich habe gerade bemerkt, dass in meinen Unterlagen der Steuerbescheid für das vorletzte Jahr fehlt. Und den bräuchte ich dringend. Was muss ich denn tun, um eine Kopie zu bekommen?« »Bitte sagen.« »Und dann?« »Schicke ich Ihnen die Kopie.« »Bitte.« »Gern. Wir vom Finanzamt sind gar nicht so. Ich bin hier Auszubildender und finde …« »Jedenfalls vielen Dank. Können Sie mir den Bescheid auch an eine neue Adresse schicken?« »Ich weiß nicht. Müsste ich mal fragen. Sie sind umgezogen?« »Nein, nein – nur gerade nicht zu Hause. Aber kein Problem. Schicken Sie mir die Kopie an die angegebene Adresse.« »Wird sofort erledigt.« Das war erstaunlich leicht gegangen. Allerdings stellte die fehlgeschlagene Adressumleitung ihn nun vor eine ungleich schwierigere Herausforderung. Um sich darauf vorzubereiten, ging er in die Küche und brühte Filterkaffee auf, der eigentlich nur für Gäste gedacht war. Er schüttete das Zeug in wenigen Zügen in sich hinein. Während er sich vor den Spiegel im Flur die Augen rieb, bis sie rötlich schimmerten, begann er zu zittern; er vertrug eben nur Espresso. Anschließend zerknitterte er die Kragenenden seines Hemdes und zog die Krawatte auf Halbmast. Nach einem prüfenden Blick verließ er die Wohnung und fuhr zur Postfiliale in der Arnsburger Straße, vor deren Schaltern sich eine Schlange postsozialistischen Ausmaßes gebildet hatte. Zeit, noch mal durchzuatmen. Zum Glück erwischte er den Schalter mit der altersmilde wirkenden Frau. Er trat mit wirrem Blick auf sie zu und stammelte, er müsse einen Nachsendeauftrag stellen. Sie reichte ihm ein Formular, zog es aber wieder zurück. »Wenn Sie einverstanden sind, fülle ich es für Sie aus.« Er nickte. Offenbar schlummerte ein Schmierendarsteller in ihm. »Ihr Name?« »Olaf Holland.« Nachdem sie alle Felder ausgefüllt hatte, bat sie um seinen Ausweis. Der Eintritt in die kritische Phase. Er durchwühlte hektisch seine Taschen. »Der muss doch … der war doch.« »Es kann auch ein anderes Ausweisdokument sein, Ihr Führerschein zum Beispiel.« »Alles in der Brieftasche«, stotterte er und klopfte sein Sakko ab. »Alles in der Brieftasche.« »Vielleicht haben Sie sie zuhause liegengelassen? Wissen Sie was: Während Sie den Ausweis holen, lege ich den Antrag hier ab, dann ist der Rest hinterher ganz schnell erledigt.« Er sah sie mit aufgerissenen Augen an. »Ich kann nicht mehr nach Hause, ich kann das nicht mehr.« »Warum denn nicht?« »Meine Frau ist gestorben.« Was ja nicht gelogen war. »Ich habe es Zuhause nicht mehr ausgehalten. Ich kann nicht mehr.« Er schlug die Hände vors Gesicht, gab einen Jammerlaut von sich und beobachtete die Frau durch die Ritzen zwischen den Fingern. Mal sehen, wer länger durchhielt. »Schön, dann will ich eine Ausnahme machen. Aber erzählen Sie es nicht weiter.« Na also, ging doch. Er fuhr nach Hause zurück und rief Pascal an, einen Freund aus Studienzeiten, der in Kassel eine Kanzlei für Wirtschaftsrecht betrieb. »Hallo, Pascal, entschuldige, wenn ich kurz angebunden bin, bei mir überschlagen sich gerade die Ereignisse. Erzähle ich dir, wenn ich mehr Zeit habe. Jetzt habe ich zunächst eine Frage: Wie genau erfahre ich aus einem Steuerbescheid etwas über die Einnahmequellen einer Person?« »Nicht allzu genau. Du müsstest auch die Steuerunterlagen beschlagnahmen.« »Dachte ich mir. Aber ich bin derzeit suspendiert, da …« »Wie bitte?« »Ist eine lange Geschichte. Jedenfalls kann ich sie nicht einfach beschlagnahmen. Angenommen, ich würde sie mir auf nicht ganz legalem Wege beschaffen. Dürfte ich sie dir faxen, damit du einen Blick hineinwirfst?« Pascal schwieg eine Weile. »Dir muss ich nicht erklären, wie schnell man seine Zulassung los ist.« »Wenn wirklich etwas aufliegen sollte, halte ich dich da raus, versprochen.« Pascal atmete hörbar durch. »Ich nehme an, du würdest nicht fragen, wenn es nicht ernst wäre. Also gut. Nur vergiss bitte nicht, dass ich Frau und Kinder zu ernähren habe. Soll ich mich nach einem Anwalt für dich umhören?« »Mal sehen. Ich melde mich wieder.« Obwohl das Textor gerammelt voll war, hatte Tom einen Tisch ergattert. »Da bist du ja endlich«, begrüßte er Markus. »Was heißt endlich? Ich bin wie immer pünktlich, da könntest du Traumtänzer dir eine Scheibe von abschneiden.« »Hey, was bist du denn so genervt?« »Bin ich nicht. – Doch, du hast recht, ich bin’s, nicht genervt, aber angespannt.« »Warst du schon mal nicht angespannt?« »Noch ein Wort, dann bin ich auch genervt.« »Ein Bier?« Tom winkte der Kellnerin. Eigentlich hatte Markus nur Wasser trinken wollen, um darin seine Fettzellen zu ersäufen. Aber nach einem Bier würde er besser schlafen und morgen frischer durchstarten. Wie man sich doch alles schönreden konnte. Immerhin würde das Abendessen ausfallen, er hatte nicht den Hauch von Hunger. »Also, wie ist es zu der fristlosen Kündigung gekommen?« »Ne, ne, so haben wir nicht gewettet. Ich will den Scheiß nicht breittreten. Du warst in Spanien?« »Nur eine Dienstreise«, wiegelte er ab, unsicher, ob Tom die Geschichte interessieren würde. »Ich will mehr wissen.« Er gab sich einen Ruck und erzählte von Anna. Und erlebte wieder mal eine Überraschung mit seinem Bruder, der ihm geradezu an den Lippen hing und sich vor Begeisterung gar nicht mehr einkriegte. »Ich bin … ey, Mann, das find ich so was von toll, dass du dich wieder verliebt hast!« Er hielt Markus sein Bierglas entgegen und sie stießen an. »Junge, Junge, das hast du dir echt verdient!« »Kapierst du denn nicht, dass vielleicht alles schon wieder vorbei ist? Dienstag hat sie Geburtstag, und wenn ich sie nicht vorher in Sicherheit gebracht habe …« Er mochte den Gedanken nicht zu Ende denken. »Ach, komm schon, klar schaffst du das!« Markus berichtete von seinen Ermittlungen. Außer den merkwürdigen Vermisstenfällen und einem halbseidenen Verdacht gegen Holland hatte er nichts in der Hand. »Ich habe Angst um sie«, schloss er seine Schilderung. Und weil er nun schon so viel preisgegeben hatte, berichtete er auch von seiner Suspendierung. Tom hörte mit bestürztem Gesichtsausdruck zu, dann begannen seine Augen plötzlich zu leuchten. »Ich kann dir doch jetzt helfen, mir ist eh langweilig!« »Wie denn helfen?« »Keine Ahnung, observieren oder so ’n Zeug. Die Drecksarbeit. Ich mach dir den Matula!« »Ich weiß nicht, vielleicht. Jedenfalls vielen Dank. Du bist ein richtig prima Bruder geworden.« »Nein, das darfst du nicht sagen.« Tom schaute, als sei er beim Erschleichen eines Verdienstordens ertappt worden. Als Markus am nächsten Morgen aufwachte, den Kopf auf dem Sekretär und vor sich den flimmernden Monitor, fühlte sich sein Nacken hart und fragil wie Glas an. Er hatte die halbe Nacht nach allem Möglichen und Unmöglichen im Netz recherchiert, Ausbeute: Genickstarre. Er nahm eine Dusche und setzte sich mit einem Cappuccino an den Schreibtisch, wo er den Stapel seiner Notizzettel sortierte. Er galt nicht zu Unrecht als ordentlich, nur ahnte niemand, welche Anstrengung es ihn kostete, sein chaotisches Temperament zu bezwingen. Nachdem er die Notizen in seine Word-Datei eingefügt hatte, druckte er sie aus und fügte sie der Kopie seiner Handakte bei, die er Degenhart verdankte: Er war so lange auf die Toilette verschwunden, bis Markus den Blätterstoß durch den Kopierer geschickt hatte. Gegen zehn ging er zum Briefkasten und hatte endlich mal Glück: Hollands Steuerbescheid war bereits da – und enthielt wie erhofft den Namen seines Steuerberaters. Das nannte man ja fast schon eine Glückssträhne. Eine halbe Stunde später parkte er seinen Toyota Prius in der Schweizer Straße, stieg aus und tippte die Nummer der Steuerkanzlei Kruger ins Handy. Er wartete, bis die nächste Verkehrswelle auf dem Kopfsteinpflaster heranrauschte, dann drückte er die Anruftaste und erklärte der Frau am anderen Ende der Leitung, er sei Holland. Sie schien es zu schlucken. »Ich müsste noch Unterlagen bei Ihnen haben«, tastete er sich vor. »Moment, Herr Holland. Ja, genau, die vom letzten Jahr.« Heute war sein Glückstag. »Ich bräuchte sie.« »Aber die Steuererklärung hat Herr Kruger noch nicht fertig.« »Schon klar«, improvisierte er. »Ist nur für kurz. Habe einen Taxifahrer losgeschickt. Müsste gleich bei Ihnen sein.« Er beendete das Gespräch und setzte sich in den Wagen, wo er dem Handschuhfach eine Schirmmütze, eine dickrandige Brille und einen Schnurrbart entnahm – Utensilien für ein Faschingsfest, zu dem ihn Ursula gezerrt hatte. Nach einem prüfenden Blick in den Rückspiegel begab er sich zur Kanzlei Kruger, die hundert Meter die Straße aufwärts lag. Einige Minuten später verließ er das Haus mit einem Aktenordner unter dem Arm und ging zu einem Copyshop, wo er die Unterlagen sichtete. Im letzten Abteil des Ordners fand er endlich Belege über Hollands Einnahmen. Er faxte sie Pascal zu und fuhr nach Hause. Unterwegs klingelte sein Handy. »Habe die Unterlagen durchgesehen. Auf was Spektakuläres bin ich allerdings nicht gestoßen. Interessant könnte höchstens sein, dass Holland nebenbei als Berater für eine Stiftung aus Luxemburg arbeitet und dafür gut 50.000 Euro eingestrichen hat. Der Name der Stiftung lautet ›Mensch und Leben‹. Sagt dir das etwas?« »Nein, leider nicht. Aber es ist ein Ansatz. Danke dir.« »Halt die Ohren steif, Kumpel.« Markus fahndete im Netz nach der Stiftung, fand aber lediglich heraus, dass sie psychiatrische Projekte unterstützte. Vielleicht auch Santers Institut? Nach einem vergeblichen Anruf bei Santer ließ er sich von der Auskunft mit MedTecMedia verbinden. Die Firma stellte »E-Health Equipment« her, wie es in der Marketing-Phraseologie hieß. Es meldete sich eine Frau mit honigsüßer Stimme. Er bat sie, ihn zum Geschäftsführer durchzustellen. »Darf ich fragen, in welcher Sache Sie Herrn Gebert sprechen möchten?« »Eine Ermittlung.« »Demnach sind Sie Polizeibeamter?« Markus rang mit sich. Er gab sich hier Blößen, die ihm die Rückkehr an seinen Schreibtisch für immer verbauen konnten. »Steuerfahndung«, erklärte er schließlich. »Wären Sie noch so nett, mir Ihren Namen zu nennen?« »Meier…rowski.« »Einen Moment, Herr Meierowski, ich verbinde Sie.« »Gebert.« Eine angenehm sonore Stimme. »Meierowski. Ich kontaktiere Sie im Rahmen einer Steuerfahndung, die einen Mitarbeiter Ihres Unternehmens betrifft, Herrn Olaf Holland. Es besteht ein Anfangsverdacht der Steuerhinterziehung.« »Herr Holland? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Jedenfalls vermag ich Ihnen in dieser Sache nicht weiterzuhelfen.« »Das werden wir sehen. Die Ermittlungen betreffen …« »Entschuldigen Sie, dass ich unterbreche, aber ich bin nicht der Steuerberater unserer Mitarbeiter.« »Gehört es nicht zu Ihren Aufgaben, Schaden vom Unternehmen abzuwenden?« »Was soll das heißen?« Geberts Stimme klang immer noch sonor, aber nicht mehr angenehm. Markus schwenkte auf einen konzilianteren Ton um. »Sehen Sie, Herr Gebert, im Steuerstrafrecht wird mit harten Bandagen gekämpft. Durchsuchungen von Wohn- und Geschäftsräumen sind an der Tagesordnung. Und dann schwirren unweigerlich die Medien an. Es geht auch diskreter, aber das setzt Kooperation voraus.« Markus meinte beinahe hören zu können, wie es in Geberts Kopf ratterte. »Was genau wollen Sie wissen?« »Es geht um die schlichte Auskunft, ob Ihre Firma Herrn Holland die Genehmigung zur Aufnahme einer Nebentätigkeit erteilt hat.« »Nein, das wüsste ich. Herr Holland ist leitender Angestellter, da bleibt gar keine Zeit für Nebentätigkeiten.« Er sprach das Wort aus, als enthalte es die Unterstellung, Holland brate heimlich bei McDonald’s Frikadellen. »Es geht um eine Beratertätigkeit.« »Aha. Und wen berät er?« Markus hatte ihn an der Angel. Die Frage, wen sein Entwicklungschef worüber beriet, konnte Gebert nicht kaltlassen. »Noch so eine Ungereimtheit. Es handelt sich um eine verschwiegene ausländische Organisation, die auf dem Gebiet der Psychiatrie tätig ist. Sehen Sie da eine Verbindung zu Projekten Ihres Unternehmens?« »Nein. Wir produzieren Informationstechnologie, zum Beispiel Telediagnostik oder bildgebende Techniken für Operateure. Will sagen: Unser Equipment kann in jedem medizinischen Bereich … Moment, es gibt vielleicht doch etwas. Unser Konzern hat eine Tochter in Genf, Genamic Industries, und die haben ein Forschungsprojekt aufgesetzt: neue Verfahren der synthetischen Biologie.« »Und das hat im weitesten Sinne mit Psychiatrie zu tun?« »Nein. Ich komme darauf, weil Genamic Industries im Segment automatisierter Gensynthese weltweit Innovationsführer ist und das Forschungsprojekt der höchsten Geheimhaltungsstufe unterliegt. Ich weiß selbst nicht im Einzelnen, welche Anwendungsszenarien es eröffnet. Der springende Punkt ist: Herr Holland arbeitet an diesem streng geheimen Projekt mit.« »Automatisierte Gensynthese?« »Es geht um Technologien, die es ermöglichen, künstlich kreierte Gene wie Legobausteine neu zu kombinieren und diesen Bausatz in eine lebende Zelle einzuschleusen. Im Anschluss wird die genetisch veränderte Zelle einem Organismus implantiert, gewöhnlich, um Defekte auf molekularer Ebene zu korrigieren.« »Das könnte der Hintergrund sein. Ich werde die Informationen an das zuständige Dezernat weiterleiten. Um Herrn Holland gegebenenfalls überführen zu können, dürfen Sie sich keinesfalls etwas anmerken lassen. Gedulden Sie sich, bis sich der entsprechende Sachbearbeiter bei Ihnen meldet.« »Und was ist mit der Organisation, von der Sie gesprochen haben? Ich brauche den Namen!« »Sie hören von uns.« Markus legte schnell auf. Künstliche Gene, die wie Legobausteine nach Bedarf zusammengesetzt wurden. Die dann in Zellen eingebaut und in einen Organismus geschleust wurden. Um was genau zu bewirken? Rätsel über Rätsel. Er musste wissen, ob Holland für den vergangenen Dienstag, als er Anna in Cambrils begegnet war, ein Alibi besaß. Kurz entschlossen wählte er dessen Privatnummer. Wie erhofft, meldete sich die »Luxusblondine«, von der Anna gesprochen hatte. Vielleicht war Holland Frau ja nicht nur auf dem Kopf blond. Er gab sich als Mitarbeiter des Flughafens aus: Ein Schlüssel mit Namensschild sei gefunden worden, der Name laute Holland. »Und dann habe ich den Namen auf einer Passagierliste gefunden, Bingo, und da dachte ich, fragen kostet nichts, so ein Schlüssel kann ja wichtig sein, meinen Sie nicht auch?« Meinte sie auch. »Mein Mann fliegt wirklich ständig, also für mich wäre das nichts! Wissen Sie, ich stehe auf Bio, und Fliegen finde ich irgendwie nicht so biologisch.« »Ganz Ihrer Meinung. Zurück zu …« »Genau! Wissen Sie, …« »Noch mal zum Schlüssel. Wenn er Ihrem Gatten gehört, müsste er auf dem Flug nach … herrje, jetzt habe ich glatt vergessen, wohin der Flug gegangen ist. Vielleicht nach Spanien?« »Spanien? Nein. Waren Sie schon mal in Benidorm? Wissen Sie, ich …« »Zuweilen bin ich ein echter Schussel. Womöglich bringe ich etwas durcheinander. Wo war Ihr Gatte denn?« »Zuletzt ist er nach Genf geflogen, vor zwei Wochen. Wissen Sie …« Nein, wusste er nicht, wollte er auch nicht. Außerdem rief jemand auf dem Festnetz an. Er beendet das Gespräch und griff zum Telefonhörer. Anastasia, schluchzend. »Es tut mir leid, Markus!« »Was tut dir leid?«, entgegnete er kühl. »Die Fotos.« »Ich dachte mir schon, dass du sie beigesteuert hast.« »Er hat mich erpresst.« »Wer?« »Strecker.« »Strecker?« Da hatte ihn sein Bauchgefühl schon wieder getäuscht! »Und womit?« »Er hat ein Video von uns beiden. Wie wir am Pool … Sex haben.« »Woher wusste er, dass du Fotos gemacht hast?« »Keine Ahnung. Vielleicht war er da, einer muss ja das Video aufgenommen haben.« Anastasia begann sich zu rechtfertigen. »Schon gut.« »Ich habe nicht darüber nachgedacht, was er mit den Fotos anstellen will. Ich wollte nur raus aus dieser elenden Geschichte. Aber mit deiner Suspendierung habe ich nicht gerechnet. Ich wollte dir nicht schaden, das musst du mir glauben!« »Ja. – Danke, dass du dich überwunden hast, mir Bescheid zu geben.« »Wegen Aids muss ich mir wirklich keine Sorgen machen?« »Nein.« »Für uns gibt es keine Hoffnung mehr, nicht wahr?« Ihre Stimme wurde ganz klein. Markus räusperte sich. »Nein. Es tut mir leid, Anastasia. Machs gut.« Er legte auf. Strecker war also doch an der Sache beteiligt! War er Annas Begleiter, der große Unbekannte, der hinter allem steckte? Nach kurzem Überlegen verwarf er den Gedanken. Wer in der Hierarchie einer kriminellen Bande oben stand, stellte sich nicht derart verdächtig ins Schaufenster. Aber an Streckers Beteiligung bestand kein Zweifel mehr. Damit gab es endlich eine heiße Spur. Markus rief Degenhart an und fragte, seit wann der Staatsanwalt wieder im Dienst war. »Keinen Schimmer. Ich höre mich mal um. Da ist noch etwas, Markus. Kurz nachdem Strecker bei uns angefangen hat, habe ich einige Personalakten angefordert. Ihre Akte habe ich jedoch nicht bekommen, weil sie bei Strecker lag.« »Danke für den Hinweis, Stefan. Es passt ins Bild. Hat Strecker eigentlich inzwischen einen Haftbefehl gegen Frau Heydt erwirkt?« »Nach seinem Vorwurf, Sie hätten den Haftbefehl verhindern wollen, blieb ihm doch gar keine andere Wahl.« Eine Stunde später stand Markus, mit den Faschingsrequisiten plus Arbeitskittel und Werkzeugkiste kostümiert, vor einem frei stehenden Einfamilienhaus in Bad Vilbel. Soweit er wusste, bestand Streckers Familie nur aus ihm selbst. Das Haus fügte sich unauffällig zwischen Zwillingshäuser der Baureihe »quadratisch, praktisch und besser als nichts« ein. Er öffnete ein kleines Gartentor und ging zur Haustür, wo er Sturm läutete, ohne dass jemand reagierte. Demonstrativ sah er auf seine Armbanduhr, schüttelte den Kopf und ging am Haus vorbei zur Rückseite. Wie aufgrund des Satellitenbildes auf Google Earth zu vermuten, war der Garten von den umstehenden Häusern nicht einsehbar. Er holte den Glasschneider aus der Werkzeugkiste und schnitt ein Loch in die Scheibe. Im Haus begab er sich auf die Suche nach einem Haustürschlüssel. Nachdem er ihn gefunden hatte, holte er sein Handy aus der Kitteltasche, drückte die Wahlwiederholung und bestätigte einen Auftrag, den er zuvor unter Vorbehalt erteilt hatte. Er begann, das Haus zu durchkämen. Nach einer Stunde betrug die Ausbeute immer noch null. Nirgends auch nur der Hauch eines Hinweises. Lediglich das Schlafzimmer im ersten Stock stand noch aus. Er öffnete die Tür und sah sich um: auch hier blassgelbe Buchenholzmöbel von nichtssagender Sachlichkeit. Weder im Nachtschränkchen noch im Bett stieß er auf etwas Interessantes. Blieb bloß noch der Kleiderschrank. Er öffnete die rechte Tür: Hemden und Anzüge. Linke Tür: Schuhe, ordentlich gefaltete weiße Unterwäsche, Socken, ineinander gerollte Ledergürtel. Im obersten Fach schimmerte etwas rötlich. Er trat einen Schritt zurück. Ein Schuhkarton? Es klingelt an der Haustür. Er ging runter und bat die beiden Glaser herein. »Ein Einbruch«, sagte er und führte sie ins Wohnzimmer. Der Ältere besah sich die Scheibe. »Kein Problem, Meister. Ist im Nu erledigt.« Markus zückte sein Portemonnaie. »Wir wickeln das Finanzielle gleich ab.« Mit einem Stuhl kehrte er ins obere Stockwerk zurück. Kurz darauf saß er auf Streckers Bett und starrte ungläubig auf die vor ihm ausgebreiteten Fotos. Die Aufnahmen zeigten eine nackte Frau. Eine Frau, die sich in ordinären Posen rekelte. Auf allen vieren, den Hintern in die Kamera gereckt. Die Beine weit gespreizt auf einem Stuhl sitzend. Mal mit, mal ohne Dildo in der Scheide. Auf einigen Bildern hatte sie statt des Dildos die menschliche Entsprechung in unterschiedlichen Körperöffnungen, ohne dass sich der Mann zu erkennen gab. Auf einem Foto uriniert er der Frau in die Mundhöhle. Kein harter Stoff für jemanden von der Sitte. Vorausgesetzt, es handelte sich um eine unbekannte Person. Das Handy klingelte, doch er reagierte nicht. Sein Hirn hatte sich festgefressen wie ein Auto im Schlamm. Nicht die sexuellen Handlungen an sich schockierten ihn, wenngleich die aggressive Zurschaustellung ihn anwiderte. Der eigentliche Schock bestand in der Erkenntnis, wie fremd ihm die Frau auf den Bildern war. Mit einer Sportpistole, die er im Kleiderschrank gefunden hatte, stieg er ins Erdgeschoss hinunter. Nirgends Dreck, die Handwerker hatten sich das Trinkgeld verdient. Er verschloss die Haustür, legte Bart und Kittel ab und ging ins Wohnzimmer, wo er sich auf einen unbequemen Eisenrohrsessel setzte. Mit irgendjemandem musste er reden, um den Schock zu verdauen. Aber mit wem? Annas Eindruck, er sei ein einsamer Eigenbrötler, hatte er widersprochen, und nun fiel ihm niemand ein, mit dem er reden konnte. Er nahm sein Handy und rief Tom an. Stotternd berichtete er von den Bildern. »Dieser Staatsanwalt, ist das ein hagerer Blonder?« »Ja. Wie kommst du darauf?« »Dünnes Haar? Blaue Augen?« »Jetzt sag endlich, wieso du das weißt!« Markus verstand die Welt nicht mehr. Woher kannte Tom das Schwein? »Er ist aus München, richtig?« »Ja! Ja! Ja! Verdammt, Tom, spuck aus, was los ist!« Plötzlich hörte er vom Flur her Geräusche. Die Haustür wurde aufgeschlossen. Wortlos beendete er das Gespräch und stellte sein Handy stumm. Er sah auf die Uhr: halb zwei. Kam Strecker zum Mittagessen nach Hause? Er nahm die Sportpistole vom Tisch und verbarg sich hinter der Tür. Im Flur hörte er Schritte, die sich entfernten. Geschirr klapperte, Strecker war offenbar in die Küche gegangen. Markus streifte die Schuhe ab, schlich zur Küchentür und spähte um die Ecke. Der Staatsanwalt saß, mit dem Rücken zur Tür, am Tisch, vor sich ein Schälchen. Er hob die Hände und faltete sie auf Brusthöhe. »Vater aller Gaben, alles, was wir haben …« Tatsächlich, die Drecksau betete, als könnte sie kein Wässerchen trüben. »Hände hoch, Strecker!« Strecker hob die Hände nicht. Stattdessen drehte er sich langsam um. In seinem Gesicht mischte sich Erstaunen mit Hass. Er sprach mit gepresster Stimme. »Dass Sie Drecksau es wagen, mein Heim mit Ihrer Anwesenheit zu schänden.« »Hände hoch! Ich meine es ernst.« »Das ist mir egal.« Ohne die Waffe zu senken kam Markus einen Schritt näher. Er zog das Foto aus der Hosentasche, in dem sich die Frau in den Mund urinieren ließ. »Was hat die Organisation mit ihr angestellt?« »Welche Organisation? Drehen Sie jetzt völlig durch?« »Entweder Sie reden, oder ich töte Sie. Glauben Sie nur nicht, ich bringe das nicht.« »Ihnen traue ich alles zu, Mörderseele. Machen Sie nur. Sie haben mein Leben zerstört, da können Sie es auch gleich beenden.« Womit immer Markus gerechnet hatte – mit dieser Reaktion nicht. »Ich – Ihr Leben zerstört? Sie haben Sie ja nicht mehr alle.« Er schwenkte das Foto. »Sind das Sie, der …?« Markus’ Satz ging im Quietschen von Bremsen unter. Ein Wagen hielt direkt vor Streckers Haus. PRÄOPERATIVE SCHMERZEN | D-EPPSTEIN/TAUNUS Wie Hunderte Male zuvor liefen die Momente von Cambrils vor Annas innerem Auge ab: Das ungläubige Staunen, als ihr bewusst wurde, was sie für Markus empfand. Die scheue Annäherung. Die aufkeimende Hoffnung. Und dann das Unfassbare: Der Mann, den sie liebte, hatte sie verraten und verkauft. Alles bloß eine schmierige kleine Polizeiaktion. Wie hatte sie sich in diesem Menschen dermaßen täuschen können? Anna konnte immer noch nicht glauben, was er ihr angetan hatte. Aber alle Versuche, die Szene im Restaurant versöhnlicher zu deuten, waren gescheitert. Abhaken und vergessen! Sie musste die Enttäuschung unter den vielen anderen vergraben. Aus ihr und Markus wäre sowieso nichts geworden. Wenn Liebe blind machte, dann nur kurz. Bald hätte das Leben ihm die Augen geöffnet. Anna saß, die Beine angezogen, auf dem Bett und stierte grimmig vor sich hin. Nicht mehr lange, dann hatte sie das Elend endlich hinter sich. Plötzlich kam eine Unruhe über sie, wie Patienten sie vor einer großen Operation empfinden. Stand ihr etwas in der Art bevor? Alexanders nebulöse Aussagen ließen keinen konkreten Schluss zu. Letztlich erschöpften sie sich in der Beteuerung, es werde nicht wehtun. Seit dem Rückflug war er die Liebenswürdigkeit in Person. Die Schießerei musste desaströs ausgegangen sein, Iwan hatte nur zwei seiner Männer mit an Bord des Learjets gebracht. Die anderen wahrscheinlich hopsgegangen oder hopsgenommen. Dem zunehmenden Getrampel im ersten Stock nach füllte sich das Mannschaftsquartier bereits wieder. Der Verlust seiner Männer spielte für Alexander offenbar keine große Rolle. Er kam regelmäßig morgens auf einen Tee samt Plausch in ihr Apartment und brachte Bücher und Sudokus zum Zeitvertreib mit. Wohl wissend, dass alles bloß Show war, nahm Anna es dankbar hin, denn Angst konnte sie nicht brauchen, wenn sie den Weg mit ihm zu Ende gehen wollte. Und etwas Besseres fiel ihr nicht ein. »Mach, Meister«, hatte sie ihn aufgefordert, »je eher, desto besser.« Sie wollte es nur noch hinter sich bringen. Zu ihrer Überraschung stellte er ihr in Aussicht, die Warterei um einen Tag zu verkürzen. Ihr Geburtstag spielte offenbar doch keine magische Rolle, was ihr ein leidlich gutes Zeichen schien. HART UND ZART | D-FRANKFURT/MAIN Markus trieb Strecker mit gezückter Waffe die Treppe hinab in einen der Kellerräume und sperrte ihn ein. Danach schlich er zur Haustür und lauschte. Nichts zu hören. Er öffnete die Tür einen Spaltbreit und lugte hinaus. Die beiden schwarz gekleideten Männer, die vor ein paar Minuten geklingelt hatten, waren verschwunden. Er zog die Tür auf. Jetzt sah er die Männer wieder. Sie betraten den Vorgarten des Nachbarhauses und klingelten. Einer der beiden, ein langer Lulatsch, hatte ein Heft in der Hand. Eine ältere Frau öffnete und der Lulatsch streckte ihr das Heft entgegen. Es war eine Geste von archetypischer Klarheit: Zeugen Jehovas auf Seelenfang. Er atmete tief durch und schloss die Tür. Auf dem Weg in den Keller versuchte er seine Eindrücke zu verarbeiten, doch Streckers Reaktion verwirrte ihn noch immer. Man hätte meinen können, der Mann beschuldige ihn statt umgekehrt. Strecker saß in einer Ecke auf dem Boden. Markus ging in die Hocke und schnippte ihm das Foto hin. »Sind Sie der Pisser?« »Ja. Ich hab ihr gegeben, was sie wirklich brauchte, und was Sie Wichtelmännchen ihr nicht geben konnten«, triumphierte er. Markus würgte die Erniedrigung runter und spuckte Arroganz aus: »So ein alter Sack und spielt immer noch Wer-hat-den-Größten.« »Meinen Lustspender hat sie ›Strammer Max‹ genannt.« Strecker entschlüpfte ein kleines gemeines Lächeln. »Ihren auch?« Das Lächeln erlosch. »Aber das pubertäre Würstchen sind Sie. Honi soi qui mal y pense. Ich spreche nämlich nicht von Schwanzmaßen, ich spreche von innerer Größe. Von der Größe, sich ganz und gar hinzugeben.« »Und das heißt dann, jemandem in den Mund zu pinkeln?« »Es heißt, ehrlich zu sein, was immer dabei rauskommt. Kapieren Sie Jammerlappen eh nicht. Jedenfalls habe ich ihr gegeben, was sie wollte.« »Sie perverses Schwein, Sie …« »Papperlapapp. Unsere Großeltern haben es nur im Dunkeln getrieben, unsere Eltern hätten sich eher die Zunge abgebissen, als sich damit zu lecken. Die Grenzen sind fließend und verändern sich. Zwei Erwachsene haben getan, worauf sie Lust hatten. Das geht Sie Schlappschwanz überhaupt nichts an.« »Aber es ist meine Frau! Sie haben es mit meiner Frau getrieben!« »Und wenn schon. Besser als es mit Kindern zu treiben, so wie Ihre Heydt«, schrie Strecker zurück. »Außerdem war es Ihre Frau, Sie haben sie ja umgebracht! Und sie war es auch nur noch auf dem Papier. In Wahrheit war sie längst meine Frau!« »Ich habe Ursula umgebracht? Sind Sie von Sinnen?« »Natürlich haben Sie sie umgebracht, Sie gottverdammter Wichser! Wer denn sonst? Man sieht doch auf den Fotos, dass wir Kondome benutzt haben. Außerdem bin ich HIV-negativ. Also kommen Sie mir nicht mit Ausflüchten.« »Sie haben es gar nicht auf Frau Heydt abgesehen?« »Heydt?« Strecker schaute erstaunt. »Was sollte mich die Schlampe denn interessieren? Ich hab sie aufs Korn genommen, weil Sie ihr so hübsche Augen gemacht haben, sonst nichts.« »Ich hab ihr keine hübschen Augen gemacht«, zischte Markus. »Sie ahnungsloser Spinner. Ein Blinder mit Krückstock hat gesehen, dass Sie auf das Klappergestell abfahren. Aber ich schwöre Ihnen: Sie werden in Ihrem Leben keine Muße mehr für Liebeleien finden.« »Warum haben Sie sich nach Frankfurt versetzen lassen?« »Um es Ihnen heimzuzahlen. Und das werde ich! Erschießen Sie mich ruhig, das ändert gar nichts. Es gibt Aufzeichnungen, aus den hervorgeht, dass Sie Ihre Frau erst mit Aids angesteckt« – er begann zu brüllen – »und dann am ausgestreckten Arm haben verhungern lassen!« »Ich bin nicht HIV-positiv, Schwachkopf. Das belegen gleich zwei Atteste. – Haben Sie sich deshalb meine Personalakte besorgt?« »Ja, und da gibt’s keine Atteste.« »Degenhart wollte sie offenbar nicht da drin haben. Aber er hat sie gesehen, fragen Sie ihn.« »Das kann nicht sein! Irgendwo muss Ursel sich ja angesteckt haben.« »Wie sagten Sie? In Wahrheit sei ›Ursel‹ Ihre Frau gewesen? Offenbar mussten Sie sie gleich mit mehreren teilen.« Die Gesichtsfarbe wich aus Streckers Gesicht. »Nein, das kann nicht sein. Ursel war treu. Sie ist auch nur deshalb zu Ihnen zurückgekehrt, weil sie Ihnen vor Gott Treue geschworen hat.« »Schöne Treue. Im Übrigen war Ursula überhaupt nicht religiös veranlagt.« »ABER SIE IST MIR NICHT FREMDGEGANGEN!« »Amen. Egal, ist Ihre Sache. Für mich ist das Schnee von gestern. Ich will wissen, was Sie mit Anna Heydt angestellt haben.« Strecker antwortete nicht. Tränen rannen ihm übers Gesicht. Markus sah es mit Befremden. Was so alles in ein und denselben Menschen reinpasste: hier rührende Zärtlichkeit, dort harte Sexpraktiken, hier ein Tischgebet, dort die Bereitschaft, Annas Existenz zu vernichten, nur weil es sich gerade anbot. Er ließ Strecker Zeit, sich zu fangen. »Noch mal: Was haben Sie mit Frau Heydt angestellt?« »Was meinen Sie damit?« »Stellen Sie sich nicht dumm, verdammt. Sie und Ihre Kumpane haben Anna in Ihrer Gewalt.« Er glaubte selbst nicht mehr, was er sagte. »Sie sind als Polizist genauso ein Versager wie als Ehemann. Ich habe die Schlampe nicht in meiner Gewalt. Und ich habe auch keine Kumpane.« »Sie stecken hinter dem Video.« »Das ja.« »Wie verkommen muss man sein, einen kleinen Jungen zu missbrauchen, um …« »Unterstehen Sie sich! Ich meine das Video, auf dem Sie Papandreou ficken – um sich ein paar Stunden später an Heydt ranzuschmeißen. Ihre moralische Verkommenheit habe ich dokumentiert, sonst gar nichts. Dafür muss man Sie in keine Falle locken, das machen Sie von selbst. Und ich arbeite mit niemandem zusammen, das ist eine persönliche Sache zwischen Ihnen und mir. Ich räche Ursel.« »Ich habe Ursula nicht angesteckt, merken Sie sich das endlich. Ich habe sie gepflegt, obwohl sie mich betrogen hat.« Strecker verbarg das Gesicht in den Händen. »Ich wollte Ursel pflegen. Aber sie konnte es nicht zulassen. Sie fühlte sich Ihnen verpflichtet. Mit unserer Liebe hat das nichts zu tun.« Ursula war – aus Liebe – mit Strecker in Bett gegangen, dann aber – aus Pflichtgefühl – zum Sterben nach Hause? Markus fragte sich, ob der Mann die verquere Logik mit seiner Intelligenz vereinbarte. »Schwören Sie bei Ursulas Seelenheil, dass Sie mit dem Verschwinden von Frau Heydt nichts zu tun haben!« Strecker blickte auf. »Ich schwöre es.« Er sagte die Wahrheit. Markus registrierte es mit einem Anflug von Panik. Jetzt stand er wieder ohne Plan in der Pampa. Die erste heiße Spur, an deren Ende er Anna zu finden gehofft hatte, endete im Morast seiner eigenen Vergangenheit. »Haben Sie mit jemandem über Ihren Rachefeldzug gesprochen?« »Ich sagte doch, das ist eine Sache zwischen Ihnen und mir.« »Sie haben Frau Heydt drangsaliert und Frau Papandreou erpresst.« »Aber nicht eingeweiht.« »Ich gehe jetzt. Die Fotos nehme ich mit.« »Lassen Sie mir wenigstens eins, bitte!«, flehte Strecker. »So ein versautes Bild? Niemals.« »Ich habe kein anderes.« Markus fiel es nicht leicht, sich zu überwinden, aber schließlich versprach er, ihm ein Bild von Ursula zu schicken. »Habe ich Ihr Ehrenwort, dass Sie mich dann in Ruhe lassen? Keine fiesen Tricks in meinem Disziplinarverfahren?« »Ja.« »Haben Sie Holland vorgeladen, wie Ogentaff es wollte?« »Er hat nicht darum ersucht. Aber wenn er es für erforderlich hält – warum nicht? Ich habe nichts gegen Ogentaff.« »Wenn das der Maßstab Ihrer Anordnungen ist, sollten Sie den Beruf wechseln.« »Da spricht gerade der Richtige.« OFFENBARUNGEN | D-WIESBADEN Das Treffen des Generalstabs fand im Konferenzraum eines Wiesbadener Hotels statt, das für gewöhnliche Gäste stets ausgebucht war. Es näherte sich dem Ende. Unter der Leitung des Majordomus hatten die sechzehn Teilnehmer, hochrangige Offiziere der wichtigsten Funktionsbereiche, neue Sicherheitsstandards besprochen. Der Salvator hatte sich nach der zeremoniellen Begrüßung zurückgezogen und betrat nun wieder den Raum, um die Abschlussformel zu sprechen. Die Anwesenden erhoben sich in ehrfürchtigem Schweigen. In dieses Schweigen stach das Klingen eines Handys wie ein Rülpser in ein Liebesspiel. Der Salvator hielt inne und griff an die Brusttasche seiner schwarzen Uniform. Nach einem Blick auf das Display wandte er sich wortlos ab und verließ den Raum. Im Foyer nahm er den Anruf an. »Schön, mal wieder von Ihnen zu hören.« »Ja, freut mich auch«, entgegnete der Anrufer spürbar angespannt. »Ich bräuchte Ihre Hilfe. Und es gibt einige Neuigkeiten. Ich muss etwas ausholen.« »Sie machen mich neugierig.« »Ich habe etwas Seltsames erlebt.« Er hörte sich den Bericht des Anrufers mit düsterer Miene an. Damit, etwas wirklich Neues über IX-α zu erfahren, hatte er nicht gerechnet. Von Mirandor abgelenkt, hatte er ihr offenbar zeitweise nicht die gebotene Aufmerksamkeit gewidmet. »Ein ziemlicher Schlamassel, nicht wahr?«, beendete der Anrufer seine Schilderung. »Das ist unglücklich gelaufen«, bestätigte er. »Und Sie hat es richtig schwer erwischt?« »Ja.« »Sie sagten, Sie bräuchten Hilfe?« Der Anrufer erläuterte sein Anliegen. »Ich werde mein Bestes geben. Was werden Sie nun unternehmen?« Er spürte, wie der Anrufer mit sich rang. Er unterbrach das Schweigen nicht. Wer etwas erfahren wollte, musste Stille aushalten. »Ich habe schon etwas unternommen. Wenn es rauskommt, könnte es mir eine Haftstrafe einbringen.« Stirnrunzelnd hörte er sich die Geschichte an. »Sie sind in gefährliches Fahrwasser geraten. Bevor Sie weitere Schritte unternehmen, sollten Sie sich mit jemandem besprechen. Ein Außenstehender ist oft der beste Ratgeber. Sie können sich jederzeit an mich wenden, wenn Sie mögen.« »Danke. Wir hören voneinander.« »Bis bald.« Der Salvator starrte nachdenklich vor sich hin. Dass Engel sich ausgerechnet an ihn wandte, war ein Glücksfall, doch die Neuigkeiten gefielen ihm nicht im Mindesten. Was IX-α betraf, spielte ihm die unglückliche Romanze zwar in die Karten, aber dafür rannte jetzt ein liebeswütiger Irrer auf der Suche nach seinem Herzblatt durch die Gegend. Obwohl nicht ansatzweise abergläubisch, beschlich ihn ein ungutes Gefühl. Erst war der diesjährige Ersatzkandidat letal gestrandet, dann mit Mirandor einer der beiden Kandidaten für das kommende Jahr. Und nun hatte er diesen hartnäckigen Schnüffler am Hals. Er musste an Murphys Gesetz denken: Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Auf dem Weg zum Konferenzraum straffte er sich und trat hinein. Die Anwesenden erwarteten ihren Salvator mit andächtigen Blicken. Wie Kinder, denen sich das Christkind offenbart. TUNNELBLICK | D-FRANKFURT/MAIN Nachdem Markus aufgelegt hatte, rief er Ogentaff an, um ihn über die Luxemburger Stiftung zu informieren, die Holland offenbar beriet. Da niemand abhob, blättert er in seinem Adressbuch und probierte es bei John Bellingham, einem englischen Ermittler, den er auf einem Seminar von Europol in Den Haag kennengelernt hatte. Bellingham gehörte zur Flying Squad, einer Sondereinsatzgruppe des Metropolitan Police Service in London, die das organisierte Verbrechen bekämpfte. Anders als es die Bezeichnung Flying Squad, fliegende Truppe, vermuten ließ, war Bellingham, von Freunden gern ironisch Sir John genannt, von altmodischer Bedächtigkeit. Markus quälte sich ein wenig Small Talk ab, um Sir John nicht mit deutscher Direktheit vor den britischen Kopf zu stoßen. Schließlich hatten sie die richtige Gesprächstemperatur für sein Anliegen erreicht: Er benötigte Informationen zu einem Fall, auf den er gestoßen war, kurz bevor Degenhart ihn in sein Büro zitiert hatte. »Du tätest mir einen großen Gefallen, wenn du mir Hintergrundinformationen über einen Tatverdächtigen besorgen könntest«, sagte er. »Es geht um einen Briten pakistanischer Abstammung namens Rohan Huqqabi«. Der mehrfach vorbestrafte Mann war des Totschlags an seinem Bewährungshelfer verdächtigt und ab November 1993 mit internationalem Haftbefehl gesucht worden. Er hatte sich von einem Tag zum anderen scheinbar in Luft aufgelöst – vier Tage vor seinem vierzigsten Geburtstag. »Dann würde mich noch interessieren, ob bei euch zwischen 1952 und 53 nach einem Mann gefahndet wurde, der ebenfalls kurz vor seinem vierzigsten Geburtstag stand. Von Interesse sind nur Personen mit pakistanischer Abstammung. Obwohl … Sagen wir, ihre Wurzeln müssten auf dem indischen Subkontinent liegen.« Bellingham versprach, sich kundig zu machen. Markus bedankte sich nach allen Regeln der Kunst und legte auf. Eigentlich konnte nichts dabei rauskommen, aber was hieß in diesem Fall schon »eigentlich«. Das Handy klingelte und wieder einmal erschien Kuhlmanns Nummer im Display. Der Mann legte plötzlich eine seltsame Anhänglichkeit an den Tag. »Ich hab vergessen, was zu erwähnen: Der getötete Deutsche könnte mit Vornamen Peter geheißen haben.« »So? Lassen Sie mich rekapitulieren: ein blonder Mann, schlank, relativ jung. Neurologe oder etwas in der Art, warum also nicht Psychologe? Vorname Peter und dann noch der Buchstabe S – S wie Santer. Ist das die Botschaft?« »Kapier ich nicht.« »Wo ist eigentlich das Foto, das Sie mir faxen wollten?« »Wieso?« »Weil bei mir keins angekommen ist.« »Ich hab’s versandt, mehr weiß ich nicht.« »Dann schicken Sie es mir noch mal.« »Geht nicht. Hab doch gesagt, dass die Geschichte hier wie ein Staatsgeheimnis behandelt wird. Offiziell gibt’s das Foto gar nicht, zumindest nicht für kleine Pupser wie mich. Also hab ich’s im Häcksler verschwinden lassen. »Ich will das Versandprotokoll.« »Das – was?« »Versandprotokoll. Faxgeräte dokumentieren, was sie wohin verschickt haben.« »Sie gehen mir grad mächtig auf den Sack, Engel.« »Hören Sie, Kuhlmann, wenn Sie mich verarschen wollen, müssen Sie die Latte höher legen. Sie spicken mich mit Infos, die haargenau zu einem Verdächtigen in einem ganz anderen Fall passen.« »Kann nur ein Zufall sein.« »Dann erklären Sie doch mal, warum Sie ausgerechnet mir Arsch eine Aufnahme schicken, die offiziell nicht existiert.« »Sie alter Korinthenkacker. Aber bitte, wenn Sie’s unbedingt wissen müssen: Natürlich hab ich es nicht für Sie getan, sondern weil … weil es im Sinne Mirandors ist, dass die Täter geschnappt werden.« »Was ist mit ihm? Lebt er überhaupt noch?« Kuhlmann schwieg. »Mirandor ist mein Zeuge! Ich verlange Auskunft von Ihnen!« »Nä, verdammich, er lebt nich mehr! Sie ham et sich doch längst zusammengereimt. Ein bewaffneter Fluchtversuch, ein Schusswechsel, selber schuld.« »Er wurde erschossen, nur weil er fliehen wollte?« »Notwehr.« »Und Sie hatten die Ehre, ihn abzuknallen, richtig?« Kein Widerspruch. »Was sind Sie bloß für ein …« Markus sprang vom Sofa und feuerte den Hörer gegen die Wand. Dieses erbärmliche Stück Dreck hatte Jesús Mirandor auf dem Gewissen! Auch wenn Mirandor zuletzt ziemlich durch den Wind gewesen war, hatte er nie und nimmer eine Gefahr dargestellt, der man sich nur durch einen Todesschuss erwehren konnte. Aber Kuhlmann musste man offenbar alles zutrauen. Nach einigen Minuten wandelte sich die Wut in Trauer. Der liebenswürdige Spanier – vom Erdboden getilgt. Markus versuchte es zu begreifen, doch er fasste ins Leere. Ohne es zu bemerken, starrte er in den hell scheinenden Lichttunnel des riesigen Gemäldes auf der gegenüberliegenden hohen Altbauwand des Zimmers: eine handgemalte Reproduktion des Bildes Memories of Max von Howard Hodgkin. Als er das Original in einer Düsseldorfer Galerie gesehen hatte, war er fasziniert stehen geblieben. Was immer Hodgkin hatte ausdrücken wollen – Markus sah den Übergang vom Leben zum Tod vor sich, sah, wie ein Ich sich in einem letzten Strudel von Erinnerungen auflöste und in etwas Feingewobenem, Lichtem verschwand, etwas, das nicht von dieser Welt war. Etwas, das wohltat. Er hatte das Bild haben müssen, und wenn nicht im Original, dann wenigstens als Reproduktion. Selbst die hatte ihn achttausend Euro gekostet. Er weinte ihnen nicht nach, denn wann immer er sich auf das Bild einließ, überkam ihm ein Gefühl von Gelassenheit. Jetzt allerdings nicht. Im Wissen, dass Jesús Mirandor gestorben war, wirklich gestorben war, bedrängt ihn zum ersten Mal die Frage, was am Ende des Lichttunnels sein mochte. Doch schon der Begriff sein passte nicht, weil er sich ohne Zeit kaum denken ließ. Markus konnte nicht glauben, dass Zeit über das irdische Dasein des Menschen hinaus Bedeutung hatte. Allemal besser passte nichts, nur war das Nichts kein Trost, denn sein Verstand bot es ihm bloß als ewige Schwärze an, die alles absorbierte, tröstliche Gedanken eingeschlossen. Jesús Mirandor hatte sich in seelenlose Biomasse verwandelt. Ob es jemanden gab, der ihn beweinte? Er hatte auf Markus, trotz seiner offenen Art, einen einsamen Eindruck gemacht. Das zumindest hatte er mit Anna gemein. Markus riss sich zusammen. Wenn er den Kopf verlor, verlor Anna ihn vielleicht auch. Was sollte er also mit Kuhlmanns mysteriösen Informationen anfangen? Wieso passte die Beschreibung so genau auf Santer, jetzt auch noch einschließlich des Vornamens? Und ausgerechnet Santer war nirgends mehr anzutreffen. Purer Zufall? Und wenn nicht: Wieso deckte ausgerechnet Kuhlmann ihn plötzlich mit Hinweisen ein? Weil er glaubte, es sei in Mirandors Sinne? Erst knallte er ihn ab und dann gab er dessen Testamentsvollstrecker? Wohl kaum. Wenn Kuhlmann aber log, dann konnte die Beschreibung erst recht kein Zufall sein. Dann wollte ihn jemand auf Santers Spur lenken. Nicht Kuhlmann selbst. Leute wie er waren in den Getrieben dieser Welt immer nur kleine Rädchen, die geschmiert wurden. Wer dann? Um einen Zusammenhang zwischen Mirandor, Santer und Anna konstruieren zu können, musste man sowohl über die spanischen wie auch die deutschen Ermittlungen Bescheid wissen. Und Strecker, der einzige, der sich dafür aufdrängte, fiel nun aus. Nicht minder schleierhaft blieb Markus, weshalb er auf Santers Spur gelenkt wurde. Um ihn in die Irre zu führen? Ihn irrezumachen? In letzterem Fall hatte sich die Mühe gelohnt: Ihm rauchte schon jetzt der Kopf. Er kühlte ihn mit einem Whiskey auf Eis. Plötzlich überkam ihn Sehnsucht nach Anna. Er holte sich die Handakte und betrachtete ihr Bild. Was sie wohl in diesem Moment machte? Ob sie an ihn dachte? Wenn ja, dann wahrscheinlich mit Abscheu. Vielleicht hasste sie ihn sogar. SLIPEINLAGE | D-EPPSTEIN/TAUNUS Anna saß am runden Esstisch im Wohnzimmer ihres Apartments, vor sich eine Tasse Tee und einen spanischen Lernthriller. Sie blickte aus dem Fenster auf ihren kleinen, von einer weißen Ziegelsteinmauer begrenzten Hof im Hof, ihre Auslaufzone. Alexander hätte längst kommen müssen. Stattdessen kam Iwan. Zwei ihr unbekannte Männer marschierten hinter ihm her. Ein beängstigender Aufmarsch. Und Anna begriff schnell, dass es genau so gemeint war. Iwan packte sie, zog sie ins Bad und zwang sie, sich auszuziehen. Dann musste sie sich vorbeugen und er forschte wonach auch immer in Körperöffnungen, die von der Evolution nicht als Versteck gedacht waren. Er ließ ihr keine Zeit, der Demütigung nachzufühlen. Kaum hatte er die Leibesvisitation beendet, checkte er ihre Klamotten quadratzentimeterweise. Was suchte er bloß? Nachdem sie sich wieder bekleidet hatte, schickte er sie ins Wohnzimmer, das einer seiner Männer gerade auseinandernahm. Plötzlich fiel ihr Engels Handy ein, das sie in dessen Saccotasche gefunden hatte, zusammen mit einem verknüllten 10-Euro-Schein. Sie besaß es noch. Es war sogar wieder geladen. Sie hätte nicht sagen können, wie sie es zustande gebracht hatte, und warum. Zwei entgegengesetzte Kräfte hatten sie bewegt. Auf der einen Seite die taube Verzweiflung nach der Begegnung mit Engel, auf der anderen Seite die flirrende Angst, als das große Schießen vor dem Haus in Salou einsetzte. Ein Krieg war ausgebrochen und Alexander hatte ihn angezettelt. Der einzige Mensch, der ihr blieb, ging über Leichen. Ihr Selbstbehauptungswille zerbröselte wie ein morscher Ast. Nein, mit Selbstbehauptung hatte es nicht zu tun, dass sie das Durcheinander in Salou nutzte, um ein herumliegendes Ladekabel an sich zu nehmen. Es war ihr so verdammt gleichgültig gewesen, ob sie erwischt wurde. Und sie hatte so verdammten Schiss gehabt, was man ihr vielleicht noch antun wollte. Das Kabel erschien ihr wie ein letztes Rettungsseil. Sie ergriff es aus einem instinktiven Reflex. Weder wusste sie, zu dem Zeitpunkt, dass der Akku leer war, noch dachte sie darüber nach, wie sie das Handy ohne PIN nutzen sollte. Eingeschaltet hatte sie es nicht. Natürlich hatte sie Alexander nichts von der Begegnung mit Engel erzählt. Wenn die Kerle jetzt das Handy aufspürten und den PIN-Code knackten, wusste er, dass sie ihn angelogen hatte. Er würde glauben, sie hätte Kontakt zur Polizei aufgenommen. Verstohlen näherte sie sich der offenstehenden Badezimmertür. Sie hatte das Handy genau da versteckt, wo Iwan soeben hinsah: in dem kleinen Abfalleimer neben der Toilette, mit Slipeinlagen verklebt, die sie zur Abschreckung mit Teesatz beschmiert hatte. Iwan öffnete den Deckel und blickte angewidert hinein. Stell den Eimer wieder hin! Anna versuchte, es ihm einzuflüstern, wie sie es mit Kerberos getan hatte. Doch weder das Abschreckungsmanöver noch die Einflüsterung zeigten Erfolg. Er nahm den Eimer hoch und stülpte ihn wie einen Würfelbecher auf den Toilettenvorleger. In der Erwartung eines ohrenbetäubenden Schepperns erstarrte Anna. Aber der hochflorige Vorleger schluckte die Geräusche. Mit angehaltenem Atem blickte sie zu Iwan. Er hob den Eimer an. »Boss, du kommen, glaube, ich finden was in Schlafzimmer.« »Komme.« Er ließ den Eimer auf den Handy-Slipeinlagen-Haufen sinken und stiefelte davon. Anna schlüpfte ins Bad. Die Tür zuzuziehen traute sie sich nicht. Allerdings musste sich der Wohnzimmerspürhund bloß umdrehen, um sie zu ertappen. Augen zu und durch. Sie ging schnurstracks zum Eimer, bückte sich, fasste drunter, fischte mit fliegenden Fingern das Handy heraus und steckte es hastig unter die Jogginghose in den Schlüpfer. »Was machst du da?« »Ich … wollte aufräumen, dachte du bist hier fertig.« »Was ist das?« Iwan hielt ihr einen Zettel mit Zahlen vors Gesicht und beinahe hätte sie gelacht. »Frag deinen Chef.« Schlechte Antwort. Ehe sie sich versah, zog Iwan sie an den Haaren ins Wohnzimmer. »Ich frage dich.« »Heißt Sudoku, so was wie ein Kreuzworträtsel aus Zahlen.« Sie konnte es gar nicht schnell genug erklären, denn ihr nach vorn gebeugter Oberkörper drückte das Handy aus der Unterhose. »Ist von Alexander, zum Zeitvertreib. LASS BITTE LOS!« Iwan tat ihr den Gefallen. Sie selbst tat sich allerdings keinen Gefallen, als sie den Oberkörper allzu schnell wieder aufrichtete, denn dabei schlüpfte das Handy endgültig hinaus. Einen Moment spürte sie es frei schwebend zwischen Slip und Jogginghose. Es fiel. Plötzlich war es Anna, als wäre die Zeit stehen geblieben. Als hätte auch das Handy den freien Fall unterbrochen. Es schien innezuhalten und einer Lösung zu harren. Der Augenblick währte keinen Wimpernschlag und doch lange genug, Anna ihre einzige Chance bewusst zu machen. Schon lief die Uhr wieder und das Handy nahm Fahrt auf. Anna ebenso. Sie warf sich, einen Meter Luftlinie mit der Kraft der Verzweiflung überwindend, in ihren Lesesessel. Bei der Landung fühlte sie das Handy am Unterschenkel, Tendenz fallend. Mit einem heftigen Ruck riss sie das Bein auf den Sessel. Plötzlich begann sie zu weinen. Iwan sah ratlos von ihr zum Wohnzimmerspürhund. »Hast du den Sessel schon?« Der Mann kratzte sich am Kopf und nickte schließlich. Anna durfte bis zum Ende der Durchsuchung sitzen bleiben. In dieser Zeit wurde ihr erst so richtig klar, wie viel Angst sie vor Alexander, ihrem Retter, hatte. KOPFLOS | D-FRANKFURT/MAIN Seit halb zwei saß Bodo Ogentaff in einem Vernehmungsraum des Polizeipräsidiums und führte eine Zeugenvernehmung durch. Ihm gegenüber saßen Holland und dessen Rechtsbeistand Dr. Marns, ein junger, glatter Anwalt. Holland hatte nicht, wie von Markus vorausgesagt, auf einer förmlichen Vorladung bestanden, sondern im Gegenteil auf einen schnellen Termin gedrängt. Markus sähe Gespenster, hatte Ogentaff vermutet, doch seit einigen Minuten war er sich da nicht mehr so sicher. Denn Holland zeigte plötzlich Nerven. »ICH KANN DOCH NICHTS ZUGEBEN, WAS ICH NICHT GETAN HABE!« Ogentaff kannte diesen Satz zur Genüge. Er markierte die ultimative Rückzugslinie, das letzte Argument eines Tatverdächtigen, der mit dem Rücken zur Wand stand. Nur gab es nicht die geringste Veranlassung dazu. Holland fühlte sich durch eine an sich harmlose Frage in die Ecke gedrängt. »Ich denke, mein Mandant hat Sie falsch verstanden«, stellte sich Marns schützend vor ihn. »Angesichts Ihrer latenten Feindseligkeit ist das nur zu verständlich.« Ogentaff ignorierte das durchsichtige Ablenkungsmanöver. »Hören Sie sich bitte noch mal an, was ich Sie gefragt habe, Herr Holland.« Er spulte das Band in der Hoffnung zurück, den Mann durch die Wiedergabe seines unsinnigen Gestammels weiter zu verunsichern. Was er von Holland wissen wollte, wusste er allerdings selbst nicht. Offiziell vernahm er ihn als Zeugen im Fall Heydt, doch tatsächlich ging es um mehr. Aber um was? Davon hatte auch Markus offenbar keine Vorstellung. In einem musste man ihm allerdings recht geben: Holland verhielt sich, wie Täter sich verhalten, die Antennen weit ausgefahren und krampfhaft bemüht, sich nicht von der Marschroute abbringen zu lassen. Markus hatte einen Schnösel angekündigt, doch erschienen war ein ängstlicher Mann, der langsam die Nerven verlor. Ogentaff drückte die Wiedergabetaste des Aufzeichnungsgeräts: »Haben Sie irgendwann jemandem gegenüber erwähnt, dass sich in der Intimzone Ihrer Exfrau ein Feuermal befindet?« Das Band rauschte einige Sekunden. »Ein Feuermal, ja? Sie sagten, ein Feuermal? In der Intimzone also. Ich wusste gar nicht, dass da …, das heißt, ich erinnere mich kaum … Wem hätte ich das denn verraten sollen?« »Sie könnten es mal nebenbei erwähnt haben.« »Nebenbei? Wie denn nebenbei? Ich … ich habe die Frau doch seit Jahren nicht mehr gesehen.« »Trotzdem könnten Sie von ihr gesprochen haben.« »Ich rede mit niemandem!« »Sie reden mit niemandem? Meinen Sie das ernst?« »Ja, ja, ja! Ich rede mit niemandem … ähm »Mein Mandant …« »Lassen Sie Ihren Mandanten ausreden!« »Ich rede mit niemandem über Frau Heydt.« »Vielleicht früher einmal, als sie noch verheiratet waren.« »ICH KANN DOCH NICHTS ZUGEBEN, WAS ICH NICHT GETAN HABE!« Ogentaff stoppte das Band. Die Idee, Holland nach dem Feuermal zu fragen, kam von Markus – eine spontane Eingebung, mit der er das richtige Näschen bewiesen hatte. Holland sah Hilfe suchend zu seinem Anwalt, der ihm aufmunternd zunickte. »Sie haben doch nichts zu verbergen, Herr Holland. Es widerspricht ja auch jeder Lebenserfahrung, grundlos ein Feuermal zu thematisieren. Und selbst wenn: Wer würde sich schon an eine derart nebensächliche Bemerkung erinnern.« Zu Ogentaffs Überraschung sprang Holland auf die Steilvorlage seines Anwalts nicht an. Marns knetete seinen Mandanten förmlich mit den Augen durch, drang jedoch nicht zu ihm durch. »Wo könnte ich das nur erwähnt haben?«, murmelte Holland nur. »Vielleicht abends in feuchtfröhlicher …?« »Schon gut, Dr. Marns!« Ogentaff gewann allmählich den Eindruck, als treffe der Anwalt die Entscheidungen, was hier erzählt wurde und was nicht. »Zurück zu meiner Frage, Herr Holland. Das Feuermal spielt eine entscheidende Rolle im Fall Heydt. Ich verlange deshalb eine klare Antwort: Wem haben Sie davon erzählt?« »Mein Mandant hat mitnichten …« »Könnte ich ein Glas Wasser bekommen?«, platzte Holland dazwischen. Auf seiner Stirn zeichneten sich Schweißperlen ab. »Nachdem Sie meine Frage beantwortet haben. Wie gesagt: Antworten, mit denen Sie sich belasten würden, müssen Sie nicht geben.« »Nein, nein, das nicht, kein Problem«, stammelte Holland. »Wo also könnte ich so etwas gegebenenfalls erwähnt haben? Vielleicht mal in geselliger Runde?« »Ich beginne mich über Sie zu wundern, Herr Holland. Nachzuerzählen, was Ihr Anwalt Ihnen vorkaut, ist nicht das, was ich unter einer ehrlichen Aussage verstehe.« »Ich kann mich nicht erinnern, irgendwem von diesem verdammten Ding erzählt zu haben«, entgegnete Holland trotzig. Er schien sich zu fangen. »Na, warum sagen Sie das denn nicht gleich? Dann ist das doch geklärt.« War es natürlich nicht. Ogentaff würde darauf zurückkommen, sobald sich Holland eine weitere Blöße gab. »Sprechen wir über ein anderes Thema. Woher hatten Sie 2005 plötzlich das Geld, um Ihre Betrugsopfer zu entschädigen?« Marns warf sich sofort in die Bresche. »Wenn Sie meinen Mandanten verdächtigen, haben Sie ihn als Beschuldigten zu vernehmen und über seine Rechte aufzuklären.« »Ich verdächtige Herrn Holland lediglich, seine Zeugenpflichten zu vernachlässigen. Also vergewissere ich mich, wo seine Bereitschaft endet, wahrheitsgemäß auszusagen.« »Wie mein Mandant vor vier Jahren zu Geld gekommen ist, also bevor er Frau Heydt überhaupt kennengelernt hat, betrifft in keiner Weise die Glaubwürdigkeit seiner Aussagen in diesem Fall.« »Waren Sie schon damals sein Anwalt?« »Wieso? Nein.« »Sind Sie mit Dr. Marns schon länger bekannt, Herr Holland?« »Was? Nein.« »Woher weiß er dann, wann Sie Frau Heydt kennengelernt haben?« »Mein Mandat hat …« »Noch ein Wort, Dr. Marns, und ich setze Sie an die Luft«, unterbrach ihn Ogentaff ruppig. »Ich will die Antwort vom Zeugen hören.« Holland schwieg. In seinen Augen las Ogentaff einen Anflug von Panik. »Sie wissen nicht, was Sie sagen sollen? Na schön. Aber dann erklären Sie mir doch wenigstens, weshalb Sie meine banalen Fragen in solche Aufregung versetzen.« Weil die Todesangst wie Fleischerhände in seinen Gedärmen wühlte. Weil er noch nicht sterben wollte. Nach Engels Suspendierung hatte er gewähnt, mit dem schnöseligen Auftritt im Café davongekommen zu sein. Er ahnte seit Langem, wie wenig mit den Leuten zu spaßen war, an die er seit 2005 Firmengeheimnisse von Genamic Industries verriet. Und in deren Auftrag er späte Heydt angebaggert, geheiratet, ausspioniert und ein bisschen fertiggemacht hatte. Warum die sich für sie interessierten, wusste er nicht. Genauso wenig verstand er, was die mit den Informationen über die Frau anfingen, die sie gezielt abfragten. Um seiner Gesundheit willen vermied er, darüber nachzudenken. Hätte er das Geld damals nicht so dringend gebraucht, wäre er nie und nimmer eingestiegen. Aber damals hatte die Alternative Freiheit oder Gefängnis gelautet. Jetzt allerdings lautete sie womöglich Leben oder Tod. Nachdem er die Kontaktnummer angerufen und pflichtgemäß von Engels Befragung berichtet hatte, war ihm Marns als Anwalt zur Seite gestellt worden. Und als Aufpasser, da gab er sich keinen Illusionen hin. Die Lage hatte sich binnen Kurzem verschärft, Nervosität lag in der Luft. Sein Kontaktmann, dem er regelmäßig Konstruktionspläne zusteckte, war plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Vielleicht wurden jetzt, wo es sich zuspitzte, alle beseitigt, die Fehler machten. Und er kam gar nicht umhin, Fehler zu machen, denn die Gedanken in seinem Hirn kreisten wie in einer außer Rand und Band geratenen Zentrifuge. Er brauchte Ruhe, um wieder ins Lot zu finden. Und dazu musste er abtauchen, hier und jetzt. Stöhnend ließ er sich vom Stuhl sinken und murmelte, ihm sei schlecht. Dann schloss er die Augen. »Ein Schwächeanfall«, stellte der Notarzt eine Viertelstunde später fest und setzte Holland eine Spritze. »Wir bringen Sie zur Sicherheit ins Krankenhaus.« Markus war in einen flirrenden Dämmerschlaf verfallen, aus dem ihn das Klingeln des Telefons weckte. Bellingham vermeldete Neuigkeiten. »Huqqabi war, was man eine verkrachte Existenz nennt: Im Waisenhaus aufgewachsen und früh auf die schiefe Bahn geraten, ein Einzelgänger mit ungesunder Neigung zum Alkohol. Nach seinem Verschwinden 1993 ist er nie wieder aufgetaucht.« Bellingham hatte noch mehr zu bieten. »Well«, sagte er gedehnt, »lets move on to witchcraft«, kommen wir zum Hexenwerk. »Ich nehme an, du weißt bereits, worauf ich hinauswill. Ich bin auf einen Haftbefehl aus dem Jahr 1953 gestoßen. Er galt einem Mann namens Husain Rhan, ebenfalls pakistanischen Ursprungs. Rhan wurde der Vergewaltigung verdächtigt. Sieben Tage vor seinem vierzigsten Geburtstag hat man ihn zuletzt gesehen, danach scheint ihn der Erdboden verschluckt zu haben. Dem Nachbarn zufolge war Rhan ein geistig verwirrter Einzelgänger, er hatte Déjà-vu-Erlebnisse. Und nun der springende Punkt: Wenn man die Fotografien von Huqqabi und Rhan nebeneinanderlegt, meint man Zwillinge zu erblicken. Du hast es vorhergesehen, nicht wahr? Worum handelt es sich denn?« »Well«, gab Markus sich bedächtig. »Ich kann noch nicht viel sagen. Es geht um eine kriminelle Organisation, von deren Machenschaften ich bislang selbst keine nennenswerte Vorstellung habe.« Bellinghams Unlust, sich damit zufriedenzugeben, fraß sich schweigend durch die Leitung. Er fasste sie nicht in Worte, die alte englische Schule. Das Unglaubliche war also eingetreten: Es existierte ein zweiter Fall, der jedem gesunden Menschenverstand widersprach. Und nun? Nichts. Das Bild der Ermittlungen hatte nicht etwa an Schärfe gewonnen, es wirkte, im Gegenteil, nur noch verworrener. Vorerst blieb Markus nichts anderes übrig, als das Puzzlestück im Kopf zu behalten und nach einer passenden Lücke suchen. Am frühen Nachmittag, Bodo hat ihn bereits über Hollands Vernehmung und den mutmaßlich vorgetäuschten Zusammenbruch informiert, unternahm Markus eine vergebliche Rundreise zu Santers Wohnung und zur Wohnung des Zeugen aus dem Jugendcafé. Auch die anschließenden Streifzüge durchs Netz – er absolvierte unter anderem ein Kurzstudium in synthetischer Biologie und wusste nun, dass Genamic Industries Automaten zur Gensequenzierung herstellte – brachten ihn keinen Schritt voran. Mittlerweile war es fast fünf. Ein ganzer Tag für die Mülltonne und die Uhr kürzte die verbleibende Zeit im Sekundentakt. Das Telefon klingelte. »Es gibt dramatische Neuigkeiten«, ging Bodo gleich in die Vollen. »Holland hat sich umgebracht.« Markus fiel die Kinnlade runter. »Er muss das Markus-Krankenhaus, wohin ihn der Rettungswagen gebracht hat, unbemerkt verlassen haben. Um halb vier meldet ein Hotel im Bahnhofsviertel einen Notfall. Ein Zimmermädchen hat einen leblosen Mann vorgefunden – Holland. Er hat sich mit einem Mittel zu Tode gespritzt, das er wahrscheinlich im Krankenhaus entwendet hat. Keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung. Stattdessen ein handschriftliches Geständnis mit folgendem Inhalt: Er habe geheime Informationen, die er im Rahmen seiner Arbeit erlangt hat, an einen US-amerikanischen Wettbewerber verraten.« Markus schwieg eine Weile. Schließlich meldete er Zweifel an: »Geht ihr nicht etwas vorschnell von Suizid aus? Die Spritze kann ihm doch auch gesetzt worden sein.« »Wie gesagt: nicht der geringste Hinweis auf Fremdeinwirkung. Es ist auch im Hotel niemand aufgefallen, der da nicht hingehörte. Und dann noch das Geständnis.« »Trotzdem.« »Komm schon, Markus, ›trotzdem‹ ist kein Argument. Könntest du dich nicht in etwas verrannt haben?« »Am Tatort war ein Rechtsmediziner?« »Adam.« »Hast du schon was wegen des Jungen aus dem Video unternommen?« »Ich habe Kollegen zu den umliegenden Schulen geschickt. Noch haben sie ihn nicht aufgespürt.« »Wir hören voneinander.« Im Sektionssaal der Frankfurter Rechtsmedizin ging es trotz der vorgerückten Stunde hoch her. Rund ein Dutzend Weißkittel stand an vier Sektionstischen und zerlegte Leichen in ihre Bestandteile. Leute von der Kripo und Staatsanwaltschaft schauten mehr oder weniger genau zu. Markus durchquerte den Saal mit gesenktem Kopf. Bloß keine Begrüßungen, an die sich neugierige Fragen anschließen konnten. Plötzlich traf ihn ein Blick von unten. Eine Frau, die offenbar nur noch aus einem Kopf bestand, der verloren auf der Edelstahlplatte eines Sektionstisches lag, starrte ihn aus braunen Augen an. Im kalten Schein des Neonlichts wirkte ihr Gesicht verbittert, als beklage sie ihre haltlose Lage. Dr. Adam, der sein Team, eine Ärztin und zwei Sektionsassistenten, um Kopflänge überragte, stand am hintersten Tisch und redete auf zwei blasse junge Männer ein. Wahrscheinlich Medizinstudenten bei ihrer Autopsie-Premiere. »Ach, Engel, wieder im Dienst? Freut mich, freut mich sehr. Und schon zieht es Sie zu den Leichen? An welche dachten Sie denn? Lassen Sie mich raten. Den Suizidenten, richtig?« »Hallo, Dr. Adam. Wenn Sie Olaf Holland meinen, ja. Sie haben am Tatort die äußere Leichenschau durchgeführt?« »Exakt. Einen Moment noch, dann habe ich für Sie Zeit.« Er wandte sich an die Studenten. »Ihre Antwort steht noch aus. Warum öffnen wir weibliche Leichen mit einem u-förmigen Schnitt?« »Wegen der Besonderheit des Unterhautfettgewebes?«, wagte sich einer der beiden aus der Deckung. »Unsinn! Bringt man Ihnen denn nichts im Studium bei? Wir machen es natürlich aus Galanterie – um den Damen nicht das Dekolleté zu zerstören, schließlich wollen sie auch im Sarg einen hübschen Anblick abgeben. Ts, ts, ts, von Ritterlichkeit keine Spur mehr. Beweisen Sie jetzt wenigstens, dass Sie ganze Männer sind. Uns interessiert hier nämlich nur der Mageninhalt von Toten. Die innere Leichenschau …« Das Kreischen einer Oszillationssäge übertönte Adams Belehrungen. Ein Sektionsassistent hatte begonnen, die Schädeldecke der Leiche zu entfernen, um ans Gehirn zu gelangen. Als die Säge endlich verstummte, hörte Markus, wie Adam den Studenten die nächsten Schritte erklärte. »Wir entnehmen die Organe aus den verschiedenen Körperhöhlen und untersuchen sie. Ich beginne damit, die Luftröhre und Bronchien aufschneiden.« Adam trat vor den Organtisch und winkte Markus zu sich heran. »Wenn es Sie nicht stört, meine Aufmerksamkeit mit der Leiche zu teilen, können wir beginnen.« »Sie sprachen von einem Suizidenten. Fremdeinwirkung ausgeschlossen?« »Ganz und gar nicht. Sie kennen doch meine Sichtweise: Wir sind Automechaniker, die nach der Ursache merkwürdiger Klopfgeräusche suchen. Manchmal gelingt’s, manchmal nicht. Im Fall Holland lässt sich aus Automechanikersicht nur wenig sicher feststellen: Erstens handelt es sich beim mutmaßlichen Inhalt der Spritze um ein depolarisierendes Muskelrelaxans, das in Überdosierung tödlich wirkt. Zweitens eignet sich das Mittel, im Fall einer Überdosierung genau die Todesursache hervorzurufen, von der wir vorläufig ausgehen. Drittens war der Zylinder der Einwegspritze groß genug, ein tödliches Volumen aufzunehmen. Vermutlich werden wir das Mittel nicht im Körper nachweisen können, weil die Muttersubstanz eine sehr geringe Halbwertszeit aufweist. Sie verwandelt sich schon nach Minuten über ein Zwischenprodukt in endogene, sprich körpereigene Stoffe. Wir werden uns wohl oder übel mit einer Indizienkette begnügen müssen.« »Gibt es Anhaltspunkte, woher Holland das Mittel hatte?« »Soweit ich weiß … Warum fragen Sie eigentlich mich, Sie sind doch viel näher dran?« Adam ließ von den Bronchien ab und lächelte. »Ach so. Nach Ihrem Dienstausweis sollte ich Sie besser nicht fragen, richtig? Ihre Alleingänge haben sich nämlich bis in unser Totenreich herumgesprochen. Hoffe, Sie kommen ans Ziel, bevor Ihre Laufbahn kollabiert. Machen wir lieber schnell, Staatsanwalt Faber schaut schon rüber. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja: Wir sprechen von einem Muskelrelaxans, das seinen festen Platz in der Krankenhausroutine hat. Und wenn der Mann Mediziner war, wusste er natürlich, wie gut es sich eignet. Vielleicht brauchte er bloß zuzugreifen, als sich die Gelegenheit bot.« »Dr. Adam?« Die Ärztin hielt ihm eine Schale mit dem Hirn der Leiche hin. »Oho, da haben wir ein paar Sachen, die da nicht hingehören. Schauen Sie, Engel.« Adam deutete mit dem Zeigefinger auf ein Hirnareal. »Viele böse kleine Zellen, die der Gesundheit abträglich sind. Danke, Frau Kollegin.« »Was war eigentlich bei Holland die Todesursache?« »Atemstillstand.« Atemstillstand. Irgendetwas sagte ihm der Begriff. »Und das Mittel?« »Succinyldicholin.« Nein, damit konnte er nichts anfangen. »Tut mir leid, Engel, mehr habe ich nicht zu bieten.« »Ja, schon gut. Vielen Dank für …« Plötzlich erinnerte er sich: Die Patienten im ›hospital del horror‹ in Málaga waren an Atemstillstand gestorben. Aber das Mittel hatte anderes geheißen. »Eine Frage noch: Gibt es für diese Succin…« »Succinyldicholin.« »Gibt es dafür noch eine andere Bezeichnung?« »Der Handelsname lautet Lysthenon.« Adam sah ihn neugierig an. »Schiff versenkt?« »Nein.« »Einen Namen habe ich noch im Angebot: Suxamethonium. Schiff jetzt versenkt?« »Allerdings.« Verwirrt begab sich Markus nach draußen. So abwegig es ihm schien: Dass Suxamethonium sowohl in Mirandors wie auch in Annas Umfeld als dezentes Mordmittel auftrat, konnte keine weitere »zufällige Parallele« sein – es gab schon zu viele: Beide waren fast im selben Alter. Beide hatten in frühen Jahren ihre Eltern bei einem Brand verloren. Beide waren drangsaliert worden, Mirandor im »Heidenheim« und Anna im Kinderheim. Beide sahen sich urplötzlich dem Verdacht schwerer Verbrechen ausgesetzt. In beiden Fällen spielte sexueller Missbrauch eine Rolle. Beider Lebenslinien hatten sich vor wenigen Tagen im Raum Tarragona gekreuzt. Demnach gab es eine Verbindung. Demnach musste er Kuhlmanns Hinweis auf den Toten ernst nehmen, der Santer so auffällig ähnelte. Markus erinnerte sich an die SMS, die Anastasia auf Annas Handy gefunden hatte, und die mit »PS« endete – wie Postskriptum. Oder wie Peter Santer. Aber weshalb stieß ausgerechnet Kuhlmann ihn auf Santer? Markus glaubte ihm nicht, dass er Mirandor in Notwehr erschossen hatte. Eher glaubte er an einen Auftragsmord. In diesem Fall gehörte Kuhlmann zur Gegenseite – die dann auch hinter dem Fingerzeig auf Santer steckte. Wozu? Es konnte sich nur um eine Falle handeln. Mangels Alternativen würde er sich hineinbegeben. Und zwar noch heute Nacht. Am besten mit Rückendeckung eines Helfers, der Schmiere stand. Außer Tom fiel ihm allerdings niemand ein. Er rief ihn an. »Zunächst interessiert mich, woher du wusstest, dass Strecker Ursulas Geliebter war.« Tom hatte sich mittlerweile die Worte zurechtgelegt. »Ursula wollte unbedingt von ihm loskommen, aber sie stand wie in seinem Bann und ...« »Du meinst, sie war ihm hörig?« »Anfangs hat ihr nur gefallen, wie er sie hofiert hat. Bei euch lief es wohl nicht so gut und bei ihm … Er ist wohl ganz gut darin, einer Frau das Gefühl zu geben, dass sie begehrenswert ist. Irgendwie ist sie in eine Abhängigkeit geraten – aber bloß körperlich! Es hat ihr zugesetzt, weil: sie wollte es gar nicht! Sie musste sich aussprechen und ich war zufällig zur Stelle. Da hat sie mir auch ein Foto von ihm gezeigt.« »Ein pornografisches?« »Gott behüte, nein. Ein Passbild. Sie hat es vernichtet. Sie wollte zu dir zurück, Markus, daran darfst du nicht zweifeln!« »Das spielt keine Rolle mehr.« »Natürlich spielt das noch eine Rolle! Man kann vielleicht den Menschen abhaken, der einen enttäuscht hat, aber nicht die Enttäuschung.« »Hört, hört. Du entwickelst sich zum philosophischen Schwergewicht. Wie kommt’s?« »Jeder macht eben seine Erfahrungen. Im Übrigen zeigt dein lakonischer Ton nur, wie verletzt du bist. Aber Ursula hat dich geliebt – auf ihre Weise.« »Ich bin bloß entsetzt, wie wenig ich sie kannte. Ist natürlich nicht allein ihre Schuld, zum Aneinandervorbeileben gehören zwei.« »Ich bete manchmal für sie.« »Du tust was?« »Bestimmt ist sie nicht in die Hölle gekommen, sie war kein schlechter Mensch. Sie wird im Fegefeuer sein und ich bete, dass sie bald erlöst wird.« Und wie er betete! Für sie – und ein bisschen auch für sich. »Du glaubst doch nicht ernsthaft an den Quatsch?« »Meinst du etwa, man würde nicht für seine Taten bestraft?« »Jedenfalls wird man nicht geröstet. Hölle und Fegefeuer kann sich nur ein Grillfanatiker ausgedacht haben. Wenn man beim Übergang vom Leben zum Tod überhaupt in etwas schmort, dann in schmerzlicher Selbsterkenntnis, wie man wirklich gewesen ist. Dürfte auch kein Honigschlecken sein.« »Weiß schon, ist grad nicht in, was ich sag. Aber das ist nur Zeitgeist. Vor, was weiß ich, dreihundert Jahren hättest du dich mindestens so sehr gewundert, wenn ich nicht an die Hölle geglaubt hätte.« »Jetzt musst du bloß noch sagen, da residiert der leibhaftige Teufel.« »Schau dir die Welt doch an. Gerade ein Polizist sieht doch ständig seine Handschrift. An den Teufel zu glauben ist doch viel leichter als an Gott.« Markus schwieg vor Verblüffung. Hatte er nicht wer weiß was auf seine Menschenkenntnis gegeben? Da hatte ein Blinder seinen scharfen Blick gepriesen! Nichts hatte er erkannt, weder seine Frau noch seinen Zwillingsbruder. Und Anna vielleicht auch nicht. Er atmete durch. Den Luxus, sich mit Selbstvorwürfen zu quälen, musste er auf später verschieben. Er setzte Tom auseinander, wobei er Hilfe brauchte. Anschließend fuhr er zu Santer. Erwartungsgemäß öffnete niemand und er klingelte woanders. Die Türsprechanlage knarzte, dann leuchteten LED-Lämpchen um ein Video-Auge auf. Er verschaffte sich unter einen Vorwand Einlass und verließ keine Minute später das Haus wieder. In einem nahe gelegenen Café rief er Triebel an. Vielleicht konnte der das Geheimnis der »Zwillinge« entschlüsseln. Vielleicht hatte er sogar eine Idee, was man sich unter der »Ernte« eines Menschen vorstellen musste. Wenn Mirandor geerntet werden sollte, dann ja vielleicht auch Anna. Markus fröstelte bei dem Gedanken. Statt Triebel meldete sich eine aufgeweckte kleine Stimme, die ihm mitteilte, ihr Papi sei noch in der Arbeit, »weil Papi muss heute sein Sternenheft fertig machen. Wusstest du, dass Papi mich Sternchen nennt? Aber wir sind alle aus Sternen, du auch. Ich muss auflegen, wir fahren jetzt zu Tante Miriam ins Wochenende. Tschü-hüss.« Markus wählte Triebels Büronummer. »Hallo, Herr Engel. Sie rufen gerade richtig an, vor zwei Minuten habe ich den Rotstift fallen gelassen und die Druckfreigabe erteilt. Unsere neue Ausgabe befasst sich mit dem Multiversum!« Seiner Stimme nach ein begeisterndes Thema. »Ist das ein anderes Wort für Universum?« »Das Multiversum besteht aus einer astronomischen Menge von Universen! Nicht Millionen, nicht Milliarden, nicht Billiarden! Es ist von unendlicher Größe, schier unermesslich und es wächst und wächst, im Millisekundentakt ein neuer Urknall und ein weiteres Universum sprengt hervor. Unter dem Mikroskop des Schöpfers wäre unser gewaltiges Universum dann kleiner als für uns ein Elementarteilchen. Eine Theorie besagt sogar, dass es Sie und mich nicht nur in dieser Welt gibt. Wir haben Doppelgänger in Parallelwelten.« »So?« »Ja. Durch Quantenverschränkungen splittet sich unsere Welt ununterbrochen in neue Weltenzweige auf, hier sind Sie Polizist, in einer zweiten Welt vielleicht …« »Perry Rhodan.« »Ja, ich weiß, es klingt nach Science-Fiction. Ist es aber nicht. Die Theorie ist natürlich umstritten, doch immer mehr Kosmologen vertreten sie, darunter Nobelpreisträger! – Ähm, ja. Es gibt doch nicht etwa Neuigkeiten von Frau Heydt?« »Es gibt Hinweise, auf die ich mir keinen Reim machen kann, und da dachte ich, wir könnten uns vielleicht zusammensetzen. Ihrem naturwissenschaftlichen Verständnis erschließt sich womöglich etwas, das mir verschlossen bleibt.« »Aber immer doch!«, willigte Triebel launig ein. »Ich wollte gerade nach Hause fahren. Besuchen Sie mich doch! Vielleicht zusammen mit Herrn Lexied? Ist ein prima Kerl, ähnelt Ihnen übrigens ein wenig in seiner Art. Er hat bestimmt Zeit, der Arme ist ja alleinstehend. Also bei einem so gut aussehenden Mann verstehe ich das nicht. Haben Sie eigentlich Kinder?« »Nein.« »Auch nicht, schade.« »Ich werde Dr. Lexied fragen. Ein kluger Kopf mehr kann nicht schaden. Auf meinen ist derzeit leider kein Verlass.« Er legte auf, rief den Anwalt an und schilderte sein Anliegen. »Grundsätzlich sehr gern, aber heute Abend ist es leider unmöglich. Lassen Sie uns doch jetzt reden.« Markus schilderte seinen Wissensstand. Schließlich berichtete er von den beiden vermeintlichen Zwillingspaaren. »Ich bin zunächst auf einen Bernd Kubik und einen Kurt Bohl aus Deutschland gestoßen, und dann auf zwei Männer namens Rohan Huqqabi und Husain Khan aus … Kleinen Moment … Nein, der zweite Mann heißt Rhan, nicht Khan. Die vier Männer sind nur wenige Tage vor ihrem vierzigsten Geburtstag verschwunden – genau wie Frau Heydt. Man könnte fast meinen, dass die Zahl vierzig eine besondere Rolle spielt, denn auch der Altersabstand beträgt rund vierzig Jahre.« »Wie sieht es mit den Fingerabdrücken aus?« »Nicht mal eineiige Zwillinge haben identische.« »Haben Sie eine Theorie, wie das alles zusammenhängen könnte?« »Ja, aber eine ziemlich verwegene.« Markus skizzierte das Bild, das er sich aus den vorhandenen und hinzugedachten Puzzlestücken gemacht hatte. Lexied hörte schweigend zu und schwieg auch noch, nachdem Markus seine Ausführungen beendet hatte. »Überzeugt Sie nicht, richtig?« »Anwälte sind zwar grundsätzlich allwissend, aber von dieser Materie verstehe ich dann doch zu wenig. Da kann Ihnen Herr Triebel wahrscheinlich ein qualifizierteres Feedback geben.« »Jetzt reden Sie nicht um den heißen Brei herum. Wenn ich mich verrenne, finde ich Frau Heydt nie!« »Mir scheint Ihre Theorie etwas weit hergeholt. Ich hätte eher an eine esoterische Gruppierung gedacht. Die Bezeichnung ›Vater‹ scheint mir auf einen Ehrentitel hinzuweisen. Vielleicht Leute, die sich aus östlichen Philosophien bedienen.« »Wieso?« »Wegen des ›Energielevels‹. Wie lautete der Satz noch?« »Sein Energiepegel steigt schon wieder.« »Ich glaube nicht, dass die Medizin diesen Begriff verwendet. Energie verbinde ich mit fernöstlichen Weltanschauungen oder Religionen.« »Aber das erklärt nicht, wie Holland und Genamic Industries involviert sind. Aber vielleicht muss man Wissenschaft und Wahnsinn in diesem Fall auf einen Nenner bringen.« »Das klingt … interessant.« »Sprechen Sie ruhig Klartext, für Höflichkeiten ist die Zeit zu knapp.« »Sie haben recht. Nein, Ihre Theorie überzeugt mich nicht. Wo immer Frau Heydt sich aufhalten mag – in Absurdistan wohl eher nicht. Ich frage mich auch, warum sie an diesem Deal interessiert sein sollte.« Markus versuchte sich an einer Antwort. »Na ja, wenn Sie meinen«, entgegnete Lexied ungläubig. »Und warum mühen sich die Täter jahrzehntelang an ihren Opfern ab? Haben Sie dafür auch eine Theorie?« Nein, hatte er vorerst nicht. »Ich würde den esoterischen Ansatz weiterverfolgen, Herr Engel. Verdammt, eine so bizarre Organisation, die seit Jahrzehnten am Werk ist und grenzüberschreitend agiert, von Deutschland über England bis nach Spanien, und wer weiß, wo noch, muss doch Spuren hinterlassen haben. Nicht mal die Freimaurerlogen konnten lange vor der Umwelt geheim halten, was sie treiben. Und aus der Kriminalgeschichte fällt mir kein einziger Fall ein, in dem man erst nach Jahrzehnten etwas von einer mafiösen Vereinigung bemerkt hätte. Ihnen etwa?« Da musste Markus passen. Er bedankte sich für die ehrliche Rückmeldung und legte frustriert auf. DREI SÄTZE ZU VIEL | D-EPPSTEIN/TAUNUS Heißes Wasser strömte über Annas Körper, seit fast einer Stunde schon, und immer noch zitterte sie vor Kälte und Bestürzung. Ein Zettelchen hatte sie in diesen Zustand versetzt. Sie hatte es in dem verknüllten 10-Euro-Schein gefunden, der sich in Engels Sakko befunden hatte. Drei Sätze standen auf dem Zettelchen. Die ersten beiden hatten sie verwirrt, der letzte vollkommen verstört: Mirandor ist wieder bereit, geerntet zu werden. Was um alles in der Welt hatten sie mit dem Spanier angestellt? Obwohl das heiße Wasser ihre Haut bereits rot färbte, rollten ihr kalte Schauer über den Rücken. Die Sprengkraft des Satzes hatte etwas in ihrem Inneren freigelegt, das sich mit frostiger Schärfe ins Bewusstsein fraß. Als habe der Satz etwas mit ihr selbst zu tun. Alexander tat, als handle es sich bei dem, was er ihr vorschlug, um eine einmalige Aktion. Vielleicht log er. Vielleicht hatte er mit Mirandor dasselbe vor und auch ihn bereits in der Mangel. Nur erklärte das nicht, warum ihre Knochen klapperten, seit sie den Scheiß gelesen hatte. Woher kam dieses Entsetzen? Jetzt reicht’s! Wütend über ihr Warmduschergeheule, drehte sie den Wasserhahn in die andere Richtung. Die kalten Tropfen schlugen wie Nadelspitzen auf ihre Gänsehaut. Sie ertrug es mit zusammengebissenen Zähnen. Schließlich drehte sie das Wasser ab, rubbelte sich trocken und legte sich im Bademantel unter die Bettdecke. Gegen ihren Willen wünschte sie sich, Markus wäre bei ihr. Einsamer hatte sie sich nie gefühlt. Nein, das stimmte nicht. Auch als ihre Eltern gestorben waren, hatte die Einsamkeit sie auf diesen endlos leeren Ozean hinausgetrieben. Ein Klopfen. Alexander trat ein und betrachtete sie abschätzend. »Geht es Ihnen nicht gut?« »Mir ist nur kalt.« Er platzierte seinen dürren Arsch auf der Bettkante, wie es früher Mama oder Papa zur Schlafenszeit getan hatten. »Sie dürfen jetzt nicht krank werden.« Er musterte die Kandidatin. Irgendwas stimmte nicht. Er lotete die Schwingungen aus. IX-α zweifelte, ob sie die richtige Entscheidung traf, was normal und leicht zu korrigieren war. Doch da schwang noch etwas anderes mit. Er rückte näher an sie heran. »Wenn Sie sich krank fühlen, müssen Sie es sagen!« »Nein, nein. Ich bin bloß nachdenklich.« »Lassen Sie mich an Ihren Gedanken teilhaben, Anna.« Was war denn in den gefahren? Hatte er ein Groschenheft verschluckt? »Ich frag mich, was meine Eltern dazu gesagt hätten, dass ich mich auf Ihren Handel einlasse.« »Ihre Eltern hätten nur das Beste für Sie gewollt. Und es ist das Beste!« »Meine Eltern haben mir beigebracht, sich dem Leben zu stellen!« »Man muss wissen, wann das Spiel verloren ist.« »Vielleicht hätten sie das Spiel noch nicht verloren gegeben.« »Doch, das hätten sie.« »Sie haben ja keine Ahnung.« »Da täuschen Sie sich. Eigentlich sollten Sie mich gut genug kennen, um zu wissen, dass ich auch über Ihre Eltern Erkundigungen eingezogen habe. Schließlich hängt auch für mich einiges davon ab, ob ich mit Ihnen die richtige Wahl treffe.« »Ja, ich kenne Sie gut genug, um zu wissen, dass Ihnen alles zuzutrauen ist.« »Ihre Eltern waren nicht so unanfechtbar, wie sie Ihnen in Ihrer Kleinmädchenerinnerung scheinen.« »Kommen Sie mir jetzt nicht damit, meine Eltern seien nicht astrein gewesen.« Anna richtete sich auf. »Ich lasse nichts auf sie kommen, klar? Meine Eltern waren aufrechte Menschen!« Er schwieg nachdenklich und Anna hätte einiges dafür gegeben, seine Gedanken lesen zu können. Sie hätte dann gelesen, wie er abwog: Wenn er sich für die – Heydt hoffentlich deprimierende – Stasi-Variante entschied, befleckte er den Trumpf, den er noch im Ärmel hatte. Aber aller Erfahrung nach handelte es sich bei diesem Aufbegehren der Kandidatin lediglich um ein letztes Aufflackern. Er würde die Trumpfkarte nicht ziehen müssen. »Wenn Sie Ihre Eltern für mutige Regimekritiker halten, haben Sie leider nur teilweise recht. Zunächst waren sie es, das stimmt. Doch dann hat die Stasi den Druck erhöht, und sie mussten klein beigeben.« »Sie Lügner!« »Ihre Eltern haben als Informelle Mitarbeiter für die Stasi gearbeitet. Ich besitze eine Kopie der Akte und kann sie Ihnen zeigen. Möchten Sie sie sehen?« »NEIN!« Er ließ es nicht dabei bewenden. So kurz vor dem Stichtag musste er jeden Funken von Widerstand im Keim ersticken. »Dann erzähle ich es Ihnen. Erstens: Ihre Eltern haben Freunde bespitzelt. Zweitens: Sie haben diese Freunde an die Stasi verraten. Drittens: Sie haben in Prozessen gegen ihre Freunde ausgesagt.« Scheinbar ermattet sank Anna aufs Kopfkissen. Aber in ihrem Inneren brodelte es. Niemals würde sie ihm diese Gemeinheit verzeihen. Sie ließ sich die Erinnerung an ihre Eltern nicht beschmutzen, da konnte er ihr tausend Akten zeigen. Erstens, zweitens, drittens? Das waren drei Sätze zu viel gewesen. Annas Angst verwandelte sich in Aggression, ihr Entsetzen in Entschlossenheit. Sollte er sich sonst wen für seine verschissenen Angebote suchen, sie hatte genug davon. Ihr Leben war Scheiße in Vollendung, klar. Aber wenn die eisige Unruhe, die der Satz von der Menschenernte in ihr hervorrief, etwas mit Alexanders Angebot zu tun hatte, würde sie sich bloß noch tiefer in die Scheiße reiten. Aus, Schluss und vorbei und höchste Zeit, das Weite zu suchen. Alexander würde sie natürlich nicht ziehen lassen, da konnte er von Freiwilligkeit schwadronieren, soviel er wollte. Doch sie hatte eine Vorstellung, wie sie vielleicht türmen konnte. Und die Vorlage hatte er ihr selbst geliefert. Anna schloss die Augen und stöhnte auf. »Sie müssen nicht verzweifeln, Anna. Mein Ehrenwort, Sie …« Anna stöhnte erneut und hielt sich die Hände über den Bauch. »Sind Sie doch krank?« »Nein, nein. Nur ein Unwohlsein …« Sie servierte ihm noch ein Stöhnen. »Das geht schon wieder vorbei.« »Sie müssen von einem Arzt untersucht werden.« »Das will ich nicht, Alexander!« Sie öffnete die Augen und sah ihn mit Kleinmädchenmine an. »Und weshalb?« »Wenn der merkt, dass hier etwas nicht stimmt … Ich will nicht, dass unser Handel platzt!« Das klang schon besser. Wie vorhergesehen hatte die Dosis Seelengift ihre Lebensgeister betäubt. Anstelle des Zweifels herrschte wieder die Verzweiflung. »Natürlich kommt er nicht hierher. Es gibt im Ort einen zuverlässigen Internisten. Der wird Sie untersuchen.« Die medizinische Betreuung hatte in den vergangenen Jahren S oblegen. Obwohl er nie einen Abschluss erworben hatte, wäre jedes Universitätsklinikum an seinem Know-how interessiert gewesen. Auch sein Nachfolger, der designierte Ziehsohn Khaled, saß bereits in medizinischen Vorlesungen, brauchte aber noch eine Weile. Bis dahin musste es Gerd tun, der als Dr. Bofinger eine internistische Praxis im Ort unterhielt. Gerd wusste natürlich, dass sie irgendwo hier eine Basis unterhielten. Wo genau, wusste er nicht, und schon gleich gar nicht, dass es sich um die Zentrale handelte. Er würde es auch nie erfahren – Abschottung stand auf der Liste der Sicherungsmaßnahmen ganz oben. »Mikki wird Sie gleich abholen und in die Praxis bringen.« »Na gut.« »Sehen Sie, es kommt alles wieder ins Lot.« Freu dich nur nicht zu früh! Der Mann, der das Café Weite Welten im historischen Stadtbahnhof von Eppstein gegen sechs Uhr abends betrat, rieb sich die kalten Hände. Er hatte seit dem frühen Morgen den Ort durchwandert und in seinem dünnen Mantel zu frieren begonnen, als die flach stehende Sonne hinter westlichen Hügeln verschwand. Er nahm auf einem Hocker am Tresen Platz und bestellte einen Espresso. Bald verließ er das Café wieder und ging in Richtung Hauptstraße. Dahin wollte, in einem Peugeot aus der anderen Richtung kommend, auch Mikki. Neben ihm saß Anna und sah erleichtert, wie er einen an der Straße gelegenen Parkplatz ansteuerte, der ihr mehrere Fluchtwege eröffnete. Sie wollte aussteigen, doch er hielt sie am Mantelkragen fest. »Keine fiesen Matenten.« »Das heißt Fisimatenten. Ein Wort.« »Egal.« »Sag ich auch immer.« »Du quatschst gleich nicht rum.« »Ich sag dem Onkel Doktor, wo’s wehtut, sonst nichts.« »Ich warne: keine …« »… fiesen Matenten, schon klar.« Es kostete Anna Kraft, sich locker zu geben, damit Mikki nicht spitzkriegte, dass sie unter Starkstrom stand. Ihr fiel eine Zeile aus einem Gedicht von Goethe ein: Kühl bis ans Herz hinan. Genau diese Kaltblütigkeit brauchte sie jetzt. Mikki lotste sie an einer Reihe parkender Autos vorbei auf einen weißen Gebäudekomplex zu. Weder er noch sie bemerkten den Mann auf der anderen Straßenseite, der zu ihnen hinüberglotzte. Ohne den Blick abzuwenden, tastete der Mann nach der Pistole unter seinem Mantel. Dr. Bofinger gewährte Anna im Hinausgehen letztmalig sein luxuriöses PrivatpatientenLächeln. Er hatte eine Magenschleimhautentzündung diagnostiziert, nachdem ihm Anna, von seinem Privatpatienten-Nicken ermuntert, die entsprechenden Symptome vorgebetet hatte. Während Mikki sie das Treppenhaus hinabbugsierte, ging sie ihren Plan durch. Den Ausgangspunkt bildete der kleine Peugeot, eine Sparvariante, bei der man das Schloss manuell öffnen musste. Diesen Moment würde sie nutzen, um Mikki einen Tritt zu verpassen und zu dem kleinen Gehweg am rechten Ende des Parkplatzes zu spurten, natürlich Luftlinie, quer über die Fahrzeuge hinweg. Und dann ging es im Zickzack durch den Kleinstadtdschungel – wie es sich für eine Parkourläuferin gehörte. Der Muskelberg würde schnell kapieren, dass seine dicken Dinger beim Hindernislauf buchstäblich im Wege standen. Bevor sie aus dem Haus traten, packte Mikki ihr Handgelenk. Anna spannte die Muskeln an wie eine Katze vor dem Sprung. So konzentriert war sie auf die vor ihr liegenden Schritte, dass sie erst spät bemerkte, was hinter ihr geschah. Plötzlich blieb Mikki stehen. Seine Finger begannen, ihr Handgelenk zu zerquetschen. »Aua!« Sie sah wütend zu ihm hinüber. Da endlich bemerkte sie den Mann. Mit den scharf eingeschnittenen Gesichtszügen und dem rasierten Schädel wirkte er wie ein Kriegsveteran. Irgendwas drückte er Mikki ins Kreuz, und der hielt es offenbar für eine Waffe. »Nach vorne schauen«, schnauzte der Mann sie an. »Wir gehen über die Straße.« Anna traten vor Wut Tränen in die Augen. Warum musste der Kerl ihr ausgerechnet jetzt in die Quere kommen! Auf der anderen Straßenseite dirigierte sie der Mann zu einem blauen VW Golf, den er per Knopfdruck entriegelte. »Beide Türen öffnen«, befahl er Mikki. Der Mann drängte sie zwischen die Türen und befahl ihnen, sich umzudrehen. Er steckte die bewaffnete Hand in die Manteltasche und deutete mit dem Pistolenlauf auf Mikki. »Taschen leeren.« Nachdem Mikki sein vielteiliges Waffenarsenal auf den Fahrersitz gelegt und seine Schuhe unter das Fahrzeug geschoben hatte, befahl der Mann ihnen vorzutreten, um an die Waffen zu gelangen. Während sie sich in der engen Öffnung zwischen den Türen aneinander vorbeidrängten, sah Anna den Pistolenlauf auf Mikkis Bauch zielen. Sie hatten den Pas de trois beinahe vollendet, da wurde sie nach vorn gerissen. Gleichzeitig stieß Mikki die Fahrertür gegen den Angreifer und katapultierte ihn ins Wageninnere. Von Mikki mitgerissen, stolperte Anna die Straße entlang. Sie sah, wie der Mann die Wagentür zurückstieß und wieder hochkam. Wenn er was vom Schießen versteht, bin ich gleich tot, ging es ihr durch den Kopf. Eine Sorge, die Mikki offenbar teilte, denn er versuchte, sie näher an sich heranzuziehen. Als sie sich auf einer Höhe befanden, schrie sie plötzlich: »MIKKI, ACHUNG!« Er hielt einen Sekundenbruchteil inne und blickte sich um. Keinen Wimpernschlag später hellte sein Teint merklich auf – im Gegensatz zu seiner Stimmung. Anna hatte ihm mit dem Knie die Weichteile geplättet. Im nächsten Augenblick war ihr Handgelenk frei, im übernächsten steckte ihr Fuß in Mikkis Krallen fest. Lass los, Wichser! Anna visierte seinen Kopf wie einen Ball an und drosch mit dem freien Fuß dagegen. Dem Knirschen nach brach irgendwas und dem Schmerz nach konnte es nur ihr Fuß sein. Sie fiel hin, entkam aber seinem Griff. Während sie auf eine Schutz bietende Lücke zwischen zwei geparkten Autos zurobbte, sah sie sich um. Mikki rappelte sich schon wieder auf. Der Angreifer stand immer noch auf Höhe seines Wagens. Er hob die Waffe. Ein Schuss peitschte durch die Straße. Zu Eiszapfen gefroren, stierten die Passanten am Straßenrand vom Schützen zum Opfer. Unter der zusammengekrümmten Gestalt bildete sich eine Blutlache. Mikki sah zu Heydt, die im selben Moment wie er selbst zu Boden gegangen war. Hatte die Kugel sie getroffen? Er versuchte hochzukommen und da bemerkte er das Blut. Er spürte keinen Schmerz, hörte jetzt aber seinen Atem wie einen Dampfkessel pfeifen. Die Kugel musste einen Lungenflügel zerfetzt haben. Er biss die Zähne zusammen, die Kandidatin war alles, was zählte. Schwankend kroch er ihr hinter her. Anna starrte ihn regungslos an. In den irrlichternden Augen des Zombies zeichnete sich etwas ab, das nur Wahnsinn oder der Tod sein konnte. Bis sie sich endlich von dem Anblick löste, hatte er sie fast erreicht. Sie stieß einen Passanten beiseite, der zwecks besserer Glotzperspektive zwischen die Fahrzeuge getreten war, und hatte den Idioten schon hinter sich gelassen, da packte er sie am Mantel und zog sie zurück. Mit einer heftigen Bewegung drehte sie sich um, die Hand zur Ohrfeige ausgeholt. Sie ließ die Hand wieder sinken. Nicht der Passant hielt sie fest, sondern der Killer. »Du rennst vor mir her«, zischte er. Mikkis blutigen Anorak vor Augen, fügte sich Anna. Dass der Mann zu morden bereit war, bedurfte keines weiteren Beweises. Sie hatten bereits die erste Abzweigung erreicht, als endlich Bewegung in die Zuschauerreihen kam und jemand nach der Polizei rief. Nach dreißig Metern bogen sie in die nächste Seitenstraße und liefen auf eine Haltestelle zu. Anna sah einen Bus heranfahren. Das konnte der Arsch wohl kaum geplant haben. Warum hatte sie nie so einen Dusel? Kurz darauf passierten sie die Ortsgrenze. Zu allem Überfluss hatte Anna auch noch die Busfahrscheine von Engels Zehner zahlen müssen, weil der Trottel von Entführer nur Fünfziger besaß. Sie starrte, in Resignation schmorend, vor sich hin und lauschte nebenbei, wie zwei ältere Frauen die Leichen der vergangenen Wochen durchkauten. Schließlich gab sie sich einen Ruck. »Welchen Strauß Sie auch immer mit Mikki oder seinem Chef auszufechten haben, mich geht das nichts an, kapiert?« Der Mann reagierte nicht. »Die haben mich gefangen genommen. Mikki war mein Bewacher, geht das nicht in Ihren blöden Schädel?« »Sie bekommen noch ausreichend Gelegenheit, mir Ihr Herz auszuschütten.« Klang nicht gerade kuschelig, aber was hatte sie anderes erwartet? In ihrem Leben nahm doch alles die miesestmögliche Wendung. »Sie hören mir jetzt zu! Also: Der Chef dieser Bande hat mich erst mithilfe der Polizei in die Enge getrieben und anschließend einkassiert – für irgendein aberwitziges Experiment. Ich bin ein Opfer, Himmel Herrgott!« Sie kramte Engels Zettel aus der Tasche ihrer Jeans und hielt ihn dem Mann zum Beweis unter die Nase. »Das soll jemand gesagt haben, an dem möglicherweise ebenfalls ein Experiment durchgeführt wurde. Da sehen Sie, dass ich mir das nicht einfach ausgedacht habe.« Der Mann starrte auf den Zettel und begann zu zittern. Keine Minute später, der Bus fuhr gerade eine Haltestelle an, hörte Anna, wie der Fahrer über eine Straßensperre der Polizei informiert wurde. »Wir müssen raus, sonst haben uns die Bullen.« Er sah sie verständnislos an und stolperte schließlich hinter ihr her. Jetzt musste sie auch noch ihren Geiselnehmer pampern, ihr blieb wirklich nichts erspart. Sie schlugen sich in die Büsche. Zwei Stunden warteten sie, dann rief Anna von Engels Handy aus ein Taxi – der PIN war gar nicht aktiviert gewesen. Wahrscheinlich glaubte der Arsch, er sei von Amts wegen vor Verlust und Diebstahl geschützt. Was für eine überhebliche Nulpe. ECK, SCHNECK, DRECK, WEG | D-FRANKFURT/MAIN Um zwanzig vor zwei machte sich Markus auf den Weg durch die nächtliche Stadt. Er bog in den Alleenring ein, auf dem ihm nur vereinzelt Autos begegneten. Der Besuch bei Triebel hatte ihm keine neuen Erkenntnisse eingebracht. Dafür aber einen neuen Duzfreund – und vielleicht auch einen Kontakt zu Genamic Industries. Triebel kannte jemanden, der dort arbeitete. Markus’ Überlegungen, wie das um Anna und Mirandor gesponnene Rätsel zu lösen sei, hatte er allerdings eine noch klarere Abfuhr erteilt als Lexied: »Wissenschaftlich undenkbar!« Mittlerweile hielt Markus seine Theorie selbst für Unfug. Er passierte das Präsidium ohne hinzusehen. Was nicht hieß, dass ihn Schuldgefühle plagten. Es wäre ihm im Gegenteil verwerflich erschienen, nicht jedes Mittel zu Annas Rettung zu ergreifen. Er parkte seinen Toyota im Grüneburgweg und ging zur Aral-Tankstelle, die gegenüber der Abzweigung zur Parkstraße lag. Wo war Tom? Er konnte ihn auf dem dunklen Areal nirgends ausmachen. Plötzlich trat jemand aus dem Schatten hervor, ganz in Schwarz gekleidet. Am Gürtel hing eine Taschenlampe, um den Hals ein Fernglas. Filmreif. Jetzt fehlte nur noch das »unauffällige« Pfeifen. »Hallo, Tom.« »Hallo.« »Du musst nicht flüstern, macht nur verdächtig. Du hast dein Handy dabei?« Tom nickte. »Ich gehe jetzt in das Haus dort drüben. Du bleibst hier und stehst Schmiere.« »Ich dachte, wir brechen zusammen ein.« »Ich brauch dich hier draußen als Rückendeckung. Wenn sich jemand aufs Haus zubewegt, rufst du mich an. Stell dein Handy auf Vibrationsalarm.« »Wie kommst du da eigentlich rein?« »Habe die Schlösser geprüft. Dürften kein großes Hindernis darstellen.« »Hätte nicht gedacht, dass sich unser Ordnungshüter aufs Schlösserknacken versteht.« »Ja, ja. Hör zu, Tom: Versprich mir, dass du in Deckung bleibst, was immer passiert.« »Großes Indianerehrenwort!« »Da hinten steht mein Wagen. Wenn ich wieder rauskomme und wegfahre, beobachtest du, ob mir jemand folgt. Danach machst du dich aus dem Staub.« »Wie lange bleibst du?« »Vielleicht eine Stunde, mal sehen. Alles klar? Dann zieh dich wieder ein Stück zurück. Und: danke, Tom!« Vor dem Hauseingang zog Markus Latexhandschuhe aus der Jeans und streifte sie sich über. Drei Minuten später stand er in Santers Wohnung. Er vergewisserte sich, ob die Jalousien komplett heruntergelassen waren, dann knipste er die Taschenlampe aus, schaltete das Licht ein und begab sich in Santers Arbeitszimmer. Eine Etage über ihm betrat auch Daniel sein Arbeitszimmer. Er griff zum Telefonhörer und rief den Majordomus an. »Henry? Ich habe richtig gelegen, er ist drin.« »Verstanden.« »Rufe ich an?« »Nein, sie erwarten, dass ich anrufe. Meine Stimme kennen sie.« Henry legte auf und wählte die Nummer einer Polizeiwache. Er hatte sofort den richtigen Mann am Apparat. Er meldete einen mutmaßlichen Einbruch, wie es sich für einen braven Bürger gehörte. Dass der Polizist und dessen Kollege sofort aufbrechen sollten, um den lästigen Engel ins Jenseits zu befördern, sagte er nicht. Musste er nicht. Es war bereits ausgemacht. Markus besah sich den Raum. Am Kopfende vor dem Fenster stand ein alter Küchentisch mit weißer Resopalplatte, der als Schreibtisch diente. Links davon erstreckte sich ein Metallregal über die gesamte Längswand. Er durchforstete die Papierstapel auf dem Tisch, ohne etwas Interessantes zu entdecken, und wandte sich dem Regal zu. Von einigen Fachbüchern absehen, enthielt es lauter Aktenordner. Markus zog einen Ordner mit der Aufschrift »Buchprojekt 7/V« heraus und schlug ihn auf: eine Abhandlung über bewusstseinserweiternde Drogen. Er ließ seinen Blick über das Regal kreisen. Der Beschriftung auf den Ordnerrücken nach dienten sie ausnahmslos Buchprojekten. Trat Santer, dessen Institut nicht mal eine Homepage hatte, etwa mit Fachbüchern in die Öffentlichkeit? Zumindest nicht unter seinem Namen, sonst hätte es im Netz seinen Niederschlag gefunden. Vielleicht reagierte ein Fachmann, der etwas zu sagen hatte, aber nichts sagen durfte, auf diese stille Weise Ehrgeiz und Eitelkeit ab. Er blätterte den Ordner bis zum Ende durch und tat dasselbe mit fünf weiteren. Nirgends ein Hinweis auf kriminelle Machenschaften. Plötzlich vibrierte sein Handy. »Markus? Hier hält gerade ein Streifenwagen. Zwei Polizisten. Knipsen Taschenlampen an. Marschieren … Moment … marschieren in die Parkstraße!« »Halt dich bedeckt.« »Verdammt, die leuchten das Haus ab! Kommt schon, Leute, weitergehen!« Taten sie nicht. Stattdessen öffnete einer der Polizisten die kleine Gartentür. »Markus, die wollen rein.« »Verstanden. Du bleibst in Deckung.« »Ja.« Doch Tom hielt sich nicht daran. Er taxierte die beiden Bullen durch das Fernglas: ein Alter und ein Fetter. Die würden ihm nicht hinterherkommen. Ergo: frontale Konfrontation. Jede Minute, die er sie beschäftigte, gewann Markus. »Hey, ihr da!« Er rannte über die Straße auf das Haus zu. »Ja, euch Pfeifenheinis mein ich. Was habt ihr Blindschleichen hier zu suchen?« Tom blieb vor der Gartentür stehen und sah die Polizisten herausfordernd an. »Schiebt ihr hier im Dunkeln ein Nümmerchen oder was ist los?« Der Jüngere kam auf ihn zu und leuchtete ihm mit der Taschenlampe ins Gesicht. »Vergiss es, Fettwanst, mich kriegst du nie.« Tom wollte gerade loslaufen, da sagte der Mann etwas, mit dem er nicht gerechnet hatte. »Wir wissen, was du hier treibst. Und wir wissen auch, wer du bist – Engel.« Irritiert hielt Tom inne. Was lief hier ab? Was auch immer, er musste verschwinden. Noch bevor er den ersten Schritt gemacht hatte, sah er den Polizisten nach seiner Waffe greifen. Bloß weg hier! Markus zog zum wiederholten Mal am Rollladengurt, doch er klemmte. Saß er hier in der Falle? Er rannte ins Wohnzimmer, dessen Fenster ebenfalls zum Innenhof zeigte, und riss mit aller Gewalt am Gurt. Ächzend bewegte sich der Rollladen nach oben. Tom rannte geduckt die Straße hinauf. Die würden doch nicht wirklich auf ihn schießen! Oder doch? Er begann, Haken zu schlagen. Markus zog mit seinem ganzen Körpergewicht. Plötzlich gab der Gurt nach und der Rollladen knallte wieder nach unten. Gleichzeitig knallte ein Schuss durch die Nacht. Das abgerissene Gurt-Ende in der Hand, erstarrte er. Was war da draußen los? Tom spürte nicht, wie die Kugel in den Oberschenkel eindrang, wohl aber die Wirkung. Er schaffte noch ein paar Meter, dann taumelte er und fiel hin. Als er aufsah, standen die beiden Polizisten vor ihm. Der jüngere fasste ihn unter die Arme und schleifte ihn über den Bürgersteig zur Unterführung neben dem Haus. Dort angekommen, holte er ein Handy aus der Hosentasche. »Hier ist Fred. Wir haben ihn. War gar nicht im Haus, haben ihn auf der Straße aufgelesen. Doch, doch, er ist es. Hat einen Steckschuss abbekommen. Und was nun? – Ja klar, aber wir dachten, auf der Flucht, und jetzt liegt er hier angeschossen vor uns.« Er stöhnte. »Na gut, ich leg auf, wir müssen das schnell erledigen, bestimmt ist schon Verstärkung im Anmarsch.« Er beendete das Gespräch und sah seinen älteren Kollegen an. »Und wie lassen wir es nach Flucht aussehen, Karl?« Der Rollladen in der Küche funktionierte anstandslos, doch Markus konnte ihn nur quälend langsam hochziehen, denn er vernahm jetzt Stimmen in unmittelbarer Nähe. Schließlich reichte der Spalt, um aus dem Fenster zu klettern. Draußen angekommen, hörte er einen Mann sprechen: »Ja, so machen wir es.« Was – machen? Tom wusste die Antwort bereits. Die Schweine hatten ihm den Schaft einer Knarre in die Hand gedrückt, weil sie seine Fingerabdrücke auf dem Ding haben wollten. Gleich würden sie einen Schuss damit abgeben – bevor oder nachdem sie ihn mit ihrer Dienstwaffe abgeknallt hatten. Die Nacht war kalt, doch Tom schwitzte, wie er noch in keiner Sauna geschwitzt hatte. Er saß auf dem Boden der Unterführung und weigerte sich aufzustehen. Er musste Zeit schinden, vielleicht kam Markus ja doch noch. Also ließ er sich wie ein Kartoffelsack durchhängen, während der jüngere Bulle versuchte, ihn hochzuziehen. »Lass mal, Fred, es geht auch so«, sagte der ältere plötzlich. Er trat einige Schritte zurück und zielte auf Toms Bauch. Toms Herz raste, als wolle es vor der endgültigen Stilllegung rausholen, was noch rauszuholen war. Sein Geist hingegen schwebte, wie auf hydraulischen Federn gelagert, ruhig über seinem angstgepeinigten Körper. Er starb für Markus. Endlich konnte er seine Schuld begleichen. Um sich auf den Tod vorzubereiten, schloss er die Augen. Die Lider hatten sich beinahe gesenkt, da meinte er, einen Schatten zu bemerken. Verstohlen blickte er an den Polizisten vorbei zum Hinterhof. Er sah nichts mehr. Trotzdem erwachten seine Lebensgeister wieder. »Moment! Ich werde doch aufstehen.« Er rappelte sich im Zeitlupentempo hoch. Wenn Markus irgendwo da hinten lauerte, musste er sich jetzt schnell was einfallen lassen. »Drück einfach ab, Karl!«, zischte Fred. Karl konnte nicht, seine Hand zitterte zu sehr. Er hatte noch nie einen Menschen getötet. Fred hatte ihm die Sache mit der Ansage schmackhaft gemacht, Engel decke Kinderschänder. Und mit hunderttausend Euro. Karl stand kurz vor der Pensionierung und ihm graute vor der miesen Rente. Aber den Kollegen wie ein waidwundes Tier abknallen? Fred stieß ihm in die Seite. »Schieß endlich!« In diesem Moment barst irgendwo im Hintergrund etwas. Es klirrte wie zerbrochenes Glas. Karl schoss. Eine Kugel, dann noch eine. Er feuerte sie blindlings ins Dunkel des Hinterhofs. Seine Nerven standen in Flammen. Gegen alles, was er in vierzig Dienstjahren gelernt hatte, rannte er vor. Fred brüllte ihm hinterher, stehen zu bleiben, doch er reagierte nicht. Stürmte in den Hinterhof wie ein Hornochse in die Arena. Fred hörte ein paar matte Geräusche. Er drückte Engel wieder auf den Boden und stellte sich hinter ihn, um nicht den Überblick zu verlieren. Es fiel zwar Licht von der Straße in die Unterführung, aber der Schein reichte nicht bis zum äußersten Ende. Deshalb konnte er zunächst nur zwei Schatten ausmachen, die langsam auf ihn zukamen. Karl schob einen Mann vor sich her. Offenbar hatte er einen Komplizen gestellt. »Hast du ihn unter Kontrolle, Karl?« »Ja.« Die Konturen schälten sich jetzt deutlicher aus dem Dunkel. Die Arme des Komplizen lagen auf dem Rücken. Karl hatte ihm schon Handschellen angelegt, gut so. Als die beiden einen Meter vor Fred hielten, stutzte er. Irritiert sah er von einem Gefangenen zum anderen. Auf diesen Moment hatte Markus gewartet. »Jetzt!«, rief er. Der hinter ihm stehenden Polizisten warf sich auf den Boden. Gleichzeitig riss Markus den rechten Arm vor und richtete dessen Dienstwaffe auf den anderen Polizisten. Doch der war verflucht schnell. Die Pistole, die er in seiner Verwunderung hatte sinken lassen, zeigte schon wieder auf Markus. Ein Patt. Es währte nur die eine Sekunde, bis Markus von hinten einen Tritt in die Kniekehlen erhielt. Er fiel gegen die Wand und verlor die Waffe. Das war’s, dachte er. Tom dagegen dachte: Jetzt! Er drückte sich mit den Armen vom Boden ab, riss das verletzte Bein hoch und hämmerte es Fred in die Weichteile. Nach Luft schnappend, ging der Fettsack in die Knie. Die Pistole entglitt seinen Händen. Grimmig holte Tom zu einem zweiten Tritt aus. Schrei vor Schmerz! Doch der fette Bulle legte eine unerwartete Wendigkeit an den Tag. Er packte das Bein und verdrehte es. Und so war es Tom, der vor Schmerz schrie, während er sah, wie der Fettsack schon wieder in Richtung Pistole stürzte. Markus wollte ihm zuvorkommen, doch sein linkes Bein steckte im Klammergriff des am Boden liegenden Polizisten fest. Mit der Kraft der Verzweiflung drehte er sich aus dem Griff und warf sich dem anderen Mann entgegen. Der schoss, noch bevor er ihn erreichte. Das Heulen von Martinshörnern näherte sich bedrohlich. »Komm, wir müssen hier weg.« »So eine Scheiße, so eine gottverdammte Scheiße!« »Ist ja gut.« »Scheiße, Scheiße, Scheiße.« Von Markus gestützt, humpelte Tom leise fluchend die Straße entlang. Plötzlich blieb er stehen. »Der hat seinen Kollegen erwischt, oder?« »Ja.« »Tot?« »Wahrscheinlich, komm weiter.« Beim Toyota angelangt, schob Markus seinen Bruder auf den Beifahrersitz und ließ den Motor an. »Wo fahren wir hin?« »Du brauchst einen Arzt.« »Ins Krankenhaus? Die stellen doch Fragen.« »Nicht ins Krankenhaus. Zu einer Praxis.« »Mitten in der Nacht?« »Ich kenne einen Arzt, den ich unter Druck setzen kann. Er hat eine Schwarzgeldkasse. Verdient unter der Hand Geld damit, Verletzungen zu behandeln, die sich Leute bei perversen Spielen zuziehen.« »Zum Beispiel?« »Nägel in Brüste schlagen, Zimmermannsnägel. Oder eine Ladung Reißnägel in den Anus befördern.« »Ne, oder? Ist das legal?« »Warum denn nicht?« »Na, ich weiß nicht. Nägel, das ist doch krank.« »Wenn beide erwachsen sind und Spaß dran haben? Möchtest du, dass jemand nachschaut, was du unter der Bettdecke treibst?« »Ich nehme keine Nägel mit ins Bett.« »Aber mehr Frauen, als der eine oder andere für gesund hält. Sollen wir jemanden zum Nachzählen vorbeischicken?« Schweigen setzte ein. Als sie vor einem Einfamilienhaus hielten, umarmte Markus seinen Bruder. »Danke«, sagte er ernst. »War doch Fun«, entgegnete Tom unbeholfen, bevor er die Umarmung erwiderte. Es hatte ihnen nie etwas gebracht, eineiige Zwillinge zu sein. Wenn es stimmte, dass zweiundvierzig Prozent des menschlichen Verhaltens von Genen bestimmt wird, dann hatten bei ihnen die anderen achtundfünfzig Prozent den Ausschlag gegeben. Vor allem wahrscheinlich Papas Spielsucht und sein Tod. Er selbst war nur Zuschauer gewesen, Markus aber in den Schlamassel hineingezogen worden. Tom erinnerte sich nicht mehr, ob sie sich vorher besonders verbunden gefühlt hatten. Danach jedenfalls nicht mehr. Keine Seelenverwandtschaft, keine Nähe. Er selbst hatte es geradezu widernatürlich gefunden, sich äußerlich so ähnlich zu sein und innerlich so fremd. Und nun hatte ausgerechnet dieser widernatürliche Anschein der Gleichheit sie beide gerettet. Die Wege des Herrn sind unergründlich, dachte Tom. Der Arzt zeigte sich zwar über den Besuch verwundert, machte aber keine Zicken. »Nachdem Sie meinen Bruder behandelt haben, fahren Sie ihn nach Hause, er wohnt in Egelsbach«, erklärte ihm Markus. »Ich muss weg.« »Bin kein Chauffeur. Kann er kein Taxi nehmen?« »Nein.« Die Polizei würde die Taxifahrten dieser Nacht checken. »Sie fahren ihn, klar?« Er verabschiedete sich von Tom. »Wo musst du denn so dringend hin?« »Noch was erledigen.« »Pass auf dich auf.« »Klar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Polizist …« »Er heißt Fred und der andere …« »Karl. Ich kenne ihn. Jedenfalls wird dieser Fred sagen, er hätte uns nicht erkannt, sonst bringt er sich selbst in Schwierigkeiten. Sollte die Polizei doch bei dir auftauchen, rufst du mich an.« Markus fuhr quer durch die Stadt und parkte am nördlichen Mainufer. Den Rest des Weges ging er zu Fuß, um Luft zu tanken und die Gedanken zu ordnen. Das soeben Erlebte erschien ihm immer noch völlig irreal, zu groß für die kleine Realität, die er gewohnt war. Auf halber Höhe des Eisernen Stegs, den er in Richtung Sachsenhausen überquerte, sah er zu den Geldtürmen im Bankenviertel hinüber. Eigentlich hätten sie vor Scham im Boden versinken müssen, doch sie standen da selbstbewusst wie eh und je. Markus musste an Hütchen denken, unter denen Spieler ihre Kügelchen versteckten. Ob sie noch wussten, wo? Egal. Er musste endlich selbst ein »Kügelchen« finden, endlich den entscheidenden Erkenntnisgewinn verbuchen. Und zu diesem Zweck würde er jetzt auch in Santers Institut einbrechen. In der letzten Stunde hatte sich der Verdacht bestätigt, dass die Gangster von seinen Gefühlen für Anna wussten. Deshalb hatten sie damit gerechnet, dass er auch vor einem Einbruch nicht zurückschrecken würde, nachdem ihm Kuhlmann den Köder hingeworfen hatte. Allerdings rechneten sie bestimmt nicht damit, dass er nach dem Desaster in der Parkstraße seine Einbruchstour fortsetzen würde. Eine halbe Stunde umschlich er die am Schaumainkai gelegene Gründerzeitvilla, dann stieg er die rückwärtige Kellertreppe hinunter und machte sich an der Holztür zu schaffen. Gegen neun riss der Wecker Markus aus dem Schlaf. Um vier war er zu Hause aufgeschlagen und wie tot ins Bett gefallen. Er hatte geschlafen, wie ein Stotterer spricht, und fühlte sich verkatert. Und frustriert, denn das aufgespürte ›Kügelchen‹ hatte bloß eine mickrige Erkenntnis gebracht: Die Luxemburger Stiftung »Mensch und Leben«, die Holland geschmiert hatte, finanzierte tatsächlich Santers Institut. Es zeichneten sich die Konturen einer vielschichtigen Organisation ab, nur brachte ihn das der Lösung nicht näher. Er quälte sich aus dem Bett und rief Tom an. »Was macht dein Bein?« »Geht schon. Hast du Nachrichten gehört?« Tom klang aufgeregt. »Die berichten. Und jetzt halt dich fest: Beide Polizisten sollen tot sein!« Markus hatte sich über das Schicksal des jüngeren Mannes keine Gedanken mehr gemacht. Aber die Todesmeldung überraschte ihn nicht wirklich. »Hör mal, Tom. Du solltest für ein paar Tage verreisen.« »Und dich mit den Killern allein lassen? Vergiss es.« »Kannst du wenigstens woanders unterkommen?« »Ich bin nicht mehr zu Hause. Du etwa?« »Ähm …« »Hältst du dich für Superman? Ich bin …« »Halt! Du hast recht, wir müssen vorsichtig sein. Wer weiß, ob die Gangster mich nicht abhören. Wir brauchen beide ein Prepaid-Handy. Du kennst meine private E-Mail-Adresse, schick mir die Handynummer dahin.« »Markus?« »Ja?« »Die Schweine wollten uns umbringen, kein Thema. Nur dass die jetzt tot sind? … Eck, Schneck, Dreck, weg. – Aber wir sind nicht dran schuld, oder?« »Nein, Tom, sind wir nicht. Wer sich mit dem Teufel einlässt, muss mit der Hölle rechnen. Mach dir darüber keine Gedanken.« »Es war dumm von mir zu sagen, es sei Fun gewesen.« »Hast du nur, damit ich keine Schuldgefühle habe.« »Ach so? Manchmal ist es doch gut, einen älteren Bruder zu haben, der durchblickt.« »Es sind ja bloß ein paar Minuten.« »Aber die werde ich nie aufholen.« »Du bist grad dabei. Bis später.« Markus verließ das Haus durch den Hintereingang, blickte sich um, ohne jemanden auszumachen, und ging zur Berger Straße. Im Saturn kaufte er ein Handy und einen UMTSStick für sein Notebook. Als er kurz darauf den Schlüssel ins Wagenschloss steckte, überfiel ihn eine Gänsehaut. Würde er jetzt in Stücke gerissen? Nie und nimmer hätte er gedacht, mal eine Autobombe fürchten zu müssen. Er biss die Zähne zusammen und schloss auf. Keine Explosion. Auch das Starten des Motors überlebte er. Glück gehabt. Er fuhr in die Weserstraße – die Demarkationslinie zwischen Banken- und Rotlichtbezirk – und quetschte seinen Wagen in eine Parklücke gegenüber dem angegrauten Silver Tower der Dresdener Bank. Vor dem Turm stand eine Greisin von circa dreißig Jahren, deren Tage ebenfalls gezählt schienen. Wie die Banker wartete sie auf Freier, die das Grauen suchten. Das Bahnhofsviertel unterschlug keine Seite des Lebens, das musste man ihm lassen. Markus ging in Richtung Taunusstraße. Der Weg war mit Bekannten gepflastert, Trinkern und Junkies, die absaßen, was ihnen noch an Leben bevorstand. In der Elbestraße betrat er eines der Laufhäuser und wandte sich an einen uniformierten Koloss vom Sicherheitsdienst. »Ich will den Chef sprechen.« Der Koloss sah mit hochgezogener Augenbraue zu ihm herab. »Und warum, der Herr?« »Sag ihm, Engel sei da. Das reicht.« Kurz darauf saß er Hartwig Dollansky gegenüber. Dollansky hatte früher als Marketingmanager für ein Leiharbeitsunternehmen gearbeitet, sich aber bei Unterschlagungen erwischen lassen. Seitdem er seine Haftstrafe abgesessen hatte, verlieh er Frauen und versuchte nebenbei, das Milieu marketingmäßig voranzubringen. Die Konkurrenz nannte ihn, wegen des vergleichsweise friedfertigen Umgangs mit seinen Nutten, den Schwalbenflüsterer. Was nicht hieß, dass er an krankhaftem Zartgefühl litt. Markus steuerte unverblümt auf sein Ziel zu: »Ich brauche eine Halbautomatik, etwas Handliches, nicht registriert.« Er hatte den Schwalbenflüsterer schon des Öfteren mit Razzien überrascht, doch nie hatte der so blöd aus der Wäsche geguckt wie jetzt. »Haben wir den 1. April?« »Sagen Sie mir einfach, ob Sie liefern können und was es kostet.« »Solche Deals sind in meiner Position nicht darstellbar. Ich bin kein Waffenhändler, wenn Sie das zu verifizieren gedachten. Und dann bitte nicht dermaßen plump.« »Sie sollten mich gut genug kennen, um zu wissen, dass ich nicht zu plumpen Tricks neige.« »Einmal unterstellt, ich könnte die Ware theoretisch beschaffen. Doch nicht für einen Gesetzeshüter!« »Das hier ist ein persönliches Anliegen. Ich bin nicht im Dienst. Und ich verspreche Ihnen auch nicht, irgendwann ein Auge zuzudrücken. Ich zahle und das war’s.« Dollansky nestelte nachdenklich an seiner dezenten Managerkrawatte. »Ihr Ehrenwort, dass Sie mich nicht linken wollen?« »Mein Ehrenwort.« »Und Sie planen auch keinen Mord, ja? Mit kriminellen Machenschaften will ich nichts zu tun haben. Ich bin prinzipiell ein gesetzestreuer Bürger.« »Ich will mich nur verteidigen können.« »Warten Sie.« »Ein Schalldämpfer wäre auch nicht schlecht.« Nach zehn Minuten brachte Dollansky eine Beretta 9 mm Parabellum mit Schalldämpfer, einem Achselholster und einem kleinen Karton Munition. Markus überprüfte die Ware und zahlte. In der Münchener Straße, Frankfurts türkischer Meile, kaufte er sich ein Lammspießchen im Fladenbrot und ging zum Wagen zurück. Als er einsteigen wollte, klingelte sein altes Handy. »Ja?« »Es geht um Jesús Mirandor.« Kuhlmann. Von dem noch mal zu hören, hatte er nicht erwartet. Markus schwieg, gespannt, was er dieses Mal aufgetischt bekäme. »Ich habe dich angelogen.« »Haben Sie überhaupt schon mal die Wahrheit gesagt?« »Gelogen war nur, dass ich Jesús bei einem Fluchtversuch erschossen hätte.« »Kaltblütig abgeknallt trifft es besser, nehme ich an.« »Du Blindgänger kapierst auch gar nichts. Jesús lebt, das ist die Pointe. Wir haben seinen Tod gemeldet, um ihn aus der Schusslinie zu ziehen. Sonst wären die Gangster immer noch hinter ihm her.« Markus glaubte ihm nicht mal mehr die Kommas in seinen Sätzen. »Wenn es so wäre, hätten Sie keine Veranlassung gehabt, mich zu belügen.« »Ach, und du hättest mich im umgekehrten Fall eingeweiht?« »Das ist was anderes.« »Klar, weil du ja immer der Gute bist. Deine Selbstgerechtigkeit ist zum Kotzen. Ich hab mir bei der Rettungsaktion eine Schussverletzung zugezogen und meine Entlassung riskiert. Hast du Vergleichbares vorzuweisen? Dann halt die Klappe. Ich konnte dich nicht einweihen, weil die Gangster Polizeikräfte schmieren. Sie hatten hier ein ziemlich hohes Tier auf ihrer Seite. Was wissen denn wir, ob die Information nicht auch bei euch in falsche Hände gerät.« »Und warum informieren Sie mich jetzt? Und dazu noch am Samstag?« »Weil der Idiot geflohen ist. Er ist nicht mehr derselbe. Vollkommen von der Idee besessen, die Wahrheit ans Licht zu bringen, um sich von den … Dämonen … oder so … zu befreien, weil, er hat ein paar absurde Sätze …« »Ich kenne die Sätze, Mirandor hat mit mir darüber gesprochen.« »Dann hättest du doch selbst merken müssen, dass er durchdreht. Der Mann, den er in seiner Gewalt hatte, ist auf sein Drängen hin gefoltert worden.« »Und was wollen Sie von mir?« »Ich glaube, er ist nach Deutschland unterwegs. Er hat einen Anhaltspunkt, einen Ortsnamen: Eppstein. Du musst versuchen, ihn zu finden, bevor es zu spät ist.« Eppstein im Taunus. Ungefähr dreißig Autominuten von Frankfurt entfernt. Genau die Zeitspanne, die Anna ihrem Gefühl nach mit dem Unbekannten zu dessen Unterschlupf unterwegs gewesen war. »Und was soll ich tun, wenn ich ihn habe?« »Bring ihn in Sicherheit und sag niemandem wo. Mich musst du auch nicht informieren. Hauptsache, er kann sich nicht selbst in Gefahr bringen. Oder andere. Ich weiß nicht, wie weit er gehen würde. Ausschließen kann man nichts mehr.« »Warum liegt Ihnen Mirandor plötzlich so am Herzen?« Weil ich ihn beinahe selbst wegen ein paar Kröten ans Messer geliefert hätte. Kuhlmann behielt es für sich, Engel war der Letzte, dem er beichten wollte. »Weil ich eingesehen habe, dass er eine arme Sau ist, die geschlachtet werden soll. Er ist ein wirklich netter Kerl, trotz allem. Also kümmere dich um ihn!« »Was ist mit dem Foto?« »Ich hab’s dir wirklich geschickt.« »Und wenn ich mich auf den Weg nach Eppstein mache, erwartet mich das nächste Mordkommando?« »Wieso Mordkommando? Sind die jetzt auch hinter dir her? Nein, ich will dich nirgendwohin locken. Ich sage gar nicht, dass du da hinfahren sollst. Du sollst lediglich Augen und Ohren offen halten und Jesús unauffällig aus dem Verkehr ziehen, wenn er sich bei euch blicken lässt. Er hat sich übrigens die Haare abrasiert. – Mehr weiß ich nicht und mehr kann ich auch nicht tun. Es liegt in deiner Hand.« Und nun? Wenn Kuhlmann die Wahrheit sagte, musste er sich erst mal freuen, dass Mirandor noch lebte. Doch es fiel ihm schwer, unter der Anspannung positive Gefühle zu bergen. Er beschloss, in den Taunus zu fahren, gleich welche Gefahren dort lauerten. Es blieb ihm gar keine andere Wahl. Hilfloser hatte er nie ermittelt. Drei Stunden später telefonierte er mit einem Kollegen vom Kriminaldauerdienst, der das Eppsteiner Tötungsdelikt vorläufig bearbeitete, bis die zuständigen Sachbearbeiter am Montag übernehmen würden. Da man in Eppstein von nichts anderem mehr sprach als vom »Mord in unseren Straßen«, hatte Markus nicht lange gebraucht, davon zu erfahren. Der Kollege vom KDD wusste von seiner Suspendierung und gab sich reserviert. Markus erfuhr lediglich, was schon in der Zeitung stand. Doch er ließ nicht locker. »Notieren Sie sich den Namen Anna Heydt, Beschuldigte in einem Missbrauchsfall. Nach dem, was die Zeitung schreibt, könnte es sich um das mutmaßliche Entführungsopfer handeln. Vergleichen Sie ihre Fingerabdrücke mit denen vom Tatort. Und wenn Sie einen Treffer landen, rufen Sie mich zurück.« Die nächste Viertelstunde verbrachte Markus mit einer Tafel Schokolade. Endlich klingelt sein Handy. »Woher wussten Sie es?« Er beschrieb dem Kollegen in groben Zügen, zu welchen Erkenntnissen er gelangt war. »Und warum ermitteln Sie trotz Ihrer Suspendierung?« »Ich liebe Frau Heydt. Deswegen bin ich auch suspendiert worden. Liebe und Polizeiarbeit vertragen sich eben nicht. Soviel dazu. Und nun zu uns: Wenn Sie mir mit ein paar Infos weiterhelfen, gebe Ihnen noch einen zweiten Namen, der Ihre Ermittlungen voranbringen wird.« »Und ich habe auf ein ruhiges Wochenende gehofft. Also gut, erzählen Sie.« »Erst Sie.« Der KDD-Mann skizzierte, was die Zeugen beobachtet hatten. »Es steht übrigens noch nicht fest, ob der Täter in tödlicher Absicht geschossen hat. Das Opfer wurde nämlich von einem Querschläger getroffen, der auch nicht tödlich war. Der Mann hat sich gewissermaßen selbst erlegt – durch den Biss auf eine Zyankalikapsel. Mysteriös, nicht?« »Und Sie haben gar nichts über ihn rausgefunden?« »Nein. Er existiert überhaupt nicht. Obwohl es Zeugen gibt, die glauben, ihn schon mal im Ort gesehen zu haben. Wir haben seinen PKW, einen Peugeot. Ist ursprünglich nach Kasachstan exportiert worden und von da offenbar irgendwie nach Deutschland gelangt. Die Halterdaten sind getürkt. Vorläufiges Ende der Spur.« »Was ist mit dem Täter und der Frau?« »Sie haben einen Bus nach Frankfurt genommen, sind aber bald wieder ausgestiegen. Später haben sie sich von einem Taxi zum Frankfurter Hauptbahnhof fahren lassen. Dort verliert sich die Spur.« Markus hörte es mit Erleichterung. Zwar versuchte die Organisation bestimmt, Anna wieder einzufangen, aber ihre Fährte am Hauptbahnhof aufzunehmen, würde den Gangstern nicht so leicht gelingen. »Und nun hätte ich gern den versprochenen Namen«, unterbrach der KDD-Mann Markus’ Überlegungen. »Der mutmaßliche Täter heißt Jesús Mirandor, ein Spanier. Er ist eines der Opfer im Heidenheimfall. Der ist Ihnen bekannt?« »Klar doch.« »Die Organisation operiert allem Anschein nach immer noch. Und hat aus unbekannten Gründen auch Frau Heydt ins Visier genommen. Mirandor versucht auf eigene Faust, die Verbrecher zu stellen. Ich schätze, der Tote gehört zur Organisation. Könnte sein, dass sie im Raum Eppstein eine Basis unterhält. Wir suchen nach Leuten, die ein vermutlich nach außen abgeschottetes Haus in ihrem Besitz haben. Sind Sie interessiert, die Spur zu verfolgen? Da gibt es den ganz großen Fisch zu angeln.« »Und Sie erzählen mir keine Räuberpistole?« »Passen die Zyankalikapsel, das Auto aus Kasachstan und der Tote, den es überhaupt nicht gibt, nicht genau ins Bild?« »Okay, solange man mich lässt, bleibe ich am Ball, also mindestens bis Montag.« »Forschen Sie nach Mietern, Pächtern oder Eigentümern von Grundstücken in diskreter Lage. Haben Sie Stift und Zettel? Dann notieren Sie: Peter Santer, Olaf Holland, Thorsten Strecker. Wenn einer der Namen auftaucht, geben Sie mir Bescheid.« Den letzten Namen nannte er aus einer Eingebung heraus. Eigentlich glaubte er Strecker. Aber er musste auf Nummer sicher gehen. Vielleicht wurde ja ein Spiel mit doppeltem Boden inszeniert. »Und was passiert, wenn ich Ihnen Bescheid gebe?« »Dann erkläre ich Ihnen den Zusammenhang.« »Ach, dann wären Sie so gütig?« »Ich kann nicht riskieren, abgehängt zu werden. In meiner Lage würden Sie nicht anders handeln. Mir kommt da noch eine Idee. Hören Sie sich um, ob jemandem in Eppstein LKW oder Lieferwagen aufgefallen sind, die medizinisches oder biotechnologisches Gerät oder etwas in der Art transportieren. Wenn ja, sollten Sie dem nachgehen.« »Wieso das denn jetzt?« »Es besteht ein vager Verdacht, dass die Organisation Automaten zur Gensequenzierung benutzt. Das war’s. Machen Sie das Beste draus – und machen Sie schnell, Kollege!« SENDERSUCHLAUF | D-FRANKFURT/MAIN Am Samstagvormittag gegen elf klingelte ein Handy des Salvators. »Hören Sie, Alexander. Wenn Sie noch an unserem Deal interessiert sind, treffen wir uns heute in Frankfurt. Um halb drei sind Sie mit dem Wagen in der Rhönstraße. Sie fahren rechts ran und warten auf Anweisung. Sie kommen allein.« Wie angekündigt, klingelte das Handy um vierzehn Uhr dreißig erneut. »Sie fahren zum Café Klatsch, Mainkurstraße. Sie gehen rein und warten.« Iwan, der über eine Funkverbindung mithören konnte, studierte auf dem Navi das Einbahnstraßengeflecht rund ums Café, beorderte seine Leute in die Würzburger Straße und schickte einen Späher auf einem Motorrad los. Der Salvator würde gemächlich folgen, um ihm Zeit zu geben, die Lage zu sondieren. Der Späher fuhr das Karree rund ums Café ab, ohne etwas Augenfälliges zu bemerken: zwei Jugendliche, die an ihren Mofas rumbastelten und einige alte Leutchen, es musste hier ein Altersheim geben. Er informierte Iwan, der daraufhin das Team neu positionierte: Der mit sechs Mann besetzte Lieferwagen sollte bis zur nächsten Kreuzung vorrücken, die zwei Männer im PKW dirigierte er in die außerhalb des Karrees gelegene Wittelsbacherallee. Er selbst bezog auf seiner Kawasaki in der Ringelstraße Posten, von wo er das Café im Blick hatte, das der Salvator soeben betrat. Heydt war bestimmt nicht dort. Sie würde versuchen, es ganz clever anzustellen, und eine Stadtrallye veranstalten. Womit er recht behielt. Nach einer Viertelstunde forderte sie den Salvator auf, mit der U-Bahn von der Höhenstraße zur Hauptwache zu fahren. Von dort sollte er zum Café Karin gehen und draußen warten. Clever? Blöd! Die Kuh gab viel zu früh preis, wohin die Reise gehen sollte. Gegen sein Rudel hatte die Einzelkämpferin sowieso keine Chance. Iwan fuhr zum Lieferwagen, um Lederjacke und Helm zu wechseln. Währenddessen fuhr in einer Parallelstraße ein VW Multivan an. Die Insassen, acht ältere Damen und Herren, zogen die Gardinen zu und wechselten Mäntel und Hüte. Kurz darauf machte sich auch der Lieferwagen mit Iwans Team auf den Weg in die Innenstadt. Der Salvator stand bereits eine halbe Stunde vor dem Café Karin, als sich Heydt wieder meldete. »Oben an der Ecke zur Kaiserstraße sitzt ein Mann mit Hells-Angels-Jacke auf einem Motorrad. Er soll zu Ihnen kommen und sich zu erkennen geben. Haut er ab, war’s das.« »Aber …« »Kein Aber.« Er winkte Iwan heran und bedeutete ihm, den Helm abzunehmen. »Für wie blöd halten Sie mich, Alexander? Gehen Sie mit Iwan ins Café, für Sie ist ein Tisch auf meinen Namen reserviert. Iwan bleibt dort hocken, bis unser Treffen beendet ist. Sie erhalten neue Anweisung.« Diesmal schickte Heydt eine Kellnerin als Botin. »Sie möchten mir bitte Ihre Handys und den Motorradhelm zur Aufbewahrung geben. Dafür bekommen Sie von mir dieses Handy. Sie sollen unter »Notizen« nachschauen, da steht was.« Sie lächelte unsicher. Wahrscheinlich hatte sie nicht die geringste Ahnung, wozu der Tauschhandel diente. Nachdem sie sich entfernt hatte, schaltete der Salvator das Gerät an und befolgte die hinterlegte Forderung: Er verließ das Lokal, startete auf dem Smartphone ein Programm für Videotelefonie und rief die gespeicherte Nummer an. Heydt meldete sich. Auch sie hatte eine Kamera eingeschaltet. »Machen Sie einen Rundum-Schwenk, damit ich sehe, dass wir unter uns sind.« Es lag Hall auf der Leitung, weshalb ihre Stimme ein wenig metallisch klang. »Gut. Wenn Sie meine Anweisungen befolgen, sehen wir uns gleich. Die erste lautet: Unsere Verbindung wird nicht unterbrochen, die Kamera nicht ausgeschaltet. Kommen Sie mir nicht mit Funklöchern. Die Wegbeschreibung schicke ich Ihnen Stück für Stück als Textnachrichten. Sie lesen sie weder laut vor und noch stellen Sie Fragen, aus denen sich etwas ergibt. Wenn Sie Ihre Leute auf dem Laufenden halten wollen, müssen Sie sich was Klügeres überlegen.« Hatte er längst. Um mit Sven zu kommunizieren, der ihm mit einigen Metern Abstand folgte, brauchte er nicht mal die Lippen zu bewegen. »Weshalb treffen wir uns nicht einfach hier? Ich will Ihnen nichts Böses, Anna.« Sie würde natürlich nicht darauf eingehen, aber er stellte die Frage auch nur, um zu testen, ob sie wirklich live kommunizierte. »Lieber nicht, in Iwans Anwesenheit fühle ich mich immer ein bisschen gehemmt. Diesmal läuft es zu meinen Bedingungen.« »Wie Sie meinen. Nur würde ich Sie bitten, für etwas mehr Beleuchtung bei sich zu sorgen, ich kann nicht mal Ihr Gesicht erkennen.« Augenblicklich erstrahlte das Bild auf dem Display. Ja, es war Heydt, dieses Gesicht kannte er nur zu gut. Forschend betrachtete er den Bildhintergrund. Ein kahler, in Neonlicht getauchter Raum. Ein schmales Lächeln huschte über sein Gesicht. Heydt saß höchstwahrscheinlich im Kopierraum von Heureka. Sie hatte die Kamera auf eine weiße Wand gerichtet und wähnte sich deshalb in Sicherheit. Doch sie hatte etwas übersehen. Er projizierte eine Videosequenz auf seine Kontaktlinsen. Ja, das verräterische Detail stimmte überein. »Ab sofort reden Sie nur noch, wenn ich Sie anspreche, Alexander. Ich schicke Ihnen jetzt die erste Textnachricht. Verdammt, halten Sie das Handy so, dass ich Ihr Gesicht sehen kann!« Auf dem Weg zum Rossmarkt, wo er beim Kaufhof in die Fußgängerzone abbiegen sollte, verschwamm mit einem Mal das übertragene Bild, dann rauschte es, klarte wieder auf und fror schließlich ein. »Was … da los, Alex… Ich nur … Standbi… Ihn….« Offenbar brach jetzt auch noch die Tonleitung zusammen. »Umgekehrt ist es dasselbe, Anna. Irgendwas stört hier die Übertragung. Was soll ich tun?« »Ich will, dass Sie mit mir reden, egal was, Hauptsache, Sie quatschen mit sonst niemandem.« Offenbar stand zumindest die Tonleitung wieder. Er stellte Heydt mit ein paar belanglosen Sätzen zufrieden. Gleichzeitig formulierte er in Gedanken den Auftrag, bei Heureka anzurufen und es genau fünf Mal klingen zu lassen. Er sandte den Gedanken an Sven. »Wo sind Sie gerade, Alexander?« Jetzt sollte er also doch seine Position angeben? Heydt geriet offenbar ins Schwimmen. »Rechts von mir ist ein Geschäft, H&M.« »Sie kriegen eine neue Textnachricht.« Er hörte, wie Heydt etwas eintippte. In ihrem Hintergrund begann ein Telefon zu klingeln. Nach exakt fünf Klingeltönen verstummte der Apparat. Perfekt! Er sandte Sven die Information über Heydts Standort, verbunden mit dem Befehl, sie sofort an den Majordomus weiterzuleiten. »Anweisung eingetroffen, Alexander?« »Ja.« Er sollte den Fahrer einer Fahrradrikscha ansprechen, die schräg gegenüber am Rand der Zeil stand. Keine dumme Idee. Allerdings hatten sie sich auf diese Situation vorbereitet: Sven schob ein Fahrrad neben sich her. »Können Sie mich mittlerweile wieder sehen, Anna?« »Nein. Wenn Sie dahinterstecken, krieg ich’s raus.« »Sie und Ihr Misstrauen.« Er sprach den Fahrer der Rikscha an, der ihn aufforderte einzusteigen. Im Rückspiegel sah er Sven aufs Rad steigen. Nach einer gemächlichen Rundreise um den Block hielt der Fahrer wieder am Ausgangspunkt und zeigte auf ein Taxi. »Da geht’s weiter, soll ich sagen. Fahrt ist schon bezahlt, schönen Tag.« Dem Taxi würde Sven nicht hinterkommen. Die Möglichkeit, seine Leute via Gedankenübertragung auf dem Laufenden zu halten, fiel damit wegen der begrenzten Reichweite seines Senders weg. Letztlich kein Problem, denn er war auch mit einem Peilsender ausgestattet, dem seine Leute nur zu folgen brauchten. Außerdem musste Henry die Mannschaft bereits in Marsch gesetzt haben. Solange Heydt in der Redaktion blieb, konnte nichts passieren. Andererseits war ihr nicht zu trauen. Was, wenn sie selbst die Bildstörung erzeugte und die Redaktion längst verlassen hatte? Als hätte jemand seine Gedanken gelesen, begann das Bild auf dem Display zu ruckeln und nach kurzem Flackern zu laufen. Heydt befand sich noch im Kopierraum. Er sandte Sven einen letzten Befehl: Niemand folgt, alle bleiben auf ihren Positionen! Wie Iwans Enttarnung zeigte, hatte Heydt irgendwen gefunden, der für sie die Lage ausspähte. Warum in dieser Situation riskieren, dass der Späher auf Verfolger aufmerksam wurde? Es lohnte nicht mehr. Er stieg ins Taxi und gab dem Fahrer das Zeichen zum Losfahren. »Sie sind im Wagen?« »Ja. Und wohin geht nun die Reise?« »Sie werden auf direktem Weg zu mir gebracht. Wehe, Sie kommen nicht allein. Vergessen Sie nicht, das Handy so zu halten, dass ich Sie sehen kann.« Während das Taxi in die Konrad-Adenauer-Straße Richtung Main fuhr, stand der Lieferwagen, den Henry zur Redaktion geschickt hatte, im Stau. Ein liegen gebliebener Umzugswagen blockierte die enge Spur auf dem Untermainkai. »Frag bei Henry nach, was wir machen sollen«, knurrte der Fahrer. Henry gab Order, das Fahrzeug abzustellen und zu Fuß zu gehen. Sie hatten nur noch zwei Kilometer bis zum Zielort zurückzulegen. Der Salvator sah aus dem Fenster. Das Taxi bog gerade in die Sonnemannstraße. Von wegen, auf direktem Weg. Statt zum Westhafen, wo die Redaktion lag, bewegte sich der Wagen in Richtung Osten. Der Taxifahrer meldete sich zu Wort. »Ich fahre da vorn auf den Seitenstreifen. Sie möchten sich bitte in die Unterführung begeben.« Gespannt, was nun als Nächstes käme, stieg er aus und betrat die Unterführung. Was kam, war der Heilige Nikolaus, genauer gesagt ein Mann in Nikolauskostüm. Durch den weißen Rauschebart schimmerte ein altes Gesicht. Wo hatte Heydt den bloß aufgetrieben? Überhaupt erstaunlich, was die Einzelkämpferin in der kurzen Zeit alles organisiert hatte. Sie musste über unbekannte Geldmittel verfügen – sie oder der Mann, der Mikki auf dem Gewissen hatte. Die Polizei ging von einem Raubüberfall aus und deutete die Entführung als Nachtatverhalten zur Fluchtsicherung. Plausibel, aber nicht sicher. Der Nikolaus legte seinen Jutesack auf dem Boden ab, klappte einen Paravent auf und bedeutete ihm, dahinterzutreten. Dem Jutesack entnahm er Kleidung und ein paar Schuhe. Sogar Unterwäsche hatte er dabei. Der Salvator verstand und zog sich aus. Wenn Heydt glaubte, sie würde ihn jetzt erwischen, dann unterschätzte sie ihn. Sein Sacco war zwar ein einziges Funkgerät, an dem jeder Knopf und jede zweite Textilfaser einem Übermittlungszweck diente, doch niemand würde die Hightech-Ausstattung erkennen. Gleichwohl missfiel ihm, eine weitere Verbindung zu verlieren. Unterdessen erfuhr Iwan von Henry, dass etwas nicht stimmte. Die Mannschaft war in die Redaktion eingedrungen – und hatte sie verwaist vorgefunden. Iwan scherte sich nun nicht mehr darum, ob er beobachtet wurde. Er stürmte hinter die Theke, stieß den Barmann beiseite und packte seinen Helm. Im Laufen stülpte er ihn über und forderte Henry über das integrierte Mikrofon auf, ihm den aktuellen Standort des Salvators zu nennen. »Sonnemannstraße Nummer …«, hörte er Henry im Helmlautsprecher. »Moment. Die Fahrt geht weiter. Letztes bekanntes Fahrzeug: ein Taxi, Mercedes.« Er gab das Kennzeichen durch. Iwan war mittlerweile auf der Berliner Straße angekommen und rauschte durch den Spalt zwischen den dichten Fahrzeugreihen. Scheiß Samstagsverkehr. Anna nahm Alexander mit einem Grinsen am Osthafen in Empfang und legte ihm unter freundlicher Mithilfe einer Pistole Handschellen an. Er glotzte ziemlich blöde in die Kopierraum-Kulisse. Ihr Handy klingelte. Der Anrufer vermeldete, dass Iwan das Café verlassen hatte, was sie nicht beunruhigte. Wahrscheinlich befand sich ein Peilsender in Alexanders Klamotten und Iwan folgte dem Signal. Sollte er. Das Zeug wurde gerade in einem Hochhauskomplex im Nordosten deponiert, da konnte er sich austoben. Ihr Handy ging erneut, diesmal meldete sich Helga Jablonsky alias Mutter Beimer persönlich. Ohne sie hätte die ganze Aktion nicht geklappt. Ohne sie und ihre vielen Bekannten aus dem SeniorenComputer-Klub ›Alt & knackig‹. »Anna? Ich stehe an der Ecke Kurt-Schumacher-Straße. Der Motorradfahrer ist gerade vorbeigekommen. Aber er ist nicht wie erwartet nach Norden abgebogen, sondern weiter in eure Richtung gefahren.« Anna drehte sich zu Alexander um. »Woher weiß Iwan, wo Sie sind?« Er begann dummes Zeug zu sülzen. Anna wandte sich wieder an Helga: »Kann Hans die Kreuzung blockieren?« »Ist noch nicht eingetroffen, zu viel Verkehr. Sollen wir die Demo starten?« »Kann nicht schaden. Wir machen uns auf den Weg.« Sie setzte Alexander eine Schlafmaske auf, damit er nicht mitbekam, wer noch mit von der Partie war, und verpasste ihm einen Knebel. Dann ging sie in den Nebenraum, um Jesús zu informieren. Gemeinsam führten sie den Gefangenen nach draußen. Iwan hatte die Sonnenmannstraße erreicht. Auf Höhe des riesigen Baugrunds der Europäischen Zentralbank bremsten die Wagen vor ihm scharf ab. Ein paar durchgeknallte alte Leutchen mit Demo-Schildern blockierten die von Baustellen verengte Fahrbahn. Iwan hätte die alten Säcke am liebsten persönlich im Jenseits abgegeben. Stattdessen riss er die Maschine über die Bordsteinkante einer halb fertiggestellten Verkehrsinsel. Er jagte auf sandigem Boden an den Demonstranten vorbei. Unverhofft setzte sich vor ihm ein Bagger in Bewegung. Scheiße, das Ding fuhr ihm in den Weg. Rechts verblieb noch eine Lücke. Er taxierte sie. Verflucht schmal, aber seine einzige Chance, einem Frontalcrash zu entgehen. Er warf seinen Körper nach rechts, zog die schlingernde Maschine mit sich und visierte die Lücke an. Sie schrumpfte unaufhörlich. Das konnte ihn ein Bein kosten. Iwan krallte sich am Lenker fest und riss, ohne die Lücke aus den Augen zu lassen, das linke Bein hoch. Er stach millimetergenau hindurch und beschleunigte sofort wieder. Ein paar Sekunden nur hatte ihn der Ausflug auf die Verkehrsinsel gekostet. Doch es ging jetzt um Sekunden. Jesús schubste den Gefangenen auf das an der Uferböschung vertäute Motorboot und sah sich nach Anna um. »Ich krieg den Knoten nicht auf!«, schrie sie. Jesús sprang an Land und versuchte es selbst. Als Anna den röhrenden Klang eines Motors hörte, blickte sie sich um. Ein Zweirad donnerte heran. Das konnte nur Iwan sein. »So ein Scheißdreck«, fluchte sie vor sich hin. Sie kniete sich hinter einen Busch und blickte zwischen Jesús und dem Motorrad hin und her. Sie meinte, den Boden unter den PS der schweren Maschine vibrieren zu fühlen. Bitte, Jesús, mach endlich! Ihnen blieben höchstens fünf Sekunden. Wollte ihre Pechsträhne denn nie enden? Plötzlich schubste Jesús sie vorwärts. »Komm schon«, rief er und warf das Tau an Deck. Iwan sah das Boot vom Ufer ablegen und dachte, dass er so eins heute auch gut hätte gebrauchen können. Egal, er hatte Heydt trotzdem erwischt. Er ging vom Gas und steuerte auf die Hofeinfahrt eines Gewerbebetriebes zu, in dem sich der Salvator befinden musste. Kaum abgebogen, legte er eine Vollbremsung hin. Drehte sich um. Und knurrte. Nein, er hatte sich nicht getäuscht, leider nicht. Eine der drei Personen im Boot war der Salvator. Heydt, die Drecksau, fuhr mit ihm davon. Was hätte er dafür gegeben, sie bei lebendigem Leib in eine Portion Gehacktes verwandeln zu dürfen. Aber noch war die Partie nicht entschieden. Zwar würde er Umwege fahren müssen, um ihr auf die andere Uferseite zu folgen, aber sie entkam ihm nicht. Auf seinem am Lenker montierten Bildschirm bildete die Software unermüdlich die Bewegung des Peilsenders ab. Welche Haken Heydt auch schlagen mochte, er brauchte nur dem Pfeil zu folgen. Auf die kurze Distanz musste auch die Gedankenübertragung wieder funktionieren. »Salvator?« »Ja?« »Ich stehe am Ufer. Der Peilsender funktioniert. Ich nehme die Verfolgung auf.« »Enttäusche mich nicht.« Mit dem Thema Peilsender beschäftigte sich auch Jesús gerade. Nur ein Sender konnte den Motorradfahrer hierhin gelost haben. Und da sich der Sender nicht am Körper des Gefangenen befand, musste er in ihm stecken. Am liebsten hätte er das Schwein aufgeschlitzt, um nachzusehen. Sie näherten sich dem Sachsenhäuser Ufer. Jesús stieg nach hinten zu Anna, die den Außenbordmotor steuerte. »Wir brauchen ein Abführmittel«, erklärte er. Als gelernter Krankenpfleger wusste er auch, welches am schnellsten wirkte. Als sie am anderen Ufer anlegten, kam ein Lieferwagen über die Promenade auf sie zugefahren. Ein älterer Herr stieg aus und spazierte mit einem Augenzwinkern davon. Während Jesús den Gefangenen hinten verfrachtete, ließ Anna den Motor an und düste ab. »Zieh ihm schon mal die Hose runter, es ist nicht weit zur Apotheke.« Alexander, der bisher stillgehalten hatte, gab gurgelnde Geräusche von sich. »Besser, du nimmst ihm den Knebel ab, sonst erstickt er uns noch.« Kaum den Knebel losgeworden, drohte er ihr in seinem typischen, rasiermesserscharfen Flüsterton: »Das Abführmittel vergessen Sie auf der Stelle, Anna. Sonst wird es ein schlimmes Ende nehmen.« »Das sehen wir, wenn es so weit ist. Sie wollten mich verscheißern, also beschweren Sie sich nicht, dass jetzt die Scheißerei an Ihnen ist.« »Ich hatte jedes Recht dazu. Sie haben eingeschlagen, bis zu Ihrem Geburtstag zu bleiben.« Anna antwortete nicht. Die Suche nach der Apotheke beanspruchte ihre Aufmerksamkeit. Endlich tauchte das Schild auf. »Mach dich bereit, rechte Seite.« Jesús sprang aus dem Wagen, noch bevor sie angehalten hatte. Anna fuhr rechts ran und sah in den Außenspiegel. Noch nichts von Iwan auszumachen. Während sie nervös auf einem Kaugummi kaute, den Rückspiegel immer im Blick, schlug ihr Herz wie ein Trommler in Ekstase. Auch aus Angst vor Iwan, aber längst nicht nur. Sie fühlte sich lebendig wie eine Ewigkeit nicht mehr. So viele Leute waren unterwegs, um Jesús und ihr zu helfen, allen voran Elisabeth und Helga, die keine Sekunde gezögert hatten. Sie überkam eine Ahnung, wie ihr Leben hätte verlaufen können, wenn ihre Eltern nicht gestorben wären. »Erzählen Sie mir, wie Sie mich ausgetrickst haben?« »Ich habe darauf gesetzt, dass Ihnen das kleine Detail auffällt, das auf den Kopierraum hinweist. Wie Sie sehen, war ich auch auf Ihren Anruf gefasst. Deswegen befand ich mich anfangs wirklich im Kopierraum. Dann haben wir mit ein bisschen Video- und Computertechnik das Schauspiel eröffnet.« Die Bildstörung hatte Elisabeth erzeugt, die Computertüftelei ging auf das Konto von Mutter Beimer und ihren Senioren. »Während der Bildstörung bin ich im Boot vom West- zum Osthafen gerast. In dieser Zeit hat eine Dame meinen Sprechpart übernommen, die ganz gut Stimmen imitieren kann. Kein Profi, aber mit ein bisschen künstlichem Hall ist es offenbar gelungen. Später habe ich aus der Kopierraum-Kopie wieder selbst mit Ihnen gesprochen.« »Woher haben Sie all die Leute? Es haben ja auch einige auf der Lauer gelegen.« »Fragen Sie mal Ihre Männer, ob Ihnen heute häufiger ältere Menschen begegnet sind. Und Umzugswagen!« Sie lachte. »Und wo ich die herhabe, ist ganz einfach: Freunde haben sie für mich zusammengetrommelt.« »Sie haben keine Freunde.« »Dachte ich auch. Da haben wir uns beide getäuscht.« »Was haben die davon?« »Freundschaft und Hilfsbereitschaft sind nicht Ihre Welt, stimmt’s?« Da konnte er ihr nicht widersprechen. In seiner Heimat blieben die Familien unter sich. Wer es sich leisten konnte, wohnte in einem großzügigen Anwesen und ging möglichst selten raus, denn draußen lauerten Gefahren. Er hatte dieses sichere Refugium vor langer Zeit verlassen und wenn er ehrlich war, genoss er die Gefahren, die seitdem überall lauerten. Viel hatte sich geändert, doch Freundschaft war ihm ein Fremdwort geblieben. Ein Scheppern riss ihn aus seinen Gedanken. Offenbar kehrte der Mann mit den Zäpfchen zurück. Er spürte dessen Hand auf seinem kalten Hintern, noch bevor das Fahrzeug anfuhr. »Erledigt.« Jesús streifte sich die Handschuhe ab. »Dreh besser das Fenster runter, in maximal fünf Minuten geht’s los.« Es dauerte keine zwei Minuten, bis der Sender ans Tageslicht kam. Und doch war es zu spät: Anna sah Iwan im Spiegel heranrücken. Sie warnte Jesús. »In ein paar Augenblicken hat er uns einkassiert. Spring raus und hau ab!« Jesús dachte nicht daran. Durch ein Fenster in den hinteren Flügeltüren beobachtete er, wie der Motorradfahrer am Ende der circa vierzig Meter langen Schlange bremste. Wahrscheinlich wusste er, dass sie sich in einem der Fahrzeuge vor ihm befanden, aber nicht in welchem. Genau darüber versuchte der Salvator in diesem Moment Iwan zu informieren. Noch ging seine Mitteilung wahrscheinlich im Funkwellensalat der Innenstadt unter, aber mit jedem Meter, den die Distanz schrumpfte, stiegen die Chancen. Jesús hob die Waffe vom Boden und ging nach vorn zu Anna. Er überlegte, den Sender einfach zu zerstören. Doch wenn das Signal ausblieb, würde der Motorradmann stutzig werden. Er würde die Sichtkontrolle der Fahrzeuge beschleunigen, und da die Ampel einfach nicht auf Grün springen wollte, hätte er sie erwischt, bevor sich die Autos auf der Kreuzung verteilen konnten. Nein, er musste es wie Carlos machen: den Sender einem anderen Fahrzeug unterjubeln. Aber wie sollte er aussteigen, ohne dass es der Verfolger bemerkte? »Ist er noch auf der linken Seite?«, vergewisserte er sich. »Ja. Er fährt von Wagen zu Wagen und schaut rein.« Jesús sah im Außenspiegel, wie ein Mofa rechts an den stehenden Fahrzeugen vorbeizog. Das brachte ihn auf eine Idee. Er öffnete die Wagentür so weit, dass der Mofafahrer nicht vorbei konnte. »Schnell, den Kaugummi.« Er hielt Anna die Hand unter den Mund. Dann beugte er sich durch den Türspalt und fragte den Mofafahrer, wie er zum Bahnhof käme. »Noch vier Fahrzeuge«, hörte er Anna im Hintergrund. Umständlich erklärte ihm der Mann den Weg. Der Salvator versuchte unterdessen erneut, eine Nachricht an Iwan abzusetzen. Doch gleichzeitig versuchte sein Darm unter den Nachwirkungen des Zäpfchens, etwas anderes abzusetzen. Seine Eingeweide bäumten sich auf, als wäre eine Bombe explodiert. Und so stöhnte der Salvator vor sich hin, statt ein Lebenszeichen zu senden. »Noch drei Fahrzeuge.« Jesús nickte dem Mofafahrer zu, streckte sich und klopfte ihm zum Dank für die Auskunft auf die Schulter. Lange würde der Kaugummi samt Sender da nicht kleben bleiben. Jetzt musste es schnell gehen. Er zog die Tür zu, damit das Mofa zur Ampel vorfahren konnte. »Noch zwei Fahrzeuge.« Jesús krallte die Finger in den Sitz. Irgendwann musste die Ampel doch umschalten! Endlich tat sie ihnen den Gefallen. Die Fahrzeuge setzten sich in Bewegung. Als der Mofafahrer hinter einem Kombi über die Kreuzung zog, blickte Iwan auf. Anna drehte das Gesicht weg. Gut, dass sie keine feuerroten Haare mehr hatte. Sie hörte sein Motorrad anfahren. Aus den Augenwinkeln sah sie es an sich vorbeifahren. Sie blickte auf, setzte den Blinker und bog ab. »Jippijeh!« Sie lachte laut und hielt Jesús die Hand hin. Mit einem leisen Lächeln klatschte er sie ab. Es war wirklich ein gutes Gefühl, verliebt zu sein. Nach dem Kauf einer Tüte Grafitpulver fuhr Markus in östlicher Richtung auf die Mörfelder Landstraße. Er wollte die Nacht in Annas Wohnung verbringen. Er hatte mehrfach dort angerufen, obwohl er nicht glaubte, dass sie sich zu Hause aufhielt. Es hatte niemand abgehoben. Endlich tauchte der Hochhauskomplex auf. Er begab sich zum Hausmeisterbüro, wo er kurzerhand den Zweitschlüsselsatz der Heydt’schen Wohnung beschlagnahmte. Zunächst sah er in den Briefkasten, aus dem aber nur Marketingmüll quoll – trotz des gut lesbaren Aufklebers: Bitte keine Werbung! (außer für Schnaps) Anna und ihr Galgenhumor. Er grinste – bis ihm eine Liedzeile einfiel: Komik ist Tragik in Spiegelschrift. Vor ihrer Wohnung zog er seine Pistole. Nachdem er die Zimmer durchkämmt hatte, warf er seinen Rechner an und fischte Toms neue Handynummer aus seinen Mails. Anschließend entnahm er der Reisetasche das Grafitpulver, Einmalhandschuhe, einen Küchenpinsel und Klebeband. Er streife sich die Handschuhe über und machte sich auf die Suche nach Fingerabdrücken, die Annas Besucher hoffentlich hinterlassen hatte. Ohne Software und kriminaltechnische Erfahrung dauerte es elend lang – und brachte keine neue Spur. Enttäuscht starrte er aus dem Wohnzimmerfenster in die Ferne. Wenn er wenigstens zu fassen bekäme, was seit heute Morgen in seinem Hinterkopf spukte. Etwas, das wahrscheinlich mit dem gestrigen Besuch bei Triebel zusammenhing. Irgendeine Bemerkung war gefallen, an der sich sein Hirn abarbeitete. Vielleicht eine Idee, die ihn einen Schritt voranbringen könnte, und deren Bedeutung er nicht gleich erkannt hatte. Doch er kam nicht drauf. Er nahm sein Handy und setzte sich in den braunen Ledersessel vorm Fenster. »Hallo, Tom.« »Mann, ich dachte schon, du meldest dich überhaupt nicht mehr. Hab mir Sorgen gemacht, ist doch klar. Jetzt will ich erst mal deine Nummer. Wo bist du denn?« »In Annas Wohnung.« »Bist du bekloppt? Die ist doch genauso gefährlich wie deine. Was machst du, wenn die Gangster plötzlich in der Tür stehen?« »Ich bitte sie herein. Langsam wird nämlich die Zeit knapp.« Er berichtete von Eppstein. »Könnte also sein, dass Anna sich in Sicherheit gebracht hat. Vielleicht ist sie in ihrer Verzweiflung aber auch freiwillig zurückgekehrt, was weiß denn ich? Jedenfalls darf ich es nicht darauf ankommen lassen. Doch es bleiben nur noch achtundvierzig Stunden und der Rest von heute, bis ihr Geburtstag anbricht. Und dummerweise ist mir ein weiterer Verdächtiger abhandengekommen – durch einen als Suizid getarnten Mord.« »Mensch, pass ja auf dich auf, Markus.« »Wo bist du eigentlich untergekommen? Bei Freunden?« »Nö. Ich hocke in meinem Caravan. Auf dem Parkplatz am Flughafen.« »In Egelsbach.« »Klar. Ich darf hier für ein paar Tage kampieren. Aber ich bin jederzeit startbereit. Soll ich kommen?« »Im Moment nicht.« »Versprichst du, dich zu melden, wenn ich helfen kann?« »Versprochen. Aber im Moment kann ich selbst nichts tun. Pass auf dich auf.« »Gleichfalls. – Du, Markus? Es ist natürlich Kacke, in was für einen Schlamassel du geraten bist. Aber es ist schön, dass wir jetzt«, er räusperte sich, »dass wir jetzt wie richtige Brüder sind.« Wie richtige Brüder. Wozu Krisen alles gut sein konnten. Und wie unrecht er Tom, seinen vermeintlichen Bruder Leichtfuß, all die Jahre getan hatte. »Ja, finde ich auch. Bis bald.« Während Markus über seine Selbstgefälligkeit nachdachte, blätterte er gedankenverloren in einem Artikel, den er auf der Fensterbank gefunden hatte. WAS GEHT AB, ALTER? Na, heute schon gestorben? Wenn Sie nicht zufällig ein Süßwasserpolyp sind, dann leider ja. Wer lebt, stirbt, jeden Tag ein Stückchen mehr. Insoweit ist die Sache klar. Die Frage, warum wir sterben müssen, ist hingegen heftig umstritten. Bloß ein Streit um des Pudels Kern? Nicht ganz. Denn letztlich geht es um die Frage aller Fragen: Könnten wir nicht vielleicht auch anders? So wie Süßwasserpolypen zum Beispiel, die unter idealen Bedingungen ewig leben. ZUMINDEST herrscht Einigkeit darüber, wo der Tod den Hebel ansetzt, nämlich in den Zellen. Wie alles Lebendige verschleißen sie mit der Zeit. Das müsste uns eigentlich gar nicht kümmern, denn prinzipiell können sich unsere Zellen durch Teilung erneuern. Sie sind ihr eigener Jungbrunnen. Nur versiegt er leider im Laufe unseres Lebens. Warum? Springen wir ins Jahr 1951. Wir befinden uns in einem Labor in Maryland, USA. Hier fahndet der Biologe George Grey seit Jahrzehnten nach menschlichen Zellen, die sich unbegrenzt oft teilen können. Und endlich landet er einen Volltreffer: In der Gewebeprobe einer Frau namens Henrietta Lacks findet er die »ewigen Zellen«. Für Henrietta Lacks ist dies kein Grund zur Freude: Sie stirbt, während Grey seinen sensationellen Fund verkündet. Doch in gewisser Weise weilt sie bis heute unter uns. Sie lebt in jenen Zellen fort, die ihr damals entnommen wurden und sich seitdem unermüdlich teilen. Ein Grund für uns, Hoffnung zu schöpfen? Vorerst leider nicht. Denn bei den Zellen der Henrietta Lacks handelt es sich um Krebszellen. GESUNDE Körperzellen können sich nur rund fünfzig Mal durch Teilung erneuern, fand Leonard Hayflick 1961 heraus. Schuld sind die Telomere, die sich auf den Enden unserer Chromosomen befinden. Man kann sie sich wie die Plastikhülsen an den Enden von Schnürsenkeln vorstellen. Sie verhindern nicht zuletzt, dass die Chromosomen zusammenklumpen. Telomere sind eine richtig gute Erfindung – nur hat die Sache leider einen Haken: Sie werden bei jeder Zellteilung ein Stück kürzer. Wenn nichts mehr übrig ist, können sich unsere Zellen nicht länger erneuern. Erst altern, dann sterben sie. Und wir mit ihnen. DABEI sind unsere Zellen prinzipiell in der Lage, auch die Telomere bei der Teilung zu rekonstruieren. Nur bräuchten sie dazu einen Schluck des Enzyms Telomerase. Obwohl im Körper vorhanden, wird es ihnen vorenthalten – und das nicht ohne Grund: Ein Schlückchen zu viel des Guten und die Sache endet wie bei Henrietta Lacks. Krebszellen sind oft geradezu in Telomerase getränkt. Möglicherweise ist Telomerase deshalb einigen speziellen Zelltypen vorbehalten, nicht zuletzt den Keimzellen (die der Fortpflanzung dienen). WÄRE es denn nicht möglich, auch die »gemeine« Körperzelle mit Telomerase zu versorgen, ohne gleich Krebs zu riskieren? Die Natur gibt ein Vorbild: den Nacktmull, ein Nagetier von erbarmungswürdiger Hässlichkeit und beneidenswerter Vitalität. Im Reich der Nager hält er den Altersrekord, und zwar mit Abstand: Auf achtundzwanzig Jahre und mehr bringt er es – eine Maus auf gerade mal vier. Nicht zuletzt, weil es ihm gelungen ist, seine Körperzellen mit Telomerase zu versorgen und zugleich der Krebsgefahr zu trotzen. Und warum gelingt das nicht auch anderen Lebewesen? Vielleicht, weil sich die Evolution für solche Tricks nicht »interessiert«. Um Missverständnissen vorzubeugen: Die Evolution ist weder ein Naturgott noch ein Stratege. Sie ist ein Auswahlmechanismus: die Selektion zufälliger genetischer Veränderungen. Maßstab sind die jeweils herrschenden Umweltbedingungen. Veränderungen, die unter diesen Bedingungen den Fortpflanzungserfolg steigern, setzen sich durch, Veränderungen, die ihn mindern, verschwinden wieder. Liegt ja auf der Hand: Je mehr Nachkommen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Gene der Zeuger dauerhaft erhalten bleiben. GENE, die sich erst im Alter, d. h. nach der Fortpflanzungsphase (positiv oder negativ) auswirken, spielen also evolutionär keine Rolle. Da Langlebigkeitsgene den Fortpflanzungserfolg nicht beeinflussen, bleibt die genetische Linie auch dann erhalten, wenn sie »verloren« gehen. Andersherum hindert die Veranlagung zu Alterskrankheiten nicht daran, viele Nachkommen (mit ebendieser Veranlagung) in die Welt zu setzen. Der Mechanismus der Selektion greift hier nicht. MEHR noch: Wann immer »Interessensgegensätze« zwischen Fortpflanzung und Langlebigkeit entstehen, setzt sich erstere durch. Wo immer Energien benötigt werden, fließen sie zuvorderst der Vermehrung zu. Logisch, denn ohne Vermehrung gäbe es kein Leben. Darum sind im Laufe der Evolution wahrscheinlich immer mehr Kompromisse zulasten der Langlebigkeit gegangen. UND warum können dann Nacktmulle und erst recht Süßwasserpolypen, schlichte Gesellen also, was wir nicht können? Vielleicht gerade deswegen. Vielleicht waren, weil sie einfacher gebaut sind, weniger Kompromisse erforderlich. Vielleicht. Letztlich wissen wir es nicht. Letztlich kollidieren alle Theorien über den Tod an dem einen oder anderen Punkt mit Forschungsbefunden. Womöglich bräuchte man eine ganz neue Theorie. UND wie sind unsere Perspektiven? Wenn es uns gelänge, unsere Körperzellen nach Art des Nacktmulls mit Telomerase zu versorgen, ohne deren Entartung zu riskieren, wären vielleicht sogar mehrere Hundert Jahre für uns drin. Der andere Ansatz: die Manipulation der Gene. Mittlerweile kennt man 150 Genvarianten, die Langlebigkeit begünstigen. In Tierversuchen ist es gelungen, die Lebensspanne durch genetische Eingriffe zu strecken. Vielleicht lassen sich die Erkenntnisse irgendwann in Gentherapien für Menschen ummünzen. Bestimmt werden an der medizinischen Front weitere Erfolge gegen Gebrechen und Krankheiten erzielt. Bis dahin heißt es gesund leben – und wenig essen, denn »hungernde« Zellen leben länger. DOCH auch ohne unser Zutun erhalten wir permanent eine Zeitgutschrift: In den vergangenen 160 Jahren stieg die durchschnittliche Lebenserwartung in unseren Breiten kontinuierlich um 2,5 Jahre je Jahrzehnt. So gewinnen wir statistisch pro Tag sechs Stunden Lebenszeit hinzu. ES tut sich also einiges, um uns ein bisschen mehr Zeit zu schenken. Das größte Geschenk können wir uns aber selbst machen – indem wir die Zeit nutzen, die uns zur Verfügung steht! Weise, weise. Ob Anna beim Schreiben auf die Idee gekommen war, der Rat gelte auch für sie selbst? Markus konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Ein Grinsen, in dem leiser Stolz mitschwang, denn ihm gefiel, wie sie schrieb. Plötzlich kam ihm ein Gedanke: Was, wenn er so lange leben könnte, wie er wollte – vorausgesetzt, er entschied unwiderruflich, wie viele Jahre ihm noch bleiben sollten. Nach getroffener Entscheidung wäre es unmöglich, früher zu sterben oder länger zu leben. Wie wie viele Jahre würde er noch buchen? Eine Milliarde? Tausend? Hundert? Es schien ihm ein Ding der Unmöglichkeit, sich festzulegen: Egal, welche Zeitspanne er sich vorstellte – sie war entweder zu kurz oder zu lang. Allmählich spürte er die Müdigkeit auf seine Augenlider drücken. Die Uhr zeigt zwar erst halb sieben, aber da er heute ohnehin nichts mehr tun konnte, nutzte er die Zeit besser, um Kraft zu tanken. Er betrat Annas Schlafzimmer, schaltete die nackt von der Decke hängende Glühbirne ein und setzte sich aufs Bett. Durfte er sich reinlegen? Da die Couch im Wohnzimmer nach Muskelzerrung aussah, überwand er seine Skrupel. Langsam schloss er die Augen – und ebenso langsam öffnete er sie wieder. Irgendetwas hatte ihn irritiert. Mit einem Mal sprang er auf, rannte in die Küche, holte Einmalhandschuhe und einen Stuhl. Seine Augen hatten ihn nicht getrogen: Da stand etwas zwischen zwei Büchern auf dem obersten Regalbrett, das den Schein der Glühbirne reflektierte: eine winzige Kamera. Er verfolgte das hinter einer Längsstrebe verlaufende Kabel und stieß in einer Geschenkschachtel auf einen Festplattenrekorder. Während der polizeilichen Durchsuchung hatte sich die Anlage definitiv noch nicht hier befunden. Hatte Anna sie in der Hoffnung installiert, den Täter auf frischer Tat zu ertappen? Markus löste das Kabel, trug den Rekorder zu seinem Notebook und brachte das Videobild nach einiger Fummelei auf den Monitor. Er blickte Anna, die zur Kamera hoch sah, direkt in die grünen Katzenaugen. »Test. Ene, mene, meck, dringst du hier ein, hau ich dich weg«. Im Hintergrund hörte er eine andere Stimme, ebenfalls weiblich, ebenfalls vergnügt –wie zwei Freundinnen, die einen Streich ausheckten. Die Aufnahme brach nach wenigen Sekunden ab, sodass ihm die mutmaßliche Freundin vorenthalten blieb. In der nächsten Sequenz trug Anna andere Kleidung. Wahrscheinlich der darauffolgende Tag, wofür auch das Tageslicht sprach. Anna ging durchs Bild zur Tür, warf einen prüfenden Blick zur Kamera und verschwand. Man hörte, wie sie die Wohnungstür zuzog. Er ließ die Aufzeichnung in mehrfacher Geschwindigkeit vorlaufen. Einige Minuten tat sich nichts, außer dass die Helligkeit langsam schwand. Ein Tag verstrich. Dann nahm er einen Lichtschein wahr. Er schaltete auf normale Wiedergabegeschwindigkeit und sah eine schattenhafte Person im Schein einer Taschenlampe die Schlafzimmertür passieren. Leider reichte der Kameraausschnitt lediglich bis auf Kniehöhe. Markus meinte, eine Anzughose zu erkennen. Dann versank das Bild wieder in Düsternis. Er beschleunigte die Wiedergabe, bis es sich erneut aufhellte. Jetzt brannte das Flurlicht. Die Person schlich in Richtung Wohnungstür. Mit einem Mal waren Geräusche zu hören. Geräusche eines Kampfes? Annas Stimme. Sie schrie. Ein lautes Krachen, als sei jemand gegen ein Möbelstück geflogen. Die Beine des Eindringlings tauchten auf, gefolgt von Annas, die sich gegen die Zugrichtung stemmten. Vergebens. Der Eindringling musste über enorme Kräfte verfügen. Anna heulte und fluchte, der Eindringling schwieg. Sie habe Besuch bekommen, hatte sie gesagt. Wenn sie diese Aktion einen Besuch nannte, wollte er nicht wissen, was sie sich unter einem Überfall vorstellte. Langsam verschwanden die Beine aus dem Bildausschnitt und die Geräusche ebbten ab. Der Eindringling musste Anna in die Küche oder ins Wohnzimmer gezerrt haben. Markus meinte, Stimmen zu vernehmen, die er aber weder zuordnen noch verstehen konnte. Nach einer Viertelstunde kam Anna wieder an der Schlafzimmertür vorbei. Kurz darauf hörte er sie sagen, sie werde nicht mehr zur Arbeit erscheinen. »Das war’s mit dieser Anna Heydt, die werden Sie nicht mehr wiedersehen.« Triebel hatte den Satz tatsächlich im genauen Wortlaut wiedergegeben. Die Schlafzimmertür wurde aufgestoßen. Anna trat ein und knipste das Licht an. Mit starrem, von Hoffnungslosigkeit gebleichtem Gesicht ging sie zum Schrank und holte Unterwäsche heraus, die sie in eine Aldi-Tüte stopfte. Im Hinausgehen schaltete sie das Licht aus und zog die Tür zu. Markus vergewisserte sich, dass nichts Interessantes mehr folgte; lediglich die beiden Streifenbeamten, die er hierhin geschickt hatte, tauchten noch auf. Anschließend ließ er die Aufzeichnung zurücklaufen, bis die Beine des Unbekannten ins Bild traten. Er drückte die Pausetaste. Der Mann trug tatsächlich eine dunkelgrau oder schwarz schimmernde Anzughose, darunter schwarze Oxfordschuhe mit dezentem Lochmuster auf der Vorderkappe. Ein Allerweltsmodell, aber in einer hochwertigen, wahrscheinlich rahmengenähten Ausführung. Markus besaß einen Blick für solche Ausstattungsdetails und hätte schwören können, diese Schuhe kürzlich irgendwo gesehen zu haben. Bei Holland? Zumindest hätten sie zu dessen eleganter Kleidung gepasst. Er rief Ogentaff zu Hause an. »Hallo, Bodo, ich …« »Es ist Wochenende und wir sitzen gerade beim Abendessen!« »So eine Idylle hätte ich auch gern. Hab ich aber nicht, also hör zu. Ich werde dir einen Festplattenrekorder per Kurier ins Präsidium schicken.« Er klärte Bodo über die Zusammenhänge auf. »Nehmt die Fingerabdrücke ab und gleicht das Profil der männlichen Stimme mit Hollands ab. Vielleicht kann die Kriminaltechnik auch herausfiltern, worüber gesprochen wird.« »Wie kommst du in den Besitz des Rekorders? Nein, sag nichts, ich will es lieber doch nicht wissen.« »Es muss schnell gehen!« »Montag.« »Das sind noch anderthalb Tage! Könntest du nicht morgen zufällig was im Präsidium zu erledigen haben?« »Also weißt du … Na gut. Sag mal, du bist schon ein ganz schönes Stück vom rechten Weg abgekommen, was? Musst du wissen. Nur – ich würde gern Polizist bleiben.« »Ja, ja.« »Soweit ich es vertreten kann, helfe ich dir, aber nicht weiter. Und jetzt möchte ich mich wieder meiner Familie und dem Abendbrot widmen. Schönen Abend.« Du mich auch. Kaum hatte er aufgelegt, hörte er vom Flur her ein Geräusch. Jemand machte sich an der Wohnungstür zu schaffen. Er sprang auf und sah sich nach seiner Pistole um. Dann erinnerte er sich: Sie lag im Schlafzimmer. Leider fehlte die Zeit, sich für diese Idiotie in den Hintern zu treten. Mit nichts als den bloßen Händen bewaffnet, verbarg er sich hinter der halb offen stehenden Wohnzimmertür. Während sich Schritte durch den Flur bewegten, stemmte Markus einen Fuß gegen die Wohnzimmerwand. Die Tür wurde aufgedrückt. Jemand trat in den Raum. Jetzt! Markus warf sich gegen die Tür. »Auuuaa!« Vom geringen Widerstand überrascht, knallte Markus gegen den Türrahmen. Er hatte den Eindringling locker in den Flur zurückgeschleudert. Offenbar kein Hüne. Auch die Stimme klang nicht nach Goliath. Eher nach David. Genauer gesagt nach Davids Schwester. Aber von einer bewaffneten Frau ging nicht weniger Gefahr aus. Er riss die Tür wieder auf und blickte in den Flur, bereit, sich auf die Waffe zu stürzen. Aber er sah keine. Was er sah, war eine verschreckte junge Frau, die sich in Erwartung weiteren Übels eingerollt hatte. Auf diese Weise ließ sich allerdings auch eine Waffe verbergen. Ohne sie aus den Augen zu lassen, stieg er über sie hinweg und holte sich seine Pistole aus dem Schlafzimmer. Er trat hinter sie. »Zeigen Sie ganz langsam Ihre Hände vor.« Sie tat es, zitternd. Er befahl ihr aufzustehen und führte sie ins Wohnzimmer, wo er ein Portemonnaie und mehrere Schlüssel aus ihrer Manteltasche zog. Einer passte in die Wohnungstür. »Woher haben Sie den?« Sie antwortete mit einer trotzigen Gegenfrage: »Wie sind Sie hier reingekommen?« »Ich bin Polizist. Und ich erwarte Antwort auf meine Frage.« »Zeigen Sie mir erst Ihren Dienstausweis.« »Den habe ich nicht dabei.« Sie warf ihm einen spöttischen Blick zu. »Dann bin ich auch von der Polizei.« »Haben Sie den Schlüssel von Frau Heydt?« »Ich weiß nicht, wo sie sich befindet.« In ihren Augen flackerte Unsicherheit auf. Markus klappte das Portemonnaie auf. Ihrem Studentenausweis zufolge hieß sie Elisabeth Erlenbach und studierte an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. »Wenn Sie zu der Organisation gehören, die hinter Frau Heydt her ist, endet Ihre Suche hier. Ich werde Sie nämlich festnehmen.« »Halten Sie mich für einen Vollposten? Wenn einer von uns beiden hinter ihr her ist, dann doch wohl Sie. Aber Anna ist auf Draht. Deswegen hat sie mir auch nicht gesagt, wo sie sich aufhält. Sie hat mich angerufen, ob ich ihr hier was besorgen könnte, und wenn sie es braucht, wird sie sich melden.« Das hatte sie sich gerade ausgedacht, war Markus sich sicher. »Und den Schlüssel hat sie Ihnen durchs Telefon zugesteckt?« »Den Schlüssel?« Sie brauchte eine kleine Denkpause. »Den Schlüssel hat sie mir schon gestern gegeben, als wir euch geleimt haben.« »Wieso geleimt?« Sie betrachtete ihn nachdenklich. »Sind Sie etwa …? Wie ist denn Ihr Name?« »Markus Engel.« »Sie also sind der Halunke. Und Sie haben immer noch nichts Besseres zu tun, als die arme Anna zu verfolgen?« »Setzen wir uns.« Er legte die Pistole auf den Couchtisch. »Ich muss Ihnen einiges erklären.« LEBER IM ANGEBOT | D-LANGEN (HESSEN) »Wer ist der Mann, der mir die Zäpfchen verpasst hat?« »Nur ein Helfer, machen Sie sich um den keine Sorgen, Alexander. Ich lasse Sie nicht auffliegen. Außerdem entscheide ich mich ja vielleicht für Ihr Angebot. Aber erst, nachdem Sie mir endlich reinen Wein eingeschenkt haben.« Alles Heuchelei, sie hatte an seinem abstrusen Angebot kein Interesse mehr. Sie brauchte seine »Hilfe« nicht. Trotz Engels hinterhältigem Tiefschlag kam sie langsam wieder auf die Beine. Denn sie hatte jetzt Freunde, allen voran Elisabeth und Jesús. Auch der Schock, den die »Menschenernte« ausgelöst hatte, klang langsam ab. Sie wollte gar nicht mehr wissen, was ihn ausgelöst hatte. Jesús hingegen musste die Wahrheit erfahren, sonst würde er seines Lebens nicht mehr froh. Deshalb die Entführung. Sie würde versuchen, Alexander unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zum Sprechen zu bringen, während Jesús im Nebenraum saß und mithörte. »Ich habe in den letzten Tagen oft geträumt und bin schweißgebadet aufgewacht«, setzte sie das Täuschungsmanöver fort. »Und immer habe ich mich hinterher an ein und dasselbe Wort erinnert: ernten.« Sie beobachtete ihn mit Argusaugen. »Sie haben mich entführt, um mit mir über Traumdeutung zu sprechen?« Es fiel ihm schwer, seine Verblüffung unter einem arroganten Lächeln zu verbergen. Mit diesem Begriff konfrontiert zu werden, hatte er nicht erwartet. Es bestätigte sich ein Verdacht, den er seit Längerem hegte: Bei den notgedrungen dilettantisch ausgeführten Behandlungen kam es zu unkontrollierten Nebenwirkungen. Déjà-vu-Erlebnisse waren in der Vergangenheit gelegentlich vorgekommen, doch nur in Form unbestimmter Gefühle und Ahnungen. Nie in dieser klarsichtigen, sich in einem Wort äußernden Weise. Offenbar trat beim Clearing von Erinnerungen ein Problem auf, vielleicht Verunreinigungen beim Verflüssigen der Neuronen; aber das war bloße Spekulation und es gab niemanden, den er fragen konnte. »Reden wir über Tatsachen statt über Träume«, lenkte er ab. »Ich hätte Ihnen schon noch gesagt, worum genau es geht. Und ich habe kein Problem, es Ihnen jetzt zu sagen. Einverstanden, Anna?« »Nur zu.« »Zunächst öffnen Sie bitte die Handschellen.« »Vielleicht nach unserem Gespräch. Also, reden Sie.« »Ich bin krank, Anna, sehr krank. Ohne eine Lebertransplantation werde ich qualvoll sterben.« »Und ich bin die Selbstbedienungstheke, aus der man sich bedienen kann?« »Sie sind unfair. Ich habe Sie keinen Moment über die Konsequenzen des Deals im Unklaren gelassen, außerdem geht es nur um einen Teil ihrer Leber. Und sie waren interessiert. Weil ich Ihnen das beste Angebot Ihres Lebens gemacht habe.« »Ja, ja. Es steht noch die Antwort aus, wer dieses unglaubliche Angebot verwirklichen soll.« »Ein Team weltweit führender Wissenschaftler, namhafte Leute, die einen Ruf zu verlieren haben. Sie glauben doch nicht, dass ich mit deren Namen hausieren gehe. Wirklich revolutionär ist übrigens nur die psychische Komponente des Angebots.« »Den Sermon kenne ich schon. Warum kommt gerade mir das Privileg dieses großartigen Angebots zu? Man könnte sich doch einfach einen Penner von der Straße holen.« »Und Sie meinen, ich hätte gerne die Leber eines Penners?« »Aber meine versoffene Leber nehmen Sie?« »Eine Leber ruiniert man nicht in kurzer Zeit. Summa summarum weisen Sie hervorragende Werte für die Behandlung auf.« Anna dachte nach. Lucy, die Haushälterin, die angeblich auch Krankenschwester war, hatte ihr in den vergangenen Tagen Blut und Speichel entnommen, doch das erklärte eines nicht: »Woher kannten Sie meine Werte, als Sie mir Ihr Angebot gemacht haben?« »Ich selbst wusste gar nichts. Aber Dr. Guhl ist mit einem der Wissenschaftler bekannt, alte Studienfreunde, wenn ich das richtig verstanden habe. Jedenfalls hat sie den Tipp gegeben.« »Woher haben Sie die Kohle, Ihre Truppe und den Fuhrpark samt Hubschrauber und Flieger zu unterhalten?« »Ist alles nicht mein Privatbesitz, sondern gehört einem Unternehmen. Ich bin dort Partner.« »Welches Unternehmen.« »Das, liebe Anna, geht niemanden etwas an. Ihre Neugierde in Ehren, aber einen Rest Privatsphäre müssen Sie mir schon lassen. Es ist jedenfalls kein Unternehmen, für das ich mich zu schämen hätte.« »Und wozu brauchen Sie ein Stehendes Heer?« »Sie übertreiben mal wieder maßlos. Ein paar Leibwächter, sonst nichts.« »Ein paar? Sie haben den Learjet zu einem Truppentransporter umgebaut.« »Mein Geschäftstätigkeit führt mich manchmal in Länder, in denen man selbst für seine Sicherheit sorgen muss. In Russland zum Beispiel kann es für ausländische Investoren sehr gefährlich werden. Die russische Mafia mag die seriöse Konkurrenz nicht. Wer da mit nur einem Leibwächter antanzt, kann sich gleich eine Zielscheibe auf die Stirn malen.« »Warum waren Sie hinter Jesús Mirandor her?« »Woher kennen Sie den Namen?«, fragte er scharf zurück. »Fiel in Salou, vor der Schießerei. Hab ich aufgeschnappt.« »Der Nachname vielleicht, aber bestimmt nicht der Vorname.« »Na, schön, Engel hat mir von ihm erzählt.« »Wann?« »Tun Sie nicht so, als wüssten Sie nicht Bescheid. Sie oder Ihre Leute, einer drückt doch immer seine Schnüffelnase in die interessanten Scheißhaufen. Sparen Sie sich also das Katzund Mausspiel und beantworten Sie meine Frage, ich werde ungeduldig.« »Mirandor hatte offenbar den Verstand verloren. Bildete sich ein, es gäbe eine Organisation, die ihn verfolgt. In seiner Raserei ist er auf die Idee verfallen, ich hätte damit zu tun.« »Und nur deswegen sind Sie mit Ihrer Horde in Spanien eingefallen?« »Mirandor wollte meinen Ruf zerstören, das ist keine Lappalie. Der Mann ist völlig durchgedreht. Am Ende hat er sogar versucht, einen Polizisten zu töten. Dabei ist er selbst erschossen worden.« »Sie haben in Salou einen regelrechten Krieg angezettelt.« »Nicht ich. Meine Leute sollten Mirandor ergreifen, um ihn der Polizei zu übergeben, damit endlich Ruhe in die Angelegenheit kommt. Doch plötzlich ist ein Trupp spanischer Soldaten aufmarschiert und hat uns angegriffen. Etwas so Bizarres haben ich noch nirgends auf der Welt erlebt. Meine Leute haben leider den Kopf verloren.« »Mirandor hat sich genau wie ich an dem Wort ›ernten‹ abgearbeitet.« »Hat Ihnen Engel das erzählt? Dann sind doch alle Fragen beantwortet: Mirandor glaubte, geerntet worden zu sein. Bedarf es eines weiteren Beweises seines Wahnsinns? Und wenn Engel Ihnen davon erzählt hat, wissen wir auch, wie der Unsinn vom Ernten in Ihre Träume geraten ist.« Der Kerl wusste wirklich auf alles eine Antwort. Sie hätte ihn gern auf die Vermisstenfälle angesprochen, doch möglicherweise spräche sie damit zugleich ihr Todesurteil. »Warum soll es ausgerechnet an meinem Geburtstag geschehen?« »Jetzt sagen Sie nicht, Sie halten mich für einen esoterischen Spinner. Ich habe Ihnen längst gesagt, dass der Eingriff nicht genau an Ihrem Geburtstag stattfinden muss. Den Termin mache auch nicht ich. Es ist eben nicht so einfach, die Stars der Branche an einen Tisch zu bringen.« An einen OP-Tisch? Unwillkürlich sah Anna sich auf dem Tisch liegen, sah alte Männer ihren Körper aufschlitzen und ihre Leber bergen. Ihr wurde kotzübel. Ende der Vorstellung, sie wollte nicht mehr. Von der Lebertransplantation abgesehen, hatte sie nichts Neues erfahren. Und die war erstunken und erlogen, wenn Jesús ebenfalls auf der Abschussliste stand und Alexander nicht gleich mehrere Lebern besaß. Jesús musste selbst ran und es auf seine eigene Weise versuchen, wenn er denn nicht anders konnte. Wortlos erhob sie sich, setzte Alexander die Augenmaske auf und führte ihn in den Keller. Er ließ es mit eisiger Miene geschehen. Als Anna ins Wohnzimmer zurückkehrte, lächelte Jesús sie an – obwohl sie ja gar nichts rausgekriegt hatte. Sie bedauerte schon, dass er bestimmt bald wieder nach Spanien abdüsen würde. Wenn erst seine Haare wieder nachgewachsen wären, würde er ihr gefallen, ziemlich gut sogar. Aber von Romanzen hatte sie die Nase voll, allzu leicht konnten sich Engel als Teufel entpuppen. Außerdem war Jesús mit Sicherheit auch nicht nach Gefühlsduselei. Er hatte nur Augen für den Feind. Während Anna ihren Gedanken nachhing, beobachtete Jesús sie verstohlen. Er gab sich größte Mühe, seine überbordenden Gefühle im Griff zu behalten. Anna liebte Markus Engel, hatte er längst eingesehen. Man musste nur seinen Namen nennen, schon explodierte sie. Wahrscheinlich redete sie sich ein, es sei Hass, doch Hass war ein zu stumpfes Gefühl, um die Funken sprühenden Ausbrüche zu erklären. Wie ein außer Rand und Band geratenes Feuerwerk. Sie liebte Engel, und wenn es auch nicht gerade nach Happy End aussah, musste er sich damit abfinden. Es fiel ihm gar nicht so schwer. Verliebt zu sein war ein gutes Gefühl, ein heilsames sogar, das seine Unruhe linderte. »Was machen wir jetzt, Jesús? Im Plauderton bringe ich nichts aus ihm raus.« »Danke für den Versuch. Du hast getan, was du konntest. Nun kommt mein Part.« »Nämlich?« »Je weniger du weißt, desto besser.« Genau genommen wusste er selbst noch nicht, wie er es anstellen wollte. Gestern noch hatte er sich vorgestellt, dem Mann ein Glied nach dem anderen zu amputieren, bis er sein Geheimnis preisgab. Sollte am Ende nur noch ein Torso von ihm übrig bleiben, auch gut. Doch die Lust auf Grausamkeit war ihm vergangenen. »Ihm seine Geheimnisse abzupressen, wird zum Himmelfahrtkommando, das weißt du doch selbst, Anna. Wenn du damit leben kannst, nichts zu erfahren, dann solltest du genau das tun: leben. Schnapp dir Elisabeth und fahr mit ihr in Urlaub.« »Keine schlechte Idee. Aber dann würde ich dich gern in Spanien besuchen.« Wie gut das klang. Jesús hätte sich gewünscht, er könnte alles abschütteln und auch einfach leben. Doch was ihm so viele Jahre gelungen war, vermochte er nicht mehr. »Ihr seid mir immer willkommen. Aber erst muss ich das hier zu Ende bringen – ohne dich.« »Ich lass dich nicht allein.« »Etwas Ähnliches hat vor Kurzem mein Freund Carlos zu mir gesagt. Jetzt ist er tot.« »Bei mir hat sich das Entsetzen von selbst wieder gelegt. Vielleicht brauchst du nur etwas mehr Zeit.« »Ich glaube es nicht, Anna.« »Aber dafür dein Leben zu riskieren …« Anna war zu aufgewühlt, um weiterzusprechen. Nach einer kleinen Pause fuhr sie mit leiser Stimme fort: »Ich habe kaum Freunde, Jesús. Und ich möchte sie nicht gleich wieder verlieren.« Sie legte ihre Hand auf sein Knie und Jesús wurde heiß und kalt. Vielleicht könnte er doch alles abschütteln, wenn sie ihm nur sagte, dass sie ihn liebe. »Lass uns eine Nacht drüber schlafen, Jesús. Der Tag war lang und anstrengend. Morgen sehen wir weiter.« Sie sah auf die Uhr. Elisabeth hätte längst zurück sein müssen. Wieso nur hatte sie ihrem Drängen nachgegeben, trotz der Gefahr, dass Alexanders Schnüffelhunde ums Haus schlichen. Elisabeth hatte die Bedenken lachend abgetan, sie würde schon auf sich aufpassen. Als spielten sie hier Räuber und Gendarm. SCHLANGENNEST & SCHWEINEREI| D-FRANKFURT/MAIN Elisabeth verließ das Haus, ging einige Meter den Weg entlang und blickte hoch. Markus zeigte sich verabredungsgemäß am Wohnzimmerfenster, um zu beweisen, dass er ihr nicht folgte. Als sie sich zum Gehen umwandte, kam ihr ein Mann entgegen. »Wissen Sie zufällig, wo Frau Heydt wohnt?« Irgendwie ahnte Elisabeth, dass der Man genau wusste, wo Anna wohnte. Ihn interessierte vielmehr, was sie hier zu suchen hatte. »Nein, hat sie Schulden bei Ihnen?« »Äh?« »Ich bin Gerichtsvollzieher und suche hier einen Herbert Mayer – das sind nicht zufällig Sie?« »Nein, so ’n Quatsch.« »Zeigen Sie mir doch mal Ihren Personalausweis.« »Sie haben sie wohl nicht mehr alle. Wenn hier einer … Ach, hau lieber ab, bevor ich unangenehm werde.« Den Gefallen tat sie ihm nur zu gern. Markus beobachtete vom Fenster aus, wie der Mann Elisabeth hinterherblickte, während sie in einen roten Mini einstieg. Einen Moment schien der Kerl unschlüssig, dann wandte er sich ab und ging zum Hauseingang. Der Verdacht, dass Annas Wohnung seit ihrer Flucht überwacht wurde, lag auf der Hand. Er musste sich eine neue Unterkunft besorgen. Elisabeth hatte zwar nicht verraten, wo Anna sich befand, aber immerhin versprochen, sich für ihn starkzumachen und auf ein Treffen zu drängen. Bis dahin musste er mögliche Verfolger abschütteln. Toni bezog am Hauseingang Posten. Ihm ging die Gerichtsvollzieherin nicht aus dem Kopf. Ziemlich jung für solch ein Amt, oder? Was wusste er schon davon. Bis vor ein paar Tagen hatte er in der Wiener Filiale als Schatten seinen eintönigen Dienst geleistet. Sie alle hatten gelernt, mit der Monotonie umzugehen: Solange der Feind sich nicht zeigte, war Langeweile der gefährlichste Gegner der Unsichtbaren Armee und auch er musste bezwungen werden. Umso mehr hatte sie die »Schlacht von Salou« elektrisiert, die vor zwei Tagen bekannt gemacht worden waren. Der Feind trat aus dem Dunkel, das Gefecht begann! Wie hatten sie diesen Moment herbeigesehnt! Doch nun zeichnete sich eine Katastrophe ab: Der Feind hatte den Salvator in seine Gewalt gebracht! Statt sich dem Kampf zu stellen, war sein Schlangenkopf hervorgeschnellt, hatte sich den Hoffnungsträger geschnappt und war feige wieder verschwunden. Und so wurden die Heilssoldaten nicht in die Schlacht geführt, sondern wie Hühner durch die Gegend gescheucht. Er selbst zuerst hierhin zur Observierung des Hauses, dann plötzlich zu einer Adresse im Westhafen, anschließend zum Osthafen und von dort wieder in die Ausgangsstellung zurück. Ein heilloses Durcheinander, das Toni immer noch nicht begriff. Und der tschechische Kamerad, mit dem er hier zusammen Wachen halten sollte, ließ auf sich warten. Er fühlte sich hilflos. Hätte er doch besser die angebliche Gerichtsvollzieherin verfolgt? Aber Iwan hatte nichts von einer Frau gesagt, sondern ihnen eingetrichtert, neben der Gesuchten nach einem Mann mit kurz geschorenem Haar Ausschau zu halten. Außerdem befand sich in der zu observierenden Wohnung immer noch der Polizist. Nein, sprach Toni sich Mut zu, er hatte richtig entschieden. Markus verstaute seine Sachen in einer Tasche und bestellte nebenbei ein Taxi. Anschließend wählte er die Notrufnummer 110. Er meldete einen Raubüberfall und gab auch gleich eine Täterbeschreibung durch; sie passte auf den Aufpasser, der unten rumlungerte. Dann fuhr er mit dem Aufzug ins Erdgeschoss und wartete, bis die Streife eintraf. Der Aufpasser reagierte sofort. Da von vorn zwei Polizisten nahten, versuchte er, das Haus entlang in Richtung Parkplatz zu verschwinden. Die Polizisten riefen ihn an, er solle stehen bleiben. Was er nicht tat, wie Markus an der Spurteinlage der Ordnungshüter erkannte. Er ging zügig zum Taxi, das bereits wartete. An der Messe stieg er in ein anderes Taxi um und ließ sich ins Mercure Hotel in Eschborn Ost fahren. Es lag am äußersten Rand eines Gewerbegebietes, wohin sich außer Geschäftsreisenden kaum jemand verirrte. Das Hotelzimmer versprühte den üblichen Charme von der Stange, von Tuttlingen bis Timbuktu dasselbe Design. Aber die Matratze trug und das Nachttischlämpchen funktionierte. Er kramte ein Buch aus der Tasche, fand aber für die filigrane Formulierkunst Jonathan Franzens keine Muße. Ständig kreisten seine Gedanken um Anna. Er legte das Buch beiseite und knipste das Licht aus. Sonntagmorgen, fünf Uhr. Triebel saß mit geschlossenen Augen im Arbeitszimmer und spielte die Alternativen durch. Aber er kam zu keinem neuen Schluss und rang sich zu einer Entscheidung durch: Um die Katastrophe abzuwenden, war alles erlaubt, wirklich alles! Man konnte in dieser Situation keine Rücksichten nehmen. Engel in Sachen Genamic Industries hinzuhalten, sollte kein allzu großes Problem darstellen, überlegte er. Schwieriger würde es werden, ihm gegebenenfalls Informationen über Anna Heydt zu entlocken. Immerhin waren sie jetzt Duz-Freunde, das schaffte eine gute Grundlage für vertrauliche Gespräche mit prekärem Inhalt. Es gab für Engel eigentlich keinen Grund, ihm zu misstrauen. Das Schwein sollte bekommen, wonach es verlangte. Als Markus gegen neun erwachte, fühlte sich sein Hirn wie frisch gewaschen an. Das Blut prickelte in freudiger Erwartung, Anna vielleicht schon heute wiederzusehen. Sie würde natürlich bocken, was sonst, aber wenn sie ihm nur zuhörte, musste sie doch zu guter Letzt einsehen, dass nicht er sie getäuscht hatte, sondern Anastasia. Beschwingt ging er in den Frühstückssaal, wo das Buffet mit allem lockte, was der Mittelklassefrühstücker von Tuttlingen bis Timbuktu erwarten durfte. Noch bevor er einen Cappuccino bestellen konnte, vibrierte sein Handy. »Hier ist Elisabeth. Leider habe ich keine so tollen Nachrichten.« »Etwas mit Anna?« »Nein, nein, nicht, was du denkst, keine Gefahr. Es geht ihr gut. Nur … Ich bin überhaupt nicht zu Wort gekommen! Sobald dein Name fällt, macht sie dicht. Und das ist noch die geschönte Fassung. Wie ich es sehe, muss ich sie zu ihrem Glück zwingen. Sie wird mir zwar die Augen dafür auskratzen, aber was tut man nicht alles für seine beste Freundin.« »Ist sie das?« »Wenn sie’s noch nicht ist, dann wird sie’s hoffentlich, ich finde sie toll. – Okay, ich habe mir Folgendes überlegt: Ich werde sie überreden, mit mir einen Spaziergang zu machen und lotse sie zu dir. Den Rest müsst ihr selbst hinbekommen. Kannst du in circa einer Stunde in Langen sein?« »Ja.« »Fahr zum Lutherplatz und warte, bis wir auftauchen. Aber verschreck sie nicht, sonst nimmt sie gleich wieder Reißaus. Am besten, du bewegst dich nicht von der Stelle. Sie wird einen Moment brauchen, den Schock über meine Hinterhältigkeit zu verdauen. Ich bin gespannt.« »Und ich erst. Also um halb zwölf am Lutherplatz. Vielen Dank, Elisabeth, ich weiß das sehr zu schätzen.« »Hoffen wir, dass Anna es auch zu schätzen weiß. Bis gleich.« Markus spürte Nervosität aufsteigen, die seinen Hunger verdrängte. Er ging zurück aufs Zimmer, wo er einige Minuten den Gang vor dem Bett hin und her schritt. Was, wenn Anna ihn nicht ausreden ließ? Wenn sie in einem ihrer Anfälle davonlief? Es wäre nicht schlecht, Verstärkung zu haben, überlegte er und rief erst Tom, dann Lexied an, beide Male ohne Erfolg. Sollte er es bei Triebel probieren? Er war unschlüssig, ob er diesen beschaulichen Menschen hineinziehen durfte. Fragen kostete ja nichts. »Hallo, hier Markus. Deine Frau und Tochter sind doch übers Wochenende weg und da dachte ich, du hättest vielleicht Zeit.« »Zeit, wieso?« »Ich könnte Hilfe gebrauchen.« »Ach so?« »Weißt du, ich werde gleich Anna sehen.« »Oh … Das freut mich.« »Tja, und ich wollte fragen, ob du mich vielleicht begleitest.« »Ähm … Würde ich nur zu gern. Aber meine Tochter ist krank. Da kann ich nicht weg.« Er fragte überhaupt nicht, woher Anna plötzlich kam und wie es ihr ging? Wenn seine Tochter erkrankte, hatte er offenbar für nichts anderes einen Kopf. »Nun, dann wünsche ich Melanie gute Besserung. Ich hatte sie letztens am Telefon, eine charmante junge Dame.« »Oh ja. Ähm … ja … dann … Und ihr trefft euch hier in Frankfurt?« »In Langen.« »Ja, kenne ich ganz gut, netter kleiner Ort, gediegen. Und wo dort?« »In der Innenstadt. Du, ich muss los.« »Los? Jetzt sofort? Ihr trefft euch gleich?« »Ja. Wir hören voneinander.« »Das würde mich freuen.« SONNIGE AUSSICHTEN | E-MADRID Um 9:50 Uhr betraten Flugkapitänin Karin Hansen und der Erste Offizier Steven Blake das Cockpit eines zweistrahligen Airbus A319-100 der Fluggesellschaft Blue Sky. Karin freute sich, mal wieder mit dem Waliser zu fliegen, denn sie schätzte sein ausgeglichenes Temperament nicht weniger als sein fliegerisches Können. Der junge Mann hatte Kerosin im Blut, ein Naturtalent. Daher wunderte es sie nicht, dass er einen Ausbildungsplatz bei einer großen deutschen Fluggesellschaft ergattert hatte, obwohl er keine Hochschulreife besaß. Was er auch einer frappierenden Tatsache verdankte: Flugzeugführer praktizierten keinen anerkannten Ausbildungsberuf wie etwa Friseure oder Schneider, sondern bloß eine »Tätigkeit«. Darum existierten nur einige grundsätzliche Zulassungsvorschriften, der Rest stand im Ermessen der Fluggesellschaften. Das Flugdatenpaket lag bereits vor. Blake prüfte das Beladungsdokument mit dem Endstand an Fracht und Passagieren. Er tippte den Wert in den Bordrechner und orderte die entsprechende Menge Kerosin; die voll besetzte Maschine würde mit 70 Tonnen Startgewicht fast die maximale Auslastung erreichen. Hansen kontrollierte unterdessen die Vollständigkeit der Borddokumentation und Notausrüstung. Gemäß dem im Cockpit herrschenden Rotationsprinzip fungierte sie auf diesem Flug als pilot non-flying. Ihr oblag vor allem der Papierkram, fliegen würde Kopilot Blake. Nachdem jeder für sich die zum Abheben erforderliche Startgeschwindigkeit berechnet hatte, glichen sie die Werte ab. Sie stimmten überein. Pünktlich um 10:27 Uhr verließ der Airbus seine Parkposition auf dem Flughafen MadridBarajas. Um 10:36 Uhr erhielt Flug BS 911 mit Ziel Frankfurt am Main Starterlaubnis. Blake ließ die Turbinen mit halber Leistung laufen. Kein Anzeichen einer Störung, ready for takeoff. Er gab vollen Schub auf die beiden Turbofan-Stahltriebwerke. Die Maschine schoss die Startbahn entlang. Nach einigen Sekunden meldete Hansen die Geschwindigkeit in Knoten: »One hundred«. »Checked«, quittierte Blake die Ansage. Während die Maschine weiter beschleunigte, prüfte Hansen die Fahrtmesser. Sie passierten die Entscheidungsgeschwindigkeit – für einen Startabbruch würde die Rollbahn nun nicht mehr reichen. Nach 1.800 Metern zog Blake die Maschine im Winkel von 12,5 Grad hoch, wie der künstliche Horizont auf dem Hauptbildschirm anzeigte. Das Flugzeug bewegte sich auf die geschlossene Wolkendecke zu. Nach drei freien, aber leider grauen Tagen, die Karin Hansen mit Mann und Stiefsohn in Madrid verbracht hatte, freute sie sich auf den Sonnenschein über den Wolken. Der Sonnenanbeter, wie sie ihren Mann gern nannte, würde sich bestimmt auch freuen. Er saß mit David hinten in der Maschine. Karin wartete, bis Fahrwerk und Klappen eingefahren waren, dann gönnte sie sich einen Blick über den blauen Horizont. Sie chauffierte nun schon seit sechzehn Jahren Passagiere durch die Luft und hatte sich noch keine Sekunde gelangweilt. FLIEHKRÄFTE| D-LANGEN (HESSEN) Verdrossen fuhr Elisabeth in Richtung Lutherplatz. Anna hatte Lunte gerochen und nachdem sie über das Ziel des Spaziergangs Bescheid wusste, war sie nicht mehr zu zähmen gewesen. Auch Jesús hatte sich vergebens den Mund fusselig geredet. Markus würde wohl oder übel unverrichteter Dinge abziehen müssen und darauf hoffen, dass sie irgendwann wieder zur Besinnung kam. Elisabeth tat es leid für ihn und nicht minder für Anna, die sich selbst im Weg stand. Aber man konnte niemanden zu seinem Glück zwingen. Am Lutherplatz sah sie Markus, lässig ausstaffiert mit grauer Jeans, weißem Hemd und schwarzem Kurzmantel. Wie sie es hasste, schlechte Nachrichten überbringen zu müssen. »Sie ist nicht mitgekommen?« »Nein. Sie weiß, dass du hier bist, will dich aber nicht sehen.« »Schade.« »Hey, lass den Kopf nicht hängen, noch ist nicht aller Tage Abend!« »Kannst du mich nicht einfach zu ihr bringen?« »Das wäre ein Vertrauensbruch.« »Verdammt, die Schweine sind doch bestimmt immer noch hinter ihr her! Ich könnte Anna schützen!« »Wir sind in Sicherheit. Außer dir weiß niemand, dass wir hier untergetaucht sind. Und wenn doch was Unvorhergesehenes passieren sollte, rufe ich dich an.« »Dann sag mir wenigstens, wer der Mann ist, den ihr euch geschnappt habt.« »Ich kenne den Namen nicht. Außerdem mische ich mich in diese Sache nicht ein.« »Was ist mit Mirandor? Verhält er sich vernünftig?« »Wieso?« »Du weißt nicht, was in Eppstein passiert ist? Bei Annas Befreiung hat er ihren Bewacher angeschossen.« »Aha.« »Es ist noch nicht klar, ob er auf ihn gezielt hat.« »Er würde nichts tun, was Anna gefährdet.« »Jetzt bin ich so nah dran und soll wieder abhauen? Ich habe kein gutes Gefühl dabei.« »Ich kann’s leider nicht ändern. Gib mir dein Ehrenwort, dass du mir nicht folgst.« Markus atmete tief durch. »Wenn du versprichst, dich sofort zu melden, wenn irgendwas vorfällt.« »Einverstanden. Komm schon, mach nicht so ein Gesicht. Freu dich, dass Anna wieder in Freiheit ist! – Wir sehen uns.« »Hoffentlich.« Er sah Elisabeth frustriert hinterher. Von der anderen Seite des Platzes machte sie ihm ein Zeichen, endlich zu verschwinden. Mit einem Seufzer wandte er sich um und ging zum Taxi, das er sicherheitshalber hatte warten lassen. Beim Einsteigen sah er Elisabeth in eine Seitenstraße abbiegen. »Zurück zum Hotel, Chef?« »Ja.« »Date nicht gut gelaufen?« »Fahren Sie einfach.« »Jawohl, Chef!« Vom Kreisel auf dem Lutherplatz aus sah Markus ein mit zwei Personen besetztes Motorrad starten. Es verschwand in dieselbe Seitenstraße wie Elisabeth. Verfolger? Schwachsinn. Das Taxi durchfuhr den Kreisel und begab sich auf die Rückfahrt. »Sind Ihnen auch die Motorradfahrer aufgefallen?« »Nein, Chef, wo denn?« »Beim Lutherplatz.« »Da war doch tote Hose.« »Da fuhr ein Motorrad an.« »Ist wahrscheinlich auch in Langen nicht verboten.« »Wenden Sie!« »Wie jetzt?« »Wir fahren zurück.« Markus glaubte nicht ernsthaft, die Motorradfahrer hätten etwas mit Elisabeth zu tun, aber er wollte es gern glauben, um sein Versprechen guten Gewissens brechen zu können. Der Gedanke, tatenlos in seinem Hotelzimmer zu vermodern, war ihm unerträglich. Er dirigierte den Fahrer in die Seitenstraße. Nichts mehr zu sehen. »Wir fahren durchs Viertel. Halten Sie bitte die Augen offen, wir suchen einen roten Mini.« »Aber Sie sind jetzt kein Massenmörder, wo Opfer ausspioniert.« »Doch, und wenn Sie nicht endlich losfahren, steche ich zu.« »Bitte nicht in den Hals, da bin ich empfindlich.« Nach einer Viertelstunde gab Markus die Hoffnung auf. »Wir fahren zurück nach Frankfurt.« »Scheint heut nicht Ihr Tag zu sein. – Moment mal.« Der Fahrer bremste und setzte den Wagen einige Meter zurück. Sie standen vor einem nach Dornröschenart zugewachsenen Einfamilienhaus. »Schauen Sie mal zum Gehweg links, Chef. Hinter den Büschen – da schimmert was Rotes.« Markus sah sich um. Nirgends ein Motorrad auszumachen. »Ich steige aus, Sie warten bitte. Aber nicht hier, fahren Sie ein Stück vor.« »Wie wär’s mit einer Anzahlung?« Markus gab ihm einen Fünfziger. »Wehe, Sie verduften.« »Wo denken Sie hin. Man hat ja nicht täglich die Ehre, einen Massenmörder zu kutschieren.« Markus schlug sich durchs Gebüsch. Tatsächlich, ein rotes Mini Cabrio. Er zog die Beretta aus dem Achselholster und quetsche sich am Wagen vorbei. Langsam arbeitete er sich durch dichter werdendes Gestrüpp zur rückwärtigen Seite des Hauses vor. Von innen meinte er ein Klingeln zu hören. Das Klingeln stammte von Iwans Handy. »Ja?« »Henry hier. Alles unter Kontrolle?« »Ja. Rat mal, wen wir hier noch gefunden haben. – Mirandor.« »Schau an, von den Toten wiederauferstanden. Endlich mal eine erfreuliche Nachricht. Der BMW fährt gerade vor. Der Wagen für die andere Bagage braucht noch etwas.« »Verstanden. Rechts vom Haus ist ein Gehweg, da soll der Wagen reinfahren.« »Ich geb’s weiter.« Iwan befahl Jorgos, den Salvator zum BMW zu begleiten. »Du fährst mit zurück.« Während Jorgos den Salvator rechtsseitig durch die Botanik zum BMW führte, erreichte Markus linksseitig die hintere Ecke. Das Haus öffnete sich zum Garten mit einer großen Glasfront, doch bodenlange Vorhänge versperrten die Sicht. Er horchte und vernahm eine männliche Stimme, die definitiv nicht Mirandor gehörte. Dem Tonfall nach erteilte jemand Befehle. Ohne sich viel Hoffnung zu machen, drückte Markus vorsichtig gegen den Rahmen der Schiebetür. Sie gab nach. Er schob sie millimeterweise auf, bis er durch den Spalt fassen und den Vorhang ein wenig beiseiteschieben konnte. Ihm gegenüber saßen Anna, Elisabeth und Mirandor auf einem Sofa. Vor ihnen stand, mit dem Rücken zum Garten, ein gedrungener, breitschultriger Mann. In der Linken hielt er ein Handy, in der Rechten eine Pistole. Markus entschied abzuwarten, bis der Mann auflegte, damit seine Kumpane am anderen Ende der Leitung nicht mitbekamen, was hier ablief. Vom zweiten Motorradfahrer fehlte jede Spur. Vermutlich befand er sich irgendwo im Haus. Zum Glück lag die halb geöffnete Wohnzimmertür genau gegenüber, sodass er ihn vor sich haben würde, wenn er herbeieilte. Endlich beendete der Mann das Gespräch. Markus hob die die Pistole. Dann stieß er die Tür beiseite. »HÄNDE HOCH!« Iwan reagierte mit der Präzision eines Elitekämpfers. Während er langsam die Arme hob, spannte er die Beinmuskulatur wie Eisenfedern und katapultierte sich zur Seite. Gleichzeitig beschleunigte er den Körper um die eigene Achse und rollte sich, kaum am Boden, hinter einen Sessel. Noch in der Bewegung gab er einen Schuss ab. Markus wurde zurückgeschleudert. »HAUT AB!«, schrie er und feuerte drei Schüsse in Richtung Sessel. Elisabeth und Mirandor sprangen sofort auf und rannten an ihm vorbei in den Garten. Anna blieb mit regungslos sitzen. »HAU AB!« Markus schoss ein weiteres Mal. Anna reagierte nicht, wohl aber der Mann. Markus fing sich noch eine Kugel ein, diesmal am Arm. »HAU ENDLICH AB!« Er warf sich auf den Boden und zwang den Mann hinter dem Sessel mit einem Schuss, in Deckung zu bleiben. Gleichzeitig ergriff Anna wie in Zeitlupe einen schweren Kerzenleuchter und warf ihn hinter den Sessel. Anschließend erhob sie sich und verschwand mit nachtwandlerischer Bewegung im Korridor. Dann tat sich nichts mehr. Markus robbte zur Seite. Der Mann lag benommen neben dem Kerzenleuchter, begann sich aber wieder zu regen. Markus sprang auf und rannte Anna hinterher. Draußen war niemand zu sehen, auch sein Taxi nicht. Wohin war sie so schnell verschwunden? Plötzlich heulte in seinem Rücken ein Motor auf. Er drehte sich um und sah einen Golf aus der Reihe geparkter Autos ausscheren. Ob Anna am Steuer saß, konnte er nicht erkennen. Der Wagen schoss an ihm vorbei. Im selben Moment wurde hinter ihm die Haustür aufgerissen. Taumelnd trat der Mann heraus. Verdammt, warum hatte er ihm die Waffe nicht abgenommen? Als er eine Kugel an sich vorbeizischen hörte, sprintete er los. Unverhofft legte der Golf eine Vollbremsung hin und setzte zurück. Er lief im Zickzack auf den Wagen zu und riss, die Waffe im Anschlag, die Beifahrertür auf. Anna saß am Steuer. Nachdem sie aus dem Schussfeld gelangt waren, betrachtete Markus den sich ausbreitenden Blutfleck auf seinem Hemd. Es hatte ihn ganz schön erwischt. Er zog sein Handy aus der Tasche und rief Tom an. »Bist du noch auf dem Flughafen?« »Ja, hier ist heute Flugschau, ich helfe. Warum?« »Anna und ich sind auf der Flucht, in Langen. Ich habe mir eine Schusswunde zugezogen.« »Jesses. Mein Campingbus steht direkt vor dem Flughafengebäude, links vom Tower. Ihr kommt mit dem Wagen allerdings nicht auf den Parkplatz, alles voll. Müsst ihn irgendwo draußen abstellen, keine Ahnung, hier ist mächtig was los. Ich warte im Caravan auf euch, okay?« Anna stieß Markus an und deutete auf den Rückspiegel: In der Ferne überholte ein Motorrad schlingernd einen PKW. »Jede Wette, das ist Iwan. Hat den Kerzenleuchter noch nicht ganz verdaut, kommt aber wieder auf Touren.« »Uns ist ein Verfolger auf den Fersen«, informierte Markus seinen Bruder. »Manövrieren wir uns bei dir nicht in eine Falle?« »In dem Kuddelmuddel findet der uns nicht so schnell. Und in zwei Stunden ist die Show zu Ende. Dann rückt die ganze Meute wieder ab. Und wir mitten drin.« »Wenn du am Steuer sitzt …« »Ist mir klar. Ich finde jemanden, der uns rausfährt.« »Bis gleich.« »Da vorn rechts – nach Egelsbach«, gab Markus die Richtung vor. »Sie haben hier nichts zu melden«, antwortete sie kühl, riss das Steuer aber im letzten Moment herum und driftete in die Seitenstraße. »Im Übrigen will ich nicht, dass Sie meinen Vornamen benutzen, wenn Sie von mir reden.« Markus erläuterte ihr Toms Plan. »Aber dazu müssten wir diesen Iwan ein paar Meter hinter uns lassen.« »Ich fahre, was die Karre hergibt.« »An der Kreuzung rechts.« »Schauen Sie nach links! Kommt da was?« »Nein, ni…« Markus verschlug es die Sprache. Anna jagte wie in einem Videospiel um die Kurve. Die Physik zerrte am Heck, der Wagen drohte auszubrechen. Mit schnellen Lenkbewegungen hielt Anna dagegen und brachte ihn wieder in die Spur. Er blickte sich um. Dem Motorradfahrer erging es nicht besser. Seine Versuche, das Zweirad in den Griff zu kriegen, scheiterten. Die Fliehkraft zog es von der Straße. Fahrer und Gefährt verschwanden zwischen Büschen. Markus blickte zu Anna hinüber, die mit dem Anflug eines Grinsens in den Rückspiegel schaute. »Wie ich Iwan kenne, ist er in einer Minute wieder auf den Beinen. Nicht kleinzukriegen. Und es ist bestimmt schon Verstärkung im Anmarsch, ein Transporter, randvoll mit Arschlöchern. Wie weit noch?« »Sind gleich dort. Es gibt allerdings nirgends freie Parkplätze.« Um solche Kleinigkeiten scherte Anna sich nicht. Da auf Höhe der Flughafeneinfahrt auch der Straßenrand zugeparkt war, hielt sie mitten auf der Fahrbahn und sprang aus dem Wagen. »Kommen Sie schon!« Markus stolperte ihr hinterher. Mittlerweile spürte er die Kugel in der Brust. Ihm war, als riesele seine Kraft wie Sand aus dem Einschussloch. Anna drehte sich nach ihm um und bemerkte die dunklen Verfärbungen auf seinem Hemd. »Alles Blut? Ach, du Scheiße.« In ihrem Blick spiegelte sich für einen Sekundenbruchteil Sorge. »Das haben Sie davon, mir nachzujagen. Als gäbe es sonst niemanden, der das Interesse der Polizei verdient.« Markus hätte es gern richtiggestellt, doch Geplauder passte nicht so richtig in die Situation. Er deutete Richtung Tower. »Da hin.« »Ich schlage uns eine Bresche, Sie bleiben hinter mir.« Kaum hatte sie den Satz beendet, hörte sie in ihrem Rücken laut quietschende Reifen. Iwan, wie sie vorhergesehen hatte. Sie zog Engel mit sich in die Menschenmenge. Iwan stellte das Motorrad am Straßenrand ab und humpelte zum Parkplatz. Den Schmerz im Fuß ignorierte er, viel schlimmer war die Benommenheit. Zumindest klarte sein Blick langsam auf. Er kniff die Augen zusammen, um die SMS von Henry zu entziffern. Sie besagte, dass Engels Bruder Tom in Egelsbach wohnte. Er besaß einen weißen VW Caravan. Auch das Kfz-Zeichen enthielt die SMS. Ein vielversprechender Ansatz. Iwan beschloss, den Zugang zum Parkplatz zu überwachen und auf die Verstärkung zu warten. Er vertrieb sich die Zeit, indem er sich ausmalte, wie er es Heydt heimzahlen würde. Jeder Rempler, den Markus sich einfing, schlug wie ein Boxhieb ein. Er hielt sich nur mühsam auf den Beinen. Am Caravan angekommen, sackten die Beine unter ihm weg. Ihm wurde schwarz vor Augen. Tom zog ihn ins Wageninnere und schloss die Tür. Anna drückte das Erstaunen über den doppelten Engel beiseite und half dem Zwilling, seinen Bullenbruder auf die hintere Sitzbank zu hieven. Markus öffnete die Augen. Tom hatte ihm den Mantel abgestreift und knöpfte gerade vorsichtig sein Hemd auf. Verbandskasten und Handtücher hatte er bereits herausgelegt. Auf dem Gaskocher stand ein Topf, aus dem Besteck ragte. Offenbar hatte er es sterilisiert. Er plante doch wohl nicht, eine Operation durchzuführen. In Toms Gesicht las er ängstliche Besorgnis. Nie hatte Markus sich ihm näher gefühlt. »Dein Arm hat wahrscheinlich nur einen Streifschuss abgekriegt, aber die Brust sieht nicht so gut aus. Ich versuche, sie zu reinigen.« Tom tupfte die Wunde mit einem ausgekochten Waschlappen behutsam ab und überlegte, wo das Herz saß. Die Wunde befand sich eher links, und das Herz saß beinahe mittig – oder? Es trat immer noch Blut aus. Auf der Suche nach der Kugel drückte er vorsichtig die Spitze eines Schälmessers in die Wunde. Markus bäumte sich schreiend auf. »Schon gut, schon gut, ich höre damit auf.« Bei dem vielen Blut war die Sache ohnehin aussichtslos. Nachdem er Gin auf die Wunde geträufelt hatte, drückte er eine Handvoll Kompressen darauf und betrachtete seinen Bruder, der noch mehr schwitzte als er selbst. Er nahm ein Handtuch und wischte ihm den Schweiß ab. Anna lugte durch die geschlossenen Fenstervorhänge. Sie hatte nur wenige Meter freie Sicht. Sobald sich eine Lücke in den Menschentrauben auftat, strömten Leute nach. Plötzlich stach ihr ein Mann ins Auge, der auf einem Flachdach längs der Parkplatzeinfahrt hockte und durch ein Fernglas zu ihr herüberblickte. Er trat an den Rand des Daches, sah hinunter und zeigte in ihre Richtung. »Wir müssen hier raus!« »Du siehst doch, wie es Markus geht. Wir sollten einen Arzt rufen. Es sind welche auf dem Gelände.« »Nein, wir müssen weg – sofort! Die Schweine ahnen, dass wir uns hier drin befinden. Sie kommen. Wenn sie euch kriegen, seid ihr tot.« »Ach, Markus, der versucht hat, dich zu retten, ist tot, aber du …« »Einen Scheißdreck hat er!« Markus ignorierte die höllischen Schmerzen, und richtete sich auf. »Weg – sofort!« Anna schob die Seitentür auf und spähte hinaus. Noch keiner von Iwans Bluthunden zu sehen. »Wir haken uns bei ihm ein. Wohin können wir verduften?« »Der einzige Ausweg ist das Flugfeld, da entlang.« Tom zeigte auf ein Tor, vor dem eine Menschenmenge auf Einlass wartete. Er schnappte sich seine Jacke, streifte Markus das Sakko über und zog ihn hoch. Gemeinsam bugsierten sie ihn ins Freie. »Platz gemacht, wir haben einen Verletzten«, brüllte Tom, »Platz, Platz, nun geben Sie doch den Weg frei!« Nicht alle sahen ein, dass einem Verletzten Privilegien zustanden, doch Anna verschaffte sich mit gezielten Tritten Respekt. Am Tor angelangt, hörte sie in der Menge hinter sich empörte Schreie. Wahrscheinlich kämpfte sich Iwan samt Mannen gerade durch den Haufen. »Wie heißt du eigentlich?« »Tom.« »Wohin jetzt, Tom?« »Zu einem Sanitätszelt?« »Da sitzen wir in der Falle.« »Die wagen doch nicht …« »Die wagen alles. Wir brauchen ein Versteck.« Anna sah sich um. Auf dem weitläufigen Flugfeld standen ihnen nicht mehr so viele Leute im Weg, dafür hatte Iwan hier viel freiere Sicht. Anna zog die beiden Engels nach rechts, wo drei Flugzeuge parkten. Dahinter konnten sie sich vielleicht verbergen. Die vorderste Maschine lief im Leerlauf. Der Pilot sprang aus einer seitlichen Öffnung und ging zu Fallschirmspringern, die einige Meter abseits miteinander redeten. Offenbar Teilnehmer der Flugschau. Anna begann zu schnaufen, langsam wurde Engel ihr schwer. »Setzen wir ihn kurz ab«, sagte sie und deutete auf den Einstieg des Flugzeugs. »Ich muss mal Luft holen.« Kaum hatten sie auf der Einstiegskante Platz genommen, wurde einer der Fallschirmspringer auf sie aufmerksam und machte Anstalten, sie zu verscheuchen. Anna wollte sich schon erheben, da winkte der Mann mit der Andeutung eines Grußes ab. Er kannte Tom offenbar. Sie fuhr sich erleichtert mit dem Ärmel übers Gesicht. Am Himmel türmten sich dunkle Wolken, doch wenn die Sonne durch eine Lücke stach, heizte sie ziemlich ein. »Okay, Tom, weiter.« Ehe Tom antwortete, sah sie Iwan in rund dreißig Metern Entfernung. Und er sah auch sie. Er winkte seine Leute heran. Die sechs Männer bildeten einen weit gezogenen Halbkreis und kamen langsam auf sie zu. STIMMLAGE | D-LUFTRAUM Jo, der Mann von Flugkapitänin Hansen, war in erster Ehe mit einer mehr oder weniger geistesgestörten Furie verheiratet gewesen. Umso mehr wussten er und sein elfjähriger Sohn David die freundliche, besonnene Art von Karin zu schätzen. Allein ihre ruhige Stimme war eine Wohltat. Trotzdem hatte ihnen ebendiese Stimme vor einigen Minuten Angst gemacht – und nicht nur ihnen. Karin hatte mit sachlichen Worten den Ausfall des linken Triebwerks gemeldet. Niemand müsse sich Sorgen machen, die Lage sei unter Kontrolle und der Frankfurter Flughafen in Reichweite. Sie würden nun eine Schleife fliegen, um den Kollegen am Boden Zeit zu geben, ihnen den Weg freizumachen. Danach würden sie sicher landen. Jo flog nicht gern. Auf einem Sitz festgenagelt, fühlte er sich vom eigentlichen Geschehen abgeschnitten. Wenn aber seine Frau im Cockpit saß, fand er sich dort gut vertreten. Er blickte aus dem Fenster in der letzten Sitzreihe und entspannte sich langsam. Triebwerksausfall klang zwar dramatisch, vor allem, wenn es nur zwei gab, doch Karin würde das Ding schon schaukeln. Auch David, der nach seiner Hand gegriffen hatte, als die Maschine von einer Sekunde zur anderen ins Schlingern geraten war, wirkte wieder gefasst. Seiner neuen Mama zu Ehren hatte er sich viel Wissen über Flugzeuge angeeignet, das er jetzt fachmännisch zum Besten gab. Es half ihm offenbar, sich innerlich wieder aufzurichten. »Weißt du, Papa, ein defektes Triebwerk wird total abgekapselt, also von Sprit, Hydraulik und Strom. Da kann nichts passieren.« WHAT A WONDERFUL WORLD | D-LUFTRAUM Iwan und seine Schergen näherten sich mit der gespannten Behutsamkeit, mit der man ein Fluchttier einfängt. Anna überlegte, wohin sie jetzt noch türmen konnten. Nirgendwohin. Endstation. Tom hingegen sah noch einen Ausweg. »Sobald die Maschine zu rollen beginnt, hievst du Markus rein«, flüsterte er. »Danach schließt du die Öffnung mit dem Rollladen.« Er robbte auf allen vieren zum Cockpit. Aus Kostengründen flog er meist auf einer kleinen Cessna 150. Diese hier, eine Cessna 208 Caravan, war ein anderes Kaliber, größer, schwerer, und mit mehr Instrumenten bestückt. Aber er würde das Ding schon schaukeln. Die Fallschirmspringer staunten nicht schlecht, als sich ihr Flugzeug ohne sie in Bewegung setzte. Noch mehr staunten sie, als sie ihren Piloten am Boden ausmachten. Selbst Iwan, der bei Heydt auf vieles gefasst war, staunte. Er erwog, auf die Reifen zu schießen, aber es standen zu viele Leute im Schussfeld. Diese Ausgeburt der Hölle konnte ihm doch nicht schon wieder durch die Lappen gehen! Nachdem Anna den Rollladen heruntergelassen hatte, sah sie sich in der ziemlich großen Kabine um. Die Ausstattung bestand im Wesentlichen aus Klappsitzen. Neben einem lagen ein paar Sachen, darunter eine Decke, ein Rucksack und ein Kunststoffseil. Sie breitete die Decke aus, rollte Engel darauf und schob ihm den Rucksack unter den Kopf. Den Versuch, ihn mit dem Seil festzubinden, gab sie schnell auf. Zu umständlich. Sie würde ihn zur Not halten. Er kam gerade wieder zu Bewusstsein und schaute ihr stumm zu. Schließ doch einfach die Bullenglubscher! Tom passierte den Rollhalt vor der Startbahn, ohne Checklisten durchzugehen oder den Vorflugcheck durchzuführen. Auch die Meldung beim Tower unterließ er. Nicht einmal das Headset setzte er auf. Der Mann im Turm würde ihn doch nur beschwören, den Unsinn zu beenden. Er sah sich nach Flugzeugen um, die ihm in die Quere kommen könnten. Alles frei. Jo hätte David gern in den Arm genommen, spürte jedoch, dass eine behütende Geste nicht willkommen wäre. Sein Sohn wollte heute ein ganzer Mann sein. Er genoss seinen Wissensvorsprung in Sachen Flug… Weiter kam Jo nicht. Das Flugzeug erzitterte unter einem gewaltigen Schlag. Das Triebwerk heulte auf, dass es in den Ohren schmerzte. Die Kabinenlichter flackerten, dann erloschen sie. Die Bildschirme versanken in Schwärze, die Passagiere in Angst. Aus den Augenwinkeln sah Jo jenseits des Fensters etwas aufflackern. Entsetzt starrte er hin: Das rechte Triebwerk zog einen Feuerschweif hinter sich her. Sein Atem stockte. Er presste sich in den Sitz und ergriff Davids Hand. Vor seinem geistigen Auge liefen Fernsehbilder: Die Concorde von Paris beim Start. Eine Turbine speit Flammen. Sekunden später stürzen über hundert Menschen in ihren fliegenden Sitzen zu Boden. Sie versinken in einem apokalyptischen Feuerball. Er blickte zu David, der mit aufgerissenen Augen der Katastrophe harrte. Die Angst kannte keine Altersbeschränkung. Nach gefühlten Stunden beruhigte sich das Triebwerk. Der Feuerschweif schrumpfte und erlosch. Die Passagiere begannen zu lauschen: kein Motorengeräusch mehr. Friedhofsruhe. Die Hysteriker antworteten mit akustischem Terror. Ein offenbar angetrunkener Mann sang zu einer erfundenen, anschwellenden Melodie: »Run-ter kommen sie im-mer, kommen sie immer, a-ber wie?« Nun begann auch noch der Mann neben Jo zu jammern: »¿Por qué? Madre mia, ¿por qué?« David betrachtete ihn mit angestrengtem Blick. Jo beugte sich zu seinem Sohn hinüber und kontrollierte erneut dessen Sicherheitsgurt. »Manche Leute machen sich bei jedem Pups in die Hose, was?«, flüsterte er ihm ins Ohr. David brachte die Mundwinkel nicht hoch. »Das Licht ist ausgegangen, weil das Flugzeug keinen Strom mehr hatte«, murmelte er. »Aber es gibt eine Notturbine.« Er sah zum verrußten, leblosen Triebwerk jenseits des Fensters. »Jetzt haben wir nur noch die Flügel zum Fliegen.« »Mama schafft das schon.« Die beiden Piloten kannten einen vollständigen Triebwerksausfall nur aus dem Flugsimulator. Sie wussten nicht, ob ein äußeres Ereignis, vielleicht der Einschlag eines verirrten Wetterballons, oder ein inneres Geschehen ihren Antrieb zerstört hatte. So oder so zeichnete sich eine Verkettung unglücklicher Umstände ab und damit das Grundmuster einer Katastrophe. Da das Triebwerk keinen Strom mehr produzierte, waren auch im Cockpit alle Monitore erloschen. Tote Instrumententafeln – ein erschreckender Anblick. Für einen Moment segelte das Flugzeug führerlos dahin. Sie aktivierten sofort die Staudruckturbine – einen schlichten kleinen Propeller am Rumpf, der sich ausklappen ließ. Inzwischen drehte er sich im Fahrtwind und versorgte zumindest die wichtigsten Steuerelemente und Bordsysteme mit Strom. Die verfügbaren Rechner waren wieder hochgefahren. Gemäß den Notfallvorschriften übernahm Kapitänin Hansen die Steuerung der Maschine. Blake gab den Code 7700 für einen Luftnotfall in den Transponder ein und meldete sich bei der Flugsicherung. »Mayday, Mayday, Mayday.« Einige Minuten später platzte Hansens Stimme in die gespenstische Stille der Kabine. »Liebe Passagiere, mein Ehrenwort, wir haben die Maschine im Griff. Um alle heil nach Hause zu bringen, brauchen wir aber Ihre Mitarbeit. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Kabinencrew, die Sie sicherheitshalber auf eine Notlandung vorbereitet. Ein persönliches Wort: Heute sind mein Mann und mein Sohn an Bord, hallo Jo, hallo David. Ich bringe uns wohlbehalten runter, versprochen.« In Davids angespannte Miene mischte sich ein stolzes Lächeln. Sein Name war genannt worden! Tom schob den Gashebel vor und die Cessna beschleunigte. Seine Augen kreisten über den Instrumenten, er brauchte jetzt alle Konzentration der Welt, um mit Fingerspitzengefühl auszugleichen, was ihm an Erfahrung und Daten fehlte. Bei siebzig Knoten entlastete er das Bugrad und hob es vorsichtig von der Rollbahn. Der Flieger schwang sich in die Luft. Dieser Teil hatte schon mal geklappt. Er plante, zum Flughafen Mainz-Finthen zu fliegen. Das war nur ein kleiner Hopser und die lange, breite Bahn dort würde ihm die Landung mit dem ungewohnt großen Flugzeug erleichtern. Tom beobachtete, wie sich über ihm die Wolkendecke schloss. Nieselregen setzte ein. Und wenn schon. Er zog die Maschine weiter nach oben. Mit der maximalen Steigleistung von 370 m/min entfernte sie sich vom Boden. Der Airbus sank wie ein gigantisches Segelflugzeug der Erde entgegen. Nach Stevens Berechnung würden sie es mit ihrem Gleitwinkel bis zum Flughafen schaffen – wenn ihnen kein Fehler unterlief. Im Cockpit herrschte höchste Konzentration. Während Hansen die Maschine steuerte, studierte Blake ein Handbuch. Die einschlägigen Informationen las er vor. Ihre erste Herausforderung bestand darin, auch ohne Turbinenschub einen Strömungsabriss beim Kurvenanflug zu verhindern, denn andernfalls drohte ein Spiralabsturz. Auch in der Flugsicherung herrschte Anspannung. Die Lotsen hatten alle Hände voll zu tun, die Maschinen im engen Luftraum horizontal und vertikal neu zu staffeln, um genügend Sicherheitsabstand herzustellen. Schließlich hatten sie es bewerkstelligt. Die Anflugkontrolle teilte Flug 911 den erbetenen Luftkorridor zu. Blake warf einen Blick auf den Höhenmesser, der umgerechnet 2045 Meter über Grund anzeigte, und meldete den Wert an den Tower. Die Maschine flog nun direkt über der Wolkendecke. Obwohl Tom nur eine Sichtfluglizenz besaß, erwog er, durch die Wolkendecke zu stoßen. Er meinte, die Feldstecher der Gangster am Boden im Genick zu spüren. Wie weit konnte man mit guten Gläsern sehen? Er wusste es nicht. Wirklich sicher vor ihren nachstellenden Blicken wären sie nur über den Wolken. Schließlich entschied er sich dagegen, denn da oben braute sich was zusammen. Zu riskant. Er beendet den Steigflug und zog die leicht nach oben gerichtete Nase der Caravan sacht herunter. Mittlerweile hatte er ein ganz gutes Gefühl für die Maschine. Er sah sich um: Der Flughafen Egelsbach befand sich bereits ein gutes Stück hinter ihnen. »Anna?« »Ja?« »Da hinten alles okay?« »Er ist nicht bei Bewusstsein, aber sein Atem geht einigermaßen ruhig. Wohin fliegen wir?« »Nach Mainz. Werde mich gleich bei der Flugsicherung melden und einen Arzt anfordern.« Der Airbus tauchte in die Wolkendecke ein und wurde heftig durchgeschüttelt. Doch Hansen nahm es nur am Rande zur Kenntnis. Entgeistert hörte sie, was der Fluglotse ihnen in ruhigen Worten mitteilte: Obwohl der Flugbetrieb auf dem Verkehrslandeplatz Egelsbach vorübergehend eingestellt worden war, hatte ein Privatflugzeug vom Typ Cessna Caravan abgehoben. Es drohte, ihren Weg zu schneiden. »This is a bad time for the Candid Camera«, murmelte Steven. Auch Karin war nicht nach Versteckte Kamera zumute. Mit einem Anflug von Ungeduld schüttelte sie den Kopf. »Dann sehen Sie zu, dass Sie die Maschine von uns fernhalten.« »Der Pilot reagiert nicht auf Funksprüche«, antwortete der Fluglotse mit sachlicher Stimme. »Das Führungszentrum für nationale Luftsicherheit ist informiert. Zwei Abfangjäger der Alarmrotte Neuburg sind gestartet. Können Sie einige Grad in östlicher Richtung ausweichen?« »Negativ.« Hansen hörte, wie der Fluglotse mit einem Kollegen sprach. Dann teilte er ihnen die Flugdaten der Cessna mit. »Sie scheint den Steigflug beendet zu haben. Wie viel beträgt Ihre aktuelle Sinkrate?« Steven gab ihm die Daten. »Ist die Cessna mit TCAD ausgerüstet?« »Positiv. Aber der Pilot hat die Maschine gewissermaßen gekapert. Ob er es aktiviert hat, ist unklar.« Tom hatte das Traffic Collision Avoidance Device, kurz TCAD, nicht aktiviert. Er flog sonst nie mit Kollisionswarngerät und hatte unter der nervlichen Anspannung vergessen, es einzuschalten. Bei seiner gegenwärtigen Flughöhe hätte er auch keine Schwierigkeiten vermutet. Zwar bewegte er sich nahe der Einflugschneise des Frankfurter Flughafens, doch unterhalb der Flugflächen, auf denen die großen Vögel flogen. Trotzdem sah er sich immer wieder um. Den Airbus, der hinter ihm durch die letzten Wolkenschichten sank, konnte er vom Cockpit aus nicht sehen. Die Airbus-Piloten hingegen konnten einen kurzen Blick auf die Cessna erhaschen. Mehr brauchten sie nicht, um zu erkennen, wie eng es würde. Steven bat die Flugsicherung um ein aktualisiertes Lagebild. »Die Cessna hat ihren Kurs beibehalten. Unseren Berechnungen nach müssten Sie knapp aneinander vorbeikommen.« »Verstanden.« »Wir versuchen weiterhin, mit dem Piloten Kontakt aufzunehmen.« In diesem Moment setzte Tom das Headset auf und schaltete das Funkgerät ein, um den Arzt anzufordern. »Tower Frankfurt für Delta Foxtrott Echo Golf Lima, Cessna 208 Caravan.« Tom zuckte zusammen. War er gemeint? Er kannte die Kennung der Maschine nicht. »Tower Frankfurt für Delta Foxtrott Echo Golf Lima, Cessna 208 Caravan, gestartet in Egelsbach.« Die meinten tatsächlich ihn. Tom überlegte, ob er sich melden sollte. Womöglich donnerten bereits Kampfjets heran, um zu verhindern, dass er Kurs auf die Frankfurter Bankentürme nahm. »Tower Frankfurt für Delta Foxtrott Echo Golf Lima, Cessna 208 Caravan.« »Hier Delta Mike Echo Golf Lima.« »Sie befinden sich auf Kollisionskurs. Drehen Sie sofort nach Westen ab.« Kollisionskurs? Tom konnte es nicht glauben. Die Stimme klang auch nicht nach Notfall. Aber wozu diente der Trick, wenn es einer war? Angestrengt ließ er seinen Blick von links nach rechts schweifen. Nirgends ein Flugzeug auszumachen. »Sofort abdrehen! Bestätigen Sie!« »Ich sehe weit und breit keine andere Maschine.« »Ein Airbus, hinter Ihnen. Sofort nach Westen abdrehen!« Jetzt klang die Stimme doch nach Notfall. »Bestätige.« Entschlossen zog Tom die Maschine in eine Schräglage von 30 Grad; die rechte Tragfläche neigte sich nach oben. Gleichzeitig hob er die Nase an, um nicht an Höhe zu verlieren. Er hätte damit alles richtig gemacht, wären nicht Ort und Zeit gegen ihn gewesen. Eine Sekunde früher oder einen Meter tiefer, und die beiden Maschinen hätten einander schadlos passiert. Die erste Berührung war in der Passagiermaschine kaum zu spüren. Es klang, als zöge jemand mit einem Nagel über den Lack. Dann bohrte sich die Kante der hochstehenden Tragfläche in den Airbus-Rumpf. Mit markerschütterndem Kreischen riss sie ein Stück der Außenhülle heraus. Der Airbus erbebte. Als sich die Tragfläche wieder löste, machte er einen Satz zur Seite. Panische Schreie durchzogen die Kabine, Becher, Dosen und Zeitschriften flogen kreuz und quer. Jo hatte keinen Blick dafür. Seine ganze Aufmerksamkeit galt dem mindestens dreißig Zentimeter breiten Riss, der neben David klaffte. Er reichte vom Boden bis auf halbe Höhe zum Fenster. Jo konnte die Erde unter sich sehen. Instinktiv umschlang er seinen Sohn. Er kannte Filme, in denen Passagiere durch Löcher in der Außenhaut ins Freie gesaugt wurden. Wie der Riss entstanden war, hatte er nicht gesehen, es war zu schnell gegangen. Er verstand auch nicht, woher das silberne Etwas gekommen war, das er für einen Sekundenbruchteil wahrgenommen hatte. Wohl aber verstand er, dass dieses Etwas sein Kind getötet hätte, wäre es nur wenig tiefer eingedrungen. »Alles in Ordnung, David?« »Werden wir jetzt sterben, Papa?« »Wo denkst du hin, Mama ist doch im Cockpit«, antwortete er mit gepresster Stimme, die seine Zuversicht Lügen strafte. »Und warum schreien die Leute?« »Weil sie Mama nicht kennen.« Jo rang sich ein Lächeln ab. »Darf ich deine Cola-Dose haben?« »Klar.« Jo zog sie aus dem Netz vor David und ließ sie in den Fußraum fallen. Er vermochte nicht so schnell zu schauen, wie das Loch sie verschlang. Genau das hatte er befürchtet. Ihn überkam Angst, der Sog könne David aus dem Sicherheitsgurt ziehen. Die Kabinenchefin setzte ihr in hundert Notfallübungen angelerntes Das-ist-alles-ganznormal-Gesicht auf und begab sich ins Heck, um nach den Passagieren im Kollisionsbereich zu sehen. »Was ist passiert?«, fragte Jo mit mühsam beherrschter Stimme. »Ein Kleinflugzeug ist uns in die Quere gekommen.« »Sie müssen sofort meinen Sohn umsetzen!« »Wir sind voll belegt.« »Aber der Sog …« »Der Sog ist lange nicht so stark, wie es in Katastrophenfilmen dargestellt wird, glauben Sie mir.« Sie beugte sich über die beiden inneren Sitze und vergewisserte sich, dass Davids Gurt stramm saß. »Solange Ihr Sohn angeschnallt bleibt, wird ihm nichts passieren.« Jo gab sich geschlagen. Und hoffte inständig, es nicht zu bereuen. »Müssten jetzt nicht die Sauerstoffmasken runterfallen?« Statt der Flugbegleiterin antwortete David: »Wir fliegen doch schon ganz niedrig. Hier gibt’s keine Dekompression mehr.« Er kämpfte immer noch gegen die Tränen und war froh, sich an seinem Wissen ein Stück aufrichten zu können. Es war gewesen, als hätte ein Luftgeist sein riesiges Messer in das Flugzeug gerammt. Jo wandte sich wieder an die Flugbegleiterin. »Was, wenn das Loch aufreißt?« »Das kann nicht geschehen«, antwortete sie mit ihrem Alles-normal-Lächeln. »Auf diesem Flug ist schon einiges geschehen, was gar nicht geschehen kann.« »Da muss ich Ihnen leider zustimmen. Erst hatten wir kein Glück und dann kam Pech dazu.« Sie unterlegte ihre Bemerkung mit einem nicht angelernten Achselzucken. »Ich muss auf meinen Platz zurück.« Während die Flugbegleiterin verschwand, fiel Jo das leichenblasse Gesicht des Sitznachbarn auf. »Are you okay, Sir?« »Just fear of flying«, sagte der Mann mit entschuldigendem Lächeln. Seine Finger waren in die Anzughose gekrallt, als könne er sich dort zur Not festhalten. »Don’t worry, please, I’m okay.« Julio Armargo aus Madrid war von Beruf Sprengmeister. Wer hätte also behaupten wollen, er sei ein ängstlicher Mensch? Aber jeder hat einen Schwachpunkt und Julio traf auf seinen, sobald er eines dieser plumpen Schwergewichte betrat, die angeblich fliegen konnten. Bis vor einigen Jahren hatte er nie einen Fuß hineingesetzt, doch seit ihn Herzprobleme plagten, verdiente er sein Geld unter anderem mit Vorträgen auf Kongressen, die häufig im Ausland stattfanden. »I only want to find my feet«, fügte er mit zitternder Stimme hinzu. Was Jo nur zu gut verstand. Auch er hätte gern wieder festen Boden unter den Füßen gehabt. Während Hansen die Maschine mit der berechneten Sinkrate in Richtung Flughafen lenkte, überwachte Blake mit Argusaugen die Multifunktionsdisplays der Bordcomputer. Karin drückte die Flugzeugnase nach unten, um Fahrt für den Schwenk zur Landebahn aufzunehmen. Die Maschine neigte sich zur Seite und erzitterte. Kein Problem, solange sie nicht ins Trudeln geriet. »Let’s get it over with!«, sagte Karin mit etwas zu breitem Grinsen. Der Crash hatte die Cessna mit der Wucht eines Schmiedehammers getroffen. Anna war hin und her geschleudert worden. Immer noch benommen, robbte sie auf die rechte Seite, krallte sich in einen Klappsitz und starrte durchs Seitenfenster. Der Flügel da draußen hing teilweise herunter. Jenseits der Bruchkante schwang er im Wind auf und nieder. Das verhieß nichts Gutes. »Anna?« »Ja?« »Verletzt?« »Nur Prellungen.« »Und Markus?« Sie rutschte auf den Boden zurück und kroch zu Engel. »Bewusstlos, aber am Leben. Ein Absturz würde ihm allerdings nicht bekommen.« »Ihr müsst … « Die Cessna begann um die Längsachse zu torkeln. »Scheiße!« Toms Hände krampften sich um das Steuerhorn. Vorsicht, mach nicht zu viel! Mit kleinen Korrekturen brachte er das Flugzeug halbwegs ins Lot. Lange konnte er die instabile Maschine nicht in der Luft halten, mit jeder Ausgleichsbewegung stieg die Gefahr, zu viel oder zu wenig zu tun. »Ihr müsst abspringen, schnell!« »Wir sollen einfach aus dem Flugzeug springen?« Anna hatte Zweifel, ob sie die Idee hilfreich fand. »Hinten liegt ein Fallschirm.« »Fehlanzeige.« »Mach die Augen auf, verdammt!« »Vergiss es.« Anna sah sich zur Sicherheit doch noch einmal um. Dabei fiel ihr Blick auf den Gegenstand, den sie Engel unter den Kopf geschoben hatte. »Dunkelblau? Sieht aus wie ein praller Rucksack?« »Ja, genau. Du brauchst was, um Markus an dir festzubinden.« »Hier liegt ein Seil.« Tom stöhnte erleichtert auf. »Leg den Fallschirm an komm. FIX!« Anna begann zu schwitzen. Sie zog den Rucksack unter Engels Kopf weg, schlüpfte wankend durch die Tragegurte und eilte nach vorn zu Tom. Den Blick auf den künstlichen Horizont geheftet und die Hände ums Steuerhorn gekrallt, erklärte er ihr das Wenige, was er übers Fallschirmspringen wusste. »Alles verstanden? Okay. Vorbereitung: Leg das Seil vor der Luke aus. Zieh Markus bäuchlings drauf und wickle es ein Mal um ihn. Öffne den Rollladen.« »Zieht uns der Sog dann nicht raus?« »So stark ist er nicht. Aber du musst natürlich achtgeben. Weiter: Du wickelst den Rest Seil um euch beide, mehrfach. Möglichst stramm, sicher verknoten. Dann irgendwie durch die Luke ins Freie.« Erst jetzt kam Anna ein irritierender Gedanke. »Und was ist mit dir?« »Mit mir …« Das Trudeln der Maschine nahm wieder zu. Tom hielt mit zusammengebissenen Zähnen dagegen. »Reib mir mal den Schweiß aus den Augen. – Danke. Ich probier, die Maschine heil auf den Boden zu bringen. Ist meine Pflicht.« Er wusste längst, dass es nicht gelingen würde. In ein paar Minuten war er tot. Ein seltsamer Gedanke. »Wenn ich es wider Erwarten nicht schaffe, dann sag Markus, dass ich ihn liebe. Und noch etwas, aber … Komm schon, blöder Vogel, bleib gerade! … Aber du darfst es ihm nur im Notfall sagen. Versprich es!« »Ich …« Die Maschine kippte über die beschädigte Tragfläche weg. Anna wurde auf den rechten Sitz geschleudert. »Komm schon, komm schon«, hörte sie Tom flehen, während der Motor aufheulte. Anna schloss die Augen. Hatte nicht alles in ihrem Leben den denkbar schlechtesten Ausgang genommen? Nun ging es endgültig die steile Bahn hinab. Sie sah die Gesichter ihrer Eltern vor sich. Mit ihrem Tod hatte alles angefangen. Selbst jetzt noch, in ihren letzten Sekunden, spürte Anna Sehnsucht nach ihnen. Sie wünschte sich, sie könne an ein Leben nach dem Tod glauben, dann hätte sie dem Aufprall in der glücklichen Erwartung entgegengesehen, bald wieder mit ihnen vereint zu sein. »Anna?« Sie öffnete die Augen. Offenbar hatte Tom den Flieger doch noch abgefangen. »Ja, ich verspreche, dein Geheimnis nur im Notfall zu lüften.« Atemlos fasste Tom in Worte, was Markus vielleicht helfen würde, über den Verlust hinwegzukommen: Er, Tom Engel, ein verantwortungsloser Schürzenjäger, hatte Ursula getötet. Sie war verzweifelt gewesen, weil sie sich nicht von Strecker lösen konnte – und da hatte er sie kurz ›getröstet‹. Ein Mal ist kein Mal! Leider hatte das eine Mal gelangt. Er hatte sie angesteckt, nicht ahnend, dass er das Virus in sich trug. Als hätte er bei seiner ausgeprägten Beischläfrigkeit nicht damit rechnen müssen. Um sich vom Fehlen eines Kondoms abhalten zu lassen, war sie in ihrer Verzweiflung zu verwöhnungsbedürftig gewesen und er zu vergnügungssüchtig. Anna hörte der bizarren Geschichte schweigend zu. »Das war’s. Jetzt sieh zu, dass ihr aus der Maschine kommt.« »Du wirst sie nicht heil auf den Boden bringen, richtig?« »Ich wünsche euch, dass ihr glücklich miteinander werdet. Und nun mach voran. Hals- und Beinbruch.« »Willst nicht du mit ihm abspringen? Schließlich ist das alles mein Schlamassel.« »RAUS!« Mit jedem Schwanken der Maschine spürte David, wie Mama gegen die Schwerkraft kämpfte. Der Mann neben Papa starrte heftig atmend auf den Monitor, als könnte er ihn auf diese Weise zum Leben erwecken. Davids Blick wanderte zu Papa. Auch er atmete schnell. »Keine Angst, Mama schafft das schon«, versuchte er ihn zu beruhigen. Jo nickte tapfer. Die Maschine erzitterte wieder, alles klapperte. Offenbar wurde die Innenverkleidung nur locker zusammengetackert. Die Kabine musste jeden Moment auseinanderfallen. Plötzlich sackte die Maschine nach unten weg. Er nahm die Hand seines Sohnes und streichelte sie. Anna sah erleichtert, dass Engel weggetreten war. Entgegen Toms Rat band sie ihn Bauch auf Bauch an sich. Auf diese Weise konnte sie seine Beine besser um ihre Hüfte schlingen, sodass sie bei der Landung mehr Bewegungsfreiheit haben würde. Sie hasste diese Kopulationsstellung schon jetzt. Keuchend rollte sie sich mit dem Fettsack durch die Absprungöffnung. Sie stürzten der Erde entgegen. Anna zählte mit geschlossenen Augen bis zehn. Als sich der Fallschirm mit heftigem Ruck öffnete, erwachte Engel aus der Bewusstlosigkeit und starrte sie aus unerträglicher Nähe an. Anna starrte an ihm vorbei, bis sich seine Augen wieder schlossen. Sie sollten miteinander glücklich werden, hatte Tom sich gewünscht. Offenbar hatte er keine Ahnung, was für ein gemeines Schwein sein Bruder war. Anna blickte zu Boden, der sich rapide näherte. Plötzlich erfasst eine Böe den Fallschirm und drehte ihn. Jetzt sah sie die Cessna wieder. Sie wurde Zeuge, wie Tom die Herrschaft über das Flugzeug verlor. Karin Hansen fuhr das Fahrwerk aus und drehte die Flugzeugnase in den Wind, um nicht von der Anfluglinie gedrückt zu werden. Steven schaltete die Bordsprechanlage ein, um die Kabine auf die Notlandung vorzubereiten: »Brace for impact! Brace for impact!« Der Flieger war mehrfach in kritische Lage geraten, doch sie hatten ihn mit Entschlossenheit und Fingerspitzengefühl hindurchlaviert. Jetzt befand er sich genau auf dem Gleitpfad. Karin hatte sich in Steven nicht getäuscht. Selbst als eine eindringliche Computerstimme »stall, stall, stall« gerufen hatte, die englische Bezeichnung für einen Strömungsabriss, war er die Ruhe selbst geblieben. Statt sie nervös zu machen, hatte er sich nüchtern versichert, dass sie den Warnhinweis wahrgenommen hatte. Offenbar wusste er, dass Stress das Hörvermögen beeinträchtigte, wie Voice-Recorder-Aufzeichnungen verunglückter Flugzeuge bewiesen: Inmitten der Krise hatten Piloten selbst laute Alarmsignale überhört. »Approaching two-five-right«, kündigte eine Computerstimme die vor ihnen liegende Landebahn an. »Hundred!«, meldete die Computerstimme. Noch hundert Fuß bis zum Boden. »Fifty.« »Forty.« Karin wollte möglichst knapp hinter der Landebahnschwelle aufsetzen. Sie konnten es sich nicht leisten, auch nur einen Meter Rollbahn zu verschwenden, denn sie flogen wegen des Ausfalls hydraulisch vertriebener Bremshilfen viel zu schnell. Umso mehr würde ihnen gleich die verzögernde Wirkung der Schubumkehr fehlen, bei der Luft aus den Triebwerken nach vorn ausgestoßen wurde. Zudem mussten sie ohne Anti-Blockier-System auskommen – und es schüttete mittlerweile wie aus Kübeln. »Thirty.« Steven warf einen Blick auf den Radiohöhenmeter, der ihm die letzten Meter zwischen Flugzeugnase und Boden anzeigte. »Twenty.« »Retard.« »Ten.« Karin setzt die 70-Tonnen-Maschine energisch auf den Asphalt. Auf der Landebahn schwamm mehr Wasser als befürchtet, viel mehr. Ideale Bedingungen für ein Wasserflugzeug. Zum ersten Mal in all den Flugjahren überkam sie Angst. Sie trat mit aller Kraft ins Bremspedal. Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge rauschten vorbei, ohne dass die Maschine merklich verzögerte. Eine Stoßböe erwischte sie. Das Heck des Airbus begann zu schlittern. »KÖPFE RUNTER!«, schrie jemand in der Kabine. »KÖPFE RUNTER!« »KÖPFE RUNTER!« Jo ignorierte den gut gemeinten Rat und richtete den Oberkörper auf. Den Blick starr auf David gerichtet, stemmte er sich gegen die Rücklehne des Vordersitzes. Seinem Gefühl nach musste das Flugzeug auch über die längste Landebahn der Welt längst hinausgeschossen sein. Er sah zum Fenster, doch ein Gischtschleier versperrte die Sicht. Auf einmal tat es einen lauten Knall. Ein geplatzter Reifen? Noch ein Knall. Er meinte zu spüren, wie die Maschine über den Rand der Bahn driftete. Worauf schlitterte sie zu? Oh Gott, bitte verschone David! Von heftigen Stößen getroffen, ratterte das Flugzeug über holprigen Untergrund. Jo wurde im Sitz hin und her geschleudert. Ein Baby begann irgendwo zu schreien. Wieder knallte es. Gepäckfächer sprangen auf und spuckten den Inhalt hinaus. Trolleys schossen durch die Kabine. Jo hörte etwas martialisch bersten. Plötzlich neigte sich die Kabine nach vorn. Einen Sekundenbruchteil hielt sie unentschlossen in der Bewegung inne, dann kippte sie zu Boden und schlug hart auf. Das Flugzeug vibrierte wie ein Bohrer, der sich in Beton frisst. Das Heck brach aus. Die Maschine schleuderte mit ohrenbetäubendem Krachen um die eigene Achse. Gleich zerreißt es sie! Die linke Tragfläche zerbrach vor Jos Augen. Dann legte sich der Flugzeugrumpf mit einem gewaltigen Ächzen auf die Seite und prallte nieder. Stille. Jo brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass der Horror ein Ende gefunden hatte. Ein glückliches Ende? »ALLE RAUS! SOFORT ALLE RAUS!« Mühsam drehte Jo den Körper zu David, den die Schwerkraft an die Kabinenwand zog. Sein junges Gesicht wirkte alt und müde. Aber er lebte. Jo öffnete beide Sicherheitsgurte. »Wir müssen schnellstens hier weg.« Wortlos deutete David zum Passagier auf dem Sitz am Gang. Der Mann hing mit aufgerissenen Augen leblos im Gurt. Um nicht durchs Cockpit geworfen zu werden, zog Tom den Sicherheitsgurt so stramm er konnte. Dann ließ er die Steuersäule der Cessna los. Er wollte die letzten Momente seines Lebens nicht damit verplempern, gegen das Unvermeidliche zu kämpfen. Die Maschine kippte über die kaputte Tragfläche weg. Ob er den beiden den Fallschirm auch überlassen hätte, wenn er nicht in Markus’ Schuld stünde? Er wusste es nicht. Zumindest haderte er nicht. Unverhofft überkam ihn Euphorie: Er, Tom Engel, übernahm endlich Verantwortung! Zahlte die Zeche, ohne zu lamentieren! Wenn er einen letzten Wunsch freigehabt hätte: Er hätte er sich gern noch richtig mit Markus angefreundet. Der alte Miesepeter musste bereits gelandet sein. Für einen Augenblick hatte er die beiden unter dem geöffneten Fallschirm niederschweben sehen. Mach’s gut, Bruderherz! Tom lächelte zum letzten Mal in seinem Leben. Dann schob er das Bedauern beiseite. Hätte, wäre, wenn und aber – das brachte ihn sowieso nicht weiter. Was hieß in dieser Lage auch »weiter«? Er stürzte dem Tod entgegen und es war verdammt schwer, dabei zuzusehen. In wenigen Augenblicken würde es keinen Tom Engel mehr geben, in wenigen Minuten würde sein Körper verbrannt sein, so vollständig, dass er nicht mehr von der Asche des Flugzeugs zu unterscheiden wäre. Schwer, sich das vorzustellen. Was ihn wohl erwartete? Die Hölle? Oder konnte er mit seinem Opfer vielleicht seine Schuld wiedergutmachen? Aber vielleicht waren Himmel und Hölle doch bloß Hirngespinste? Vielleicht wurde einfach nur das Licht ausgeknipst, Ende der Vorstellung. Ohne dass Tom es registrierte, zog seine rechte Hand den MP3-Spieler aus der Jackentasche und setzte die Ohrstöpsel ein. Es erklang »What a wonderful world«, in einer Fassung der amerikanischen Industrial-Metal-Band Ministry. Während die Cessna immer schneller um die Achse wirbelte, drehte seine Hand die Lautstärke auf. I see skies of blue and clouds of white. Tom begann leise, beinahe schüchtern, mitzusingen. »The bright blessed day, the dark sacred night. « Er weinte, ohne es zu bemerken. In seinen Augen vereinten sich Schweiß und Tränen. Wie gern hätte er noch ein bisschen gelebt! Doch ihm blieb vom Leben nur noch ein Refrain. Er sang ihn aus voller Kehle. »AND I THINK TO MYSELF WHAT A WONDERFUL WORLD.« TÖDLICHE BONBONS | D-FRANKFURT/MAIN Wo bin ich? Er wollte die Augen öffnen, brachte aber die Lider nicht hoch. Er schlief wieder ein und wachte wieder auf und wusste nicht, ob eine Minute oder ein Jahrhundert später. Seine verschleierten Augen registrierten nur Weiß um sich herum, viel Weiß. Nicht mein Schlafzimmer. Was dann? Vielleicht besser, es nicht zu ergründen. Er schlief wieder ein. Eine Frauenstimme: »Hallo? Hören Sie mich? Können Sie die Augen öffnen?« Wahrscheinlich konnte er – aber wollte er? Da draußen saß was auf der Lauer. »Wo bin ich?« Seine Zunge fühlte sich pelzig an, dem Geschmack nach Stinktierpelz. »Können Sie die Augen öffnen?« Sie würde wohl keine Ruhe geben. Er hob die Lider und tauchte in den weißen Kosmos ein. Die dunkle Haut der Ärztin stach heraus wie kaffeebraune Schlieren auf einem Cappuccino. »Ich bin Dr. Makadida.« »Wo bin ich?« »Was glauben Sie?« »Im Himmel.« »Ein Stockwerk darunter, Krankenhaus.« Er sah sich blinzelnd um. Ein Zweibettzimmer, das andere Bett leer. »Ich habe Schmerzen in der Brust. Und im Fuß.« »Können Sie mir Ihren Namen nennen?« »Ich hab Schmerzen. Wo kommen die her?« »Sie erinnern sich nicht?« »Helfen Sie mir auf die Sprünge.« »Machen wir einen Deal: Sie verraten mir Ihren Namen und ich sage Ihnen, was ich weiß.« »Markus Engel.« »Danke. Und nun sagen Sie mir auch noch, welcher Wochentag heute ist.« »Sonntag?« »War gestern.« »So? Na gut, und jetzt sind Sie dran.« »Ein anonymer Anrufer hat einen Notfall gemeldet. Sie wurden auf einem Feld gefunden.« Auf einem Feld? Er ließ die Information auf sich wirken, doch sein Gedächtnis verweigerte den Dienst. »Wie bin ich da hingekommen?« »Darüber möchte die Polizei mit Ihnen reden.« Polizei. Ihm fiel ein, dass er selbst Polizist war. Oder doch nicht? Irgendwas schien falsch daran. »Was ist mit meinen Schmerzen? Wo kommen die her?« »Den Fuß haben Sie sich nur verstaucht, nichts Ernstes. Aber Sie haben auch zwei Wunden – in der Brust und am Arm. Keine Ahnung, wo die herrühren?« Sollte das ein Quiz werden? »Nein.« »Es sind Schussverletzungen. Man könnte meinen, jemand habe Sie töten wollen.« Dr. Makadida schaltete auf Röntgenblick um, doch das Gesicht des Patienten blieb undurchdringlich. »Waren Sie vielleicht auch bewaffnet?« Langsam nahm sein Hirn die Arbeit auf. Seine Erinnerung reichte jetzt bis zu dem Moment, als er in Langen aus dem Haus gerannt war. Die Polizei hatte wahrscheinlich Schmauchspuren an ihm festgestellt, deshalb fragte die Ärztin nach einer Waffe. Sie versuchte sich als Ermittlerin. »Ich – bewaffnet?« Er setzte ein nachdenkliches Gesicht auf. »Schussverletzungen, hm. Schlimm?« »Nein, Sie haben Glück gehabt. Den Arm hat nur ein Streifschuss getroffen und die Kugel in der Brust ist zwar von einer Rippe abgelenkt worden und hätte fast das Herz getroffen, aber eben nur fast.« »Warum fühle ich mich dann so schwach?« »Das ist normal nach einer Operation. Außerdem hatten Sie viel Blut verloren. Noch ein paar Infusionen und Sie sind wieder auf dem Damm.« Markus richtete sich mühsam auf. Erst jetzt sah er die Kanüle samt Schlauch in seinem Arm. »Warum tut mir das Sprechen weh?« »Ihre Stimmbänder sind entzündet, ein Kollateralschaden der Schussverletzung. Sie müssen Ihre Stimme schonen und viel Kamillentee trinken – das wird wieder. Erinnern Sie sich nun, wie es zu dem Schusswechsel gekommen ist?« Von einem Schusswechsel hatte er überhaupt nichts gesagt. Er ließ sich ins Kissen sinken. »Müde«, flüsterte er. »Nicht einschlafen, um zehn kommt die Visite!« Krankenhäuser und ihre heiligen Rituale. Wahrscheinlich verbaten sie den Patienten auch, vor der Visite abzukratzen. »So müde«, wiederholte er und schloss die Augen. Kaum hatte sie das Zimmer verlassen, richtete er sich auf. Reha stand derzeit nicht auf dem Spielplan. Er las die Zeit von seiner Armbanduhr ab, die auf dem Beistellwagen lag. Bis zum Ärzteauflauf blieb ihm eine Dreiviertelstunde. Nachdem er den Schlauch aus der Kanüle gezogen hatte, schob er in Zeitlupentempo die Beine aus dem Bett. Fühlten sich wie verfaulte Bananen an. Er brauchte fast eine halbe Stunde, sich anzuziehen. Zwei Mal ging er in die Knie, zwei Mal rappelte er sich wieder auf. Schließlich öffnete er die Zimmertür und spähte hinaus. Er fühlte sich wie in einem Film, da flüchteten die angeschossenen Helden auch gern aus Krankenhäusern. Nur dass er sich nicht wie ein Held fühlte, eher wie eine Wachspuppe, die zu nahe bei der Kerze gestanden hatte. Zwanzig Minuten später saß er in einem Taxi und beorderte den Fahrer zum Hauptbahnhof, von wo er mit einem anderen Taxi ins Hotel fuhr. Dort klebte er die Verbände an Brust und Arm mit Teilen einer Plastiktüte ab und setzte sich unter die kalte Dusche, um seiner Benommenheit Herr zu werden. Während er vor sich hin zitterte, lichteten sich weitere Schleier des Vergessens. Seine Erinnerung reichte nun bis zum Flugplatz in Egelsbach. Wir haben den Caravan verlassen und sind aufs Flugfeld gegangen. Da haben mich Tom und Anna auf irgendwas abgesetzt. Irgendwann später hatte sich Anna über ihn gebeugt. Oder auf ihn gelegt? Er konnte sich keinen Reim darauf machen. Und dann gab es ein letztes Bild: Anna und er in inniger Umarmung. Aber sie blickte ihn dabei grimmig an und starrte schließlich an ihm vorbei. Ihre struppigen Haare standen seltsam nach oben weg. Ein surreales Bild, das aus einem Traum stammen musste. Nach der Dusche fühlte er sich etwas besser, wenngleich die Bananenbeine immer noch nicht viel Halt gaben. Plötzlich hatte er ein Geräusch im Ohr. Ein tiefes Brummen. Was ist das bloß? Mit einem Mal wusste er es: das Motorengeräusch eines Flugzeugs. Eines kleinen Flugzeugs, eines mit Propeller, wie Tom es flog. Waren sie in einem Flugzeug geflohen? Aber wie bin ich dann auf das Feld gelangt? Das ergab keinen Sinn! Ergab es doch. Schlagartig klärte sich das Bild, in dem Anna und er sich umarmten. Denn er sah vor seinem inneren Auge, was sich hinter Anna in der Ferne abzeichnete: die Frankfurter Skyline. Die Türme im Bankenviertel ragten heraus – und doch blickte er auf sie hinab. Anna und er waren zusammen mit einem Fallschirm abgesprungen, ein Tandemsprung. Es fügte sich nun alles: Annas vom Luftzug aufgerichtetes Haar, die körperliche Nähe, die sie mit grimmigem Blick quittierte, die Landung auf einem Feld, der verstauchte Fuß. Lediglich eine Frage blieb offen: Was um alles in der Welt war mit Tom geschehen? Markus beschlich ein ungutes Gefühl. Warum waren sie überhaupt gesprungen? Hatten die Gangster sie etwa in einer zweiten Maschine verfolgt? Unrealistisch. Vielleicht ein Problem mit dem Flugzeug. Aber weshalb ist dann nicht Tom mit mir abgesprungen? Anna hat sich doch offensichtlich nicht darum gerissen. Das ungute Gefühl wurde nicht besser. Schließlich kam ihm ein Gedanke, der die Sache vielleicht erklärte: Anna hatte sich ihn aufgeladen, weil sie etwas vom Fallschirmspringen verstand. Und warum hatte Tom ihn nicht ins Krankenhaus gebracht? War sein Fallschirm zu weit abgetrieben? Ja, so musste es sein. Markus atmete ein wenig auf. Anna hatte die Nacht von Sonntag auf Montag in einem Frankfurter Frauenhaus verbracht. Geld für ein Hotel besaß sie nicht, ihre Barschaft belief sich auf zweiundsechzig Cent, der Rest lag in Langen. Mutter Beimer war als Unterschlupf nicht infrage gekommen, weil das Haus bestimmt überwacht wurde. Und Elisabeth durfte sie nicht erneut in Gefahr bringen; schlimm genug, dass Alexanders Leute nun ihr Gesicht kannten. Sie hatte ihre Freundin auf dem Handy angerufen und sich vergewissert, dass sie und Jesús in Sicherheit waren. Vom Absturz erzählte sie nur wenig. Das Bild des Flugzeugs, das sich in die Erde bohrte und explodierte, saß zu tief. Sie konnte Jesús auch nicht mehr helfen. Nicht noch einen Menschen sterben sehen! Sie hatte sich nicht anstrengen müssen, im Frauenhaus die Verzweifelte zu geben, zumal sie bei der Landung im Kornfeld einige Prügel eingesteckt hatte. Anna sah in den Spiegel. Nach einer schlaflosen Nacht blickte ihr wieder mal ein Zombie entgegen. Sie fasste einen Entschluss: Verdünnisieren! Morgen hatte sie Geburtstag, und danach hörte der Spuk hoffentlich auf. Zumindest, was Alexander betraf. Engel hingegen würde seinen Kreuzzug gegen die Kinderschänderin wahrscheinlich fortsetzen. Sie verstand den Mann nicht. Hatte er sie von Anfang an mit seiner vermeintlich menschenfreundlichen Art täuschen wollen? Letztlich stellte er mit all seinen Gemeinheiten selbst den Staatsanwalt in den Schatten. Kam sich besonders clever vor mit seinem Lover-Getue und war doch dumm wie Schifferscheiße. Dumm genug jedenfalls, für Iwan den Pfadfinder nach Langen zu spielen. Anna ging ins Büro des Frauenhauses, verabschiedete sich und fuhr mit der S-Bahn zur Konstablerwache. Auf dem großen Platz trainierten ein paar Jungen auf ihren Skateboards. Sie sprach einen akneverseuchten Jungspund an und fragte, ob er ihr mal sein Handy für ein Telefonat leihen könne. Der Junge gab es ihr bereitwillig. Eigentlich hatte Anna geplant, damit zu türmen, doch als sie das nagelneue iPhone in der Hand hielt, vermutlich sein ganzer Stolz, brachte sie es nicht über sich. »Hat sich gerade erledigt«, murmelte sie und gab es ihm zurück. Ein paar Minuten später ergaunerte sie ein moralisch vertretbares Billighandy und rief in der Redaktion an. Blöderweise fiel ihr Triebels Durchwahl nicht ein, sodass sie erst Bembel am Apparat hatte. »Oh, Frau Heydt. Wie geht’s Ihne dann?« Was tat die Trulla denn so betroffen? »Ich will Triebel sprechen.« »Ei ja, natürlisch. Isch stell Se dorsch. Alles Gude, Frau Heydt, alles Gude!« »Triebel.« »Ich bin’s.« »Meine Güte, Frau Heydt. Das ist ja …« »Können Sie mir Geld leihen?« »Aber selbstverständlich, selbstverständlich. Wo befinden Sie sich denn?« »Wie viel könnten Sie mir leihen?« »Was Sie wollen. Sagen Sie einfach eine Zahl.« »Zweitausend. Es wird ein bisschen dauern, bis ich es zurückzahlen kann.« »Ja, ja, kein Problem. Wo sind Sie gerade? Ich bringe Ihnen das Geld. Am besten sofort.« »In Ordnung. Am Haupteingang vom Zoo, geht das?« »Natürlich. Sagen wir in einer Stunde?« »Ich dachte sofort.« »Ach so, ja. … Aber ich muss vorher … noch was erledigen.« »Also gut, in einer Stunde.« »Ich, ähm … Es tut mir wirklich sehr leid, dass mit Ihnen ein so böses Spiel getrieben wird. Wirklich.« »Danke für Ihre Hilfsbereitschaft, Herr Triebel.« »Nein, nein! Dann in einer Stunde.« Gesine Bembel hatte der Neugierde nicht widerstehen können, hinter der angelehnten Tür zu lauschen. Offenbar wollte ihr Chef der armen Frau Heydt Geld leihen. Seit die Nebenbuhlerin das Feld geräumt hatte, empfand Gesine Mitleid für sie. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, kam ihr in den Sinn. Genau das war ihr Chef. Ein Fels in der Brandung, die Frau Heydt seinen Andeutungen nach umtobte. Sie war noch in Gedanken, als sie registrierte, dass er wieder telefonierte. »… weil sie Geld braucht.« … »Zoo, Eingang Brehm-Platz.« … »In einer Stunde.« … »Halten Sie sich an die Vereinbarung: ihr wird kein Haar gekrümmt.« … »Was? Nein! Wieso denn?« … »Und was ist mit der versprochenen …?« … »Ich fordere … Hallo? Hallo?« Fassungslos hielt Gesine den Atem an. Zunächst hatte sie geglaubt, er informiere die Polizei, was zwar nicht nett, aber vielleicht seine Pflicht war. Doch wieso hätte er einem Polizisten sagen sollen, er möge Frau Heydt nichts antun? Das passte einfach nicht. Die Polizei hätte ihm auch nichts für die Meldung versprochen. Gesine entfernte sich auf leisen Sohlen von der Tür und setzte sich an ihren Schreibtisch. Sie brütete und brütete und kam doch immer wieder zu derselben bestürzenden Frage: Hatte ihr Chef die Leute informiert, die Frau Heydt verfolgten? Sie drückte den Knopf für die Anzeige der eingegangenen Anrufe, doch Frau Heydt hatte ihre Nummer leider unterdrückt. Ächzend quälte sie sich aus dem Schreibtischstuhl, klopfte an Triebels Tür und trat ein. »Herr Triebel?« Er saß da und starrte vor sich hin. »Herr Triebel!« »Äh, ja, was?« »Isch hätt e Problem midd em Kopierer. Könne Se mal komme?« »Muss das jetzt sein?« »Ja. Mir hawwe en Papierstau, un isch grieschs net uff die Reih.« Er mühte sich hoch und ging an ihr vorbei durchs Vorzimmer in Richtung Flur. »Isch komm sofort nach«, rief sie ihm hinterher. Sie wartete, bis er im Flur verschwand, und drückte den Wahlwiederholungsknopf auf seinem Telefonapparat. Es wurde eine redaktionsinterne Nummer angezeigt. Er hatte offenbar von seinem Handy aus angerufen. Sie nahm es und öffnete den Ordner der ausgehenden Anrufe. Leer. Warum hätte er die Liste löschen sollen, wenn er die Polizei angerufen hatte? »Frau Bembel?« Vor Schrecken hätte sie das Handy beinahe fallen gelassen. »J…a?« »Was machen Sie da?« »Isch such en Vertraach – de neue Pachtvertraach, Se wisse schonn.« Während sie sich zu ihm umwandte, ließ sie das Handy auf den Schreibtisch gleiten. »Oder ist er …?« Sie tat, als hätte sie eine Idee, drehte sich wieder dem Schreibtisch zu und schob das Handy an die alte Stelle. »Nee, der is werklisch net hier.« »Ich habe Ihnen den Vertrag gestern gegeben.« Plötzlich wurde er laut, was noch nie geschehen war. »Außerdem ist, verdammt und zugenäht, mit dem Kopierer alles in Ordnung! Was für Sie offenbar nicht gilt. Ich dulde dieses Chaos nicht, hören Sie, ICH DULDE ES NICHT!« Eigentlich hätte Gesine jetzt in Tränen über die Ungerechtigkeit ausbrechen müssen. Doch sie blieb vollkommen ruhig, geradezu kalt. Triebel beschimpfte sie bloß, weil er unter Druck stand. Ohne auf sein Geschrei einzugehen, verließ sie das Büro und zog die Tür hinter sich zu. Sie nahm ihr Handy und eine Visitenkarte aus der Handtasche und verzog sich in den Kopierraum. Dort wählte sie die Nummer des Polizisten, der während der Durchsuchung mit ihr gesprochen hatte. »Ogentaff.« »Oh, da hab isch misch verwählt.« »Wollten Sie mit Herrn Engel sprechen?« »Ja, genau.« »Ich vertrete ihn. Wie ist denn Ihr Name?« »Isch waas net.« »Sie kennen Ihren Namen nicht?« »Dumm Zeusch! Isch waas net, ob isch mit em Vertreter spreche möcht. Nee. Isch hab intieme Insiderinformatione, die isch nur dem Herrn Engel höchstpersönlisch mitteile kann. Könne Se mir net saache, wie isch ihn erreiche kann?« »Betreffen Ihre Informationen den Fall Heydt?« »Ja, genau.« »Wenn Sie mir Ihren Namen geben, werde ich ihn kontaktieren und er wird Sie zurückrufen.« »Ei guud. Es is awwer dringend. Es dreht sisch um Minude!« Als ihr Handy einige Minuten später klingelte, saß sie noch im Kopierraum. »Markus Engel. Sie möchten mich sprechen?« Die Stimme klang seltsam, fand Gesine. »Sind Se werklisch Herr Engel?« »Ja.« »Irschendwie klinge Se anners.« »Ich habe geweint, darum.« »Oh, des dudd mer leid! – Äh, könne Se trotzdem zuhöre? Also, isch bin die Chefsekretärin von ›Heureka‹, wir hawwe miteinander geredet, Se erinnern sisch?« »Ja.« »Es ist ebbes vorgefallen.« Sie berichtete von Triebels Telefonaten. Markus erinnerte sich an die schreckliche Frau. Sie hatte kein gutes Haar an Anna gelassen. Deshalb hätte er die Information mit Skepsis aufgenommen, wenn er nicht längst selbst Triebel verdächtigt hätte. Nur von ihm konnten die Motorradfahrer vom Treffen in Langen erfahren haben. Es war ein unverzeihlicher Fehler gewesen, ihn einzuweihen. Ein Fehler, in dessen Folge Tom gestorben war. Markus hatte nichts ahnend den Fernseher im Hotelzimmer eingeschaltet und erst erschrocken, dann mit zunehmendem Grauen den Bericht über die Flugzeugkollision verfolgt. Am Ende fiel der Name Thomas E., und er war auf den Boden gesunken. Warum hatte Tom nicht ihn in der Maschine gelassen? Schließlich traf ihn die ganze Schuld. Er bedankte sich bei der Chefsekretärin und legte auf. Nie und nimmer hätte er von ihr erwartet, sich für Anna ins Zeug zu legen. Eine Überraschung nach der anderen. Und sein berühmtes Bauchgefühl war taub wie ein Sack Nüsse. Er rief Bodo an, meldete das bevorstehende Kidnapping und verlangte von ihm, ein Spezialeinsatzkommando anzufordern. »SEK? Ich habe dich die ganze Zeit machen lassen, ohne viele Fragen zu stellen. Aber ich werde einen Teufel tun, auf vage Vermutungen hin eine Großveranstaltung anzuberaumen. Außerdem würde die Zeit gar nicht reichen.« »Besteht der Haftbefehl gegen Frau Heydt noch?« »Ja, wieso?« »Weil du dann was zu unternehmen hast.« »Jetzt hör mir mal zu!« »Nein, du hörst zu. Du bist verpflichtet, sie festzunehmen, und ich sage dir jetzt wie.« War schon im Ersten Weltkrieg die Zahl der getöteten Zivilisten explodiert, so fielen im Zweiten erstmals mehr Zivilisten als Soldaten. Und die Tiere des Frankfurter Zoos, Einwohner der östlichen Innenstadt, zählten zu ihnen. Obwohl sie weder antisemitische Neigungen offenbart noch Lebensraum im Osten beansprucht hatten, verloren sie im Bombenhagel, wie so viele Frankfurter, wenn nicht das Leben, dann die Behausung. Den Wiederaufbau ihres Heims verdanken sie vor allem Zoodirektor Bernhard Grzimek. Um an das nötige Geld zu gelangen, erweiterte er den Tier- zum Vergnügungspark mit Achterbahn und anderem Amüsement. Da die Tiere kein Geld besaßen, konnten sie dem Spektakel nur amüsiert zuschauen. Immerhin füllten sich ihre Bäuche wieder, was auch bei Tieren an erster Stelle steht. Im Laufe der Jahre wuchs der Zoo mit seinen Einnahmen, und sie wurden die Karussell-Konkurrenz wieder los. Heute leben hier rund 4.500 Tiere auf einem elf Hektar großen Anwesen, mit einem Vordereingang im Westen und einem Hintereingang im Osten. Während sich das Anwesen rückseitig an die bescheidene Umgebung anpasst, präsentiert es sich auf der Vorderseite mit seinem 1876 errichteten »Gesellschaftshaus«, wie es sich für den zweitältesten deutschen Tierpark geziemt. Vor ihm erstreckt sich der ovale Alfred-BrehmPlatz, der von einer Straße eingefasst wird, und in dessen Mitte eine kleine Grünanlage mit Gehwegen, Bänken und einem Brunnen sparsame Eleganz entfaltet. Auf einer dieser Bänke saß Anna und wartete auf Triebel. Die Geldübergabe sollte hier stattfinden, weil sie den Bonobos einen Besuch abstatten und sich von ihrer Freundin Ukela verabschieden wollte, bevor sie das Weite suchte. Fünf Minuten vor der verabredeten Zeit ging sie zum Zoo-Eingang hinüber, vor dem sich mindestens eine Schulklasse tummelte. Sie tauchte in die Menge ein, um den Platz zu beobachten, ohne selbst sofort gesehen zu werden. Nicht, dass sie Triebel misstraute, keine Spur. Es handelte sich um ein allgemeines Sicherheitsbedürfnis, das die vergangenen zwei Wochen, vor allem die Ereignisse in Langen, sie gelehrt hatten. Doch sie war längst in den Brennpunkt zweier Ferngläser geraten. Bodo Ogentaff beobachtete sie, hinter parkenden Pkws verborgen, von der gegenüberliegenden, westlichen Längsseite des Platzes aus. Markus’ Vorschlag gemäß rückten zur gleichen Zeit sieben in aller Eile aufgebotene Polizisten quer durch den Zoo vom Hinter- zum Vordereingang vor. Von dort aus sollten sie die Beschuldigte und gegebenenfalls auch die Kidnapper überrumpeln. Aber noch hatte der Trupp seine Position nicht erreicht. Auch Iwan hatte bereits Stellung bezogen. Er stand, in einem Winkel von 90° zu Ogentaff, am nördlichen Ende des Platzes. Die Entfernung zu Heydt betrug ungefähr fünfzig Meter. Triebel sollte sie hierhin locken, wo sie unauffälliger eingefangen und abtransportiert werden konnte. Auf der gegenüberliegenden, südlichen Seite des Platzes tauchte jetzt Markus auf. Er sah sowohl Anna als auch Triebel, der sich ihr langsamen Schrittes näherte, als fürchte er, sie zu verschrecken. Ogentaff hatte Markus das Versprechen abgenommen, sich nicht einzumischen, und so verharrte er hinter einem Stapel Getränkekisten, die jemand auf dem Bürgersteig abgestellt hatte. Den Jugendlichen, der sich in seinem Rücken mit hoher Geschwindigkeit auf einem Skateboard näherte, bemerkte er nicht. Um einem Passanten auszuweichen, verlagerte der Skater schlagartig das Gewicht und verlor die Balance. Er ruderte mit den Armen, traf Markus und stieß ihn in den Getränkekistenstapel. Während Markus mit dem klirrenden Stapel zu Boden ging, explodierten Schmerzen in seiner Brust. Schlimmer traf ihn der Lärm der berstenden Flaschen. Nie hatte er etwas Schrilleres gehört. Noch im Fallen fühlte er tausend Augen auf sich gerichtet. Auch Anna blickte aufgeschreckt hinüber. Sie war bereits im Begriff, sich wieder abzuwenden, da erkannte sie Engel. Der Spastiker lag blöde am Boden rum und winkte ihr zu. Wo kam der Dreckskerl her? Schon war er wieder auf den Beinen und begann zu schreien: »Hierhin, Anna, hierhin, bitte!« Für wie blöd hältst du mich? Sie rannte Triebel entgegen. Einen Wimpernschlag lang überlegte sie, ob er sie an den Bullen verraten hatte. Aber das würde er nicht tun, für kein Geld der Welt! Entweder hatte Engel auch ihn mit der Ich-will-nur-ihr-Bestes-Nummer eingeseift oder er war ihm heimlich gefolgt. Triebel sah sie auf sich zulaufen. Müde wirkte sie, müde wie nach Jahren der Schlaflosigkeit. Und geschunden. Ihr Gesicht durchzogen rote Striemen. »Da lang«, rief er und deutete nach Norden, »da steht mein Auto.« Ogentaff hatte verbissen zugesehen, wie Markus die Sache verdarb. Nervös wanderte sein Blick von den Flüchtenden zum Funkgerät. Endlich meldete sich Fechter, der Anführer des Polizeitrupps. Sie seien beim Kassenhäuschen angekommen. Bodo befahl, sofort die Verfolgung aufzunehmen. Der vierundvierzigjährige Polizeihauptmeister Michael Fechter zögerte nicht. »Waffen entsichern!«, befahl er. »Bernd, du treibst Kinder und Passanten aus der Schusslinie.« Dann stürmte er seinen Kollegen voran durch die Eingangspforte. Ihr martialischer Auftritt sprengte die Schulklasse auseinander und er hatte freie Sicht. Hinter sich hörte er Bernd schreien: »Weg, Kinder, weg!« Fechter zeigte in Richtung der flüchtenden Frau. »Da lang, Leute«, rief er und rannte weiter. Während er überlegte, was wohl auf ihn zukäme, immerhin war von der möglichen Beteiligung gefährlicher Krimineller die Rede, kam etwas kleines Schnelles auf ihn zu. Zu schnell und zu klein, um es auszumachen, obwohl es beinahe genau auf sein rechtes Auge zu raste. Er bemerkte es nicht einmal, als es oberhalb der Braue einschlug. Er bemerkte überhaupt nichts mehr. Entgeistert beobachtete Iwan das sich anbahnende Desaster. Alle Pannen der vergangenen Jahre zusammen kamen nicht an die Serie der letzten zwei Wochen heran. Aber die Bullenherde kam zu spät, Hassan hatte sich Heydt bereits geschnappt. Die anderen bestrichen das Areal mit Dauerfeuer, um ihn abzuschirmen. Wer sich vorwagte, wurde direkt ins Jenseits weitergereicht. Triebel, der sich zwischen den Fronten befand, hatte sich in eine Nische gerollt, wo er sich, die Hände schützend über dem Kopf, so klein wie möglich machte. Er betete, dass dieser Gewaltausbruch keine schrecklichen Folgen nach sich ziehen würde. Einerseits wünschte er Frau Heydt, dass sie davonkam, andererseits durfte es ihr auf keinen Fall gelingen. Als Iwan sah, dass Triebel toter Mann spielte, beschloss er, aus dem Spiel Ernst zu machen. Er zog seine Pistole und zielte. Da nahm er aus den Augenwinkeln wahr, wie Hassan einknickte und umfiel. Ein dummer Zufallstreffer der Bullen und ein weiterer Beweis der nicht enden wollenden Pechsträhne. Iwan machte sich sofort an Heydts Verfolgung. Sie rannte ungefähr vierzig Meter vor ihm die Thüringer Straße entlang. Sein lädierter Fuß steckte in einem Spezialschuh mit hohem Schaft und verstärkten Flanken, die ihm Halt gaben, sich aber nur mäßig zum Sprinten eigneten. Und Heydt war verflucht schnell unterwegs. Im Laufen wandte sich Anna um. Iwan holte kaum auf. Der Schock über Triebels Verrat hatte sie zunächst gelähmt und sie hatte sich ohne Gegenwehr packen lassen. Inzwischen war der Schock gewichen: Nie und nimmer würde sie sich Iwan ausliefern! An der Kreuzung zur Waldschmidtstraße überlegte sie, ob sie ins schräg gegenüberliegende Hotel flüchten sollte. Ihr Vorsprung reichte, um ungesehen darin zu verschwinden. Dort wäre sie auch den Blicken der Bullen entzogen, die sich mit anschwellendem Sirenenkonzert aus allen Himmelsrichtungen näherten. Doch statt nach links zum Hotel, bog sie nach rechts ab. Menschen konnten einen verraten, Tiere nicht. Es zog sie in den Zoo, wo sie sich zu Hause fühlte und wie in ihrer Westentasche auskannte. Bis zum Hintereingang in der Rhönstraße war es nicht mehr weit. Iwan fragte sich immer noch, was diesmal schiefgelaufen war. Triebel konnte die Polizei nicht informiert haben, der Schisser hätte sich selbst in den Arsch gefickt, wenn sie es ihm befohlen hätten. Er versuchte, seine Männer per Funk zu erreichen, um Unterstützung anzufordern, doch keiner reagierte. In der Ferne hörte er Geknatter und Explosionen. Wahrscheinlich hatte die Polizei bereits Verstärkung erhalten und seine Männer in die Defensive gedrängt, aus der sie sich jetzt unter Einsatz der Handgranaten befreiten. Dann musste er eben allein klarkommen. Zwar hatte er den Vorsprung nicht merklich verringert, dafür aber eine Idee, wohin die Fotze wollte. Jahrelang hatten ihre Schatten Berichte über sie verfasst, aus denen sich ein präzises Psychogramm ergab. Unter Heydts starrsinniger Schale steckte ein Balg, das sich aus Angst vor der bösen, bösen Menschenwelt in die Arme von Viechern flüchtete. Iwan hätte sonst was drauf gewettet, dass sie zu denen wollte. Dieses Mal würde er sie kriegen. Um ihm zu entwischen, musste sie ihn umbringen. Und an diesem Versuch hatten sich schon ganz andere Kaliber die Zähne ausgebissen. Anna flitzte durch den Zoo-Eingang, ohne sich um die Protestrufe der Frau im Kassenhäuschen zu scheren. Sie verschwand in einer dunklen Nische, von der aus sie den Eingang überblicken konnte. Mit etwas Glück würde sie gleich Iwan draußen vorbeilaufen sehen. Ihr Wunsch ging nach wenigen Sekunden in Erfüllung. Erleichtert atmete sie auf, wartete zur Sicherheit aber eine Weile, ob er vielleicht zurückkehrte. Iwan lief demonstrativ am Kassenhäuschen vorbei, denn Heydt lag bestimmt auf der Lauer. Eigentlich ein Unding, dass ihm jemand, der so leicht auszurechnen war, immer wieder durch die Lappen ging. Er kniete sich hinter ein Auto und funkte erneut seine Männer an. Kurz darauf wusste er über die Vorgänge auf dem Brehm-Platz Bescheid. Ein regelrechtes Gemetzel hatte stattgefunden und zwei weitere Männer das Leben gekostet. Ein Schwerverletzter wurde von einem Kameraden nach Eppstein gefahren. Damit hatte Iwan nur noch Ulrich vor Ort, dem die Flucht gelungen war. Er beorderte ihn samt Kleinbus zum Hintereingang. Sieben Minuten später traf er ein. »Hol zwei Spritzen aus dem Bus«, befahl er ihm. Ulrich brachte die Spritzen. Sie befanden sich in schwarzen Plastikbeuteln, die man zur Not durchstechen konnte. »Ich gehe rein, hab so eine Ahnung, wo sie sich aufhält. Sollte ich sie erwischen, gebe ich Bescheid und du kommst nach. Den Vorderausgang haben die Bullen gesperrt, richtig? Also muss sie hier durch, wenn sie raus will. Du verpasst ihr gegebenenfalls die Spritze. Lass sie nicht entwischen, sonst findet heute Abend eine spezielle Zeremonie für dich statt.« Der 2008 eröffnete Borgori-Wald für Menschenaffen ist eines der Glanzstücke des Frankfurter Zoos. Wie der Name erahnen lässt, wurde massig Natur ins Haus geholt – ein Miniaturdschungel aus Bäumen, Sträuchern, Felsen und Erde. Was die Besucher darüber hinaus schätzen, sind die riesigen Panoramascheiben, die freie Sicht auf Gorillas, OrangUtans und Bonobos gewähren. Vor einer solchen Scheibe saß Anna. Sie hatte fünf Minuten am Zoo-Eingang verharrt, ohne Iwan noch mal zu sehen. Dann war sie, am Pavianhügel vorbei, zum Borgori-Wald gegangen und hatte sich vor dem Gehege der Bonobos auf eine Bank gesetzt. Ukela, die in einer Nische der künstlichen Felsformation hockte und auf einer Apfelsinenschale kaute, sprang auf und schwang sich einen Baum hoch. Von dort aus sah sie Anna. Zur Begrüßung legten beide eine Hand auf die Scheibe. Nachdem sie sich gesetzt hatten, begann Anna lautlos zu erzählen. Zeitweise schloss sie dabei die Augen, dann wieder sah sie ihre Freundin traurig an, die aufmerksam zurückblickte. Anna war mit dieser stillen Art des Beisammenseins immer zufrieden gewesen, doch jetzt, nach der bedrückenden Erfahrung, auch von Triebel verraten und verkauft worden zu sein, war ihr danach, Ukela zu umarmen. Ihr über den gescheitelten schwarzen Haarschopf zu streichen. Ukela spürte es offenbar, denn sie legte wieder ihre Hand auf die Scheibe. Wehmütig stand Anna von der Bank auf und tat es ihr gleich. »Hab da mal ’ne Frage. Ich suche Affen, die so ähnlich wie Süßigkeiten heißen. Ich komm nicht auf den Namen.« »Süßigkeiten?« Der Tierpfleger kratzte sich am Kopf. »Sie meinen die Zuckerschnuten vom Stamme der Honigmäuler?« Den Rest seiner humoristischen Bemerkung verkniff er sich angesichts der finsteren Miene des Besuchers. »Mal im Ernst: Es gibt keine Affen, die nach was Süßem heißen.« »Doch. Es geht um was zum Lutschen, Drops oder so.« »Drops?« Das wurde ja immer besser. »Drops, Bonbons oder Lutscher, was weiß denn ich.« »Bonobos – meinen Sie die?« Genau das war das Wort, das Iwan in einem Bericht über Heydt gelesen hatte. »Wo find ich die?« »Gehören zur Familie der Menschenartigen. Halten Sie sich an der nächsten Abzweigung links, dann laufen Sie direkt drauf zu.« Vor dem Eingang zum Borgori-Wald zog Iwan seine Pistole aus dem Holster und verbarg sie in der Jackentasche. Die Anlage machte einen unübersichtlichen Eindruck, und wenn er Glück hatte und Heydt hier rumlungerte, konnte er sich vielleicht anschleichen und ihr die Spritze von hinten ins Fleisch rammen. Aber bei Heydt hatte Iwan noch nie Glück gehabt. Hätte sie wieder auf der Bank Platz genommen, sein Plan wäre aufgegangen. Doch sie kniete immer noch vor der Scheibe, von wo aus sie den Gehweg überblicken konnte. Auch das wäre kein Problem gewesen, hätte sie ihren Blick nicht unvermittelt von Ukela abgewandt. Eine instinktive Reaktion auf ein Gefühl der Gefahr, ähnlich unerklärlich wie das Gespräch zwischen Mensch und Affe. Als sie Iwan erblickte, begann sie zu schreien, laut und wild. Gehetzte Schreie einer Seele, die nicht zur Ruhe kommt. Auf diesen Ausbruch war Iwan nicht gefasst. Doch er reagierte sofort. Mit der Schnelligkeit einer vorpreschenden Schlange brachte er seine Waffe in Anschlag. »Schnauze, Miststück!«, zischte er. »Du kommst sofort hierher, sonst knall ich dich ab!« Er wollte sie hinter den Büschen haben, wo sie dem Blick der im Hintergrund gaffenden Besucher entzogen wäre. Doch Anna dachte nicht daran. So abrupt, wie der Anfall gekommen war, verflog er wieder. Iwan würde sie keineswegs abknallen, so viel war mal klar. Sie sprang auf. Iwan streckte die Pistole aus und zielte. Töten durfte er Heydt zwar nicht, aber eine Schussverletzung im Oberschenkel würde sie nicht gleich unbrauchbar machen. Er schoss, noch bevor Anna den ersten Schritt gemacht hatte. Aber sie winkelte das Bein bereits an und so verfehlte der Schuss sie um Haaresbreite. Er schlug in der Panoramaglasscheibe ein. Entsetzt drehte sich Anna zu Ukela um. Auch in deren Blick spiegelte sich Entsetzen, doch sie war nicht getroffen worden. Nicht minder entsetzt schauten die Zoobesucher. Zu Salzsäulen erstarrt, ließen sie die Frau und den bewaffneten Mann an sich vorbeilaufen. Was sie im Anschluss zu sehen bekamen, versetzte ihnen den nächsten Schock: Nach einem Moment vollkommener Stille setzte im Bonobo-Gehege lautes Geschrei ein. Ein Bonobo hüpfte mit wedelnden Armen auf und ab, drehte sich dabei im Kreis und stieß schrille Laute aus. Dann hämmerte der Affe mit den Fäusten gegen die Glasscheibe, durch die sich ein schmaler Riss vom Einschlussloch bis auf zwei Meter Höhe zog. Aus dem Hintergrund schleppten zwei Affen einen Baumstumpf herbei. Andere Affen gesellten sich ihnen zu. Gemeinsam packten sie den Stumpf und rammten ihn in die Scheibe. Die Besucher hielten staunend den Atem an. Volker Pohl, ein pensionierter Biologielehrer, glaubte seinen Augen nicht zu trauen. Der Gemeine Schimpanse war für Gewaltexzesse bekannt, nicht aber der Zwergschimpanse alias Bonobo. Im Gegenteil: Er galt als Hippie unter den Menschenaffen, als Verfechter von »Make love, not war«. Pohl schwankte zwischen Faszination und Angst. Die Glasscheibe würde sie nicht mehr lange voneinander trennen, und dann käme er vielleicht gar nicht mehr dazu, einen Aufsatz über dieses erstaunliche Phänomen zu veröffentlichen. Die Scheibe barst nach dem sechsten Schlag. Die Tiere ignorierten die auf sie herabregnenden Glassplitter und sprangen mit Ausnahme einiger weniger aus dem Gehege. Geschlossen rannten sie den Gehweg entlang – der Flüchtenden und ihrem Verfolger hinterher. Erst jetzt kam wieder Leben ins Publikum. Pohl beteiligte sich nicht an dem nutzlosen Gerede. Er musste unbedingt wissen, was die Bonobos vorhatten. Denn so sehr sich sein Lehrerwissen auch dagegen sträubte: Es schien, als habe die Aktion einem Zweck gedient. Rund fünf Minuten streifte Pohl umher, bis er die Bonobos fand – wie auch die Frau und den Mann. Die Frau saß auf einem Felsstein und hielt einen der Affen im Arm. Der Mann lag, von Bonobos umringt, auf dem Boden. Wie er zu Tode gekommen war, erschloss sich Pohl auf Anhieb; eines der Tiere hielt noch einen Pflasterstein in der Hand. Der Steinhagel hatte den Unterkiefer des Mannes in eine breiige, blutgetränkte Masse verwandelt. Auch er hielt seine Waffe noch in der Hand. Er war wohl überrascht worden. Die Frau erhob sich und drückte dem Affen einen Kuss auf die hellen Lippen. Dann gab sie Fersengeld. Pohl ließ sie unbehelligt ziehen, nach dreißig Jahren unter Schülern hatte er das Interesse an Menschen verloren. Lieber wollte er die unglaublichen Bonobos weiter beobachten. Das Areal vor dem Frankfurter Zoo glich einem Kriegsschauplatz. Das Pflaster war an vielen Stellen aufgerissen, in der Umzäunung des Zoos klaffte ein großes Loch. Eine schier unüberschaubare Armada aus Polizei- und Rettungsfahrzeugen verstopfte den Platz. Darüber kreiste ein Rettungshubschrauber, der nirgends Raum zur Landung fand. Für die Toten, fünf Polizisten und drei Kriminelle, hatte man bereits eine Sammelstelle auf der Grünanlage in der Platzmitte geschaffen. Ein Schüler mit Streifschuss und vier schwerverletzte Polizisten lagen in Rettungswagen, deren Fahrer darauf warteten, dass sich endlich eine Gasse bildete. Auch der Mann, für den der Hubschrauber vorgesehen war, lag vorläufig in einem Rettungswagen. Er hatte Splitter einer Handgranate abbekommen und befand sich in kritischem Zustand. Man hatte ihn wiederbeleben müssen. Es handelte sich um Horst Triebel. Markus ging zu dem Rettungswagen, in dem er lag. Im Inneren hantierte ein Weißkittel herum. »Kommen Sie mal kurz?« »Der Arzt beugte sich aus dem Wagen. »Was gibt’s?« »Wird er durchkommen?« »Wenn er seinen Urlaub gebucht hat, dann hoffentlich mit Reiserücktrittsversicherung.« »Das heißt?« »Im Moment ist er stabil, die Frage ist nur, wie schwer die inneren Verletzungen sind.« »Ist er bei Bewusstsein?« Der Arzt blickte sich zu seinem Patienten um und nickte. »Ich muss mit ihm reden.« »Können Sie vergessen, ein Mal knutschen reicht mir.« »Er kann uns wichtige Informationen geben. Wollen Sie den Hinterbliebenen der toten Polizisten später sagen, wir hätten nicht alles in unserer Macht Stehende getan, die Mörder zu fassen?« »Puh. Na gut, aber bringen Sie mir den Mann nicht um, würde mir die Statistik verhageln.« Markus stieg in den Rettungswagen. »Hallo, Horst, hörst du mich?« Triebel schlug die Augen auf und nickte. »Meine Dochder!« Triebel fehlte die Kraft, seine Zunge richtig zu bewegen. »Das Schwein had verlan…ngd … Sie is … Oh God!« »Ganz ruhig. Was ist mit deiner Tochter geschehen?« »En…führ!« Markus las pure Panik in Triebels Blick. »Entführt? Um dich zu erpressen?« Er nickte. »Weißt du, wer dahinter steckt?« »Nur Dele…« »Telefon.« »Oh Melanie!« Mit tränenverschleiertem Blick betete Triebel, sie möge nicht dafür büßen müssen, dass hier alles schiefgelaufen war. Er hatte den anonymen Anrufer bekniet, wenigstens eine Schachtel Lorazepam irgendwo hinterlegen zu dürfen, denn ohne die Notfallmedizin würde Melanie einen Epilepsieanfall vielleicht nicht überstehen. Doch er war auf taube Ohren gestoßen. »Was hat man von dir verlangt?« »Frau Hey… « »Sie zu verraten? Er deutete ein Nicken an und schaute fragend. »Sie ist verschwunden, keine Ahnung wohin. Hat man noch mehr von dir verlangt?« »Gei…« Triebel kämpfte verzweifelt um die Kontrolle über seine Zunge. »Geingonhag … ssudjien …« »Schon gut.« Markus sah ein, dass Triebel nicht mehr konnte. Er drückte dessen Hand. »Ich werde tun, was ich kann, um deine Tochter zu retten.« Er stieg aus dem Wagen. Geingonhag … ssudjien – was um alles in der Welt sollte das bedeuten? Grübelnd suchte er in dem Chaos nach Sinn. Geingonhag … ssudjien. Triebel hatte sich schwergetan, harte Konsonanten zu artikulieren. G weich, K hart. Gein – Kein! Und dann bedeutete Gonhag vielleicht Kontakt. Kein Kontakt! Aber ssudjien ? Handelte es sich um ein Wort? Ihm fiel kein passendes ein. Sushi, Südsee, Zuziehen – ergab alles keinen Sinn. Dann andersherum: Was konnte auf »kein Kontakt« folgen? Kein Kontakt – zu! Aber zu wem oder was? Djien … Tschien … Schien … … Es wollte nicht klick machen. Vielleicht ein Fremdwort? Etwas Englisches? Jeans? Nein. Etwas Englisches … etwas Englisches … englisch … England. Es spukte etwas in seinem Kopf herum, das nichts mit Triebels Gestammel zu tun hatte. Etwas, das seit Kurzem vergebens versuchte, in sein Bewusstsein aufzusteigen. Mit einem Mal wusste er es. Wusste ALLES! Nicht nur, dass mit Djien »Genamic« gemeint war: »Kein Kontakt zu Genamic Industries.« Er wusste auch, wer Triebel offenbar ausgehorcht hatte. Wer hinter der ganzen Sauerei steckte! Er legte das Puzzlestück ins Bild und es passte! DU GOTTVERDAMMTER HEUCHLER! Entschlossen bahnte er sich den Weg zu Bodo, der erregt auf einen Kollegen vom Morddezernat einredete. »Noch ist das mein Einsatz, aus, Punkt, Schluss! Entweder Sie ordnen sich ein oder Sie scheren sich zum Teufel!« Der Kollege zog ab und Bodo richtete seine Aufmerksamkeit auf Markus. »Wir zwei haben noch ein Hühnchen zu rupfen! Du musstest ja unbedingt hier auftauchen. Und nun sieh dir die Folgen an!« »Weder habe ich den Sturz verschuldet, noch hat er mit meiner Suspendierung zu tun.« »ACH ERZÄHL MIR DOCH NICHTS!« Überrascht sah Markus, wie Bodo die Tränen liefen. Er schluchzte. »Ich habe sie in den Tod geschickt.« Er sprach offenbar von den Kollegen. Markus fiel ein, was Anastasia über falsche Schuldgefühle gesagt hatte. »Wir sind nicht für die Verbrechen verantwortlich, die wir bekämpfen.« »Du hast mir geraten, ein SEK …« Der Rest ging in einem Tränenstrom unter. »Dafür wäre keine Zeit gewesen, hast du selbst festgestellt, und zwar zu Recht.« »Weißt du, wie viele Kollegen gestorben sind?« Bodos Funkgerät knarzte. »Polizeioberwachtmeister Zorn für Ogentaff.« »Was gibt’s?« »Wir haben eine weitere Leiche, im Zoo. Wir haben auch die Mörder, nur werden wir sie schlecht festnehmen können.« Nach dem Bericht des Kollegen schüttelte Bodo entgeistert den Kopf. »Affen, die einen Menschen steinigen, das ist doch der pure Wahnsinn.« »Hm.« »Offenbar haben die Affen eine Frau verteidigt, der Beschreibung nach deine Freundin. Sie soll mit einem der Affen geschmust haben.« Bodo lachte hysterisch. »Pass auf, dass der Affe sie dir nicht ausspannt!« »Konnte Frau Heydt fliehen?« »Ihren Verfolger haben ja die Affen eliminiert. Von da aus konnte sie fortlaufen …« »Etwas über die Identität des Toten bekannt?« »Keine Ausweispapiere. Vielleicht kommen wir über die Fingerabdrücke weiter.« »Wage ich zu bezweifeln. Hast du eine Beschreibung des Mannes?« »Mittelgroß, sehr muskulös, auf der Stirn …« »… hat er eine Narbe.« »Du weißt wieder mal schon Bescheid?« »Die Spurensicherung soll nach einer Zyankalikapsel suchen.« »Wie kommst du darauf?« Markus erklärte, was sich in Eppstein zugetragen hatte. »Verdammt, und wieso erfahre ich das erst jetzt?« »Verschieb deine Fragen auf später. Atme mal tief durch und komm wieder runter. Es gibt nämlich noch was zu tun.« Markus räusperte sich, um das zunehmende Kratzen im Hals loszuwerden. »Ich konnte gerade ein paar Worte mit Triebel wechseln. Man hat seine Tochter entführt, um ihn zu erpressen …« »… Heydt ans Messer zu liefern.« »Auch. Aber da ist noch etwas: Ich habe ihn am Freitag besucht. Bei unserem Gespräch ergab sich, dass er einen Kontakt zu einer Firma herstellen könnte, an deren Projekten Holland mitgearbeitet hat. Die Entführer haben es ihm verboten. Er weiß nicht, wer dahintersteckt, aber der Drahtzieher muss von unserem Gespräch gewusst und ihn gezielt ausgehorcht haben. Dabei hat er von dem Kontakt erfahren und durch die Entführung verhindert, dass Triebel mir hilft.« »Oder Triebel ist einfach eine Plaudertasche.« »Es gibt jemanden, dem ich erzählt habe, dass ich Triebel besuchen würde.« »Das ist bestenfalls ein Indiz.« »Dieser Jemand besitzt ein Paar Schuhe, wie es auf dem von Frau Heydt aufgenommenen Video zu sehen ist.« »Hattest du da nicht Holland in Verdacht?« »Jetzt weiß ich es besser.« »Wie viele Tausend Schuhkataloge hast du denn durchgeblättert, um dir da sicher zu sein? Das sind doch einfach nur elegante Lederschuhe.« »Das Beste kommt noch. Mir ist nämlich gerade ein Licht aufgegangen. In einem Telefonat habe ich zwei Männer mit pakistanischen Namen erwähnt, die irgendwie in den Fall verwickelt zu sein scheinen. Bevor ich erwähnen konnte, dass sie Engländer sind, wurde ich gestört. Trotzdem hat mein Gesprächspartner später von England gesprochen. Würdest du bei dem Namen Rohan Huqqabi an einen Briten denken?« Bodo antwortete nicht. »Wir brauchen Durchsuchungsbeschlüsse für Kanzlei und Wohnung von Dr. Lexied.« »Lexied, der Anwalt?« »Ja. Ich weiß nicht, welche Rolle er bei den Dreckskerlen spielt, aber er gehört zu ihnen, das ist sicher.« »Und wie ist er an Heydt geraten?« »Ich hab ihn auf den Fall aufmerksam gemacht.« »Hörst du nicht selbst, wie unlogisch das klingt? Die Polizei muss den Täter erst auf das Opfer hinweisen – das nimmt dir doch niemand ab. Jedenfalls kein Richter. Mal abgesehen von deinem verqueren Verständnis unserer Aufgaben. Wir sollen das Recht schützen, nicht die Täter.« »Lexied hat mich an dem Tag vorgeblich wegen eines anderen Falls angerufen. Passgenau nachdem Strecker die Verhaftung von Frau Heydt veranlasst hatte. Lexied muss gewusst haben, dass ich mit dem Staatsanwalt aneinandergeraten war …« »Unterstellst du jetzt auch noch, deine Kollegen arbeiten mit Kriminellen zusammen?« »… und er hat es darauf angelegt, dass ich den Fall Heydt zur Sprache bringe.« »Da traut man sich ja nicht mehr auszuatmen, so wackelig ist deine Theorie. Das ist keine Grundlage für einen Durchsuchungsbefehl.« »Ich habe dir als Zeuge drei präzise Indizien genannt. Die trägst du vor, dann kriegst du den Wisch. Die offenen Fragen klären wir später.« »Was interessiert dich der Fall überhaupt noch? Wie’s aussieht, ist deine Heydt doch aus dem Schneider.« »Das glaube ich erst, wenn ich’s sicher weiß. Vielleicht war ihr nicht nur der eine Verfolger auf den Fersen. Außerdem hab ich Triebel versprochen, mich um seine entführte Tochter zu kümmern. Und nun mach voran!« Zwei Stunden später standen sie ratlos in Lexieds Besprechungsraum. Sie hatten seine Wohnung und die Kanzlei im Schutz eines SEK auf den Kopf gestellt, ohne einen Hinweis zu finden. Auch Lexied tauchte nicht auf. Seiner Sekretärin zufolge hatte er sich einige Tage freigenommen. »Schöner Mist«, knurrte Bodo. »Hast du noch einen Trumpf im Ärmel?« »Mal sehen.« Markus rief den Kollegen vom KDD an. »Kriminaldauerdienst, Huber.« »Engel. Haben Sie was rausgekriegt?« »Teilweise. Jemand hat tatsächlich vor ein paar Monaten einen LKW bemerkt, der Medizinzeug in großen Paketen entladen hat. War zwar vor einer Arztpraxis, also nicht wirklich verdächtig, wenn man so will. Aber wir haben uns heute Vormittag trotzdem da umgesehen. Und sind da auch fündig geworden, beziehungsweise nicht fündig.« »Das heißt?« »Wir sind auf einen Lieferschein für einen Computertomo…dingsbums gestoßen, ein ziemlich dickes Ding, das da aber nicht war. Der Arzt, ein Dr. Bofinger, gibt dafür mehr oder weniger plausible Gründe an, aber wenn Sie mich fragen: Lüge. Wo das Zeug schließlich gelandet ist, weiß ich noch nicht.« »Und was ist mit den Grundbucheinträgen?« »Fehlanzeige, sag ich mal. Es gibt fünf Grundstücke in besonders abgelegener Lage, aber keins gehört einem von den Namen, die Sie mir gegeben haben.« »Was ist mit dem Namen Lexied, Dr. Alexander Lexied?« »Sagt mir spontan nichts.« Vielleicht hatte Lexied einen Strohmann vorgeschoben? Markus fiel die österreichische Eignergesellschaft ein, hinter der sich die Halter von Flugzeugen verbergen konnten. »Wissen Sie, ob sich eines der Grundstücke im Besitz einer juristischen Person befindet?« »Juristische Person?« »Ein Unternehmen.« »Ach so, das ja. Es gehört so einer Immobilien-Hol…dingsbums.« »Holding.« »So muss es wohl sein. Immobilien-Kontor Saalbach heißen die. Ich hab da auch angerufen und mit dem Geschäftsführer geredet, aber das Grundstück ist nicht vermietet. Die nutzen es als Lager oder Archiv oder so. Befindet sich übrigens schon seit Vorkriegszeiten im Besitz von denen, also für mich klingt das nicht nach Ganovenunterschlupf.« »Haben Sie den Stromverbrauch gecheckt?« »Hä?« »Hätte ein Ansatzpunkt sein können. Wenn es sich wirklich nur um ein Archiv handelt, dürfte der Verbrauch nicht allzu hoch sein.« »Also das klingt mir jetzt zu sehr nach CSI Miami oder so.« »Wo liegt es?« »Ich hol mal den Bebauungsplan. – Direkt am Wald. Von der B455 geht eine kleine Straße ab, führt zu einem Nachbarort. Nach ein paar Hundert Metern zweigt eine Sackgasse ab, die sich dann gabelt, links geht’s zu einem Gehöft, wo ein uralter, tauber Landwirt wohnt, rechts zu dem Grundstück.« »Geben Sie mir die Telefonnummer und die Daten der Immobilienfirma, sprich: Adresse des Grundstücks und der Holding, Gesellschafternamen, Name des Geschäftsführers. Die Nummer des zuständigen Grundbuchamts könnte ich auch brauchen.« »Sekündchen.« Nach dem Telefonat rief er beim Grundbuchamt an. Der Name Lexied tauchte in den Eintragungen nicht auf. »Wäre ja auch zu leicht gewesen«, kommentierte er den Misserfolg. »Ich muss noch woanders anrufen, Bodo. Du könntest draußen aufpassen, dass die Sekretärin nicht mithört.« »Auf die passen doch die SEK-Leute auf.« »Geh einfach, wenn du nicht reingezogen werden willst.« Nachdem Bodo den Raum verlassen hatte, holte Markus seinen Notizblock aus dem Sakko, in dem auch die Nummer der österreichischen Flugzeugeigner-Gesellschaft stand. »Safe-Hangar, Andrea Birnbaum.« »Immobilienkontor Saalbach, Dr. Masslow«, meldete sich Markus mit dem Namen des Geschäftsführers. Er machte sich keine Mühe, seine Stimme zu verstellen, denn er brachte ohnehin nur noch ein heiseres Krächzen heraus. »Ach, Herr Dr. Masslow, dass Sie einmal selbst anrufen! Guten Tag! Sie sind erkältet?« »Ja.« »Das tut mir leid. Brauchen Sie Ihre Maschine?« Treffer – er hatte richtig kombiniert! »Nein, nein. Ich mache gerade private Aufzeichnungen und erinnere mich nicht mehr an den genauen Termin meines letzten Flugs.« »Das war die Reise nach Spanien, nicht wahr? Reus. Wegen des Datums muss ich nachsehen.« BLATTWERK | D-EPPSTEIN/TAUNUS Lautlos schwebte das zweisitzige Segelflugzeug über die bewaldeten Höhen und Senken des Taunus. Es herrschten gute Sichtverhältnisse, sodass der Pilot das Zielobjekt am Waldrand frühzeitig erspähte. Der hinten sitzende SEK-Mann aktivierte die beiden am Flugzeugrumpf angebrachten Geräte, eine Foto- und eine Wärmebildkamera, und schoss in schneller Folge Bilder vom Areal. Nach Auswertung des Bildmaterials und einiger Satellitenaufnahmen forderte das SEK beim Bundesministerium des Innern Amtshilfe durch die GSG 9 in Sankt Augustin an. Die GSG 9, eine Spezialeinheit der deutschen Bundespolizei, wurde 1973 gegründet – nach dem Blutbad bei den Olympischen Spielen in München. Ihr Einsatzspektrum umfasst Terrorbekämpfung, Geiselbefreiung und Bombenentschärfung. Bei ihrer Feuertaufe 1977, der Stürmung der Lufthansa-Maschine »Landshut« in Mogadischu und der Befreiung der Geiseln aus den Händen palästinensischer Terroristen, stellte sie ihre Schlagkraft unter Beweis: Die Mannen unter Ulrich Wegner setzten die vier Terroristen außer Gefecht, ohne ein einziges Leben unter den Passagieren und Kameraden zu verlieren. Dies begründete einen geradezu überirdischen Heldenmythos, der aber auf harter Tagesarbeit und einem strengen Auswahlverfahren beruht. Jeder Polizeibeamte, der zu den Elitekämpfern will, muss durch eine neunmonatige Spezialausbildung. Nur einer von fünfzehn Absolventen besteht sie. Hagen Surgers, der seit zwölf Jahren der GSG 9 angehörte, war die Einsatzleitung übertragen worden. Wegen des enormen Platzbedarfs für Menschen und Ausrüstung hatte er das Lagezentrum in der Sporthalle der Freiherr-vom-Stein-Schule in Eppstein errichtet. Insgesamt würden fast zweihundert Kräfte an der Aktion teilnehmen. Die wichtigsten Einsatzkräfte und Delegierten hatten sich vor einer Projektionsleinwand versammelt: seine neun Männer, weitere sieben des hessischen SEK, vier Kriminalbeamte aus dem Frankfurter Polizeipräsidium, die Leiterin einer Einsatzhundertschaft, der Vertreter eines Ärzteteams, zwei Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr und eine Abgesandte des Technischen Hilfswerks. Surgers ging durch die Sitzreihen nach vorn. »Ich bin von der GSG 9 und leite die Operation. Mein Name ist Hagen – während des Einsatzes sind wir per Du. Bitte entschuldigt unsere Gesichtsmasken – wir müssen unsere Anonymität wahren. Die Kollegen, die ich gleich namentlich nenne, erheben sich bitte kurz. Okay. Die operative Einheit, die in das Zielobjekt eindringen wird, besteht aus Kollegen von GSG und SEK. Sie untersteht unmittelbar meinem Kommando. Zwei Kollegen von der Kripo werden sich uns als Berater hinzugesellen, Bodo und Markus. Für die weiträumige Sicherung des Areals um das Zielobjekt herum haben wir eine Einsatzhundertschaft an Bord, die – Moment –, die Manuela leitet. Koordinator der medizinischen Kräfte, der Feuerwehr und des THW ist Lars, ebenfalls vom SEK. Wie ihr seht, haben wir sechs Arbeitsbereiche mit Stellwänden abgetrennt, dahin zieht ihr euch mit euren jeweiligen Teams zur Einsatzvorbereitung zurück. Bitte absolute Konzentration, unsere Aktionen müssen wie Zahnräder ineinandergreifen. Den Innendienst leitet Paul vom SEK. Er fungiert als zentrale Anlaufstelle und koordiniert die Einsatzbereiche. Ihr wendet euch mit allen Fragen, Vorschlägen etc. ausschließlich an ihn oder seine Leute. Ich gebe euch jetzt … Halt, ich habe Oberstaatsanwalt Dr. Korn unterschlagen. Ist es in Ordnung, wenn wir Sie während der Operation duzen?« Korn zog ein süß-säuerliches Gesicht. »Ich heiße Isidor. Aber bitte nur heute, meine Damen und Herren.« »Isidor stellt sicher, dass wir uns im gesetzlichen Rahmen halten. Mit Zweifelsfragen wendet ihr euch an ihn. Ich gebe euch jetzt einen ersten Überblick. Zunächst zum Einsatzort. Die Präsentation, bitte. Das Zielobjekt liegt am Waldrand und ist durch diese Zufahrt von der B455 aus zu erreichen. Das nächste Bild. Hier seht ihr Luftaufnahmen der oberirdischen Bebauung. Das Areal ist komplett von einer drei Meter hohen Mauer umgeben. Nächstes Bild. Hier sieht man den einzigen regulären Zugang, ein fünf Meter breites und drei Meter hohes Tor. Nächstes Bild. Wir haben hier einige Luftaufnahmen zusammengefügt, um euch einen Eindruck vom gesamten Areal zu geben. Oberflächlich betrachtet haben wir es nur mit einem größeren Landhaus und einem davor platzierten Nutzgebäude zu tun. Doch es gibt eine unterirdische Ebene, die weitaus größer ist als die oberirdische Bebauung, wie das SEK per Thermografie festgestellt hat. Nächstes Bild. Hier haben wir die mutmaßlichen Umrisse der unterirdischen Ebene eingezeichnet. Sie erstreckt sich über eine Fläche von rund dreihundert Quadratmetern. Da das Umfeld des Grundstücks durch Bewegungsmelder und Infrarotgeräte überwacht wird, konnten wir nicht nahe an das Objekt ran. Doch wir haben einige aufschlussreiche Luftbilder, die uns einen Eindruck von der sicherheitstechnischen Infrastruktur geben. Das war’s für den Moment. Alle Details, die für eure jeweiligen Aufgaben wichtig sind, bekommt ihr in euren Arbeitsgruppen. Nach aktuellem Stand beginnt die Aktion um drei Uhr dreißig. Uhrenvergleich: Es ist jetzt genau einundzwanzig Uhr siebzehn.« Der Salvator befand sich im OP, dem Zentrum des unterirdischen medizinischen Trakts, der auch ein Labor und einen Radiologie-Sektor umfasste. In der Mitte des weiß gekachelten, gut vierzig Quadratmeter großen Raums stand ein OP-Tisch. Um ihn herum schwebten – an Deckenstativen mit Schwenkarmen angebracht – zwei Operationsleuchten, vier Monitore, ein Röntgenfilmbetrachter und zwei mehrstöckige Trägersysteme mit Diagnose- und Überwachungsgeräten. Zu Letzteren gehörten einige spezielle Apparaturen, die es nicht zu kaufen gab. Außer den drei OP-Helfern – zuletzt Lucy, S und Khaled – hatte niemand den medizinischen Trakt je betreten, nicht einmal Henry und Iwan. Dem Plan nach sollte Khaled erst in sieben Jahren die Nachfolge von S antreten, wenn die arabische Phase beginnen und das Hauptquartier nach Kairo wechseln würde. Nun musste der neue Ziehsohn frühzeitig das ihm gewährte Vertrauen rechtfertigen. Letztlich waren alle seine Männer Ziehsöhne, wenngleich mit gewissen Abstufungen. Sie alle hatte er zunächst den Betreibern der unterschiedlichsten Missbrauchsanstalten zum Anbraten auf den Grill gelegt. Nachdem sie ausreichend in der Hölle geschmort hatten, »rettete« er sie. Dann wurden sie auf ihn abgerichtet. Die meisten ließ er in seinen Lagern zu Kombattanten und Koordinatoren, Aufklärern und Schatten ausbilden. Doch das Spektrum der erlernten Berufe reichte weit: Soziologen, Juristen und Kaufleute befanden sich ebenso in seinen Reihen wie Ingenieure und Informatiker, Mediziner und Pädagogen. Er bedurfte ihrer Qualifikationen nur selten, aber in dieser lebensfeindlichen Umgebung musste man für alle Eventualitäten gerüstet sein. Die intelligenten Exemplare wurden nach der militärischen Grundausbildung selektiert und in einem Leistungszentrum untergebracht, um sie gemäß ihren Anlagen zu trainieren und ihnen den nötigen Korpsgeist auf vergleichsweise subtile Art einzupflanzen. Anschließend durften sie vorübergehend von der Leine, um öffentliche Bildungsanstalten zu besuchen. Diese angehenden Funktionäre lebten zwischenzeitlich ein relativ freies Leben »im Feindesland«, aber bis dahin hatte er ihrem Willen längst Scheuklappen aufgesetzt. Sie wussten, wem sie ihr Leben verdankten. Darüber hinaus wussten sie, was ihnen oder ihrem Bußbürgen blühte, wenn sie von der Fahne gingen. Jeder hatte in jungen Jahren als Beobachter der speziellen Zeremonie beigewohnt, die Verrätern und Versagern drohte. Mancher hatte, um seine Fügsamkeit unter Beweis zu stellen, das Blut von Kameraden an den Fingern. Blind trauen würde er aber immer nur den Gewährsmännern, die nie aus seinem Dunstkreis gekommen waren. Die nach jahrelangem Dressurakt keine andere Wahl hatten, als sich gehorsam einzureihen. Die ihm bis in den Tod ergeben waren und weder Ausweise noch Urkunden besaßen, weil sie offiziell gar nicht existierten. Sie alle taten maximal bis zu ihrem vierzigsten Geburtstag Dienst. Dann wurden sie feierlich verabschiedet und in ein abgelegenes, hermetisch verriegeltes Reservat an der libyschen Küste umgesiedelt, wo ihnen jeder Wunsch von den Augen abgelesen wurde. Drei Jahre lang. Lucy betrat den OP. Vor sich hielt sie die Petrischale mit einer der Zellkulturen, die in den vergangenen sechs Monaten in einem Brutschrank herangereift waren. Der Zeitraum, in dem sie nach der Ausreifung zu nutzen waren, umfasste nur wenige Tage. Der Salvator setzte sie stets so an, dass sie am 40. Geburtstag des jeweiligen Kandidaten zur Verfügung standen. Mit der Routine langjähriger Verrichtung nahm Lucy einen Mikrospatel und bestäubte die Kultur mit einem weißen Pulver. Er hatte die drogensüchtige Kindernutte in den Straßen von Varna an der bulgarischen Schwarzmeerküste aufgelesen und zur OP- und Anästhesieschwester ausbilden lassen. Seit fast dreißig Jahren begleitete sie ihn auf seinen Zügen durch die Welt, die er in vier Zonen mit nahezu identisch gestalteten und voneinander abgeschotteten Zentralen aufgeteilt hatte. Neben dem deutschen Hauptquartier gab es eines nahe Kairo, eines bei Bogotá und eines in der thailändischen Provinz Phuket. Lucy war also, wie er selbst, eine Weltenbummlerin. Die einzige Frau seiner Gefolgschaft und die Einzige, der das libysche Finale erspart bleiben würde. Er hoffte, dass sie trotz ihrer etwas schwächlichen Konstitution noch einige Jahre durchhielt. Der jeweilige Ziehsohn und der Ziehsohnaspirant halfen nur beim ersten Teil der OP mit, der Kandiatenentleerung. Den zweiten Teil führte Lucy ganz allein durch. Sein Leben lag in jeder Hinsicht ungeschützt in ihrer Hand. Sie allein wusste, zu welchem Zweck die Kandidaten wirklich geerntet wurden. Sie allein kannte – fast – alle Hintergründe. Und sie durfte niemandem je ein Sterbenswort davon berichten. Früher hatte er den zweiten Teil der OP an ein Zweierteam delegiert und die beiden danach eliminiert. Doch vom enormen Schulungsaufwand abgesehen, barg dieses Verfahren das Risiko tödlicher Fehler. Der Strategiewechsel hatte sich bewährt: Seit vielen Jahren schon vollzog Lucy die SimultanFlutung mit großer Souveränität. Er hatte viel Mühe darauf verwandt, sie in alle Feinheiten der Technik einzuweihen. Sie hatte sie von ihm erlernt wie ein Geselle von einem Meister. Ebenso wie er sie erlernt hatte. Khaled erschien mit zwei Instrumentenwagen, die er vor die halbhohe Schrankzeile schob. Er würde sie nun bestücken: mit OP-Besteck, Nierenschalen, Pipetten, Spritzen und einigen speziellen Utensilien, darunter einen Knochenmarkschaber mit ultraharter Klinge, gegen die sich Diamanten wie Wattebäusche ausnahmen. Er beobachtete ihn aus den Augenwinkeln. Der junge Mann zeigte keine Nervosität. Seit sieben Jahren wirkte er im OP mit, doch nur als Handreicher, das letzte Glied in der Kette der Verrichtungen. Nun würde ein anderer diesen Platz einnehmen und Khaled auf einen Schlag deutlich mehr Verantwortung tragen. Noch heute Nacht. Nach Iwans Tod wollte er nicht länger warten, das Pflaster war entschieden zu heiß geworden. Auch sein Blutdruck, der sukzessiv sank und sich im Auskühlen des Körpers bemerkbar machte, mahnte ihn zur Eile. Kandidatin IX-α musste in wenigen Stunden auf den OP-Tisch, wenn nicht freiwillig, dann eben mit Gewalt, selbst um den Preis, den er dafür später würde zahlen müssen. Morgen früh, nach der Behandlung, würde er sich wieder besser fühlen – und wärmer. Und gegen Mittag würde sich Dr. Alexander Lexied aus Frankfurt nach zwölfjähriger Anwaltstätigkeit in Luft aufgelöst haben. Wenige Stunden später würde der Neuseeländer James Brickler in Alexandria auftauchen und bald darauf die Leitung einer Import-Export-Firma übernehmen, an der auch Staatspräsident Husni Mubarak Anteile hielt. Damit wäre die europäische Phase weit vor der Zeit zu Ende. Kein Problem, er konnte die Weichen von einem Tag zum anderen umstellen. Kurz nach Hagens Präsentation klingelte Markus’ Handy. Er gab es Bodo, denn seine Stimmbänder hatten mangels Schonung und Kamillentee endgültig den Dienst eingestellt. »Apparat Engel.« »Wo ist Markus?« Elisabeth war drauf und dran aufzulegen. »Er steht neben mir. Aber er bringt keinen Ton mehr raus, die Stimme streikt. Mit wem spreche ich denn?« »Und mit wem spreche ich?« »Kriminaloberkommissar Ogentaff, bin ein Kollege von Markus.« »Können Sie das beweisen?« »Erst mal will ich wissen, wer Sie sind.« »Fragen Sie Markus. Sagen Sie ihm, mein Name beginnt mit E und ich habe J bei mir.« »Moment, er wird mir die Antwort gegebenenfalls aufschreiben müssen.« »Zehn Sekunden, dann lege ich auf.« »Sie heißen Elisabeth, und bei Ihnen ist Jesús Mirandor. Wieso machen Sie es so kompliziert?« »Markus könnte sich in der Hand der Verbrecher befinden, und denen will ich bestimmt nichts erzählen. Gibt es Neuigkeiten von Anna?« »Wir wissen nichts Genaues. Heute hat eine Schießerei beim Zoo stattgefunden, Sie haben bestimmt davon gehört. Frau Heydt ist dort eine Falle gestellt worden. Zunächst sah es aus, als sei sie entkommen. Mittlerweile liegt uns aber die Aussage eines Zeugen vor, dass ein Mann eine Frau durch den Zoo geschleppt habe. Es sind also Zweifel angebracht, ob sie tatsächlich fliehen konnte.« »Oh Gott, nicht schon wieder! Sie wissen, dass morgen ihr Geburtstag ist? Und was das bedeutet?« »Ja, wir sind im Bilde. Was wollen Sie denn von Markus?« »Ihm sagen, dass wir in Sicherheit sind. Und dann wollte ich ihm noch eine Information geben.« »Moment, ich schalte den Lautsprecher an. Okay, er kann jetzt mithören.« »Hallo Markus. Der Mann, nach dem ihr sucht, heißt Alexander Lexied, Annas Anwalt. Noch was. Weil Jesús seit ein paar Tagen zunehmende Déjá-vus hat, habe ich ihn heute zu einem Hypnotiseur gebracht, ein Mediziner, kein Hokuspokus. Was dabei im Einzelnen herauskam, wäre jetzt zu umständlich zu erklären. Vieles kann Jesús auch noch nicht deuten. Aber er meint, sich an einen Keller zu erinnern, vielleicht eine unterirdische Anlage, wo etwas mit ihm gemacht wurde. Der Zugang ist getarnt, so was wie eine Schleuse. Er kriegt das Bild noch nicht richtig zu fassen, glaubt aber, dass er sie erkennt, wenn er davor steht. Wenn ihr also auf so eine Anlage trefft, kann er euch vielleicht helfen. Solltet ihr wissen, dachten wir uns.« »Bleiben Sie kurz dran, ich möchte was mit Markus besprechen.« Bodo legte das Handy beiseite. »Was hältst du von der Idee, die beiden hierher zu holen? Womöglich fallen Mirandor noch mehr Sachen ein, wenn er vor Ort ist.« Markus nickte. »Hören Sie, Elisabeth? Wir befinden uns im Taunus und hätten Sie und Mirandor gern hier. Wir könnten Sie von einer Polizeistreife abholen lassen.« »Sekunde. … Ja, wir sind einverstanden, aber ich komme lieber mit dem eigenen Auto.« Lange Zeit war es in der Sporthalle zugegangen wie auf Ameisenstraßen. Leute kamen und verschwanden, wanderten von einer Arbeitsgruppe zur nächsten, marschierten in Gespräche vertieft auf und ab. Jetzt, um Viertel vor drei, herrschte Ruhe, die berüchtigte Ruhe vor dem Sturm. Jemand hatte dankenswerterweise die grelle Beleuchtung gedimmt. Noch fünfundvierzig Minuten. Markus saß mit geschlossenen Augen abseits von Bodo, Elisabeth und Jesús auf einem Plastikstuhl. Anfangs hatte er sich zumindest als Zuhörer an ihren Versuchen beteiligt, mit Gerede die Zeit totzuschlagen. Sprechen konnte er nach wie vor nicht, seine Stimmbänder schienen in Fetzen zu hängen. Schließlich konnte er auch nicht mehr zuhören. Zu erschöpft. Zu unruhig. Nicht zu wissen, ob Anna sich im Anwesen, also in Gefahr befand, machte ihn schier verrückt. Hinzu kam die Verzweiflung über Toms Tod. Und das Schuldbewusstsein. Seit er wusste, dass Tom sich für ihn geopfert hatte, träumte er nicht mehr von einem gemeinsamen Leben mit Anna. Er liebte sie, das ja, aber für Idyllen war kein Raum mehr. Nur ein Schwein würde sein Glück auf dem Unglück des Bruders aufbauen. Hätte Tom doch ihn sterben lassen! Das Grübeln brachte ihn nicht weiter. Er versuchte sich abzulenken, indem er im Kopf die geplante Aktion durchging. GSG 9 und SEK hatten sich großes Kino ausgedacht, mit simuliertem Großbrand im Wald und getürkter Geräuschkulisse einschließlich Explosionen und Feuersirene; ein Katastrophenszenario, das dem Anrücken einer kleinen Armada einen Deckmantel umlegen sollte. Ob es funktionieren würde? Seinen Wunsch, vor Ort mit dabei zu sein, hatte Hagen abgelehnt. Erst wenn das Haus unter Kontrolle war, durfte er mit Mirandor nachkommen, vorausgesetzt, ihre Hilfe wurde benötigt. Markus erinnerte sich an einen Film über das Schicksal von Frauen, deren Männer in den Krieg zogen, und begriff jetzt die Pein des Zurückgebliebenen. »Markus?« Er öffnete die Augen. Elisabeth stand vor ihm. »Dir geht es nicht gut, oder?« Sein Versuch, ihre Frage mit einem Lächeln zu quittieren, misslang. »Darf ich mich zu dir setzen? Du grübelst, ja? Ist es wegen Anna? Oder auch wegen …?« Er meinte zu wissen, dass sie von Tom sprach, und nickte. »Ich denke, es war Schicksal. Da ist man letztlich immer machtlos.« Sie eierte so rum, weil sie wissen wollte, ob er Schuldgefühle hegte – ohne sie ihm unterzuschieben. »Kannst du es dabei belassen?« Sein grimmiges Kopfschütteln erinnerte sie an Anna. Die beiden hatten vielleicht mehr gemein als auf den ersten Blick ersichtlich. »Ich muss dir was sagen. Kommt von Anna, die es von deinem Bruder hat. Sie musste ihm versprechen, es dir nur zu erzählen, wenn du dich mit Schuldgefühlen quälst. Und meinem Bauchgefühl nach bis du genau der Typ dafür. Da kürzen wir es lieber ab. Allerdings wird dir die Geschichte nicht gefallen, – was dich heilen soll, ist ziemlich bittere Medizin.« Markus zog Notizblock und Stift aus der Hemdtasche und schrieb: Warum hat Anna es dir erzählt? »Weil sie sich um ihren Schatz Sorgen macht, was denn sonst?« Elisabeth lachte spitzbübisch. »Was sie natürlich abstreiten würde. Sie hat’s in den Hörer gerotzt, als stündest du am anderen Ende der Leitung. Sich mag sie was vormachen können, mir nicht. Und sie wird auch noch dahinter kommen, es müssen sich nur erst die Gefühlswogen glätten. Kommt schon noch.« Was hat Tom gesagt? »Ich bin nicht gern der Überbringer schlechter Nachrichten, aber das ist jetzt wohl nicht zu ändern.« Elisabeth sah zu Boden, um ihm nicht zu nahezutreten, und berichtete von Toms Geständnis. »Seine letzten Worte an dich lauten: ›Es tut mir unendlich leid. Und es ist nur gerecht, dass ich in der Maschine bleibe. Ich liebe dich. Werde bitte glücklich!‹ – Das war’s.« Aus den Augenwinkeln sah sie Tränen auf Markus’ Gesicht. Sie drückte seine Hand und stand auf. Hagen hatte mit seinem Team die Sammelstelle in der Waldlichtung erreicht. Durch das Nachtsichtgerät schätzte er die Distanz zum Anwesen, rund zweihundert Meter. Er vergewisserte sich, dass alle Einsatzkräfte ihre Positionen eingenommen hatten. Dann gab er das Startkommando der Operation Melanie. Die mit Hilfe des THW errichtete Konzertanlage wurde aufgedreht und die Tonkonserve gestartet. Aus der Tiefe des Waldes drang das Donnern von Explosionen, ein Krachen, Grollen und Tosen, als hätte die endzeitliche Entscheidungsschlacht begonnen. Dunkler Rauch stieg auf, Blitze stachen in den Himmel, Flammen schienen aufzusteigen – ein kongeniales Zusammenwirken von THW und Feuerwerkern. Kurz darauf schreckte die Feuersirene die Eppsteiner aus dem Schlaf. Nach zehn Minuten forderte Hagen Polizei und Feuerwehr auf, zum Anwesen vorzurücken. Während die Einsatzfahrzeuge ihre Martinshörner einschalteten und sich auf das Anwesen zubewegten, schickte Hagen vier seiner Leute zur rückwärtigen Mauer, um die Ausrüstung zwischenzulagern, darunter Steighilfen, Panzerfäuste und Blendgranaten, eine Ramme und eine Wasserkammer, die mittels extremen Wasserdrucks selbst Metalltüren zum Bersten brachte. »Klingeln!«, gab Hagen den nächsten Befehl. Eine SEK-Frau in der Uniform einer Streifenpolizistin stieg aus ihrem Einsatzfahrzeug, ging zur Sprechanlage neben dem Eingangstor und drückte die Klingel. Als sich eine männliche Stimme meldete, sagte sie ihren Spruch auf: Es sei ein Großbrand ausgebrochen, wahrscheinlich durch Sprengstoff aus dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Sie rate dringend, das Haus zu räumen. Jetzt wussten die drinnen Bescheid, warum sich das Großaufgebot vor ihrem Haus sammelte. Bei allem Misstrauen würden sie nicht gleich wissen, was sie von der Sache halten sollten. Diesen Moment der Verwirrung galt es zu nutzen, um unbemerkt die Außenmauer zu überwinden. Hagen gab das Zeichen, den Strom zu kappen. Als er den ersten Hubschrauber hörte, brach er mit seinen Leuten auf. Das Wandtelefon im OP klingelte. Unwillig nahm der Salvator den Hörer ab. »Ich will nicht gestört werden, habe ich das nicht unmissverständlich gesagt?« Henry, der sonst keine Furcht kannte, duckte sich unwillkürlich. »Ja, Salvator.« »Also, was gibt es?« »Hier oben passieren merkwürdige Dinge.« Henry berichtete von der Durchsage der Polizistin. »Angeblich wurde uns aus Sicherheitsgründen der Strom abgestellt. Die Notstromgeneratoren sind sofort angesprungen, insofern unbedenklich. Aber was steckt dahinter?« Henry fühlte sich überfordert. Um diese Art von Gefahrenlagen hatte sich Iwan gekümmert und dessen Ersatzmann war noch nicht eingetroffen. »Die Hunde?« »Schlagen wie wild an, aber das ist ja kein Wunder bei dem Theater da draußen.« »Was schlägst du vor?« »Ich habe drei Mann durch den Fluchttunnel nach draußen geschickt, um die Lage zu sondieren. Die Explosionen finden im Westen statt, wir müssten also, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, nach Osten freie Bahn haben.« »Ich erwarte einen konkreten Vorschlag. Enttäusche mich nicht, Henry.« »Einen Moment bitte, Salvator, ich erhalte eine Meldung.« Während Henry mit jemandem sprach, sah der Salvator zu Khaled rüber, der eine Spritze aufzog. Plötzlich bezweifelte er, dass die OP hier und heute stattfinden würde. »Salvator? Die Sache ist getürkt. Unsere Leute haben zwei bis an die Zähne bewaffnete Einsatzkräfte ausgeschaltet, die sich in der Nähe des Notausgangs befunden haben.« »Sofort meine Flucht vorbereiten! Der Notausgang ist zu sichern, bis ich draußen bin. Gib mir Iwans besten Mann mit.« »Matteo?« »Jemanden mit Ortskenntnis.« »Dann Rudi.« »Er soll einen Seitenschneider oder eine Drahtschere mitnehmen, etwas Robustes jedenfalls. Lucy und Khaled begleiten mich. Ruf Leo an, er soll seinen Wagen bereitstellen. Ich nehme zunächst den Krankenwagen und steige am Standort sieben in den Mercedes um. Nun das Wichtigste: Fünf Minuten, nachdem ich draußen bin, greift Notfallplan Endzeit. Bestätige!« Ohne zu zögern, bestätigte Henry den Befehl. Er hatte soeben sein Todesurteil erhalten, er und alle anderen, die zurückblieben. »Vorher informierst du Ludger über die Lage. Er übernimmt bis auf Weiteres deinen Posten.« »Ja, Salvator.« »Wo befindet sich das Mädchen?« »Im Lager in Bad Vilbel.« »Jemand setzt sie vor der nächsten Polizeistation ab. Vielleicht ist sie der Grund für den Angriff. Also lassen wir sie auf der Stelle frei.« »Jawohl, Salvator. In Ehre und Ewigkeit!« In der Sporthalle hatte lediglich die durchdringende Feuersirene angezeigt, dass die Aktion anlief. Doch plötzlich schwang der Boden unter der Wucht einer Detonation. Markus, der die Halle unruhig auf und ab gelaufen war, hielt genauso inne wie alle anderen. Das war eine echte Explosion gewesen – und zwar eine gigantische, sonst hätte man sie nicht bis hierhin gespürt. Markus packte Jesús am Arm und zog ihn mit sich nach draußen. Bodo brüllte hinter ihnen her, da zu bleiben, doch Markus überhörte ihn. Stumm war er bereits, jetzt eben auch taub. Bald darauf befanden sie sich vor dem Anwesen, genauer gesagt den Ruinen. Verbrannte Erde zurückzulassen, das passte haargenau zu einem Mann, der seine Leute Zyankalikapseln schlucken ließ, bevor sie der Polizei in die Hände fielen. Selbst von Ruinen zu sprechen, erwies sich auf den zweiten Blick als übertrieben. Sie sahen ein tiefes Trümmerfeld vor sich, eine zu allen Seiten hin offene Geröllhalde. Lediglich ein verrußter schwarzer Würfel erhob sich aus ihr – wie die Kaaba aus der Heiligen Moschee in Mekka. Von Pilgern allerdings keine Spur. Wer von den Einsatzkräften das Höllenfeuer überlebt hatte, hielt respektvoll Abstand. Immerhin hatte jemand mit einem letzten Funken von Geistesgegenwart das Flutlicht eingeschaltet. Markus und Jesús warfen sich einen Blick zu: Ja, sie würden das Gelände trotz des Risikos weiterer Detonationen betreten, um nach Anna zu suchen. Wenn sie sich auf dem Grundstück befunden hatte, war sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tot. Aber sie mussten es wissen. Sie besorgten sich eine Taschenlampe und gingen los. Schon nach wenigen Metern trafen sie auf einen Toten, genauer gesagt den Torso eines der Männer vom SEK. In seiner kaum beschädigten Kampfmontur wirkte er geradezu unversehrt, nur fehlte die untere Körperhälfte. Vor dem Schuttberg angekommen, der einmal das Haus gewesen war, holte Markus tief Luft. Sie waren an einigen bizarren Leichenteilen vorbeigekommen, und wenn Anna sich im Haus aufgehalten hatte, würde ihm vielleicht ihr Kopf entgegenrollen, haltlos wie jener in der Rechtsmedizin. Er deutete zu dem schwarzen Würfel, einem Betonquader von knapp drei Meter Kantenlänge, der aus einem Trichter herausragte. Offenbar hatte er zum Kellertrakt gehört. War er entgegen der Planung des Sprengmeisters stehengeblieben? Oder handelte es sich um einen Panikraum, einen gepanzerten Rückzugsort, in dem Lexied sich verborgen hielt? Eher unwahrscheinlich. Wer so einen Weltenbrand entfachte, war entweder darin verbrannt oder vorher diskret verschwunden. Erst als sie den Würfel umrundet hatten, sahen sie den Zugang: eine schwere Tresortür, die von der Explosion halb aus den Angeln gerissen worden war. Markus leuchtete durch den Türspalt ins Innere. Bläulich schimmernde Stahlwände. Ein Tisch, zwei Stühle, ein Regal, sonst nichts. Der Raum wirkte wie leergefegt. Als Jesús den Kopf durch den Spalt steckte, begann er zu zitterten. »Ich will da rein.« Fragend zog Markus eine Augenbraue hoch. »Keine Ahnung. Aber ich muss da rein.« Nach einigen Minuten hatten sie die Tür weit genug aufgebracht, um sich hindurchzuquetschen. Unsicher, ob der Tresor gegen Funkwellen abgeschirmt war, legte Markus sein Handy vor der Tür ab. Jesús verstand nicht, was ihn hierhin zog, einen nichtssagenderen Raum konnte man sich kaum vorstellen. Und doch sagte er ihm etwas. Aber was? Er schwenkte die Taschenlampe. Nein, wirklich nichts Bemerkenswertes. Offenbar spielten seine Gedanken verrückt, weil er sich so sehnlich Klarheit wünschte. Er wandte sich zu Markus um. »Falscher Alarm, tut mir leid. Suchen wir weiter nach Anna, vielleicht ist ja ein Wunder geschehen.« Seiner tonlosen Stimme nach glaubte er an kein Wunder. Markus ebenso wenig. Hätte er nicht die Stimme verloren, er hätte losgeschrien. Der Gedanke, Anna nie mehr wiederzusehen, ging über seine Kräfte. Seine Beine gaben nach. Er versuchte, sich auf einem Regalbrett abzustützen, doch er glitt ab und fiel. Ein blaues Blatt Papier segelte hinter ihm her. An einer Holzhütte am Waldrand angelangt, blickte der Salvator zurück. Die Feuersäule über dem Anwesen war bereits in sich zusammengesunken. Ein Hauptquartier weniger. Rudi zog einen Schlüssel aus der Hose und kniete vor der Hütte nieder. Er brauchte einen Moment, um das Astloch zu ertasten, in dem sich das Schloss verbarg. Einen anderen Zugang gab es nicht, die vermeintliche Tür war nur Makulatur. Er und Khaled hoben die Längswand aus der Verankerung und ließen sie zu Boden. Ein Polizeimotorrad und ein Krankenwagen tauchten auf. Rudi fuhr den Wagen heraus. Lucy stieg ein und reichte ihm und Khaled ihre Sets: eine Polizeiuniform und die Montur eines Rettungssanitäters. Während sie sich umzogen, fragte Rudi den Salvator, wo es langgehen sollte. »Du umfährst Frankfurt in großem Bogen, Heydt läuft uns nicht weg. Wir nähern uns der Stadt von Süden her, keine Autobahnen. Khaled, du folgst Rudi.« Er bestieg den Wagen und legte sich auf die Liege. Lucy, die bereits in ihre Arztkluft geschlüpft war, begann ihn zu verbinden. Rudi warf das Motorrad an und näherte sich im Schritttempo dem Feldweg, der nach hundert Metern auf eine kleine Straße führte. Nachdem er sich umgesehen hatte, schaltete er das Blaulicht ein, woraufhin Khaled den Krankenwagen anließ. Der Salvator trug mittlerweile einen blutbespritzten Kopfverband, der sein Gesicht verdeckte. Unter dem Verband hatte Lucy ihn mit einem Miniaturmikrofon und einem Funkempfänger versorgt. »Kannst du mich hören, Rudi?« »Ja, Salvator. Ich hab auch gleich eine Frage. Wir fahren auf eine Straßensperre zu. Versuchen wir, da zivilisiert durchzukommen oder sprengen wir durch?« Erwartungsvoll sah Markus das Blatt auf sich zusegeln. Umso enttäuschter stellte er fest, dass es unbeschrieben war. Er legte es auf den Tisch und fuhr mit der Hand über weitere Regalbretter, ohne fündig zu werden. Aus den Augenwinkeln sah er, wie Jesús das blaue Blatt anstarrte, als könnte er ihm per Röntgenblick Geheimnisse entreißen. »Setz dich, Markus, wir sind noch nicht fertig. Ich war schon mal in diesem Raum. Und damals lag auch so ein Blatt vor mir. Ist dir aufgefallen, wie seltsam es sich anfühlt? Nicht wie normales Papier. Und nun schau genau hin.« Er nahm das Blatt, zerknüllte es und legte es auf den Tisch. Ehe Markus sich versah, entfaltete sich das Papier. Nicht der Anflug eines Knicks war mehr zu erkennen. Jesús zog einen Kuli aus Markus’ Hemdtasche und kritzelte damit auf dem Blatt herum. Die Tinte hinterließ keine Spuren. »Ich habe damals etwas auf so ein Papier geschrieben, wenn mich meine Erinnerung nicht trügt. Obwohl … Mir ist, als hätte das Blatt im Raum geschwebt, vielleicht also doch nur eine Fantasie. Mir gegenüber saß dieser Mann – Lexied. Weißt du, es ist keine normale Erinnerung, eher ein verschwommener Traum. Der Stift, den ich in meiner Hand sehe, kommt mir vor wie aus Glas. Vielleicht befindet er sich ja irgendwo hier. Lass uns suchen.« Sie fanden ihn in einer Klemmvorrichtung unter dem Tisch. Markus nahm ihn und betrachtete den Glaskörper, der sich ungewöhnlich kalt anfühlte. Vielleicht ein Mineral. Unten lief er spitz zu, doch eine Mine besaß er nicht. Während er ihn in der Hand drehte, glomm in dessen Inneren ein violettes Licht auf. »Gib her, gib her!« Jesús ergriff den Stift. »Der Mann hat etwas gezeichnet, und ich könnte schwören, es war ein Symbol, das ich kannte. Und danach konnte man irgendwas auf dem Blatt lesen.« Er versuchte vergebens, das Bild in seinem Kopf zu schärfen. »Gib mir deinen Notizblock, vielleicht krieg ich es intuitiv hin.« Er begann, den Block mit dem Kugelschreiber vollzumalen, Seite für Seite. Ohne Erfolg, keine der Kritzeleien rief eine Erinnerung wach. Die verschnörkelten Zeichnungen wurden immer verworrener. »Verdammt, ich bring’s nicht hin!« Angestrengt betrachtete Markus die letzte Zeichnung, drei Bögen, die einem »m« ähnelten, in das eine Schleife hineingezogen war. Irgendetwas sagte es ihm. Seinem Gefühl nach befand sich die Schleife aber nicht an der richtigen Position. Er fing selbst an zu kritzeln. »DAS IST ES!« Mit fliegenden Händen nahm Jesús den Glasstift. »Das Tierkreiszeichen der Jungfrau, plötzlich weiß ich es wieder!« Er setzte den Stift auf dem leeren Papier an und zeichnete das Symbol ins untere linke Eck. Ein unwirkliches Licht flammt auf. Das Blatt begann zu leuchten. Unversehens schwebte eine transparente, hellblaue Lichtfläche über dem Blatt, aus der erhabene Striche hervortraten, so körperlich wie imaginär: ein gestochen scharfes Hologramm. Fasziniert beugte sich Markus vor und wedelte mit der Hand durch den Zwischenraum zwischen Blatt und Schwebetext. Das Hologramm blieb davon unberührt. Es reagierte auch nicht, als er das Blatt verschob und schließlich hinter seinem Rücken versteckte, wohl aber, als er an der Projektionsfläche »zupfte«: Sie ließ sich an jeden beliebigen Punkt im Raum ziehen, gleich wo sich das Blatt gerade befand. »Nun ist gut.« Jesús zog die Fläche zu sich und betrachtete das Streifenmuster unterschiedlich dicker und langer Linien. Sah aus wie ein Strichcode. Und nun? Brauchte man einen Scanner, um den Code in Sprache zu übersetzen? Aus einer Eingebung heraus tippte Jesús mit dem Zeigefinger auf die erste Linie. »Traducción.« Nichts. »Übersetzung.« Keine Reaktion. »Traduction … Tradução … Translation.« Wieder nichts. »In meiner Erinnerung hat der Mann ›Übersetzung‹ gesagt. Demnach habe ich ihn verstanden. Aber mir fällt keine Sprache mehr ein, in der ich das Wort kenne. Eine Idee?« Markus malte mit dem Zeigefinger ein ›i‹ auf die Tischplatte. »Italienisch? Ja, vielleicht, obwohl mir im ersten Moment nicht einfällt, wie …« Er sprach den Satz nicht zu Ende. »Translatio.« Die lateinische Variante. Augenblicklich verwandelten sich die Strichcodes in lateinischen Text. Markus schob seinen Stuhl neben den von Jesús, um mitlesen zu können. Eine nummerierte Liste mit 67 Einträgen. Jesús’ Augen wanderten die Zeilen hinunter. In Zeile XVII fand er den Eintrag »Germania«. Er tippte mit dem Zeigefinger auf das Wort. Markus hielt den Atem an, während er zusah, wie sich die Buchstaben veränderten. DEUTSCHE VERSION Zeitumrechnung nach →gregorianischem GE-Kalender Namen in lateinischer Schreibweise freie Übersetzungen: ›…‹ Übersetzungsassistent: ↔ SYSTEMINFORMATIONEN DNS-Rechner-Paket [100 Rechner] Bio-Data Version II II II II II [Spielwaren-Index 1/13/12] Leistung/Rechner: 1.000.000 Teraflops/Sek. Leistungslevel/Rechner: A-00002 Speicherkapazität/Rechner: 700 Exabyte Freigabe: Kinder ab 5 Jahre Patent vom 2.2.1482 n. Chr. Patent-Register: XP/a/12/68.19-QDF Systemaktivierung: 2.2.1484 n. Chr. Reg. Eigentümer: Kal Syr Logg, EWG-Z 109/8874 RECHNER 71 von 100 Blatt Sensorische Eingabe: aktiviert Spracheingabe: aktiviert Biokinetische Eingabe: aktiviert Sehrinden-Vision: deaktiviert Scan-Schutz: deaktiviert 700 Exabyte – Jesús konnte es nicht glauben. Maß man nicht den gesamten digitalen Ausstoß der Welt in Exabyte? Wie sollte ein Blatt Papier speichern, was auf Hunderten von Millionen Klein- und Großrechnern produziert wurde? Und so etwas sollte ein Spielzeug für Kinder ab fünf sein, eine Art Schmierblatt aus einem 100-Seiten-Block? Patentiert im Mittelalter? »Anna Heydt.« Der Blattrechner reagierte nicht. »Suche: Anna Heydt.« Nichts. »Die Spracheingabe ist doch aktiviert, verdammt. Kapiert das Ding denn nur lateinische Befehle?« Markus versuchte es mit etwas Primitiverem: Er wischte mit der Hand über das Hologramm. Ein Index leuchtete auf. Offenbar ein in Themenblöcke gegliedertes Inhaltsverzeichnis. Sein Blick wanderte über die Zeilen – die Zeilen bewegten sich automatisch mit. Eine Rubrik mit Lexika erschien. Eines der Werke interessierte ihn besonders. Kaum hatte er es gedacht, schienen neue Luftzeichen auf: Lexikon Gegenerde. ÜBERBLICK 1401 n. Chr. entdeckte Pol Xigg Kyrt den Zwillingsplaneten Gegenerde [GE] mittels Supra-Magnet-Indikation. 1410 n. Chr. wies er nach, dass Gegenerde von der Erde im Wege einer globalen Quantenverschränkung abgespalten wurde. Die Quantenverschränkung datierte er auf den 23.5. im Jahr 23 n. Chr., die Ursache ist unbekannt. Die Abspaltung vollzog sich in der siebzehnten Dimension der Raumzeit. Sie wird im →Dimensionen-Modell nach Ter Gal Kugg als raumgleicher Zeit-Parallel-Strahl abgebildet. Erde und GE nehmen identischen hyperlokalen Raum ein. Sie sind auf ihren →Zeitstrings um 1,073 Attosekunden [10-18 Sekunden] verschoben. 1422 n. Chr. wurde der Antimaterienebel mittels optimiertem Quanten-Supervisor durchdrungen. Mittels Invers-Thermografie wurde Leben auf GE nachgewiesen. Verbesserungen der Photonen-Masse-Spin-Detektion und neue Transmitter der Hypervisualisierung [Typ Gamma 5] ermöglichten in den Folgejahren zunehmend präzise Simulationen. 1426 n. Chr. wurde humanoides Leben auf GE nachgewiesen. 1464 n. Chr. legte das Team um Sarym Lel Forr mittels der →Zeitsprungtheorie die Basis für die Vor-Ort-Erforschung von GE: Die Zeitstrings von Erde und GE pulsieren längs der Symmetrieachsen ihrer Magnetfelder phasenverschoben gegeneinander. In Perioden größter Annäherungen interferieren sie. 1467 n. Chr. wurde das vorhergesagte Interferenzmuster nachgewiesen. Es zeigte sich, dass die Zeitstrings von Erde und GE im März 1476 n. Chr. die nächste Phase größter Annäherung erreichen würden. Auf Initiative des Hohen Rats setzte das NETZWERK unter Führung der Laboratorien Kryonik-/Lasertechnologie und Kalte Fusion das Projekt →String-Sprung auf. Es diente der Realisierung der technischen Voraussetzungen der temporalen Teleportation zwischen Erde und GE. Am 2. März 1476 n. Chr. wurde ein 29-köpfiges Team aus Wissenschaftlern und Schutzstaffel mit Forschungseinrichtungen und mobiler Teleportationseinheit nach GE teleportiert. Das Zeitfenster betrug 413 Stunden und 19 Minuten. Nach der Rückkehr fasste Expeditionsleiter →Toff Legg Lo seine Eindrücke in dem berühmten Satz zusammen: „Die haben mehr Bazillen im Mund als wir im Darm.“ Jesús sah Markus stirnrunzelnd an. »Kannst du mir das erklären? Kann sich nur um einen Scherz handeln, oder?« Markus wusste es nicht. Was da stand, klang nach schlechter Science-Fiction. Aber der Rechner, der sich äußerlich nicht von einem Blatt Papier unterschied, funktionierte wirklich per Augen- und Gedankensteuerung. Ihm fiel das Telefonat mit Triebel ein. Angeblich spekulierten anerkannte Physiker, es könne Parallelwelten geben. Demnach war deren Existenz grundsätzlich genauso denkbar wie ihre Nichtexistenz. Und wenn die Sache fünfzig zu fünfzig stand, dann fiel jedes noch so kleine Indiz ins Gewicht, und dieser Rechner war ein eindrückliches. Nach der Rückkehr von GE starben 11 der 29 Teilnehmer während der Quarantäne an Seuchenkrankheiten, die auf der Erde unbekannt sind. Der Hohe Rat untersagte weitere Expeditionen. Seit 1671 n. Chr. erteilt er →Lotteristen [EWG-Z] zweckgebundene Ausnahmegenehmigungen, die der Bekämpfung des Pandemischen Kap-Land-Virus dienen. Die Rückständigkeit von GE ist Gegenstand der →GE-Forschung. Die Auswertungen des Expeditionsteams und die kontinuierliche Observation mittels Hypervisualisierung belegen Folgendes: In den ca. 1500 Jahren nach der Abspaltung 23 n. Chr. erzielte GE nur marginalen zivilisatorischen/technologischen Fortschritt. In vielen Bereichen fiel GE hinter die ›Antike‹ [→Naive Ära] zurück. Das Rätsel des Stillstands löste die GE-Forscherin Hak Zi Lidd 1489 n. Chr. nach intensiver Forschungsarbeit: – „Während auf der Erde rationale Weltanschauungen den vorherrschenden Polytheismus der ›Antike‹ ablösten, entstanden auf GE monotheistische Religionen. Sie basieren auf dem Nationalglauben des jüdischen Stammes und weisen psychotische/totalitäre Züge auf, namentlich →Katholizismus und →Islam. Sie sind Glaubens-Gemeinschaften, doch sie glauben mit einer Gewissheit, die jedes menschliche Wissen in den Schatten stellt. Um bedingungslose Gefolgschaft zu gewährleisten, machten sie die Not zur Tugend: Gerade weil sich ihr Gott jeder Überprüfung entzieht, können sie ihn zur unbestreitbaren Tatsache erheben. Wer ihren Glauben nicht teilt, den bedrohen sie mit dem Tod. Und sie drohen nicht nur.“ – „Ihrem depressiven und expansiven Charakter gemäß unterwarfen Katholizismus und Islam zunehmende Teile von GE einem fortschrittsfeindlichen Diktat. Während der arabische Islam eine einheitliche Praxis des Glaubens vor allem durch gesellschaftlichen Anpassungsdruck erzwingt, zielt der europäische Katholizismus unter Einsatz eines differenzierten Instrumentariums psychischer und physischer Folter auch und insbesondere auf intellektuelle Gleichschaltung. [Zu solcher Art Handeln sieht sich die katholische Kirche durch einen allmächtigen Gott berufen, der sie zu seiner Stellvertretung beauftragt habe. Sie beruft sich dabei auf den Propagandisten →Paulus und auf das Wortspiel eines jüdischen Wanderpredigers namens Jesus von Nazareth, →Petrus-Aphorismus. Nach katholischer Deutung handelt es sich bei Letzterem um den Gottessohn. Seine Geburt markiert den Anfang der →christlichen Zeitrechnung, das Jahr Null. Demnach wäre er bis zur Abspaltung von GE Bewohner der Erde gewesen. Trotz intensiver Forschung findet unsere Geschichtswissenschaft keinen Beleg seines Wirkens.]“ – „Katholizismus und Islam bilden Männergesellschaften mit schizophren-paranoider Einstellung zur Sexualität. Je ungehemmter sie ihre Triebe ausleben, desto stärker die Abscheu vor der Triebhaftigkeit. Diese Abscheu projizieren sie auf die Frau als schuldige Verführerin. Frauen gelten als willens- und leistungsschwach. Von Ausnahmen abgesehen, werden sie wie eine minderwertige Rasse behandelt und von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen – mit dramatischen Folgen für die zivilisatorische Entwicklung.“ [zitiert aus: Hak Zi Lidd, Religion und Raserei, Essay über die Allmacht und Ohnmacht auf GE, 1490 n. Chr.] Die von Hak Zi Lidd und anderen GE-Forschern gewonnenen Erkenntnisse verarbeitete Dakk Se Zurl 1529 n. Chr. in seinem epochalen Roman Die Primitiven. Er wurde damit zum Vorreiter der →GE-Literatur, die u. a. die Werke Und Gott rief: Stillgestanden! und Das Machwerk alter Männer hervorgebracht hat. Ab Mitte des 16. GE-Jahrhunderts vollzog sich in Wissenschaft/Kunst/Philosophie der nordwestlichen GE-Regionen ein Aufschwung, in dessen Folge die Macht der Kirchen zu schwinden begann … »Wir sind also bloß die Abspaltung und die anderen die echte Erde?« Jesús schob den Stuhl zurück und ging erregt auf und ab. »Vielleicht sind wir für die auch gar keine echten Menschen. Die kriegen also Reisegenehmigungen, um bei uns den Kap-Land-Virus zu bekämpfen. Schon mal von dem gehört? Nein? Kann mir auch kaum vorstellen, dass die uns heimlich besuchen kommen, um uns von unseren Viren zu befreien. Aber dass die mit ihren gefährlichen Viren zum Experimentieren anreisen, weil auf uns, die Primitiven, ohnehin geschissen ist – das kann ich mir sehr gut vorstellen!« Er setzte sich wieder. »Leider gibt’s da keinen Link. Aber es gibt einen Link zu den Lotteristen, die sie uns auf den Hals hetzen. Ist dir aufgefallen, dass hinter Lotteristen ein Kürzel stand, EWG-Z? Dasselbe Kürzel steht bei den Systeminformationen hinter dem Namen des Eigentümers. Schauen wir uns das näher an?« Markus nickte, scrollte den Text zurück und tippte auf den Link. ›Lotterist‹ –II II II II II II II–. Amtliche Bezeichnung: EWG-Z. Gewinner der jährlichen Lotterie Donum vitae. Die Lotterie wird durch den →KODEX gewährleistet. Teilnahmeberechtigt ist jeder →Spendable. Die Gewinnausschüttung beläuft sich auf 1,2 Prozent aller Lose. Lotteristen werden von der Spendenverpflichtung entbunden und als Berechtigte vierten Grades in das →Programm aufgenommen. Seit 1671 n. Chr. werden Lotteristen auf freiwilliger Basis zu Forschungszwecken auf GE entsandt. [→19. Zusatz zum KODEX] Jesús’ Finger stach hervor und zielte auf den Link »Spendable«. Markus ging dazwischen. Um nicht den Überblick zu verlieren, arbeiteten sie sich besser vom Allgemeinen zum Konkreten vor. Er deutete auf den Link »Kodex« und Jesús nickte widerwillig. KODEX Der Kodex ist ein Gesetzeswerk im Verfassungsrang. Er verbrieft Rechte und Pflichten von Gebern und Empfängern des →Ewigkeitsprogramms [Kurzform: Programm]. Er wurde 1336 n. Chr. auf Grundlage einer Volksabstimmung vom Hohen Rat verabschiedet. Der Kodex beendete die moralische Krise der →Obskuren Ära. Den Hintergrund bildete die Erfindung der →Lebensfluss-Technologie [LFT] im Jahr 1301 n. Chr. Damals betrug die durchschnittliche Lebenserwartung im →Afrikanischen Überlebensraum 169 Jahre. Die LFT stellte eine Vervierfachung in Aussicht. Heutige Studien des →Lebens-Werk besagen, dass LFT-Absolventen, die regelmäßig am Programm teilnehmen, vom altersbedingten Tod ausgenommen sind. Derzeit [Stand: 2006 n.Chr.] verfügen rund 2 Prozent der Bevölkerung des Afrikanischen Überlebensraums über die Mittel, als Nehmer aktiv am Programm teilzunehmen [Level-1Mitbürger]. Erläuterungen: 1. LEBENSFLUSS-TECHNOLOGIE Die LFT-Behandlung stoppt den körperlichen Alterungsprozess zum Zeitpunkt der [Erst]Behandlung. Voraussetzung für ein dauerhaftes Einfrieren des Körperalters sind Auffrischungsbehandlungen im Vierjahrestakt. Seit 1574 n. Chr. kann der Alterungsprozess graduell programmiert und dadurch ein höheres, genau definiertes Körperalter angesteuert werden. Die Alterung ist irreversibel. Die LFT basiert auf einer multi-invasiven Kombinationstherapie. Sie umfasst u. a. die nanotechnische Dosierung kompetitiver und allosterischer Enzymregulatoren [→ProteinEngineering] und die Genom-Therapie mittels Kunst-Genen [die u. a. den Transdifferenzierungsmodus der Qualle Turritopsis nutricula imitieren]. Zur Unterdrückung immunologischer Abwehrmechanismen wird der Nehmer mit chemotherapeutisch modifiziertem Blut eines Gebers geflutet: [1] Es erfolgt ein vollständiger Blutaustausch vom Geber zum Nehmer. [2] Es wird Echt-Blut zugeführt, da die erforderliche T-Lymphozyten-Supprimierung mit stammzellenbasiertem Nachzucht- oder Kunst-Blut Wirksamkeitsdefizite aufweist. [3] Die Verwendung von Echt-Blut in Form von Lager-Blut erhöht das Risiko von Komplikationen statistisch um 31,8 %. Das Lebens-Werk verwendet daher ausschließlich Echt-Blut in Form von Frisch-Blut gemäß Spez167/200. [4] Die Flutung des Nehmers mit Echt-Blut verschiedener Geber [Spender] erhöht dessen Erkrankungsrisiko statistisch um 18,2 % je Spenderzahl >1. Das Lebens-Werk verwendet daher ausschließlich Blut aus singulärer Quelle. [5] Der Blutaustausch erfolgt unmittelbar und vollständig vom Geber auf den Nehmer im Wege der →Ein-Akt-Flutung [Simultan-Flutung] nach Druckausgleichprinzipien. 2. OBSKURE ÄRA Aufgrund der Transfusionsbedingungen führt die Blutspende auf Seite des Gebers/Spenders zum Tod. Dieser Umstand löste im Zeitraum von 1315 bis 1336 n. Chr. bürgerkriegsähnliche Verwerfungen aus. Der Historiker Okk Iz Fabb führt dazu aus: [1] „In der moderaten Periode richteten sich die Übergriffe gegen ‚Bürgerrechtslose‘ [Nicht-Mitbürger], die nach dem Ausbruch der Eiszeit [→Zweite Klimakatastrophe/Versiegen des Golfstroms] nicht in den Afrikanischen Überlebensraum eingetreten waren. Um an frisches Echt-Blut zu gelangen, lauerten gedungene Korps ihnen auf, um sie der Ausblutung zuzuführen.“ [2] „Die intensive Periode wurde gekennzeichnet vom ›Schachern und Schächten‹: Vermögende Level-1-Mitbürger eigneten sich verarmte Level-3-Mitbürger gegen Zahlung hoher Abfindungen an. Mit den Abfindungen ermöglichten die Opfer ihren Hinterbliebenen den sozialen [Wieder]Aufstieg.“ [3] „In der extremen Periode, dem sogenannten bürgerlichen Blutrausch, wurden Level-3Mitbürger auch gegen ihren Willen gewaltsam ausgeblutet. Selbst Level-2-Mitbürger gerieten in die Fänge der ‚Bluthunde‘. [In diesem Zeitabschnitt kam die sozialwidrige Bezeichnung Quellen für Blutspender auf.] Gegen Ende der extremen Periode formierten sich Teile der Level-2- und Level-3-Mitbürgerschaft und zerstörten Exklusiv-Zonen der Level-1-Mitbürger.“ [zitiert aus: Okk Iz Fabb, Die Blutfehde,1399 n. Chr.] Historiker schätzen die Zahl der Opfer auf rund 150.000, darunter ca. 30.000 Mitbürger des Afrikanischen Überlebensraums [0,3 Prozent der rund 10 Millionen Mitbürger]. Im Jahr 1336 n. Chr. gelang es dem Hohen Rat nicht zuletzt durch Verabschiedung des Kodex, die sozialen Unruhen einzudämmen. Übergeordnetes Ziel des Kodex war und ist es, einen Interessenausgleich innerhalb des Ewigkeitsprogramms herzustellen, insbesondere zwischen Nehmern/Ewigen [aktive Teilnehmer] und Gebern/Spendablen [passive Teilnehmer]: KODEX Beseelt vom Humanitären Prinzip, jedem Mitbürger das Streben nach Entfaltu