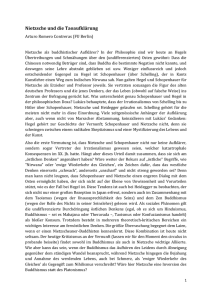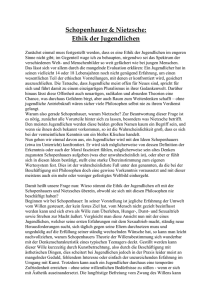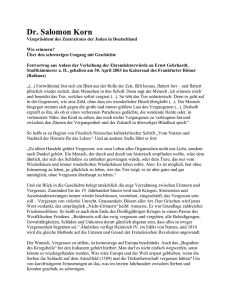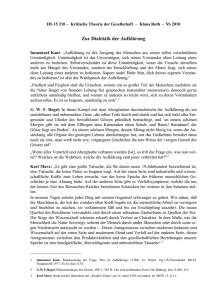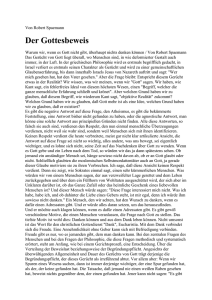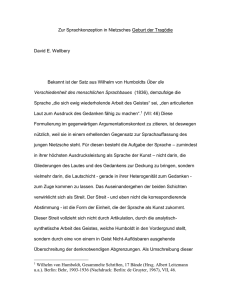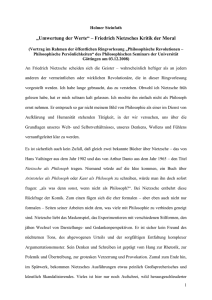FN-Morgen-K - WordPress.com
Werbung
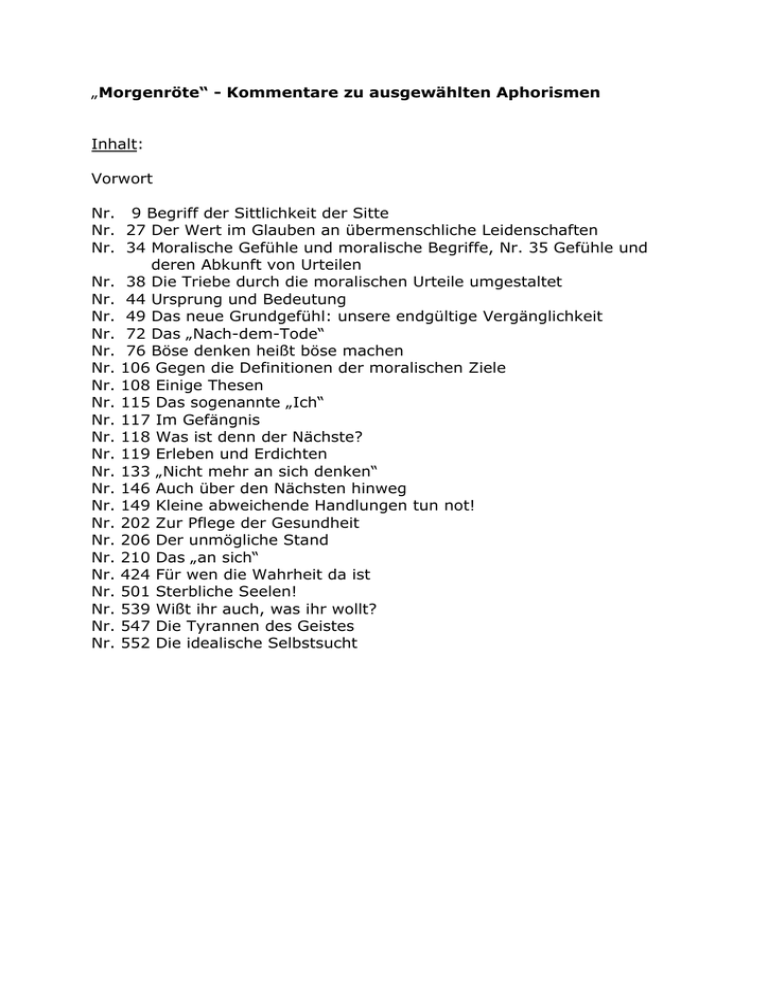
„Morgenröte“ - Kommentare zu ausgewählten Aphorismen Inhalt: Vorwort Nr. 9 Begriff der Sittlichkeit der Sitte Nr. 27 Der Wert im Glauben an übermenschliche Leidenschaften Nr. 34 Moralische Gefühle und moralische Begriffe, Nr. 35 Gefühle und deren Abkunft von Urteilen Nr. 38 Die Triebe durch die moralischen Urteile umgestaltet Nr. 44 Ursprung und Bedeutung Nr. 49 Das neue Grundgefühl: unsere endgültige Vergänglichkeit Nr. 72 Das „Nach-dem-Tode“ Nr. 76 Böse denken heißt böse machen Nr. 106 Gegen die Definitionen der moralischen Ziele Nr. 108 Einige Thesen Nr. 115 Das sogenannte „Ich“ Nr. 117 Im Gefängnis Nr. 118 Was ist denn der Nächste? Nr. 119 Erleben und Erdichten Nr. 133 „Nicht mehr an sich denken“ Nr. 146 Auch über den Nächsten hinweg Nr. 149 Kleine abweichende Handlungen tun not! Nr. 202 Zur Pflege der Gesundheit Nr. 206 Der unmögliche Stand Nr. 210 Das „an sich“ Nr. 424 Für wen die Wahrheit da ist Nr. 501 Sterbliche Seelen! Nr. 539 Wißt ihr auch, was ihr wollt? Nr. 547 Die Tyrannen des Geistes Nr. 552 Die idealische Selbstsucht Vorwort Im Folgenden findet man 25 (oder 26, wenn man ganz genau zählen will) so genannte Aphorismen Nietzsches aus seinem Buch „Morgenröte“ (1881). Sie stellen die Quintessenz seines Denkens in dieser Zeit vor dem „Zarathustra“ dar. Als solche sollen sie zur Kenntnis genommen, gleichzeitig jedoch auch geprüft werden - wir brauchen keinen NietzscheKult und keine Heldenverehrung. Der Prüfung dienen die Kommentare; sie entsprechen im Umfang etwa den Aphorismen und zeigen einmal bestimmte Querverbindungen im Denken Nietzsches auf, sollen im Wesentlichen jedoch untersuchen, ob Nietzsches Gedanke heute noch trägt. Meine Kommentare müssen ebenso wenig wie Nietzsches Gedanken geglaubt werden, laden vielmehr zum Mitdenken ein. Wird dies, auch im Widerspruch, getan, was könnte ich Besseres erreichen? - Ein kleiner Essay Nietzsches aus dem Nachlass der Achtzigerjahre, halb Reflexion, halb Bericht, weist die Richtung: ‚Mein neuer Weg zum „Ja“‘. Die von mir benutzte Ausgabe ist die von Schlechta (Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1997 = Hanser 1954). Die Bearbeitung stammt aus dem Jahr 2002. Norbert Tholen zu Nr. 9: Begriff der Sittlichkeit der Sitte Wer denkt über ein so befremdliches Thema wie die Sittlichkeit der Sitte nach? Man muss zwischen Sittlichkeit und Sitte unterscheiden beziehungsweise den Unterschied hören, den Nietzsche an dieser Stelle macht: „Die Sitte repräsentiert die Erfahrungen früherer Menschen über das vermeintlich Nützliche und Schädliche“1; das Nützliche für wen? Für die Gemeinde, in der man lebt.2 Die Sittlichkeit dagegen ist ein „Gefühl für die Sitte“, welches sich auf die Heiligkeit und Unantastbarkeit der Sitte bezieht.3 Diesen Zusammenhang stellt auch der erste Hauptsatz (Z. 1013) her. Zur Sittlichkeit gehört also das Motiv des Gehorsams: in Fragen der Gesundheit, des Ackerbaus, der Ehe und so weiter so handeln, wie man handeln soll und weil man so handeln soll. Nietzsche stößt hier zum Ursprung des „Sollens“ vor, das noch dem großen Kant als unhintergehbarer Ausgangspunkt moralischer Erfahrung gegolten hatte. Ist dieser Ausgangspunkt einmal fixiert und kritisch umkreist, dann verliert das „Du sollst...!“ seinen Charakter unbedingter Verpflichtung: Es ist bedingt, und zwar durch das bedingt, was man früher einmal für den Nutzen der Gemeinde gehalten hat. Wie erlebt der Einzelne, sofern er zur Sittlichkeit, also zum Gehorsam gegen die Sitten erzogen ist, die unbedingte Verpflichtung? Er ist von Furcht erfüllt, Furcht „vor einer unbegreiflichen, unbestimmten Macht, vor etwas mehr als Persönlichem“ (Z. 30 f.). Indem Nietzsche den Ursprung dieser Macht begreiflich macht, leistet er in der Nachfolge Voltaires4 und Kants Aufklärung; er zeigt, dass in dieser Furcht Aberglaube steckt (Z. 31 f.). Mit der Einsicht in den Ursprung des „Du sollst...!“ kann er auch zu Versuchen, dieses „Du sollst...!“ neu zu begründen, Stellung nehmen. Er greift hier den Versuch des Sokrates an, Sittlichkeit aus ihrem Vorteil für den Einzelnen, für sein „wahres“ Glück zu begründen (Z. 55 ff.): Solche Versuche verfehlen die Sittlichkeit, der es um ihre eigene Geltung geht, nur um den Vorteil der Gemeinde5, nie um den Einzelnen (Z. 49 ff.). Wir sind in dieser sokratischen Tradition unterrichtet worden, weshalb sie uns die Einsicht in den Ursprung der Sittlichkeit versperrt: Aus dem unbegreiflichen Willen des Gottes der Zehn Gebote ist die vernünftige und damit auch begreifliche Forderung des Kategorischen Imperativs geworden, den Vorteil der Gemeinde hat man zum wahren Glück des Individuums uminterpretiert - aber die sittliche Forderung läuft nach wie vor darauf hinaus, dass der Einzelne sich opfern soll (Z. 54). Wozu klärt Nietzsche den Ursprung der Sittlichkeit auf? Ich nehme an, dass man nur dann so radikal denken kann, wenn man zutiefst verwundet ist; wenn man durch die Forderungen eines sittlichen Lebens verletzt ist, eingeengt, unterdrückt - von der Forderung und ihren Repräsentanten: 1 Morgenröte, Nr. 19. Vermischte Meinungen und Sprüche, Nr. 89. 3 Morgenröte, Nr. 19. 4 „Menschliches, Allzumenschliches“ (I) ist mit entsprechender Widmung 1878, zum hundertsten Todestag Voltaires, erschienen. 5 Vermischte Meinungen und Sprüche, Nr. 89. 2 von den Müttern und Vätern und großen Schwestern, von den Pfarrern und Lehrern und Besserwissern, welche aus ihrer Position als Statthalter der Sittlichkeit selber Macht gewinnen. Von solchen erdrückenden Forderungen und Figuren muss man sich befreien, will Nietzsche sich befreien. Er sagt das „historisch“: dass die besseren, ursprünglicheren Geister, die starken Individuen darunter gelitten haben, dass man sie als unsittlich und böse verdammen durfte (Z. 78 ff.); man wird nicht fehlgehen, wenn man annimmt, dass Nietzsche sich selbst zu diesen starken Geistern zählt, die es wagen, „ich“ zu sagen und zu sein; das wird sich an vielen Stellen zeigen - hier genügt der Hinweis auf den von Nietzsche propagierten Polytheismus.6 Dass Nietzsche, indem er den Ursprung der Sittlichkeit und damit die Sittlichkeit selbst analysiert, sich befreien will, zeigen für mein Empfinden deutlich zwei kleine Aphorismen: „Was ist dir das Menschlichste? Jemandem Scham ersparen.“ „Was ist das Siegel der erreichten Freiheit? - Sich nicht mehr vor sich selber schämen.“7 Hier kann man förmlich fühlen, was den Denker Nietzsche umtreibt: nicht mehr von den Agenten der Sittlichkeit öffentlich beschämt werden, und indem man sich von den Maßstäben der „Sittlichkeit“ löst, sich auch selber nicht vor sich schämen. Das versteht jeder, der ähnlich beschämt worden ist. In die gleiche Richtung weist der Gedanke, dass es in der Logik der „Sittlichkeit“ liegt oder liegen kann, gerade die schwerste Erfüllung der sittlichen Forderung zu fordern: dass der Einzelne sich opfere, damit die Gemeinde und ihre Sittlichkeit im hellen Glanz, im göttlichen Licht erstrahlen kann (Z. 43 ff. und 49 ff.). Auch hier kann man spüren, finde ich, dass sich jemand dagegen wehrt, zum Nutzen der Gemeinde geopfert zu werden, dass jemand am Recht auf sein eigenes und eigenständiges Leben festhält: Nietzsche. Wo sind diese Gedanken aktuell? Wo es „Gemeinden“ gibt, welche ihre Mitglieder ihren unbefragten und unbezweifelbaren Gesetzen unterwerfen; wo die Sitten und die Regeln nicht ihren Nutzen erweisen - ihren Nutzen gerade für die, welche sie befolgen, und nicht nur für jene, die sie als heilige Gralswächter oder heilige Väter (gibt es auch heilige Mütter?) propagieren.8 Im Verlauf der weiteren Lektüre Nietzsches werden wir auf Themen stoßen, welche die Aktualität dieser Gedanken auch nach über 100 Jahren zeigen. zu Nr. 27: Der Wert im Glauben an übermenschliche Leidenschaften Dieser Aphorismus ist beinahe zu kurz, als dass hier das Verhältnis von schnell vergehender Leidenschaft und dauerhaftem Verhältnis, von „Liebe“ und „Ehe“ geklärt werden könnte. Nietzsche sieht die Ehe als Institution, in welcher angeblich die leidenschaftliche Liebe auf Dauer gestellt werden soll (Z. 1-4). Dass dies in der Regel nicht gelingt, bewertet er ambivalent: 6 Die Fröhliche Wissenschaft, Nr. 143. Die Fröhliche Wissenschaft, Nr. 274 und 275. 8 Aufbau des Aphorismus: Z. 1-10-26-32-40-55-65-78-86. 7 Einerseits sei der Glaube an die ewige Liebe ein Irrtum oder eine Lüge (Z. 6 und 17), anderseits werde so der Leidenschaft ein höherer Adel verliehen, werde der Mensch erhoben (Z. 6 f. und 18 f.). Nietzsche erliegt hier dem Mythos der „Liebe“; gegen ihn muss man seine eigene methodische Forderung, „das historische Philosophieren von jetzt ab“ zu üben9, geltend machen und anwenden. Es ist also fraglich, ob die Institution Ehe „gegründet“ oder „erfunden“ worden ist, um der Leidenschaft der Liebe Dauer zu verleihen, ob sie nicht viel prosaischer in der geregelten Arbeitsteilung von Mann und Frau ihren Ursprung hat; die Liebesehe ist jedenfalls eine recht späte Erscheinung in Europa.10 Der Liebes-Mythos hat verschiedene Wurzeln; Gernot Böhme nennt die antike eros-Philosophie, die christliche agape- und die mittelalterliche minne-Idee.11 Die Eigenart des modernen Liebesmythos zeigt sich deutlich in Schillers „Kabale und Liebe“ (1784): Ferdinand und Luise haben ihre Liebesträume aus Büchern gewonnen, welche von emanzipierten jungen Bürgern (und entsprechenden Adeligen) gelesen werden; in ihnen ist von Liebe und Herz und der gemeinsamen Flucht in die entlegensten Wüsten die Rede, vom Akkord zweier Herzen, im Gegenzug von teuflischen Herzen und ungeheurem Betrug, aber eben nicht von Ehe und Scheidung; die Liebe des Paares ist sicher „ewig“, aber nicht von Dauer. Auch in Goethes „Faust“ ist diese Problematik von Faust gegenüber Gretchen angesprochen (V. 3185 ff.) und mit Mephisto diskutiert worden (V. 3251 ff. und 3521 ff.); das Ende Gretchens ist bekannt. Wenn man sieht, wie Liebe und Ehe literarisch behandelt werden, so findet man die Liebe bis zum Gewinn des ersehnten Partners auch im Hollywoodfilm als „Märchen“ erzählt; die Ehe wird dagegen als Komödie oder Tragödie dargestellt. Soll also etwas vom Liebesversprechen in die Ehe gerettet werden, dann muss sich die Vorstellung von „Liebe“ in der alltäglichen Erfahrung verändern; dann muss man den Partner wie sich selbst als normale bedürfte Menschen sehen, welche füreinander nicht Traumgestalten der Sehnsucht sein, jedenfalls nicht bleiben können: Dass es Dauer nur „im Wechsel“ gibt, hat bereits Goethe im Gedicht festgehalten. Ich deute das hier nicht (unbedingt) als Wechsel der Partner, sondern der Gefühle, der Einsichten, der Ansprüche - im Rückblick nennt man das „Reifung“. 9 Menschliches, Allzumenschliches I, Nr. 2, ähnlich auch Nr. 1. Grundbegriffe der Soziologie. Hg. von Bernhard Schäfers. Leske + Budrich: Opladen 1995 (4. A.), S. 42. - Beim Liebespaar ist der einzelne unersetzlich, in der Familie erfüllt er eine Funktion - darin ist er ersetzbar. In seinem Aufsatz „Mama macht Überstunden“ (DIE ZEIT Nr. 35 vom 22. August 2002, S. 35) gibt Birger A. Priddat als wesentliches Merkmal der Familie an, dass sie auch eine Organisation ist - das kann jeder bestätigen, der mit Kindern zusammenlebt und deren Verpflichtungen und Interessen Rechnung tragen muss. 11 Böhme, Gernot: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Darmstädter Vorlesungen. edition suhrkamp 1301 (1985), S. 97 ff. (bzw. bereits S. 77 ff.: Geschlechtlichkeit). - Beachten Sie den Aphorismus Nr. 118! 10 zu Nr. 34: Moralische Gefühle und moralische Begriffe Ein kleiner Aphorismus, streng als Argument aufgebaut (Z. 1 ff.; 6 ff.; 13 ff.): 1. Moralische Gefühle werden von den Erwachsenen auf die Kinder übertragen. 2. Nachträglich wird irgendeine Begründung der Gefühle (Abneigungen) nachgeliefert. Also ist die Geschichte der moralischen Gefühle eine andere als die der Begriffe. Der Gedankengang besticht; aber zumindest die erste Prämisse ist nur zum Teil richtig. Würden nämlich alle moralischen Gefühle immer übertragen, könnte es keinen Wertewandel geben; der aber lässt sich heute etwa bei der Wertschätzung der Arbeit feststellen. Auch der zweite Satz ist nicht in der strengen Form zu halten, wie Nietzsche sie bietet: Die nachträgliche Begründung mag zwar oft willkürlich sein, etwa dass man vom Onanieren Schwindsucht bekommen könnte; es könnte aber auch sein, dass die nachträglich gelieferte Begründung richtig ist - welche falsche Begründung des Mordverbots wäre denn bekannt? Wenn die Schlussfolgerung trotzdem interessant und vermutlich auch richtig ist, müsste man dafür Gründe angeben können, die über Nietzsche Gedanken hinausgehen. Auf Anhieb fallen mir dafür drei Gründe ein. Den ersten hat Nietzsche selbst geliefert, als er zeigte, wie etwa Sokrates die alten Forderungen der Sittlichkeit neu und rational begründen wollte (Nr. 9, Z. 55 ff.). Der zweite Grund ergibt sich aus dem, was Wilhelm Emil Mühlmann die Überprägnanz moralischer Begriffe genannt hat12: So wahrhaftig, wie es der reine Begriff der Wahrhaftigkeit fordert, kann niemand sein, ohne dass er überall aneckte; an dem Begriff muss man aber festhalten, damit überhaupt klar wird, was mit Wahrhaftigkeit gemeint ist. Der dritte Grund ist der, dass manchmal zu vorhandenen Gründen die passenden Gefühle erst erfunden werden müssen, dass also etwa zur Sicherung der Erdölreserven der passende Unhold kommen muss, den man bekämpfen kann, um so auch an das Erdöl zu kommen. zu Nr. 35: Gefühle und deren Abkunft von Urteilen Hier geht es darum, die Einsichten des voraufgehenden Aphorismus auszuwerten. Wenn nämlich Gefühle vererbt sind, ist es zumindest leichtfertig, die gängige Mahnung „Vertraue deinem Gefühle!“ (gleich: entscheide aus dem Bauch!) zu befolgen. Wem aber sonst vertrauen? Nietzsche rät: auf die Götter setzen, die in uns sind: auf unsere eigene Vernunft, auf unsere eigene Erfahrung. Wenn aber schon unsere Gefühle nicht die eigenen sind, wieso sollen dann unsere Vernunft und Erfahrung uns zu eigen sein? Sozusagen als letzte feste Größen? Wenn einmal das Misstrauen erwacht ist, kann man es auch nicht mit einem Hinweis auf die eigenen Götter besänftigen. Nietzsche hat zur Begründung den Begriff des intellektuellen Gewissens13 12 13 Der Mensch als Kulturwesen. In: Homo Creator. Darmstadt 1962, S. 120-122. Die Fröhliche Wissenschaft, Nr. 335. eingeführt: Auch seinem eigenen Gewissen kann man nicht vertrauen, ohne es zu prüfen. So bleiben für uns die programmatischen Fragen zu bedenken: Wie können wir sichern, dass wir wirklich Erfahrungen machen? Wie können wir sichern, dass wir tatsächlich vernünftig argumentieren und denken? zu Nr. 38: Die Triebe durch die moralischen Urteile umgestaltet Nietzsche nennt als Beispiele für das, was er denken will, Feigheit und Demut; Neid; Hoffnung; Zorn. Für die drei letzten Emotionen weist er nach, dass sie von verschiedenen Völkern zu verschiedenen Zeit unterschiedlich eingeschätzt worden sind (ab Z. 12); für das Paar Feigheit-Demut meint er den gleichen „Trieb“, jedoch unterschiedlich bewertet, nachweisen zu können (Z. 1 ff.). Der Begriff des Triebs ist nicht unproblematisch, wenn man ihn auf den Menschen anwendet; in vielen Lehrbüchern der Biologie taucht er überhaupt nicht mehr auf. Gleichwohl ist nicht zu leugnen, dass „es“ oft Menschen dazu drängt oder treibt, etwas zu tun oder zu sagen. Dass derart unwillentlich-triebhaftes Verhalten keinen „moralischen Charakter“ hat (Z. 7), ist trivial; ob es auch frei von jeder Beziehung auf das Empfinden von Lust und Unlust ist, sei dahingestellt. Interessanter ist die Beobachtung, dass so tiefgehende Emotionen wie Hoffnung oder Neid in der Kulturgeschichte anders bewertet und anders gepflegt worden sind. Wenn Nietzsche „die Sitte“ für die Unterschiede in deren Bewertung verantwortlich macht, wird er damit wohl sagen wollen: Schert euch nicht um das Urteil der Sitte, lebt eure Emotionen!14 Man könnte den gleichen Sachverhalt anders werten: als Anzeichen dafür, dass wir nach den Metzeleien des 20. Jahrhunderts hoffen dürfen, dass wir Menschen auch human miteinander umzugehen lernen könnten. Das möchte ich am Beispiel des Zorns aufzeigen. Im Alten Testament gibt es viele Aussagen über den Zorn Gottes; als Beispiel nenne ich eine Stelle aus dem Propheten Jesaja: „Seht, der Tag des Herrn kommt, voll Grausamkeit, Grimm und glühendem Zorn; dann macht er die Erde zur Wüste, und die Sünder vertilgt er. (...) Dann bestrafe ich den Erdkreis für seine Verbrechen und die Bösen für ihre Vergehen. Dem Hochmut der Stolzen mache ich ein Ende und werfe die hochmütigen Tyrannen zu Boden.“ (13,9 ff.) Gottes Zorn gilt als Reaktion auf die menschliche Sünde; sein Zorn wird zu einer totalen Bedrohung der menschlichen Existenz. Hier fällt mir eine Parallele auf zu dem, was Rudolf Bilz die Schuld-Angst der Menschen nennt; die hat ihre Vorstufe in einem Mobbingverhalten von Tieren, etwa Krähen, die an einer „anders“ aussehenden Krähe Anstoß nehmen und sie ausmerzen. Auch Menschen seien von „von diesem 14 Das ergibt sich aus dem, was er zur Sittlichkeit der Sitte sagt (etwa Nr. 9) dagegen spricht er in Nr. 35! Ausmerze-Schema geplagt“; wir seien auf einen Uniformismus sowohl des Aussehens wie des Norm-Verhaltens erpicht.15 Gegen Nietzsche meine ich, dass der zornige Gott Symbol der Gemeinde ist, die jeden Abweichenden ausmerzt. Ich habe die Hoffnung, dass eine „vernünftige“ Sitte diesen „tierischen“ Antrieb des Ausmerzens dämpfen, mildern kann. Gegen Nr. 38 ist (mit Nr. 202) zu sagen: Folgt nicht euren Impulsen des Zorns und des Ausmerzens! zu Nr. 44: Ursprung und Bedeutung Unbestimmt genug spricht Nietzsche 1881 von dem, was die Forscher früher zu finden meinten, „wenn sie auf dem Wege zum Ursprung der Dinge waren“ (Z. 3). Vielleicht spricht er von Forschern, welche im Interesse einer Renaissance, also einer Wiedergeburt der klassischen Anfänge zu forschen bestrebt waren, oder im Sinn einer Reformation der im Lauf der Zeit verkommenen Kirche. Diese Forscher setzten nach Nietzsche voraus, „von der Einsicht in den Ursprung der Dinge müsse des Menschen Heil abhängen“ (Z. 6 f.); im Beispiel gesagt, man müsse wissen, wie die Urchristen gelebt und geliebt und geglaubt haben, und man müsse in diese Urgemeinde eintauchen und daraus Kraft und Leben schöpfen. Vielleicht spricht er auch von Leuten, die zu wissen meinen, was „deutsch“ ist, wenn sie die Geschichte des Wortes verfolgen, oder von Forschern, denen das „missing link“ zwischen Tier und Mensch alles ist. Dagegen stellt Nietzsche seine These: „Mit der Einsicht in den Ursprung nimmt die Bedeutungslosigkeit des Ursprungs zu.“ (Z. 12 f.) Das ist kein Forschungsergebnis, sondern eine programmatische These. Es ist das Programm, was er bereits zwei Jahre zuvor verkündet hat: „Wir müssen wieder gute Nachbarn der nächsten Dinge werden und nicht so verächtlich wie bisher über sie hinweg nach Wolken und Nachtunholden hinblicken.“16 Wolken und Nachtunholde, das waren für ihn etwa die Fragen, was nach dem Tod kommt, wie der Mensch sich mit Gott versöhnt „und wie diese Kuriosa lauten mögen“. Es sind also Fragen, die nicht nur für das wirkliche Leben bedeutungslos sind, sondern sogar den Blick auf dieses verstellen und dem möglichen Glück heute im Wege stehen. Und durch die Frage nach den „Ursprüngen“ entfernen wir uns von den nächsten Dingen - so verstehe ich Nietzsche Äußerung. Dass Nietzsche, um den Bann der Worte und den numinosen Zauber der Vorstellungen zu zerbrechen, selbst das historische Philosophieren, die Zersetzung der Begriffe und Empfindungen durch historische Aufklärung gefordert hat17, widerspricht dem Programm von Nr. 44 nicht. Im Gegenteil, beide Forderungen sind vom Interesse bestimmt, von der Last des Vergangenen frei zu werden. 15 Bilz, Rudolf: Urängste im Rahmen der sog. Daseins-Angst. In: Studien über Angst und Schmerz. stw 44, S. 175 ff. bzw. 177/79. - Die „Sünder“ weichen von der Norm ab, deshalb sind sie zu vertilgen. 16 Der Wanderer und sein Schatten, Nr. 16. 17 Menschliches, Allzumenschliches I, Nr. 1 und 2. zu Nr. 49: Das neue Grundgefühl: unsere endgültige Vergänglichkeit Dass wir endgültig vergehen, ist in der Tat ein neues Grundgefühl - neu in Europa, neu nach dem Sieg und der Ausbreitung des Christentums; in der Antike hatte es zumindest in intellektuellen Kreisen dieses Gefühl bereits gegeben. Epikur lehrte es: „Der Tod ist für uns ein Nichts; denn was der Auflösung anheimgefallen ist, besitzt keine Empfindung mehr, was aber keine Empfindung mehr hat, bedeutet für uns nichts mehr.“18 Im Christentum hat sich dagegen, in Verbindung mit einem christianisierten Platonismus, die Auffassung durchgesetzt, dass die Seele unsterblich ist, dass Gott die Erlösten in den Himmel aufnimmt, dass es ein „ewiges Leben“ gibt. Dagegen wendet sich Nietzsche, indem er die beiden Hauptstränge der Begründung solcher Annahmen kappt. Die „alte“ biblische Begründung operiert mit der Herkunft des Menschen aus Gottes Schöpferhand, genauer mit dem Titel „Ebenbild“ oder „Abbild Gottes“, der den Menschen laut Gen 1,26 verliehen ist und womit ihre herrschaftliche Stellung in der Natur begründet wird. Dem stellt Nietzsche die Evolutionstheorie entgegen, in deren vereinfachter Version die Menschen „vom Affen“ abstammen (vgl. Z. 4), woraus sich keine Ewigkeitshoffnungen ableiten lassen. Er wendet sich auch gegen alle optimistischen Hoffnungen auf einen „Fortschritt“ der Menschheit zu immer höheren Zielen oder Zuständen und begründet dies einmal mit der Tatsache, dass die uns wesentlich gleichen Ameisen und Ohrwürmer auch „keinen Übergang in eine höhere Ordnung“ (Z. 13 f.) kennen; allgemeiner gesagt, dass das Werden „das Gewesensein hinter sich her“ (Z. 16) schleppt. Was heißt das? Es heißt, dass alles Werdende nicht von dem loskommt, was es gewesen ist, dass also nichts wesentlich Neues entsteht. Warum fällt uns schwer, einfach zu glauben, was wir eigentlich wissen: dass auch wir Menschen in die Evolution der Lebewesen gehören, dass diese Evolution spätestens dann zu Ende geht, wenn die Sonne ausgebrannt ist, vermutlich schon vorher? Warum sprechen wir in Abschiedssituationen so gern vom „Wiedersehen“, etwa wie Werther, der im Tagebuch vom 10. September zweimal solche Äußerungen gegenüber Lotte berichtet: „Wir werden uns wieder sehen, wir werden uns finden, unter allen Gestalten werden wir uns erkennen. Ich gehe, ich gehe willig, und doch, wenn ich sagen sollte auf ewig, ich würde es nicht aushalten.“19 Dass wir es „nicht aushalten“ oder nicht auszuhalten meinen, ist der Grund dafür, dass wir trotz besserer Einsicht an alten Vorstellungen und Hoffnungen festhalten. Es ist der Schatten Buddhas, der noch 18 Epikur: Schriften. Über die irdische Glückseligkeit. Übertragen und eingeleitet von Paul M. Laskowsky. Wilhelm Goldmann Verlag: München o.J., S. 75. 19 Ausgabe mit Materialien im Ernst Klett Schulbuchverlag (eingeleitet von Doris Bonz), S. 59; ähnlich S. 57 und S. 121. Jahrhunderte nach seinem Tod gezeigt wird, wie Nietzsche später sagt20; es ist der Schatten des toten Gottes, den wir noch besiegen müssen, nachdem Gott selbst längst gestorben ist. zu Nr. 72: Das „Nach-dem-Tode“ Die Vorstellung, ewig in die Hölle kommen zu können, ewig leiden zu müssen, ewig verstoßen werden zu können, kann und muss Menschen beinahe wahnsinnig machen, wenn sie diesen Glauben wirklich teilen. Das ergibt sich aus einem Geflecht mehrerer Gründe: 1. Der Richter ist die Gottheit, und deren Maßstäbe sind unendlich fein; kein Mensch kann ihnen mit seiner mehr oder weniger ausgebildeten Charakterstärke genügen, jeder ist ambivalent auch in seinen guten Werken, also letztlich „böse“. 2. Die Gottheit ist allwissend und erkennt demgemäß auch verborgene Fehler und „Sünden“, von denen ich selber nichts weiß; sie weiß mehr, als ich wissen kann, und ich kann nie sicher sein, was sie weiß - oder vielmehr ich kann beinahe sicher sein, dass sie weiß, dass ich böse bin. 3. Gerade wenn ich versuche, besonders gut zu leben und das Geforderte nicht nur zu erfüllen, sondern in besonderem Maß zu erfüllen, werde ich dessen inne, dass ich nicht aufrichtig das Gute tun will, sondern insgeheim meinen Vorteil erhoffe und also auch im Gutsein böse bin. Tilman Moser spricht von der „Gottesvergiftung“ (1976), an der er gelitten hat; ich weiß aus eigener Erfahrung, wovon er spricht. Nietzsche nennt deshalb den Höllenglauben für die Kulte des römischen Reiches das fruchtbarste „Ei“ (Z.4), also Ursprung ihrer Macht: Wer die Ängste der Menschen erfolgreich bewirtschaft, gewinnt Macht über sie. Warum ist die Höllenangst eine so hervorragende Quelle der Macht? Die Gottheit braucht den Beweis ihrer Macht nicht anzutreten, kann ihn sogar „jetzt“ nicht antreten, kann ihn erst am Ende der Tage, nach dem letzten Gericht liefern; ähnlich ist es mit dem Versprechen, den Gläubigen den Himmel zu gewähren: Das Versprechen dieser Belohnung kann sich nicht verschleißen, da sie ja stets zukünftig verliehen werden wird. Ist also erst der Glaube an Himmel und Hölle verankert, dann wird er „ein erwünschtes Werkzeug“ (Z. 42) in der Hand nicht nur der Missionare, sondern aller religiösen Funktionäre. So nennt Nietzsche das Christentum und seine Repräsentanten „klug“ (Z. 10), dass sie dieses Machtmittel für sich ergriffen haben.21 Im Prozess der Aufklärung erleben die sich aufklärenden Subjekte Angst, wie Kant22 gezeigt hat: Die alten Machthaber machen ihren Untertanen auf bewährte Weise Angst; diese selbst tun wie Kinder die ersten Schritte in die Freiheit unsicher, da sie den Weg nicht kennen, den sie gehen werden. Wenn dann klar wird, dass uns nichts angeht, was nach 20 Die Fröhliche Wissenschaft Nr. 108. Ob die Religionsgeschichte der Höllenvorstellung in Judentum und Christentum genau so verlaufen ist, wie Nietzsche es darstellt, braucht hier nicht diskutiert zu werden. 22 Kant, Immanuel: Beantwortung der Frage: „Was ist Aufklärung?“ 21 dem Tod sein wird, dann ist das für vormals Verängstigte wirklich „eine unsägliche Wohltat“ (Z. 50). Nur so können sie, können wir aus dem Schatten des toten Buddha23 heraustreten; wir täten klug daran, nun nicht den von Presseorganen regelmäßig geschürten Weltuntergangsängsten zu erliegen.24 zu Nr. 76: Böse denken heißt böse machen Im Sinn der Überschrift enthält der erste Satz den Kerngedanken des Aphorismus: „Die Leidenschaften werden böse und tückisch, wenn sie böse und tückisch betrachtet werden.“ Das heißt: Leidenschaften sind zunächst nicht böse und tückisch; sie werden es erst, „wenn sie böse und tückisch betrachtet werden“ (Z.2). So wie dieser Satz da steht, sind „böse und tückisch“ adverbiale Angaben: Auf welche Weise werden die Leidenschaften betrachtet? Mit einem bösen Blick; es liegt an der Art des Schauens, was man sieht. Dass dieser Vorgang zu beklagen ist, liegt auf der Hand, weil er jeden Menschen betrifft - Nietzsche denkt konkret an das christianisierte Europa; an die Mächte Eros und Aphrodite; an das traurige Ergebnis, das er „christliche Verdüsterung“ (Z. 11) nennt. Über die Gründe dieser Verdüsterung sagt er hier nichts; in Nr. 72 hat er sich aber mit der Höllenangst als einer Machtquelle befasst. Sprechen wir also für ihn über Gründe und Motive der Verdüsterung. Ein Grund der christlichen Welt- und Leibfeindschaft ist sicher der eschatologische Fanatismus, der Jesus und den frühen Christen eigen war; so verbietet Jesus die Ehescheidung und setzt sie mit Ehebruch gleich (Mk 10,2 ff.), woraus im Matthäusevangelium der Rat wird, überhaupt nicht zu heiraten (Mt 19,10 ff.); Paulus wünscht sich, alle Christen wären ehelos wie er (1 Kor 7,7). „Denn ich sage euch, Brüder: Die Zeit ist kurz. Daher soll, wer eine Frau hat, sich in Zukunft so verhalten, als habe er keine, (...) denn die Gestalt dieser Welt vergeht.“ (1 Kor 7,29-31). Dieser Fanatismus lebte im 3. und 4. Jahrhundert in der ägyptischen Wüste bei den Einsiedlern wieder auf und verband sich später mit manichäischen Impulsen und einer platonisierenden Philosophie - ein komplizierter Prozess, der hier nur skizziert werden kann. Mindestens genau so interessant sind die Motive derer, die von der christlichen Verdüsterung profitieren: die kirchlichen Hirten und Oberhirten, welche die Höllenängste bewirtschaften, wie in Nr. 72 analysiert worden ist. Dass solche Ängste, die auf sexuellen „Verfehlungen“25 beruhen, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein erlebt 23 Siehe oben Nr. 49! Epikur geht einen anderen Weg: Er erklärt (etwa im Brief an Menoikeus) die Gottheiten nicht für tot, sondern für ewig selige Wessen, denen Zorn und Missgunst, also Strafen und Hölle, fremd sind und von denen nichts zu befürchten ist. 24 Aufbau des Aphorismus: Z. 1-13-23-37-46-51-52. 25 Jeder Katholik wusste, dass man in Gedanken, Worten und Werken „unkeusch“ sein konnte und dass es in sexualibus keine lässlichen Sünden gibt, nur Todsünden worden sind, weiß ich nicht nur aus eigener Erfahrung; es gibt eine Dokumentation, die 1972 im Herder-Verlag erschienen ist26 und bezeichnenderweise nach wenigen Wochen auf kirchlichen Druck vom Markt genommen wurde. Dass die Wirkung dieser Verteufelung nur komisch (Z. 23) sein und zu maßloser Überschätzung des Erotischen führen kann, ist ein für das 19. Jahrhundert erstaunlich hellsichtiges Urteil, welches heute auf allen TVKanälen bestätigt wird. Wie menschlich und klug sind dagegen die Reden in Platons „Symposion“, in denen der Gott Eros gepriesen wird; dort sagt Aristophanes am Ende seiner mythischen Rede, dass wir die zu uns passenden Geliebten finden, „wenn wir mit dem Gott [Eros] Freund geworden und mit ihm versöhnt sind“ (193 b). Wie dies möglich ist, müsste uns eine philosophische Lebenslehre sagen können - man vergleiche dazu auch Nr. 27! Es gibt eine berechtigte Einschränkung der sexuellen Leidenschaft, sagt Nietzsche; aber die (antike Tugend) „Mäßigung“ beruht nicht auf Feindschaft gegenüber dem Eros (Z. 13 ff.)! zu Nr. 106: Gegen die Definitionen der moralischen Ziele Wenn man über „das Ziel der Moral“ (Z. 2) nachdenkt, kann einem schwindelig werden; darüber haben schon Aristoteles und Kant und viele andere so viel nachgedacht und geschrieben, dass man sich gar nicht traut, ohne die Analyse ihrer grundlegenden Begriffe überhaupt etwas zu sagen. Außerdem, was ist mit diesem Ziel überhaupt gemeint? Ist es die soziale Funktion, welche die anerkannten moralischen Grundsätze in einer Gesellschaft haben, also die Milderung von Spannungen, Sicherung des Bestands? Oder ist das Ziel gemeint, welches ich einer idealen Moral zubillige? Oder auch das Ziel, das ich mit der Erziehung meiner Kinder im Auge habe? Ziele über Ziele, wohin man blickt: Welches ist gemeint? Die von Nietzsche diskutierte Formel „Erhaltung und Förderung der Menschheit“ (Z. 2 f.) ist unbestimmt genug und wird von ihm auch richtig kritisiert. Dass Moral den Weg zum Glück weise oder sogar baue, glaubt heute niemand mehr; Sigmund Freud hat „Das Unbehagen in der Kultur“, welche von den großen Verboten, also von Moral bestimmt ist, untersucht. Ihm hat Richard Huber in einem lesenswerten Aufsatz widersprochen: Ein kurzes Glück genieße der, welcher überlegen ist oder den Kampf gewonnen hat; dauerhaftes Glück sei an einen höheren Grad von Bewusstheit und an die Sublimierung vitaler Impulse gebunden.27 Wen meint Nietzsche mit dem moralischsten Menschen, dessen Moral „tiefste Unseligkeit“ (Z. 25 f.) mit sich bringt? Meint er Jesus, den wir zu mit zugehöriger Höllenstrafe. [Wer bei einer Abtreibung mitwirkt, wird automatisch exkommuniziert, während Hitler immer noch auf seine Exkommunikation wartet.] 26 Leist, Fritz: Der sexuelle Notstand und die Kirchen. Verlag Herder: Freiburg 1972. 27 Huber, Richard: Instinkterfüllung und corticale Hemmung. Biologische Aspekte menschlichen Glücks. In: Was ist Glück? Ein Symposion. Mit Beiträgen von Friedrich Georg Jünger u.a. dtv: München 1976, S. 127 ff. den eschatologischen Fanatikern gezählt haben, weil bei ihm der Weg zur Erlösung von der Welt, ihren Genüssen und Gefahren wegführen muss?28 Vielleicht erledigt sich die Frage nach dem Ziel der Moral, wenn man sieht, dass es „die Moral“ nicht geben kann - eine Einsicht, zu der Nietzsche mit dem Lob des Polytheismus29 einen entscheidenden Beitrag geleistet hat: Wenn die Welt, selbst die Menschenwelt nicht mehr auf einen letzten Einheitspunkt bezogen werden kann - er heiße nun GOTT oder VERNUNFT -, zeigen sich die vielen alten „Götter“ wieder und beanspruchen, einen Lebensbereich zu beherrschen, das heißt dann auch: ihm sein Recht zu gewähren, sei es Liebe oder Krieg, Betrug oder Tapferkeit. Wem es nicht gelingt, für alle Menschen verbindlich jenen einen letzten Bezugspunkt aufzuzeigen, wird sich wie Nietzsche mit der Relativität aller Moral, der Unbestimmtheit des Glücks und der Geltung eines toleranten Rechts begnügen müssen. zu Nr. 108: Einige Thesen Hier werden die Gedanken von Nr. 106 weitergeführt. Dass man niemandem Vorschriften machen kann, was er tun soll, um glücklich zu werden, ist zwar für alle Erzieher schwer zu akzeptieren, aber bereits von Kant theoretisch begründet worden: „weil Glückseligkeit nicht ein Ideal der Vernunft, sondern der Einbildungskraft ist“30; das heißt bei Kant, dass alle „Elemente“ des glücklichen Lebens aus der Erfahrung stammen, dass aber zur Idee der Glückseligkeit ein absolutes Ganzes gehört - ein Widerspruch in sich, weil alle Gegebenheiten unseres Lebens nicht „absolut“ sein können. Nietzsche argumentiert dahin, dass das Glück eines Menschen „aus eigenen, jedermann unbekannten Gesetzen“ (Z. 3) hervorquelle. Was meint er damit? Vielleicht die Tatsache, dass man sein Glück nicht wie das Abitur oder einen Autokauf unmittelbar als Ziel anstreben kann, sondern dass es sich sozusagen nebenher einstellt, wenn man das Abitur besteht oder ein Auto kauft oder... - man weiß vorher nicht, wie glücklich man sein wird; genau so wenig kann man anstreben, sich an einem Tag oder in einen Menschen zu verlieben, auch wenn in manchen Annoncen gerade dieser Wunsch gegen jede Einsicht ausgesprochen wird. Neu ist hier der Versuch, das Glück nicht als „Ziel“ einer Entwicklung zu denken (Z. 13 ff.); dieser von Nietzsche abgelehnte Gedanke ist dem 19. Jahrhundert, vielleicht auch noch dem Optimismus der Aufklärung verpflichtet. Nietzsche lehnt es mit Recht ab, niederes gegen höheres Glück zu verrechnen, weil es selbst bei Entwicklungen nur möglich ist, das jeder Stufe eigentümliche Glück zu erlangen. Auch dieser Gedanke ist für „Erzieher“ bedenkenswert; selbst wenn man Stufen einer Entwicklung kennt oder zu kennen meint, darf man niemand das Recht verwehren, 28 Vgl. dazu Nr. 76! Die Fröhliche Wissenschaft, Nr. 143. Vgl. auch „Menschliches, Allzumenschliches“ I, Nr. 618. 30 Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Akademie-Ausgabe S. 418. 29 seinen eigenen Weg zu gehen. Wenn man Kant gelesen hat, weiß man jedoch, dass es Ratschläge gibt, „von denen die Erfahrung lehrt, daß sie das Wohlbefinden im Durchschnitt am meisten befördern“31. Wenn Nietzsche den Unterschied, ob man ein Ziel vorfindet oder empfiehlt, betont, versucht er wohl nicht, sich selbst Klarheit zu verschaffen, sondern seinen Zeitgenossen Illusionen zu nehmen. Dabei hat er in Wilhelm Ludwig Wekhrlin einen Mitstreiter, der den wunderbaren „Monolog einer Milbe im siebenten Stock eines Edamerkäses“ (1784) geschrieben hat. Der Leser erfreut sich an der Arroganz einer philosophierenden Milbe, welche ganz naiv alle Dinge auf sich bezieht, sich in der besten aller möglichen Welten wähnt und noch zum Schluss, als sie mitsamt dem Käse gegessen wird, „behauptet, ihre Erhaltung, ihr Wohl sey der Endzwek der Natur“32. Leider erfreuen sich nur solche Leser an diesem Monolog, welche ohnehin den Gedanken an ein „Ziel“ der Weltgeschichte aufgegeben haben - die anderen erreichen selbst Nietzsche und Wekhrlin mit ihren Argumenten nicht. zu Nr. 115: Das sogenannte „Ich“ Hier betritt Nietzsche das Feld der Sprache: ein weites Feld, auf dem er wesentliche Entdeckungen gemacht hat: „Überall, wo die Uralten ein Wort hinstellten, da glaubten sie eine Entdeckung gemacht zu haben. (...) Jetzt muß man bei jeder Erkenntnis über steinharte verewigte Worte stolpern, und wird dabei eher ein Bein brechen als ein Wort.“33 Beachten wir den dafür verdienten Lorbeerkranz einmal nicht und prüfen stattdessen, wie richtig die neu geäußerten Gedanken sind! Wir beginnen mit dem ersten, dass für „innere“ Erlebnisse und Vorgänge „Worte allein für superlativische Grade dieser Vorgänge und Triebe da sind“ (Z. 4 f.). Diese Behauptung ist richtig und falsch zugleich; richtig ist sie insofern, als wir häufig Ja-nein-Entscheidungen treffen müssen, wofür wir klare Kriterien brauchen: Wenn es also kalt ist, muss man die Fenster schließen; wenn es dagegen warm ist, kann man sie öffnen oder offenstehen lassen. Dieses Beispiel zeigt, dass es vor allem um die Alternative warm/kalt geht, dass es aber durchaus für unser Empfinden die Reihe „heiß-warm-mild-frisch-kühl-kalt-eisig“ gibt; dafür gibt es auch die passenden Wörter. Auch wenn dieses Beispiel nicht für innere Vorgänge steht, gilt dort Ähnliches; aber wir wollen die feinen Nuancen meistens nicht wahrhaben, obwohl wir sie wahrnehmen oder zumindest wahrnehmen können. „Liebst du mich? Oder bin ich dir gleichgültig?“ Wenn man das Verhältnis nicht gefährden will, kann man nur sagen: „Ich liebe dich.“ Man könnte natürlich viel mehr und auch Genaueres sagen; ja, man müsste zuerst 31 a.a.O., S. 418. Arbeit mit Texten S II. Hrsg. von Robert Ulshöfer. Schroedel: Hannover 1993, S. 146. 33 Morgenröte, Nr. 47. - In Nr. 117 zeigt er an weiteren Beispielen ( etwa „hart/weich“), auf welchen „Vorurteilen“ die Sprache aufgebaut ist - wenn man ihr wörtlich glaubt. 32 fragen: „Was meinst du damit?“ Aber wenn so fragte, wäre schon Streit da. Jedoch wäre man „natürlich“ imstande zu sagen, dass einem auch die Arbeit wichtig ist, dass man sich für manches nicht so dringend wie der Partner interessiert, dass auch andere Menschen schön oder faszinierend sind - das alles weiß man, und man könnte es sagen; aber man kann es nicht sagen, weil der andere es nicht hören, nicht ertragen kann. Nietzsche selbst rät dazu, „auf die leise Stimme der verschiedenen Lebenslagen zu hören“ und sich „nicht als starres beständiges eines Individuum“ zu behandeln34. Es liegt an der menschlichen Eitelkeit, manches nicht hören zu „können“, auch wenn die feinsten Gespinste uns durchaus verborgen sein mögen. Damit verträgt sich der Gedanke, dass wir uns alle verkennen (Z. 19 ff.). Ob die falsche Meinung von uns den Charakter bestimmt, bezweifle ich; aber mir leuchtet ein, dass sie unser Schicksal mitbestimmt. Wir handeln und planen täglich ja mit einer bestimmten Auffassung von uns selbst; wenn nun diese Auffassung einseitig oder sogar falsch ist, wirkt sich das auf den Erfolg unseres Handelns, damit auch auf unser Schicksal aus. Das so genannte „Ich“ ist vielleicht weniger das nicht erkannte als das nicht angenommene Ich; doch hier sind die Grenzen fließend, weil als ein weiterer Filter die Zensur wirkt, welcher die anderen sich unterwerfen, wenn sie uns ihre Meinung sagen. zu Nr. 117: Im Gefängnis Die Metapher „Gefängnis“ beherrscht den Aphorismus Nr. 117: entlaufen (Z. 4), einschließen (Z. 6), Gefängnismauern (Z. 7 f.), Entrinnen (Z. 26, einschließlich der Schlupf- und Schleichwege). Aber was ist der Gedanke? Es ist die Einsicht, dass unser Erkennen durch das Verhältnis von Auge und Horizont begrenzt ist; wer sich Erkenntnis der wahren Welt erhofft, muss diese Begrenzung als Gefängnis erleben. Wie weit ist der Horizont vom Auge entfernt? Was liegt alles innerhalb unseres Horizonts? Das, was „unsere Sinne“ (Z. 8) uns erschließen. Es liegt in der Logik des Bildes, dass der Horizont und der darin erschlossene Raum jedem Wesen „eigentümlich“ (Z. 5) ist; eigentümlich, würden wir heute ergänzen, derart, dass eine Gattung darin leben, also überleben und sich entfalten kann, bis sie untergeht. Nietzsche klagt, es sei ein kleiner Raum: ein Gefängnis. Gefängnis ist der Raum aber nur für den, welcher ihn verlassen will. Wollen wir das? Will ich das? Der zweite Gedanke besagt, dass wir innerhalb dieses Raumes alles Wahrnehmbare „messen“ (Z. 8); was wir also messend empfinden - und empfinden ist wesentlich messen, wie in Nr. 118 entfaltet wird -, das benennen wir so, als sei es eine „Eigenschaft“ oder Qualität der Dinge: „groß/klein“, „hart/weich“ und so weiter: „alles Irrtümer an sich!“ (Z. 11) Stellen wir die erste Gegenfrage: Genügt es nicht zu wissen, dass eine Hausmauer und ein Laternenpfahl „hart“ sind, dass man also besser nicht dagegen läuft, wenn man sich kein Loch im Kopf holen will? Muss ich denn unbedingt wissen, wie die Mauer „an sich“ ist? Gefängnis ist unser Raum 34 Menschliches, Allzumenschliches. Bd. I, Nr. 618. nur für den, der ihn verlassen will - wollen wir das wirklich? Genügt es nicht zu wissen, dass unser Wissen begrenzt, aber durchaus nützlich ist? Genügt es nicht, den Zauber des „ist“ zu durchschauen? Andere Sinnesorgane würden uns einen anderen, jedoch wiederum prinzipiell begrenzten Raum erschließen (Z. 18 ff.). Nietzsche meldet sich mit einem weiteren Gedanken, dass wir nämlich unser Leben an dem messen, was durchschnittlich möglich ist (Z. 11-14). Das ist aber ein anderer Aspekt, der nicht in diesen Zusammenhang gehört: dass man sich mit anderen vergleicht, um daraus Zufriedenheit oder Unglück zu schöpfen. Mit dem Bild vom Netz schließt Nietzsche den Aphorismus. Es leuchtet ein, dass die Art des Netzes und die Weite der Maschen bestimmen, was wir fangen; auch ist wichtig, wo wir das Netz auswerfen und zu welchem Zweck; vielleicht können wir sogar neue Netze bauen? Sind wir darum Spinnen (Z. 27)? Ja, wir sind Spinnen, weil wir Netzbenutzer sind. Nein, wir sind keine Spinnen, weil Netzbenutzer nicht zu verachten sind, nicht Ungeziefer sind. Nietzsche selbst hat in einem großen Aphorismus gefordert, dass wir uns „über die ersten und letzten Dinge“35 nicht den Kopf zerbrechen sollen: „Wir müssen wieder gute Nachbarn der nächsten Dinge werden und nicht so verächtlich wie bisher über sie hinweg nach Wolken und Nachtunholden blicken.“36 Wo Nietzsche Recht hat, hat er Recht - gegen alle metaphysischen Träumer, aber auch gegen Nietzsche. zu Nr. 118: Was ist denn der Nächste? In diesem Aphorismus wird zunächst nur der Gedanke von Nr. 117 fortgeführt oder ausgeführt: dass wir von unserem Blickpunkt aus „die Welt“ vermessen. In Nr. 118 wird jedoch vorgeführt, wie wir die Welt ertasten: dass wir den Nächsten nur darin begreifen, dass er die Ursache der an uns erlebten Veränderungen ist (Z. 1-5). Unser ganzes Wissen von ihm - nur eine Rekonstruktion aufgrund der an uns selbst in der Berührung erlebten Eindrücke! Und dann die praktische Konsequenz: „Wir legen ihm die Empfindungen bei, die seine Handlungen in uns hervorrufen“ (Z. 5 f.); wer uns also verärgert, der ist uns böse, der mag uns nicht leiden, und wer uns erfreut, der liebt uns vermeintlich. Dass der Stein, an dem wir uns stoßen, nicht von einem Geist beherrscht und gelenkt wird, wissen die meisten; die magische Sicht der Welt ist bei uns weithin überwunden, sofern wir nicht von Schicksalsschlägen getroffen werden - „Schläge“, da haben wir noch die alte Magie! Da fällt es uns immer noch schwer, auf die dumme Frage zu verzichten: Warum trifft es gerade mich, gerade meine Familie? Da spuken noch überirdische Mächte in den Köpfen herum; die Astrologen und ihre Lügengenossen verdienen auch heute nicht schlecht. Kaum jedoch ist diese Sicht überwunden, wenn wir unseren Nächsten, an den wir im Gefühl gebunden sind, als die absichtlich wirkende Ursache unserer Empfindungen betrachten und behandeln: Wie viele Irrtümer in 35 36 Der Wanderer und sein Schatten, Nr. 16. ebenda. Liebe und Hass wurzeln hier! Von hier aus müsste man den Aphorismus Nr. 27 noch einmal neu bedenken: wie wir den Nächsten „zu einem Satelliten unsres eigenen Systems“ (Z. 8) bilden! Erst recht werden die Verhältnisse dadurch kompliziert, dass auch der (oder die) Nächste mich zu seinem (oder ihrem) Satelliten macht - und dass dann die beiden wechselseitigen Satelliten-Bilder nicht zueinander passen, wenn man sie zur Deckung bringen will; da sie jedoch Bilder des gleichen Bereichs, des gleichen Verhältnisses sind, da ferner beide „Sonnen“ aus ihrer Sicht handeln und zudem erwarten, dass der Satellit der eigenen Sicht entsprechend fliegt, kann es fast nur zu Unstimmigkeiten zwischen denen kommen, die einander Sonne und Satellit sind. Der Amerikaner Irvin Yalom hat in seinem Roman „Und Nietzsche weinte“ (1992, deutsch 1994) gezeigt, wie schwer wir uns von solchen Satellitenbildern lösen - im Roman Dr. Breuer vom Bild Berthas, Nietzsche vom Bild Lous; am Ende der heilsamen Begegnung ist aus dem Machtkampf der beiden Giganten ein wirkliches Gespräch geworden, und Breuer bekennt: „Doch nun, Friedrich, ist, was als Maskerade begann, zur Redlichkeit geläutert.“37 Das mag selten gelingen, aber vielleicht kann es doch wahr werden; dann sprechen wir von Freundschaft. In vielen Geschichten, vom Jonas der Bibel bis zum Großvater und seinem Enkel bei den Brüdern Grimm, wird erzählt, wie es gegen zähen Widerstand gelingt, den Nächsten aus seiner Satellitenrolle zu entlassen, indem man seine Perspektive auch im Fühlen einnimmt und seine Sicht mit der eigenen ausgleicht: Humanität auf der Grundlage gegenseitiger Anerkennung. zu Nr. 119: Erleben ist Erdichten Am besten verschafft man sich bei einem so großen Aufsatz zuerst einen Überblick, damit man sich im Gestrüpp der 101 Zeilen nicht verheddert. Nietzsche beginnt also mit einer Beschreibung des uns unbekannten TriebLebens (Z. 1-20); danach deutet er die Träume als kompensatorische Befriedigung hungriger Triebe (Z. 21 ff.), wobei er ins Erkenntnistheoretische umschwenkt: Träume seien „Interpretationen unserer Nervenreize während des Schlafens“ (Z. 46 f.). Dann führt er die Metaphern „Text und Kommentar“ ein (ab Z. 51) und tut den entscheidenden Schritt seines Gedankengangs: Der Nacht für Nacht gleiche Text werde jeweils verschieden interpretiert, und zwar von der Vernunft, aber unter dem Einfluss wechselnd starker Triebwünsche; Vernunft erdichte nur vorgestellte „Ursachen“ dieser Nervenreize (Z. 5158). Mit diesem Modell von (gleichem) Text und (erdichtetem) Kommentar, der von den Trieben souffliert wird, wechselt Nietzsche die Bühne. Das wache Leben könne nach dem gleichen Modell verstanden werden (Z. 58 ff.): Zwar gibt es dort nicht die gleiche Freiheit der 37 Yalom, Irvin D.: Und Nietzsche weinte. Ins Deutsche übertragen von Uda Strätling. btb 1996, S. 421. Interpretation, aber zwischen Wachen und Schlafen gebe es „keinen wesentlichen Unterschied“ (Z. 63). Diese Behauptung wird durch zwei Beispiele gestützt (Z. 71 ff. und Z. 86 ff.). Den Schluss bildet das Fazit, welches „die dichtende Vernunft“ (Z. 52 f.) verewigt und wo Nietzsche fragend behauptet: „Erleben ist ein Erdichten?“ (Z. 101) - seine behauptende Aussage (Z. 99 f.) ist allerdings vorsichtiger formuliert. Was bedeuten diese Gedanken? Nietzsche sprengt hier die Fundamente der alten abendländischen Erkenntnistheorie, welche auf der klaren Unterscheidung von Wachen und Schlafen beruhte: Im Traum erlebt man phantastische Bilder; aber den wach Seienden ist die Welt auf gleiche Art erschlossen; noch Descartes hat die Sätze dieses Glaubensbekenntnisses wiederholt, auch wenn er in der Serie seiner Zweifelsgründe behauptet, „dass Wachsein und Träumen niemals durch sichere Kennzeichen unterschieden werden können“38. Wenn wir die psychologische Traumtheorie hier beiseite lassen, sind folgende Fragen zu erörtern: 1. Was taugt die Metapher von Text und Kommentar? 2. Lässt sich mit dieser Metapher (auch) das wache Erleben verstehen? Der Metapher „Text“ liegen verschiedene Annahmen zu Grunde, deren wichtigste lautet: Es ist Nacht für Nacht der gleiche Text („sehr ähnlich“; Z. 52), welcher jeweils verschieden interpretiert wird, und zwar unter dem Einfluss des jeweils zufällig dominierenden Triebs. Dieses Axiom ist fragwürdig, weil ja der Text uns gar nicht zugänglich ist, wenn Nietzsche mit dem Modell von Text und Kommentar Recht hat: Wir kennen nur die phantastischen Kommentare, mehr nicht; wir können also überhaupt nicht feststellen, ob die wesentliche Annahme vom stets gleichen Text zutrifft. Auch das erste Beispiel, welches auf unterschiedliche Verarbeitungen des gleichen Erlebnisses abzielt, ist fragwürdig: Werden Menschen auf ähnliche Begebenheiten meist nicht gleichartig reagieren: erzürnt oder freundlich oder ironisch, also nicht nach der jeweiligen Triebkonstellation, sondern nach dem, was man Charakter nennt? In diese Richtung weist auch eine Beobachtung, die ich selbst an meinen Träumen mache: Immer wieder träume ich von einer bestimmten Lebenssituation, dass ich nämlich im Theologenkonvikt vor der Frage stehe, ob ich bleiben oder die Ausbildung zum Priester abbrechen soll; anders als damals in meinem Leben entscheide ich mich im Traum, den vermeintlichen Gewissensforderungen zu widerstehen und die Ausbildung zum Priester abzubrechen. Diese Beobachtung zeigt, dass es wiederkehrende Träume gibt und dass diese nicht nur (!) von der Macht der Triebe interpretiert werden - es sei denn, man fasste den Begriff „Trieb“ so weit, dass die ganze Lebensgeschichte hineinpasst. Die zweite Frage (‚Lässt sich mit dieser Metapher auch das wache Erleben verstehen?‘) wird von Nietzsche eher vorsichtig beantwortet, indem er zugibt, dass wir im wachen Leben nicht die gleiche Interpretationsfreiheit haben wie im Schlafen - warum denn nicht? Und dass wir heute nicht die gleichen phantastischen Weltdeutungen vertreten 38 Descartes: Meditationen über die Grundlagen der Philosophie I 5; in der vierten Meditation muss allerdings wieder das, „was ich so klar einsehe“, wahr sein (IV 10). können wie Menschen anderer Kulturstufen - warum denn nicht? Wollen wir denn vergessen, was wir bei Nietzsche über den Wert der Methoden gelesen haben, mit Hilfe derer wir auf Überzeugungen verzichten können?39 Muss es nicht einen feststellbaren Unterschied zwischen Wachen und Träumen geben, da wir doch geträumte Gehalts- oder Preiserhöhungen von realen unterscheiden können? Anderseits ist es nicht leicht, die den Katholiken und den Moslems, den Amerikanern und den Terroristen, den Israelis und den Palästinensern gemeinsame Welt zu finden und zu beschreiben. Unser Erleben ist also ein Erdichten, aber eben nicht nur! Das weiß Nietzsche natürlich auch; er ist vorsichtig genug anzudeuten, dass die nächtlichen Texte „im allgemeinen (...) sehr ähnlich“ (Z. 51 f.) sind; für den Gedankengang ist jedoch erforderlich, dass sie gleich sind. Auch zum Schluss legt Nietzsche es durch die Satzform nahe, dass der Leser fragt, ob Leben nicht überhaupt ein Erdichten ist - er selber behauptet es nicht. Er denkt versuchsweise, nicht systematisch; er liebt „gefährliche Vielleichts“40. Da macht es ihm nichts aus, wenn der eine Gedanke einem anderen widerspricht: gut, dann widerspricht er ihm eben! Wieder eine andere Frage ist die, welche politischen Konsequenzen wir aus der Einsicht ziehen sollen, dass unser Erleben teilweise ein Erdichten ist. Ich meine dies: Unser Bemühen sollte dahin gehen, die Traumelemente des Erlebens in wichtigen Situationen aufzuspüren - auf methodisch gebahnten Wegen. Was weiter zu tun ist, ist zu Nr. 118 bereits gesagt worden. zu Nr. 133: „Nicht mehr an sich denken“ Viele große Gedanken findet man in diesem einen Aufsatz über das so genannte Mitleid: dass wir dabei unbewusst an uns selbst denken (Begriff des unbewussten Denkens!); dass unser erlebtes Leid nicht das des anderen, des Leidenden sein kann; dass wir nicht nur aus einem einzigen Motiv handeln; dass wir beim Handeln „aus Mitleid“ auch einem Antrieb der Lust nachgeben; dass die Sprache mit dem einen Wort „Mitleid“ die Vielfalt der Motive verdunkelt; dass „gut“ und „böse“ zu verschiedenen Zeiten das gleiche Handeln bewerten können - aus anderer Perspektive. Jeder dieser Gedanken verdient bedacht zu werden, jeden wird man im Wesentlichen akzeptieren können. Richten wir unser Augenmerk also auf etwas anderes: Wir können hier studieren, wie Nietzsches Denken im Fluss ist, alte Gedanken wie Steine mit sich schleppt, sie abschleift, abrundet, dabei neuen Zielen zustrebt. Gleich das erste Beispiel erinnert an einen Aphorismus von 1878, dass man einem Ertrinkenden noch lieber nachspringt, wenn andere zugegen sind, die es nicht wagen41; damit ist auch schon der Antrieb der Lust nachgewiesen, von dem Nietzsche Z. 37 spricht, oder dass wir auch beim vermeintlich uneigennützigen Handeln sehr wohl unbewusst an uns selbst 39 Menschliches, Allzumenschliches I, Nr. 629 ff. Jenseits von Gut und Böse, Nr. 2. 41 Menschliches, Allzumenschliches I, Nr. 325. 40 denken (Z. 10). Im gleichen Buch hat er auch gezeigt, wie Mitleid zu erweisen untergründig vom Gefühl der eigenen Macht begleitet ist42. Damit war zugleich erwiesen, dass wir nicht nur aus einem einzigen Motiv handeln (Z. 35 ff.); als Theorie war bereits 1878 formuliert, dass alle unsere Motive aus den gleichen Wurzeln wachsen, sodass es zwischen guten und bösen Handlungen „keinen Unterschied der Gattung, sondern höchstens des Grades“ gibt43. Dass die Sprache für diese Vielfalt von Motiven nur ein einziges Wort zur Verfügung stellt - Nietzsche spricht bildhaft vom polyphonen Wesen -, ist der schönste Beweis für die oben aufgestellte These von der Existenz der „Vorurteile, auf denen die Sprache aufgebaut ist“44. Von Schopenhauer hat Nietzsche viel gelernt, vor allem den Primat des Willens vor dem Intellekt, der dann bei Nietzsche zum Primat der Triebe wird; dass er sich mit seinem „Lehrer“ immer wieder auseinandersetzt, sich von ihm absetzt, gehört zum Bestreben, selber zu denken und den eigenen Weg zu finden. Hier beruft er sich gegen Schopenhauers Theorie des Mitleids (Z. 52 ff.) auf die Erfahrung (Z. 47 ff.). Wenn Nietzsche von den Menschen ohne Mitleid spricht (Z. 58 ff.), meine ich, er zeichne ein ideales Selbstportrait. In denen, die das Mitleid preisen und Mitleid „gut“ nennen, fertigt Nietzsche schon eine Skizze derer an, welchen er später den Sklavenaufstand in der Moral vorwerfen wird45; die anderen, die männlich Harten sind die Vorboten eines neuen Adels, der Vornehmen, die ihre Maßstäbe durchsetzen werden46. „Man muß sich selber lieben lernen - also lehre ich - mit einer heilen und gesunden Liebe: daß man es bei sich selber aushalte und nicht umherschweife. Solches Umherschweifen tauft sich ‚Nächstenliebe‘: mit diesem Wort ist bisher am besten gelogen und geheuchelt worden, und sonderlich von solchen, die aller Welt schwer fielen.“ Also sprach Zarthustra47, Nietzsches prophetische Stimme; Schluss mit Lüge und Heuchelei, das ist ein Hauptmotiv von Nietzsches Denken; da ist er unserer dauernden Zuneigung sicher. Übrigens war sich Nietzsche der Tatsache bewusst, dass er häufig alte Gedanken neu formulierte, erneut bedachte: „Im Gebirge der Wahrheit kletterst du nie umsonst: entweder du kommt heute schon weiter hinauf oder du übst deine Kräfte, um morgen höher steigen zu können.“48 42 Ebenda, Nr. 50 und Nr. 103. Ebenda, Nr. 107. 44 Morgenröte, Nr. 115, Z. 1 f. 45 Jenseits von Gut und Böse, Nr. 195. 46 Ebenda, Nr. 257 ff.; Zur Genealogie der Moral. 47 Also sprach Zarathustra III (Vom Geist der Schwere, Nr. 2). 48 Vermischte Meinungen und Sprüche (heute in: Menschliches, Allzumenschliches II), Nr. 358. - Das Mitleid bedenkt Nietzsche erneut in „Die Fröhliche Wissenschaft“, Nr. 338. 43 zu Nr. 146: Auch über den Nächsten hinweg Zunächst vertritt Nietzsche hier die verbreitete Auffassung, dass man in seinem Handeln langfristige Erfolge anstreben soll. Das ist eine alte Erziehungsweisheit, wie sie schon im biblischen Buch der Sprichwörter gelehrt wird: „Wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater seinen Sohn, den er gern hat.“ (3,12) Was also kurzfristig Schmerzen bereiten mag, kann langfristig wohltätig wirken. Nur eine wirklich ganz „enge und kleinbürgerliche Moral“ (Z. 4 f.) könnte diese Einsicht leugnen. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter, der hier und heute dem Überfallenen hilft, wird auch bei kirchlichen Hilfswerken von der Spruchweisheit ergänzt, dass man dem Armen nicht einen Fisch geben, sondern ihn fischen lehren soll. Warum also viel Aufheben um etwas Selbstverständliches machen? Wenn ich richtig zähle, bringt Nietzsche vier Gründe dafür vor, dass man entfernte Zwecke „unter Umständen auch durch das Leid des anderen“ (Z. 7 f.) fördern darf: 1. Wir dürfen es, weil wir uns selbst so behandeln (Z. 10 ff.). 2. Am Beispiel der Fürsten kann man lernen, dass „allgemeinere Interessen“ das Opfer einiger Individuen rechtfertigen (Z. 15 ff.). 3. Das Gefühl, Opfer zu bringen und „gegen uns selber den Sieg erringen“ (Z. 27 f.) zu können, ist höher und wichtiger als die Überlegung, was dem Nächsten wohl oder weh tut (Z. 24 ff.). 4. In der Pose des Machthabers verzichtet der Vordenker Nietzsche auf Worte: „Ein Blick genügt, ihr habt mich verstanden.“ (Z. 35 f.) Nein, mir genügt der Blick nicht! Mir genügt auch nicht der dritte Grund, dass der Nächste überredet werden darf, eine Aufgabe zu erfüllen, „für die wir ihn benützen“ (Z. 26). Nachdem im 20. Jahrhundert unzählige Menschen angeblich im Dienst höherer Ziele von Linken wie Rechten geopfert wurden, werde ich bei solchen Formeln mehr als misstrauisch. Das Pathos des heroischen Untergangs, wir kennen es! Am stärksten ist noch der zweite Grund, dass der viel zitierten „allgemeinen Interessen wegen“ (Z. 17) von den Einzelnen Einschränkungen erwartet werden dürfen, auch Opfer. Da beginnt aber erst das Problem: Wie werden allgemeine Interessen ermittelt? Platon hat diese Frage so gelöst, dass er dem philosophischen König als dem Wissenden einen Erziehungsauftrag zuerkannt hat49; ob unsere Politiker tatschlich wissende Weise sind? Und selbst wenn die allgemeinen Interessen erkannt wären, auf welchem Weg wären sie durchzusetzen? Die Metapher des Pflügens (Z. 22 ff.) hilft nicht viel weiter. Bleibt der erste Grund. Da wird jedoch nur die notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung dafür, dass man von anderen Opfer fordern darf, genannt: dass man selbst bereit ist, Opfer zu bringen - auch sich selbst „aufzuopfern“ (Z. 15) und nicht nur in Machtkämpfen zu verschleißen. Alle vier Gründe zählen nicht wirklich. In politischen Fragen versagt Nietzsches Denkweise; sie kann sogar ideologisch missbraucht werden. 49 Platon: Politikos 292 b ff. (31. - 35. Kap.). Vermutlich steht er noch oder schon wieder im Schatten des toten Gottes50: Hatte im 18. Jahrhundert Gott selbst noch „Die Erziehung des Menschengeschlechts“51 in der Hand, so fordert Nietzsche gegen seine eigene Einsicht, dass man kein Ziel der Menschheit finden und benennen kann52, hier, der Philosoph müsse die Erziehung der Menschheit in die Hand nehmen und damit die Position Gottes einnehmen. Ich finde, wir sollten bescheidener sein. zu Nr. 149: Kleine abweichende Handlungen tun not! Wenn man die Überschrift liest, weiß man nicht recht, wovon die Handlungen ein bisschen abweichen sollen; wenn man aber den spöttischen Ton in den ersten Zeilen bemerkt hat, wird klar, worum es Nietzsche geht: dass man Einsichten auch in der Öffentlichkeit konsequent vertritt, dass das intellektuelle Gewissen eben nicht „in Schlaf gesungen“ (Z. 9) wird. Damit ist das Stichwort genannt, was Nietzsches Größe bezeichnet: dem Ruf des intellektuellen Gewissens zu folgen, also des Gewissens „hinter deinem ‚Gewissen‘“53, wie er später einmal sagt. Gemeint ist damit jene unbedingte Redlichkeit, die in Fragen der Wahrheit keinerlei Kompromisse macht und auch gegen sich selbst, seine eigenen Sehnsüchte und Handlungsmotive erbarmungslos die schärfsten Mittel der Erkenntnis anwendet (vgl. Nr. 424). Wer aber nur zu den „leidlich freigesinnten Menschen“ (Z. 6) gehört, dem ist es wichtiger, bei den Mitmenschen nicht anzuecken, als seine eigenen Einsichten unbesehen auch in der Öffentlichkeit zu vertreten. Mit einem Wortspiel begründet Nietzsche seine Forderung, von dem abzuweichen, was alle Welt tut: Das Übliche, das vernunftlos Anerkannte nämlich, wird „durch die Handlung eines anerkannt Vernünftigen noch einmal bestätigt“ (Z. 18 f.). Die von ihm genannten Beispiele gelten nur noch teilweise, da Kriegsdienstverweigerung vom Grundgesetz anerkannt und die kirchliche Trauung nicht mehr allgemein praktiziert wird. Die Serie müsste heute um andere Beispiele ergänzt werden, etwa um den Steuerund Versicherungsbetrug, um Mitgliedschaft in Parteien und Verbänden 50 Die Fröhliche Wissenschaft, Nr. 108. Titel einer Schrift Lessings, die in zwei Teilen (1777 und 1780) veröffentlicht worden ist. 52 Vgl. oben Nr. 108. 53 Die Fröhliche Wissenschaft, Nr. 335. Die Metapher ist von Günther Anders in der Parabel „Der gewissenhafte Nihilist“ erzählerisch durchgespielt worden (Der Blick vom Turm. C.H. Beck: München 1968, S. 31 f.) Nietzsche berichtet in einem unveröffentlichten Rückblick von seiner „Experimental-Philosophie“: „‚Wie viel Wahrheit erträgt, wie viel Wahrheit wagt ein Geist?‘ - dies wurde für mich der eigentliche Wertmesser. Der Irrtum ist eine Feigheit... jede Errungenschaft der Erkenntnis folgt aus dem Mut, aus der Härte gegen sich, aus der Sauberkeit gegen sich...“ (Aus dem Nachlass der Achtzigerjahre. Werke, hrsg. von Karl Schlechta, Bd. III, S. 834). 51 aus Karriere-Interessen, um Vertuschen der von Kollegen begangenen Fehler... Freilich muss man sehen, welchen Preis man für intellektuelle Redlichkeit zahlt: Man gehört nicht zur Herde, würde Nietzsche sagen; man findet keine Verbündeten, wenn man seine Projekte verwirklichen will. Will und kann man diesen Preis zahlen? Wenn ich mich öffentlich zu etwas bekennen soll, was ich nicht vertreten kann, dann muss ich „nein“ sagen. Ich erinnere mich, dass ich wider besseres Wissen während meines Theologiestudiums den Antimodernisteneid geschworen habe - eine „Errungenschaft“ des 19. Jahrhunderts, mit der man katholische Theologen am historisch-kritischen Denken hindern wollte. Diesen Eid konnte man vor 40 Jahren nicht guten Gewissens schwören - aber wir Studenten sahen, wie die großen progressiven Theologen, die Rahner, Küng und Ratzinger offensichtlich auch den Eid geschworen hatten; und da wir uns von Gott berufen glaubten, dachten wir: „Was die Großen können, dürfen wir auch tun.“ Dem windigen Eid folgten intellektuelle Eiertänze um die historischen Einsichten herum, Ausweichen ins Erbauliche oder offener Zynismus. Das Beispiel zeigt, wie sehr Nietzsche mit seiner Argumentation Recht hat. Es gibt Grenzen; wenn man sie erreicht, muss man „nein“ sagen. Vermutlich liegen diese Grenzen näher bei uns, als man gemeinhin vermutet. zu Nr. 202: Zur Pflege der Gesundheit An einer großen Voraussetzung hängt in diesem Aphorismus die Argumentation: „daß man glaubt, die übliche moralische Denkweise sei die Denkweise der geistigen Gesundheit“ (Z. 5 f.). Nietzsche glaubt das zwar nicht, wie „Die Fröhliche Wissenschaft“ Nr. 120 zeigt; er greift hier nur das gängige Verständnis von Moral auf, um seinen „Gegnern“ zu zeigen: Selbst von eurer Basis aus müsstet ihr den Verbrechern anders begegnen. Sogar die Bergpredigt zitiert er (Z. 39 f.), also die von ihm verachtete Moral der Schwachen - es muss ihm wohl äußerst wichtig sein, was er sagen will. Eine Menge Fragen wirft Nietzsche hier auf, mehr als man in 76 Zeilen beantworten kann. Wenn ich richtig lese, sind es zwei Dinge, die ihm so wichtig sind, dass er über seinen Schatten springt: Er möchte, dass wir auf Rache verzichten, wenn wir Schaden erlitten haben (Z. 30-36, das Stichwort in Z. 32); Rache erscheint ihm als kleinlich, deshalb verspottet er die Waage der Justitia als Krämerwaage (Z. 34). Stattdessen sollen wir großzügig mit denen umgehen, „die uns beleidigt haben“ (Z. 40); den guten ärztlichen Willen dazu fordert er ein (Z. 10 ff.), und er macht eine Reihe wirklich großzügiger Vorschläge (Z. 20-30). Freilich sieht er selbst, wie utopisch sein Ideal ist: „Noch fehlen vor allem die Ärzte...“ (Z. 60 ff.). Gut hundert Jahre nach Nietzsche sehen wir, dass einerseits zumindest für manche jugendliche „Verbrecher“ Nietzsches Programm einer Resozialisierung (Z. 10 ff.) mehr oder weniger erfolgreich praktiziert wird; anderseits sehen wir, dass unsere finanziellen Mittel begrenzt sind, dass Kinder und Alte besser betreut werden müssten, dass bei den Forschungsmitteln gespart wird, dass Entwicklungshilfe nach wie vor kleingeschrieben wird, - dass wir also auch für die Sozialisierung der Verbrecher nicht genug Geld haben. Hinzu kommt, was Nietzsche verschweigt: Es gibt eine Reihe von Verbrechen - ich verzichte darauf, Details zu schildern -, bei denen der Schaden nicht so leicht ausgeglichen oder überboten werden kann, wie Nietzsche es andeutet (Z. 24-26). Eine Frage bleibt grundsätzlich: Können wir, müssen wir auf Strafe verzichten? Nach dem Gefühl würde man vielleicht sagen: Wir sollten es. Dass wir es nicht können, sehen wir, wenn wir den Menschen realistisch betrachten. Wer glaubt, der Mensch sei unbegrenzt lernfähig und wesentlich rational - was Nietzsche natürlich nicht glaubt -, wird auf jede Strafe verzichten wollen; wer das nicht glaubt, wird das Strafen als eine Vermittlung von Erfahrung nicht nur zulassen, sondern auch bejahen (müssen). Diese konservative These möchte ich durch einen Rückgriff auf die Fabeltheorie begründen. Fabeln haben in der Antike dazu gedient, als konstruierte Beispiele54 Analogien für das richtige Entscheiden zu bieten („richtig“ im Sinn des Sprechers): Die fragliche Situation wird durch ein kluges Wort oder durch den Misserfolg eines Kontrahenten entschieden. Der schiffbrüchige Athener wird belehrt: „Beten kannst du zu Athene, aber du musst auch schwimmen!“55 Und der eitle Rabe wird bestraft, indem er den Käse verliert, als er seinen Schnabel zum Singen öffnet.56 - Wenn es auch Varianten dieser beiden Typen gibt, etwa dass die lügenhafte Willkür in den „Argumenten“ des Wolfes aufgedeckt wird57, ist das Nebeneinander von rationaler Argumentation und Misserfolg als den Kriterien des richtigen Handelns zu beachten. Durch Erfahrung wird man klug, aber manche Erfahrungen macht man, indem man sich die Finger verbrennt; dem rationalen Argument sind manche Menschen manchmal nicht zugänglich, sie müssen sich die Finger verbrennen. Raben müssen einfach den Käse verlieren - zu schön klingen die Worte vom glänzenden Gefieder; und gar die Hoffnung, der schönste aller Vögel zu sein dagegen kommt kein Argument an. In dieser Konstruktion des Menschen liegt auch das Recht des Strafens begründet: In dem abgekürzten Lernverfahren, welches ein Misserfolg darstellt, bedeutet die Strafe den sozialen „Misserfolg“ des praktisch erfolgreichen „Verbrechers“; nur so lernen manche Leute, dass sie nicht richtig handeln. Wie man sinnvoll bzw. Erfolg versprechend straft, ist aber noch nicht ausgemacht. Wie derjenige, der eine Fabel erzählt, beansprucht also auch der Strafende, dass er über eine bessere oder richtigere Einsicht als der Bestrafte verfügt. Natürlich ergeben sich hier Fragen: Ob die Machtposition auch die richtige Einsicht garantiert, ist die am schwersten wiegende Frage. Vielleicht noch schwerer zu beantworten ist die 54 Aristoteles: Rhetorik II 5. Fabeln. Herausgegeben von Therese Poser. Reclam: Stuttgart 1975, Nr. 1: Der Schiffbrüchige. 56 Fabeln. A.a.O., Nr. 8: Fuchs und Rabe. 57 Fabeln. A.a.O., Nr. 10: Wolf und Lamm. 55 vorausliegende Frage, ob es denn erweislich richtiges Handeln im Umgang mit anderen gibt. Die zuletzt genannte will ich mit dem Hinweis auf die Goldene Regel, auf das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung also, andeutungsweise beantworten; die erste Frage kann man mit „nein“ beantworten, aber auch mit dem Hinweis darauf, dass die Konstruktion des Rechtsstaates und des unabhängigen Richters zumindest einen Versuch darstellt, die richtige Einsicht von der Machtposition unabhängig zu machen. Damit wir uns nicht Details verlieren: Verzichten wir an dieser Stelle auf eine Typologie der Verbrecher oder der Verbrechen. Halten wir fest: Auf Strafen können wir nicht ganz verzichten; aber von dem kleinlichen Bedürfnis nach Rache sollten wir frei werden. zu Nr. 206: Der unmögliche Stand Der unmögliche Stand, das ist nach diesem Aphorismus der des Fabrikarbeiters; dem könne weder durch Reformen noch durch Revolution geholfen werden. Er solle sich lieber auf die inneren Werte besinnen, statt äußere Werte zu begehren; in Scharen sollten die Arbeiter aufbrechen, Scharen „schwärmender Kolonisten-Züge“ (Z. 52) sollten sich einen Platz für freie Menschen in der Welt erobern... Die Aufforderung zum kolonisierenden Ausschwärmen erscheint zu Beginn des 21. Jahrhunderts so absurd, dass sie beinahe übersehen lässt, welche Sachfragen hier zur Debatte stehen. Die erste ist die sozialpolitische Frage: Sind die Fabrikarbeiter - mit den Einschränkungen: heute und bei uns in Mitteleuropa - als Sklaven anzusehen? Wenn man diese Frage verneinen darf (und vielleicht auch überlegen soll, was sich daraus für die Politik etwa in der Dritten Welt ergibt), kann man sich den beiden eher philosophischen Fragen zuwenden: Wie steht es um den Primat der inneren Werte (Z. 16 f.) gegenüber dem, was von außen kommt (Z. 30 f.)? Und als zweite die Frage, ob wir uns dagegen wehren müssen, verbraucht zu werden. Die erste dieser beiden Fragen wird in vielen erbaulichen Traktaten behandelt, und dort wird regelmäßig den inneren Werten der Vorzug gegeben; die gleiche Bewertung ist dank der Schriften Erich Fromms an die Gegenüberstellung von Haben und Sein gebunden: Haben ist schlecht, Sein ist gut. Diese Alternative gibt es, von Nietzsche andeutungsweise zitiert (Z. 23 f.), seit der Antike: radikal bei den Kynikern oder dem sprichwörtlichen Diogenes in der Tonne („Geh mir aus der Sonne!“), gemäßigt bei den Stoikern; das Gleichnis Jesu vom Kornbauern, der nach reicher Ernte mit dem Tod konfrontiert wird (Luk 12,16-20), greift das Thema auf: Wem wird all das, was er da nutzlos aufgehäuft hat, gehören, wenn er tot ist? Lukas fügt als fromme Fortsetzung hinzu: „So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt...“ (Luk 12,21). Irrtum, lieber Lukas: Was der Kornbauer gesammelt hat, hat er nicht nur für sich gesammelt, sondern für seine Familie; seinen Kindern wird es gehören, wenn er tot ist, oder seinen Geschwistern und deren Kindern. Günther Anders hat böse mit Erich Fromms Alternative von Haben und Sein abgerechnet58; wir können es uns daher ersparen, die Polemik zu wiederholen. Zu fragen wäre vielleicht, woher der Lobpreis des Seins seinen Zauber bezieht oder weshalb die inneren Werte gegenüber den äußeren einen Vorrang beanspruchen dürften. Nietzsches feines Ohr könnte hier die Stimme der Unterlegenen und ihres Ressentiments gegenüber den Erfolgreichen hören59; wir würden vielleicht an fortlebende romantische Impulse denken. Ich weise auf einen kleinen Aufsatz Michael Landmanns hin, dessen Schluss so lautet: „Für die kulturanthropologische Betrachtung sind Lebensordnungen das Primäre. Das Innen in seiner Selbständigkeit ist erst ein Gewordenes. Nicht nur die Beziehung zu Objektivität und Objektivationen, sondern auch die Subjektivität selbst unterliegt dem geschichtlichen Wandel.“60 Wenn man diesen Gedanken Landmanns verstanden hat, denkt man vermutlich auch über die Beobachtung anders, dass wir „verbraucht werden“ (Z. 6 f.). Natürlich wollen wir nicht „als Schrauben einer Maschine“ (Z. 5) verbraucht werden; doch der Vorwurf, dass wir „Lückenbüßer der menschlichen Erfindungskunst“ (Z. 6) seien, verschleiert die Notwendigkeit, dass wir in unserer Arbeit verbraucht werden: zur Erhaltung des eigenen Lebens wie zur Sicherung des Lebens der nächsten Generation. In Goethes Gedicht „Grenzen der Menschheit“ lautet die beiden letzten Strophe in der gedruckten Fassung so: „Was unterscheidet Götter von Menschen? Dass viele Wellen vor jenen wandeln, ein ewiger Strom: Uns hebt die Welle, verschlingt die Welle, und wir versinken. Ein kleiner Ring begrenzt unser Leben, und viele Geschlechter reihen sich dauernd an ihres Daseins unendliche Kette.“ Dass wir nicht wie Schrauben verbraucht werden, dass maschinenförmige Arbeit also von Maschinen verrichtet wird, daran arbeiten die Maschinenbauer; wer überblickt, wie sich in den letzten 50 Jahren die Arbeit der Bauern oder der Maurer verändert hat, wird den 58 Anders, Günther: Ketzereien. C.H. Beck: München 1982, S. 191-193: Haben ist ein Monopol des Menschen; dieser kann ohne Haben nicht sein. Weil wir etwas halten und behalten, haben wir etwas. 59 Die bisher allein bejahte Seite des Daseins werde vom Instinkt der Leidenden, der Herde, der meisten geschätzt, sagt Nietzsche in einem bemerkenswerten Essay im Nachlass (s. oben Anm. 54). 60 Landmann, Michael: Innen und Außen. In: Das Ende des Individuums. Anthropologische Skizzen. E. Klett: Stuttgart 1971, S. 80-83 (das Zitat auf S. 83). Maschinenbauern bescheinigen, dass sie gut gearbeitet haben - dass sie also verbraucht worden sind dafür, dass sie anderen die Arbeit erleichtert haben. zu Nr. 210: Das „an sich“ Für den philosophisch geschulten Leser rennt Nietzsche hier offene Türen ein: Kant hat deutlich gemacht, dass uns die Dinge „an sich“ nicht zugänglich sind. Bei den Regeln moralischen Handelns hat Kant immerhin versucht, ein Prinzip zu finden, mit dem wir die Grundsätze unseres Handelns prüfen können: ob sie uns unbedingt („kategorisch“) verpflichten - das an sich Gute hat aber auch Kant nicht mehr nennen können. Nur in der Volksseele gibt sich das an sich Gute, vor allem aber das an sich Böse zu erkennen; dann ruft des Volkes Stimme: „Rübe ab!“ Groß ist Nietzsches Satz: „Wir haben die Prädikate der Dinge wieder zurückgenommen, oder wenigstens uns daran erinnert, daß wir sie ihnen geliehen haben.“ (Z. 9 f.) Vielleicht sind es nicht nur unsere „Seelenzustände“ (Z. 7), sondern auch die ihnen entsprechenden Handlungen (das Lachen, Z. 5), denen wir „Eigenschaften“ von Dingen und Handlungen zuordnen: lächerlich. Mit den Unterscheidungen von ehemals und jetzt (Z. 1 und 4), von Einfällen und Besinnung (Z. 3 und 5) macht er jedenfalls klar, wo die richtige Sicht zu finden ist. Seine Einsicht lebt im Begriff des Werturteils fort; mit diesem Begriff wird festgehalten, dass ich es bin, der etwas bewertet. Wenn mir etwas gut schmeckt, sage ich: „Das ist lecker.“ Ist es bloße Naivität, so zu sprechen, oder wünsche ich manchmal, dass die anderen ebenso urteilen? Jeder, der Kinder hat, weiß, wie schwer es ist, beim Essen vom eigenen Geschmack auf den der Familienmitglieder zu schließen; vorschreiben kann man ohnehin niemandem, was ihm gut schmecken soll. Können wir auch niemandem sagen, was er bitte unbedingt zu unterlassen hat? Können wir das über Formeln hinaus [neminem laede: Schädige niemand (unnötig)!] in realen Situationen sagen: Damit schädigst du mich unnötig? Verberge ich die Problematik des Einschätzens nicht im modalen Adjektiv „unnötig“? Ist jemand vielleicht krank61, wenn er etwas nötig hat, was ich oder, besser noch, wir alle als unnötig einschätzen? Freilich müssen wir handeln, auch wenn diese Fragen nicht endgülitg beantwortet sind - aber wie? zu Nr. 424: Für wen die Wahrheit da ist Für wen ist die Wahrheit da? Das ist eine seltsame Frage. Seit alters wird doch „der Mensch“ als ein vernunftbegabtes Lebewesen verstanden; also müsste die Wahrheit für jeden Menschen da sein. „Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar“, hat Ingeborg Bachmann behauptet; darin klingt 61 Nach wie vor lesenswert zu diesen Fragen ist Foucault, Michel: Die Ordnung des Diskurses. Ullstein Buch 3367, 1977. Foucault zeigt, wie Gesellschaften mit solchen Unterscheidungen ihre „Diskurse“ regeln. schon an, dass die Wahrheit eine Zumutung darstellen, also schwer zu ertragen sein kann. Nietzsche geht von der Erfahrung aus, dass viele Mitbürger wissenschaftliche Wahrheiten nicht schätzen (Z. 20 ff.), dass sie und weil sie Trost erwarten. Was ist Trost? Das, was jemanden in seinem Leid aufrichtet. „Das tröstet mich“, damit wird eine Leistung oder Funktion bezeichnet; eine Lüge kann so gut wie eine Wahrheit trösten, vielleicht sogar noch besser. Nietzsches knappe These lautet: Wahrheiten sind nicht zum Trost da und nicht für die, welche Trost brauchen. Zur Begründung setzt er sich mit der Metaphysik jener auseinander, welche von der Wahrheit Trost erwarten. Eine solche Erwartung wäre nur dann gerechtfertigt, wenn man „vom Menschen als dem Zwecke der Natur“ (Z. 10) ausgehen könnte; wenn es also einen Weltgeist oder Gott oder Seinsgrund oder einen ihrer Kollegen gäbe, der es sich tatsächlich zum Ziel gesetzt hätte, die ganze Welt auf des Menschen Glück hin anzulegen, einschließlich aller Unfälle und Wahrheiten. Ohne diese Frage hier zu diskutieren, geht Nietzsche davon aus: Die Welt ist nicht so. Wahrheit ist nur für Menschen da, welche sie ertragen können (Z. 14) warum er Aristoteles zu den harmlosen Seelen zählt (Z. 16) und Friedrich N. nicht erwähnt, kann hier offen bleiben. Spendet die Philosophie keinen Trost? Sie lehrt jedenfalls keine Trostwahrheiten, sondern leitet zum Fragen an: „Warum leide ich? Leide ich mehr als andere? Leide ich zu Recht an meinem Verlust? Warum erwarte ich, es sollte für mich kein Leid geben?“ Auf solche Fragen hat es viele Antworten gegeben: die Philosophiegeschichte, aber keine erlernbaren Trostwahrheiten. Vielleicht sollte man nicht sagen, Philosophie leite zu solchen Fragen an, sondern eher dies: Wer so auch den Grund und das Recht seines Leidens zu befragen versteht, betreibt Philosophie. So zu fragen bedeutet, die Wahrheit zu suchen (Z. 17 f.); das können nur die „mächtigen“ (Z. 15) Seelen, sagt Nietzsche; ich würde vorziehen zu sagen, es seien die starken. Aber woher kommt ihnen die Stärke? Woher haben die Aufklärer ihren Verstand? Wie haben die Aufrührer ihre Freiheit gewonnen? Nicht ohne Angst, nicht ohne Kampf, auch nicht ohne Irrtümer - und sicher auch nicht ohne ihre Freunde. zu Nr. 501: Sterbliche Seelen! „O Gott, sollte ich wirklich keine unsterbliche Seele haben?“ So erschrecken sich jene, die im Himmel ihre Geburtstagsfeiern in gewohnter Besetzung fortsetzen wollen. Sie können den Aphorismus Nr. 501 nicht verstehen, weil sie nie unter dem Druck einer absoluten Entscheidung gestanden haben: Wenn ich dies und jenes tue, verspiele ich vielleicht meine ewige Seligkeit, weil ich Gott unendlich beleidige - Gottheiten kann man nur unendlich beleidigen, ihre Strafe ist nach göttlicher Logik oder der Logik des Göttlichen unendlich; daher darf man sich auf keinen Fall einen Fehler erlauben, jede Entscheidung muss ganz richtig sein - und die Angst, etwas falsch zu machen, darf nicht da sein, weil sie zwingend die ungeteilte Hingabe verhindert - jene Hingabe, die nie ungeteilt sein kann, weil sie stets von der Möglichkeit des unendlichen Verfehlens bedroht ist. Der psychologische Fachbegriff dafür ist double bind: „Entscheide dich frei und ohne Höllenangst, mein Lieber, sonst kommst du in die Hölle!“ Ob ich Nietzsche hier richtig verstehe? Ich zweifle nicht daran, einmal aus Kenntnis meiner Biographie, dann auch, weil ich einige Leidensgenossen kenne. Äußerst heftig hat Tilmann Moser von seiner „Gottesvergiftung“ (1976) berichtet, charmant und distanziert erzählt Adolf Holl62 von seinem Leben und seinen Einsichten. Ich könnte auch von meinem Leben erzählen - meine Einsicht finde ich in Nietzsches Aphorismus Nr. 501: „Versuchen, Vorläufig-nehmen“ (Z. 9) dürfen, das ist ein wahrer Segen. Aus der Zwickmühle des double bind befreit zu werden, das eröffnet neue Horizonte. [Ich erinnere mich, wie wir in unserem Kurs mit dem „heiligen“ Zölibatseid fertig geworden sind. Wir haben mehr oder weniger salopp gesagt: „Wir probieren es mal.“ Das war zwar ernster gemeint, als es klingt, aber doch der Versuch, das Geschick der unsterblichen Seele aus der Bindung an den Zölibat zu lösen.] So wenig wie die Religion Zynismus und doppelte Moral verhindert, kann unsere Einsicht in die Sterblichkeit der Seelen die totale Beliebigkeit verhindern. „Versuchen“ heißt schon: ernsthaft suchen, nicht nur: mal probieren. Aber mit einer sterblichen Seele ist es eher möglich, dass man zugeben kann, auf einem falschen Dampfer gefahren zu sein, ohne dass die Seele gleich durch den Schornstein geht. Die Wahrheit suchen und seinem intellektuellen Gewissen folgen, das kann man leichter, wenn man keine unsterbliche Seele zu verlieren hat. zu Nr. 539: Wißt ihr auch, was ihr wollt? Die Reflexion, für wen die Wahrheit da ist (Nr. 424), zielt nach außen, bedenkt die anderen Menschen. Jetzt aber müssen wir uns selbst fragen (lassen): „Wißt ihr auch, was ihr wollt?“ Tauge ich selbst dazu, „das, was wahr ist, zu erkennen“ (Z. 2)? Nietzsche hat sich unerbittlich selbst geprüft und gewusst, wie viel Stolz und Rechthaberei, wie viel aggressive Zuspitzung in den Kampf der Argumente eingeht: „Der persönliche Kampf der Denker hat schließlich die Methoden so verschärft, daß wirklich Wahrheiten entdeckt werden konnten und daß die Irrgänge früherer Methoden vor jedermanns Blicken bloßgelegt sind.“63 Einer Gewissenprüfung muss sich jeder unterziehen, der vermeint, die Wahrheit zu suchen: Was will ich in Wahrheit (Z. 4 ff.)? Mit den Gedanken verkehrt man ja wie mit Menschen (Z. 16 ff.), man mag sie oder nörgelt 62 Holl, Adolf: Tod und Teufel. Stuttgart 1973 (= dtv 1132, 1976). Menschliches, Allzumenschliches I, Nr. 634. Die Aphorismen Nr. 629 - 635 bzw. 637 dort gehören für mich zum Besten, was Nietzsche geschrieben hat: unbedingt lesenswert. „Aus der innersten Erfahrung des Denkers“ berichtet Nietzsche in „Vermischte Meinungen und Sprüche“, Nr. 26 - ebenfalls mit dem versöhnlichen Schluss, dass das intellektuale Gewissen „aus einer Schwarz-wurzel“, also aus dumpfen Ursprüngen hervorgeht. 63 an ihnen herum; da muss man sich schon fragen, ob Zustimmung und Ablehnung wirklich „sachlich“ oder doch eher „persönlich“ begründet sind. Zum Schluss ein schönes Bild, eine Anspielung auf Platons Höhlengleichnis (Z. 23 ff.): In der Höhle der Erkenntnis mag einem „die Wahrheit“ begegnen, obwohl sie in Wahrheit nur das verkleidete eigene Gespenst ist. Also dann, meine Beste, auf, mein Lieber: Erforsche dich selbst! Stelle dich der Frage: Ist es nicht eine schauerliche Komödie, in welcher ich unbedachtsam mitspielen will, gar eine Hauptrolle übernehmen möchte? Glaube ich wirklich, dass „Eine kaiserliche Botschaft“64 mich erreicht (hat)? zu Nr. 547: Die Tyrannen des Geistes Wie ehemals Erkenntnis gesucht wurde im Unterschied zur Art, wie „jetzt“ Wissenschaft betrieben wird, ist das Thema dieses Aphorismus. Dabei ist „jetzt“ spätestens 1881, das Jahr, in dem die „Morgenröte“ erschienen ist. Wir wissen „heute“, dass auch nach 1881 Wissenschaft im alten Stil betrieben wurde - nicht nur die „weiche“ Literaturwissenschaft mit ihrem bunten Methodenwechsel (immanente Interpretation, marxistische und psychoanalytische Deutung, empirische Rezeptionsforschung, Textlinguistik, Dekonstruktion... - jeweils mit religiöser Inbrunst propagiert) oder die Sozialwissenschaften; auch in der Naturwissenschaft werden St. Hawkings Bücher zur Zeit wie der Stein der Weisen gehandelt. Das legt den Verdacht nahe, dass Nietzsches Erklärung zu kurz greift: Nicht weil man geglaubt hat, dass „alles in der Welt auf den Menschen hin eingerichtet“ (Z. 8) ist, werden die wissenschaftlichen Schnellschüsse abgefeuert; mir scheint der Grund dafür eher im ganz normalen Narzissmus zu liegen: dass man sich selbst für etwas ganz Außergewöhnliches hält. Theodor Fontane war in der glücklichen Lage, als alter Mann sich an seine welterobernden Hoffnungen zu erinnern, ohne eine Erklärung für seinen jugendlichen „Größenwahn“ zu bieten - er sah ihn wohl als normal an: „Was ich mal wollte, was ich dann wurde, Manchmal grenzt es ans Absurde. Sprachen sprechen, tutti quanti, Wollt‘ ich à la Mezzofanti, Reisen zum Chan, zu zwei‘n oder solo, Wollt‘ ich mindestens wie Marco Polo. Dazu dichten im Stile Dantes, Prosa schreiben wie Cervantes...“ Das liebe Ich hält sich für ein Genie, und es kann sich glücklich preisen, wenn es wie Fontane erkennt, dass es keines ist. Soll man diese jugendliche Überheblichkeit „moralische Beschränktheit“ nennen? Ja, wenn sie auch im reiferen Alter nicht durchschaut wird, wenn der preisgekrönte Professor an die Lobeshymnen seiner Assistenten oder „Kritiker“ tatsächlich glaubt. „Was liegt an mir!“ steht in der Tat über der Tür des wissenschaftlichen Arbeiters (Z. 29 f.), sollte jedenfalls dort 64 Kafka, Franz: Die Erzählungen. S. Fischer Verlag: Frankfurt a.M. 1961, S. 143 f. stehen; aber wenn jemand die wissenschaftliche Bühne betritt, muss er natürlich ein wenig lärmen, damit man ihn bemerkt. Vielleicht gibt es noch einen anderen Grund für die Suche nach den Weltformeln, der in dem genannten Lebensziel erscheint: „Ein Rätsel ist zu lösen.“ (Z. 15) Da höre ich die Erwartung des unaufgeklärten Publikums, dem clevere Verleger und Scharlatane solche Lösungen verkaufen. Die Welt will betrogen werden - warum sollte man davon nicht profitieren, fragen sie sich. Nietzsche wusste dies: „Das Halbwissen ist siegreicher als das Ganzwissen: es kennt die Dinge einfacher, als sie sind, und macht daher seine Meinung faßlicher und überzeugender.“65 zu Nr. 552: Die idealische Selbstsucht Paradox klingt der Titel: Wie kann Selbstsucht idealisch sein? Außerdem steht dieser Gedankengang in Spannung zu den Aphorismen 539 und 547; er umkreist den utopischen Mythos des Erkennenden und Schaffenden: „Alles ist verschleiert, ahnungsvoll, ... man wartet ab und sucht bereit zu sein.“ (Z. 10 f.) Auch die als Größenwahn entlarvte Hoffnung kennt Nietzsche, dass da etwas Größeres in uns wächst, als wir sind (Z. 17 f.). Es klingt so, als wollte er sich Mut machen, weil er es selbst nicht recht glaubt: „In dieser Weihe soll man leben! Kann man leben!“ (Z. 20 f.) Zwei Ausrufezeichen, dazu die religiöse Metapher der Weihe: Das klingt mir verdächtig nach dem Pfeifen des ängstlichen Knaben im Wald. Dann taucht noch das Stichwort vom wesentlichen Vollbringen auf; dieses muss wohl im Gegensatz zum unwesentlichen zielbewussten Arbeiten stehen. Da nimmt auch die paradoxe Überschrift nicht wunder, dass die Selbstsucht idealisch sei, was später so erklärt wird: „für den Nutzen aller“ (Z. 27) werden die wesentlichen Dinge vollbracht. Wenn Nietzsche uns doch ein Beispiel fürs wesentliche Vollbringen nennte, könnte man diskutieren, welchen Anteil am Erfolg das Abwarten und welchen das tägliche Mühen schließlich hat. Aber nein, er kann nur um Nachsicht für „die Schwangeren“ bitten. Wollen wir ihm diese Nachsicht gewähren? Ich halte es lieber mit dem Nietzsche der vorhin gelesenen Aphorismen. Bei Nietzsche selber sehen wir, wie er an den Gedanken arbeitet, sie wiederkäut, zurechtschleift; sein Beispiel und seine eigenen Gedanken machen mich skeptisch gegenüber allem Geniekult. Halten wir es wie beim Aphorismus Nr. 146 der „Morgenröte“: Vorsicht gegenüber denen, die sich der Kritik entziehen! 65 Menschliches, Allzumenschliches I, Nr. 578.