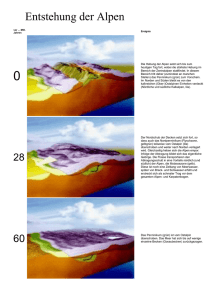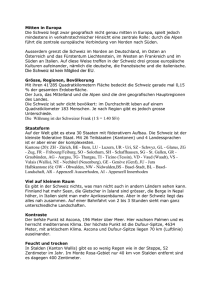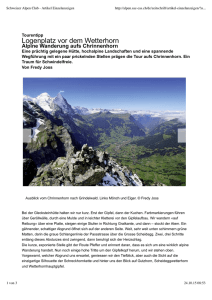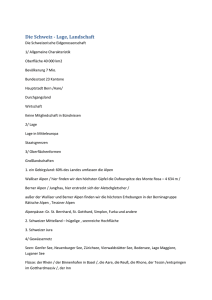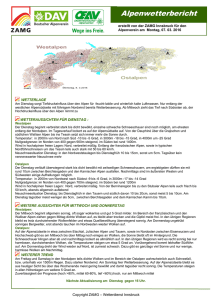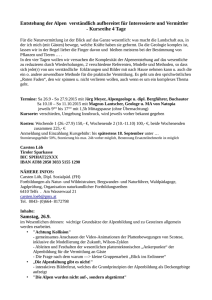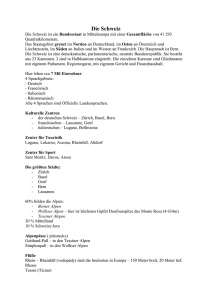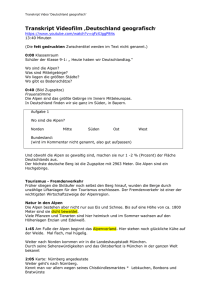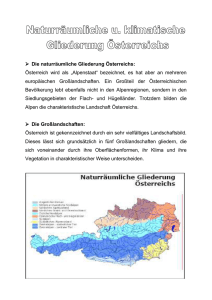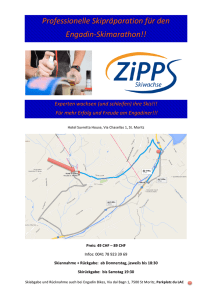Alpeninitiative - Legislating Architecture
Werbung
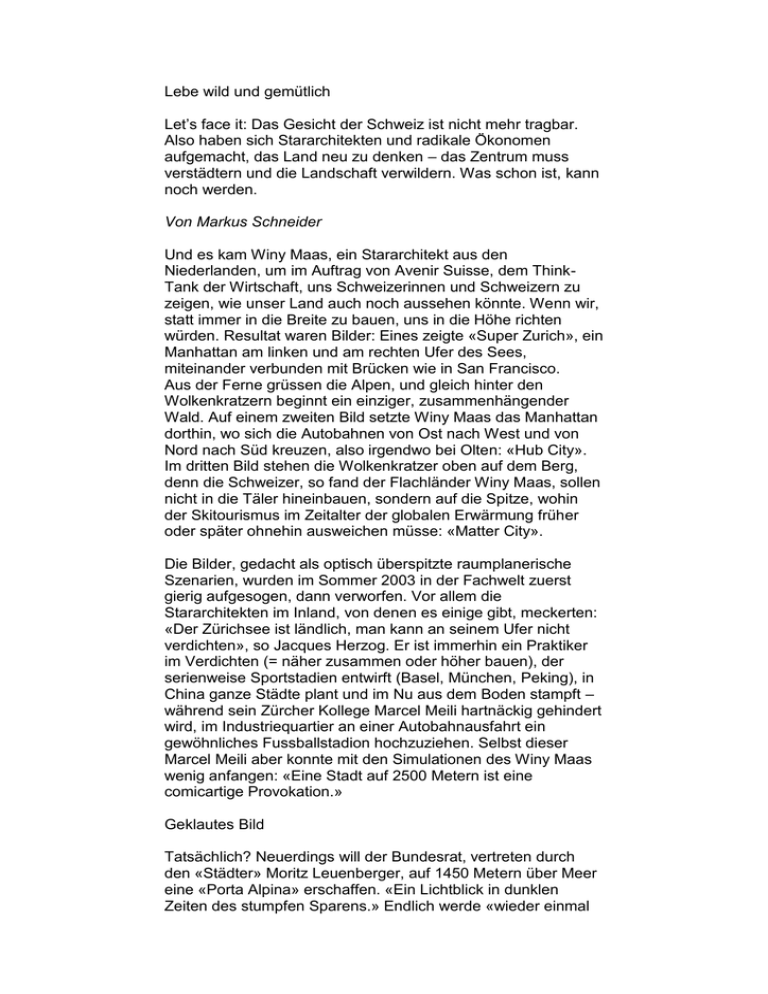
Lebe wild und gemütlich Let’s face it: Das Gesicht der Schweiz ist nicht mehr tragbar. Also haben sich Stararchitekten und radikale Ökonomen aufgemacht, das Land neu zu denken – das Zentrum muss verstädtern und die Landschaft verwildern. Was schon ist, kann noch werden. Von Markus Schneider Und es kam Winy Maas, ein Stararchitekt aus den Niederlanden, um im Auftrag von Avenir Suisse, dem ThinkTank der Wirtschaft, uns Schweizerinnen und Schweizern zu zeigen, wie unser Land auch noch aussehen könnte. Wenn wir, statt immer in die Breite zu bauen, uns in die Höhe richten würden. Resultat waren Bilder: Eines zeigte «Super Zurich», ein Manhattan am linken und am rechten Ufer des Sees, miteinander verbunden mit Brücken wie in San Francisco. Aus der Ferne grüssen die Alpen, und gleich hinter den Wolkenkratzern beginnt ein einziger, zusammenhängender Wald. Auf einem zweiten Bild setzte Winy Maas das Manhattan dorthin, wo sich die Autobahnen von Ost nach West und von Nord nach Süd kreuzen, also irgendwo bei Olten: «Hub City». Im dritten Bild stehen die Wolkenkratzer oben auf dem Berg, denn die Schweizer, so fand der Flachländer Winy Maas, sollen nicht in die Täler hineinbauen, sondern auf die Spitze, wohin der Skitourismus im Zeitalter der globalen Erwärmung früher oder später ohnehin ausweichen müsse: «Matter City». Die Bilder, gedacht als optisch überspitzte raumplanerische Szenarien, wurden im Sommer 2003 in der Fachwelt zuerst gierig aufgesogen, dann verworfen. Vor allem die Stararchitekten im Inland, von denen es einige gibt, meckerten: «Der Zürichsee ist ländlich, man kann an seinem Ufer nicht verdichten», so Jacques Herzog. Er ist immerhin ein Praktiker im Verdichten (= näher zusammen oder höher bauen), der serienweise Sportstadien entwirft (Basel, München, Peking), in China ganze Städte plant und im Nu aus dem Boden stampft – während sein Zürcher Kollege Marcel Meili hartnäckig gehindert wird, im Industriequartier an einer Autobahnausfahrt ein gewöhnliches Fussballstadion hochzuziehen. Selbst dieser Marcel Meili aber konnte mit den Simulationen des Winy Maas wenig anfangen: «Eine Stadt auf 2500 Metern ist eine comicartige Provokation.» Geklautes Bild Tatsächlich? Neuerdings will der Bundesrat, vertreten durch den «Städter» Moritz Leuenberger, auf 1450 Metern über Meer eine «Porta Alpina» erschaffen. «Ein Lichtblick in dunklen Zeiten des stumpfen Sparens.» Endlich werde «wieder einmal ein kühnes Projekt gewagt», das sich zwar «rein betriebswirtschaftlich nicht rechnet», wie Moritz Leuenberger offen zugibt, um das Gewicht auf andere, höhere Ziele zu legen: «Das Projekt soll einer Randregion dienen und den dortigen Tourismus nachhaltig fördern.» Wie die lokalen Promotoren diese Vorgabe umsetzen wollen, zeigen sie mit dem Bild, das sie bei Winy Maas entlehnt, ja geklaut haben. Ursprünglich war «Matter City» eine Antwort auf die bestehenden, zu Zweitwohnungsstätten ausfransenden Tourismus-Industrie-Zentren; während der kurzen Saisons voll, sonst leer. Nun aber wird «Matter City» auf die grüne Wiese gesetzt – als Werbegag für die «Porta Alpina» bei Sedrun, zu sehen als Diashow auf www.visiun-porta-alpina.ch. Klick. Das nächste Dia schafft eine Assoziation zu Lille, dem nordfranzösischen Bahnverkehrsknotenpunkt zwischen Brüssel, Paris und London. Dort hat ein anderer holländischer Stararchitekt, Rem Koolhaas, möglichst billig in no time einen futuristischen Mittelpunkt konstruiert («Euralille»), was einen «Bauboom» samt «Arbeitsplätzen» ausgelöst habe. Nicht erwähnt wird, dass Lille eine Stadt ist mit 180000 Einwohnern, in der Ebene liegt, umkreist von einem Ballungsgebiet mit einer Million Einwohnern, während Sedrun ein Fleck ist mit 1584 Einwohnern, oben im Gebirge, weit weg von der nächsten weissen Arena (Flims/Laax/Falera). Klick. Die Promotoren zeigen ihre nächste «Visiun», eine Porta Alpina als «Stadtpark für Zürich und Mailand». Noch ist Sedrun einfach Sedrun. «Gemütlich, authentisch, fernab des grossen Rummels.» So jedenfalls wirbt die Destination im Internet für sich selber. Man könnte auch sagen: Sedrun liege mitten drin – mitten in der alpinen Brache. Das Wort «Brache» brüskiert, aber das ist Absicht. Der Begriff stammt aus der mittelalterlichen Landwirtschaft. Eine Anbaufläche wird stillgelegt, um sie nach dieser Ruhepause neu zu nutzen. Wofür, das weiss noch niemand. Genau wie bei der Porta Alpina. Was neu entstehen soll, steht in den Wolken. Selbst Moritz Leuenberger, der ranghöchste Raumplaner im Land, weiss erst, was er nicht will: «Wir wollen keine gerammelt vollen Züge mit Tagesausflüglern aus Mailand, die nur zum Pilzesammeln in die Surselva kommen.» Erfunden wurde das Wort «alpine Brache» von den vier Architekten Marcel Meili, Jacques Herzog, Roger Diener und Pierre de Meuron. Unterstützt vom Geografen Christian Schmid haben sie das ETH-Studio Basel gegründet und nun während vier Jahren zusammen mit 141 Studenten das Land durchforscht, immer mit dem besonderen Blick auf die «urbanen Potenziale». Am kommenden Freitag, 4. November, präsentieren sie ihr grosses Werk, das über 1000 Seiten dick geworden ist: «Die Schweiz – ein städtebauliches Portrait». Mit diesen drei Bänden wollen die vier Architekten, wie Marcel Meili gegenüber dem Tages-Anzeiger angekündigt hat, «die Karte im Kopf der Schweizer verändern» und mit einem Schweizbild aufräumen, das schon lange mehr einem Mythos gleiche als der urbanen Realität. Denn in Wirklichkeit ist das Land vollkommen verstädtert. Im Büffelland Es ist schon fast Mode geworden, mit neuen Landkarten die Leute wachzurütteln; allein dieses Jahr gab es drei prominente Anläufe. Den Reigen eröffnet hat Avenir Suisse. Nach ihrem Bildband «Stadtland Schweiz», in dem Winy Maas seine Extremvarianten des Verdichtens und Entleerens zeigte, wandte sich der Think-Tank dem Alltag zu: der «Baustelle Föderalismus», publiziert im Februar. Für Furore sorgte aber nicht etwa der Text, sondern die mitgelieferte Schweizer Karte. Was haben die Avenir-Suisse-Ökonomen getan? Sie nahmen die Statistiken der Pendlerströme als Indikator für die wirtschaftliche Aktivität. An jenen Orten, wo der Anteil der Pendler am höchsten ist, malten sie einen farbigen Klecks. Hierhin pendeln die Leute, um zu arbeiten. Um diese Kerne herum wurden Kreise gezogen. Das sind die Gemeinden, aus denen die Pendler herkommen. Entstanden sind sechs verschiedenfarbige Gebilde – nämlich die sechs Metropolitanregionen um Genf, Lausanne, Bern, Basel, Zürich und im Tessin (als Anhängsel von Mailand). Hier leben und arbeiten fast 80 Prozent der Einwohner, die 84 Prozent der Wirtschaftsleistung erbringen. Diese Aussage ist nicht neu; warum der Lärm? Zunächst erkennen St. Gallerinnen oder Luzerner ungern, dass sie einem Gross-Zürich zugeschlagen werden. Die grösste Aufregung entstand aber nicht innerhalb der sechs Metropolitanregionen, sondern ausserhalb. Dort leben auch Menschen, die sich nun dargestellt sehen als weisse Flecken. «Für mich als Bergler ist das eine Provokation», meinte Hans-Jörg Hassler, SVPNationalrat und Berglandwirt aus Cultira GR. «Künftig wohnen alle nur noch in Städten, und der Rest ist Büffelland», höhnte CVP-Grossrat Franz Wüest aus Ettiswil LU. Und Gabi Huber, FDP-Nationalrätin aus Altdorf UR, schlüpfte in ihre Rolle als Anwältin: «Es müssen auch Gebiete gefördert werden, die strukturelle Nachteile haben.» «Unsere Schweizer Karte ist keine technokratische Gebietseinteilung, kein Masterplan.» Thomas Held, Direktor von Avenir Suisse, zog landauf, landab und erklärte: «Die Karte bildet einfach nur die Realität der sechs grössten Pendlereinzugsgebiete ab, von denen Zürich und Basel rund vierzig Prozent des Bruttoinlandproduktes erwirtschaften. In den weissen Flecken dazwischen leben weniger Leute, sie pendeln nur in geringem Masse, und entsprechend tief fällt die Wertschöpfung in diesen Gegenden aus.» Das Auseinanderdriften dürfte sich sogar akzentuieren. Gemäss den neuen Prognosen von BAK Basel Economics findet bis 2010 in neun Kantonen ein Nullwachstum statt. Gerade noch in fünf Kantonen der Schweiz wächst die Wirtschaft richtig: in den beiden Basel, Zürich, Zug und Genf. Wie sagt man’s auf Beamtendeutsch? Nur wenige Wochen nach dem Wirbel um die Avenir-SuisseKarte legte das Bundesamt für Raumentwicklung seinen «Raumentwicklungsbericht 2005» nach. Das Echo war gering, die Botschaft dieselbe: «Die Kluft zwischen den Metropolitanregionen und den übrigen Landesteilen vergrössert sich.» Doch sogleich fügte Amtsdirektor Pierre-Alain Rumley an, dass er sich um eine «ausgewogene Raumentwicklung» bemühen wolle. Das sah man seiner mitgelieferten Schweizer Karte an: Zwar zeigt diese ebenfalls nur fünf Metropolitanräume (bereits St. Gallen ist keiner, während Genf und Lausanne in eine Einheit zusammengefasst werden). Auch solle die zukünftige Siedlungsentwicklung weitgehend im Innern dieser fünf Metropolitanräume stattfinden. Aber eben nicht ausschliesslich. Also ergänzten die Bundesplaner die Zwischenräume: zum Beispiel strategische Städtenetze. Im Wallis reicht eines vom Genfersee via Martigny bis Brig, das nun dank der Neat einen S-Bahn-Anschluss an Bern erhält (die Reisezeit Bern–Visp halbiert sich auf 55 Minuten). Zusätzlich zu diesen neuen Städtenetzen zeichneten die amtlichen Raumplaner einige grüne, ländliche Zentren ein und sämtliche grösseren Tourismusdestinationen in den Bergen. Dennoch blieben einige weisse Flecken übrig, das liess sich nicht vermeiden, aber sie sind eben viel kleiner ausgefallen als bei Avenir Suisse. Auch bei der Wortwahl nahmen die Bundesbeamten Rücksicht. Statt von «alpinen Brachen» reden sie von «bevölkerungsarmen peripheren Gemeinden». Sie würden auch nie sagen, dass sich ganze Talschaften «entleeren»; immerhin legen sie nüchtern dar, «die Gemeinden im zentralen Alpenraum» hätten Jahr für Jahr um bis zu drei Prozent Einwohner verloren, womit sich «insbesondere bei Gemeinden mit weniger als 500 Einwohnerinnen und Einwohnern und bereits lang anhaltendem Bevölkerungsrückgang die Frage der langfristigen Überlebensfähigkeit» stelle. Die dritte neue Schweizer Karte, gezeichnet von den vier Städtebau-Professoren Diener, Herzog, Meili und de Meuron, ist nochmals anders gestrickt. Sie ist keine statistische Darstellung wie bei Avenir Suisse und auch kein Wunschbild für eine «dynamische und solidarische Schweiz» wie beim Bundesamt für Raumplanung. Hinter dieser neuen Karte steckt die Art und Weise, wie namhafte Architekten die Schweiz wahrnehmen. Sie haben «Expeditionen ins Landesinnere» unternommen, die sie «Bohrungen» nennen, eine Methode, mit der sich unendlich viel entdecken lässt, aber etwas ganz sicher nicht: weisse Flecken. Als diese neue Schweizer Karte vor einem Jahr in der Fachzeitschrift Werk, Bauen + Wohnen erstmals publiziert wurde, erzählte Marcel Meili im Interview: «Das Abbild des Alpenraums hat auch uns überrascht.» Im Westen gibt es einzelne Ski-Resorts (Grindelwald, Wengen, Adelboden, Gstaad im Berner Oberland, Leukerbad, Les Diablerets, Verbier, Haute-Nendaz, Crans-Montana, Evolène, Zermatt, Grächen, Saas Fee, Rieder- und Bettmeralp im Wallis). Auch im Osten gibt es einzelne Resorts (im Bündnerland Flims/Laax, Lenzerheide-Valbella, Arosa, Davos, Bergün, St. Moritz). Aber in der Mitte der Schweiz? Ist nichts. «Wir sind, als wir die Situation verbildlicht haben, staunend vor diesem riesigen, zusammenhängenden Loch in der Mitte der Schweiz gestanden.» Dieses «Loch» nannten sie «alpine Brachen», die, schaut man genau hin, eigentlich auf eine einzige Brache hinauslaufen, die riesengross ist und sich vom «geografischen und mythologischen Zentrum rund um den Gotthard» in alle vier Himmelsrichtungen ausbreitet. Wörtlich handelt es sich hier um «Zonen des Niedergangs und der langsamen Auszehrung. Ihr gemeinsames Merkmal ist eine anhaltende Abwanderung.» Es geistert in diesem Kontext ein Missverständnis herum, das von einigen Politikern im Berggebiet bewusst geschürt wird: Man dürfe nicht «von oben herab Leute umsiedeln», wiederholte die Urner FDP-Nationalrätin Gabi Huber stereotyp in einer Fernseh- und Radio-Diskussion auf der Rigi. Das ist absurd: In der Schweiz wird niemand zwangsumgesiedelt, im Gegenteil. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler der Metropolitanregionen geben laufend noch mehr Geld aus, um gegen den Prozess der Entleerung anzukämpfen. Dieses Ziel steht sogar in der Bundesverfassung: So soll die Landwirtschaftspolitik einen «wesentlichen Beitrag zur dezentralen Besiedlung des Landes» leisten. Wird dieses Ziel erreicht? Dies untersucht hat der ETHAgronom Peter Rieder, und zwar im Auftrag des Bundesamts für Landwirtschaft. Sein Fazit: «Die Landwirtschaft leistet nur in relativ wenigen Gemeinden der Schweiz einen wesentlichen Beitrag zur dezentralen Besiedlung.» Trotz den Subventionen und Direktzahlungen, die nirgends so hoch sind wie in der Schweiz, bleibt das Mass der Abwanderung so gross, dass am Ende «viele Dörfer so klein sein werden, dass sie ihre Funktionsfähigkeit verlieren». Rein statistisch müsse heute jede zwölfte Gemeinde der Schweiz als «gefährdet» eingestuft werden. Das ergibt insgesamt 231 «gefährdete» Gemeinden, die sich wie folgt übers Land verteilen: 22 Dörfer im Jura (in denen noch acht Prozent der Kantonsbevölkerung leben), 8 Dörfer in Glarus (sieben Prozent der Bevölkerung), 5 Dörfer in Uri (sechs Prozent der Bevölkerung), 54 Dörfer in Graubünden (fünf Prozent der Bevölkerung) und 46 Dörfer im Tessin (in denen sich nicht einmal mehr drei Prozent der Bevölkerung aufhalten). Damit belegt Peter Rieder, der in Vals GR aufgewachsen ist: Das böse Wort von der «alpinen Brache» ist kein Hirngespinst von Urbanisten. Es ist Realität. Insgesamt ist die Bevölkerung zwar stark gewachsen, um eine Million Menschen in den letzten 30 Jahren. Aber bezogen auf die einzelnen Gemeinden kam es zu einer scharfen Zweiteilung: «Grössere Dörfer werden immer grösser, kleine Dörfer immer kleiner.» Dörfliche Städte, städtische Dörfer Ob in steilen oder in flachen Lagen, alle räumlichen Prozesse laufen hierzulande ähnlich ab: unspektakulär, fast automatisch. Es gab und gibt keine zentrale Instanz, die von oben herab diktieren würde: Da ziehen wir eine richtige Stadt hoch, dort lassen wir ein ganzes Tal verganden. Darum ist ein Downtown Switzerland so wenig vorstellbar wie eine grossflächige reine Wildnis. In der Schweiz entsteht immer Verschiedenes an jedem Ort. Dies entschieden wird grundsätzlich auf der tiefstmöglichen Ebene – also bei den Gemeinden, von denen es bis vor kurzem noch 3000 gab. «Es war nie die Idee der Schweiz, etwas Grösseres zu schaffen, sondern dreitausend Mal dasselbe Kleine grösser», heisst es irgendwo in den drei Bänden der vier Architekten (zitiert nach einer Zusammenfassung in der Zeitschrift Hochparterre). Ganz ähnlich tönte es schon in einem Buch, das 1954 erschienen ist. «Wir bauen im dörflichen Massstab, bis das Dorf eben eine Stadt ist, aber eine Stadt mit dörflicher Bauweise – ohne dass wir fragen, wie denn eigentlich unsere Städte aussähen, wenn wir sie als Städte bauen würden.» Das schrieben ein Schriftsteller und Architekt, Max Frisch, ein Städteplaner und Professor, Lucius Burckhardt, ein Werber und späterer Politiker, Markus Kutter. «Achtung: die Schweiz», hiess der Titel ihrer Broschüre, die als Warnung konzipiert war. «Zwar haben wir bald kein Land mehr, um in dieser Art weiterzudörfeln, aber ein bisschen haben wir schon noch.» Um aus diesem Kreislauf auszubrechen, schlug das Trio vor, anstelle der Landesausstellung Expo 1964 eine neue Stadt zu bauen. Denn «was wir nicht wollen, ist das unselige Durcheinander, wie es rings um unsere jetzigen Städte zu finden ist, halb verstädtertes Dorf und halb dörflerische Stadt». Das Durcheinander hat überlebt, auf dem Berg, im Tal, am See. «Verglichen mit München ist Zürich ein Dorf», meinte Jacques Herzog anlässlich eines Round-Table-Gesprächs mit Avenir Suisse vor zwei Jahren. Doch wenn Zürich keine Stadt ist, gibt es dann überhaupt eine urbane Realität? Das ist ein Widerspruch in sich, den die Architekten aufzulösen versuchen, indem sie in ihrem neuen Buch eine spezifisch schweizerische Form der Urbanität definieren. «In unsern Augen wohnen die Leute selbst dann in der Stadt, wenn sie glauben, auf dem Land zu leben. Uzwiler und Ostermundiger sind Städter», sagten Marcel Meili und Jacques Herzog bereits vor drei Jahren in einem gemeinsamen grossen Interview mit der Weltwoche. «Vielleicht hat es in Ostermundigen mehr Apfelbäume und Wiesen. Aber die Lebensform ist städtisch.» Im Flachland wurde und wird jede Sekunde fast ein Quadratmeter verbaut, meistens für «ausgedehnte Einfamilienhaussiedlungen, unstrukturierte Industrie- und Gewerbezonen, Einkaufszentren und Erlebnisparks mit riesigen Parkplätzen», wie sogar der offizielle Raumentwicklungsbericht des Bundes kritisiert. All das ist tausendmal beschrieben, Millionen Mal beklagt worden, am originellsten vom Stadtwanderer Benedikt Loderer («Hüsli-Schweiz»). Von London lernen Etwas weniger geläufig ist der Prozess, wie er sich in den steilen Lagen abspielt. Mal wird hier eine Wiese nicht mehr gemäht, mal dort eine Alp nicht mehr beweidet. Aus dem Gras wachsen Büsche, aus den Büschen Bäume. Jede Sekunde wächst in der Schweiz auf 1,5 Quadratmetern neuer Wald nach. Das ergibt pro Tag eine Fläche von fünf Fussballfeldern, pro Jahr die Fläche des Thunersees. Nur wächst dieser neue Wald nicht etwa an einem zusammenhängenden Stück, sondern unauffällig an allen Ecken und Enden und Rändern. Genauso unauffällig findet die fortschreitende Urbanisierung im Flachland statt: Die neuen Bauten ragen nicht in den Himmel, sie wuchern hinaus auf die Felder. «Zürichs erstes Hochhaus seit 20 Jahren»: Dieser Titel der NZZ, erschienen am 16. Oktober 2003, spricht Bände. Dabei müsste eine Schweizer Stadt gar nicht so hoch hinaus wie New York; Zürich darf sich auch an London orientieren, einem Grossraum, der nur wenige ganz hohe Gebäude zählt und der eigentlich klein ist, kleiner jedenfalls als der Kanton Zürich. Gleichwohl wohnen dort 7,3 Millionen Menschen, alle mit Zugang zu einem Park in nächster Nähe, und genügend Raum gibt es dort für 4,5 Millionen Arbeitsplätze. Das zeigt: Rein theoretisch bietet allein der Kanton Zürich genug Platz für alle Schweizerinnen und Schweizer, sowohl fürs Wohnen wie fürs Arbeiten. Interessant ist nun, wie London seine Zukunft plant. Das gesamte Stadtgebiet, inklusive Vororte, soll nochmals verdichtet werden. Das geht natürlich nur, wenn die Gebäude stellenweise markant in die Höhe wachsen. «Learning from London», so schliessen die Avenir-Suisse-Autoren ihr Buch «Baustelle Föderalismus» ab und meinen das im doppelten Sinn: städtebaulich wie politisch-institutionell. Gross-London steht unter der Hoheit einer einzigen Behörde, die 33 Bezirke koordiniert. Im Gegensatz dazu erstreckt sich die Metropolitanregion Zürich über elf Kantone und zerfällt in Hunderte von Gemeinden. Jacques Herzog analysiert das ähnlich: «Städte wie Zürich, aber auch Basel und Genf, werden vom Föderalismus blockiert.» Die Macht der Gemeinden Thomas Held, Direktor von Avenir Suisse, der zuvor beim Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL) als Projektleiter eng mit dem französischen Stararchitekten Jean Nouvel zusammengearbeitet hat, freut sich auf das neue «Städtebauliche Portrait»: «Im Grundsatz sind wir uns einig.» Bildet sich eine neue bunte Koalition, bestehend aus namhaften Architekten und radikalen Ökonomen? Wäre der Basler Jacques Herzog in Basel so frei wie in China, würde er «am Rheinhafen bis zu zehntausend Menschen an sensationeller Wohnlage ansiedeln», wie er einmal zur Weltwoche sagte. «Man müsste in grösseren Zusammenhängen denken: Wo ist es sinnvoll, Ballungszentren zu schaffen? Wo sollen Freiräume bleiben?», ergänzte Marcel Meili im Streit ums HardturmStadion. Also geht die nötige Diskussion weit über die erlaubten Ausnützungsziffern in den verschiedenen Bauzonen hinaus. Landesweit gibt es rund 200 Spitäler, wovon die meisten viel zu klein sind, damit sie effizient geführt werden könnten. Im Prinzip würden vierzig Spitäler vollends genügen: Trotzdem wäre jeder Mann, jede Frau, jedes Kind in weniger als einer Stunde im nächsten Spital, wie der Lausanner ETH-Architekt und Gesundheitsökonom François de Wolff gezeigt hat. Sparpotenzial: bis zu zwei Milliarden Franken pro Jahr. «Es stimmt, vierzig Spitäler würden theoretisch genügen, wenn sie am richtigen Ort stünden und die richtige Grösse hätten», bestätigt der Luzerner Markus Dürr, Präsident der 26 kantonalen Sanitätsdirektoren. «Doch wenn ein Regierungsrat nach rein rationalen Kriterien Spitäler schliesst, wird er frühpensioniert.» Ganz ähnlich bei den Universitäten. Das Fach Theologie wird heute an acht Universitäten zur freien Wahl für nicht ganz 300 Studienanfänger angeboten, obschon die einzelnen Bildungsstätten in Pendlerdistanz erreichbar sind. Gemäss Jacques Herzog wäre es zwar falsch, wenn man Szenarien für nur noch drei Universitätszentren entwerfen würde. «Unserer Meinung nach sollten stattdessen die bestehenden Universitäten Schwerpunkte entwickeln.» Genau das hat die Uni Basel versucht und vor zwei Jahren beschlossen, die Bereiche Astronomie, Slawistik und Geologie vollständig aufzuheben. Es kam dann allerdings zu derart heftigem Widerstand, dass dieser Plan fallen gelassen werden musste. Das ist der Stoff, an dem ein Thomas Held verzweifelt. Anders die vier Architekten: Sie zeigen in ihrem neuen Buch seitenlang die Bedeutung der einzelnen Gemeinden, kritisieren deren Macht – um just vor dieser Macht zu kapitulieren, weil sie unveränderbar ist. Es sei zwar denkbar, dass gewisse Gemeinden unter Druck zusammengelegt werden oder dass sie sich zumindest entschliessen, gemeinsam nur noch ein Freibad oder ein Spital zu betreiben. «Das ist aber wohl das Äusserste, wozu Gemeinden fähig sind», meint Jacques Herzog heute. Gleichwohl steckt politischer Zündstoff im «Städtebaulichen Portrait», nämlich in der Debatte um die alpinen Brachen. «Denn die bedeutendste kollektive Übereinkunft zur territorialen Ordnung der Schweiz gründet darauf, dass der Alpenraum über dieselben Rechte, Möglichkeiten, Sicherheiten, Versorgungen und Perspektiven verfügt wie jedes Dorf, jede Stadt, jede Sprachregion und jeder Landstrich», heisst es (zitiert nach Hochparterre). Marcel Meili prophezeit gar den «räumlichen Klassenkampf». Es ist auf alle Fälle nicht gelungen, die Abwanderung aus den hintersten Chrächen aufzuhalten. Und dies, obschon die urbane Schweiz sehr viel Geld spendet. Via Landwirtschaft, Strassenbau, Eisenbahn- und Busverkehr, Postdienste, Armee, Tourismusförderung werden alljährlich Milliarden umverteilt – von den Metropolitanregionen hinauf in die alpinen Brachen. Trotzdem kann die Abwanderung nicht aufgehalten werden, im Gegenteil, die hintersten Täler entleeren sich weiter. «Die gleichmässige, dezentrale Besiedelung des Landes ist nicht realisierbar, alle Trends sprechen dagegen», predigt der Ökonom Walter Wittmann seit Jahren. «Im Extremfall müsste der Bund dafür bezahlen, dass genügend Personen in entlegenen Tälern wohnen, in denen es keine Beschäftigung gibt.» Tabuzone: Abwanderung Der Basler Regionalökonom René L. Frey fragt in seinem neuen Buch dasselbe: «Warum nicht gewisse Täler verwildern lassen?» Wenn sich der Mensch aus Problemregionen zurückziehe, ergäben sich neue individuelle Chancen. «Es geht nicht um Zwangsumsiedlungen, sondern darum, die Rahmenbedingungen so zu ändern, dass Binnenwanderungen gefördert statt gebremst werden.» Das sind keine weltfremden Gedanken. Bis ins Jahr 1970 wurde die Abwanderung innerhalb der Schweiz toleriert; seither wird sie bekämpft, wenn auch erfolglos, neuerdings sogar tabuisiert – allerdings nur innerhalb der Landesgrenzen. Überall sonst auf der Welt tut die Schweizer Entwicklungshilfe alles, um ausgerechnet die Abwanderung aus den Bergen zu fördern. «Ob in Asien, Afrika oder Lateinamerika, wir helfen den Bauern wo immer möglich, von den Hanglagen wieder herunterzukommen und in den Ebenen anzubauen», sagt Remo Gesu von der Organisation Helvetas. «Ziel ist es, die Hänge möglichst bewaldet zu lassen, um die Erosion einzudämmen.» Ökologisch und ökonomisch spricht vieles dafür, die alpinen Brachen sich selbst zu überlassen. Wo sich die Bauern zurückziehen, wächst Wald nach. Ist das schlimm? «Aus gesamtschweizerischer Sicht ist das Überhandnehmen der Natur und die Entvölkerung keine Katastrophe», antwortete Marcel Meili vor einem Jahr. «Es ist ja noch nicht völlig beunruhigend, dass irgend-etwas in diesem Land mal nicht überbaut wird.» Diese letzte Aussage muss inzwischen relativiert werden. Wie im «Städtebaulichen Portrait» nachzulesen ist, wurde (noch) nicht das ganze Mittelland vom Lac Léman bis zum Bodensee verbaut und zersiedelt. Dazwischen blieben wenigstens drei grössere Inseln verschont, die nun «stille Zonen» genannt werden: Appenzell-Toggenburg, das Napfgebiet und die Freiburger Voralpen. Die Weltwoche, Ausgabe 44/2005 Der Schweizer Wintertourismus steckt in der Krise Seit 20 Jahren stagniert die Zahl der Hotelübernachtungen. Immer weniger Tage stehen die Schweizer und Schweizerinnen pro Jahr auf ihren Skiern und Snowboards in den Schweizeralpen. Viele Schweizer machen Ferien im günstigeren Ausland. Insgesamt gingen seit 2005 192.00 Hotelübernachtungen in St. Moritz verloren. Immerhin sind das knapp 20 Prozent. Längst hat sich die Eurokrise auf den Tourismus in dem Schweizer Bergdestinationen bemerkbar gemacht. Während dem der Städtetourismus davon kaum betroffen ist. Im Gegenteil die Stadt Zürich boomt. Vor ca. 150 Jahren war der Tourismus eine Möglichkeit sich aus der bäuerlichen Armut zu entkommen. Heute arbeiten nur noch wenige Schweizer im Hotel-und Gastgewerben. Primär arbeiten nun Ausländer dort. Für Schweizer Verhältnisse liegt der Lohn auch eher im unterem Bereich mit 4108 Franken mit Berufslehre. Man spricht sogar von einer Armutsfalle, wenn man in dem Bereich tätig ist. (DIE ZEIT Nr. 1/2015; NZZ 2014) Klimawandel Wärmeres Klima bewirkt im Winter mehr Niederschlag. Allerdings nimmt dabei die Schneemenge bei erhöhter Temperatur ab. Das führt dabei zur Abnahme von Schneemenge. Helfen können heute noch Schneekanonen. Jedoch wird es in der Zukunft immer wie aufwendiger und deswegen lohnt es sich wirtschaftlich irgendwann nicht mehr. Der abnehmende Schneefall kann noch bis Mitte dieses Jahrhunderts kompensiert werden. Trotzdem verkürzen sich die Saisondauern immer mehr. In der Schweiz sind vor allem die Skigebiete im Berner Oberland, in der Zentralschweiz, im Tessin sowie in den Kantonen Waadt und Freiburg betroffen vom Klimawandel. Der Klimawandel bedroht mehr und mehr den Wintertourismus in den Alpen. So ist bei einem Temperaturanstieg um vier Grad die Schneesicherheit in diesen Regionen nicht mehr gegeben. Schon bei einem Temperaturanstieg von einem Grad wären noch 500 von 666 grösseren Skiregionen schneesicher. Bei vier Grad würden nur noch 200 Skiregionen übrig bleiben. Dennoch sind die Alpenländer in der Schweiz am wenigsten betroffen vom Klimawandel. Kantone wie Wallis und Graubünden, welche auch höher liegen, müssen nur geringe wirtschaftliche Auswirkungen des Klimawandels hinnehmen. Klimawandel kann aber auch positive Aspekte beinhalten. So würden immer mehr Gäste wegen denn zu heissen Temperaturen am Mittelmehr sich in die Alpenregionen zurück ziehen. Nichtsdestotrotz wird der Sommertourismus in der Schweiz an Bedeutung gewinnen. So soll auch die saisonale Abhängigkeit verringert werden. (NZZ 2006) Gemeinde Tschlin Die Gemeinde Tschlin liegt im Unterengadin und grenzt an Österreich und Italien. Die Einwohnerzahl beträgt 429. Gesprochen wird romanisch. Wie viele andere abgelegene Berggemeinden schwindet auch hier die Einwohnerzahl. Viele Häuser stehen nun leer. Vor allem macht die Privatisierungsund Deregulierungspolitik dieser Gemeinde zu schaffen. Die Poststelle wie auch die Schule wurden z.B. geschlossen, was die Gemeinde für Neubürger(innen) nicht attraktiver macht. Vor etwa zehn Jahren entstand das Entwicklungskonzept Tschlin 2000“, welche durch eine Umfrage entstand. Ziel war es, eine sanfte und nachhaltige Entwicklung der Gemeinde und Arbeitsplätze sollen geschaffen werden. Alles unter dem Aspekt, dass das Dorfbild erhalten bleibt. So wurde Tschlin Mitglied des Gemeindenetzwerks „Allianz in den Alpen“. Im neuen Baugesetzt wurden strenge Bestimmungen über den Umbau von Erstwohnungsanteilen erlassen. Dabei soll verhindert werden, dass baufällige Häuser als Ferienhäuser verkauft werden. Ziel sollte damit sein, dass die touristische Entwicklung im Dorf bleibt. Das liberale Baugesetzt lässt auch moderne Umbauten zu. Voraussetzung ist, dass ein architektonisch befriedigendes Projekt entsteht. Die Umsetzung des Entwicklungskonzeptes gestaltete sich nicht einfach. Viele Bewohner äusserten Bedenken und Ängste, was auch zu mangelndem Engagement führte. So scheiterte das Hotelprojekt von Peter Zumthor. Das Projekt war ein Teil dieses Entwicklungskonzeptes. Zudem sprach dieses Projekt die Bewohner an. Aber die Angst vor den finanziellen Konsequenzen und die Auswirkungen auf das Dorfleben überwiegten. Der Projektkredit wurde somit abgelehnt von der Gemeinde. (Heimatschutz 2003) Allianz der Alpen: Ein Zusammenschuss von Gemeinden und Regionen aus insgesamt 7 Staaten des Alpenraums. Die Mitglieder entwickeln gemeinsam den alpinen Lebensraum. Grundlage und Leitfaden für diese nachhaltige Entwicklung ist die Alpenkonvention. Momentan sind55 Gemeinden Mitglied im Schweizer Netzwerk. (SAB „Allianz der Alpen“) Adelboden Wellnessbad Für ca. 140 Millionen Franken soll in Adelboden ein Wellnessbad mit einem Fünfsternhotel entstehen. Auf einer Brache im Dorf, soll ein Fünfsternehotel mit 200 Betten gebaut werden. Die Investoren geben sich jedoch nicht zu erkennen, was auch auf Verunsicherung stösst. Finanzieren will es nun die Basler Innovafina Project AG. Es wird mit 400 Besuchern pro Tag im Bad gerechnet. Das Hotel steht aber auch unter Kritik. Einige würden lieber ein Familienhotel an dieser Stelle sehen. Vor ungefähr 10 Jahren entstand dieses Vorhaben mit einem arabischen Investor. Dieser ging im Zuge der Finanzkrise jedoch pleite. Nun kam es zu einem Abbruch der arbeiten. (BZ 2014; Der Bund 2014) Intercontinental in Davos Das Luxushotel wird wegen seiner Form und Farbe auch „Goldenes Ei“ genannt. Nach nur einem halben Jahr nach der Eröffnung ging das Hotel insolvent. Schlechte Verträgen sind ausgehandelt worden. Zudem verlangte die Credit Suisse einen zu hohen Pachtzins. In Davos ist nicht das ganze Jahr World Economic Forum. Denn in der Zwischenzeit läuft kaum etwas. Deswegen macht es auch keinen Sinn das ganze Jahr geöffnet zu haben. Zudem war nicht mal die Hälfte der Ferienwohnungen verkauft worden. Die Individualgäste sollten mit der auffallenden Architektur angelockt werden, diese blieben aber aus. Der Buissnessplan ging von einer Auslastung von 60 Prozent aus. Zu optimistisch hiess dabei in der Kritik. Im Unterschied zu Andermatt baut Sawiris jene Ferienwohnungen, welche auch schon verkauft sind. Zudem besitzt Sawiris mehrere finanzielle Standbeine. Hinzu kommt das der Bund den Ausbau des Skigebietes bewilligt hat. Zudem bestehen vier weitere Chedi-Hotels. Hotel Intercontinental gibt es weltweit tausendfach. Dieses Hotel hat sich an städtischen Beispielen orientiert. Der Unterschied ist, dass dort Konferenzen, Meetings oder Messen unabhängig vom Wetter statt finden. Deshalb sind städtische Hotels weniger anfällig auf Absagen. Schlechtes Wetter in den Bergen und die dazu kommenden Absagen können schnell zu 200’00 Franken Verlust führen. Kurz nach der Konkurs Bekanntgabe wurde auch schon der neue Pächter präsentiert: die Davoser Weriwald AG. Eine nahtlose Weiterführung des Hotelbetriebes wird angestrebt. Insgesamt verfügt das Hotel 216 Zimmer und Suiten mit Balkonen. Der SpaBereich umfasst 1200 Quadratmeter und Konferenzräume erstrecken sich über 1500 Quadratmeter. Das Hotel verfügt zudem noch über drei Restaurants, Bars und Sportgeschäfte. (Tagesanzeiger 2014; SRF 2014) Château Gütsch Das Hotel verfügt über 27 Zimmer. Kein Zimmer ist gleich wie das Andere. Ein Hotel im Märchenstil. Luxus befindet sich in jeder Ecke des Hotels. 2014 wurde das Hotel wieder eröffnet nachdem es seit 2003 geschlossen war. 2002 übernimmt die italienische Gruppe Turin Hotels Internationals das Viersternehotel als Pächter. Im Folgejahr geht die Firma Konkurs und damit auch das Hotel zu. Schliesslich kauft 2007 der russische Milliardär Alexander Lebedev das Schlosshotel. Nun soll das Haus umgebaut werden. Zwischenzeitlich wird die Gütschbahn stillgelegt. Es kommt zu mehren Anläufen, welche jedoch scheitern. Zudem verzögern sich die Bauarbeiten. Die Stadt Luzern übernimmt schliesslich 2014 einen Teil der Finanzierung der Sanierung der Bahn. 2014 öffnet das Hotel seine Türen nach einem längeren Umbau. Trotz dem grossen Kapital des Investors stand das Hotel mehr oder weniger insgesamt elf Jahre still. Solch ein unterfangen könnte in Zukunft auch Luxushotels in den Alpen treffen. Es wird zwar investiert aber der Erfolg bleibt aus. Zudem kommt dazu, dass dieses Hotel grundsätzlich au ganzjährlich funktionieren könnte. Die prominente Lage des Hotels, nämlich über dem Vierwaldstädtersee und der Stadt Luzern, könnte viele Besucher anlocken. Unlängst ist das Hotel ein Wahrzeichen von Luzern geworden. (NLZ 2014; NZZ 2013) Naturschutz Die Schweiz ist geprägt durch eine Vielfalt von Natur und Landschaft. Dieser Fakt deutet auf eine nationale Identität hin. Für unsere Gesellschaft ist es somit eine wichtige Angelegenheit, die Landschaft und die Natur zu erhalten. Nebst den natürlichen Faktoren enthält die Natur für die Bevölkerung auch Identität. Die Natur steht jedoch unter Druck. Sie wird zersiedelt und immer mehr Verkehrsmöglichkeiten werden gebaut. Die Herausforderung für das Volk ist es, die Natur wachsen und sich weiterentwickeln zu lassen, gleichzeitig aber auch nach Wachstum zu streben. Seit dem Jahre 1994 ist der Alpenschutz-Artikel in der Verfassung enthalten. Er geht zurück auf die Volksinitiative, die vom Verein "Zum Schutz des Alpengebietes vor dem Transitverkehr" erfasst, und im Jahre 1994 vom Volk mit 52% angenommen wurde. Die Alpenschutziniative sieht vor, die negativen Belastungen des Verkehrs zu lindern. Menschen, Tiere und Pflanzen, sowie ihre Lebensräume, sollten nicht geschädigt werden. Auch sieht die Initiative vor, dass der alpenquerende Gütertransitverkehr auf der Schiene erfolgt. Die Anzahl der Strassen in den Alpengebieten soll nicht erhöht werden. Die Initiative hängt zusammen mit dem Vorhaben der Grossinvestoren auf den Schweizer Alpen. Der Bezug zum Verkehr zum schon bestehenden Gesetz hängt eng zusammen mit den Grossinvestoren – je mehr auf den Alpen gebaut wird, desto mehr Verkehr, Verschmutzung und Belastung würde dies für die Berggebiete bedeuten. Durch das weltweite Konkurrenzdenken verliert der gesamte Alpenraum seine Eigenschaften. Er wird zweckentfremdet, und zur Kulisse von Projekten. Die Gelder für den Schutz der Wälder nehmen ab, und Rodungen werden trotz Verbotes geplant. Da die Alpen ein Anzugsgebiet für Touristen sind, stellt sich die Frage, ob sie nur noch eine Kulisse für die Menschen sind, an welcher sie ihre Bedürfnisse befriedigen können, also verschiedene Vergnügen wie Skifahren, Wandern, Klettern. Zusätzlich kommt dazu, dass es immer mehr Strassen und Verkehr auf den Alpen gibt. Die Gewerbe- und Verkehrsflächen nehmen zu, wobei die Grünfläche automatisch abnimmt. Durch menschliche Eingriffe ist die Vielfalt der Arten in den Alpen in Gefahr. Immer mehr Nutzungsansprüche wirken sich negativ auf die Alpen aus. Dies führt zu einer Zerstörung der Natur, sowie zu einer Überlastung des Ökosystems in den Alpen. Die Umweltorganisation setzt sich gegen die Zersiedelung und für die Natur ein. Dass dies nicht immer Erfolg hat, zeigt sich im Beispiel von Mollens, VS. Sie reichte eine Klage gegen das Vorhaben einer russischen Firma ein. Diese planten eine edle Hotelanlage „Le Village Royale“, welche 15 Chalets beinhaltet. Die Gesamtkosten für die Errichtung von „Village Royal“ betragen mehr als 650 Millionen Schweizer Franken. Das schweizerische Bundesgericht lehnte die Klage des Umweltschutzes ab, und erlaubte den Russen den Bau der Luxusanlage. (Aargauer Zeitung, 2010, Themen-Nr.:276.4; Sputnik, 2012; Dr. Bertold Suhner-Stiftung, 2011; Bund Naturschutz; Alpeninitiative, 1999) Moderne Architektur vs. Bergchalets Es stellt sich die Frage, wie gut oder schlecht sich die moderne Architektur der Grossinvestoren auf den Alpen auswirken würde. Es ist gut möglich, dass die modernen Bauten nicht mit der schon bestehenden Landschaft und den bestehenden Gebäuden verschmelzen, sondern dass sie negativ auffallen könnten. Wenn sich der Architekt aber genug Zeit nimmt, sich die bestehenden Häuser zu begutachten, und Recherchen über die Umgebung betreibt, könnte es gut möglich sein, dass sich durch die Neubauten in den Bergdörfern einen Aufschwung ergeben würde. Es gäbe neue Arbeitsplätze für die Dörfer und dies könnte einen wirtschaftlichen Aufschwung der Gemeinden führen. Die Schweizer Chalets und Berghäuser haben einen eigenen Stil, für manche bedeutet dieser Heimat. Die Häuser sind charakterisiert durch vorkragenden und verzierte Dächer, Balkone und Schnitzereien. Heutzutage baut man nicht mehr so – die Häuser sind modern, die Formen strukturiert und ähneln keineswegs mehr der Chalet Architektur. Ob diese Vermischung der beiden Stile sich positiv oder negativ auf das Dorf, beziehungsweise die Stadt auswirkt, steht noch offen. Es ist gut möglich, dass die Mischung der beiden Stile das Landschaftsbild der ehemaligen „urchigen“ Bergdörfer zerstört. Dies könnte eine grosse Herausforderung für die Investoren bedeuten: ist es möglich, zum Beispiel eine grosse Anlage auf den Bergen zu bauen, welche sowohl die Interessen der Einwohner, sowie die der Touristen befriedigen? Da die Touristen ein gewisses Vermögen haben müssen, um sich überhaupt eine Reise in dieses Gebiet leisten zu können, könnte es also schwierig werden, eine Anlage für alle Bedürfnisse der beiden Zielgruppen zu gestalten. Die Bevölkerung der Bergdörfer könnte sich also „bedroht“ fühlen, wenn eine Berglandschaft durch ein Projekt zersiedelt würde. Die Idylle, die Atmosphäre und die Landschaft könnte sich komplett verändern. Klar ist es, dass dieser Neubau sich natürlich nicht grossflächig auf das ganze Dorf ausbreiten würde – die Auswirkungen dieser Anlagen könnten jedoch prekär sein für die ganze Stadt. Es müssten mehr Verkehrsmöglichkeiten gebaut werden, denn die Besucher brauchen eine Möglichkeit, zu dieser Anlage zu gelangen. Die Anzahl der Restaurants, Bars und Freizeitangebote würde sich automatisch vergrössern, da die Touristen gewisse Ansprüche mit sich bringen, beziehungsweise nicht an einen Ort in die Ferien gehen, an welchem es kein gewisses Angebot gibt. Das Ortsbild der Bergdörfer bzw. der Alpen würde sich stark verändern durch den Eingriff der Investoren. Ob dies eine positive oder negative Auswirkung hätte, steht jedoch offen. Die Bewohner könnten sich beispielsweise auch über ihre versperrten Aussichten und mögliche Schattenwürfe beklagen. Wenn die Investoren den Bewohnern ihr Projekt aber schmackhaft machen können, und die Leute von ihrem Vorhaben überzeugen können, dann würde sich der gesamte Geist der Bergdörfer positiv verändern. Ob die Investoren Schweizer oder Ausländer sind, spielt grundsätzlich keine Rolle. Der Geldgeber sollte sich zwingend mit der Kultur, dem Land, der Gegend und der Bevölkerung auseinandersetzen. Durch einen falschen „Eingriff“ in die Bergdörfer könnten falsche Absichten entstehen: die gebaute Landschaft würde eine künstliche Atmosphäre erzeugen und die (Berg-)Kultur würde verloren gehen. Es könnte schnell der Fall sein, dass sich die Bauten nicht mit dem jetzigen Stand der Dörfer vereinen und völlig fremd wirken. Fakt ist also, dass eine mögliche Zweckentfremdung des Gebietes folgen könnte, wenn der Investor sich nicht mit dem Gebiet auseinandersetzt. Geld spielt heutzutage immer die grösste Rolle in allen Projekten und Geschäften. Wenn die Vorhaben der Investoren wenig mit den jetzigen Bergregionen zu tun haben und sich nicht anpassen, dann würde eine künstliche Stadt entstehen. Die „wahre Schweiz“ würde verloren gehen, obwohl mehr Arbeitsplätze als positiver Effekt der Neubauten folgen würde. Diese Arbeitsplätze würden jedoch nicht alle von Schweizern und Einheimischen besetzt werden, sondern von Pendlern und eventuell Ausländern. Durch diesen Bevölkerungszuwachs würde sich die Bergregion prekär verändern, je nach Grösse der geplanten Anlage. Zweitwohnungsinitiative Das Thema der Zweitwohnungen war in der letzten Zeit eine heisse Diskussion. Die Initiative forderte, dass nicht mehr als 20% aller Wohnungen in jeder Gemeinde Zweitwohnungen sind. Dieser Dies hätte zur Folge, dass die Zersiedelung gestoppt würde. Das Problem war, dass zu viele Wohnungen das ganze Jahr lang leer standen, und es zu viele „kalte Betten“ gab. Viele Familien besitzen eine Zweitwohnung, um dort Ferien zu machen. Sie sind nur wenige Tage im Jahr dort, um beispielsweise Ski zu fahren. Viele Leute besitzen eine Zweitwohnung, um sich dort an den Wochenenden aufzuhalten. Jede einzelne Zweitwohnung beansprucht eine gewisse Fläche, und durch diese wird die Zersiedelung der Landschaft gefördert. Für einheimische Personen wird es schwieriger, eine Wohnung zu finden, da die Miet- und Kaufpreise durch diese Zweitwohnungen ansteigen. Die Initiative forderte also, die Landschaft und die Gebiete mit vielen leerstehenden Wohnungen zu schützen, und mehr Sorge zu tragen, indem mehr Wohnungen bewohnt werden. Nicht mehr als 20% der Wohnungen in allen Gebieten sollen Zweitwohnungen, und somit leerstehende Wohnungen sein. Die Initiative fördert somit einen Zurückgang der Zersiedelung, und will die Situation in den (vor allem) Bergregionen verbessern. In den Kantonen Wallis, Graubünden und Tessin sind die Auftragseingänge der Baubranchen gesunken, im Berner Oberland nur leicht gestiegen. Die Baumeister sehen den Grund dafür in den Einsprachen der Initianten der Zweitwohnungsinitiative in den Alpen. Diese Initiative hat einen starken Zusammenhang mit der Zersiedelung der Alpen (durch Grossinvestoren). Das Volk hat das Bedürfnis, die Berge und die Landschaften zu schützen. In den Tourismusregionen ging die Bautätigkeit stark zurück. Das Ziel der Initiative war es unter anderem, die Bergdörfer zu beleben. Die Besitzer sollten nicht nur einige Wochen oder Tage pro Jahr in ihren privaten Ferienwohnungen sein, sondern sie zum Beispiel unter dem Jahr vermieten, um die Dörfer zu beleben. (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2014) Situation Andermatt Die Wirtschaft in Andermatt, bestehend aus Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe und Dienstleistung, wird zu 71.79% von Einheimischen geführt. Rund 100 Personen pendeln täglich in einen anderen Kanton, um dort zu arbeiten. Die Anzahl der Zupendler pro Tag beträgt 220. Diese Zahlen könnten steigen, wenn sich die Wirtschaft und der Hotelbetrieb in Andermatt vergrössert. Andermatt ist ein Wintersportgebiet und ein Kurort. Das Handeln des Grossinvestors Saviris versprach dem Volk eine starke touristische Entwicklung. Die Umweltverbände in Uri kritisierten, dass diese geplante Zone für den Wintersport zu gross seien. (Wikipedia, 2015) Situation Vals Die Wirtschaft in Vals ist stark abhängig vom Tourismus. Die Industrie in diesem Gebiet ist sehr stark. Sie beinhaltet Kraftwerke, eine SteinplattenFirma und Mineralquellen (Valser Wasser). Der von Remo Stoffel geplante Hotel-Wolkenkratzer forderte ende März unzählige Diskussionen. Sein geplanter Turm sollte 381 Meter hoch sein, luxuriöse Suiten umfassen, und für reiche Geschäftsleute dienen. Laut Stoffel hätte dieser Turm den wirtschaftlichen Abgrund verhindern können, da die Strategien für Massentourismus in den Alpen laut ihm nicht funktionieren können. Vals und Andermatt sind zwei Beispiele, wie sich Bergdörfer durch Investoren in grössere Städte verwandeln können. Je nach dem, wie viel Wert auf die bisherige Kultur und die bisherigen Bauten gelegt wird, kann so ein Projekt gut gehen oder scheitern. Was das Projekt in Vals anbelangt zeigt, dass die Bevölkerung gegen eine komplette Veränderung des Landschaftsbildes in Vals war. (Neue Zürcher Zeitung, 25.5.2015; Wikipedia, 2015) Zersiedelung Durch die wachsende Bevölkerung wird die Zersiedelung gefördert. Werden Plätze und Areale aber schlau umgenutzt, könnte dies teilweise das Problem lösen. Immer mehr Einwohner leben in der Schweiz, unter anderem weil die Städte seit den 80er Jahren wieder attraktiver wurden. Nach Schätzungen von Avenir Suisse misst die Einwohnerzahl im Jahre 2040 in der Schweiz rund 10 Millionen. Laut Berechnungen der UBS könnte es sogar sein, dass bereits im Jahre 2031 10 Millionen Menschen in der Schweiz wohnen. Es stellt sich also die Frage, wo diese Menschen wohnen und arbeiten werden. Nur ca. 1% aller Schweizer Immobilien stehen leer. Wird die Einwohnerzahl nun zunehmen, würde das bedeuten, dass für jeden Zuwanderer neu gebaut werden muss. Raumplaner setzen sich als Ziel, eine Zersiedelung zu verhindern. Die wachsende Bevölkerung hat dazu geführt, dass unsorgfältig auf unbebauten Flächen Wohnraum geschafft wurde; dies sollte nicht mehr vorkommen. Laut dem verfassten Raumkonzept Schweiz soll sich die Siedlungsentwicklung auf die überbauten Gebiete konzentrieren. Die Zauberformel lautet «Siedlungsentwicklung nach innen» oder «innere Verdichtung». Dass es enger werden wird, ist ein Fakt. Die Schweiz wird verpflichtet, mehr Häuser in die Höhe zu bauen. Die Frage ist nun, ob sich der Charakter der Städte dadurch verändern würde. Das Erscheinungsbild der verschiedenen Gemeinden würde sich komplett verändern, was die Einwohner kaum akzeptieren würden. Für die Schweiz ist es typisch, dass der Charakterzug eines Ortes immer erhalten bleiben muss. In der Stadt Zürich bestehen Geschossflächenreserven von mehr als 14 Millionen Quadratmetern, wovon die Hälfte für Wohnzonen gebraucht werden kann. Pro Person rechnet man zurzeit mit ca. 45 Quadratmetern Wohnfläche, was zu bedeuten hätte, dass Wohnraum für rund 150'000 Personen geschaffen werden könnte. Die Stadt Zürich könnte also um einen Drittel wachsen. Die Gebiete, welche Platz für mehr Bauten hätten, sind meistens nicht begeistert von Neubauten in ihrer Nähe. Sie sind nicht interessiert an einer Verdichtung. Ziel ist es unter anderem, eine Mischung von Wohnund Gewerbeflächen zu bauen. Problematisch an diesen Fakten ist die wachsende Anzahl Quadratmeter Wohnfläche pro Person – sie steht im Gegensatz zur Verdichtung. Würde es zu einer Verdichtung kommen, wäre dies gleichzeitig auch eine Chance für neue Wohn- und Lebensformen. Durch die bebauten Zonen würden die freien Zonen mehr Bedeutung erhalten. Ziel ist es nicht, alle Erholungszonen aus den Wohnzonen zu streichen. Der Markt entscheidet schlussendlich, ob eine Verdichtung gelingen wird. Sicher steht jetzt schon, dass die Baubranchen in den nächsten Jahren genug zu tun haben werden. Bergdörfer Siedlungen und Einzelgebäude sind schuld an der schweizweiten Zersiedelung. Durch sie fallen unter anderem höhere Kosten für Infrastruktur an, mehr Pendler sind unterwegs und Pflanzen und Tiere verlieren ihren natürlichen Lebensraum. Diese Zersiedelung stellt also eine Gefahr für Mensch und Tier dar. Es gibt jedoch auch Fakten, dass sich Bergregionen nicht nur negativ entwickeln: Der Bund ist stark daran interessiert, dass die Abwanderung in den Bergdörfern sich stabilisiert. Viele Berggebiete verloren durch die Zersiedelung in Städten an Aufmerksamkeit. Nicht zu vergessen ist, dass sich neue Beziehungen zwischen Stadt und Berggebieten entwickelt haben. Immer mehr junge Familien ziehen sich in ein Berggebiet zurück. Jede Gebiete, welche eher in der Nähe einer Stadt liegen, entwickelten sich in den letzten Jahren dynamisch weiter. (Pendlerströme). Sie profitierten von exportorientierten Unternehmen, welche in den ländlichen Gebieten angesiedelt sind, und von der Nachfrage der dort lebenden Pendler. Das Ziel des Bundes ist es also, den ländlichen Regionen eine Perspektive zu geben. (Neue Zürcher Zeitung, 2012) Bergdörfer erhalten und neu beleben Man fragt sich, was die Zukunft der Bergdörfer in der Schweiz ist. Massentourismus und unverhältnismässige Eingriffe sind bereits passiert, dagegen muss jedoch gehandelt werden. Es ist problematisch, wie heutzutage in Bergdörfern gebaut wird. Die gebauten Häuser integrieren sich teilweise schlecht in die historischen Kerne und verbrauchen eine Grosse Anzahl Fläche. Häuser, welche sich nicht in das Gesamtbild des Gebietes einfügen, sind keine Seltenheit mehr – vielmehr verfälschen sie die Identität der Orte. Die Anforderungen sind nicht, so zu bauen wie unsere Vorfahren. Mit Hilfe moderner Mittel sollte gebaut werden, man sollte sich jedoch mehr von ursprünglichen Bauten inspirieren lassen. Die Bevölkerungen auf Bergdörfern lebten meist sparsam und einfach. Die Häuser bestehen aus einfachen Konstruktionen, sie sind dauerhaft und stabil. Holz und Stein sind die Hauptelemente dieser Bauten; sie verbinden die Gebiete mit der Natur und sind oftmals einheimisch. Dies deutet auf eine umweltfreundliche Architektur hin. Neubauten in Bergdörfern haben die Aufgabe, die Dörfer zu beleben. Wenn den Architekten dies gelingt, werden viele Besucher angezogen, was zum Wirtschaftswachstum beiträgt. Es muss den Bauherren sozusagen gelingen, mit dem Neubau eine Verbindung von Alt und Neu zu erzielen. (Heimatschutz Patrimoine, 2009) Die Tourismus-Destination Schweiz gibt es erst seit rund 150 Jahren. Es waren vorallem englische Touristen, die sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts von den Alpen faszinieren liessen. Zu den wenigen Besuchern, die schon früher das Land und besonders die Alpen durchquert hatten, gehörten Pilger auf der Durchreise nach Italien oder Spanien, Säumer und ihre mit Handelsware vollgepackten Saumpferde, sowie ab dem 16. Jahrhundert die ersten Humanisten und Naturforscher aus den grösseren Schweizer Städten, welche die Alpen mitsamt ihrer Flora und Fauna zu erforschen begannen. Die "Grand Tour" Im 18. Jahrhundert gehörte es für junge Adelsherren und Grossbürgersöhne aus England, Deutschland und Skandinavien, teilweise auch aus Amerika, zum guten Ton, ihre klassische Ausbildung mit einer Reise zu den historischen Stätten und Landschaften in Frankreich und vor allem Italien abzuschliessen. Das nannte sich die "Grand Tour", im Deutschen etwa auch als "Kavaliersreise" oder "Jungfernfahrt" bezeichnet. Einer der berühmtesten dieser "Gentlemen-Touristen" im 18. Jahrhundert war James Boswell, der spätere Biograph des Gelehrten Samuel Johnson. Als Zwischenstation auf der Reise von und nach Italien gehörte die Schweiz zur Grand Tour. Im 19. Jahrhundert verweilten romantische Dichter und Schriftsteller wie Lord Byron oder das Ehepaar Percy sowie Mary Shelley bei ihren Reisen durch Europa auch einige Zeit am Genfersee und in den Alpen. Sie verwandelten ihre Eindrücke in Geschichten. herrliche Gedichte oder fantastische Die Eroberung der Alpen Ab dem 18. Jahrhundert unternahmen Schweizer Forscher wie Horace-Benedict de Saussure erste Klettertouren in den hohen Alpen. Die Gipfel von Jungfrau und Finsteraarhorn wurden 1811 beziehungsweise 1812 erstmals bestiegen; das Matterhorn wurde 1865 bezwungen – eine Erstbesteigung, die tragisch endete. Nach der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Alpen in rascher Folge Gipfel um Gipfel erobert, in erster Linie von britischen Besuchern, die auch den Schweizer Alpen Club (SAC) gründeten. Diese Organisation besteht noch immer und unterhält ein alpenweites Netzwerk von Hochgebirgsunterkünften für Bergsteiger. (swissinfo.ch 03. Februar 2011) Das Aufkommen des Massentourismus So richtig begann der Tourismus in der Schweiz 1858 mit der ersten Pauschal-Ferienreise durch Europa, organisiert vom englischen Unternehmer Thomas Cook. Zu den frühen Ferienreisenden in die Schweiz gehörte auch Sir Arthur Conan Doyle, den die Reichenbachfälle bei Meiringen im Berner Oberland derart beeindruckten, dass er gleich den Abgang seines Romanhelden Sherlock Holmes dorthin verlegte. Jetzt wurden auch Strassen über die Alpenpässe gebaut. Und die neuen Verkehrswege, namentlich die Eisenbahnen, erschlossen die Alpen endgültig dem Massentourismus. Dank der Erfindung der Zahnradbahn konnten bald auch steilste Steigungen auf dem Schienenweg überwunden werden – ein technischer Fortschritt, von dem die Schweizer Bahnkonstrukteure in der Folge ausgiebig Gebrauch machten. Im späteren 19. Jahrhundert wurden nicht bloss Eisenbahnen, sondern auch Hotels gebaut, in denen die immer zahlreicheren Besucher und Besucherinnen Unterkunft finden konnten, beispielsweise in Grindelwald. Ebenfalls aus dieser Zeit stammen die ersten grossformatigen Bildreklamen für Touristenorte – die Tourismusplakate oder Reiseposter – und natürlich die Urmutter aller Ferienandenken, die Ansichtskarte. (swissinfo.ch 03. Februar 2011) Luftschlösser in den Alpen Die Araber wollen nun doch nicht. Vergangene Woche ist die Pearl of Kuwait Real Estate Company aus dem Alpenbad Adelboden ausgestiegen. Das 140-Millionen-FrankenProjekt, welches der Tourismusdestination frischen Wind und neue Gäste bringen soll, steht nach mehrjähriger Planungsphase erneut auf wackeligen Beinen. Die Araber wollen nun doch nicht. Vergangene Woche ist die Pearl of Kuwait Real Estate Company aus dem Alpenbad Adelboden ausgestiegen. Das 140-Millionen-FrankenProjekt, welches der Tourismusdestination frischen Wind und neue Gäste bringen soll, steht nach mehrjähriger Planungsphase erneut auf wackeligen Beinen. Schnell kommentierte die Konkurrenz andernorts, dass man im Berner Oberland wohl auf Sand gebaut habe. (NZZ 8.8.2010) Im Wallis und in Graubünden versandet zwischen hochfliegenden Plänen und dem ersten Spatenstich ebenfalls einiges: In der 850-Seelen-Gemeinde Mollens (VS) haben Umweltverbände dem Village Royal der russischen Mirax Group – einem Resort mit 5-Sterne-Hotel, 2500 Betten und einem Spa für Pferde – den Kampf erklärt. Zu wenig ökologisch sei das Projekt, zu unsicher die Finanzkraft der Russen, heisst es beim Landschaftsschutz Schweiz in Bern. Den eingelegten Rekurs wird man, falls nötig, bis vors Bundesgericht ziehen. Für das avantgardistische Hotel im Davoser Stilli-Park wurde zwar mit der IntercontinentalGruppe ein renommierter Betreiber gefunden, aber noch immer nicht die dafür benötigten 250 Mio. Fr. Es sind jedoch nicht nur Luftschlösser, die in den Alpen gebaut werden. Über 60 Grossprojekte zählen die Wirtschafts- und Tourismusverbände der Bergkantone in ihren Destinationen, wie aus dem im Juni in Zusammenarbeit mit dem Seco erschienenen «Leitfaden zur Ansiedlung für Feriendörfer und Hotels» ersichtlich ist. Allen voran Samih Sawiris' Andermatt Swiss Alps, welches auf eine Investition von 1,5 Mrd. Fr. veranschlagt ist. Selbst wenn, wie Experten schätzen, davon vielleicht nur ein gutes Dutzend realisiert werden, ist das im historischen Vergleich ein RekordBauboom. «Das Vertrauen der Investoren in die Tourismusdestination Schweiz ist zurückgekehrt», freut sich Christoph Juen, Direktor von Hotelleriesuisse. Es mache sich nun bezahlt, dass viele Betriebe in den Jahren vor der Krise ihre Eigenfinanzierungskraft erhöht hätten. Dadurch sei man aus der Rezession mit einer relativen Stärke hervorgegangen. Zudem schätzen ausländische Investoren die langfristig stabilen Perspektiven, wie der Staatsfonds aus Katar, der mit 500 Mio. Fr. an verschiedenen Orten engagiert ist. Laut Juen profitiere die Schweiz zudem vom prognostizierten Anstieg des globalen Tourismus (laut WTO jährlich plus 4%), andererseits von einer weltweiten Rückbesinnung auf die Schweiz. «Dazu kommen vermehrt Kunden aus neuen Märkten wie Indien, Arabien und Asien.» Und da diese Gäste öfters in grösseren Verbänden reisen, schätzen sie die Möglichkeit, in einem Resort mehrere Wohnungen zu mieten. Die im Ausland schon länger etablierte Beherbergungsform erfreut sich in der Schweiz zunehmender Beliebtheit. Neben dem Bemühen, durch Pflichtvermietung von Eigentumswohnungen den Zweitwohnungsbau einzudämmen, entsteht eine Vielzahl von neuen, sehr unterschiedlichen Bauten, die als eigentliche Hybride zwischen der klassischen Hotellerie und dem Ferienhäuschen bezeichnet werden können (siehe Text nebenan). Und selbst wenn noch das eine oder andere Projekt platzen dürfte: Vieles deutet darauf hin, dass der derzeitige Bauboom in den Alpen die touristische Zukunft der Schweiz einläutet. (NZZ 8.8.2010) Swiss Hospitality Investment Forum An Investoren, die Interesse an der Schweizer Hospitality Branche haben, mangelt es nicht. Die Rahmenbedingungensind jedoch vielfältig und komplex: Zum einen sind da die gesetzlichen Restriktionen wie die Zweitwohnungsinitiative, welche die Finanzierung von Hotelprojekten gefährdet. Oder die aufwändigen Vorschriften beim Bau resp. Bei Baubewilligungsverfahren, die schon für manches ambitiöse Projekt das Aus bedeuteten und bei Investoren für Kopfschmerzen sorgten. Zum anderen ist der Schweizer Markt für Hotelimmobilien sehr fragmentiert und es besteht – obwohl in den letzten Jahren erhebliche Mittel in die Luxushotellerie investiert wurden – grosser Nachholbedarf bei der Klein- und Mittelhotellerie (KMH). Erschwerend kommt hinzu, dass die Angebote oft nicht strukturiert sind und sich die Problematik der Nachfolgeregelung in Zukunft noch verschärfen dürfte. Diese speziellen Anforderungen an die Hospitality Industrie in der Schweiz generieren spezifischen Informations- und Kontaktbedarf. Und dieses Bedürfnis nach Information will das Swiss Hospitality Investment Forum stillen – mit glaubwürdigen Promotoren des Standortes Schweiz, die beispielsweise neue Betriebskonzepte und Finanzierungskonzepte aufzeigen. Denn die Schweizer Tourismusidustrie hat grosses Interesse daran, Investoren zu finden, die ein langjähriges und nachhaltiges Engagement in der Schweiz suchen. (Aktuelle Ausgabe Swiss Hospitality Investment Forum.) Ausländische Investoren in den Schweizer Bergen Es sind gewaltige Summen, die ausländische Investoren in die Schweizer Alpen buttern. Beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) gibt es zwar keine Zahlen dazu. Aber Recherchen der anzeigen: In den letzten Jahren wurden in den Schweizer Alpen mit ausländischem Geld Projekte für über 2 Milliarden Franken gebaut oder angerissen. Ferienresorts, Hotelanlagen, Bergbahnen - überall wird investiert. Ohne Geld keine Zukunft Urs Wagenseil, Professor für Tourismus an der Hochschule Luzern, erklärt das Phänomen so: «Wir haben, gerade in der Hotellehe und bei den Bergbahnen, einen gewissen Investitionsbedarf, weil in den 70er-, 80er- und 90er-Jahren in der Schweiz nicht so viel investiert wurde, wie eigentlich nötig gewesen wäre.» Gerade Bergbahnanlagen sind enorm teuer- und darum für kleinere Gebiete ohne Dritt-Investoren kaum finanzierbar. Messbar sind die ausländischen Gelder nur bei Grossprojekten, doch gerade die kleineren Hotels in den Alpen sind in einem grossen Umbruch. «Auch dort steckt viel ausländisches Geld drin», sagt Urs Wagenseil. Die Könige von St. Moritz Sie besitzen Hotels und Bergbahnen und sind die grössten Grundbesitzer vor Ort. Die Niarchos-Familie und ihre kostspielige Liebe zum Engadin. Es ist wieder so weit. In St. Moritz ist die Skisaison eröffnet, bald werden sie wieder alle kommen, die exklusiven WinterEinwohner des Skiorts, der sich hartnäckig «Top of the World» nennt. Mit den Flick, von Opel, Burda, Onassis und Thyssen werden auch zwei unauffällige Brüder anreisen, die in St. Moritz kaum jemand auf der Strasse erkennt, deren Name im Engadin aber allen ein Begriff ist. Ein Name, der meist nur Lob im Stil von «eine grosszügige Familie» oder «nette Leute» und nur ganz gelegentlich ein nachdenkliches «reiche arme Familie» auslöst: der der Brüder Niarchos. Philip und Spyros Niarchos, 52 und 50 Jahre alt, gehören seit ihrer Kindheit nach St. Moritz. Hier fahren sie seit Jahrzehnten Ski - in der Hochsaison auch schon einmal umgeben von dreissig weiteren Milliardären. Das Engadin ist ein Stück Heimat für die Weltbürger, seit der Vater, der legendäre griechische Reeder Stavros Niarchos, in den fünfziger Jahren in St. Moritz - wie andere zugewanderte Superreiche - zu investieren begann. Doch der Bergort St. Moritz und der Name Niarchos, das wurde eine besondere Liebesgeschichte, die tiefer ging und über Jahrzehnte hinweg nie ihre Intensität verloren hat. Mitte der fünfziger Jahre gründete Stavros Niarchos die Luftseilbahnen auf Corvatsch und Piz Nair. 1970 schnappte er dem Club Med das Kulm-Hotel weg - seitdem gilt Niarchos als Retter der St. Moritzer Luxushotellerie. Wer hat sie vergessen, die Schwarzweissfotos aus seinen stürmischen Engadiner Skitagen? Die begehrten Reederstöchter Eugenia und Athina Livanos, die beide Niarchos' Ehefrauen wurden, stapften abwechslungsweise neben ihm durch den Schnee. «Buy and build big», lautete Stavros Niachros' Philosophie im Reedereigeschäft. 1952 baute er - zeitgleich mit seinem lebenslangen Rivalen Aristoteles Onassis - seinen ersten Tanker, bereit, Rekordmengen von Erdöl über die Weltmeere zu verschiffen. Schnell florierte das Geschäft, die Suezkrise 1956 verschaffte Niarchos grossartige Einnahmen. Er stieg zum grössten privaten TankerflottenBesitzer auf, 80 Schiffe fuhren in den besten Zeiten unter seinem Namen. Gesellschaftlich gesehen wurde Stavros Niarchos selber zu so etwas wie einem Supertanker. Mit seiner steten Anwesenheit bei den wilden St. Moritzer Partys und seiner wiederholten Hochzeiten wegen war er in den Klatschspalten über Jahrzehnte nicht mehr zu übersehen. Doch seine Kinder pflegen heute einen ganz anderen Stil. Weitab vom Rampenlicht haben sich Philip, Spyros und deren jüngere Schwester Maria ihren Platz zum Leben gesucht. Von den Niarchos-Geschwistern existiert kaum eine neuere Foto, geschweige denn ein Interview. Fast unbemerkt von der einheimischen Bevölkerung verbringen sie mit ihren Familien einen nicht kleinen Teil des Jahres in ihren Villen in St. Moritz. Dabei sind sie, nachdem der berühmte Vater 1996 in Zürich gestorben ist, nicht nur Erben. Philip und Spyros Niarchos sind heute die grössten privaten Grundbesitzer in St. Moritz. Als Mehrheitsaktionäre der Grand-Hotels Engadinerkulm AG besitzen sie das bekannte Fünfsternehotel Kulm. Auf dem Hotelgelände befinden sich der legendäre Cresta Run, die Bobbahn und auch der Dracula-Club, den Gunter Sachs 1974 gegen die damals noch ab und an aufkommende Langeweile im ehemaligen Bauerndorf gegründet hat. Zur Gesellschaft gehören des Weiteren Wohnungen, Geschäfte, Tennis- und Eislaufplätze, ein Golfplatz und viel Grundbesitz mit grossen Baulandreserven. Schon mit den 240 Hotelangestellten zählen Philip und Spyros Niarchos zu den wichtigsten Arbeitgebern im ganzen Kanton Graubünden. Vor zwei Jahren kauften die Brüder noch den denkmalgeschützten «Kronenhof» im benachbarten Pontresina dazu. «30 Millionen Franken werden wir dort bis Ende nächsten Jahres investieren», sagt Heinz Hunkeler, der ehemalige «Kulm»-Direktor, der heute im Verwaltungsrat der AG sitzt. Doch die Investitionslust der Niarchos-Familie hört nicht in St. Moritz auf. Man begegnet ihr auch im Rest des Kantons Graubünden, wenn auch in anderer Form. Bei caritativen Veranstaltungen wird der Familie immer wieder gedankt, ob es nun Kirchenrenovierungen oder Spitalfinanzierungen sind. «In diesem Jahr war ich bei drei Einweihungen von Projekten, die unsere Stiftung gesponsert hat», erzählt der Aargauer Steuerexperte Kurt Arnold. Seit drei Jahren ist er Mitglied des Stiftungsrates der Stavros Niarchos Foundation, die in Athen, Monte Carlo, New York und London Büros unterhält und seit der Gründung 1996 die durchaus beeindruckende Summe von 266,5 Millionen Dollar auf über tausend verschiedenste Projekte verteilt hat. Immer ein Zimmer Im Frühjahr dieses Jahres wurde in Graubünden die abgeschlossene Renovierung der St.-Ulrich-Kapelle des zum Unesco-Weltkulturerbe erklärten Klosters St. Johann in Müstair gefeiert, die von der Niarchos-Stiftung finanziert wurde. Ende Juni fand in der ebenfalls mit einem grosszügigen NiarchosBeitrag restaurierten Burg Riom die Premiere eines romanischen Theaterstückes statt. Bereits Anfang 2000 beschenkte die Stiftung den Kanton Graubünden mit einem Fonds von 5 Millionen Franken, «für Projekte kleinerer Dimension», wie es Kurt Arnold nennt. Stavros Niarchos liebte das Engadin so sehr, dass er das Spital in Samedan schon zu Lebzeiten mit einer eigenen Stiftung bedachte: Die meisten Neuanschaffungen werden bis heute aus diesem Fonds bezahlt. Dafür soll für die Niarchos-Familie dort immer ein Zimmer bereit sein, erzählt man in St. Moritz. Den Vorzug, den die Bündner bei der Projektvergabe auch im Stiftungsrat der weltweit tätigen Stavros Niarchos Foundation geniessen, versucht Kurt Arnold gar nicht erst herunterzuspielen: «Die Niarchos-Brüder leben an vielen Orten der Welt. Aber die Vorliebe für St. Moritz und Graubünden ist auch dieser Generation der Familie erhalten geblieben», sagt er. Kurt Arnold kennt die Niarchos- Brüder seit zwanzig Jahren. In regelmässigen Telefonkonferenzen und bei vier Treffen im Jahr berät er sich mit ihnen und den vier anderen Stiftungsräten über die Projekte, die es weltweit zu beurteilen gilt. Obwohl der Schwerpunkt der Stiftung auf Griechenland liegt - in Athen wollen die Niarchos- Brüder dem Vater in den kommenden Jahren sein grösstes Denkmal setzen und den geplanten Bau einer Stavros- Niarchos-Nationalbibliothek und eines Nationaltheaters finanzieren -, wurden auch in der restlichen Schweiz zahlreiche Projekte finanziert: Ein Online-Lexikon mit Begriffen aus dem Altertum zählte ebenso dazu wie das Drogenentzugs-Projekt «Terra Vecchia» im Tessin. Im Frühjahr 2008 wird die Niarchos-Stiftung im Antikenmuseum in Basel als Hauptsponsor einer Ausstellung über das Werk Homers auftreten. «Es ist eine schöne Aufgabe, bei solchen Veranstaltungen im Namen der Stiftung dabei sein zu können», sagt Kurt Arnold und fügt schmunzelnd hinzu: «Die Rolle des Wohltäters ist immer eine angenehme.» Manchmal jedoch lässt Kurt Arnold bei Veranstaltungen, an denen er die Stiftung vertritt, rätselnde Zuschauer zurück. Für wen er genau spricht, wenn er «die Niarchos-Familie» sagt, ist selbst in Graubünden nicht allen klar, so zurückgezogen leben Philip, Spyros und Maria Niarchos. Keiner der Angestellten spricht über die Familie, und wenn es jemand doch tut, dann nur äusserst vorsichtig. «Sie wollen weder mit ihrem Vermögen noch mit ihrer Herkunft protzen, sondern ihre Einstellung durch ihre Arbeit zeigen», sagt Kurt Arnold. Und Heinz Hunkeler, der noch für Stavros Niarchos selbst das Hotel Kulm dreissig Jahre lang als Direktor geführt hat, rechtfertigt die Publikumsscheu der Familie so: «Schon der Vater war nicht der Typ, der in die Stammkneipe ging und sich auf die Schulter klopfen liess.» So viel ist zumindest bekannt: Reeder sind Philip und Spyros Niarchos keine mehr. Die letzten Schiffe verkauften sie vor zwei Jahren. Heute konzentriert sich ihre Firmengruppe auf Finanzoperationen, dem Beispiel Stavros Niarchos' folgend, der nach der Ölkrise Anfang der siebziger Jahre immer stärker vom Reeder zum Investor wurde. «Philip befasst sich intensiv mit Kunst, Spyros ist mehr der Geschäftsmann», sagt Kurt Arnold. Philip Niarchos ist in New York und London als ein Mäzen bekannt, der einem unbekannten Künstler über Nacht zu Berühmtheit verhelfen oder dessen Nachruhm sichern kann - so wie er es 1998 tat, als er Jean-Michel Basquiats «Selbstporträt» für den unerwartet hohen Preis von etwa 7,7 Millionen Franken kaufte und damit die familiäre Kunstsammlung um ein weiteres Juwel aufstockte. Als Stavros Niarchos starb, soll er seinen vier Kindern - der Ehe mit Charlotte Ford entstammte noch eine Tochter - 3 Milliarden Franken hinterlassen haben. Ein Vermögen, das der Familie nicht immer viel Glück brachte. Ähnlich dem Schicksal der Onassis, Agnelli und Kennedy war auch das Leben der Niarchos-Familie von Tragödien überschattet: 1999 starb der jüngste Sohn Constantine im Alter von nur 37 Jahren an einer Überdosis Kokain - zwei Wochen zuvor hatte er noch als erster Grieche den Mount Everest bestiegen. Constantine Niarchos habe es nie verwunden, dass seine Mutter Eugenia unter mysteriösen Umständen gestorben sei, als er acht Jahre alt war, und die Presse damals spekuliert habe, sein Vater Stavros Niarchos habe sie umgebracht. Das zumindest schreibt die italienische Prinzessin Alessandra Borghese, die vierzehn Monate lang mit Constantine Niarchos verheiratet war, in ihrem Buch «Con occhi nuovi» (Mit neuen Augen). Paris Hilton als Freundin Im Clan der Niarchos ist inzwischen auch die dritte Generation erwachsen geworden. Und das Prinzip des radikalen Rückzugs aus der Öffentlichkeit, an das sich die zweite NiarchosGeneration gehalten hat, scheint die dritte nicht mehr einhalten zu wollen. Insbesondere Philip Niarchos' älterer Sohn, der 21- jährige Stavros, sorgt seit einem Jahr für Schlagzeilen. Ausgerechnet die Hotelerbin Paris Hilton hat sich der Filmstudent der University of Southern California in Los Angeles als Freundin ausgesucht - was seiner Familie zutiefst missfällt. Der bekannte PR-Agent Brian Quintana behauptet, von der Familie Niarchos beauftragt worden zu sein, die Hotelerbin von Stavros junior fernzuhalten. «Welche Eltern wären schon glücklich, ihren Sohn mit Paris Hilton in der Presse zu sehen», sagt Kurt Arnold. Doch in den USA mehren sich Vermutungen, Paris Hilton und Stavros Niarchos III. hätten die Affäre nur inszeniert, um sich ins Gespräch zu bringen. Den jungen Stavros, ein begeisterter Kite- Surfer, scheint der Klatsch wenig zu kümmern. Er zelebriert sein Leben weiter in aller Öffentlichkeit. Fast wie der Grossvater: «Buy and build big.» (NZZ 3.12.2006) Die Bergtäler der Schweiz waren nicht immer so attraktiv wie sie heute erscheinen. Den Bergtourismus entstand eigentlich erst vor rund 150 Jahren. Es war vor allem der britische Adel welcher sich ab der Mitte des 19.Jh. für die Schweizer Alpen interessierte. So war es üblich, dass man als Adelsfamilie denn ganzen Winter in einem eleganten Resort in den Schweizer Bergen verbrachte und somit wurden die Schweizer Bergtäler immer attraktiver. Zudem gehörte es sich zum Abschluss einer exklusiven Ausbildung, dass die jungen Adelsherren und Grossbürgersöhne sich auf Reisen begaben. Die sogenannte „Grand Tour“, welche auch durch die Schweiz führte und den Tourismus zusätzlich anregte. Ausländische Investoren investieren enorme Summen in den Schweizer Bergtourismus. In den letzten zwei Jahren wurden über 2 Milliarden Franken investiert und dies breit verteilt in grosse Hotelanlagen, Resorts, Bergbahnen usw. Es ist aber gemäss Recherchen auch notwendig, denn gerade in der Hotellerie besteht ein grosser Investitionsbedarf. Da vor allem zwischen den 70er und 90er Jahren nicht mehr viel investiert wurde. Bergbahnen zum Beispiel sind enorm teuer und dadurch nur schwer tragbar für kleinere Gebiete. Es gibt genügen viele Erfolgsgeschichten von Ausländischen Investoren, welche auszusterbende Bergtäler wiederbeleben konnten. Ein Paradebeispiel für eine Erfolgsgeschichte von Auslandinvestoren sind die Brüder Niarchos. Die Griechen Philip und Spyros Niarchos, aus einer Reeder-Familie, renovierten den denkmalgeschützten Kronenhof im Engadin. Im Grand Hotel Kronenhof in Pontresina, wurde unter anderem die Wellnessalage mit 2000 Quadratmetern umgebaut. Die Investitionen beliefen sich ungefähr auf 50 Millionen Franken und wurde 2008 fertiggestellt. Den Niarchos, gehören auch weitere Hotels unter anderem auch das Kulm Hotel in St. Moritz. Aber dies ist längst nicht alles. Weiter Wohnungen, Geschäfte, Tennis und Eislaufplätze, ein Golfplatz und viel Grundbesitz mit grossen Baulandreserven gehören Ihnen, Das ganze fällt zusammen unter der „Aktiengesellschaft Grand Hotels Engadinerkulm“. Aber ihre Investitionen greifen noch viel weiter. Sogar Kirchenrenovierungen oder Spitalfinanzierungen gehören dazu. Phillip und Niarchos zählen mit 240 Hotelangestellten zu den wichtigsten Arbeitsgeber im ganzen Kanton Graubünden. Die Familie hat in St. Moritz Wurzeln geschlagen und verbringt zu einem grossen Teil des Jahres ihre Zeit in St. Moritz. Die Einwohner verbinden mit dem Namen Niarchos meist nur Lob im Stil von «eine grosszügige und sich zurückhaltende Familie » oder «nette Leute». Zudem gründete die Investorenfamilie die Luftseilbahn auf Corvatsch und Piz Nair. Die Niarchos Familie gilt seither als Retter der St. Moritzer Luxushotellerie. Ein weiteres Beispiel für erfolgreiche Ausland Investitionen in die Schweizer Alpen, zeigt Der italienische Investor Amedeo Clavarino. Die Berge haben für ihn eine magische Anziehungskraft. Calvarino kaufte das Maloja Palace auf und liess das mit 380 Zimmer bestückten Zimmer umbauen. Er will Gäste aus Mailand, Paris, London oder aus den Schweizer Städten anlocken und das Hotel wieder zur Blüte bringen wie einst, als das Maloja Palace das grösste Grand Hotel der Alpen war. Dadurch wird natürlich auch das 310 Seelendorf enorm profitieren können. Denn genau dieses Grand Hotel war Ende des 19. Jh. zur Tourismusdestination geworden. Mit einer Investition wird das Grand Hotel sowie das Dorf den grössten Wandel seit damals erleben. Eine riesige Gelegenheit für eine Wiederbelebung des Bergdorfes. Im Weitern gibt es das Grand Hotel Alpina in Gstaat, in welches der französische Milliardär Jean-Claude Mimran und Schweizer Immobilienhändler Marcel Bach, für 300 Millionen Franken investiert wurde. Die beiden hatten schon das Skigebiet „Les Diablesrets“ gekauft. „Bach und seine Partner versprechen der Region ein Skigebiet, das in Zukunft mit St. Moritz, dem Jungfraugebiet und den grossen Walliser Destinationen in heftigem Wettbewerb stehen soll. Ein Skigebiet, so hoffen die Investoren zumindest, das frei von staatlicher Hilfe funktionieren wird.“ (NZZ, 9.10.2005 ) Das «Aminona Luxury Resort & Village» in Mollens, ein 700 Millionen Franken teures Resort, mit 550 Zimmern, 45 Chalets und eine Zentrumszone mit 15 Gebäuden. Die russische Investorengruppe „Mirax Group“ hat sich zu den ökologischen Grundsätzen des Bundes verpflichtet und demensprechend das Projekt angepasst. Ebenso wird nicht nur Geld in die Hotellerie gesteckt, sondern auch in die Schweizer Bergbahnen. Exemplarisch dafür sind die Saas Fee Bergbahnen. Der holländische Kernphysiker und Hedge-Fund Manager Edmond Offermann hat der Skigebiet-Betreiberin Companie des Alpes 2009 ihre Anteile abgekauft. Die Saas Fee Bergbahnen sollen in naher Zukunft mit anderen Bahnen im Saastal verknüpft werden. Das bekannteste Beispiel für ein wiederbeleben eines Bergtales ist Andermatt. Der ägyptische Investor Samih Sawiris investiert mit seiner Orascom Development Group 1.5 Milliarden Franken. Das ist mit Abstand das grösste Investment in den Schweizer Bergtourismus. Ein Teil des Projektes ist bereits realisiert. Das Ziel ist jedoch, 6 Hotels, 450 Wohnungen, 30 Villen und einen 18-Loch-Golfplatz. Die Absicht ist auch hierwieder Touristen aus aller Welt in die Schweizer Berge zu locken.In der Hotellerie machen sich Finanzinvestoren breit. Es gelingt nur schwer und immer weniger Hotelierfamilien, Luxusetablissements von einer Generation der nächsten weiterz zu geben. Die Hotelfamilien verfügen nicht über so grosse finanzielle Mittel. Heute gehören gemäss Recherchen rund 40% der Schweizer Luxushäuser an ausländischen Investoren. Investoren kommen aus allen möglichen Ländern, aus den USA, Frankreich, Deutschland Österreich, Israel, Ägypten, Katar, oder Thailand. Es gibt nur noch wenige Hotelierfamilien zum Beispiel die Familie Candrian. Ihnen gehört das «Suvretta House» in St. Moritz, das 2012 sein hundertjähriges Bestehen feiert. Es ist bereits die fünfte Generation welche das Hotel führt. «Es braucht Investoren, die an das Projekt glauben und dafür Geld in die Hand nehmen», sagt VR-Präsident Martin Candrian. Und dies geschieht auch immer mehr. Ausländische Investoren haben Lust auf mehr und sehen die Schweiz als attraktiver Investitionsort. So zum Beispiel wird in das Bürgenstock-Resort etwa durch den katarische Staatsfonds fast 0,5 Mrd. Fr. verbaut. Dazu gehört bereits das Hotel Schweizerhof in Bern. Zudem will ein Investor aus Katar aus dem Hotel Atlantis in Zürich wieder eine Perle machen. Wobei das Hotel Atlantis schon seit Jahren leer steht und nur durch junge Leute illegal besetzt wird. Ein Investor kommt also äusserst gelegen. Oder Der österreichische Multimillionär Peter Pühringer steckt gut 250 Mio. Fr. in die Totalrenovation des Park-Hotels in Vitznau. (NZZ Peter Keller 7.10.2012) Die Angst, dass die Investition nicht rentieren könnte und durch dies eine Geisterstadt entstehen könnte ist unbegründet. Denn selbst wenn keine Investition getätigt wird, würden sowieso junge Leute die Bergtäler verlassen und eine Geisterstadt entstehen. Es muss ohnehin etwas passieren das die Bergdörfer nicht aussterben und für das braucht es Investoren. Zudem besteht natürlich immer ein Restrisiko bei Investitionen, aber dies ist immer so und wenn man dies nicht möchte dann sollte man am besten gar nie in irgendetwas investieren. Zudem die Frage: investieren schon, aber weshalb dann nicht nur Schweizer Investoren? Erstens, weil nur selten welche gibt und Zweitens weil wirtschaftlich gesehen es sicherer ist wenn Geld vom Ausland gebracht wird. Grossinvestoren in der Schweizer Bergewelt Aber Investoren, investieren ja nicht einfach blindlinks irgendwo Millionen von Franken in etwas hinein. Wenn es gar nicht rentierte, würde wahrscheinlich kaum jemand investieren. Dahinter stecken sicher fundierte Analysen mit entsprechenden Erwartungen an die Rentabilität dahinter, wie etwa Beim Hotel Atlantis in Zürich. Aber es ist natürlich schon so , dass wenn Hotels renoviert und neu aufgestellt werden, dass immer mit einer Anlaufszeit zu rechnen ist. Normalerweise vergehen mindestens drei Jahre, bis der Break-even erreicht ist und der Betrieb zu rentieren beginnt. Aber bei den Investitionen in der Schweiz geht es meist nicht nur um den Renditeaspekt, denn ansonsten würde eine Mehrheit davon in der Schweizer Nobelhotellerie kaum funktionieren. Vielmehr geht es um die Auffächerung des Investments, ein tieferes Risiko und natürlich nicht zu vergessen auch um Prestige. Viele Investitionen werden über längere Zeit getätigt um somit doch eine gewisse Rendite zu erzielen. Auch werden die Häuser nicht so schnell wieder verkauft. Am Schluss muss die Gesamtsumme seines Engagements für den Investor aufgehen. „Ein Grossteil kommt nach wie vor aus Europa, besonders aus den Nachbarländern der Schweiz. Weitere wichtige Investoren sind aus Katar, Saudiarabien und Ägypten – man denke etwa an Samih Sawiris – sowie den USA.“ sagt Stefan Pfister von KPMG welcher unter anderem ausländische Investoren bei Schweizer Luxushotels berät. Es ist natürlich so das die Schweizer Investoren von den ausländischen Märkte und Tourismusstrukturen etwas verstehen müssen, gut vernetzt sein und kompetente Hotelbetreiber haben. Die Schweizer Investitionsgefässe sind jedoch oft zu klein, um den riesigen Aufwand betreiben zu können. Zwar können sie sich, wie auch die ausländischen Investoren in der Schweiz, beraten lassen. Doch es sind schlussendlich sie, die investieren und allfällige Risiken tragen. Weil diese hierzulande als geringer betrachtet werden als im Ausland, engagieren sich Schweizer Investoren immer noch lieber im eigenen Land – nach dem Motto «Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht». (Tagesanzeiger 12.07.2013)