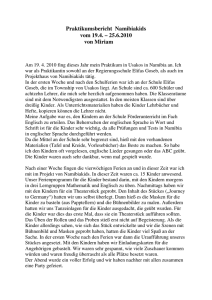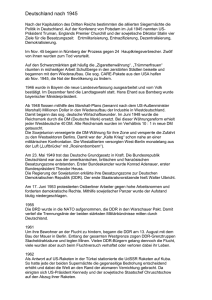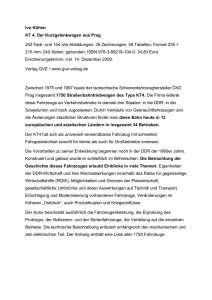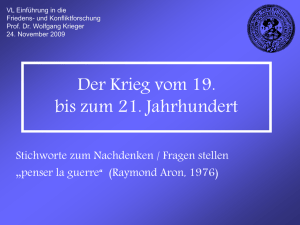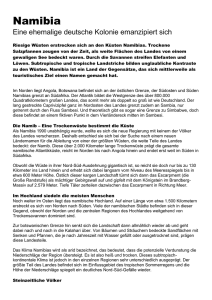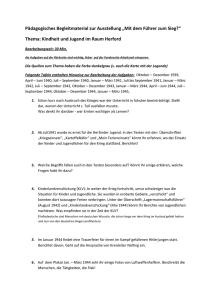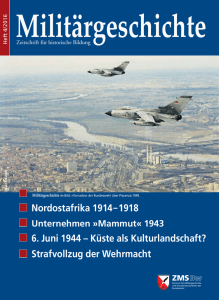PDF-Download - Zentrum für Militärgeschichte und
Werbung

B^a^i~g\ZhX]^X]iZ :EITSCHRIFTFÓRHISTORISCHE"ILDUNG C 21234 ISSN 0940 -ÊÊ 4163 Heft 3/2014 Militärgeschichte im Bild: Sam Nujoma, Chef der namibischen Befreiungsbewegung SWAPO, besucht die DDR, August 1989. DDR-Einsatz im Auftrag der UNO Israels Luftschläge gegen Irak und Syrien Schlacht im Golf von Leyte 1944 Der Langemarck-Mythos ÌBÀ}iÃV V ÌV iÃÊÀÃV Õ}Ã>Ì Impressum Editorial ZMG 2014-H3 Impressum Editorial Militärgeschichte Zeichen: 2.900 Zeitschrift Bildung V1für mthistorische 2014-08-21, V2 lekt 2014-08Herausgegeben 21, V3 mt 2014-08-22 vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr S. 2 durch Oberst Dr. Hans-Hubertus Mack und Oberst Dr. Sven Lange (V.i.S.d.P.) Produktionsredakteur der aktuellen Ausgabe: Mag. phil. Michael Thomae Redaktion: Major Dr. Klaus Storkmann (ks), korresp. Mitglied Oberleutnant Ariane Aust M.A. (aau) Friederike Höhn B.A. (fh) Oberstleutnant Dr. Harald Potempa (hp) Hauptmann Ines Schöbel M.A. (is) Mag. phil. Michael Thomae (mt) Bildredaktion: Dipl.-Phil. Marina Sandig Lektorat: Dr. Aleksandar-S. Vuletić Karten: Daniela Heinicke, Yvonn Mechtel Layout/Grafik: Maurice Woynoski / Medienwerkstatt D. Lang Anschrift der Redaktion: Redaktion »Militärgeschichte« Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr Postfach 60 11 22, 14411 Potsdam E-Mail: ZMSBwRedaktionMilGeschichte@ bundeswehr.org Homepage: www.zmsbw.de Manuskripte für die Militärgeschichte werden an obige Anschrift erbeten. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht gehaftet. Durch Annahme eines Manuskriptes erwirkt der Herausgeber auch das Recht zur Veröffentlichung, Übersetzung usw. Die Honorarabrechnung erfolgt jeweils nach Veröffentlichung. Die Redak­ tion behält sich Änderungen von Beiträgen vor. Die Wiedergabe in Druckwerken oder Neuen Medien, auch auszugsweise, anderweitige Vervielfältigung sowie Übersetzung sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Die Redaktion übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte von in dieser Zeitschrift genannten Webseiten und deren Unterseiten. Für das Jahresabonnement gilt aktuell ein Preis von 14,00 Euro inklusive Versandkosten (innerhalb Deutschlands). Die Hefte erscheinen in der Regel jeweils zum Ende eines Quartals. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Wochen zum Ende des Bezugszeitraumes. Ihre Bestellung richten Sie bitte an: SKN Druck und Verlag GmbH & Co., Stellmacherstraße 14, 26506 Norden, E-Mail: [email protected] © 2014 für alle Beiträge beim Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) Bedrohungen der Sicherheit des Landes und ­seiner Bevölkerung tritt Israel stets entschlossen entgegen. Diese Entschlossenheit fordert ihren Preis: Gemäß UN-Angaben kamen etwa im Gazakrieg zwischen 8. Juli und 26. August 2014 insgesamt 2168 Menschen ums Leben (2101 Tote auf palästinensischer, 67 Tote auf israelischer Seite). Bestimmend für die Bedrohungswahrnehmung Israels ist u.a. die geopolitische Lage des Landes, was den israelischen Staat Ende der 1960er Jahre veranlasste, zur Abschreckung Atomwaffen anzuschaffen. Damit die Abschreckung auch funktioniere, dürfe keiner der arabischen Nachbarn in den Besitz von Atomwaffen gelangen, weswegen Israel sich gezwungen sah, gegen die Atomprogramme Iraks und Sy­riens mit militärischen Mitteln vorzugehen. Marcel Serr informiert nicht nur über diese beiden Luftschläge von 1981 und 2008, sondern er betrachtet in seinem Beitrag auch die aktuelle Bedrohung des israelischen Allein­stellungsmerkmals in der Region durch das iranische Atomprogramm. Auch wenn angesichts der letzten bewaffneten Auseinandersetzungen ein dauerhafter Frieden zwischen Israelis und Palästinensern kaum zu erwarten ist, darf bezweifelt werden, ob eine Befriedung des Nahostkonfliktes ein Regime wie das im Iran veranlassen würde, auf sein Atomprogramm zu verzichten. Das Jahr 1989/90 erlebten weltweit viele Länder als politische Zäsur, so auch in Afrika, wo Namibia sich von Verwaltung und Besatzung durch die Republik Südafrika löste und seine Unabhängigkeit erlangte. Begleitet wurde dieser Prozess durch eine UN-Friedensmission, an der auch die DDR beteiligt war. Über die Beziehungen der DDR zu Namibia und den ersten und zugleich letzten Einsatz von DDR-Kräften im Auftrag der UNO berichtet ­Daniel Lange. Am 10. November 1914 versuchte ein Reservekorps in der Nähe des belgischen Ortes Langemarck die französischen Linien zu durchbrechen. Die Franzosen wehrten sich erfolgreich, die deutsche Seite erlitt Verluste in Höhe von 2000 Mann. In der Folge entstand um die Schlacht bei Langemarck ein regelrechter Mythos, der seinen Höhepunkt während der NS-Herrschaft erlebte. Die Entstehung dieses Mythos und seine Instrumentalisierung erhellt Tobias Hirschmüller. Axel Schilling informiert schließlich über die größte Seeschlacht des Zweiten Weltkriegs. Die Schlacht im Golf von Leyte 1944 war zugleich der letzte Versuch der Kaiserlich Japanischen Marine, sich der enormen Überlegenheit der US Navy entgegenzustellen. In eigener Sache: Seit dem Wechsel seines Dienstortes in das Bundesarchiv nach Freiburg i.Br. können wir stets auf die Unterstützung unseres ehemaligen Redaktionsmitgliedes Major Dr. Klaus Storkmann zählen. Er steht uns nicht nur mit seiner Expertise in Sachen NVA und Afrika zur Verfügung, sondern versorgt uns auch regelmäßig mit Ideen für spannende Themen. Dafür möchten wir Herrn Storkmann herzlich danken. Verabschieden möchten wir uns von Frau Hauptmann Ines Schöbel M.A. Sie beendet ihre Dienstzeit bei der Bundeswehr. Auch ihr sei herzlich gedankt für die Mitarbeit. Wir wünschen Frau Schöbel alles Gute für die Zukunft. Eine gewinnbringende Lektüre dieses Heftes wünscht Druck: SKN Druck und Verlag GmbH & Co., Norden ISSN 0940-4163 Michael Thomae Inhalt Der Langemarck-Mythos Der Erste Weltkrieg in der nationalsozialistischen Erinnerungskultur 4 Dipl. Soz.-Päd. Tobias Hirschmüller M.A., geb. 1981 in Neuburg an der Donau, Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt Die Schlacht im Golf von Leyte 1944 8 Fregattenkapitän Axel Schilling, geb. 1960 in Stadeln (heute Fürth), Dezernent in der Unterabteilung Ausbildung im Marinekommando Rostock Im Auftrag der UNO Die Beteiligung der DDR an der Friedensmission 1989/90 in Namibia Service Das historische Stichwort: Der »Sitzkrieg« 1939/40 22 Neue Medien 24 Lesetipps 26 Die historische Quelle 28 Geschichte kompakt 29 Ausstellungen 30 Militärgeschichte im Bild Namibias Weg in die Unabhängigkeit 14 Daniel Lange M.A., geb. 1980 in Berlin, Stipendiat der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Berlin Sam Nujoma, Chef der South-West Africa People’s Organisation (SWAPO), trifft zu einem Arbeitsbesuch in der DDR auf dem Flughafen Berlin Schönefeld ein. Beziehungen zur SWAPO unterhielt die DDR seit 1977. 1989/90 sah die DDR durch die Beteiligung an einer UN-Mission in Namibia schließlich die Möglichkeit, aktiv den Freiheitsprozess des afrikanischen Partnerlandes mitzugestalten. Erster Präsident des seit 1990 unabängigen Namibia wurde Sam Nujoma. Foto: BArch, Bild 183-1989-0818-034/Klaus Franke Blaupause für den Iran? Israels Luftschläge gegen die Atomprogramme Iraks und Syriens Marcel Serr M.A., geb.1984 in Ludwigshafen am Rhein, Wissenschaftlicher Assistent am Deutschen Evangelischen Institut für Altertums­ wissenschaft des Heiligen Landes, Jerusalem 18 Weitere Mitarbeiter dieser Ausgabe: Oberstudienrat Martin Grosch M.A., Eltville; Laura Haendel M.A., Berlin; Dr. Dorothee Hochstetter, ZMSBw; Linda v. Keyserlingk M.A., MHM Dresden; Jens Wehner M.A., MHM Dresden. 31 Der Langemarck-Mythos Der Langemarck-Mythos Scherl/SZ Photo Der Erste Weltkrieg in der nationalsozialistischen Erinnerungskultur 5Langemarck-Gedenkfeier im Berliner Lustgarten, 11. November 1934: Generalfeldmarschall August von Mackensen, Heerführer im Ersten Weltkrieg, salutiert vor den Fahnen alter kaiserlicher Regimenter (rechts im Bild Soldaten der Reichswehr). »Deutschlands Jugend bewahrt sich das Vermächtnis der Front im ­großen Krieg und des Kampfes der nationalsozialistischen Bewegung. Langemarck ist zum Symbol dieses Vermächtnisses geworden.« I n einer Rede im Frühjahr 1938 ­betonte Generalfeldmarschall Hermann Göring die anhaltend wichtige Bedeutung eines eigentlich eher unwichtigen Gefechts nahe eines belgischen Dorfes zu Beginn des Ersten Weltkrieges. Noch 14 Jahre später solle sich die deutsche Jugend ein Beispiel an den Soldaten nehmen, die für das Vaterland ihr Leben geopfert hatten. »Langemarck« war einer der Bausteine der nationalsozialistischen Instrumentalisierung des Ers­ten Weltkrieges. Wie aber konnte dieses Gefecht vom 10. No­ vember 1914 eine solche Bedeutung erlangen? Von der Schlacht und ihrer ­Mythisierung Für den Krieg mobilisierte die deutsche Armee 1914 nicht nur unzählige Soldaten, sondern auch historische Persönlichkeiten wie Gebhard von Blücher, Prinz Eugen von Savoyen oder Otto von Bismarck. Sie fungierten in der Populärkultur als Leitbilder für die Soldaten und somit als Siegesgaranten für die Armee. Neben diesen Bezügen auf die Vergangenheit entstanden be- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 reits während des Krieges eine Reihe neuer Mythen, die aus scheinbaren oder realen Teilerfolgen der Armee hervorgingen. Hierzu zählten unter anderem militärische Siege wie Tannenberg oder Schlachten mit hohen Opferzahlen wie Verdun. Der Langemarck-Mythos nimmt dabei eine Sonderrolle ein, denn hierbei handelte es sich weder um einen Sieg des deutschen Heeres noch um eine Schlacht mit militärisch bedeutsamen Verlusten. Nach der taktischen Niederlage der Deutschen in der Schlacht an der Marne im September 1914 begann der sogenannte Wettlauf zum Meer: Deutsche und britisch-französisch-belgische Verbände versuchten sich auf ihrem Vormarsch gegenseitig zu überflügeln. marer Republik weiter verklärt. Träger dieser Form der Überlieferung waren völkische und konservative Verbände und national geprägte Teile der bürgerlichen Jugend. Die Funktion des Mythos bestand darin, in der Jugend die Bereitschaft zu wecken, sich im erneuten Kriegsfall für das Vaterland, für das größere Ganze zu opfern. Auch an den Schulen und Hochschulen wurde der Mythos in Form von Feiern mit stark militärischen Konnotatio­ nen verbreitet. Insbesondere Gymna­ siasten und Studenten identifizierten sich mit der Umschreibung »junge Regimen­ter«. Mehrere studentische Verbindungen nahmen schon in ihrem Namen Bezug auf die Schlacht, wie beispielsweise 1921 der »LangemarckAusschuss für Hochschule und Heer«. Im Jahr 1928 beschloss die Deutsche Studentenschaft, der Dachverband der allgemeinen Studentenausschüsse der deutschen Hochschulen, in Langemarck neben dem bisherigen Soldatenfriedhof einen eigenen Friedhof für die Toten der Schlacht zu errichten. Dieser »Deutsche Soldatenfriedhof Nr. 123« wurde 1932 fertiggestellt. Der Weltkrieg in der NS-Erinnerungskultur Adolf Hitler erklärte auf einer Versammlung der NSDAP im November 1922: »Nicht eine Menge Menschen, sondern stets einzelne kraftvolle Naturen waren es, die für die Geschichte ihres Volkes bedeutend wurden.« Zu solchen Persönlichkeiten zählten für ihn in erster Linie politische und militärische Entscheidungsträger wie Friedrich der Große, die preußischen Heeresreformer oder der Reichsgründer Otto von Bismarck, aber auch Vertreter der Geistesgeschichte wie Immanuel Kant und Friedrich Schiller. Hitler vertrat die Auffassung, es gebe von der Geschichte gestellte Aufgaben, die nur solche »Führer« zu lösen in der Lage seien. In diesem historistisch geprägten Geschichtsbild des Nationalsozialismus bildete nun der Erste Weltkrieg eine entscheidende Ausnahme. Auf einer Versammlung der Nationalsozialisten in der bayerischen Landeshauptstadt im Mai 1929 prophezeite Hitler: »Es wird die Zeit kommen, wo Deutschland seine Lichtseite zeigen wird, und wir sind von der stolzen Zuversicht durchdrungen, dass die Welt diese Lichtseite schätzen wird. Endlich sind wir nicht mehr das Volk von Genf und Locarno, das Volk des Dawes-Vertrages, sondern wir sind das Volk von Verdun und Flandern. Von der Somme und von Ypern, das Volk der U-Boote, ein anderes Volk, was die Welt heute sieht.« Damit betonte er einerseits den militärisch dominierten Machtstaatsgedanken, andererseits die Vorstellung vom Weltkrieg als Volksleistung. Galt für Hitler beispielsweise der preußische Erfolg im Siebenjährigen Krieg als alleiniges Werk Friedrichs des Großen, BArch, Bild 102-16342/Georg Pahl Dabei wurde die Frontlinie immer weiter in Richtung Nordsee verlängert. Dem gut ausgebildeten und bestens ausgerüsteten britischen Expeditions­ korps gelang es, in der Ersten Flandernschlacht vom 20. Oktober bis 18. November 1914 die belgische Stadt Ypern zu halten. Auf deutscher Seite hatten Regimenter aus Freiwilligenverbänden mit wesentlich weniger Erfahrung gekämpft, die zudem oft ohne Artillerie­ unterstützung vorgestürmt waren. Im Rahmen eines deutschen Durchbruchversuches zur Eroberung Yperns fand nahe des belgischen Ortes Bixschoote am 10. November 1914 ein relativ unbedeutendes Gefecht statt, das als »Schlacht von Langemarck« in die Geschichte eingehen sollte. Den entscheidenden Impuls zur Genese eines Mythos ergab der viel zitierte öffentliche Heeresbericht der Obersten Heeresleitung vom 11. November 1914 über den Einsatz von Freiwilligenverbänden einen Tag zuvor: »Westlich Langemarck brachen junge Regimenter unter dem Gesange ›Deutschland, Deutschland über alles‹ gegen die ersten Linien der feindlichen Stellungen vor und nahmen sie.« Dabei handelte es sich um eine aus propagandistischen Gründen idealisierte Darstellung. Der Vorstoß war unter hohen Verlusten erfolgt und konnte keine strategische Bedeutung erzielen. Rund 2000 deutsche Soldaten des XXIII. Reservekorps kamen ums Leben. Aus der Umschreibung »junge Regimenter« entstand die bis heute weit verbreitete Legende, die Einheiten hätten vollständig oder zumindest mehrheitlich aus sich freiwillig gemeldeten Studenten bestanden, die sich unter den Klängen des Deutschlandliedes für ihr Vaterland opferten. In der Propaganda des Weltkrieges wurde dieses angebliche Opfer der »Jugend von Langemarck« zum Vorbild für die gesamte deutsche Jugend stilisiert. In Wahrheit jedoch handelte es sich um Freiwillige aller Altersstufen, insbesondere um Männer der Landwehr. In der Folge wurden schon während des Krieges Gedenkstätten errichtet sowie Straßen und Plätze zu Ehren der Toten von Langemarck benannt. In Gedichten, Liedern und Erzählungen zu jährlichen Langemarck-Feiern im November mit öffentlichen Zeremonien wurde das Geschehen auch in der Wei- 5Langemarck-Gedenkfeier im Berliner Lustgarten, 11. November 1934: Studentenabordnungen in Wichs. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 ullstein bild Der Langemarck-Mythos nicht wirklich geendet habe, sondern nur mit anderen Mitteln gegen das deutsche Volk fortgesetzt werde, konnte man die Kämpfer der »Bewegung« in die Tradition des Frontsoldaten stellen. Die Kontinuität der ­Opferbereitschaft 5General Walther von Brauchitsch, Oberbefehlshaber des Heeres, bei den ­Gedenkfeiern im November 1940 auf dem Friedhof von Langemarck. so war für ihn der lange Kampf in den Schützengräben in erster Linie dem Charakter und den Tugenden des deutschen Frontkämpfers zu verdanken. So standen beim Gedenken an Verdun, den Skagerrak und andere große Schlachten weniger die Heerführer und Admirale im Zentrum, sondern das Kriegserlebnis von Infanteristen und Matrosen. Sowohl Hitler als auch Propagandaminister Joseph Goebbels besaßen gegenüber militärischen Entscheidungsträgern wie Helmuth von Moltke (dem Jüngeren) und Erich von Falkenhayn eine ablehnende Haltung, da sie sie als inkompetent erachteten. Die Leis­tun­ gen der 3. Obersten Heersleitung unter Paul von Hindenburg und Erich Luden­ dorff wurden hingegen grundsätzlich unterstrichen. Allerdings entwickelte der propagierte Sieger von Tannenberg und spätere Reichspräsident von Hindenburg sich nie zu einer Galionsfigur der NSDAP, und er wurde von ihr schon gar nicht zu einem zweiten Bismarck stilisiert, wie dies in rechtskonservativen Kreisen weit verbreitet war. Die Erinnerung an die Feldherrn des Weltkrieges blieb daher eher ambivalent. Dementsprechend konzentrierte sich das nationalsozialistische Gedenken an die Schlachten auf die Perspektive und den Beitrag des »einfachen Solda­ten«. Dies hatte einen weiteren Vorteil: Da der Krieg aus der nationalsozialistischen Sichtweise, wie der »Völkische Beobachter« 1921 schrieb, Da bei Langemarck der Fokus der Heldenverehrung auf den Fontkämpfer und nicht auf die Armeeführung gerichtet war, liegt die Vermutung nahe, dass sich die Legende funktional in die nationalsozialistische Erinnerung an den Weltkrieg integrieren ließ. Doch die Ereignisse von Flandern besaßen für den Parteiredner Hitler in den 1920er Jahren keine große Bedeutung. Auch Goebbels bezog hierzu nicht öffentlich Stellung. In seinen politischen Reden verwendete der »Führer« den Ortsnamen Langemarck kaum, er sprach nur von den Schlachten in Flandern. Bei diesen, so gab er in »Mein Kampf« vor, sei auch er das Deutschlandlied singend nach vorne gestürmt. Dabei ist jedoch ein entscheidender Unterschied zur mehrheitlich praktizierten Erinnerungskultur festzustellen. Hitler erklärte in seinem Buch die Gefallenen von Flandern im Jahr 1914 und damit jene von Langemarck nicht zu eigentlichen Fronthelden, sondern stilisierte sie zu Opfern von »verbrecherischen parlamentarischen Tau­ge­ nichtse[n]«. Die sich seit 1918 an der Macht befindenden Parteien hätten, so die Behauptung, eine »gültige Friedensausbildung« verhindert. Von der hohen Verlustzahl an nicht mehr ersetzbaren Männern, und dies ohne greifbaren Erfolg, distanzierte er sich. Sein Vorwurf, dass in Flandern 1914 zu viele Soldaten als »Kanonenfutter dem Feinde preisgegeben wurden«, erscheint in Anbetracht von Hitlers militärischen Entscheidungen im Zweiten Weltkrieg nahezu grotesk. Langemarck war in der nationalsozialistischen Propaganda nicht in erster Linie eine Chiffre für Aufopferung und Heldenmut, sondern ein bezeichnendes Beispiel für die negativen Folgen der Macht des Parlamentarismus. Es handelte sich somit nicht um eine wie sonst so häufig militärisch bestimmte Form der Erinnerung, sondern um eine, die vor allem die Inkompetenz und damit Illegitimi- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 tät des demokratischen Systems belegen sollte. Erst gegen Ende der 1920er Jahre entstand eine genuin nationalsozialistische Erinnerungskultur hinsichtlich der Schlacht bei Langemarck. Teilweise waren dabei bis in die frühen 1930er Jahre die Studentenverbindungen der NSDAP in die öffentliche universitäre Festkultur integriert. Ein Katalysator zur Intensivierung des Gedenkens an Langemarck bildete die Phase der Machtfestigung des Regimes in den Jahren 1933/34. Anlässlich des ersten Langemarck-Tages unter der Regierung Hitlers verfasste der Gauwart der NS-Gemeinschaft »Kraft durch Freude«, Kurt Maßmann, einen Artikel im »Völkischen Beobachter« mit dem Titel »Das Blut von Langemarck«. Im Unterschied zu Hitler erklärte Maßmann jetzt: »Der Tag von Langemarck ist ein Tag des heiligsten Opfers, das ein Volk überhaupt bringen kann!« Gemeint war die Jugend. Die Ereignisse wurden nun zum Sieg uminterpretiert, denn »aus solchem Sterben wächst tausendfaches Leben«. Die Freiwilligen aus dem Weltkrieg hissten symbolisch mit der Hakenkreuz­flagge »das Banner der deutschen Auferstehung«. Das Rot der Parteifahne stehe für das Blut der Toten von Langemarck wie des gesamten Krieges und sei damit »Offenbarung und Evangelium« zugleich. In der NSPropaganda wurden somit die gefallenen Freiwilligen des Weltkrieges mit den Mitgliedern der »Bewegung« – gemeint war die NSDAP – gleichgesetzt, da jene ebenfalls als Freiwillige im Kampf um Deutschland, d.h. beim Versuch die NS-Herrschaft gewaltsam durchzusetzen, gefallen seien. Die »Blutzeugen« der Bewegung, wie Albert Leo Schlageter, Horst Wessel und Herbert Norkus, wurden in eine Traditionslinie mit den Toten von Langemarck gestellt. So hieß es 1937 im »Völkischen Beobachter«: »So sehen wir eine innere Linie, die von Langemarck zur Feldherrnhalle führt und von dort zum Tage der deutschen Erhebung. Im neuen Reich hat sich das Opfer der Toten vollendet.« Im gesamten Reichsgebiet etablierten sich nationalsozialistische Gedenkfeiern zu Langemarck. Bereits bestehende Elemente der Erinnerung und des Gedenkens wurden unter der Schirmherrschaft des Regimes fortgeführt. Im Un- panie der Reichswehr (später der Wehrmacht), eine Ehren-Hundertschaft der Landespolizei, des Feldjäger­ korps, Ehrenstürme der SS, der SA, des Luftsportverbandes, des Luftschutz­ bundes, Ehrenabordnungen des Arbeitsdienstes sowie der Arbeitsfront waren zugegen. Damit erhielt die Erinnerung eine militärische wie auch eine parteipolitische Konnotation. Der soldatische Aspekt wurde nach dem Kriegsbeginn 1939 weiter verstärkt. In der Zeitschrift »Wille und Macht«, die sich an die Führer der Hitlerjugend wandte, wurden die Toten von Langemarck nun in eine Kontinuität mit ­König Leonidas und dessen 300 Spartanern in der Schlacht bei den Thermopylen 480 v.Chr. sowie mit Friedrich dem Großen bei Leuthen im Jahre 1757 gesetzt. Als während des Westfeldzuges die Wehrmacht Flandern erreichte, bilanzierte der »Völkische Beobachter« unter dem Titel »Das andere Langemarck«: »Die heilige Saat ist aufgegangen und hat ihre Erfüllung gefunden.« Die Langemarck-Feier konnte somit im November 1940 am Ort des Geschehens stattfinden. Der Oberbefehlshaber des Heeres, Generalfeldmarschall Walther von Brauchitsch, kommentierte in seiner Festrede: »Mit dem 28. Mai, mit dem Tag, an dem die Reichskriegsflagge in Langemarck gehisst wurde, ist das Vermächtnis der Jugend von 1914 erfüllt.« Nach dem Beginn des Feldzuges gegen die Sowjet­ ullstein bild – CARO/Andreas Bastian terschied zu den Feiern während der Weimarer Republik wurde versucht, dem Mythos seinen elitären Charakter zu nehmen. Der Fokus lag nicht, wie seit dem Weltkrieg üblich, auf der Vorstellung, dass nur Studenten gefallen seien, sondern nun zählten deutsche Jugendliche aus allen gesellschaftli­ chen Schichten zu den Opfern. So übernahm schon 1934 die Hitlerjugend von der Deutschen Studentenschaft die Patenschaft für das Ehrenmal in Flandern, und die Langemarck-Spende der Studenten wurde zur Spende der deutschen Jugend umfunktioniert. Der »Völkische Beobachter« erklärte, dass es »nicht nur Studenten, nicht nur Schüler [waren], die damals so marschierten«, sondern auch »Jungbauern, Arbeiter und Handwerker«. Der Langemarck-Mythos wurde somit zum Symbol für die »Volksgemeinschaft«. Diese Form der Erinnerung wurde aber weiterhin nicht auf der obersten Führungsebene praktiziert, denn Hitler, wenn er auch 1940 die Soldatenfriedhöfe in Flandern besuchte, erwähnte Langemarck bis zu seinem Tod 1945 weder in seinen öffentlichen Reden noch gegenüber seinem unmittelbaren Umfeld. Die zentrale Feier fand ab 1934 im Berliner Lustgarten statt. Hierbei kam es nicht nur zum Aufmarsch der Hitlerjugend, sondern auch Abordnungen der ehemaligen Regimenter, die bei Langemarck fochten, eine Ehrenkom- union entwickelte sich die nationalsozialistische Erinnerung an Langemarck zu einer Durchhalteparole, nach der sich die Opfer der Toten von 1914 im gegenwärtigen »Schicksalskampf des deutschen Volkes« erfüllten. Der Mythos wurde auf rudimentäre Elemente beschnitten, um den aktuellen Ansprüchen der Propaganda gerecht zu werden. »Langemarck« nach dem ­Zweiten Weltkrieg Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der NS-Herrschaft änderte sich der Stellenwert des Militärs in der deutschen Gesellschaft. Die Bedeutung von kriegerischem Heldentum im kollektiven Gedächtnis der Deutschen relativierte sich. Die aktuellen Diskussio­ nen um Straßenbenennungen belegen, dass der Wandel im Umgang mit der Vergangenheit nicht abgeschlossen ist. Wenngleich Platz- und Straßennamen im Fall von Langemarck gegenwärtig noch in einer Vielzahl von deutschen Städten anzutreffen sind, ist damit keine Aufforderung mehr zur Opferbereitschaft verbunden. Durch das Verschwinden der Erinnerung an die Schlachten in Flandern wurde auch der Mythos zerstört. Verklärende Bezüge auf die Ereignisse von Langemarck werden noch im neonazistischen Umfeld wie der NPD gebraucht; sie nehmen aber dort in Analogie zum historischen Nationalsozialismus nur eine untergeordnete Rolle ein. Auf dem »Deutschen Soldatenfriedhof 1914 bis 1918 Langemarck« erinnern heute Steinplatten statt Kreuze an die Gefallenen. Seit 2006 informiert in einem Anbau eine Filmaufführung über die Geschichte und die Geografie der Schlachten in Flandern und des Friedhofes, der nunmehr ein Mahnmal gegen den Krieg darstellt. Tobias Hirschmüller Literaturtipps 5Der Friedhof in Langemarck, errichtet in den 1930er Jahren vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.; die Kreuze sind durch Steinplatten ersetzt worden. Heute ruhen hier 44 304 deutsche Gefallene. Reinhard Dithmar (Hrsg.), Langemarck – ein Kriegsmythos in Dichtung und Unterricht, Ludwigsfeld 2002. Gerd Krumeich, Langemarck. In: Etienne François und ­Hagen Schulze (Hrsg.), Deutsche Erinnerungsorte, Bd 3, München 2003, S. 292–309. Karl Unruh, Langemarck. Legende und Wirklichkeit, ­Koblenz 1986. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 Die Schlacht im Golf von Leyte 1944 5Träger, Schlachtschiffe und Kreuzer der Task Force 38 der US Navy im Pazifik nach dem Ende der Operationen in den ­Philippinen, Dezember 1944. N ach dem Angriff auf Pearl Harbor im Dezember 1941 konnten die Alliierten mit der Besetzung Guadalcanals das rasche Vordringen der japanischen Streitkräfte im ­Pazifik zunächst stoppen. In den langwierigen Kämpfen um die Salomonen ab August 1942 wurde Japan erstmals zum Rückzug gezwungen. Dabei hielten sich die Schiffsverluste beider Seiten zunächst die Waage, jedoch waren die Verluste an Piloten und Kriegsschiffen für Japan erheblich schwerer zu ersetzen als für die USA, dessen einzigartige Wirtschaftskraft eine schnell wachsende Kriegsproduktion erlaubte. Bis Ende 1943 herrschte im Pazifik mehr oder weniger ein strategisches Patt. In dieser Zeit kamen die US-Industrie und die Streitkräfte auf volle Leistung und lieferten Kriegsmaterial und ausgebildetes Personal in solchen Mengen, dass Ende 1943/Anfang 1944 mit den Landungen auf den Gilbertund Marschall-Inseln die Rückeroberung des pazifischen Raumes eingeleitet werden konnte. Es gelang jedoch nicht, die japanische Flotte vernichtend zu schlagen. Als »Fleet in being« stellte sie bei allen Operationen unverändert eine Bedrohung für die US-amerikanischen Operationen dar. Der Weg zu den Philippinen Im Juni 1944, annähernd zeitgleich zur Landung der Alliierten in der Normandie, wurden die Marianeninseln im Rahmen der Operation »Forager« durch Streitkräfte des Befehlsbereichs Pazifik (Admiral Chester W. Nimitz) angegriffen. Die Marines landeten auf Saipan, Tinian und Guam, während die 5. Flotte der US Navy unter Admiral Raymond A. Spruance die Landung deckte und die Brückenköpfe der Marines gegen erwartete Angriffe der Kaiserlich Japanischen Marine schützte. Diese stellte einen großen Verband aus Trägern und Begleitschiffen zusammen und plante, unter Ausnutzung der Flugplätze auf den Inseln und außerhalb der US-amerikanischen Reichweite operierend, mittels Pendelbombardierung die US-amerikanischen Invasions­kräfte zu zerschlagen. Da aber die US-Marinefliegerkräfte die abso­lute Luftüberlegenheit besaßen, hatten die schlecht ausgebildeten japanischen Marinepiloten in ihren mittlerweile technisch unterlegenen Maschinen keine Chance: Sie wurden im sogenannten »Truthahnschießen bei den Marianen« nahezu vollständig aufgerieben. Darüber hinaus verlor die Kai­ ser­liche Marine zwei Angriffs- und Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 ­einen leichten Träger sowie einige Zerstörer und Tankschiffe. Admiral ­Spruance verzichtete jedoch darauf, den geschlagenen japanischen Kräften nachzusetzen, wofür er von mehreren Seiten – nicht jedoch von Nimitz – Kritik einstecken musste. Sein Auftrag lautete jedoch, die Brückenköpfe auf den Marianen zu decken. Wieder konnte das Gros der Kaiserliche Marine, zumindest der Überwasserkräfte, entkommen und als latente Gefahr weiter die US-amerikanischen Operationen bedrohen. Nach dem Angriff auf die Marianen hatte die Kaiserliche Marine keine re­ levanten Fliegerkräfte mehr, der Verteidigungsring um Japan war durchbrochen und die USA verwandelte die ­besetzte Inselgruppe in riesige Luftstützpunkte. Japan selbst lag nun in Reichweite der neuen B 29-Verbände. Parallel dazu kam im Befehlsbereich Südwest-Pazifik (General Douglas ­ MacArthur) die Rückeroberung ­Papua-Neuguineas und der umliegenden Insel­gruppen zum Abschluss. Die 7. Flotte (Admiral Thomas C. Kinkaid) unterstützte die zahlreichen Landungsoperationen mit ihrer eindrucksvollen Beschießungsgruppe unter Rear Admiral Jesse B. Oldendorf, die aus alten, aber modernisier- ullstein bild/Roger-Viollet Leyte 1944 pa/United Archives/TopFoto ten Schlachtschiffen, Kreuzern und Zerstörern bestand. Nach dem getrennten Vormarsch konnten die Kräfte von Nimitz und MacArthur vereint werden, um gemeinsam in den inneren Ring der japanischen Verteidigung einzubrechen. Erklärte Ziele waren dabei die Bündelung der eigenen Kräfte, um erstens Japan weiter zu isolieren und zweitens dessen Marine endgültig als Machtfaktor auszuschalten. Auf höchster nationaler und alliierter Ebene wurden verschiedene Optionen für den Weg nach Japan diskutiert und die Philippinen, Formosa (heute Taiwan) oder das chinesische Festland als nächste Ziele untersucht. Schließlich fiel für Dezember 1944 der Entschluss für eine Landung auf Mindanao, der südlichen Hauptinsel der Philippinen. MacArthur stellte die Truppen: Die 7. Flotte sollte die Landungen decken, die 5. – jetzt in 3. Flotte (Admiral William F. Halsey) umbenannt – die seeseitige Sicherung übernehmen. Es unterblieb jedoch, die beiden Befehlsbereiche unter einen einheitlichen Oberbefehl vor Ort zu stellen. Das sollte Folgen haben. Japans Militärführung erkannte in ihrer Lagebeurteilung die US-amerikanischen Absichten und bereitete mit Sho-1 bis Sho-3 (»Sho« bedeutet »Sieg«) entsprechende Reaktionspläne vor, rechnete jedoch frühestens Anfang 1945 mit einem Angriffsbeginn. Doch unabhängig davon, wo die US-ameri­ kanische Offensive stattfände, Japan drohte von seinen Öl- und Kautschukquellen in Niederländisch-Ostindien (Indonesien) abgeschnitten zu werden. Der Rohstoffnachschub für die Kriegs- 5Admiral William F. Halsey, Befehlshaber der 3. US-Flotte, Dezember 1944. industrie – durch den US-amerikanischen U-Bootkrieg bereits schwer getrof­fen – käme damit völlig zum Erliegen. Die Kaiserliche Marine entschloss sich daher selbst zu einem offensiven Vorgehen, statt in den Häfen liegen zu bleiben und dem Unvermeidlichen entgegenzusehen. Ihr Oberbefehlshaber, Admiral Toyoda Soemu, sagte dazu nach dem Krieg: »Wir hatten die Wahl, die Flotte in den Stützpunkten im Süden zu lassen – mit Treibstoff, aber ohne Munition und Ersatzteile, oder in Japan – mit Munition und Ersatzteilen, aber ohne Treibstoff!« Obwohl durch seine Pioniere vorgewarnt, zeigte sich MacArthur von dem schwierigen Boden überrascht; der Flugbetrieb auf dem zerstörten japanischen Platz konnte tagelang nicht aufgenommen werden. Gegen sich versteifenden Widerstand rückten die Truppen in zunehmend schwierigeres Gelände vor, unterstützt von Fliegerkräften der 16 Geleitträger der 7. Flotte. Diese leichten, auf Handelsschiffsrümpfen gebauten Einheiten verfügten über je 25 bis 30 Flugzeuge und waren spezialisiert auf Nahunterstützung (»Close Air Support«). Der Seekrieg aus der Luft blieb Aufgabe der 3. Flotte. Landung auf Leyte Sho-1 Aufgrund der raschen Lageentwicklung schlug Halsey vor, die Philippinen unter Vernachlässigung anderer Ziele schon Mitte Oktober 1944 auf der zentralen Insel Leyte anzugreifen. Angriffe auf die Hauptinseln durch die Flieger der 3. Flotte in der Task Force 38 (verteilt auf je acht schwere und leichte Träger in vier Task Groups) stießen auf nur geringen Widerstand, was für Halseys Vorgehen sprach. Nach der Eroberung von Leyte wären die japanischen Streitkräfte auf Luzon im Norden und Mindanao im Süden getrennt. MacArthur stimmte dem Vorschlag zu; als Angriffstermin wurde Mitte Oktober angestrebt. Zuvor aber wurde noch die nicht mehr zu verschiebende Landung auf Peleliu in den Palau-Inseln durchgeführt. Sie stellte sich im Nachhinein als militärisch sinnlos heraus und verlief für die USA äußerst verlustreich. Halsey unternahm nun einen Vorstoß Richtung Formosa und Okinawa und vernichtete rund 1200 japanische Flugzeuge und Piloten, die als Verstärkung für die Philippinen geplant waren. So stellte er die absolute Luftüberlegenheit über dem Gebiet um Leyte ­sicher. Ab dem 17. Oktober besetzten US-Einheiten einige Leyte vorgelagerte Inseln. Noch konnten sich die Japaner nicht dazu durchringen, Sho-1 auszulösen. Der Treibstoff war zu knapp, um einem eventuellen alliierten Ablenkungsangriff entgegnen zu können. Die Hauptlandungen der USA begannen am 20. Oktober in der Gegend um Tacloban, wo geplant war, in aller Kürze einen Flugplatz zu errichten. Als feststand, dass die Landung im Golf von Leyte der erwartete große Angriff der US Navy sein würde, löste die Kaiserliche Marine am 21. Oktober den Plan Sho-1 aus. Er basierte, wie bei der japanischen Marine üblich, auf einem komplexen Zusammenspiel verschiedener see- und landgestützter Verbände. Die Hauptmacht, »Center Force« unter Vizeadmiral Kurita Takeo, brach am 22. Oktober von den Treibstofflagern auf Borneo aus auf. Teile detachierten kurz danach und liefen als eigenständige Einheit »Southern Force« (Vizeadmiral Nishimura Shoji) mit zwei alten Schlachtschiffen, einem schweren Kreuzer und vier Zerstörern durch die Sulu-See südlich der Insel Negros Richtung Surigao-Straße. In einer Zangenbewegung sollte »Center Force« die Sibuyan-See durchqueren und über die San-Bernardino-Straße von Norden ebenfalls auf die SurigaoStraße vorstoßen und die Transportschiffe vor den Brückenköpfen auf Leyte sowie die gelandeten Truppen vernichten. Verstärkung für Nishimura war durch eine zweite, von nordwestlich der Philippinen anlaufende Gruppe aus zwei schweren und einem leichten Kreuzer und vier Zerstörern vorgesehen. Um Halsey und seine Fliegerkräfte der 3. Flotte wegzulocken, bekam Vizeadmiral Ozawa Jisaburo den Auftrag, mit einem Trägerverband von Japan aus – also von Norden – anzulaufen und den Lockvogel zu spielen. Aufgrund der Verluste in den Vormonaten hatte ­ diese »Northern Force« so gut wie keine Flugzeuge mehr an Bord, der Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 pa/United Archives/TopFoto Leyte 1944 5Die Yamato, das größte und stärkste je gebaute Schlachtschiff, ca. 1941/42. . Verlust der Einheiten wurde bewusst in Kauf genommen. Man wollte dem bekannten Wunsch Halseys, unbedingt Träger zu versenken, ein Ziel bieten und spekulierte darauf, dass er den Köder schluckte. »Center Force« fuhr ohne eigene Luftstreitkräfte, Sho-1 setzte auf die an Land stationierten Fliegerkräfte zur Deckung des Verbands. Diese aber waren bis auf wenige, bewusst zurückgehaltene »spezielle Angriffskräfte« zu diesem Zeitpunkt schon aufgerieben. Doch war die Feuerkraft von Sho-1 gewaltig: fünf Schlachtschiffe, darunter Yamato und Musashi mit 18,1 Zoll (46 cm) Hauptkaliber, zehn schwere, zwei leichte Kreuzer sowie 15 Zerstörer. Sho-1 sah vor, dass die Einheiten nach dem Treffen vor Leyte gemeinsam außer­halb der Reichweite von Halseys Flugzeugen über die Sulu-See nach Borneo zurückkehrten. Palawan-Passage, 23.10. Sho-1 stand unter einem schlechten Stern. US-amerikanische U-Boote klärten den entlang der Nordküste Palawans laufenden Verband frühzeitig auf. Das Seegebiet ist durch gefährliche Untiefen und wenig Manövrierraum gekennzeichnet. Für die sicherere, aber längere Passage aller Einheiten durch die Sulu-See fehlte der Treibstoff. Nach Sichtungsmeldungen an Halsey setzten die U-Boote Darter und Dace zum Angriff an, versenkten Kuritas Flaggschiff, den Kreuzer Atago sowie den Kreuzer Maya und beschädigten den Kreuzer Takao so schwer, dass er zurückkehren musste. Kurita wurde aus dem Meer geborgen und setzte auf Yamato seine Flagge. Er hatte wichtiges Kommunikationsmaterial und -personal verloren. Der Verband fuhr dennoch weiter auf das Ziel Leyte. Die Dace lief kurze Zeit später auf ein Riff und wurde – ohne Ver- 10 luste unter der Besatzung – aufgegeben. Sibuyan-See, 24.10. »Center Force« lief ohne die zugesagte Luftunterstützung in die Sibuyan-See ein und wurde von Halseys Aufklärern entdeckt, der in typischer Manier seinen Fliegern befahl: »Strike – repeat: Strike! Good luck!« Halsey erfüllte auftragskonform einen Zusatz seines Einsatzbefehls: »Sollte sich die Möglichkeit bieten, große Teile der feindlichen Flotte zu zerstören, dann wird das die Hauptaufgabe.« Damit war er von der engen Bindung an die Landungszone (wie Spruance vor den Marianen) befreit. Dieser Zusatz war ohne Absprache mit MacArthur entstanden. Ein gemeinsamer Oberbefehlshaber vor Ort hätte dies sicher anders gesehen. Die verbliebenen japanischen Fliegerkräfte versuchten von Land aus die US-Trägerverbände anzugreifen, wurden aber erfolgreich abgewehrt. Einem einzelnen japanischen Bomber gelang der Durchbruch zur Task Force 38. Er erzielte einen Treffer auf dem Träger Princeton, der Feuer fing. Der Kreuzer Birmingham ging längsseits zur Hilfeleistung, als der Träger plötzlich explodierte. Auf dem Kreuzer gab es hohe Verluste durch Splitter; über 400 Seeleute fielen. Den ganzen Nachmittag des 24.Oktober über wurde »Center Force« von insgesamt fünf Wellen US-amerikanischer Flieger angegriffen. Nahezu alle schweren Einheiten wurden getroffen, der Schwere Kreuzer Myoko gar so beschädigt, dass er ablaufen musste. Das Superschlachtschiff Musashi sank, wofür mindestens zwölf Torpedos und ca. 20 Bombentreffer notwendig waren. Mit der Musashi gingen 1200 Besatzungsmitglieder unter. Kurita, durch Dengue-Fieber und den Verlust seines Flaggschiffs kaum noch Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 in der Lage zu führen, entschloss sich zum Rückzug und ließ nach Westen ablaufen. Halsey erhielt die Meldung, dass der Gegner abgedreht hatte, und glaubte den weit übertriebenen Erfolgsmeldungen seiner Piloten. Die Gefahr durch »Center Force« beurteilte er als gebannt. Ihm selbst und seinem Stab war es jedoch ein Rätsel, wo sich die bisher nicht erkannten japanischen Träger aufhielten, auf deren Vernichtung er so fixiert war. Bei keinem gemeldeten Verband waren bisher Träger gesichtet worden. In einem Fernschreiben informierte er Nimitz über die beabsichtigte Bildung einer »Task Force 34« aus schweren Einheiten, welche die SanBernardino-Straße, den nördlichen Zugang zum Brückenkopf auf Leyte, gegebenenfalls decken sollte. Wörtlich hieß es, »Task Force 34 will be formed«. Halsey erachtete das als Ankündigungssignal; Kinkaid, der im Süden den Funkverkehr mithörte, aber auch Nimitz verstanden es als tatsächliches Ausführungssignal. Inzwischen hatten Halseys Aufklärer im Norden Ozawas »Northern Force«, den Lockvogel, entdeckt. Halsey reagierte exakt so, wie es die japanische Marineführung erhofft hatte. Eingedenk seiner Zusatzweisung lief er mit Höchstfahrt Ozawa entgegen. Er informierte Nimitz über die neue Lage und schloss: »I am proceeding North« – mit drei Träger-Task Groups seiner Task Force 38 (eine Task Group war zur Nachversorgung detachiert worden). Auch seine Schlachtschiffe und Kreuzer wurden mitgenommen, ohne Nimitz oder Kinkaid darüber zu informieren. Sie gingen nach wie vor davon aus, dass die San-Bernardino-Straße gedeckt sei. Wiederum machte sich das fehlende einheitliche Oberkommando nachteilig bemerkbar. Surigao-Straße, 24./25.10. Zeitgleich zu den Gefechten in der ­ ibuyan-See lief die »Southern Force« S mit dem ersten Verband unter Nishimura durch die Sulu-See. Kurzfristig geriet sie unter Luftangriffe, was zu leichten Treffern auf dem Schlachtschiff Fuso und dem Zerstörer Shigure führte. Die Ereignisse in der SibuyanSee zogen die Marineflieger ab, Nishi- mura lief südlich von Negros und Bohol auf die Surigao-Straße zu. Oldendorf hatte genügend Zeit, seine Kräfte zu formieren, und ließ Nishimura in eine klassische »Crossing-the-T«-Situation fahren. Seine schweren Einheiten sperrten den nördlichen Ausgang der Straße und konnten mit ihren Breitseiten auf den in dem engen Fahrwasser in Kiellinie anlaufenden Gegner wirken, der nur seine vorderen Geschütze einzusetzen vermochte. Ständig informierten ihn entlang der Anmarschroute dislozierte Schnellboote über den Gegner, dessen Zusam- mensetzung, Kurs und Fahrt. Ihre couragiert vorgetragenen Angriffe blieben allerdings erfolglos. Nishimura wurde bei Eintritt in die schmale Straße an den Flanken von Zerstörern in klassischen Torpedoangriffen in die Zange genommen und verlor ein Schlachtschiff sowie mehrere Zerstörer, alle übrigen Einheiten wurden beschädigt. Die US-amerikanischen Kreuzer und Schlachtschiffe eröffneten auf weite Kampfentfernung ihr radargesteuertes Feuer und vernichteten Nishimuras Verband. Dabei kamen auf US-Seite auch Schiffe zum Einsatz, die in Pearl Harbor versenkt oder beschädigt und Seeschlacht im Golf von Leyte, Oktober 1944 NORTHERN FORCE (Ozawa) Kap Engaño 25.–26.Okt.: Schlacht am Kap Engaño SÜDCHINESISCHES MEER 14. ARMEE (Yamashita) PHILIPPINENSEE LUZON Lingayen San Antonio MANILA LamonBucht 2. Verband der SOUTHERN FORCE (Shima) 24. Okt.: Schlacht um die Sibuyan-See MINDORO Sibuyan- SAMAR See 1. Verband der CENTER FORCE (Kurita) See Ormoc PANAY 35. ARMEE (Suzuki) CEBU PALAWAN 25.Okt.: Schlacht um Samar Visayan- NEGROS Puerto Princesa Task Force 38/ 3. FLOTTE (Halsey) o-Straße ardin ern n-B Sa Tacloban 20.Okt. - St gao Suri SULU-SEE Golf von Leyte LEYTE BOHOL Homonhon 18.Okt. Suluan 17.Okt. ra ß 6. ARMEE (Krueger) Dinagat 18.Okt. e 7. FLOTTE (Kinkaid) 24.–25.Okt.: Schlacht um die Surigao-Straße SOUTHERN FORCE (Nishimura) MINDANAO 22.10. Auslaufen aus Brunei (Nordborneo) japanisch besetzte Gebiete Kurslinien Japaner Kurslinien Alliierte Seegefechte JOLO und Schiffsverluste BORNEO 0 CELEBES-SEE 100 Quelle: The Chronological Atlas of World War Two, New York 1989, S. 197. 200 300 400 km © ZMSBw 04265-12 wieder einsatzfähig gemacht worden waren. Die Missouri schoss dabei die letzte Salve, und zwar auf Fuso; es war das letzte Mal in der Geschichte des Seekrieges, dass ein Schlachtschiff auf ein anderes schoss. Es war auch die letzte Seeschlacht ohne Unterstützung durch Fliegerkräfte. Sie wurde allein von schwimmenden Einheiten ausgetragen. Lediglich der Zerstörer Shigure entkam leicht beschädigt, alle anderen Einheiten wurden entweder sofort versenkt oder gingen später infolge der Schäden verloren bzw. mussten aufgegeben werden. Shigure konnte den zweiten Verband der »Southern Force« unter Admiral Shima Kiyohide, der rund 40 Seemeilen (ca. 65 km) hinter Nishimura lief, rechtzeitig warnen und zur Umkehr bewegen. Auf US-Seite ging lediglich ein Schnellboot verloren, ein Zerstörer wurde durch »friendly fire« beschädigt. Warum sich Shima und Nishimura nicht zu einer Streitmacht vereinigten, ist nicht bekannt. Lag es an den unterschiedlichen Befehlssträngen, denen sie unterstanden, oder aber am strengen Senioritätsprinzip der Kaiserlichen Marine? Da die Chemie zwischen beiden »nicht stimmte«, wollte Nishimura sich vermutlich Shima nicht unterordnen. Geändert am Ausgang hätte wohl auch eine zusammengefasste Flotte nichts. Kap Engano, 25.10. »Engano« bedeutet »Täuschung«, wie zum Auftrag der »Northern Force« passend. Halsey wollte endlich Träger versenken und lenkte seine Einheiten nach Norden. Am Morgen des 25. Oktobers sollten Flugzeuge den japanischen Gegner stellen, die schweren Überwassereinheiten sollten nachstoßen und eventuell beschädigte Schiffe endgültig vernichten. Warnungen aus seinem Stab, dass nun die Straße von San Bernardino offen sei, ignorierte Halsey mit dem Hinweis, die »Center Force« sei kein ernst zu nehmender Faktor mehr. Der fast ohne Jagdschutz fahrende Verband Ozawas wurde zur leichten Beute für Halsey; der schwere Träger Zuikaku, der letzte überlebende Veteran des Angriffs auf Pearl Harbor, sowie drei leichte Träger, drei Kreuzer Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 11 Leyte 1944 ullstein bild/TopFoto 3Philippinen, Sibuyan- und insgesamt neun Zerstörer wurden versenkt. Zum totalen Sieg im Norden kam es jedoch nicht, denn anstatt mit den schweren Einheiten nachzusetzen, musste Halsey umdrehen, um dringenden Hilferufen aus dem Süden nachzukommen. Halsey kommentierte dies als die »bitterste Entscheidung meines Lebens«. Was war geschehen? Das Gefecht vor Samar, 25.10. Nachdem er eine Weile Richtung Westen geschwenkt war, drehte Kurita auf Weisung aus Tokio überraschend und unbemerkt wieder auf Ostkurs. Er durchquerte die San-Bernardino-Straße bei Nacht und lief in das Seegebiet vor Samar nordöstlich von Leyte. Da Halsey auf Ozawas Bluff hereinfiel, war dieses Einfallstor nach Leyte ungedeckt. Der nördliche Teil von Sho-1 verlief damit erfolgreich. Lediglich drei Gruppen (von Süden nach Norden als »Taffy 1–3« bezeichnet) mit insgesamt 16 Geleitträgern und zugehörigen Sicherungsfahrzeugen standen noch zwischen den weltweit stärksten Rohrwaffen auf See und den Landungsstränden. In den folgenden Stunden verteidig­ ten sich die überraschten US-amerikanischen Einheiten verzweifelt gegen die anrückende japanische Übermacht. Die für den Landkampf bewaffneten Flugzeuge sämtlicher Träger flogen Angriff auf Angriff mit Bomben (nicht panzerbrechend, da für Landziele gedacht) und Bordwaffen, einige wenige Torpedoflieger griffen ein. Ein Pilot meldete sogar, dass er mit seiner Pis­ tole auf ein Schlachtschiff geschossen habe. Leergeschossene Flugzeuge flogen »Dummy-Angriffe«, um die Kaiserliche Marine zum Ausweichen zu zwingen. Sie nutzten das kaum aufnahmefähige Flugfeld von Tacloban, 12 See, 24. Oktober 1944: Der Kreuzer USS Birmingham (rechts) versucht, das durch einen japanischen Bombentreffer auf dem leichten Träger USS Princeton ausgelöste Feuer zu löschen. Die Princeton sank, die Birmingham wurde schwer beschädigt. wo Heeresflieger und Pioniere mit primitivsten Mitteln die Jäger und Bomber betankten und bewaffneten. Kurita war von seiner erfolgreichen Annäherung selbst überrascht, gleichzeitig unterliefen ihm Fehler bei der Feindaufklärung: Er identifizierte Geleitträger als schwere Träger und Zerstörer als Kreuzer. Statt koordiniert in Formation anzugreifen, befahl er einen »allgemeinen Angriff«, und jede Einheit machte letztendlich das, was sie für geeignet hielt. Zum ersten und einzigen Mal wurden jetzt die Riesenkaliber gegen andere Schiffe eingesetzt. Vermutlich war Kurita durch Krankheit und Anspannung der letzten Tage nicht mehr in der Lage, klar zu führen. Ein Torpedoangriff zwang ihn, nach Norden auszuweichen; er verlor das Lagebild völlig aus den Augen. Die US-Zerstörer und Geleitboote liefen nun auf die Japaner zu – David gegen Goliath –, bis in Reichweite ihrer Fünf-Zoll-Geschütze; sie torpedierten und nebelten. Die besonders gefährdete nördliche Trägergruppe »Taffy 3« unter Rear Admiral Clifton »Ziggy« Sprague manövrierte geschickt durch Regenschauer und zwang die nur optisch schießenden Japaner zu ständig neuer Zielauffassung. Einige Schwere Kreuzer der japanischen Marine wurden durch Beschuss, Torpedos und Fliegerangriffe so stark beschädigt, dass sie sanken. Die japanische Artillerie verschoss Farbzusätze, um die Aufschlagsbeobachtung zu erleichtern. Dies veranlasste einen Seemann zu der Äußerung: »Sir, sie schießen auf uns in Techni­ color!« Der Geleitträger Gambier Bay wurde schwer getroffen, er sank als einziger Träger im Pazifik durch Rohrwaffen. Insgesamt aber gelangen den Japanern vergleichsweise wenige Treffer. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 Unterdessen verfolgten Kinkaid im Süden und Nimitz in Hawaii das Gefecht aus der Ferne. Offene Funksprüche, Hilferufe der »Taffies«, Fragen nach dem Verbleib von Halseys TF 34, die den Zugang decken sollte, wie alle annahmen – keiner hatte ein klares Lagebild. Das Fehlen eines Befehlshabers vor Ort veranlasste Nimitz schließlich, einen Funkspruch an Halsey zu senden. »Truthahn tritt Wasser DD Wo, ich wiederhole, wo ist Task Force 34 DD Das fragt sich die Welt.« Die Teile vor und nach den »DD« waren als Funksicherheit gedacht und sollten dem Gegner das Entschlüsseln erschweren. Halsey jedoch bekam das Ende mit vorgelegt. Er geriet völlig außer sich und musste durch seinen Stab beruhigt und beschworen werden umzudrehen. Es dauerte noch eine Stunde, bis der Entschluss dazu fiel. Die Chance, Träger zu versenken, war vorbei; bis er bei Samar eintraf, würde auch Kurita verschwunden sein, seine große Gelegenheit war verloren. Die Kaiserliche Marine staffelte unterdessen dichter an »Taffy 3« heran, schoss wirksamer, aber ihre panzerbrechenden Granaten durchschlugen meist die dünnen Decks der Geleitträger ohne zu detonieren. Der US Navy drohte eine schwere Niederlage, doch Kurita fasste den bis heute rätselhaften Entschluss, nach Norden durch die San-BernardinoStraße wieder abzulaufen. Da er sich nie Historikern gegenüber geäußert hat, kann man nur aus Kriegstagebüchern und Erinnerungen seines Stabes Rückschlüsse ziehen. Die Vernichtung der »Southern Force« war ihm inzwischen bekannt, er hatte selbst schon drei Kreuzer verloren. Er befürchtete verstärkte Luftangriffe und die Sperrung der San-Bernardino-Straße, womit der Rückzug abgeschnitten wäre. Anders als viele japanische Admirale lehnte Kurita nachweislich sinnlose Kämpfe ab. Halsey kam zu spät, Kurita konnte mit dem Gros seiner Schiffe entkommen, nur Halseys Flieger erzielten noch einigen Schaden. Bis zum Kriegs­ ende spielten die Schiffe der japani­ schen Marine keine Rolle mehr. Kamikaze Nun spielte die Kaiserliche Marine ihren letzten Trumpf aus: den seit Lan- gem seitens der Führung geforderten Einsatz der Kamikaze-Verbände. Benannt nach einem Taifun (»Kamikaze« heißt wörtlich »Göttlicher Wind«), der im 13. Jahrhundert zweimal eine mongolische Invasionsflotte zerstört hatte, sollten diese »Speziellen Angriffsverbände« die US Navy aufhalten. Der Einsatz war schon früher vorgesehen gewesen, wurde aber immer wieder verschoben. Diese anfangs auschließlich freiwilligen Flieger stürzten sich mit Bomben beladen in Selbstmordangriffen auf die »Taffies«. Der Träger St. Lô wurde ihr ers­tes Opfer, weitere Träger erfuhren schwere Beschädigungen. Bis zum Kriegsende fielen durch Kamikaze mehr US-Seeleute als durch alle anderen Angriffe und Gefechte zuvor, aber auch dies vermochte nichts mehr am Ausgang des Krieges zu ändern. Ende Oktober/Anfang November endete der Seekrieg um Leyte. Das Kaiserliche Heer versuchte über den nordwestlichen Hafen Ormoc die Truppen zu verstärken. US-Luftangriffe versenkten schließlich fast alle Transporter und eine größere Zahl an Zerstörern, darunter viele, die den Gefechten der Vortage entkommen waren. Zusammenfassung ullstein bild/TopFoto Die Gefechte um Leyte waren der letzte Versuch der Kaiserlichen Marine, sich der erdrückenden Überlegenheit der US Navy entgegenzustellen. Ganz im Denken eines Mahan verwurzelt, versuchte der japanische Admiralsstab eine »Entscheidungsschlacht« herbeiführen, d.h. in einer großen Schlacht soll der Gegner derart geschwächt werden, dass er um Frieden nachsucht. Seine Verluste sollen so hoch sein, dass eine Fortsetzung des Kampfes nicht mehr möglich ist. Dieses Prinzip ist jedoch, wenn überhaupt, nur bei gleich starken Gegnern anwendbar. Wegen der stetig wachsenden Überlegenheit der US Navy, ihrer guten Ausbildung und des Fehlens japanischer Fliegerkräfte war dieser Versuch von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die materielle US-Überlegenheit war so groß, dass selbst krasse Fehler ihrer Führung keine entscheidende Rolle spielten. Auch ein Durchbruch zu den Brückenköpfen auf Leyte hätte nicht mehr geholfen, die US-Streitkräfte von den Philippinen zu vertreiben. Der Angriff kam schlicht zu spät, da die Transporter bereits entladen und abgelaufen waren. Die US-amerikanischen Brückenköpfe waren etabliert und gesichert. Für künftige Operationen einschließlich der Landung in Japan selbst – ge­ plant für Oktober 1945 und März 1946 als Operation »Downfall« – wurde ­MacArthur zum Supreme Commander Allied Powers (SCAP) ernannt. Unklare Befehlsstränge sollte es nicht wieder gegeben. Rund 1500 US-amerikanische und über 10 000 japanische Seeleute und Flieger fielen in den Seegefechten. Die Schlacht um Leyte war die größte Seeschlacht des Zweiten Weltkriegs, mit etwa so vielen Kampfschiffen wie im Skagerrak 1916, einem Fünftel mehr Tonnage plus Flugzeugen und U-Booten. Japan war nun vollständig abgeriegelt, auch die Transporte aus China wurden leichte Opfer der ungehindert operierenden US-amerikanischen UBoote und Flugzeuge. Der Import kam völlig zum Erliegen. Die Industrie konnte so gut wie nichts mehr produzieren, und wenn, dann minderwertige Qualität. Mit dem Verlust der Philippinen war die Hoffnung auf eine entscheidende Wende endgültig dahin. Selbst der inländische Verkehr, der Transport von Kohle und Erz aus dem Norden zu den Industrieanlagen im Süden wurde durch die nun ungehindert vor den Küsten Japans kreuzenden US-amerikanischen Trägerverbände effektiv unterbunden. Die Kaiserliche Marine hörte auf, als kampffähige Einheit zu existieren. Ihre Fliegerkräfte waren aufgerieben, Nachwuchs wurde hastig und unzureichend ausgebildet und in Kamikaze-Angriffen verheizt. Die Flotte lag entweder in der Region um Singapur, ohne in der Lage zu sein, nötige Reparaturen durchzuführen, oder in den Häfen Japans. Dort dienten die Schiffe meist als stationäre Flakbatterien und wurden ein leichtes Opfer der US-Luftstreitkräfte. Die Yamato wurde im April 1945 schließlich bei einem »Kamikaze«-Einsatz gegen Okinawa ebenfalls aus der Luft versenkt. Halsey führte die 3. Flotte im September 1945 zur Kapitulation Japans in die Bucht von Tokio. Kurita war in seiner letzten Verwendung Kommandeur der Offizierschule Eta Jima. Hier versuchte er seine jungen Kadetten auf ein Leben nach dem Krieg vorzubereiten und verbot ihnen ausdrücklich, sich in »Kamikaze«-Einsätzen zu opfern. Axel Schilling Literaturtipps 5Marinejäger Mitsubishi A6M Typ Null »Reisen« (alliierter Codename »Zeke«), hier eine Beutemaschine in US-Markierungen: Gegen Kriegsende kaum mehr konkurrenzfähig, wurde die A6M ab 1944 häufig bei Kamikaze-Angriffen eingesetzt, so auch in der Schlacht um Leyte. Thomas J. Cutler, The Battle for Leyte Gulf, 23–26 October 1944, Annapolis, MD 1994. James D. Hornfischer, The Last Stand of the Tin Can Sailors, New York, NY 2004. Anthony P. Tully, Battle of Surigao Strait, Bloomington, IN 2009. Milan Vego, The Battle for Leyte 1944, Annapolis, MD 2006. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 13 Im Auftrag der UNO Im Auftrag der UNO pa/dpa Die Beteiligung der DDR an der Friedensmission 1989/90 in Namibia 5UN-Stützpunkt in Gibeon im Süden Namibias mit zwei DDR-Polizeibeobachtern und einem Offizier aus Pakistan, November 1989. W ährend sich durch die anhaltenden Massenproteste der Bevölkerung gegen die Herrschaft der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) die Lage in der DDR im Herbst 1989 zuspitzte, wandten sich vier Soldaten der Nationalen Volksarmee (NVA) am 2. Oktober 1989 mit einem sonderbaren Anliegen an den Generalsekretär der SED. Ob dieser Brief Erich Honecker jemals erreichte? Die Angehörigen der Wartungs- und Konservierungsbasis 1 in Peenemünde sahen es auf jeden Fall als ihre »Pflicht an, uns für einen Einsatz in Namibia zum Ruhme unseres Landes, zur Stabilisierung der Lage in Namibia, natürlich freiwillig zu bewerben«. Und weiter hieß es: »Das soll auch eine Antwort auf den Verrat der ›DDR-Bürger‹ sein, die meinen, im ›goldenen Westen‹ ein neues Vaterland zu finden. Wir wollen am Vorabend des 40. Geburtstages unserer Republik zeigen, dass es noch Millionen staats- 14 bewusste Bürger gibt, die alles zu tun bereit sind, damit unsere Republik weiter an Ansehen und Achtung im Völkerbund gewinnt.« Was hatte es damit auf sich? Und von welchem Einsatz sprachen sie überhaupt? 25 Jahre nach dem Zusammenbruch der SED-Herrschaft bietet sich mit der folgenden Rückschau die Chance, die erste und einzige Beteiligung der DDR an einer Friedensmission der Vereinten Nationen (UN) und die damit einhergehenden Überlegungen im Ministerium für Nationale Verteidigung (MfNV) in Erinnerung zu rufen. »Blauhelmmission« im ­Südwesten Afrikas Ebenso wie zwischen Rostock und Plauen geriet 1989 auch am anderen Ende der Welt zwischen Lüderitzbucht, Swakopmund und Windhuk die bisherige politische Ordnung ins Wanken. Seit April 1989 ebnete die UN- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 Friedensmission zur Unterstützung eines politischen Übergangsprozesses (United Nations Transition Assistance Group, UNTAG) auf Grundlage der Resolution 435 des UN-Sicherheitsrates von 1978 (UNSCR 435/78) Namibia den Weg in die Unabhängigkeit. Das ehemalige koloniale Schutzgebiet des Deutschen Kaiserreiches (1884 bis 1915) stand seit 1920 unter südafrikani­ scher Verwaltung bzw. Besatzung; mit UN-Hilfe sollten nun demokratische Wahlen, eine verfassungsgebende Natio­ nalversammlung und die Souveränität des Landes friedlich herbeigeführt werden. Erstmals verfügte eine »Blauhelmmission« neben ihren regulären militärischen Kräften über ein gleichwertiges ziviles Kontingent, zu dem eine eigene UN-Polizei gehörte. Während die Berliner Mauer fiel, erreichte die UNTAG anlässlich der Wahlen in Namibia vom 7. bis 11. November 1989 mit fast 8000 Mitarbeitern aus 109 Staaten ihren größten personellen Umfang. Darunter befanden sich 1494 Polizeibeobachter, 4493 Mann militärisches Personal sowie 2000 Zivilbedienstete. Die 4493 ­UNTAGSoldaten wurden durch drei Bataillone aus Finnland, Malaysia und Kenia gestellt. Jugoslawien, Venezuela, Bangladesch und Togo hielten weitere Streitkräfte auf Abruf bereit. Auch die beiden deutschen Staaten waren mit eigenen Einheiten beteiligt und verrichteten in Ombalantu im Norden Namibias in einem Stützpunkt der International Civilian Police (CivPol) schon vor Öffnung der innerdeutschen Grenze unter internationalem UN-Kommando zusammen ihren Dienst. In Ombalantu waren auch Polizeibeobachter aus Kanada, Irland, ­Indien, Pakistan und Schweden stationiert. Ihr gemeinsamer Auftrag bestand darin, unbefangen und unbewaffnet den Wahlprozess zu begleiten sowie das Vorgehen der bis zur Unabhängigkeit im Land verbleibenden polizei­lichen und paramilitärische Einheiten Südafrikas zu überwachen. Warum führte das taumelnde SED-Regime ein solches Vorhaben selbst noch in den »Wirren der Wende« durch? Die SED verstand sich in ihrer Afri­ kapolitik als konsequent antikolonialistisch und antirassistisch. Jegliche koloniale deutsche Vergangenheit in ­Namibia verwies Ost-Berlin in die Tradition der Bundesrepublik, wollte die DDR sich doch in Afrika historisch unbelastet als deutscher sozialistischer Alternativstaat präsentieren. Enge Beziehun­gen zur nationalen Befreiungsbewegung Namibias, der Südwestafrikanischen Volksorganisation (South-West Africa People’s Organisation, SWAPO), pflegte sie schon seit 1977. Verständlich wird somit die intensive Subventionierung der SWAPO allein 1989 mit 16 Millionen Mark der DDR, etwa für den bevorstehenden Wahlkampf oder die Rückführung namibischer Flüchtlinge in ihre Heimat; ein Indiz dafür, welch hohen Stellenwert die SED der Unabhängigkeit Namibias beimaß. Das hatte gute Gründe. 1989 wollte die DDR unbedingt an der Umsetzung der UN-Resolution 435 mitwirken; auch weil andere Länder des Warschauer Paktes (Polen, Ungarn, Rumänien) schon länger, etwa durch logistische Hilfen, UN-Missionen unterstützt hatten und die DDR im UNSonderausschuss für Friedensmissio­ nen seit geraumer Zeit mit Sitz und Stimme vertreten war. Für sie ging es darum, ihren personellen Einfluss in den Vereinten Nationen zu vergrößern und sich prinzipiell stärker an solchen Einsätzen zu beteiligen – auch, um ihre Pflichtbeiträge als Mitglied der Vereinten Nationen zu senken. Zugleich flankierte die Mitwirkung an Namibias Freiheitsprozess Pläne im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten (MfAA) im Frühjahr 1989, die Afrika-Strategie der DDR neu auszurichten, d.h. Epidemien oder Hunger­ katastrophen in Afrika lösungsorientierter anzugehen und nicht nur unter den längst überholten ideologischen Gesichtspunkten des Ost-West-Konfliks zu betrachten. Das zusammen mit dem Institut für Internationale Beziehungen (IIB) in Potsdam erstellte (von der SED-Führung aber wohl nicht mehr beschlossene) Konzept ordnete Namibia bis zum Jahr 2000 eine wichtige Rolle in Subsahara-Afrika zu. Angesichts des Bürgerkrieges im angrenzenden Angola und der nicht ab- zusehenden Entwicklung Südafrikas mit Blick auf den Apartheid-Konflikt wäre Namibia für die DDR perspektivisch ein wertvoller Regionalpartner im südwestlichen Afrika gewesen. Knackpunkt Südafrika Im April 1989 hatten schwere Kämpfe im Norden Namibias zwischen südafri­ kanischen Militärs und SWAPO-Milizen mit mehreren Hundert Todesopfern den Beginn der UNTAG-Mission überschattet. Der UN-Sondergesandte für Namibia, der Finne Marrti Ahtisaari, verfügte im Nachgang die Aufstockung der zivilen Polizeikräfte innerhalb der UNTAG zunächst von 500 auf 1000 und schließlich bis November 1989 auf 1500 Mann. Dabei bedachte er auch beide deutschen Staaten, weil zum einen die deutsche Sprache in Namibia aufgrund der kolonialen Vergangenheit oft gesprochen und noch mehr verstanden wurde. Zum anderen wollte Ahtisaari mit deutschen Wahlbeobachtern der einflussreichen, der SWAPO skeptisch gegenüberstehenden deutschstämmigen Minderheit entgegenkommen und bei ihr das Vertrauen in den Unabhängigkeitsprozess stärken. Darüber hinaus verfolgte er innerhalb der UNTAG das Prinzip der politischen Balance, nach der sich politisch konträr gegenüberstehende Staaten (u.a. Pakistan und Indien) unter UN-Flagge auf Augenhöhe bewegen sollten. Während die westdeutsche Seite trotz Debatten über den Umgang mit der kolonialen deutschen Vergangenheit in Namibia und den ersten derartigen Auslandseinsatz der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg dem Einsatz zustimme, hemmten zwei wesentliche Faktoren Ahtisaaris Intention, auch die DDR an der UNTAG zu beteiligen: Einerseits wehrte sich die Republik Südafrika vehement gegen die Beteiligung der DDR, wohl wissend um ihre enge Liaison mit der SWAPO, dem schärfsten Gegner der südafrikanischen Besetzung. Erst im August 1989 und nach persönlicher Einflussnahme von UN-Generalsekretär Javier Pérez de Cuéllar zogen südafrikanische Diplomaten ihren Widerstand gegen die ostdeutsche Beteiligung an der UNTAG mit Polizeibeobachtern zurück. Andererseits hatte Ahtisaari im Mai 1989 die DDR mit seiner Anfrage nach 50 Polizeibeobachtern überrascht. Mehrmals angeboten hatten das MfAA, die UNTAG mit Wahlhelfern, humanitärer Hilfe und diplomatischen Beobachtern vor Ort zu unterstützen – was schließlich auch geschah. Auf die Entsendung einer Polizeieinheit war OstBerlin allerdings nicht vorbereitet. Die DDR betrat Neuland. Sofortmaßnahmen und Zukunfts­pläne Zügig fand sich im Mai 1989 unter Federführung des DDR-Außenministeriums eine Expertenrunde zusammen – noch nicht ahnend, dass Südafrikas Blockadehaltung bis in den Spätsommer 1989 Bestand haben sollte. Hinzu kamen Vertreter des Innenministeriums (MdI), dem die Deutsche Volkspolizei nachgeordnet war, des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) und des Verteidigungsministeriums. Gesucht wurden 40 bis 50 Personen aus den vier Ministerien, darunter zwölf Angehörige des Militärs. Das MfNV begann bald darauf in der NVA und in der Volksmarine die Suche nach geeigne­ tem Personal. Währenddessen fand pa/dpa Ostdeutsche Namibia-Interessen 5SWAPO-Anhänger in Windhuk begrüßen die Resolution 435 des UN-Sicherheitsrates, die Namibia Autonomie zusichert, September 1989. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 15 5Verabschiedung der 30 DDR-Polizeibeobachter nach Namibia auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld durch den stellvertretenden DDR-Außenminister Bernhard ­Neugebauer, 11. Oktober 1989. Potsdam stationierten Luftlandeeinheit der NVA mit Fallschirmspringern, eingegliedert werden. Für längere Missio­ nen war für einen personellen Wechsel eine zweite Kompanie vorgesehen. Hinzu wären weitere Kräfte zur Versorgung der Kompanien gekommen, sodass die Zahl der für UN-Einsätze zu schulenden Soldaten ab 1991 bei etwa 350 Personen gelegen hätte. pa/dpa eine Abstimmung auf höchster Regierungs- und Parteiebene statt. Außenminister Oskar Fischer informierte die Minister des Innern (Friedrich Dickel), für Staatssicherheit (Erich Mielke) und Nationale Verteidigung (Heinz Keßler) und sicherte sich an den obersten SEDGremien (Politbüro, Zentralkomitee) vorbei die Rückendeckung von Erich Honecker, der sich Entscheidungen in außenpolitischen Fragen durchaus persönlich vorbehielt und die Entsendung der Polizeibeobachter billigte. Für den Moment allerdings blieb das bekannte Signum »Einverstanden E.H.« des Parteichefs ein Muster ohne Wert, weil das südafrikanische Veto gegen die DDR in der UNTAG weiter galt. Parallel dazu kam die Frage auf, wie sich die DDR zu künftigen UN-Missio­ nen positionieren sollte. Muster für ­diese Pläne war Polen, das seit 1971 an mehreren UN-Missionen zumindest im logistischen Bereich beteiligt war. Dass die Vereinten Nationen ihren Statu­ten nach mit ihren Missionen eine »stabile Friedensordnung in der Welt« gewährleisten wollten, kam der sich als dialogbereiten Friedensstaat präsentierenden DDR entgegen. Geplant war, 30 bis 40 Militärbeobachter bis Ende 1990 auf UN-Missio­ nen vorzubereiten und ab Ende 1991 den Vereinten Nationen eine militäri­ sche Einheit anzubieten. Diese sollte aus einer Kompanie mit drei Zügen zu je 50 Mann bestehen und in das Luftsturmregiment 40, einer in Lehnin bei BArch, Bild 183-1989-1011-026/Bernd Settnik Im Auftrag der UNO 5Ankunft der Polizeibeobachter aus der DDR auf dem Flugplatz in Windhuk am 12. Oktober 1989: Kommandeur Oberstleutnant der Volkspolizei Ulrich Kienzle ­erstattet dem stellvertretenden Chef der UNTAG-Polizei Meldung. 16 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 Polizeieinsatz ohne Polizisten? Statt der von den Vereinten Nationen geforderten 50 Polizeibeobachter konnte in der Kürze der Zeit nur eine Gruppe mit 30 geeigneten Personen zusammengestellt werden, hauptsächlich, weil nicht genügend Angehörige der Volkspolizei mit ausreichend Kenntnissen der englischen (UN-Kommando-)Sprache verfügbar waren. Damit einher ging die Tatsache, dass die Angehörigen der Namibia-Einheit in der Regel gar nicht als klassische Polizisten arbeiteten (im Streifendienst etwa). Sie waren in ihrem normalen beruf­lichen Alltag u.a. als Kriminaltechniker, Dolmetscher oder im diplomatischen Dienst tätig. Die zwölf Polizeibeobachter aus der NVA und dem Verteidigungsministerium arbeiteten u.a. in dessen Verwaltung für Internatio­ nale Verbindungen, in militärischen Bildungseinrichtungen und nicht zuletzt in der Ausbildung ausländischer Militärs. Sie waren daher bislang ebenfalls nicht mit polizeilichen Aufgaben befasst gewesen. Kurzerhand wurden sie wie alle anderen DDR-Polizeibeobachter zu Offizieren der Volkspolizei ernannt, um den Vereinten Nationen zu signalisieren, dass hier tatsächlich Deutsche Einheit im ­afrikanischen Busch­ In Namibia erwarteten gänzlich andere Fragen die Polizeibeobachter der DDR, aber auch das seit September 1989 in Namibia weilende bundesdeutsche UNTAG-Kontingent (gebildet aus 50 Beamten des Bundesgrenzschutzes, BGS). Zunächst hatten sie eine Fahrprüfung der UN zu bestehen, denn der im Land geltende Linksverkehr hatte auf den oft gefährlichen Schotterpisten, durch umherlaufende Tiere im namibischen Busch oder wegen des verminten Geländes an der Grenze zu Angola bis Ende September 1989 bereits 13 Tote aus den Reihen der UNTAG gefordert. Extreme klimatische Bedingungen mit bis zu 40 Grad Celsius, instabile Strom- und Wasserversorgung, provisorische Unterkunft in Schulen, in Wohnwagen und bei Farmern oder teils fehlende sanitäre Anlagen beeinträchtigten Leben und Arbeiten der Polizei­beobachter. Täglich hatten sie südafrikanische Einheiten zu begleiten, Munition unschädlich zu machen, Wahlveranstaltungen zu beobachten, Einschüchterungen Südafrikas gegen die Bevölkerung zu melden und Patrouillenfahrten durchzuführen. Wichtig war der Kontakt zu den Bürgern, um der UNTAG und dem Weg Namibias in die Unabhängigkeit besonders bei den südafrikanisch- und deutschstämmigen Interessengruppen Akzeptanz zu verschaffen, etwa durch Besuche bei Parteien, Kirchen oder Geschäfts­leuten, aber auch in Gesprächen mit Häuptlingen verschiedener Stammesgruppen. Diese Arbeit konnte schnell gefährlich werden, weil die politischen Spannungen im Land immer wieder hervortraten. Extremisten griffen im August 1989 ein UNTAG-Büro mit Handgranaten an. Anhänger verfeindeter Parteien lieferten sich im September 1989 in Windhuk eine teils bewaffnete Straßenschlacht. Zwischen Mai und November 1989 wurden rund 200 Fälle registriert, die auf politische Auseinandersetzungen zurückzuführen waren und bei denen vereinzelt auch Todesopfer zu beklagen waren. Problematisch war für die Polizeigruppen beider deutscher Staaten aufgrund der mangelhaften Infrastruktur der Austausch von Einsatzbefehlen. Stationiert war die DDR-Einheit an sechs Stützpunkten im Norden Namibias, darunter in drei Orten, die im Grenzgebiet zu Angola lagen, wo stets bewaffnete Kämpfe zwischen SWAPO und südafrikanischer Miliz befürchtet werden mussten. Der BGS befand sich auf acht Stützpunkten ebenso im Norden des Landes. Zu zwei dieser entlegenen BGS-Standorte gab es von der Hauptstadt Windhuk aus keine Funkverbindung. Nachrichten wurden aufwendig durch den Transport mit dem Auto, in Wochenberichten oder wenn möglich über Informationsketten ausgetauscht. Die weiten Entfernungen zwischen den Einsatzorten in Namibia, das mehr als doppelt so groß wie Deutschland ist, erschwerten zudem die Betreuung beider Kontingente durch ihre jeweiligen diplomatischen Beobachtermissionen im Land. Während der Wahlen in Namibia war in Berlin am 9. November 1989 auch die Mauer gefallen. Nachrichten dar­ über erreichten die Kontingente in der Wildnis nur zögerlich, da nicht überall die Chance bestand, per Weltempfänger den südafrikanischen Rundfunk oder die Deutsche Welle zu empfangen oder per Telefon und Fernschreiber Informationen aus der Heimat zu erhalten. Ihre eigene, vorgezogene deutsche Einheit konnten Angehörige der ostund westdeutschen UNTAG-Einheiten bereits einige Wochen vorher begehen. Zusammen leisteten sie ihren UNDienst im Norden Namibias am Stützpunkt Ombalantu. Unter dem Kommando der Vereinten Nationen griff die in der DDR für Volkspolizisten geltende Geheimhaltungsordnung, die den Kontakt zu Bürgern nichtsozialistischer Länder verbot, nicht mehr – es entwickelte sich ein kameradschaftliches Verhältnis zwischen den Vertretern aus DDR und Bundesrepublik und zu den dort tätigen Kollegen aus Kanada, Irland, Indien, Pakistan und Schweden. Begegnungen zwischen Ost und West gab es aber auch an anderen Einsatzorten, so in Ondangwa und Oshakati im Zuge der vorzubereitenden SZ Photo/pa/dpa/ap eine Polizeieinheit zur Verfügung stand. Am 11. Oktober 1989 flog die polizeiliche Beobachtereinheit der DDR nach Namibia. Sieben Tage nach ihrer Abreise wurde Erich Honecker entmachtet. 5Verabschiedung Namibias in die Unabhängigkeit am 31. März 1990: Der Sieger der Wahlen und erste Präsident Sam Nujoma mit Südafrikas Präsident Frederik de Klerk. Wahlen. Als sich Namibia im März 1990 seiner Unabhängigkeit näherte und das zwölfmonatige Mandat der UNTAG auslief, war auch die erste und einzige Zusammenarbeit von Bundesrepublik und DDR in einer UN-Mission beendet. Während der BGS am 6. April 1990 seine Heimreise antrat, hatten die Polizeibeobachter der DDR ihre CivPol-Unterstützung bereits am 4. März beendet. Die Verhältnisse in ihrer Heimat hatten sich derart rasch geän­dert, dass freie Wahlen nun am 18. März 1990 erstmals auch in der DDR durchgeführt wurden. Am 21. März 1990 schließlich fand die ­UNTAG-Mission der Vereinten Nationen mit der Unabhängigkeit Namibias ihren erfolgreichen Abschluss. Daniel Lange Literaturtipp Daniel Lange, Auf deutsch-deutscher UN-Patrouille: Die polizeiliche Beobachtereinheit der DDR in Namibia (1989/90), Schkeuditz 2011. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 17 pa/dpa Blaupause für den Iran? Das irakische Atomprogramm 5Ruine des 1981 durch die Israelische Luftwaffe zerstörten Osirak-Reaktors 30 km vor Bagdad. Aufnahme von 2002. Blaupause für den Iran? Israels Luftschläge gegen die Atomprogramme Iraks und Syriens D ie traumatische Erfahrung der Shoa und das extrem feindliche Umfeld, in dem der jüdische Staat sein Überleben sichern muss, sind bestimmende Faktoren der israelischen Sicherheitspolitik. Aufgrund dieser historischen Erfahrungen und geopolitischen Bedingungen ist das Selbstverständnis Israels von der Vorstellung geprägt, eine isolierte »Insel in einem Meer arabischer Staaten« zu sein und »mit wenigen gegen viele« zu stehen. Aus dieser Bedrohungsperzeption erwuchs das Bedürfnis nach Nuklearwaffen, über die der israelische Staat wahrscheinlich seit Ende der 1960er Jahre verfügt. In einem Worst-case­Szenario sollen sie als ultimative Abschreckung gegen arabische Invasionsversuche dienen. Premierminister ­Menachem Begin (1913–1992) prägte 18 Ende der 1970er Jahre die nach ihm benannte Doktrin, wonach Israel keinem feindlichen Staat der Region gestatten darf, selbst Nuklearwaffen zu entwickeln und damit Israels Abschreckungsfähigkeiten zu neutralisieren. Die israelische Sicherheitspolitik richtet sich bis heute an dieser strategischen Maxime aus. Diese bestimmt auch die Bedrohungswahrnehmung des iranischen Atomprogramms – einer derzeit existenziellen Sicherheitsgefährdung für den jüdischen Staat. Seit Jahren erwartet die Weltöffentlichkeit einen israelischen Militärschlag gegen die Einrichtungen im Iran. I­sraels Luftwaffe (Israeli Air Force, IAF) hat mit ihren Operationen gegen das irakische und syrische Atomprogramm (1981 und 2007) bereits eindrucksvoll bewiesen, dass sie dazu fähig ist. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 Ab Mitte der 1970er Jahre arbeitete der Irak mithilfe Frankreichs in al-Tuwaitha südlich von Bagdad am Bau eines Leichtwasserreaktors. Der sogenannte Osirak-Reaktor hätte den Irak in die Lage versetzt, waffenfähiges Plutonium zu produzieren. Nach Einschätzungen westlicher Geheimdienste war Bagdad Anfang der 1980er Jahre nur wenige Jahre vom Bau einer Atombombe entfernt. Saddam Hussein, der ab 1979 als ­D iktator im Irak uneingeschränkt herrschte, war ein großer Förderer des Atomprogramms. Sein Weltbild war geprägt von einem abstrusen Antisemitismus und Israel-Hass. In Reden machte Hussein unmissverständlich klar, dass er den Besitz von Nuklearwaffen anstrebe, um einen Krieg gegen Israel anzuzetteln. Er glaubte, dass eine irakische Bombe Israels nukleare und konventionelle militärische Überlegenheit neutralisieren werde. Der Besitz von Nuklearwaffen würde einen Schirm der Abschreckung über der arabischen Welt aufspannen und ein atomares Kräftegleichgewicht zwischen Israel und dem Irak etablieren. Unter dem Schutz dieses nuklearen Gleichgewichts könnten die arabischen Staaten – unter Führung Husseins – ­einen konventionellen Abnutzungskrieg gegen Israel führen und Jerusalem langsam in die Knie zwingen, so die Vorstellung des Despoten. Israels Regierung unter Menachem Begin bewertete das irakische Atomprogramm entsprechend als existenzielle Bedrohung und setzte den Auslandsgeheimdienst Mossad darauf an. Zur Informationsgewinnung rekrutierte der Dienst französische Techniker, die an dem Projekt arbeiteten. Außer­dem übte der Mossad Druck auf involvierte Wissenschaftler aus, um sie dazu zu bewegen, ihre Zusammenarbeit mit dem Irak einzustellen. Doch Ende der 1970er Jahre wurde klar, dass diese Bemühungen nicht ausreichen würden. Daher setzte der Mossad verstärkt auf Sabotageaktionen: Anfang April 1979 zerstörten als Ökoterroristen getarnte israelische Agenten im Hafen von Toulon zwei für den Irak bestimmte Reaktorkerne, was das gesamte Atomprogramm um mindestens sechs Monate zurückwarf. Operation Opera (1981) Operation Opera: Flugroute der israelischen Kampfjets ullstein bild/Sven Simon von Israel besetztes Gebiet TÜRKEI IRAN ZYPERN SYRIEN BA NO N M I T T E L MEER LI Osirak ISRAEL JORDANIEN Etzion SAUDI ARABIEN Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Osirak_de.png Kaffeepause. Sie hatten bislang nichts Auffälliges festgestellt. Für 30 Minuten blieben die Radarschirme unbeaufsichtigt. Kurz vor Erreichen des Reaktors stiegen die F-16 auf 2130 m und stießen anschließend mit über 1000 km/h auf den Reaktor hinab. Auf einer Höhe von ca. 1000 m warfen sie ihre 900 kg schweren Mark-84-Freifallbomben ab. Da es sich hierbei nicht um Lenkwaffen handelte, mussten die Piloten die Bombe im Sturzflug ausklinken, um sie sicher ins Ziel zu bringen. Die ers­ ten Bomben brachen die Hülle des Reak­tors, die folgenden zerstörten das Innere. In zwei Minuten war die Operation vollzogen. Bevor die irakische Luftabwehr reagieren konnte, stiegen die F-16 auf eine Höhe von 12 000 m und jagten wieder nach Hause. Gegen Sonnenuntergang landeten alle Piloten wohlbehalten in Israel. Mission erfüllt? 5Menachem Begin, Ministerpräsident Israels von 1977 bis 1983. BAGDAD IRAK ÄGYPTEN In Jerusalem begann derweil die Planung für einen Luftangriff gegen Iraks Atomanlage. Die IAF bereitete sich unter strengster Geheimhaltung auf die anspruchsvolle Mission vor. Währenddessen sammelten die israelischen Geheimdienste alle notwendigen Informationen für einen Luftangriff auf den irakischen Reaktor. Dem Mossad gelang es sogar, irakische Techniker zu gewinnen, die in Frankreich ausgebildet worden waren. Aufgrund von schlechtem Wetter musste der Angriff dreimal verschoben werden. Doch die Zeit lief davon und die Operation sollte unter allen Umständen noch vor Inbetriebnahme des Reaktors anlaufen, um nuklearen Fallout zu vermeiden. Am 7. Juni 1981 war es schließlich soweit: Um 15:55 Uhr starteten acht Mehrzweckkampfjets F-16 und sechs Luftüberlegenheitsjäger F-15 vom Luftwaffenstützpunkt ­Etzion und machten sich zu einem rund 1000 km langen Flug nach Bagdad auf. In 60 m Höhe jagten die Kampfjets in enger Formation über Saudi-Arabien hinweg. Irgendwo in der saudischen Wüste klinkten sie ihre zusätzlichen Treibstofftanks aus. Über einen blinden Fleck in der irakischen Luft­ überwachung drangen sie in den irakischen Luftraum ein und sanken auf 30 m ab. Im Situation Room in Tel Aviv herrschte angespanntes Schweigen unter den nur ein Dutzend eingeweihten Militär- und Geheimdienstleuten. Gegen 17.30 Uhr erreichten die israelischen Kampfjets ihr Ziel. Die irakischen Besatzungen der Luftabwehr gingen gerade in ihre frühabendliche Der irakische Atomreaktor war komplett zerstört worden. Israel übermittelte dem Irak und der gesamten Region mit dem Luftschlag eine wichtige Bot- © ZMSBw 07332-04 schaft: Jerusalem wird keine weitere Atommacht im Nahen Osten dulden! Die Militäroperation führte jedoch keineswegs dazu, dass Saddam Hussein sein Streben nach Nuklearwaffen aufgab, im Gegenteil: In den 1980er Jahren stieg das Budget des Atomprogrammes von 400 Mio. US-Dollar auf 10 Mrd. US-Dollar. Dennoch reduzierte der Luftschlag die nuklearen Fähigkeiten des Irak erheblich, und zwar aus folgenden Gründen: Die Zerstörung des Reaktors richtete die internationale Aufmerksamkeit stärker auf das Atomprogramm des Irak, was es Bagdad fast unmöglich machte, auswärtige Unterstützung zu erlangen. Der Schaden am Reaktor war so massiv, dass ein Wiederaufbau nicht in Frage kam. Ohne auswärtige Unterstützung war das Land also gezwungen, das Atomprogramm von der Plutoniumgewinnung zur Urananreicherung umzustellen. Die irakische Forschung musste daher noch einmal bei Null anfangen. Um dabei der internationalen Beobachtung zu entgehen, verlegte der Irak das Atomprogramm in den Untergrund. Dazu mussten eine Reihe von zer- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 19 pa/dpa Blaupause für den Iran? 5F-15 »Eagle« des US-Flugzeugbauers McDonnell Douglas, seit 1977 in unterschiedlichen Ausführungen in der Israelischen Luftwaffe in Verwendung. F-15 kamen im Irak 1981 wie auch in Syrien 2007 zum Einsatz. streuten und versteckten Einrichtungen errichtet werden, was nicht nur erhebliche finanzielle Mittel band, sondern auch die Koordination der Wissenschaftler erschwerte. Die Absicht des irakischen Regimes, über eigene Atomwaffen zu verfügen, hatte sich demnach auch durch die begrenzte Militäraktion kaum beeinflussen lassen. Jedoch führte der israelische Luftschlag zu einer massiven Verzö­ gerung des irakischen Nuklearprogramms. Wäre die irakische Einrichtung nicht zerstört worden, hätte der Irak bis Anfang der 1990er Jahre sehr wahrscheinlich über Nuklearwaffen verfügt. Ob die USA in dieser Situation gegen die irakische Invasion Kuwaits 1990 interveniert hätten, ist fraglich. Den USA war dies durchaus bewusst. So schenkte Dick Cheney, US-Vertei­ digungsminister von 1989 bis 1993, ­Israels Luftwaffenkommandant Generalmajor David Ivry ein Satellitenfoto der überwucherten Osirak-Ruine aus dem Jahr 1991 mit der Bildunterschrift: »For Gen. David Ivry, with thanks and appreciation for the outstanding job he did on the Iraqi nuclear program in 1981 – which made our job much easier in Desert Storm«. Desert Storm war die Bezeichnung für die alliierte Offensive gegen den Irak unter Führung der Vereinigten Staaten ab 16. Januar 1991. Die Entdeckung des syrischen Atomprogramms Gegen Ende 2006 entdeckte Israels Geheim­dienst in einer abgelegenen ­Gegend im Nordosten Syriens den Bau eines verdächtigen Gebäudes nahe des 20 Euphrat, 30 km von dem Ort Deir azZur entfernt. Ein großes Dach blockierte die Sicht auf den Komplex aus der Luft. Hier wurde offensichtlich etwas errichtet, das versteckt werden musste. Israels Geheimdienst vermutete, dass es sich um ein geheimes Atomprogramm handeln könnte. Dieser Verdacht erhärtete sich bald. Im Februar 2007 lief der iranische General Ali Reza Askari zu den USA über. Askari war Sicherheitsberater unter Irans Ex-Präsident Mohammad Chatami und langjähriger stellvertretender Verteidigungsminister. Nach der Wahl Mahmud Ahmadinedschads zum iranischen Präsidenten 2005 war Askari in Ungnade gefallen und entschied sich zur Flucht. Er lieferte den USA wertvolle geheimdienstliche Informationen. Unter anderem berichtete er von einem syrischen Nuklearwaffenprogramm, finanziert vom Iran und durchgeführt von Nordkorea. Konkret arbeiteten die Nordkoreaner in der Einrichtung ­namens al-Kibar an einem Gas-Graphit-Reaktor zur Produktion von waffenfähigem Plutonium. Die USA teilten diese Erkenntnis umgehend mit Israel. Wie sich herausstellen sollte, hatte der spätere syrische Präsident Bashar al-Assad bereits beim Begräbnis seines Vaters und Amtsvorgängers im Juni 2000 Kontakt mit den Nordkoreanern aufgenommen, um über den Bau eines Reaktors zu verhandeln. Die Beziehungen zu Pjöngjang waren traditionell eng – das Regime hatte den Syrern in der Vergangenheit schon bei der Entwicklung von Chemiewaffen gehol­ fen. 2002 erreichten Syrien die ersten Bauteile, Techniker und Wissenschaft- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 ler aus Nordkorea. Die Bauarbeiten blieben weitgehend unbeobachtet, da Funk- und Telefonverkehr auf der Baustelle strikt untersagt waren. Um diese bedenklichen Berichte zu bestätigen, durchsuchte der Mossad im März 2007 das Wiener Hotelzimmer von Ibrahim Othman, dem Direktor der Syrischen Atomenergie-Kommission. Othman hatte seinen Laptop im Zimmer zurückgelassen, sodass die Agenten problemlos den gesamten Inhalt der Festplatte kopieren konnten. Unter den Daten waren Dutzende Farbfotos, die das Innere des verdächtigen Gebäudes zeigten. Den Analys­ten war schnell klar, dass es sich tatsäch­ lich um den Bau eines Nuklearreaktors handelte. Die Fotos zeigten Nordkorea­ ner bei der Arbeit – darunter auch Chon Chibu, einen der führenden Experten des nordkoreanischen Atomprogramms. Der einzige Zweck dieses Plutoniumreaktors war die Herstellung von Nuklearwaffen, so die Überzeugung des Mossad. Den Fotos war auch zu entnehmen, dass der Reaktor nur noch wenige Monate von der Betriebsbereitschaft entfernt war. War der Reak­ tor erst einmal aktiv, würde ein Luftschlag zu nuklearem Fallout führen – ein nicht hinnehmbares Risiko für die Zivilbevölkerung. Es galt also schnell zu handeln. Operation Obstgarten (2007) Nachdem sich die israelische Regierung sicher war, dass Syrien kurz vor Inbetriebnahme eines Kernreaktors stand, wurde mit Washington das weite­re Vorgehen besprochen. US-Präsident George W. Bush agierte sehr vorsichtig: Im Hinterkopf der US-Administration nagte die Erin­nerung an das PR-Desaster im Zu­sammenhang mit den vermeintlichen Massenvernichtungswaffen im Irak. Die CIA stimmte der Interpretation der Kollegen in Jerusalem zwar zu, doch es gab Skeptiker in den Reihen der Bush-Administration – allen voran US-Außen­ ministerin Condoleezza Rice. Sie ­befürchtete eine unkontrollierbare regionale Eskalation. Die US-Regierung hatte mit den Konflikten in Irak und Afghanistan ohnehin genug um die Ohren. An die Eröffnung einer dritten Front im Nahen Osten hatte das Weiße Haus daher wenig Interesse. pa/dpa Israels Premierminister Ehud Olmert machte unmissverständlich klar, dass er auch unilateral gegen das syrische Projekt vorgehen werde, sollten sich die USA nicht zu einer Operation durchringen können. Als Bush zu verstehen gab, dass er einen israelischen Alleingang nicht zu blockieren gedenke, begannen die israelischen Streitkräfte die Vorbereitungen für einen begrenzten Luftschlag auf den syrischen Reaktor. Im Juni drang ein Spezialkommando von »Sayeret Matkal« (hebräisch für »Späher des Generalstabes«), eine im Schwerpunkt für Terrorismusbekämpfung und nachrichtendienstliche Aufklärung zuständige Sonderheit des israelischen Heeresnachrichtendienstes Aman, in Syrien ein und sammelte die letzten Informationen für den Luftschlag. Am 5. September 2007 fiel in Israels Sicherheitskabinett schließlich die Entscheidung für einen Luftschlag, die Operation Orchard (Obstgarten). Noch in derselben Nacht stiegen zehn F-15 und F-16 vom israelischen Luftwaffenstützpunkt Ramat David in den Himmel auf. Zunächst flog die Gruppe entlang der Mittelmeerküste nach Norden, schwenkte dann nach Osten und flog entlang der syrisch-türkischen Grenze. Mit elektronischen Kampfmitteln blendeten sie die syrische Flugabwehr, zerstörten eine Radarstation und drangen dann in den syrischen Luftraum ein. Gegen 0.45 Uhr meldeten die Piloten den erfolgreichen Vollzug der Operation. Die syrische Anlage war vollständig zerstört worden. Die israelischen Maschinen kehrten ohne Verluste wieder zu ihrem Stützpunkt zurück. Die syrische Flugabwehr hatte nicht eine einzige Rakete gestartet. Eine Kernüberlegung der Opera­ tionsplanung war es, die Reaktion von Damaskus so gering wie möglich zu halten. Israels Geheimdienst wusste um die syrischen Raketen, die auf sensible Ziele in Israel gerichtet waren. Daher hüllte sich Jerusalem nach der Operation in Schweigen. Aus Syrien kamen widersprüchliche Nachrichten. Doch das israelische Kalkül ging auf: Assad konnte sein Gesicht wahren, ­indem er die gesamte Existenz eines Atomprogrammes leugnete und damit auf einen Gegenschlag verzichtete. Währenddessen rätselte die Welt monate­lang, was in der September- 5Ehud Olmert, Ministerpräsident Israels von 2006 bis 2009. nacht in Syrien tatsächlich geschehen war. Um die Operation zu komplettieren, tötete die Kampfschwimmereinheit »Shayetet 13« (»Flottille 13«) der israelischen Marine am 1. August 2008 mit General Mohammed Suleiman den Spiritus Rector des syrischen Nuklearwaffenprogramms. Nichtsahnend befand sich der langjährige Vertraute der Assad-Familie beim Abendessen mit Freunden in seiner Villa am Meer, als er von gezielten Schüssen israelischer Scharfschützen tödlich getroffen wurde. Aus israelischer Perspektive war die Operation ein voller Erfolg. Die BeginDoktrin war eindrucksvoll bestätigt worden und Syrien hat bislang keine erneuten nuklearen Ambitionen erkennen lassen. Schlussbetrachtungen Mit Blick auf den Iran verfolgt Israel nach wie vor die Begin-Doktrin, da die Gefahr besteht, dass iranische Nuklear­ waffen in die Hände von Terroristen fallen. Zudem herrscht in Teheran ein theokratisches Regime, dem mit dem Instrument der »Abschreckbarkeit« schwerlich beizukommen ist. Aus regio­ naler Perspektive ist es überdies wahrscheinlich, dass eine iranische Bombe ein Wettrüs­ten auslösen und den Nahen Osten massiv destabilisieren würde. Es gibt daher gute Gründe, die für die Zerstörung des iranischen Atom- programms sprechen. Dennoch: Eine Militäroperation gegen die iranischen Einrichtungen ist deutlich anspruchsvoller als die Bedingungen im Irak und in Syrien. Während in Syrien und im Irak nur jeweils eine Einrichtung zu zerstören war, handelt es sich im Iran um mehrere, über das Land verstreute Anlagen. Die Gebäude werden beschützt und liegen zum Teil unterirdisch. Darüber hinaus ist die Distanz größer, sodass Luftbetankungen erforderlich sind. Auch die Tatsache, dass die iranischen Anlagen schon in Betrieb sind und damit eine große Gefahr von Kollateralschäden besteht, erschwert ein militärisches Vorgehen. Schließlich wäre bei einer Militäroperation auch mit Gegenschlägen des Iran und seines Stellvertreters in der Levante – der Hisbollah – zu rechnen. Da die ganze Welt auf das iranische Atomprogramm schaut, wären im Falle eines erfolgreichen Angriffes Schweigen und Leugnen für beide Seiten keine Option. Hinzu kommt, dass ein erfolgreicher Militärschlag das Atomprogramm zeitlich verzögern würde, doch die Absicht des iranischen Regimes dadurch nicht oder nur unzureichend beeinflusst werden könnte. Eine tiefgreifende Änderung der Absichten ist letztlich nur durch einen Regimewechsel zu erwarten. Ungeachtet all dieser Schwierigkeiten ist ein Militärschlag gegen das iranische Programm durchaus möglich – auch in Form eines israelischen Alleingangs. Dadurch würde der Iran möglicherweise um Monate zurückgeworfen. Dies wird Israels Sicherheitsproblem zwar nicht lösen, aber für den Moment entschärfen. Ein Blick in die Geschichte des jüdischen Staates zeigt, dass man Sicherheitsbedrohungen in Jerusalem aufgrund der historischen Erfahrungen sehr ernst nimmt und entschlossen gegenübertritt. Marcel Serr Literaturtipps Amos Perlmutter u.a., Two Minutes over Bagdad, 2., erw. Aufl., London, Portland 2003. Hal Brands and David Palkki, Saddam, Israel, and the Bomb. In: International Security, 26 (2011), 1, S. 133–166. David Makovsky, The Silent Strike. How Israel Bombed a ­Syrian Nuclear Installation and Kept It Secret. In: The New Yorker, 17. September 2012, S. 34–40. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 21 Service Das historische Stichwort Der »Sitzkrieg« 1939/40 22 Scherl/SZ Photo I nfolge des deutschen Überfalls auf Polen am 1. September 1939 trat die britisch-französische Garantieerklärung vom April 1939 formell in Kraft. Beide Staaten erklärten daraufhin am 3. September dem Deutschen Reich den Krieg. Hitler sollte aber mit seiner Annahme Recht behalten, dass kein Angriff auf das deutsche militärische Verteidigungssystem im Westen des Deutschen Reiches, den Westwall, erfolgen werde. Trotz großer Überlegenheit (rund 30 schwache Divisionen auf deutscher, knapp 100 Divisionen mit über 2500 Panzern auf französischer Seite) und obwohl die dort stationierten deutschen Truppen nur über einen Munitionsvorrat für drei Kampftage verfügten, entschieden sich die Westmächte für eine Strategie des Abwartens und Zermürbens. Frankreichs Oberkommandierender, General Maurice Gamelin, beabsichtigte eine Offensive erst für das Jahr 1941. Der deutschen strategischen Führung wurde so der nötige Spielraum verschafft, mit der geballten Kraft fast aller Divisionen Polen so rasch zu besiegen, dass danach die Westgrenze durch Einheiten gesichert werden konnte, die in Eiltransporten aus Polen herangeschafft worden waren. Für die Deutschen entwickelt sich hier nun der »Sitzkrieg«, den die Briten »The Phoney War« (Scheinkrieg)« und die Franzosen »drôle de guerre« (Seltsamer Krieg) nannten. Maßgeblich für das Verhalten der deutschen Truppen war der Befehl Hitlers vom 31. August 1939: »Im Westen kommt es darauf an, die Verantwortung für die Eröffnung von Feindseligkeiten eindeutig England und Frankreich zu überlassen. Geringfügigen Grenzverletzungen ist zunächst rein örtlich entgegenzutreten. Die deutsche Westgrenze ist an keiner Stelle ohne meine ausdrückliche Genehmigung zu überschreiten.« Auf französischer Seite beschränkte sich die Polen im »Gamelin-Kasprzycki-Abkommen« (Mai 1939) verspro- 5Ein deutscher Soldat ruft mit einem Megaphon Propagandaparolen zu den französischen Stellungen am Oberrhein hinüber mit dem Ziel, die gegnerische Kampfmoral zu schwächen, 1940. chene Entlastungsoffensive auf einen Erkundungsvorstoß kleinerer Einheiten im Höhenzug des Warndt bei Saarbrücken, die sogenannte SaarOffen­sive (»Opération Sarre« oder auch »Offensive de la Sarre«). Französische Truppen überschritten am 9. September die deutsche Grenze und standen am 12. September acht Kilometer tief auf deutschem Gebiet, wobei sie zwölf deutsche Ortschaften entlang der geräumten Grenzzone im Saargebiet vor dem Westwall besetzten. Die Berichte des Oberkommandos der Wehrmacht (OKW) verzeichneten neben Artilleriebeschuss u.a. des geräumten Flughafens von Saarbrücken für ­diese Tage lediglich »örtliche Vorpos­ tenkämpfe«. Ziel dieser begrenzten Offensive war die Feststellung der Stärke der Verteidigungsanlagen des Westwalls. Der OKW-Bericht vom 27. September dokumentierte schließlich nur noch »geringe Gefechtstätigkeit. Der Feind schanzt auf der ganzen Front«. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 Am 30. September wurde dann der Rückzug der französischen Truppen auf französisches Gebiet angeordnet. Einige französische Generäle ­ waren damit nicht einverstanden und sahen eine Gelegenheit ungenutzt verstreichen; nicht zu Unrecht, denn der Westwall, von der deutschen Propaganda als unüberwindliches Hindernis verklärt, war in Wirklichkeit erst halbfertig, nur dünn gestaffelt und hätte somit für die alliierten Armeen kaum ein entscheidendes Hindernis dargestellt. Oberst Charles de Gaulle war einer der heftigsten Kritiker des französischen Oberkommandos. Er bezeichnete dessen Strategie als »Maginot-Linienmentalität«, die darin bestehe, darauf zu warten, dass die anderen etwas tun. Die letzten Nachhuteinheiten, die in den eroberten Stellungen noch verblieben waren, wurden bis zum 21. Oktober nach Frankreich zurückgeworfen. Bis auf einen erfolglosen Angriff der Royal Air Force auf den Flottenstütz- Flugblättern versuchten Alliierte und Deutsche die Kampfmoral des Gegners zu schwächen. Hauptthema der deutschen Propaganda war der latente französisch-britische Gegensatz. Die Darstellung britischer Soldaten, die sich mit französischen Frauen amüsieren, sollte das Misstrauen der Franzosen gegenüber Großbritannien wecken, das Frankreich quasi als Handlanger instrumentalisiere und sich nur mit geringen eigenen Kräften am Aufmarsch beteilige. In der Tat waren zu Beginn des Oktobers 1939 erst vier Divisionen des Britischen Expeditionskorps in Frankreich eingetroffen, die bis Mai 1940 auf 15 verstärkt wurden. Die ­Royal Air Force entsandte mit 456 Flugzeugen jedoch rund ein Drittel ihres Gesamtbestands. Das französische Oberkommando jedenfalls war entschlossen, den Angriff der Deutschen abzuwarten. Überzeugt, hinter der Maginot-Linie, einem ausgedehnten System von Bunkern und Geschütztürmen entlang der deutschen Grenze, vor Angriffen geschützt zu sein, verlegte es sich auf eine Verteidigungsstrategie und vernachlässigte die Vorbereitung der Offensivkräfte. Zweifel am Mythos der Unbezwingbarkeit der Maginot-Linie waren tabu. Man glaubte vielmehr, dass der Gegner sich an Festungen und Bunkern ausbluten würde, was sich jedoch als folgenschwerer Irrtum erwies. Mit dem deutschen Angriff auf Frankreich, Belgien, Luxemburg und Scherl/SZ Photo punkt Wilhelmshaven sowie auf Cuxhaven am 4. September unterblieben während des Polenfeldzugs auch nennenswerte alliierte Luftangriffe, denn Frankreich befürchtete deutsche Vergeltungsschläge auf seine Industriezentren. Nach diesen ersten Wochen einer gewissen Unruhe und gegenseitigen Erwartung eines gegnerischen Großangriffs normalisierte sich die Lage an der Westfront allmählich. Die Wachbesatzungen wechselten in regelmäßigen Abständen: Die ablösenden Soldaten machten es sich mit Kartenspielen und Büchern in den Festungswerken der Maginot-Linie so angenehm wie möglich, die abgelösten Truppenteile verlegten in die dörflichen Quartiere oder in die nächstgelegenen Kasernen. Der Krieg hielt nun quasi seinen Winterschlaf. Die von Hitler noch vor dem Einbruch des Winters geplante Offensive im Westen musste von Mitte November an aufgrund der winterlichen Großwetterlage, die eine deutsche Luftüberlegenheit erschwerte, insgesamt 29 mal verschoben werden. Heftige Regenfälle und Winde verboten den Einsatz der Luftwaffe, die der entscheidende Faktor für die neue Taktik der Wehrmacht im Zusammenspiel von Panzerverbänden und Flugzeugen war. Schon bald nahm dieser »Sitzkrieg« auch die Form eines wechselseitigen Propagandafeldzugs an. Mittels Lautsprecherdurchsagen, Plakaten sowie 5Wehrmachtsoldat auf Patrouillie zwischen Panzerhindernissen des Westwalls an der deutsch-französischen Grenze, 1940. die Niederlande am 10. Mai 1940 auf einer Front zwischen Luxemburg und Nijmegen und somit unter Umgehung der Maginot-Linie endete der »Sitzkrieg«. Bis dahin hatte die Wehrmacht auf dem westlichen Kriegsschauplatz fast 10 000 Mann, davon rund 6000 Tote und Vermisste, verloren. Doch warum verhielten sich Großbritannien und Frankreich dermaßen defensiv? Wäre nicht ein entschlossenes militärisches Vorgehen sinnvoll und eventuell auch erfolgreich gewesen? In diesem Zusammenhang muss die gesamte Appeasementpolitik beider Staaten kritisch betrachtet werden. Ein Eingreifen 1936 im Zuge der deutschen Besetzung des entmilitarisierten Rheinlands oder spätestens im März 1939 bei der Besetzung der Tschechoslowakei hätte Hitlers Expansionspolitik möglicherweise verhindern können. Die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs haben beim Verhalten v.a. Frankreichs eine nicht zu unterschätzende Rolle gespielt. Sie hatten die Überzeugung entstehen lassen, dass ein künftiger Krieg mit Deutschland wieder ein Stellungskrieg sein werde, da eine deutsche Offensive in Frankreich sich festfahren würde. Dafür spricht, dass sich die Franzosen hinter der als vermeintlich unüberwindbares Bollwerk konzipierten Maginot-Linie einigelten, was der »kriegsunlustigen« Stimmung in Frankreich entsprach. Hinzu kommt, dass Deutschlands Verbündete Italien und Japan sich 1939 als nichtkriegführend bzw. neutral erklärt hatten und Großbritannien davon ausging, über ein enormes militärisches Potenzial zu verfügen, nachdem auch Australien, Indien, Neuseeland, Südafrika und Kanada in den Krieg eingetreten waren. Alfred Jodl, im Kriege Chef des Wehrmachtführungsstabes im OKW, sagte während der Nürnberger Prozesse aus: »Dass wir nicht bereits im Jahr 1939 gescheitert sind, war nur dem Umstand zu verdanken, dass während des Polen­ feldzuges die schätzungsweise 110 fran­ zösischen und britischen Divisio­nen im Westen komplett inaktiv gegen die deutschen 23 Divisionen gehalten wurden.« Beide Westmächte haben auch dadurch Polens Interessen ignoriert, ja Polen der deutschen Wehrmacht leichtfertig ausgeliefert. Martin Grosch Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 23 Service ! Neue Medien Comics & Graphic Novels Kriegstagebücher E in Lehrer, der 1949 aus politischen Gründen die DDR verlassen muss; ein berühmter französischer Regisseur; eine Hausfrau in Kärnten; ein französischer Arzt, der gerne Karikaturen zeichnet. Was haben diese vier Personen gemeinsam? Sie alle erlebten den Ersten Weltkrieg als Kinder oder Jugendliche. Ihre Erinnerungen aus den Jahren 1914 bis 1918 bilden die Grundlage für ein deutsch-französisches Vorzeigeprojekt zum 100. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkrieges. In kurzen Einzelepisoden gibt das Comic, das gleichzeitig zur deutschen Version auch in französischer Sprache erscheint, Einblicke in das ­Leben dieser vier jungen Menschen. Walter, der spätere Lehrer, meldet sich 1914 freiwillig, da ist er 17 Jahre alt. Lucien, der junge Arzt, dient als Sanitäter an der Front; Nessi und der damals erst sechsjährige René erleben den Krieg in der Heimat. Für René ist der Krieg anfangs ein großer Spaß. Er freundet sich mit Soldaten an, wirft gefundene Munition in Rauchfänge von Lokomotiven und spielt mit seinen Freunden »Krieg«. Walter hingegen wird schwer verwundet und bei seiner Rückkehr in die Schule als Held gefeiert. Doch von Kriegsverherrlichung will er nichts mehr hören. Lucien erlebt im Feldlazarett das Leid und den Schrecken, den vor allem die Artillerie den Soldaten zufügt. Er möchte unbedingt eine Auszeichnung für seine Leistungen erhalten. Nessi lebt auf dem Land und begrüßt den Krieg enthusiastisch. In ihrem Tagebuch bejubelt sie die deutschen Siege. Erst als sie ihren geliebten Bruder verliert, versteht sie, was wirklich passiert. Alexander Hogh und Jörg Mailliet, Tagebuch 14/18. Vier Geschichten aus Deutschland und Frankreich. Unter Mitw. und mit einem Vorw. von Gerd Krumeich und Nicolas Beaupré hrsg. von Julie Cazier und Martin Block, Köln: Tintentrinker 2014. ISBN 978-3-9816323-1-6; 117 S., 20,00 Euro 24 Der Comic wurde in gemeinsamer Arbeit für deutsche wie französische Jugendliche und Erwachsene entwickelt und zeigt, dass die Erfahrungen, die diese vier jungen Menschen im Ers­ ten Weltkrieg gemacht haben, jenseits nationaler Zugehörigkeit sind. Sie überschreiten die Grenzen, um die vor hundert Jahren unerbittlich gekämpft wurde. fh Kriegskrimi L eutnant Vialatte wird im Januar 1915 in die Champagne gerufen. Er ist Gendarm und soll den mysteriösen Mord an einer jungen Frau aufklären, die beim Ausheben eines Grabens in unmittelbarer Frontnähe gefunden wurde. Bald entdecken Soldaten eine zweite Leiche – diesmal direkt im Schützengraben – und wenig später wird eine dritte Frau ermordet. Die Ermittlungen führen den Leutnant in die vordersten Linien und mitten in das Maël/Kris, Mutter Krieg, Bielefeld: Splitter 2014. ISBN 978-3-86869-757-5; 256 S., 38,90 Euro Kampfgeschehen. Vialatte muss erkennen, dass der Krieg »keine Poesie, kein Epos, kein Abenteuer« ist, sondern nur eine »gewaltige Verschwendung«. Im Schmutz der Gräben, zwischen Angriff und Verteidigung ist kriminalistische Arbeit fast unmöglich. Auf der Suche nach Zeugen und Beweisen landet er immer wieder bei einer Truppe von 16 jugendlichen Strafgefangenen aus Paris, die von einem alten Bekannten des Gendarmen geführt wird. Was wissen die Soldaten? Was haben sie mit den Morden zu tun? Erst nach dem Krieg findet Vialatte die Wahrheit heraus. Sie lässt ihn bis an sein Lebensende nicht los. »Mutter Krieg« erinnert nicht nur wegen der Frauenmorde an Alan Moores monumentales Werk »From Hell« (1991–1996). Wo Moores Held Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 Frederick Abberline sich im viktorianischen London auf der Suche nach Jack the Ripper in den Gassen von Whitechapel verirrt, stößt Vialatte in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges an die Grenzen seines Glaubens und Patriotismus. Beide Comics erzählen mehr als eine Kriminalgeschichte: Sie sind Gesellschaftsstudien vom Rande der Menschlichkeit. Nicht umsonst wurde das Werk der beiden Autoren Maël und Kris zum offiziellen Comic des 100. Jahrestags des Ersten Weltkrieges (»La Mission du centenaire«) in Frankreich ausgewählt. Es wird derzeit auch verfilmt. Die vier Einzelbände, die zwischen 2009 und 2012 auf Französisch erschienen sind, wurden nun in eine deutsche Komplettausgabe zu einem mehr als 250seitigen Album gebunden. fh Remarque gezeichnet ... A ls »ein besonders betrübendes Zeichen für den Zeitgeist im heutigen Deutschland« des Jahres 1929 empfand es ein kriegsgedienter Oberst a.D., dass sich Erich Maria Remarques Roman »Im Westen nichts Neues« in nur wenigen Wochen millionenfach verkaufen konnte. Besagter Oberst kam jedoch nicht umhin, den literarischen Wert des Werkes hervorzuheben, obwohl es »eine ungeheuerliche Beleidigung des deutschen Heeres im Weltkriege [...] eine Verunglimpfung des Andenkens unserer gefallenen Kameraden« sei. Für andere, etwa für den Schriftsteller Carl Zuckmayer, war es »so geschrieben, so geschaffen, so gelebt, dass es mehr wird als Wirklichkeit: Wahrheit, reine gültige Wahrheit«. Unerhört war das Buch für viele Deut­ sche auch deswegen, weil Re­marque auf jedwede Wertung mit Blick auf UrPeter Eickmeyer und Gaby von Borstel, Im Westen nichts Neues. Eine Graphic Novel nach dem Roman von Erich Maria Remarque, Bielefeld: Splitter 2014. ISBN 978-386869-679-0; 176 S., 22,80 Euro neue sachen, Ziele und Folgen des Krieges verzichtete. Seine Darstellung verwies somit auf die Sinnlosigkeit all des Schlachtens und all der Opfer. Die Nazis erklärten den Roman 1933 schließlich zum »undeutschen Schrifttum« und setzten ihn auf die Liste der zu verbrennenden Bücher. Dieser Sinnlosigkeit des Krieges, der Resignation, der Todesangst und all der Gräuel in den Gräben der Westfront gibt Peter Eickmeyer in seinen Zeichunungen zur Graphic Novel nach dem Roman von Remarque im wahrsten Sinn des Wortes ein Gesicht. Für die Bearbeitung des Textes zeichnet Gaby von Borstel verantwortlich, die letztlich die Originalvorlage gekürzt hat. Eickmeyer greift bei seinen Graphiken auf das kollektive Bildgedächtnis zum Zeitalter der Weltkriege zurück. Dazu zählen Gemälde von Künstlern wie Pablo Picasso oder Otto Dix, Fotos aus den Jahren 1914 bis 1918 oder Dokumentarfilme. Dazu zählt aber auch die US-Verfilmung des Romans aus dem Jahr 1931, an die so manche Figur in dem Album erinnert. Diese Graphic Novel eröffnet durch ihre ausdruckstarken Bilder einen weiteren, spannenden Zugang zum Thema Erster Weltkrieg und durch die umfangreichen Textauszüge aus dem Original mehr als einen bloßen Einstieg in den – an sich schon bildgewaltigen – Roman »Im Westen nichts Neues«. Selbst wenn man das Buch schon kennt oder es gar mehrfach gelesen hat: Die gelungene Text-Bild-Komposition lässt einen von Neuem den Helden auf seinem Weg bis zum bitteren Ende begleiten. mt ... und vorgelesen E s ist die einfache, präzise und manchmal erschreckend nüchterne Sprache, die die Geschichte um das (Kriegs-)Erleben und Sterben Paul Bäumers und seiner Kameraden auszeichnet. Das »unerhörte« Geschehen, das sich jeder rationalen Erklärung entzieht, tatsächlich auch hörbar zu machen, dieser Aufgabe haben sich der Rundfunk Brandenburg-Berlin und der Hörverlag verschrieben: So konn- Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues. Gelesen von August Diehl, München: Der Hörverlag 2006, 5 CDs, 367 Min. ISBN 978-3-8445-1225-0; 19,99 Euro ten sie den Bühnen- und mittlerweile auch international bekannten Filmschauspieler August Diehl für eine unge­kürzte Lesung des Romans »Im Westen nichts Neues« gewinnen. Das Ergebnis wurde auf insgesamt fünf CDs gebannt. Die Stimme des Vorlesers passt wegen ihrer Jugendlichkeit in besonderer Weise zu der Erzählung des 19-jährigen Abiturienten Bäumer, bei dem, wie bei seinen Kameraden auch, die anfängliche Begeisterung durch die Schikanen bei der Ausbildung rasch verfliegt und bei dem bald schon die Ernüchterung des Soldaten eintritt. Zurück bleibt die blanke Realität. Die Facetten dieses kurzen, dafür aber umso intensiveren Lebens des Protagonisten bringt uns August Diehl gefühlvoll nahe, etwa wenn er uns an der Angst und der Panik Bäumers teilhaben lässt – und dabei doch stets den eingangs beschriebenen Duktus des Romans wahrt, ohne in Sentimentalitäten abzugleiten. Man lauscht gebannt dem Sprecher Diehl – und folgt dem Soldaten Bäumer durch jeden Schützengraben, in jede Schlacht. Die Tragik dieser Geschichte prägt sich durch die Intensität des Vortrags tief ins Bewusstsein des Hörers ein. mt, aau zuletzt des Öfteren in die Kritik geraten ist, unter anderem weil der Holo­ caust weitgehend ausgeblendet wird, was jedoch von anderen wiederum als Anknüpfungspunkt gesehen wird, um im Unterricht den Holocaust zu thematisieren. Das Buch gliedert sich in 32 Episoden, die die Geschichte einer Freundschaft zwischen einem jüdischen und einem nichtjüdischen Jungen zum Thema haben. Sie werden beide 1925 geboren und wohnen im selben Haus. Als Erzähler tritt der namenlose nichtjüdische Junge auf, der durch das Zusammensein mit seinem Freund Frie­d­ rich die zunehmende Diskriminierung der Juden in Deutschland erlebt: von den anfänglichen Beschimpfungen als »Judenbengel« in der Weimarer Republik bis zur Zerstörung jüdischer Geschäfte und Wohnungen und zum ­Angriff auf Leib und Leben der jüdi­ schen Nachbarfamilie im Nationalso­ zialismus. Gelesen wird der Roman von Michael Degen. Der 1932 geborene Schauspieler jüdischer Herkunft hat seine ­eigene Erfahrung als jemand, der die Zeit versteckt mit seiner Mutter bei nichtjüdischen Freunden überlebte, selbst in ein Buch gepackt (»Nicht alle waren Mörder«, 2004; verfilmt 2006). Wie die Geschichte nach und nach »aus der heilen Kinderwelt in ein unfassbares Dunkel« abgleitet, bringt Degen den Hörern – bis zum Tod Friedrichs im Bombenhagel in Berlin 1942 – vermutlich nicht zuletzt wegen seiner eigenen Überlebenserfahrung mit großer Eindringlichkeit nahe. Die Lesung erhielt eine Auszeichnung von der hr2Hörbuchbestenliste. mt Drittes Reich D as Buch »Damals war es Friedrich« ist erstmals 1961 erschienen. Es wurde in 13 Sprachen übersetzt und erlebte hierzulande bislang mehr als 60 Auflagen. Es ist eines der bekanntesten deutschen Jugendbücher zum Nationalsozialismus und wird bis heute als Schullektüre eingesetzt, auch wenn es Hans Peter Richter, Damals war es Friedrich. Hörbuch, gelesen von Michael Degen, Murnau: uccello 2007, 3 CDs, 225 Min. ISBN 978-3-937337-16-6; 19,90 Euro Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 25 Service Lesetipp Deutschland im 20. Jahrhundert Menschenfresser Krieg Bürgeraufstände D D P as 20. Jahrhundert – auch als das »kurze Jahrhundert« oder »Zeitalter der Extreme« (Eric Hobsbawm) bezeichnet – ist endgültig vorbei. Dies wird uns vor allem dann bewusst, wenn Historiker Bilanz ziehen. Als einer der ersten stellt sich der Freiburger Professor für Neuere und Neueste Geschichte Ulrich Herbert der Herausforderung, die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts zwischen zwei Buchdeckel zu »packen«. Die erste Hälfte des Jahrhunderts war von »Kriegen und Katastrophen« geprägt, die zweite Hälfte von Teilung, Wohlstand und Stabilität und am Ende von der Überwindung der Teilung. Auch wenn ­Herbert den Bogen von 1870 bis zur Agenda 2010 spannt, kann er nicht alle Ereignisse beleuchten und nach ihrer Bedeutung gewichten – so räumt er dem »Dritten Reich« und dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr Seiten ein als der Zeit zwischen 1945 und 1973. Um eine Überblicksdarstellung vorzulegen und keinen Datenspeicher, gilt es Schwerpunkte zu setzen und beschreibende Kategorien zu finden. Herbert konzentriert sich auf Politik-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte – militärgeschichtliche Themen werden randständig behandelt. Als Signum des Jahrhunderts identifiziert er den Wandel der Industriegesellschaft und die Konkurrenz zwischen liberal-demokratischem Kapitalismus, Nationalsozialismus und Kommunismus. Fazit: Den Leser erwar­ ten keine aufsehenerregenden Thesen, sondern 1400 Seiten profunde Geschichtswissenschaft, davon 182 Seiten Anmerkungen und Literatur. Ein Buch, dessen Wissensfülle zu kostbar ist, um es in den Schrank zu stellen und Allgemeinwissen vorzutäuschen – man muss es lesen, um Deutschland im 21. Jahrhundert zu verstehen. Dorothee Hochstetter Ulrich Herbert, Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, München 2014. ISBN 978-3-406-66051-1; 1451 S., 39,95 Euro 26 er VfB Leipzig hat gerade gegen Fürth das Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft verloren. Ferdinand, 17 Jahre alt und Druckerlehrling, jubelt den Spielern trotzdem zu. Aber sie tragen nicht ihre Trikots, sondern Uniform, denn im Sommer 1914 ziehen sie mit dem Infanterieregiment 134 nach Frankreich. Es ist Krieg. Ferdinands Familie ist sozialdemokratisch und unterstützt Karl Liebknecht. Doch Anni, seine große Liebe, hat nur noch Augen für Ernst, der in seiner schicken Leutnantsuniform der Ulanen durch die Stadt flaniert. Also meldet sich Ferdinand gemeinsam mit seinem besten Freund August heimlich als Freiwilliger. Elisabeth Zöller, Der Krieg ist ein Menschenfresser, München 2014. ISBN 978-3-44624510-5; 288 S., 15,90 Euro Fähnrich Max Quinte hat im Frühjahr 1918 keine Ahnung, warum er gemeinsam mit seinem Feldwebel auf eine Gruppe von Soldaten schießt. Schnell merkt er, dass es deutsche Soldaten sind, darunter auch Ferdinand. Ein Versehen oder ein von oben in Auftrag gegebener Mord, um die revolutionä­ ren Umtriebe in der Armee zu unterdrü­ cken? Die Frage lässt ihm keine Ruhe. Die fiktive Geschichte um Ferdinand und Max verbindet zwei sehr unterschiedliche junge Männer im Ersten Weltkrieg. Durch einen Schuss verschränken sich die Welten des Arbeiterjungen und des Bürgersohns. Elisabeth Zöller erzählt vom Alltag im Krieg, von Schuldgefühlen und dem Verwehen der patriotischen Stimmung des Sommers 1914. Dabei achtet sie auf historische Details und erklärt jüngeren Lesern die wichtigsten Begriffe in einem umfangreichen Glossar. Der Roman ergänzt die zahlreichen jüngst erschienenen Sachbücher zum Ersten Weltkrieg und gibt spannend und gefühlvoll den vielen unbekannten Schicksalen eine Stimme. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 fh feffer war ein Sammelbegriff für Gewürze, ein wichtiges Mittel zur Haltbarmachung von Lebensmitteln und ein Fernhandelsgut. Einkauf, Transport und Verkauf organisierten zumeist reiche Kaufleute, die »Pfeffersäcke«, die in den Städten das Bürgerrecht besaßen. Es waren die Bürger, nicht die Unterschichten, die sich gegen die mittelalterlichen weltlichen oder geistlichen Stadtherren wehrten, mehr Rechte forderten und sich Beteiligung an der Herrschaft erstritten. Zwischen 1301 und 1550 kam es in über 100 Städten des Reiches zu etwa 210 Bür­ gerunruhen. Karin Schneider-Ferber stellt zehn davon beispielhaft vor: Köln (zweimal), Leipzig, Worms, Erfurt, Augsburg, Braun­schweig, Ulm, Wismar und Münster. Dabei skizziert sie auch die Fernhandelsrouten und die komplizierten, regional unterschiedlichen Herrschaftsverhältnisse. Die damals strittigen Themen klingen z.T. ziemlich modern: ungerechte Steuerlasten, Geldverschwendung, Amtsmissbrauch, Krieg- und Fehdeführung zum Nachteil des Gemeinwesens, willkürliche Rechtsprechung, mangelnde Kontrolle der Entscheidungsgremien. Ähnlich aktuell muten die Forderungen an: erhöhte Bürgerbeteiligung in der Politik, mehr Transparenz in Steuer- und Finanzverwaltung sowie stärkere Kontrolle der Regierung. Damals entwickelten die Bürger ein großes Arsenal an Konflikt- und Schlichtungsritualen: den bewaffneten Auflauf vor dem Rathaus; die Bildung eines Ausschusses, der die Beschwerden vortrug; die Übergabe der Machtinsignien, wie etwa Siegel oder Stadtkasse. Es folgte eventuell der bewaffnete Aufstand oder aber eine neue Stadtverfassung. Alles in allem: ein gut lesbares Buch mit durchaus hohem Aktualitätsbezug. hp Karin Schneider-Ferber, Aufstand der Pfeffersäcke. Bürgerkämpfe im Mittelalter, Darmstadt 2014. ISBN 978-3-8062-0012-6; 240 S., 24,95 Euro Jüdisches Leben Unbekannte Verschwörer Antworten zum Ersten Weltkrieg M V B ehr als 300 000 jüdische Soldaten zogen im Ersten Weltkrieg für die k.u.k. Armee in den Krieg. Dies war möglich, da sie 1867 bürgerliche Rechte erhielten, was viele Juden den Kaiser unterstützen ließ, trotz des parteien­ übergreifenden Antisemitismus. Der Umstand, dass sich im Ersten Weltkrieg Juden als Feinde gegenüber standen, warf Fragen zur Loyalität gegenüber dem Vaterland und zu ihrer Identität als gemeinsames jüdisches Volk auf. Das Buch zur gleichnamigen Ausstellung im Jüdischen Museum Wien zeigt die zahlreichen Facetten jüdischen ­Lebens dieser Zeit in Österreich-Ungarn auf. Das Aufeinandertreffen von verschiedenen Interpretationen und Praktiken des jüdischen Glaubens durch­zieht die Beiträge des Bandes. Sie Marcus G. Patka (Hrsg.), Weltuntergang. Jüdisches Leben und Sterben im Ersten Weltkrieg, Jüdisches Museum Wien, Wien 2014. ISBN 9783222134340; 256 S., 24,99 Euro behandeln im Schwerpunkt jüdische Soldaten, zudem Feldrabbiner, die Rolle jüdischer Frauen sowie Antisemitismus in den deutschen Streitkräften. Ein weiterer Fokus liegt auf der Nachkriegszeit, dem Schicksal jüdi­ scher Flüchtlinge sowie dem Engagement unterschiedlichster Gruppen in der jüdischen Gemeinde. Zu erwähnen sind außerdem die Biografien im Anhang, die einen Überblick über Lebensentwürfe und politi­ sche Einstellungen von Juden in dieser Zeit liefern. Der Begleitband mit dem Titel »Weltuntergang« markiert den Ersten Weltkrieg als einen Umbruch, nach welchem sich politische und religiöse Strömungen verhärteten und der mit dem Zusammenbruch der Donaumonarchie die zunehmende Ausgrenzung der jüdi­schen Bevölkerung bewirkte. Die Auto­rinnen und Autoren unternehmen einen wichtigen Schritt, um eine weitere Forschungslücke zum jüdi­schen Leben in dieser Zeit zu schließen. Laura Haendel or 70 Jahren sollte die Herrschaft des Nationalsozialismus in Deutsch­land mit dem Attentat des 20. Juli 1944 auf Adolf Hitler ein Ende finden. Durch den langanhaltenden verlustreichen Krieg, den Beginn massiver Verfolgungsmaßnahmen gegen Juden und die brutale deutsche Besatzungspolitik wandten sich einige ehemalige Befürworter vom NS-System ab und schlossen sich dem Widerstand an. Die beiden Autoren verdeutlichen in ihrem Buch »Stauffenbergs Gefährten« mit Biografien von zehn Personen, was außerhalb des Zentrums um Claus Schenk Graf von Stauffenberg geschah. Denn meist ist der Umfang des Widerstandes den heutigen Zeitgenossen kaum bekannt. Im teilweise erstaunlichen Netzwerk – von familiären, berufsbezogenen, freundschaftlichen Verbindungen von Personen aus dem Adel, der Wehrmacht und Verwaltung – war der persönliche Anteil am Staatsstreich höchst unterschiedlich. Im Mittel­punkt des Interesses stehen die einzelnen Personen mit ihrer individuellen Geschichte, ihren Zweifeln, Irrtümern, aber auch ihrem unerschrocke­ nem Mut, viel, ja alles zu wagen und nicht nur das eigene Leben zu riskieren, sondern auch das der Angehörigen. Jede Biografie steht für sich – und doch wird dem Leser schnell deutlich, dass eine Gesamtheit dieses Buch prägt: die Gegnerschaft zum NS-Regime und der Wille, etwas tun zu wollen. Mit Interviewbeiträgen von Zeitzeugen wie Richard von Weizsäcker und Ewald-Heinrich von Kleist gelingt eine äußerst lesenswerte und fesselnde Geschichte über Persönlichkeiten, die mit ihrem Wirken zu einem prägenden histo­rischen Ereignis beigetragen haben – jede und jeder in individueller Weise und nach seinen/ihren Möglichkeiten. aau Antje Vollmer und LarsBroder Keil, Stauffenbergs Gefährten. Das Schicksal der unbekannten Verschwörer, München 2013. ISBN 978-3446241565; 256 S., 19,90 Euro estimmt ließen sich die meisten der 101 hier gestellten Fragen mit Wikipedia beantworten. Doch herrscht zumal beim Laien oftmals Unsicherheit über die Zuverlässigkeit der im www gebotenen Informatio­nen. Hier vermag das schmale Bändchen des hochangesehenen Experten Gerd Krum­ eich allemal abzuhelfen. Kurz und kompakt werden sowohl allbekannte Fragen wie die Kriegsschuldfrage oder jene nach der Zahl der Kriegsopfer abgehandelt. Aber auch vermeintliche Kuriosa der Zeit oder Mythen werden angesprochen und vom Autor schlüssig aufgeklärt, etwa bei der Beantwortung der Frage 17, ob französische Soldaten wirklich im Taxi zur Marneschlacht verbracht worden sind (ja, rund 4000, soviel sei hier verraten). Gerd Krumeich, Die 101 wichtigsten Fragen – Der Erste Weltkrieg, München 2014. ISBN 3-40665941-6; 150 S., 10,95 Euro Die Fragen sind in insgesamt sieben Komplexe zusammengefasst: Vorkriegszeit und Julikrise, Das große Schlachten, Politik im Krieg, Front und Heimat, Kultur, Technik und Wirtschaft, Kriegsende und Kriegsfolgen. Der Schwerpunkt der Fragen liegt eindeutig auf der Erlebnis- und Kulturgeschichte des Krieges. Zugleich bringt Krumeich dem Leser vernachlässigte militärische Aspekte nahe, indem er über die Reichweite von Kanonen erzählt oder die Größe eines Regiments beschreibt. Oftmals regt allein die Art der Fragestellung zur Lektüre an: »Mit welcher Nation war Gott?« Und einige der Fragen mag sich vielleicht auch so mancher Weltkriegshistoriker so noch nicht gestellt haben: »Wieso war das Feuer eine Walze?« Gerd Krumeich liefert kurzweilige Antworten für Laien, für Kollegen der Zunft jedoch eine Steilvorlage, wie Geschichte auch anders erzählt werden kann. mt Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 27 Service Die historische Quelle Militärhistorisches Museum der Bundeswehr, Dresden Roennes Kassiber aus der Haft 1944 eben den 150 bis 200 Personen, die sich aktiv an der Vorbereitung und der Durchführung des Attentates auf Hitler und des Staatsstreichversuches vom 20. Juli 1944 beteiligten, gab es eine große Anzahl von Eingeweihten, die nicht am eigentlichen Umsturz mitwirkten. Auch Oberst i.G. Alexis Freiherr von Roenne, Chef der Abteilung »Fremde Heere West« im Oberkommando des Heeres, zählte zu diesem Personenkreis. Nachdem er zu Beginn des Ostfeldzuges von Massen­ erschießungen und Hinrichtungen an Juden erfahren hatte und mit wachsender Enttäuschung die militäri­ schen Fehl­entscheidungen Hitlers sowie die Tatenlosigkeit der hohen Militärs be­ 5Alexis Freiherr von Roenne. obachtet hatte, distanzierte er sich vom Nationalsozialismus und vom Regime. Roenne war nicht nur in seinem Umfeld, sondern auch bei den Nationalsozialisten als Regimegegner bekannt. Er hatte zu den zentralen Personen des militärischen Widerstandes Kontakt und war über die Umsturzpläne informiert. Aus Gewissensgründen lehnte er eine aktive Teilnahme an einer gewaltsamen Beseitigung des Regimes ab. Da er sich aber in den Tagen um den 20. Juli 1944 im Bendlerblock, der Umsturzzentrale, aufgehalten be Ad Leihga elheid B. Döll im MH M Adelheid B. Döll N Einseiner 944 mit 1 r. r e e r b ö . Okto erschw s vom 1 d Ziele der V oenne n R u r e e iv ib t ass r Mo 5K ng übe schätzu 28 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 hatte, wurde er unmittelbar nach dem Attentat verhaftet, jedoch kurz darauf wieder frei gelassen, um Anfang ­August 1944 erneut festgenommen zu werden. Der Prozess vor dem Volksgerichtshof fand am 19. und 20. September 1944 statt. Roland Freisler, der Präsident des Volksgerichtshofes, war mit dem Verlauf der Verhandlung nicht einverstanden, weswegen er persönlich die Prozessführung übernahm. Nur wenige Tage später, am 5. Oktober 1944, wurde Roenne zum Tode verurteilt. Eine Woche später, am 12. Oktober 1944, wurde er in der Strafanstalt Plötzensee hingerichtet. Das Militärhistorische Museum hat die Kassiber, die Roenne in seiner Gefängniszelle an seine Frau schrieb, als Leihgabe aus Privatbesitz gewinnen können. Ausführlich beschreibt er darin die für Deutschland aussichtslose militärische Lage im Sommer 1944 und immer wieder spricht der gläubige Christ von der schweren Schuld, die das deutsche Volk in diesem Krieg auf sich geladen habe. Er versucht seiner Frau die Motive und die Ziele der Verschwörer und die Notwendigkeit ihres Handelns zu erklä­ ren. Die Kassiber wurden zum Teil von seinem Anwalt, der Roenne vor dem Volksgerichtshof zu verteidigen hatte, zum Teil aber auch von einem Wärter, einem ehemaligen Schulkameraden des Inhaftierten, aus dem Gefängnis herausgeschmuggelt. In dem hier abgebildeten Kassiber vom 1. Oktober 1944 wagt Roenne zuletzt eine Prognose für die historische Bedeutung des Umsturzversuches, nämlich dass die Gesinnung der Offiziere vom 20. Juli 1944 möglicherweise einmal als geistige Grundlage für den Aufbau eines neuen deutschen Heeres dienen könnte: »Ihre Ziele sind rein gewesen wie ihr Idealismus. Ihre Gesinnung wird vielleicht einmal wieder geistiger Anknüpfungspunkt für ein deutsches Heer in ferner Zukunft werden, denn sie haben bewiesen, dass der deutsche Generalstab sein Volk nicht widerstandslos in’s Verderben führen ließ, sondern sich unter Einsatz seines Lebens vor die Räder warf. Das ist stolz u. zukunftsweisend!« Linda v. Keyserlingk Die Sonderausstellung im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden »Attentat auf Hitler. Stauffenberg und mehr« zeigt noch bis 4. November 2014 die Vielfalt und Komplexität eines Umsturzversuches, der jahrelang vorbereitet worden war und schließlich auf dramatische Weise scheiterte. Originale Exponate aus den Nachlässen der Beteiligten ergänzen die 20 Ausstellungstafeln, die auch als Wanderausstellung angefragt werden können. 5. November 1414 22. September 1964 Beginn des Konzils von Konstanz Erstflug Lockheed SR-71 »Blackbird« Zu Beginn des 15. Jahrhunderts stand die Welt vor dem Anbruch eines neuen Zeitalters. Zwar befand sich Konstantinopel noch nicht in der Hand der Osmanen, die europäische Expansion hatte noch nicht begonnen und Martin Luther noch keine 95 Thesen angeschlagen. Aber die alte Welt war bereits aus den Fugen geraten. Schon seit 1378 regierte ein zweiter Papst in Rom, die weströmische Kirche war gespalten. Als 1409 in Pisa sogar noch ein dritter Papst gewählt wurde, beriefen der römisch-deutsche König und spätere Kaiser Sigismund (1368-1437) und Gegenpapst Johannes XXIII. (1370-1419) ein Konzil nach Konstanz ein. Die Versammlung des Klerus sollte das Schisma beenden und wichtige innerkirchliche Reformen vorantreiben. Insbesondere sollte sich die Kirche als Einheit gegen die »ketzerischen« Umtriebe stellen. Denn bereits vor Luther gab es heftige Kritik und Reformbewegungen innerhalb des Klerus. Schon der englische Theologe John Wyclif (ca. 13301384) hatte für Unruhe gesorgt; nun waren es vor allem die böhmischen Prediger Jan Hus (ca. 1369-1415) und Hieronymus von Prag (ca. 1379-1416), die eine große Anhängerschaft, die Hussiten, hinter sich versammeln konnten und eine Erneuerung der Kirche forderten. Vier Jahre lang tagten und feierten 600 Kleriker und über 70 000 weitere Gäste in der kleinen Stadt am Bodensee. Die Gegenpäpste Johannes XXIII. und Benedikt XIII. wurden abgesetzt, der eigentliche Papst Georg XII. trat freiwillig zurück. So konnte im November 1417 vom Konzil ein neuer Papst gewählt werden: Martin V. Das Große Abendländische Schisma war beendet. Das Konzil erklärte Wyclif posthum zum Ketzer und verbot seine Schriften. Am 6. Juli 1415 wurde Hus und ein Jahr später auch Hieronymus von Prag als Ketzer auf dem Scheiterhaufen in Konstanz verbrannt. Daraufhin kam es in Böhmen zu Aufständen der Hussiten, die sich in der Folge zu den sogenannten Hussitenkriegen (1419–1439) ausweiteten. Nach außen hatte die Kirche durch die Einigung und das rigorose Vorgehen gegen die »Ketzerei« Stärke und Geschlossenheit gezeigt, doch die dringenden inneren Reformen waren in Konstanz nicht auf den Weg gebracht worden. Auch die nachfolgenden Konzile lösten keines der innerkirchlichen Probleme. Erst hundert Jahre später, durch die von Martin Luthers 95 Thesen ausgelöste »Reformation«, war die katholische Kirche dann gezwungen, die bis dahin immer wieder aufgeschobenen Veränderungsprozesse anzustoßen. fh 1960 wurde ein hoch und langsam fliegendes Spionageflugzeug U-2 der Central Intelligence Agency (CIA) von sowjetischen Luftabwehrraketen abgeschossen. Damit war eingetreten, was die Experten des US-Auslandsnachrichtendienstes schon länger befürchtet hatten. Um weiter gefahrlos Spionageflüge betreiben zu können, hatte die CIA bereits Ende der 1950er Jahre bei der amerikanischen Flugzeugbaufirma Lockheed ein schnell fliegendes Aufklärungsflugzeug in Auftrag gegeben. Entwickelt wurde daraufhin die schnell und hoch fliegende A-12. Die technischen Herausforderungen, die es zu bewältigen galt, waren beträchtlich. Die geplante dreifache Schallgeschwindigkeit des Flugzeuges erhöhte die Reibungshitze, die durch den Widerstand der Hülle mit der Luft entstand, auf gefährliche dreistellige Temperaturen. Normale Flugzeugbaustoffe begannen dabei zu schmelzen. Daher musste das bis heute kostspielige Titan als zentraler Baustoff Verwendung finden. Mehrfache Tarnmaßnahmen (Stealth) sollten die A-12 zudem vor der Erfassung durch Radar schützen, darunter ein radarabsorbierender Anstrich. Gegen Fremdortung wurde sogar radioaktives Cäsium in den Triebstoff gegeben, um die Radarsignatur des Abgasstrahls zu verringern. Ab 1967 flogen die A-12 Spionageflüge über Vietnam, Nordkorea und dem Nahen Osten. Allerdings erwies sich die zweisitzige Variante namens SR-71 als flexibler, da sie im Gegensatz zum Einsitzer noch mehr Aufklärungsgeräte wie Kameras, Radargeräte und Infrarotsensoren mitführen konnte. Ihr Erstflug fand am 22. September 1964 statt. Ab 1968 wurde die SR-71 für Spionageflüge auch über der Sowjetunion genutzt. Bei einer Reisegeschwindigkeit von Mach 2,8 (3000 km/h) und einer Maximalgeschwindigkeit von Mach 3,3 (3550 km/h) waren die in einer Höhe von ca. 25 km fliegenden amerikanischen Aufklärer für die sowjetische Luftabwehr zwar zu orten, aber nicht zu bekämpfen. Keine einzige SR-71 wurde seit Indienststellung abgeschossen oder stürzte über fremdem Territorium ab. In den 1970er Jahren wurden mit dem Flugzeugtyp einige Rekorde erflogen, die zum Teil bis heute Gültigkeit haben. So flog eine SR-71 mit einer dafür notwendigen Luftbetankung die Strecke New York–London in knapp zwei Stunden. Hauptsächlich infolge der verbesserten Technik der Spionagesatelliten wurden die SR-71 Ende der 1990er Jahre außer Dienst gestellt. Jens Wehner pa/DoD pa/Keystone Geschichte kompakt 3Dreiköpfiger Pfau mit Papstkronen auf dem Kaiserbrunnen in Konstanz, 2014. 3Lockheed SR-71 »Blackbird«. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 29 Ausstellungen • Berlin • Koblenz 1914–1918. Der Erste Weltkrieg Deutsches Historisches Museum Unter den Linden 2 10117 Berlin Tel.: 0 30 / 20 30 40 www.dhm.de bis 7. Dezember 2014 täglich 10.00 bis 18.00 Uhr Eintritt: 8,00 Euro (unter 18 Jahren frei) Verdun – 100 Jahre danach. Eine deutschfranzösische Spurensuche Landesmuseum ­Koblenz Festung Ehrenbreitstein 56077 Koblenz Tel.: 02 61 / 66 75 0 www.diefestungehren breitstein.de bis 26. Oktober 2014 täglich 10.00 bis 18.00 Uhr Eintritt: 6,00 Euro (Kombiticket Festung und Seilbahnfahrt hin und zurück: 11,80 Euro) ermäßigt: 4,00 Euro (Kombiticket: 6,90 Euro) • Dresden 14 – Menschen – Krieg Militärhistorisches ­Museum der Bundeswehr Olbrichtplatz 2 01099 Dresden Tel.: 03 51 / 82 32 85 1 www.mhmbw.de bis 24. Februar 2015 Montag 10.00 bis 21.00 Uhr Donnerstag bis Dienstag 10.00 bis 18.00 Uhr Eintritt: 5,00 Euro ermäßigt: 3,00 Euro (für Bundeswehr-Angehörige Eintritt frei) Attentat auf Hitler. Stauffenberg und mehr Militärhistorisches ­Museum der Bundeswehr bis 4. November 2014 • Essen 1914 – Mitten in Europa LVR-Industriemuseum UNESCO-Welterbe Zollverein, Areal C ­(Kokerei) Arendahls Wiese 45141 Essen 02 01 / 12 46 81 44 4 www.1914-ausstellung.de bis 26. Oktober 2014 täglich 10.00 bis 18.00 Uhr Eintritt: 10,00 Euro ermäßigt: 7,00 Euro 30 • Münster Pferd und Krieg Westfälisches Pferdemuseum im Allwetterzoo Münster Sentruper Str. 311 48161 Münster Tel.: 02 51 / 48 42 70 www.pferdemuseum.de bis 26. Oktober 2014 täglich 9.00 bis 18.00 Uhr Eintritt (inkl. Allwetterzoo): 16,90 Euro ermäßigt: 11,90 Euro • Munster »Was damals Recht war…« – Soldaten und Zivilisten vor Gerichten der Wehrmacht Deutsches Panzer­ museum Munster Hans-Krüger-Str. 33 29633 Munster Tel.: 0 51 92 / 25 55 www.deutsches­panzermuseum.de bis 30. Nov. 2014 Juni bis September täglich 10.00 bis 18.00 Uhr Okt. und Nov. Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr Eintritt frei (Sonder­ ausstellung) • Wesel Playing Lawrence on the other side. Die Expedition Klein und die deutsche Orientpolitik im Ersten Weltkrieg Preußen-Museum Nordrhein Westfalen An der Zitadelle 14–20 46483 Wesel Tel.: 02 82 / 33 99 6 – 30 0 www.rheinland1914.lvr.de 26. Oktober 1914 bis 25. Januar 2015 Dienstag bis Sonntag 11.00 bis 17.00 Uhr Eintritt: bitte anfragen (bei Redaktionsschluss noch unbekannt) • Wilhelmshaven Die Flotte schläft im Hafen ein. Kriegsalltag 14/18 in Matrosen-Tagebüchern Deutsches Marine­ museum Südstrand 125 26382 Wilhelmshaven Tel.: 04 42 1 / 40 08 40 www.marinemuseum.de bis 31. Oktober 2014 täglich 10.00 bis 18.00 Uhr Eintritt: 9,50 Euro ermäßigt: 5,00 Euro Operation Heimkehr. Bundeswehrsoldaten über ihr Leben nach dem Auslandseinsatz Deutsches Marine­ museum Dezember 2014 bis 29. März 2014 täglich 10.00 bis 17.00 Uhr Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 Militärgeschichte Heft 4/2014 Service Zeitschrift für historische Bildung Vorschau Militär und Raum bilden die Überschrift des nächsten Heftes. Den Anfang macht dabei Sebas­tian Rosenboom, der von den Schwierigkeiten erzählt, welche die Fliegertruppe an der Ostfront von 1914 bis 1918 zu bewältigen hatte. Sie musste, im Vergleich zu ihren Kameraden an der Westfront, größere Entfernungen überwinden und sah sich mit schlechterer Infrastruktur konfrontiert. Zudem traf sie auf eine Bevölkerung, deren Sprache sie kaum verstand und deren Lebensweise und Mentalität ihr fremd blieb. Da die Aktivitäten des Gegners in der Luft vergleichsweise gering waren, steht folglich die Meisterung des Raumes und nicht der Luftkampf im Zentrum der Fliegermemoiren der 1920er und 1930er Jahre. Afro-Amerikaner hatten einen immensen sozialen Raum zu überwinden, bevor sie in ihrer Heimat als Piloten zugelassen wurden. In beiden Weltkriegen herrschte bei den USamerikanischen Streitkräften zudem Rassentrennung. Stefan Kontra beleuchtet dies am Beispiel der »Tuskegee Airmen«, einer rein schwarzen Fliegereinheit in der United States Army Air Force 1941–1945. Bevor ein Waffensystem in die Streitkräfte eingeführt wird, vergehen Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Von der Idee bis zur Auslieferung gilt es, viele Hindernisse und Bedenken in den politischen, sozialen und gesellschaftlichen Räumen zu überwinden bzw. zu zerstreuen. Heiner Möllers zeichnet die Geschichte des Jägers 90 bzw. des Eurofighters nach. Raum, Zeit, Kräfte und Information sind die klassischen militärischen Faktoren, die sich in den letzten 150 Jahren massiv verändert haben. Klaus-Jürgen Bremm geht diesem Aspekt nach und analysiert die Rolle der Telegrafie in den Einigungskriegen 1864, 1866 und 1870/71. hp Militärgeschichte im Bild Namibias Weg in die Unabhängigkeit 1989/90 O ullstein bild/Photo 12 hne Zweifel stehen die Jahre 1989/90 weltweit für eine politische Zäsur. Das gilt für die Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung, das Ende der chilenischen Militärdiktatur, den Tod des iranischen Revolutionsführers Ajatollah Khomenei oder den endgültigen Abzug der Sowjetunion aus Afghanistan ebenso wie für den aus deutscher Sicht besonders bedeutenden gesellschaftlichen Umbruch in der DDR und die Überwindung der politischen Teilung Europas. In diese Kette historischer Ereignisse reihte sich auch die Beendigung eines besonders langwierigen Konfliktes im südlichen Afrika ein: die Loslösung Namibias von südafrikanischer Verwaltung und Besatzung sowie die friedliche Hinführung des Landes in Unabhängigkeit und Freiheit durch einen von den Vereinten Nationen unterstützten politischen Prozess. 5Die Befreiungsbewegung Namibias führte ab Mitte der 1960er Jahre einen bewaffneten Kampf für die Unabhängigkeit des Landes. Die vielschichtige Namibia-Frage war stets verwoben mit der wechselvollen Geschichte des Landes zwischen südlichem Oranjefluss und nördlichem Owamboland an der Grenze zu ­Angola. Bis heute als koloniales Schutzgebiet »Deutsch-Südwestafrika« (1884–1915) des Deutschen Kaiserreiches eingebrannt in das deutsch-namibische Gedächt­nis, waren es bis 1989/90 beson­ ders zwei Faktoren, die Namibias Entwicklung maßgeblich beeinflussten: Die Republik Südafrika setzte ihre regio­nale Vormachtstellung in »Südwestafrika« durch, indem sie dem ihr 1920 als Verwaltungsmandat übertragenen Territorium nicht zu seiner vorgesehenen Souveränität verhalf, sondern das Gebiet als eine ihr zustehende Provinz betrachtete. Ab 1962 forcierte sie nicht nur den infrastrukturellen und administrativen Ausbau ihrer dortigen kolonialen Besatzung, sondern betrieb zudem ab 1964, beruhend auf dem sogenannten Odendaal-Plan, die Einrichtung von Regionalgebieten auf ethnischer Basis (»Homelands«) und somit die faktische Aufspaltung der namibischen Gesellschaft nach dem Vorbild der südafrikanischen Rassentrennung (Apartheid). Zwar entzogen die Vereinten Nationen 1966 Südafrika das Mandat für ­Namibia, was Südafrika jedoch nicht akzeptierte. Die Bestimmungen der Apartheid setzte die südafrikanische Verwaltung als Instrument ihrer Vorherrschaft in Namibia weiter restriktiv durch. Rassistisch motivierte Verbote und die politische Willkür gegenüber den nicht-weißen Bevölkerungsgruppen galten somit in Windhuk wie in Kapstadt oder Johannesburg. In Südwestafrika formierten sich in den 1960er Jahren bewaffnete Kräfte gegen die südafrikanische (Besatzungs-)Politik. Politisch führte den Widerstand die Südwestafrikanische Volksorganisation (South-West Africa People‘s Organisation, kurz SWAPO). Sie war 1960 unter Sam Nujoma aus verschiedenen Widerstandsgruppen gegründet worden und ging ab 1966 besonders von Angola aus auch mit Waffengewalt gegen die südafrikanische Besatzung vor. Verflochten war der von der SWAPO vorangetriebene Kampf um Namibias Unabhängigkeit somit mit dem seit 1975 (bis 2002) heftig wütenden Bürgerkrieg in Angola, in den die Sowjetunion und Kuba einerseits, die Vereinig­ten Staaten von Amerika und vor allem Südafrika andererseits militärisch eingriffen und der dem Land am Kap der Guten Hoffnung unter der verharmlosenden Bezeichnung »Buschkrieg« in Erinnerung blieb. Die sich somit auf verschiedenen Ebenen darstellende Krisensituation im Südwesten Afrikas war zu einem Stellvertreterkonflikt zwischen den Ost- und Westmächten des Kalten Krieges mutiert, in dem sich als nicht unwesentlicher Randaspekt auch eine oft vergessene Facette der deutsch-namibischen Beziehungen entwickelte. Denn im Zuge der sowjetischen Marschrichtung in Afrika hatte die von Ost-Berlin aus regierende So­zialis­ tische Einheitspartei Deutschlands (SED) die DDR ab 1960 innerhalb des brisanten Deutschlandkonfliktes und in Abgrenzung zur Bundesrepublik als antikolonialen Stützpfeiler der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegung positioniert, auf den auch die SWAPO gerne zurückgriff. 1962 besuchte Sam Nujoma erstmals die DDR, im August 1989 war er der letzte prominente Repräsentant Afrikas, der dem ostdeutschen Staat kurz vor seinem Untergang noch einmal einen Besuch abstattete. Ihren Schlusspunkt fand diese intensive namibischostdeutsche Liaison unter der Obhut der Vereinten Nationen: Seit 1978 hatten sie in langjährigen Verhandlungen einen Fahrplan entworfen, der Namibia schließlich von April 1989 bis März 1990 unter Aufsicht einer UN-Friedensmission in die Unabhängigkeit führte. Sowohl die DDR als auch die Bundesrepublik beteiligten sich vor Ort an dieser Mission (siehe hierzu in diesem Heft S. 14–17). Daniel Lange Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 3/2014 31 ZMSBw Neue Publikationen des ZMSBw neue PUBLIKATIONEN Abonnement Matthias Rogg, Kompass Militärgeschichte. Ein historischer Überblick für Einsteiger. Jahresabonnement: 14,00 Euro inkl. MwSt. Hrsg. vom ZMSBw, Freiburg i.Br., Berlin, Wien: Rombach 2013, X, 384 S., 19,80 Euro und Versandkosten (innerhalb Deutschlands, ISBN 978-3-7930-9732-7 Auslandsabonnementpreise auf Anfrage) Kündigungsfrist: 6 Wochen zum Ende des Bezugszeitraumes. Christoph Nübel, Durchhalten und Überleben an der Westfront. Raum und Körper im Ersten Weltkrieg, Paderborn [u.a.]: Schöningh 2014 (= Zeitalter der Weltkriege, 10) X, 484 S., 44,90 Euro Die Garnisonkirche Potsdam. Zwischen Mythos Erinnerung. Im Auftrag des ISBNund 978-3-506-78083-6 ZMSBw hrsg. von Michael Epkenhans und Carmen Winkel, Freiburg i.Br., Berlin, Wien: Rombach 2013, 120 S., 10 Euro ISBN 978-3-7930-9729-7 Kontakt zum Bezug der Zeitschrift: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr z.Hd. Frau Christine Mauersberger Postfach 60 11 22, 14471 Potsdam Tel.: 0331/9714 599, Fax: 0331/9714 509 Mail: [email protected] Die Betreuung des Abonnements erfolgt über die Firma SKN Druck und Verlag, Stellmacher Straße 14, 26506 Norden, die sich mit den Interessenten in Verbindung setzen wird. »Vom Einsatz her denken!« Bedeutung und Nutzen von Militärgeschichte zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Mit Beiträgen von Donald Abenheim, Eberhard Birk, Bernhard Chiari, Antje Dierking, Axel F. Gablik, Winfried Heinemann, Hans-Hubertus Mack und Peter Andreas Popp. Im Auftrag des ZMSBw hrsg. von Dieter H. Kollmer, Potsdam: ZMSBw 2013, 107 S. (= Potsdamer Schriften zur Militärgeschichte, 22), 9,80 Euro Loretana de Libero, Rache und Triumph. ISBN 978-3-941571-26-6 Krieg, Gefühle und Gedenken in der Moderne, München: Oldenbourg 2014 (= Beiträge zur Militärgeschichte, 73) X, 447 S., 39,95 Euro ISBN 978-3-486-71348-0 Abonnement Jahresabonnement: 14,00 Euro inkl. MwSt. und Versandkosten (innerhalb Deutschlands, Auslandsabonnementpreise auf Anfrage) Kündigungsfrist: 6 Wochen zum Ende des Bezugszeitraumes. From Venus to Mars? Provincial Reconstruction Teams and the European ft: ExpeZeitschriMilitary g der 2001–2014. zu e B m rience in Afghanistan, On behalf of zu t k Konta Bundeswehr Centre of Military History undinand hte ic h c s e ­Social Sciences ed. by Bernhard Chiari rg ä it il trum für Mwith Thijs deswehr Ze­cnollaboration Brocades r BunZaalberg, e d n e ft a h c s issen and Ben Schoenmaker, ialwLabanca berger So­Nzicola auers2014 M e n ti s ri h C F ­ reiburg i.Br. [et al.]: Rombach amNeueste d(= .Hd. Frau zMilitärgeschichte. ots P 1 7 4 4 1 , 2 Analysen und Studien, 2 h 60 11 7143)509 /9 1 ostfS.,ac48,00 3 P476 3 0 : x Euro a F , 331/9714 599 [email protected] el.: 0978-3-7930-9771-6 TISBN ers eMau Mail: Christin www.zmsbw.de www.mgfa.de Piraterie in der Geschichte. Mit Beiträgen von Robert Bohn, Martin Hofbauer, Teresa Modler, Gorch Pieken und Martin Rink. Im Auftrag der Deutschen Kommission für Militärgeschichte sowie des ZMSBw hrsg. von Martin Hofbauer, Potsdam: ZMSBw 2013, V, 85 S. (= Potsdamer Schriften zur Militärgeschichte, 21), 9,80 Euro ISBN 978-3-941571-25-9 r die Firma SKN e b ü t lg o rf e ts n des Abonneme 06 Norden, Die Betreuung , Stellmacher Straße 14, 265 en wird. ag setz Druck und Verl teressenten in Verbindung www.zmsbw.de In n die sich mit de