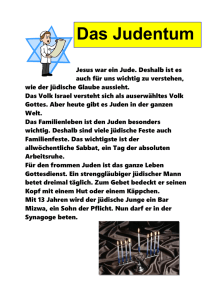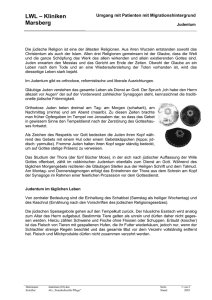1 Rabbiner Prof. Dr. Walter Homolka Israelsonntag
Werbung

Oberpfarr - und Domkirche zu Berlin Rabbiner Prof. Dr. Walter Homolka Israelsonntag, 12. August 2012, 18 Uhr Voneinander Glauben lernen - Im Bewusstsein des religiösen Eigenwerts Als Martin Luther 1523 seine Schrift "Daß Jesus Christus ein geborener Jude sei" herausbringt, war das für jüdische Leser zunächst eine gute Nachricht. Hier kommt jemand und verweist auf den Ursprung des Christentums im Judentum und bietet sogar Anknüpfungspunkte für größeres Verständnis. Doch Luther wird enttäuscht. Die ausgestreckte Hand führt nicht dazu, dass jüdische Gemeinden ins reformatorische Lager wechseln. Der Missionsversuch scheitert und Luther wird schließlich zu einem Feind des Judentums. Aus der Feder des alternden Reformators entstehen stark polemische Schriften wie "Von den Juden und ihren Lügen", und Luther ruft sogar zum Niederbrennen von Synagogen auf. Jahrhunderte lang boten Luthers Ausfälle gegen Juden willkommene Argumentationshilfen für Antisemiten, bis in die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts. Schon an diesem markanten Beispiel wird deutlich: die Beziehung von Judentum und Christentum hatte seine Höhen und Tiefen. Am Israelsonntag haben Sie nun einen Juden, einen Rabbiner eingeladen, zu predigen. Das ist nur ein aktueller Fingerzeig, dass sich das Verhältnis zwischen Protestantismus und Judentum in den letzten Jahrzehnten grundlegend verbessert hat. Vor allem wenn man sich vor Augen führt, dass auf dieser selben Kanzel auch schon Adolf Stoecker stand, 2. Hof- und Domprediger unter Wilhelm II., der als ein herausragender Vorkämpfer des kirchlichen und politischen Antisemitismus im Deutschen Kaiserreich unrühmlich in die Geschichte einging. Auch daran denkt man unwillkürlich, wenn man die Stufen hier herauf erklimmt, um zu Ihnen zu sprechen. Oder daran, dass der Israelsonntag früher einmal der „Judensonntag“ hieß und gar nicht zufällig in einer zeitlichen Nähe zum jüdischen „Tischa be-Av“ liegt, dem Tag, an dem wir Juden uns fastend der Zerstörung des Tempels in Jerusalem erinnern. Das traditionale Evangelium am 11. So. nach Pfingsten bzw. 10. Sonntag nach Trinitatis war nach der altkirchlichen Leseordnung Lk 19,41-47. – Im Vers 44 kann man lesen: Sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein auf dem andern lassen; denn du hast die Zeit der Gnade nicht erkannt. Offensichtlich wollten die spätmittelalterlichen Kirche und die Reformatoren damit die Verwerfung Israels zum Ausdruck bringen, greifbar gemacht durch die Zerstörung Jerusalems. Heute dagegen haben wir einen ganz anderen Text gelesen. (Jesaja 62,6 – 12) 6 Auf deine Mauern, Jerusalem, stellte ich Wächter. … Ihr, die ihr den Herrn (an Zion) erinnern sollt, / gönnt euch keine Ruhe! 7 Lasst auch ihm keine Ruhe, / bis er Jerusalem wieder aufbaut, / bis er es auf der ganzen Erde berühmt macht. … 10 … bahnt dem Volk einen Weg … und räumt die Steine beiseite! / …12 Dann nennt man sie «Das heilige Volk», / «Die Erlösten des Herrn». Und dich nennt man / «Die begehrte, die nicht mehr verlassene Stadt». Jesaja 62 spricht nicht von der Zerstörung Jerusalems, der Verwerfung Israels. Er nennt Israel das Volk der Erlösten und Jerusalem die nicht mehr verlassene Stadt. Das verweist auf eine grundlegend neue Sicht der Kirche gegenüber dem Judentum: dass nämlich der Bund Gottes mit seinem Volk Bestand hat und gültig ist und dauerhaft. Wenn ich hier heute auf der Kanzel stehe, ist die Aufgabe des Predigers nicht die, die sich Adolf Stoecker vielleicht noch gestellt hätte: dem verstockten Judentum vor Augen zu halten, dass Jerusalem als Unterpfand der Liebe Gottes in Schutt und Asche liegt und Juden die Zeichen einer neuen Zeit endlich erkennen sollten. 1 Oberpfarr - und Domkirche zu Berlin Wenn ich hier heute auf der Kanzel stehe, ist das zeichenhaft für ein Miteinander auf gleicher Augenhöhe, wissend um die Vergangenheit und hoffnungsvoll für die Zukunft. Deshalb bin ich heute gerne hier. Wer in die frühjüdische und frühchristliche Zeit blickt, trifft auf zwei Schwestern, die sich lange nicht trennen mochten, so reich und vielfältig waren ihre Bezüge noch Jahrhunderte nach der Zeitenwende. Schon in der Frühzeit beider Religionen war nichts so abgezirkelt und sauber getrennt, wie wir es heute immer wieder gerne darstellen. Später hat man sich brüsk voneinander abgewandt. Disputationen zu gewinnen, war für jüdische Gelehrte so gefährlich, wie sie zu verlieren. Erfolg konnte auf dem Scheiterhaufen enden, Niederlage am Taufbecken. Und selbst in dieser Zeit und unter solchen Bedingungen gab es einen gewissen Austausch von Anregungen, Einflüssen, gab es geistige Befruchtung. Es hat der Aufklärung bedurft, um in Europa die Karten neu zu mischen. Die Übermacht des Christentums begann zu bröckeln, zu brechen. Und aus der Ohnmacht erwachte das Judentum zu neuer geistiger Kraft und kritischem Vermögen – jenseits der Idee vom „christlichen Staat“ in einer sich langsam pluralisierenden Gesellschaft. Mochte das Denken eines Abraham Geiger christlicherseits noch abgetan werden als Äußerungen einer verkümmerten Vorstufe hin zum göttlichen Heilsplan, so war da dennoch ein Jude, der ernsthaft Jesus als Juden reklamierte und den Disput von neuem begann, den Martin Luther mit „Daß Jesus Christus ein geborener Jude sei“ einmal angestoßen hatte: wo denn der Kern des einen endete und das Wesen des anderen seinen Anfang nahm. Ein jüdischer Zweig der Leben-Jesu-Forschung bis hin zu David Flusser durchzog das 19. und 20. Jahrhundert: auf der Suche nach der Verortung einer Person, die so unendlich viele bewegt und angetrieben hatte über zwei Jahrtausende hinweg. In der Reibung gegeneinander und in der Abgrenzung voneinander gewann man aneinander je eigene Identität. Hier Augenhöhe mit dem Christentum zu erlangen, hat die jüdische Theologie des ausgehenden 19. und 20. Jahrhunderts in nicht geringem Maße beschäftigt. Rabbiner Abraham Geiger war es, der 1830 forderte, die Ausbildung von Rabbinern der christlicher Geistlicher gleichzustellen. Unverkennbar sind seine Anleihen bei dem Protestanten Friedrich Daniel Schleiermacher, wenn ich mir seine strukturelle Konzeption des Rabbinerstudiums anschaue. Für ihn war Jüdische Theologie als Universitätsfach der Test, ob die jüdische Emanzipation gelungen sei. Als er 1874 schließlich die Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums in Berlin errichtete, war die aber eben kein Teil der Friedrich-Wilhelms-Universität. Erst 1912 sprach sich der evangelische Theologe Martin Rade für die Errichtung einer akademischen Rabbinerausbildung aus: „Wir fordern eine jüdisch-theologische Fakultät im Interesse der deutschen Kulturnation“. Der renommierte Alttestamentler Hermann Gunkel antwortete Martin Rade darauf: "Was ich persönlich von jüdischer 'Wissenschaft' kennen gelernt habe, hat mir nie einen besonderen Respekt eingeflößt. Unsere jüdischen Gelehrten haben zumeist noch nicht einmal die Renaissance erlebt!" Gunkels Ablehnung obsiegte und mit der Schoa setzte die Kulturnation Deutschland einen grausamen Endpunkt. Akademischen Disput auf gleicher Ebene hat es im Verhältnis von Judentum und Christentum hierzulande leider nie gegeben. Dabei wäre die Universität und ihre Lehr- und Gedankenfreiheit der Ort gewesen, Trennendes und Gemeinsames zu diskutieren und vor allem die Fragen zu behandeln, die uns als Glaubende bewegen: Ist der Mensch bei all seinem Wollen zum Guten nun dem Bösen passiv ausgeliefert und unfähig, das Gute zu wirken? Oder kann er in einem Prozess der Selbstläuterung die besten Kräfte nähren und bündeln, um das messianische Reich aus eigener Kraft herbeizuzwingen? Solche und andere Fragen beschreiben die Pole einer theologischen Debatte, die hilfreich die Kategorien schafft im System der Experten. Wer die Berichterstattung der Presse aufmerksam verfolgt, weiß: Jüdische Theologie an einer deutschen Universität wird es nun doch endlich geben. Und heute kann ich vielen wichtigen Unterstützern in der evangelischen und der katholischen Kirche danken, die die Gleichberechtigung der jüdischen Theologie mit uns gefordert und durchgesetzt haben. Sie alle sind für uns Juden „Schomrei Yerushalayim“ „Wächter auf den Mauern Jerusalems“ - geworden. 2 Oberpfarr - und Domkirche zu Berlin Das Interesse am Errichten von Barrikaden zwischen unterschiedlichen geistigen Erfahrungswelten hat stark abgenommen. Heute sehen wir das Gemeinsame öfter und lieber als das, was uns trennt. Es ist nicht leicht für den jüdischen Partner, dies ohne Bitterkeit zu tun, angesichts von Jahrhunderten elendigen Unrechts. Aber auch wir Juden mussten aus dem Traum von der Einzigartigkeit schließlich erwachen und mussten erkennen, dass Gott mit seiner Schöpfung Dinge vorhat auf vielerlei verschiedene Weise. Eine der schwierigsten Lehren, die der jüdische Religionsphilosoph Schalom Ben Chorin uns Juden hinterlassen hat, ist die folgende: „das verhängnisvolle Selbstmissverständnis Israels liegt in der Bagatellisierung des Evangeliums von Christus Jesus. Diese Bagatellisierung aber ist eine Blasphemie. Sie ist es gerade vom jüdischen Glauben aus gesehen. Denn wenn es wahr ist, dass Gott der Herr der Geschichte ist – und wie sollte dies jüdischem Glauben nicht wahr sein? -, dann hat dieser Herr aller Herren selbst sein Bundesvolk Israel durch Jesus von Nazareth gefragt. Und die Juden haben auf Gottes Frage nicht wie Abraham geantwortet „Hier bin ich“, sondern sie haben sich versteckt wie Adam, oder sie haben Witze gerissen.“ Schalom Ben Chorin gibt alles zu, was Juden hier zu ihrer Verteidigung anführen: dass Jesus nämlich nichts Neues gelehrt habe oder dass er als Messias gescheitert sei im geschichtlichen Raum. Und doch wird Jesus von Nazareth in der Rückschau zu Recht als große Zäsur in der Geschichte empfunden, „als der Einbruch der Ewigkeit in die Zeitlichkeit, als Ende und Anfang eines Äons“. Das hochentwickelte Judentum und die junge christliche Gemeinde mit ihrem Glauben an die Frohe Botschaft - kaum schriftlich fixiert -, standen einander gegenüber und rangen – einen göttlichen Augenblick lang – um die geistliche Herrschaft . „Keine jüdische Orthodoxie kann es leugnen: die Herrschaft fiel der Kirche Christi zu. Aber Israel verschwand nicht von der Erde mit dem Machtantritt des Christentums. Das kann keine christliche Orthodoxie leugnen.“ Dass beide bestehen in dieser Welt, konnte für Schalom Ben Chorin nur heißen, dass sie einander Rede und Antwort stehen müssen – und damit beide Gottes Willen erfüllen als Teil seines Heilsgeschehens unter den Menschen. Das wäre doch was: aus den Wagenburgen säuberlich aufgerichteter Systematik heraus einmal ungeschützt aufeinander zu blicken. Sich nicht damit zufrieden zu geben, dass jeder für sich ein Laufställchen des Glaubens unterhält, in dem unsere kindliche Vorstellung von Gott vor jedem Einwand bewahrt wird. Judentum und Christentum müssen heute gemeinsam einsehen: religiöser Zweifel ist eine gesellschaftliche Realität. Wenn wir ihn nicht zum Feind erklären, steckt darin auch eine große Chance für das Gespräch. Denn uns Menschen treibt doch alle eine existentielle Not mit den Sinnfragen des Lebens. Unser Prüfstein für gelingendes Leben ist die Frage: Haben wir ein tieferes Verständnis von unserem Dasein gewonnen, sind wir großzügiger geworden? Sind wir Gott näher gekommen? Haben wir Seinen Funken in uns aufblinken sehen? Welches Verhältnis haben Juden und Christen heute zueinander, wenn dieser Israelsonntag denn einlädt, das Fazit zu ziehen? Wir stehen in einer intensiven Doppelbeziehung von Faszination und Aversion, von Anziehung und Abstoßung. Und ich bin davon überzeugt: wenn wir uns auf den Anderen existentiell einlassen, birgt das die Chance, auch uns selbst zu begegnen. Wir Juden waren über Jahrzehnte nicht fähig, Christen wirklich die Türe zur inneren Begegnung zu öffnen. Zu schwer schmerzten die Wunden der Vergangenheit. Das Geheimnis des spirituellen Überlebens heute für Juden wie Christen liegt aber in der Möglichkeit echter Begegnung. Denn das „Ich“ wird am „Du“, weniger durch die Erfahrung künstlicher Übereinstimmung, sondern vor allem durch das Aushalten unserer Unterschiedlichkeit. Die gemeinsame große Herausforderung liegt darin, religiöse Authentizität zu wahren. Aus einem in der Begegnung gewonnenen festen eigenen Standpunkt kann es gelingen, sich trotz theologischer Unterschiede auf die Suche zu machen nach einem viel tieferen Gleichklang. Dort ist die Quelle, aus der wir gemeinsam Kraft schöpfen für die harte Arbeit zur Heilung der Welt. (tikkun olam). Unser Introitus, der 146. Psalm, formulierte schon die gemeinsame Aufgabe: 3 Oberpfarr - und Domkirche zu Berlin Unsere Hoffnung setzen auf den Herrn unseren Gott, mit ihm Recht schaffen denen, die Gewalt leiden, mit ihm die Hungrigen speisen, die Gefangenen frei machen, die Blinden sehend, aufrichten die, die niedergeschlagen sind, die Fremdlinge behüten, die Witwen und Waisen, Denn der Herr liebt die Gerechten. Amen! 4