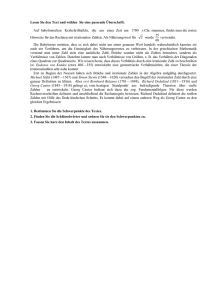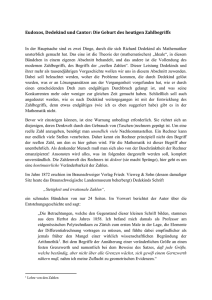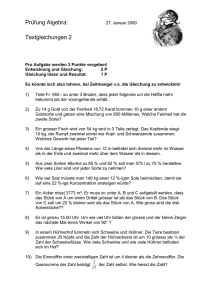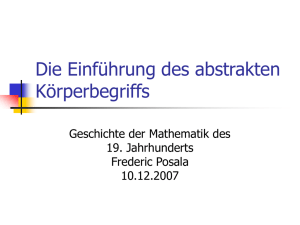Gedenkschrift für Richard Dedekind - IHK Braunschweig
Werbung
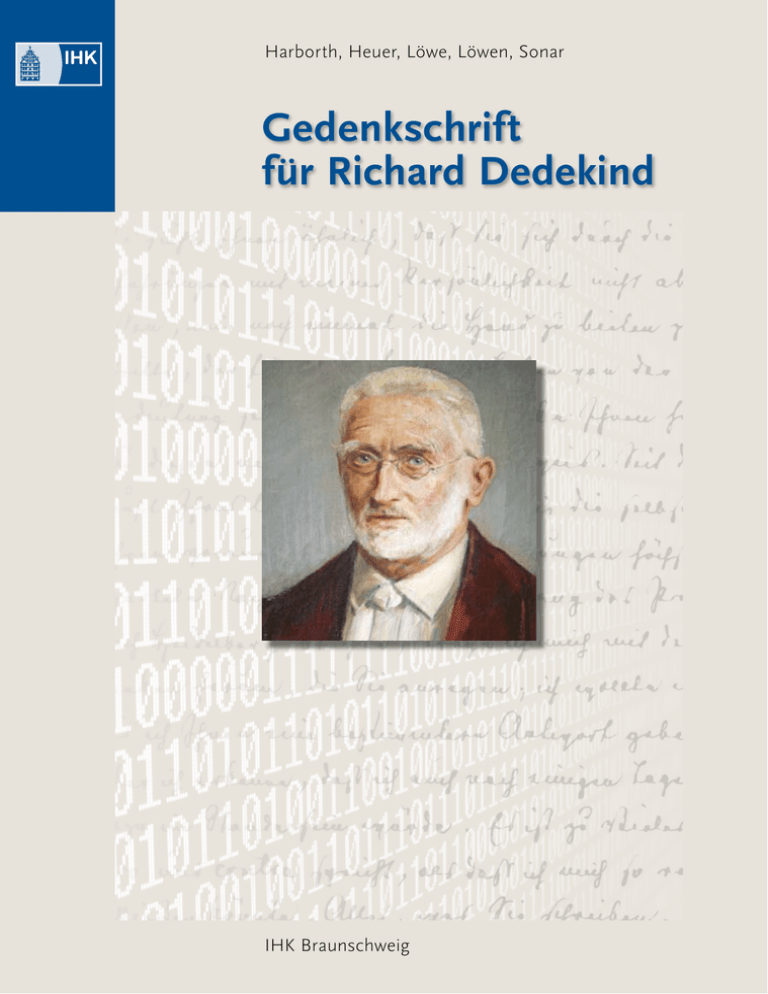
Harborth, Heuer, Löwe, Löwen, Sonar Gedenkschrift für Richard Dedekind IHK Braunschweig IHK Braunschweig Gedenkschrift für Richard Dedekind Heiko Harborth, Maria Heuer, Harald Löwe, Rainer Löwen, Thomas Sonar Gedenkschrift für Richard Dedekind Ein Beitrag der Wirtschaft, vertreten durch die Industrieund Handelskammer Braunschweig Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. Impressum: Herausgeber Industrie- und Handelskammer Braunschweig Postfach 3269, 38022 Braunschweig Telefon 0531 · 4715-0, www.braunschweig.ihk.de Redaktion Carl Langerfeldt, Jochen Hotop Layout Peter Pohl, DPP Designbüro Fotografien Susanne Hübner, Rainer Löwen, Peter Pohl Druck Ruth Printmedien, Braunschweig ISBN 00: X-XXXX-XXXX-0 ISBN 00: XXX-X-XXXX-XXXX-0 INHALT Vorwort ...................................................................................... 7 Prof. Dr. Heiko Harborth Zum Leben des Mathematikers Richard Dedekind ...............9 Prof. Dr. Thomas Sonar Richard Dedekind und seine Beziehungen in der Gelehrtenrepublik . ...................................................... 13 Prof. Dr. Rainer Löwen Eudoxos, Dedekind und Cantor: Die Geburt des heutigen Zahlbegriffs .................................. 27 Prof. Dr. Harald Löwe Dedekinds Theorie der Ideale ................................................ 51 Prof. Dr. Thomas Sonar Die Bändigung des Unendlichen. Richard Dedekind und die Geburt der Mengenlehre .......... 85 Maria Heuer Faszination Mathematik . ....................................................... 99 Prof. Dr. Heiko Harborth Einige Selbstzeugnisse, zum Beispiel Briefe, Richard Dedekinds ............................103 Autoren................................................................................... 107 Förderer der Gedenkschrift................................................... 1 1 1 Vorwort Mit der Gedenkschrift für Richard Dedekind anlässlich der Auszeichnung Braunschweigs als „Stadt der Wissenschaft 2007“ möchte die Industrie- und Handelskammer Braunschweig, der Technischen Universität Braunschweig vielfach verbunden, gemeinsam mit deren Carl-Friedrich-Gauß-Fakultät das menschliche Interesse an Leben und Wirken dieses bedeutenden Braunschweiger Mathematikers mit einer Einladung in die Welt der Mathematik verknüpfen. Die Mathematik entspringt nicht nur einer ganz besonderen Fähigkeit menschlichen Denkens1; sondern sie ist auch geeignet, mit ihrer weltweit gültigen Formelsprache Naturgesetze so zu beschreiben, dass wir diese anwenden und technisch nutzen können. Auf dieser wahrhaft erstaunlichen Tatsache beruhen unsere ganze heutige erdumspannende Technik und Wirtschaft. Mathematik ist der Schlüssel zum Verständnis aller Naturwissenschaft und Technik, deren Entwicklung unser Leben, unsere von Menschen geschaffene Lebenswelt und unsere gesamte Erde umfassend prägt und in rasantem Tempo revolutionär verändert. Sie dient der internationalen Finanzwelt zur Steuerung von Kapital und Liquidität und ist Voraussetzung für die unauf haltsame Globalisierung unserer Zeit. Daher ist Mathematik heutzutage unverzichtbarer Bestandteil einer grundlegenden Allgemeinbildung, die nicht nur überhaupt ein Grundverständnis unserer Gegenwart und unseres Alltages ermöglicht, sondern uns auch erst zur Ausübung vieler anspruchsvollerer Tätigkeiten und Berufe befähigt. Darüber hinaus vermitteln mathematische Strukturen und Beweise immer wieder das Erlebnis von Schönheit und Eleganz. Aufgeschlossenheit und Wissensdurst, vielleicht sogar Lust an der Mathematik, gerade auch bei Schülern der Oberstufe und Studenten zu wecken, ist deshalb erklärtes Ziel dieser Gedenkschrift. Dem Initiator, Vizepräsident Carl Peter Langerfeldt, sowie allen Mitwirkenden und Förderern sei herzlich gedankt! Dr. Wolf-Michael Schmid Dr. Bernd Meier Präsident der IHK Braunschweig Hauptgeschäftsführer der IHK Braunschweig 1 Dehaene, Stanislas, Der Zahlensinn oder warum wir rechnen können, Birkhäuser Basel 1999 ISBN 3-7643-5060-9; Butterworth, Brian, The Mathematical Brain, Macmillan London 1999 ISBN 0 333 73527 7 Richard Dedekind, Ölgemälde im Forum-Gebäude der TU Braunschweig © TU Braunschweig Zum Leben des Mathematikers Richard Dedekind Prof. Dr. Heiko Harborth, TU Braunschweig R i c h a r d D e d e k i n d wurde am 6. Oktober 1831 in Braunschweig geboren, wo er seine Kindheit sowie den Großteil seines Berufslebens verbrachte und wo er am 12. Februar 1916 starb. Getauft wurde Richard Dedekind in St. Katharinen, seine letzte Ruhestätte fand er in der Familiengrabstätte auf dem Braunschweiger Hauptfriedhof. Sein familiäres Umfeld kann als repräsentativ für das Braunschweiger Bildungsbürgertum in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelten. Der Vater, Julius Levin Ulrich Dedekind (1795-1872), war Jurist und lehrte als Professor am Collegium Carolinum. Hier war schon Richard Dedekinds Großvater, Professor Johann Ferdinand Friedrich Emperius (1759-1822), tätig, der außerdem ab 1806 als Direktor dem Herzoglichen Museum in Braunschweig (heute: Herzog Anton Ulrich Museum) vorstand. Zu den bleibenden Verdiensten von Emperius gehört es, dafür Sorge getragen zu haben, dass ein Großteil der von den Franzosen, die das Herzogtum seit der Niederlage der preußischen Truppen bei Jena und Auerstedt 1806 besetzt hielten, nach Paris verbrachten Kunstschätze 1815 nach Braunschweig zurückkehren konnte. Richard Dedekind wuchs in der väterlichen Dienstwohnung des Collegium Carolinum am Bohlweg auf. Nach der Bürgerschule besuchte er das Martino-Katharineum und anschließend das Collegium Carolinum (1848-1850). Zwischen 1850 und 1852 studierte er in Göttingen und wurde dort nach nur vier Semestern mit einer Arbeit „Über die Elemente der Theorie der Eulerschen Integrale“ als letzter Doktorand bei dem großen Braunschweiger und Göttinger Mathematiker Karl Friedrich Gauß (1777-1855) promoviert. Weitere zwei Jahre darauf folgten 1854 die Habilitation und bis 1858 eine Tätigkeit als Privatdozent in Göttingen. Im Jahre 1858 erhielt Richard Dedekind einen Ruf als Professor für Mathematik an das Polytechnikum in Zürich. Trotz des hohen Ansehens dieses Lehrstuhls zog es ihn in seine Heimatstadt zurück, wo 1862 eine Professur für Mathematik am Collegium Carolinum (dem späteren Polytechnikum und der heutigen Technischen Universität) antrat. Als Hochschullehrer in Braunschweig wirkte Richard Dedekind dann mehr als drei Jahrzehnte. Nach 32 Jahren Lehrtätigkeit trat er 1894 in den Ruhestand, hielt allerdings auch danach weiterhin Vorlesungen. Von 1872 bis 1875 war Richard Dedekind der erste gewählte Direktor des Collegium Carolinum. In seine Amtszeit fielen eine Reihe schwieriger Verhandlungen. Seinem Entschluss und seiner Überzeugungskraft ist es zu danken, dass das Collegium Carolinum nicht nur in seinem Bestand erhalten blieb, sondern dass man ihm 1872 sogar die erhebliche Summe von einer halben Million Talern für einen Neubau des Polytechnikums bewilligte. Dedekind hatte den ersten Vorsitz in der Baukommission, und 1877 konnte das neue Gebäude in der Pockelsstraße, damals noch im Außenbereich der Stadt, eingeweiht werden. Durch die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs blieb von diesem Gebäude leider nur die Fassade erhalten. Auch an der Errichtung eines der bedeutendsten Braunschweiger Denkmäler, des Gauß-Denkmals, war Richard Dedekind maßgeblich beteiligt. Von ihm stammt die Anre- 10 Zum Leben des Mathematikers Richard Dedekind 1 5 2 3 4 6 7 Zum Leben des Mathematikers Richard Dedekind gung, am Sockel ein regelmäßiges Siebzehneck anzudeuten, das dann als vergoldeter Stern eingemeißelt wurde. 1930 und 32 in drei Bänden vom Vieweg-Verlag herausgegeben worden. Zwei kleine Schriften von Dedekind (Was sind und was sollen die Zahlen? Stetigkeit und Irrationale Zahlen.) werden noch heute gedruckt. In Stichwortverzeichnissen von Geschichten der Mathematik wird Dedekind ebenso häufig wie Gauß genannt. Man liest, dass Dedekind „über 50 Jahre die Zierde der heutigen Technischen Universität Braunschweig“ war. Nach E. T. Bell (1967, Die großen MatheRichard Dedekind war Mitglied der Akade- matiker) ist Dedekind „einer der größten und mien der Wissenschaften in Berlin, Paris und originellsten Mathematiker Deutschlands.“ B. Rom sowie der Leopoldinisch-Carolinischen L. van der Waerden schreibt: „E. Galois und Akademie der Naturforscher. In Anerkennung R. Dedekind sind es, die der modernen Algebseiner großen wissenschaftlichen Verdienste ra ihre Struktur gegeben haben. Das tragende wurden ihm Ehrendoktorate in Kristiania, Zü- Skelett stammt von ihnen“. Nach W. Felscher rich und Braunschweig verliehen. (1978, Naive Mengen und abstrakte Zahlen) „kann der Einfluss, welchen Dedekinds MethoDie Ergebnisse seiner wissenschaftlichen den auf die Entwicklung der Algebra gehabt Forschungen veröffentlichte Richard Dede- haben, in seiner Bedeutung kaum überschätzt kind in über 50 Publikationen, wobei sein werden“. Hauptarbeitsgebiet die Algebraische Zahlentheorie war. Richard Dedekind hat sich in Richard Dedekind hat Rufe auf bedeutende seinen Arbeiten sehr um die Bewahrung der Lehrstühle ausgeschlagen, unter anderem Werke von Carl Friedrich Gauß, Peter Gus- nach Zürich, Hannover, Straßburg, Gießen, tav Lejeune-Dirichlet und Bernhard Riemann Karlsruhe, Göttingen (zweimal). Er ist seiner verdient gemacht. Außerdem nahm er durch Heimatstadt immer mit Überzeugung treu geseine enge Freundschaft mit Georg Cantor blieben. Er war damit ein echter Braunschweian dessen grundlegenden Arbeiten zur Men- ger Bürger, dessen Bedeutung für die Mathegenlehre intensiven Anteil. Die gesammelten matik auf der ganzen Welt auch heute noch Werke von Richard Dedekind sind zwischen bekannt und unbestritten ist. n Nach dem Tod seines Vaters (1872) wohnte der Junggeselle Richard Dedekind mit Mutter und älterer Schwester Julie zusammen in der Petrithorpromenade 24 (heute Inselwall 12). Im Jahre 1894 siedelte er zusammen mit seiner Schwester in die erste Etage der Kaiser-Wilhelm-Straße 87 (heute Jasperallee 87) über. 1 Adolf Dedekind (1829–1909), Bruder von Richard Dedekind 2 Julie (1825–1914) und Mathilde (1827–1860) Dedekind, Schwestern von Richard Dedekind 3 J. L. Ulrich Dedekind (1795–1872), Vater von Richard Dedekind 4 Caroline Dedekind, geb. Emperius (1799–1882), Mutter von Richard Dedekind 5 Richard Dedekind, 37 Jahre alt 6 Richard Dedekind, 55 Jahre alt 7 Richard Dedekind, 72 Jahre alt, am 6. März 1904 11 12 In der ersten Etage des Hauses Jasperallee 87 hatte Dedekind seit 1894 mit seiner Schwester Julie gewohnt. 13 Richard Dedekind und seine Beziehungen in der Gelehrtenrepublik Prof. Dr. Thomas Sonar, TU Braunschweig „Gelehrtenrepublik“ B e r e i t s i n d e r A n t i k e wurde die Vorstellung geboren, ein Staat unter der Führung von gelehrten Philosophen würde Glück und Wohlstand garantieren. Der Begriff der Gelehrtenrepublik blieb bis in das 18te Jahrhundert hinein als die „res publica literaria“ synonym für die Gemeinschaft von Poeten, Bibliothekaren und Philosophen, die über Korrespondenz, Bücher und Besuchsreisen länderübergreifend Kontakt hielten. In der Zeit der absoluten Herrscher sollte es gerade unter den Gelehrten eine „Republik“ sein, um sich gegen die Herrschaftsformen der Regierenden abzugrenzen. Lokale Realisierungen waren Friedrich Gottlieb Klopstock die „Salons“ des 18ten Jahrhunderts, in denen man sich über schöngeistige Dinge ebenso zu informieren versuchte wie über Physik. Im Jahr 1774 legte Friedrich Gottlieb Klopstock sein Werk „Die deutsche Gelehrtenrepublik 1“ vor. Es handelt sich dabei um die fiktive Verfassung einer Gemeinschaft von Gelehrten, in der das Volk nur als „Pöbel“ auftritt, und um die Beschreibung eines Landtages dieser Republik. Klopstocks Plädoyer für eine Befreiung der Gelehrten vom Broterwerb zeigt die Absurdität einer Gelehrtenrepublik in unserer Zeit und Welt. Von dem demokratischen Charakter einer Gelehrtenrepublik ist durch die Unterdrückung des Volkes nichts mehr geblieben, andererseits persifliert Klopstock die fehlende Einigungsbereitschaft der Gelehrten. So verständlich der Wunsch nach einer Staatsführung durch die wissenschaftliche und künstlerische Elite sein mag – er ist unrealistisch und war es schon zu Zeiten Klopstocks. Im 19ten Jahrhundert verblasste dieser Begriff, denn an Stelle der „literarisch“ Gebildeten traten durch die umfassenden Entwicklungen in Physik, Chemie, Mathematik mehr und mehr die naturwissenschaftlich gebildeten Kreise in den Vordergrund. So ging der Begriff der „Gelehrtenrepublik“ verloren, um in unseren Tagen in Form des Begriffes „scientific community“ wieder aufzuerstehen. Diese „Gemeinschaft der Wissenschaftler“ strebt allerdings nicht mehr nach der Idee einer eigenen Republik. In neuerer Zeit, 1957, hat der Schriftsteller Arno Schmidt die Idee der Gelehrtenrepublik 2 noch einmal aufgegriffen und nach einer fast völligen Vernichtung der Erde eine schwimmende künstliche Insel beschrieben, auf der erstrangige Wissenschaftler des Westens und des Ostens in zwei getrennten Republiken leben. Auf diese Weise gelingt ihm eine satirische Überspitzung der 14 Richard Dedekind und seine Beziehungen in der Gelehrtenrepublik Folgen des kalten Krieges. Interessanterweise taucht die „Gelehrtenrepublik“ bei Schmidt noch einmal in einem anderen Zusammenhang auf 3 , und zwar in dem Rundfunkdialog „Das schönere Europa. (Zur Erinnerung an die erste große wissenschaftliche Gemeinschaftsleistung unseres Kontinents, den Venusdurchgang von 1769.)“. Es geht dort um die Expedition zur Beobachtung des Venusdurchgangs im Jahr 1769. Eine Gruppe von Wissenschaftlern hatte sich auf den beschwerlichen einjährigen Weg gemacht, um mit Hilfe des Venusdurchgangs die Entfernung von Erde und Sonne zu messen. Schmidt schreibt 4: ... ausgerechnet in den entferntesten Teilen des Globus waren die wichtigsten Beobachtungsstationen erwünscht; und damals f log man noch nicht in 4 Stunden im Düsenbomber über den Atlantik! Aber es gelang den vereinten Anstrengungen der europäische Gelehrtenrepublik – vor allem eben unter Hinweis auf die zu erwartenden praktischen Ergebnisse – die Unterstützung der Regierungen oder finanzkräftiger Privatleute zu gewinnen. Und weiter 5: Aber einmal wenigstens war man doch, und auf‘s Erhabenste, einig gewesen: Siebzehnhundertneunundsechzig! ... Am dritten Juni! Der Begriff der Gelehrtenrepublik wird hier also in moderner Zeit wieder in einem positiven Sinne verwendet: Die „Gemeinschaft der Wissenschaftler“ unternimmt eine Expedition, deren Ziel Erkenntnis ist. Wir wollen „Gelehrtenrepublik“ im Zusammenhang mit Dedekind in einem dualen Sinn verstehen: Zum einen werden wir seine Rolle in der (kleinen!) Gemeinschaft der deutschen Mathematiker beleuchten, zum anderen aber auch seine Stellung in der Braunschweiger Bürgergesellschaft und innerhalb gebildeter Kreise, in denen er sich bewegte. Jugend und Studium Richard Dedekind ist das jüngste Kind eines Professors der Rechtswissenschaften am Braunschweiger Collegium Carolinum, Julius Levin Dedekind, und wird somit in eine bürgerliche Bildungsfamilie hinein geboren. Drei ältere Geschwister – Julie, Mathilde und Adolf – leben mit ihren Eltern in der Dienstwohnung des Vaters im Collegium Carolinum. Der Vater hat eine ärmliche Kindheit und beschwerliche Jugend hinter sich gebracht, aber Dedekinds Mutter stammt aus der in Braunschweig berühmten Familie der Emperius. Dieses Elternhaus sorgt dafür, die Kinder früh wissenschaftlichen und schöngeistigen Einf lüssen auszusetzen. Im Innenhof arbeiteten der Bildhauer Howaldt und der Maler Heinrich Brandes. Richard Dedekind hat das absolute Gehör und wird sein Leben lang die Liebe zur Musik bewahren; er wird sich als begnadeter Cello- und Klavierspieler einen Namen machen. Seine größte Liebe wird jedoch die Mathematik. Schon als Achtzehnjähriger unterrichtet er den zwölfjährigen Hans Zincke, genannt Sommer, den Stiefsohn des Gründers der Voigtländer-Werke und begründet eine lebenslange Freundschaft. Beide teilen sowohl die Liebe zur Mathematik, als auch zur Musik. Am 2. Mai 1848 trägt sich der 16-jährige Richard Dedekind in das Matrikelbuch des Collegium Carolinum ein. Das Collegium war keine Universität in heutigem Sinne, sondern Richard Dedekind und seine Beziehungen in der Gelehrtenrepublik Hans Zincke genannt „Sommer“ sollte auf den Besuch einer solchen vorbereiten. Ab 1850 finden wir den jungen Richard Dedekind in Göttingen. Er studiert nun Mathematik, während sein Bruder Adolf dort Jura studiert. Im Zuge der Revolution 1848 wird Adolf Mitbegründer der studentischen Verbindung Brunsviga. Im Jahr 1849 begeht der größte Mathematiker seiner Zeit, Carl Friedrich Gauß, in Göttingen sein 50-jähriges Doktorjubiläum. Diese Feier wird sicherheitshalber ganz im Stillen abgehalten, denn man befürchtet Störungen und Unruhen durch revolutionäre Kräfte. Carl Friedrich Gauß konnten, wurden sogar vom Prorector gezwungen, einen ihm zugedachten Fackelzug zu unterlassen. Übrigens soll er viele Decorationen, z.B. den Orden „Heinrich des Löwen“, sowie das Braunschweiger Ehren=Bürgerrecht erhalten. Adolf schreibt über das Ereignis an seinen Vater6: Richard Dedekind hört Vorlesungen 7 bei Moritz Abraham Stern, G.K.J. Ulrich, Wilhelm Weber, Johann Benedict Listing, Quintus Icilius, Benjamin Goldschmidt und bei Carl Friedrich Gauß. Bereits nach viersemestrigem Studium reicht Dedekind bei Gauß seine Doktorarbeit über sogenannte Eulersche Integrale ein. Er schreibt am 11. Juni 1852 in einem Brief an seine Schwester Julie 8: Das Gauß’sche 50jährige Doctor=Jubiläum ist ohne allen Prunk vorbei gegangen und die Studenten, die sich nicht einigen Mir ist am Anfang dieses Semesters auch noch ein Urtheil der Fakultät, namentlich von Gauss, über mich durch ein Mitglied 15 16 Richard Dedekind und seine Beziehungen in der Gelehrtenrepublik Friedrich Gustav Jacob Henle derselben, das ich nicht nennen darf, zugekommen, und das hat mich sehr angenehm gestimmt. Dedekind ist also schon früh dem alten Gauß aufgefallen und im Alter von 21 Jahren ist er bereits ein junger Doktor, und zwar der letzte Gaußsche Doktorsohn. So wird der Braunschweiger Dedekind der letzte wissenschaftliche Abkömmling des Braunschweigers Gauß. Höchst eindrucksvoll ist Dedekinds Bericht einer Gaußschen Vorlesung über die Methode der kleinsten Fehlerquadrate 9 . In der Göttinger „Gelehrtenrepublik“ findet Dedekind einen besonderen Platz bei dem Physiker Wilhelm Weber und in der Familie des Anatomen Friedrich Gustav Jacob Henle. Dedekinds Mutter schreibt in einem Brief vom 8. Mai 1853 10: Wilhelm Weber Nur bei Webers und Henles glaubt er fester Fuß gefasst zu haben. Bei den anderen hohen Personen (mit seinen eigenen Worten zu reden) wo er nur Visite macht, wenn er einmal förmlich eingeladen ist (stolz wie ein Spanier) – glaubt er sich nicht um seiner selbst willen geliebt ... Richard arbeitet an einer akademischen Karriere und bereitet seine Habilitation vor. Offenbar gab es durch Kränklichkeit von Gauß einige Verzögerungen, aber am 30. Juni 1854 schreibt er in einem Brief an seinen Vater 11, dass das zur Habilitation erforderliche Kolloquium erfolgreich bestanden sei. Dedekind ist nun Privatdozent an der Universität Göttingen und hat sich damit einen Platz in der Welt der Gelehrten gesichert, und zwar nicht nur durch seine mathematischen Leistungen, sondern auch durch die Musik, der er weiter mit großer Freude nachgeht. Richard Dedekind und seine Beziehungen in der Gelehrtenrepublik In der Göttinger Gelehrtenrepublik Seine ersten Schritte als Universitätslehrer verlaufen deprimierend. In seinem ersten „Colloquium“ sitzen ganze zwei Hörer, einer davon der Freund Hans Sommer, der inzwischen ebenfalls in Göttingen studiert. Jeder Hörer hatte ein Hörergeld zu entrichten, von dem die Privatdozenten zu leben hatten, so dass zwei zahlende Hörer den Magen sicher nicht füllen konnten. Besser sah es aus in der öffentlichen, aber kostenlosen, Vorlesung, die er zur gleichen Zeit anbietet und in der er 16 bis 18 Hörer zählt, darunter „alte Leute, Hannöversche Lieutenant’s mit Bärten“12 . Auch in den folgenden Jahren werden seine Vorlesungen nicht gut besucht. Im Jahr 1856 wissen wir von einer Vorlesung mit zwei Hörern (einer davon Hans Sommer) und von einer mit nur einem einzigen Hörer (Hans Sommer). Bei diesen kärglichen Einkünften verwundert es nicht, wenn Dedekind beim Herzog von Braunschweig Anträge auf einen Freitisch, d.h. kostenloses Mittagessen, stellte und gewährt bekam 13 . Im Winter 1856 hält er eine Epoche machende Vorlesung 14 zur modernen Algebra; es ist wohl die erste dieser Art überhaupt. Im Jahr 1855 war Gauß gestorben. Der Nachfolger wird Peter Gustav Lejeune Dirichlet, der für Dedekind prägend wird. War Gauß ein verschlossener Mensch, der ungern Vorlesungen hielt und keine Schule im eigentlichen Sinne auf baute, so zeigte Dirichlet an seinen Schülern und Mitarbeitern ein lebhaftes Interesse und förderte sie, wo es nur ging. Ab 1856 ist Dedekind fast ständig mit Dirichlet zusammen und lernt von ihm. Er schreibt über Dirichlet: „bei dem ich eigentlich erst recht zu lernen anfange“15 und wir dürfen uns durch- aus vorstellen, dass durch Dirichlet, der von Alexander von Humboldt 1827 nach Berlin geholt wurde und der auf zahllosen Gebieten der Mathematik bahnbrechende Arbeiten leistete, auch die Mathematik in Göttingen einen Schub der Erneuerung erfuhr. Zudem ist Dirichlet mit Rebecca Mendelssohn-Bartholdy verheiratet, einer Schwester von Felix Medelssohn-Bartholdy, und die Musik bestimmt das Privatleben der Dirichlets zu Dedekinds Freude ganz erheblich. Neben der Förderung, die er durch Dirichlet erhält, wird Dedekind ab 1856 durch den vier Jahre jüngeren Bernhard Riemann beeinflusst. Riemann, ein introvertierter Sohn eines protestantischen Geistlichen aus Breselenz bei Dannenberg, ist ein junges mathematisches Genie in Göttingen. Von 1846 bis 1847 studierte er Mathematik in Göttingen und ging dann nach Berlin, um seine Studien fortzusetzen – unter anderen auch bei Dirichlet. Im Jahr 1849 ist er wieder in Göttingen und arbeitet an seiner bahnbrechenden Dissertation über Funktionentheorie, mit der er 1851 promoviert wird. Im Jahr 1854 habilitiert er sich. Gauß, der das Thema des Habilitationsvortrages auswählte – „Über die Hypothesen, die der Geometrie zugrunde liegen“ – war tief beeindruckt. Riemann entwickelte hier eine Differentialgeometrie von Flächen in Räumen mit beliebiger Dimension, ohne auf die Einbettung der Flächen in diese Räume zurückzugreifen. Die beiden jungen Männer fühlten sich offenbar früh zueinander hingezogen. Am 3. November 1856 schreibt Richard Dedekind an seine Schwester Julie 16: Außerdem verkehre ich sehr viel mit meinem vortreff lichen Kollegen Riemann, der ohne Zweifel nach oder gar mit Dirich- 17 18 Richard Dedekind und seine Beziehungen in der Gelehrtenrepublik Gustav Lejeune Dirichlet let der tiefsinnigste Mathematiker ist und bald als solcher anerkannt sein wird, wenn seine Bescheidenheit ihm erlaubt, gewisse Dinge zu veröffentlichen, die allerdings vorläufig nur Wenigen verständlich sein werden. Es steht außer Frage, dass die beiden Männer gegenseitig das verwandte Genie erkannten: Hier Dedekind, der ruhige Durchdenker, der alle Zusammenhänge verstehen wollte, dort Riemann, das eher stürmische Genie, das Zwischenschritte gerne ausließ, um an ein Ziel zu gelangen. Aber Riemann geht es nicht gut. Von Geburt an kränklich, überarbeitet er sich nun in Göttingen bis hin zum Zusammenbruch, der 1857 eintritt. Der Freund Richard Dedekind sorgt für einen erholsamen Aufenthalt in Bad Harzburg im Schoß seiner Familie. Er schreibt am 13. August 1857 17: Bernhard Riemann Zunächst muß ich mich dahin entscheiden, das Zusammentreffen mit Euch in Harzburg aufzugeben. ... Statt meiner empfehle ich Euch für die wenigen Tage die beiden Herren Doctoren Riemann und Ritter; der erstere, von dem ich Euch soviel erzählt habe, ist jetzt sehr unglücklich; er ist den ganzen Sommer bis vor Kurzem in Bremen geblieben, um dort gewisse höchst bedeutende Arbeiten für den Druck zu vollenden; aber sein einsames Leben und dazu körperliche Leiden haben ihn im höchsten Grade hypochondrisch und misstrauisch gegen die Menschen und gegen sich selbst gemacht, wenn er auch äußerlich ganz freundlich erscheint. Er hat übrigens diese Arbeiten vollendet, und es steht zu hoffen, dass ein ruhiger Aufenthalt in Harzburg und ein harmloser Umgang mit Menschen sehr günstig Richard Dedekind und seine Beziehungen in der Gelehrtenrepublik auf ihn einwirken wird. ... Man muss alles auf bieten, um einen so vortreff lichen und wissenschaftlich höchst bedeutenden Menschen wie Riemann aus seinem jetzt höchst unglücklichen Zustand herauszureißen; ... Er hat hier die wunderlichsten Dinge gemacht, blos aus solchen Gründen, weil er glaubt, Niemand mag ihn leiden u.s.w. Die eigentlichen Arbeitsgebiete von Dedekind und Riemann waren grundverschieden. Dedekind zog es unter dem Einf luss von Dirichlet in die Zahlentheorie und Algebra, während Riemann an Fragen der mathematischen Analysis - Funktionentheorie, Differentialgeometrie - interessiert war. Trotzdem – oder gerade deswegen – sind die Göttinger Gespräche zwischen Riemann und Dedekind wohl entscheidend gewesen. Ohne Begriffsbildungen Riemannscher Prägung wäre Dedekind vermutlich nicht einer der Väter der Mengenlehre geworden. So benutzt Riemann das Wort „Mannigfaltigkeit“ für eine Menge von Punkten, die eine Fläche im Raum beschreiben. Diesen Begriff, den man in der Mathematik noch immer verwendet, benutzt auch Georg Cantor in den ersten Abhandlungen zur Mengenlehre für das, was wir heute „Menge von Punkten“ nennen. Riemann beschäftigte sich intensiv mit der Geometrie von Teilmengen in einem höherdimensionalen Raum; Cantor versuchte sich an der „Maßbestimmung“ solcher Gebilde. Als Dedekind auf Cantor traf 18 war Dedekind durch die revolutionären Ideen Riemanns sozusagen schon vorbereitet. Dedekind etabliert sich durch seine Arbeiten in der Göttinger Privatdozentenzeit aber nicht nur in Göttingen. Auch im zweiten großen Zentrum der deutschen Mathematik, Berlin, Georg Cantor wird sein Name mit Anerkennung genannt. Dort arbeitet Leopold Kronecker an ähnlichen Fragestellungen wie Dedekind (Algebra und Zahlentheorie) und steht im Briefwechsel mit ihm. Dieser schreibt am 3. Juli 1857 an seinen Vater 19: Mit meinem Berliner Rivalen Kronecker stehe ich im freundschaftlichsten Briefwechsel, und die Achtung, die er mir über meine Arbeiten ausdrückt, gefällt mir sehr; es sind jetzt auch einige von meinen Aufsätzen gedruckt, und ich hoffe, daß sie Beifall finden werden. Nicht zu vergessen ist Dedekinds Verankerung in der Göttinger Gesellschaft durch seine Liebe zur Musik. In seiner Privatdozentenzeit hat er über zahlreiche Gesellschaften, Musikfeste, Hausmusikabende und von Aus- 19 20 Richard Dedekind und seine Beziehungen in der Gelehrtenrepublik Leopold Kronecker f lügen berichtet. Er wird auch Mitglied im Göttinger Bildungsverein. Es ist schon fast tröstlich, wenn der hart arbeitende Dedekind am 26. Januar 1856 an die Schwester Julie schreibt 20, dass nach einem Herrendiner zu Ehren Dirichlets „noch immer der Champagner und unzählige andere Weine mit dem Verstande um die Oberherrschaft“ in ihm kämpfen. Er selbst kämpft derweil um etwas Ruhe und Zeit für die wissenschaftliche Arbeit, denn der Preis für die Mitgliedschaft in der Gelehrtenrepublik ist die wachsende Zahl der gesellschaftlichen Verpf lichtungen. Professor in Zürich Im Januar 1858 wurde eine Professur für Mathematik am Züricher Polytechnikum, der heutigen Eidgenössischen Technischen Hochschule, europaweit ausgeschrieben, worauf fast 50 Bewerbungen eingingen 21 . Unter den ersten Bewerbern waren Dedekind und Riemann. Dirichlet empfahl beide in einem Brief an den damaligen Schulratspräsidenten Karl Kappeler nachdrücklich, gibt aber Riemann „den ersten Rang“22 . Darauf hin reiste Kappeler selbst nach Göttingen, um sich die beiden Bewerber genauer anzusehen. Über Riemann schrieb er, er sei „zu stark in sich gekehrt, um zukünftige Ingenieure zu lehren.“, denn es galt nicht, zukünftige Mathematiker auszubilden, sondern das Polytechnikum war die Ingenieursschmiede der Schweiz. Kappelers Wahl fiel also auf Dedekind und man muss im Nachhinein die Menschenkenntnis und das sichere Urteilsvermögen dieses Schulratspräsidenten – heute würden wir Universitätspräsident sagen – bewundern. Schon am 21. April 1858 trifft Dedekind in Zürich ein – er ist nun vom Privatdozenten zum Professor aufgestiegen, allerdings nicht in einer Lebensstellung. Dedekinds Vorgänger am Polytechnikum, ein Professor Raabe, hatte sich 1857 aus gesundheitlichen Gründen entpf lichten lassen, hatte aber noch die Vorlesungen „Elemente der Differentialgleichungen“ (7-stündig) und „Integralrechnung mit Anwendung auf die Geometrie“ (2-stündig) angekündigt, die der Nachfolger nun halten muss. Dedekind beginnt damit am 26. April morgens um 6 Uhr. Einen guten Eindruck von seiner eigenen Einschätzung der Lehrtätigkeit gibt er in einem Brief an die Schwester Mathilde vom 27. Januar 1859 23: Ich kann auch nicht sagen, dass ich so ganz und gar glücklich mit meiner Schulmeisterei bin; von den mir überlieferten älteren Schülern will ich gar nicht sprechen, die sind zum grossen Theil verdorben; von meinen neuen ist ein Drittel ganz vorzüglich, Richard Dedekind und seine Beziehungen in der Gelehrtenrepublik schnell und er berichtet seiner Familie über vielfältige Kontakte. Gleichzeitig hält er den brief lichen Kontakt mit der Familie Henle in Göttingen aufrecht. Karl Kappeler ein anderes Drittel mässig gut, der Rest schwach, zum Theil erbärmlich. Meine Ideen von Freiheit, freier Entwicklung der Schüler sind radical vernichtet; so wie Österreich in Italien, so bin ich auch eine Zeit lang zu milde gewesen; die Schüler verstehen das nicht zu würdigen, es sind Kinder wie unsere Progymnasiasten, wenigstens in ihrem Benehmen. Jetzt genire ich mich gar nicht mehr, einen Übelthäter vor versammelter Menge so niederzudonnern, dass er zusammensinkt und Respect kriegt. Das hat eine sehr heilsame Wirkung. Aber ärgerlich ist es immer und mir zuwider. Neben diesen Klagen, die über alle Zeiten hinweg bis heute wohl immer gleich geblieben sind, fühlt sich Dedekind aber recht wohl in Zürich. Als Professor gelingt ihm die Aufnahme in die Zürcher Gelehrtenrepublik sehr Am 5. Mai 1859 stirbt Dirichlet im Alter von 54 Jahren an den Folgen eines Herzinfarktes. Dedekind wird davon durch einen Brief seines Freundes Riemann informiert. Dirichlet hat in seinem Vermächtnis Richard Dedekind eine noch nicht fertiggestellte Arbeit und ein Buch aus seiner mathematischen Bibliothek zum Andenken hinterlassen. Aber offenbar hat Riemann ganz vergessen, diese Dinge auch tatsächlich an Dedekind zu schicken. Erst zehn Wochen nach Dirichlets Tod kann Dedekind die Papiere und das Buch in Händen halten. Dedekind wird 1879 Dirichlets „Vorlesungen über Zahlentheorie“ herausgeben. Heute sind in in diesem Buch die „Supplemente“ berühmt, in denen Dedekind ganz entscheidend die algebraische Zahlentheorie und die Idealtheorie entwickelt. Es ist bezeichnend für den zurückhaltenden und bescheidenen Dedekind, dass er seine bahnbrechenden Entwicklungen nicht im Rahmen eines eigenen Buches publizierte, sondern dem Buch seines Lehrers und Freundes beigab. Am 25. Juli 1861 stirbt der Mathematikprofessor am Braunschweigischen Collegium Carolinum, August Wilhelm Julius Uhde, und Dedekind bewirbt sich auf die vakante Stelle in seiner Heimatstadt. Zurück in der Braunschweiger Gelehrtenrepublik Dedekind war offenbar in Zürich unzufrieden mit der Art der Mathematik, die er zu lehren hatte. Für einen tiefen Denker wie Dedekind, 21 22 Richard Dedekind und seine Beziehungen in der Gelehrtenrepublik der sich mit Fragen der abstrakten Algebra, der Zahlentheorie und mit dem Auf bau des Zahlensystems beschäftigte, muss es wie eine Strafe gewesen sein, für mehr oder weniger unwillige Ingenieurstudenten die eher niedere Mathematik zu lesen und sich in unzähligen Prüfungen zu verzehren. Daher ist es nicht verwunderlich, dass er sich bei der Bewerbung um Uhdes Stelle ausbedungen hatte, sich nicht um die niedere Mathematik kümmern zu müssen. Durch diese Forderung gab es wohl eine Verzögerung bei seiner Berufung, denn Dedekinds Tante Minna von Wolffradt schreibt in einem Brief vom 13. Oktober 1861 24: Hoffentlich ist die Unentschiedenheit wegen Richards Anstellung ausgeglichen – ich bin ihm beinah etwas böse, dass er so eigen ist, und nicht allenfalls etwas niedere Mathematik lehren will – um hier zu bleiben, wo er so viele Herzen dadurch erfreuen würde – Wilhelm hatte mir schon von dieser Klausel, die er gemacht, gesagt, der es von Zimmermann gehört. Wenn also davon gesprochen wird, so ist es nicht durch mich geschehen. Hoffentlich ist die Sache aber nicht von Belang und wir hören bald, daß der liebe Herr Professor gern und auf seine eigenen Bedingungen hier bleibt. Schließlich lässt sich alles zur Zufriedenheit Dedekinds regeln: Ostern 1862 nimmt er von Zürich Abschied und nimmt seine Tätigkeit als Professor am Collegium Carolinum auf. Bereits 1863 erhält er einen ehrenvollen Ruf nach Hannover – in der Republik der Mathematiker galt der Name Dedekind zu dieser Zeit etwas. Weitere Rufe werden folgen – immer wird Dedekind ablehnen und bis zu seinem Tod 1916 in Braunschweig bleiben. Dedekind beteiligt sich an der Herausgabe der Gaußschen Werke und kann so bei Reisen nach Göttingen alte Bekanntschaften auffrischen. Auch die Göttinger Freunde schauen von Zeit zu Zeit bei Dedekind herein, der nun mit seinem Bruder Adolf in einer Wohnung am Hagenmarkt lebt. Leider kommt es zwischen Dedekind und Ernst Schering, einem ebenfalls an der Herausgabe der Gaußschen Werke beteiligten Göttinger Mathematiker, zu Verstimmungen, über die wir bis heute nichts Näheres wissen. Anfang 1864 zieht sich Dedekind jedenfalls wegen dieser Verstimmungen von der Herausgebertätigkeit zurück. Aus den vorliegenden Briefen 25 scheint sicher, dass Schering einen Streit mit Dedekind vom Zaun gebrochen hat, der sich noch Jahrzehnte später keines Verschuldens bewusst war. Nach dem Tod des Vaters 1872 bezieht Dedekind ein Haus am heutigen Inselwall gemeinsam mit seiner Mutter und der Schwester Julie, die beide die Dienstwohnung im Collegium Carolinum räumen mussten. Ab 1894 lebt er dann mit seiner Schwester Julie in der ersten Etage eines Hauses in der heutigen Jasperallee. Da die technischen Fächer eine immer größere Rolle spielten, wurde das Collegium Carolinum 1878 in die Herzogliche Technische Hochschule Carolo-Wilhelmina überführt, nachdem der Neubau an der Pockelsstraße (der heutige Altbau) am 16. Oktober 1877 feierlich eingeweiht werden konnte. Von 1872 bis 1875 fungierte Richard Dedekind als Direktor der Hochschule und als Vorsitzender der Baukommission für den Neubau, den er maßgeblich mitbestimmt hat. Es liegt nun nahe, Richard Dedekinds Rolle in der Braunschweiger Gesellschaft als Richard Dedekind und seine Beziehungen in der Gelehrtenrepublik eine allgemein anerkannte und von den meisten Braunschweigern respektierte Autorität zu verklären. Nach den uns bekannten Ereignissen, die sich in den in Wäschekörben gefundenen Briefen der Familie widerspiegeln, sah die Realität aber anders aus. Dedekind war zumindest im letzten Drittel seines Lebens offenbar in der Braunschweiger Gesellschaft aus politischen Gründen isoliert. Das hing mit dem überall in Deutschland auff lackernden Nationalismus zusammen, den man nach der Thronbesteigung von Kaiser Wilhelm II. im Jahr 1888 durchaus als „Preußifizierung“ bezeichnen kann. Die Familie Dedekind war aber den braunschweigischen Welfen zugewandt, und 1897 kam es in Braunschweig zu einem Eklat, der die beiden Brüder Richard und Adolf Dedekind direkt betraf. Welfisch engagierte Braunschweiger pf legten in zwei Parteien organisiert zu sein, der Braunschweigischen Welfenpartei bzw. der Braunschweigischen Landesrechtspartei 26 . Im Jahr 1897 wurde durch das Braunschweigische Ministerium allen Beamten und Offizieren des Landes Braunschweig per Dekret verboten, Mitglied in einer dieser Parteien zu sein. Landesgerichtspräsident Adolf Dedekind, der Bruder unseres Richard, hält einen solchen Eingriff für nahe am Hochverrat und äußert dies auch öffentlich, worauf hin eine bevorstehende Ordensverleihung an ihn gestrichen wird. Adolf Dedekind ist nun massiv unter Druck und damit seine ganze Familie. Einer der Söhne übernimmt die Verteidigung des Vaters, gegen den nun ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird. Es besteht kein Zweifel, dass auch der Bruder Richard eindeutig auf der welfischen Seite seines Bruders zu finden war. Erst etwa 25 Jahre später bezieht die Zeitung Volksfreund Stellung zu den Ereignissen und schreibt 27 : Es gehörte immerhin ein persönlicher Mut dazu, in Braunschweig für das damals verpönte Welfenhaus gegen die Regierungsmänner der Regentschaft und die hinter ihr stehende preußische Regierung in Berlin aufzutreten. Diesen Mut haben die Dedekinds aufgebracht ... Wir wollen an dieser Stelle den Vorgängen nicht im Einzelnen nachgehen, obwohl eine genauere Analyse sicherlich lohnenswert wäre; so schlägt ein Gedicht der Schwester Julie Dedekind, in dem das Welfenhaus verteidigt wird, selbst im Braunschweigischen Landtag hohe Wellen. Für uns bleibt an dieser Stelle nur festzuhalten, dass Richard Dedekinds Stellung in der Braunschweiger Gelehrtenrepublik gerade zum Ende seines Lebens hin sicher nicht einfach war. Sein gesellschaftlicher Umgang wird sich ganz wesentlich auf die Familie und auf die welfisch gesinnten Kreise in Braunschweig beschränkt haben, was ihm andererseits aber sicher auch mehr Zeit für seine mathematischen Forschungen ließ. Epilog Richard Dedekind ist als Schöpfer großer Teile der modernen Mathematik in vielen Gelehrtenrepubliken zu Hause gewesen. Unter den Mathematikern war er früh anerkannt und seine zahlreichen Rufe an auswärtige Universitäten belegen die Wertschätzung, die man seinen Leistungen zumaß. Er war mit einigen der größten Mathematiker des 19ten Jahrhunderts wie Dirichlet, Cantor und Riemann gut befreundet; Gauß war sein akademischer Lehrer. Auch in der Gelehrtenrepublik der Künstler war er durch seine Liebe zur Musik kein Unbekannter. Am 12. Februar 1916, mitten im ersten Weltkrieg, stirbt er hochbetagt 23 24 Richard Dedekind und seine Beziehungen in der Gelehrtenrepublik in Braunschweig. Da er sich geweigert hatte, ein „Intellektuellenmanifest“ zu unterzeichnen, in dem die Greuel deutscher Soldaten in Belgien verharmlost und die Schuld am Ausbruch des Krieges den Alliierten Frankreich und England zugeschoben werden sollten, erscheint am 14. März 1916 eine Würdigung Dedekinds aus Anlass seines Todes von der Pariser Akademie der Wissenschaften – noch vor jeder Ehrung aus seinem Heimatland. n Seite 13 1 Friedrich Gottlieb Klopstock: Die deutsche Gelehrtenrepublik. Erster Theil. Hamburg 1774. 2 Arno Schmidt: Die Gelehrtenrepublik. Kurzroman aus den Roßbreiten. 15te Auflage, Fischer Verlag 2004. Seite 14 3 Den Hinweis auf diese Textstelle verdanke ich Herrn Manfred Zieger, dem ich dafür herzlich danke. 4 Arno Schmidt: Bargfelder Ausgabe Werkgruppe II Dialoge, Band 1, Bargfeld (Arno-Schmidt-Stiftung), Zürich (Haffmans Verlag), S. 269, 1990. 5 ebenda S.274. Seite 15 6 Ilse Dedekind: Unter Glas und Rahmen. Briefe und Aufzeichnungen 1850-1950. Ein Jahrhundert aus der Sicht einer Braunschweiger Familie. S. 74, Appelhans Verlag 2000. 7 Karl Gerke, Heiko Harborth: Zum Leben des Braunschweiger Matehmatikers Richard Dedekind. S. 659, Städtisches Museum Braunschweig 1981. 8 I. Dedekind: a.a.O. S.76. Seite 16 9 Hans Wußing: Carl Friedrich Gauß. S. 83, BSB B.G. Teubner Verlagsgesellschaft 1982. 10 ebenda S. 77. 11 ebenda. Seite 17 12 ebenda S. 78. 13 in: Winfried Scharlau (Hrsg.): Richard Dedekind 1831-1981. Vieweg Verlag 1981. 14 ebenda. 15 I. Dedekind: a.a.O. S.81. 16 ebenda S.82. Seite 18 17 ebenda S.82f. Seite 19 18 siehe den Beitrag zur Mengenlehre in diesem Band 19 I. Dedekind: a.a.O. S.83. Seite 20 20 ebenda 21 Die geringe Zahl der Bewerbungen bei einer europaweiten (!) Ausschreibung ist heute kaum noch nachvollziehbar, wo man auf die lokale Ausschreibung einer weit unbedeutenderen Stelle bereits 50 und mehr Bewerbungen erhält. Die Zahlen sind aber belegt, vergl. Max-Albert Knus, Winfried Scharlau: Einleitung zu Dedekinds Vorlesung über Differential- und Integralrechnung, in: Richard Dedekind: Vorlesung über Differential- und Integralrechnung. S.9, Vieweg Verlag 1985. 22 ebenda. 23 ebenda S.331. Seite 22 24 I. Dedekind: a.a.O. S.116. 25 ebenda S.128f. Seite 23 26 ebenda S.233. 27 ebenda S.235. 25 Relief von Richard Dedekind an der Fassade der Technischen Universität in der Pockelsstraße 4, gestaltet von Jürgen Weber Foto: Rainer Löwen 26 ΕUDOXOΣ EUKLΕΙDΗΣ DEDEKIND 27 Eudoxos, Dedekind und Cantor: Die Geburt des heutigen Zahlbegriffs Prof. Dr. Rainer Löwen, TU Braunschweig I n d e r H a u p t s a c h e sind es zwei Dinge, durch die sich Richard Dedekind als Mathematiker unsterblich gemacht hat. Das eine ist die Theorie der (mathematischen) „Ideale“, in dieser Gedenkschrift in einem eigenen Abschnitt behandelt, und das andere ist die Vollendung des modernen Zahlbegriffs, des Begriffs der „reellen Zahlen“. Dieser Leistung Dedekinds und ihrer mehr als tausendjährigen Vorgeschichte wollen wir uns in diesem Abschnitt was im folgenden dargestellt werden soll, komplett unverständlich. Die Zahlenwelt des Rechners ist diskret (sie macht Sprünge), hier geht es um eine kontinuierliche Veränderbarkeit der Zahlen. Im Jahre 1872 erschien im Braunschweiger Verlag Friedr. Vieweg & Sohn (dessen damaliger Sitz heute das Braunschweigische Landesmuseum beherbergt) Dedekinds Schrift „Stetigkeit und irrationale Zahlen“, zuwenden. Dabei soll beleuchtet werden, woher die Probleme kommen, die durch Dedekind gelöst wurden, was er an Lösungsansätzen aus der Vergangenheit vorgefunden hat, wie er durch einen entscheidenden Dreh zum endgültigen Durchbruch gelangt ist, und was seine Konkurrenten mehr oder weniger zur gleichen Zeit gemacht haben. Schließlich soll auch angedeutet werden, wie es nach Dedekind weitergegangen ist mit der Entwicklung des Zahlbegriffs, denn etwas endgültiges (wie ich es eben suggeriert habe) gibt es in der Mathematik nicht. Bevor wir einsteigen können, ist eine Warnung unbedingt erforderlich. Sie richtet sich an diejenigen, deren Denkwelt durch den Gebrauch von (Taschen-)rechnern geprägt ist. Um eine reelle Zahl anzugeben, benötigt man unendlich viele Nachkommastellen. Ein Rechner kann nur endlich viele Stellen verarbeiten. Daher kennt ein Rechner prinzipiell nicht den Begriff der reellen Zahl, um den es hier gehen wird. Für die Mathematik ist dieser Begriff aber unentbehrlich. Als denkender Mensch muß man sich also von der Beschränktheit der Rechner emanzipieren! Ansonsten wird alles, ein schmales Bändchen von nur 24 Seiten. Im Vorwort berichtet der Autor über die Entstehungsgeschichte und sagt: „Die Betrachtungen, welche den Gegenstand dieser kleinen Schrift bilden, stammen aus dem Herbst des Jahres 1858. Ich befand mich damals als Professor am eidgenössischen Polytechnikum zu Zürich zum ersten Male in der Lage, die Elemente der Differentialrechnung vortragen zu müssen, und fühlte dabei empfindlicher als jemals früher den Mangel einer wirklich wissenschaftlichen Begründung der Arithmethik 1 . Bei dem Begriffe der Annäherung einer veränderlichen Größe an einen festen Grenzwerth und namentlich bei dem Beweise des Satzes, daß jede Größe, welche beständig, aber nicht über alle Grenzen wächst, sich gewiß einem Grenzwerth nähern muß, nahm ich meine Zuf lucht zu geometrischen Evidenzen.“ Dabei muß man sich vor Augen halten, daß die Züricher Studenten wohl künftige Ingenieure waren, und daß Ingenieurstudenten naturgemäß und mit Recht nicht in erster Linie an den gedanklichen Grundlagen der Ma- 28 Eudoxos, Dedekind und Cantor: Die Geburt des heutigen Zahlbegriffs thematik, sondern an anwendbaren Rechenverfahren interessiert sind. Um diesem Publikum eben jene für seine Bedürfnisse gemachte „höhere Mathematik“ befriedigend zu erklären, fehlte Dedekind und seinen Zeitgenossen, wie er feststellte, immer wieder eine ganz bestimmte wesentliche begriff liche Grundlage, etwas, worauf man sich hätte berufen müssen, was aber nicht da war. Es handelt sich dabei um etwas ganz Unauffälliges, dessen immense Bedeutung keineswegs auf den ersten Blick ersichtlich ist. Wir wollen daher den knappen Hinweisen von Dedekind an dieser Stelle etwas nachgehen und erläutern, was es auf sich hat mit dem im obigen Text (von mir) hervorgehobenen „Satz, daß jede Größe, …. sich gewiß einem Grenzwerth nähern muß“ und wozu man diesen Satz denn braucht. Quadratwurzeln und das Supremumsprinzip. Dazu (und nur dazu) will ich ein etwas handgestricktes Verfahren schildern, das die Berechnung der Quadratwurzel einer reellen Zahl erlaubt (es ist angeregt durch ein von Isaac Newton stammendes, viel professionelleres Verfahren). Wir denken uns eine Zahl c größer als 4 gegeben und suchen eine Quadratwurzel dazu, also eine Zahl b mit b2 = c. Wir wollen uns dem gesuchten b schrittweise nähern und beginnen, indem wir die ganzen Zahlen 1,2,3,… durchprobieren und die größte nehmen, deren Quadrat nicht größer ist als c; wir nennen sie a. Dann ist also 4 < c; 1 < a; a2≤ c; (a + 1)2 > c. Die gesuchte Zahl sollte also die Form b = a + x haben mit einem x zwischen 0 und 1. Wir wollen (a + x)2 = a2 + 2ax + x2 = c haben, aber diese Gleichung ist eher schwerer zu lösen als b2 = c, deshalb vereinfachen wir sie (zunächst noch ohne Rechtfertigung, warten Sie etwas ab!) zu a2+ 2ay +ay = c. Im Gegensatz zu x läßt sich dies y leicht berechnen, aber was ist es wert? Nun, schauen wir uns das einmal an. Die Gleichung für y zusammen mit der ausmultiplizierten Ungleichung a2 + 2a + 1 = (a + 1)2 > c ergibt a2 + 2a + 1 > a2+ 2ay + ay, woraus nach Subtraktion von a2 folgt 2a + 1 > 2ay + ay > 2ay + y (am Schluß haben wir noch a > 1 benutzt). Division durch die positive Zahl 2a + 1 ergibt y < 1; mit 1 < a zusammen haben wir 0 < y2< ay und somit 0 < ay – y2< ay. Nun vergleichen wir einmal a2 mit dem Quadrat von a’ = a + y. Wir haben c = a2+ 3ay (hierdurch haben wir y ja eingeführt), und somit c – (a + y)2= a2+ 3ay – (a2+ 2ay + y2) = ay – y2. Das bedeutet aber, dass der Abstand von (a’)2 zu c gleich ay – y2ist, und von dieser Zahl hatten wir gesehen, daß sie zwischen 0 und ay liegt, also höchstens ein Drittel des Abstandes von c und a2 ausmacht, welcher ja genau 3ay beträgt. Mit anderen Worten: das Quadrat von a’ ist zwar immer noch nicht gleich c, aber es liegt nicht mehr so sehr daneben wie das Quadrat von a. Wiederholen wir diese Prozedur unendlich oft, so erhalten wir eine Folge von Zahlen b1 = a, b2 = a’, b3 = a’’, ... .., deren Quadrate dem Ziel c immer näher kommen, sie konvergieren gegen c: limn bn2 = c. Das sieht schon sehr verführerisch aus, aber jetzt kommt Dedekinds Problem: Können wir aus der zuletzt gemachten Feststellung den Schluß ziehen, daß die Zahlen bn selbst konvergieren, und daß ihr Grenzwert b die Eigen- Eudoxos, Dedekind und Cantor: Die Geburt des heutigen Zahlbegriffs schaft b2= c hat, womit sich b als Quadratwurzel qualifizieren würde? Ist also wirklich, wie wir vermuten, _ lim n bn = √ c ?? Die Antwort auf diese Frage ist ja, aber um so zu schließen, brauchen wir den Satz von den beständig, aber nicht über alle Grenzen wachsenden Größen, von dem Dedekind spricht: Jedes bn ist größer als sein Vorgänger in der Folge, und alle sind kleiner als c, also gibt es den Grenzwert b; auch um die Gleichung b2 = c zu begründen, muß man allerdings noch einmal argumentieren, dazu später mehr. Der besagte Satz heißt heute das Supremumsprinzip, und daß dieses Prinzip für reelle Zahlen gilt und eine fundamentale Aussage über sie macht, ist die eigentliche Erkenntnis und das Anliegen Dedekinds. Das Unendliche im Endlichen. Nun versuchen Sie bitte einmal, sich die Folge der Zahlen bn aus der obigen Überlegung bildlich vorzustellen. Dazu benutzen wir die zu Dedekinds Zeiten längst übliche Vorstellung, daß die Zahlen auf einer Geraden angeordnet liegen, und zwar liegt eine positive Zahl d im Abstand d rechts von einem willkürlich gewählten, mit 0 bezeichneten Bezugspunkt, und die negative Zahl –d liegt im gleichen Abstand links von 0. –d 0 d b1 b2 b3 b4 _ √ c c  Wir haben unendlich viele Zahlen bn . Sie werden ständig größer (sie rücken weiter nach rechts), bleiben aber alle unterhalb einer festen Schranke c. Welche Alternative gibt es denn zu der gewünschten Eigenschaft, daß solche Zahlen einem Grenzwert zustreben? Die Anschauung sagt, daß sie aus Platzgründen immer enger zusammenrücken müssen, und wenn an der Stelle, wo das passiert, keine Zahl ist, dann hat die Gerade an dieser Stelle ein Loch, ein schwarzes Loch gewissermaßen, das unsere Zahlen bn für großes n verschlingt. Woher wissen wir also, daß das nicht passiert? Das ist Dedekinds Problem. Wohlgemerkt, es handelt sich hier nicht um eine Frage über die wirkliche Welt, denn weder Zahlen noch die Punkte einer Geraden finden in der wirklichen Welt statt, es sind vielmehr Abstraktionen unseres Geistes, begriff liche Schöpfungen des Menschen. Die Antwort auf die Frage, ob die Gerade Löcher hat oder nicht, kann also nur dadurch gegeben werden, daß man den Zahlbegriff in einer Weise präzisiert, die zu einer definitiven Entscheidung unserer Frage führt. Mit anderen Worten, der Mathematiker muß selbst entscheiden, ob er eine Zahlengerade mit oder ohne Löcher haben will. Dedekind erkennt und benennt dies mit der für ihn typischen Klarheit, wenn er sagt 2: Und wüßten wir gewiß, daß der Raum unstetig 3 wäre, so könnte uns doch wieder nichts hindern, falls es uns beliebte, ihn durch Ausfüllung seiner Lücken in Gedanken zu einem stetigen zu machen; diese Ausfüllung würde aber in einer Schöpfung von neuen Punct-Individuen bestehen ... Das hört sich verführerisch einfach an, man füllt einfach die Lücken aus, wenn welche da sind, ist es aber nicht. Zuerst ist die Frage, woran erkennt man, wo Löcher sind? Wie spricht man einzelne von ihnen an? Womit füllt man sie aus? Wie garantiert man, daß man beim Ausfüllen alter Löcher keine neuen reißt? Wie arbeitet man mit dem schließlich 29 30 Eudoxos, Dedekind und Cantor: Die Geburt des heutigen Zahlbegriffs entstehenden Zahlsystem, ist es überhaupt handhabbar, kann man damit rechnen? Fragen über Fragen! Um weiterzukommen, müssen wir weit ausholen und die Vorgeschichte seit der Antike, die Dedekind natürlich bestens bekannt war, in einem zwangsläufig etwas f lüchtigen Durchgang vorstellen. Daß hier etwas Unheimliches vorgeht, wenn unendlich viele Zahlen auf endlichem Raum Platz finden, haben zuerst die Griechen der Antike bemerkt, namentlich Zenon von Elea (etwa 490 bis 430 v.u.Z, Bild siehe im Abschnitt über das Unendliche), von dem uns das Paradox von Achill und der Schildkröte überliefert ist, das in dieser Gedenkschrift im Beitrag über die Bändigung des Unendlichen (S. 85 ff) noch einmal auftritt. Der für seine Schnelligkeit berühmte Achill tritt gegen die Schildkröte zum Wettrennen an. Fairerweise gibt er ihr einen Vorsprung, sagen wir 100 Meter. Nehmen wir an, Achill brauche 10 Sekunden für diese 100 Meter, aber die Schildkröte ist die schnellste unter ihren Artgenossen und schafft in den 10 Sekunden 10 Meter. Nach einer weiteren Sekunde ist Achill an dieser Stelle angekommen, aber auch die Schildkröte hat schon wieder 1 Meter zurückgelegt. Achill macht das 1 in __ Sekunde wett, nur um zu sehen, daß die 10 Schildkröte immer noch einen Vorsprung hat, 1 der jetzt __ Meter beträgt. Wie man sieht, kann 10 Achill die Schildkröte nicht einholen, weil beim Zurücklegen des alten Vorsprungs immer ein neuer entsteht. Jede der eben betrachteten Stationen des Wettlaufs findet zu einem Zeitpunkt statt, der als endliche Teilsumme der unendlichen Summe  1 1 1 10 + 1 + __ + ___ + ____ + ... 10 100 1000 angegeben werden kann. Dies entspricht ex- akt der Situation in unseren Betrachtungen zum Wurzelziehen, wo wir die unendliche Summe a + y1 + y2 + y3 + ... antrafen, auf deren endliche Teilsummen bn das Supremumsprinzip paßt; ebenso ist es auch hier, und aus heutiger Sicht ist es so, daß das Supremumsprinzip uns für die Folge der Achill-Zahlen einen endlichen Grenzwert (nämlich die Zahl 11,111111…, unendlich viele Einsen hinter dem Komma) liefert, und genau zu diesem Zeitpunkt sind Achill und die Schildkröte exakt gleichauf; danach gewinnt Achill einen Vorsprung. Für die alten Griechen war dieses Auftreten des Unendlichen im Endlichen extrem beunruhigend, aber ihre ungeheure Leistung ist, daß sie es erstens bemerkt haben und zweitens überaus konstruktiv auf die Beunruhigung reagiert haben, nämlich indem sie eine außerordentlich aufwendige Untersuchung über den Zahlbegriff und über die Geometrie der Strecken auf einer Geraden angestellt haben. Davon soll im nächsten Abschnitt die Rede sein. Euklid und die Proportionenlehre des Eudoxos. Die Erfahrung mit Zenons Paradox hatte die griechischen Mathematiker äußerste Vorsicht gelehrt; sie wußten, daß allzu naßforsche mathematische Argumente sehr schnell in eine Aporie, d.h. in die Ausweglosigkeit, führen konnten. Daher bestanden sie darauf, eine strenge Trennung zwischen den Begriffen Zahl und Länge (von Strecken) durchzuhalten; dabei waren Zahlen nur die zum Zählen geeigneten, also 2, 3, 4 und so weiter. Schon die Einbeziehung der Eins war nicht selbstverständlich, an eine Zahl 0 war nicht zu denken, Eudoxos, Dedekind und Cantor: Die Geburt des heutigen Zahlbegriffs ganz zu schweigen von negativen Zahlen. Außerdem wurden mathematische Argumente nur akzeptiert, wenn sie auf wenigen klar formulierten Grundlagen (Axiomen) fußten und jeder kleine Gedankenschritt mit größtmöglicher Strenge durchgeführt war. Euklid von Alexandria (etwa 360 –300 v.u.Z.) hat in einer in 13 „Bücher“ gegliederten Enzyklopädie mit dem Titel Elemente das mathematische Wissen seiner Zeit festgehalten. In Buch V, etwa aus dem Jahre 325, stellt er die Proportionenlehre seines älteren Kollegen Eudoxos von Knidos (etwa 410 – 350 v.u.Z.) dar. Es geht dabei um eine Art von „Rechnen“ mit Streckenlängen, das ausschließlich auf geometrischen Überlegungen beruht und daher als gut gefeit gegen unerwartete Aporien gelten konnte. Wie wir sehen werden, hat Eudoxos diese Streckenrechnung zu solcher Reife gebracht, daß man sich schon große Mühe geben muß, um zu erkennen, daß er Dedekinds Leistung nicht etwa vorweggenommen hat. Bei all dem darf man nie vergessen, daß die Griechen dieses Niveau des Denkens um des Denkens willen ohne ebenbürtige Vorläufer in sehr kurzer Zeit erreicht haben. Zunächst muß klar gesagt werden, daß die Proportionenlehre ohne eine Definition des Begriffs der Länge von Strecken auskommt; nur der Begriff der Strecke ist nötig. Er ist durch die Axiome der Geometrie abgesichert. Nun ist zunächst zu klären, wann zwei Strecken als gleichlang (oder, kurz gesprochen, als gleich) anzusehen sind --- nämlich dann, wenn man sie durch Verschieben und nötigenfalls Drehen der einen Strecke zur völligen Deckung bringen kann. Nun kann man Strecken addieren (d.h., längs einer Geraden aneinandersetzen), und man kann eine kürze- re von einer längeren abziehen. Das Resultat ist jeweils wieder eine Strecke. Nun ist klar, dass man auch sinnvoll von der doppelten, dreifachen, vierfachen Strecke und so weiter sprechen kann. Bezeichnen wir Strecken einfach indem wir die Namen ihrer Endpunkte nebeneinander schreiben, etwa AB, und ist n eine der natürlichen Zahlen 1,2,3,…, so wollen wir das n-fache der Strecke AB mit nAB bezeichnen. Kommensurable Streckenpaare. Dies genügt offensichtlich noch nicht, um zwei beliebige Strecken der Länge nach vergleichen zu können. Zum Beispiel könnte das Verhältnis der Längen, in heutiger Ausdrucksweise gesagt, ein Bruch sein, 2_3 zum Beispiel. Diese Situation wird bei Eudoxos durch den Begriff der kommensurablen Streckenpaare erfaßt. Zwei Strecken AB und CD heißen kommensurabel, wenn sie ein gemeinsames Vielfaches haben, wenn es also Zahlen m und n gibt, derart, daß nAB = mCD ist. Die folgende Figur zeigt das Beispiel 2AB = 3CD: A B C D  U V Die Figur zeigt außerdem, daß es eine dritte Strecke UV gibt, von der beide gegebenen Strecken Vielfache sind; es ist nämlich AB = 3UV 31 32 Eudoxos, Dedekind und Cantor: Die Geburt des heutigen Zahlbegriffs und CD = 2UV. Dies ist der Grund, warum die gegebenen Strecken kommensurabel heißen: sie haben das gemeinsame Maß UV. Wählt man dieses Maß als Grundeinheit, so kann man beide Strecken durch ganze Zahlen (hier 2 und 3) beschreiben. Das ist nicht nur bei diesem Beispiel so. Um zunächst ein weiteres Beispiel zu betrachten, nehmen wir an es sei 3AB = 5CD; dann kann man die Strecke CD verdoppeln und davon die Strecke AB abziehen, um ein gemeinsames Maß UV zu erhalten (probieren Sie es aus!). Allgemein gilt für ein Streckenpaar mit nAB = mCD, daß es ein gemeinsames Maß UV gibt, und daß AB = mUV sowie CD = nUV ist. Um das so allgemein einzusehen, benutzt Euklid das Verfahren der Wechselwegnahme, das heute noch jeder Mathematikstudent im ersten Semester in algebraischem Gewand und unter der Bezeichnung Euklidischer Algorithmus kennenlernt. Wir neigen dazu, den Sachverhalt nAB = mCD sofort mit unserer heutigen Interpretation zu versehen. Wir bleiben nicht wie Eudoxos und Euklid dabei stehen, zu sagen, dass die Strecke AB sich zur Strecke CD verhält wie die Zahl m zur Zahl n; wir wollen gleich den weiteren Schritt machen und sagen, daß dies Verhältnis wieder durch eine Zahl ausgedrückt wird, nämlich durch den Bruch m __n . Es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, das Euklid aus Sicherheitsgründen nicht wagen kann und darf einen solchen Schritt zu tun. Proportionen sind für ihn keine Zahlen, sondern Verhältnisse zwischen zwei Strecken oder allenfalls zwischen zwei Zahlen. So etwas wie unsere Brüche hatte er einfach nicht! Stattdessen betrachten Eudoxos und Euklid die Proportionen als selbständige neue Objekte ihres Denkens. Ein kommensurables Streckenpaar mit nAB = mCD hat die Proportion AB : CD = m : n, und ein anderes Streckenpaar A’B’, C’D’ hat dieselbe Proportion wie das Paar AB, CD, falls mit denselben Zahlen m und n die Gleichung nA’B’ = mC’D’ gültig ist. Bis jetzt ist die Welt in Ordnung. Die Beschreibung der Längenverhältnisse von Streckenpaaren durch Zahlen funktioniert so gut, und sie hat obendrein, wenn man an Längen von Saiten eines Musikinstruments denkt, einen unmittelbaren Bezug zur Harmonie der Töne, daß aus diesen Erkenntnissen ein großartiger Traum wurde, der Traum, alle Verhältnisse zwischen beliebigen Dingen, die es in der Welt gibt, irgendwann einmal durch Zahlenverhältnisse beschreiben zu können. Daß das zumindest bei Streckenpaaren immer geht, hielt man für ausgemacht. Diesen Traum nährte die Schule der Pythagoreer, benannt nach Pythagoras, dessen Satz über die Seitenlängen in rechtwinkligen Dreiecken wir alle in der Schule gelernt haben und auch heute auf Schritt und Tritt brauchen (seine Ursprünge sind aber älter als Pythagoras). Aber der Traum der Pythagoreer hatte ein jähes Ende: Der Schock der Inkommensurabilität. Ausgerechnet an ihrem eigenen Logo, einem sternförmig gezeichneten regelmäßigen Fünfeck, mußten die Pythagoreer feststellen, daß nicht einmal alle Streckenpaare sich durch Zahlenverhältnisse vergleichen lassen. Die Diagonale eines regelmäßigen Fünfecks ist nicht kommensurabel zur Seite desselben Fünfecks. Die Pythagoreer würde man heute als Geheimbund bezeichnen, und man weiß Eudoxos, Dedekind und Cantor: Die Geburt des heutigen Zahlbegriffs nicht sicher, wer der Unglückliche war, der das heilige System zum Einsturz brachte, indem er dies bewies und die peinliche Kunde aus dem Geheimbund nach außen schleuste; man vermutet es sei Hippasos von Metapont gewesen. Verschiedene Legenden besagen, daß er geächtet und schließlich ermordet oder in den Selbstmord getrieben wurde, oder aber von den Göttern bestraft wurde, die ihn durch Schiff bruch umkommen ließen. Man merkte dann, daß es einfachere Beispiele von inkommensurablen Streckenpaaren gibt, zum Beispiel Seite und Diagonale eines Quadrats. Nehmen wir an, daß die Quadratseite die Länge 1 hat (in moderner Denkweise, für Euklid ist die Länge keine Zahl!), dann sagt der Satz des _Pythagoras, daß die Diagonale die Länge √ 2 hat. Wären die Strecken kommensurabel, so müßte diese Zahl sich als p Bruch _q schreiben lassen, mit ganzen Zahlen p und q.  _ √ 2 1 1 Wenn das geht, dann gibt es auch einen gekürzten Bruch mit demselben Wert und wir können annehmen, daß unser Bruch schon gekürzt ist. Dann kann höchstens eine der beiden Zahlen p und q eine gerade Zahl sein. Andererseits ergibt sich aus unserer Annahme sofort, daß p2= 2q2 ist, also muß p gerade sein und q ist dann ungerade. Aber wenn man p = 2r in obige Gleichung einsetzt und durch 2 kürzt, sieht man, daß q doch auch gerade sein muß, ein Widerspruch zu dem was wir wissen. Also kann es solche Zahlen p und q nicht geben. Irrationale Proportionen. Man würde es gut verstehen, wenn die Griechen nach dieser niederschmetternden Erkenntnis ihre kühnen Träume einfach aufgegeben hätten. Das haben sie aber nicht getan, sondern jetzt kommt die eigentliche Leistung des Eudoxos: Er zeigte, wie man über die Proportionen inkommensurabler Streckenpaare nicht nur sprechen und (das ist das erste Grundbedürfnis) erklären kann, wann zwei solche Proportionen gleich sind, sondern wie man mit diesen Proportionen im erweiterten Sinne all das machen kann, was man bis dahin für die Proportionen der kommensurablen Paare schon konnte. Man konnte sie bereits der Größe nach ordnen, und man konnte mit ihnen rechnen – also all das, was wir mit Brüchen gewohnt sind zu tun. Im Grunde handelt es sich ja auch nur um eine andere Betrachtungsweise der Brüche. Nun mache man sich das erste Problem, vor dem Eudoxos stand, zunächst einmal klar. Ein kommensurables Streckenpaar ist vergleichbar, man kann seine innere Beziehung 33 34 Eudoxos, Dedekind und Cantor: Die Geburt des heutigen Zahlbegriffs durch die eines Zahlenpaares ausdrücken. Ein inkommensurables Paar ist eben nicht vergleichbar (in sich selbst), wie kann man da hoffen, zwei in sich unvergleichbare Paare miteinander zu vergleichen? Aber Eudoxos schafft genau das! Seine Definition der Gleichheit lautet wie folgt: Zwei beliebige (eventuell inkommensurable) Streckenpaare definieren dieselbe Proportion, geschrieben AB : CD = A’B’ : C’D’, wenn diejenigen Zahlenpaare m,n, für die nAB < mCD ausfällt, genau dieselben sind, für die die Beziehung nA’B’ < mC’D’ gilt. Dabei bedeutet das Zeichen < einfach, daß die links stehende Strecke kürzer ist als die rechts stehende, was ebenso wie bei der Gleichheit von Streckenlängen durch Verschieben der Strecken festgestellt wird. Die obige Definition ist einleuchtend: wenn man kein Zahlenpaar findet, das genau paßt, um die Proportion zu beschreiben, dann verlegt man sich darauf, zu prüfen, bei welchen Zahlenpaaren die linke Strecken nAB zu kurz bzw. zu lang wird. Aber sie ist kompliziert und entsprechend schwierig in der Handhabung. Es ist eine wirkliche Meisterleistung, daß Eudoxos und Euklid es schaffen, auf der Grundlage dieser Definition ein komplettes Lehrgebäude zu errichten, in dem unter anderem gezeigt wird, wie man diese erweiterten Proportionen der Größe nach vergleichen und mit ihnen rechnen kann. Erweiterungen des Zahlbegriffs. In gewisser Weise ist das System der Proportionen ebenbürtig dem System der reellen Zahlen, wie es Dedekind viel später geschaffen hat, und es beruht auf demselben Grundgedanken. Der Hauptnachteil des Systems von Eudoxos besteht in der kompletten Abhängigkeit von der Geometrie. Um zu zeigen, daß es eine bestimmte Proportion gibt, muß man ein Streckenpaar mit dieser Proportion geometrisch konstruieren. Man weiß heute, daß das nicht immer geht; zum Beispiel ist es nicht möglich, den Umfang eines Kreises auf diese Weise zu erfassen. Aber es fehlen noch viele andere Dinge, die wir heute für selbstverständliche Aspekte eines funktionierenden Zahlensystems halten: es fehlte die Null, es fehlten die negativen Zahlen, vor allem gab es keine Division. Man lasse sich nicht täuschen, die Proportionen erscheinen uns zwar so, als würde Bruchrechnung getrieben, aber dabei wurde nicht ans Teilen gedacht! In diesem Abschnitt wollen wir daher kurz skizzieren, wie in kleinen Schritten über die Jahrhunderte der Begriff der Zahl immer mehr erweitert wurde. Typisch für diese Entwicklung ist, daß jeder neue Erweiterungsschritt mit großem Mißtrauen aufgenommen wurde, Mißtrauen, von dem wir heute oft nichts mehr spüren, außer bei den jüngsten Schritten wie etwa der Einführung der komplexen Zahlen. Aber die Namen der jeweils neuen Zahlentypen sind geblieben, und sie drücken dieses Mißtrauen manchmal sehr unverblümt aus: irrationale Zahlen, transzendente Zahlen, imaginäre Zahlen, surreale Zahlen, Nichtstandard-Zahlen – aber jetzt gehe ich schon über Dedekind hinaus, also zurück zur historischen Reihenfolge! Brüche in unserem Sinne kannten schon die Babylonier vor viertausend Jahren. Ein Eudoxos, Dedekind und Cantor: Die Geburt des heutigen Zahlbegriffs n Bruch __ m soll ausdrücken, daß ein ganzes in m gleiche Teile gebrochen wird und daß wir n solche Teile zusammen in die Hand nehmen. Sie konnten damit auch rechnen, sogar quadratische Gleichungen lösen. Zu uns gekommen ist diese Kunst auf dem Umweg über die Araber, zuerst wohl in dem 1202 erschienenen Liber Abbaci von Leonardo von Pisa, genannt Fibonacci, der uns hauptsächlich durch seinen Versuch bekannt ist, die Vermehrung von Kaninchen mathematisch zu beschreiben, was sich allerdings mehr für die Mathematiker als für die Kaninchenzüchter segensreich ausgewirkt hat. Gleichzeitig brachte Fibonacci die heute übliche Zahlenschreibweise (die Dezimalzahlen) zu uns, womit das Elend der schwerfälligen römischen Zahlen endlich ausgestanden war. Im gleichen Buch hat er auch dritte Wurzeln eingeführt und näherungsweise berechnet, während Quadratwurzeln schon den Babyloniern und auch den Griechen bekannt waren. Eine Seite aus dem Liber Abbaci Gedanklich scheint besonders die Einführung der Null schwierig gewesen zu sein. Sie ist ebenfalls durch Fibonacci zu uns gelangt, aber es gibt eine lange Vorgeschichte, auf die wir hier nicht eingehen können. Jedenfalls muß man unterscheiden zwischen der Rolle der Null in der Dezimalschreibweise von Zahlen und ihrer Rolle als gleichberechtigte Zahl, mit der man rechnen kann wie mit jeder anderen. Beides kostete langwierige Kämpfe. Noch länger dauerte es, bis negative Zahlen voll akzeptiert waren. Negative Zahlen als Lösungen von Gleichungen wollte erst der französische Mathematiker Albert Girard 1629 erlauben. Schon wesentlich früher, nämlich 1585, hatte sich der Belgier Simon Stevin dafür stark Simon Stevin 35 36 Eudoxos, Dedekind und Cantor: Die Geburt des heutigen Zahlbegriffs Girolamo Cardano Carl Friedrich Gauß gemacht, Lösungen von Polynomgleichungen lamo Cardano 1545 eine entsprechende Forals richtige Zahlen anzusehen (wenn sie po- mel für kubische Gleichungen (n = 3), danach sitiv sind). Dabei handelt es sich um die Lö- leistete sein Schüler Lodovico Ferrari (1522 sungen von Gleichungen wie 4x3+ 25x – 1 = 0, – 1565) dasselbe für die Gleichungen vierten oder, in der allgemeinsten möglichen Form, Grades (n = 4). Das nährte bei den Matheman n–1  an x + an –1 x + ··· + a1 x + a0 = 0, tikern die Überzeugung, nun müsse es für mit ganzzahligen Koeffizienten a0 , ..., an . Um größere Grade n genauso weitergehen, mit die Berechnung der Lösungen dieser Art von einer passenden Formel für jeden Grad, die Gleichungen wurde jahrhundertelang gerun- allenfalls vielleicht etwas schwieriger zu fingen, und dies hat sehr erheblich zur Entwick- den und zu gebrauchen sein würde, wenn der lung der Mathematik beigetragen. Am An- Grad groß wird. Hier gab es jedoch eine herfang steht die allgemein bekannte Formel für be Enttäuschung. Nachdem viele Mathematiquadratische Gleichungen (das ist der Fall n ker sich vergeblich bemüht hatten, war wohl = 2), die schon die Babylonier kannten: die der in Braunschweig geborene Carl Friedrich 2 Gleichung x + px + q = 0 hat die beiden Lö- Gauß (1777 – 1855) der erste, der den Versungen dacht äußerte, daß es eine solche Formel viel_____ p_ __ p2 leicht nicht geben könne, daß sie also nicht x = – 2 ± 4 – q . nur schwer zu finden, sondern eine UnmögDanach gab es rasche Fortschritte erst im lichkeit sei. Im Jahre 1824 hat das dann für 16. Jahrhundert. Zunächst entwickelte Giro- den Grad 5 ein sehr junger norwegischer Ma- √ Eudoxos, Dedekind und Cantor: Die Geburt des heutigen Zahlbegriffs Nils Henrik Abel Evariste Galois thematiker bewiesen, der bald darauf infolge seiner Mittellosigkeit an Schwindsucht starb, Nils Henrik Abel (1802 – 1829). Noch etwas weitergehend zeigte der Franzose Evariste Galois (1811 – 1832, also ebenfalls sehr jung verstorben, und zwar in einem Duell), daß es oft genug auch nicht möglich ist, für eine einzelne Lösung einer einzelnen Polynomgleichung irgendeine Beschreibung zu finden, in der nur die gegebenen ganzzahligen Koeffizienten der Gleichung a 0 , ..., a n sowie die Rechenoperationen Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division sowie Wurzeln (vom Grad zwei oder höher, auch ineinandergeschachtelt) verwendet werden.  Und was gibt es noch für Krankheiten? sie endlich einen Überblick über alle denkbaren Bedrohungen erhalten. Ähnlich ist es mit den Mathematikern (wahrscheinlich sollte man hier die ganze Menschheit einbeziehen), die wissen wollen, ob all diese Bemühungen um den ultimativen Zahlbegriff denn jemals von einem abschließenden Erfolg gekrönt sein können, ob es eine Erweiterung des Zahlenreiches gibt, nach der keine weitere Erweiterung mehr nötig ist. Diese Frage stellte meine Tochter mir als kleines Kind immer wieder. Offenbar wollte Blicken wir noch einmal zurück auf die Hierarchie der Zahlen, wie sie sich uns jetzt darstellt. Am Anfang stehen die natürlichen Zahlen 1,2,3,…, die zum Zählen verwendet werden. Ergänzt durch Null und die negativen Zahlen -1,-2,-3,… bilden sie die ganzen Zahlen, im Gegensatz zu den gebrochenen oder rationalen Zahlen. Dann kommen als wiederum umfassenderer Bereich die algebraischen Zah- 37 38 Eudoxos, Dedekind und Cantor: Die Geburt des heutigen Zahlbegriffs Sir Isaac Newton Leonhard Euler (schweizer Banknote) len, darunter die Wurzeln, aber auch andere Zahlen, die sich durch keinen noch so komplizierten Wurzelausdruck darstellen lassen. Ist nun endlich Schluß?  Leider nein! Oder, je nach Standpunkt, glücklicherweise nicht. Um es zunächst einmal vom heutigen Wissensstand aus zu betrachten: Im Abschnitt über die Bändigung des Unendlichen können Sie nachlesen, daß es überab- Joseph Liouville zählbar viele reelle Zahlen gibt. Die Anzahl der algebraischen Zahlen ist aber noch abzählbar, denn für die Koeffizienten eines Polynoms gibt es abzählbar viele Möglichkeiten (die ganzen Zahlen), und ein einzelnes Polynom hat nur endlich endlich viele Nullstellen; daher kann man eine Abzählung ähnlich einrichten wie Cantor es für die rationalen Zahlen getan hat. Die Hauptmasse der Zahlen ist unseren Bemühungen also immer noch entgangen! Der erste, der gesehen hat, daß offenbar noch etwas fehlt, war der Brite Sir Isaac Newton (1643 – 1727). In Buch I seiner Principia Mathematica untersucht er Kurven in der Ebene. In Lemma 28 stellt er fest, daß der Inhalt der von einer ovalen Kurve umschlossenen Fläche niemals eine algebraische Zahl sein kann. Unter diese Feststellung fällt insbesondere die Fläche eines Kreises, womit also die Kreiszahl Eudoxos, Dedekind und Cantor: Die Geburt des heutigen Zahlbegriffs Dabei bedeutet zum Beispiel 4! (lies: 4 Fakultät) die Zahl 4! = 1 · 2 · 3 · 4 = 24, und allgemein ist n! das Produkt der ersten n natürlichen Zahlen. Die obige Summe kann man sich gut in Dezimalschreibweise vorstellen. Sie hat eine Null vor dem Komma und überall hinter dem Komma außer an den wenigen Stellen, deren laufende Nummer eine Fakultät n! ist; an diesen Stellen steht immer eine 1. Weitere konkrete und prominente Beispiele transzendenter Zahlen sind die Kreiszahl π, wie schon erwähnt und unabhängig von Newton bewiesen durch Ferdinand von Lindemann (1852 – 1939), sowie die Euler-Zahl e, die Basis des naürlichen Logarithmus. Auch diese Zahl ist der Grenzwert einer unendlichen Summe, nämlich e = 1 + __ 1 + __ 1 + __ 1 + __ 1 + ···. 1! 2! 3! 4! Carl Louis Ferdinand von Lindemann π als nicht algebraische Zahl erkannt ist. Für solche nicht algebraischen Zahlen prägte der schweizerische Mathematiker Leonhard Euler (1707 – 1783) später den Begriff transzendent. Die Argumente von Newton mögen noch etwas lückenhaft sein. Besser begründete Nachweise für die Existenz transzendenter Zahlen lieferte der Franzose Joseph Liouville (1809 – 1992). Er konstruierte transzendente Zahlen zuerst 1844 durch sogenannte unendliche Kettenbrüche, auf die wir hier nicht näher eingehen wollen, sodann 1851 durch unendliche Summen, wie wir sie schon bei Achill und der Schildkröte, und davor bei der Quadratwurzelberechnung kennengelernt haben. Er zeigt beispielsweise, daß der Grenzwert der folgenden Summe transzendent ist: 1 1! 1 2! 1 3! 1 4! ( __ ) + (__ 10 ) + (__ 10 ) + (__ 10 ) + ··· 10 Dedekind-Schnitte. Noch immer konnte man den Eindruck haben, es würde immer so weitergehen mit der uferlosen Entdeckung neuer Zahlentypen und man würde nie einen Überblick gewinnen. Aber nun kommt die Leistung Dedekinds. Er zeigt, wie man in einem einzigen Schritt, ausgehend von den rationalen Zahlen, also den Brüchen, das System der Zahlen zum Abschluß bringen kann, wobei dann alle algebraischen und transzendenten Zahlen auf einmal erfaßt sind. Er geht dabei von der alten Idee des Eudoxos aus; lesen Sie vielleicht an dieser Stelle noch einmal dessen Definition der Gleichheit von Proportionen im nicht kommensurablen Fall nach. Er kombiniert diese Idee nun aber mit der radikal neuen Denkweise, die er in die Mathematik hineingebracht hat und die auch seiner Idealtheorie zugrundeliegt. Er wagt es, nicht nur bekannte Objekte, zum Beispiel Zahlen, 39 40 Eudoxos, Dedekind und Cantor: Die Geburt des heutigen Zahlbegriffs zu Mengen zusammenzufassen, nein, er geht noch einen Schritt weiter und bildet auf noch höherer Stufe Mengen, deren Elemente selbst Mengen (z.B. von Zahlen) sind. Anders gesagt, er betrachtet Mengen von bekannten Zahlen als neue Zahlen und fügt sie den alten hinzu. Wie geht das? Nun, ganz einfach: Um das Vorgehen mit dem von Eudoxos vergleichen zu können, stellen wir uns vorübergehend die Zahlen als Längen von Strecken vor. Ist d die Länge von A und hat CD die Länge Eins, so können wir außerdem die Zahl d mit der Proportion AB : CD gleichsetzen (Eudoxos hört uns nicht, es würde ihn grausen). Um diese Proportion mit anderen zu vergleichen, bildet Eudoxos bereits eine Menge von Zahlenpaaren, auch wenn er diesen Begriff gar nicht kennt – nämlich die Menge derjenigen Zahlenpaare m,n, für die nAB < mCD gilt (Sie erinnern sich?). In heutiger Lesart heißt das AB < m __ . d = ___ n CD Für Eudoxos ist die Proportion (Zahl) d also bestimmt durch die Menge aller O(d) aller Brüche, die größer sind, die Obermenge von d. Ebenso bilden wir jetzt die Untermenge U(d); sie besteht aus allen Brüchen, die kleiner sind als d oder gleich d. Nun können wir die Geometrie und Eudoxos wieder vergessen, wir halten einfach fest, daß jede bisher bekannte Zahl d auf diese Weise eine Unterund eine Obermenge definiert, die folgende Eigenschaften haben: Jeder Bruch aus U(d) ist kleiner als jeder Bruch aus O(d), und jede rationale Zahl gehört genau einer dieser beiden Mengen an. Man nennt ein solches Paar von zwei Mengen rationaler Zahlen, das diese beiden Eigenschaften hat, heute einen Dedekind-Schnitt. Der Dedekind-Schnitt, der zur Zahl d gehört, beschreibt genau deren Positi- on, sie paßt in die Lücke zwischen U(d) und O(d), und sie ist die einzige, die dort hineinpaßt. Soweit ist noch alles wie bei Eudoxos. Jetzt kommt die genial einfache und doch unerhörte Idee: Wenn ein Dedekind-Schnitt nicht von einer schon bekannten Zahl herrührt (in der beschriebenen Weise), dann nimmt Dedekind ihn einfach als neue Zahl zu den bestehenden hinzu! Wenn auf der anderen Seite ein Dedekind-Schnitt von einer bereits bekannten (rationalen) Zahl herrührt (dieser Fall wird ja auch auftreten), dann soll er diese Zahl künftig ersetzen. Das läuft darauf hinaus, daß man alle alten Zahlen vergessen kann und als neue Zahlen sämtliche Dedekind-Schnitte in der Menge der rationalen Zahlen erklärt. Alle DedekindSchnitte zusammen bilden somit das System der reellen Zahlen. Man muß dann allerdings auch noch sagen, wie man solche neuen KunstZahlen der Größe nach ordnen und wie man mit ihnen rechnen will, aber das hat im Grunde alles Eudoxos schon vorgemacht. Was ist nun gewonnen? Der Anspruch dieser Erweiterung des Zahlsystems lautet, daß danach keine weitere Erweiterung mehr nötig ist. Alle algebraischen und transzententen Zahlen und sonstigen Gespenster sind ein für allemal eingefangen. Wie kann man da so sicher sein? Nun, dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen, die Dedekind alle aufführt: Das Supremumsprinzip gilt, das heißt, alle Lücken auf der Zahlengeraden sind nun geschlossen. Das liegt unmittelbar daran, daß eine eventuell vorhandene Lücke einen Dedekind-Schnitt definieren würde (U(d) ist al- Eudoxos, Dedekind und Cantor: Die Geburt des heutigen Zahlbegriffs les links von der Lücke, O(d) ist alles rechts von ihr), und dieser würde die Lücke ausfüllen. Hieraus folgt, daß man das ganze Lehrgebäude der Differential- und Integralrechnung nunmehr bestens absichern kann und es den Ingenieurstudenten in Zürich erklären kann. Eine Wiederholung der Prozedur würde nichts neues mehr bringen. Ja, denn wenn alle Lücken schon geschlossen sind, findet man auch keine Dedekind-Schnitte mehr, in die keine bereits bekannte Zahl hineinpaßt. Die Rechenoperationen Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division sind stetig. Hören wir hierzu Dedekinds eigene Worte: Noch viel größere Weitläufigkeiten scheinen in Aussicht zu stehen, wenn man dazu übergehen will, die unzähligen Sätze der Arithmetik der rationalen Zahlen … auf beliebige reelle Zahlen zu übertragen. Dem ist jedoch nicht so; man überzeugt sich bald, daß hier alles darauf ankommt, nachzuweisen, daß die arithmetischen Operationen selbst eine gewisse Stetigkeit besitzen. Hiermit ist gemeint, daß die Summe (das Produkt, der Quotient) zweier Zahlen sich nur geringfügig ändern, wenn man die beteiligten Zahlen selbst geringfügig ändert. Diese Tatsache (die leicht einzusehen ist), reicht aus um jedes Gesetz, das im Bereich der rationalen Zahlen gültig ist, auf die reellen Zahlen zu übertragen. Dabei spielt es eine wesentliche Rolle, daß die rationalen Zahlen in der Menge aller reellen Zahlen dicht liegen, das heißt, beliebig nah bei jeder reellen Zahl findet man rationale Zahlen; auch dies eine unmittelbare Folge der Definition der reellen Zahlen mit Hilfe der Dedekind-Schnitte. An dieser Stelle können wir die letzte offene Frage über unser eingangs beschriebenes Verfahren zur Quadratwurzelberechnung klären. Die Zahlenfolge bn konvergiert gegen b, also konvergiert wegen der Stetigkeit der Multiplikation die Folge bn2 gegen b2 . Da wir früher gezeigt haben, daß sie auch gegen c konvergiert, muß b2 = c sein, denn eine Folge kann nicht zwei verschiedene Grenzwerte haben. Cauchy-Folgen konvergieren. Was mit dieser in moderner Terminologie formulierten Aussage gemeint ist, lassen wir am besten wieder Dedekind selbst sagen: Läßt sich in dem Änderungsprocesse einer Größe x für jede positive Größe δ auch eine entsprechende Stelle angeben, von welcher ab x sich um Weniger als δ ändert, so nähert sich x einem Grenzwerth. Heute sagen wir so: um zu zeigen, daß eine Folge konvergiert, muß man den Grenzwert nicht im Voraus kennen; dann kann man zwar nicht nachweisen, daß sich die Glieder der Folge diesem Grenzwert beliebig stark annähern, aber das muß man auch gar nicht, es reicht, zu zeigen, daß sich die Glieder untereinander beliebig stark annähern. Folgen mit der zuletzt genannten Eigenschaft heißen heute Cauchy-Folgen nach Augustin Louis Cauchy, 1789–1857. Die oben formulierte Aussage ist für sich allein schon wichtig, aber uns interessiert sie hier besonders deshalb, weil sie die Brücke zwischen Dedekind und seiner Konkurrenz schlägt, wovon im nächsten Abschnitt die Rede sein soll. In diesem Zusammenhang sei auch 41 42 Eudoxos, Dedekind und Cantor: Die Geburt des heutigen Zahlbegriffs erwähnt, daß außer der Konvergenz der Cauchy-Folgen auch das Supremumsprinzip und die Stetigkeit der Rechenoperationen in Cauchys Werken schon auftauchen, wenn auch ohne befriedigende Begründung und ohne die Einsicht, welche Bedeutung diese Eigenschaften haben. Wege anderer Mathematiker zu den reellen Zahlen. Hier ist in erster Linie Georg Cantor zu nennen, von dem im Beitrag über die Bändigung des Unendlichen ausführlich die Rede ist. Er war mit Dedekind befreundet und schickte ihm 1872, gerade als Dedekind das Vorwort zu „Stetigkeit und Irrationalzahlen“ schrieb, eine Arbeit zu, in der er einen unabhängigen eigenen Zugang zu den reellen Zahlen beschreibt. Lassen wir Dedekind mit seiner Reaktion selbst zu Wort kommen: Und während ich an diesem Vorwort schreibe (20. März 1872), erhalte ich die interessante Abhandlung „Über die Ausdehnung eines Satzes aus der Theorie der trigonometrischen Reihen“, von G. Cantor (Math. Annalen von Clebsch und Neumann, Bd. 5), für welche ich dem scharfsinnigen Verfasser meinen besten Dank sage. Wie ich bei raschem Durchlesen finde, so stimmt das Axiom in §.2 derselben, abgesehen von der äußeren Form der Einkleidung, vollständig mit dem überein, was ich unten in §.3 als das Wesen der Stetigkeit bezeichne 4 . Welchen Nutzen aber die wenn auch nur begriffliche Unterscheidung von reellen Zahlgrößen noch höherer Art gewähren wird, vermag ich gerade nach meiner Auffassung des in sich vollkommenen reellen Zahlgebietes noch nicht zu erkennen. Augustin Louis Cauchy Die Bemerkung am Schluß dieses Zitats legt den Finger in eine Wunde: Dedekind hat sofort eine Unausgegorenheit in Cantors Artikel erkannt und benennt sie, ohne im mindesten verletzend zu sein, auf sehr vornehme Weise. Dazu unten mehr. Zunächst halten wir fest, daß auch Cantor die reellen Zahlen konstruiert und daß sein Produkt dem von Dedekind mathematisch völlig gleichwertig ist. Jedoch wählt er eine völlig andere Konstruktionsmethode: Er geht aus von den Cauchy-Folgen rationaler Zahlen, von denen sehr viele im Bereich der rationalen Zahlen keinen Grenzwert haben. Seine Idee ist nun, die Cauchy-Folgen von rationalen Zahlen selbst als die neuen Zahlen zu nehmen. Nur gibt es dabei ein technisches Problem, denn mehrere Cauchy-Folgen können z.B. gegen dieselbe rationale Zahl konvergieren, und es ist zu er- Eudoxos, Dedekind und Cantor: Die Geburt des heutigen Zahlbegriffs wünschenswerten Zahlen erreicht hat. In diesem Fall ist das die Eigenschaft, daß in den reellen Zahlen jede Cauchy-Folge bereits konvergent ist. Wir erinnern uns, daß Dedekind die entsprechende Eigenschaft für seine reellen Zahlen bewiesen hat. Umso verblüffter muß er gewesen sein, daß Cantor in seinem Artikel zumindest den Eindruck macht, als glaubte er, man müsse seine Prozedur mehrfach, vielleicht unendlich oft, wiederholen. Darum geht es in der oben schon kommentierten Bemerkung aus Dedekinds Vorwort. Georg Kantor warten, daß auch dann, wenn der Grenzwert eine Zahl ist, die erst neu erschaffen werden muß, dasselbe passiert. Das heißt, man muß stets (unendlich) viele Cauchy-Folgen zu einer neuen Zahl bündeln. Wann zwei Folgen zusammengehören, ist klar: genau dann, wenn aus ihnen durch Zusammenfügen nach dem Reißverschluß-Prinzip wieder eine Cauchy-Folge entsteht. Somit ist bei Cantor jede reelle Zahl eine Menge von unendlich vielen Cauchy-Folgen rationaler Zahlen, ein nicht minder kühner Gebrauch des Mengenbegriffs als bei den Dedekind-Schnitten. Die Technik läuft nach dieser Idee dann wieder geradlinig ab; man muß zeigen, daß sich alle wesentlichen Eigenschaften der rationalen Zahlen auf die reellen Zahlen übertragen, daß aber eine neue Eigenschaft hinzukommt, die besagt, daß man nunmehr alle In Wirklichkeit ist es so, daß auch Cantors Verfahren nach einmaliger Anwendung endgültig abgeschlossen ist. Aus manchen Gründen wird es heute gegenüber dem Dedekindschen oft bevorzugt. Einer der Gründe ist, daß Dedekind eine Ordnung (die Begriffe größer und kleiner) unter den rationalen Zahlen braucht um seine Schnitte zu definieren. Cantors Verfahren bewährt sich auch dann, wenn eine solche Ordnung nicht gegeben ist, was in vielen für die Mathematik interessanten Situationen der Fall ist (aber natürlich nicht bei den rationalen Zahlen). Um zu verstehen, warum Cantor glaubt, seine Konstruktion müsse mehrfach angewendet werden, muß man sich anschauen, was eigentlich sein Anliegen war. Der Titel seiner Arbeit (in obigem Dedekind-Zitat erwähnt) sagt es deutlich: seine Arbeit handelt von einem sehr konkreten Problem der Analysis, das mit dem Konvergenzverhalten sogenannter trigonometrischer Reihen zu tun hat (wie man sie bei der Frequenzanalyse von Schwingungsvorgängen antrifft). Um sein Ergebnis formulieren zu können, mußte er eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Typen von Zahlenmengen einführen, und eigentlich war die Hinzunah- 43 44 Eudoxos, Dedekind und Cantor: Die Geburt des heutigen Zahlbegriffs me von Grenzwerten aller Cauchyfolgen nur dazu gedacht, zu zeigen, daß alle die von ihm unterschiedenen Mengentypen tatsächlich auftreten. In diesem Zusammenhang spielte dann die Anzahl der Wiederholungen dieser Konstruktion eine Rolle. Cantor hat aber dann bemerkt, daß seine Konstruktion nebenbei auch das alte Problem löst, das System der Zahlen zu einem endgültigen Abschluß zu bringen, und er hat das ebenso nebenbei und etwas hastig in dieselbe Arbeit eingebaut, ohne sich darüber klar zu sein, oder zumindest ohne dem Leser deutlich zu sagen, daß er an einigen Stellen der Arbeit an Teilmengen des Systems der reellen Zahlen denkt und an anderen Stellen an das System aller reellen Zahlen. Man spürt einen gewaltigen Kontrast zwischen diesen beiden Mathematikercharakteren. Dedekind hat nach jahrelangem Nachdenken eine abgeklärte und in jedem Detail perfekte und ausgereifte Lösung eines klar umrissenen Problems vorgelegt. Cantor dagegen steht mitten in einem Kampfgetümmel, bei dem es um etwas ganz anderes geht, man spürt, wie er von den neuen Ideen und Feststellungen hingerissen ist, und ohne sich Zeit nehmen zu können um die Dinge sich setzen zu lassen, schreibt er eine Arbeit, in der alles heraus muß, was er gefunden hat.  Zumindest erwähnen wollen wir, daß auch der Berliner Mathematiker Karl Weierstraß (1815–1897) in seinen unveröffentlichten Vorlesungen 1865 eine gleichwertige, aber im Weg abweichende Konstruktion der reellen Zahlen durchgeführt hat. Dieser Zugang wurde 1867 von seinem Schüler Hermann Hankel (1839–1873) veröffentlicht und ist damit die erste im Druck erschienene Konstruktion der reellen Zahlen. Zwei weitere, ungefähr gleich- Karl Weierstraß zeitige Veröffentlichungen mit ähnlichem Inhalt stammen von Heinrich Eduard Heine (1821–1881) und Charles Méray (1835–1911). Der früheste bekannte Versuch, die reellen Zahlen zu konstruieren, wurde in den Jahren nach 1817 von dem Prager Bernard Bolzano (1781–1848) unternommen, aber nicht veröffentlicht. Er erkannte seine Arbeit später selber als fehlerhaft, soll allerdings dann auch eine erfolgreiche Korrektur gefunden haben. Heutige Mathematikstudenten lernen übrigens Bolzano und Weierstraß in ihrem ersten Semester als Gespann kennen, weil ein fundamentaler Satz der Analysis, der eng mit dem Supremumsprinzip zusammenhängt, von ihnen stammt und nach ihnen benannt ist. Diese Häufung von mehr oder weniger erfolgreichen Angriffen auf das Problem, die re- Eudoxos, Dedekind und Cantor: Die Geburt des heutigen Zahlbegriffs Bernard Bolzano René Descartes ellen Zahlen auf eine solide Grundlage zu stel- auf hingewiesen, daß das nicht ganz ernstlen, zeigt offenkundig, daß das Problem „sturm- gemeint ist. In der Mathematik ist nie etwas reif“ war. Die Mathematiker hatten es lange ge- endgültig in dem Sinne, daß danach nichts nug umkreist und von allen Seiten betrachtet, mehr kommen kann (wohl in dem anderen und die Begriffe der Mengenlehre, die in der Sinn, daß mathematische Wahrheiten nicht Luft lagen, gaben genügend Hilfsmittel her, „verfallen“ können). Tatsächlich war lange vor um die Festung zu besiegen. Dennoch bleibt Dedekind klar, daß nach den reellen Zahlen es das Verdienst Dedekinds, als erster einen er- noch mehr kommen muß. folgreichen Zugang gefunden zu haben; außerdem ist seine gedankliche Durchdringung des Beim Lösen quadratischer Gleichungen ganzen Komplexes wohl die ausgereifteste und stößt man bereits auf den Fall, daß man nach tiefschürfendste unter den Konkurrenten. der Quadratwurzel einer negativen Zahl zu su chen hat, etwa bei der Gleichung x2+ 1 = 0. Eine Jedes Ende ist zugleich ein Anfang. reelle Lösung kann es dafür nicht geben, denn das Quadrat einer reellen Zahl ist nie negativ. Auf den vorangegangenen Seiten haben wir Hier war es noch möglich, zu sagen, daß diese mehrmals das Wort „endgültig“ für die an- Gleichung eben keine Lösung besitzt, aber bei gestrebte und schließlich durch Dedekind Gleichungen dritten Grades kann es vorkomerreichte Erweiterung des Zahlbegriffes ge- men, daß die Gleichung drei reelle Lösungen braucht, aber wir haben von Anfang an dar- hat (mehr kann es nicht geben), und dennoch 45 46 Eudoxos, Dedekind und Cantor: Die Geburt des heutigen Zahlbegriffs in den Lösungsformeln von Cardano als Zwischenstadium der Berechnung Wurzeln aus negativen Zahlen gebildet werden müssen. Man fing also irgendwann an, auch mit Wurzeln aus negativen Zahlen zu rechnen, allerdings mit großem Unbehagen, das sich in dem von René Descartes (1596–1650) geprägten Namen imaginäre Zahlen (d.h. soviel wie scheinbare, bloß vorgestellte Zahlen) ausdrückt. Carl Friedrich Gauß prägte viel später den Ausdruck komplexe Zahlen für Zahlen, die aus einem reellen und einem imaginären Bestandteil als Summe zusammengesetzt sind, und er stellte diese Zahlen als Punkte einer Ebene, der komplexen Zahlenebene, dar. Noch wichtiger war, daß Gauß in seiner Doktorarbeit 1799 (also mit etwa 22 Jahren) den Fundamentalsatz der Algebra bewies, der besagt, daß jede Polynomgleichung mindestens eine komplexe Lösung besitzt. (Natürlich sind dabei Gleichungen der Form a = 0 ausgenommen, in denen gar keine Unbekannte x auftritt). Dies hatten bereits Descartes und der ebenfalls schon einmal erwähnte Albert Girard ohne Beweis behauptet. Durch Dedekinds Absicherung des Begriffs der reellen Zahlen standen auch die komplexen Zahlen auf solidem Grund, denn man kann sie leicht aus den reellen Zahlen entwickeln (etwa als Paare reeller Zahlen mit bestimmten einfachen Rechenregeln). Nun könnte man wieder meinen, daß damit endlich allen moralisch gerechtfertigten Bedürfnissen abgeholfen wäre, aber weit gefehlt. Schon früh entwickelte der Ire Sir William Rowan Hamilton (1805–1865) den Traum, auch mit Tripeln reeller Zahlen so rechnen zu können wie Gauß mit Paaren. Das verlockte ihn deshalb, weil man die Drehungen der Ebene mit den komplexen Zahlen (aufgefaßt als Gaußsche Zahlenebene) wunderschön be- Sir William Rowan Hamilton schreiben kann, und er hoffte, daß ihm etwas ähnliches mit den viel schwierigeren Drehungen des Raumes gelingen könnte. Darum hat er viele Jahre gekämpft, bis er einsah, daß es nicht ging (und man weiß heute, daß es nicht gehen konnte), aber daß es mit Quadrupeln (aus 4 reellen Zahlen bestehend) möglich ist. Statt der komplexen Zahlen mit der imaginären Einheit i und dem Rechengesetz i2 = –1 schuf er nun 1843 die Quaternionen mit gleich drei imaginären Einheiten i,j,k und den Gesetzen i2 = j2= k2 = –1 sowie ij = –ji = k , jk = –kj = i , ki = –ik = j. Man sieht, daß es bei dieser Multiplikation auf die Reihenfolge der Faktoren ankommt, eine für „Zahlen“ höchst merkwürdige Eigenschaft. Dennoch, oder gerade deshalb, erwiesen sich die Quaternionen als äußerst nützlich, wenn auch vielleicht nicht ganz so nützlich wie Hamilton es meinte. Aber es stimmt, daß sie hervorragend für die Berech- Eudoxos, Dedekind und Cantor: Die Geburt des heutigen Zahlbegriffs Arthur Cayley Ferdinand Georg Frobenius nung von Drehungen geeignet sind. Ein Fachmann für Raketensteuerung hat mir erzählt, daß der winzige Computer an Bord der ApolloMondfähre niemals in der Lage gewesen wäre, die Raketenmanöver zu berechnen, wenn nicht bei seiner Programmierung diese Vorteile der Quaternionen ausgenutzt worden wären. Nachzutragen ist hier, daß Hamilton sich auch eine zeitlang vergeblich um die Konstruktion der reellen Zahlen bemüht hatte. and Georg Frobenius (1849–1917) zeigt nämlich im Jahre 1878, daß eine nochmalige Verdopplung der Oktaven nichts sinnvolles mehr bringen kann, ja, daß in gewissem Sinne nun mit diesen vier Systemen (reelle und komplexe Zahlen, Quaterionen und Oktaven) alle denkbaren Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Nun wundert es nicht mehr, daß es danach eine weitere Station gibt: Arthur Cayley (1821 –1895) entwickelte 1845 die Oktaven mit nunmehr sieben imaginären Einheiten, mit deren Hilfe man die Drehungen eines siebendimensionalen Raumes beschreiben kann. Eher ist es jetzt überraschend, daß nun doch einmal ein Satz bewiesen wird, der besagt, daß es auf diesem Wege nicht mehr weitergeht. Ferdin- Es ist dennoch keineswegs so, daß mit dem Satz von Frobenius Grabesruhe eingekehrt wäre; die wird es in der Mathematik nie geben, und der Satz besagt ja auch nur, daß es auf diesem Wege nicht mehr weitergeht. Eine durchschlagende Neuerung gab es zum Beispiel in den 1960er Jahren, als Abraham Robinson (1918–1974) die sogenannten Nichtstandard-Zahlen (heute auch als hyperreelle Zahlen bezeichnet) entwickelte. Dieses Zahlsystem hat auch Platz für unendlich klei- 47 48 Eudoxos, Dedekind und Cantor: Die Geburt des heutigen Zahlbegriffs ne Zahlen (näher bei Null als jede reelle Zahl) und für unendlich große Zahlen (größer als jede reelle Zahl). Damit läßt sich der Begriff der infinitesimalen Größe, den Leibnitz und Newton bei ihrer Einführung der Differentialund Integralrechnung sehr intuitiv verwendet haben, rechtfertigen, und man hat klare Regeln, welche Schlüsse damit erlaubt sind und welche nicht. Dies ist eine große Leistung; sie war zunächst nur deshalb möglich, weil in den Jahren zuvor die mathematische Logik entscheidende Fortschritte gemacht hatte. Allerdings gibt es inzwischen auch einfachere Zugänge zu diesem neuen Zahlenreich. Wie um die Behauptung zu beweisen, daß es in der Mathematik nie einen endgültigen Schluß gibt, stellte John Conway dann noch- mals eine Erweiterung vor, die über die hyperreellen Zahlen hinausgeht und mit einer Konstruktion ähnlich den Dedekindschen Schnitten erreicht wird. Donald E. Knuth, der Schöpfer des wunderbaren (hier leider nicht verwendeten) Textverarbeitungssystems TEX, hat diese surrealen Zahlen 1974 in einem Roman ausführlich beschrieben. Erst danach erschien (1976) ein Fachbuch von Conway mit dem Titel „On Numbers and Games“, in dem diese Zahlen mathematisch präsentiert werden. Sie haben engen Bezug zu Spielen und den darin verwendeten Strategien. Wer wüßte jetzt nicht gerne, was in tausend Jahren der Stand der „Zahlenfrage“ sein wird? Und wer würde nicht gern etwas zu dieser unendlich spannenden Geschichte beitragen? n Seite 27 1 Lehre von den Zahlen Seite 29 2 a.a.O., §3 3 gemeint ist: das er Löcher hat Seite 42 4 Gemeint ist die Eigenschaft, dass jeder Dedekind-Schnitt durch eine reelle Zahl ausgefüllt ist. 49 TU Braunschweig, links neben dem Eingang befindet sich das Relief von Richard Dedekind. 50 μαϑησις μαϑηματικος Mathematik mathematics mathématiques wiskunde математика matematicas 51 Dedekinds Theorie der Ideale Prof. Dr. Harald Löwe, TU Braunschweig E i n e d e r a u s h e u t i g e r S i c h t herausragenden Leistungen Richard Dedekinds liegt in der Einführung des Begriffs „Ideal“, ohne den die moderne Algebra nicht so recht denkbar ist und ohne den die Zahlentheorie mitsamt ihren Anwendungen in der Kryptographie (der Lehre vom Verschlüsseln) nicht so rasante Fortschritte gemacht hätte. Und doch hat kaum jemand außerhalb der Mathematik von dieser Errungenschaft gehört. Das liegt vor allem an der recht abstrakten Natur dieses Begriffes, der sich – da nicht innerhalb von fünf Minuten erklärbar – der heutigen Zeit doch sehr sperrt. Trotzdem, oder besser, gerade deswegen möchte ich in der vorliegenden Arbeit den Versuch unternehmen, diesen Begriff, seine Herkunft, aber auch seine weiteren Auswirkungen auf die Mathematik auch einem Nicht-Mathematiker verständlich werden zu lassen. Ein ehrliches Wort vorweg: Bei diesem Unterfangen bin ich auf Ihre Mitwirkung angewiesen, denn die folgenden Seiten lesen sich durchaus nicht einfach so weg! Vielmehr wäre es sehr nützlich, wenn Sie Papier und Bleistift parat hätten, um im Zweifelsfalle eine Rechnung auch selbst einmal durchführen zu können. Der Taschenrechner kann Ihnen dagegen nicht helfen (es sei denn, Sie besitzen einen der modernen Rechner mit einem Computeralgebrasystem, der Sie an der einen oder anderen Stelle im Rechnen unterstützen kann). Nun stammt der Begriff des Ideals aus dem Bereich der Zahlentheorie, also der Lehre von den ganzen Zahlen und ihren Teilbarkeitsbeziehungen. Eine der Aufgaben der Zahlentheorie besteht im Auffinden ganzzahliger Lösungen von „diophantischen Gleichungen“, beispielsweise der Gleichung x2+ y2= z2oder x3+ y3= z3(die dem Kenner des „großen Satzes von Fermat“ vertraut vorkommen werden) oder auch x2+ 2 · y2= z3. Schon früh haben die Mathematiker herausgefunden, dass man bei den Lösungsversuchen zu 52 Dedekinds Theorie der Ideale diesen Gleichungen nicht nur in den ganzen Zahlen arbeiten sollte, sondern mit großem Nutzen diesen Rechenbereich erweitern kann. Genau um diese Erweiterung des Rechenbereichs der ganzen Zahlen oder der Brüche geht es im ersten Teil. Um Ihnen das Verständnis nicht schon hierbei schwer werden zu lassen, habe ich mich bemüht, möglichst viele Beispiele derartiger Erweiterungen zu beschreiben. Ganz am Ende dieser Einführung gelangen wir dann an die Grenze des Rechnens und stoßen auf ernsthafte Probleme. Dies ist der Startschuss zur Einführung der Ideale, die sich erst recht spät in diesem Abschnitt einfinden. Im weiteren Verlauf sehen wir dann auch die Anwendungen in der Zahlentheorie, um derentwillen Dedekind den Begriff des Ideals geprägt hat. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch eine vage Vorstellung davon geben, warum die Ideale auch in der Algebra eine so steile Karriere hinter sich haben. Wir beschäftigen uns mit einem recht merkwürdigen Zahlbereich, in dem die Gleichung 1 + 1 = 0 gilt, der aber dennoch das Fundament der ganz handfesten Codierungstheorie bildet, ohne die es weder die CD noch das Hubble-Teleskop gäbe. Dieser Zahlbereich ist auch der Anlass für eine erneute Beschäftigung mit den zu Beginn eingeführten algebraischen Zahlkörpern, denn auch diese kann man mit Hilfe von Idealen besser beschreiben. So soll diese Arbeit nicht nur den Zugang von Dedekind zu den Idealen aufzeigen, sondern auch die immense Bedeutung des Begriffes in der gesamten Mathematik belegen. Ich hoffe, es ist mir gelungen und hoffe noch viel mehr, dass Sie hieran Spaß finden. Dedekinds Theorie der Ideale 1. Erweiterungen von Zahlbereichen 1.1 Die quadratischen Zahlkörper Wir setzen voraus, dass wir die ganzen Zahlen und die rationalen Zahlen (die Brüche) gut kennen und damit auch rechnen können. Zumindest aus algebraischer Sicht liegt diese Voraussetzung auf der Hand – schließlich kennen wir die Zahlen 0 und 1, und mit Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division erhalten wir hieraus die rationalen Zahlen, zum Beispiel 1+1 – 2_3 = 0 – _______ . 1+1+1 Somit bildet die Menge Q der rationalen Zahlen sozusagen das Minimalgerüst, um überhaupt mit den elementaren Rechenoperationen +,–,·,÷ hantieren zu können. In den rationalen Zahlen können wir in gewohnter Weise Gleichungen des Typs a · x + b = 0 nach x auflösen. Die Gleichung x2 – 9 = 0 stellt uns ebenfalls vor keinerlei Schwierigkeiten – die Lösungen x = ±3 lesen wir einfach ab. Auch wissen wir aus der Mit_ telstufe, dass die – ganz ähnlich aussehende – Gleichung x2 –7 = 0 die Lösungen x = ±√ 7 besitzt. Doch gerade bei der letzten Gleichung lohnt es sich, inne zu _ halten und Rechenschaft darüber abzulegen, ob wir wirklich wissen, was das Symbol 7 bedeutet. Klar, auch √ _ das wissen wir aus der Mittelstufe: √ 7 ist diejenige positive Zahl, deren Quadrat 7 ergibt. Da wir hier aber _ nur die rationalen Zahlen als bekannt voraussetzen, müssen wir uns fragen, ob denn √ 7 solch eine Zahl ist. Die Antwort lautet – nein, es gibt keinen Bruch, dessen Quadrat 7 ergibt! _ Zum Beweis dieser Behauptung nehmen wir an, dass 7 doch eine rationale Zahl ist. √ _ Dann können wir √ 7 als vollständig gekürzten Bruch schreiben, d.h. wir finden teiler_ p fremde ganze Zahlen p und q mit √ 7 = _q . Multiplizieren mit q und quadrieren dieser Gleichung führt zu 7 · q2 = p2 . Da nun 7 ein Teiler von p2 ist, muss p ebenfalls ein Vielfaches von 7 sein. Also können wir p schreiben als p = 7 · ~ p, wobei auch ~ p eine ganze Zahl ist. Wir 2 2 2 2 ~ ~ setzen ein und erhalten 7 · q = (7 · p) = 7 · p und nach Kürzen q2 = 7 · ~ p 2 . Damit ist auch q durch 7 teilbar – aber p und q sollten nach Voraussetzung teilerfremd sein. Da wir in der _ Argumentation keinerlei Fehler gemacht haben, muss die Annahme „√ 7 kann als Bruch geschrieben werden“ falsch gewesen sein – wir haben die Behauptung bewiesen. _ Demnach liegt die „Zahl“ √ 7 nicht in unserem Rechenbereich, den rationalen Zahlen. _ Nun, kein Problem (sagt jedenfalls die Schule), denn √ 7 ist ein „unendlicher aperiodischer Dezimalbruch“ beziehungsweise eine „reelle Zahl“. Jetzt müssten wir erklären, was wir genau unter einer reellen Zahl (oder einem „unendlichen Dezimalbruch“) verstehen wollen. Eine solche Erläuterung benötigt mehr als die Grundrechenarten und ist somit nicht ohne weiteres innerhalb der Algebra formulierbar. _ Und trotzdem schlägt jetzt die Stunde der Algebra! Wir fassen √ 7 als Symbol auf und fügen dieses unserem Rechenbereich hinzu, wobei wir erklären müssen, _ _ wie mit diesem _ neuen Symbol zu hantieren ist. Zunächst einmal legen wir fest: √ 7 · √ 7 = 7, denn √ 7 soll schließlich die Lösung der Gleichung x2 – 7 = 0 sein. Außerdem wollen wir weiterhin ad- 53 54 Dedekinds Theorie der Ideale dieren und multiplizieren können. Als minimale Voraussetzung ist zu stellen, _ _ dass in dem 2 8 __ __ neuen Rechenbereich Zahlen der Gestalt + 27 √ 7 oder, allgemein, a + b · √ 7 für beliebige 13 rationale Zahlen a, b liegen. Jetzt können wir addieren und multiplizieren, ohne unseren neuen Rechenbereich zu verlassen: _ _ _  ( a + b · 7 ) + ( x + y · 7 ) = (a + x) + (b + y) · 7 , und √ √ √ _ _ _ _ _ _ (a + b · √ 7 ) · (x + y · √ 7 ) = ax + ay · √ 7 + bx · √ 7 + by · (√ 7 ) 2 =_ (ax _+ 7by) + (ay + bx) · √ 7 , wobei wir bei der letzten Umformung von der Gleichung √ 7 · √ 7 = 7 Gebrauch gemacht haben. Wie aber steht es mit dem Dividieren im neuen Rechenbereich? Hierzu bedienen wir uns des Tricks, der schon in der Schule zum „rational machen des Nenners“ verwen_ _ det wurde: _ _ (a + b · √ 7 ) · (x – y · √ 7 ) ax – 7by –ay + bx a_______ + b · √ 7 __________________ _ _ _ = = ______ + ______ · √ 7 2 2 2 2 x + y · √ 7 (x + y · √ 7 ) · (x – y · √ 7 ) x – 7y _ x – 7y Der zuletzt erhaltene Ausdruck hat wieder die Form r + s · √ 7 mit rationalen Zahlen r und s, so dass auch die Division den neu gewonnenen Zahlbereich nicht verlässt. Ohne Kenntnis der reellen _ Zahlen können wir daher den Zahlbereich Q der rationalen Zahlen durch die Lösung √ 7 der Gleichung x2 –_7 = 0 erweitern. Um anzudeuten, dass unser neuer Zahlbereich durch Hinzufügen von √ 7 zu Q entsteht, verwenden wir als Symbol _ _ _ Q(√ 7 ) . Die Elemente von Q(√ 7 ) sind_ daher die Ausdrücke a + b · √ 7 , wobei a und b rationale Zahlen sind. Rechnen in Q(√ 7 ) ist eine völlig natürliche Erweiterung der gewöhnlichen Rechenoperationen. An dieser Stelle wollen _ wir uns den folgenden Sachverhalt vor Augen führen. Eine der neuen Zahlen a + b · √ 7 kann _ nur dann gleich 0 sein, wenn sowohl a = 0 als auch b = 0 ist. Wäre_ nämlich a + b · √ 7 und b von 0 verschieden, so könnten wir die Gleichung zu – a / b _= √ 7 umformen. Da a und b Brüche sind, ist aber auch –a / b ein Bruch und kann nicht_ mit √ 7 übereinstimmen – siehe oben. Hieraus lesen wir ab, dass die Darstellung a + b · √ 7 _ _ für unsere neuen Zahlen eindeutig ist: Gilt _ nämlich a + b · √ 7 = x + y · √ 7 (wobei a, b, x, y Brüche sind), so folgt (a – x) + (b – y) · √ 7 = 0 und hieraus nach dem eben Gesagten a – x = b – y = 0 bzw. a = x, b = y. Genau wie oben können wir durch Hinzufügen einer Lösung der Gleichung x2 – 11 = 0 __ __ 2 oder__ x – 21 = 0 zu den Zahlbereichen__ Q(√ 11 ) (mit den Elementen a + b · √ 11 , a, b Q ) bzw. Q(√ 21 ) (mit den Elementen a + b · √ 21 , a, b Q ) gelangen. Natürlich kommen wir an dieser Stelle _ auch in die Versuchung, dieses Verfahren auch einmal mit einer „formalen Lösung“ √ 9 der Gleichung x2 – 9 = 0 zu erproben. Spätestens jetzt geraten wir in große Bedrängnis, wenn wir dividieren wollen: _ _ _ 3_ + √ 9 _ + √ 9 3_____ √ 9 1 _ _____ = _____________ = 3_____ = + , 2 0 3 – √ 9 (3 – √ 9 ) · (3 + √ 9 ) 3 – 9 was in einem „anständigen Zahlbereich“ nicht angeht. Eine genauere Analyse dieser Rech_ nung zeigt, dass wir auf die beschriebene Weise nur dann √ d zu den rationalen Zahlen Dedekinds Theorie der Ideale dazufügen können, wenn d nicht schon selbst Quadrat einer rationalen Zahl ist. Außer_ _ √ 6 3_ __ dem reicht es für _ unsere Bedürfnisse aus, wenn d eine ganze Zahl ist (anstelle von 2 = 2 reicht es aus, √ 6 hinzuzufügen), die quadratfrei _ ist, d.h. durch kein ganzzahliges __zudem _ Quadrat geteilt wird (anstelle von √ 12 = 2 · √ 3 füge √ 3 hinzu). Zusammenfassend treffen wir daher folgende Vereinbarung: √ Ist d_ eine quadratfreie ganze Zahl, so verstehen wir unter dem quadratischen Zahlkörper _ Q_(√ d ) die Menge _aller Zahlen a + b · √ d mit rationalen Zahlen a und b. Zwei Zahlen a + b · √ d sowie x + y · √ d werden folgendermaßen addiert / subtrahiert / multipliziert / dividiert: _ _ _ (a + b · √ d _ ) ± (x + y · √ _d ) = (a ± x) + (b ± y) · √ d _ (a + b · √ d ) · (x + y · √ d ) = (ax + byd) + (ay + bx) · √ d _ _ _ – byd -ay + bx + b · √ d ax _ a_______ = ______ + ______ · √ d (x + y · √ d ≠ 0) x + y · √ d x – dy x – d y 2 2 2 2 _ Wir sagen, der quadratische Zahlkörper Q(√ d ) entsteht aus Q durch Adjungieren einer Lösung der Gleichung x2 – d = 0. _ Unter den quadratischen Zahlkörpern befindet sich natürlich auch unser Beispiel Q(√ 7 ) , das wir ja schon oben eingehend studiert haben. Dieses Beispiel erscheint uns auch völlig vertraut; die Rechnungen in diesem Zahlbereich sind uns so geläufig, dass uns die Verallge_ meinerung auf Q(√ d ) schon fast selbstverständlich erschien. Allerdings haben wir nirgends ausgeschlossen, dass d negativ ist. Und in der Tat steht __ ___ mit dem Zahlkör_ der Mathematiker per Q(√ –2 ) auf genauso vertrautem Fuß wie mit Q(√ 7 ) , auch wenn √ – 2 noch nicht einmal eine reelle Zahl ist! Denn schließlich sind die Rechnungen ebenso einfach wie sonst, z.B. ___ ___ ___ ___ ___ ___ (3 + 2 · √ – 2 ) · (– 4 + √ – 2 ) = 3 · (–4) + 3 · √ – 2 + 2 · √ – 2 · (–4) + 2 · √ – 2 · √ – 2 __ ___ ___ = (√ –2 )=–2 = – 12 + 3 · √___ – 2 – 8 · √ – 2 + 2 · (–2) = – 16 – 5 · √ – 2 ___ 2 Das Verständnis dieser Rechnung liegt in der Tatsache, dass √ – 2 ein Symbol für eine Lösung der Gleichung x2 + 2 = 0 ist – und hier liegt auch die Schwierigkeit, denn eben diese Gleichung (so haben wir in der Schule gelernt) hat keine reelle Lösung. Daher liegt es nahe, an dieser Stelle die reellen Zahlen ebenfalls zu erweitern, indem wir eine Lösung der Gleichung x2 + 1 = 0 hinzufügen. Natürlich können wir das auf genau die gleiche Weise wie schon bei den quadratischen Zahlkörpern in Angriff nehmen: 55 56 Dedekinds Theorie der Ideale ___ Eine komplexe Zahl ist ein Ausdruck x + y · √ – 1 wobei x und y beliebige reelle Zahlen sind. Gerechnet wird mit den komplexen Zahlen folgendermaßen: ___ ___ ___ (a + b · √ –___1 ) ± (x + y · √ ___ – 1 ) = (a ± x) + (b ± y) · √ – 1 ___ (a + b · √ – 1 ) · (x + y · √ – 1 ) = (ax – by) + (ay + bx) · √ – 1 ___ ___ ___ + by –ay + bx + b · √ –__1 ax a_________ = ______ + ______ · √ – 1 (x + y · √ – 1 ≠ 0) 2 2 2 2 x + y x + y x + y · √ –1 Eine kurze Überlegung zeigt nun, dass jeder qua__ x+y·√ –1 dratische Zahlkörper ein Teil der komplexen Zahlen ist. Trotzdem bleibt ein gewisses Unbehagen 1, denn y schließlich „sehen“ wir die reellen Zahlen auf dem Zahlenstrahl, auf dem für die komplexen Zahlen kein Platz mehr ist. In Wahrheit ist auch dies kein großes Problem: Anstelle des Zahlenstrahls nehr men wir die „Gaußsche ___Zahlenebene“ und denken uns die Zahl x + y · √ – 1 als Punkt (x | y) in dieser Ebene. Mit dieser visuellen Anschauung einer koma plexen Zahl verbindet sich ein ganz handfester algebraischer Hintergrund. Anstelle der Koordinaten x können wir nämlich mit gleichem Recht eine komGaußsche Zahlenebene plexe Zahl (alias ein Punkt der Ebene) auch durch seinen Abstand r zum Ursprung und den eingezeichneten Winkel a zur x-Achse angeben. In dieser Darstellung erhält man das Produkt zweier komplexer Zahlen, indem man die Abstände zum Nullpunkt multipliziert und die Winkel addiert. 1.2 Exkurs: Noch mehr Zahlkörper _ Im letzten Abschnitt haben wir gesehen, wie wir durch Hinzufügen eines Symbols wie √ 7 den Rechenbereich der rationalen Zahlen um die Lösungen der Gleichungen x2 – 7 = 0 bzw. x2 + 2 = 0 erweitern können, ohne die reellen oder komplexen Zahlen bemühen zu _ 3 müssen. Natürlich können wir so auch höhere Wurzeln adjungieren, so etwa √ 2 als Lösung der Gleichung x3 – 2 = 0. Hierbei müssen wir allerdings etwas_ aufpassen: Die Zahlen des _ _ 3 3 3 2 neuen Rechenbereichs Q(√ 2 ) haben die Form a + b · √ 2 + c · (√ 2 ) wobei a, b und c Brüche _ 3 sind; nur Zahlen des Typs a + b · √ 2 zu nehmen reicht hier nicht aus! Hierfür gibt es einen tieferen Grund (und Mathematik betreiben heißt, diesen Grund zu finden und zu verstehen), den wie hier nur kurz für diesen Spezialfall andeuten wollen. Dedekinds Theorie der Ideale _ _ gehört (√ 2 )2 Nach dem Hinzufügen von √ 2 zu Q wollen wir multiplizieren und demzufolge _ 3 ebenfalls zum neuen Zahlbereich. Würden nun Zahlen der Form a + b · √ 2 ausreichen, so _ _ 3 3 2 gäbe es rationale Zahlen a und b mit ( 2 ) = a + b · √ 2 . Wir multiplizieren die letzte Glei√ _ _ _ 3 3 3 3 chung mit 2 , ersetzen die entstehende linke Seite (√ 2 ) durch 2 und erhalten 2 = a · √ 2 + √ _ _ _ _ 3 3 3 3 2 2 2 b · (√ 2 ) . Ersetzen von (√ 2 ) durch (√ 2 ) = a + b · √ 2 führt zur Gleichung 3 3 _ _ _ 2 = a · √ 2 + b · (a + b · √ 2 ) = ab + (a + b2 ) · √ 2 . 3 3 3 Diese Gleichung kann nur dann gelten, wenn ab = 2 und a + b2= 0 erfüllt sind. Insgesamt erhält man hieraus a = –b2und daher 2 = ab = –b3 . Da aber b ein Bruch ist, und kein Bruch _ _ 3 3 2 zur dritten Potenz erhoben 2 ergibt, kann unsere Annahme „ (√ 2 ) = a + b · √ 2 mit rationalen Zahlen a und b“ nicht richtig sein. _ Damit wird das Rechnen in Q(√ 2 )ziemlich eklig. Erfordert schon die Multiplikation einiges an Rechnung, so steht vor der Division noch die Hürde, mit einem Nenner der Form a + b · _ _ 3 3 2 √ 2 + c · (√ 2 ) zu hantieren. Die hierzu nötigen Werkzeuge 2 stehen uns nicht zur Verfügung, so dass wir uns auf quadratische Zahlkörper beschränken. Wir notieren an dieser Stelle lediglich: Einen Zahlbereich, der aus den rationalen Zahlen durch Hinzufügen einiger oder aller Lösungen einer oder mehrerer Polynomgleichungen  an · xn + an –1 · xn–1 + ... + a1 · x + a0 = 0 mit rationalen Zahlen an ,an –1 ,..., a2 , a1 , a0 entsteht, nennen wir einen (algebraischen) Zahlkörper. Die Beschäftigung mit den algebraischen Zahlkörpern ist eines der zentralen Themen der algebraischen Zahlentheorie. 3 1.3 Ganze komplexe Zahlen Wir fangen diesen Abschnitt zur Motivation mit einem zahlentheoretischen 3 Problem an. Gesucht werden sämtliche Primzahlen, die sich als Summe zweier Quadrate ganzer Zahlen schreiben lassen. Die 2 als einzige gerade Primzahl ist rasch erledigt, denn schließlich ist 2 = 12 + 12eine Zerlegung der gewünschten Art. Mit ein wenig Ausprobieren gelangen wir zum Ergebnis, dass 5 = 22 + 12, 13 = 32 + 22und 17 = 42 + 12Primzahlen der gewünschten Art sind, während sich 3, 7, 11 und 19 nicht als Summe zweier Quadrate schreiben lässt. Aber diese Beispiele beantworten nicht die Frage! Denn von der Primzahl 97 wissen wir noch nicht, ob sie sich in gewünschter Art zerlegen lässt 4. Wir geben mit elementaren Methoden zunächst eine Teilantwort. Ist p eine ungerade Primzahl, und gibt es ganze Zahlen x und y mit p = x2 + y2, so muss eine dieser Zahlen gerade und die andere ungerade sein. Natürlich können wir hier voraussetzen, dass x die gerade und y die ungerade Zahl ist. Damit ist x = 2 · n das Doppelte einer ganzen Zahl n, während sich zu der ungeraden Zahl y eine ebenfalls ganze Zahl m mit y = 2 · m + 1 finden lässt. Durch Einsetzen und Ausmultiplizieren erhalten wir p = x2 + y2 = (2n)2 + (2m + 1)2 57 58 Dedekinds Theorie der Ideale = 4 · (n2 + m2 + m) + 1. Aus dieser Gleichung lesen wir ab, dass die ungerade Primzahl p nur dann als Summe zweier Quadrate geschrieben werden kann, wenn p bei Division durch 4 den Rest 1 hat – sonst nicht! Und umgekehrt? Alle bisherigen Beispiele lassen vermuten, dass jede ungerade Primzahl p, die bei Division durch 4 den Rest 1 besitzt, sich auch tatsächlich als Summe zweier Quadrate schreiben lässt. Zum zweifelsfreien Nachweis dieser Vermutung aber reichen die elementaren Methoden nicht! Um das Problem doch noch angehen zu können, verlassen wir die ganzen Zahlen und gehen in den quadratischen Zahl__ körper Q(√ –1 ) . Dort können wir__ die Summe der __ Quadrate als Produkt schreiben:  p = x2 + y2 = (x + y · √ –1 ) · (x – y · √ –1 ) mit ganzen Zahlen x und y. Diese Rechnung geschieht nicht mehr in __ den ganzen Zahlen, sondern im Rechenbereich der „ganzen komplexen Zahlen“ x + y · √ –1 (mit ganzen Zahlen x und y). Die Menge aller __ ganzen komplexen Zahlen bezeichnen wir mit Z(√ –1 ) , da einerseits Z für die Menge__aller gewöhnlichen ganzen Zahlen steht, __ und andererseits der Übergang von Z nach Z(√ –1 ) so verläuft wie der von Q nach Q(√ –1 ) . Natürlich __ können wir ganze komplexe Zahlen addieren, subtrahieren und multiplizieren, ohne Z(√ –1 ) zu verlassen. Dagegen führt – genau wie in Z – die Division__aus diesem Zahlbereich heraus. Daher __ ist es nützlich, den Begriff der Teilbarkeit auf Z(√ –1 ) zu übertragen: Sind 5 a, b aus Z(√ –1 ) , so heißt a ein Teiler von b (oder b durch a teilbar), wenn es eine wei__ tere ganze komplexe Zahl __γ mit der Eigenschaft b = a · γ gibt. Somit ist etwa a = 1 – 2 · √ –1 ein Teiler von b = 13 __ – √ –1 , denn__ __ __ __ b (13 – √ –1 ) · (1 + 2 · √ –1 ) 13 – –1 ___________________ 15 + 25 · √ –1 √ ________ __ __ __ g = — = = = __________ = 3 + 5 · √ –1 a 1 – 2 · √ –1 5 (1 – 2 · √ –1 ) · (1 + 2 · √ –1 ) __ ist eine ganze komplexe Zahl und erfüllt offenbar b = a · γ. Dagegen ist a = 1 – √ –1 kein __ Teiler von b = 2 + √ –1 , da der Quotient __ __ b 2 + √ __ –1 1_ 3_ — = ______ = + · √ –1 g 1 – √ –1 2 2 eben keine ganze komplexe Zahl ist. Für die zweite Rechnung gibt __ es einen eleganten Ersatz. Hierzu ordnen wir zunächst jeder komplexen Zahl x + y · √ –1 ihre so genannte Norm __ __ __ N (x + y · √ –1 ) = (x + y · √ –1 ) · (x – y · √ –1 ) = x2 + y2 zu und rechnen nach, dass die Norm eines Produktes gleich dem Produkt der Normen ist: __ __ __ N ((x + y · √ –1 ) · (u + v · √ –1 ) ) = N ((xu – yv) + (xv + yu) · √ –1 ) = (xu – yv)2 + (xv + yu)2 = x2 u2– 2xyuv + y2 v2 + x2 v2 + 2xyuv + y2 u2 = x2 u2+ y2 v2 + x2 v2 + y2 u2 = (x2 + y2 ) · (u2 + v2 ) __ __ = N (x + y · √ –1 ) · N (u + v · √ –1 ) Dedekinds Theorie der Ideale Außerdem stellen wir fest, dass die Norm einer ganzen komplexen Zahl eine gewöhnliche ganze Zahl__ist. Damit erhalten wir eine interessante Aussage: Ist nämlich a ein Tei__ ler von b in Z(√ –1 ) , so gibt es ja ein g aus Z(√ –1 ) mit b = a · g. Für die zugehörigen Normen N (a), N (b) und N (g) (die gewöhnliche ganze Zahlen sind) gilt dann die Gleichung N (b) = N (a · g) = N (a) · N (g) – damit ist N (a) ein Teiler von N (b) im Rechenbereich Z der ganzen Zahlen! __ __ Das __ wenden wir auf a = 1 – √ –1 und b = 2 + __ √ –1 an! Wir berechnen die Normen N (a) = N (1 – √ –1 ) = 12 + (– 1)2 = 2 und N (b) = N (2 + √ __ –1 ) = 22 + 12= 5. Da 2 in den ganzen Zahlen nun einmal kein Teiler von 5 ist, kann a in Z(√ –1 ) auch kein Teiler von b sein. Ein wenig vorsichtig sollte man an dieser Stelle schon sein – auch wenn N (a) ein Teiler __ von N (b) ist, braucht a noch lange kein Teiler von b zu sein! Denn a = 5 und b = 4 + 3 · √ –1 haben beide die Norm 25 und trotzdem ist weder a ein Teiler von b noch umgekehrt, denn keiner der beiden Quotienten __ __ b 4 + 3 · √ –1 4_ 3_ — = ________ = + · √ –1 a 5 5 5 __ a 5 __ 4_ 3_ ________ — = = – · √ –1 b 4 + 3 · √ –1 5 5 ist eine ganze komplexe Zahl. __ Nachdem wir die Teilbarkeit __in Z(√ –1 ) eingeführt und näher beleuchtet haben, liegt es nahe, auch Primzahlen in Z(√ –1 ) einzuführen. Aber Vorsicht! Mit der Schulweisheit „eine Zahl ist eine Primzahl, wenn sie nur durch 1 und sich selbst teilbar ist“ kommen wir nicht sehr weit. Das gilt noch nicht einmal in den ganzen Zahlen, denn schließlich hat die Zahl 3 (die ja unbestreitbar eine Primzahl ist) die Teiler 1, 3, –1 und –3. Schuld an diesem Missstand trägt die in den natürlichen Zahlen nicht vorkommende Zahl –1, die als Teiler von 1 auch jede weitere Zahl teilt. Immerhin, es gibt nur zwei Zerlegungen der Zahl 3, nämlich 3 = 1 · 3 und 3 = (–1) · (–3). In beiden Zerlegungen steckt einer der Teiler von 1, so dass wir einen ersten Ansatzpunkt für den Begriff einer „komplexen Primzahl“ haben: __ Eine ganze komplexe Zahl a =__x + y · √ –1 heißt unzerlegbar, falls für jede Zerlegung a = b · g (mit Elementen b, g aus Z(√ –1 ) ) einer der beiden Faktoren b, g ein Teiler von 1 ist. Teiler der 1 nennen wir auch kurz Einheiten, und diese wollen wir jetzt bestimmen. Wenn a eine Einheit ist, dann teilt die Norm von a (eine positive ganze Zahl) die Zahl 1. Damit kommen nur 1, –1, __ __ Zahlen a mit Norm 1 in Frage – und davon gibt es genau vier, nämlich__ –1 und – –1 , die auch sämtlich Einheiten sind. Eine unzerlegbare Zahl a = x + y · –1 √ √ √ besitzt also tatsächlich genau vier Zerlegungen, nämlich __ __ x + y · √ –1 = 1 · (x + y · √ –1 ) __ = (–__ 1) · (– x – y · √ –1 ) __ = √ –1 __ · (y – x · √ –1 ) __ = (– √ –1 ) · (– y + x · √ –1 ) 59 60 Dedekinds Theorie der Ideale Warum aber nennen wir solche Zahlen „unzerlegbar“ und nicht „Primzahl“? Nun, uns reicht die Eigenschaft der „Unzerlegbarkeit“ noch nicht aus. Wir erwarten vielmehr, dass eine Primzahl nur dann ein Produkt teilt, wenn sie ein Teiler einer der beteiligten Faktoren ist. Wir legen daher fest: __ __ Eine ganze komplexe Zahl a = x + y · √ –1 heißt eine Primzahl __ in Z(√ –1 ) , wenn a nur dann ein Teiler eines Produktes b · g (mit Elementen b, g aus Z(√ –1 ) ) sein kann, wenn a einen der Faktoren b oder g teilt. __ Glücklicherweise fallen im Rechenbereich Z(√ –1 ) die Begriffe „Primzahl“ und „unzerlegbar“ zusammen – dieses Glück wird uns weiter unten in anderen Rechenbereichen jedoch verlassen! Mit dieser Information (die wir an dieser Stelle nicht belegen, sondern nur zur Kenntnis nehmen) können wir endlich unser Ausgangsproblem angehen. Zur Erinnerung: p bezeichnet eine gewöhnliche Primzahl mit Rest 1 bei Division durch 4. Von dieser Primzahl wollen wir feststellen, ob sie sich als Summe p = x2 + y2 von Quadraten zweier ganzer Zahlen x und y schreiben lässt. Da p bei Division durch 4 den Rest 1 besitzt, finden wir eine natürliche Zahl n mit p = 4n + 1. Wir setzen u = (2n)!= 1 · 2 · 3 ·...· (2n). Dann lässt sich u2 + 1 durch p __ teilen, wobei wir diese Tatsache nur zitieren und nicht zeigen wollen. Im Rechenbereich Z ( –1 ) gilt natürlich √ __ __ ebenfalls, dass p ein Teiler von__ u2 + 1 = (u + √ –1 __ ) · (u + √ –1 ) ist.__Andererseits kann p kein Teiler eines der Faktoren u ± √ –1 sein, __ da u_p ± 1_p √ –1 nicht in Z(√ –1 ) liegt – schließlich ist 1/ p keine ganze Zahl. Damit ist p in Z(√ –1 ) keine Primzahl mehr und __ lässt sich demzufolge in ein Produkt p = a · b zweier Nicht-Einheiten a und b aus Z(√ –1 ) zerlegen6. Übergang zu den Normen liefert die Gleichung p2 = N (p) = N (a) · N (b) in den ganzen Zahlen. Als Nicht-Einheiten haben a und b eine von 1 verschiedene Norm. Da p in den ganzen Zahlen __ eine Primzahl ist, schließen wir hieraus N (a) = N (b) = p. Ist nun etwa a = x + y · √ –1 , so erhalten wir endlich das gewünschte__Ergebnis p = N (a) = N (x + y · √ –1 ) = x2 + y2 mit ganzen Zahlen x und y. 1.4 Exkurs: Dreiecke und ganze komplexe Zahlen Kennen Sie Pythagoräische Tripel? Das sind jeweils drei ganze Zahlen x, y und z, die als Längen der Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks auftreten können. Nach dem Satz des Pythagoras ist das der Fall, wenn x, y und z folgender diophantischer Gleichung genügen: x2 + y2 = z2 . Eine Lösung kennt vermutlich jeder, nämlich x = 3, y = 4 und z = 5. Eine weitere Lösung wäre x = 6, y = 8 und z = 10; aber diese Lösung haben wir aus der ersten durch Verdoppeln erhalten. Es stellt sich natürlich die Frage, ob es noch grundlegend andere Lösungen gibt. Dedekinds Theorie der Ideale __ Dazu gehen wir in unseren neuen Rechenbereich Z(√ –1 ) , zerlegen dort die linke Seite der Gleichung mit der dritten binomischen Formel __ und erhalten __  x2 + y2 = (x + y · –1 ) · (x – y · √ –1 ) = z2 √ __ Wenn jetzt beide Faktoren x ± y · √ –1 Quadrate wären, __ __ dann hätten wir weitere __ Lösungen. 2 2 2 Also setzen wir kurzerhand an: x ± y · √ –1 = (m ± n · √ –1 ) = (m – n ) ± 2mn · √ –1 mit ganzen Zahlen m und n. Damit haben wir weitere Lösungen gefunden! Sind m und n beliebige ganze Zahlen, so ist x = m2 – n2 y = 2mn z = m2 + n2 ein pythagoräisches Tripel – und diese erhalten wir jetzt wie Sand am Meer. So wählen wir zum Beispiel m = 12, n = 7, erhalten hieraus das pythagoräische Tripel x = 122 – 72 = 95 y = 2 · 12 · 7 = 168 z = 122 + 72 = 193 und in der Tat gilt 952 + 1682 = 37249 =1932. Sicherlich hätte man dieses Beispiel nicht durch Probieren gefunden… 1.5 Ganze Zahlen in quadratischen Zahlkörpern Bevor wir ganze Zahlen auch in den anderen quadratischen Zahlkörpern kennen lernen, wollen wir auch hierfür eine Begründung unseres Interesses skizzieren. Ausgangspunkt der schon in Leonhard Eulers (1707–1783) Buch „Vollständige Anleitung zur Algebra“ aufgeführten Fragestellung ist wieder einmal ein zahlentheoretisches Problem: Gesucht sind diejenigen ganzen Zahlen x, für die x2 + 2 eine Kubikzahl ist, d.h. gesucht werden alle ganzzahligen Lösungen x und y der Gleichung x2 + 2 = y3 . Auch hier werden wir mit elementaren Methoden wenig zu bestellen haben; auch hier führt der Lösungsweg wieder über die ganzen Zahlen in einem quadratischen Zahlkörper. Zunächst überlegen wir uns, dass x ungerade ist: Wäre nämlich x durch 2 teilbar, so ist sicherlich auch y3= x2+ 2 und damit auch y gerade. Folglich wäre 4 ein Teiler von y3– x2=___ 2, was aber nicht zutrifft. Wir zerlegen nun___ die 3 2 3 linke Seite der Gleichung y = x + 2 in Q ( – 2 ) und erhalten die Gleichung y = (x + – 2 ) · √ √ ___ ___ (x – √__ – 2 ) in Z(√ – 2 ). Ohne weitere Begründung nehmen wir an, dass die beiden Faktoren x ± √ –2 mit ungeradem x keine gemeinsamen Teiler besitzen (was stimmt und weiter unten bewiesen wird). Dann, so Euler weiter, müssten beide Faktoren ebenfalls __ __ Kubikzahlen sein, und es gibt folglich ganze Zahlen a und b, so dass x + √ –2 = (a + b · √ –2 ) 3 gilt (was ebenfalls richtig ist). Wir multiplizieren die rechte Seite aus und erhalten __ __ __ x + √ –2 = (a + b · √ –2 ) 3 = (a3 – 6ab2 ) + (3a2 b – 2b3 ) · √ –2 . Ein Vergleich der linken und rechten Seite ergibt die beiden Bedingungen x = a3 – 6ab2 = (a2 – 6b2 ) · a 1 = 3a2 b – 2b3 = (3a2 – 2b2 ) · b 61 62 Dedekinds Theorie der Ideale Damit haben wir das Problem erneut in die ganzen Zahlen verschoben, wo wir es mit elementaren Mitteln lösen können! Aus der zweiten Bedingung folgt nämlich  3a2 – 2b2 = b – ± 1, denn anders kann das Produkt dieser beiden Zahlen nicht 1 ergeben. Jedenfalls gilt b2 = 1 und Einsetzen in 3a2 – 2b2 = ±1 liefert 3a2 = 2 ±1. Da das Dreifache des Quadrates der ganzen Zahl a nicht 2 – 1 = 1 ergeben kann, kommt nur das positive Vorzeichen in Betracht. Daher entnehmen wir der zweiten Bedingung sogar 3a2 – 2b2 = b = 1 . Für a verbleiben lediglich die beiden Zahlen 1 und – 1. Setzen wir nun b = 1 und a = ±1 in die erste Gleichung x = a3 – 6ab2 ein, so erhalten wir als einzige Möglichkeit x = ±5. In der Tat ist dann x2 + 2 = (±5)2 + 2 = 27 die dritte Potenz von 3. Wir haben daher zwei Lösungen der Gleichung x2 + 2 = y3 gefunden und gleichzeitig sichergestellt, dass es keine weiteren Lösungen gibt. Offenbar haben wir mit den ganzen Zahlen in den quadratischen Zahlkörpern ein gutes Mittel gefunden, zahlentheoretische Probleme besser anpacken zu können – es lohnt sich, einiges an Arbeit hier zu investieren! Allerdings gibt es auf dem Weg noch allerlei Fallstricke. Zunächst ist noch nicht wirklich klar, was denn eine ganze Zahl in einem quadratischen (oder einem sonstigen) Zahlkörper überhaupt sein soll. Zwar liegt es nahe, ein Element a _ _ + b · √ d aus Q(√ d ) als ganzzahlig zu bezeichnen, wenn beide Koeffizienten a und b ganze Zahlen im üblichen Sinne sind. Doch aus verschiedenen Gründen ist dies nicht nur unbefriedigend, sondern auch irreführend. Stattdessen legen wir fest, wann wir eine beliebige komplexe Zahl als „ganze Zahl“ ansprechen wollen: Eine komplexe Zahl ϑ heißt ganzalgebraische Zahl, wenn sie die Lösung einer Gleichung  xn+ an –1 · xn–1 + ... + a1 · x + a0 = 0 mit ganzzahligen Koeffizienten an –1 , an –2 , ..., a1 , a0 ist. Beachten Sie hierbei, dass der Koeffizient vor der höchsten Potenz xngleich 1 sein muss – sonst wäre ja auch 3/7 als Lösung der Gleichung 7 · x – 3 = 0 eine ganzalgebraische Zahl. Warum aber gerade diese Definition? Nun, solch eine Polynomgleichung mit ganzzahligen Koeffizienten (und einer 1 als Koeffizient vor der höchsten Potenz) hat eine Eigenschaft, die der Algebraiker auch in anderen Zahlkörpern nicht missen mag: Jede rationale Lösung einer derartigen Gleichung ist nämlich automatisch eine ganze Zahl. Und so soll es auch in den quadratischen Zahlkörpern bleiben. Die Rettung der lieb gewordenen Eigenschaft erkauft man sich allerdings _ mit einer Seltsamkeit, die schon in den quadratischen Zahlkörpern zu Tage tritt. In Q(√ d ) sind sämtliche nicht-rationalen Elemente _bereits Lösungen von quadratischen Gleichungen, was wir durch Einsetzen von x = a + b · √ d in die Gleichung x2– 2ax + (a2– b2d) = 0 unmittelbar einsehen. Der Koeffizient vor der höchsten Potenz x2 ist dabei wunschgemäß 1. Sind _ a und b ganze Zahlen, so auch alle Koeffizienten der Gleichung, und damit ist a + b · √ d (a, b ganze Zah- Dedekinds Theorie der Ideale len) eine ganzalgebraische Zahl. Sind umgekehrt die Koeffizienten –2a und a2 – b2 d ganzzahlig, so haben wir zwei Fälle zu betrachten, je nachdem ob a bereits eine ganze Zahl oder ein Bruch der Form a = u_2 mit einer ungeraden ganzen Zahl u ist. Im ersten Fall (a ist ganz) gibt es keine Probleme, denn dann ist auch (a2– b2d) – a2= b2d ganzzahlig, so dass b ebenfalls eine ganze Zahl sein muss. Im zweiten Fall ( a = u_2 mit ungeradem u) muss, damit a2 – b2 d ganzzahlig sein kann, b die gleiche Gestalt haben: b = _v2 mit ungeradem v. Wir schreiben u = 2n + 1 und v = 2m + 1, und setzen in den Ausdruck a2– b 2 d ein: 13 13 13 13 13 13 13 13 2 2 + 1 2 2m +1 2 –d _____ _____ a2 – b2 d = u_2 – _v2 · d = 2n – · d = [n2 + n – (m2 + m)d] + 1____ . 2 2 4 Der Ausdruck in den eckigen Klammern ist ganzzahlig. Daher hängt die Ganzzahligkeit – d von a2 – b2 d nur davon ab, ob 1____ eine ganze Zahl ist (also Division von d durch 4 den 4 Rest 1 ergibt) oder nicht. Damit erhalten wir in einigen quadratischen Zahlkörpern mehr ganzalgebraische Zah_ 3______ + 7√ 5 len als erwartet. Ist etwa d = 5, so ist die Zahl ganzalgebraisch, da sie eine Lösung 2 2 13 143 13 2 13 13 1 43 der Gleichung 0 = x2 – 2 · 3_2 · x + 3_2 – 7_2 · 5 = x2 – 3x – 59 ist. Immerhin, so halten wir ohne Beweis fest, haben wir jetzt alle ganzrationalen Zahlen in quadratischen Zahlkörpern gefunden. Es sei d eine quadratfreie natürliche Zahl7. _ Sind a und b ganze Zahlen, dann ist die Zahl a = a + b · √ d ganzalgebraisch. Ergibt Division von d durch 4 den Rest 2 oder 3, so sind dies schon alle im quadratischen _ Zahlkörper Q(√ d ) liegenden ganzalgebraische Zahlen. Ergibt Division von d durch 4 den Rest 1, so sind außer den Genannten auch die Zahlen _ a_______ +b·√ d ; a, b ungerade, ganzalgebraisch. Mehr gibt es nicht. 2 Um die umständliche Sprechweise „ganzalgebraische Zahl aus dem quadratischen Zahl_ körper Q(√ d ) “ zu vermeiden, benennen wir die Menge _all dieser Zahlen kurzerhand mit W√ _d . Außerdem vereinbaren wir, dass – analog zu Q(√ d ) – für eine komplexe Zahl ϑ die Menge aller Zahlen der Form a + b · ϑ; a, b ganze Zahlen, mit Z(ϑ) bezeichnet wird. Dann erhalten wir den ersten Teil unseres Ergebnisses in folgender, sehr viel einprägsamerer Form. _ Ist d eine quadratfreie Zahl mit Rest 2 oder 3 bei Division durch 4, so gilt W√ _d = Z(√ d ) . In einigen Zeilen Rechnerei (die hier ausgelassen werden) erhalten wir auch den zweiten Teil. 63 Dedekinds Theorie der Ideale _ 13 13 + √ d Ist d eine quadratfreie Zahl mit Rest 1 bei Division durch 4, so gilt W√ _d = Z 1_____ . 2 Wir halten inne und vergegenwärtigen uns den Inhalt der letzten Aussage für d = –7. Dann ist d –1 = –7 –1 = –8 durch 4 teilbar. Somit ergibt Division von d durch 4 in der Tat den Rest 1. Damit ist hier der kurze Satz im letzten Kasten zuständig, Satz be__ und dieser __ sagt Folgendes: Sind a und b rationale Zahlen (dann liegt a + b · –7 in Q ( –7 ) ), und ist a √ √ __ n n–1 + b · √ –7 die Lösung einer Gleichung __ x + an –1 · x + ... + a1 · x + a0 = 0 mit __ganzzahligen Koeffizienten (das heißt a + b · –7 ist eine ganzalgebraische Zahl in Q ( –7 ) bzw. a + b · √ √ __ ), dann gibt es ganze Zahlen u und v mit √ –7 ist ein Element von W√ __ –7 __ __ __ 1 + √ –7 a+b·√ –7 = u + v · ______ 2 __ __ 13 __ 13 1 + √ –7 (das heißt a + b · √ –7 ist ein Element von Z ______ 2 ). Sind umgekehrt u und v ganze Zahlen, 13 1 + √ –7 1 + √ –7 so ist u + v · ______ 2 (eine Zahl aus Z ______ 2 ) die Lösung einer Gleichung xn+ an –1 · xn–1 + 13 64 __ ... + a1 · x + a0 = 0 mit (das heißt a + b · √ –7 ist eine ganzalgeb__ ganzzahligen Koeffizienten __ raische Zahl in Q(√ –7 ) bzw. a + b · √ –7 ist ein Element von W√ __ –7 ). Wir sehen daran, dass durch die Rückführung der Symbole und Benennungen auf ihre Bedeutung aus einem recht kurzen Satz eine ziemlich lange Erläuterung wird. Das ist in der Mathematik (und nicht nur da) völlig normal – die Aufgabe von Bezeichnungen und Symbolen ist es, recht kurze und einprägsame Sätze bilden zu können; so einen Satz kann aber nur der verstehen, der aus den Bezeichnungen und Symbolen die ursprüngliche Bedeutung zurückgewinnen kann. Der nächste Punkt auf unserem Programm besteht in einer genaueren Betrachtung von W√ d . Zunächst stellen wir fest, dass wir in W√ _d ganz normal addieren, subtrahieren und multiplizieren können und dabei stets wieder Elemente aus W√ _d erhalten. Dass hierbei die gewohnten Rechenregeln gelten, bedarf nahezu keiner Erklärung – denn diese Regeln gelten in den komplexen Zahlen und übertragen sich natürlich auf die Teilmenge W√ _d . Nur mit der Division, deren Ergebnisse im allgemeinen nicht mehr in W√ _d liegen, hapert es. Der Mathematiker sagt an dieser Stelle „W√ _d ist ein Ring“ und meint damit genau das, was wir eben gesagt haben8. _ _ Teilbarkeit __ und die Einheiten (Teiler der 1) des Ringes W√ d werden so wie im Beispiel _ W√ –1 = Z(√ –1 ) eingeführt, genauer: Sind a und b aus W√ d , so heißt a ein Teiler von b, wenn es eine Zahl g aus W√ _d mit b = a · g gibt. Für von 0 verschiedene Zahlen a ist dies gleichbeb deutend damit, dass g = — in W√ _d liegt. Eine Einheit a bzw. einen Teiler der 1 erkennt man a _ 1 somit daran, dass der Kehrwert — __ von Einheiten a wieder ein Element von W√ d ist. Beispiele _ __ sind (in jedem W√ d ) die Zahlen 1 und –1. In W√ –1 hatten sich bereits ± √ –1 als weitere Ein__ Dedekinds Theorie der Ideale heiten vorgestellt. Für positive d ist die Angelegenheit nicht so einfach überschaubar. So ist _ 8 + 3 · √ 7 eine Einheit in W√ _7 , denn schließlich liegt ihr Kehrwert _ _ _ _ 8 –_ 3 · √ 7 8 – 3 · 7 8 – 3 · √ 7 √ 1 _ _________________ _______ _______ = _ = = _______ = 8 – 3 · √ 7 8 + 3 · √ 7 wieder in W√ _7 . (8 + 3 · √ 7 ) · (8 – 3 · √ 7 ) 8 2 – 32 · 7 1 – _ Die _ Norm in W _ √ d erhalten wir auf _ einem kleinen Umweg: Wir nennen die_Zahl a = a – b · d konjugierte Zahl. Die Konjugation in Q(√ d ) passiert daher √ d die in Q(√ d ) zu a = a + b · √ _ _ „formal“, indem man die Lösung √ d der Gleichung x2 – d = 0 gegen die zweite Lösung – √ d austauscht. Da wir ohnehin diese beiden Lösungen nicht recht auseinander halten können, _ sollte dieser Austausch für die Struktur des Rechenbereichs Q(√ d ) ohne weitere Auswirkung sein. Tatsächlich gelten die leicht nachrechenbaren Gleichungen ––––– – –  a+b=a+b _ ––––– – – a · b = a · b für alle a, b aus Q(√ d ) . = a=a Jetzt setzen wir N_ (a) = a · a– als Norm von __ die _ a fest; es gilt _ daher _ ––––––––––  N (a + b · √ d ) = (a + b · √ d) · (a + b · √ d ) = (a + b · √ d ) · (a– b · √ d ) = a2 – db2 . –––– – – · b · –b = N (a) · N (b) erhalten wir diejeWegen N (a · b) = a · b · a · b = a · b · a– · b = a · a __ nige Eigenschaft der Norm geschenkt, die uns schon in Z(√ –1 ) so hilfreiche Dienste erwiesen hat. Speziell gilt wieder, dass die Norm einer ganzalgebraischen Zahl eine gewöhnlich ganze Zahl ist, und dass sich Teilbarkeit von Elementen aus W√ _d auf Teilbarkeit der Normen überträgt. Weiterhin können wir feststellen, dass genau den Einheiten in W√ _d die Norm ±1 zu– = 1 folgt unmittelbar, dass a ein Teiler von 1 ist. kommt. Klar, denn aus ± N(a) = a · (±a) Umgekehrt teilt die Norm einer Einheit a die Norm von 1, was N(a) = ±1 nach sich zieht. So gerüstet können wir das Eingangsbeispiel dieses __ __Abschnitts erneut in Angriff neh__ __ men und zeigen, dass die Elemente x + √ –2 und x – –2 für ungerades x in W = Z(√ –2 ) √ –2 √ __ stets teilerfremd sind. Denn ist a __ = a + b · √ –2 ein gemeinsamer Teiler dieser Zahlen, so __ __ teilt a auch deren Differenz (x + √ –2 ) – (x – √ –2 ) =__ 2 · √ –2 . Somit muss die Norm __ N(a) = N(a + b ·√ –2 ) = a2 + 2b2 von a ein Teiler von N(2 · √ –2 ) = 2 · 22 = 8 sein. Der Betrag der ganzen Zahlen a und b darf daher sein; eine nähere Inspektion liefert a = ±1 (also Einheiten), a = ±2, a = __ nicht sehr groß__ ±√ –2 und a = ±2 · √ –2 als einzige Möglichkeiten. __ __ Bis auf a = ±1 ergibt die Division von x + __ –2 , x ≠ 0, durch a kein Element aus W = Z( –2 ), so dass jeder gemeinsame Teiler von x √ __ √ √ –2 __ __ + √ –2 und __ x – √ –2 eine Einheit ist. Das wiederum besagt gerade die Behauptung „x + √ –2 und x – √ –2 sind teilerfremd“. 65 66 Dedekinds Theorie der Ideale 2. Eulers Fehler, Kummers Ansatz und Dedekinds Ideale 2.1 Ein ernstes Problem Wir fahren mit einem Problem fort, das dem im letzten Abschnitt geschilderten sehr ähnelt. Gesucht sind diesmal sämtliche ganzzahligen Lösungen x und y der Gleichung x2 + 5 = y2 , d.h. wir stellen uns die Frage, wann ein um 5 vermehrtes Quadrat wieder ein Quadrat ist. Wieder zerlegen wir die linke Seite mit__Hilfe der dritten binomischen Formel und erhalten die folgende Gleichung in W√ __ –5 = Z(√ –5 ): ___ __  y2 = (x + √ – 5 ) · (x – √ –5 ) __ Auch den nächsten Schritt kennen wir gut: –5 ein __ Ist a = a + __b · √ __ von den Einheiten ±1 verschiedener gemeinsamer Teiler von x + √ –5 und x – √ –5 in Z (√ –5 ), so sind jedenfalls a __ und b von__0 verschieden, denn sonst ergibt die Division von x__ + √ –5 durch __a kein Element __ von Z (√ –5 ). Außerdem ist a ein Teiler der Differenz __ (x + √ –5 ) – (x – √ –5 ) = 2 · √ –5 ; die Norm N(a) = a2 + 5b2 muss dann ein Teiler · √ –5 = 20) sein. Solche ganzen Zahlen __ von N(2 __ a und b gibt es aber nicht, womit x + √ –5 und x – √ –5 als teilerfremd enttarnt sind. __ Wir zerlegen nun y innerhalb des Rechenbereichs Z(√ –5 ), in ein Produkt__von Primfak__ 2 toren y = p1 · p2 · ... · pn . Hieraus erhalten wir y__ = p1 2 · p2 2 · ... · pn 2 = (x + √ –5 ) · (x – √ –5 ). __ Jeder der Primfaktoren teilt x + √ –5 oder x – √ –5 und aufgrund der Teilerfremdheit kann keiner der Primfaktoren beide Terme teilen. Sind __ __nun etwa p1 , p2 ,..., pk diejenigen Primfaktoren, die x + –5 teilen, so erhalten wir x + –5 = p1 2 · p2 2 ·...· pk 2 = (p1 · p2 ·...· pk )2 und √ √ __ __ __ x – √ –5 = (pk+1 · pk +2 ·...· pn )2 . Also ist x + √ –5 ein Quadrat in Z(√ –5 ); wir finden daher ganze Zahlen a und b mit __ __ __ x + √ –5 = (a + b · √ –5 ) 2 = (a2 – 5b2 ) + 2ab · √ –5 . __ Aus der letzten Gleichung folgt durch Vergleich der Faktoren vor √ –5 aber die Bedingung 2ab = 1, was in den ganzen Zahlen einfach nicht zu machen ist. Daher gibt es überhaupt keine ganze Zahl x, für die x2 + 5 wieder eine Quadratzahl ist – oder doch? In unserer Rechnung muss ein Wurm stecken! Setzen wir nämlich x = 2, so erhalten wir wegen x2 + 5 = 22 + 5 = 9 = 32 doch eine ganzzahlige Lösung der Gleichung. Nun ist nach erneuter sorgfältiger Prüfung die einzige faule Stelle in unserer Argumentation die, an der wir y in „Primfaktoren“ zerlegt haben: Weder haben wir genau erläutert, was denn eigentlich eine Primzahl ist, noch haben wir gezeigt, dass sich tatsächlich jede Zahl y als Produkt solcher Primzahlen schreiben lässt. Klar, in den ganzen Zahlen kennen wir den Begriff der Primzahl und auch die Zerlegung einer ganzen Zahl in Primfaktoren ist uns ___ geläufig. Und wahr ist auch, dass sich unser neuer Zahlbereich Z(√ – 5 ) in vielerlei Hinsicht wie der alte Bereich der ganzen Zahlen verhält – aber eben nicht in jeder Hinsicht! In dieser Beziehung verhält sich die Mathematik recht unwirsch: Solange wir den Begriff der Primzahl in den neuen Rechenbereichen nicht unmissverständlich festgelegt haben, dürfen wir auch keinerlei Aussagen über Primzahlen machen. Nach einer solchen Festle- Dedekinds Theorie der Ideale gung dürfen wir immer noch nicht sagen, dass „alles genauso wie in den ganzen Zahlen geht“, sondern müssen vielmehr zum einen mit Hilfe der Begriffe klar formulierte Aussagen aufstellen und zum anderen deren Gültigkeit nachweisen. 2.2 „Unzerlegbare Zahl“ versus „Primzahl“ Wir übertragen zunächst den Begriff der „Primzahl“ aus der Welt der ganzen Zahlen in die neue Welt des Rechenbereichs W√ _d . Wie das zu geschehen hat, haben wir für den Fall d = –1 bereits besprochen und bei dieser Gelegenheit auch schon angedeutet, dass wir zwei verschiedene Festlegungen __ des Wortes „Primzahl“ unterscheiden wollen (und, im Gegensatz zur Situation in Z(√ –1 ) , auch müssen). Hier nun der erste der zuständigen Begriffe: Ein Element a von W√ _d , das keine Einheit ist, heißt unzerlegbar oder irreduzibel 9 , wenn in jeder Zerlegung a = b · g von a einer der beiden Faktoren eine Einheit ist. Bitte passen Sie hierbei höllisch auf, in welchem Rechenbereich Sie sich __befinden! So __ ist zwar 2__ in Z irreduzibel, aber die gleiche Zahl 2 lässt sich in W = Z( –1 ) zerlegen √ √ –1 ___ ___ ___ in __ __ 2 = (1 + √ –1 ) · (1 – √ –1 ) . In W√ –2 = Z(√ – 2 ) ist 2 ebenfalls zerlegbar: √ – 2 . In ___ ___2 = (–√ – 2 ) · ___ W√ ___ = Z( – 5 ) wiederum ist 2 irreduzibel, denn ist 2 = (a + b · – 5 ) · (x + y · – 5 ) eine √ √ √ – 5 Zerlegung, so zeigt die Betrachtung der Normen ___ ___ N(2) = 4 = N(a + b · √ – 5 ) · N(x + y · √ – 5 ) = (a2 + 5b2 ) · (x2 + 5y2 ), dass b und y gleich 0 sein müssen (sonst werden _ die ganzzahligen Faktoren auf _ der rech_ ten Seite der Gleichung zu groß). In W = Z( 3 ) dagegen zeigt 2 = (5 + 3 · √ √ 3 ) · (–5 + 3 · √ 3 _ √ 3 ) die Zerlegbarkeit von 2. Jedenfalls bedeutet „irreduzibel“, dass die betreffende Zahl keine „echten“ Teiler besitzt, also genau die Eigenschaft besitzt, die innerhalb der ganzen Zahlen die Primzahlen auszeichnet. Damit können wir die Zerlegung eines beliebigen Elements a des Rings W√ _d in irreduzible Faktoren genau wie in Z nachweisen: Entweder ist a bereits irreduzibel (dann sind wir fertig) oder a lässt sich echt zerlegen in a = b · g. Die beiden Faktoren sind entweder beide irreduzibel (dann sind wir fertig) oder einer der beiden (sagen wir g) lässt sich wieder in ein Produkt von zwei Nicht-Einheiten j und y zerlegen. Im zweiten Fall erhalten wir a = b · j ·y und machen so weiter wie oben: Entweder sind die drei Faktoren irreduzibel, oder ... – und so weiter. Jetzt müssen wir nur noch dafür Sorge tragen, dass dieses Verfahren irgendwann ein Ende findet 10, und haben zum Schluss die gesuchte Zerlegung von a in irreduzible Faktoren dastehen. Da bei jedem Schritt des Verfahrens ein Faktor hinzukommt, müssen wir hierfür uns nur vergewissern, dass die Anzahl n von Nicht-Einheiten d1 , d2 ,..., dn in einer (beliebigen) Zerlegung a = d1 · d2 ·...· dn von a nicht 67 68 Dedekinds Theorie der Ideale beliebig groß werden kann. Da nur Einheiten die Norm ±1 haben, zieht aber die Zerlegung a = d1 · d2 ·...· dn eine Zerlegung N(a) = N(d1 ) · N(d2 ) ·...· N(dn ) der Norm in echte Teiler N(d1 ), N(d2 ),..., N(dn ) nach sich – und diese Zerlegung findet innerhalb des Rechenbereichs der ganzen Zahlen statt. Damit kann die Anzahl n irreduzibler Faktoren in a = d1 · d2 ·...· dn nicht größer sein als die Anzahl der (gewöhnlichen) Primfaktoren der ganzen Zahl N(a). Wir fassen zusammen: Jede Zahl a aus W√ _d lässt sich in W√ _d als Produkt a = d1 · d2 ·...· dn irreduzibler Faktoren d1 , d2 ,..., dn schreiben. Diese Zerlegung ist aber nur ein schwacher Ersatz für die gewohnte Primfaktorzerle__ gung in den ganzen Zahlen! Schreiben wir die Zahl y innerhalb von Z(√ –5 ) als Produkt y = p1 · p2 · ... · pn irreduzibler Faktoren, so erhalten y2 = x2 + 5 selbstverständlich ___ wir aus ___ 2 2 2 2 auch die Gleichung y = p1 · p2 · ... · pn = (x +√ – 5 ) · (x – √ – 5 ). Hieraus ___ ___aber folgern zu wollen, dass p1 ein Teiler einer der beiden Faktoren x + √ – 5 oder x – √ – 5 sein muss, ist schlichtweg falsch. Unser (und übrigens auch Leonhard Eulers) Fehler liegt daher in dem Irrtum, dass irreduzible Faktoren sich so verhalten wie Primzahlen: Ein Element p von W√ _d , das keine Einheit ist, heißt Primzahl in W√ _d , wenn gilt: Teilt p ein Produkt b · g , dann teilt p wenigstens einen der beiden Faktoren b oder g. Jetzt müssen wir noch viel mehr darauf Acht geben, über welchen Rechenbereich wir reden! So können wir über die Zahl 3 (die uns eben noch wohlvertraut und unkompliziert vorgekommen ist) je nach Rechenbereich ganz unterschiedliche Aussagen treffen: · · · · In den ganzen Zahlen und in W√ __ –1 ist 3 sowohl irreduzibel als auch eine Primzahl. _ _ In W√ _7 gilt 3 = (2 + √ 7 ) · (–2 + √ 7 ) und damit ist 3 nicht irreduzibel und auch keine Primzahl. _ In W√ _3 ist 3 „sogar“ ein Quadrat: 3 = (√ 3 ) 2 und damit ebenfalls weder irreduzibel noch eine Primzahl. In W√ __ –5 ist 3 zwar irreduzibel, aber trotzdem keine Primzahl, was wir etwas weiter unten begründen werden. Bei diesen verschiedenen Möglichkeiten ist es tröstlich zu wissen, dass jede Primzahl p in W√ _d auch irreduzibel zu sein hat. Ist nämlich p = b · g eine Zerlegung, so teilt p das Produkt b · g und damit auch einen der Faktoren, sagen wir g. Damit erhalten wir g = d · p und damit wiederum durch Einsetzen p = b · g = b · d · p. Kürzen liefert nun 1 = b · d, womit der Faktor b der Zerlegung p = b · g als Einheit enttarnt ist. Dedekinds Theorie der Ideale Umgekehrt gilt das nicht! Ist nämlich p lediglich irreduzibel, und teilt p das Produkt b · g, so erhalten wir hieraus die Gleichung a · p = b · g mit ___ passendem a. Und bei dieser Gleichung hängen wir fest. Hierzu ein Beispiel aus Z(√ – 5 ), das wir in kleinen Schritten untersuchen: ___ Zunächst stellen wir fest, dass es in Z( – 5 ) keine Zahl mit___ Norm 3 gibt. √ ___ Wäre nämlich a + b · √ – 5 eine derartige Zahl, so ist N(a + b · √ – 5 ) = a2 + 5b2 = 3. Da a und b ganze Zahlen sind, muss b = 0 gelten, da anderenfalls schon 5b2wenigstens 5 betragen würde. Aus b = 0 folgt aber a2 = 3, was für keine ganze Zahl a gelten kann. ___ Damit erhalten wir, dass 3 in Z(√ – 5 ) irreduzibel ist, denn jede Zerlegung 3 = a · b in ___ Z(√ – 5 ) zieht eine entsprechende Zerlegung 9 = N(3) = N(a) · N(b) der Normen nach sich. Da keine Zahl die Norm 3 haben kann, muss eine der beiden Normen N(a) und N(b) gleich 1 sein – damit ist aber a beziehungsweise b eine Einheit. ___ das entsprechende Element ___ ___ Nun teilt 3 in Z(√ – 5 ) das Produkt (2 + √ – 5 ) · (2 – √ – 5 ), was wir direkt aus der Gleichung ___ ___ 3 · 3 = 9 = (2 + √ – 5 ) · (2 – √ – 5 ) ablesen. Da der Quotient ___ ___ 2______ ± √ – 5 2_ 1_  = 3 ± 3 · √ – 5 3 ___ ___ nicht in Z(√ – 5 ) liegt, ist 3 aber kein Teiler von 2 ± √ – 5 . Wir erhalten insgesamt: ___ In Z(√ – 5 ) ist die Zahl 3 zwar irreduzibel, aber keine Primzahl. ___ Es ist sogar schlimmer: Keine einzige Primzahl___ in Z(√ – 5 ) teilt 3. Denn wäre p so ein Teiler, so wäre 3 = a · p mit passendem a aus Z(√ – 5 ). Da 3 irreduzibel ist, wäre dann a eine Einheit und 3 doch eine Primzahl – ist es aber nicht. 2.3 Kummers Idee: Die idealen Teiler ___ ___ ___ Es ist an der Zeit, die uns in Z(√ – 5 ) so ärgernde Gleichung 3 · 3 = 9 = (2 + √ – 5 ) · (2 – √ – 5 ) nochmals genau zu betrachten. Unsere Schwierigkeiten rühren von der Tatsache her, dass ___ sich die Zahl 9 in Z(√ – 5 ) auf zwei wesentlich verschiedene Arten in irreduzible Faktoren zerlegen lässt, die allesamt keine Primzahlen sind. Dagegen hätten wir erwartet, dass es zwei Zahlen j und y gibt, die den Bedingungen j · y = 3 ___ j2 = 2 + √ ___ – 5 2 y = 2 – √ – 5 genügen – dann nämlich wäre ___ ___ 32 = (j · y)2 = j2 · y2 = (2 + √ – 5 ) · (2 – √ – 5 ). 69 70 Dedekinds Theorie der Ideale ___ Solche Zahlen gibt es (allerdings natürlich nicht in Z(√ – 5 )): __  ___ __ ___ √ 10 + √ – 2 √ 10 – √ – 2 j = ________ und y = ________  2 2 4 2 erfüllen sämtliche Anforderungen und sind zudem als Lösungen der Gleichung ___ x – 4 · x + 9 = 0 ganzalgebraische Zahlen. Mit dieser Zerlegung verlassen wir aber Q(√ – 5 ) und gehen in einen nicht-quadratischen Zahlkörper, in dem das Hantieren mit ganzalgebraischen Zahlen noch viel schlimmer wird. Diese Beobachtung machte auch der Mathematiker Ernst Eduard Kummer (1810-1883). Sein Lösungsvorschlag in dieser Situation war ebenso einfach wie wirkungsvoll: Anstelle die Zerlegung 3 = j · y mit konkreten Werten für j und y anzugeben, nehmen wir diese Symbole einfach mit dazu und sprechen von „idealen Teilern“ (im Gegensatz zu den „realen“, wirklich vorhandenen Teilern). Glücklicherweise kennen wir dieses Erweitern eines Zahlbereichs ja schon vom Übergang von den rationalen Zahlen zu einem der algebraischen Zahlkörper, so dass wir uns Einzelheiten ersparen können. Auch wollen wir an dieser Stelle keine Rechenschaft darüber ablegen, ob es in jeder Ernst Eduard Kummer (1810–1883) ähnlichen Situation eine derartige Erweiterung überhaupt gibt. Stattdessen sehen wir uns an, wie die Vermeidung von unangenehmen Rechnungen mit konkreten Zahlen erst der Auslöser für ein vertieftes Verständnis eines mathematischen Sachverhaltes ist – wie so häufig! Wir stellen uns daher___vor, wir hätten eine passende Erweiterung (nennen wir sie K) des Rechenbereichs Q(√ – 5 ) gefunden, in dem es einen vernünftigen Begriff von „ganzen ___ Zahlen“ gibt. Hierbei soll natürlich jedes Element von Z(√ – 5 ) nach wie___ vor als ganze Zahl angesprochen werden. Umgekehrt soll jede in K ganze Zahl, die zu Q( – 5 ) gehört, bereits √ ___ in Z(√ – 5 ) liegen. Zu guter letzt möge es in K ganze Zahlen j und y geben, die folgende Gleichungen erfüllen: ____ ___ j · y = 3, j2 = 2 + √ – 5 und y2 = 2 – √ – 5 . ___ Wir sehen uns den gemeinsamen „idealen Teiler“ j von 3 und 2 + √ – 5 an. Da uns der neue Rechenbereich K nicht wirklich etwas angeht, wollen wir von j auch nur die ___ „Schatten“ in Q( – 5 ) sehen. Vor allen Dingen interessiert uns, welche Zahlen g aus √ ___ Z(√ – 5 ) durch j teilbar sind – aber das, bitteschön, wollen wir in unserem Rechenbereich Dedekinds Theorie der Ideale ___ Q(√ – 5 ) feststellen können! Damit taugt der Ansatz „g ist durch j teilbar, falls g = j · ϑ ___ mit einer ganzen Zahl ϑ gilt“ für unsere Zwecke nichts, weil wir ein derartiges ϑ in Q(√ – 5 ) nicht___ finden. Jetzt hilft nur noch ein Trick: Wir multiplizieren die Gleichung g = j · ϑ mit 2 – √ – 5 = y2 und erhalten ___ g · (2–√ – 5 ) = j · ϑ · y2 = (j · y) · (ϑ · y) = 3 · (ϑ · y). Als Produkt ganzer Zahlen ist ϑ · y ebenfalls eine ganze Zahl. Außerdem lesen wir ab, ___ dass g · (2–√ – 5 ) ϑ · y = ________ 3 ___ ___ ein Element von Q(√ – 5 ) ist, da die rechte Seite nur mit Zahlen aus ___ Q(√ – 5 ) gebildet wird. Vereinbarungsgemäß sind die in K ganzen Zahlen, die auch in Q( – 5 ) liegen, bereits Ele√ ___ mente von Z(√ – 5 ). Rekapitulieren wir: ___ Der gemeinsame „ideale Teiler“ dann ein Teiler einer belie___ j von 3 und 2 + √ – 5 ist genau ___ bigen ganzen Zahl g aus Z(√ – 5 ) , wenn 3 ein Teiler von g · (2–√ – 5 ) ist. Ob 3 aber ein Teiler ___ ___ g · (2–√ – 5 ) ist oder nicht, das können wir in Z(√ – 5 ) überprüfen! ___ ___ Dazu nehmen wir eine Zahl g = x + y · √ – 5 . Ist nun 3 ein Teiler von g · (2–√ – 5 ), so liegt die Zahl ___ ___ ___ ___ +y·√ – 5 ) · (2 – √ – 5 ) 2x + 5y 2y –x g ________ · (2–√ – 5 ) (x  = __________________ = ______ + ____ · √ – 5 ___ 3 3 3 3 in Z(√ – 5 ). Dann müssen die beiden Zahlen 2x + 5y = (2y – x) + 6x und 2y – x durch 3 teilbar sein. Dies wiederum ist offenbar genau dann der Fall, wenn 2y – x ein Vielfaches von 3 ist. Nochmals geben wir eine Zusammenfassung: ___ ___ Genau die Zahlen g = x + y · √ – 5 aus Z(√ – 5 ), bei denen 2y – x ein Vielfaches von 3 ist, werden durch den „idealen Faktor“ j geteilt. Wir nennen die Menge dieser Zahlen I und ___ beachten, dass I ganz in Z(√ – 5 ) enthalten ist. Statt___ des „idealen Faktors“ j können wir daher die Menge I der durch j teilbaren Zahlen aus ___ Z(√ – 5 ) betrachten, ohne Z(√ – 5 ) zu verlassen. Dedekinds wirklich geniale Leistung, auf die wir im nächsten Abschnitt zu sprechen kommen, besteht nun, derlei von „idealen Teilern“ herrührenden Teilmengen zu kennzeichnen – und das nur mit Ausdrücken, für deren Beschreibung ___ Z(√ – 5 ) völlig ausreichend sind. 2.4 Dedekinds Geniestreich: Die Geburt des Idealbegriffs Wir betrachten nunmehr wieder den Zahlbereich W √ _d . In diesem nehmen wir eine Teilmenge I her, die aus denjenigen Zahlen besteht, die von einer – sei es „idealen“ oder 71 72 Dedekinds Theorie der Ideale „gewöhnlichen“ – Zahl j geteilt wird. Eine derartige Teilmenge nennt Dedekind ein Ideal von W√ _d . Dedekind stellt nun fest, welche wesentlichen Eigenschaften eine solche Menge haben sollte: 1.) Die Null wird von j geteilt. 2.) Mit zwei Zahlen werden auch Summe und Differenz durch j geteilt. 3.) Mit einer Zahl werden auch beliebige Vielfache dieser Zahl durch j geteilt. Das können wir unmittelbar übersetzen: Eine Teilmenge I von W√ _d heißt ein Ideal, wenn folgende Forderungen erfüllt sind: 1.) Die Null liegt in I. 2.) Sind a und b aus I, so liegen auch Summe a + b und Differenz a – b wieder in I. 3.) Ist a aus I und ist g ein beliebiges Element von W√ _d , so liegt das Produkt a · g in I. Die bislang gelernten Begriffe wollen wir jetzt Stück für Stück in eine neue Sprache übersetzen, in der die Ideale die Hauptrolle spielen. Zunächst stellen wir fest, welche Ideale den Zahlen j aus W√ _d entsprechen: Ist j eine Zahl aus W√ _d , so bezeichnet j · W√ _d die Menge aller Vielfachen j · a ; a aus W√ _d . Dann ist j · W√ _d ein Ideal 11 . Ideale dieser Form bezeichnen wir als die Hauptideale von W√ _d . Um mit dem neuen Begriff recht gut vertraut zu werden, sehen wir uns als Beispiel einige Hauptideale in dem Rechenbereich Z der ganzen Zahlen 12 an. Dort haben wir etwa das Hauptideal 2 · Z, das aus allen Vielfachen der 2 und damit aus allen geraden Zahlen besteht: 2 · Z : ..., –14, –12, –10, –8, –6, –4, –2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ...  An dieser Stelle ist anzumerken, dass das zu –2 gehörende Hauptideal genau die gleichen Zahlen enthält. Ganz allgemein können wir sagen, dass die Hauptideale zu zwei Zahlen a und b genau dann gleich sind, wenn sich a und b nur um eine Einheit unterscheiden (also b = a · g mit einer Einheit g gilt). Ein weiteres Hauptideal ist das zur Zahl 6 gehörende, das die durch 6 teilbaren Zahlen enthält:  6 · Z : ..., –24, –18, –12, –6, 0, 6, 12, 18, 24, ... Jede durch 6 teilbare Zahl ist natürlich erst recht durch 2 teilbar. Daher ist es kein Wunder, dass 6 · Z eine Teilmenge von 2 · Z ist. Und das gilt nicht nur speziell für die Zahlen Dedekinds Theorie der Ideale 2 und 6 oder nur in den ganzen Zahlen, sondern ganz allgemein für die zu zwei Elementen j und y aus W√ _d gehörenden Hauptideale j · W√ _d beziehungsweise y · W√ _d : Ist j ein Teiler von y, so ist jedes Vielfaches von y erst recht ein Vielfaches von j. In diesem Fall umfasst daher j · W√ _d das Ideal y · W√ _d . Ist umgekehrt y · W√ _d eine Teilmenge von j · W√ _d , so liegt insbesondere y = y · 1 in j · W√ _d , womit y ein Vielfaches von j beziehungsweise j ein Teiler von y ist. Kurz und griffig können wir für die Ideale sagen: Teilen heißt umfassen. Um nun den Begriff der Teilbarkeit ganz allgemein für sämtliche Ideale einzuführen, lassen wir uns von der eben beobachteten Situation leiten: Sind I und J zwei Ideale von W√ _d , so heißt I ein Teiler von J, wenn J in I enthalten ist. 2.5 Der Idealbegriff auf dem Prüfstand Nachdem wir die Teilbarkeit von Zahlen mit Hilfe der Hauptideale ausdrücken können, haben wir hoffentlich ein wenig Zutrauen zu dem Begriff gefasst. Aber trotzdem haben wir Ideale nicht für diese wohlvertraute Situation eingeführt, sondern wollten damit eine Präzisierung des Begriffs des „idealen Teilers“ von Kummer in der Hand haben. Daher ist es an der Zeit, dem neuen Begriff in dieser Beziehung sehr genau auf den Zahn zu fühlen. Wir erinnern Abschnitt 2.3: Dort hatten wir festgestellt, dass ___ uns an das Beispiel im ___ ___ in W√ – 5 = Z(√ – 5 ) die Zahlen 3 und 2 + √ – 5 einen gemeinsamen „idealen Teiler“ j besitzen.___ Weiterhin haben wir uns überlegt, dass___ die Menge I der durch j teilbaren Zahlen aus Z(√ – 5 ) genau aus denjenigen g = x + y · √ – 5 besteht, bei denen der Ausdruck 2y – x ein Vielfaches von 3 ist. Wenn die Ideale nun tatsächlich etwas mit „idealen Teilern“ zu tun haben sollten, dann müssen sich in dieser Situation folgende Behauptungen zeigen lassen: ___ 1.) Die Menge I der durch j teilbaren Zahlen ist ein___ Ideal in Z(√ – ___ 5 ). ___ 2.) Das Ideal I ist ein Teiler der Hauptideale 3 · Z(√ – 5 ) und (2 + √ – 5 ) · Z(√ – 5 ). ___ Zu 1.) Die Menge I besteht aus genau denjenigen Zahlen g = x + y · √ – 5 , bei denen 2y – x ein Vielfaches von 3 ist. Für diese Menge können wir die drei Idealeigenschaften schlicht und einfach nachrechnen: ___ · Die Null 0 + 0 · √ – 5 liegt = 0 ist durch 3 teilbar. ___in I, denn 2 · 0 – 0___ · Stammen a = x + y · √ – 5 und b = u + v · √ – 5 aus I, so sind 2y – x und 2v – u durch 3 teilbar. Dann ist auch 2(y ± v) –___ (x ± u) = (2y – x) ± (2v – u) durch 3 teilbar. Daher liegt a ± b = (x ± u) + (y ± v) · √ – 5 ___ ebenfalls in I. · Wir betrachten ein Element g = x + y · – 5 aus I sowie eine beliebige Zahl a = √ __ ___ a + b · √ –5 aus Z(√ – 5 ). Zu zeigen ist, dass auch das Produkt a · g = (xa – 5yb) + 73 74 Dedekinds Theorie der Ideale ___ (xb + ya) · √ – 5 wieder zu I gehört: Zu diesem Zweck berechnen wir 2 · (xb + ya) – (xa + 5yb) = (2y – x) · (a – 2b) + 9yb und stellen fest, dass dieser Ausdruck durch 3 teilbar ist, da 2y – x ein Vielfaches von 3 ist. Damit liegt a · g in der Tat in I. Wie gewünscht haben wir die Idealeigenschaften von I nachgerechnet. ___ ___ Zu 2.) Die Zahlen 3 = 3 + 0 · √ – 5 und 2 + √ – 5 liegen beide im Ideal I. Damit liegt jedes Vielfache___ dieser Zahlen wieder in ___ I (dritte Idealeigenschaft). Demnach sind die Hauptidea___ le 3 ·___ Z(√ – 5 ) und (2 + √ – 5 ) ___ · Z(√ – 5 ) ___ in I enthalten – und somit I ein Teiler sowohl von 3 · Z(√ – 5 ) als auch von (2 + √ – 5 ) · Z(√ – 5 ). Wir stellen fest, dass der Idealbegriff hat, denn ___die erste Probe voll und ___ganz bestanden ___ I ist ein Ideal, das sowohl A = 3 · Z(√ – 5 ) als auch B = (2 + √ – 5 ) · Z(√ – 5 ) teilt. Darüber hinaus wollen wir uns überlegen, dass I sogar ___ der größte gemeinsame Teiler ist. Dazu betrachten wir ein beliebiges Element g = x + y · √ – 5 von I und erinnern uns, dass dann 2y – x ein Vielfaches von 3 ist. Daher + 3n und erhalten ___ finden wir eine ganze ___ Zahl n mit x = 2y ___ g = x + y · √ – 5 = (2y + 3n) + y · √ – 5 = n · 3 + y · (2 + – 5 ). √ ___ Als Vielfaches von 3 liegt der zweite ___ der erste Summand in A = 3 · Z( ___√ – 5 ), während ___ als Vielfaches von (2 + √ – 5 ) aus dem Hauptideal B = (2 + √ – 5 ) · Z(√ – 5 ) stammt. Jedes Element g aus I lässt sich daher als Summe g = a + b mit a aus A und b aus B schreiben. Ist umgekehrt a aus A und b aus B, so liegen a und b in I (denn A und B sind in I enthalten). Damit ist auch a + b ein Element aus I. Daher besteht I genau aus den Summen a + b, mit a aus A und b aus B, wofür wir symbolisch I = A + B schreiben wollen. Ist nun J ein beliebiger gemeinsamer Teiler von A und B, so sind A und B und damit natürlich auch die Summe A + B Teilmengen von J – folglich teilt J das Ideal A + B. Kurzum: ___ ___ ___ Das Ideal I = A + B___ = 3 · Z(√ – 5 ) + (2 + √ – 5 ) · Z( √ – 5 ) ist der größte gemeinsame Teiler der ___ ___ Ideale A = 3 · Z(√ – 5 ) und B = (2 + √ – 5 ) · Z(√ – 5 ). ___ ___ Genauso erhält man den größten · Z(√ – 5 ) + (2 – √ – 5 ) · ___ ___gemeinsamen Teiler ___ J = 3 ___ Z(√ – 5 ) der Hauptideale A = 3 · Z(√ – 5 ) und C = (2 – – 5 ) · Z( – 5 ); Nachrechnen zeigt √ √ ___ dann, dass J aus genau denjenigen x + y · √ – 5 besteht, bei denen 2y + x durch 3 teilbar ist. 2.6 Primideale und ein Ergebnis von Dedekind Um den Begriff „Primideal“ einführen zu können, müssen wir noch kurz erläutern, was wir unter dem Produkt A · B zweier Ideale A und B von W√ _d verstehen wollen. Ähnlich wie bei der im letzten Abschnitt erwähnten Summe könnten wir natürlich sämtliche Produkte a · b mit a aus A und a aus B in einer Menge sammeln – dummerweise ist das Dedekinds Theorie der Ideale Ergebnis im allgemeinen kein Ideal mehr. Man kann nun mit einigen Überlegungen feststellen, dass man zusätzlich noch sämtliche Summen derartiger Produkte mit hinzunehmen muss; dann ist das Produktideal A · B wirklich ein Ideal. Die Rolle der 1 beim Rechnen mit Idealen wird von dem Hauptideal W√ _d = 1 · W√ _d übernommen, das natürlich jedes Ideal teilt. Ein zweites, manchmal recht ärgerliches Ideal ist das Nullideal, das – wie der Name andeutet – lediglich die Zahl 0 enthält. Wir wollen ein von W√ _d und vom Nullideal verschiedenes Ideal in Zukunft als echtes Ideal bezeichnen. Die folgende Festlegung sollte jetzt auf der Hand liegen: Ein echtes Ideal P heißt Primideal, wenn gilt: Teilt P das Produkt A · B zweier Ideale A und B, so teilt P eines der beiden Ideale. Hierzu gleichwertig ist: Liegt ein Produkt a · b in P, so liegt wenigstens einer der Faktoren ebenfalls in P. Natürlich sollte wenigstens das zu einer Primzahl p aus W√ _d gehörende Hauptideal p · W√ _d stets ein Primideal sein. Das stimmt auch! Ist nämlich das Produkt a · b aus p · W√ _d , so ist (nach Definition der Hauptideale) p ein Teiler von a · b. Da p eine Primzahl ist, teilt p eine der beiden Faktoren, etwa a. Damit gehört a zu p · W√ _d und wir haben alles gezeigt. In dem Rest dieses Abschnitts wollen wir lediglich festhalten, dass der Idealbegriff in Zusammenhang mit den ganzalgebraischen Zahlen tatsächlich als Ersatz für die – nicht in jedem W√ _d vorhandene – eindeutige Primfaktorzerlegung eingesetzt werden kann. Das ist (meiner Einschätzung nach) auch dasjenige Resultat Richard Dedekinds, das am Beginn einer wahrhaft stürmischen Entwicklung der algebraischen Zahlentheorie wie auch der abstrakten Algebra stand, und das sich seinen Platz in der Geschichte der Mathematik gesichert hat. Resultat (Dedekind): Ist d eine quadratfreie Zahl, so lässt sich jedes echte Ideal A von W√ _d eindeutig als Produkt von Primidealen schreiben. Die gleiche Aussage gilt ganz allgemein im Ganzheitsring eines algebraischen Zahlkörpers13 und noch allgemeiner in der Klasse der „Dedekindringe“. Mit Hilfe des Idealbegriffs können wir sogar sagen, wann wir in W√ _d den Satz über die eindeutige Zerlegung in Primfaktoren erwarten dürfen. Das ist so schwierig nicht – jede Zahl aus W√ _d lässt sich als Produkt von „idealen Primfaktoren“ schreiben (das besagt ja das oben aufgeführte Resultat von Dedekind). Wenn daher alle „idealen Primzahlen“ (also Primideale) „tatsächliche Zahlen“ (also Hauptideale) sind, so ist alles klar. Es gilt sogar: 75 Dedekinds Theorie der Ideale Resultat: Genau dann ist jedes Element a aus W√ _d eindeutig in ein Produkt von Primelementen zerlegbar, wenn jedes Ideal von W√ _d ein Hauptideal ist. Sollte tatsächlich jedes Ideal ein Hauptideal sein, so nennt man W√ _d kurz und bündig einen Hauptidealring. Beispiele für solche W√ _d sind ___ 1.) der Ring der ganzen Gaußschen Zahlen W√ __ ), –1 = Z(√ – 1 1______ + √ – 3 2.) der Ring der Eisensteinzahlen W√ __ , und nicht zuletzt –3 = Z 2 3.) der Ring der ganzen Zahlen Z. ___ 13 13 76 In diesen drei Rechenbereichen ist also jede Zahl eindeutig in Primfaktoren zerlegbar. Ein Gegenbeispiel, nämlich W√ ___ – 5 , haben wir ebenfalls kennen gelernt. Eine allgemeine Antwort auf die Frage, für welche d der Rechenbereich W√ __d ein Hauptidealring ist und für welche nicht, muss ich schuldig bleiben – es gibt derzeit keine Antwort! Natürlich interessieren sich gerade die Algebraiker und die Zahlentheoretiker brennend für eine solche Antwort, so dass wir mit der Frage am aktuellen Rand der Forschung stehen. 2.7 Die Ideale bewähren sich – zum zweiten ___ Kehren wir ein letztes Mal zum Rechenbereich Z(√ – 5 ) ___ und seinen Idealen ___ ___ I = 3 · Z(√ –___ 5 ) + (2 + √ ___ – 5 ) · Z(√ ___ – 5 ) J = 3 · Z(√ – 5 ) + (2 – √ – 5 ) · Z(√ – 5 ) zurück. Beide Ideale sind sogar Primideale, wie wir es von I sofort nachweisen werden (und gleiche Weise nachrechnen könnten): Liegt nämlich das Produkt (a + b ___ von J auf die ___ ___ ·√ – 5 ) · (x + y · √ – 5 ) = (ax – 5by) + (ay + bx) · √ – 5 in I, so ist 3 ein Teiler der Differenz 2 · (ay + bx) – (ax – 5by) = – (2b – a) · (2x – y) + 9by. Daher muss 3 auch ein Teiler von (2b – a) · (2x – y) sein. Hier ist die Teilbarkeit in den ganzen Zahlen gemeint, und dort ist 3 eine Primzahl und teilt folglich einen ___ der beiden Faktoren, etwa den ersten (2x – y). Das wiederum bedeutet, dass x + y · √ – 5 in I liegt, was den Beweis beendet. Mit ein wenig Rechnerei (die wir hier ___weglassen wollen) ergibt sich noch für die Produkte: I · J = 3 · Z(√___ – 5 ) ___ I · I = (2 + √ –___ 5 ) · Z(√ –___ 5 ) J · J = (2 – √ – 5 ) · Z(√ – 5 ) Wunderbar! Wir haben mit den Idealen ___ I und J also tatsächlich einen vollen Ersatz für die Zerlegung der Zahlen 3 und 2 ± √ – 5 in ihre „idealen Primfaktoren“ gefunden. Schöner kann man sich das nicht mehr wünschen – die Ideale haben ihre erste Probe sogar mit Auszeichnung bestanden! Dedekinds Theorie der Ideale 3. Epilog: Ideale und Zahlbereichserweiterungen Einen auf den ersten Blick seltsam anmutenden Rechenbereich erhält man so: Die einzigen Zahlen sind 0 und 1, mehr gibt es nicht. Die Addition und Multiplikation dieser beiden Zahlen entnimmt man den folgenden Tabellen: + 0 1 0 0 1 1 1 0 · 0 1 0 0 0 1 0 1 So sonderbar ist es dann doch nicht, denn bis auf die Gleichung 1 + 1 = 0 ist alles wohlvertraut. Wenn Sie sich ein wenig mit digitalen Schaltungen auskennen, so haben Sie ohnehin bereits die Multiplikation als das logische „Und“ sowie die Addition als „ExklusivOder“ erkannt. Damit bekommt man eine Ahnung vom Nutzen dieses Rechenbereichs, denn was sich als Schaltung realisieren lässt, das kann man für automatische Verfahren nehmen. Es wundert uns daher nicht, dass der oben eingeführte Rechenbereich bei den Computern eine wesentliche Rolle spielt. Dennoch wollen wir einen mathematischen Standpunkt einnehmen. Genauso, wie der Informatiker die 0 mit „fast keine Spannung“ und die 1 mit „viel Spannung“ übersetzt, werden auch wir die beiden Symbole mit Bedeutungen belegen, indem wir die Symbole 0 und 1 durch die Worte „eine gerade Zahl“ (für 0) beziehungsweise „eine ungerade Zahl“ (für 1) ersetzen. So wird aus der Gleichung „1 + 0 = 1“ der Satz „eine ungerade Zahl plus eine gerade Zahl ergibt eine ungerade Zahl“, während sich „0 · 1 = 0“ als das altvertraute „gerade mal ungerade gleich gerade“ entpuppt. Auf diese Weise ist dann die Gleichung 1 + 1 = 0 auch keine Ungeheuerlichkeit mehr, sondern lediglich die Kurzschreibweise der Aussage „die Summe zweier ungerader Zahlen ist stets gerade“. Hinter dieser Interpretation steht eine recht grobe Einteilung der ganzen Zahlen in zwei Schubladen, nämlich die der geraden Zahlen und die der ungeraden Zahlen. Auf andere Weise ausgedrückt gelten zwei Zahlen als gleich, wenn sie beide gerade oder wenn sie beide ungerade sind. Aus der Schublade der ungeraden Zahlen nimmt man deren prominentesten Vertreter, die 1, und rechnet zunächst 1 + 1 = 2. Anschließend sieht man, dass das Ergebnis 2 aus der geraden Schublade stammt und ersetzt es durch deren Vertreter, die 0. Das führt insgesamt auf die Gleichung 1 + 1 = 0. Die Einteilung von Zahlen in „Schubladen“ und das anschließende Rechnen mit Repräsentanten dieser Schubladen erscheint daher eine wirklich nette Angelegenheit zu sein. Voraussetzung ist allerdings, dass die Schubladen nicht allzu willkürlich gewählt werden – sonst können wir nicht erwarten, dass etwas Sinnvolles entsteht. Wie sinnlos so etwas werden kann, sehen wir anhand einer anderen Einteilung der ganzen Zahlen, diesmal in Primzahlen und Nicht-Primzahlen. Damit geraten wir in ungeheure Schwierigkeiten, denn 77 78 Dedekinds Theorie der Ideale nehmen wir die 2 und 3 aus der Schublade der Primzahlen, so liegt deren Summe 5 wieder in dieser Schublade. Haben wir dagegen nach dem Griff in die Primzahlenschublade die Zahlen 7 und 13 in der Hand, so erhalten wir als Summe 20 und somit eine Nicht-Primzahl. Unser Schubladendenken führt völlig in die Irre, denn keine der beiden Aussagen „Primzahl plus Primzahl gleich Primzahl“ beziehungsweise „Primzahl plus Primzahl gleich NichtPrimzahl“ ist uneingeschränkt richtig. Wir stellen uns natürlich die Frage, welche Schubladeneinteilungen der ganzen Zahlen überhaupt zu einer vernünftigen Addition und Multiplikation führen. Vor der endgültigen Antwort sehen wir uns nochmals den eingangs beschriebenen Rechenbereich an, der die Zahlen in gerade und ungerade Zahlen unterteilt. Diese Einteilung können wir auch folgendermaßen beschreiben: Zwei Zahlen liegen in der gleichen Schublade, wenn ihre Differenz durch 2 teilbar ist, beziehungsweise wenn ihre Differenz im Ideal 2 · Z liegt. Genau das ist dann auch die geeignete Bedingung, die wir verallgemeinern können! Wir nehmen irgendein Ideal I zur Hand und erklären zwei Zahlen a und b zu derselben Schublade gehörend, wenn ihre Differenz im Ideal I liegt, oder – was die gleiche Tatsache ausdrückt – wenn sich a und b nur durch ein Element von I unterscheiden: a = b + g mit g aus I. In diesem Fall nämlich können wir aus zwei Schubladen ganz beliebige Elemente a und b herausgreifen – die Summe a + b liegt immer in der gleichen Schublade; genauer: Ist a – a’ aus I (d.h. a und a’ stammen aus der gleichen Schublade), und ist b – b’ aus I, so liegt auch (a + b) – (a’ + b’) in I (d.h. die Summen a + b und a’ + b’ liegen in der gleichen Schublade). Entsprechendes gilt auch für die Multiplikation. Warum der Aufwand? Könnten wir nicht Rechenbereiche wie den eingangs beschriebenen einfach hinschreiben? Na klar könnten wir, aber trotzdem hat das Schubladendenken einen gewaltigen Vorteil. Wir kennen nämlich die Rechengesetze in den ganzen Zahlen, und diese übertragen sich automatisch. So gilt etwa das Distributivgesetz a · (b + c) = a · b + a · c ganz automatisch im neuen Rechenbereich, da wir „eigentlich“ auch dort mit ganzen Zahlen rechnen. Dazu müssen wir nicht a, b und c in jeder denkbaren Kombination durch 0 und 1 ersetzen und in jedem so entstehenden Fall die Gültigkeit des Distributivgesetzes überprüfen! Fein, dann kennen wir jetzt jede Menge Rechenbereiche, in denen die üblichen Rechengesetze ebenfalls gelten: Wir nehmen die ganzen Zahlen Z, eines der Ideale n · Z und stecken diejenigen Zahlen in eine Schublade, deren Differenz in n · Z liegt oder, damit gleichwertig, deren Reste bei Division durch n gleich sind. Vertreter dieser Schubladen sind typischerweise die Zahlen 0,1,2,...,n–1. Da wir von den ganzen Zahlen Z ausgehen und die Schubladen mit Hilfe des Ideals n · Z festlegen, wollen wir für den neuen Rechenbereich symbolisch Z / n · Z schreiben. Für n = 3 ergeben sich in Z / 3 · Z folgende Tafeln zu Addition und Multiplikation: Dedekinds Theorie der Ideale + 0 1 2 0 0 1 2 1 1 2 0 2 2 0 1 · 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 2 1 In Z / 3 · Z können wir sogar dividieren, da der Kehrwert von 2 wieder 2 ist (was wir aus der Gleichung 2 · 2 = 1 ablesen). Damit können wir in Z / 3 · Z so rechnen, wie wir es aus den rationalen oder reellen Zahlen kennen – aus dem Ring Z ist der Körper Z / 3 · Z geworden. In Z / 4 · Z aber geschehen absonderliche Dinge, denn hier gilt 2 · 2 = 0 (das Produkt zweier Zahlen, die bei Division durch 4 den Rest 2 hinterlassen, ist durch 4 teilbar), obwohl doch 0 und 2 verschieden sind! Gerade Z / 4 · Z hätten wir für Belange der Informatik gut nutzen können, da die vier Zahlen 0, 1, 2, 3 wunderbar den 2-Bit-Worten 00, 01, 10, 11 entsprechen. Zumindest bemerken wir an dieser Stelle, woran die Angelegenheit scheitert – im Gegensatz zu den Primzahlen 2 und 3 ist die 4 zusammengesetzt, also nicht irreduzibel. Wir erkennen, dass Z / n · Z für zusammengesetzte n niemals ein anständiger Rechenbereich werden kann. Für Primzahlen n dagegen ist das Ideal n · Z eben ein Primideal – und damit (so lässt sich zeigen) ist ein Produkt in Z / n · Z nur dann 0, wenn einer der Faktoren 0 ist. Dennoch wollen wir uns das Verfahren der Schubladenbildung in anderen Situationen ansehen. Ausgangspunkt ist ein Rechenbereich (genauer: ein sogenannter Ring) R, in dem wir addieren, subtrahieren und multiplizieren können und bei diesen Rechenoperationen auch die üblichen Gesetze wie etwa das Distributivgesetz zur Verfügung haben. Eine Division, gleich welcher Art, muss es dagegen in diesem Rechenbereich nicht geben. Die zweite Zutat ist ein Ideal I in R. Anschließend erfolgt die Schubladenbildung, wobei zwei Elemente a und b aus R dann in der gleichen Schublade landen, wenn ihre Differenz a – b aus dem Ideal I stammt. Das Symbol für die Menge all dieser Schubladen ist dann R / I. Für die Addition zweier Elemente aus R / I nehmen wir aus den beiden beteiligten Schubladen jeweils einen Vertreter heraus, addieren diese beiden und sehen anschließend nach, zu welcher Schublade das Ergebnis gehört. Die Multiplikation ist ebenso erklärt. Mit diesen Rechenoperationen wird R / I wieder ein Ring. Man kann nun zeigen, dass Dividieren in dem neuen Rechenbereich genau dann möglich ist, wenn das Ideal I keine echten Teiler besitzt. Direkt nach Definition der Teilbarkeit von Idealen ist hierzu gleichwertig, dass I nur in den Idealen I und R enthalten ist. Solche Ideale nennt man maximal. Hierzu sehen wir uns sofort ein Beispiel an: Als Rechenbereich R wählen wir die Menge aller Polynome an xn+ an –1 xn–1 + ... + a2 x2 + a1 x + a0 , deren Koeffizienten an ,an –1 ,...,a2 ,a1 ,a0 Brüche sind; diese Menge erhält als Symbol Q[x]. Das Addieren und Multiplizieren von 79 80 Dedekinds Theorie der Ideale Polynomen kennen wir aus der Schule; wir wissen auch, dass die Ergebnisse stets wieder Polynome sind. Die üblichen Rechenregeln gelten ebenfalls, so dass Q[x] tatsächlich ein geeigneter Rechenbereich (ein Ring) ist. Als zweite Zutat fehlt uns noch ein Ideal I, wobei wir ohne jeden Beleg zur Kenntnis nehmen, dass Q[x] sogar ein Hauptidealring ist. Wir wählen I = (x2 – 7) · Q[x] und sehen uns die Beschaffenheit der zugehörigen Schubladen an. Ganz speziell liegen die Polynome 0 und x2 – 7 in der gleichen Schublade, so dass im Rechenbereich Q[x]/ (x2 – 7) · Q[x] die Gleichung x2 – 7 = 0 beziehungsweise x2 = 7 gilt. Ohne die Schublade zu wechseln, dürfen wir daher bei jedem Polynom jedes auftretende x2 durch 7 ersetzen. So gilt in Q[x]/ (x2 – 7) · Q[x] die Gleichung x5 + 3 · x3 – 2 · x2 + x + 9 = x · (x2 )2 + 3 · x · x2 – 2 · x2 + x +9 = x · 72 + 3 · x · 7 – 2 · 7 + x + 9 = 71 · x – 5 In jeder Schublade ist daher genau ein lineares Polynom ax + b vorhanden. Addiert und multipliziert werden solche Vertreter folgendermaßen: (ax + b) ± (ux + v) = (a ± u) · x + (b ± v) (ax + b) · (ux + v) = aux2 + (bu + av) · x + bv x= 7 = (bu + av) · x + (7au + bv) _ Ersetzen Sie jetzt einmal sämtliche vorkommenden x durch √ 7 . Dann werden Sie fest_ stellen, dass der Rechenbereich Q[x] / (x2 – 7) · Q[x] identisch mit dem Zahlkörper Q(√ 7 ) ist. Und genauso erhalten wir auch alle anderen algebraischen Zahlkörper, indem wir vom Ring Q[x] der Polynome samt einem Ideal I = p(x) · Q[x] (mit einem geeigneten Polynom p(x)) zu dem neuen Rechenbereich Q[x] / p(x) · Q[x] übergehen. Damit in dem neuen Rechenbereich auch Dividieren möglich ist, muss I ein maximales Ideal sein. Hierfür reicht in dem Hauptidealring Q[x] aus, dass sich das Polynom p(x) nicht zerlegen lässt – also p(x) ein irreduzibles Element von Q[x] ist. Nehmen wir anstelle der rationalen Zahlen den Rechenbereich K = Z / 2 · Z, so können wir ebenfalls sämtliche Polynome an xn + an –1 xn–1 + ... + a2 x2 + a1 x + a0 mit Koeffizienten an ,an –1 ,...,a2 ,a1 ,a0 aus K ansehen. Derartige Polynome addiert und subtrahiert man ebenfalls auf die gewohnte Weise; allerdings sind die Rechnungen mit den Koeffizienten (nicht mit den Exponenten) in K = Z / 2 · Z durchzuführen. Das führt zu solch merkwürdigen Gleichungen wie (x + 1)2 = x2 + 2 · x + 1 = x2 + 0 · x + 1 = x2 + 1; das Polynom x2 + 1 ist daher zerlegbar14 . Überlegen Sie sich jetzt, dass x2 + x + 1 das einzige irreduzible quadratische Polynom ist und versuchen Sie anschließend den Rechenbereich K[x]/(x2 + x + 1) · K[x] zu verstehen. (Hinweis: Es gibt genau vier Schubladen, und diese tragen die Aufschriften 0, 1, x und x + 1.) Kann man in diesem Rechenbereich dividieren? 2 Ich hoffe, Sie haben einen Eindruck gewonnen, wie leistungsfähig der Begriff des Ideals ist: Aus einem Rechenbereich (genauer: einem Ring) sowie einem Ideal in die- Dedekinds Theorie der Ideale sem Ring entsteht durch Schubladenbildung ein neuer Rechenbereich, dessen Güte von der Zerlegbarkeit oder, besser, von der Unzerlegbarkeit des verwendeten Ideals abhängt. Dieses Verfahren ist derartig vielseitig einsetzbar, dass seine Kenntnis mittlerweile für einen Profimathematiker unabdingbar ist. Damit ist insbesondere der Dedekindsche Idealbegriff aus der Welt der Mathematik nicht mehr wegzudenken. Am Schluss unseres anstrengenden Weges in die abstrakte Algebra steht noch eine Anmerkung für diejenigen unter Ihnen, die den Abschnitt über die Geburt des heutigen Zahlbegriffs bereits gelesen haben. Unter anderem wird dort berichtet, wie Georg Cantor aus den rationalen die reellen Zahlen mit Hilfe der Cauchy-Folgen konstruiert. Nun, auch dies kann man mit Hilfe der Ringe und Ideale ausdrücken: Die rationalen Cauchy-Folgen bilden einen Ring, denn zwei Folgen kann man schließlich gliedweise addieren, subtrahieren und multiplizieren. Spezielle Cauchy-Folgen sind die Nullfolgen, also diejenigen, die gegen die Zahl 0 konvergieren. Die Menge aller Nullfolgen wiederum bilden ein Ideal und – Sie ahnen es sicherlich – durch die nun schon häufig genug gesehene Schubladenbildung (zwei Cauchy-Folgen liegen in der gleichen Schublade, wenn ihre Differenzfolge gegen 0 konvergiert) entstehen die reellen Zahlen. Die Besonderheit dieser Geschichte liegt darin, dass Richard Dedekind als Entdecker des Idealbegriffs eben nicht diesen Zugang gewählt hat, sondern vielmehr die reellen Zahlen über die Dedekindschen Schnitte einführte. n Seite 56 __ 1 Dieses Unbehagen teilten unsere Vorfahren! Nicht umsonst bezeichnete man Zahlen der Form y · √ –1 als „imaginäre Zahlen“, die man zwar in Rechnungen vorteilhaft einsetzen _ konnte, deren Existenz man aber nicht so richtig wahrhaben wollte. Nun denn – auch das Wort „irrationale Zahl“ für √ 2 zeugt ja nicht gerade von der Zuversicht, dergleichen wirklich anzutreffen. Seite 57 _ 2 Zur Erinnerung: Das „rational machen“ eines Nenners der Form a + b · √ 7 haben wir mit der dritten binomischen Formel _ _ 2 2 (a + b · √ 7 ) · ( a – b · √ 7 ) = a – 7b bewerkstelligt. In dem jetzt vorliegenden Fall bräuchten wir die folgende Monstergleichung _ _ 2 _ _ 2 3 3 3 3 a + b · √ 2 + c · √ 2 · a2– 2bc + 2c2– ab · √ 2 + b2– ac · √ 2 = a3+ 2b3+ 4c3– 6abc. ( ( ) ) (( ) ( ) ( ) ( ) ) Und auch bei Kenntnis dieser Gleichung wüssten wir immer noch nicht, wie diese zustande kommt. 3 Die Zahlentheorie beschäftigt sich mit den ganzen Zahlen und den Beziehungen zwischen diesen, insbesondere der Teilbarkeit. Die Grundlage der Teilbarkeitslehre bilden die Primzahlen. 4 Ja, denn 97 = 92+ 42. Seite 58 5 Mit kleinen griechischen Buchstaben bezeichnen wir Elemente der Zahlkörper, während kleine lateinische Buchstaben immer für rationale bzw. ganze Zahlen stehen. 81 82 Dedekinds Theorie der Ideale Seite 60 __ 6 Hier brauchen wir, dass nur die Primzahlen in Z (√ –1 ) unzerlegbar sind. Seite 63 7 Insbesondere ist 4 = 22 kein Teiler von d. Damit kommen als Reste von d bei Division durch 4 nur die Zahlen 1, 2 und 3 in Frage. Seite 64 8 Genauer: Ein Ring besteht aus einer Menge R von Dingen (zum Beispiel komplexe Zahlen), die wir addieren und multiplizieren können, d.h. wir kennen zu je zwei Elementen x und y aus R die Summe x + y und das Produkt x · y, die beide wieder in R liegen. Hierbei verlangen wir, dass die folgenden Rechenregeln erfüllt sind: 1. Für x, y und z aus R gilt stets x + y = y + x und x · y = y · x (Kommutativgesetz) (x + y) + z = x + (y + z) und (x · y) · z = x · (y · z) (Assoziativgesetz) x · (y + z) = x · y + x · z und (x + y) · z = (x · z) + (y · z) (Distributivgesetz)  2. Es gibt Elemente 0 und 1 aus R, so dass 0 + x = x und 1 · x = x für alle x gilt. 3. Zu jedem x aus R gibt es ein –x, so dass x + (–x) = 0 gilt. Gibt es zusätzlich noch zu jedem von 0 verschiedenen x noch ein multiplikatives Inverses x–1 (mit x · x–1 = 1), so sprechen wir von einem Körper. Seite 67 9 Wir ziehen das Fremdwort „irreduzibel“ dem Wort „unzerlegbar“ vor, um nicht ständig von Zerlegungen von unzerlegbaren Elementen reden zu müssen. 10 Ein Beispiel einer Zerlegung, die nie ein Ende findet, wäre etwa 1 = 1 · 1 = 1 · 1 · 1 = 1 · 1 · 1 · 1 = .... Da wir die (bis auf die Reihenfolge der Faktoren) eindeutige Zerlegung ganzer Zahlen in Primfaktoren sehr schätzen, können Sie sich jetzt sicherlich denken, warum 1 nicht als Primzahl angesehen wird, obwohl 1 „nur durch 1 und sich selber teilbar“ ist. Seite 72 11 Rechnen Sie die drei Idealeigenschaften nach – Sie werden sehen, wie einfach das geht! 12 In den Definitionen ist zwar immer nur von W _ die Rede, aber natürlich gibt es den Idealbegriff auch im Rechenbereich √ d der ganzen Zahlen. Falls Sie hier unsicher sind, so setzen Sie einfach W√ _1 = Z, was zwar nur formal so gemacht werden sollte, uns aber hier unnötige Fallunterscheidungen erspart. Seite 75 13 Ein algebraischer Zahlkörper ist eine Erweiterung der rationalen Zahlen durch eine oder mehrere Nullstellen rationaler Polynome. Der Ganzheitsring eines Zahlkörpers besteht aus den in ihm vorhandenen ganzalgebraischen Zahlen. Seite 81 14 Auch das leuchtet sofort ein, denn wegen 12 + 1 = 0 ist x = 1 eine Nullstelle des Polynoms x2 + 1. 83 84 Aristoteles Rad 85 Die Bändigung des Unendlichen Richard Dedekind und die Geburt der Mengenlehre Prof. Dr. Thomas Sonar, TU Braunschweig Das Unendliche in der Antike D a s U n e n d l i c h e hat die Menschen seit allen Zeiten fasziniert, aber erst im 19ten Jahrhundert ist es innerhalb der Mathematik gelungen, tatsächlich mit der Unendlichkeit sauber umzugehen. Richard Dedekind war maßgeblich an dieser Entwicklung beteiligt. Bereits in der Antike erhoben Philosophen warnende Einwände gegen eine Verwendung des Unendlichen. Der Philosoph Zenon aus der antiken Hafenstadt Elea im Süden Italiens lebte zwischen 490 und 430 vor unserer Zeit. Über seine Ideen und Arbeiten wüssten wir gar nichts, wenn nicht Aristoteles (384–322 v.u.Z.) in seiner Physikvorlesung von ihm berichtet hätte. Demnach ist Zenon der Urheber von berühmten Paradoxien, die vor dem Umgang mit dem Unendlichen warnen sollten und die bis heute nichts von ihrer Verblüffungskraft verloren haben. Das berühmteste Zenonsche Paradoxon ist „Achill und die Schildkröte“. Der berühmte Krieger und Sportler Achilles soll sich in einem Wettlauf mit einer Schildkröte messen. Da Achilles viel schneller ist als die Schildkröte, bekommt das Reptil einen gehörigen Vorsprung. Nehmen wir zum besseren Verständnis an, dass Achilles 10 mal so schnell ist wie die Schildkröte und dass die Schildkröte einen Vorsprung von 10 Metern bekommt. Nach dem Startschuss laufen Athlet und Reptil los. Wenn Achilles den Startpunkt der Schildkröte erreicht hat, dann ist diese einen Meter vor ihm. Hat er diesen einen Meter zurückgelegt, dann ist die Schildkröte noch 10 Zentimeter vor ihm. Hat Achilles diese 10 Zentimeter zurückgelegt, dann ist die Schildkröte noch einen Zentimeter Zenon von Elea vor ihm, und so geht das immer weiter – unendlich oft – und Achilles kann die Schildkröte nie einholen! Natürlich können wir diesen Einwand gegen eine Verwendung des Unendlichen leicht entkräften. Zenon weiß nämlich nicht, dass die Addition von unendlich vielen positiven Zahlen immer noch einen endlichen Wert ergeben kann. Achilles und die Schildkröte laufen nämlich nur 10+1+0.1+0.01+0.001+... Meter weit, und das sind ganze 11.11111111... Meter! Das ist nämlich genau die Strecke, bei der Achilles die Schildkröte überholen würde. Wieviel Zeit ist bis dahin vergangen? Nach Zenon würde es unendlich lange dauern, denn man hat unendlich viele Zeitabschnitte zu addieren. Nehmen wir an (die Zahlen sind ganz unerheblich) dass Achilles für die 10 Meter genau eine Sekunde benötigt, d.h. er braucht für einen Me- 86 Die Bändigung des Unendlichen. Richard Dedekind und die Geburt der Mengenlehre. ter eine Zehntel Sekunde, und so fort. Dann treffen sich Achilles und die Schildkröte nach der endlichen Zeit 1+0.1+0.01+0.001+...=1.1111 1... Sekunden. Nun ist es nicht so, als hätte Zenon tatsächlich geglaubt, dass Achilles die Schildkröte nie einholen kann. Das Paradoxon ist vermutlich aus einem Kampf der Philosophen erwachsen, bei dem es um die Frage ging, ob die Welt diskret oder ein Kontinuum ist. Die Idee einer aus unteilbaren Teilchen gebildeten Welt kam etwa im fünften Jahrhundert vor Christus auf und wird Atomismus genannt. Frühe Vertreter dieser Theorie waren die Philosophen Demokrit und Leukippos. Epikur entwickelte diese Ideen dann weiter. Demnach ist die Welt (d.h. alle Materie) aufgebaut aus unteilbaren, unendlich harten und unveränderlichen Atomen. Bezogen auf die Mathematik bedeutet der atomistische Standpunkt, dass eine gerade Linie aus lauter unendlich kleinen, unteilbaren Punkten aufgebaut ist. Der Atomismus wurde von vielen griechischen Philosophen abgelehnt, so etwa auch von Aristoteles, der die Welt als Kontinuum ansah. Ein Kontinuum ist beliebig oft teilbar, aber nach jeder Teilung liegen wieder Kontinua vor. Das heißt, dass man eine Strecke beliebig oft teilen kann, ohne jemals auf eine kleinste Strecke zu treffen. Die Griechen definierten die Mathematik als die Wissenschaft vom Messen, und Dinge die nicht messbar sind, sind auch kein Gegenstand der Mathematik. Daher war nach klassischer Ansicht für unteilbare und unendlich kleine Punkte gar keine Mathematik machbar, was die Ablehnung des Atomismus von vielen alten Philosophen erklärt. Stellen wir uns also eine Strecke als Kontinuum vor, dann können wir nicht von Punkten in dieser Strecke sprechen, denn ein Punkt ist gerade kein Kontinuum. Man kann die Strecke halbieren, die halbe Strecke wieder halbieren, und so fort – unendlich oft – und man erhält immer wieder ein Kontinuum. Ist die Strecke aber diskret, dann ist sie aus Punkten aufgebaut. Im Paradoxon von Achilles und der Schildkröte nimmt Zenon an, die Laufstrecke sei ein Kontinuum, und zeigt dann (vermeintlich), dass das nicht möglich sein kann. In einem weiteren Beispiel nimmt Zenon an, eine Strecke sei aus diskreten Punkten aufgebaut. Es geht um einen Bogenschützen, der einen Pfeil eine Strecke weit zur Zielscheibe schießen soll. Besteht die Flugstrecke aus diskreten Punkten und die Zeit ebenfalls, dann können wir den Pfeil in einem Zeitpunkt betrachten. In diesem Zeitpunkt ist eine Bewegung aber gar nicht mehr möglich, denn die Pfeilspitze befindet sich an einem festen Raumpunkt. Da die gesamte Strecke aus diskreten Punkten besteht, kann sich der Pfeil also in keinem Raumpunkt bewegen und damit ist eine Bewegung überhaupt unmöglich! Also führt auch die Annahme eines diskreten Raumes und einer diskreten Zeit zu Widersprüchen. Verwirrend, nicht? Der Philosophenkrieg um das Kontinuum oder das unendliche Diskrete hat dann noch das gesamte christliche Mittelalter beherrscht und ist bis auf den heutigen Tag nicht ganz ausgestanden, wie wir sehen werden. Mathematisch eng verwand mit der Philosophenfrage ist der Unterschied zwischen dem Aktual-Unendlichen und dem Potentiell-Unendlichen. Das Aktual-Unendliche ist ein wirklich existierendes und erreichbares Unendlich; etwa eine „Zahl“ ∞. Das Potentiell-Unendliche hingegen ist keine jemals zu erreichende Zahl, sondern beinhaltet nur die Möglichkeit eines Die Bändigung des Unendlichen. Richard Dedekind und die Geburt der Mengenlehre. Abbildung 1: Alle Kreise haben die gleiche Anzahl von Punkten Abbildung 2: Eine Diagonale hat genau so viele Punkte wie die Seite des Quadrats Galileo Galilei immer weiteren Fortschreitens zu immer größeren Zahlen. Auch auf diesen wichtigen Punkt werden wir noch zurückkommen. Mittelalterliche Spekulationen Im Mittelalter wurden weitere Ungereimtheiten bei Verwendung des Unendlichen im Licht der Aristotelischen Logik diskutiert. So betrachtete man etwa konzentrische Kreise mit unterschiedlichen Radien und damit auch unterschiedlichen Umfängen. Schnitt man diese Kreise nun mit Strahlen wie in Abbildung 1, dann erhielt man das paradox erscheinende Resultat, dass alle Kreise immer dieselbe Anzahl von Punkten aufwiesen, obwohl sie vom Umfang her doch deutlich verschieden waren. Ebenso zeigte eine Betrachtung am Quadrat, wie in Abbildung 2 gezeigt, dass die doch längere Diagonale aus genauso vielen Punkten zu bestehen schien wie die Seite. Galileo Galilei Kluge Gedanken zum Unendlichen finden wir im Werk des großen Italieners Galileo Galilei (1564–1642), den wir ohne Übertreibung als den Großvater der modernen Physik bezeichnen dürfen. Wenn wir eine endliche Menge vor uns haben, zum Beispiel eine Menge von fünf Tomaten, dann ist für uns völlig klar, dass eine echte Teilmenge davon weniger als fünf Tomaten enthalten muss. Haben von den fünf Tomaten drei noch einen Stiel, aber zwei nicht, dann besteht die Teilmenge der Tomaten mit Stiel aus genau drei Tomaten. In seinem Buch „Discorsi i dimonstrazioni matematiche“ („Un- 87 88 Die Bändigung des Unendlichen. Richard Dedekind und die Geburt der Mengenlehre. terredungen und mathematische Demonstrationen“), das im Jahr 1638 in Leiden erschien, lässt er seine drei Protagonisten Salviati, Sagredo und Simplicio über die Anzahl der Quadratzahlen 1, 4, 9, 16, usw. sprechen1. Die drei kommen schließlich zu dem Schluß, dass es genau so viele Quadratzahlen geben muss wie es natürliche Zahlen 1, 2, 3, 4, usw. gibt. Galilei hatte die Idee, jeder Quadratzahl ihre „Wurzel“ zuzuordnen: 1 2 3 4 5 ... eine echte Teilmenge der natürlichen Zahlen; trotzdem gibt es nach Galilei genau so viele Quadratzahlen wie natürliche Zahlen. Ebenfalls bei Galilei finden wir eine weitere interessante Diskussion, wenn er das „Aristotelische Rad“ bespricht. Er diskutiert ein reguläres Polygon mit n Seiten; sagen wir n=6, also ein reguläres Sechseck so wie in Abbildung 3 gezeigt. Innerhalb dieses Sechsecks befinde sich noch ein kleineres Seckseck. Beide seien fest miteinander verbunden. ... . 1 4 9 16 25 ... Genau so, wie wir unsere fünf Tomaten durch die Zuordnung der Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 abzählen können, werden hier die Quadratzahlen abgezählt. Jeder Quadratzahl ist genau eine natürliche Zahl (ihre Wurzel) zugeordnet. Also muß es doch genau so viele Quadratzahlen wie Wurzeln geben, obwohl zwischen 0 und 37 doch nur sechs Quadratzahlen, aber 36 natürliche Zahlen liegen! Zwischen 0 und 1000001 gibt es gar nur 1000 Quadratzahlen, aber 1000000 natürliche Zahlen, und so werden die Quadratzahlen immer „dünner“, je weiter wir zu größeren Zahlen kommen. Hier scheint nun ein viel ernsteres Paradoxon zu lauern als bei Zenon. Insbesondere gerät unsere durch den Umgang mit endlich vielen Dingen geschulte Anschauung ins Wanken: Bei endlichen Mengen sind wir es gewohnt, dass echte Teilmengen immer weniger Elemente enthalten als die Ausgangsmenge. Mit anderen Worten: Der Teil ist immer kleiner als das Ganze. Galileo Galilei hat aber eindrucksvoll gezeigt, dass das beim Umgang mit dem Unendlichen offenbar nicht stimmen kann, denn die Quadratzahlen sind ja Abbildung 3: Abrollende Sechsecke Dieses Sechseck rollen wir nun ab, und zwar im ersten Schritt um den Punkt D, so dass schließlich das Sechseck wieder auf einer Seite zu liegen kommt. Das in der Ursprungslage eingezeichnete Dreieck DOS befindet sich dann in der Lage DSS’, so dass der Mittelpunkt O jetzt in S liegt. Rollen wir auf diese Weise das Sechseck fünf Mal ab, dann hat die untere Linie die Länge 6*a und das ist der Umfang des äußeren Sechsecks. Den Umfang des inneren Sechsecks finden wir in den angerollten Dreiecken wieder, aber nicht als durchgezogene Linie, sondern natürlich als unterbrochener Linienzug. Jetzt überlegt Galilei was passiert, wenn man kein Sechseck abrollt, sondern ein n-Eck mit sehr großer Seitenzahl n. Dann werden Die Bändigung des Unendlichen. Richard Dedekind und die Geburt der Mengenlehre. die abgerollten Dreiecke in Abbildung 3 immer mehr und daher immer schmaler und die Streckenstücke der Länge b rücken immer näher zusammen. Überschreitet die Anzahl der Seiten alle Grenzen, dann werden aus unseren n-Ecken schließlich Kreise. Wie wir am Beispiel der n-Ecke gesehen haben, müssen jetzt die (unendlich kleinen) Streckenstücke der Länge b, die den Umfang des inneren n-Ecks ausgemacht haben, dicht nebeneinander liegen, denn unsere abgerollten Dreiecke sind nun zu Linien degeneriert. Damit ist aber der Umfang des großen Kreises genau so groß wie der Umfang des kleinen!? Bernard Bolzano O O U Abbildung 4: Das Rad des Aristoteles Wir wollen nicht weiter auf Galileis wunderschöne Argumentationen zu diesem Problem beim Übergang vom Endlichen zum Unendlichen eingehen, sondern die Leser ermuntern, Galilei einmal selbst zur Hand zu nehmen! Wir halten nur fest, dass der Umgang mit dem Unendlichen noch bis ins 19te Jahrhundert hinein die Mathematiker verblüffte und verunsicherte. Bernard Bolzano und die Paradoxien des Unendlichen In Prag studierte Bernard Bolzano (1781–1848) Theologie, legte aber auch im Jahr 1800 eine Zwischenprüfung im Fach Mathematik ab, die der Prüfer so interessant gefunden hatte, dass er sogar seine Gichtschmerzen vergaß 2. Als ausgebildeter Theologe bezog Bolzano einen neu eingerichteten Lehrstuhl für Religionswissenschaft an der Prager Karls-Universität, wo er bald durch zu liberale Predigten bei der Obrigkeit in Ungnade fiel. 1819 wurde er fristlos entlassen und er erhielt ein Verbot jeglicher Tätigkeit an der Universität; er durfte noch nicht einmal eine Assistentur am Astronomischen Institut annehmen. Nun hatte Bolzano also Zeit, über Grundlagenfragen der Mathematik nachzudenken und dieses Nachdenken war wirklich fruchtbar. Er gilt heute als großer Denker, der vor Cantor und Dedekind mathematische Antworten auf die Probleme des Unendlichen finden wollte. Im Jahr 1851 wird das Bolzanosche Buch Paradoxien des Unendlichen3 von seinem Freund 89 90 Die Bändigung des Unendlichen. Richard Dedekind und die Geburt der Mengenlehre. Franz Prihonsky veröffentlicht. Es enthält auf etwa 150 Seiten außerordentlich einsichtsvolle Diskussionen von scheinbaren Paradoxien aus der Mathematik, aber auch aus der Physik. Bolzano untersucht auch Paradoxa des AktualUnendlichen mit Hilfe eines Mengen-Begriffs; ganz so, wie wir es nun im Fall von Cantor und Dedekind sehen werden. Bolzanos Leistungen sind übrigens von Cantor gewürdigt worden; allerdings ist Bolzano nicht zum eigentlichen Kern der Mengenlehre vorgedrungen und daher nicht ihr Begründer. Dedekind und die Geburt der Mengenlehre Im Jahr 1872 reisen zwei sich fremde Männer in die Schweiz und begegnen einander zufällig. Der eine ist der 1845 in Sankt Petersburg geborene Georg Cantor, der nach seinem Studium an der Eidgenössischen Polytechnischen Schule in Zürich und an der Universität Göttingen 1867 in Berlin promoviert wurde. Seit 1869 arbeitet er an der Universität Halle, und zwar zuerst als Privatdozent, dann ab 1872 als Extraordinarius und schließlich ab 1877 bis zu seiner Emeritierung 1913 als ordentlicher Professor. Sowohl die Doktorarbeit, als auch die Habilitationsschrift, die Cantor im Frühjahr 1869 in Halle vorlegt, beschäftigen sich mit Problemen der Zahlentheorie. Schon früh, nämlich auch 1869, hat sich Cantor mit dem Aufbau der reellen Zahlen beschäftigt und dazu zwei Arbeiten veröffentlicht. Gerade in Halle, wird Cantor sich mit den Eigenschaften von trigonometrischen Reihen beschäftigen. Er beweist einen Eindeutigkeitssatz für solche Reihen und wird im Rahmen dieser Arbeiten auf Fragen geführt, mit denen die Geburtsstunde der Mengenlehre ein- Georg Kantor geläutet wird. Cantor möchte nämlich gerne die „Größe“ von Zahlenmengen bestimmen, auf denen seine trigonometrischen Reihen nicht unbedingt mehr sinnvoll sein müssen, die Darstellung als solche Reihe aber trotzdem eindeutig bleibt. Im Jahr 1872 – es ist das Jahr der Schweizer Begegnung – erscheint in den Mathematischen Annalen die Arbeit Über die Ausdehnung eines Satzes aus der Theorie der trigonometrischen Reihen. In dieser Arbeit entwirft Cantor eine Theorie der reellen Zahlen, die er mittels Folgen von rationalen Zahlen, also Brüchen, konstruiert. Diese Cantorsche Konstruktion steht völlig ebenbürtig neben den Dedekindschen Schnitten. Wir sind noch nicht auf den zweiten Mann der zufälligen Begegnung in der Schweiz eingegangen; es ist Richard Dedekind. Die beiden Männer sind sich sympathisch und interessiert Die Bändigung des Unendlichen. Richard Dedekind und die Geburt der Mengenlehre. Wir wollen nicht den einzelnen Axiomen nachspüren, aber hier handelt es sich genau um die Cantorsche Konstruktion der reellen Zahlen aus Folgen von Brüchen bzw. um die Dedekindschen Schnitte, die in dieser Gedenkschrift an anderer Stelle gewürdigt werden. Wichtig für uns ist nur, dass beide Männer offenbar eine saubere Konstruktion der Zahlengeraden vorgenommen haben, und_ zwar durch Einfügen von Punkten wie etwa √ 2 oder p, die sich ja nicht als Brüche schreiben lassen. Nun geht es den beiden Männern um die Frage, wie viele reelle Zahlen es denn eigentlich Wäre man nicht auch auf den ersten Anblick geneigt zu behaupten, dass sich (n) nicht p eindeutig zuordnen lasse dem Inbegriffe _q p_ aller positiven rationalen Zahlen q ? Und dennoch ist es nicht schwer zu zeigen, dass sich (n) nicht nur diesem Inbegriffe, sondern noch dem allgemeineren ... eindeutig zuordnen lässt, ... 13 Und während ich an diesem Vorwort schreibe (20. März 1872), erhalte ich die interessante Abhandlung: „Über die Ausdehnung eines Satzes aus der Theorie der trigonometrischen Reihen“, von G. Cantor [...], für welche ich dem scharfsinnigen Verfasser meinen besten Dank sage. Wie ich bei raschem Durchlesen finde, so stimmt das Axiom in §2 derselben, abgesehen von der äußeren Form der Einkleidung, vollständig mit dem überein, was ich unten in §3 als das Wesen der Stetigkeit bezeichne. gibt. Von den natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4, usw. gibt es unendlich viele. Schon die Anzahl der Brüche muss enorm viel größer sein als die Anzahl der natürlichen Zahlen, denn zwischen der 1 und der 2 liegen – wenn wir 1 und 2 mitzählen – ganze zwei natürliche Zahlen, aber schon unendlich viele Brüche. Vielleicht hat uns ja schon Galileo Galiei gelehrt, dass die Dinge nicht mehr so einfach sind, wenn unendliche Zahlenmengen beteiligt sind! Und in der Tat: Cantor muss schon um 1873 gewusst haben, dass es nicht mehr Brüche gibt als natürliche Zahlen. Am 29ten November 1873 schreibt Cantor nämlich an Dedekind 4: 13 an den Grundlagenfragen der Mathematik. So entspinnt sich ein Briefwechsel. Dedekinds Schrift Stetigkeit und irrationale Zahlen, über das wir an anderer Stelle genauer berichtet haben (S. 27 ff), hatte nach Aussagen ihres Autors im Vorwort bereits im Herbst 1858 begonnen, als Dedekind Professor am Eidgenössischen Polytechnikum in Zürich war und bei Mathematikvorlesungen für Ingenieure eine rigorose Begründung der reellen Zahlen vermisste. Die Arbeit erschien erst 1872 – im Jahr der zufälligen Schweizer Begegnung – und Dedekind schreibt im Vorwort: In einem Brief an den Berliner Gymnasiallehrer Goldschneider, der sich an Cantor mit einigen Fragen zu dessen „Mannigfaltigkeitslehre“ wandte, beweist Cantor dann am 18ten Juni 1886 aus Halle 5 die Abzählbarkeit der Brüche: I. Abstrahiert man bei einer gegeben, bestimmten Menge M, bestehend aus konkreten Dingen oder abstrakten Begriffen, welche wir Elemente nennen, sowohl von der Beschaffenheit der Elemente, wie auch von der Ordnung ihres Gegebenseins, so erhält man einen bestimmten Allgemeinbegriff, den ich die Mächtigkeit von M oder die der Menge M zukommende Cardinalität nenne. 91 Die Bändigung des Unendlichen. Richard Dedekind und die Geburt der Mengenlehre. II. Zwei bestimmte Mengen M und M1 heißen äquivalent, in Zeichen M ~ M1 , wenn es möglich ist, sie nach einem Gesetz gegenseitig eindeutig und vollständig, Element für Element einander zuzuordnen. Ist M ~ M1 und M1 ~ M2 , so ist auch M ~ M2 . .. . Damit hat Cantor zur Feststellung der Mächtigkeit von Mengen, also zur Feststellung der „Anzahl der Elemente“, dasselbe Vergleichsprinzip definiert, das schon Galileo Galilei angewendet hatte, als er die Quadratzahlen abzählte. Zwei Mengen haben also genau dann gleich viele Elemente, wenn man sie sich gegenseitig eindeutig, Element für Element, zuordnen kann. Eine solche Zuordnung nennt man in der Mathematik eine bijektive Abbildung. Nun aber zurück zu der Frage nach der Anzahl der rationalen Zahlen, also der Brüche. In demselben Brief an Goldschneider finden wir die Passage: VII. Nun mache ich Sie mit dem allgemeinen Begriff einer wohlgeordneten Menge vetraut, ... . Beispiele: 1. (a,b,c,d,e,f,g,h,i,k) ist eine wohlgeordenete Menge im Gegensatz zu a b c d e f g h i k; 2. die Reihe der endlichen Cardinalzahlen in ihrer natürlichen Folge: (1,2,3,..., v,..............) die Menge aller positiven rationalen Zahlen in folgender Anordnung: 1–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,–,... 1 2 1 3 1 2 3 4 1 5 1 2 3 4 5 6 . 1 2 1 3 1 4 3 2 1 5 1 6 5 4 3 2 1 13 III. Aus I und II schließt man, dass äquivalente Mengen immer dieselbe Mächtigkeit haben und dass auch umgekehrt Mengen von derselben Cardinalzahl äquivalent sind. beide Mengen bestehen aus denselben Elementen, haben also auch gleiche Mächtigkeit. 13 92 Das Gesetz der Anordnung ist hier dieses, dass von zwei in der irreduciblen6 Form genommenen Rationalzahlen m __n und m’ __ n’ die erstere einen niederen oder höheren Rang als die andere erhält, je nachdem m + n kleiner oder größer als m’+ n’; ist aber m + n = m’ + n’ so richtet sich die Rangbezeichnung nach der Größe von m und m’. Mit der gewählten Anordnung der Brüche ist aber jetzt sofort klar, dass wir alle positiven Brüche durchnummerieren können. Nehmen wir noch die Null hinzu und schreiben hinter jeden positiven Bruch noch den negativen, dann erhalten wir in der Tat die Abzählung 0 1– ––1 1 1 1– ––1 2 2 2– ––2 1 1 1– ––1 3 3 1 2 4 6 8 3 5 7 3– ... 1 ... 9 10 ... und damit gibt es genau so viele Brüche wie es natürliche Zahlen gibt! In dem schon zitierten Brief von Cantor an Dedekind vom 29ten November 1873 stellt Cantor die Frage nach der Abzählbarkeit aller Die Bändigung des Unendlichen. Richard Dedekind und die Geburt der Mengenlehre. reellen Zahlen. Er schreibt, dass die Abzählbarkeit nicht möglich sein kann, denn die reellen Zahlen bildeten schließlich ein Kontinuum, aber er verweist darauf, dass man auch nicht glauben mochte, dass die Brüche abzählbar seien. Leider sind die meisten der Dedekindschen Antwortbriefe nicht erhalten, aber man kann aus Cantors Schreiben jeweils auf den Inhalt von Dedekinds vorhergehendem Brief schließen oder auf Dedekinds eigene Aufzeichnungen zu diesen Briefen zurückgreifen 7. Im Dedekindschen Antwortschreiben bekennt dieser, dass er die Frage nach der Abzählbarkeit der reellen Zahlen ebenfalls nicht beantworten kann, aber er teilt Cantor einen Beweis mit, dass die algebraischen Zahlen abzählbar sind. Man nennt eine Zahl algebraisch, wenn sie Lösung der algebraischen Gleichung a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + ··· + an xn= 0 ist, wobei die Koeffizienten ak ganze Zahlen sind. Dedekind beweist die Abzählbarkeit solcher Zahlen über ein kluges Argument, wobei die von Dedekind definierte Höhe einer algebraischen Zahl x, h = n –1+ | a0 | + | a1 | +··· | an |, eine wichtige Rolle spielt. Weil die Koeffizienten der algebraischen Gleichung ganze Zahlen sind, gehören zu jeder Höhe offenbar nur endlich viele algebraische Zahlen, die man daher abzählen kann. Cantor antwortet am 2ten Dezember 1873 und bedankt sich herzlich bei Dedekind. Interessanterweise schreibt Cantor 8: Übrigens möchte ich hinzufügen, dass ich mich nie ernstlich mit ihr [d.h. der Frage nach der Abzählbarkeit der reellen Zahlen] beschäftigt habe, weil sie kein besonderes practisches Interesse für mich hat und ich trete Ihnen ganz bei, wenn Sie sagen, dass sie aus diesem Grunde nicht zu viel Mühe verdient. Die beiden Männer scheinen sich also zu Beginn Ihrer gemeinsamen Überlegungen über die Bedeutung der von ihnen diskutierten Probleme nicht klar gewesen zu sein. Erst viel später ist Cantor von der Bedeutung der frühen Arbeiten überzeugt9. In einem Brief vom 7ten Dezember 1873 präsentiert Cantor schließlich seinem Freund Dedekind den Beweis für die Nichtabzählbarkeit der reellen Zahlen10! Der Beweis ist noch nicht sehr elegant, aber schon im Brief von 9ten Dezember kündigt Cantor an, einen vereinfachten Beweis gefunden zu haben11. Allerdings hatte inzwischen Dedekind seinem Freund bereits eine Vereinfachung des Beweises zugeschickt. Unter dem Datum 7.12.1873 hatte Dedekind notiert12: C. theilt mir einen strengen, an demselben Tage gefundenen Beweis des Satzes mit, dass der Inbegriff aller positiven Zahlen ... dem Inbegriff (n) nicht eindeutig zugeordnet werden kann. Diesen, am 8. December erhaltenen Brief beantworte ich an demselben Tage mit einem Glückwunsch zu dem schönen Erfolg, indem ich zugleich den Kern des Beweises «wiederspiegele»; diese Darstellung ist ebenfalls fast wörtlich in Cantor’s Abhandlung (Crelle Bd. 77) übergegangen; ... Der vereinfachte Beweis enthält eine Technik, die heute als Cantorsches Diagonalverfahren bekannt ist. Dieses Verfahren ist außerordent- 93 94 Die Bändigung des Unendlichen. Richard Dedekind und die Geburt der Mengenlehre. lich einfach und deshalb wollen wir an dieser Stelle den Beweis erbringen, dass schon die Zahlen zwischen 0 und 1 nicht mehr abzählbar sind: Wir schreiben alle Zahlen zwischen 0 und 1 als unendlichen Dezimalbruch 0,a1 a2 a3 a4 ···. Die Zahl 0,1 ist also 0,100000.... und so weiter. Die Null vor dem Komma ist allen unseren Zahlen gemeinsam, deshalb reicht es, wenn wir uns die Nachkommastellen ansehen. Ich behaupte nun: Die reellen Zahlen zwischen 0 und 1 sind abzählbar! Wenn meine Behauptung stimmt, dann lassen sich alle überhaupt nur auftretenden Nachkommastellen durchnummerieren, z.B.: 1 – 19826735412618.... 2 – 79635374292901.... 3 – 56374837282771.... 4 – 52620000282726.... usw. Jetzt werde ich eine neue Zahl konstruieren, und zwar aus den bereits durchnummerierten Nachkommastellen. Die Vorschrift zur Konstruktion ist die folgende: Die Zahl beginnt natürlich mit „0,“. Jetzt nehmen wir die erste Ziffer der ersten Zahl (das ist die 1) und addieren eine 1. Damit erhalten wir eine 2 und unsere neue Zahl beginnt mit „0,2“. Von der zweiten Zahl nehmen wir die zweite Ziffer (eine 9) und addieren eine 1. Es ergibt sich die 10, aber wir wollen verabreden, aus der 9 eine 0 zu machen. Unsere neue Zahl fängt also mit „0,20“ an. Von der dritten Zahl nehmen wir die dritte Ziffer (3) und machen daraus durch Addition der 1 eine 4. Unsere neue Zahl ist jetzt „0,204“. Und so geht es weiter. Von der k-ten Zahl nehmen wir die k-te Ziffer, erhöhen um 1 (bzw. setzen eine 0, wenn die Ziffer eine 9 war) und das ist die k-te Zif- fer unserer neuen Zahl. Die so erhaltene neue Zahl liegt ganz sicher auch zwischen 0 und 1, aber ist sie auch in unserer Abzählung? Würde meine Behauptung stimmen, dann müsste die neue Zahl irgendwo in der Liste stehen, aber das tut sie nicht! Warum nicht? Die neue Zahl hat an der ersten Nachkommastelle eine andere Ziffer als die erste Zahl in unserer Liste, also kann sie nicht die erste Zahl sein. Die zweite Nachkommastelle unterscheidet sich von der zweiten Nachkommastellen der zweiten Zahl, also kann die neue Zahl auch nicht die zweite sein. Auch die dritte Nachkommastelle der neuen Zahl ist verschieden von der dritten Stelle der dritten Zahl, so dass unsere neue Zahl auch nicht die dritte sein kann. Aber so geht es immer weiter! Die k-te Nachkommastelle unserer Zahl ist ungleich der k-ten Nachkommastelle der Zahl k, also kann unsere neue Zahl nicht die k-te Zahl der Liste sein, und das gilt für alle k! Damit haben wir aber eine Zahl zwischen 0 und 1 konstruiert, die nicht in unserer Abzählung enthalten ist. Meine Behauptung war also falsch und damit sind die reellen Zahlen zwischen 0 und 1 nicht abzählbar. Man sagt auch, die reellen Zahlen sind überabzählbar. Nach diesem schönen Erfolg, an dem Dedekind einen großen Anteil hatte, wendet sich Cantor weiteren Fragen des Unendlichen zu. In einem Brief 13 vom 5ten Januar 1874 stellt er an Dedekind die Frage, ob es zu jedem Punkt eines Quadrats genau einen Punkt auf einer Strecke gibt, d.h. er fragt danach, ob die Menge der Punkte im Quadrat und die Menge der Punkte auf einer Strecke von gleicher Mächtigkeit sind. Cantor ist sich sicher, dass das nicht sein kann und er hält einen Beweis für fast überflüssig, allerdings findet er keinen! Noch scheint es zu ungeheuerlich, die Anzahl der Punkte auf einer Strecke, einem eindimensi- Die Bändigung des Unendlichen. Richard Dedekind und die Geburt der Mengenlehre. oder 0,6=0,5999999... und dies macht folgendes Problem: Auf der Strecke führt der Punkt z=0,2304070707... nach Cantors Konstruktion zu dem Punkt x=0,2, y=0,347777... im Quadrat. Statt 0,2 können wir nun aber auch 0,19999.... schreiben, allerdings gehört zu dem Quadratpunkt x=0,199999..., y=0,347777... nicht der Punkt z, sondern der Punkt z’=0,13949797...! Vereinbaren wir also, alle Zahlen als unendliche Dezimalbruchdarstellungen zu schreiben, d.h. 0,5 als 0,49999... usw., dann gehört der Punkt 0,2304070707... auf der Strecke zu keinem Punkt im Quadrat! Cantor reagiert sofort auf Dedekinds Einwand und schreibt eine Postkarte15 mit Poststempel 23. Juni 1877. Er sieht sofort, dass der Dedekindsche Einwand x,y 0,a1 b1 a2 b2 a3 b3 a4 b4 a5 b5 ··· richtig ist, aber er stellt fest, dass er dadurch mehr bewiesen hat, als er ursprünglich dachan. So wird also tatsächlich jedem Punkt im te! Die Punkte des Quadrates lassen sich sogar Quadrat genau ein Punkt auf der Einheitsstre- auf eine Teilmenge der Punkte der Strecke abcke zugeordnet und umgekehrt. bilden und umgekehrt. Es zeigt sich, dass die „Ausnahmemenge“, also diejenigen Punkte der Strecke, die nicht abgebildet werden, abzählbar ist. Schließlich gelingt es Cantor doch noch sehr umständlich, das Quadrat auf die gesamte y Strecke abzubilden und umgekehrt. Den Beweis teilt er Dedekind in einem Brief vom 25. Juni 1877 mit. Bereits in einem Brief 16 vom 23. Oktober 1877 an Dedekind kann er stolz einen einfachen und eleganten Beweis angeben. onalen Gebilde, der Anzahl der Punkte eines Quadrats (einem zweidimensionalen Gebilde) gleichzusetzen. Erst in einem Brief vom 20ten Juni 1877, drei Jahre nach der Fragestellung, teilt Cantor Dedekind mit, dass er einen Beweis für die Gleichmächtigkeit von Quadrat und Strecke gefunden habe und gibt diesen Beweis an. Der Beweis besteht einfach in einer Abbildung, die jedem Punkt im Quadrat genau einen Punkt auf der Strecke zuweist und umgekehrt. Betrachten wir den Einheitsquadrat und die Einheitsstrecke und bezeichnen wir die x- bzw. y-Koordinate eines Punktes im Quadrat mit x = 0,a1 a2 a3 a4 a5 ···, y = 0,b1 b2 b3 b4 b5 ···, dann gibt Cantor als Abbildung x z Abbildung 5: Abbildung eines Quadrates auf eine Strecke In seiner Antwort bezeichnet Dedekind14 das Cantorsche Resultat als „interessante Schlussfolgerung“, macht allerdings einen Einwand. Die Dezimalbruchdarstellung der reellen Zahlen ist nicht eindeutig, z.B. ist 1=0,999999... Cantor weiß, dass er eigentlich etwas Ungeheuerliches bewiesen hat. So ist es nicht verwunderlich, wenn er seinen Freund Dedekind bereits am 29. Juni 1877 schriftlich drängt, seinen Beweis zu überprüfen. Er schreibt 17: Entschuldigen Sie es gütigst meinem Eifer für die Sache, wenn ich Ihre Güte und Mühe so oft in Anspruch nehme; die Ihnen jüngst von mir zugegangenen Mitthei- 95 96 Die Bändigung des Unendlichen. Richard Dedekind und die Geburt der Mengenlehre. lungen sind für mich selbst so unerwartet, so neu, dass ich gewissermassen nicht eher zu einer gewissen Gemüthsruhe kommen kann, als bis ich von Ihnen, sehr verehrter Freund, eine Entscheidung über die Richtigkeit derselben erhalten haben werde. Ich kann so lange Sie mir nicht zugestimmt haben, nur sagen: je le vois, mais je ne le crois pas. Dedekind antwortet in einem Brief 18 vom 2. Juli 1877 und beglückwünscht Cantor zu seiner unglaublichen Entdeckung. Der von Dedekind überprüfte Beweis ist korrekt, aber auch Dedekind kann nicht glauben, dass ein zweidimensionales Gebilde von gleicher Mächtigkeit sein soll wie ein eindimensionales. Ihm war aufgefallen, dass die Cantorsche Abbildung zwischen Quadrat und Strecke überall unstetig war. Damit ließ diese Abbildung eine wichtige Eigenschaft vermissen, die sich Dedekind gewünscht hätte. In bildhafter Sprache teilt er Cantor mit19: ... die Ausfüllung der Lücken zwingt sie, eine grauenhafte, Schwindel erregende Unstetigkeit in der Correspondenz20 eintreten zu lassen, durch welches Alles in Atome aufgelöst wird, so dass jeder noch so kleine stetig zusammenhängende Theil des einen Gebietes in seinem Bilde als durchaus zerrissen, unstetig erscheint. Nun vermutet er, dass es nur an der Unstetigkeit der Abbildung liegt, dass der Dimensionsunterschied zwischen Quadrat und Strecke im Licht der Mächtigkeit keine Rolle mehr spielt. Er vermutet den folgenden Zuammenhang21: Gelingt es, eine gegenseitige eindeutige und vollständige Correspondenz zwischen den Puncten einer stetigen Mannigfaltigkeit A von a Dimensionen einerseits und den Puncten einer stetigen Mannigfaltigkeit B von b Dimensionen andererseits herzustellen, so ist diese Correspondenz selbst, wenn a und b ungleich sind, nothwendig eine durchweg unstetige. Mit dieser Vermutung bewies Dedekind wieder einmal sein mathematisches Gespür. In etwas allgemeinerer Form wurde die Vermutung im Jahr 1911 von dem Mathematiker Luitzen Egbertus Jan Brouwer bewiesen. Epilog Aus der heutigen Mathematik ist die Mengenlehre nicht mehr wegzudenken. Schöpfer dieser Theorie, die einen Umgang mit dem Unendlichen möglich macht, ist sicher Georg Cantor, allerdings spielt Richard Dedekind, wie wir gesehen haben, als Briefpartner in den 1870er Jahren eine ganz entscheidende Rolle. Dedekind hat auch die eigentliche Definition unendlicher Mengen gegeben, und zwar in seiner Schrift „Was sind und was sollen die Zahlen“. Cantor hat später diese Definition aufgegriffen22: Ein System23 S heißt unendlich, wenn es einem echten Teile seiner selbst ähnlich ist; im entgegensetzten Falle heißt S ein endliches System. Im Unendlichen gilt also gerade nicht mehr, dass ein Teil kleiner ist als das Ganze. Damit erlaubt die moderne Cantor-Dedekindsche Mengenlehre, die scheinbar paradoxen Ergebnisse der Antike und des Mittelalters, die wir zu Beginn diskutiert haben, zu erklären. Cantor hat dabei eine klare Entscheidung zwischen dem Die Bändigung des Unendlichen. Richard Dedekind und die Geburt der Mengenlehre. antiken Kontinuum und der diskreten Auffassung gefällt: Wer der Cantor-Dedekindschen Auffassung folgt, und das sind heute fast alle Mathematiker, baut das Kontinuum aus diskreten Punkten auf; eine für die antiken Philosophen unhaltbare Idee! Dafür haben wir eine sichere Methode gewonnen die es uns erlaubt, mit dem Unendlichen umzugehen. David Hil- bert, einer der größten Mathematiker überhaupt, hat die Begeisterung über die Mengenlehre in dem Satz zusammengefasst 24: Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben können. Seite 87 1 In der deutschen Übersetzung: Galileo Galilei – Unterredungen und mathematische Demonstrationen über zwei neue Wissenszweige, die Mechanik und die Fallgesetze betreffend (Wiss. Buchgesellschaft, 1973) auf den Seiten 30-31. Seite 89 2 Herbert Meschkowski – Denkweisen großer Mathematiker: Ein Weg zur Geschichte der Mathematik. Vieweg Verlag, 3te Auflage 1990, S.123. 3 Dr. Bernard Bolzano – Paradoxien des Unendlichen. Nachdruck im VDM Verlag 2006. Seite 91 4 E. Noether, J. Cavaillès (Hrsg.): Briefwechsel Cantor-Dedekind, S.13. Herman & Cie, Paris 1937. 5 Der vollständige Brief ist abgedruckt in: Herbert Meschkowski – Denkweisen großer Mathematiker. Ein Weg zur Geschichte der Mathematik. S.189-196, Vieweg Verlag 1990. Seite 92 6 „irreducible Form“ heißt hier, dass die Brüche gekürzt sein sollen. Seite 93 7 E. Noether, J. Cavaillès: a.a.O., S.18–20. 8 E. Noether, J. Cavaillè: a.a.O., S.13. 9 H. Meschkowski: Probleme des Unendlichen. Werk und Leben Georg Cantors. S.27, Vieweg Verlag 1967. 10 E. Noether, J. Cavaillè: a.a.O., S.15. 11 ebenda S.16. 12 ebenda S.19. Seite 94 13 ebenda S.20. Seite 95 14 ebenda S.27. 15 ebenda S.28. 16 H. Meschkowski: a.a.O. S.39. 17 H. Meschkowski, W. Nilson (Hrsg.): Georg Cantor Briefe. S.44, Springer-Verlag 1991. Seite 96 18 E. Noether, J. Cavaillès: a.a.O. S.37-38. 19 H. Meschkowski: a.a.O. S.41. 20 Damit ist die Abbildung zwischen Quadrat und Strecke gemeint. 21 H. Meschkowski, . Nilson: a.a.O. S.44. 22 R . Dedekind: Was sind und was sollen die Zahlen. S.13, Vieweg Verlag 1918. 23 Wir würden heute „Menge“ sagen. Seite 97 24 D. Hilbert: Über das Unendliche. (Mathematische Annalen, Bd.95, S.161-190, 1926). n 97 98 99 Faszination Mathematik Maria Heuer, Schülerin, Wilhelm Gymnasium Braunschweig M e i n e L e i d e n s c h a f t für die Mathematik entbrannte bereits, als ich im Kindergarten die Zahlen kennen lernte. Wie viele Kinder, zählte auch ich einfach so zum Spaß bis Hundert oder bis Tausend und dabei kam eines Tages die Frage auf, ob man ewig weiter zählen könne. Gibt es eine größte Zahl, nach der es nichts Höheres mehr gibt? te ich zum ersten Mal mein mathematisches Wissen zu verteidigen, was es noch viel interessanter machte, da ich bemerkte, dass nicht jeder diesen Verstand und diese Neugierde hatte, wie ich. Diese Wissbegier ließ mich immer mehr Facetten der Mathematik entdecken, die noch heute eine tiefe Faszination auslösen. Die folgenden Ausführungen sollen einen Einblick in meine Begeisterung von der Mathematik ermöglichen. „Die Mathematiker sind eine Art Franzosen: redet man zu ihnen, so übersetzen sie es in ihre Sprache, Als ich meinem Vater die Frage stellte, und dann ist es alsobald ganz etwas anderes.“ konnte ich mich nicht damit zufrieden geben, Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) dass „die Unendlich“ die höchste Zahl sei, die aber eigentlich keine richtige Zahl sei. Nein, Dieses „andere“ eröffnet völlig neue Perich verlangte eine richtige Antwort und so spektiven, da die Sprache der Mathematik fragte ich ihn, was die höchste Zahl sei, die er durch ihren Aufbau eigene Akzente setzt. Lokenne. Das war die Dezillion. gische Zusammenhänge lassen sich in ihr ohne viele Worte ausdrücken. Dadurch entDiese Sicherheit allein, dass ich eine Zahl steht eine neue Denkweise, die es ermöglicht, gefunden hatte, die eine Antwort auf meine einen Sachverhalt von einer ganz anderen SeiFrage lieferte, reichte mir jedoch nicht aus. Ich te her zu beleuchten. wollte genau wissen, um was für eine Zahl es sich handelte. Daraufhin erklärte mein Vater Darüber hinaus ist die Logik der Mathemamir, dass es eine „Eins mit sechzig Nullen“ tik unendlich; es werden immer wieder neue sei und wir nahmen ein Papier, malten sie auf Zusammenhänge und Formeln entdeckt. Desund hängten den zwei Meter langen Streifen halb ist sie so umfangreich und spannend, da an meine Zimmertür. Bis zur fünften Klasse, sie stets eine neue Überraschung bereithalten in der ich die Dezilliarde kennen lernte, war kann. Die Logik der literarischen Sprache hindies die größte Zahl, die ich kannte. gegen, die durch die Grammatik verkörpert wird, ist endlich, da diese in wenigen Jahren Meiner Kindergartenfreundin berichtete erlernt werden kann. Die Mathematik jedoch ich selbstverständlich von meiner neuen Er- lässt sich niemals vollständig begreifen. kenntnis. Die jedoch wusste damit nicht viel anzufangen und es begann eine Diskussion, Durch die Fähigkeit, beide Sprachen zu beob es diese Zahl überhaupt gäbe. Dort lern- herrschen, die Sprache der Mathematik und 100 Faszination Mathematik die eigene Muttersprache, wird das Verständnis der Welt erweitert. Selbst beim Vergleich zweier literarischer Sprachen fällt auf, dass diese von der jeweiligen Kultur geprägt sind und bestimmte Redewendungen und Wörter enthalten, die die Denkweise bestimmen. In der Mathematik sind dies die Verknüpfungen, die neue Zusammenhänge herstellen können. Bezogen auf das Leben kann die Mathematik zwar vieles berechnen, jedoch kann sie nicht in der Lage sein, die Handlungen der Menschen vorauszusagen. Sie ist rational und erfasst nicht alle Schicksale des richtigen Lebens. Allerdings gibt es in der Physik, in der die Mathematik sehr stark präsent ist, eine Formel, die offenbart, dass auch keine andere Sprache die Unvorhersehbarkeit der Gefühle, wie der Liebe, voraussagen kann. Dies ist die Heisenbergsche Unschärferelation. Sie besagt, dass der Ort und Impuls eines Quantenobjekts nicht eindeutig festgelegt sind. Dadurch sind sie nicht vorhersagbar; es ist lediglich möglich, eine zugehörige Wahrscheinlichkeit auszurechnen. Die Mathematik veranschaulicht somit, warum der Mensch bestimmte Situationen nicht voraussehen kann – weder mit ihrer Sprache, noch mit irgendeiner anderen. Infolgedessen hat ein Mathematiker nicht mehr Macht, als ein anderer Mensch, diese Welt zu verstehen. Er begreift sie nur auf eine andere Weise: durch die Sprache der Mathematik. Die Mathematik kann nicht nur das Leben bereichern, sondern außerdem den Naturwissenschaften eine belegbare Grundlage geben, so dass relativ exakte Beschreibungen und Voraussagen möglich werden können. Neue Beweise und Entdeckungen erweitern das logische Konstrukt der Mathematik fortwährend. Sie wird durch die Arbeit der Mathematiker immer komplexer. Wird sie vielleicht eines Tages in der Lage sein, die gesamte Welt zu beschreiben? Der Bauplan existiert schon; der Mensch muss die Mathematik nur weiterentwickeln, bis sie so komplex wird wie der Kosmos selbst. Ob die Menschen jemals in der Lage sein werden, das Universum zu verstehen, wird sich zeigen. Das Potential, es eines Tages vollständig zu beschreiben, hat die Mathematik bestimmt. Weiterhin ist die Mathematik vom Anfangspunkt an nachvollziehbar, da sie von Menschen erfunden ist, die alle mit den einfachsten Axiomen begannen. Ihre Nachvollziehbarkeit und Allgemeingültigkeit sind für jede Wissenschaft erstrebenswert. Je tiefer der Mensch in die Mathematik hervordringt, desto mehr öffnet sich ihre Schönheit und ihre Vollkommenheit. Es ist vielleicht wie mit der Mandelbrotmenge: Auf den ersten Blick ist sie nur eine Darstellung der komplexen Zahlen, doch die Details offenbaren eine unbeschreibliche Schönheit, kreiert von der Mathematik. Auch werden Symmetrien allgemein von Menschen als ästhetisch empfunden, woraufhin die Vielzahl an Symmetrien in der Mathematik der Schönheit entscheidend Ausdruck verleihen. In vielen verschiedenen Fachgebieten können die gleichen Muster angewandt werden, wodurch das Verständnis erheblich erleichtert wird. Hat man sich diese mathematische Denkweise erst einmal angeeignet, steht einem die Welt der Mathematik offen. Mit etwas Mühe lässt sich nun so gut wie jede The- Faszination Mathematik matik verstehen. Darüber hinaus ist es auch möglich, mit der gelernten Sprache selber neue Konzepte zu entwickeln. Diese Vielseitigkeit, einerseits wichtige Berechnungen zu ermöglichen und andererseits das Leben mit ihrer Logik zu bereichern, grenzt an Perfektion. Nur derjenige, der mit der Mathematik auf einer Wellenlänge ist, kann ihre Schönheit erfassen. Um all ihre faszinierenden Facetten zu erfahren, ist es der Mühe durchaus wert, sich durch die komplizierten Beweise immer wieder zur Verzweiflung zu bringen. Ähnlich einer Sinuskurve kommt nach einem Tiefpunkt wieder ein Hochpunkt, der die Begeisterung erweckt und die ganzen vorherigen Zweifel wieder in den Schatten stellt. Nur derjenige, der den Mut hat, den Schwierigkeiten stand zu halten, wird mit dem Einblick in eine wunderschöne Welt belohnt, die mit jedem Schritt mehr von sich offenbart. n 101 102 Auszug aus dem Brief vom 14. Januar 1875 an Obermedizinalrat Henle in Göttingen. 103 Einige Selbstzeugnisse, zum Beispiel Briefe Dedekinds Prof. Dr. Heiko Harborth, TU Braunschweig W i r d m a n i r g e n d w o in der Welt von einem Mathematiker nach dem Herkunftsort „ … Sein Leben theilt sich in Lernen und Musizieren. Oft begreife ich nicht, woher er die viele Zeit zu diesem Letzteren nimmt, da er doch immer in der Schule die besten Zeugnisse bekommt …“ Braunschweig gefragt, so ist es meistens eindrucksvoll, wenn man einer kurzen geographischen Einordnung hinzufügt, dass Gauß und Dedekind hier geboren sind und dass Richard Dedekind die meiste Zeit als Professor hier Mathematik gelehrt hat. Ein Kommilitone des älteren Bruders Adolf von Richard schreibt 1850 an Adolf: „… Der Kleine (Richard) soll also jetzt auch nach der Paradiesischen Norddeutschen Hochschule G.? – das ist recht. Da werden sie ihm schon die verwünschten Zahlen aus dem Kopf bringen und die eklige cycloide kann er praktisch studieren, wenn Sonntags Nachmittags nach Gleichen, Witzenhausen gefahren wird. Die Brüderchen ziehen doch jedenfalls zusammen? Das wird ein ganz netter Haushalt werden, wenn der Steinund der Zahl-Reiche Herr Dedekind zusammenziehen …“ In Gesprächen über das Leben von Richard Dedekind ergeben sich immer zwei Fragen ganz besonders: 1. Warum ist er der Herzoglich Technischen In seiner Zeit als Privatdozent in GötHochschule Braunschweig treu geblieben tingen schreibt Richard Dedekind 1857 an seiund nicht einem Ruf an eine Universität ge- nen Vater: folgt? „… Im übrigen führe ich stets das seit Jahren ge2. Warum ist er sein ganzes Leben lang unver- wohnte Leben fort: ich arbeite recht viel und Diheiratet geblieben? richlet ist sehr zufrieden mit allem, was ich zu Stande bringe, und läge es an ihm, so wäre ich Mit klaren Antworten auf beide Fragen wird längst irgendwo Professor; aber auch er kann das wohl auch Richard Dedekind selbst seine nicht erzwingen; das muss also mit Ruhe erwarSchwierigkeiten gehabt haben. tet werden. Mit meinem Berliner Rivalen Kronecker stehe ich im freundschaftlichen Briefwechsel Bei der Suche nach Material zum 150. Ge- und die Achtung, die er mir über meine Arbeiburtstag hat Ilse Dedekind, eine Großnichte ten ausdrückt, gefällt mir sehr; es sind jetzt auch von Richard Dedekind, zwei Waschkörbe mit einige von meinen Aufsätzen gedruckt und ich Briefen der Familie Dedekind aus drei Jahr- hoffe, dass sie Beifall finden werden. Diese Dinge zehnten gefunden. In zwei Büchern 1, 2 hat sie und der tägliche Verkehr mit Dirichlet bilden den Ausschnitte zusammengestellt und veröffent- Hauptteil meines jetzigen Lebens; …“ licht, die unter anderem Eindrücke zum Leben von Richard Dedekind ermöglichen. In seinen Jahren in Göttingen (1850–1858) nahm Richard Dedekind an dem gesellschaftIn einem Brief von 1947 schreibt die Mut- lichen Leben vor allen Dingen mit seinem Celter Caroline über Richard: lo- und Klavierspiel teil. So begleitete er auch 104 Einige Selbstzeugnisse, zum Beispiel Briefe Dedekinds den Vortrag von Liedern und nicht selten führ- legium Carolinum, schreibt Richard Dedekind te das freundliche Zunicken beim Einsatz des 1873 an Frau Henle: Gesangs einer jungen Dame zum Gerücht „ … Wie ich dazu gekommen bin, trotz größter über eine baldige Verlobung. Abneigung gegen Verwaltungsgeschäfte das Directorat unseres Carolinums auf drei Jahre zu Regelmäßig begleitete Richard das Singen übernehmen, und zwar unter den ungünstigsvon der sieben Jahre jüngeren Bertha Wagner, ten Verhältnissen, das zu erzählen, würde zu die 1857 an Richards Schwester Mathilde über lang werden … ganz heimlich, wenn ich mal ein ein Studentenfest berichtet: paar freie Stunden habe, denke ich an mein ma„ … Dein Herr Bruder hatte die Einladung abge- thematisches Lieblingsthema, „die Theorie der lehnt, weil er arbeiten musste; er ist plötzlich so Ideale“, und arbeite mit recht hübschem Erfolge ungeheuer solide geworden und macht sich Vor- daran weiter; nur schade, daß außer mir kaum würfe über sein vieles Ausgehen …“ noch ein paar Menschen auf dieser Erde sich dafür interessieren …“ Im Mai 1859 beantwortet Richard aus Zürich einen Brief von Mathilde: In seiner Antwort 1875 an Herrn Henle auf „ … daß Du in der „Chur’schen Familie“ schon die Anfrage nach einer möglichen Professur die künftige Verwandtschaft erblickst, amüsierte von Richard Dedekind in Göttingen schreibt mich sehr, … sehe ich mit behaglicher Erinne- er: rung auf diesen Tag zurück, aber das ist alles. „ … denn hier glaube ich nützlich zu sein und Denn vom bloßen Wohlgefallen an dem Verkehr meine Stellung wird, sobald ich am nächsten mit einer Familie bis zum Verlieben in eine be- 1. September mein Directorat niedergelegt haben stimmte Persönlichkeit ist noch ein sehr großer werde, wieder eine sehr ruhige und sie lässt mir Schritt, zu dem ich nicht den kleinsten Ansatz so viel freie Zeit, wie ich es mir wünschen kann … gemacht habe; und vom bloßen Verlieben bis zu Und nun meine Familie; meine Mutter in ihrem etwas Ernsthafterem ist noch ein viel größerer hohen Alter zu überreden … Alles zu verlassen … Schritt, für mich wenigstens …“ würde schwerlich zu rechtfertigen sein. Sie mit meiner Schwester hier allein zurücklassen - ich Nach seiner Rückkunft 1862 nach Braun- kann mir kaum denken, daß ich das thun würde; schweig liest man in einem Brief von Richard bis jetzt habe ich sie natürlich mit solchen GeDedekind an die Familie Henle in Göttingen: danken, die ja noch im weiten Felde liegen, nicht „ … Hier in Braunschweig ist es auch gut … Auf beunruhigen wollen …“ einer Universität ist zwar mehr Anregung, aber auch mehr Rivalität und Missgunst; die Letztere Aus einem Bericht der Schwester Julie ist mir unerträglich und auch ohne Rivalität hof- über Richard Dedekind: fe ich, Energie zum Fortarbeiten zu behalten. Ich „ … Die kleine Welt der Familie, vereint mit der glaube nicht, daß ich diese Ansichten so leicht Gelegenheit stillen zurückgezogenen Forschens, ändern werde …“ zieht er so der größeren Welt der Anerkennung, aber auch den weitergespannten Möglichkeiten Während des ersten gewählten Direkto- an bedeutenden Universitäten vor. Man darf sich rats (1872–1875) am Polytechnikum, dem Col- allerdings Richard Dedekinds Leben in Braun- Einige Selbstzeugnisse, zum Beispiel Briefe Dedekinds Auszug aus Dedekinds Taschenkalender von 1903 schweig nicht auf dem „Abstellgleis“ und fern der wissenschaftlichen Welt vorstellen. Viele Mathematiker von Rang haben ihre Reiseroute über Braunschweig gelegt, um bei ihm zu einem wissenschaftlichen Gespräch abzusteigen (Wilhelm Weber, Minkowski, Cantor, Frobenius, Heinrich Weber, Kronecker, Clebsch … usf). Auch pflegt er seine Reisen so zu planen, daß sie meist einem Treffen mit Kollegen dienen … „ Zum Beginn seines Ruhestandes schreibt Richard Dedekind 1895 an Frobenius in Berlin: „… Was aber meinen Rücktritt vom Amte betrifft, so ist der zwingende Grund dafür wirklich der gewesen, daß ich den besonderen Anstrengungen durch zwölf wöchentliche Vorlesungen und Übungen mit einer großen Anzahl von Zuhörern mich nicht mehr hinreichend gewachsen fühlte; an einer Universität würde ich wahrscheinlich nicht zurück getreten sein; das Dociren macht mir große Freude; ich habe auch in diesem Winter mit Passion meine einstündige Vorlesung über Wahrscheinlichkeitsrechnung gehalten (wie vor 40 Jahren bei Beginn meiner Lehrtätigkeit) und eine zweistündige über Fourier’sche Reihen; in der letzteren habe ich einen, in der ersten drei Zuhörer … und ich verdiene durchschnittlich beinahe 15 RM in der Stunde, was mir auch Freude macht …“ In seinem Taschenkalender machte Richard Dedekind alltägliche Notizen, jedoch keine mathematischen. Nur der Kalender vom Jahre 1903 ist erhalten geblieben. Das Wesen von Richard Dedekind wird als durch Bescheidenheit, durch Humor, durch 105 106 Einige Selbstzeugnisse, zum Beispiel Briefe Dedekinds Exaktheit, durch Pflichtbewusstsein und durch Musikalität gekennzeichnet beschrieben. Er legte kleine Reime und Gedichte bei, wenn er seinen Verwandten oder Arbeitern Geld zukommen ließ. Er liebte Spaziergänge und abends vor dem Schlafengehen legte er häufig Patiencen. Als Richard Dedekind in den neunziger Jahren seinen Todestag in einem gedruckten Kalender angezeigt findet, schreibt er dem Herausgeber, dass das Tages- und Monatsdatum künftig wohl zutreffen möge, aber nach seinem Tagebuch habe er seinen Todestag in bester Gesundheit mit seinem Freund Georg Cantor in Bad Harzburg zugebracht, allerdings habe Cantor nicht ihm selbst, sondern einem mathematischen Irrtum von ihm den Todesstoß versetzt. Als 1906 der 75-jährige Richard Dedekind eine zukünftige Schwiegertochter von seinem Bruder Adolf bei ihrem ersten Besuch bei Dedekinds zu Tische führt, sagt sie ihm, daß sie Mathematik für eine trockene Wissenschaft hält und daß sie sich nicht sehr dafür erwärmen kann. Daraufhin sagt Richard Dedekind lächelnd: „Und sehen sie, für mich birgt das Einmaleins die größte Poesie.“ Die Familiengrabstätte befindet sich als Ehrengrab der Stadt in der Abteilung 29 auf dem Hauptfriedhof. Der Schreibtisch aus dem Dienstzimmer von Dedekind befindet sich im Braunschweigischen Landesmuseum. Der Matrikel-Buch-Eintrag von 1848, die 1930 herausgegebenen Gesammelten Werke und die 1995 aus Evansville, Indiana, zurück erworbenen Briefwechsel mit Georg Cantor, Georg Frobenius und Heinrich Weber sind in der Universitätsbibliothek zu finden. In der Pockelsstraße 4 wurde 1981 links neben dem Eingang ein von Jürgen Weber gestaltetes Relief von Richard Dedekind angebracht. Gegenüber, in der Pockelsstraße 14 in der ersten Etage des Forum-Gebäudes findet man ein grosses Ölgemälde gegenüber einem von Karl Friedrich Gauß. Beide Bilder wurden vom Braunschweigischen Hochschulbund 1927 bei der Feier zum 150sten Geburtstag von Gauß und gleichzeitig verspäteter Gedenkfeier zum Tod von Richard Dedekind der Technischen Hochschule mit einem Festakt im Schloss übergeben. Auf dem Bild trägt Dedekind ein Was kann man heute noch in BraunBuch mit dem Titel „Idealtheorie“ in der Hand. schweig zu Richard Dedekind finden? Er hat jedoch nie ein solches geschrieben, sondern in seiner bescheidenen Art diese Theorie Es gibt eine Dedekindstrasse in der Lin- in der dritten Auflage der von ihm herausgedenbergsiedlung (seit 1945). gebenen Vorlesungen von Dirichlet über Zahlentheorie als Ergänzung in dem berühmten In der ersten Etage des Hauses Jasperallee „elften Supplement“ entwickelt. n 87 hat Dedekind seit 1894 mit seiner Schwes- 1 Ilse Dedekind: Aus Körben und Schachteln. ter Julie zusammen gewohnt. Die Stadt hat Quadrato Verlag 1994. 1981 eine Plakette angebracht und seit Okto- 2 Ilse Dedekind: Unter Glas und Rahmen. ber 2007 steht vor dem Haus eine „Persön- Appelhans Verlag 2000. lichkeitstafel“. 107 Autoren Maria Heuer, geb. 1989 in Braunschweig, Klasse 13 des Braunschweiger Wilhelm-Gymnasiums, will nach bestandenem Abitur an der Universität in Göttingen Theoretische Physik studieren. Fotos: Susanne Hübner Die Industrie- und Handelskammer dankt allen Autoren der Gedenkschrift für Richard Dedekind: 108 Autoren Geb. 1938; 1958 bis 1964 Studium in Mathematik und Physik für das Höhere Lehramt; 1965 Promotion; 1972 Habilitation; ab 1978 Universitätsprofessor in Braunschweig; ab 2003 Professor a. D. Es liegen Forschungsergebnisse in mehr als 180 Veröffentlichungen aus den Gebieten Zahlentheorie, Kombinatorische Geometrie, Kombinatorik und Graphentheorie vor. Von 19 „Doktorkindern“ wurden die Promotionen betreut. Mitglied in der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft; Mitglied in 13 internationalen Mathematischen Gesellschaften; Mitherausgeber der Zeitschriften „Mathematische Semesterberichte“ (bis 2001), „Fibonacci Quarterly“ und „Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory“. Professor Dr. Heiko Harborth Diskrete Mathematik TU Braunschweig e-mail: [email protected] Geb. 1964; Studium der Mathematik mit Nebenfach Theoretische Physik an der TU Braunschweig; Promotion (1994) und Habilitation (2001) an der TU Braunschweig; seit 2005 Direktor des Mathematikzentrums Mathe-Lok am Institut Computational Mathematics der TU Braunschweig. Forschungsgebiete: Topologische Inzidenzgeometrie, insbesondere Translationsebenen und symmetrische Ebenen, Anwendung geometrischer und algebraischer Methoden in der Robotik Beirat und Landesbetreuer für Niedersachsen des Vereins „Begabtenförderung Mathematik e.V.“, Mitherausgeber der Zeitschrift „Mathematikinformation“. apl. Professor Dr. Harald Löwe Institut Computational Mathematics TU Braunschweig E-Mail: [email protected] www.mathe-lok.de Derzeitige Tätigkeit: Neben Fortbildungen für Mathematiklehrerinnen und -lehrern führt das Mathematikzentrum Mathe-Lok vor allem Projekte für Schülerinnen und Schüler im Bereich der Mathematik und ihrer Anwendungen durch. Hierdurch soll einerseits das Interesse am Fach Mathematik geweckt und gefördert werden, andererseits bietet die Mathe-Lok die Möglichkeit, sich bereits vor einem einschlägigen Studium mit universitärer Mathematik auseinanderzusetzen. Autoren Geb. 1947; Studium der Mathematik an den Universitäten Tübingen, Göttingen und Warwick (England), danach Diplom (1972), Promotion (1975) und Habilitation (1980) in Tübingen. Nach einer Zeitprofessur in Tübingen und einer Lehrstuhlvertretung in Erlangen (1987) folgte 1987 der Ruf auf eine Professur an der TU Braunschweig. Forschungsgebiet: Geometrie in verschiedenen Spielarten, insbesondere Topologische Geometrie. Professor Dr. Rainer Löwen Buchpublikationen: Compact Projective Planes (mit H. Salzmann, D. Betten, T. Grundhöfer, H. Hähl und M. Stroppel, 1995), The Classical Fields (mit H. Salzmann, T. Grundhöfer und H. Hähl, 2007). Herausgeber von Advances in Geometry. Federführender Vertrauensdozent für die Studienstiftung des deutschen Volkes an der TU Braunschweig. Institut für Analysis und Algebra TU Braunschweig e-mail: [email protected] Geb. 1958; Studium des Maschinenbaus an der Fachhochschule Hannover, anschließend Studium der Mathematik Universität Hannover; Promotionsstudien an der Oxford University; 1991 Promotion an der Universität Stuttgart; 1995 Habilitation in Darmstadt; von 1996 bis 1999 Professor für Angewandte Mathematik an der Universität Hamburg; seit 1999 Professor für Technomathematik an der TU Braunschweig. Forschungsgebiete: Analysis und Numerik hyperbolischer Erhaltungsgleichungen, Geschichte der Analysis. Professor Dr. Thomas Sonar Institut Computational Mathematics TU Braunschweig e-mail: [email protected] Buchpublikationen: Mehrdimensionale ENO-Verfahren (1997), Einführung in die Analysis (1999), Mathematik für Ingenieure Bd.3 (mit H.J. Oberle, K. Rothe, 2000), Angewandte Mathematik, Modellbildung und Informatik (2001), Proceedings of the GAMM Workshop Discrete Modeling and Discrete Algorithms in Continuum Mechanics (Edt. mit I. Thomas, 2001), Der fromme Tafelmacher: Die frühen Arbeiten des Henry Briggs (2002). Mitglied der Braunschweiger Wissenschaftlichen Gesellschaft BWG. Herausgeber von ZAMM, ZAMP, Mathematische Semesterberichte, Buchreihe Mathematik für das Lehramt (Springer Verlag), Buchreihe Disquisitiones Historiae Scientiarum-Braunschweiger Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte. 109 Familientafel, Nachfahren von Richard Dedekind 110 Die Industrie- und Handelskammer Braunschweig bedankt sich bei den Förderern, welche die Verwirklichung dieses Buchprojektes ermöglicht haben: 114