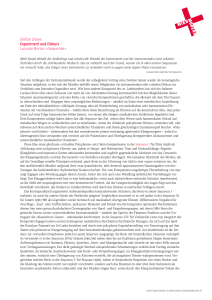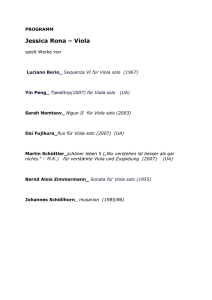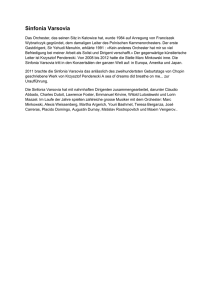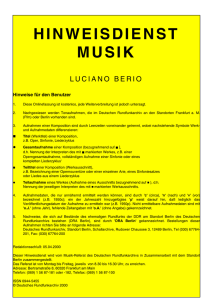Stefan Fricke Nicht nur ein Weg führt zum Ziel … Zu Luciano Berio
Werbung

Stefan Fricke Nicht nur ein Weg führt zum Ziel … Zu Luciano Berio und seinem Musik-Labyrinth Musik, so lehren es die Lexika, sei die absichtsvolle Ordnung von Tönen in der Zeit. Das stimmt. Richtig ist aber auch: Musik ist all das, was wir mit der Absicht hören, es sei Musik. Der Gedanke stammt von dem italienischen Komponisten Luciano Berio. Allerdings nicht nur von ihm allein. Zahlreiche Musikschöpfer unserer Zeit dachten und denken so, enga­gier(t)en sich mit ihren Werken für eine Öffnung der Ohren und der Hirne, damit unsere Wahrnehmung von der Welt wach bleibt, damit unsere Sinne nicht auf der Stelle treten. Schließlich, ein weiterer Gedanke von Luciano Berio, ist nichts je vollendet. Alles fließt. Und das nicht nur in eine Richtung. Ästhetische Positionen, musikalische Ideen und Modelle bewegen sich kreuz und quer durch die Kulturen von einst und jetzt, bilden kleine, große, riesige Labyrinthe. Sie sind, keine wirklich neue Erkenntnis, unübersichtlich. Inmitten dieser Irrgärten, in denen sich zu verlaufen nicht das Schlimmste sein muss, begegnen wir Berios Musik. Einer Musik, die selbst labyrinthisch ist, die mit Täuschungen und Wirklichkeiten spielt, die Neues und Altes miteinander verknüpft, die Geschichte(n) erzählt, weitererzählt, aus dem Gestern übers Heute ins Morgen tragen will. Der 1925 in Imperia am Ligurischen Meer geborene Komponist, Sprössling einer italienischen Musikerfamilie, bekannte einmal: «Zukunft kann sich nur aus der Vergangenheit bilden.» Das Ergebnis dieser Auffassung ist ein außergewöhnlich facettenreiches, vielgesichtiges Œuvre mit weit über hundertfünfzig Werken. Darunter einige Meilensteine der jüngeren Musikgeschichte, zudem etliche pädagogische Stücke – Berio engagierte sich sehr für den musikalischen Nachwuchs – und zahlreiche Bearbeitungen des Repertoires: von Monteverdi und Purcell über Schubert, Brahms, Verdi, Mahler, Manuel de Falla, Paul Hindemith, Kurt Weill bis hin zu eigenen Stücken und Beatles-Songs. Die Ensemblekomposition Laborintus II, einer der bedeutenden Wegweiser aus Berios Werkstatt – 1965 zu Beginn seiner bis 1971 andauernden Lehrtätigkeit an der renommierten New Yorker Juilliard School entstanden –, prangt wie ein Motto über dieser weitverzweigten Ästhetik, die mehr die Gegensätze zu überwinden suchte als ihre Konturen zu schärfen. Mit Laborintus II formulierte Berio, der am 27. Mai 2003 im Alter von 77 Jahren in Rom starb, erstmals ein äußerst engmaschiges Klangnetz. Auf der Basis einer Textmontage des italienischen Schriftstellers Edoardo Sanguineti, mit dem der Komponist mehrfach zusammengearbeitet hat, verdichten sich hier gesungene und gesprochene Sprache, historische und aktuelle Instrumental- wie elektronische Klänge plus Schauspielergesten zu einem einzigartigen polystilistischen Spiel, das von der pluralen Kultur- und Musikgeschichte in der damaligen Situation kündet und über diese hinaus weit in die Nachwelt der Komposition weist. Rückblickend und eingedenk der ebenfalls ­pluralistischen Werke des Kölner Komponisten Bernd Alois Zimmermann (1919–1970) öffnete Luciano Berio damit die heute so geheißene postmoderne Tür, thematisierte er anschaulich Mehrdeutigkeit und Vielschichtigkeit des Kunstwerks im Kunstwerk selbst. Bekannter als Laborintus II ist allerdings Berios Ende der 1960er Jahre geschriebene Sinfonia geworden. Diese Komposition für acht Stimmen und Orchester, ein Tribut an die Großen der Musikgeschichte, erregte seinerzeit Aufsehen. Und bis heute ist sie eine der populärsten Kompositionen Berios überhaupt. Weitaus intensiver als in Laborintus II quillt die Sinfonia nur so über von Anspielungen und Zitaten: Johann Sebastian Bach, Claude Debussy, Richard Strauss, Gustav Mahler, Maurice Ravel, Paul Hindemith, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen und viele andere Zeitgenossen mehr. Etliche ihrer Werke hat Berio in diesem Werk miteinander verknüpft, nebst Textfragmenten von Samuel Beckett, Claude Lévi-Strauss, James Joyce und Parolen der studentischen Revolutionäre von 1968. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – Luciano Berio hat sie in seiner Sinfonia synchronisiert. Und das in einer bis dahin ungehörten Transparenz. Riesiger Beifall nach der Uraufführung 1969 bei den Donaueschinger Musiktagen. Die Idee der musikalischen Collage und Montage lag in der Luft. Der Avantgarde-Purismus der 1950er Jahre hatte sich völlig überholt. Die Abkehr von den sklavischen Systemzwängen des Serialismus, der verschärften mitteleuropäischen Weiterentwicklung der Zwölftonmusik, war offensichtlich notwendig, um musikalisch überhaupt noch etwas anderes, etwas Neues sagen zu können. Und Berio war einer der Ersten, der dies tat – mit großem Erfolg. Seine Sinfonia, ein Meisterwerk, markiert einen wichtigen Wendepunkt in der Musikgeschichte. Übrigens nicht nur in der Entwicklung der Neuen Musik. Auch der Konzertbetrieb hat davon erheblich profitiert, ohne dass er sich darüber wirklich klar ist. Für das forcierte Wiederentdecken der Musik Gustav Mahlers Anfang der 1970er Jahre lieferte Berios Komposition – plus Lucchino Viscontis Film Tod in Venedig (1970 gedreht; Ausschnitte aus Mahlers Fünfter als Filmmusik) – den Auftakt. So fungiert das komplette Scherzo aus Mahlers 2. Symphonie im dritten Satz der fünfteiligen S­ infonia als real klingendes Fundament, auf dem sich in etlichen Stockwerken und Räumen unzählige Zitate der Musikgeschichte türmen. Alles in allem eine imposante, ergreifende Architektur, ein exzeptionelles wie dialektisches E-Musik-Dokument des Zeitgeistes der späten 1960er Jahre. Geborgen sind darin die Achtundsechziger mit ihren ARCHIV WIEN MODERN | © WIEN MODERN | WWW.WIENMODERN.AT gesellschaftlichen Aus- und Aufbrüchen – Berio hat den zweiten Satz O King dem 1968 ermordeten Bürgerrechtler Martin Luther King gewidmet – sowie die bürgerliche Sehnsucht nach einem neuen «Schönen», wofür die Aktualität Mahlers stehen mag. Eine allerdings weitestgehend falsch verstandene Aktualität des 1911 gestorbenen Wiener Komponisten und Dirigenten; die Brüche und Widersprüche in dessen Musik wollte damals kaum einer so wirklich wahrhaben. Gegen die schnell Mode werdende bloße Sentimentalität beim Hören seiner Symphonien und Lieder konnte allerdings Berios mäanderhafte Sinfonia nichts mehr ausrichten. Auch das gehört zu den Geschichten der Musik, einer stets in sich, zudem einer nach vorne wie zurück verweisenden Musikgeschichte. In deren Repertoire nimmt die Sinfonia einen herausragenden Platz ein, wie auch Berios Sequenzen, eine Reihe von technisch komplizierten Solo-Etüden für nahezu jedes Instrument. Sie sind Referenz­stücke für jeden Virtuosen und solche, die es werden wollen. Über vierzig Jahre hat ihn die Idee der Sequenzen beschäftigt. Bei den Darmstädter Ferienkursen 1958 erklang die erste – für Flöte –, und 2002, während der Wittener Tage für neue Kammermusik, kam die Nummer XIV und damit die letzte Sequenza zur Uraufführung. «Ein Element», sagte Berio, «das die Sequenzen miteinander verbindet, ist meine Überzeugung, dass Musikinstrumente nicht wirklich verändert, auch nicht zerstört und erst recht nicht erfunden werden können. Ein Musik­instrument ist aus sich heraus ein Teil der musikalischen ­Sprache. Der Versuch, ein neues zu erfinden, ist so sinnlos ­vergebene Liebesmüh’ wie das Ansinnen, für unsere Sprache eine neue Grammatik auszubrüten.» Ein neues Instrument hat Luciano Berio tatsächlich auch nie erfunden. Allerdings hat er gemeinsam mit dem befreundeten Dirigenten und Komponisten Bruno Maderna 1955 das erste Studio für elektroakustische Musik in Italien gegründet hat, das Mailänder Studio di Fonologia Musicale. Kennengelernt hatte Berio die Tonbandmusik in den USA, wo er im Oktober 1952 im Museum of Modern Art in New York ein Konzert besuchte, bei dem auch Werke von Vladimir Ussachevsky und Otto Luening uraufgeführt wurden. Diese Veranstaltung war übrigens das erste Konzert mit tape music in den Vereinigten Staaten von Amerika. Berio war von den Möglichkeiten dieser Verbindung von Musik und Technik sofort sehr angetan, sodass er nach seiner Rückkehr nach Italien bald Entscheidungsträger bei der Radio Audizioni Italiane (RAI) kontaktierte. Zunächst wurde Berio musikalischer Berater für den TV-Bereich und half außerdem bei der Film-Synchronisation. ­Später folgten erste Aufträge für die Hörspielabteilung. Als sich 1953 dann Berio und Bruno Maderna kennenlernten, entwickelten die beiden schnell die Idee eines elektroakustischen Studios. Maderna kannte bereits die Unternehmungen der musique concrète in Paris und die elektronischen Bestrebungen des WDR in Köln. Noch im selben Jahr fuhren die beiden Komponisten gemeinsam nach Basel zu einer Konferenz über die elektronische Musik und Berio lernte hier Karlheinz ­Stockhausen kennen. Anfang 1954 konkretisierte sich das ­Vorhaben, eine Institution elektronischer Musik beim RAI in Mailand zu schaffen. Man führte intensive Gespräche mit der RAI-Direktion; im Juni 1955 war es dann so weit: Das Studio di Fonologia Musicale wurde offiziell gegründet. Berio begann sogleich mit der Arbeit an Mutazioni, seinem zweiten Tonbandstück nach Mimusique No. 1 von 1953. Die Mono-Komposition mit einer Dauer von drei Minuten und dreißig Sekunden besteht weitestgehend aus hüpfend-tropfenden Sinustönen, deren Klangfarben sich durch Filterungsprozesse nach und nach verändern (Mutazioni = Veränderungen). Zudem verlängern sich auch die Klangpunkte, sie dehnen sich aus und neues Material tritt hinzu; eine stark gefilterte ­Frauenstimme erklingt mehrmals, allerdings ist sie kaum einmal deutlich herauszuhören. 1957 realisierte er im Studio di Fonologia Musicale sein drittes elektroakustisches Werk mit dem Titel Perspectives, das er als sein eigentliches elektronisches Opus 1 auffasste. Wohl wegen der Dauer von nun gut sieben Minuten und wegen der hier erstmals von ihm produzierten Stereo­phonie. Überdies ist die Dramaturgie hier ausschweifender als die in den vorausgegangenen Mutazioni: Es hat eine weitaus größere dynamische Bandbreite, spielt mit verschiedenen ­Graden von Dichten, die ineinanderfließen. Die Materialien von P ­ erspectives sind Sinustöne, synthetische Klänge, Klavier- und Glockenklänge, die sich aber kaum als solche heraushören ­lassen, da sie diversen Manipulationen unterzogen wurden: Verschiedene Einschwingvorgänge wurden abgeschnitten, unterschiedliche Filter benutzt. Das Resultat ist ein perspekti­visches Spiel mit Klanggesten, die sich zu ­kom­plexeren Strukturen verbinden. Mit der 1968 im Studio entstandenen Stereo-Komposition Thema – Omaggio a Joyce gelang ihm eines seiner frühen Meisterwerke und ein bis heute eindrucksvolles Dokument der elektronischen Musik, die sich seit Stockhausens im Kölner WDR-Studio produzierten Gesang der Jünglinge (1955/56) und Herbert Eimerts ebendort realisierten Epitaph für Aikichi Kuboyama (1962) immer wieder um neue Wege in der Amalgamierung von elektronischen Klängen und Sprache bemühte. Textgrundlage des in Neapel uraufgeführten Thema – Omaggio a Joyce bildet der Anfang des elften Kapitels aus James Joyces 1922 veröffentlichtem Roman Ulysses, das sogenannte Sirenen-Kapitel, das folgendermaßen beginnt: «BRONZE BY GOLD HEARD HOOFIRONS STEELYRINGING / Imperthnthn thnthnthn. / Chips, picking chips off rocky thumbnail, chips. / Horrid! And gold flushed more …» Diesen Text hat Berio von der Sängerin Cathy Berberian, seiner Frau und langjährigen Mit-Arbeiterin in Sachen Sprachmusik, auf Englisch und in italienischer wie französischer Übersetzung einsprechen lassen und die Aufnahmen anschließend bearbeitet. Es geht ihm bei diesem Stück nicht – wie schon zuvor ­Stockhausen und Eimert auch in deren Werken nicht – um die Verbindung von Literatur und Musik, genauso wenig geht es um Textvertonung im Sinne etwa der romantischen Kunstlieder. Vielmehr ist das Sujet von Berios Komposition Thema, Sprache und Musik miteinander verschmelzen zu lassen, ein Kontinuum zwischen Verstehen und abstraktem Klang zu schaffen. So changiert die Schärfe des Hörbaren, des selbst schon onomatopoetischen Textes stetig zwischen verschiedenen Graden des Verständlichen. Klang und musikalischer Sinn wiegen über weite Strecken mehr als der semantische. Das allerdings ist bereits ein wichtiges Merkmal von Joyce Ulysses-Roman selbst, den er im Nachfolgewerk Finnegans Wake noch weitaus pointierter exemplifiziert hat und der seit den 1950er Jahren zur Pflichtlektüre vieler Komponisten gehört – so wie auch Berios komponierte Hommage an den irischen Schriftsteller eine gewichtige Marke der Musikgeschichte ist. Berios Engagement für die elektronische Musik – institutionell wie auch im eigenen, ästhetisch unideologischen Œuvre – ließen ihn Anfang der 1970er als geeigneten Partner für ein damals weltweit einzigartiges Projekt erscheinen. In ihm sah Pierre Boulez, der in jenen Jahren im Pariser Centre Pompidou das heute berühmte Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique (kurz IRCAM genannt) aufbaute, den passenden Mitstreiter und bat ihn, mit ihm gemeinsam die elektroakustische Abteilung aufzubauen, die Berio bis 1980 dann auch leitete. Vor allem im Bereich der Vokalmusik hat Berio die Möglichkeiten und die Grenzen derselben so intensiv und experimentell erkundet wie außer ihm nur noch wenige. Viele Jahre war Berio mit der famos-exaltierten Stimmakrobatin Cathy Berberian verheiratet. Die künstlerische Zusammenarbeit beider Musiker, über ihre Scheidung im Jahre 1964 hinaus, hat die Vokalkunst auf ein bis dahin ungeahntes Niveau gehievt. «Die Stimme» – so Berio, der ihr 1965/66 die dritte Sequenza gewidmet hat – «vom unverschämtesten Geräusch bis zum vornehmsten Gesang, bedeutet immer etwas, verweist immer auf etwas anderes außerhalb ihrer selbst und schafft eine große Bandbreite an Assoziationen kultureller, musikalischer, alltäglicher, emotionaler, psychologischer Art.» Um eine solch weitgefächerte Stimmkunst aber schlüssig-gebündelt gestalten zu können, in der sich das, wenn nicht die (musikalischen) Leben von einst und dem jeweiligen Heute artikulieren, bedarf es einer ungeheuren Kenntnis der Vergangenheit(en) und einer ebenso unbändigen Neugierde auf Unbekanntes. Unbekanntes …, oder: Momente des nicht völlig und gänzlich Vertrauten, Ausgeloteten – das erkannte Luciano Berio auch in seinen eigenen Stücken. Wiederholt hat er sich mit ­etlichen von ihnen neu auseinandergesetzt, sie bearbeitet, mit den Mitteln und Möglichkeiten des Komponisten umgestaltet. So hat er mit dem Werkzyklus Chemins («Wege») seine Sequenzen für Soloinstrumente in Kompositionen für Ensemble plus Solo transformiert, das ursprüngliche Stück dabei neu betrachtet, es in einen neuen Kontext gestellt. Berio selbst schrieb dazu: «Der beste Weg, ein musikalisches Werk zu ­analysieren und zu kommentieren, ist, ein anderes zu schreiben und dafür Materialien von dem Originalwerk zu nehmen: Eine schöpferische Untersuchung ist zur gleichen Zeit eine Analyse, ein Kommentar und eine Erweiterung des Originals. Der ­profitabelste Kommentar von einer Symphonie oder einer Oper hat immer eine andere Symphonie oder Oper zu sein. Dies ist Grund, warum meine Chemins, wo ich meine Sequenzen für Soloinstrumente zitiere, übersetze, ausbreite und beschreibe, die besten Analysen der Sequenzen sind. Sie sind eine Serie von spezifischen Kommentaren, die, meist intakt, das Objekt und Subjekt des Kommentars enthalten. Die Chemins sind nicht die Versetzung eines objet trouvé in einen anderen Kontext oder in den orchestralen ‹Anzug› eines Solostücks (der originalen Sequenza); sie sind eher als ein organischer Kommentar mit ihr verbunden und von ihr generiert.» Sieben solcher Chemins hat Berio zwischen 1965 und 1992 geschrieben, darunter: Chemins I über Sequenza II [1963] für Harfe und Orchester (1965); Chemins II über Sequenza VI [1967] für Viola und neun Instrumente (1967); Chemins III über Chemins II [1967] für Viola und Orchester; Chemins IV über Sequenza VII [1969] für Oboe und elf Streicher. Erklingen Urwerk und die danach geschriebenen Kommentare und Ausfransungen in einem Konzert, was ja durchaus mal geschieht, so erhalten wir als Publikum die seltene Chance, Ohrenzeuge eines historisch-kritischen – so nennen die Literaturwissenschaftler die ­Zusammenschau verschiedener Varianten des gleichen Textes – oder synoptischen – so nennen die Neutestamentler die ­Parallelisierung der Matthäus-, Lukas-, Johannes- und ­Markus-­Evangelien – ­Musikerlebens zu sein. Man muss hören und hören, immer wieder hören und dabei aufs Neue hören – zurück in die Geschichte und visionär nach vorne, ins Mögliche. Und im jeweiligen Jetzt sowieso. In seiner abendfüllenden «Musikalischen Aktion» Un Re in ascolto («Ein König horcht»), uraufgeführt 1984 bei den Salzburger Festspielen, hat Berio das Hören, das Horchen, das Lauschen selbst zum Thema gemacht. Im Libretto des italienischen Schriftstellers Italo Calvino heißt es: «Da ist eine Stimme, die redet von mir, begraben unter den Stimmen in mir, im Horchen … Du stirbst, sagt sie. Ich habe Angst.» Prospero, der Held der «Hör-Oper» (Shakespeares Sturm ist eines ihrer Quellstücke), sagt dies ganz am Schluss seiner Träume von einem neuen, einem anderen Theater, einer anderen Musik. Zuvor sucht er «etwas, das mir zwischen den Tönen gesagt wird und von dem ich nicht weiß, ob ich’s mit Verlangen erwarten soll oder mit Angst.» Wie seine Hör-Figur hat auch Berio, der gerne und oft selbst seine Werke dirigierte, zeitlebens nach neuen Tönen und vor allem nach unbekannten Zwischentönen gesucht. Denn, so sagte Berio einmal: «Nichts ist je vollendet.» Musik wie alle Kunst ist – in den Worten des französischen Dichters Pierre Garnier – «nie vollendbare poetische Anstrengung». Stefan Fricke: Nicht nur ein Weg führt zum Ziel … Zu Luciano Berio und seinem Musik-Labyrinth, in: Katalog Wien Modern 2007, hrsg. von Berno Odo Polzer und Thomas Schäfer, Saarbrücken: Pfau 2007, S. 9-11.