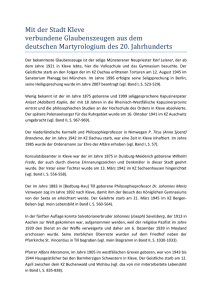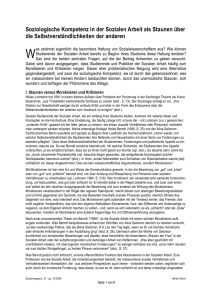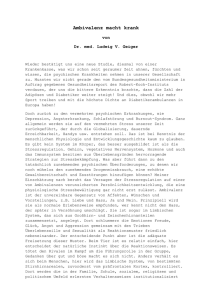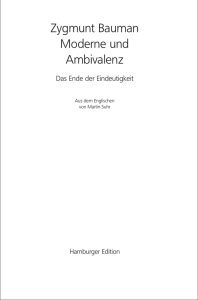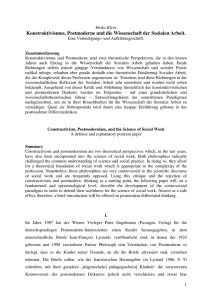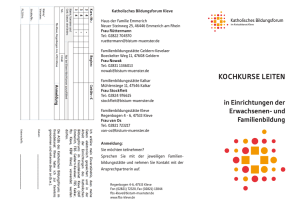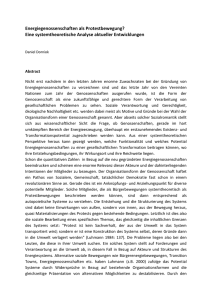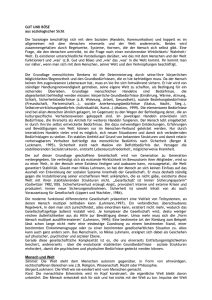Heiko Kleve Zwischen Tradition und Moderne Postmoderne Soziale
Werbung

Heiko Kleve Zwischen Tradition und Moderne Postmoderne Soziale Arbeit am Beispiel Familie „Die Familie übertreibt Gesellschaft.“ Niklas Luhmann (1990: 215). Zusammenfassung Die Familie wird als ein besonderes Sozialsystem in der funktional differenzierten Gesellschaft präsentiert, das zwar in einem modernen Kontext eingebettet ist, der nahezu alles Soziale flexibilisiert und dynamisiert, in dem aber das Traditionelle fortbesteht. Denn die Familie als traditionelles System verweist auf stammesgesellschaftliche Sozialformen der vollständigen individuellen Systemeinbindung. Überdies kommen in Familien systemische Regeln und Sozialprozesse zum Wirken, die ebenfalls an tribale Gemeinschaften erinnern. Wie Soziale Arbeit diese Ambivalenz von Tradition und Moderne beachtet und in ihre Programme einbezieht, wird schließlich knapp skizziert. Ambivalenz als Kennzeichen postmoderner Sozialer Arbeit Unser Alltagsverstand, aber auch die moderne Philosophie und Sozialwissenschaft gehen in der Regel davon aus, dass die gesellschaftliche Entwicklung als ein Prozess des Fortschreitens und Weiterentwickelns gedacht werden kann. Sichtbar wird dies etwa in den klassischen Vorstellungen einer dialektischen Evolution geistiger und sozialer Prozesse. Bekanntlich hat Hegel die Geistesentwicklung als eine dialektische Stufenleiter gedacht, an deren Ende der Weltgeist zu sich selber gekommen sein wird. Marx hat diese dialektische Idee, wie es so schön heißt: vom Kopf auf die Füße gestellt und betrachtet die Sozialentwicklung bezüglich der materiellen Arbeitsbedingungen als eine geschichtliche Treppe, die ausgehend von der Urgesellschaft, über die Sklavenhaltergesellschaft, den Feudalismus und Kapitalismus schließlich den Sozialismus und Kommunismus hervorbringen wird. Triebfeder dieser Evolution sei der Prozess vom Kampf der Gegensätze, die als Thesis und Antithesis das Neue als Synthesis generieren. Diese dialektische Fortschrittsphilosophie des Geistes und des Sozialen wurde bereits von Nietzsche kritisiert, der die Geschichte als einen Kreislauf der ewigen Wiederkehr des Gleichen auffasste. In der klassischen kritischen Theorie der Frankfurter Schule, die sich auch 1 von Nietzsche inspirieren ließ, wird das Fortschrittsdenken massiv angegriffen. In der Dialektik der Aufklärung (Horkheimer/Adorno 1947) und später in der Negativen Dialektik (Adorno 1966) wird gezeigt, wie die geschichtliche Entwicklung nicht in Form des dreistufigen dialektischen Prozesses (Thesis, Antithesis, Synthesis) gedacht werden sollte, sondern vielmehr als Ambivalenz – im Sinne einer dialektischen Bewegung ohne Synthese, als Gleichzeitigkeit des Gegensätzlichen. Auch die jüngere kritische Theorie, die etwa durch Axel Honneth (2002: 9) repräsentiert wird, wendet ihren Blick inzwischen deutlich auf ambivalente soziale Prozesse: „Seit Jahren schon scheint sich innerhalb der Soziologie die Tendenz abzuzeichnen, verstärkt auf Begriffe wie Ambivalenz, Gegenläufigkeit oder eben Paradoxie zurückzugreifen, um die neuere Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaften zu deuten; wo heute nicht jenen simplen Fortschritts- oder Verfallsmodelle vorherrschen, setzt sich unterschwellig das Bewusstsein durch, dass wir gegenwärtig nicht krisenhafte oder widersprüchliche Zuspitzungen, sondern höchst paradoxale Wandlungsprozesse beobachten können“ (ebd.; paradigmatisch dazu siehe etwa Junge 2000). Die Theorie der postmodernen Sozialen Arbeit (siehe Kleve 1999/2007; 2007) knüpft ebenfalls an das Ambivalenzkonzept an. Demnach kann Soziale Arbeit als eine Profession verstanden werden, die von zahlreichen Ambivalenzen, Gegenläufigkeiten sowie Doppel- und Mehrfachorientierungen gekennzeichnet ist. Der Abschied vom klassischen Streben des Wegarbeitens dieser Ambivalenzen, die Akzeptanz und permanente praktische wie wissenschaftliche Reflexion der Gegenläufigkeiten bezeichne ich in Anlehnung an Zygmund Bauman (1991) als postmodern. Während eine moderne Gemüts- und Geisteshaltung die Suche nach dem Eindeutigen fortführt und Ambivalenzen nach dem Entweder/Oder-Prinzip zu beseitigen versucht, anerkennt die postmoderne Haltung die Mehrdeutigkeit durch eine Sowohl-als-auch-Einstellung, die die unterschiedlichen Pole ambivalenter Situationen gleichermaßen zu achten sucht (siehe ausführlicher Kleve 2009). Im Folgenden wollen wir an diese postmoderne Blickrichtung anschließen und eine maßgebliche Ambivalenz reflektieren, die bei näherem Hinsehen in der Sozialen Arbeit mit Familien aufscheint. Die These ist, dass Familien heute einerseits mit drastischen Wandlungsprozessen konfrontiert sind, die wir der rasanten Veränderungsdynamik der modernen Gesellschaft zuschreiben können und dass sie andererseits zugleich traditionelle Sozialprozesse fortführen, die auf die Urform menschlicher Vergesellschaftung, auf die tribale Stammes- und Sippengemeinschaft verweisen. 2 Moderne Gesellschaft als Verdrängung der Tradition Freilich können wir hinsichtlich der Gesellschaft von Entwicklung sprechen. Und wir können sogar unterschiedliche gesellschaftliche Typen unterscheiden, die sich im Laufe der Menschheitsgeschichte heraus differenziert haben (siehe etwa Luhmann 1997: 595ff.). Allerdings verläuft diese Entwicklung nicht eindeutig, sondern ambivalent und vielschichtig. Bevor wir uns dieser Evolution zuwenden, soll diese Ambivalenz und Vielschichtigkeit kurz ins Zentrum gerückt werden. Wenn wir als Endstufe der bisherigen gesellschaftlichen Evolution die moderne Gesellschaft annehmen, dann wirken in dieser Gesellschaft nach wie vor Dynamiken und Prinzipien, die aus früheren Epochen stammen und sich nicht geradlinig einfügen in die Prinzipien der Moderne. Karl Otto Hondrich (2006: 51) macht diese These stark, wenn er davon spricht, dass wir heute in zwei sozio-moralischen Welten zugleich leben: in einer modernen und einer traditionalen. „Die Spannung, ja Widersprüchlichkeit zwischen ihnen müssen wir aushalten, sie ist der Preis für die Entwicklung der Kultur. Eine Art, die Spannung auszuhalten, ist das Verdrängen, das Verdrängen der einen moralischen Welt durch die andere“ (ebd.). Die eine sozio-moralische Welt verweist auf alte stammeskulturelle Prägungen des Menschen, die andere entspringt der permanenten Veränderungsdynamik der Moderne. Wir neigen offenbar dazu, in unseren Einstellungen, Denk- und Verhaltensweisen die traditionale zugunsten der modernen Welt zu verdrängen. Das Verdrängte jedoch wirkt untergründig weiter, verstärkt sich möglicherweise sogar und generiert unterschiedlichste Symptome. Wir kommen darauf zurück. Die traditionale Prägung jedenfalls scheint auf tribale, stammeskulturelle Ursprünge zurückzugehen. Stammeskulturen können als wohlgeordnete Gemeinschaften verstanden werden, in denen die Kommunikation insbesondere durch die Mündlichkeit der Sprache geprägt war. Die Gesellschaft zeichnete sich dadurch aus, dass im Stamm jede/r jede/n kannte. Das Eigene trennte sich klar ab vom Fremden. Menschen waren in all ihren persönlichen Bezügen voll in die Gesellschaft integriert und hatten ihren festen Platz, ihre klar bestimmte Position. Die sozialen Verhältnisse waren von Reziprozität, also von einer Gegenseitigkeit gekennzeichnet, so dass etwa das Helfen ein Helfen unter potentiell Gleichen war. Zudem erwarb derjenige, der einem anderen half, den Anspruch, von diesem anderen ebenfalls etwas zu bekommen, etwa bei Bedarf ebenfalls Hilfe oder aber eine andere 3 Dankesleistung (vgl. Luhmann 1973). Der Stamm wurde durch diese Gegenseitigkeit von Geben und Nehmen, durch dieses Prinzip des Erwiderns (vgl. Hondrich 2006) zusammen gehalten, so dass die sozialen Bindungen in Abgrenzung zu einer potentiell feindlichen sozialen (andere Stämme) oder natürlichen Umwelt gesichert waren. Für die Sippe fielen gewissermaßen Stammesgemeinschaft und Gesellschaft zusammen. Die nächsten Etappen der gesellschaftlichen Evolution können analog zur Stammesgesellschaft, die durch die Mündlichkeit der Sprache geprägt war, als Antworten auf das Entstehen neuer sozialer Verbreitungsmedien aufgefasst werden (vgl. Baecker 2007). Die feudale, pyramidenartig durch Schichten differenzierte und geprägte Gesellschaft könnte demnach als Antwort auf das Entstehen der Schrift gedeutet werden. Die moderne Gesellschaft nun, die wir intensiver betrachten werden und die als funktional differenziert gilt, reagierte auf die Entstehung des Buchdrucks. Ob wir derzeit an der Schwelle zu einer nächsten, tatsächlich einer postmodernen Gesellschaft stehen, in welcher der Buchdruck durch die Dominanz des neuen Verbreitungsmediums Computer bzw. Internet überformt wird, ist eine Frage, mit welcher sich Dirk Baecker (2007) derzeit beschäftigt. Wir wollen hier jedoch bei der modernen Gesellschaft verweilen. Die moderne Gesellschaft ist jene Sozialform, die bereits Karl Marx und Friedrich Engels beschreiben und die für diese Denker durch eine eigendynamisch Loslösung der ökonomischen Rationalität vom Rest des gesellschaftlichen Lebens, eben kapitalistisch geprägt ist. Die kapitalistische Eigenlogik und Autonomie der Wirtschaft zeige sich immer deutlicher und bestimme mehr und mehr alle anderen gesellschaftlichen Bereiche. Heute nennen wir dieses Phänomen Ökonomisierung. Für Marx und Engels (1948: 49) offenbart sich diese Ökonomisierung durch eine „fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände“. Das führe dazu, dass „[a]lle festen, eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen […] aufgelöst [werden], alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung ihre gegenseitigen Beziehungen nüchtern anzusehen.“ Diese Dynamisierung des sozialen Lebens wirkt freilich auch auf die Familie, so dass Alice Salomon (1928: 137) bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts konstatieren konnte, dass die „Menschen […] von der Scholle losgelöst [sind]. Sie müssen der Arbeit dorthin nachwandern, wo sie Gelegenheit und Unterhalt finden. Die Familie ist aufgerissen. Wie Flugsand, wie 4 Blätter, die vom Winde verweht werden, treibt die Arbeit sie von Ort zu Ort.“ Seit geraumer Zeit spricht Ulrich Beck (etwa 1993) als Vertreter der Theorie reflexiver Modernisierung sogar davon, dass die erste Moderne, die kapitalistische Industriegesellschaft, und die damit etablierten gesellschaftlichen Institutionen wie die Kleinfamilie, die Geschlechterverhältnisse oder die Erwerbsarbeit einen erneuten Wandel und Erosionsprozess durchmachen, so dass eine zweite Moderne entsteht, die durch eine noch weiter gesteigerte Flexibilisierung und Verflüssigung gesellschaftlicher Prozesse sowie durch Risiken und Nebenfolgen allen sozialen Handelns geprägt ist. Wiederkehr der Tradition in der Familie Wir wollen uns jetzt auf die soziologische Systemtheorie Niklas Luhmanns beziehen, die die eigenartige Ambivalenz von Tradition und Moderne, die in der heutigen Familie aufscheint, zumindest implizit veranschaulicht. Nach der soziologischen Systemtheorie (siehe etwa Luhmann 1997) löst sich nicht nur die Wirtschaft als eigendynamisches System vom Rest der Gesellschaft ab. Vielmehr erleben wir eine Eigendynamik unterschiedlicher gesellschaftlicher Logiken: Neben der Wirtschaft entstehen zwar aufeinander angewiesene, aber klar getrennte gesellschaftliche Funktionsbereiche wie Politik, Wissenschaft, Recht, Kunst, Sport, Massenmedien, Erziehung, Gesundheitssystem etc. Daher wird die Gesellschaft aus dieser Blickrichtung als funktional differenziert bezeichnet. Jeder dieser Bereiche bedient eine andere gesellschaftliche Funktion und stellt den anderen Funktionsbereichen notwendige Leistungen zur Verfügung. Für Luhmann ändert sich mit der funktionalen Ausdifferenzierung auch die Partizipation der Menschen an der Gesellschaft. Nicht mehr Integration in die Gesellschaft sei der maßgebliche Teilhabemodus, sondern Inklusion in die Funktionssysteme. Um ihre physische, psychische und soziale Existenz zu sichern, sind heutige Individuen darauf angewiesen, dass sie von den Funktionssystemen für sozial relevant erachtet, dass sie inkludiert werden. Inklusion heißt jedoch, dass nicht der ganze Mensch vom Wirtschaftssystem, der Politik, dem Rechtssystem oder dem Gesundheitssystem einbezogen wird, sondern nur rollenhafte Ausschnitte der Person, etwa Konsumenten (vom Wirtschaftssystem), Wähler (vom Politiksystem), Staatsbürger (vom Rechtssystem) oder Patienten (vom Gesundheitssystem). Vielleicht könnten wir zugespitzt sagen, dass sich der moderne Mensch von der Gesamtgesellschaft emanzipiert. „Der Grund dafür: daß bei funktionaler Differenzierung die Einzelperson nicht 5 mehr in einem und nur einem Subsystem der Gesellschaft angesiedelt sein kann, sondern sozial ortlos vorausgesetzt werden muß“ (Luhmann 1982: 16). Was aber heißt das für die Familie als gesellschaftliches System? Die Antwort, die die Systemtheorie auf diese Frage gibt, ist interessant. Denn die Familie entziehe sich der Inklusionslogik der modernen Gesellschaft. Während Inklusion ausschnitt- oder rollenhafte Teilnahme an den funktionalen Subsystemen bedeutet, inkludieren Menschen familiär nach wie vor als ganze Personen. Familie ist und bleibt auch in der Moderne eine Sozialform, die an die beschriebene stammesgesellschaftliche Vergemeinschaftung erinnert. Luhmann (1990: 208) drückt genau dies aus, wenn er schreibt, dass die Familie ein soziales System ist, in „dem das Gesamtverhalten, das als Person Bezugspunkt für Kommunikation werden kann, behandelt, erlebt, sichtbar gemacht, überwacht, betreut, gestützt werden kann“. Da in der Familie so etwas wie Vollinklusion, wir könnten vielleicht auch sagen: klassische Integration (vgl. Kleve 2004) vollführt wird, kommt Luhmann zum Schluss, dass dieses Sozialsystem „das Modell einer Gesellschaft [bildet], die nicht mehr existiert“ (ebd.). Familie entspricht einer traditionalen, konkreter: tribalen Vergemeinschaftung, allerdings im einbettenden Kontext der Moderne, „also unter den Bedingungen einer anders strukturierten gesellschaftlichen Umwelt“ (ebd.). Damit wird zugleich das Spezifische, mithin die besondere Funktion der modernen Familie benannt: Sie bietet etwas, das sonst nirgends in der Gesellschaft zu haben ist: „die Inklusion der Vollperson“ (ebd.). „Die Familie lebt von der Erwartung, daß man hier für alles, was einen angeht, ein Recht auf Gehör, aber auch eine Pflicht hat, Rede und Antwort zu stehen. Man kann erzählen, man darf auch fragen. Für das, was mit der Einzelperson zusammenhängt, gibt es keine anerkannten thematischen Beschränkungen“ (ebd.). Bruno Hildenbrand (2005: 84) macht ebenfalls darauf aufmerksam, wenn er hinsichtlich der Familie den „Unterschied zu rollenförmigen Sozialbeziehungen“ betont und formuliert, das „im Falle von Paar- und Familienbeziehungen der Ausschluss und nicht der Einschluss von Themen begründungspflichtig ist“ – dazu sein schönes Beispiel: „So kann man als Postkunde problemlos den Wunsch des Briefträgers nach einem Gespräch über seine Ehekonflikte zurückweisen. Verweigert aber ein Ehemann grundsätzlich das Gespräch mit seiner Frau über ihre Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, dann stellt er die Paarbeziehung insgesamt infrage“ (ebd.). Die moderne Familie ist demnach ein besonderes System in der funktional differenzierten Gesellschaft, weil in ihr die vormoderne Sozialform des Stammes weiterlebt: Wir sind als 6 ganze Personen inkludiert bzw. integriert, stehen in einem reziproken Bindungsverhältnis zueinander, das einer „affektiven Solidarität“ (ebd.) gleicht, da eine generalisierte emotionale Beziehung hinsichtlich der Partnerebene (diese kann jedoch getrennt werden) und hinsichtlich der Eltern- und der Eltern/Kind-Ebene (diese lässt sich nicht auflösen) auf Dauer gestellt wird. Während die Moderne mit einer permanenten Veränderungsdynamik der Gesellschaft einhergeht, sich in allen gesellschaftlichen Teilsystemen stetige Wandlungsprozesse vollziehen, mithin Dauerkrisen normal sind, so verweist das Traditionelle auf Kontinuität und Beständigkeit. Hinsichtlich der Familie könnten wir an dieser Stelle bereits zu der sicherlich empirisch plausiblen Erkenntnis kommen, dass das Leben in Partnerschaften, dass die Erziehung von Kindern, dass das Pflegen von Angehörigen, dass also die familiäre Lebensführung, die emotionale Dauer und Intensität intendiert, tatsächlich auf kontinuierliche und beständige Gemeinsamkeit ausgerichtet ist. Was Lebenspartner sowie Eltern mit ihren Kindern ohne Frage benötigen ist gemeinsame Zeit, soziale Verlässlichkeit und räumliche Verbundenheit – obwohl die gesellschaftliche Umwelt, d.h. insbesondere die Eigendynamiken der gesellschaftlichen Teilsysteme das Gegenteil davon erwarten: zeitliche, soziale und räumliche Flexibilität, eben den flexiblen Menschen (siehe Sennett 1998). Dementsprechend arbeitet auch Norbert Bolz (2006) in seinem engagierten Essay Die Helden der Familie heraus, dass es von der Gesellschaft, besser: von ihren funktionalen Subsystemen nicht honoriert wird, starke familiäre Emotionen zu empfinden. „Eher lässt sich umgekehrt sagen, daß Gefühlsschwäche in der modernen Welt adaptiv ist. Je emotionaler man nämlich an eine Sache herangeht, um so geringer wird die eigene Mobilität und Flexibilität“ (ebd.: 53). Und daher kommt Bolz zu seinem pointierten und knappen Fazit: „Familiengefühle sind unmodern“ (ebd). Somit bewertet er diejenigen als heroisch, die versuchen, den familiären Gefühlen, Ansprüchen und Bedürfnissen zu erziehender Kinder und zu pflegender Angehöriger trotz gegenläufiger gesellschaftlicher Erwartungen immer wieder erneut gerecht zu werden: „Eltern sind die modernen Helden“ (ebd.: 54). Gerade weil die gesellschaftliche Umwelt strukturell familienfeindlich ist und die Familie das einzige System ist, das Menschen voll inkludiert, in klassischer Weise integriert, steigen freilich die Erwartungen und Ansprüche an das familiale Miteinander (vgl. auch Luhmann 1990: 208). Dadurch wird die Familie im Prozess ihres Abgrenzens von der feindlichen gesellschaftlichen Umwelt sowohl gefestigt als auch vor permanente Zerreißproben gestellt. Ein Blick auf die Scheidungsraten und gleichermaßen auf die Zahlen von 7 Familienneugründungen kann dies offenbaren. Aber auch die Pluralisierung der Familienformen verweist auf dieses Phänomen, so dass wir vielleicht nicht nur vom flexiblen Menschen, sondern ebenfalls von der flexiblen Familie sprechen können (siehe etwa Schuldt 2004). Die Familie flexibilisiert sich zwar, etwa in Form von „Patchworkfamilien“, aber sie bleibt dennoch Familie. Die Familie, in welcher Form auch immer, ist auch heute „der Ort, an dem man geboren wird, aufwächst und stirbt“ (Baecker 2007: 191). Auch wenn wir in üblicher Manier moderner Menschen glauben, dass wir alles, eben auch das Familiäre, qua Verhandlung und Entscheidung beliebig umgestalten können, um das Traditionelle abzustreifen und selbstbewusst zu planen, wie wir leben wollen, so schleicht sich hinterrücks wohl das wieder ein, was wir zu verdrängen trachten: die Tradition. „Es gehört […] zu den Paradoxien der Verdrängung, daß sie uns desto mehr an das Verdrängte bindet, je weniger wir von dieser Bindung wissen wollen“ (Hondrich 2004: 51f.). Und damit ist es vielleicht gar so, dass gerade in einer hoch flexiblen modernen Gesellschaft, die alles Heilige und Ständische verdampfen lässt, wie wir mit Marx und Engels gesagt haben, das Traditionelle wieder stärker hervor zu scheinen beginnt – als ambivalente Gegenbewegung. So sieht schon diejenige, die wir bereits als Zeugin für das Aufbrechen des familiären Zusammenhalts in der Moderne zitiert haben, nämlich Alice Salomon (1928), dass trotz aller Erosion des Familiären der Mensch „eingeordnet [ist] in die natürliche Gemeinschaft der Familie; in die Zusammenhänge der Blutsgemeinschaft“ (ebd.: 140). Salomon spricht noch pathetischer, wenn sie eine „heilige[…] Unteilbarkeit der Familie“ (ebd.) annimmt. Sie fordert, „daß alle Wohlfahrtspflege die Familie als Einheit erfaßt, selbst wenn nur ein Glied der Familie in irgendeiner Form Hilfe braucht“ (ebd.). Wie die systemische Familienberatung lehrt, weiß auch Salomon, dass „[a]lle Bemühungen der Wohlfahrtspflege um einen Einzelnen […] stets seine gesamte Familie [beeinflussen], wie andererseits alle Glieder der Familie, selbst wenn sie mit der Wohlfahrtspflege nie in Berührung kommen, die Tätigkeit fördern oder hindern, die einem ihrer Glieder zugewandt wird“ (ebd.). Diese Erkenntnis ist in der Sozialen Arbeit inzwischen Allgemeingut, obwohl häufig nicht danach gehandelt wird. Bedingt ist die systemische Vernetzung von Familienmitgliedern durch die tribale Struktur der Familie, durch die festen Kopplungen, die durch enge, d.h. zeitlich ausgedehnte, räumlich fixierte und emotional aufgeladene Systeminklusionen entstehen. Eigentlich dürfte es daher nicht überraschen, dass in derartigen Sozialsystemen 8 auch systemische Regeln weiterbestehen und sich immer wieder erneut manifestieren, die menschheitsgeschichtlich offenbar schon sehr alt sind. Systemische Regeln und Sozialprozesse in Familien Besonders die Empirie von Familienaufstellungen, die systematische Auswertung der Ergebnisse von Aufstellungsprozessen hat gezeigt, dass wir in Sozialsystemen, die zeitlich, räumlich und emotional eng gekoppelt, mithin hoch integriert sind, regelmäßig systemische Wirkprinzipien beobachten können, deren Beachtung bei Problemen lösend wirken kann (vgl. grundlegend dazu Weber 1997; König 2004 oder weiterführend Weber et al. 2005; für die Soziale Arbeit siehe Kleve 2010; 2011). Hinsichtlich dieser Wirkprinzipien und systemischen Regeln wollen wir uns an Matthias Varga von Kibéd und Insa Sparrer (2005) halten, denen wir eine konstruktivistische Interpretation dieser Prozesse verdanken. Demnach sind die systemischen Regeln, die in Familien wirken und von denen ich die erste und bedeutendste Regel knapp erläutere, nicht präskriptiv und nur bedingt deskriptiv, sondern eher kurativ zu verstehen. Was wir angesichts der Erfahrungen mit systemischen Aufstellungen lediglich sagen können, ist, dass diese Prinzipien bei der Lösung von Problemen sehr hilfreich sein können, dass sie familiäre Prozesse neu und zumeist konstruktiv und zukunftsorientiert zu strukturieren und zu ordnen vermögen – nicht mehr und nicht weniger. Daher bitte ich die Leser, dieses kurative Verständnis mitlaufen zu lassen, auch wenn die nachfolgenden Ausführungen wohl eher deskriptiv und explikativ, also beschreibend und erklärend daher kommen. Die wesentliche und zentrale Regel, die wir in Anlehnung an Karl Otto Hondrich (2004; 2006) auch als einen elementaren Sozialprozess in Familien bezeichnen könnten, lässt sich mit Vollständigkeit der Systemzugehörigkeit benennen. Zudem wird damit auf ein Phänomen verwiesen, das wir aus der Individualpsychologie, insbesondere aus der Psychoanalyse bereits kennen, nämlich auf die Dynamik der Verdrängung. Wie Josef Breuer und Sigmund Freud (1895) eindrucksvoll anhand von unterschiedlichen Fallgeschichten erzählen, können Gefühle, die mit Erlebnissen einhergehen, zwar aus dem Bewusstsein verdrängt werden, aber damit wird ihre Wirkung nicht negiert – im Gegenteil: Das Verdrängte wirkt untergründig weiter und erscheint als leidvolles Symptom wieder an der Oberfläche. Die Psychoanalyse empfiehlt als Heilungsweg das Aufdecken des Verdrängten. Denn die überraschende 9 Erkenntnis der Pioniere der Psychotherapie war, dass die Symptome regelmäßig verschwinden, wenn die verdrängten Gefühle ins Bewusstsein treten können. Interessant erscheint, dass durch die Aufstellungsarbeit hinsichtlich der Verdrängungsdynamik eine Isomorphie, eine Strukturähnlichkeit von sozialen und psychischen Systemen entdeckt wurde, die von Bert Hellinger mit einem so genannten tribalen „Sippengewissen“ (Weber 1997: 150) erklärt wird. Dieses Gewissen zeigt sich, indem es bei Verdrängungen von Familienmitgliedern eine systemische Symptombildung auslöst, um die aus dem familiären Gedächtnis Ausgeschlossenen zumindest symbolhaft ins System zurückzuholen. Ein solches Sippengewissen hatte für einen Stamm offenbar eine evolutionär wichtige Funktion. Denn für das Überleben der Stammesgruppe waren deren Vollständigkeit und damit die vollständige Einbeziehung aller Erfahrungen äußerst zentral, so dass jedes Mitglied das gleiche Zugehörigkeitsrecht hatte (vgl. Nelles 2006). So wie im Stamm so wirkt diese Dynamik noch heute in modernen Familien – zumindest können wir dies aus der Arbeit mit Familienaufstellungen schließen. Lebende oder bereits verstorbene Familienmitglieder, die aus welchen Gründen auch immer aus der familiären Geschichte ausgeklammert, verdrängt werden, wirken somit untergründig weiter. Dadurch können sich in nachfolgenden familiären Generationen Probleme wiederholen. Um die diesbezüglichen Symptome zu lösen, die Probleme zu beheben, empfiehlt die Aufstellungsarbeit – analog der Psychoanalyse – das Einblenden des Ausgeblendeten. Das nachträgliche Hineinnehmen der Ausgeschlossenen durch erinnerndes Achten und Anerkennen ihres Familienplatzes im Rahmen eines Aufstellungsprozesses kann, so zeigt sich häufig, aktuelle familiäre Symptome auflösen bzw. die Symptomträger von ihren Schwierigkeiten befreien. Das so genannte Sippengewissen bindet die Familienmitglieder über Generationen hinweg aneinander. Diese „unsichtbaren Bindungen“, von denen bereits die Familientherapeuten Ivan Boszormenyi-Nagy uns Geraldine Spark (1973) sprechen, werden durch Aufstellungen deutlich zu Tage gefördert, so dass sichtbar werden kann, dass dieses „Gewissen uns so folgenschwer an eine Gruppe [bindet], daß wir, was andere in ihr erlitten und verschuldet haben, als Anspruch und Verpflichtung spüren, und so werden wir, in fremde Schuld und fremde Unschuld, in fremdes Denken, Sorgen, Fühlen, in fremden Streit und fremde Folgen, in fremde Ziele und fremdes Ende blind verstrickt“ (Hellinger in Weber 1997: 150; sehr aufschlussreich und mit vielen Fallbeispielen siehe dazu auch Ancelin Schützenberger 1993). Auch hier kann die Familienaufstellung lösend wirken, wenn es zu symbolischen Ausgleichs10 oder Rückgabeprozessen von Schuld kommt (siehe ausführlich – aus systemischkonstruktivistischer Perspektive – dazu vor allem Sparrer 2004). Postmoderne Soziale Arbeit mit Familien – ein Blick in die Praxis Postmoderne Soziale mit Familien wird in diesem Beitrag als eine sozialprofessionelle Praxis verstanden, die der Ambivalenz Rechnung trägt, dass in Familien zwei gegensätzliche Bewegungen wirken: einerseits – gemäß der gesellschaftlichen Modernisierungsprozesse – die Verflüssigung, Dynamisierung und Flexibilisierung von klassischen familiären Werten, Normen, Strukturen, Geschlechterverhältnissen, Erziehungs- und Pflegepraktiken und anderseits – entsprechend der tribalen Herkunft der Familie – die traditionelle Vollinklusion (Integration) der Familienmitglieder mit all ihren sozialen und emotionalen Folgen sowie die systemischen Sozialprozesse und Regeln, die in Familienaufstellungen regelmäßig aufscheinen. Daher kann der Familiensozialarbeit empfohlen werden, dass sie zugleich modern und traditionell agieren sollte. Modern müsste die Soziale Arbeit in dem Sinne sein, dass sie die Erfahrung ernst nimmt, dass sich heutzutage nichts mehr von selbst versteht, sondern dass sich kognitive und soziale Strukturen verflüssigen und flexibilisieren. Daher müssen in Hilfeplanungen und -prozessen die Pluralität und Relativität von Problemsichtweisen und Zielvorstellungen radikal beachtet werden. Deshalb gilt es, Kommunikation über das zu stiften, worum es überhaupt gehen und was aus Sicht der Familie und ihrer Mitglieder als Ziel erreicht werden sollte. In die traditionelle Richtung weist die Familiensozialarbeit, wenn sie real oder virtuell alle Familienmitglieder einzubeziehen versucht, speziell auch jene, welche aus der familiären Interaktion verdrängt wurden oder werden. Diese intendierte Vollständigkeit des familiären Einbezugs bedeutet nicht, dass alle Familienmitglieder auch real in die sozialarbeiterischen Prozesse inkludiert werden müssen. Es heißt jedoch, dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in ihrer Haltung der Familie gegenüber die Vollständigkeit beachten und ihnen bewusst ist, dass die zirkulären Verkoppelungen von Familienmitgliedern besonders stark sind. Daher hängen beobachtete Symptome nicht selten mit ausgeblendeten familiären Themen zusammen oder verweisen auf verdrängte Familienmitglieder. Und Effekte sowie nicht gewollte Nebenfolgen sozialarbeiterischer Interaktionen zeigen sich möglicherweise auch dort, wo sie nicht vermutet werden – an bisher nicht thematisierten Orten, Personen oder Aspekten der Familie. Denn 11 „[d]as Tun des Einen ist das Tun des Anderen“, wie Helm Stierlin (1971) mit einem Buchtitel pointiert. In der Praxis können wir sicherlich zahlreiche sozialarbeiterische Programme finden, die – wahrscheinlich zumeist implizit, ohne dies offen zu reflektieren – diese Ambivalenz von Moderne und Tradition zur Geltung bringen. Ich will abschließend zwei Ansätze kurz skizzieren, die aus meiner Sicht dem ambivalenzorientierten Anspruch postmoderner Sozialer Arbeit mit Familien besonders entsprechen: das Triangel-Konzept und den Familienrat. Das Triangel-Konzept, das mit unterschiedlichen Modellprojekten in Deutschland und der Schweiz startete, stellt eine familientherapeutisch orientierte stationäre oder teilstationäre Soziale Arbeit mit der ganzen Familie her und wurde vom Familientherapeuten Michael Biene entwickelt (siehe ausführlich dazu Kleve 2003: 131ff.; 2007: 131ff.). In der Regel werden bei gravierenden Erziehungsproblemen in Familien, die von den Sozialprofessionellen oder von Familiengerichten als Kindeswohlgefährdungen bewertet werden, Kinder aus dem familiären Haushalt herausgenommen und fremd untergebracht. Die Arbeit konzentriert sich dann, trotz praktizierter Elternarbeit, auf die Kinder – mit der Folge, dass sich die familiäre Interaktion nur selten gravierend verändert und sich die Eltern aus der Erziehungsverantwortung verabschieden. Bei Triangel werden demgegenüber nicht die Kinder aus dem familiären Haushalt herausgenommen, sondern die gesamte Familie wird in einen sozialarbeiterischen Prozess einbezogen. Im stationären oder teilstationären Setting wird mit den Eltern und den Kindern gearbeitet. Dabei bleibt die Erziehungsverantwortung bei den Eltern. Im Mittelpunkt der professionellen Arbeit steht zudem die Interaktion zwischen Eltern und Kindern sowie zwischen allen anderen relevanten Familienmitgliedern und öffentlichen Institutionen, etwa dem Jugendamt (siehe ausführlicher dazu etwa http://www.sitinstitut.ch und auch http://www.jakus.org/angebote/familienprojekt-triangel.html). Der Familienrat, der ursprünglich aus Neuseeland kommt, dort in den 1980er Jahren von der tribalen Kultur der Maori initiiert wurde, setzt sich als alternatives Verfahren der Hilfeplanung inzwischen auch in unseren Breitengraden mehr und mehr durch (siehe datzu Früchtel et al. 2007: 34ff.). Er ist geradezu eine idealtypische Verbindung aus moderner Sozialarbeit und traditioneller Orientierung. Modern ist der Familienrat, weil er auf eine diskursive Aushandlungskultur setzt und die radikale Selbstbestimmung der Familie intendiert. Es geht nämlich darum, dass die Familienmitglieder sowie weitere lebensweltliche Bezugspersonen gemeinsam besprechen, 12 wie die Probleme der Familie bzw. einzelner Personen gelöst werden könnten. Genau dazu wird ein selbstbestimmter Plan erstellt, der in einem Kontext gesucht wird, den die Professionellen zwar organisieren und flankieren, den sie aber nicht durch ihre Anwesenheit stören. Denn die entscheidende Phase eines Familienrates, die exklusive Familienzeit, findet ohne die Professionellen statt. Der Plan wird freilich – insbesondere in Fällen, in denen es um Kinderschutz geht – von den Professionellen bewertet und, wenn er denn akzeptiert wird, unterstützt. Die Professionellen selber dürfen jedoch keine alternativen Lösungsvorschläge entwickeln; sie haben lediglich ein Vetorecht, wenn sie der Ansicht sind, dass durch den Plan die Problemlösung, etwa die Beseitigung der Kindeswohlgefährdung nicht gelingen kann. Auf Tradition setzt der Familienrat, weil er die Familie an die erste und zentrale Stelle rückt hinsichtlich der Suche und der Umsetzung von Problemlösungsprozessen. Die Professionellen eröffnen damit den familiären und lebensweltlichen Selbstorganisationsprozessen einen Weg. Sie gründen ihre Arbeit auf die sozialstrukturelle Leistung, die in der modernen Gesellschaft nur die Familie zu realisieren vermag, die die Soziale Arbeit zwar ebenfalls kompensatorisch zu erreichen trachtet, aber nie gänzlich praktizieren kann: die ganzheitliche Einbindung von Menschen, die Vollinklusion bzw. Integration potentiell aller Persönlichkeitsanteile und aller Personen der Familie. Im Sinne der benannten systemischen Regel von der Vollständigkeit des Einbezugs aller dazugehörigen Aspekte der Familie wird der Familienrat professionell so geplant und mit der Familie vororganisiert, dass insbesondere bisher vielleicht eher zu wenig beachtete Familienmitglieder oder lebensweltliche Bezugspersonen in den Rat einbezogen werden. Denn gerade von diesen bisher eher ausgeblendeten oder gar verdrängten Personen könnten maßgebliche Ressourcen zur Problemlösung ausgehen. Zusammenfassend formuliert, postmoderne Familiensozialarbeit kann als eine Praxis verstanden werden, die die Doppelgesichtigkeit des familiären Lebens beachtet. Gemäß moderner Dynamiken der Auflösung von fest gefügten Strukturen, Mustern, Normen, Werten und Standards setzt sie auf eine kommunikative Aushandlungskultur, insbesondere bei der Erhebung von Problemsichtweisen und der Bestimmung von Zielen. Bei der Lösungssuche jedoch verbündet sie sich mit der prägenden, alle Familienmitglieder und deren Persönlichkeitsanteile integrierenden Kraft der Familie. Diese versucht systemische Familiensozialarbeit konstruktiv, problemlösend und für die Familienmitglieder gewinnbringend zu stützen und anzuregen. 13 Literatur: Adorno, Theodor W., 1966: Negative Dialektik. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Ancelin Schützenberger, Anne, 1993: Oh, meine Ahnen. Wie das Leben unserer Vorfahren in uns wiederkehrt. Heidelberg: Carl-Auer, 2003. Baecker, Dirk, 2007: Studien zur nächsten Gesellschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Bauman, Zygmunt, 1991: Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit. Frankfurt/M.: Fischer, 1995. Beck, Ulrich, 1993: Die Erfindung des Politischen. Zu einer Theorie reflexiver Modernisierung. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Bolz, Norbert, 2006: Die Helden der Familie. München: Fink. Breuer, Josef/Sigmund Freud, 1895: Studien über Hysterie. Frankfurt/M.: Fischer, 1991. Früchtel, Frank/Gudrun Cyprian/Wolfgang Budde, 2007: Sozialer Raum und Soziale Arbeit. Fieldbook: Methoden und Techniken. Wiesbaden: VS Verlag. Hildenbrand, Bruno, 2005: Einführung in die Genogrammarbeit. Heidelberg: Carl-Auer. Hondrich, Karl Otto, 2004: Liebe in Zeiten der Weltgesellschaft. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Hondrich, Karl Otto, 2006: Verborgene Bindungen, in: Wilfried Nelles/Heinrich Breuer (Hrsg.): Der Baum trägt reiche Frucht. Dimensionen und Weiterentwicklungen des Familienstellens. Heidelberg: Carl-Auer: 42-54. Honneth, Axel (Hrsg.), 2002: Befreiung aus der Mündigkeit. Paradoxien des gegenwärtigen Kapitalismus. Frankfurt/M./New York: Campus. Horkheimer, Max/Theodor W. Adorno, 1947: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. Reclam: Leipzig, 1989. Junge, Matthias, 2000: Ambivalente Gesellschaftlichkeit. Die Modernisierung der Vergesellschaftung und die Ordnungen der Ambivalenzbewältigung. Opladen: Leske + Budrich. Kleve, Heiko, 1999/2007: Postmoderne Sozialarbeit. Ein systemtheoretischkonstruktivistischer Beitrag zur Sozialarbeitswissenschaft. Wiesbaden: VS Verlag. Kleve, Heiko, 2003: Sozialarbeitswissenschaft, Systemtheorie und Postmoderne. Grundlegungen und Anwendungen eines Theorie- und Methodenprogramms. Freiburg/Br.: Lambertus. Kleve, Heiko, 2004: Die intime Grenze funktionaler Partizipation. Ein Revisionsvorschlag zum systemtheoretischen Inklusions-/Exklusions-Konzept, in: Roland Merten/Albert Scherr (Hrsg.): Inklusion und Exklusion in der Sozialen Arbeit. Wiesbaden: VS-Verlag: 163-187. Kleve, Heiko, 2007: Ambivalenz, System und Erfolg. Provokationen postmoderner Sozialarbeit. Heidelberg: Carl-Auer. Kleve, Heiko, 2009: Postmoderne Sozialarbeitswissenschaft. Zur Praxis und Wissenschaft in Ambivalenz und Vielfalt, in: Bernd Birgmeier/Eric Mührel (Hrsg.): Die Sozialarbeitswissenschaft und ihre Theorie(n). Positionen, Kontroversen, Perspektiven. Wiesbaden: VS Verlag: 101-112. Kleve, Heiko, 2010: Systemische Strukturaufstellungen in der Sozialen Arbeit. Theorie und Praxis eines innovativen Konzeptes. Veröffentlicht am 11.12.2010 in socialnet Materialien unter http://www.socialnet.de/materialien/112.php, [14.02.2011]. Kleve, Heiko, 2011: Aufgestellte Unterschiede. Systemische Soziale Arbeit weitergedacht. Heidelberg: Carl-Auer (in Vorbereitung). König, Oliver, 2004: Familienwelten. Theorie und Praxis von Familienaufstellungen. Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta. Luhmann, Niklas, 1973: Formen des Helfens im Wandel gesellschaftlicher Bedingungen, in: ders. Soziologische Aufklärung 2. Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1975: 134-149. 14 Luhmann, Niklas, 1982: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Luhmann, Niklas, 1990: Sozialsystem Familie, in: ders. Soziologische Aufklärung 5. Konstruktivistische Perspektiven. Opladen: Westdeutscher Verlag: 196-217. Luhmann, Niklas, 1997: Die Gesellschaft der Gesellschaft. 2 Bände. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Marx, Karl/Friedrich Engels, 1948: Manifest der Kommunistischen Partei. Berlin: Dietz, 1989. Nelles, Wilfried, 2006: Familien- und Systemaufstellungen. Methode, soziale Ordnungen und philosophische Grundhaltung, in: Das gepfefferte Ferkel. Online-Journal für systemisches Denken und Handeln, http://www.ibs-networld.de/ferkel/21/002.htm [17.01.2007] sowie http://www.wilfried-nelles.de/documents/Familien-undSystemaufstellungen.pdf [14.02.2011]. Salomon, Alice, 1928: Grundlegung für das Gesamtgebiet der Wohlfahrtspflege, in: Werner Thole et al. (Hrsg.): KlassikerInnen der Sozialen Arbeit. Sozialpädagogische Texte aus zwei Jahrhunderten – ein Lesebuch. Neuwied/Kriftel: Luchterhand: 131-145. Schuldt, Christian, 2004: Der Code des Herzens. Liebe und Sex in den Zeiten maximaler Möglichkeiten. Frankfurt/M.: Eichborn. Sennett, Richard, 1998: Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus. Berlin: Berlin Verlag. Sparrer, Insa, 2004: Wunder, Lösung und System. Lösungsfokussierte Systemische Strukturaufstellungen für Therapie und Organisationsberatung. Heidelberg: Carl-Auer. Stierlin, Helm, 1971: Das Tun des Einen ist das Tun des Anderen. Eine Dynamik menschlicher Beziehungen. Frankfurt/M.: Suhrkamp. Varga von Kibéd, Matthias/Insa Sparrer, 2005: Ganz im Gegenteil. Tetralemmaarbeit und andere Grundformen Systemischer Strukturaufstellungen – für Querdenker und solche, die es werden wollen. Heidelberg: Carl-Auer. Weber, Gunthard (Hrsg.), 1997: Zweierlei Glück. Die systemische Psychotherapie Bert Hellingers. Heidelberg: Carl-Auer. Weber, Gunthard/Gunther Schmidt/Fritz B. Simon, 2005: Aufstellungsarbeit revisted ... nach Hellinger? Mit einem Metakommentar von Matthias Varga von Kibéb. Heidelberg: CarlAuer. Autor: Heiko Kleve, Prof. Dr., Studium der Sozialen Arbeit (Sozialarbeit/Sozialpädagogik) und der Sozialwissenschaften, Promotion in Soziologie. Zusatzqualifikationen als Systemischer Berater (DGSF), Supervisor (DGSv)/Systemischer Supervisor (SG), KonfliktMediator (FH) und Case Management-Ausbilder (DGCC). Professor für soziologische und sozialpsychologische Grundlagen sowie Fachwissenschaft Sozialer Arbeit an der Fachhochschule Potsdam. Forschungs- und Publikationsschwerpunkte: systemischkonstruktivistische und postmoderne Theorie und Methodik Sozialer Arbeit. Kontakt: [email protected]; http://sozialwesen.fh-potsdam.de/heikokleve.html 15