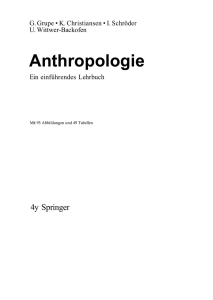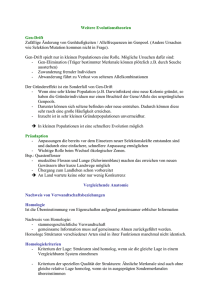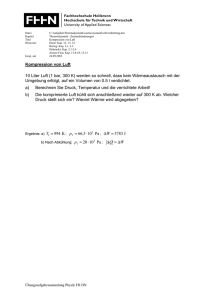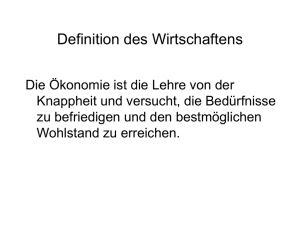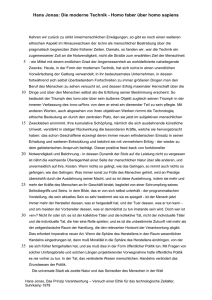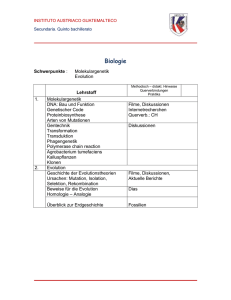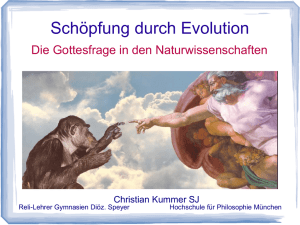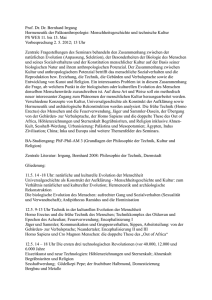- BeYeuMe
Werbung

Springer-Lehrbuch G. Grupe · K. Christiansen · I. Schröder U. Wittwer-Backofen Anthropologie Ein einführendes Lehrbuch Mit 95 Abbildungen und 49 Tabellen Professor Dr. Gisela Grupe Abteilung Biologie I Bereich Biodiversität/Anthropologie Universität München Grosshaderner Straße 2 82152 Planegg-Martinsried Professor Dr. Kerrin Christiansen Universität Hamburg Biozentrum Grindel Abteilung Humanbiologie Martin-Luther-King-Platz 3 20146 Hamburg Priv.-Doz. Dr. Inge Schröder Universität Kiel Zoologisches Institut Abteilung Anthropologie Olshausenstraße 40 24098 Kiel Professor Dr. Dr. Ursula Wittwer-Backofen Professor Universität Freiburg Institut für Humangenetik und Anthropologie Breisacherstraße 33 79106 Freiburg ISBN 3-540-21159-4 Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben auch bei nur auszugsweiser Verwertung vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes. Springer ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media springer.de © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005 Printed in Germany Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Produkthaftung: Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Verlag keine Gewähr übernommen werden. Derartige Angaben müssen vom jeweiligen Anwender im Einzelfall anhand anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Satz: perform electronic publishing GmbH, 69115 Heidelberg Einbandgestaltung: deblik Berlin Titelbild: Elke Werner 29/3150WI – 5 4 3 2 1 0 – Gedruckt auf säurefreiem Papier Vorwort Anlass zu der Abfassung dieses einführenden Lehrbuches war nicht allein das beharrliche Drängen des Springer-Verlages. Eine nicht nur außerhalb, sondern gelegentlich auch innerhalb der Wissenschaften anzutreffende Unsicherheit über die Inhalte dieses ohne Frage breit gefächerten Faches gab den Anstoß dazu, sich auf die unabdingbaren Inhalte einer Grundausbildung in der Anthropologie zu besinnen, ungeachtet weiterführender spezieller Ausrichtungen oder der Berührungspunkte mit anderen Disziplinen. Aufgrund dieser fachlichen Breite wiederum haben wir uns für ein Mehrautoren-Buch entschlossen und uns bemüht, die fachlichen Grundkenntnisse in angemessener Form zu präsentieren. Ein jeweils größerer Raum wurde dabei jedoch jenen Abschnitten dieses Buches gewidmet, welche zusätzliche Kenntnisse aus Gebieten benötigen, die nicht an allen biologischen Fakultäten vertreten sind, wie z. B. aus der Demographie, oder aus solchen, welche grundlegende Kenntnisse aus primär nicht-biologischen Fächern benötigen, wie z. B. der Mineralogie und Geologie im Falle des Kapitels zur Prähistorischen Anthropologie. Wir Verfasserinnen können auf eine außerordentlich fruchtbare Teamarbeit zurückblicken. Ohne vielfältige Hilfestellung wäre jedoch die Realisierung dieses Buchprojektes nicht möglich gewesen. An erster Stelle sei dem Springer-Verlag in Heidelberg für die Betreuung gedankt, insbesondere Frau Iris Lasch-Petersmann, Frau Stefanie Wolf und Frau Elke Werner. Für die Anfertigung bzw. Verfügbarmachung von Originalabbildungen danken wir Herrn Michael Schulz, Institut für Paläoanatomie und Geschichte der Tiermedizin der LMU München, Frau Carolin Bleese, Department Biologie II der LMU München, Frau Manuela Schellenberger, GeoBio-Center der LMU München, dem Tierbildarchiv Toni Angermayer in Holzkirchen, Dr. Thomas Meier, Institut für Ur- und Frühgeschichte der LMU, sowie aus den Arbeitsgruppen der Autorinnen Dr. Karola Dittmann, Dr. Mike Schweissing, und den Diplom-Biologinnen Stefanie Doppler und Nadja Strott. Wertvolle technische Hilfe bei der Manuskripterstellung lieferte Frau Michaela Svihla, München. Die mühsame Aufgabe wiederholten Korrekturlesens haben Dipl.-Biol. Nadja Strott und Dr. Anja Staskiewicz, LMU München, Dr. Marc Luy vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, die Mitarbeiter vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung Dr. Jan Beise, Dr. Alexander Fabig und MA Svenja Weise, sowie cand.phil. Simone Ortolf und Julia Ruf von der Universität Freiburg, und PD Dr. Stefanie Ritz-Timme, Institut für Rechtsmedizin der Universität Kiel, auf sich genommen. Einige Kapitel wurden im Entwurf in Lehrveranstaltungen an VI Vorwort der Universität Freiburg im WS02/03 und im SS 03 mit großem Engagement unter den Studierenden erarbeitet. Ihnen allen gilt unser besonderer Dank. Die Autorinnen, im Juni 2004 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ............................................................................................ 1 2 Evolution des Menschen ................................................................... 3 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3.3 2.3.4 2.3.5 Stellung des Menschen in der Natur ..................................................... 3 Die Ordnung Primates ........................................................................... 3 Sonderstellung des Menschen in der Natur? ...................................... 13 Stammesgeschichte .............................................................................. 22 Die Wurzeln der Homininae und Ponginae ....................................... 24 Die Vielfalt der Hominini .................................................................... 26 Die Schwierigkeit, Ordnung in die Vielfalt zu bringen ...................... 27 Die frühesten Homininen ........................................................................ 28 Die beginnende Radiation der Hominini im Pliozän: Australopithecus, Paranthropus und Kenyanthropus ....................... 31 Die Gattung Homo ............................................................................... 35 Hominisationsszenarien ...................................................................... 49 Die Evolution ausgewählter arttypischer Merkmale ......................... 54 Prähistorische Anthropologie ............................................................. 64 Aufgaben und Ziele .............................................................................. 64 Aufbau und Entwicklung des menschlichen Skelettes, Erhaltungsgrad archäologischer Skelettfunde ................................... 72 Diagnose biologischer Basisdaten ....................................................... 89 Paläodemographie ............................................................................. 102 Archäometrie ...................................................................................... 123 3 Bevölkerungsbiologie ................................................................... 139 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 3.2.1 3.2.2 Populationsgenetik ............................................................................ 139 Aufgaben und theoretische Grundlagen ........................................... 139 Veränderung von Genfrequenzen ..................................................... 144 Evolutionäre Aspekte der Populationsgenetik ................................. 155 Medizinische Aspekte ........................................................................ 162 Humanökologie .................................................................................. 169 Homo sapiens – eine polytypische Spezies ....................................... 170 Anpassung an physikalische Umweltparameter .............................. 172 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.3 2.3.1 2.3.2 VIII 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 Inhaltsverzeichnis Anpassung an biologische Umweltparameter .................................. 184 Eingriffe von Menschen in die naturräumliche Umwelt ................. 188 Die Entwicklung der Weltbevölkerung ............................................. 191 Epidemiologie und Public Health ..................................................... 203 Demographie ...................................................................................... 213 Aufgaben und Ziele, Geschichte ........................................................ 213 Konzepte demographischer Messungen ........................................... 220 Demographische Maßzahlen ............................................................. 224 Die demographische Alterung .......................................................... 238 Biologische und soziale Determinanten der Sterblichkeit ............... 246 Der demographische Wandel in Deutschland im internationalen Vergleich. Die kinderlose Gesellschaft – Fertilität im demographisch-biologischen Kontext ......................... 253 Bevölkerungsprognosen, Bevölkerungskontrolle und Bevölkerungspolitik ................................................................... 266 4 Lebenszyklus .................................................................................. 271 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 Wachstum, Reifung, Altern ............................................................... 271 Menschlicher Lebenszyklus und postnatales Wachstum ................ 272 Steuerung des postnatalen Wachstums ............................................ 280 Evolution des menschlichen Wachstums- und Reifemusters ......... 284 Altern und Seneszenz ......................................................................... 286 Ursachen des Alterns ......................................................................... 299 Fortpflanzungsbiologie ...................................................................... 311 Geschlechtsdetermination und sexuelle Differenzierung ................ 313 Sexuelle Reifung ................................................................................. 322 Sexualhormone und Sexualverhalten ............................................... 329 Evolutionsbiologische Aspekte der Fertilität ................................... 336 Keimzellentwicklung, Befruchtung und Implantation: Die ersten Phasen menschlichen Lebens .......................................... 343 Störfaktoren der Fertilität bei Frauen und Männern ....................... 357 Menopause ......................................................................................... 368 Vitalität und Reproduktionsfähigkeit des älteren Mannes ............. 375 5 Angewandte Anthropologie ........................................................ 381 5.1 5.1.1 5.1.2 Industrieanthropologie ...................................................................... 381 Definition und Forschungsgegenstand ............................................. 381 Die Variabilität von industrieanthropologisch relevanten Körpermaßen ................................................................... 382 Stichproben ........................................................................................ 387 Methoden ............................................................................................ 390 Forensische Anthropologie ............................................................... 403 5.1.3 5.1.4 5.2 Inhaltsverzeichnis IX 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 Gewinnung forensischer Individualdaten ........................................ 403 Gesichtsrekonstruktion ..................................................................... 407 Fotoidentifikation .............................................................................. 410 Altersschätzung beim lebenden Menschen ...................................... 411 6 Verhaltensbiologie ......................................................................... 417 6.1 6.1.1 6.1.2 Grundlagen des Verhaltens ............................................................... 417 Die Entwicklung der Verhaltensbiologie .......................................... 417 Die theoretischen Grundlagen der modernen Verhaltensbiologie .................................................... 422 Verhalten des Menschen .................................................................... 427 Eltern-Kind-Beziehungen .................................................................. 427 Kinderethologie – die Ontogenese menschlichen Verhaltens ......... 430 6.2 6.2.1 6.2.2 Literaturverzeichnis ..................................................................................... 435 Sachverzeichnis ............................................................................................. 473 Einleitung Die Anthropologie gehört zwar heute zu den eher kleinen akademischen Fächern, zeichnet sich aber durch eine sehr große fachliche Breite aus. Sie ist daher vor allem für Studierende mehrheitlich schwierig zu strukturieren. Heute schließt die Lehre vom Menschen (Anthropologie, aus dem griechischen „ánthrÇpos“ = Mensch und „lógos“ = Lehre) die Betrachtung unserer nächsten Verwandten im Tierreich, der nicht-menschlichen Primaten, selbstverständlich mit ein. Dies ist notwendig zum Verständnis der biologischen Stellung der Spezies Homo sapiens in der Natur, vor allem aber zum Verständnis der stammesgeschichtlichen Genese scheinbar mensch-spezifischer Eigenschaften, wie z. B. die Fähigkeit zur Schaffung von Kulturen. Da Menschen Kulturwesen sind, welche in ihren Lebensäußerungen nicht allein aus der Biologie heraus verstanden werden können, empfindet sich die Anthropologie auch zu Recht als echtes Brückenfach, welches zwischen Natur- und Kulturwissenschaften vermittelt. Zahlreiche primär kulturelle Randbedingungen zeigen unmittelbare Auswirkungen auf wiederum basisbiologische Aspekte des Lebens (etwa das generative Verhalten), so dass beide Aspekte des „Menschseins“ auf das Engste verzahnt sind. Als genuin biologisches Ausbildungsfach verliert die Anthropologie daher niemals ihre kulturwissenschaftlichen Bezüge. Hierdurch erklärt sich auch ihre Eigenständigkeit als Fachrichtung in der Biologie, da eine Behandlung von Menschen im Rahmen einer „Humanzoologie“ dem Untersuchungsgegenstand nicht gerecht werden kann. Als kleines akademisches Fach mit einer eher geringen Personaldecke und der notwendigen persönlichen Spezialisierung auf einzelne fachliche Aspekte an den bundesdeutschen Forschungs- und Ausbildungsinstitutionen ist eine umfassende akademische Lehre regional nur begrenzt realisierbar. In der Folge werden an einzelnen Standorten vertretene Teilgebiete vor allem außerhalb der Fachwelt als stellvertretend für das Fach an sich angesehen. Dadurch ist die Bandbreite des Faches vielfach nicht bekannt. Andererseits trifft man auch auf die Tendenz, alles unter dem Begriff der Anthropologie zu subsumieren, was nur irgendwie mit Menschen zu tun hat. Dadurch kommt es zu einer Aufweichung des Fachprofils und einer nicht zu übersehenden Beliebigkeit in der Handhabung der Fachbezeichnung. Innerhalb der „Gesellschaft für Anthropologie e.V.“ (Informationen unter www.gfanet.de) wurde daher über ein Curriculum speziell für die Grundausbildung nachgedacht. Diese Besinnung auf unerlässliche fachliche Inhalte und eine Abgrenzung gegenüber Nachbardisziplinen und anderen „Anthropologien“ im Grundstudium war schließlich der Anstoß für die Realisierung des vorliegenden Lehrbuches. 2 Einleitung Eine bundesweite Erhebung bezüglich anthropologischer Forschung und Lehre durch die „Gesellschaft für Anthropologie e.V.“ hatte zum Ergebnis, dass die unterschiedliche Namengebung des Faches an den einzelnen akademischen Standorten (Anthropologie bzw. Humanbiologie) sich in keiner Weise auf die fachlichen Inhalte auswirkt, beide Begriffe werden offenkundig synonym verwendet. Die Bezeichnung als „Humanbiologie“ wird vor allem von den Lehramtsstudiengängen favorisiert, beschränkt sich jedoch auch dort glücklicherweise keinesfalls auf Bau und Funktion des menschlichen Körpers. Wir haben für den Titel dieses Lehrbuches den Begriff der „Anthropologie“ gewählt, in Übereinstimmung mit der großen Mehrheit von Kollegen, welche im Jahre 1992 nach der Zusammenführung der ehemaligen Fachgesellschaften der alten und neuen Bundesländer für den bestehenden gemeinsamen Dachverband die Namengebung „Gesellschaft für Anthropologie e.V.“ favorisiert hatten, und in bewusster Abgrenzung zu zahlreichen „Anthropologien“, welche sich jedoch lediglich auf Teilaspekte des Menschseins beziehen (etwa theologischer, historischer oder philosophischer Natur). Wir haben uns bemüht, ein einführendes Lehrbuch vorzulegen, welches gleichermaßen für die Grundausbildung in der Biologie von Diplom-, Lehramt- und Magisterstudierenden geeignet ist. Das Buch wendet sich ebenso an Magisterstudiengänge, welche die biologische Anthropologie als Nebenfach oder Teilaspekte anderer „Anthropologien“ beinhalten. Gewisse allgemeinbiologische Grundlagen sind jedoch für die Lektüre dieses Lehrbuches unerlässlich, etwa in Bezug auf die Anatomie des menschlichen Körpers oder die formale Genetik. Evolution des Menschen 2.1 Stellung des Menschen in der Natur 2.1.1 Die Ordnung Primates Erstmals seit der Antike stellte der Schwede Carl Linnaeus (1707–1778, seit seiner Erhebung in den Adelsstand im Jahre 1762 Carl von Linné) den Menschen als Angehörigen der Ordnung Primates („Herrentiere“) wieder in das Tierreich und gab ihm den Namen Homo sapiens („der vernunftbegabte Mensch“). Mit dieser Klassifikation wurden die Menschen zwar eines maßgeblichen Teiles ihrer von der Bibel verliehenen, über die Natur hinausragenden Stellung beraubt, die grundsätzliche Akzeptanz der Schöpfungsgeschichte durch Linnaeus (Munk 2000) zeigt sich aber klar in der Namengebung, welche dem Menschen allein Vernunftbegabung zugesteht und die Ordnung der „Herrentiere“ gleichsam als Krone der Schöpfung ausweist. Während die Klassifikation von Carl von Linné noch ausschließlich auf Ähnlichkeiten beruhte, besteht seit Darwins Einbeziehung des Menschen in den Prozess der natürlichen Evolution (Darwin 1871) kein Zweifel mehr an der nahen Verwandtschaft von Menschen und nicht-menschlichen Primaten. Es dürfte allgemein bekannt sein, dass der gemeine Schimpanse (Pan troglodytes) der nächste Verwandte des Menschen im Tierreich ist – dass seinerseits der Mensch, nicht aber der Gorilla auch wiederum der nächste Verwandte des Schimpansen ist (s. unten), stösst noch immer auf gelegentliches Erstaunen. Zur Zeit sind mehrere hundert Primatenarten bekannt (Fleagle 1999, Geissmann 2003). Die Ordnung der Primaten (Ordo: Primates) umfasst eine systematische Kategorie der Klasse der Säugetiere, Unterklasse Plazentatiere (Classis: Mammalia, Subclassis: Eutheria), im Stamm der Chordatiere, Unterstamm Wirbeltiere (Phylum: Chordata, Subphylum: Vertebrata). Andere Ordnungen in dieser Systematik sind z. B. die Insektenfresser (Insectivora), die fleischfressenden Raubtiere (Carnivora) oder die Wale (Cetacea). Eine Übersicht über die weitere systematische Gliederung der Ordnung Primates gibt Tabelle 2.1. Strepsirrhini (Feuchtnasenaffen) Primates (Herrentiere) Haplorrhini (Trockennasenaffen) Unterordnung Ordnung Tabelle 2.1. Die Ordnung Primates Cercopithecoidea (Hundsaffen) Catarrhini (Schmalnasenaffen) Hominoidea (Menschenaffen und Menschen) Tarsioidea (Koboldmakis) Ceboidea (Neuweltaffen) Hominidae (große Menschenaffen und Menschen) Homininae (Gorillas, Schimpansen und Menschen) Ponginae (Orang-Utans) Lorisoidea (Loris) Loriformes (Loriartige) Tarsiiformes (Koboldmakis) Platyrrhini (Breitnasenaffen) Cheirogaleidae (Maus- und Katzenmakis) Daubentoniidae (Fingertiere) Indriidae (Indris) Lemuridae (Lemuren) Lepilemuridae (Wieselmakis) Galagidae (Galagos) Loridae (Loris) Tarsiidae (Koboldmakis) Cebidae Callitrichinae (Kapuzinerartige) (Krallenaffen) Cebinae (Kapuzineraffen) Aotinae (Nachtaffen) Atelidae (Greifschwanzaffen) Callicebinae (Springaffen) Pitheciinae (Sakiaffen) Atelinae (Klammeraffen) Cercopithecidae Cercopithecinae (Hundsaffen) (Backentaschenaffen) Colobinae (Stummelaffen) Hylobatidae (Gibbons) Lemuroidea (Lemuren) Lemuriformes (Lemurenartige) Unterfamilie Familie Überfamilie Zwischenordnung 4 Evolution des Menschen Stellung des Menschen in der Natur 5 Die Ordnung gliedert sich zunächst in die beiden Unterordnungen der Feuchtnasenaffen (Strepsirrhini) und Trockennasenaffen (Haplorrhini), wobei insbesondere die Strepsirrhini eine Reihe von für Primaten ursprüngliche (plesiomorphe) Merkmale aufweisen. Hierzu zählen ein feuchter Nasenspiegel (als Zeichen für die wichtige Rolle des Geruchssinnes bei der Orientierung), ein knöcherner Ring um die Augenhöhle, oder auch die Nachtaktivität. Alle Strepsirrhini tragen am zweiten Strahl des Fußes eine Putzkralle an Stelle eines platten Nagels. In vielen Lehrbüchern findet sich noch immer die Einteilung in Halbaffen (Prosimii) und echte Affen (Simii), wobei die Halbaffen sowohl die Lemuriformes, die Loriformes und die Tarsiiformes umfassen. Aus heutiger Sicht muss diese Unterteilung jedoch zurückgewiesen werden, da es sich bei den „Halbaffen“ um keine monophyletische Gruppe handelt (Tarsier sind mit den echten Affen näher verwandt als mit den Lemuren; s. Box 2.1) (Geissmann 2003). Box 2.1 Phylogenetische Systematik Anders als andere Schulen der biologischen Systematik setzt die phylogenetische Systematik Merkmalsbefunde nicht direkt zur Definition biologischer Einheiten ein. Statt dessen geht sie davon aus, dass sich ein natürliches phylogenetisches System mit allen seinen Einheiten allein aus historischen Beziehungen der Abstammung ergibt (Wiesemüller et al. 2003). Der phylogenetischen Systematik zufolge sind nur abgeleitete (apomorphe) Merkmale für die Rekonstruktion stammesgeschichtlicher Beziehungen signifikant,sofern diese in einer Stammart und den daraus abgeleiteten Tochterarten auftreten. Die Klassifikation der Organismen erfolgt streng nach monophyletischen Gruppen (synonym „clades“ nach dem griech. klados = Zweig, bestehend aus einer Stammart und allen ihren Folgearten). Diese können damit jeweils objektiv durch die Benennung der jeweils zugrunde liegenden Stammart voneinander abgegrenzt werden. Damit ergeben sich z. T. gravierende Unterschiede zur eher traditionellen evolutionären Klassifikation, welche neben der strikt auf Deszendenz beruhenden Aufspaltungsfolge (Kladogenese) auch die Entstehung von evolutiv entstandenen Merkmalsänderungen berücksichtigt, welche ein neues „Evolutionsniveau“ beschreiben sollen. Das angewendete Klassifikationsprinzip hat unter anderem erhebliche Folgen in bezug auf die Stellung von Homo sapiens nerhal der Ordnung der Primaten (s. unten). In diesem Lehrbuch folgen wir den Prinzipien der phylogenetischen Klassifikation. Systematische Einheiten von Organismen (Arten, monophyletische Gruppen) werden als Taxa (Singular Taxon) bezeichnet. 6 Evolution des Menschen Abb. 2.1. Vergleich des Skelettes von einem Standfuß (rechts: Homo) und einem Greiffuß mit abduzierbarer Großzehe (links: Gorilla). Zeichnung: M. Schulz Die Ordnung der Primaten ist sehr heterogen und lässt sich besser durch ein Merkmalsmuster als durch einzelne, definierte Merkmale beschreiben. Einige Primatenmerkmale sind durchaus plesiomorphe Säugetiermerkmale, wie z. B. das Vorhandensein von Schlüsselbeinen, oder das Bewahren einer fünfstrahligen Extremität (fünf Finger bzw. Zehen, Reduktion kommt vor). Primatentypische Merkmale (Ausnahmen kommen jeweils bei der einen oder anderen Art vor!) sind u. a. • • • • • • • • • Greifhand und Greiffuß mit opponierbarer Großzehe und Daumen (Ausnahme z. B. Standfuß bei Homo sapiens) (Abb. 2.1), Plattnägel auf Fingern und Zehen (Ausnahme z. B. Krallenäffchen), Hautleistensysteme auf Hand- und Fußflächen, Zehen und Fingern, Betonung des Gesichtssinnes zu Ungunsten des Geruchssinnes (bei tagaktiven Formen), knöcherner Ring um die Augenhöhlen (Strepsirrhini) bzw. trichterförmig geschlossene knöcherne Augenhöhle (Haplorrhini), im Verhältnis zum Körpergewicht vergrößertes Gehirn mit Sulcus calcarinus1 und Sylvischer Furche2, Blinddarm vorhanden, primär arboricole Lebensweise (in den Bäumen lebend), bei Männchen freihängender Penis und Hoden in einem Hodensack, Sulcus calcarinus = Hirnareal aus drei (Ausnahme: Krallenäffchen) Furchen auf der Innenseite des Großhirn-Hinterlappens 2 Sylvische Furche, syn. Sulcus lateralis = Furche auf der Außenseite des Großhirnes, welche den Vorderlappen vom Seitenlappen trennt 1 Stellung des Menschen in der Natur • • • 7 bei Weibchen epitheliochoriale3 (Strepsirrhini) bzw. hämochoriale4 (Haplorrhini) Plazenta, verlängerte Tragzeit und kleine Wurfgrößen mit relativ unentwickelten Jungen, verlängerte Wachstumsphase und relativ späte Geschlechtsreife. (Geissmann 2003, zusammenfassende Darstellung bei Henke u. Rothe 1994, 1998 sowie Martin 1990). Die Primaten bilden eine außerordentlich faszinierende Organismengruppe im Tierreich, über die eine Fülle von Spezialliteratur vorliegt (z. B. Martin 1990, Rowe 1996, Byrne 1997, Fleagle 1999, Ankel-Simons 2000, Geissmann 2003). An dieser Stelle seien daher die wichtigsten Gruppen kurz charakterisiert und besondere Aufmerksamkeit den Hominoidea gewidmet, zu denen die Menschen zählen. Die Lemuriformes sind in ihrer Verbreitung auf Madagaskar beschränkt, wo sie sich aufgrund weitgehend fehlender Beutegreifer und fehlender Konkurrenz mit anderen Primaten zu einer beachtlichen Vielfalt entwickeln konnten. Zu den Lemuren zählen z. B. die kleinsten heute lebenden Primaten überhaupt, die Mausmakis (Gattung Microcebus, Familie Cheirogaleidae), welche lediglich 30–60 g wiegen. Eine Reihe besonderer Merkmale weist das Fingertier Daubentonia madagascariensis (einzige Art der Familie Daubentoniidae) auf, wie z. B. eine dem Nagergebiss konvergente Bezahnung, und den besonders verlängerten und dünnen mittleren Strahl der Hand, den Daubentonia als Sonde zur Erbeutung im Holz lebender Insekten und deren Larven benutzt. Bei den Lemuriformes bilden die Frontzähne des Unterkiefers einen Zahnkamm, der zur Fellpflege eingesetzt wird. Die beiden Unterkieferhälften sind nicht miteinander verwachsen wie bei den echten Affen. Die Lorisiformes bilden die Schwestergruppe (= Angehörige eines Taxons, die unmittelbare Nachkommen derselben Stammart sind, Wiesemüller et al. 2003) zu den Lemuriformes. Nachtaktivität und Insektivorie zählen zu den ursprünglichen Merkmalen der Strepsirrhini. Auch Loris besitzen den charakteristischen Zahnkamm und den noch paarigen Unterkiefer. Sie unterscheiden sich von den Lemuriformes u. a. durch die Blutversorgung des Gehirnes. Einzigartig unter den rezenten Primaten ist die langsame arborikole Fortbewegungsweise der Loridae, bei denen der erste Strahl von Hand und Fuß verstärkt ist, der zweite jedoch reduziert. Hände und Füße können somit einen „greifzangenartigen“ festen Griff ausüben, weshalb die Loridae auch als „Greifzangenkletterer“ bezeichnet werden (Geissmann 2003). Die Tarsiiformes zählen zu den Haplorrhini, d. h. der Geruchssinn spielt im Vergleich zum Gesichtssinn bereits eine untergeordnetere Rolle. Sie teilen mit den Strepsirrhini einige ursprüngliche Merkmale wie z. B. den paarigen Unterkiefer. Gemeinsame abgeleitete Merkmale wie die fast vollständig geschlossene knöcherne Augenhöhle, eine Stelle schärfsten Sehens im Auge (Fovea cenepitheliochoriale Plazenta = kaum in das mütterliche Uterusgewebe eingenistete Plazenta, fetaler und mütterlicher Kreislauf bleiben getrennt 4 hämochoriale Plazenta = tief in das mütterliche Uterusgewebe eingenistete Plazenta, die äußere Membran des Embryos wird direkt von mütterlichem Blut umspült 3 8 Evolution des Menschen tralis) und das Fehlen einer lichtreflektierenden Schicht hinter der Netzhaut (Tapetum lucidum) teilen die Tarsier jedoch mit den anderen Haplorrhini. Aufgrund des Fehlens eines Tapetum lucidum wird angenommen, dass die Nachtaktivität der Tarsiiformes eine sekundäre Adaptation ist. Ein einzigartiges Merkmal der Tarsiiformes unter den Primaten ist ihre Fähigkeit, ihren Kopf – ähnlich wie es Eulen tun – um fast 180° in beide Richtungen drehen zu können. Die Haplorrhini (mit Ausnahme der Tarsiiformes) oder echten Affen besitzen abgeleitete Merkmale: • • • • • die bereits genannte Verknöcherung der beiden Unterkieferhälften, nach vorn gerichtete Augen in einer geschlossenen knöchernen Höhle und die Fähigkeit zum Farbensehen (selbst bei nachtaktiven Tieren wie den Aotinae), das Fehlen einer Putzkralle, den Besitz eines einfachen Uterus bei den Weibchen, Reduktion der Zitzen auf jeweils ein Paar. Die beiden letztgenannten Merkmale stehen im funktionellen Zusammenhang mit der geringen Wurfgröße, d. h. die Geburt jeweils nur eines Jungen ist die Regel. Die Platyrrhini (Breitnasenaffen) sind regional auf Zentral- und Südamerika beschränkt (Neuweltaffen) und unterscheiden sich von den Catarrhini (Schmalnasenaffen, Altweltaffen) der alten Welt in einigen wesentlichen Merkmalen. Namengebend ist die breite Nase mit seitwärts divergierenden Nasenöffnungen bei den Platyrrhini im Gegensatz zur schmalen, mit nach vorn gerichteten Öffnungen versehenen Nase der Catarrhini. Platyrrhini besitzen z. B. noch drei Prämolaren gegenüber zwei bei den Catarrhini.Eine heute nur bei den Platyrrhini vorkommende Spezialisierung ist die Ausbildung des Schwanzes als „fünfte Extremität“ (Greifschwanz der Atelidae, „Greifschwanzaffen“), welcher auf seiner Innenseite statt der normalen Behaarung Hautleistensysteme analog jener auf den Hand- und Fußflächen aufweist und somit zu einem sensiblen Tast- und Greiforgan geworden ist. Die Catarrhini werden in die Hundsaffen (Cercopithecoidea) und die Menschenaffen (Hominoidea) eingeteilt, wobei die Cercopithecoidea ökologische Nischen für tagaktive Organismen in der Alten Welt besetzen konnten (vgl. Nachtaktivität der Strepsirrhini). Die Cercopithecoidea werden weiterhin in die zwei Unterfamilien der Cercopithecinae (Backentaschenaffen) und Colobinae (Stummelaffen) unterteilt; beide sind durch ein hoch diverses Gattungs- und Artenspektrum gekennzeichnet. Die Colobinae ernähren sich überwiegend von Blättern und Samen und unterscheiden sich von den überwiegend früchtefressenden Cercopithecinae durch die Morphologie ihrer Schneide- und Backenzähne und den Besitz eines mehrkammerigen Magens. Neben anderen Schädelmerkmalen sind die Colobinae durch einen kurzen bis sogar fehlenden Daumen und einen langen bis sehr langen Schwanz gekennzeichnet. Cercopithecinae besitzen die namengebenden Backentaschen, einen gut ausgebildeten Daumen (Ausnahme: Husarenaffe Erythrocebus patas) und z.T. recht kurze Schwänze (z. B. bei der Gattung Mandrillus). Stellung des Menschen in der Natur 9 Bezüglich der Überfamilie der Hominoidea (Menschenaffen und Menschen) findet sich noch immer in den einschlägigen Lehrbüchern eine unterschiedliche weitere Einteilung in Familien und Unterfamilien, was auf den jeweils zugrunde gelegten Klassifizierungskonzepten beruht (vgl. Box 2.1). Folgt man den Prinzipien der evolutionären Klassifikation, umfasst die Überfamilie der Hominoidea die drei Familien der Hylobatidae (Gibbons), Pongidae (große Menschenaffen: Orang-Utan, Gorilla, Schimpansen) und Hominidae (einzige Gattung: Homo, einzige Art: Homo sapiens) (vgl. Fleagle 1999). In dieser Systematik wird den Menschen ein evolutives Niveau zugestanden, welches ihnen eine separate Familie zuweist (vgl. Kap. 2.1.2). Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass eine Familie der Pongidae, welche alle großen Menschenaffen umfasst, aufgrund der Verwandtschaftsverhältnisse und Abspaltungsdaten der jeweiligen Linien keinesfalls eine monophyletische Gruppe darstellt. Nach den Prinzipien der phylogenetischen Systematik bleibt die Familie der Hylobatidae unangetastet (die heute lebenden Gibbons sind in der Tat die Vertreter der ältesten Menschenaffen überhaupt), während die Familie der Hominidae alle großen Menschenaffen einschließlich des Menschen umfasst. Die frühe Abspaltung der zum heutigen Orang-Utan führenden Linie von den afrikanischen Menschenaffen gibt vielmehr berechtigten Anlass, die Hominidae in zwei Unterfamilien zu unterteilen, jene der Ponginae (Gattung Pongo) und der Homininae (Gattungen Gorilla, Pan, sowie Homo) (Tabelle 2.2). Aufgrund molekularbiologischer Daten dürfte sich die zur Gattung Pongo führende Linie vor etwa 16 Mio. Jahren von jener der afrikanischen Menschenaffen abgespalten haben, die Linien von Gorillas und Schimpansen vor 7–9 Mio. Jahren und die Linien von Menschen und Schimpansen vor etwa 6 Mio. Jahren. Die Aufspaltung der Gattung Pan in Pan troglodytes und Pan paniscus dürfte sich kaum früher als vor etwa 2,5 Mio. Jahren ereignet haben (Henke u. Rothe 1998). In Abhängigkeit von der Kalibrierung der jeweils zugrunde gelegten „molekularen Uhr“ und dem Auffinden neuer Fossilien, welche geeignet sein können, die zahlreichen Lücken in der Fossildokumentation der Primaten- und Hominidenevolution zu schließen, werden gegebenenfalls andere Aufspaltungszeiten angegeben (z. B. Janke u. Arnason 2001). Diese ändern jedoch nichts an der verwandtschaftlichen Nähe der einzelnen Taxa und deren Zusammenfassung in monophyletische Gruppen (Abb. 2.2–2.5). Die große genetische Nähe des Menschen insbesondere zu den afrikanischen Menschenaffen ist unstreitig – dennoch zeichnen sich Menschen durch Merkmale und Lebensäußerungen aus, die in dieser Form nirgendwo sonst im Tierreich angetroffen werden und suggerieren, dass Menschen sich sehr stark von ihren biologischen Wurzeln emanzipiert haben. An dieser Stelle soll nochmals an die Namengebung durch Linné erinnert werden („der vernunftbegabte Mensch“ innerhalb der Ordnung der „Herrentiere“). Und hat nicht schon Johann Gottfried Herder den Menschen als „ersten Freigelassenen der Schöpfung“ bezeichnet? So verwundert es nicht, dass viele Lehrbücher noch heute die evolutionäre Klassifikation bevorzugen und dass vor allem in manchen Schulbüchern noch immer ganze Kapitel der „Sonderstellung des Menschen in der Natur“ gewidmet sind (z. B. Bayrhuber u. Kull 1998). Zweifellos gehören zum „Humanen“ mehr als Biologie und genetische Abstände, und die 10 Evolution des Menschen Tabelle 2.2. Phylogenetische Systematik der Hominoidea (Fleagle 1999, Geissmann 2003) Überfamilie Familie Unterfamilie Gattung Hominoidea Hylobatidae Hominidae Spezies Hylobates Ponginae Homininae H. agilis (Schwarzhandgibbon) H. lar (Weißhandgibbon) H. muelleri (Grauer Gibbon) H. klossii (Kloss-Gibbon) H. moloch (Silbergibbon) H. pileatus (Kappengibbon) Symphalangus S. syndactylus (Siamang) Bunopithecus B. hoolock (Hulock) Nomascus N. gabriellae (Gelbwangen-Schopfgibbon) N. leucogenys (Weißwangen-Schopfgibbon) N. concolor (Westlicher Schwarzer Schopfgibbon N. nasutus (Östlicher Schwarzer Schopfgibbon) Pongo P. pygmaeus pygmaeus (Borneo-Orang-Utan) P. p. abelii (Sumatra-Orang-Utan) Gorilla G. gorilla gorilla (Westlicher Flachlandgorilla) G. g. graueri (Östlicher Flachlandgorilla) G. g. beringei (Berggorilla) Pan P. troglodytes (gemeiner Schimpanse): P. t. schweinfurthii (östlicher), P. t. troglodytes (zentraler), P.t. verus (westlicher) P. paniscus (Bonobo, „Zwergschimpanse“) Homo H. sapiens (anatomisch moderner Mensch) Eigenständigkeit der biologischen Anthropologie als akademisches Fach ist ebenfalls eindeutiges Zeichen dafür, dass Menschen in vielen Aspekten nicht allein vom biologischen Standpunkt aus im Sinne einer „Humanzoologie“ definierbar und erklärbar sind. Im Folgenden sollen diejenigen Aspekte, welche zur Postulierung der „Sonderstellung“ des Menschen Anlass geben, näher betrachtet werden. Es kann gezeigt werden, dass alle unsere „Besonderheiten“ tief im Tierreich verwurzelt und in hohem Maße bei unseren nächsten Verwandten bereits angelegt, wenn nicht sogar ausgeprägt sind. Stellung des Menschen in der Natur 11 Abb. 2.2. Junger Weißhandgibbon, hangelnd. Foto: Tierbildarchiv Angermeyer Abb. 2.3. Portrait eines alten Orang-UtanMännchens. Foto: Tierbildarchiv Angermeyer 12 Evolution des Menschen Abb. 2.4. Weiblicher Flachlandgorilla mit Jungtier. Foto: Tierbildarchiv Angermeyer Abb. 2.5. Schimpanse beim Sondieren nach Insekten. Foto: Tierbildarchiv Angermeyer Stellung des Menschen in der Natur 13 2.1.2 Sonderstellung des Menschen in der Natur? Der aufrechte Gang, die Bipedie, gehört zu den Spezifika des Menschen unter allen Primaten. Bei den Hominoidea finden sich mehrere Spezialisierungen in Bezug auf die Lokomotion, wie das Schwinghangeln der Gibbons oder der Knöchelgang bei Gorilla und Schimpanse. Menschen sind die einzigen rezenten Primaten, welche obligatorisch biped sind und damit die vordere Extremität vollständig von der Aufgabe der Fortbewegung befreit haben. Viele Primaten sind jedoch fakultativ biped, d. h. sie können sich kurze Strecken auf den Hinterextremitäten allein fortbewegen. Da neben den Menschen auch andere Primaten sekundär zu einer zumindest vorwiegend terrestrischen Lebensweise übergegangen sind, ohne biped zu werden (Mandrills, Dscheladas), ist der aufrechte Gang nicht zwangsläufig durch die Aufgabe der arborikolen Lebensweise impliziert. Zweifellos ist die Bipedie eine energetisch aufwendige Fortbewegungsweise, da der Körper entgegen der Schwerkraft aufgerichtet werden muss und während des Gehens und Laufens jeweils nur eine Extremität das gesamte Körpergewicht zu tragen hat (Standbein). Zahlreiche mehr oder weniger überzeugende Gründe sind für die Selektionsvorteile, welche diese spezialisierte Fortbewegungsweise mit sich gebracht haben könnte, vorgeschlagen worden (Zusammenfassung bei Niemitz 2002). Tatsache ist, dass Menschen sehr ausdauernd gehen können und dabei leicht Strecken von mehr als 30 km am Tag bewältigen. In Bezug auf die zurückgelegten Wegstrecken sollen Menschen alle anderen Primaten übertreffen können (Preuschoft u. Witte 1993). Vergleicht man das Skelett, also den passiven Bewegungsapparat, von Menschen mit jenem der nächsten Verwandten (Schimpansen), fallen folgende anatomische Merkmale auf, welche für die obligatorische Bipedie erforderlich sind (Abb. 2.6): Entwicklung eines Standfußes mit Fußgewölbe und Verlust der Opponierbarkeit der Großzehe; verlängerte Hinterextremität; doppelt S-förmig gebogene Wirbelsäule; verkürztes und verbreitertes, nach dorsal5 gebogenes und schüsselförmiges Becken; physiologische X-Beinstellung der Oberschenkel; zentrale Lage des Hinterhauptloches6 des Schädels, so dass dieser vertikal auf der Wirbelsäule getragen wird. Die Umstrukturierung der Hüftregion und die einseitige Verlagerung des Körpergewichtes auf das jeweilige Standbein beim Gehen und Laufen bedurfte wiederum der Umfunktionierung der Hüftmuskulatur, um ein Aufrichten des Rumpfes durch dauerhafte Streckung der Hüfte und die Balance zu gewährleisten. Besonders betroffen ist die Glutealmuskulatur, das Ensemble der drei Muskeln Musculus gluteus maximus, M. g. medius und M. g. minimus, welche beim Schimpansen auf der Dorsalseite der Hüfte verlaufen und sämtlich die Funktion der Hüftstreckung haben (Abb. 2.7). Bei Menschen übt nur noch einer dieser drei Muskeln, der M. g. maximus, die Funktion des Hüftstreckers aus 5 6 dorsal = zum Rücken weisend Hinterhauptloch (Foramen magnum) = Durchtrittsstelle des verlängerten Markes in die Schädelkapsel 14 Evolution des Menschen Abb. 2.6. Montiertes Skelett eines Knöchelgängers (a: Schimpanse) im Vergleich zu dem des bipeden Menschen (b). Bezüglich der anatomischen Merkmale vgl. Text a b und entwickelte zur Effizienzsteigerung einen mächtigen Muskelbauch bei gleichzeitig relativ kurzen Muskelfasern. Das prominente und muskulöse Gesäß des Menschen, einzigartig unter den Primaten, beruht auf dieser Muskelverstärkung. Der mittlere und der kleine Glutealmuskel haben beim Menschen einen Funktionswandel dahingehend erfahren, dass sie durch ihre seitliche Lage an der Hüfte in der Standbeinphase die Hüfte gegen ein seitliches Stellung des Menschen in der Natur 15 Abb. 2.7. Vergleich der Glutealmuskulatur von Schimpanse (links) und Mensch (rechts). Durch die veränderte Beckenkonfiguration beim Menschen (vgl. Abb. 2.6) sind der mittlere und kleine Gluteusmuskel nunmehr seitlich an der menschlichen Hüfte positioniert und erfüllen nicht mehr die Funktion eines Hüftstreckers (vgl. Text). Zeichnung: M. Schulz Einknicken stabilisieren, und in der Spielbeinphase das jeweilige Bein abspreizen können (Benninghoff/Goerttler 1978). Der Balance förderlich ist ferner die generelle Proportionierung des menschlichen Körpers, mit einem hohen und schlanken Rumpf von geringer Tiefe (Preuschoft u. Witte 1993). Die Umgestaltung des knöchernen Beckens bedingt u. a. den komplizierten Geburtsvorgang beim Menschen, welcher eine zweifache Rotation des Kindes bei der Passage der Geburtswege erfordert (Trevathan 1987, Walrath 2003). Das hochentwickelte Gehirn, die enormen assoziativen Leistungen des Menschen und seine dadurch bedingte Fähigkeit zur Zukunftsplanung wird speziell als dasjenige Merkmal herangezogen, welches dem Menschen seine von der Tierwelt emanzipierte Stellung in der Natur verleiht. Mit der Hirnentwicklung unmittelbar verknüpft sind ebenfalls scheinbar spezifisch menschliche Leistungen wie Sprache und Schrift, die Genese von Kulturen und Industrien, sowie auch Lebenslaufparameter wie eine verlängerte Kindheit und Jugend (s. unten). Es ist zu unterscheiden zwischen der Cerebralisation, der generellen Zunahme des Hirnvolumens und zunehmender Intensivierung der Verschaltung der Hirnzentren, und der Encephalisation, der progressiven Entwicklung der Großhirnrinde (Henke u. Rothe 1998, Storch et al. 2001). Das Hirngewicht des rezenten Menschen liegt im Durchschnitt zwischen 1250 und 1350 g und macht etwa 2% des Körpergewichtes aus, das Gehirn ist aber ein energetisch sehr aufwendiges Organ, welches allein rund ein Fünftel des 16 Evolution des Menschen Grundumsatzes beansprucht. Die Oberflächenvergrößerung wurde insbesondere durch die Ausbildung von gewundenen, rundlichen, durch Furchen (Sulci) voneinander getrennten Wülsten (Gyri) erreicht und resultiert in einer Oberfläche von 2200 bis 2500 cm2. Bemerkenswert ist vor allem das Produkt der Encephalisation: Die Großhirnrinde des Menschen ist um 30% größer als bei allen anderen Primaten und übertrifft mit einem Volumen von 550– 660 cm3 das Gesamtgehirnvolumen eines Schimpansen (Martin 1990), welches knapp 1% von dessen Körpergewicht ausmacht. Im generellen Aufbau unterscheidet sich das menschliche Gehirn nicht von denen anderer Säugetiere, wohl aber in Bezug auf seine funktionelle Organisation. In der Großhirnrinde existieren primäre, sekundäre und assoziative Felder, wobei letztgenannte die Informationen der primären und sekundären Felder (Registrierung und Bündelung sensorischer und motorischer Eingänge) verarbeiten und verknüpfen. Die assoziativen Felder (assoziativer Cortex) sind daher am ehesten mit intellektuellen Leistungen verknüpft. Nach Storch et al. (2001) hat die menschliche Großhirnrinde bis zu 90% assoziative Funktion. Die Hirnentwicklung des Menschen ist jedoch keine evolutive Neuheit per se, sondern entspricht allgemeinen Trends bei den Primaten, welche ihrerseits allgemeine Trends in der Entwicklung der Säugetiere fortführen. Generell gilt, dass große Tiere schwerere Gehirne haben als kleine. Für die Beurteilung einer progressiven Gehirnentwicklung kommt es also darauf an, ob das Gehirn einer Spezies relativ zum Körpergewicht größer ist als erwartet. Bei Wirbeltieren besteht eine Relation zwischen Hirngewicht und Körpergewicht in der Weise, dass das Gehirngewicht im Verhältnis von durchschnittlich 0,7:1 zum Körpergewicht zunimmt, was zunächst impliziert, dass kleinere Tiere generell relativ schwere Gehirne haben. Auch variiert dieses Durchschnittsverhältnis bei den verschiedenen Wirbeltierklassen: während es bei Reptilien bei 0,54:1 liegt, steigt es bei den Säugetieren auf 0,76:1, d. h. die Hirnvergrößerung ist bereits ein Säugetiermerkmal innerhalb der Wirbeltiere. Innerhalb der Säugetiere wiederum haben Primaten größere Gehirne als andere Säuger gleichen Körpergewichtes. Der oben angeführte Gewichtsvergleich zwischen der menschlichen Großhirnrinde und dem Gesamtgehirngewicht eines Schimpansen zeigt, dass Menschen in diesem Aspekt einem allgemeinen Entwicklungstrend folgen. Dies gilt auch für die Encephalisation: Primaten haben gegenüber anderen Säugetieren einen vergrößerten assoziativen Cortex, und bei allen Primaten einschließlich des Menschen betrifft diese Vergrößerung insbesondere den Stirnlappen (Roth 1998). Bestimmte Lebenslaufparameter wie der geringe Entwicklungsgrad der Neugeborenen und insbesondere die lange Kindheits- und Jugendphase werden als spezifisch menschlich angesprochen. Nach herrschender Vorstellung ermöglicht die lange Wachstums- und Reifezeit es den menschlichen Nachkommen, kulturelles Verhalten zu erlernen und die erforderliche soziale Kompetenz für eine Lebensgemeinschaft zu erwerben, welche durch orale Tradition und kulturelle Werte und Normen gesteuert ist (Leigh 1996, Schröder 2000, Bogin u. Smith 2000, s. auch Kapitel 4.1). Es kann jedoch gezeigt werden, dass auch diese menschlichen Lebenslaufparameter wiederum die konsequente Fortführung von Trends darstellen, welche in der Evolution der Primaten wirksam waren. Stellung des Menschen in der Natur 17 Box 2.2 Das Life-History-Konzept Life-History-Analysen n identifizieren zunächst die bedeutsamen ontogenetischen Variablen, die life-history-Merkmale wie Größe bei der Geburt, Wachstumsverlauf und -geschwindigkeit, Alter und Größe bei Fortpflanzungsfähigkeit, Anzahl, Größe und Geschlechterverhältnis der Nachkommen, alters- und größenspezifisches reproduktives Investment, alters- und größenspezifische Mortalität, Lebensdauer und n konzentrieren sich anschließend auf deren Konsequenzen für Population, Art oder Stammlinie. Life-History-Konzepte haben nicht zum Ziel, die Ontogenese einer Organismengruppe zu untersuchen, sondern den Untersuchungsgegenstand im ontogenetischen Kontext zu prüfen. (Henke u. Rothe 1998). Jede Spezies muss für die ihr gegebene Lebensspanne bestmöglich geeignete Zeiträume für Wachstum, Reifung, Reproduktion und Elterninvestment in die Jungen festlegen, ferner die verfügbaren Ressourcen in Reproduktion, Jungenaufzucht und Erhalt des eigenen Lebens in einer Weise aufteilen, mit der ein optimaler Reproduktionserfolg gewährleistet ist (Fleagle 1999). Die speziesspezifischen Parameter der Ontogenese werden im Rahmen des „Life-HistoryKonzeptes“ (Stearns 1992) untersucht, mit einem Schwerpunkt auf der Aufwendung von Zeit und Energie für die Reproduktion (Box 2.2). Im Vergleich zu anderen gleichgroßen Säugetieren zeichnen sich Primaten durch eine höhere Lebenserwartung, einen späteren Eintritt in das Reifealter und geringere Wurfgröße aus (Charnov u. Berrigan 1993). Innerhalb der rezenten Primaten ist wiederum ein Trend zu immer höherer Lebenserwartung zu erkennen, bei gleichzeitig höher werdendem Elterninvestment in die Jungen. Letztes wird erreicht durch eine Verlängerung der Schwangerschaft, eine Reduktion der Wurfgröße, höhere Intergeburtenabstände und eine verlängerte Abhängigkeit der Jungen. Die Eltern können sich somit um jedes einzelne Junge länger und intensiver kümmern. Folge der verlängerten Abhängigkeit ist wiederum ein späteres Eintreten in die Geschlechtsreife und damit ein später Zeitpunkt für die erste eigene Reproduktion (Voland u. Winkler 1990). Bei allen Hominoidea ist die Geburt von jeweils nur einem Jungen die Regel. Während bei Gibbons die Schwangerschaft 210 Tage dauert, währt sie beim Schimpansen 238, beim Menschen 266 Tage. Die kindliche Abhängigkeit beträgt beim Gibbon 2 Jahre, bei Schimpansen 3 und bei Menschen 6 Jahre, gefolgt von einer Jugendzeit, welche beim Gibbon etwa 6, bei Schimpansen 7 und bei Menschen bis zu 14 Jahre dauern kann (Jolly 1985, Fleagle 1999, Geissmann 2003). 18 Evolution des Menschen Der geringe Reifegrad menschlicher Neugeborener im Vergleich zu anderen Primaten erklärt sich zwanglos aus dem großen Gehirn und der speziellen Form des an die Bipedie angepassten menschlichen Beckens, da ein höherer Entwicklungsgrad des Neugeborenen zu einem unmittelbaren Geburtshindernis führen würde. Kurz vor der Geburt verlangsamen die Feten ihr Wachstum in Anpassung an die mütterliche Beckenkonfiguration. Die Geburt von kleinen und wenig entwickelten (= altrizialen) Jungen ist charakteristisch für andere Säugetierordnungen, etwa die Carnivora, nicht aber für Primates, so dass beim Menschen sekundäre Altrizialität vorliegt (Schröder 2000). Für Menschen charakteristisch ist ferner ein langer postreproduktiver Lebensabschnitt, messbar an der weiblichen Menopause (vgl. Kap. 4.1; 4.2). Primaten sind primär soziale Lebewesen; ein Zusammenhang zwischen komplexem Sozial- und Kommunikationsverhalten und der progressiven Hirnentwicklung wird postuliert. Während die meisten Altweltaffen um eine Gruppe miteinander verwandter Weibchen organisiert sind (Fleagle 1999), haben sich bei den Hominoidea stark voneinander verschiedene Sozialsysteme herausgebildet. Gibbons galten lange Zeit als streng monogame Spezies, bei denen die Kleinfamilie aus dem Elternpaar und den noch nicht erwachsenen Nachkommen besteht. Dies ist zwar die Regel, jedoch konnte durch Sommer u. Reichard (2000) nachgewiesen werden, dass Partnerwechsel häufig vorkommen und Gruppenbildung aus einem erwachsenen Weibchen und zwei erwachsenen, nichtverwandten Männchen nicht selten ist. Orang-Utans leben zumeist solitär, mit Ausnahme von Mutter/Kind-Dyaden, der temporären Bindung an den Sozialpartner zur Paarung oder dem Aufsuchen von Fruchtbäumen zur Fruchtreife. Die Streifgebiete eines erwachsenen Männchens sind erheblich größer als jene der Weibchen, und das Männchen paart sich mit allen Weibchen im Überlappungsgebiet. Orang-Utans haben somit ein polygynes Sozialsystem, welches aufgrund seiner spezifischen Ausprägung auch als „exploded harem“ bezeichnet wird. Eine haremsartige Struktur findet sich bei Gorillas, bei denen die Gruppen in der Regel aus einem adulten Männchen („Silberrücken-Mann“), mehreren nicht miteinander verwandten Weibchen und deren Nachkommen sowie einem oder mehreren jungen Männchen bestehen. Die starke Konkurrenz der Männchen um die jeweilige Führungsposition und die Monopolisierung der Weibchen durch ein Männchen dürfte ursächlich für den extremen Sexualdimorphismus dieser Spezies sein, bei welcher die Männchen mehr als doppelt so schwer wie die Weibchen werden können. Schimpansen wiederum leben in Sozietäten, welche alle Alters- und Geschlechtsgruppen umfassen und durch ein promiskes Paarungssystem gekennzeichnet sind. Die Gruppengröße ist flexibel, größere Gemeinschaften können gebildet werden und wieder in Untergruppen zerfallen („fission-fusion society“, Fleagle 1999). Echte Promiskuität als dauerhaftes Sozial- und Paarungssystem kommt in menschlichen Gesellschaften dagegen nicht vor (Schröder 1992), obgleich aufgrund der kulturellen Vielfalt diverse Systeme in menschlichen Gesellschaften existieren, sei es die Monogamie, die Polygynie oder sogar die Polyandrie. Weltweit dürfte Polygynie am häufigsten sein, wobei ein Individuum entweder zur selben Zeit oder nacheinander mehrere Sexualpartner hat (Betzig 1986). Strikte Stellung des Menschen in der Natur 19 Monogamie ist häufig gesetzlich vorgeschrieben, wird aber nicht notwendigerweise auch praktiziert. Charakteristisch für menschliche Sozietäten sind die dauerhaften, engen persönlichen Beziehungen sowohl zu Verwandten als auch zu Nichtverwandten und die Einordnung der jeweiligen Kernfamilie in eine übergeordnete Gemeinschaft (Schröder 2000). Der Gebrauch von Werkzeugen (= körperfremden Gegenständen) zur Verbesserung des Erreichens eines Zieles ist bei Wirbeltieren gut bekannt, etwa der Gebrauch von Steinen als Amboss (Seeotter, Europäische Singdrossel) oder als Hammer (Schmutzgeier) oder von Kaktusstacheln als Sonde und Spieß (Galapagosfink). Die Herstellung von Werkzeugen (= Bearbeitung körperfremder Gegenstände) galt lange als exklusive kognitive Fähigkeit von Hominiden und war namengebend für „Homo habilis“ („der geschickte Mensch“, vgl. Kap. 2.2). Werkzeugherstellung und -gebrauch, zusammengefasst als Werkzeugverhalten, bedarf einer bewussten Planung und Zielvorstellung. Studien von großen Menschenaffen in Freiheit und in Gefangenschaft haben bewiesen, dass es sich auch hier um keine exklusiv menschliche Fähigkeit handelt, wenngleich Menschen zweifellos die elaboriertesten Werkzeuge und sogar Maschinen herzustellen vermögen. Orang-Utans, Gorillas und Schimpansen lösen im Experiment Aufgaben, bei denen sie sich eines Hilfsmittels bedienen müssen, etwa eines Stockes zum Heranholen anderweitig nicht erreichbaren Futters. Das regelmäßig beobachtbare Zusammenfügen mehrerer kurzer Stöcke zu einer längeren „Angel“ erfüllt bereits das Kriterium der Werkzeugherstellung. Schimpansen zertrümmern Steine und benutzen die Splitter als Messer oder Stichel (Lethmate 1990). Auch in freier Wildbahn zeigen insbesondere Schimpansen vielfaches Werkzeugverhalten, so dass man ihnen den Besitz einer materiellen Kultur (Fleagle 1999), zumindest aber eine Kulturfähigkeit (Vogel 1983) nicht absprechen kann. Blätter werden als Schwamm benutzt, Zweige als Sonden oder Grabstöcke, Äste und Steine als Hammer zum Öffnen hartschaliger Nüsse oder als Wurfgeschoss zur Verteidigung. Schimpansen reparieren ihre Werkzeuge auch, indem sie z. B. Zweige, welche dem Angeln von Termiten dienen, mit den Zähnen richten und verbogene Enden abbeißen, bis die Angel wieder funktionsfähig ist. Boesch und Boesch (1990) haben als erste die Nussschmieden der westafrikanischen Schimpansenpopulationen beschrieben: Baumwurzeln oder Steine dienen als Amboss, Steine als Hammer zum Öffnen der Nüsse. Der Hammerstein wird entsprechend der Härte der Nussschalen ausgewählt und gezielt an den Ort des Nussvorkommens transportiert. Besonders geeignete Exemplare werden über längere Zeit herumgetragen oder an einem gesonderten Platz bis zur weiteren Verwendung niedergelegt. Dass Schimpansen planvolles und einsichtiges Werkzeugverhalten in freier Wildbahn zeigen, steht somit außer Frage, wodurch die Kluft zwischen Menschen und Menschenaffen wiederum erheblich geringer wird (Boesch u. Tomasello 1998). Zwei Aspekte sind besonders zu betonen, um die Kulturfähigkeit von Schimpansen zu untermauern: Die Weitergabe der Fähigkeiten durch soziales Lernen und die erheblichen Unterschiede in der Häufigkeit und Art des Werkzeugverhaltens zwischen verschiedenen Schimpansenpopulationen. Da Werkzeugverhalten und dessen Erwerb durch Lernprozesse auch bei anderen Primaten 20 Evolution des Menschen außerhalb der Hominoidea vorkommt (z. B. manche Makaken, Kapuzineraffen), ist auch die menschliche materielle Kultur als echtes Primatenerbe anzusprechen. Es bleibt die Vokalsprache, zugleich eine Symbolsprache, welche die menschliche Kommunikation allen bekannten Formen tierischer Kommunikation überlegen erscheinen lässt. Entscheidend ist dabei zum einen die Symbolhaftigkeit, d. h. das gesprochene Wort als Symbol für einen Gegenstand oder eine Handlung, welches verstanden wird, ohne dass der benannte Gegenstand präsent ist oder die benannte Handlung gerade ausgeführt wird. Zum anderen bedarf es einer Grammatik, welche erst die Möglichkeiten eröffnet, nahezu beliebige Kombinationen von Wörtern und Silben zu bilden, welche bei Einhaltung bestimmter Regeln (Syntax) der Sprache ihren Bedeutungsinhalt verleihen. Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass eine Symbolsprache in diesem Sinne nicht notwendigerweise auch eine Vokalsprache sein muss – Gebärdensprachen erfüllen ebenfalls die genannten Kriterien. Zahlreiche Hirnareale sind für die Entwicklung einer Symbolsprache miteinander verknüpft. Die wesentlichen Areale befinden sich beim Menschen in unmittelbarer Nähe der Sylvischen Furche, und zwar in der linken Hirnhemisphäre: das Brocasche Zentrum, verantwortlich für die motorische Sprachfähigkeit, und das Wernickesche Zentrum, welches für das Sprachverständnis, d. h. die Umsetzung des Gehörten in dessen Bedeutung, zuständig ist. Die ausgeprägte Lateralisation der Sprachzentren (die rechte Hemisphäre ist sehr selten für die Sprache dominant, lediglich 2% der Menschen haben keine Sprachdominanz einer Hirnhemisphäre, Storch et al. 2001) gilt ebenso für die Lautwie auch für die Gebärdensprache (Hickok et al. 1996). Der Nachweis eines deutlich abgrenzbaren Wernicke’schen Zentrums bei Schimpansen (Gannon et al. 1998) könnte erklären, warum auch unsere nächsten Verwandten zu sehr erstaunlicher Kommunikation fähig sind: Schimpansen erlernen Symbolsprachen wie z. B. die Taubstummensprache oder mittels Bedienung von Computertastaturen, so dass eine Kommunikation zwischen Menschen und Schimpansen möglich wird. Erlernte Symbolsprachen werden auch von den Tieren untereinander benutzt. Es konnte zweifelsfrei gezeigt werden, dass Schimpansen keinesfalls lediglich im „Hier und Jetzt“ leben, sondern ebenso Erinnerung an Vergangenes wie Erwartungen an die Zukunft haben, und dass sie Gefühle wie Trauer und Freude zum Ausdruck bringen (Fouts 1997). Der Bonobo „Kanzi“ verfügt über ein großes aktives und ein noch größeres passives Verständnis von 500 Wörtern, wobei das Gehörte auch über Kopfhörer verstanden wird. Er versteht spontan für ihn neue Sätze mit komplexer Syntax, wie z. B. eingeschobene Sätze oder Pronomina, und ist in Bezug auf seine Sprechkompetenz einem 2½ jährigen Kind äquivalent (Savage-Rumbaugh et al. 1998). Und auch Gorillas können Erstaunliches leisten: Das Gorillaweibchen „Koko“ kommuniziert in Gebärdensprache und versteht auch das gesprochene Wort. Sie kann einfache Bedienungen am Computer ausführen und einige gedruckte Wörter sogar lesen, sie beweist im Spiel eine hohe Vorstellungskraft (Patterson u. Gordon 2001). Bislang sind jedoch noch keine Menschenaffen, auch nach intensivem Training, in Bezug auf ihre Sprachkompetenz über die Stufe eines menschlichen Kleinkindes hinausgekommen und bleiben deutlich hinter den durchschnittli- Stellung des Menschen in der Natur 21 chen Leistungen eines erwachsenen Menschen zurück, welcher über einen aktiven Wortschatz von etwa 10 000 Wörtern und einen rund zehnmal größeren passiven Wortschatz verfügt. Dennoch kann heute keinesfalls mehr davon ausgegangen werden, dass die menschliche Sprache in der Natur etwas Einzigartiges darstellt. Einzigartig sind vielmehr die kombinatorischen Effekte aus der Weiterentwicklung der neuronalen Sprachzentren, der Vergrößerung präfrontaler Hirnareale, und die Umgestaltung des Kehlkopfes, welcher die menschliche Vokalsprache ermöglicht. Was Menschen von ihren nächsten Verwandten unterscheidet, sind die Möglichkeiten einer enorm verbesserten Handlungsund Zukunftsplanung (Roth 1998). Zusammenfassung Kapitel 2.1 Stellung des Menschen in der Natur n Menschen gehören zu der Ordnung Primates und sind gemeinsam mit Schimpansen und Gorillas Angehörige der Unterfamilie Homininae. n Die habituelle Bipedie des Menschen ist eine spezielle Art der Fortbewegungsweise, welche einzigartig unter den Säugetieren ist. n Andere scheinbar exklusiv menschliche Merkmale sind jedoch eindeutig in der Fortführung von Evolutionstrends innerhalb der Primaten aufzufassen, darunter die Hirnentwicklung, die verlängerte Kindheit und Jugend, die materielle Kultur und die Entwicklung von Sprache. Aus biologischer Sicht ist eine echte „Sonderstellung von Menschen in der Natur“ daher unbegründet. 22 Evolution des Menschen 2.2 Stammesgeschichte Die Rekonstruktion der menschlichen Stammesgeschichte ist ein Forschungsfeld, in dem Ergebnisse und Erkenntnisse aus vielen Teildisziplinen der Naturund Kulturwissenschaften integriert werden. Die bis heute wichtigste Säule ist die Paläoanthropologie, die sich mit der Analyse der Fossilfunde befasst. Aus einer ursprünglich deskriptiven Fossilkunde hervorgegangen, nehmen in der heutigen Paläoanthropologie funktionsmorphologische Analysen einen breiten Raum ein, um die taxonomische Einordnung, die phylogenetischen Beziehungen und die gestaltlichen Umwandlungen zu klären. Doch auch Forschungsergebnisse aus der Molekularbiologie, der Evolutionsökologie und der Ethologie müssen herangezogen werden, um den Prozess der Menschwerdung zu entschlüsseln (zu den Forschungsergebnissen aus der Molekularbiologie s. Box 2.3). In dem vorliegenden Kapitel wird – zu Gunsten eines breiten Überblicks – auf viele Einzelheiten verzichtet, die umfassend in anderen Lehrbüchern dargestellt sind. Besonders zu empfehlen ist die „Stammesgeschichte des Menschen“ von Henke und Rothe, die 1998 im Springer-Verlag erschienen ist. Box 2.3 Proteine, DNA und Evolution des Menschen Nicht nur die an den Fossilien erkennbaren anatomisch-morphologischen Merkmale haben sich im Laufe der Evolution verändert, sondern auch die den physiologischen und genetischen Prozessen zugrunde liegenden molekularen Strukturen. Leider unterliegen die großen und informationsträchtigen Biomoleküle wie Proteine und DNA nach dem Tod eines Organismus einer erheblichen Degradation, so dass sie bisher nur in Ausnahmefällen aus prähistorischem organischen Material isoliert und für eine direkten Analyse genutzt werden können. Ein solcher Ausnahmefall sind die bemerkenswerten Untersuchungen an alter,konservierter DNA (s.auch Kap.2.3),die vom Humerus des Neandertalers aus der Feldhofer Grotte stammt. Krings et al. (1997) verglichen die mitochondriale DNA (mtDNA) des Neandertalers mit derjenigen heutiger Bevölkerungen und stellten fest, dass die Variation zwischen dem Neandertaler und dem heutigen Menschen erheblich größer ist als innerhalb rezenter Bevölkerungen. Aufgrund dessen gelangten sie zu der Schlussfolgerung, dass die Neandertaler ausstarben, ohne mtDNA an moderne Menschen weitergegeben zu haben.Damit wären die Neandertaler ein Seitenzweig mit eigenständiger Entwicklungslinie. Diese weitreichende Schlussfolgerung wird jedoch aus mehreren Gründen in Zweifel gezogen (Henke u. Rothe 1998): n Da mitochondriale DNA von der Rekombination ausgeschlossen ist,ist sie wenig geeignet,zum biologischen Artkonzept beizutragen. Stammesgeschichte Box 2.3 (Fortsetzung) n Da zum Vergleich die mtDNA rezenter Menschen herangezogen wurde,kann nicht ausgeschlossen werden,dass Homo-sapiens-Individuen, die zeitgleich mit Neandertalern gelebt haben, nicht dieselben mtDNA-Sequenzen aufwiesen. n Es ist in Frage zu stellen, ob die beobachteten Unterschiede in den untersuchten Gen-Loci mit Merkmalen im Sinne einer phylogenetischen Analyse gleichgesetzt werden dürfen. Unabhängig von solchen kontrovers diskutierten Aspekten haben aber molekularbiologische Untersuchungen einen erheblichen Beitrag zu unserem Verständnis vom Ablauf der menschlichen Stammesgeschichte geleistet.Da keine Biomoleküle ausgestorbener Spezies für entsprechende Analysen zur Verfügung stehen, werden – je nach Fragestellung – verschiedene Primatenspezies miteinander verglichen oder unterschiedliche Populationen des rezenten Menschen, so dass Rückschlüsse auf den Ursprung des modernen Homo sapiens möglich sind.Die ersten molekularbiologischen Untersuchungen in den 1960er Jahren waren immunchemische Vergleiche der Serumalbumine verschiedener Hominoidea (Sarich u. Wilson 1967). Sie legten nahe, dass die Trennung der zu den Hominini und der zu den rezenten afrikanischen Menschenaffen führenden Linien nicht – wie damals vermutet – 15 bis 20 oder sogar 30 Mio.Jahre zurückliegt, sondern eher 5 Mio.Jahre. In der Folgezeit erweiterte sich das methodische Arsenal der molekularbiologischen Evolutionsforscher ganz erheblich. Zunächst konnten weitere Proteine vergleichend immunologisch analysiert werden (z. B. Hämoglobin, Cytochrom C), später kamen Aminosäuresequenzanalysen von Proteinen hinzu, und schließlich wurde auch die DNA direkt untersucht, wobei zwei Verfahren unterschieden werden können: die DNA-DNA-Hybridisierung und die DNA-Sequenzierung (Friday 1992).Die so gewonnenen Daten werden auch als Molekulare Uhr zur paläogenetischen Datierung herangezogen. Dieses Konzept beruht auf der Annahme, dass durch Punktmutationen hervorgerufene Änderungen auf der Ebene der Moleküle auch über lange Zeiträume hinweg gleichmäßig stattfinden, so dass man den Zeitpunkt bestimmen kann, zu dem sich bestimmte Stammlinien getrennt haben (Wilson u. Cann 1992). Doch die molekulare Datierung wird auch kritisch betrachtet, weil unterschiedliche molekulare Systeme unterschiedlich schnell mutieren und weil die Mutationsraten möglicherweise doch nicht gleichmäßig in der Zeit stattfinden. Henke und Rothe (1998) meinen daher, dass Referenzdaten aus anderen Forschungsdisziplinen gewissermaßen als Taktgeber benötigt werden, um die Molekulare Uhr zu eichen. Davon unabhängig aber bieten vergleichende molekularbiologische Analysen ein wertvolles Instrument, um verwandtschaftliche Nähe oder auch verwandtschaftliche Distanz zu untersuchen. 23 24 Evolution des Menschen 2.2.1 Die Wurzeln der Homininae und Ponginae Obwohl aus dem Miozän eine Vielzahl von Hominoidea-Arten bekannt ist, wird bis heute sehr kontrovers diskutiert, welche fossilen Primaten in die Vorfahrenlinie der rezenten Ponginae und Homininae gehören (zur Nomenklatur s. Box 2.4 sowie Kap. 2.1). Im frühen Miozän lebten in Ostafrika mindestens zehn verschiedene Menschenaffenarten. Bereits in den 1930er Jahren wurde das erste Skelett eines Proconsul entdeckt, der lange Zeit als letzter gemeinsamer Vorfahr der heutigen Menschenaffen und der Hominini diskutiert wurde. Bestimmte Merkmale stimmen jedoch nicht mit unserem heutigen Vorstellungen davon überein, wie der gemeinsame Vorfahr ausgesehen hat. Außerdem lebten die archaischen Proconsuliden zu früh, um nach unserem heutigen Kenntnisstand als letzte Vorfahren in Frage zu kommen. Die frühmiozänen Hominoidea lebten auf Bäumen und bewegten sich auf allen vier Extremitäten fort. Die Zahnmorphologie miozäner Menschenaffen zeigt, dass sie zumindest mit Blick auf ihre Ernährung ökologisch unterschiedlich eingenischt waren: Proconsul und Dryopithecus gelten als eher generalisierte Früchtefresser, andere spätere Arten wie Ouranopithecus oder Afropithecus waren auf den Verzehr harter Nahrung spezialisiert und Kenyapithecus und Oreopithecus haben sich vermutlich folivor (Blätter essend) ernährt. Das postkraniale Skelett dieser verschiedenen Arten weist jedoch keine großen funktionalen Unterschiede auf. Ab dem mittleren Miozän dominieren eurasiatische Funde verschiedener Hominoidea den Fossilreport. Bei diesen Menschenaffen (z. B. Oreopithecus, Sivapithecus, Dryopithecus) sind nun auch Veränderungen des postkranialen Skeletts nachweisbar; die Knochen des Rumpfes und der Extremitäten lassen auf eine überwiegend suspensorische Fortbewegung schließen: Die Menschenaffen bewegten sich nicht mehr auf den Ästen, sondern überwiegend im Tabelle 2.3. Kurzübersicht zur Evolution der Primaten Epoche Zeitrahmen Evolutionsereignisse Holozän Pleistozän 10 000 – heute 1,64 Mio. – 10 000 Pliozän 5,2 Mio. – 1,64 Mio. Miozän 23,3 Mio. – 5,2 Mio. Oligozän 35,4 Mio. – 23,3 Mio. Eozän 56,5 Mio – 35,4 Mio. Paläozän 65 Mio – 56,5 Mio. keine Entstehung des modernen Homo sapiens, Aussterben mehrerer Hominini-Arten Radiation der Hominini (Ardipithecus, Australopithecus, Paranthropus, Homo) Radiation der Hominoidea (z. B. Proconsul, Sivapithecus, Ouranopithecus, Dryopithecus) Erste höhere Affen (z. B. Aegyptopithecus), Trennung von Cercopithecoidea und Hominoidea Trennung von Alt- und Neuweltaffen durch „Flößer“ im ausgehenden Eozän 1. Radiation der Primaten aus Vorfahren, die zu den Insektenfressern gehörten Stammesgeschichte 25 Geäst hängend fort. Die Besiedlung außerafrikanischer Regionen soll in mehreren Wellen erfolgt sein. Vermutlich ermöglichten bewaldete Korridore zwischen Afrika und Eurasien diese Ausbreitung. Es ist heute nicht entscheidbar, welche der zahlreichen Arten in die direkte Vorfahrenlinie der Menschen und Menschenaffen gestellt werden kann. Besondere Probleme bereitet die Bewertung, ob es sich bei bestimmten Merkmalen um ursprüngliche oder abgeleitete Merkmale handelt oder ob diese mehrfach unabhängig voneinander entstanden sind. Außerdem liegen bislang aus dem kritischen Zeitraum der Aufspaltung von Hominini und Panini vor ca. acht bis fünf Mio. Jahren kaum Funde vor, die es gestatten, zweifelsfreie Bezüge zu vorausgegangenen miozänen Hominoidea herzustellen. Box 2.4 Hominid oder hominin? Lange Zeit ging man davon aus, die Überfamilie der Hominoidea in drei Familien zu untergliedern, die Hylobatidae (Kleine Menschenaffen), Pongidae (Große Menschenaffen) und Hominidae (Menschenartigen). Nach neueren Erkenntnissen der Phylogenetischen Systematik (s. auch Kap. 2.1) werden Gorillas, Schimpansen und Menschen gemeinsam in die Unterfamilie der Homininae gestellt, die asiatischen Orang-Utans hingegen in die Unterfamilie der Ponginae. Alle aufrecht gehenden Mitglieder der Homininae – fossile Formen ebenso wie der moderne Homo sapiens – werden zu den Hominini zusammengefasst, die Nachbargruppen werden als Panini und Gorillini bezeichnet. Wenn in diesem Kapitel von hominin oder Homininen die Rede ist, ist der Begriff daher weitgehend deckungsgleich mit den in der älteren Literatur gebräuchlichen Begriffen hominid und Hominiden. Wichtige Kriterien für die Einordnung eines homininen Fossilfunds sind beispielsweise Größe der Zähne, Lage des Foramen magnum (= Hinterhauptsloch) und Schädelmorphologie sowie am postkranialen Skelett alle Merkmale, die Hinweise auf die Lokomotion liefern, wie z. B. Morphologie des Beckens, Form und Proportionen der großen Arm- und Beinknochen oder Form der Hand- und Fußknochen. Sehr fragmentarische oder liegezeitlich deformierte Fossilfunde gestatten manchmal keine eindeutige Beurteilung der Kriterien, so dass eine Zuordnung zu den Hominini nicht immer zweifelsfrei möglich ist. Besonders zurückhaltend oder sogar kontrovers werden vor allem jene neuen Funde diskutiert, deren Datierung sie in eine große zeitliche Nähe zum vermuteten letzten gemeinsamen Vorfahren von Panini und Hominini stellt. 26 Evolution des Menschen 2.2.2 Die Vielfalt der Hominini Zahlreiche bedeutende Fossilfunde der letzten dreißig Jahre haben die Erforschung der Evolution des Menschen und anderer Homininen zu einer dynamischen Wissenschaft werden lassen, in der mit jedem neuen Fund neue Fragen gestellt werden. Je nach taxomischer Zuordnung der homininen Fossilien werden heute bis zu acht Gattungen mit insgesamt mehr als zwanzig Arten unterschieden. Allein in den letzten zehn Jahren sind vier neue Gattungen, fünf neue Arten und zwei neue Unterarten hinzugekommen. Eine Zusammenstellung dieser Funde ist der Tabelle 2.4 zu entnehmen. Einen Überblick über die bis heute identifizierten Akteure auf der vorgeschichtlichen Bühne gibt die Abb. 2.8. Die Gültigkeit und Bedeutung mehrerer dort aufgeführter Taxa ist allerdings strittig. Dies gilt besonders für die neuesten Funde, die ihrer Datierung nach dem letzten gemeinsamen Vorfahren der Hominini und Panini sehr nahe kommen. Abb. 2.8. Übersicht über die bisher bekannten Hominini-Arten und ihre zeitliche Einordnung. Unsichere Datierungen sind durch Querbalken angedeutet. Zur Validität einzelner Taxa und zu alternativen Klassifikationsmöglichkeiten s. Text Stammesgeschichte 27 2.2.3 Die Schwierigkeit, Ordnung in die Vielfalt zu bringen Allein die neuen Funde, die in den letzten 10 Jahren publiziert wurden (s. Tabelle 2.4), zeigen den enormen Zuwachs, den die Gruppe der Hominini zu verzeichnen hat. Hinzu kommen laufend neue Erkenntnisse durch anatomische und funktionsmorphologische Vergleiche der verschiedenen Fossilien und neue methodische Ansätze, um die Vielfalt zu strukturieren. Einige Vertreter haben mehrfach den Namen gewechselt, wie z. B. Paranthropus boisei, der früher als Australopithecus boisei und davor als Zinjanthropus boisei bekannt war. Eine weitere sehr kontrovers diskutierte Spezies ist Homo habilis. Früher wurde das Taxon von vielen als nicht valide angesehen und die Fossilien entweder den Australopithecinen oder dem Homo erectus zugerechnet. Heute ist die Existenz der Art Homo habilis zwar akzeptiert, doch aufgrund der morphologischen Variabilität werden einzelne Funde ausgegliedert und anderen Arten zugeordnet, dies gilt z. B. für KNM-ER7 1470, der nunmehr von vielen Anthropologen in die Art Homo rudolfensis gestellt wird. Wood (2002) nimmt zwar ebenfalls eine Differenzierung in zwei Spezies vor, bleibt jedoch bei der Ansicht, dass es sich nicht um Angehörige der Gattung Homo handelt, sondern um Australopithecus rudolfensis und Australopithecus habilis. Ein wieder anderes Klassifikationsschema stellt diesen Fund aufgrund morphologischer Übereinstimmungen mit dem neu entdeckten Kenyanthropus platyops inzwischen als Kenyanthropus rudolfensis in eine andere Gattung (Lieberman 2001). Je nach Bewertung wird also der Fund 1470 als Homo habilis, Homo rudolfensis, Kenyanthropus rudolfensis oder Australopithecus rudolfensis bezeichnet. Diese für Nichtfachleute verwirrende Vielfalt spiegelt ein Kernproblem bei der Artdifferenzierung der Hominini wider: die Einschätzung von Unterschieden als „interspezifisch“ oder „intraspezifisch“, also die Entscheidung, ob die individuellen Merkmalsausprägungen einzelner Funde noch in die Variationsbreite einer Spezies fällt oder so stark von anderen ähnlichen Funden abweicht, dass sie einer anderen Spezies angehören. Bei der taxonomischen Zuordnung kommt erschwerend hinzu, dass der Artbegriff in der Biologie eine erhebliche Wandlung erfahren hat (s. Box 2.5). Der jetzigen heterogenen Fundsituation und den immer noch kontrovers diskutierten verwandtschaftlichen Beziehungen der zahlreichen Hominini entsprechend hat auch die Anzahl möglicher Stammbäume drastisch zugenom7 Für Eingeweihte liefert oft schon die Fundbezeichnung wichtige Informationen. In diesem Fall setzt sie sich zusammen aus dem Kürzel KNM für Kenya National Museum, der Abkürzung ER für East Rudolph und einer laufenden Nummer. Der Namensbestandteil KNM weist also auf das Herkunftsland Kenia hin; das Kürzel ER enthält nicht nur Hinweise auf die Region (Ostufer des Rudolfsees), sondern auch auf den Zeitpunkt der Entdeckung, denn der frühere Rudolfsee wurde 1975 in Turkanasee umbenannt. Bei den heutigen Funden aus der Region enthält die Katalognummer die Fundortkürzel ET (East Turkana) oder WT (West Turkana). Analog dazu können auch die anderen Funde meist schnell anhand der Katalognummer geografisch eingeordnet werden, die Funde aus der Olduvai-Schlucht in Tansania beginnen stets mit dem Kürzel OH für Olduvai Hominide und die Funde aus der Afar-Region in Äthiopien tragen die Kurzbezeichnung AL für Afar Locality. 28 Evolution des Menschen Tabelle 2.4. Wichtige Homininenfunde der letzten 10 Jahre in der Reihenfolge ihrer Erstveröffentlichung (durch Fettdruck ist gekennzeichnet, ob es sich um eine neue Gattung, Art oder Unterart handelt) Taxon Fund publiziert von Ardipithecus ramidus Australopithecus anamensis Australopithecus bahrelghazali Homo antecessor Australopithecus garhi Homo georgicus Orrorin tugenensis Kenyanthropus platyops Ardipithecus ramidus kaddaba Sahelanthropus tchadensis Homo sapiens idaltu White et al. 1994 Leakey et al. 1995 Brunet et al. 1995 und 1996 Bermudez de Castro et al. 1997 Asfaw et al. 1999 Gabunia et al. 2000 und 2002 Senut et al. 2001 Leakey et al. 2001 Haile-Selassie 2001 Brunet et al. 2002 White et al. 2003 men, so dass einige Anthropologen meinen, es sei unmöglich, in dem „Wald“ den richtigen Stammbaum zu identifizieren. Aus diesem Grund wird auch in dem vorliegenden Kapitel darauf verzichtet, einen Stammbaum darzustellen; dennoch werden mögliche verwandtschaftliche Beziehungen zwischen verschiedenen Arten vorgestellt. 2.2.4 Die frühesten Homininen In den vergangenen zehn Jahren sind drei von ihren Entdeckern als hominin klassifizierte fossile Arten gefunden worden, die aufgrund ihrer Datierung der vermuteten Aufspaltung zwischen der zu den Hominini und den Panini führenden Linien sehr nahe kommen. Sie haben daher möglicherweise große Ähnlichkeiten mit dem letzten gemeinsamen Vorfahren. Der Sahelanthropus tchadensis ist eine aufgrund von Fossilfunden aus dem Tschad im Jahr 2002 neu beschriebene Art (Brunet et al. 2002). Es handelt sich um den ältesten bisher bekannten Vertreter der Homininen, denn er wird aufgrund der Begleitfauna auf ein Alter von 6 bis 7 Mio. Jahre geschätzt! Der Fund umfasst ein nahezu vollständiges Cranium sowie Fragmente des Unterkiefers und weist ein einzigartiges Mosaik ursprünglicher und abgeleiteter Merkmale auf. Aufgrund verschiedener Zahn- und Schädelmerkmale, die bei keiner lebenden oder ausgestorbenen Gattung der Hominoidea zu beobachten ist, haben die Erstbeschreiber (Brunet et al. 2002) das Fossil in eine neue Gattung gestellt. Einige Merkmale des Sahelanthropus sind eher menschenaffenähnlich, andere Merkmale sind eher für die späteren Homininen typisch. In einfachen Worten gesagt, sieht Sahelanthropus von hinten wie ein Schimpanse aus, von vorne hingegen wie ein Australopithecus vor etwa zwei Mio. Jahren. Es wird deswegen vermutet, dass das Fossil dem letzten gemeinsamen Vorfahren von Stammesgeschichte Box 2.5 Was ist eine Art? Es ist in der biologischen Systematik erforderlich,Lebewesen nach dem Grad ihrer Verwandtschaft in Gruppen zu klassifizieren; die zentrale Einheit ist dabei die Art.Allerdings hat sich der Artbegriff bzw.seine Definition im Laufe der Zeit verändert. Das Artkonzept bei Linné, der die biologische Systematik im 18. Jahrhundert begründete, war typologisch, er fasste Organismen aufgrund morphologischer Ähnlichkeiten zu Arten zusammen. Dieses heute nicht mehr gebräuchliche Konzept bezeichnet man als Morphospezies. Als „prädarwinischer“ Naturforscher ging Linné noch davon aus, dass Arten statisch sind, sich also mit der Zeit nicht verändern.Die Akzeptanz der Evolutionstheorie hatte daher geradezu zwangsläufig die Konsequenz, dass sich die Definition der Art veränderte. Eine heute weit verbreitete Begriffsbestimmung der Art beruht auf dem Konzept der Fortpflanzungsgemeinschaft. Zu einer Art gehören danach Lebewesen, die sich miteinander fortpflanzen, die Zeugung fruchtbarer Nachkommen ist nur innerhalb einer Art möglich,nicht über Artgrenzen hinweg (z.B.Mayr 1975).Bei diesem Konzept der Biospezies spielen morphologische Ähnlichkeiten keine zentrale Rolle. Auch diese Artdefinition hat jedoch Defizite, so trifft sie z.B.nicht auf Organismen zu,die sich nur uniparental fortpflanzen.Außerdem ist das Kriterium der fruchtbaren Kreuzung in jenen Fällen nicht prüfbar, in denen Populationen räumlich oder zeitlich getrennt existieren.Letztes ist besonders problematisch für die Definition fossiler Arten. Der phylogenetischen Systematik (s. Kap. 2.1) liegt das Konzept der evolutionären Art zugrunde, danach sind Arten „Vorfahren-Nachfahren-Linien von tatsächlich oder potentiell sich kreuzenden Populationen, die aus biologischen Gründen vollständig reproduktiv von anderen solchen Linien isoliert sind.Arten entstehen durch die Aufspaltung ihrer Stammart infolge ausgebildeter Reproduktionsbarrieren und erlöschen ebenso durch ihre eigene Aufspaltung oder durch nachkommenloses Aussterben“ (Wiesemüller et al.2003).Für die Paläoanthropologie ist noch ein weiterer Artbegriff von Bedeutung: die Chronospezies. Bei der Abgrenzung von fossilen Spezies ist zu berücksichtigen,dass Arten sich im Laufe der Zeit verändern können. Durch die zeitlichen Lücken im fossilen Befund ist es oft problematisch, die Zusammengehörigkeit früher und später Vertreter einer Art korrekt zu erkennen. Daher werden von vielen Paläontologen und Paläoanthropologen Fossilien in unterschiedliche Arten gestellt,wenn sie sich deutlich voneinander unterscheiden. Diese willkürliche subjektive Unterteilung aufgrund anatomisch-morphologischer Kriterien führt zur Klassifikation von Chronospezies. Das zugrunde liegende Konzept ist wieder typologisch wie bei der Morphospezies und steht im Widerspruch zum evolutionären Artkonzept, das für die Differenzierung von Arten ein Aufspaltungsereignis erfordert. 29 30 Evolution des Menschen Menschen und Schimpansen sehr nahe steht. Der Sahelanthropus tchadensis nimmt also in zweierlei Hinsicht eine besondere Stellung ein. Zum einen handelt es sich um einen Fund, der im Tschad gemacht wurde, also weit abseits der bekannten Fundorte im Ostafrikanischen Grabenbruch. Zum anderen ist er aufgrund der Datierung der früheste bekannte Vertreter der Homininen-Linie. Der Fund ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Buches noch so neu, dass weiter gehende Interpretationen möglicher Verwandtschaftsbeziehungen zu anderen fossilen Homininen noch ausstehen. Da Fossilien postkranialer Skelettteile fehlen, müssen Aussagen über den Grad der Bipedie und damit auch die Zuordnung zu den Hominini noch als vorläufig angesehen werden. Weitere Analysen sind erforderlich, um die endgültige Bedeutung dieses Fundes zu evaluieren. Ardipithecus ramidus ist eine Spezies, die ihren Namen von White et al. im Jahre 1994 erhalten hat. Zunächst war der Fossilfund der Gattung Australopithecus zugeordnet worden, doch die Unterschiede zu den übrigen Australopithecinen sind so groß, dass die Funde einer neuen Gattung zugeordnet wurden. Ursprünglich wurde dieser Fossilfund aus Aramis in Äthiopien, der überwiegend aus Schädelfragmenten besteht, auf ca. 4,4 Mio. Jahre datiert. Die Fundstücke weisen ein Mosaik aus paninen und homininen Merkmalen auf. Ein Milchzahn zeigt eine sehr viel größere Ähnlichkeit mit einem Schimpansenmilchzahn als mit irgendeinem anderen homininen Fund. Zur Zeit der Erstbeschreibung handelte es sich um den ältesten homininen Fund, der in eine wichtige Fundlücke fiel. Die phylogenetischen Beziehungen zu den späteren Hominini, vor allem Australopithecus anamensis und Australopithecus afarensis, sind noch umstritten. Zwischen 1997 und 2001 wurde etliche Fossilfragmente geborgen, die auf ein Alter von 5,8 bis 5,2 Milo. Jahre datiert werden und einer neuen Unterart Ardipithecus ramidus kaddaba zugeordnet wurden (Haile-Selassie 2001). Ein Zehenknochen lässt auf Bipedie schließen, doch da er einige hunderttausend Jahre jünger ist als die übrigen Fossilien, ist seine Zugehörigkeit zu dieser Spezies nicht zweifelsfrei gesichert. Ein weiterer neuer Homininenfund ist der Orrorin tugenensis aus dem Baringo-Distrikt im Nordwesten Kenias. Sein Alter wird auf 6 Mio. Jahre geschätzt. Die Entdecker (Senut et al.2001) sind der Ansicht,dass es sich bei Orrorin um einen Vorfahren der Gattung Homo handelt,der durch fakultative Bipedie gekennzeichnet gewesen sei,also sowohl an eine bipede Lokomotion am Boden als auch das Klettern auf Bäumen angepasst gewesen sei. Der Fossilienfund umfasst allerdings nur einige Zähne, sowie Fragmente von Arm- und Beinknochen, so dass die Deutung des Fundes, seine Beziehungen zu anderen Hominini und insbesondere auch seine Zugehörigkeit zu den Hominini,noch umstritten ist (Aiello u. Collard 2001). Stammesgeschichte 31 2.2.5 Die beginnende Radiation der Hominini im Pliozän: Australopithecus, Paranthropus und Kenyanthropus Während die Paläoanthropologie jahrzehntelang nach denjenigen fossilen Hominini suchte, mit deren Hilfe man den evolutionären Werdegang der Gattung Homo und speziell der Art Homo sapiens nachzeichnen wollte, stellte sich durch immer neue Funde heraus, dass die Australopithecinen und Paranthropinen, von denen die meisten als direkte Vorfahren der Gattung Homo ausscheiden, eine erhebliche Formenvielfalt aufweisen, deren Entstehung meist unter dem Begriff Australopithecinenradiation beschrieben wird (Abb. 2.9). Unter dem Begriff Australopithecinenradiation versteht man die Entstehung mehrerer Australopithecinenarten, die teilweise auch zeitgleich mit Vertretern der Gattung Homo gelebt haben, aber nicht als direkte Vorfahren der zum Homo sapiens führenden Linie betrachtet werden. Der Begriff entstand zu einer Zeit, als die meisten Anthropologen die heute zum Genus Paranthropus zusammengefassten Arten noch als Australopithecinen bezeichneten. Am auffälligsten zeigt sich die unterschiedliche ökologische Einnischung, die zu dieser Radiation geführt hat, an der unterschiedlichen Zahn- und Schädelmorphologie. Die robusten Paranthropinen werden als Arten interpretiert, die zahlreiche Anpassungen aufweisen, die mit ihrer Ernährung im Zusammenhang stehen. Große Mahlzähne und knöcherne Schädelstrukturen, die auf eine gewaltige Kaumuskulatur hinweisen, lassen vermuten, dass sie in Bezug auf ihre pflanzliche Ernährung spezialisiert waren und entweder an den Verzehr größerer Mengen energiearmer Nahrung oder auch an die Verwertung besonders harter oder zäher Nahrung (z. B. Körner, Nüsse) angepaßt waren (Walker 1981, Lucas et al. 1985). Die grazileren Australopithecinen hingegen weisen keine Merkmale auf, die auf eine Nahrungsspezialisierung schließen lassen. Zu den Australopithecinen zählen heute fünf Arten: Australopithecus anamensis, A. afarensis, A. africanus, A. bahrelghazali und A. garhi. Der Australo- Abb. 2.9. Drei „berühmte“ Australopithecinen: Das „Kind von Taung“, A. africanus „Mrs. Ples“ (STs 5), und P. boisei (KNM-ER 406) (von links nach rechts) 32 Evolution des Menschen pithecus anamensis wurde 1995 von Leakey et al. benannt; dieser neuen Art liegen verschiedene 1988 in Allia Bay und 1994 in Kanapoi gefundene Fossilien zugrunde. Da die Fossilien zu unterschiedlichen Zeitpunkten an verschiedenen Fundorten am Turkanasee in Kenia entdeckt wurden, ist die Zugehörigkeit zu einer Spezies nicht endgültig gesichert. Der Australopithecus anamensis ist der bislang älteste Australopithecine; er wird auf 4,2 bis 3,9 Mio. Jahre datiert und zeigt eine Mischung vergleichsweise ursprünglicher Schädelmerkmale und fortgeschrittener Merkmale am postkranialen Skelett: Zähne und Kiefer ähneln eher denen älterer fossiler Menschenaffen, doch ein Tibia(Schienbein-)fragment lässt auf Bipedie schließen und der Teil eines Oberarmknochens sieht sehr menschlich aus. Über die verwandtschaftlichen Beziehungen zu anderen (früheren und späteren) Hominini können zur Zeit noch keine zuverlässigen Aussagen gemacht werden. Der Australopithecus afarensis gehört zu einer durch etliche Fossilfunde sehr gut dokumentierten Spezies und lebte vor 3,9 bis 3,0 Mio. Jahren. Die Spezies ist gekennzeichnet durch eine menschenaffenähnliche Gesichtmorphologie mit niedriger Stirn, flacher Nase, fliehendem Kinn und einem vorspringenden Kiefer mit großen Vorbacken- und Backenzähnen. Das Hirnschädelvolumen variiert zwischen ca. 375 und 550 cm³. Die Eckzähne sind viel kleiner als bei Menschenaffen, doch größer und spitzer als bei Menschen. Die Form des Zahnbogens ist noch nicht parabolisch wie bei späteren Hominini, sondern weist parallele Backenzahnreihen wie bei Menschenaffen auf. Das postkraniale Skelett zeigt, dass bei diesen Homininen bereits die wesentlichen Anpassungen an den aufrechten Gang vollzogen waren. Diese Annahme wird auch durch die Fußabdrücke von Laetoli in Tansania unterstützt, die dem A. afarensis zugeschrieben werden. Der große Zwischenraum zwischen der I. und II. Zehe ist zwar eher menschenaffenähnlich, doch die Großzehe ist adduziert und auch der Fersenabdruck ist ein Indiz für Bipedie. Dennoch darf man nicht davon ausgehen, dass diese Australopithecinen sich aufrecht bereits so fortbewegten wie die späteren Vertreter der Gattung Homo. Andere Skelettteile des Rumpfes und der oberen Extremitäten zeigen auch, dass diese Hominini noch über Anpassungen an eine suspensorische Lokomotion verfügten und gute Kletterer waren. Von A. afarensis liegen fossile Überreste von zahlreichen Individuen vor. Der Fund AL 288-1 aus dem Jahre 1974, der unter dem Spitznamen „Lucy“ berühmt wurde, ist ungefähr zur Hälfte erhalten und ermöglichte somit umfangreiche funktionsmorphologische Analysen. Außerdem wurden in der Afar-Region, nach der die Spezies ihren Namen erhielt, Fossilien von weiteren 13 Individuen gefunden, die unter dem Namen „First Family“ bekannt wurden – obwohl es sich bei diesem Fund gewiss nicht um eine Gruppe Verwandter handelt. Der Vergleich dieser Funde zeigt, dass es sich bei A. afarensis um eine sehr heteromorphe Spezies handelt, die geschätzten Körperhöhen variieren zwischen 107 und 152 cm, wobei eine wesentliche Ursache dieser Unterschiede im Sexualdimorphismus zu sehen ist. Der Australopithecus africanus ist eine Homininen-Art, die bereits 1925 – nach der Entdeckung des berühmten „Kind von Taung” in Transvaal – von Raymond Dart benannt wurde. Das Taxon ist durch etliche Fossilfunde, die Stammesgeschichte 33 auch postkraniale Knochen einschließen, dokumentiert und die Datierungen lassen vermuten, dass diese Spezies vor etwa 2,8 bis 2,4 Mio. Jahren lebte. Von einigen Autoren wird der Zeitraum der Existenz auch mit 3 bis 2 Mio. Jahren angegeben. Der Australopithecus africanus ist eine grazile Spezies, deren Schädel- und Zahnmerkmale weiter menschenähnlich evolviert sind als beim A. afarensis, der Zahnbogen beispielsweise ist bereits parabolisch und die Eckzähne sind vergleichsweise stärker reduziert. Das Hirnschädelvolumen wird mit 420 bis 500 cm³ angegeben und das postkraniale Skelett lässt erkennen, dass die Fähigkeit zur Bipedie ausgebildet war, obwohl gleichzeitig noch Anpassungen an eine fakultativ suspensorische Lokomotion zu erkennen sind. Lange Zeit wurde vermutet, dass der A. africanus das Bindeglied zwischen dem A. afarensis und den ersten Vertretern der Gattung Homo war. Inzwischen wird diese Annahme jedoch in Frage gestellt und die verwandtschaftlichen Beziehungen zu anderen Hominini sehr kontrovers diskutiert. Einige kraniale Merkmale lassen vermuten, dass Australopithecus africanus die Stammart des Paranthropus robustus ist, wenngleich dessen spezielle Anpassungen des Kauapparates an eine besonders hartfaserige grobe Kost noch nicht ausgebildet sind. Von der 1999 aufgrund von Fossilfunden aus Äthiopien benannten Spezies Australopithecus garhi (Asfaw et al. 1999) liegt ein Teil des Schädels vor. Einige ebenfalls geborgene Fragmente postkranialer Knochen können dem Fund nicht zweifelsfrei zugeordnet werden. Der Schädel wird auf 2,5 Mio. Jahre datiert und unterscheidet sich von anderen Australopithecinen durch eine besondere Kombination von Merkmalen: Die Morphologie wirkt ursprünglich und die Zähne erscheinen bemerkenswert groß. Bei den postkranialen Elementen fällt auf, dass das Verhältnis von Humerus (Oberarm) und Femur (Oberschenkel) eher menschenähnlich und das Verhältnis von Oberarm zu Unterarm eher menschenaffenähnlich ist. Die Erstbeschreiber halten die Spezies für eine mögliche Stammart der ersten Vertreter der Gattung Homo. Für eine endgültige Bewertung des Taxons müssen jedoch noch weitergehende Funde und Analysen abgewartet werden. Der Australopithecus bahrelghazali ist eine neue Spezies, die auf ein Alter von etwa 3,5 bis 3 Mio. Jahre datiert wird (Brunet et al 1995, 1996). Bemerkenswert an diesem Fund ist der Fundort, denn A. bahrelghazali ist der erste Homininenfund aus dem Tschad, stammt also aus einem Gebiet, das etwa 2500 Kilometer westlich des Ostafrikanischen Grabenbruchs liegt, in dem sich die meisten bedeutenden Fundstätten homininer Fossilien befinden. A. bahrelghazali umfasst leider nur einen Unterkiefer und einen Zahn aus dem Oberkiefer, so dass aufgrund der spärlichen Fundsituation noch keine endgültigen Schlussfolgerungen gezogen werden können. Die Abgrenzung von A. afarensis beruht auf einigen Aspekten der Kiefer- und Zahnmorphologie (z. B. dreiwurzelige Prämolaren), so dass weitere Funde erforderlich sind, bevor endgültig feststeht, dass es sich nicht nur um eine regionale Variante des A. afarensis handelt. 34 Evolution des Menschen Der Paranthropus aethiopicus lebte vor 2,6 bis 2,3 Mio. Jahren. Von dieser Spezies ist vor allem der sogenannte Schwarze Schädel8 bekannt, der 1985 am Turkana-See in Kenia gefunden wurde. Er weist ein erstaunliches Mosaik ursprünglicher und abgeleiteter robuster Merkmale auf, die er mit den späteren robusten Paranthropinen teilt. Durch die Hirnschädelkapazität von nur knapp 420 cm³ sowie die ausgeprägte alveolare Prognathie (= vorstehende Schnauze, bedingt durch mehr waagerechte als senkrechte Position der Zahnfächer im Kiefer) weist er eher Bezüge zum Australopithecus afarensis auf, doch einige Merkmale wie die ausgeprägte Crista sagittalis (= Scheitelkamm), das eingedellte Mittelgesicht und die großen Zähne zeigen große Ähnlichkeit mit P. robustus und P. boisei. Es fehlen bislang postkraniale Skelettelemente im Fundmaterial, so dass über die Fortbewegung nur spekuliert werden kann; er besaß vermutlich die Fähigkeit, sich biped fortzubewegen, doch ob er noch über eine gute Kletterfähigkeit verfügte, ist unklar. Möglicherweise stellt er das Bindeglied zwischen Australopithecus afarensis und den robusten Paranthropinen dar, wobei einige Wissenschaftler aufgrund bestimmter Merkmale allerdings annehmen, dass der südafrikanische P. robustus sich vom Australopithecus africanus ableitet. In diesem Falle wären allerdings die gemeinsamen robusten Merkmale von P. boisei und P. robustus auf eine parallele Entwicklung zurückzuführen. Paranthropus robustus ist eine hominine Spezies aus Südafrika, die vor etwa 2 bis 1,5 Mio. Jahren lebte und bereits in den 1930er Jahren entdeckt wurde. Das spärlich vorhandene postkraniale Skelettmaterial unterscheidet sich nicht wesentlich von dem eines A. africanus, doch der Schädel zeigt etliche kraniodentale Spezialisierungen. Er ist sehr quer betont, mit ausladenden Jochbögen, einem eingedellten Mittelgesicht und einer extrem flachen Stirn. Die Prämolaren sind sehr massiv und die gesamte Kaufläche der Vorbackenund Backenzähne ist deutlicher größer als beim A. africanus. Die meisten Schädel dieser Spezies haben eine Crista sagittalis, einen knöcherner Scheitelkamm, an der die stark ausgeprägte Kaumuskulatur ansetzte. Die speziellen Anpassungen des Paranthropus robustus werden allgemein auf seine Ernährung zurückgeführt; vermutlich ernährte er sich von grober faserreicher Kost, die zur mechanischen Zerkleinerung lange und stark gekaut werden musste. Das Gehirnvolumen betrug durchschnittlich 530 cm³, liegt also über dem größten beim A. africanus gemessenen Wert. Allerdings ist dieser Unterschied auch auf allometrische Effekte (s. Kap.4.1) zurückzuführen. Da nur wenige postkraniale Knochen gefunden wurden, gibt es sehr unterschiedliche Schätzungen von Körpergröße und -gewicht; es weist jedoch vieles darauf hin, dass bei dieser Spezies ein erheblicher Sexualdimorphismus bestand. Einige Paranthropusfunde aus Südafrika werden manchmal gesondert unter der Artbezeichnung Paranthropus crassidens aufgeführt, auf diese Differenzierung wurde hier jedoch verzichtet. 8 Der Schädel trägt diesen Trivialnamen, da er während seiner langen Liegezeit durch manganreiche Mineralien eine teilweise bläulich-schwarze Färbung erhalten hat. Stammesgeschichte 35 Paranthropus boisei ist eine robuste Spezies aus Ostafrika. Sie lebte vor 2,1 bis 1,1 Mio. Jahren und ähnelt dem P. robustus, der zeitgleich im südafrikanischen Raum lebte. Der erste P. boisei wurde 1959 von Louis und Mary Leakey in der Olduvaischlucht entdeckt und erhielt aufgrund seiner megadonten Bezahnung den Spitznamen „Nussknackermensch“. Tatsächlich erreichen die Backenzähne dieser Spezies einen Durchmesser von bis zu 2 cm und die Kaufläche der Prämolaren und Molaren ist mit 800 mm² deutlich größer als beim südafrikanischen Vetter. Generell sind die speziellen Merkmale der Paranthropinen beim P. boisei „hyperrobust“ ausgebildet. Die Jochbeine beispielsweise sind noch stärker ausladend, und die Crista sagittalis ist auch bei weiblichen Schädelfunden ausgebildet. Ein augenfälliges Unterscheidungsmerkmal zum P. robustus sind auch die Überaugenwülste, die beim P. boisei nach lateral abfallen. Da auch bei diesen Homininen kaum postkraniales Skelettmaterial vorliegt, sind Schätzungen von Körpergröße und -gewicht wenig zuverlässig. Kenyanthropus platyops ist ein anderer fossiler Neuling in der wachsenden Familie der Homininen (Leakey et al. 2001; Lieberman 2001). Der Schädel KNM-WT 40000 wurde 1999 zusammen mit etlichen weiteren Schädel- und Zahnfragmenten, die noch nicht zugeordnet sind, am Turkanasee in Kenia gefunden. Er wird auf ein Alter von 3,2 bis 3,5 Mio. Jahren datiert. Die Backenzähne mit starkem Zahnschmelz, das Gehirnschädelvolumen und die kleine Ohröffnung zeigen Ähnlichkeiten mit den Australopithecinen, doch der Gesichtsschädel weist Merkmale auf, die eine große Ähnlichkeit mit dem Homo rudolfensis, besonders dem Schädel KNM-ER 1470, erkennen lassen. Besonders auffällig ist das flache Gesicht. Insgesamt zeigt der Fossilfund ein Mosaik von Merkmalen, das in dieser Kombination bei keiner anderen bisher identifizierten homininen Spezies beobachtet wurde. Daher haben Leakey et al. (2001) vorgeschlagen, diesen homininen Fund in eine neue Gattung zu stellen: Kenyanthropus platyops. Die Zuordnung von KNM-WT 40000 zu den Australopithecinen ist wegen der Bezüge des Fundes zu anderen homininen Spezies problematisch und würde eine Revision der Klassifikation zahlreicher Funde erfordern. Dennoch ist die Zuordnung zur Zeit noch umstritten und es bleibt abzuwarten, ob die neue Gattung akzeptiert wird. 2.2.6 Die Gattung Homo Je nach Bewertung von Merkmalen und entsprechender Klassifikation wird die Gattung Homo heute in etliche Arten unterschieden. Kaum eine von ihnen ist unumstritten. Im folgenden sollen neun Spezies differenziert werden: Homo habilis, Homo rudolfensis, Homo georgicus, Homo ergaster, Homo erectus, Homo antecessor, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis und Homo sapiens. Es ist inzwischen durchaus strittig, ob eine so weit gehende Differenzierung wirklich erforderlich ist. So ist Henke (2003) der Ansicht, dass Paläoanthropologen ernsthaft daran denken sollten, die Anzahl der Spezies zu reduzieren, und er stellt in Frage, ob H. ergaster, H. erectus, H. antecessor, H. heidelbergensis und H. neanderthalensis wirklich Vertreter jeweils eigener Arten sind. Über die Neulinge unter ihnen, Homo georgicus und Homo anteces- 36 Evolution des Menschen sor, ist ohnehin noch nicht so viel bekannt, dass sie bereits als etablierte Spezies angesehen werden können, dies gilt vor allem auch wegen der neu zu überdenkenden Beziehungen zwischen den verschiedenen Homo-Arten. Aber auch alt bekannte Arten bereiten Probleme: So sind Wood u. Collard (1999) der Ansicht, dass weder H. habilis noch H. rudolfensis die Kriterien erfüllen, um der Gattung Homo zugeordnet zu werden. Auch die Differenzierung in Homo (resp. Australopithecus) rudolfensis und Homo (resp. Australopithecus) habilis wird nicht von allen Anthropologen akzeptiert. Das gleiche gilt für die Trennung von Homo ergaster und Homo erectus, und schließlich ist es nicht endgültig klar, ob der Neandertaler in eine eigene Art gestellt werden sollte oder ob er als Unterart Homo sapiens neanderthalensis aufzufassen ist. Dass hier dennoch die stark aufgegliederte Differenzierung in neun Arten für die Darstellung gewählt wurde, soll den Leserinnen und Lesern die Vergleichbarkeit mit der übrigen Fachliteratur erleichtern. Für die Zukunft steht zu hoffen, dass es den Paläoanthropologen gelingt, eine tragfähige und konsensfähige Revision der Klassifikation zu erarbeiten. Die ersten Funde des Homo habilis, der vor ca. 2,3 bis 1,6 Mio. Jahren lebte, stammen aus der Olduvai-Schlucht, wo sie Anfang der 1960 Jahre entdeckt wurden (Leakey et al. 1964). Die Fossilien unterscheiden sich in zahlreichen kraniodentalen Merkmalen sowohl von Paranthropus boisei, der kurz vorher dort gefunden wurde, als auch vom Australopithecus africanus und schließlich auch von den damals bereits bekannten asiatischen Fossilien des Homo erectus. Das erste geschätzte Hirnschädelvolumen eines Homo habilis lag bei etwa 670 cm³, so dass man vermutete, dieser neue hominine Fund sei auch der Urheber der in Olduvai so zahlreich gefundenen Geröllgeräte (s. Box 2.6). Um dieser Tatsache Rechnung zu tragen, nannte man das neue Familienmitglied der Hominini Homo habilis, der „geschickte Mensch“ (der englische Spitzname lautet handy man, was soviel bedeutet wie Bastler oder Heimwerker). Obwohl weitere Fossilien von anderen ostafrikanischen Fundstätten hinzukamen, blieb die Validität dieser Art lange Zeit umstritten, und Homo habilis wurde erst in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre akzeptiert. Einen wesentlichen Beitrag dazu lieferte ein Schädelfund aus Nordkenia, der KNM-ER 1470 (Abb. 2.10), und es ist eine Ironie des Schicksals,dass dieser Fund heute das Typusexemplar des Homo rudolfensis ist. Anfang der 1970er Jahre wurden am Turkana-See kurz hintereinander zwei Schädelfunde gemacht, die der Art Homo habilis zugeordnet wurden: der große KNM-ER 1470 mit einem Hirnschädelvolumen von 775 cm³ und KNM-ER 1813 mit einem Volumen von nur 510 cm³ (im Allgemeinen gilt ein Wert von ca. 600 cm³ als Richtwert, um einen homininen Fund als Homo zu klassifizieren). Diese beiden Funde zeigen bezüglich ihrer Schädelmaße Unterschiede, die so groß sind, dass der Sexualdimorphismus von Gorillas übertroffen wird. Damit stehen diese beiden Schädel exemplarisch für die Tatsache,dass die intraspezifische Variabiliät bei den ursprünglich dieser Spezies zugeordneten Funden bemerkenswert groß ist, wobei besonders das Fundmaterial aus Koobi Fora am TurkanaSee sehr heterogen war. 1986 machte dann Alexeev den Vorschlag, den Fund 1470 und einige andere „große“ habiline Fossilfunde der neuen Art Homo rudol- Stammesgeschichte 37 Abb. 2.10. Fund KNM-ER 1470 (vgl. Text) fensis zuzuordnen.9 Die Kontroverse um die Spezies Homo habilis und Homo rudolfensis und ihre Beziehungen zueinander und zu anderen früheren und späteren Homininen wird andauern. Folgt man dieser Klassifizierung, so ergibt sich zwangsläufig, dass vor ca. 2 Mio. Jahren mindestens zwei Arten der Gattung Homo zeitgleich in Ostafrika lebten. Die Spezies Homo rudolfensis wird vor allem durch das oben genannte Fundmaterial vom Turkana-See repräsentiert, dessen absolutes und relatives Hirnvolumen bereits dem Homo ergaster nahe kommt. Es gehört jedoch auch ein Unterkiefer zu dieser Spezies, der in Malawi gefunden wurde. Diese Mandibula mit der Katalognummer UR 501 wird auf 2,5 bis 2,1 Mio. Jahre geschätzt (Schrenk et al. 1993) und ist damit deutlich älter als das kenianische Typusexemplar. Vom Homo rudolfensis liegt praktisch kein postkraniales Skelettmaterial vor, so dass nur indirekt geschlossen werden kann, dass die Fortbewegung dieser Spezies derjenigen des Homo habilis ähnlich war. Aufsehen erregende neue Funde stammen aus Georgien. Insgesamt drei gut erhaltene Schädel und ein Unterkiefer wurden im Kaukasus geborgen, die auf ein Alter von etwa 1,8 Mio. Jahre datiert werden (Gabunia et al. 2000; Vekua et al. 2002). Für die Fossilien, die aufgrund ihrer morphologischen Merkmale 9 Um zu verdeutlichen, welcher Klassifikation man folgt, ergänzt man den Artnamen häufig durch den Zusatz sensu stricto („im engen Sinn“) bzw. sensu lato („im weiten Sinn“). Spricht man vom Homo habilis sensu stricto, so meint man den H. habilis im engeren Sinne, also abgegrenzt vom Homo rudolfensis; mit der Bezeichnung Homo habilis sensu lato tut man hingegen kund, dass man die Trennung nicht akzeptiert, sondern im weiteren Sinne das von anderen als H. rudolfensis klassifizierte Fundmaterial einschließt. Auch bei der nicht von allen akzeptierten Trennung in Homo ergaster und Homo erectus ist diese Feindifferenzierung häufig zu finden. 38 Evolution des Menschen Box 2.6 Steinwerkzeuge und Feuerbenutzung Die ältesten bekannten Steinwerkzeuge sind knapp zweieinhalb Mio. Jahre alt. Es handelt sich um einfach zugerichtete Geräte der Oldowan-Industrie, die den ersten Vertretern der Gattung Homo zugeschrieben werden. Ob auch Australopithecinen einfache Steinwerkzeuge hergestellt haben, ist strittig. Die wichtigsten Fundstätten von Geröllgeräten der Oldowan-Industrie sind Olduvai in Tansania, von dem sich der Name ableitet, sowie Omo und Hadar in Äthiopien. Wie bereits in Kap. 2.1 ausgeführt wurde, sind Werkzeugbenutzung und -herstellung keineswegs ein ausschließlich hominines Merkmal, sondern auch bei anderen hochentwickelten Wirbeltieren,besonders bei den Primaten häufig beobachtet worden. Daher ist davon auszugehen, dass auch die Homininen, die vor der Entstehung der Gattung Homo existierten, zu einer vielfältigen Werkzeugbenutzung fähig waren. Im Gegensatz zu Steinwerkzeugen sind Werkzeuge aus organischem Material jedoch vergänglich und daher im archäologischen Befund nicht nachweisbar. Welche Bedeutung die Herstellung von Steinwerkzeugen für die Hominisation hatte, wird kontrovers diskutiert. Während Toth (1985) oder Leakey (1994) der Ansicht sind, dass Menschenaffen nicht über alle erforderlichen kognitiven Fähigkeiten verfügen, um lithische Geräte herzustellen, meinen Wynn und McGrew (1989), dass die ersten Steinwerkzeughersteller keine größeren mentalen Fähigkeiten benötigten als rezente Menschenaffen aufweisen. Ein deutlicher technologischer Fortschritt in der Werkzeugherstellung ist erst mit dem Auftreten der Acheuléen-Industrie (benannt nach dem französischen Fundort Saint Acheul) vor etwa 1,4 Mio. Jahren festzustellen.Innerhalb der Formenvielfalt kennzeichnen zweiseitig bearbeitete große Faustkeile diese Stufe der lithischen Artefakte. Die ältesten Funde stammen aus Äthiopien und werden dem Homo ergaster zugeschrieben, die jüngsten Geräte stammen von europäischen Fundorten. Innerhalb der Acheuléen-Industrie lassen sich eine einfachere ältere Stufe und eine jüngere Stufe unterscheiden, die viel feinere Bearbeitungsspuren zeigt. Der letzte Nachweis von Acheuléen-Werkzeugen datiert auf etwa 200 000 Jahre; das Spätacheuléen wird dem Homo sapiens zugeordnet. Geräte dieser Kultur sind zur Fleischbearbeitung und -zerlegung und zur Holzbearbeitung geeignet. Die dominierende Steinwerkzeug-Industrie des Mittelpaläolithikums (vor 130 000 bis 10 000 Jahren) ist das Moustérien (benannt nach dem französischen Fundort Le Moustier). Das vielgestaltige Geräteinventar (z.B.Bohrer, Schaber, Stichel, Kratzer) ist wesentlich graziler als die Werkzeuge des Acheuléen und weist ausgefeilte Herstel Stammesgeschichte Box 2.6 (Fortsetzung) lungstechniken auf. Zeitliche Überlappungen gibt es sowohl mit der älteren Acheuléen-Industrie als auch mit dem jüngeren Aurignacien. Die Moustérien-Geräte wurden lange Zeit ausschließlich den Neandertalern zugeschrieben, doch im Nahen Osten kommt auch der Homo sapiens als Hersteller in Frage (Henke u. Rothe 1998). Die frühen Steinwerkzeuge sind vermutlich zweckmäßige Geräte für die Erschließung von Nahrung gewesen;hierfür sprechen auch die an fossilen Säugetierknochen entdeckten Schnittmarken, die z. B. in der Olduvai-Schlucht mit dem Homo habilis assoziiert werden. Für den Nahrungserwerb jedoch, speziell für die Jagd auf Großsäuger, waren einfache Steinwerkzeuge ungeeignet. Effiziente Fernwaffen sind erst relativ spät im archäologischen Befund nachweisbar. Ein besonderer Fund sind die Reste von Holzspeeren, die in der Nähe von Helmstedt entdeckt wurden und auf ca.400 000 Jahre datiert werden (Thieme 1997). Andere wirkungsvolle Distanzwaffen, wie etwa Pfeil und Bogen, sind erst aus dem Jungpaläolithikum nachgewiesen (Stodiek u. Paulsen 1996). Der früheste Nachweis von Feuergebrauch ist umstritten. Bei der Verwendung von Feuer durch Menschen ist zu unterscheiden zwischen der kurzfristigen Benutzung von natürlichem Feuer, der Unterhaltung von Feuer und dem Entfachen von Feuer.Vor allem bei frühen Hinweisen auf Feuer im Kontext mit menschlichen Aktivitäten ist diese Differenzierung meist nicht zweifelsfrei möglich. Eine auf 1,4 Mio. Jahre datierte Fundstelle bei Chesowanja in Kenia zeigt im Zusammenhang mit Lavawerkzeugen und Tierknochen Hinweise auf mögliche Feuerbenutzung, doch es ist keineswegs auszuschließen, dass es sich um Spuren einer natürlichen Feuerentfachung z. B. durch einen Blitzschlag handelt. Der überzeugendste Beweis für Feuergebrauch stammt aus China, wo der Homo erectus in den Höhlen von Zhoukoudian dicke Ascheschichten und Holzkohle hinterließ, die auf kontrollierte Feuerstellen über längere Zeiträume hindeuten. Ein wichtiger Vorteil des Feuergebrauchs ist im Erhitzen von Nahrung zu sehen, weil möglicherweise enthaltene Giftstoffe und Parasiten unschädlich gemacht und Nährstoffe aktiviert werden können. Bislang wurde der Beherrschung des Feuers eine zentrale Rolle bei der Besiedlung Eurasiens zugeschrieben,da der Licht- und Wärmespender Feuer als wichtige Voraussetzung für die Besiedlung gemäßigter Klimazonen gilt. Sofern es jedoch in Zukunft keine neuen Erkenntnisse über frühen Feuergebrauch gibt, wird diese Annahme durch die Fossilfunde von Dmanisi, welche die Anwesenheit früher Vertreter der Gattung Homo in Asien belegen, zumindest relativiert. 39 40 Evolution des Menschen zunächst als zwischen Homo habilis und Homo erectus sensu lato bzw. Homo ergaster stehend eingeordnet wurden, ist inzwischen der Artname Homo georgicus vorgeschlagen worden (Gabunia et al. 2002). Das Fundmaterial ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. Zum einen ist es eine große Überraschung, dass vergleichsweise „primitive“ Vertreter der Gattung Homo bereits den afrikanischen Kontinent verlassen haben, und zum anderen zeigen die drei Schädel im Vergleich miteinander eine erhebliche Variationsbreite. Sie unterscheiden sich in einigen morphologischen Aspekten und vor allem in der Größe. Das Hirnschädelvolumen beispielsweise reicht von 600 cm³ (Fund D2700) bis zu 780 cm³ (D2280). Damit ist D2700 der kleinste hominine Schädel, der jemals außerhalb des afrikanischen Kontinents gefunden wurde. Morphologische Ähnlichkeiten sowohl mit Homo habilis als auch mit Homo ergaster sind unübersehbar. Diese Tatsache könnte zu einer Revision der Klassifikation früher Vertreter der Gattung Homo führen. Bisher ging man davon aus, dass erst Homo ergaster oder Homo erectus mit längeren Beinen und einem höher evolvierten Gehirn wie beispielsweise der KNM-WT 15000 (s. unten) in der Lage waren, den weiten Weg nach Europa zu bewältigen.Diese Ansicht muss angesichts des vergleichsweise kleinen „primitiven“ Homo georgicus in Eurasien nun definitiv revidiert werden und die evolutionsökologischen Szenarien müssen neu formuliert werden. Seit etwa Mitte der 1970er Jahre zeigen etliche Fossilfunde, die größtenteils vom Turkanasee stammen, dass seit etwa 1,75 Mio. Jahren Vertreter der Gattung Homo in Afrika nachweisbar sind, die sich von den anderen Arten Homo habilis und Homo rudolfensis in etlichen Merkmalen deutlich unterscheiden. Von besonderer Bedeutung ist der auf etwa 1,6 Mio. Jahre datierte Fund KNM-WT 15000, bei dem es sich um ein bemerkenswert vollständiges Skelett handelt. Der Fossilfund stammt vermutlich von einem Jungen, der auf ca. 12 Jahre geschätzt wird (Turkana Boy, Junge von Nariokotome). Das postkraniale Skelett zeigt erstaunlich „moderne“ Körperproportionen und die Körperhöhenschätzung hat ergeben, dass das noch nicht erwachsene Individuum bereits 1,50 Meter groß war. Das Schädelvolumen wurde mit 880 cm³ berechnet, die Zahnmorphologie weist auf große Ähnlichkeiten mit Homo-erectus-Funden aus China hin. Zunächst wurde dieser Fund wie auch einige andere ähnliche Funde aus Afrika dem Homo erectus zugeordnet. Doch zahlreiche Unterschiede zwischen diesen afrikanischen Funden und den asiatischen Homo-erectus-Fossilien haben dazu geführt, dass sich in den letzten zehn Jahren mehr und mehr die Ansicht durchgesetzt hat, die afrikanischen Funde als Homo ergaster (der arbeitende Mensch) zu klassifizieren und von dem asiatischen Homo erectus abzugrenzen; dennoch ist die Trennung zwischen den beiden Spezies H. ergaster und H. erectus nicht generell akzeptiert, weil das Fundmaterial von Homo ergaster und Homo erectus auch als eine einzige polytypische Spezies aufgefasst werden kann. Ein neuer Schädelfund aus Bouri in Äthiopien, der auf 1 Mio. Jahre datiert wurde, wird von seinen Entdeckern als Homo erectus klassifiziert. Seine Merkmale lassen nach ihrer Meinung eine morphologische Kontinuität zwischen H. ergaster und H. erectus erkennen (Asfaw et al. 2002), so dass eine Trennung in zwei Arten nicht gerechtfertigt sei. Einigkeit besteht jedoch bezüglich der Abgrenzung zu Stammesgeschichte 41 Abb. 2.11. Homo erectus KNM-ER 3733 Homo habilis und Homo rudolfensis, da die Homo ergaster-Fossilien sich durch zahlreiche Schädelmerkmale deutlich von diesen Arten absetzen. Die ersten Funde von Fossilien des Homo erectus (sensu stricto) wurden bereits Ende des 19. Jahrhundert auf Java gemacht. Seitdem sind dort im Laufe von Jahrzehnten fossile Überreste zahlreicher Individuen geborgen worden. Zu den bedeutenden Fundorten gehören Trinil, Modjokerto und Ngandong. Die Fundstätte, in der die meisten Homo-erectus-Funde gemacht wurden, liegt in der Nähe von Peking. In den Höhlen von Zhoukoudian wurden in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts zahlreiche Kalvarien, Unterkiefer, Zähne und postkraniale Skelettteile entdeckt und geborgen. Leider ist das gesamte Material während des Zweiten Weltkriegs verschollen und heute nur noch durch Abgüsse repräsentiert. Die klassischen Homo-erectus-Funde werden auf ein Alter zwischen ca. 1 Mio. und 350 000 Jahren datiert, ältere Datierungen von Fossilmaterial sind zweifelhaft. Allerdings gibt es in Asien Funde von Steinwerkzeugen, die älter sind und einen indirekten Beweis für die Anwesenheit von Vertretern der Gattung Homo in Asien liefern.10 Am Schädel von Homo erectus fällt der sehr prominente und massive Torus supraorbitalis (= Überaugenwulst) auf (Abb. 2.11), das Neurokranium ist dickwandig und die Hirnschädelkapazität liegt zwischen 850 und 1250 cm³; der Unterkiefer ist robust mit einem fliehenden Kinn. Das postkraniale Skelett ist allgemein recht robust (eine übersichtliche und detaillierte Beschreibung der einzelnen Merkmale von Homo erectus und Homo ergaster geben Henke u. Rothe 1998). 10 Solche alten lithischen Artefakte müssen nun auch vor dem Hintergrund der Entdeckung des Homo georgicus neu interpretiert werden. 42 Evolution des Menschen In den Jahren 1994 bis 1996 wurden in der spanischen Gran Dolina Fossilfunde entdeckt, die von Bermudez de Castro et al. (1997) als Vertreter einer neuen Spezies angesehen werden. Die Fossilien umfassen Überreste von mindestens sechs Individuen, die auf 780 000 Jahre datiert werden. Darunter befinden sich Teile des Gesichtsschädels eines etwa 10 bis 11-jährigen Individuums, das vor allem im Bereich des Mittelgesichtes einige moderne Merkmale aufweist. Andere Merkmale hingegen wirken recht ursprünglich. Aufgrund der Datierung repräsentieren die Fossilfunde unstrittig die zur Zeit ältesten Europäer. Die kranialen und dentalen Merkmale, die sich vom späteren Homo heidelbergensis unterscheiden, haben die Entdecker veranlasst, die Fossilien einer neuen Art Homo antecessor zuzuordnen. Da die Fossilien auch Merkmale aufweisen, die Beziehungen zum Homo ergaster erkennen lassen, vermuten Bermudez de Castro et al. (1997), dass diese neue Art direkt vom Homo ergaster abstammt. Ihrer Ansicht nach entstand der Homo antecessor in Afrika und breitete sich vor etwa 1 Mio. Jahre nach Europa aus. Hier bildete er die Stammart des späteren Homo heidelbergensis, den Bermudez de Castro et al. nur als den Vorfahren des Neandertalers ansehen, während sich in Afrika der Homo sapiens aus dem Homo antecessor entwickelt habe. Nach dieser sehr kontrovers diskutierten Ansicht, kommen sowohl Homo erectus als auch Homo heidelbergensis nicht mehr als direkte Vorfahren des Homo sapiens in Frage. Kritiker wenden unter anderem ein, dass die Merkmale, die vor allem auf der Beschreibung des nicht-erwachsenen Individuums beruhen, kindlich-jugendliche Ausprägungen darstellen, die bei einem erwachsenen Vertreter möglicherweise nicht in dieser Form vorhanden sind. Seit Beginn der 1990er Jahre setzte sich zunehmend die Ansicht durch, dass die mittelpleistozänen homininen Funde in Europa nicht als Unterarten des Homo erectus aufzufassen sind, sondern eine eigene Art bilden, den Homo heidelbergensis. Nach dieser Auffassung gibt es keine homininen Funde aus Europa, die zweifelsfrei dem Homo erectus zugeordnet werden. Daraus folgt, dass letztere Spezies vermutlich über den Nahen Osten nach Asien wanderte, ohne den europäischen Kontinent zu besiedeln. Generell ist es nicht einfach, die europäischen Skelettfunde aus der Zeit zwischen 500 000 und 200 000 Jahren morphologisch vom späten Homo erectus abzugrenzen, da die Übergänge fließend erscheinen. Exemplare des Homo heidelbergensis sind weniger robust als der Homo erectus aber robuster als der moderne Homo sapiens. Oft haben sie noch kräftige Überaugenwülste, eine fliehende Stirn und kein prominentes Kinn. Namen gebend für den Homo heidelbergensis war der Fund eines etwa 500 000 Jahre alten Unterkiefers bei Mauer im Elsenztal nahe Heidelberg aus dem Jahre 1907. Andere bedeutende Funde, die dieser Art zugerechnet werden, sind Fossilien aus Arago in Frankreich, Petralona in Griechenland, Vértesszöllös in Ungarn, Bilzingsleben in Thüringen, Atapuerca in Spanien oder Boxgrove in England. Vor allem die jüngeren dieser Fossilien werden von einigen Anthropologen alternativ auch als archaischer Homo sapiens klassifiziert, doch die Einteilung in archaische und moderne Typen innerhalb einer Spezies ist taxonomisch problematisch. Auch einige mittelpleistozäne Fossilfunde aus Afrika werden heute dem Homo heidelbergensis zugerechnet, dies gilt z. B. für einen etwa 600 000 Jahre alten Teilschädel aus Bodo in Äthiopien. Es wird ver- Stammesgeschichte 43 Abb. 2.12. Klassischer Neandertaler von La-Chapelle-aux-Saints mutet, dass sich der Homo heidelbergensis aus dem Homo ergaster entwickelt hat. Viele Paläoanthropologen halten diese Art für die gemeinsame Stammart des Homo sapiens in Afrika und des Homo neanderthalensis in Europa; besonders die jüngeren Vertreter des Homo heidelbergensis zeigen gewisse Ähnlichkeiten zum späteren Homo neanderthalensis. Eine andere Ansicht ist oben im Zusammenhang mit dem Homo antecessor beschrieben worden. Vor etwa 200 000 bis 30 000 Jahren lebte in ganz Europa der Homo neanderthalensis11. Die frühesten Fossilfunde dieser Menschenart sind morphologisch nicht immer scharf von dem Homo heidelbergensis, der vermuteten Stammart, abzugrenzen. Das vermutete Verbreitungsgebiet der Neandertaler erstreckt sich von Spanien bis Usbekistan und von Norddeutschland bis Israel. Bis zum Nachweis des modernen Homo sapiens vor etwa 40 000 Jahren waren Neandertaler die einzigen menschlichen Bewohner Europas. Die zahlreichen Fossilfunde gestatten es, das unverwechselbare äußere Erscheinungsbild der Neandertaler detailliert zu rekonstruieren. Ihr mittleres Hirnschädelvolumen liegt mit knapp 1600 cm³ deutlich über dem Durchschnittswert des modernen Menschen. Sie hatten langgezogene abgeflachte Schädel mit einem prominenten Mittelgesicht und einer charakteristischen knotenartigen Wölbung des Hinterhaupts (Abb. 2.12). Es wird diskutiert, ob das nach vorne ausgezogene Gesicht eine biologische Anpassung daran ist, dass die Neandertaler ihre Frontzähne offensichtlich 11 Alternativ dazu werden die Neandertaler oft auch als Homo sapiens neanderthalensis bezeich- net, doch die deutliche Abgrenzung gegenüber dem modernen Homo sapiens spricht für die Klassifikation als eigene Art. 44 Evolution des Menschen regelmäßig als „Werkzeuge“ einsetzten. Diese Menschen waren kleiner als moderne Menschen aber sehr viel robuster und kompakter; vor allem die Knochen waren dickwandiger und schwerer. Die Muskelansatzstellen zeigen, dass Neandertaler sehr stark und kräftig waren. Die gedrungene Körpergestalt kann als Anpassung an das eiszeitliche Klima interpretiert werden, weil die damit verbundene Verkleinerung der Körperoberfläche wärmeregulatorische Vorteile bietet. Neandertaler haben offensichtlich ein gefährliches Leben geführt, denn viele Skelette zeigen Knochenbrüche und andere traumatische Veränderungen. Da Homo sapiens und Homo neanderthalensis zumindest eine Zeitlang koexistierten, ist es ausgeschlossen, dass der Neandertaler ein direkter Vorfahr des modernen Menschen ist, doch die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen diesen beiden homininen Spezies werden bis heute sehr kontrovers diskutiert. Die Untersuchungen der mitochondrialen DNA von Neandertalern (Krings et al. 1997, 2000, Ovchinnikov et al. 2000, Schmitz et al. 2002, s. Box 2.3) stützen die Ansicht, dass der Homo neanderthalensis ausstarb, ohne dass er einen Beitrag zum Genpool des modernen Menschen geleistet hat. Dennoch schließen nicht alle Anthropologen aus, dass es während der Zeit der Koexistenz beider Arten in Europa vor 40 000 bis 30 000 Jahren nicht doch zu Vermischungen zwischen ihnen gekommen ist. Die Frage, warum die Neandertaler ausstarben, ist bis heute nicht endgültig beantwortet. Möglicherweise waren die modernen Menschen durch eine effizientere Technologie in der Umweltnutzung überlegen, wodurch sie Überlebensvorteile hatten. Da sich das Verschwinden der Neandertaler über einen Zeitraum von etwa 10 000 Jahren erstreckte, reichten möglicherweise schon eine etwas höhere Geburtenrate und eine geringfügig niedrigere Sterberate des modernen Homo sapiens, um die verwandte Menschenart „auszukonkurrieren“.Seit der Entdeckung der Neandertaler sind diese Menschen oft systematisch als einfältig und minderbegabt diskreditiert worden (Henke u. Rothe 1998), obwohl die archäologischen Befunde belegen, dass sie unter teilweise widrigen Umweltbedingungen über fast 200 000 Jahre erfolgreich in Europa siedelten. Ob die Neandertaler über die Fähigkeit zur sprachlichen Kommunikation verfügten, ist strittig. Durch den Fund eines Zungenbeins bei einem Neandertaler-Skelett aus Kebara in Israel, das mit dem eines modernen Menschen identisch ist, wird geschlossen, dass diese Menschen über alle anatomischen Voraussetzungen für eine verbale Verständigung verfügten. Ein weiteres indirektes Indiz für Sprachfähigkeit liefern Befunde zur intentionellen Bestattung, weil die Bestattung von Toten den Austausch von Gedanken voraussetzt. Ebenfalls kontrovers diskutiert wird die Frage, inwieweit Neandertaler über kulturelle Ausdrucksformen wie Kunst oder Schmuck verfügten. „Flöten“ oder flötenähnliche Artefakte sind von mehreren paläolithischen Fundorten bekannt und können möglicherweise auch Neandertalern zugeordnet werden (Turk et al. 1997). Ein weiteres äußerst umstrittenes Kapitel der Paläoanthropologie ist die Frage, wo und wann der moderne Mensch, der Homo sapiens, entstanden ist. Zwei diametral entgegen gesetzte Hypothesen kennzeichnen die wissenschaftliche Diskussion um den Ursprung des Homo sapiens: die Out-of-Africa-Hypothese und die Multiregionale Hypothese. Für beide Annahmen existieren in der Literatur verschiedene Synonyme. Die Hypothese vom multiregionalen Ursprung Stammesgeschichte 45 Abb. 2.13. Das Out-of-Africa-Modell geht davon aus, dass bereits ansässige Altbevölkerungen von jüngeren, evolvierteren Menschentypen abgelöst wurden, die aus Afrika kommend in Siedlungsgebiete in Eurasien und Australien vordrangen. Eine Kontinuität zwischen älteren und jüngeren Funden in verschiedenen Regionen der Welt wird damit ausgeschlossen. Da die Klassifikation einzelner Funde in Abhängigkeit vom bevorzugten Abstammungsmodell variiert, sind keine Bezeichnungen von Arten oder Unterarten genannt, sondern die Fundorte von Schlüsselfossilien. Im Text sind nicht alle Funde erwähnt, sie können jedoch in geeigneten Lehrbüchern (z. B. Henke u. Rothe 1998) nachgeschlagen werden des modernen Menschen wird häufig auch als Kandelaber-Modell bezeichnet. Die Out-of-Africa-Hypothese wird auch als Arche-Noah-Modell oder replacement-Hypothese bezeichnet. In den Arbeiten, die aufgrund von Untersuchungen der mitochondrialen DNA moderner Bevölkerungen einen monogenetischen Ursprung des modernen Menschen postulieren, also inhaltlich die an Hand anatomisch-morphologischer Merkmale formulierte Out-of-Africa-Hypothese stützen, wird diese Vorstellung oft Eva-Theorie oder Lucky-Mother-Hypothese genannt. Der Out-of-Africa-Hypothese (z. B. Stringer 1995) zufolge ist der moderne Mensch in Afrika entstanden und hat von dort aus andere Regionen der Alten Welt besiedelt und bereits in diesen Gebieten ansässige ältere Menschentypen abgelöst (Abb. 2.13). Die heutige morphologische Vielfalt und die verschiedenen geographischen Populationen wären demnach das Ergebnis einer jungen Differenzierung innerhalb einer polytypischen Spezies. Die vergleichenden Untersuchungen der mtDNA weisen in eine ähnliche Richtung; danach stammen alle 46 Evolution des Menschen Abb. 2.14. Das Kandelabermodell geht von Merkmalskontinuität zwischen älteren und jüngeren Funden in verschiedenen Regionen der Welt aus. Da die Klassifikation einzelner Funde in Abhängigkeit vom bevorzugten Abstammungsmodell variiert, sind keine Bezeichnungen von Arten oder Unterarten genannt, sondern die Fundorte von Schlüsselfossilien. Im Text sind nicht alle Funde erwähnt, sie können jedoch in geeigneten Lehrbüchern (z.B. Henke und Rothe 1998) nachgeschlagen werden rezenten Menschen von einem weiblichen Vorfahren ab, der vor etwa 200 000 Jahren in Afrika gelebt hat (Wilson u. Cann 1995). Nach der Hypothese vom Multiregionalen Ursprung (z.B.Thorne u.Wolpoff 1995) hingegen sind die heutigen Menschen allmählich aus den jeweiligen regionalen Vorgängerpopulationen hervorgegangen. Nach dieser Hypothese weist eine Merkmalskontinuität darauf hin, dass sich die heutigen Bevölkerungen Asiens und Europas direkt aus älteren endemischen Menschenformen der jeweiligen Region entwickelt haben. Die morphologischen Unterschiede zwischen den verschiedenen rezenten menschlichen Bevölkerungen wären also recht alten Ursprungs (vgl. Abb. 2.14). Obwohl die meisten Anthropologen eher der Out-of-Africa-Hypothese zustimmen, ist die Frage noch nicht endgültig geklärt. Die vorhandenen Funde gestatten keine Entscheidung, ob der moderne Mensch, der heute die ganze Erde be- Stammesgeschichte 47 siedelt hat, monozentrischen oder polyzentrischen Ursprungs ist. Für alle, die sich nicht zwischen diesen beiden Extrempositionen entscheiden wollen, bleiben schließlich noch „Zwischenlösungen“. So ist es durchaus möglich, dass aus Afrika in andere Regionen eingewanderte Menschen die dort bereits ansässigen Altbevölkerungen nicht vollständig ablösten, sondern sich mehr oder weniger stark mit ihnen vermischten. Je nach Anzahl von Emigrationsereignissen und Intensität der genetischen Vermischung sind Szenarien zwischen regionaler Kontinuität mit etwas Genfluss und Migration mit weitgehender Ablösung und geringfügiger regionaler Kontinuität denkbar. Zu den typischen Merkmalen des Homo sapiens gehören ein kurzer, hoher Schädel mit einer steilen Stirn, nur schwach ausgeprägte Überaugenbögen, ein prominentes Kinn und ein relativ graziles postkraniales Skelett. Auch beim modernen Homo sapiens sind im diachronen Vergleich morphologische Veränderungen nachweisbar, die einen evolutionären Trend darstellen: Osteologisch ist eine zunehmende Grazilisierung des kranialen und postkranialen Skelettes zu beobachten und die Molaren zeigen eine allgemeine Tendenz, kleiner zu werden. Die ältesten unzweifelhaft modernen Vertreter des Homo sapiens werden heute durch afrikanische Funde repräsentiert. Hier sind z. B. die Funde Omo I und Omo II aus Äthiopien zu nennen, die auf ein Alter von ca. 130 000 Jahren datiert werden. Im Jahre 2003 veröffentlichten White et al. die Analyse neuer Fossilfunde aus Herto in Äthiopien, die sogar auf 160 000 Jahre datiert werden. Die drei gefundenen Schädel zeigen Merkmale, die sie nach Ansicht der Entdecker an die Schwelle zum modernen Menschen stellen. Da die Schädel aber noch nicht ganz in die Variationsbreite des modernen Homo sapiens fallen, haben die Entdecker sie in eine neue Unterart gestellt: Homo sapiens idaltu. Selbst wenn es nicht einhellig akzeptiert wird, diese Funde als neue Unterart zu klassifizieren (Stringer 2003), stützen die Herto-Fossilien zum einen durch ihre Datierung und zum anderen durch ihre Morphologie, die ältere afrikanische Funde mit dem modernen Homo sapiens verbindet, die Out-of-Africa-Hypothese. Die ältesten unstrittigen Homo-sapiens-Funde außerhalb Afrikas stammen aus Israel. Die zu mindestens 11 Individuen gehörenden Skelettreste aus der Qafzeh-Höhle bei Genezareth werden auf ca. 90 000-100 000 Jahre datiert. Auch aus der Skhul-Höhle bei Haifa liegen Fossilfunde von mehreren Individuen vor, die auf etwa 90 000 Jahre datiert werden. Für die Qafzeh-Funde wird vermutet, dass es sich um Bestattungen handelt. In dieser Region ist der Homo sapiens vor dem Homo neanderthalensis nachgewiesen; beide Arten haben über mehrere zehntausend Jahre zeitgleich in derselben Region gelebt. In Europa sind anatomisch moderne Menschen erstmals vor ca. 40 000 Jahren im Fundmaterial nachweisbar. Zu den bekanntesten Skelettfunden gehören die Skelettreste aus Cro-Magnon in Frankreich, die Namen gebend waren für den ersten modernen Menschentyp und seine Kultur in Europa. Vergleichende Untersuchungen der europäischen Funde haben ergeben, dass diese Menschen ein sehr heterogenes Erscheinungsbild aufwiesen (Henke 1992). Bei vielen asiatischen Funden, die in den kritischen Zeitraum der Entstehung des Homo sapiens datiert werden, gestatten die anatomisch-morphologischen Merkmale keine endgültige Entscheidung, ob es sich um späte Vertreter 48 Evolution des Menschen des Homo erectus oder um archaische Sapiens-Formen handelt. Dies gilt beispielsweise für einen vermutlich etwa 200 000 Jahre alten Schädelfund aus Dali in Nordchina. In anderen Fällen wiederum stehen umstrittene Datierungen einer klaren Einordnung entgegen. So werden die Fossilfunde aus Ngandong auf Java zwischen 24 000 und 900 000 Jahre datiert und je nach Datierung und Merkmalsinterpretation als Homo sapiens soloensis (Ngandong liegt am SoloFluss) oder als Homo erectus klassifiziert. Die Kontinente Australien und Amerika sind erst vom modernen Homo sapiens bevölkert worden. Australien wurde vermutlich von Südostasien aus zu einer Zeit besiedelt, als Australien, Tasmanien und Neuguinea eine gemeinsame Landmasse bildeten. Die zwischen diesem Kontinent und dem heutigen Indonesien liegenden Inseln boten die Möglichkeit, den fünften Kontinent durch „Island-hopping“ auf dem Seeweg zu besiedeln. Vermutlich erreichten die ersten Menschen Australien vor etwa 50 000 bis 60 000 Jahren. Insgesamt liegen nicht viele aufschlussreiche Fossilfunde aus Australien vor. Einem auf etwa 25 000 bis 30 000 Jahre datierten Schädel aus Willandra Lake kommt insofern Bedeutung zu, als er von den Vertretern der Multiregionalen Hypothese als Bindeglied zwischen dem javanischen Ngandong-Fossil und den rezenten Aborigines betrachtet wird. Insgesamt zeigt das spärliche Fundmaterial Australiens eine bemerkenswerte Variabilität, so dass auch eine mehrfache Besiedlung zu diskutieren ist. Der amerikanische Kontinent wurde vermutlich über die Bering-Landbrücke zwischen Sibirien und Alaska besiedelt, die während der Eiszeit, als große Wassermassen in den Gletschern gebunden waren, trocken lag. Eine Besiedlung auf diesem Wege war ungefähr vor 26 000 – 11 000 Jahren möglich. Skelettfunde, die Aufschluss über die frühen Einwanderer aus Asien liefern könnten, fehlen leider weitgehend. Den ersten sicheren archäologischen Nachweis menschlicher Besiedlung stellt die Clovis-Kultur dar, die auf etwa 11 000 Jahre datiert wird. Obwohl vielfach vermutet wird, dass Amerika schon vor 20 000 oder sogar 30 000 Jahren von den ersten Menschen besiedelt wurde, sind sicher datierte archäologische Funde spärlich. Hinweise gibt es von einer Fundstätte bei Meadowcroft in Pennsylvania, wo ein Artefakt auf knapp 20 000 Jahre datiert wurde. Möglicherweise ältere Hinweise auf menschliche Besiedlung stammen aus Monte Verde in Chile und der Pendejo-Höhle in New Mexico, doch die wenigen Funde sind in ihrer Datierung und Interpretation umstritten. TIPP: Wer in der Paläoanthropologie auf dem Laufenden bleiben möchte und sich über neue Funde informieren möchte, findet im Internet gute, wissenschaftlich einwandfreie Seiten. Drei Adressen sollen hier exemplarisch genannt sein: http://www.talkorigins.org http://www.becominghuman.org http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins Es ist jedoch anzumerken, dass es für umfassende Informationen immer noch erforderlich ist, die Originalarbeiten zu lesen. Stammesgeschichte 49 2.2.7 Hominisationsszenarien Das anthropologische Erkenntnisinteresse beschränkt sich nicht allein darauf, fossile Hominini-Arten zu entdecken, ihre morphologischen Merkmale zu analysieren und zu beschreiben und anschließend die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen ihnen und zum modernen Homo sapiens zu rekonstruieren. Von besonderem Interesse ist die Frage nach dem Ursprung spezifisch menschlicher Eigenschaften (s. auch Kap. 2.1) wie z. B. die Komplexität sozialer Strukturen, das Ausmaß der Kulturfähigkeit, die symbolbegriffliche Lautsprache, der Grad der Erkenntnisfähigkeit oder die Vergegenwärtigung künftiger Bedürfnislagen, also ein Zeitverständnis (Bischof 1985, Markl 1986, Casimir 1994, Lethmate 1994, Vollmer 1994). Auch wenn aus biologischer Sicht Wissenschaft, Philosophie, Religion, Kunst und Moral eher Nebenprodukte der Evolution des Menschen sind (Vollmer 1994), muss die Anthropologie Antworten auf die Frage suchen, welche Wechselwirkungen zwischen pliound pleistozäner Umwelt und den Vorfahren des Homo sapiens für eine Gehirnentwicklung verantwortlich waren, die in einem Intellekt resultierte, der den rezenten Homo sapiens zu solchen Leistungen befähigt. Einen Überblick über die wichtigsten bisherigen Modelle zur Rekonstruktion des Menschwerdungsprozesses sowie Aspekte der Kritik gibt Tabelle 2.5. Sie zeigt, dass viele Annahmen im Laufe der Zeit revidiert werden mussten, weil sie sich durch neuere widersprechende Erkenntnisse als Fehlinterpretationen erwiesen haben. Außerdem wird deutlich, dass Kritik auf unterschiedlichen Ebenen ansetzt, was im Folgenden anhand einiger Beispiele näher erläutert wird. Generell zeigen die in Tabelle 2.5 zusammengestellten Modelle ein deutliches Übergewicht von Hypothesen, bei denen die Benutzung von Werkzeugen direkt oder indirekt als Schlüsselanpassung auf dem Wege zur Menschwerdung angesehen wird. Der instrumentellen Intelligenz wird häufig eine so große Bedeutung beigemessen, dass das Fehlen des Nachweises lithischer Artefakte durch die hypothetische Benutzung anderer Werkzeuge z. B. oste-odonto-keratische (= gekennzeichnet durch Werkzeuge aus organischem Material, wie Knochen, Zähne und Horn) Kultur- oder Sammelwerkzeuge organischen Ursprungs – wie etwa Grabstöcke – die keine fossilen Spuren hinterlassen, kompensiert wurde. Selbst die zunehmende Bedeutung von Ernährungsstrategien wird in keinem der Szenarien losgelöst von der Werkzeugverwendung betrachtet. Lediglich das von Lovejoy (1981) entwickelte Paarbindungsmodell bildet hier eine Ausnahme, die Benutzung oder Herstellung von Werkzeugen nimmt keine zentrale Funktion mehr ein. Entgegen der Wertschätzung, die der Werkzeugverwendung in den meisten Szenarien beigemessen wird, haben die vielfältigen ethologischen Daten zum primären und sekundären Werkzeuggebrauch im Tierreich diese erheblich relativiert (s. auch Kap. 2.1). Beobachtungen, dass z.B. wildlebende Schimpansen nicht nur vielfältige Werkzeuge benutzen, sondern diese auch zurichten (z. B. Termitenangeln, Blattschwämmchen), und dass Menschenaffen in Gefangenschaft auch sekundären Werkzeuggebrauch erlernen können, machen eine Revision der Bedeutung von Werkzeugbenutzung erforderlich. Wenngleich Die Frau – die Sammlerin d Das Sammeln von Nahrung mit Hilfe von Werkzeugen durch Frauen wird als die entscheidende Verhaltensanpassung in der Evolution des Menschen angesehen: eine Grundlage für soziale Verhaltensweisen (Nahrungsteilung). Die Werkzeuge seien organischen Ursprungs und daher im archäologischen Befund nicht erhalten. – Bedeutung pflanzlicher Nahlung bleibt unklar rung – Nahrungskonkurrenz wird nicht the- – Bedeutung von Ernährungsmatisiert strategien – Überbetonung von Nahrung pflanzli- – Korrektur des männlichen chen Ursprungs Bias – Widersprüche zum verhaltensökologischen Konzept der optimalen Nahrungsnutzung – Selektionsvorteil der Nahrungstei- Die Emanzipationsbewegung der Frauen in den 1970er Jahren führte nach der lange vorherrschenden Überbetonung männlicher Perspektiven zu einem Ausschlag in die andere Richtung: Die männlichen Vorfahren wurden in unbedeutende Rollen gedrängt. Die Vorstellung, dass dem Menschen eine stammesgeschichtlich verankerte Tendenz zum Töten und zur Grausamkeit innewohnt, war beeinflusst von der geistigen Auseinandersetzung mit den Schrecken und Gräueltaten des 2. Weltkriegs. Hominiden sind vermutlich durch andere Beutegreifer zu Tode gekommen) – oste-odonto-keratische Kultur ist archäologisch nicht nachweisbar – keine Der Mensch – der Killeraffe c Variante des Jagdmodells: Aus Häufungen von zertrümmerten Tier- und AustralopithecusSchädeln wurde gefolgert, dass unsere Vorfahren blutrünstige Jäger gewesen seien; da Steinwerkzeuge fehlten, wurde eine oste-odonto-keratische Kultur angenommen. – Fehlinterpretation der Funde (die Der Hintergrund einer patriarchalen Gesellschaft führte zu einer Überbewertung männlicher und einer Unterbewertung weiblicher Funktionen. außerwissenschaftliche Einflüsse Der Mensch (Mann) – der Jäger b – keine stichhaltigen archäologischen – Bedeutung von ErnährungsFakten strategien Weiterentwicklung des Werkzeugherstellermodells: Jagd als innovative Ernährungsstrategie, – Widersprüche zu neueren verhaltens- – Bedeutung von Kooperation ökologischen Befunden und Kommunikation die gleichzeitig eine Basis für vorausschauende Planung, Kooperation und Arbeitsteilung darstellte. nachhaltige Erklärungselemente Überbewertung technologischer Errungenschaften, die vermutlich im Zusammenhang mit der industriellen Revolution in England in der Mitte des 19. Jahrhunderts steht. Gegenargumente Der Mensch – Werkzeughersteller a – Nachweis des zeitlich getrennten Auf- – generelle Bedeutung der intretens der verknüpften Elemente; strumentellen Intelligenz auch Autokatalyse-Modell mit positiven Feed-Backdie Bipedie z. B. entstand lange bevor unabhängig vom Nachweis liMechanismen zwischen vier HauptkomponenSteinwerkzeuge nachgewiesen sind. ten: Reduktion der Eckzähne, Bipedie, Fähigthokultureller Aktivität. keit zur Werkzeugherstellung mit den von der – Ethologische Befunde zur WerkzeugLokomotionsfunktion befreiten Händen, Geherstellung im Tierreich (speziell bei hirnvergrößerung Schimpansen) Hypothese Tabelle 2.5. Die wichtigsten Szenarien zur Menschwerdung in der Reihenfolge ihrer Entstehung. Neben den zentralen Aussagen und den ausgewählten Pround Contraargumenten sind auch außerwissenschaftliche Aspekte erwähnt, die sich aus der Objekt-Subjekt-Identität in der Anthropologie ergeben (verändert nach Schröder 2000) 50 Evolution des Menschen g Das Paarbindungsmodell stammt von Lovejoy (1981). f Das Aasfressermodell beruht auf alternativen Interpretationen der Knochen- und Artefaktansammlungen verschiedener Fundstätten (Binford 1981, Shipman 1985), später wurden auch verhaltensbiologische Untersuchungen an Carnivoren integriert (Blumenshine u. Cavallo 1992). Ansammlungen von Knochen und Zähnen verschiedener Tierarten in Kombination mit lithischen Artefakten aufweisen. Das Modell überbewertet die monogame Kernfamilie, eine typische Erscheinung westlicher Industrienationen. Die soziokulturellen Ursachen patriarchaler Strukturen werden ignoriert Paarbindungs-Modell g – Widersprüche zum soziobiologischen – Anwendung von evolutionsKonzept von Paarungsmustern und verhaltensökologischen Nicht litho-kulturelle Aktivität oder ErnähÜberlegungen rungsstrategien seien Schlüsselanpassungen ge- – Gruppenharmonie kann als Wirkung wesen, sondern eine innovative Paarungsstratevon Gruppenselektion missdeutet – Integration von Paarungsstragie. Die Familiarisierung des Vaters durch die werden tegien in HominisationsmoEntstehung der Monogamie sei zur Steigerung delle des Reproduktionserfolgs erforderlich gewesen. Die Bipedie wird als Anpassung an Nahrungsund Kindertransport angesehen. Gesteigerte Gruppenharmonie und Arbeitsteilung seien die Folge. c Das Modell geht auf Interpretationen der südafrikanischen Im Ursprung geht das Modell bereits auf Darwin (1874) zurück. Es beherrschte bis in die 1950er Jahre hinein die Makapansgat-Funde zurück. Es gewann zusätzliche BedeuVorstellungen von der Menschwerdung. Zu den bedeutentung durch populärwissenschaftliche Veröffentlichungen den späteren Vertretern des Erlärungsmodells gehört Oakley durch Ardrey (1961 a, 1961 b) (1963). d Das Modell geht auf die Anthropologinnen Tanner und b Das Modell ist vor allem in den 1960er Jahren von zahlreiZihlman (Zihlman u. Tanner 1978, Zihlman 1985) zurück. Der wichtige Aspekt des Sammelns von Nahrung ist in chen Wissenschaftlern favorisiert worden. Den Höhepunkt seiner Wertschätzung erreichte es 1965 durch eine Tagung in abgewandelter Form in spätere Vorstellungen eingeflossen. Washington mit dem Titel „Man the hunter“, auf die eine e Das Nahrungsteilungsmodell (Isaac 1978) beruht auf der Publikation gleichen Titels folgte (Lee u. DeVore 1968). Rekonstruktion und Interpretation zweier Fundorte, die Das Modell richtet sich auch gegen die in der Jagdhypothese enthaltene unausgesprochene Annahme, das Sammeln und Verzehren von Aas (Kleptoparasitismus) sei den Vorfahren des Menschen „unwürdig“. Aasfresser-Modell f – Aasfressen als Ernährungsgrundlage – Alternative Erklärung für den ist risikoreich, auch wegen des stark Zweck von Steinwerkzeugen: Alternativ zur Jagdhypothese geht das Modell schwankenden Nahrungsangebots Verarbeitung von Nahrung davon aus, dass die Beschaffung proteinreicher statt Erwerb Nahrung durch die Nutzung von aufgefunde- – Aasfressen kann gesundheitsschädlich sein nen Tierkadavern zur ökologischen Nische der – Erweiterung des Spektrums Hominiden wurde. Die effiziente Zerlegung ermöglicher Nahrungsstrategien folgte mittels Steinwerkzeugen. a Die soziokulturellen Ursachen der ausgeprägten geschlechtstypischen Arbeitsteilung werden möglicherweise unterbewertet. – Das Modell ist eine Verhaltensbe- – gleichzeitige Berücksichtigung schreibung, keine Analyse der Selekpflanzlicher und tierischer tionsvorteile Nahrung bei den Nahrungsstrategien – Das Modell ist eine Projektion von Lebensformen heutiger Wildbeuter- – Einbeziehung von Aspekten gesellschaften auf archaische Bevölder sozialen Organisation kerungen Nahrungsteilungs-Modell e Es beschreibt die Nahrungsteilung innerhalb einer arbeitsteiligen Gesellschaft (Männer jagen, Frauen sammeln). Es entsteht Kooperation als Fundament menschlicher Kulturfähigkeit. Stammesgeschichte 51 52 Evolution des Menschen lithische Geräte nach der derzeitigen Befundsituation nur der Gattung Homo zugeordnet werden können, muss dennoch die vielseitige Werkzeugbenutzung vor allem der Schimpansen in die Betrachtungen einbezogen werden. Diese Primaten verwenden nicht nur eine Vielzahl von Werkzeugen im Zusammenhang mit Techniken der Nahrungsgewinnung sowie zur Körperpflege, sondern zeigen darüber hinaus auch von Population zu Population unterschiedliches Werkzeugverhalten, so dass man von „Kulturtraditionen“ bei Schimpansen sprechen kann. Während früher die Werkzeugbenutzung herangezogen wurde, um die Tier-Mensch-Dichotomie zu untermauern, haben diese und andere neuere Erkenntnisse aus der Primatologie dazu geführt, dass statt der dichotomen Denkweise die enge Verwandtschaft zwischen dem Menschen und den übrigen Primaten, speziell den Menschenaffen, betont wird (Schröder 2000). Die Beobachtungen zum Werkzeuggebrauch gelten heute eher als weiterer Beweis für die große verwandtschaftliche Nähe zwischen Menschen und Menschenaffen; aus dem Nachweis des vielfältigen Umgangs mit Werkzeug bei Schimpansen kann auf eine wichtige Prädisposition für den Prozess der Menschwerdung geschlossen werden. Die Tendenz, der Werkzeugbenutzung eine große Bedeutung für die Menschwerdung beizumessen, gründet sich jedoch nicht allein auf die möglichen kausalen Beziehungen zur Evolution spezifisch menschlicher Eigenschaften, sondern hat auch einen eher pragmatischen Aspekt: Abgesehen von den homininen Fossilfunden selbst, die uns zusätzlich zu anatomischen Informationen indirekt auch Hinweise auf Verhalten geben können (z. B. über funktionsmorphologische Analysen), sind lithische Artefakte im Regelfall die einzigen konkreten und direkten Hinweise auf das Verhalten ausgestorbener Hominini. Dass außerwissenschaftliche Strömungen die Vorstellungen von der Menschwerdung beeinflusst haben, ist bereits von zahlreichen Autoren thematisiert worden (Vogel 1977, Leakey 1981, Shipman 1985, Lewin 1988a, Johanson u. Shreeve 1990, Lethmate 1990, Henke u. Rothe 1994 und 1998) und bildet eine weitere Ebene der Kritik an Hominisationsmodellen. Diese außerwissenschaftlichen Einflüsse haben unsere Vorstellungen von der des Menschen in vielfältiger Weise mit geprägt; sie hängen eng mit der Objekt-Subjekt-Identität zusammen: Ausgehend von subjektiv als besonders menschlich angesehenen Eigenschaften oder Fähigkeiten, wird in der Vergangenheit nach Anhaltspunkten für die Entstehung genau dieser Merkmale gefahndet. Dieses „posthoc-Denken“ (Johanson u. Shreeve 1990) steht dem Verständnis für die Prozesse der menschlichen Vergangenheit entgegen, weil es nicht weiterführt, vom Ergebnis her rückwärts zu denken. Tooby und DeVore (1987) kritisieren nicht nur, dass Eigenschaften moderner Jäger und Sammler, wie etwa Sprache, Nahrungsteilung oder Paarbindungsverhalten, auf einen gemeinsamen Vorfahren von Menschenaffen und Menschen zurück projiziert werden, sondern dass viele Forscher darüber hinaus die menschliche Evolution als einen langen Korridor betrachten, den ein recht intelligenter, Werkzeug benutzender Schimpanse auf der einen Seite be- Stammesgeschichte 53 tritt, während ihn auf der anderen Seite der bereits erwähnte moderne Jäger und Sammler verläßt.12 Die Rekonstruktion von Verhalten ist ein wichtiger Bestandteil von Szenarien zur Menschwerdung: Ernährungsstrategien wie Sammeln, Jagen oder Aasfressen sowie Aspekte des Gemeinschaftslebens wie Nahrungsteilung, Kooperation und Kommunikation basieren auf individuellen Verhaltensweisen, aber die Gegenargumente zu den Hominisationsmodellen (s. Tabelle 2.5) zeigen, dass viele Schwächen und Irrtümer in den Modellen auf Fehlinterpretationen im Bereich des Verhaltens beruhen. Das hypothetische Verhalten des letzten gemeinsamen Vorfahren von Hominini und Panini sowie das Verhalten ausgestorbener Hominini wird typischerweise über den Vergleich mit lebenden nichtmenschlichen Primaten rekonstruiert. Spezifisch menschliche Merkmale werden in das Verhaltensszenario inkorporiert, indem die möglichen ökologischen Bedingungen und die sich daraus ergebenden möglichen Adaptationsvorteile über logisch-plausible Annahmen hergeleitet werden (Potts 1987). Im Allgemeinen werden dabei die Verhaltensmuster einer bestimmten Primatenspezies zugrunde gelegt, die dann als Referenzmodell13 fungiert.Besonders häufig sind Paviane und Schimpansen als Referenzmodell für die Interpretation des Ursprungs menschlichen Verhaltens herangezogen worden (Wrangham 1987). Paviane können aufgrund verhaltensökologischer Gemeinsamkeiten (z. B. terrestrische Lebensweise bei arborealer Lebensweise der Vorfahren) als analoges Referenzmodell betrachtet werden, Schimpansen sind hingegen wegen ihrer großen verwandtschaftlichen Nähe zum Menschen eher als homologes Referenzmodell anzusehen (Kinzey 1987). Obwohl solche Referenzmodelle häufig plausibel sind und zum weiteren Nachdenken anregen, meint Wrangham (1987), dass sie durch die initiale Vermutung limitiert sind, die soziale Organisation unserer Vorfahren sei derjenigen irgendeiner lebenden Spezies ähnlich gewesen. Die plio-pleistozänen Homininen haben aber möglicherweise über Verhaltensanpassungen verfügt, die weder beim heutigen Menschen noch bei den übrigen rezenten Primaten zu finden sind (Potts 1987). Die auf Verhaltensähnlichkeiten und -übereinstimmungen basierenden Referenzmodelle beziehen sich oft auf eine sehr frühe, eher menschenaffenähnliche Evolutionsphase der Hominini, für die nur geringe Unterschiede zwischen Homininen und der jeweiligen Referenzspezies angenommen werden. Damit bleiben viele kritische, die Evolution der Homininen kennzeichnende Transformationen unberücksichtigt. Tooby und DeVore (1987) meinen, dass der Forschungsansatz des Referenzmodells dazu führt, dass die 12 Diese Ansicht wird gut durch das folgende Zitat von Tanner und Zihlman (1976: 587-588) illu- striert: „Living chimpanzees represent the kind of population from which we evolved. Contemporary gathering-hunting peoples provide data on evolved patterns. We can then look at the two ends of the continuum and try to fill in the missing parts.“ 13 Bei einem Referenzmodell wird ein reales Phänomen als Modell für ein anderes reales Phänomen benutzt, das sich einer direkten Erforschung entzieht. Ein Beispiel aus einem anderen Forschungsgebiet ist der pharmakologische oder toxikologische Tierversuch als Modell für eine Medikamentenwirkung beim Menschen, die aus ethischen Gründen nicht direkt untersucht wird (Tooby u. DeVore 1987). 54 Evolution des Menschen zentrale Frage, warum wir Menschen sind und nicht Schimpansen, Bonobos oder Gorillas etc., letztlich unbeantwortet bleibt. Bei Referenzmodellen werden die Ähnlichkeiten zu Lasten der Unterschiede in den Vordergrund gestellt, weil sie keine klare Vorgehensweise bieten, wie Unterschiede zu behandeln sind. Dadurch werden Verhaltensdiskontinuitäten vernachlässigt. Auch die Annahme, dass Schimpansen seit der Aufspaltung der paninen und homininen Linie keine wesentlichen evolutiven Veränderungen erfahren haben, ist problematisch. Schimpansen als „lebende Fossilien“ zu betrachten, bei denen die Merkmalskomplexe des letzten gemeinsamen Vorfahren im Wesentlichen konserviert sind, offenbart eine anthropozentrische Perspektive. Tatsächlich ist die Gattung Pan die einzige unter den Menschenaffen, die in zwei sich in vielen Merkmalen deutlich unterscheidenden Spezies vertreten ist: Pan troglodytes und Pan paniscus, deren Trennung vor etwa 2,5 Mio. Jahren stattgefunden hat (s. Kap. 2.1). Darüber hinaus weisen Schimpansen eine Reihe von Merkmalen auf, die als Autapomorphien14 innerhalb der Hominidae aufzufassen sind, z. B. die soziale Struktur der Sammlungs-Trennungs-Gesellschaft (fusion-fission-society), die enormen anogenitalen Schwellungen östrischer Weibchen oder Penis- und Hodengröße der Männchen. Tooby und DeVore (1987) haben vorgeschlagen, Referenzmodelle durch Konzeptmodelle zu ersetzen. Konzeptmodelle sind keine realen Phänomene, sondern werden deduktiv durch strategische Modellierung auf der Grundlage der modernen Evolutionstheorie und Verhaltensökologie erstellt. Auf diese Weise entsteht gewissermaßen ein Raster, in das vor- und frühmenschliche Verhaltensadaptationen und -innovationen eingeordnet werden können. In einer nicht abschließenden Liste nennen Tooby und DeVore allein 21 hominidentypische Merkmale, die in einem Konzeptmodell berücksichtigt werden sollten. Weiterhin schlagen sie einen ebenfalls nach unten offenen Katalog von 25 evolutionstheoretisch und verhaltensökologisch relevanten Grundsätzen als vorläufige Richtlinien für die strategische Modellierung von Konzeptmodellen vor. Abschließend ist festzuhalten, dass trotz umfangreicher Kenntnisse und vielfältigster Forschungsansätze ein allgemein akzeptiertes, schlüssiges Hominisationsmodell bis heute fehlt. 2.2.8 Die Evolution ausgewählter arttypischer Merkmale Die aktuell diskutierten Hypothesen zur Hominisation lassen eine Reihe von spezifischen Kennzeichen des Menschen erkennen, die als besonders bedeutsam für den Prozess der Menschwerdung gelten.Die meisten der Eigenschaften, die wir als einzigartige Kennzeichen des Homo sapiens ansehen, hängen unmittelbar mit der Entwicklung des menschlichen Gehirns zusammen (s. auch Kap. 2.1), doch Fossilfunde gestatten nur in begrenztem Umfang Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit des Gehirns. Der Grad der zerebralen Organisation 14 Als Autapomorphie bezeichnet man eine evolutionäre Neuerwerbung, die auf eine Stammlinie begrenzt ist. Entgegen dem ursprünglichen Wortsinn (griech. morph: Gestalt) sind alle Merkmale gemeint, nicht nur morphologische Kennzeichen. Stammesgeschichte 55 wird durch die Messung von Hirnschädelkapazitäten nur bedingt reflektiert, und es müssen allometrische Effekte der Körpergröße auf das Schädelvolumen berücksichtigt werden. Dennoch darf man annehmen, dass die enorme Zunahme der Hirnschädelkapazität, welche die Evolution der Homo-Linie kennzeichnet, die Steigerung der intellektuellen Leistungsfähigkeit widerspiegelt. Gleichzeitig ist die Hirnschädelkapazität ein wichtiges Kriterium zur Abgrenzung der Gattung Homo von den übrigen Homininen. Die Frage nach den Gründen dieser außergewöhnlichen Gehirnentwicklung ist das vermutlich wichtigste bislang ungelöste Problem der Hominisationsforschung. Nach der derzeitigen Befundsituation sind Schädelvolumina, die deutlich über den für Australopithecinen und Paranthropinen ermittelten Werten liegen, erst seit etwa 2 Mio. Jahren nachgewiesen. Für die Annahme, dass Homininen mit relativ großen Gehirnen schon früher entstanden sind, fehlt bislang jeglicher direkter Beweis. Als mögliche Ursachen für die zunehmende Cerebralisation werden verschiedene Wechselwirkungen zwischen pleistozäner Umwelt und den in ihr lebenden Hominini diskutiert. Als wichtige Faktoren gelten lithokulturelle Aktivitäten, Änderungen der Ernährung und Veränderungen in der sozialen Umwelt. Die außergewöhnliche Gehirnentwicklung ist vermutlich eher das Ergebnis eines multikausalen Geschehens, als dass eine spezifische Einzelbedingung als Ursache identifiziert werden könnte. Aus der Fülle von Eigenschaften und Merkmalen, deren evolutiver Hintergrund von besonderem Interesse ist, werden im Folgenden einige besonders wichtige herausgegriffen und dargestellt: Bipedie, Werkzeuggebrauch, Ernährung, Wachstum und soziale Organisation. Bipedie Der aufrechte Gang ist ein exklusives Kennzeichen der Homininen (s. auch Kap. 2.1). Die mit dieser neuen Fortbewegungsweise verbundenen anatomischen Veränderungen sind an postkranialen Skelettteilen vieler fossiler Homininenspezies nachweisbar. Darüber hinaus liegt zur bipeden Lokomotion früher Homininen ein Verhaltensfossil vor: die Fußabdrücke von Laetoli in Tansania, die auf etwa 3,8 Mio. Jahre datiert sind und dem Australopithecus afarensis zugeschrieben werden. Wenngleich die grundsätzliche Fähigkeit zur Bipedie beim Australopithecus afarensis und späteren Homininen nicht zu bezweifeln ist, gibt es doch sehr unterschiedliche Ansichten darüber, ob der aufrechte Gang der Australopithecinen bereits dem moderner Menschen entspricht. Während Lovejoy (1988) beispielsweise meint, dass die bipede Lokomotion der Australopithecinen vom Gang des Homo sapiens nicht zu unterscheiden ist, meinen andere (z. B. Susman u. Stern 1983), dass die Australopithecinen noch über eine Reihe ursprünglicher anatomischer Merkmale verfügten, die sie zu einer effizienten arborikolen Lebensweise befähigten. Damit zeigt der skelettäre Lokomotionsapparat der Australopithecinen ein Mosaik plesio- und apomorpher (ursprünglicher und abgeleiteter) Merkmale, aufgrund dessen sie möglicherweise ein ganz eigenes Fortbewegungsmuster aufwiesen, das sich sowohl von der habituellen Bipedie des modernen Men- 56 Evolution des Menschen schen als auch von der Fortbewegungsweise rezenter nichtmenschlicher Primaten unterschied (Henke u. Rothe 1994). Vergleichende Untersuchungen an den Bogengängen des Innenohrs, die eine entscheidende Funktion für den Gleichgewichtssinn und somit für das Lokomotionsmuster haben, konnten zeigen, dass es signifikante Unterschiede in der Architektur des Kanalsystems zwischen verschiedenen Hominoideaspezies gibt (Spoor et al. 1994): Die Konfiguration der Bogengänge im Innenohr bei fossilen Vertretern der Gattung Homo entspricht derjenigen des modernen Menschen, bei den Australopithecinen hingegen sind die Krümmungsverhältnisse sowie die Weiten- und Höhenmaße eher menschenaffenähnlich. Dies ist ein Indiz dafür,dass sie – anders als die späteren Vertreter der Gattung Homo – noch nicht vollständig an die bipede Lokomotion angepasst waren. Über die adaptiven Vorteile der Bipedie gibt es zahlreiche unterschiedliche Hypothesen (s.z.B.Coppens u.Senut 1991,Henke u.Rothe 1998).Die Liste reicht von der Befreiung der Hände von der Fortbewegungsfunktion (z. B. Lovejoy 1981) über die Vergrößerung des Blickfeldes (z. B. Day 1986), die ökonomische Bewältigung langer Wege im Zusammenhang mit der Nahrungsbeschaffung (Shipman 1986) bis zu einer günstigeren Thermoregulation (Wheeler 1993). Da der aufrechte Gang eine Gruppe von Primaten kennzeichnet, die den Übergang von einer arborikolen zu einer (bei einigen fossilen Spezies vielleicht noch nicht ausschließlich) terrestrischen Lebensweise vollzogen hat, ist es plausibel zu vermuten, dass die neue Fortbewegungsart mit dem Bodenleben zusammenhängt. Der Übergang zur terrestrischen Lebensweise kann unterschiedlich erklärt werden; klimaökologische Veränderungen werden ebenso diskutiert wie eine allgemeine Körpergrößensteigerung, die einer arborikolen Lebensweise entgegensteht (Henke u. Rothe 1994). Die Hominiden sind keinesfalls die einzigen Primaten, die im Laufe ihrer Evolution zum Bodenleben übergingen, von etwa 40 ausgestorbenen und lebenden Primatenarten ist bekannt, dass sie durch eine terrestrische Lebensweise gekennzeichnet sind (Napier u. Napier 1967). Der Übergang zum Bodenleben erfordert neue Adaptationen. Dazu gehören Strategien zum Schutz vor Beutegreifern, die Erschließung neuer Ressourcen in veränderten Konkurrenzsituationen sowie eine effiziente Form der Fortbewegung. Die terrestrisch lebenden Primaten weisen unterschiedliche Anpassungen der Lokomotion am Boden auf, so dass die homininen-typische Bipedie nur eine Lösung unter vielen darstellt. Es wird häufig die Meinung vertreten, dass die Bipedie eine Schlüsselanpassung in der Hominisation darstellt (z. B. Sinclair et al.1986, Lethmate 1990). Betrachtet man die Radiation der Homininen, die zu mehreren, teilweise zeitgleich existierenden, aber klar unterscheidbaren Spezies führte, hat diese Annahme einen hohen Erklärungswert, denn trotz vermuteter unterschiedlicher ökologischer Einnischung ist allen Homininen die bipede Lokomotion gemeinsam. Sie muss adaptive Vorteile gehabt haben, auch wenn diese nicht endgültig geklärt sind. Blickt man allerdings auf die Entstehung der Gattung Homo, so ist die Menschwerdung im engeren Sinne nur erklärbar, wenn man von der Existenz zusätzlicher Schlüsselanpassungen ausgeht. Stammesgeschichte 57 Werkzeuggebrauch Wie bereits im Zusammenhang mit Tabelle 2.5 diskutiert, haben Werkzeuge und Werkzeugherstellung oft eine wichtige Rolle in den Erklärungsmodellen zur Menschwerdung gespielt. Zugerichtete Steinwerkzeuge sind offenbar spezifisch für die Homininen, vermutlich sogar nur für die Gattung Homo. Die frühesten Steinwerkzeuge der Olduwan-Industrie (s. auch Box 2.6), die etwa 2,5 Mio. Jahre alt sind, waren einfach und opportunistisch (Leakey 1994). Ein deutlich erkennbarer technologischer Fortschritt in der Werkzeugherstellung ist erst ungefähr 1 Mio. Jahre später mit der sogenannten Acheuléen-Technologie zu verzeichnen. Ob Geröllgeräte der Olduwan-Industrie bereits auf Australopithecinen zurückgehen, ist unklar. Die Bedeutung von Steinwerkzeugen für die Menschwerdung ist strittig: Während Wynn und McGrew (1989) zu dem Ergebnis kommen, dass die frühesten Steinwerkzeughersteller keine größeren intellektuellen Fähigkeiten aufweisen mussten als rezente Menschenaffen haben, meinen Toth (1985) und Leakey (1994), dass Menschenaffen nicht grundsätzlich über alle kognitiven Voraussetzungen verfügen, um Pebble-tools herzustellen. Bisher liegen über die Gehirnkapazität von fossilen Vertretern der Gattung Homo zur Zeit des ersten Nachweises von lithischen Artefakten noch keine Daten vor; die Schätzungen zum Gehirnvolumen der Arten Homo rudolfensis und Homo habilis beziehen sich auf Funde, die auf 1,8 bis 1,9 Mio. Jahre datiert werden, also mindestens eine halbe Million Jahre jünger als die ersten Geröllgeräte sind. Vor diesem Hintergrund läßt sich die Frage nach der Bedeutung von Steinwerkzeugen für die Evolution der Gattung Homo zum jetzigen Zeitpunkt nicht endgültig klären. Davon unabhängig ist jedoch festzuhalten, dass in früheren Hominisationsszenarien die Bedeutung der Werkzeugbenutzung oft überschätzt worden ist. Dies gilt insbesondere für die Vorstellungen über Werkzeugbenutzung bei der Jagd. Die meisten frühen Steinwerkzeuge sind zwar dazu geeignet, tote Tiere zu zerlegen und zu zerteilen, doch sie sind keine effizienten Jagdwerkzeuge. Das von Darwin (1874) vorgeschlagene AutokatalyseModell mit der Reduktion der waffenähnlichen Eckzähne und der Werkzeugbenutzung (s. Tabelle 2.5) ist offenbar lange Zeit unkritisch weitergeführt worden, wobei auch Darwins häufig missverstandene Metapher vom „Kampf“ ums Dasein dazu beigetragen haben mag, dass Werkzeug und Waffen fast immer synonym verwendet wurden und der Einsatz dieser Waffen überproportional in die früheren Vorstellungen von der Menschwerdung eingeflossen ist. Zusammenfassend läßt sich festhalten, dass die instrumentelle Intelligenz des Menschen durch Verhaltensbeobachtungen an rezenten Primaten viel von ihrer ursprünglich vermuteten Exklusivität verloren hat, dass aber dennoch lithokulturelle Aktivitäten als kritisches Element (Henke u. Rothe 1994) im evolutionären Szenarium der Menschwerdung betrachtet werden können. Ernährung Die Ernährung der frühen Hominiden spielt häufig eine wichtige Rolle in den Erklärungsmodellen zur Hominisation, da Fossilfunde und archäologische 58 Evolution des Menschen Fundstücke direkt oder indirekt Rückschlüsse auf die Ernährung gestatten. Die vergleichende Analyse kraniodentaler Merkmale geben Hinweise auf die Art und Zusammensetzung der Nahrung, lithische Artefakte deuten auf die Verwendung von Werkzeug bei der Erschließung bestimmter Nahrungsquellen hin. Schließlich sind Schnittspuren an fundbegleitenden fossilen Säugerknochen ein wichtiges Indiz für die Verwertung tierischer Nahrungsquellen. Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand weisen die Befunde an fossilen Homininen darauf hin, dass die frühen Vertreter der Gattung Homo sich omnivor ernährten. Ergänzende Annahmen darüber, ob diese Homininen die tierischen Nahrungsbestandteile durch jagdliche Aktivitäten selbst erbeuteten, oder ob sie die Kadaver verendeter oder von Carnivoren getöteter Tiere nutzten, lassen sich anhand der oben dargelegten Befunde nicht machen. Auch die Gehirnentwicklung steht in einem wichtigen direkten Zusammenhang zur Ernährung: Das Gehirn ist ein metabolisch aufwendiges Organ. Beim modernen Menschen benötigt es 20 Prozent der Energiezufuhr, obwohl es nur 2 Prozent des Körpergewichts ausmacht (s. auch Kap. 2.1). Daher wird vermutet, dass der Verzehr von Fleisch, das eine konzentrierte, energetisch hochwertige, protein- und fetthaltige Nahrungsquelle darstellt, eine wichtige Voraussetzung für die einsetzende Cerebralisation war (Martin 1983). Andererseits kann man annehmen, dass die adaptiven Vorteile eines größeren Gehirns so groß waren, dass sie die hohen metabolischen Kosten aufwogen. Eine interessante Annahme zur Bedeutung der Ernährung für die Hominisation stammt von Casimir (1994). Er führt aus, dass nur Tiere, die sich omnivor bzw. herbivor-polyphag15 ernähren, die Fähigkeit zur Traditionsbildung haben, die wiederum eine wichtige Voraussetzung für die Evolution der Kulturfähigkeit ist. Während mono- oder oligophage Arten alle Nährstoffe und Energie aus jenen Nahrungssorten beziehen, an die sie adaptiert sind, müssen sich omnivore oder polyphage Spezies – wie z. B. die rezenten Hominidae – eine ausgewogene Diät aus den verschiedensten, sich ergänzenden Energieund Nährstofflieferanten zusammenstellen. Eine unzureichende Nahrungszusammensetzung führt schnell zu Mangelernährung und stellt ein vitales Risiko dar. Speziell bei pflanzlicher Nahrung kommt hinzu, dass auch zwischen verschiedenen Teilen der Nahrungspflanzen differenziert werden muss, wenn beispielsweise die Blätter einer Pflanze nahrhaft, ihre Früchte hingegen giftig sind. Diese Probleme, die ein omnivores oder herbivor-polyphages Verhalten mit sich bringt, bedingen, dass einerseits viele Informationen tradiert werden müssen und andererseits auch die Fähigkeit zum Diskriminationslernen ausgeprägt sein muss. Darüber hinaus bietet diese Ernährung zahlreiche Optionen für die Entwicklung von Techniken zur Nahrungsgewinnung, einschließlich eines vielfältigen Gebrauchs von Werkzeugen. Da neben dem omnivoren modernen Homo sapiens auch die übrigen rezenten Vertreter der Hominoidea omnivor bzw. polyphag-herbivor sind, kann man auch aus dieser Perspektive annehmen, dass unsere Vorfahren sich ent15 Im Gegensatz zur omnivoren Ernährung, bei der Nahrung pflanzlichen und tierischen Ursprungs verzehrt wird, bezeichnet man mit dem Begriff herbivor-polyphag eine Ernährung, die ein breites Spektrum von Nahrungsstoffen pflanzlichen Ursprungs nutzt. Stammesgeschichte 59 sprechend vielseitig ernährten und somit über eine wichtige Prädisposition für die Kulturevolution verfügten. Wachstum Innerhalb der Plazentalia gibt es zum einen Ordnungen, deren Jungtiere klein und wenig entwickelt (altrizial) zur Welt kommen (etwa Carnivora oder Insectivora), zum anderen gibt es Ordnungen, deren Jungtiere relativ groß und gut entwickelt geboren werden. Zu der letzten Gruppe gehören beispielsweise Huftiere, Elefanten, Wale und Primaten (Martin 1992a). Innerhalb der Primaten nimmt der Mensch hinsichtlich des Reifestadiums des Nachwuchses bei der Geburt eine Sonderstellung ein: Menschliche Säuglinge sind im Vergleich zu Menschenaffenbabys hilfloser und unreifer, sie weisen eine sekundäre Altrizialität auf (s. auch Kap. 2.1). Die Ursache für dieses Phänomen liegt in einer Kombination von zwei humanspezifischen Merkmalen: dem großen Gehirn und dem an den aufrechten Gang angepassten Becken. Die Öffnung des Geburtskanals konnte mit der evolutiven Gehirnvergrößerung nur begrenzt Schritt halten, sie setzt der Gehirngröße der Neugeborenen eine natürliche Grenze. Im Gegensatz zu den übrigen Primaten ist der Geburtsvorgang beim Menschen für Mutter und Kind überaus anstrengend und mit einem vitalen Risiko verbunden; er ist so außergewöhnlich belastend, dass die Gebärende in allen Kulturen geburtshilflich unterstützt wird (Meissner 1993). Die durchschnittliche Gehirngröße eines menschlichen Neugeborenen beträgt mit etwa 385 cm³ nur etwas mehr als 25 Prozent der Gehirngröße eines Erwachsenen (1350 cm³). Bei Menschenaffen hingegen hat das Gehirn eines Neonatus bereits ca. 50 Prozent der Größe eines ausgewachsenen Gehirns, das im Mittel ca. 400 cm³ erreicht (Leakey 1994). Da die Gehirnschädelkapazität früher Homininen kaum größer war als die rezenter Menschenaffen, wird das Größenverhältnis vom Neugeborenengehirn zum Erwachsenengehirn vermutlich menschenaffenähnlich gewesen sein. Extrapoliert man diese Relation, so muss im Laufe der Gehirnevolution ein kritischer Punkt erreicht gewesen sein, als die Schädelkapazität eines Erwachsenen etwa 770 cm3 betrug. Dieser Wert beträgt das Doppelte der Gehirngröße eines heutigen menschlichen Neugeborenen. Eine weitere Steigerung der Gehirngröße während des pränatalen Wachstumsabschnitts war danach nicht mehr möglich. Diese Verhältnisse lagen z. B. beim Homo rudolfensis (KNM-ER 1470) vor, für den eine Hirnschädelkapazität von 775 cm³ ermittelt wurde (Leakey 1994). Einen weiteren Hinweis auf die Veränderungen des Wachstumsmusters im Laufe der Hominisation liefert das postkraniale Skelett des Fundes KNM-WT 15000. Messungen am rekonstruierten Becken lassen darauf schließen, dass der Geburtskanal beim Homo ergaster zwar enger war als beim rezenten Homo sapiens, jedoch eine ungefähre Gehirngröße von 275 cm³ beim Neonatus gestattete (Walker u. Leakey 1993, Leakey 1994). Daraus folgt, dass sich die Gehirngröße beim Homo ergaster im Verlauf der Individualentwicklung verdreifachen musste: ein deutlicher Unterschied zur Relation bei Menschenaffen. 60 Evolution des Menschen Ein menschliches Neugeborenes holt seinen „Rückstand“ in der Gehirnentwicklung allerdings enorm schnell auf: Bereits mit 5 Jahren hat ein Kind 90 Prozent und mit 10 Jahren 95 Prozent des erwachsenen Gehirngewichts erreicht (Tanner 1992). Jolicoeur et al. (1988) geben sogar an, dass das Gehirnwachstum bereits mit 6,0 Jahren bei Jungen bzw. 6,4 Jahren bei Mädchen beendet sein kann. Demgegenüber zeigt das allgemeine körperliche Wachstum (s. auch Kap. 4.1) einen völlig anderen Verlauf, der vor allem durch den zweiten Wachstumsschub auffällt (Tanner 1992). Abgesehen davon, dass das körperliche Wachstum des menschlichen Kindes langsamer verläuft und länger dauert als bei allen rezenten Menschenaffen, ist möglicherweise auch dieser pubertäre Wachstumsschub, während dessen eine Körperhöhenzunahme von bis zu 10 cm jährlich erreicht wird, ein weiteres Unterscheidungskriterium. Während Bogin (1988, 1993) meint, dass es sich bei dem pubertären Wachstumsschub in der menschlichen Individualentwicklung um ein autapomorphes Merkmal handelt, das den Menschen ebenso charakterisiert wie die Bipedie oder das große Gehirn, meinen Tanner et al. (1990), Leigh und Shea (1995) und Leigh (1996), dass auch bei anderen Primatenspezies solche Wachstumsschübe existieren. Unabhängig von dieser noch nicht endgültig geklärten Frage ist zumindest das späte Auftreten des Wachstumsschubs beim Menschen als ein besonderes Merkmal des Menschen zu betrachten. Leigh (1996) kommt zu dem Ergebnis, dass trotz der unterschiedlichen Angaben darüber, wann genau das Wachstum des Gehirns beendet ist, zumindest festzustellen ist, dass zwischen der Beendigung des Gehirnwachstums und dem späten Beginn des Wachstumsschubs eine erhebliche zeitliche Lücke besteht. Diese zusätzliche Phase in der Individualentwicklung des Menschen bedarf einer evolutionären Erklärung. Eine viel diskutierte Hypothese (Tanner 1978, Bogin 1988, Leakey 1994, Leigh 1996) besagt, dass dieser zusätzliche Abschnitt in der Individualentwicklung erforderlich ist, um im weiteren Sinne kulturelles und soziales Verhalten zu erlernen und zu trainieren, das beim Menschen eine offenkundig größere Bedeutung hat als bei den übrigen Primaten. Soziale Organisation Obwohl Aspekte der sozialen Struktur und Organisation in mehreren Hominisationsmodellen (s. Tabelle 2.5) eine zentrale Rolle spielen, wird die soziale Organisation selbst häufig nicht als Ergebnis eines Evolutionsprozesses betrachtet. Im Mittelpunkt des Jagdmodells beispielsweise stehen gemeinschaftlich jagende, miteinander kooperierende und kommunizierende Männer als vorgegebenes Element der sozialen Organisationsform früher Homininen, ohne dass erklärt wird, wo diese Männerbünde ihren Ursprung haben. Dabei stellt die Bildung von männlichen Allianzen innerhalb einer gemischt geschlechtlichen Gruppe im Spektrum der sozialen Organisationsformen der Primaten eine seltene Ausnahme dar. Auch das Nahrungsteilungsmodell stellt einen kooperierenden Sozialverband in den Mittelpunkt, ohne die evolutionsbiologischen Wurzeln dieser Form des Soziallebens zu thematisieren. Das Paarbindungsmodell schließlich ist das einzige der in Tabelle 2.5 dargestellten Szenarien, das versucht, Aspekte des Reproduktions- und Paarungs- Stammesgeschichte 61 verhaltens in eine evolutionsökologische Betrachtung zu integrieren. Das Modell ist zwar heftig umstritten und wird von zahlreichen Wissenschaftlern (Hill 1982, Tooby u. DeVore 1987, Lethmate 1990, Henke u. Rothe 1994, Leakey 1994) als fehlerhaft betrachtet, weil es mit wichtigen Bausteinen eines verhaltensökologischen Konzepts nicht kompatibel ist, doch es stellt einen wichtigen Fortschritt innerhalb der Modelle dar. Erstmals wurden grundlegende biologische und nicht kulturelle Aspekte in den Vordergrund gestellt. Lovejoy (1981) betrachtet eine Veränderung der Paarungsstrategie in einer frühen Hominisationsphase als wichtige Schlüsselanpassung. Er vermutet, dass sich – ausgehend von einem schimpansenähnlichen Muster des Fortpflanzungsverhaltens – individualisierte monogame Partnerbindungen entwickelt hätten. Den reproduktionsbiologischen Vorteil sieht er in einer höheren Vaterschaftssicherheit und dem damit verbundenen höheren Fürsorgeaufwand durch die Väter. So hätten sich die Geburtenabstände verringern können. Auch die Entstehung der Bipedie sieht Lovejoy in einem engen Zusammenhang mit dem veränderten Reproduktionsverhalten: Bei terrestrischer Lebensweise wird es für Mütter einfacher, den Nachwuchs zu tragen und gleichzeitig ein älteres Kind zu führen, und für Väter wird es erleichtert, die Nahrung für die Familie herbeizuschaffen. Neben einem offensichtlichen Einfluss außerwissenschaftlicher Strömungen (s. auch Tabelle 2.5), wie beispielsweise die unzulässige Verallgemeinerung der monogamen Kernfamilie westlicher Industrienationen (Cann u. Wilson 1982, Wolfe 1991) sprechen vor allem auch verhaltensökologische Aspekte gegen diese Annahmen zur Hominisation: Der durch die Fossilfunde bekannte Sexualdimorphismus der Homininen spricht gegen das Monogamie-Modell, denn bei den übrigen Primaten ist Monogamie stets damit verbunden, dass männliche und weibliche Individuen annähernd gleich groß sind. Außerdem liefert das Paarbindungsmodell keine Erklärung dafür, warum und wann sich die nahrungsteilenden, kooperierenden, monogamen Kernfamilien zu jenen übergeordneten Gemeinschaften zusammengeschlossen haben, welche die soziale Organisation moderner Menschen kennzeichnet (Schröder 2000). Tooby und DeVore (1987) bemängeln ferner, dass Lovejoy Paarungsmuster wie unabhängige Determinanten behandelt, statt sie wie Variablen zu behandeln, die von anderen ökologischen Faktoren abhängen. Ein Hominsationsmodell muss also berücksichtigen, dass auch die soziale Organisation des Menschen ein einzigartiges, speziestypisches Merkmal ist. Bei unseren nächsten Verwandten finden wir: • • • • territoriale monogame Paare mit ihrem subadulten Nachwuchs (Hylobatidae), solitäre Lebensweise mit polygamem Paarungsmuster (Pongo pygmaeus), aus meist einem voll erwachsenen Männchen und mehreren Weibchen sowie dem subadulten Nachwuchs bestehende Familiengruppen mit polygynmonandrischem Paarungsmuster (Gorilla gorilla), Sammlungs-/Trennungsgesellschaften aus vielen Weibchen und vielen miteinander verwandten Männchen mit einem promisken Paarungsmuster (Pan troglodytes). 62 Evolution des Menschen Keines dieser Muster ist geeignet, die soziale Struktur und Organisation des Menschen zu beschreiben (Schröder, 1992, 1995, 2000). Der Mensch lebt in (serieller) Monogamie oder mäßiger fakultativer Polygamie und bildet auf dieser Basis reproduktive Einheiten (Familien), die in übergeordnete soziale Gemeinschaften integriert sind, die durch ein außergewöhnliches Maß sozialer Kontakte und Interaktionen gekennzeichnet sind. Diese sozialen Kennzeichen der verschiedenen Hominidae-Arten sind das Ergebnis von evolutionären Prozessen, bei denen die Individualinteressen (Schutz vor Beutegreifern, optimale Ernährung und Reproduktion) unter verschiedenen ökologischen Rahmenbedingungen zu unterschiedlich strukturierten sozialen Gruppen geführt haben. Die Evolution sozialer Lebensformen ist häufig – nicht nur mit Blick auf die Hominisation – mit einem effizienteren Nahrungserwerb in Verbindung gebracht worden. Leakey (1994) beispielsweise, der von der Annahme ausgeht, dass der Prozess der Menschwerdung durch eine immer stärker werdende Kooperation zwischen Männern gekennzeichnet ist, nennt als mögliche Ursache für diese offenbar evolutionsbiologisch vorteilhafte Veränderung des Sozialverhaltens die Ernährung mit Fleisch als eiweißreicher, energetisch hochwertiger Nahrung. Möglicherweise jedoch ist die Bedeutung sozialer Strategien des Nahrungserwerbs für die Evolution von Sozialstrukturen bisher überschätzt worden. Für die kooperativ jagenden Löwen haben Packer (1986) sowie Packer u. Rutton (1988) beispielsweise anhand von Modellberechnungen und alternativen Szenarien gezeigt, dass bei diesen Großkatzen die kooperative Jagd ein eher unwahrscheinlicher Motor der Evolution der Sozialität ist. Dennoch wird immer noch häufig das Argument angeführt, soziale Strategien hätten im Laufe der Menschwerdung zu einem effizienteren Nahrungserwerb geführt.Unabhängig von der Frage,ob die Evolution neuer sozialer Verhaltensweisen tatsächlich auf Anforderungen im Bereich des Nahrungserwerbs zurückgeführt werden kann, ist jedoch festzuhalten, dass die „übertriebene Sozialität“ (Lewin 1987) des Menschen nur unter ökologischen Bedingungen entstehen konnte, bei denen das Nahrungsangebot hinreichend große Gruppen auf Dauer zuließ, denn die Verfügbarkeit und Beschaffenheit von Nahrung (ihre zeitliche und räumliche Verteilung, ihr relativer Energiegehalt usw.) bestimmen ganz maßgeblich die Gruppengröße (Schröder 2000). Aspekte der sozialen Organisation in ein Hominisationsmodell zu integrieren, ist jedoch nicht allein deshalb erforderlich, weil das soziale Organisationsmuster des Menschen ungewöhnlich ist, sondern weil darüber hinaus die sapiensspezifische Gehirnentwicklung ursächlich mit der Evolution der Sozialität des Menschen in Verbindung gebracht werden kann. Überlegungen dieser Art basieren auf der Annahme, dass die Intelligenz der Primaten ganz allgemein eine soziale Funktion hat (Humphrey 1976). Viele Anthropologen (z. B. Lovejoy 1981, Alexander 1989, Johanson u. Shreeve 1990, Leakey 1994) sind der Ansicht, dass entscheidende Abschnitte in der Hominisation mit Veränderungen der sozialen Organisation eng zusammenhängen. Holloway (1975), der sich besonders mit Messungen der Hirnschädelkapazität von Hominiden befasst hat, ist zu der Überzeugung gelangt, dass Verhaltensanpassungen, die der sozialen Kontrolle dienen, einen wesentlich bedeutsameren Einfluss auf die Stammesgeschichte 63 Cerebralisation hatten als beispielsweise die durch lithische Geräte indizierten instrumentellen Fähigkeiten. Zusammenfassend ist festhalten, dass die Homininen aufgrund von Prädispositionen seit Beginn ihrer Evolution höchst soziale Wesen sind, so dass jeder Versuch, die Evolution des Menschen zu verstehen, unvollständig bleibt, wenn nicht soziale Aspekte berücksichtigt werden. Zusammenfassung Kapitel 2.2 Stammesgeschichte n Die Rekonstruktion der menschlichen Stammesgeschichte ist ein Forschungsfeld, in dem Erkenntnisse aus vielen Teildisziplinen der Natur- und Kulturwissenschaften integriert werden. Die wichtigste Säule ist die Paläoanthropologie,welche sich mit der Analyse von Fossilfunden befasst. n Je nach taxonomischer Zuordnung der homininen Fossilien werden heute bis zu acht Gattungen mit mehr als zwanzig Arten unterschieden. n In Bezug auf den Hominsationsprozess muss die Anthropologie Antworten auf die Frage suchen, welche Wechselwirkungen zwischen den Vorfahren des Menschen und seiner Umwelt für die Entwicklung spezifischer Merkmale des Homo sapiens verantwortlich waren. n Wesentliche Merkmale, welche als adaptive Antworten auf verschiedene Selektionsdrücke aufgefasst werden müssen,betreffen die obligatorische Bipedie, den hochentwickelten Werkzeuggebrauch, die Ernährung, das Wachstumsmuster und vor allem auch die soziale Organisation des modernen Menschen. 64 Evolution des Menschen 2.3 Prähistorische Anthropologie 2.3.1 Aufgaben und Ziele Mit dem Auftreten des anatomisch modernen Menschen (Homo sapiens) am Übergang des Mittel- zum Jungpaläolithikum vor ca. 40 000 Jahren entfaltet sich die jungpaläolithische Kultur, welche nicht nur deutlich differenzierter erscheint als jene der vorangegangenen Wildbeuterkulturen (Henke u. Rothe 1998),sondern auch eine zunehmende Beschleunigung in Bezug auf ihre weitere Diversifikation erfährt. Dies kann z. B. anhand der klassischen epipaläolithischen Sequenz Südwestfrankreichs gezeigt werden: Auf das Aurignacien (40 000 –28 000 BP = before present) folgte das Gravettien (28 000–21 000 BP), das Solutréen (21 000–16 500 BP) und schließlich das Magdalénien (16 500–11 000 BP). Regional sind diese Kulturstufen wiederum in Subkulturen mit spezifischen Charakteristika untergliedert (Hoffmann 1999, Klein 1999). Kennzeichnend für diese jungpaläolithischen Kulturen sind: • Die zunehmende Komplexität der Steinwerkzeuge sowie die Bearbeitung auch von Knochen, Elfenbein und Geweih zur Werkzeugherstellung (Abb. 2.15). Abb. 2.15 a,b. Knochenartefakte: a knöcherner Angelhaken aus Schleswig-Holstein, mesolithisch, Originallänge 8,5 cm; b Harpune aus Rentiergeweih, Schleswig-Holstein, frühneolithisch, erhaltene Länge 26,5 cm. Zeichnung: M. Schulz (nach Probst 1991) Prähistorische Anthropologie • • • • • 65 Harpunen und Angelhaken belegen die Erweiterung des Nahrungsspektrums auf aquatische Ressourcen. Durch die Entwicklung von Fernwaffen wie Pfeil und Bogen (ca. 20 000 BP) und Speerschleudern (ca. 14 000 BP) konnten auch potentiell gefährliche Tiere aus einer größeren Distanz erlegt werden. Es ist wahrscheinlich, dass im ausgehenden Jungpaläolithikum (12 000–10 000 BP) bereits diejenige Technologie erreicht worden war, über welche noch historische Wildbeuterpopulationen verfügten. Erstmals wurden auch die klimatisch widrigen Regionen Osteuropas und Nordasiens besiedelt, wozu es einer verbesserten Konstruktion von Unterkünften und adäquater Kleidung bedurfte. Aus dem Gravettien sind mobile Kunstobjekte z. B. in Form von Venus- oder Tierfigurinen bekannt (Abb. 2.16), welche die Funktion eines Fertilitätsoder Totemsymbols oder auch der Verkörperung einer Gottheit gehabt haben könnten. Weltberühmt sind die Höhlenmalereien Südwesteuropas, welche bis zu 31 000 Jahre alt sind (Lorblanchet 2000). Auch bei diesen zum Teil sehr naturalistischen Darstellungen wird davon ausgegangen, dass diese Kunstobjekte nicht um der Kunst willen hergestellt wurden, sondern religiös-zeremoniell motiviert waren. Nicht zuletzt bedarf die Bestattungskultur der besonderen Erwähnung, welche wiederum deutlich fortgeschrittener erscheint als noch im Moustérien (vgl. Kap. 2.2): Mehrfachbestattungen kommen ebenso vor wie Bestattungen mit Grabbeigaben aus Holz, Muscheln oder auch Steinartefakten (Klein 1999). Abb. 2.16. Venusfigurine, „Venus von Willendorf“ aus dem Gravettien, ergraben 1908 in Niederösterreich, Originalhöhe 10,3 cm. Zeichnung: M. Schulz (nach Probst 1991) 66 Evolution des Menschen Abb. 2.17. Skelettfunde aus einer komplexen Bestattungssituation vom Petersberg, Flintsbach am Inn/Oberbayern. Aufgrund einer begrenzten Raumsituation wurden die Grabgruben zum Teil in den anstehenden Felsen eingetieft. Im Vordergrund das Skelett eines Kindes, welches das Skelett eines zuvor bestatteten erwachsenen Individuums stört (mehrheitlich fehlt die linke Körperseite des Erwachsenen). Die zeitliche Abfolge von Bestattungen ist somit aus dem Kontext rekonstruierbar. Im Hintergrund jenseits des Maßstabes verworfene Skelettelemente eines ebenfalls durch Nachbestattung gestörten weiteren erwachsenen Individuums. ©Thomas Meier, München Die zunehmende Zahl archäologischer Fundstätten legt nahe, dass die Menschen im ausgehenden Paläolithikum auch bereits zahlreicher gewesen sind als ihre Vorgänger. Offensichtlich haben die genannten Innovationen ein stärkeres Wachstum der Populationen erlaubt, welche ihre geographische Verbreitung nicht nur auf die bereits genannten kalten Regionen Osteuropas und Nordasiens ausgeweitet hatten: Spätestens vor 40 000 Jahren wurde Australien besiedelt, was trotz des gesunkenen Meeresspiegels als Folge des eiszeitlichen Klimas seegängige Boote oder Flöße erforderte, da noch immer eine Strecke von 80 bis 100 km über das offene Meer bewältigt werden musste. Nur wenig später erreichten die Menschen über die Beringstraße auch den amerikanischen Kontinent. Mit Ausnahme der Antarktis, der entlegenen pazifischen Inseln und erstaunlicherweise auch einiger Mittelmeerinseln hatte somit der anatomisch moderne Mensch zum Ende der letzten Vereisung praktisch den gesamten Globus besiedelt (Roberts 1998). Körperliche Relikte des anatomisch modernen Menschen stellen das Substrat der prähistorischen Anthropologie dar. Mehrheitlich handelt es sich hierbei um die mineralisierten Hartgewebe (Knochen, Zähne) aus Körperbestattungen (Abb. 2.17), Leichenverbrennung (vgl. Box 2.9) oder anderweitiger Manipulation eines Leichnams, welche im Zuge archäologischer Ausgrabungen aufgedeckt werden. Zahlenmäßig weitaus geringer ist die Überlieferung konservierter Weichgewebe bei Mumien (nach intendierter oder natürlicher Mumifikation) und bei Moorleichen. Im weiteren Sinne sind auch Überreste von Fäkalien in Prähistorische Anthropologie 67 Form von historischen Latrinenverfüllungen oder konservierter, einzeln abgesetzter Fäkalreste (Koprolithen) zu diesen körperlichen Relikten von Menschen vergangener Epochen zu zählen. Während die Paläoanthropologie sich (s. Kap. 2.2) Fragen nach der Entstehung des anatomisch modernen Menschen widmet, bestehen die Ziele der prähistorischen Anthropologie in der Erschließung der Determinanten menschlicher Bevölkerungsentwicklung in Zeit und Raum sowie einer Vielfalt von Aspekten der Alltagsgeschichtsforschung, soweit diese sich in ihren Ursachen und Folgen biologisch greifen lässt. Die moderne prähistorische Anthropologie versteht sich als Bevölkerungsbiologie von Menschen früherer Zeiten. Denn letztlich stellt die Population die kritische Einheit für eine hinreichende Charakterisierung von Lebensweise, Verhaltensmustern, Krankheitserleben, sozialer Interaktion und Umweltbeziehungen dar, welche unabweisbar im Kontext des jeweiligen Kulturkreises zu sehen ist. Über ein rein historisch-akademisches Interesse hinaus ist, insbesondere vor dem Hintergrund des erforderlichen ethischen Umganges mit diesem Forschungssubstrat, der Gegenwartsbezug prähistorisch-anthropologischer Forschung von hohem Stellenwert. Da Knochen und Zähne sowohl in Bezug auf ihre Struktur als auch in Bezug auf ihren molekularen Aufbau ausgesprochen sensibel auf die Umwelt reagieren, stellen menschliche Skelettfunde eine einzigartige Informationsquelle bezüglich genetischer und physiologischer Anpassung unserer Vorfahren an die Herausforderungen der natürlichen und soziokulturellen Umwelt dar. Im Gegensatz zu vielen Artefakten im archäologischen Fundgut, zu vielen schriftlichen Überlieferungen und auch mündlichen Traditionen sind körperliche Relikte von Menschen eben keine kulturabhängigen, symbolischen Konstrukte. Archäologische Funde von Knochen und Zähnen sind zwar einerseits tote Gewebe, sie stellen aber Gewebebanken dar, welche als empirische Geschichtsquelle die tatsächlichen physischen Interaktionen von Menschen mit ihrer Umwelt retrospektiv erklären können und damit eine Schlüsselrolle im Verständnisprozess dessen spielen, was tatsächlich während der biologischen und kulturellen Evolution unserer Spezies geschehen ist. Das Arbeitsgebiet der prähistorischen Anthropologie setzt zeitlich in der Regel im Jungpaläolithikum ein, spätestens im Mesolithikum (vgl. Box 2.7), und endet in der Neuzeit. Während die Übergänge von der Paläoanthropologie zur prähistorischen Anthropologie somit fließend sind, endet ihr Zuständigkeitsbereich in Abgrenzung zur Rechtsmedizin bzw. forensischen Anthropologie (s. Kap. 5.2) eindeutig mit der jeweils geltenden Verjährungsfrist für Mord bzw.Völkermord. Gelegentlich wird von der prähistorischen Anthropologie eine historische Anthropologie unterschieden, welche sich auf die Erforschung menschlicher Populationen jüngerer Zeithorizonte konzentriert. Ergebnisse biologisch-anthropologischer Forschung stehen aufgrund der Spezifität ihres Substrates niemals isoliert, sondern unabweisbar stets im interdisziplinären Kontext mit den Kulturwissenschaften. Während für die Ur- und Frühgeschichte in der Regel Skelettfunde und Relikte der damaligen Sachkultur ergraben werden und sich die Diskussion daher im Wesentlichen auf die Fachrichtungen Anthropologie und Archäologie beschränkt, stehen für jüngere Zeiträume zunehmend auch literarische und ikonographische Quellen zur Verfügung. Eine Unter- 68 Evolution des Menschen Box 2.7 a Zeitleiste für die Kulturstufen in der Geschichte des anatomisch modernen Menschen in Europa Steinzeit: Bezeichnet den längsten Abschnitt der Geschichte des Homo sapiens, welche durch den Gebrauch von Steinwerkzeugen charakterisiert ist. Sie wird unterteilt in das Paläolithikum (Altsteinzeit), das Mesolithikum (mittlere Steinzeit) und das Neolithikum (Jungsteinzeit). Jungpaläolithikum: 38 000–8000 v. Chr. Diese Zeitspanne umfasst mehrere Kulturstufen und ist maßgeblich von der Kultur des anatomisch modernen Menschen geprägt (vgl. Text). Mesolithikum: 8000–4000 v. Chr. Der Begriff Mesolithikum ist im Wesentlichen auf Europa beschränkt und kennzeichnet den regional zeitlich variablen Übergang von der aneignenden zur produzierenden Lebensweise (vom Jäger/Sammler/Fischer zum Ackerbauern und Viehzüchter). Neolithikum: 8000–2200 v. Chr. Zeitstufe der Entwicklung sesshafter, Ackerbau und Viehzucht treibender Bevölkerungen („Neolithische Revolution“). Der Ursprung der neuen Lebensweise in Europa liegt im „Fruchtbaren Halbmond“ des Zweistromlandes und des südlichen Anatoliens. Europäische Kulturstufen des Neolithikums sind die älteste bäuerliche Kultur der Linienbandkeramik (5500–4500 v. Chr.), gefolgt von der Stichbandkeramik (4900–4500 v. Chr.), der Ertebølle-EllerbeckKultur (5000–4300 v. Chr.), der Rössener Kultur (4600–4300 v. Chr.), der Michelsberger Kultur (4300–3500 v. Chr.), der Trichterbecher-Kultur (4300–2700 v. Chr.), der Kugelamphoren-Kultur (3100–2700 v. Chr.), der Schnurkeramik (2800–2400 v. Chr.) und schließlich der endneolithischen Glockenbecherkultur (2500–2200 v. Chr.; s. Kupferzeit). Charakteristisch für das europäische Neolithikum sind Bestattungen in Seitenlage mit angewinkelten Beinen (Hockbestattung, Schläferstellung). Kupferzeit: bezeichnet das späte Neolithikum zwischen 3500 und 2200 v. Chr. Bronzezeit: 2200–800 v. Chr. Bronze, eine Legierung aus Kupfer und Zinn, wurde zum Werkstoff für zahlreiche Werkzeuge, Waffen, Geräte und auch Schmuckstücke.Anthropologisch-kulturgeschichtlich kann die Bronzezeit weiter unterteilt werden in die frühe Bronzezeit (2300– 1600 v. Chr.: „Hockergräberkultur“ aufgrund der Bestattung der Toten in Seitenlage mit angewinkelten Extremitäten), die mittlere Bronzezeit (1600–1250 v. Chr.: „Hügelgräberkultur“ aufgrund der Beisetzung von Leichnamen ohne oder nach Leichenverbrennung unter Grabhügeln) und die späte Bronzezeit (1250–800 v. Chr.: „Urnenfelderkultur“ Prähistorische Anthropologie 69 Box 2.7. (Fortsetzung) aufgrund der Leichenverbrennung als vorherrschende bis ausschließliche Bestattungsform). Eisenzeit: 800–15 v. Chr. Im metallverarbeitenden Handwerk wird der Rohstoff Bronze durch Eisen ersetzt,welches aus Erzen gewonnen wird und im Gegensatz zur Bronze geschmiedet statt gegossen wird. Es wird unterschieden zwischen der älteren Eisenzeit (800–400 v. Chr., „Hallstattzeit“, benannt nach einem Gräberfeld bei Hallstatt, Nähe Salzburg) und der jüngeren Eisenzeit (400–15 v. Chr.; „Latènezeit“, benannt nach dem Ort La Tène am Neuenburger See). Römerzeit: 15 v. Chr.–400 n. Chr. Große Teile Europas gerieten unter römischen Einfluss und gehörten z.T. zum Imperium Romanum. Leichenverbrennung ist die häufige Bestattungssitte, welche gegen Ende der Römerzeit wieder von Körperbestattungen abgelöst wird. Frühmittelalter: 400–800 n. Chr., bezeichnet im Wesentlichen die Zeitspanne von der Spätantike bis zum Ende der Regierungszeit Karls des Großen. In seinen früheren Phasen ist das Frühmittelalter im Wesentlichen identisch mit der Völkerwanderungszeit. Charakteristisch für das frühe Mittelalter ist die Bestattung in Reihengräberfeldern. Mittelalter: 800–1500 n. Chr. Im Verlaufe des Mittelalters kam es zur Gründung erster Städte, d.h. die bislang fast ausschließlich ländliche Bevölkerung wandelte sich zur urbanen Gesellschaft mit Ausprägung überregionaler Handelsbeziehungen. Neuzeit: Zeitspanne vom 16. Jahrhundert an bis heute. Nach der Renaissance kam es zur Industrialisierung durch Einführung neuer Technologien in Handwerk und Gewerbe. a Die Zeitangaben sind Richtwerte, welche regional variieren können. scheidung zwischen prähistorischer und historischer Anthropologie ist daher inhaltlich erst auf der Interpretationsebene der Befunde relevant (und dort auch unerlässlich), sie betrifft nicht die Arbeitsweise des Anthropologen auf der Ebene der Befunderhebung. Menschen können ohne ihre Kultur nicht verstanden werden. Somit ist das Fach Anthropologie von sich aus interdisziplinär ausgerichtet. Moderne anthropologische Sammlungen sind überwiegend Sammlungen von Skelettfunden, da die sachgerechte Konservierung und Unterbringung von Mumien und Moorleichen spezieller Voraussetzungen bedarf. Die Geschichte der Rekrutierung osteologischen16 Materiales für naturkundliche 16 Osteologie = die Lehre von den Knochen 70 Evolution des Menschen und später naturwissenschaftliche Sammlungen geht Hand in Hand mit der Veränderung inhaltlicher Schwerpunkte dieses Teilgebietes der Anthropologie. Das Studium der menschlichen Anatomie führte gegen Ende des 18. Jahrhunderts zu der Annahme, dass die beobachtete Variabilität eine Schlüsselstellung in der Diskussion um die Ursprünge und die Bedeutung biologischer und kultureller Unterschiede des Menschen einnehmen könne. Nicht zuletzt unter starkem Einfluss der Phrenologie17 wurden daher im 19. Jahrhundert osteologische Sammlungen zusammengetragen, welche überwiegend bis ausschließlich aus Schädeln bestanden. Zu den bekanntesten deutschen Sammlungen gehören die Blumenbach-Sammlung in Göttingen, die Rudolf-Virchow-Sammlung in Berlin und die Alexander-Ecker-Sammlung in Freiburg. Die anthropologische Forschung des 19. Jahrhunderts war typologisch ausgerichtet und hatte die Klassifizierung der Menschen in Kategorien aufgrund ihrer Schädelmorphologie zum Ziel. Diese typologische und kraniometrisch18 orientierte Vorgehensweise hatte letztlich Kontinuität bis in das 20. Jahrhundert und blieb zunächst auch relativ unbeeinflusst von Darwins Evolutionstheorie. Ein weiterer Schwerpunkt anthropologischer Sammlungstätigkeit entsprang dem klinisch-anatomischen Interesse an pathologischen Veränderungen des Skelettes. Somit setzt sich das osteologische Material, das um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert zusammengetragen wurde, vornehmlich aus Schädeln und pathologisch veränderten Skelettelementen zusammen (Walker 2000). In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde damit begonnen, individuelle Skelette mit bekannten biologischen Basisdaten wie Sterbealter und Geschlecht im Kontext mit solchen genetischen oder umweltbedingten Faktoren zu sehen, welche einen Einfluss auf die Gesundheit und die morphologische Variabilität haben. Der typologische Ansatz wurde durch Studien zur Variabilität und deren Ursachen abgelöst, wobei noch immer die Metrik und die statistische Verarbeitung metrischer Daten methodisch ganz im Vordergrund standen. In Bezug auf die Fragestellungen hatte sich jedoch hiermit der Wandel von der Fallstudie zum Populationskonzept bereits vollzogen (s. Box 2.8). Moderne anthropologische Sammlungen konservieren und betreuen die noch vorhandenen Sammlungsbestände des 19. Jahrhunderts, beherbergen darüber hinaus aber überwiegend die Skelettfunde von archäologischen Ausgrabungen, welche gut dokumentiert und in den Kontext des jeweiligen Zeithorizontes eingebettet sind. Ungeachtet der tatsächlichen Anzahl ergrabener Skelette pro Fundort liegen somit Bevölkerungen oder zumindest deren Ausschnitte aus den verschiedenen Zeitstufen, ökologischen und soziokulturellen Umfeldern vor, welche, erleichtert durch technologische, methodische und vor allem auch theoretische Fortschritte, wiederum eine Trendwende in der prähistorischen Anthropologie begünstigt haben. Es wurde der Schritt von der 17 Phrenologie = von dem Wiener Arzt Franz Joseph Gall (1758–1828) begründete Pseudo-Wis- senschaft, der zufolge aus der Form des Schädels auf geistige und seelische Veranlagungen zu schließen sei. (Die frühen Griechen nahmen an, das Zwerchfell – phrenes – sei der Sitz des Verstandes). 18 Kraniometrie = Vermessung des Schädels Prähistorische Anthropologie 71 Box 2.8 Typologie- versus Populationskonzept Das Typologiekonzept (syn. Essentialismus) beruht auf der Annahme, dass die beobachtbare Variabilität der belebten Welt (hier: der Menschen) letztlich aus einer endlichen Zahl von Typen besteht, welche unveränderlich und voneinander scharf zu trennen sind. Dieses prä-Darwinsche Konzept führte u. a. zur Einteilung von Menschen in „Rassen“ (s. Kap. 3.2). Im Populationskonzept sind die individuellen Mitglieder einer Population voneinander verschieden, so dass die Charakterisierung einer Bevölkerung auf statistischen Mittelwerten und deren Streuung beruht, welche somit eine Abstraktion darstellen. Populationen sind im Gegensatz zu Typen nicht statisch,sondern über die Zeit variabel. „Populationsdenken und Populationen sind keine Gesetze, sondern Konzepte. Es ist einer der fundamentalsten Unterschiede zwischen der Biologie und den so genannten exakten Naturwissenschaften, dass Theorien in der Biologie auf Konzepten beruhen, während sie in den physikalischen Wissenschaften auf Naturgesetzen fußen.“ (Mayr 2002). Deskription zur Verhaltensebene vollzogen. Die Entschlüsselung von Aktivitätsmustern, von physiologischem Stress, Ernährung, Fortpflanzung und genetischen Beziehungen liefert einen maßgeblichen Beitrag zur Alltagsgeschichtsforschung. Sie ist damit geeignet, Problemlösungen von Menschen auf der Populationsebene gegenüber den zahlreichen Herausforderungen und Einschränkungen, welche durch die naturräumliche und soziale Umwelt im Alltagsleben auftreten, zu erforschen (Walker 2000). Es ist insbesondere dem Einsatz neuer Techniken zu verdanken, dass Skelettfunde heute bis hin zur molekularen und submolekularen Ebene untersucht werden können, um die relevante Information zur individuellen und kollektiven Lebensgeschichte, welche in Form dieser biologischen Merkmale im Gewebe niedergelegt wurden, zu erschließen. Selbstverständlich wird sich der in der prähistorischen Anthropologie tätige Wissenschaftler nicht auf den rein osteologischen Aspekt seiner Untersuchungen beschränken, sondern die Funde im Zusammenhang mit den für die jeweilige Epoche zusammengetragenen kulturwissenschaftlichen Befunden in Beziehung setzen. Nicht zuletzt muss erwähnt werden, dass moderne anthropologische Sammlungen in zunehmendem Maße von Wissenschaftlern aus der Medizin einschließlich der Zahnmedizin nachgefragt werden. Da archäologische Skelettfunde eines bestimmten Gräberfeldes im Gegensatz zu modernem Sektionsmaterial Populationen repräsentieren, welche sehr viel homogener sowohl in genetischer Hinsicht als auch in Bezug auf ihr Umwelterleben waren, dienen sie als Forschungssubstrat für zahlreiche anatomische, physiologische 72 Evolution des Menschen und kieferorthopädische Fragestellungen (Larsen 1997). In diesem Aspekt liegt ein weiterer wichtiger Gegenwartsbezug prähistorisch-anthropologischen Untersuchungsgutes. 2.3.2 Aufbau und Entwicklung des menschlichen Skelettes, Erhaltungsgrad archäologischer Skelettfunde Knochen und Zähne bestehen – in abnehmender quantitativer Reihenfolge – aus Mineral, Kollagen, Wasser, nicht-kollagenen Proteinen, Fetten, vaskulären Elementen und Zellen (Boskey 1999). Die mineralische Komponente des menschlichen Skelettes einschließlich der Zähne besteht im Wesentlichen aus einem dem geologischen Hydroxylapatit analogen Calcium-Phosphat [Ca10(PO4)6(OH)2]. Gegenüber diesem idealen Hydroxylapatit hat das Knochenmineral jedoch Defizienzen in Bezug auf Calcium und Hydroxylionen und ist ferner durch zahlreiche Substitutionen, hauptsächlich durch Karbonate, gekennzeichnet. Unter diesen überwiegen die Typ B-Karbonate, welche für die Phosphationen substituieren, gegenüber den Typ A-Karbonaten, welche OH-Gruppen ersetzen (Boskey 1999). Art und Menge dieser Substitutionen haben einen Einfluss auf die Löslichkeit des Knochenminerales. Während des Erwachsenenalters nimmt die Karbonatfraktion zu, die Phosphatfraktion hingegen ab, jedoch bleibt die Summe aus Karbonatund Phosphationen im Knochenmineral stets konstant. Die reale Mineralfraktion des menschlichen Skelettes entspricht somit im Wesentlichen der Zusammensetzung Ca8.3(PO4)4.3(CO3)x(HPO4)y(OH)0.3, mit x+y = 1,7 (const.). Die Mineralkristalle besitzen eine hexagonale Symmetrie und eine durchschnittliche Größe von 5 ×5 ×40 nm (Martin et al. 1998). Etwa 90% der organischen Grundsubstanz des Knochens (Osteoid) bestehen aus Kollagen I, einem tripelhelikalen Molekül mit zwei identischen α1(I)und einer α2(I)-Kette (von der Mark 1999). Als Strukturprotein handelt es sich um ein konservatives Molekül, wobei das Divergieren der Ketten in α1(I) und α2(I) vermutlich bereits zum Zeitpunkt der Separation von Invertebraten und Vertebraten einsetzte. Alle drei Ketten besitzen eine zentrale Region von 1014 Aminosäuren, bestehend aus 338 Tripeptiden vom Typ Glycin-X-Y. Rund ein Drittel der Glycin benachbarten Aminosäuren sind Prolin (am C-terminalen Ende), und Hydroxyprolin (am N-terminalen Ende). Das häufige Vorkommen hydroxylierten Prolins dient der Stabilisierung der Tripelhelix und ist typisch für Kollagen I, ebenso die Tatsache, dass ein Drittel aller Positionen mit der kleinsten Aminosäure (Glycin) besetzt wird, wodurch eine besonders enge Windung der Helices gewährleistet ist. Das eigentliche Kollagenmolekül hat eine Länge von ca. 300 nm und einen Durchmesser von 1,25 nm. Im Interstitium lagern sich die Tripelhelices, begünstigt durch die physikalischen Gewebsspannungen, in linear-paralleler Weise zu Fibrillen zusammen, welche mehrere Millimeter Länge und bis zu 500 nm Dicke erreichen können. Bei der Mineralisierung des Knochens orientieren sich die Apatit-Kristalle parallel der Fibrillenachse und stabilisieren damit die Periodizität der organischen Matrix (Lowenstam u. Weiner 1989). Das Kollagengerüst des Knochens besteht Prähistorische Anthropologie 73 jedoch nicht ausschließlich aus Kollagen I, sondern aus Heterofibrillen unter Einschluss von wenigen Prozent Kollagen V. Eingebettet in die mineralische Grundsubstanz und nicht-kollagene Proteine sind diese Heterofibrillen für die einzigartigen biomechanischen Eigenschaften des Knochens (Elastizität, Torsionsresistenz) verantwortlich (von der Mark 1999). Etwa 10% der Knochenproteine sind nicht-kollagene Proteine (non collagenous proteins, NCP), zu unterteilen in mineralgebundene und nicht-mineralgebundene Proteine. Letzte sind im Wesentlichen Serumproteine, die mineralgebundenen NCPs wurden erst in jüngerer Zeit zunehmend identifiziert; ihre Funktion ist noch nicht in allen Fällen aufgeklärt. Aufgrund ihrer Eigenschaften werden die mineralgebundenen NCPs in die drei Gruppen der sauren, z.T. phosphorylierten Glycoproteine, der Proteoglycane und gla(= γ-Carboxyglutamat)-Proteine unterteilt. Während die gla-Proteine wahrscheinlich auf Vertebraten beschränkt sind, spricht die weite Verbreitung der ersten beiden Gruppen im Tierreich für die Vermutung einer basalen Funktion während der Mineralisierung von Geweben (Lowenstam u. Weiner 1989). Das saure Glycoprotein Osteonectin bindet z. B. wie Osteocalcin an Calciumionen, Fibronectin hingegen bindet an Zellen und Kollagen. Somit spielen zahlreiche NCPs eine wichtige Vermittlerrolle bei der strukturellen Organisation von Kollagen und Apatit (Lian u. Stein 1999). Im reifen Skelettelement sind die Kollagenfibrillen vollständig von dem Apatit ummantelt, welcher aufgrund seiner geringen Löslichkeit letztlich dafür verantwortlich ist, dass auch organische Komponenten des Skelettes archäologisch relevante Zeitspannen im Erdreich überdauern und in Bezug auf ihren jeweiligen Informationsgehalt hin untersucht werden können (z. B. werden 14C-Datierungen in der Regel am Knochenkollagen vorgenommen; s. Kap. 2.3.5). Die prozentualen Anteile organischer und anorganischer Grundsubstanz sind in den vier wesentlichen Qualitäten mineralisierter Hartgewebe (Knochen, Zahnschmelz, Dentin, Wurzelzement) in deren reifem Zustand deutlich voneinander verschieden (Tabelle 2.6). Typisch für Zahnschmelz ist z. B., dass die organische Matrix bei der Schmelzreifung zurückgedrängt und durch Mineral ersetzt wird, mit dem Ergebnis, dass reifer Zahnschmelz das am höchsten mineralisierte und damit auch härteste und dauerhafteste Gewebe des menschlichen Körpers ist. Tabelle 2.6. Prozentuale Zusammensetzung der mineralisierten Hartgewebe in Bezug auf die mineralische Komponente und Proteine (Hillson u. Antoine 2003) Knochen Zahnschmelz Dentin Wurzelzement Mineral Kollagen NCP 70 >96 72 70 21 – 18 21 1 0,5 2 1 74 Evolution des Menschen Aufbau und Entwicklung von Knochen Knochengewebe ist mesenchymalen Ursprunges. Für seinen Aufbau, Erhalt, Abbau und seine Anpassung an aktuelle biomechanische Gegebenheiten sind vier Zelltypen verantwortlich: Osteoblasten sind knochenbildende Zellen, welche vermutlich aufgrund mechanischer Reize aus zunächst undifferenzierten Mesenchymzellen, überwiegend aus dem Stroma des Knochenmarkes, entstehen. Ihre charakteristische Zellleistung ist die Produktion von Osteoid, der organischen Knochenmatrix, mit einer Syntheserate von circa 1µm/Tag (Martin et al. 1998, Ducy et al. 2000). Sie synthetisieren Tropo-Kollagen, eine Vorstufe des Kollagen I, welches nach Hydroxylierung der Aminosäureketten in das Interstitium abgegeben wird, wo seine Reifung zum Kollagen und die Fibrillenbildung erfolgt. Durch Produktion von alkalischer Phosphatase wird der geeignete pH-Wert für die nachfolgende Mineralisation eingestellt. Die Synthese zahlreicher NCPs ist ebenfalls eine Leistung der Osteoblasten, ebenso wie die Produktion von Matrixvesikeln zur Akkumulation von Calcium und Phosphat und deren gezielte Abgabe an den Ort der Mineralisation (Lowenstam u. Weiner 1989). Osteoblasten hüllen sich durch die Osteoidbildung und deren nachfolgende Mineralisierung somit selbst ein, was zu deren morphologischer Differenzierung in Osteozyten, die Zellen des reifen Knochens, führt. Sie liegen in Hohlräumen (Lakunen) der mineralisierten Matrix und kommunizieren miteinander über lange Zellprozesse, welche in Tunneln (Canaliculi) verlaufen (Abb. 2.18). Pro mm3 Knochen können bis zu 15 000 Lakunen gezählt werden, die aufgrund ihrer geringen Größe aber lediglich etwa 1% des Knochenvolu- Abb. 2.18. a Schema der mikrostrukturellen Organisation eines kompakten Knochens. Zeichnung: M. Schulz Prähistorische Anthropologie 75 Abb. 2.18. b Histologischer Querschnitt der Oberschenkelkompakta einer frühmittelalterlichen Bestattung. Die Osteone und auch die Osteozytenspalten sind aufgrund des guten Konservierungsgrades sehr gut differenzierbar. Aufnahme im Differentialinterferenzkontrast. Foto: S. Doppler mens ausmachen. Das Netzwerk der Canaliculi bildet dabei die enorme Oberfläche von rund 1200 m2 beim erwachsenen Mann (Martin et al. 1998). Osteozyten halten den Knochenstoffwechsel aufrecht und stehen im Dienst der Reizleitung für mechanische Reize, vermutlich über Änderungen der Strömungssituationen in den Canaliculi. Etwa 90% der Osteoblasten werden jedoch nicht durch das Knochenmineral eingeschlossen wie die späteren Osteozyten, sondern verbleiben als bone lining cells (BLC) auf der Oberfläche neu synthetisierten Knochens liegen. Sie kommunizieren mit den Osteozyten und sind wie diese mechanosensitiv, da sie Knochenbildung bzw. -umbau in Antwort biochemischer oder mechanischer Reize initiieren. Die bone lining cells stellen somit eine Reservepopulation von Zellen dar, welche im Falle raschen Bedarfs die Sezernierung von Osteoid wieder aufnehmen können. Im Gegensatz zu den vorgenannten Zelltypen entstammen die Osteoclasten, knochenresorbierende Zellen, einer Makrophagen-Monozyten-Zelllinie des hämatopoietischen Anteiles des Knochenmarkes (Martin et al. 1998, Lian u. Stein 1999, Teitelbaum 2000, Suda et al. 2001). Diese mehrkernigen Riesenzellen entstehen durch Fusion von mononukleären Vorläuferzellen und produzieren das Enzym Carboanhydrase, welches die unmittelbare Umgebung ei- 76 Evolution des Menschen nes Osteoclasten bis auf einen pH von 4,5 ansäuern kann. Der Knochenabbau erfolgt durch Hydrolyse zunächst des Minerales, dann der organischen Grundsubstanz, und zwar mit einer Rate von mehreren zehn bis zu 100 µm pro Tag. Da ein Osteoclast somit pro Tag potentiell ebenso viel Knochenmasse abbauen kann wie 100 Osteoblasten synthetisiert haben, repräsentieren sie einen recht aggressiven Zelltypus, dessen Evolution plausibel auf die Notwendigkeit zurückzuführen sein dürfte, dass bei Bedarf Mengen- und Spurenelemente des Knochenminerales (Calcium, Magnesium, Zink u. a.) rasch für den Organismus verfügbar gemacht werden müssen. Als stoffwechselintensives Gewebe mit der Fähigkeit, sich im Zusammenspiel von Knochenaufbau und -abbau wechselnden mechanischen Gegebenheiten flexibel anzupassen, unterliegt auch reifer Knochen einem steten Umbau, wodurch pro Jahr etwa 4–5% des kompakten, und bis zu 25% des spongiösen Knochengewebes (s. unten) ausgetauscht und erneuert werden (Delling u. Vogel 1992, Martin et al. 1998). Zu welchem Anteil die lebenslange Umbauaktivität jedoch deterministisch bzw. stochastisch initiiert wird, ist noch nicht geklärt. Der programmierte Zelltod (Apoptose) von Osteoblasten und Osteoclasten, welcher zu einem Überwiegen des Auf- bzw. Abbaues führt, hat sich in jüngerer Zeit als klinisch hoch relevant herausgestellt. Während Östrogene die Apoptose der Osteoclasten stimulieren und somit eine wichtige Rolle bei der Genese der postmenopausalen Osteoporose spielen, wird die Apoptose von Osteoblasten durch einen Überschuss von Glucocorticoiden motiviert und führt zur glucocorticoidinduzierten Osteoporose (Dempster 1999). Mesenchymzellen sind zur Bildung sogenannter Matrixvesikel (s. oben) fähig, rundlicher oder ovoider Strukturen von 0,1–0,2 µm Durchmesser, umgeben von einer Doppelmembran. Die Entdeckung dieser Matrixvesikel hat den Prozess der de-novo-Mineralisierung von Bindegeweben maßgeblich aufgeklärt, da gezeigt werden konnte, dass sie in der Lage sind, Calcium- und Phosphationen in einem solchen Maße zu kondensieren, dass sie als Calciumphosphat präzipitieren. Die Mineralisierung beginnt somit innerhalb dieser Vesikel, nachdem sie von den Mutterzellen in das Interstitium abgegeben wurden. Kristallwachstum führt zur Zerstörung der Vesikel, und diese freigewordenen Kristalle dienen ihrerseits als Nukleationsort für die weitere Proliferation von Mineral (epitaktische Nukleation). In Abhängigkeit von der Bindegewebsqualität, in welcher die Mineralisierung beginnt, werden unterschieden: • • desmale Ossifikation (Verknöcherung membranösen Bindegewebes, „Deckknochen“), peri- und enchondrale Ossifikation (Verknöcherung von Knorpelstrukturen, „Ersatzknochen“) (Scheuer u. Black 2000). Obgleich man dem reifen Knochen seine Genese nicht mehr ansieht, reicht die Diskussion um die Kausalität dieser zwei Ossifikationswege bis zurück in das 19. Jahrhundert. Im menschlichen Skelett entstehen die platten Knochen des Schädeldaches, die flachen Gesichtsknochen, der Unterkiefer und die Schlüsselbeine auf desmalem Wege (vgl. Abb. 2.19). Es wurde daher vorgeschlagen, dass die rascher – da ohne Bildung einer knorpeligen Vorstufe – verlaufende Prähistorische Anthropologie 77 Abb. 2.19. Menschliches Skelett mit anatomischer Bezeichnung der wesentlichen Elemente. Zeichnung: M. Schulz 78 Evolution des Menschen desmale Ossifikation solche Skelettelemente betreffe, welche bereits vom Embryo dringend zum Schutz wichtiger Organe benötigt werden, etwa die Knochen der Schädelkapsel. Mehrheitlich werden jedoch Knochen, welche auf desmalem Wege mineralisieren, als Relikte des Exoskelettes der frühesten Wirbeltiere angesehen. Der Theorie der kausalen Histogenese (Kummer 1963) folgend, ist die desmale Ossifikation letztlich die biomechanische Antwort auf Zugspannungen in elastischen Membranen, die enchondrale Ossifikation dagegen Antwort auf Druck- und Biegebelastungen, denen ein knorpeliges Skelettelement nicht hinreichend standhalten kann. Aufgrund erst in den letzten Jahren nachgewiesener Unterschiede in der Matrix von enchondralem und desmalem Knochen (Scott u. Hightower 1991) ist diese – bislang noch nicht abgeschlossene – Diskussion wieder aufgegriffen worden, da ein massives klinisches Interesse z. B. im Bereich der plastischen, rekonstruktiven Chirurgie besteht (Scheuer u. Black 2000). Zweifellos ist die desmale Ossifikation der ursprünglichere Mineralisierungsweg und auch derjenige, welcher im menschlichen Skelett als erster beschritten wird (im späteren Schlüsselbein werden bereits in der 6. Embryonalwoche Vorläuferzellen von Osteoblasten nachgewiesen; Scheuer u. Black 2000). Der Ersatz eines knorpelig präformierten Skelettelementes durch Knochengewebe folgt stets derselben Sequenz: Die Knorpelzellen (Chondrozyten) proliferieren und reifen, um später zu hypertrophieren und abzusterben, woraufhin eine Vaskularisierung des Gewebes erfolgt und Osteoblasten mit der Sezernierung nachfolgend mineralisierenden Osteoides beginnen. Im Falle der langen Röhrenknochen beginnt die Ossifikation durch Tätigkeit von Osteoblasten, welche die Kapillaren des die Knorpelstruktur umgebenden arteriellen Gefäßnetzes umschließen, so dass zunächst eine perichondrale Knochenmanschette gebildet wird (Abb. 2.20). Es wird diskutiert, dass diese Knochenmanschette die für die Ernährung des nicht-vaskularisierten Knorpels erforderliche Diffusion behindert und damit einen Eigenbeitrag zur Hypertrophie der Knorpelzellen liefert (Scheuer u. Black 2000). Diese perichondrale Ossifikation ist somit der eigentlichen enchondralen Ossifikation vorgeschaltet und dürfte auch in evolutiver Hinsicht der ältere Ossifikationsweg sein. Die Präzipitation der perichondralen Knochenmanschette beginnt etwa zum selben Zeitraum, in dem der Embryo erste Muskelkontraktionen durchführt. Zwar scheint der Beginn der perichondralen Ossifikation selbst weniger von mechanischen Stimuli abhängig zu sein, sie wird aber von diesen offenbar gefördert. Zunehmende Muskelkontraktion induziert Biegemomente in der Schaftregion der präformierten Knochen und steht entsprechend im Zusammenhang mit der echten enchondralen Ossifikation (Carter u. Beaupré 2001). Diese beginnt im Kern der Knorpelanlage, nachdem Blutgefäße durch die periphere Knochenmanschette hindurch sprossen und somit eine Invasion des Knorpelkernes mit Osteoblasten erlauben. In der Regel bleibt eines dieser periostalen Gefäße erhalten und wird zur dominanten Arterie für die Blutversorgung des Knochens (Scheuer u. Black 2000). Ihre Eintrittsstelle in das Knocheninnere ist makroskopisch in Form eines Nutritionalkanales (Foramen nutritium) sichtbar, der mehrere Millimeter Durchmesser aufweisen kann. Prähistorische Anthropologie 79 Abb. 2.20. Bildung der perichondralen Knochenmanschette. Zeichnung: M. Schulz Unabhängig vom Ossifikationsweg wird zunächst ein ursprünglicher Geflechtknochen gebildet, eine wenig organisierte Gewebsqualität mit großen physiologischen Hohlräumen für das Blutgefäßsystem, welche typisch für alle embryonalen Knochen ist. Im Zuge der Knochenreifung werden konzentrische Lamellen um die vorhandenen Blutgefäße herum präzipitiert, bis ein primäres Osteon entstanden ist, die charakteristische mikrostrukturelle Einheit des Knochens, mit dem leicht azentrisch gelegenen Havers-Kanal, welcher Blutgefäße und Nerven enthält (Abb. 2.18). Weiterer Umbau führt zu reifem Lamellenknochen, einer wohlgeordneten Gewebequalität, welche aus longitudinal orientierten, zylindrischen sekundären Havers-Systemen besteht. Diese können mehrere Millimeter lang werden. Sie bestehen aus konzentrischen Lamellenschichten, in denen die Orientierung der Kollagenfibrillen von Schicht zu Schicht alterniert (Abb. 2.18). Diese Anordnung verleiht dem Knochen sein anisotropes19 Verhalten. Im Gegensatz zu primären Osteonen sind sekundäre Osteone von einer Zementlinie (nicht zu verwechseln mit Zahnwurzelzement, s. unten) umgeben, welche im Falle von Strukturermüdung verhindert, dass Fissuren oder andere Mikrotraumata von einem Osteon auf das benachbarte weitergeleitet werden. Reife menschliche Osteone bestehen aus fünf bis zwanzig konzentrischen Schichten von 4–10 µm Dicke.Die Havers-Kanäle haben einen typischen Durchmesser von 50 µm und sind untereinander durch Volkmann-Kanäle verbunden, perforierende Gefäße, welche nicht einzelnen Osteonen zugeordnet sind (Abb. 2.18; Rohen u. Lütjen-Drecoll 2000, Martin et al. 1998). 19 Anisotropie = Eigenschaft von Kristallen, nach verschiedenen Raumrichtungen unterschied- liche physikalische Eigenschaften zu zeigen. 80 Evolution des Menschen Abb. 2.21. Aufbau und Verteilung von Kompakta und Spongiosa in einem langen Röhrenknochen (hier: Unterschenkel). Diaphyse: Schaft; Epiphyse: Gelenkende; Epiphysenfuge: während des Wachstums knorpelige Region, in welcher das Längenwachstum erfolgt (vgl. Text); Metaphyse: Übergangsbereich zwischen Epiund Diaphyse. Zeichnung: M. Schulz An solchen Regionen des Skelettes, welche mechanischen Belastungen aus sich häufig ändernden Richtungen ausgesetzt sind, bildet sich ein bis zu mehrere Millimeter dicker kompakter Knochen (Kompakta) aus, wie z. B. an den Schäften (Diaphysen) langer Röhrenknochen (Abb. 2.21). Kompakter Knochen weist in der Regel eine hohe Biegebelastbarkeit auf (Rohen u. Lütjen-Drecoll 2001). Kleine, kuboide Knochen (z. B. Hand- und Fußwurzelknochen) oder platte Knochen (Rippen) besitzen nur eine dünne kompakte äußere Schicht (Kortikalis). Um das Gleiten der Skelettelemente im Gelenkspalt zu ermöglichen, sind die Gelenkenden der Knochen mit einer Knorpelschicht bedeckt, welche jedoch weniger druckresistent ist als das knöcherne Gewebe. In der Folge sind die Gelenkenden verdickt, um die für die Druckaufnahme notwendige größere Fläche bereitzustellen, und der unterhalb der Kortikalis befindliche Knochen ist typisch in schwammartig strukturierte Bälkchen ausgemagert (Spongiosa). Die Spongiosabälkchen (Trabekel) verlaufen nicht regellos, sondern sind entlang der Hauptspannungsrichtungen (Trajektorien) orientiert, in welchen Druckund Zugkräfte auf das Skelettelement wirken (trajektorieller Knochenbau; Rohen u. Lütjen-Drecoll 2001). Die Spongiosatrabekel sind abgeplattete Strukturen von ca. 200 µm Dicke und bilden ein hochporöses Netzwerk mit einer Porosität von 75–95% (gegenüber der Porosität der Kortikalis von lediglich 5–10%; Martin et al.1998).Durch die Ausbildung solcher Netzwerke kann im Skelett erhebliche Masse eingespart werden, ohne die Stützfunktion zu beeinträchtigen. Prähistorische Anthropologie 81 Abb. 2.22. Aufbau des menschlichen Zahnes und Zahnhalteapparates. Zeichnung: M. Schulz Aufbau und Entwicklung der Zähne Menschliche Zähne bestehen aus drei verschiedenen Hartgewebsqualitäten: • • • dem Zahnbein (Dentin), dem Zahnschmelz (Enamelum), dem Wurzelzement (Abb. 2.22). Sowohl Zahnkrone als auch -wurzel sind zum größten Teil aus Dentin aufgebaut, welches im Bereich der Krone von einer Schmelzkappe überzogen ist, im Bereich der Wurzel von Zement.Diejenige Region,in welcher Schmelz und Zement aneinander stoßen, wird als Zahnhals bezeichnet. Die Zahnwurzel umschließt die Pulpahöhle, welche Blutgefäße und Nerven enthält und im Übrigen von lockerem Bindegewebe gefüllt ist. Das Wurzelzement ist Teil des Zahnhalteapparates, welcher ferner aus dem knöchernen Zahnfach des Kiefers (Alveole), der Wurzelhaut (Desmodont) und dem Zahnfleisch (Gingiva) besteht. Die Bindegewebsfasern der Wurzelhaut verbinden das Wurzelzement mit der Alveole, so dass jeder Zahn elastisch in seinem Zahnfach verankert ist. Als Resultat werden die beim Kauen oder anderweitigem Zahngebrauch aufgebauten erheblichen Drücke in Form einer Zugbelastung auf den Kieferknochen übertragen. Zugspannungen sind dem Knochenerhalt förderlich, während hohe Druckbelastungen zu einem unerwünschten Knochenabbau (Druckatrophie) führen können. Sehr früh in der Embryonalentwicklung, bereits in der sechsten Woche nach der Befruchtung, beginnt die Entwicklung der ersten Zahnanlagen, welche in ein Leisten-, Knospen-, Kappen- und Glockenstadium unterteilt wird. Im Leistenstadium kommt es zu einer Verdickung des Mundhöhlenepithels, welches je Kieferhälfte eine bogenförmige Leiste bildet, die sich wiederum in je eine Vestibular- und eine Zahnleiste teilt (vestibuläre und dentale Lamina). Aus letzterer sprossen etwa in der zehnten Woche pro Kieferhälfte je zehn 82 Evolution des Menschen Zahnknospen, aus denen die weitere Entwicklung der Milchzähne ihren Ausgang nimmt. Die entsprechenden Schmelzorgane für die Dauerzähne werden von der sechzehnten Woche an nach und nach entwickelt (Hillson 1996, Radlanski 1997) (Abb. 2.23). Durch Wachstum vornehmlich an den Rändern erhält die Zahnknospe eine konkave Form (Kappe), aus deren innerem Epithel die zahnschmelzproduzierenden Zellen (Ameloblasten) hervorgehen werden. Durch weitere Ausprägung der Konkavität wird das Glockenstadium erreicht, in dessen Hohlraum Mesenchymzellen eingeschlossen werden, welche die Zahnpapille bilden. Deren äußere Zellen differenzieren sich zu dentinbildenden Zellen (Odontoblasten), die in diesem frühen Stadium dem Schmelzepithel unmittelbar gegenüberliegen. Somit wird die Schmelz/Dentin-Grenze sehr früh festgelegt. Im letzten Entwicklungsstadium bildet sich die Pulpa durch Einsprossen von Nerven und Blutgefäßen in die Papille. Die Mesenchymzellen außerhalb der Zahnanlage verdichten sich geflechtartig zum Zahnsäckchen (Follikel), aus welchem später das Zahnzement hervorgehen wird. Die Einheit aus Follikel, Schmelzorgan und Papille wird als Zahnkeim bezeichnet (Radlanski 1997, Schroeder 1997, Scheuer u. Black 2000; Rohen u. Lütjen-Drecoll 2000). Die ektodermalen Ameloblasten sezernieren zunächst eine Schmelzmatrix. Apatitkristalle werden in die Matrix hinein abgegeben, wo sie später zu ihrer vollen Größe auswachsen werden. Charakteristisch für Ameloblasten ist der Tomes-Fortsatz, eine zelluläre Ausstülpung, welche nach dem Rückzug der Ameloblasten aus dem reifenden Zahnschmelz ein System von hexagonalen Abb. 2.23. Schemazeichnung einer Zahnanlage (vgl. Text). Zeichnung: M. Schulz Prähistorische Anthropologie 83 Lücken in der Matrix hinterlassen. Hierdurch erhält der Zahnschmelz seinen im Wesentlichen prismatischen Aufbau. Während der Schmelzreifung erfolgt eine Metamorphose der Ameloblasten, welche jetzt beginnen, die organische Matrix wieder abzubauen. Im Gegensatz zur Knochenbildung wird diese daher fast vollständig durch Mineral ersetzt, und einmal gebildeter Zahnschmelz ist als nunmehr zellfreies Gewebe zu keinem weiteren Umbau und somit auch keiner Reparatur mehr fähig. Die Schmelzkappe kann bei den Dauermolaren eine Dicke von 2 mm erreichen, während sie bei Milchzähnen in der Regel eine Dicke von 1 mm nicht überschreitet (Hillson 1996). Die organische Matrix unreifen Zahnschmelzes unterscheidet sich signifikant von jener anderer mineralisierter Hartgewebe, da sie zu etwa 90% aus Amelogenin besteht, einem schmelzspezifischen Protein mit einem Molekulargewicht bis 20 kDa. Etwa ein Viertel aller Aminosäuren des Amelogenins wird allein durch Prolin gestellt, wobei die für das Kollagen typische hydroxylierte Form vollständig fehlt. Im Zuge der Schmelzreifung wird Amelogenin spezifisch zu Peptiden gespalten und aus der Matrix entfernt. Im reifen Zahnschmelz finden sich mehrheitlich nur noch Proteine und Peptide mit einem Molekulargewicht bis 5 kDa, deren Aminosäurezusammensetzung nicht-amelogeninen Schmelzproteinen ähnlicher ist als dem Amelogenin (Hillson 1996). Das Dentin ist ein Produkt der Odontoblasten, zylindrischer Zellen mit je einem langen Fortsatz, welcher nach Mineralisierung des Dentins in langen Tubuli lokalisiert ist. Auch die Odontoblasten sezernieren zunächst eine organische Matrix (Prädentin), welche sukzessive mineralisiert. Ausdifferenzierte Odontoblasten verlieren ihre Teilungsfähigkeit, sind aber über die ganze Lebensdauer eines Zahnes hinweg vital (Hillson 1996). Im Gegensatz zum Zahnschmelz wird zeitlebens sekundäres Dentin gebildet, welches die Pulpahöhle auskleidet. Die aus dem Follikel stammenden Zementoblasten befinden sich in der Wurzelhaut und beginnen mit der Präzipitation des Präzementes bereits auf dem Prädentin. Während das Wurzelzement mehrheitlich zellfreies Gewebe ist, finden sich insbesondere in der Nähe der Wurzelspitze ausdifferenzierte Zementozyten, die analog den Osteozyten in Lakunen liegen. Im fertigen Zahn ist die gesamte Wurzelfläche mit Zement bedeckt, wobei die Zementschicht des Erwachsenen in der Regel 100–200 µm dick ist, in der Nähe der Wurzelspitze jedoch bis 600 µm Dicke erreichen kann (Hillson 1996). Aufgrund seiner wesentlichen Rolle in der Verankerung des Zahnes im Zahnfach wird Zahnzement während des ganzen Lebens gebildet. Aufgrund der Dynamik jener physikalischen Kräfte, welche durch den Kauapparat erzeugt werden, befinden sich die Kollagenfasern der Wurzelhaut in ständigem Umbau mit der Folge, dass die Zementbildung der sich ständig ändernden und erneuernden Anheftung der Fasern an der Zahnwurzel gerecht werden muss. Zahnzement ist in seiner Zusammensetzung dem Knochen am ähnlichsten, kann aber in Bezug auf die Präsenz von Zellen und die Herkunft des Kollagengerüstes variieren. Extrinsische Kollagenfasern entstammen der Wurzelhaut und sind mit einem Querschnitt von 6–12 µm deutlich dicker als intrinsische, von den Zementoblasten selbst produzierte Fasern, welche in der Regel eine Querschnittsdicke von 84 Evolution des Menschen Abb. 2.24. Heterodontes menschliches Milch- und Dauergebiss. Bezeichnung der Dauerzähne in Großbuchstaben, der Milchzähne in Kleinbuchstaben. I: Incisivus, C: Caninus, P: Prämolar, M: Molar. Zeichnung: M. Schulz 2 µm nicht überschreiten (Hillson 1996). In Bezug auf Aufbau und Funktion unterscheidet man folgende fünf Zementtypen: • • • • • azelluläres, afibrilläres Zement (lokalisiert an der Schmelz/Zement-Grenze und auf dem Schmelz), azelluläres Fremdfaserzement (bedeckt die Wurzel vom Zahnhals bis zur Wurzelmitte), zelluläres Eigenfaserzement (auf apikalen20 und interradikulären21 Wurzelflächen, in Resorptionslakunen und Frakturspalten), azelluläres Eigenfaserzement, zelluläres Gemischtfaserzement (jeweils auf apikalen und interradikulären Wurzelflächen) (Schroeder 1992). Das azelluläre Fremdfaserzement wird aufgrund seines strikt appositionellen Wachstums zur Sterbealtersdiagnose erwachsener Individuen herangezogen (vgl. Kap. 2.3.3). Das menschliche Gebiss ist heterodont, d. h. es besteht aus verschiedenen Zahntypen unterschiedlicher Funktion. Ferner gibt es einen einmaligen Zahnwechsel, den Milchzähnen (Dentes decidui) folgen die Dauerzähne (Dentes permanentes). Das aus zwanzig Zähnen bestehende Milchgebiss weist je Kieferhälfte zwei Schneidezähne (Incisivi), einen Eckzahn (Caninus) und zwei Backenzähne (Molares) auf, das aus zweiunddreißig Zähnen bestehende Dauergebiss zusätzlich je zwei Vorbackenzähne (Prämolares) und einen dritten Dauermolaren, den „Weisheitszahn“ (Abb. 2.24). Zähne sind für die Diagnostik sehr wichtige Skelettelemente, da sie eine enorm hohe Merkmalsdichte auf kleinem Raum aufweisen. Bezüglich der 20 apikal = die Spitze (Apex, hier: Wurzelspitze) betreffend 21 radikulär = die Wurzel (Radix) betreffend Prähistorische Anthropologie 85 Morphologie der einzelnen Zahntypen, ihrer Funktion und anatomischer Varianten besteht eine Fülle spezieller Literatur, auf die an diesem Ort verwiesen werden soll (Hillson 1996, Herrmann et al. 1990, Alt 1997, Alt u. Türp 1997). Die zahnspezifischen Durchbruchszeiten werden zur Altersbestimmung nicht erwachsener Individuen herangezogen (s. Kap. 2.3.3). Für archäologische Skelettfunde kann nur das alveoläre Durchbruchsalter herangezogen werden, welches zeitlich vor dem klinischen Durchbruchsalter durch die Gingiva liegt. Während die Durchbruchszeiten der Zähne zwar im Wesentlichen genetisch gesteuert sind, aber z.T. beträchtlichen Schwankungen aufgrund von Umwelteinflüssen welche sich generell auf die Reife auswirken, wie z. B. Fehlernährung, und damit soziokulturellen Parametern unterliegen, scheint der zeitliche Ablauf der Mineralisierung der einzelnen Zahnstrukturen deutlich umweltstabiler zu sein (Scheuer u. Black 2000). Erhaltungsgrad archäologischer Skelettfunde Materie zirkuliert im Ökosystem. Nach dem Individualtod wird daher der Körper in der Regel vollständig abgebaut, allerdings ist das Skelettsystem aufgrund seiner Dichte und Zusammensetzung erst sehr spät von diesen Dekompositionsprozessen betroffen (Gill-King 1997). Der Zustand eines Skelettes bei seiner Bergung ist demnach abhängig von den Umgebungsbedingungen, denen es Hunderte, Tausende oder mehr Jahre ausgesetzt war. In günstigen Situationen kommt es zur sukzessiven Substitution der Skelettkomponenten durch Mineralien des Liegemilieus (z. B. Silikate), und der Knochen bleibt unter Wahrung seiner äußeren Form, oft auch unter Wahrung seines mikrostrukturellen Aufbaues, in versteinerter Form erhalten (Fossilisation). Das andere Extrem ist mit dem vollständigen Vergehen des Skelettes gegeben, an dessen ursprünglichem Ort bestenfalls eine Bodenverfärbung (Leichenschatten) oder messbare Akkumulation von Calcium und Phosphat, den mineralischen Matrixkomponenten, verbleibt. Für die Dekomposition des Skelettes sind physikalische, chemische und biologische Mechanismen verantwortlich (Herrmann et al. 1990). Physikalische Kräfte, z. B. hervorgerufen durch den Druck des auf die Knochen lastenden Erdreiches, aber auch Frostsprengung oder mechanische Bewegung führen zu einer Fragmentierung. Die weniger dichten, spongiösen Teile des Skelettes sind daher häufig schlechter erhalten als die kompaktknöchernen Areale. Unter den chemischen Parametern hat der pH-Wert des Bodens eine herausragende Bedeutung, da unter sauren Bedingungen eine Hydrolyse des Apatits beschleunigt verläuft. Die Verfügbarkeit von Wasser und Sauerstoff ist für viele chemische Prozesse ebenfalls relevant, steuert aber ganz wesentlich den biologischen Abbau des Skelettes. Aufgrund seiner Porosität bietet der Knochen eine große innere Oberfläche, welche saprophagen Mikroorganismen eine ideale Angriffsfläche bietet (Grupe 2001). Empirisch und auch experimentell konnte nachgewiesen werden, dass insbesondere bodenbewohnende Bakterien wie Bacillus subtilis (Child 1995a,b) das Skelett invadieren (Abb. 2.25). Das Wachstum von Bodenbakterien wird durch initiale Dekompositionsprozesse wie z. B. die Freisetzung von Wasserstoff 86 Evolution des Menschen Abb. 2.25. Histologisches Querschnittspräparat eines bodengelagerten menschlichen Knochens (frühmittelalterlich). Die Kompakta ist vollständig mit Bohrkanälen durchsetzt, Osteone sind lediglich noch anhand der Havers-Kanäle kenntlich, welche mehrheitlich mit exogener Substanz infiltriert sind. Foto: S. Doppler und organischen Säuren im Zuge der Degradation von Biomolekülen erleichtert, da hierdurch eine Ansäuerung des jeweiligen Mikromilieus erreicht wird (Gill-King 1997). Durch Produktion saurer Metabolite sind viele Mikroorganismen in der Lage, den Apatit zu hydrolysieren (Grupe et al. 1993) und später auch das somit demaskierte Kollagen zu spalten. Bakterienkollagenasen sind sehr viel aggressiver als die Gewebskollagenasen der Säugetiere, da die Bakterien selbst über kein Kollagen verfügen (vgl. z. B.Achromobacter iophagus, ein Bakterium, welches Kollagen I in sehr spezifischer Weise spalten kann; Vrany et al. 1988). So produzieren Bakterien der Gattung Streptomyces eine Kollagenase, welche jener von Clostridium histolyticum sehr ähnlich ist, also eines Bakteriums, welches eine herausragende Rolle in der Kollagendegradation unmittelbar nach dem Individualtod spielt (Child 1995a). Die Tatsache, dass Streptomyces auch an der Zersetzung von Steinen und Bauwerken beteiligt ist, belegt die unglaubliche Flexibilität bestimmter Mikroorganismen, bedingt durch die Vielfalt der von ihnen produzierten Enzyme (Urzi u. Krumbein 1994). Pilze zählen mehrheitlich zu den Sekundärbesiedlern des im Zustand der Dekomposition befindlichen Skelettes. Prähistorische Anthropologie 87 Je nach Lagerung eines Leichnams und später des Skelettes sind die Dekompositionsprozesse daher beschleunigt oder verzögert. Oberflächennahe Leichen werden häufig bereits primär durch Tierverbiss (Nagetiere, Füchse, Marder) zerstört. Je tiefer ein Leichnam bestattet wurde, desto langsamer verläuft dessen Dekomposition, im Erdreich in der Regel etwa achtmal langsamer als an der Oberfläche (Rodriguez 1997). Neben dem pH-Wert, der Verfügbarkeit von H2O und O2 ist auch die Temperatur ein wesentlicher Faktor, welcher mikrobielles Wachstum fördert oder inhibiert. Die mittlere Grabtemperatur in den gemäßigten Breiten beträgt etwa 10°C. Konservierende Liegebedingungen sind generell kalt, trocken und eher basisch, zehrende Liegemilieus sauer, warm und feucht. Somit ist ersichtlich, dass der Überlieferungsgrad archäologischer Skelettfunde viel weniger von der Liegezeit abhängt als von den Liegebedingungen (Herrmann et al. 1990). Der Überlieferungsgrad bestimmt wiederum die Fülle und Sicherheit der Diagnosen, welche an einem bestimmten Skelettfund noch erhoben werden können, und zwar auf makroskopischer, mikroskopischer und molekularer Ebene. Box 2.9 Leichenbrand Eine besondere, für bestimmte Zeitstufen häufige bis regional exklusive Bestattungsform (vgl. Box 2.7) ist die Leichenverbrennung. Vor der Bestattung wurde der Leichnam hohen Temperaturen ausgesetzt (auch mit einem prähistorischen Scheiterhaufen konnte eine Temperatur von um die 1000°C erreicht werden),wodurch die Weichgewebe im Idealfalle vollständig verbrennen. Auch die Hartgewebe werden signifikant verändert, wobei eine Hochtemperaturmodifikation des Apatits die entscheidende Rolle spielt (Herrmann et al.1990,McKinley u. Bond 2001). Geschützt durch das Knochenmineral degradiert die organische Matrix erst bei etwa 250°C. Im selben Temperaturbereich entweicht Kristallwasser, und es kommt zu einer optisch kaum wahrnehmbaren Initialschrumpfung des Knochens. Oberhalb 600°C entweicht sämtlicher organischer Kohlenstoff, und der Knochen erscheint kreidig weiß. Ab 800°C kommt es zu einer Modifikation des Apatits zu einem Tricalciumphosphat mit begleitender Fusion der Kristalleinheiten im Sinne einer physikalischen Festkörperreaktion. Je nach Mineraldichte wird der Knochen nunmehr merklich schrumpfen, und zwar bis zu 10% in jede Raumrichtung. Kugelige Skelettelemente wie z. B. der Oberschenkelkopf sind daher nach der Verbrennung um rund ein Drittel kleiner. Da innerhalb auch eines Skelettelementes die Mineraldichten regional je nach physikalischer Belastung schwanken,kommt es zu keiner einheitlichen, sondern differentiellen Schrumpfung der 88 Evolution des Menschen Box 2.9 (Fortsetzung) Knochen, welche sich in der Folge verbiegen und zerbrechen. Die mineraldichte Zahnkrone wird von der weniger mineraldichten Zahnwurzel abgesprengt und zerscherbt in der Regel vollständig. Aufgrund des Verlustes organischer Substanz ist vollständig verbrannter Knochen unelastisch, aufgrund seiner hohen Mineraldichte aber sehr hart. Von einer Temperatur von 1630°C an beginnt der Knochen zu schmelzen. Abgekühlte, erhärtete Knochenschmelze wird als Clincer bezeichnet (Herrmann et al. 1990). Diese Schmelztemperatur wird jedoch bei prähistorischen Leichenbränden in der Regel nicht erreicht. Ob eine solche vollständige Verbrennung des Skelettes erreicht wird, hängt von der Verbrennungspraxis (verwendete Holzart, Belüftung des Scheiterhaufens, Brenndauer) ab. Unvollständig verbrannte Skelette weisen z. B. noch Reste primären Kohlenstoffes im Knocheninneren auf und erscheinen rußig-grau anstatt kreidig-weiß.Während der Begriff „Leichenbrand“ im engeren Sinne die Gesamtheit aller nicht brennbaren Teile des menschlichen Körpers umfasst, wird er praxisnah im weiteren Sinne für die Beschreibung aller nach einem Verbrennungsvorgang noch vorhandenen Teile des menschlichen Körpers benutzt (Abb.2.26).Es ist wesentlich darauf hinzuweisen,dass nach Leichenverbrennung mitnichten nur noch Asche übrigbleibt, sondern eben die zerscherbten Reste des verbrannten Skelettes einschließlich der Zahnwurzeln. Trotz in der Regel hohen Fragmentierungsgrades verbleiben nach der Leichenverbrennung durchaus noch Stücke von mehreren Zentimetern Größe und besitzen daher erheblichen anthropologischen Aussagewert. Die Art der Bestattung (vollständiges oder unvollständiges Auflesen des Leichenbrandes, Beisetzung in einer Urne oder als Brandschüttung direkt im Erdreich), in wesentlicher Weise aber auch die Art der Bergung und Präparation dieser brüchigen Fragmente haben einen entscheidenden Einfluss auf den letztendlichen Fragmentierungsgrad der Stücke,welche dem Anthropologen für die Diagnostik vorliegen. Prähistorische Anthropologie 89 Abb. 2.26. Menschlicher Leichenbrand 2.3.3 Diagnose biologischer Basisdaten Zu den biologischen Basisdaten gehören alle jene Daten, welche am Skelettfund (auch an Leichenbrand oder anderweitiger Überlieferungsform) erhoben werden können und geeignet sind, das jeweilige Individuum zu charakterisieren. Hierzu gehören das Sterbealter, das Geschlecht, metrische Merkmale wie Körperhöhe und Proportionen, kleinräumige Varianten in Aufbau und Struktur des Skelettes, Aktivitätsmuster und gegebenenfalls Symptome von Erkrankungen oder Anzeichen für die Todesursache. Da zu diesem Thema ausführliche Spezialliteratur einschließlich der erforderlichen Diagnoseschlüssel existiert (z. B. Brothwell 1981, Bass 1987, Herrmann et al. 1990, White u. Folkens 1991, Scheuer u. Black 2000), sollen an dieser Stelle lediglich die grundlegenden Gesichtspunkte erwähnt werden. Bestimmung des Sterbealters Das Sterbealter ist makroskopisch bis zur Vollendung der Skelettreife relativ zuverlässig bestimmbar. Jedoch ist auch der Prozess der ontogenetischen Reife bis zu einem gewissen Grade umweltplastisch, so dass Altersangaben immer nur innerhalb gewisser Grenzen möglich sind. Ferner ist zu bedenken, dass die Mehrzahl jener Individuen, welche vor dem Erreichen des Erwachsenenalters verstorben sind, krank oder z. B. auch fehlernährt gewesen sein dürfte, so dass eine Verzögerung der Reife stets in Betracht zu ziehen ist. Traditionell werden die Individuen anthropologisch sechs großen Altersklassen zugeordnet (vgl. Herrmann et al. 1990; Tabelle 2.7). 90 Evolution des Menschen Tabelle 2.7. Definition anthropologischer Altersklassen. Die Gruppen Adultas und Maturitas werden häufig weiterhin gedrittelt in ein jeweils junges, mittleres und spätes Stadium Altersgruppe Jahre Infans I (frühe Kindheit) Infans II (späte Kindheit) Juvenis (Jugendalter) Adultas (Erwachsenenalter) Maturitas (Reifealter) Senilis (Greisenalter) 0–6 7–12 13–20 20–40 40–60 60-ω Für Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres wird die Sterbealtersbestimmung am zuverlässigsten anhand des Zahnwechsels vorgenommen, wobei am mazerierten Skelettmaterial naturgemäß der alveoläre Zahndurchbruch festgestellt wird. Umweltstabiler als die Durchbruchszeiten sind die Mineralisationsstadien noch unvollständig ausgebildeter Zähne (vgl. hierzu Smith 1991). Als Faustregel kann jedoch gelten, dass im Alter von 2,5 bis 3 Jahren ein vollständiges Milchgebiss angelegt ist, dass der erste Dauermolar im Alter von 6 Jahren erscheint („Schulzahn“), der zweite Dauermolar mit zwölf Jahren. Gerade bei sehr kleinen Kindern, deren Knochen sehr zart und noch nicht ausgereift sind, bleiben nach längerer Liegezeit im Erdreich lediglich die Zähne oder sogar nur noch die Zahnkronen erhalten. Auf diese ist im Zuge der archäologischen Ausgrabung daher besonders zu achten. Zuzüglich zu dem Zahnstatus können auch einige Reifemerkmale des Skelettes gut zur Sterbealtersschätzung herangezogen werden (Scheuer u. Black 2000). Für Jugendliche ist die Skelettreife ein guter Marker für das Sterbealter. Aufgrund seiner Mineralisierung kann knöchernes Gewebe nicht mehr durch interstitielles Wachstum proliferieren. Um das Längenwachstum zu gewährleisten, verbleiben bis zum Abschluss der Skelettreife knorpelige Wachstumsfugen, die Epiphysenfugen, erhalten. Sie separieren in langen Röhrenknochen die Gelenkenden (Epiphysen) vom Schaft (Diaphyse). Die Epiphysen platter Knochen werden auch als Apophysen bezeichnet (Abb. 2.21). Für den knöchernen Verschluss der Epiphysenfugen und damit Wachstumsabschluss eines Skelettelementes ist u. a. eine Reihe von zellulären Wachstumsfaktoren, aber auch der individuelle Hormonstatus verantwortlich. Im Falle der langen Extremitätenknochen setzt der Epiphysenverschluss z. B. gegen Ende der Pubertät und des puberalen Wachstumsschubes ein (Ulijaszek et al. 1998). Nach vollständiger Reifung des Skelettes, also mit etwa 30 Jahren, kann das Sterbealter Erwachsener nur noch anhand der Alterung des Skelettes geschätzt werden. Jedoch ist diese Alterungsrate nicht konstant, sondern sehr stark umweltplastisch und von den individuellen Lebensbedingungen abhängig. Die makroskopische Methode mit der größten Verbreitung ist die Komplexe Methode (Acsadi u. Nemeskeri 1970), welche vier Kriterien berücksichtigt: • • den sukzessiven Verschluss der Schädelnähte, die altersbedingte Veränderung des Reliefs der Schambeinsymphyse, Prähistorische Anthropologie • • 91 den Verlust der Spongiosa des proximalen22 Oberarm- und Oberschenkelbereiches, die zunehmende Ausdehnung der Markhöhle und Abbau der Trabekel. Diese makromorphologische Sterbealtersbestimmung lässt jedoch nach neueren Erkenntnissen nur eine Beurteilung eines Individuums im groben Rahmen zu. Auch der mikrostrukturelle Aufbau der Kompakta unterliegt altersabhängigen Veränderungen. Im jungen Erwachsenenalter nimmt die Anzahl der Osteone zu Lasten der Generallamellen zu, während mit zunehmendem Alter der ständige Knochenumbau dazu führt, dass die Osteone dichter gepackt werden, einander überlagern und zahlreiche Fragmente alter Osteone persistieren. Durch den quantitativen, altersbedingten Mineralverlust entstehen Resorptionshöhlen, auch die Havers-Kanäle werden erweitert (Abb. 2.27). Eine Altersschätzung anhand histomorphometrischer Auswertung der Kompaktaorganisation, wie z. B. der Relation intakter Osteone zu Osteonfragmenten, erlaubt eine Sterbealtersbestimmung mit einem Fehler von +/- sechs bis sieben Jahren (Stout 1992). Letztlich können somit die Individuen wiederum nur in Alterskategorien eingeteilt werden, welche mehr als zehn Jahre umfassen. Eine Bestimmung des kalendarischen Sterbealters Erwachsener ist nach gegenwärtigem Kenntnisstand ausschließlich anhand der jährlichen Zuwachsringe im Zahnzement möglich (Wittwer-Backofen u. Buba 2002). Das im oberen Drittel der Zahnwurzel befindliche zellfreie Fremdfaserzement wächst strikt appositionell und unterliegt nach seiner Bildung keinem weiteren Umbau. Nach Durchtritt des Zahnes in die Mundhöhle (klinischer Zahndurchbruch) reagiert das Zahnzement auf die physikalische Beanspruchung des Kauvorganges mit der Anlagerung in der Regel jährlich eines Zuwachsringes (Abb. 2.28). Jeder Zuwachsring entspricht einer Doppelbande aus je einem helleren (schwach mineralisierten) und einem dunklen (stark mineralisierten) Ring, wobei saisonale Rhythmen für diese differentielle Mineralisation verantwortlich sein dürften (Grue u. Jensen 1976, Lieberman 1993, 1994, Morris 1972). Für die Sterbealtersbestimmung muss im histologischen Querschnitt durch die Zahnwurzel die in der Regel deutlich untermineralisierte Durchtrittslinie aufgesucht werden (Abb. 2.28), welche sich im Zuge der raschen Durchtrittsbewegungen des Zahnes bildet. Anschließend werden die jährlichen Zuwachsringe gezählt und das mittlere Durchbruchsalter des Zahnes addiert. Sofern eine ungestörte Zementogenese vorliegt, was bei intakter Wurzelhaut bis zum Sterbezeitpunkt gegeben ist, kann mit Hilfe dieser Methode das chronologische Sterbealter des untersuchten Individuums angegeben werden, wobei der Bestimmungsfehler der individuellen Variation im Durchtritt des untersuchten Zahnes entspricht. Prämolaren weisen ausgesprochen geringe Schwankungen von lediglich +/- 1,55 Jahren des individuellen klinischen Durchbruchszeitraumes auf (Schumacher et al. 1990). Eine Altersbestimmung anhand des Zahnzementes ist mit einer Genauigkeit von etwa +/- 2,5 Jahren 22 proximal = die dem Rumpf nähere Lokalisation an einer Extremität 92 Evolution des Menschen Abb. 2.27 a,b. Histologische Querschnittspräparate menschlicher Kompakta unterschiedlichen Individualalters, frühmittelalterliche Bestattungen. Das jungerwachsene Individuum (weiblich, Zahnzementalter 21 Jahre) weist gut voneinander absetzbare Osteone zwischen Resten ehemaliger Generallamellen auf (a), während das deutlich ältere Individuum (männlich, Zahnzementalter 58 Jahre) durch dicht gepackte Osteone und deren Fragmente sowie deutlich erweiterte Havers-Kanäle gekennzeichnet ist (b). Fotos: S. Doppler Prähistorische Anthropologie 93 Abb. 2.28. Histologisches Präparat der Zuwachsringe im Zahnzement (Strott u. Grupe 2003). Deutlich transparenter erscheint die untermineralisierte Durchtrittslinie (Pfeil). Z = Zahnzement, D = Dentin möglich. Liegen Erkrankungen der Zähne und insbesondere des Zahnhalteapparates vor, ist jedoch mit einer Unterzahl von Zuwachsringen zu rechnen (Kagerer u. Grupe 2001a). Zu einem geringen Prozentsatz lässt sich das Phänomen des „doublings“ beobachten, bei dem ein Individuum statt in der Regel eines Doppelringes pro Jahr derer zwei anlegt. In solchen Fällen würde also das Sterbealter stark überschätzt, so dass ein Abgleich des Zahnzementalters mit dem morphologischen Alterungsgrad des Skelettes geboten ist. Ein weiterer Vorteil dieser Sterbealtersdiagnose am Zahnzement liegt darin, dass die Zementschicht nach Leichenverbrennung in der Regel auf der Zahnwurzel verbleibt und daher dieses Verfahren auch bei Leichenbränden mit gutem Erfolg angewendet werden kann (Großkopf 1989). Geschlechtsbestimmung Im erwachsenen Skelett liegt ein populationstypischer Geschlechtsdimorphismus vor, welcher mehr oder weniger deutlich ausgeprägt ist. Die Geschlechtsbestimmung am Skelett erfolgt zweckmäßigerweise zunächst am Becken, da sich hier ein funktionell bedingter Geschlechtsdimorphismus zeigt. Im weiblichen Geschlecht sind Strecken und Winkel dieses Skelettelementes weiter und offener, um den Geburtsvorgang zu ermöglichen. Allein anhand des Beckens ist eine Geschlechtsbestimmung mit einer Zuverlässigkeit von bis zu 96% möglich (Cox 2001). Aufgrund des höheren Muskelquerschnittes im männlichen Geschlecht sind die übrigen geschlechtsdifferenten Merkmale des 94 Evolution des Menschen Skelettes im Wesentlichen Robustizitätsmerkmale. Die Elemente des männlichen Skelettes sind in der Regel größer als jene des weiblichen Geschlechtes, Muskelmarken auf der Knochenoberfläche sind prominenter. Recht deutlich sind die geschlechtsdifferenten Merkmale am Schädel ausgebildet, einschließlich der metrischen Merkmale der Zähne. Zweifellos erfolgt eine Geschlechtsdiagnose mit umso höherer Sicherheit, je vollständiger das Skelett überliefert ist. Es empfiehlt sich aber in jedem Falle, zunächst die Gesamtvariabilität der Robustizitätsmerkmale der ergrabenen Population zu erfassen (Herrmann et al. 1990, Cox 2001). Bei stark fragmentiertem Untersuchungsgut kann eine Geschlechtsbestimmung anhand von metrischen Merkmalen, welche diskriminanzanalytisch ausgewertet werden, erfolgen. Hierzu werden mehrere Maße des Skelettes erhoben, gewichtet, linear kombiniert (Diskriminanzfunktion) und der Trennwert für die beiden Geschlechter mathematisch ermittelt. In der Regel müssen diese Diskriminanzfunktionen jedoch für jede Population eigens erstellt werden. Die Fehlklassifikationen liegen deutlich höher bei 20% und mehr (Herrmann et al. 1990). Bei nicht erwachsenen Individuen ist die morphologische Geschlechtsbestimmung stark erschwert, obgleich bereits im fetalen Skelett der spätere Geschlechtsdimorphismus für den erfahrenen Osteologen erkennbar ist (Fazekas u. Kosa 1978). Bei Applikation geeigneter Diskriminanzfunktionen kann jedoch auch für das Kleinkind auf morphometrischem Wege eine korrekte Geschlechtszuweisung für mehr als 70% der untersuchten Individuen erreicht werden (Schutkowski 1990), was jedoch immer noch einer Fehlklassifikation von 30% entspricht. Osteometrie Allgemein dient die metrische Erfassung von Form- und Größenmerkmalen des Skelettes (Osteometrie) der quantitativen Beschreibung des Individuums und der Population. Morphologische Unterschiede zwischen Populationen können nach multivariat-statistischer Verarbeitung einer Vielzahl von Maßen durch statistische Abstandsmaße quantifiziert werden, wobei jedoch im Einzelfall nicht immer auch eine fundierte biologische Begründung für die beobachteten Unterschiede geliefert werden kann und der Befund daher auf der Ebene der Deskription verbleibt. Ein gut dokumentiertes Beispiel ist der Grazilisationsprozess, die Robustizitätsabnahme vom archaischen zum anatomisch modernen Menschen im Pleistozän, welche bis in das Holozän hinein Kontinuität hat (vgl. Kap. 2.2). Menschen des Neolithikums sind insgesamt schlanker und weniger robust als noch im oberen Paläolithikum, auch ein Wandel der Schädelform ist evident. Die möglichen Ursachen für diesen Formwandel sind vielfältig und können in genetischen Unterschieden (s. Kap. 3.1) ebenso begründet sein wie in einigen umweltbezogenen Aspekten (Klimawandel, produzierende Lebensweise mit verändertem Arbeits- und Ernährungsspektrum). Die Körperhöhe, welche ein Individuum zu Lebzeiten erreicht hatte, wird in der Regel aus den Längen der Ober- und/oder Unterschenkelknochen mittels Prähistorische Anthropologie 95 linearer Regression ermittelt, wobei die zur Verfügung stehenden Formeln die alters- und geschlechtsspezifischen Proportionen berücksichtigen (Zusammenstellung bei Herrmann et al. 1990). Eine Längsschnittbetrachtung der Körperhöhen von Kindern und Jugendlichen eines Skelettkollektives ergibt Hinweise auf den Wachstumsverlauf und damit wiederum auf die allgemeinen Lebensbedingungen (Ernährungssituation, Erkrankungshäufigkeiten; Hoppa u. Fitzgerald 1999). Körperproportionen sind auch klimaabhängig, wie etwa die Relation der Extremitätenlänge zum Körperstamm (s. Kap. 3.2). So weist z. B. die spezielle Proportionierung der Neandertaler auf deren Adaptation an eiszeitliche Klimaverhältnisse hin (vgl. hierzu Henke u. Rothe 1998). Nicht zuletzt können individuell abweichende Form- und Größenmerkmale einzelner Skelettelemente pathologische Ursache haben (s. unten). Morphologische Varianten Als diskontinuierlich variierende Merkmale (synonym: Diskreta, epigenetische Merkmale) werden in der Regel kleinräumige Varianten des Skelettes bezeichnet, welche metrisch nicht erfasst werden können. Zu diesen gehören z. B. die Persistenz der Stirnnaht (Sutura metopica) als Zeichen allgemein verzögerten Schädelnahtverschlusses, da die beiden Hälften des zunächst paarig angelegten Stirnbeines mit Vollendung des dritten Lebensjahres vollständig miteinander verwachsen sein sollten, oder das Vorhandensein akzessorischer Nutritialkanäle (Foramen mentale accessorium, Abb. 2.29). Da die Mehrzahl dieser diskontinuierlich variierenden Merkmale familien- oder auch populationstypisch gehäuft auftreten, ist eine genetische Grundlage hoch wahrscheinlich (Hauser u. De Stefano 1989), zur Zeit aber nur in den wenigsten Fällen (insbesondere für einige Merkmale der Zähne und des Gebisses, Alt 1997) nachgewiesen. Einige nicht-metrische Merkmale basieren jedoch auch auf Verhaltensmustern und sind damit nicht genetisch bedingt, wie z. B. die Ausprägung einer zusätzlichen Gelenkfläche am Knöchelgelenk des Unterschenkels durch ge- Abb. 2.29. Foramen mentale accessorium (doppelt angelegter Nutritialkanal im Unterkiefer, Pfeil). Zeichnung: M. Schulz 96 Evolution des Menschen wohnheitsmäßiges Hocken (Hockfacette) oder die Extension der Gelenkfläche des Oberschenkelkopfes auf den Oberschenkelhals als Folge regelmäßigen Reitens zu Pferd (Larsen 1997). Paläopathologie Besondere Aufmerksamkeit wird den pathologischen Veränderungen am Skelett gewidmet, da diese nicht nur Auskunft über individuelle Schicksale erteilen, sondern insbesondere Rückschlüsse auf die Krankheitsbelastung der Bevölkerung erlauben. Welchen Erkrankungen war eine Bevölkerung zu welcher Zeit und in welcher geographischen Region überhaupt ausgesetzt, welche Altersgruppen oder Geschlechter waren besonders betroffen und welches waren die medizinischen Möglichkeiten zur Linderung oder Heilung? Erkrankungen können sowohl umweltinduziert sein durch einfaches Vorkommen des Krankheitserregers am Standort (z. B. Malaria), wobei ein Teil der Infektionskrankheiten auch anthropogenen Ursprunges ist und sowohl im Zuge der Haustierhaltung und -züchtung als auch durch Kulturfolger vom Tier auf den Menschen übertragen wurde (Zoonosen), wie z. B. die Tuberkulose der Boviden. Größenzunahme und Verdichtung einer Bevölkerung ergibt einen Selektionsvorteil für solche Infektionen, welche durch Tröpfchenübertragung auf kurzem Wege von Mensch zu Mensch übertragen werden (z. B. Grippe), schlechte hygienische Bedingungen fördern Schmutzinfektionen. Der Wandel von Krankheitsspektren in Zeit und Raum ist daher von hohem medizinhistorischem und epidemiologischem Interesse. Die Paläopathologie widmet sich explizit den genannten Fragestellungen, hat aber mit substratspezifischen Problemen zu kämpfen. Jede Krankheitsdiagnose muss posthum gestellt werden ohne die Möglichkeit einer Anamnese oder Katamnese, und in der Regel liegt lediglich noch Knochen als einzige verfügbare Gewebequalität vor. Jedes geborgene Skelettelement ist daher gründlich auf Abweichungen bezüglich seiner Form, Größe und Struktur zu untersuchen und im Einzelfall zu prüfen, ob eine gefundene Abweichung Resultat eines intravitalen Prozesses ist oder lediglich eine Pseudopathologie aufgrund von Dekompositionsvorgängen vorliegt. In manchen Fällen ist der äußere Aspekt eines Skelettelementes unauffällig, so dass nur eine radiologische oder histologische Inspektion Hinweise auf ein pathologisches Geschehen liefern kann. Auch für den Bereich der Paläopathologie liegt eine Fülle von Spezialliteratur vor, auch in enzyklopädischer Form (z. B. Schultz 1988, Aufderheide u. Rodriguez-Martin 1998), so dass an dieser Stelle daher lediglich auf einige häufig auftretende und sicher zu diagnostizierende Krankheitskomplexe anhand ausgewählter Beispiele eingegangen werden soll: Degenerative Erkrankungen der Gelenke und Frakturen sind primäre Erkrankungen des Skelettes und daher in der Regel zweifelsfrei zu diagnostizieren. Ein Frakturgeschehen ist Folge zu hoher physikalischer Belastungen des Knochens, und in vielen Fällen lässt die Lokalisation der Fraktur eindeutige Rückschlüsse auf die Ursache der Verletzung zu. Ein Bruch im handgelenknahen Bereich der Unterarmknochen ist häufig Folge eines Sturzes nach vorn, wenn die Person den Sturz mit vorgestreckten Armen abfangen will. Fraktu- Prähistorische Anthropologie 97 ren des Fersenbeines oder auch der Wirbelsäule sind charakteristisch für Stürze aus großer Höhe. Verletzungen des Schädels können in Bezug auf ihre Ätiologie nach der „Hutkrempenregel“ beurteilt werden: Liegt die Fraktur oberhalb der gedachten Krempenlinie eines Hutträgers, war die Ursache ein Schlag oder Hieb auf den Kopf (wobei die Form des Traumas charakteristisch für die verwendete Waffe ist). Liegt die Fraktur jedoch unterhalb dieser Krempenlinie, ist das Trauma wiederum eher Folge eines Sturzes (Herrmann et al. 1990). Von diesen Verletzungen infolge direkter Gewalt- oder Krafteinwirkung zu unterscheiden sind pathologische Frakturen, welche aufgrund einer Ermüdung des Knochens durch Mineralverlust entstehen und somit Folge einer vorherigen Primärerkrankung sind, wie z. B. Oberschenkelhalsbrüche infolge von Osteoporose oder Rippenbrüche infolge von Rippenmetastasen eines Lungenkarzinoms. Degenerative Erkrankungen der Gelenke sind Folge des Zugrundegehens des Gelenkknorpels aufgrund unphysiologisch hoher Belastung, etwa durch harte Arbeit oder auch aufgrund von Fehlstellungen der Gelenke. Sie manifestieren sich am Skelett zunächst in der Ausprägung von Knochenanbau in Form von Osteophyten, welche in schweren Fällen mehrere Millimeter lang werden können. Sie sind als Reaktion des Körpers auf das schmerzende Gelenk zu verstehen, welches durch knöcherne Überbrückung ruhiggestellt und dysfunktional wird. Sukzessive kommt es auch zu einer Formveränderung des betroffenen Gelenkes und kompaktknöcherner Verstärkung der Kortikalis. Bei vollständiger Erosion des Gelenkknorpels gleitet Knochen auf Knochen, kenntlich an der wie poliert erscheinenden Gelenkfläche (Eburnisation). Die Schwere der Ausprägung einer degenerativen Gelenkerkrankung korreliert nicht immer mit der individuellen Beeinträchtigung durch Schmerzen. Eine gewisse Gelenkalterung während des Lebens ist ohnehin die Norm, so dass die Grenzen zwischen normalem „Verschleiß“ und beginnender echter Pathologie oft nur schwer zu ziehen sind. Die Verteilung degenerativer Erkrankungen auf die einzelnen Gelenke des Körpers und die Abschnitte der Wirbelsäule ist von besonderem Interesse für die Rekonstruktion täglicher Aktivitätsmuster der Individuen und lässt u. a. die Rekonstruktion arbeitsteiliger Lebensweise zwischen den Geschlechtern zu (Larsen 1997). Infektionserkrankungen sind nur dann morphologisch am Skelett zu diagnostizieren, wenn der Knochen primärer Infektionsherd ist (z. B. im Falle einer Knochenmarksvereiterung) oder wenn das Skelett sekundär befallen wird. Im letztgenannten, häufigeren Falle bedarf es eines längeren bis chronischen Krankheitsverlaufes, um eine Infektion am Knochen diagnostizieren zu können. Infektionen mit hochpathogenen Erregern wie z. B. der Pest haben in präantibiotischen Zeiten den Individualtod in so kurzer Zeit herbeigeführt, dass diese schwere Erkrankung keinerlei Spuren am Skelett hinterlässt und nur noch molekularbiologisch durch Detektion von Relikten des Krankheitserregers selbst diagnostizierbar ist (s. Kap. 2.3.5). Bei epidemieartig auftretenden Infektionen kann das abweichende Mortalitätsprofil der Individuen aufschlussreich sein, ohne dass jedoch eine Diagnose der Krankheit möglich ist. Klassische Beispiele für chronisch verlaufende Infektionskrankheiten mit charakteristischen Symptomen am Skelett sind Lepra, Syphilis und Tuberkulose 98 Evolution des Menschen (Box 2.10). Es ist jedoch nicht ohne Weiteres möglich, aus der Anzahl von Skeletten, welche eindeutige Symptome einer Infektionserkrankung aufweisen, auf den Prozentsatz Erkrankter in der Lebendbevölkerung zu schließen, da die altersspezifische Mortalitätsrate einer jeden Erkrankung einbezogen werden muss. Wenn z. B. im Falle der Tuberkuloseinfektion im Jugendalter eine lediglich zehnprozentige Mortalität besteht, wird durch die Anzahl jugendlicher Skelette mit Tuberkulosesymptomen in einer Skelettserie die tatsächliche Krankheitsbelastung der Lebendbevölkerung deutlich unterschätzt (Waldron 1994). Box 2.10 Zur Epidemiologie von Lepra und Tuberkulose Die Lepra, hervorgerufen durch Tröpfchenübertragung von Mycobacterium leprae, ist eine chronische Erkrankung, welche Haut, Nasenschleimhaut, periphere Nerven und Knochen befällt. Die lepromatöse Lepra beginnt mit einer chronischen Rhinitis, welche zunächst unspezifisch verläuft. Durch langsame Zerstörung der Nasenschleimhaut,des Nasenseptums,des Nasenbodens und des knöchernen Gaumens mit Verlust der Frontzähne entwickelt sich die charakteristische Facies leprosa.Die tuberkuloide Lepra ist dagegen essentiell eine Erkrankung der peripheren Nerven, deren Zerstörung Taubheit in den betroffenen Körperteilen hervorruft;es kommt zur Atrophie von Muskeln und Knochen sowie zur Resorption der Finger und Zehen. Im christlichen Europa wurde die Lepra als Gottesstrafe angesehen. Per Gesetz wurde der Kontakt zwischen Leprösen und Gesunden minimiert, die Leprakranken in Leprosorien untergebracht. Die Tuberkulose ist eine primäre Infektion der Lunge durch Inhalation von Mycobacterium tuberculosis, welche sekundär das Skelett befällt und dort charakteristische Zerstörungen der Wirbelsäule verursacht. Es besteht eine Kreuzreaktivität zwischen Mycobacterium tuberculosis und Mycobacterium leprae, und bereits 1924 fiel auf, dass Tuberkuloseimpfungen eine protektive Wirkung in Bezug auf Lepra hatten. Während die Lepra mit ihrer mehrjährigen Inkubationszeit einen Selektionsvorteil in dünn besiedelten Gebieten hat, konnte sich die Tuberkulose im Verlauf zunehmender Bevölkerungsdichte immer mehr durchsetzen. Da eine Primärinfektion mit Tuberkulose einen gewissen Infektionsschutz gegenüber Lepra darstellt (werden tuberkulin-positive Individuen später mit Lepra infiziert, kommt es vermehrt zur viel weniger infektiösen tuberkuloiden Lepra), konnte die Tuberkulose im Verlauf des europäischen Mittelalters die Lepra zunehmend verdrängen. Die verbreitete Praxis der städtischen Milchviehhaltung war darüber hinaus der Verbreitung von Mycobacterium bovis, des Erregers der Rindertuberkulose, förderlich. Prähistorische Anthropologie 99 Abb. 2.30. Porotische Hyperostose auf einem kindlichen Unterkiefer als Folge von Vitamin C-Mangel, typischerweise in Gelenknähe lokalisiert Alimentäre Erkrankungen wie Vitamin- oder Spurenelementmangel, ihrerseits wiederum häufig Folge allgemeiner Fehlernährung, sind ebenfalls nur dann zu diagnostizieren, wenn der Skelettstoffwechsel betroffen ist. Dies ist z. B. bei Vitamin C-Mangel der Fall, da Vitamin C unverzichtbarer Kofaktor bei der Hydroxylierung der Aminosäure Prolin und damit für die Stabilität des Knochenmatrixkollagens erforderlich ist (Box 2.11). Das bei Vitamin C-Mangel gebildete Defektkollagen ist weniger elastisch, so dass es aufgrund einer resultierenden „Gewebsbrüchigkeit“ zu Blutungen kommt (z. B. Zahnfleischbluten), auch unter die Knochenhaut. Als Reaktion neugebildete, stark poröse Knochenauflagerungen finden sich daher bevorzugt in Gelenknähe, also an Orten hoher mechanischer Belastung (Abb. 2.30). Vitamin D-Mangel im Kindesalter führt zu den klassischen Symptomen der Rachitis, Verbiegungen der Skelettelemente durch unzureichende Mineralisierung. Neben der Ausbildung flächiger, poröser Knochenauflagerungen ist auch die Auswirkung auf die mikrostrukturelle Organisation des Knochens charakteristisch: Vitamin D-Mangel führt zu einem niedrigen Serum-Calciumspiegel, welcher wiederum die Ausschüttung von Parathormon induziert. Dieses aktiviert die Osteoclasten, welche durch Knochenabbau den SerumKalziumspiegel wieder anheben, aber charakteristische Resorptionslakunen im Knochen hinterlassen (vgl. Kap. 3.2). Alimentäre Erkrankungen wie Vitamin C- und Vitamin D-Mangel, auch Eisenmangelanämien, finden sich in der Regel gehäuft an Skelettfunden von Kleinkindern. Gemeinsam mit einer archäometrischen Rekonstruktion der Ernährungsweise (s. Kap. 2.3.5) konnte mehrfach gezeigt werden, dass überwiegend solche Kinder betroffen waren, welche gerade abgestillt wurden (Dittmann 100 Evolution des Menschen Box 2.11 Pathophysiologie des Vitamin C-Mangels in Bezug auf die Kollagenbildung Das für die Hydroxylierung der Aminosäure Prolin notwendige Enzym Prolyl-Hydroxylase ist an die Präsenz von molekularem Sauerstoff, Eisen und Ascorbinsäure (Vitamin C) gebunden. Es enthält in seinem aktiven Zentrum ein Fe2+-Atom, dessen Oxidationsstufe für die Enzymaktivität wesentlich ist.Um das Eisen in seiner zweiwertigen Form zu erhalten, wird Ascorbinsäure als Kofaktor benötigt, welche als Reduktionsmittel wirkt und anfallendes Fe3+ durch Elektronenabgabe sofort wieder in den aktiven, zweiwertigen Zustand überführt. Sowohl bei Eisen- als auch Vitamin C-Mangel kann daher keine regelhafte Hydroxylierung des Prolins stattfinden, was zu einer mangelnden Stabilität der Kollagen I-Tripelhelix führt. Mit einem Körperpool von etwa 2000 mg Vitamin C und einem täglichen Bedarf von 60–70 mg manifestieren sich Vitamin C-Mangelsymptome bereits nach einem bis drei Monaten einer Vitamin C-freien Ernährung. Aufgrund der Sauerstoff- und Temperatursensitivität des Vitamin C ist ein Vitaminverlust von bis zu 50% bereits nach nur zwei Tagen der Lagerung von Nahrungsmitteln möglich. Mangelzustände werden daher rasch erreicht. u. Grupe 2000). Die Koinzidenz des Sterbegipfels im Kleinkindalter mit einer Akkumulation von Fehlernährungssymptomen an den Skeletten und dem Abstillzeitpunkt ist keineswegs zufällig. Während die Kinder noch gestillt werden, sind sie durch die Muttermilch sowohl in Bezug auf die Nährstoffe als auch in Bezug auf die passive Immunisierung gegenüber einer Vielfalt von Infektionen geschützt. Bekanntlich stellt der Entwöhnungszeitpunkt für Kleinkinder einen besonders risikobehafteten Lebensabschnitt dar, da sie in dieser Zeit besonders anfällig für Affektionen des Verdauungstraktes sind (weanling diarrhea). Die anthropologische Diagnose der Skelettfunde gibt somit detaillierten Aufschluss über das Wohlergehen des nachwachsenden Teiles einer Population – wesentlicher Parameter für deren weitere demographische Entwicklung. Aufgrund der günstigen Überlieferungsaussichten von Zähnen (Dichte und Härte des Zahnschmelzes, Protektion des Dentins durch den Alveolarknochen) gehören die Erkrankungen der Zähne und des Zahnhalteapparates zu den am häufigsten diagnostizierten pathologischen Affektionen von Skelettfunden. Den Bevölkerungen der Steinzeit praktisch noch unbekannt, zählt die Karies heute mit mehr als 95% Erkrankter in den westlichen Industrienationen zu den häufigsten „Zivilisationskrankheiten“. Der Zahnschmelz ist dem Mundhöhlenmilieu und damit auch gegebenenfalls saurem pH-Wert unmittelbar ausgesetzt. In Abhängigkeit von der Nahrungszusammensetzung und -verarbeitung und Prähistorische Anthropologie 101 Abb. 2.31. Stadien fortschreitender Karieserkrankung. Von links nach rechts: Caries superficialis, C. media, C. profunda, vollständig zerstörte Zahnkrone. Zeichnung: M. Schulz der Mundhygiene vergären Mikroorganismen in der Mundhöhle Kohlenhydrate zu Säuren, welche nach und nach zu einer bakteriell induzierten chemischen Demineralisierung des Zahnschmelzes führen. Der Beginn des Mineralverlustes (Initialkaries) äußert sich lediglich in Form einer Verfärbung der Zahnkrone (Schmelzfleck). Der fortschreitende Mineralverlust betrifft zunächst nur die Schmelzschicht (Caries superficialis), setzt sich bis zum Dentin fort (Caries media) und zerstört schließlich die nervöse Versorgung des Zahnes (Caries profunda, Abb. 2.31). Da Zahnschmelz sich nicht regenerieren kann, führt Karies ohne therapeutische Behandlung letztlich zum Zahnverlust. Im Rahmen epidemiologischer Fragestellungen wird üblicherweise unterschieden zwischen der Kariesfrequenz (Anteil an Karies erkrankter Individuen einer Skelettserie) und der Kariesintensität (Anzahl erkrankter Zähne bezogen auf alle Zähne des Skelettkollektives) (Herrmann et al. 1990). Erkrankungen des Zahnhalteapparates werden als Parodontopathie bezeichnet und können massive Zerstörungen auch des Alveolarknochens mit anschließendem Zahnverlust hervorrufen. Die entzündliche Form (Parodontitis) wird mehrheitlich wie die Karies durch Bakterien (z. B. Streptokokken) hervorgerufen. Die nicht-entzündliche Degeneration des Zahnhalteapparates (Parodontose) ist dagegen Folge hoher physikalischer Belastungen des Gebisses (etwa Gebrauch von Zähnen als körpereigenes Werkzeug) oder auch von Parafunktionen wie z. B. dem Bruxismus (stressbedingtes Zähneknirschen). Das Ableiten von physischem oder psychischem Stress über die Zahnreihen kann auch bei nicht-industrialisierten Bevölkerungen häufig sein (Kaidonis et al. 1993). Dem mazerierten Kiefer ist es oft nicht mehr mit Sicherheit anzusehen, ob eine Parodontopathie entzündlichen oder nicht-entzündlichen Ursprunges ist. Gegebenenfalls sind über spezielle Abriebmuster auf den Zahnkronen Aufschlüsse auf den Gebrauch von Zähnen als Werkzeug zu gewinnen. Bei Vorliegen von Parodontopathien ist bei der Sterbealtersbestimmung Erwachsener mit Hilfe der Zahnzementchronologie Vorsicht geboten, da das Desmodontium dysfunktional geworden sein kann. Nicht zuletzt können Erkrankungen des Zahnhalteapparates auch Folge anderer Grunderkrankungen sein, z. B. von Diabetes oder diversen Stoffwechselstörungen. 102 Evolution des Menschen Abb. 2.32. Transversale Schmelzhypoplasien Transversale Schmelzhypoplasien (Abb. 2.32) entstehen als Folge von physiologischen Stresssituationen während der Zahnschmelzgenese und beruhen auf Fehlbildungen des Zahnschmelzes, welche nach Überwindung der Situation (z. B. Infektionserkrankung, Nahrungsmangel) als transversale Einkerbung der Zahnkrone persistieren. Da diese Wachstumshemmung der Zahnkrone unmittelbare Antwort auf eine anderweitige massive Belastung des noch jungen Organismus ist, kann anhand der Mineralisationszeiten für den Zahnschmelz der einzelnen Zahntypen durch Messung von der Schmelz/ZementGrenze auf die Hypoplasie das Individualalter der Genese dieser Fehlbildung festgestellt werden (z. B. Goodman et al. 1980). Somit lassen sich wiederum solche Lebensalter erkennen, in denen die heranwachsenden Individuen besonderen Risiken ausgesetzt waren, wie z. B. das Abstillalter. 2.3.4 Paläodemographie Ziel der Paläodemographie ist es, zum Verständnis der Lebensbedingungen prähistorischer Bevölkerungen beizutragen. Sie dient der Rekonstruktion demographischer Parameter früherer Bevölkerungen auf der Grundlage von Skelettfunden. Voraussetzungen dafür sind valide Daten zum Sterbealter und Geschlecht der einzelnen Individuen und Kenntnisse über die Zusammensetzung der Skelettpopulation. Die Paläodemographie versucht, Informationen über Verteilungen, Entwicklung und Dichte früherer Bevölkerungen, von denen keine schriftlichen Quellen existieren, zu erlangen (Acsadi u. Nemeskeri Prähistorische Anthropologie 103 1970, Buikstra u. Koenigsberg 1985). Damit aggregiert sie auf der Individualebene am Skelett erfasste Daten auf der Bevölkerungsebene (zur Definition des Begriffs der Bevölkerung s. Kap. 3.3.1). Die Ausgangsdaten der Paläodemographie sind die an Skeletten erhobenen anthropologischen Merkmale. Ihre Leistung besteht darin, Kenntnisse über die demographischen Strukturen von Bevölkerungen zu gewinnen, die mit anderen Quellen nicht oder nur in Kombination mit den anthropologischen Daten erlangt werden können. Dies geschieht prinzipiell dadurch, dass die Gesamtzahl der untersuchten Individuen betrachtet wird und dabei grundsätzlich neue Erkenntnisse gewonnen werden, die bei der Untersuchung auf der Individuenebene nicht aufgezeigt werden können (Abb. 2.3.19). Ihr liegt eine biodemographische Ausgangsannahme zugrunde, nach der Bevölkerungen auf die Beschaffenheit ihres kulturellen und ökologischen Umfeldes mit demographisch messbaren Veränderungen reagieren. Dies impliziert die Annahme, dass sich das Prinzip der biologischen Antwort des Menschen auf Umweltbedingungen während der betrachteten Zeitspanne der letzten etwa 12 000 Jahre seit der Sesshaftwerdung des Menschen nicht geändert hat. Dieses Prinzip der Uniformität gilt als eine essentielle Annahme in der paläodemographischen Forschung (Howell 1976). Gerade biologische Lebenslaufprozesse wie Kindheitsentwicklung, fertile Altersspanne oder Alterung bedingen die demographische Struktur und Dynamik einer Bevölkerung. Ähnliche Bedingungen, denen Bevölkerungen in der Vergangenheit ausgesetzt waren, führten damals ebenso wie heute und in Zukunft zu vergleichbaren Reaktionsmustern. Dies betrifft nicht nur die Zeitachse, sondern ebenso die lebensräumliche Vergleichbarkeit. Änderungen der Fertilität beispielsweise bewirken in einer Industriebevölkerung eine Veränderung der Alterszusammensetzung,die in ihrem Verlauf,nicht aber in ihrem Ausmaß entsprechenden Prozessen in prähistorischen bäuerlichen Bevölkerungen vergleichbar ist. Einer dieser Aspekte betrifft die Sterblichkeitsverhältnisse einer Bevölkerung. Ist die Sterbealtersbestimmung eines Individuums vorgenommen worden (vgl. Kap. 2.3.3), so ermöglicht dieses Ergebnis zunächst einmal eine Aussage bezüglich der Anzahl der Jahre, die diese Person in der zu betrachtenden Bevölkerung gelebt hat. Eine paläopathologische Analyse erschließt darüber hinaus mögliche Erkrankungen, die gesundheitliche Risiken darstellten, welche von dieser Person aber überlebt wurden. In seltenen Einzelfällen kann zudem die Todesursache und damit der ursächliche Faktor für die Begrenzung der Lebenslänge ermittelt werden (vgl. Kap. 2.3.3). Eine sorgfältige Analyse der vorhandenen Individualdaten stellt die erste und damit Ausgangsebene der Paläodemographie dar. Es kann jedoch noch keine Antwort auf die Frage gegeben werden, ob diese Person ein im Verhältnis zu anderen Mitgliedern längeres bzw. mit weniger gesundheitlichen Risken behaftetes Leben geführt hat. Dies setzt voraus, dass ein Risikomodell der betreffenden Bevölkerung bekannt ist. Ein solches Modell unter den gegebenen Bedingungen zu erstellen, ist die zweite Ebene bzw. Aufgabenstruktur der Paläodemographie. Ist dies erreicht, lässt sich das berechnete Sterblichkeitsmuster hinsichtlich seiner altersspezifischen Sterberaten interpretieren. Dies kann als die dritte und komplexeste Ebene der Paläode- 104 Evolution des Menschen mographie angesehen werden. Bei einer ökotoporientierten Betrachtung lassen sich Rückschlüsse auf belastende oder gesundheitsfördernde Umweltbedingungen (insbesondere Arbeits- und Ernährungsverhältnisse) ziehen. Eine geeignete Datengrundlage ermöglicht die Analyse der Bevölkerungsdynamik und ihrer Veränderungen in Zeit und Raum. Für die betrachtete Bevölkerung kann damit im Idealfall ein wesentlicher Beitrag zum Verständnis prähistorischer Lebensmuster geleistet werden. Der zeitliche Forschungsrahmen Der zeitliche Forschungsrahmen, in dem sich die paläodemographische Forschung bewegt, wird einerseits durch die Materialgrundlage und andererseits durch das Forschungskonzept eingegrenzt. Für eine Rekonstruktion demographischer Prozesse bedarf es einer Skelettserie, die dem Bevölkerungsanspruch (s. unten) gerecht wird. Die frühesten Bestattungskomplexe des anatomisch modernen Menschen im ausgehenden Paläolithikum umfassen lediglich einzelne bis wenige Individuen und erlauben noch keine Kalkulation von Gruppendaten. Indirekte Verfahren, wie beispielsweise die Bedeutung von Symbolen und Idolen für die Gruppenidentität mesolithischer Jäger-Sammler-Gesellschaften, lassen zwar Rückschlüsse auf Gruppenmobilität und -zusammensetzung zu (Constandse-Westermann et al. 1984). Dies kann jedoch nicht durch eine ausreichende Materialgrundlage gestützt werden. Erst für die prähistorischen Zeiten, in denen eine soziale Gruppe die intentionale Bestattung ihrer Mitglieder an tradierten Plätzen praktizierte, kann eine paläodemographische Forschung ansetzen. Die ältesten Fundkomplexe, bei denen dies möglich ist, treten im Natufium, der mesolithischen Kulturstufe im Küstenstreifen des östlichen Mittelmeeres, mit saisonalen Camps wie Ain Mallaha auf, die in das 12. bis 9. vorchristliche Jahrtausend datieren. Sie dokumentieren den Übergang von der aneignenden zur produzierenden Lebensweise des Neolithikums vom 8. bis 5. Jahrtausend v. Chr.,wie dies in den frühen Fundorten des präkeramischen Abu Hureyra oder Nahal Oren bereits vollzogen ist (Mellart 1975, Molleson 1994). Bestattungen werden dort zunächst in den Wohnbereichen angelegt, später, bei komplexer werdenden Siedlungsstrukturen, in separierte Bestattungsareale aus den Siedlungen ausgelagert. Mit der Sesshaftwerdung im Zuge der neolithischen Lebensweise werden die Verstorbenen in der Regel in nahe gelegenen Gräberfeldern bestattet und sind damit prinzipiell für die paläodemographische Forschung zugänglich. In der nahöstlichen Region des „Fruchtbaren Halbmondes“ finden sich auch hier die ältesten großen Fundkomplexe wie beispielsweise Çatal Hüyük in der heutigen Türkei, eine bereits im Neolithikum dicht besiedelte städtische Bevölkerungsagglomeration mit bis zu zehntausend Einwohnern (Shane u. Küçük 1998). Gelegentlich werden auch nicht-intentionale Bestattungen für die paläodemographische Untersuchung zugänglich, wie bei dem neolithischen Fundkomplex von Talheim, bei dem die Einwohner einer Siedlung als Opfer eines Überfalls gemeinsam verscharrt wurden (Wahl u. König 1987), oder den Einwohnern von Pompeji und Herculaneum, die im Jahr 79 Opfer eines Vulkanausbruchs des Vesuvs wurden (Mastrolorenzo et al. 2001). Solche Fundkom- Prähistorische Anthropologie 105 Abb. 2.33. Für die paläodemographische Rekonstruktion der Skelettserie eines Gräberfeldes zu berücksichtigende Faktoren am Beispiel des Gräberfeldes Demircihüyük (vgl. Text). Die anthropologischen Analysen sind gerahmt. Das Zusammenspiel anthropologischer und archäologischer Daten ist von der jeweiligen Befundsituation abhängig und muss bei jeder paläodemographischen Rekonstruktion erneut konstruiert werden plexe sind hervorragend geeignet, Momentaufnahmen einer Bevölkerung zu dokumentieren, die anhand von sukzessiven Bestattungen in Gräberfeldern methodisch nur bedingt zugänglich sind. In Ausnahmefällen liegen durch epigraphische Aufzeichnungen, wie etwa anhand von römischen oder byzantinischen Grabmälern, exakte Geburts- und Sterbedaten einzelner Personen oder selektierter Bevölkerungsgruppen vor. Die paläodemographische Betrachtung früherer Bevölkerungen endet mit dem Auftreten demographisch verwertbarer Bevölkerungsaufzeichnungen, welche die paläodemographischen Möglichkeiten an Präzision und damit Aussagekraft übertreffen. Dies waren zunächst Geburts-, Heirats- und Sterbedaten aus Kirchenregistern, Hospitälern, Klöstern, Ortssippenbüchern usw., die teilweise bis in das 16. Jh. zurückführten. Dieser als Historische Demographie bezeichnete Forschungszweig wird gleichermaßen von Geschichtswissenschaftlern, Demo- 106 Evolution des Menschen graphen und Anthropologen aus verschiedenen Blickwinkeln in den Mittelpunkt des Forschungsinteresse gerückt. Trotz der Problematik defekter Daten, mit denen auch die Historische Demographie konfrontiert ist, gelingen regionale Bevölkerungsrekonstruktionen, gekoppelt mit zum Teil sehr detaillierten Sozialstrukturanalysen (z. B. Imhof 1986, 1995, Voland 1998, Voland u. Engel 2000, Luy 2002a). Mit der flächendeckenden Einführung der amtlichen Statistik wird auch dieser historisch-demographische Forschungsansatz obsolet, die nun verfügbaren Daten sind ungleich präziser und umfassender. Die moderne Demographie entwickelt für die Erfassung der Bevölkerungsprozesse ein umfangreiches und auf die Datenlage zugeschnittenes Methodenrepertoire (Abb. 2.33; vgl. Kap. 3.2). Entwicklung der Paläodemographie Eingeleitet wurde die paläodemographische Forschung durch den Paradigmenwechsel der typologischen Betrachtung in der frühen Anthropologie zu einem populationsgenetischen Forschungskonzept in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts (vgl. Kap. 2.3.1; 3.1). Dadurch, dass nun die biologische Variabilität einer Gruppe zur Interpretationsgrundlage wurde, stand der Weg offen für das paläodemographische Konzept in seiner interdisziplinären Definition. Allgemein wird die Begründung der paläodemographischen Forschung mit den Arbeiten Lawrence Angel’s verbunden, der mit Berechnungen der Lebenserwartungen im alten Griechenland das Konzept der Sterbetafelberechnung in die Paläodemographie integrierte (Angel 1947, 1953, 1969). Er führte damit die von Braidwood und Howe (1960) in die Archäologie eingebrachte ökosystemorientierte Betrachtung prähistorischer Bevölkerungen parallel in die anthropologische Forschung ein. Methodische Grundlagen wurden der jungen Wissenschaft durch das gemeinsame Werk eines Demographen und eines Anthropologen (Acsadi u. Nemeskeri, 1970) bereitgestellt (s. Koenigsberg u. Frankenberg, 2002; vgl. Hoppa 2002 für einen ausführlichen Überblick über die Geschichte der Paläodemographie). Die kritischen Anmerkungen der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts betrafen insbesondere die Problematik der makromorphologischen Sterbealtersbestimmungen (Bocquet-Appel u. Masset 1982), die zunächst unüberwindbar schien (vgl. Kap. 2.3.2). Die Autoren zeigten anschaulich, dass die jeweils erzielte Altersverteilung einer untersuchten Skelettserie diejenige der Referenzstichprobe widerspiegelt, an der die angewandte Methode entwickelt wurde. Die Unzulänglichkeiten der Zusammensetzung von Referenzpopulationen,oft altersselektierte Pathologiestichproben,konnten nicht besser dokumentiert werden.Eine Regression zur Mitte hin – jüngere Erwachsene werden zu alt und senile Individuen zu jung geschätzt – war dabei einer der wesentlichen unerwünschten Effekte. Im Zuge dieser Diskussion erwies sich, dass diese stichhaltigen Argumente nicht entkräftet werden konnten (VanGerven u. Armelagos 1983, Buikstra u. Koenigsberg 1985, Bocquet-Appel u. Masset 1985). Eine nahezu vollständige Unterbrechung der paläodemographischen Forschung für ein Jahrzehnt war die Folge. Prähistorische Anthropologie 107 Parallel dazu wirkte weiterhin die Kritik seitens der Demographen, dass Paläodemographen über zu wenig Kenntnisse der formalen Demographie verfügten und dass die von ihnen betrachteten Skelettserien zu klein und damit nicht repräsentativ für eine reale Bevölkerung seien (Petersen 1975). Wenn auch die Kritik aus demographischer Sicht berechtigt war, so änderte dies nichts an der Materialzusammensetzung und -beschaffenheit. Erst seit Mitte der neunziger Jahre scheint ein Durchbruch dahingehend gelungen zu sein,dass hinsichtlich des limitierenden Faktors,der Materialbeschaffenheit, neue realistische Arbeitsziele entwickelt werden. Der adäquate Umgang mit den im demographischen Sinn defekten Daten sowie das Bemühen um verbesserte Methoden der Datengewinnung stehen seitdem im Vordergrund der paläodemographischen Forschung. Die aktuelle Forschungssituation kann anhand der wesentlichen Fragen an die Paläodemographie (Milner et al. 2000, Hoppa 2002) aufgezeigt werden, die im Folgenden behandelt werden. Was sagt eine vorliegende Skelettserie über die zugrunde liegende Bevölkerung aus? Die prähistorische Anthropologie erfasst mit ihren aus dem archäologischen Kontext vorliegenden Skelettserien nur einen Teilausschnitt aus der Bevölkerung eines definierten Raumes und einer definierten Zeitspanne. Diese Skelettkollektive unterliegen Selektionskriterien, die in unterschiedlichem Maße wirken können. Nicht jeder Person, die in einer prähistorischen Gesellschaft gelebt hat, kommt die gleiche Wahrscheinlichkeit zu, für eine paläodemographische Untersuchungen zur Verfügung zu stehen. Aber wie können wir den Selektionsprozess verstehen, der dazu führt, dass nur ein Ausschnitt einer prähistorischen Bevölkerung zur paläodemographischen Untersuchung vorliegt? In Anlehnung an Milner et al. (2000) wird im Folgenden am Beispiel einer prähistorischen Siedlungsgemeinschaft gezeigt, wie komplex und damit in der paläodemographischen Forschung nicht pauschal zu handhaben dieser Bereich ist (Box 2.12). „Defekte Daten“ – Möglichkeiten zur Bestimmung des Fehlbestandes Bei der Beurteilung einer prähistorischen Skelettserie ist die Abschätzung des durch eine Selektion oder eine Kombination der Selektionskriterien verursachten Fehlbestandes ein wesentlicher Aspekt. Bevor daher paläodemographische Parameter ermittelt werden können, muss zunächst die Altersverteilung der Gestorbenen auf ihre Plausibilität hin geprüft werden. Welche Rahmenbedingungen sind aber für eine prähistorische Bevölkerung anzunehmen? Wie niedrig kann unter günstigen Lebensbedingungen die Kindersterblichkeit in einer nicht modern-medizinisch betreuten Bevölkerung liegen? Oder wie stark kann sie unter ungünstigen hygienischen und Ernährungsverhältnissen ansteigen? Von der angenommenen Spannweite dieser und weiterer Werte ist die Beurteilung eines Fehlbestandes in einer unbekannten Skelettserie abhängig. Unter Berücksichtigung der Uniformitätsregel (s. oben) muss demnach mit geeigneter Methodik versucht werden, die demographischen Charakteristika 108 Evolution des Menschen Box 2.12 Die fünf Stadien der paläodemographischen Selektion 1. Übergangsstadium Leben – Tod: Nahezu jede Bevölkerung stellt ein offenes dynamisches System dar, in das neue Mitglieder verschiedenen Geschlechts und unterschiedlichen Alters zu verschiedenen Zeiten aufgenommen werden, die nicht lebenslang zur Bevölkerung zu zählen sind. Analog gilt dies auch für abwandernde Personen, die nach ihrem Tod in der Regel nicht in ihrem Herkunftsort, sondern in ihrem letzten Wohnort bestattet werden. Sie stehen in dem betrachteten Siedlungsgräberfeld dann nicht zur Verfügung, obwohl sie eine Anzahl von Jahren zur Bevölkerung gehörten. Das Ausmaß der dadurch entstehenden Verzerrungen ist abhängig von der Höhe des Migrationsaufkommens und des Migrationssaldos (vgl.Kap.3.3).Quantitativ ist diese Fehlerquelle praktisch nicht zu ermitteln,wenn auch die Archäometrie mit der Analyse stabiler Isotope wertvolle Hinweise auf die Wanderungstätigkeit früherer Bevölkerungen liefern kann (vgl. Kap. 2.3.5). 2. Übergangsstadium Tod – Bestattung: Die kulturellen Traditionen der betrachteten Bevölkerung tragen maßgeblich dazu bei, welche ihrer gestorbenen Mitglieder in dem gemeinsamen Kontext eines Gräberfeldes bestattet werden. Diejenigen Mitglieder einer Bevölkerung, denen aus unterschiedlichen Gründen eine andere Behandlung nach dem Tod zuteil wurde, liegen ebenfalls häufig nicht in dem Skelettkollektiv vor. Wie ausgeprägt dieses Phänomen ist, zeigt sich insbesondere bei Situationen, in denen diese Sonderbestattungen aufgefunden wurden. Beispielsweise diente die Bestattung ungetaufter Kinder, meist Säuglinge, unterhalb der Dachtraufen christlicher Kirchen durch das vom Kirchendach herablaufende und damit vermeintlich geweihte Regenwasser in verschiedenen Regionen Mitteleuropas als nachträgliche Segnung. Neben diesen Traufbestattungen (Ulrich-Bochsler 1997, 2002, Wittwer-Backofen 1998) finden sich Kindergräber in Gruben bronzezeitlicher Wohnhäuser oder in eigenen Gräbergruppen an Siedlungsmauern etc.Neben den zahlreichen Dokumentationen von Sonderbestattungen aus historischem Kontext (Wahl 1994) liefert die ethnographische und frühneuzeitliche Beschäftigung mit dem Tod (Herrmann 2003, Illi 1992, Descœudres et al. 1995, Ariès 1997) einen Eindruck der Bandbreite von Bestattungssitten, mit denen auch in historischen Bevölkerungen gerechnet werden muss. Aber nicht nur der Bestattungsplatz spielt als Selektionskriterium des Überdauerns eine Rolle, sondern auch die Bestattungsweise. Die unterschiedlichen intentionellen Behandlungen des Leichnams (Mumifizierung, Leichenverbrennung, Sarg-, Topfbestattungen etc.) führen Prähistorische Anthropologie 109 Box 2.12 (Fortsetzung) zu unterschiedlicher Repräsentanz in der Gesamtserie (vgl. Kap. 2.3.1). Dadurch wird deutlich, welcher Art die Verzerrungen der Geschlechtsund Alterszusammensetzung sein können, wenn derartig sonderbestattete Tote aus dem Komplex der regulär im Gräberfeld und somit zur Untersuchung vorliegenden Bestatteten ausfallen. Für das am häufigsten beobachtete Phänomen der unterrepräsentierten jüngsten Altersklassen hat sich der Begriff des Kinderdefizites etabliert. 3. Übergangsstadium Bestattung – Ausgrabung: Die umgebungsbedingten Dekompositionsprozesse des Leichnams an seinem Bestattungsplatz (s. Kap. 2.3.2) sind ein in hohem Maße ausschlaggebendes Selektionskriterium für die Zusammensetzung der Skelettkollektive. Für das schon zuvor beschriebene Kinderdefizit werden in der prähistorischen Anthropologie bereits seit langem die Lagerungsbedingungen im Boden verantwortlich gemacht: Die feinen und weniger dicht mineralisierten Knochen von Kindern sind durch ein aggressives Umgebungsmilieu stärker gefährdet als die widerstandsfähigeren Knochen Erwachsener. Oberflächennahe Grabanlagen kleiner Kindergräber, die peripheren Grablegen von Frauen oder Angehörigen bestimmter sozialer Gruppen können beispielsweise durch Bodenerosionsprozesse, bodenchemische Prozesse oder Bodenorganismen derart reduziert werden, dass eine Verzerrung der Gruppenzusammensetzung resultiert. Eine möglichst umfassende taphonomische Analyse kann zumindest einen qualitativen Eindruck der abgelaufenen Prozesse vermitteln (Nestler 1982). 4. Übergangsstadium Ausgrabung – anthropologische Analyse: Dem Selektionsprozess durch die Veränderung des Knochengewebes im Boden schließt sich derjenige durch den Ausgrabungsprozess an. Unterschiedliche Grabungstechniken und Fähigkeiten der Ausgräber tragen dazu bei, dass Individuen bei gleich stark reduziertem Erhaltungszustand in einem Gräberfeld erfasst werden, in einem anderen jedoch nicht. So kann beispielsweise die Dokumentation eines Kinderskelettes von der Bergung der allein überdauernden Zahnkronen abhängen (die bei ungeübter Vorgehensweise übersehen werden können) oder Bodenverfärbungen durch Leichenschatten bei vollkommenem Abbau der Knochen (vgl. Kap. 2.3.2) fehlinterpretiert werden. Durch Optimierung von Grabungstechniken (Kunter 1990) sowie die intensive und aktive Beteiligung der Anthropologie bei der Planung und Durchführung der Ausgrabungen von Gräberfeldern hat sich diese Problem jedoch in den letzten Jahren reduzieren können. 110 Evolution des Menschen Box 2.12 (Fortsetzung) 5. Übergangsstadium anthropologische Analyse – paläodemographische Interpretation: Ist ein Individuum durch Skelettüberreste repräsentiert und liegt damit zur anthropologischen Untersuchung vor, sind nicht alle daraus zu extrahierenden biologischen Informationen gleichwertig. Vielmehr sind sie direkt von dem Erhaltungszustand abhängig. Ist daher der allgemeine Erhaltungszustand einer Skelettserie vergleichsweise günstig, lassen sich die anthropologischen Informationen mit höherer Präzision ermitteln als bei einer Vergleichsserie, die Daten mit höherer Fehlerbreite liefert. Paläodemographische Schätzwerte wie Sterbewahrscheinlichkeiten lassen sich dann nur bedingt vergleichen. Über die Variabilität der Datenqualität hinaus ist die methodenbedingte Fehlbestimmung noch kritischer zu betrachten. So birgt beispielsweise die Verschiebung eines Sterbemaximums durch systematisch zu niedrige Altersbestimmungen bei stark fragmentiertem Skelettmaterial Erwachsener eine Gefahr der Fehlinterpretation. Fazit: Da die paläodemographischen Forschung eine Rekonstruktionsabfolge darstellt,an deren Ende als Ziel die lebende Bevölkerung steht, ist sie gefordert, die jeweils unterschiedlichen Bedingungen, der jede einzelne Skelettserie ausgesetzt ist, möglichst exakt zu rekonstruieren. Nur mit ausreichender Kenntnis der postmortal abgelaufenen Prozesse ist der vorliegende Bevölkerungsausschnitt sinnvoll zu interpretieren. Der Einfluss der hier beschriebenen Stadien wird aus dem Resultat,dem vorliegenden Skelettmaterial und seinem Erhaltungszustand, retrospektiv erschlossen. einer Bevölkerung zu bewahren. Dies geschieht vor dem Hintergrund der Kenntnis der Variabilität menschlicher Bevölkerungsstrukturen. Diese Kenntnis erlaubt das Abstecken von Grenzwerten, im Rahmen derer sich die demographischen Daten jeder Bevölkerung bewegen. Solche Rahmenbedingungen der Paläodemographie können nur aus Kenntnis der Prozesse in heutigen Bevölkerungen vorgegeben werden, deren demographische Daten erfasst sind und die als Modellbevölkerungen fungieren. Da heutige Bevölkerungen, insbesondere diejenigen der Industriestaaten, aber im Laufe des letzten Jahrhunderts eine als „demographische Revolution“ bezeichnete (vgl. Kap. 3.3) und in der Geschichte der Demographie nie da gewesene Entwicklung durchgemacht haben, sind sie als Modellbevölkerungen für die Paläodemographie nur bedingt einzusetzen. Die Bandbreite paläodemographischer Daten wird daher durch eine Auswahl rezenter Jäger-Sammler-Bevölkerungen, kleiner Isolatbevölkerungen, Populationen aus Entwicklungsländern, Bevölkerungen aus Lebensräumen mit Extrembedingungen Prähistorische Anthropologie 111 und bekannten historischen Bevölkerungsstrukturen definiert, die diesen modernen Trend noch nicht zeigen. Darauf basierend ist seitens der Demographie, die mit ähnlichen Problemen „defekter Daten“ in Entwicklungsländern umzugehen hat, eine Reihe von Tests entwickelt worden, mit Hilfe derer eine Plausibilitätsschätzung der Alterszusammensetzung erfolgen kann (Brass 1975, United Nations 1983, Coale u. Demeny 1983, Ledermann 1969). Für die prähistorische Anthropologie ist dies erstmalig von Weiss (1973) umgesetzt worden. Aus diesen Annäherungen hat sich eine Reihe von Testformeln entwickelt, die spezifisch auf die Repräsentanzschätzung von Säuglingen und Kleinkindern anzuwenden sind (Tabelle 2.8). Sie gehen von einem aus zahlreichen Bevölkerungen empirisch ermittelten Muster der Sterberisiken aus, bei dem das Niveau der Säuglingssterblichkeit in engem Zusammenhang mit der Sterblichkeit älterer Kinder und Jugendlicher steht. Letzte weisen in Vergleichsbevölkerungen die niedrigsten Sterberaten während der gesamten Lebensspanne auf. Ein erhöhtes Sterberisiko dieser Altersgruppe kann als Indikator für ungünstige Lebensbedingungen betrachtet werden, die zwangsläufig zu einer proportionalen Erhöhung der Sterblichkeit im besonders gefährdeten Säuglingsalter führen. Weiterhin gehen die Schätzmodelle davon aus, dass die Altersgruppen der über 5jährigen Kinder in der zu testenden Skelettserie ungestört vorliegen. Dies stellt eine sicher nicht grundsätzlich zutreffende Prämisse dar, die im Einzelfall kritisch geprüft werden muss. Die gebräuchlichsten Schätzformeln werden am Beispiel der frühbronzezeitlichen Skelettserie des westlichen zentralanatolischen Gräberfeldes von Demircihüyük (sprich: demirdschihüjük) demonstriert (Korffmann 1983, Seeher 2000, Wittwer-Backofen 2000). Bei diesem Gräberfeld mit knapp 500 Gräbern wurden 363 Skelette geborgen. In einer Reihe von Gräbern konnten trotz aller Bemühungen keine Skelettreste festgestellt werden. Ihre geringe Größe und oberflächennahe Lage weist sie als Säuglingsgräber aus. Das Beispiel zeigt anschaulich die unterschiedlichen Schätzwerte, einerseits ausschließlich basierend auf der Anzahl nachgewiesener Skelette und andererseits unter Berücksichtigung der leeren Kindergräber. Erste Vorgehensweise dokumentiert ein deutliches Defizit der Säuglinge unter einem Jahr und in der Folge davon eine überhöhte Lebenserwartung. Dieser Fehlbestand wird nahezu vollständig ausgeglichen, wenn die leeren Kindergräber dieser Altersgruppe hinzugerechnet werden. Entsprechend der ersten beiden Testformeln ergeben sich für das quantitative Verhältnis der älteren Kinder untereinander bzw. deren Relation zu den Erwachsenen plausible Werte, die für die Repräsentanz dieser Altersgruppen sprechen. Sobald jedoch der Säuglingsanteil in die Berechnung einfließt, werden Rechenwerte erzielt, die deutliche Abweichungen von den Erwartungswerten zeigen (Modelle 3 und 4). Der erwartete Anteil der unter 5jährigen lässt sich anhand der zuvor berechneten Quotienten aus der Besetzung höherer Altersgruppen schätzen. Gemäß Modell 7 sollte, ausgehend von den Sterblichkeitsverhältnissen im Alter 5–14 Jahre, die Sterbewahrscheinlichkeit innerhalb der ersten fünf Lebensjahre 0,43 betragen, das bedeutet 43 von 100 Neugeborenen überleben die ersten Jahre nicht. Von diesen sterben nach Modell 6 bereits 27, 78,721 log10 q0 5 1,154 log10 3,384 1,503 d 5 14 d 20 x 200 1,014 0,041 d 5 14 0,438 0,016 d 20 x 200 d 20 x d 5 14 q 0 1 0,568 log10 e0 d 1.10 d1 14 .10 : d 20 x d 20 x d 20 x d 1 d 0 19 0,43 0,27 25,8 5–8:3–8 1,3–4 >0,1 >2 Sollwert 0,11a 0,25b 0,11a 0,25b 36,4a 31,2b 0,1:3,7a 2,5:3,5b 0,09a 2,4b 0,18 2,1 Wert Demircihüyük auf der Grundlage der nachgewiesenen Skelette, b Berechnung inklusive der leeren Kindergräber (mit dx= Anzahl der Gestorbenen in der Altersgruppe x in Prozent, e0= Lebenserwartung bei Geburt, qx= Sterbewahrscheinlichkeit in der Altersklasse x; vgl. Kap. 3.3) Zur Berechnung der Modellwerte werden die an der zu testenden Skelettserie ermittelten Werte für dx in die entsprechende Formel eingesetzt. Die Ergebnisse der Berechnung werden mit dem Sollwert verglichen. Abweichungen vom Sollwert zeigen Störungen in der Repräsentanz der getesteten Altersklas sen an. a Berechnung 7. Sterbewahrscheinlichkeit unter 5 Jahren (Bocquet u. Masset 1977) 6. Sterbewahrscheinlichkeit im Säuglingsalter <1Jahr (Bocquet u. Masset 1977) 5. Lebenserwartung bei Geburt (Bocquet u. Masset 1977) 4. Anteil Säuglinge zu Anteil 1–14 Jahre pro 10 Erwachsene (Angel 1969) 3. quant.Verhältnis der Säuglinge zu den unter 19jährigen (Brothwell 1971) 2. quant.Verhältnis der 5–14jährigen zu den Erwachsenen (Bocquet u. Masset 1977) d 59 1. quant. Verhältnis der 5-9jährigen zu den 10–14jährigen (Masset 1973) d 10 14 d 5 14 Berechnung Demographischer Parameter Tabelle 2.8. Modelle zur Repräsentanzschätzung der Skelettpopulation Demircihüyük und ihre Testformeln 112 Evolution des Menschen Prähistorische Anthropologie 113 mehr als die Hälfte, im ersten Lebensjahr. Die tatsächlich vorhandene Anzahl gestorbener Kinder führt jedoch zu unrealistisch niedrigem Sterberisiko von 0,11 (11%) für Säuglinge und Kleinkinder und in der Konsequenz zu überhöhten Lebenserwartungen der Neugeborenen. Die Berechnungen unter Berücksichtigung der leeren Kindergräber nähern sich mit 0,25 (25%) den erwarteten Modellwerten. Nur in den wenigsten Fällen paläodemographischer Untersuchungen lässt sich der altersspezifische Fehlbestand derart präzise ermitteln und anhand der fundortspezifischen Situation ergänzen. Üblicherweise bleibt die Unsicherheit der defizitären Materiallage. In solchen Fällen ist letztlich die Schätzung des Fehlbestandes auf das nach Kriterien vergleichbarer Lebensbedingungen gewählte Niveau einer Modellbevölkerung die einzige Möglichkeit, eine paläodemographische Rekonstruktion weiterzuführen. Eine derartige Anwendung der Rahmenbedingungen aus Modellbevölkerungen bedeutet aber nicht, dass allen prähistorischen Bevölkerungen uniforme demographische Modellparameter aufgestülpt werden. Bei sorgfältiger Auswahl geeigneter Modelle kann man sich vielmehr die Gesetzmäßigkeiten der altersspezifischen Sterberisiken zu Nutze machen. Eine derartige Vorgehensweise ist jedoch nur zulässig unter der Voraussetzung, dass es sich um eine natürliche Siedlungsbevölkerung handelt. Davon abweichende Formen des Zusammenlebens (Militärlager, Kloster, Saisoncamps o.ä.) unterliegen nicht diesen Gesetzmäßigkeiten. Welche der Altersklassen von einem Defizit betroffen sind und wie hoch dieser Fehlbestand ist, wird mittels geeigneter Modelle geschätzt. Unter den von den United Nations (1955) vorgegebenen Niveaus der Sterblichkeit sind in der Regel für prähistorische Bevölkerungen die Modelle 30–40 geeignet. Sie spiegeln Sterbeverhältnisse in Bevölkerungen wider, die nicht industrialisierten Lebensbedingungen ausgesetzt sind. Diese bereits vor einem halben Jahrhundert beobachteten und den Modellen zugrunde liegenden Bevölkerungen sind besonders für die Anwendung in der Paläodemographie geeignet, da sie die modernen Trends der „demographischen Revolution“, die heute auch in den Entwicklungsländern in abgeschwächter Form zu beobachten ist, noch nicht zeigen. Die von Coale und Demeny (1983) derart zusammengestellten Tafeln lassen sich in vier Grundtypen unterschiedlicher Sterblichkeitsniveaus differenzieren. Für die paläodemographische Anwendung kommt vor allem „Model West“ in Frage, das mit hoher Kindersterblichkeit und im Vergleich zu den drei anderen regionalen Modellen früh einsetzender Alterssterblichkeit ab 40 Jahren charakterisiert ist. Unter den 25 Ebenen dieses Modells ist diejenige auszuwählen, deren Sterbewahrscheinlichkeiten qx denen der in prähistorischen Skelettserien repräsentativ besetzten Altersklassen der älteren Kinder entsprechen. Vor Anwendung dieser Modelle ist jedoch grundsätzlich im Einzelfall abzuschätzen, ob die Repräsentativität der zur Modellanpassung gewählten Altersklassen gegeben ist. Der Wert der zu niedrig besetzten Altersklasse wird durch einen entsprechenden Wert aus dem Modell ersetzt und damit in einen realistischen Rahmen angehoben. 114 Evolution des Menschen Unverzerrte Altersverteilungen als Basis demographischer Berechnungen Die Schätzgüte paläodemographischer Parameter hängt direkt von der Exaktheit ab, mit der individuelle Altersbestimmungen vorgenommen werden. Die darauf basierende nach Geschlecht differenzierte Altersverteilung liefert die für weitere Kalkulationen notwendige Basis. Üblicherweise geschieht dies durch folgende Schritte: 1. Bestimmung der Stadien morphologischer Ausprägung aller Merkmale am einzelnen Skelett (vgl. Kap. 2.3.3), 2. Verknüpfung der ermittelten Skelettmerkmale mit dem chronologischen Alter mittels einer altersbekannten Referenzpopulation, 3. Altersbestimmung 4. Aggregierung der individuellen Altersbestimmungen zu Altersverteilungen. Für die Berechnung der Altersverteilung ist insbesondere Schritt (2) ausschlaggebend, da von ihm die Fehlerspanne der individuellen Altersbestimmung, deren Mittelwert und schließlich die Besetzung der Altersklassen abhängt. Um dies zu erreichen, müssen geeignete Modelle entwickelt werden, um die Wahrscheinlichkeit Pr(c,a)zu bestimmen, mit der eine bestimmte Merkmalsausprägung c bei gegebenen Alter a zu beobachten ist. Dieser statistisch empfindliche Wert muss sorgfältig an einer geeigneten altersbekannten Referenzpopulation im Zuge der Methodenentwicklung erstellt werden. Die Verwendung verfügbarer Referenzen ist damit auch der größte Schwachpunkt einer Methode zur Altersbestimmung. Letztlich von Aussagewert für die Applikation der Methode ist jedoch Pr(a,c), die Wahrscheinlichkeit, dass das untersuchte Skelett mit der Merkmalsausprägung c einer Person gehörte, die im Alter a gestorben ist. Lange ist der Bedeutungsunterschied beider Wahrscheinlichkeiten in der Paläodemographie nicht erkannt oder nicht umgesetzt worden. Erst mit dem „Rostocker Manifest“ ist explizit auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht worden, mittels des Bayes’schen Theorems Pr(a,c) aus Pr(c,a) zu berechnen (Hoppa u. Vaupel 2002b): Pr(a|c ) = Pr(c |a) f (a) ∫ ω 0 Pr(c |a) f (a)da Die endgültig zu bestimmende Wahrscheinlichkeit Pr(a,c) ist damit auch von f(a) abhängig, der Verteilungsfunktion der Sterbealter in der zu untersuchenden Bevölkerung. Da dies aber gerade das Ziel der Untersuchung und damit eine noch unbekannte Größe ist, erscheint diese Formel für mit der formalen Demographie nicht Vertraute als ein Dilemma. Tauschte man die beiden Wahrscheinlichkeiten vereinfachend, aber unzulässigerweise aus, resultierten daraus die bekannten Phänomene, die Bocquet-Appel und Masset zu ihrer vernichtenden Kritik paläodemographischer Altersverteilungen veranlassten (s. oben). Ein Ausweg ist nur über die Modellierung von f(a) zu erreichen, die auf unterschiedlichen Wegen erfolgen kann (Hoppa u. Vaupel 2002b) (vgl. Box 2.13). Prähistorische Anthropologie 115 Box 2.13 Modellierung von Sterbealtersverteilungen f(a) als Funktion der individuellen Sterbealtersbestimmungen Variante 1: Im Altersbereich zwischen dem Eintritt in das Erwachsenenalter, ab dem alle Skelettreifungsprozesse abgeschlossen sind, und dem höchsten erreichbaren Alter (in der Paläodemographie wird ohne Nachweis häufig mit dem Alter 80 Jahre operiert) können alle Altersklassen mit gleicher Wahrscheinlichkeit besetzt sein. Diese vereinfachende Variante wird jedoch als wenig reflektiert und nicht adäquat angesehen angesichts der mit Sterbemaxima und -minima ausgestatteten Sterbealtersverteilung aller bekannten Bevölkerungen. Variante 2: Der Untersucher geht von einer subjektiv geprägten Wahrscheinlichkeitsfunktion aus (sog. „Expertenurteil“). Da diesem mangels Daten keine tatsächliche Kenntnis prähistorischer Sterbealtersverteilungen zugrunde liegen kann, ist auch diese Methode zumindest unpräzise und anfällig für Effekte durch Fehleinschätzungen. Variante 3: Die bekannte Sterbealtersverteilung einer vergleichbaren Population wird angenommen. Dies impliziert die Kenntnis oder zumindest Annahme verschiedener Parameter der Lebensbedingungen beider Bevölkerungen. Variante 4: Mittels geeigneter mathematischer Modellierung können unter Verwendung der Verteilungsfrequenz der Merkmalsausprägung c der zu untersuchenden Skelettserie sowie der Kenntnis von Pr(c,a) in der Referenzpopulation die altersspezifischen Werte für f(a) berechnet werden. Hierfür existieren mehrere Modelle zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitsdichte (maximum likelihood) der Sterbealtersverteilung (Love u. Müller 2002, Holman et al. 2002, Koenigsberg u. Herrmann 2002). Bei einer Entscheidung zu einer der ersten drei Varianten in Box 2.13 resultiert als Ergebnis ein nahezu proportionales Verhältnis von Pr(a,c) und Pr(c,a) (Boldsen et al. 2002). Die letzte Variante besitzt gegenüber den anderen den Vorteil, flexible Anpassung an die jeweils zu untersuchende Skelettserie zu erreichen, erfordert allerdings auch intensivere mathematische Kenntnisse zu ihrer Anwendung (Herrmann u. Koenigsberg 2002). Ist eine dieser Modellvarianten appliziert worden, resultiert daraus ein Sterbealtersprofil für die untersuchte Skelettserie. Noch nicht auf die Siedlungsbevölkerung zu übertragen, ist es lediglich die Anzahl der in den definierten Altersklassen Gestorbenen. Im Idealfall bzw. nach Korrektur der Fehlbestände in 116 Evolution des Menschen Abb. 2.34. Modell und Realität. Sterbewahrscheinlichkeiten qx im Kindesalter am paläodemographischen Beispiel des Demircihüyük im Vergleich zu ausgewählten Modellbevölkerungen. Demircihüyük fettgedruckt, höherer Wert der Säuglingssterblichkeit 1q 0 durch Korrektur mit leeren Kindergräbern. Punktierte Linien entsprechen Modellen der United Nations level 30 (niedrige Werte) und level 40 (hohe Werte), gestrichelt Modelle Coale und Demeny „Model West level 4 females“ (niedrigere Werte) und males (höhere Werte) den definierten Altersklassen sollte sich die gesamte Verteilung der Gestorbenen innerhalb der Bandbreite der gewählten Modellbevölkerungen bewegen. Im Beispielsfall Demircihüyük wird dies aus der kombinierten Auswertung anthropologischer und archäologischer Daten bereits erreicht, erkennbar im Vergleich der Altersverteilungen der Modellbevölkerungen im Kindesalter (Abb. 2.34). Eines der gewählten Modelle, dasjenige der United Nations Group D (United Nations 1955) weist sogar noch ungünstigere Sterbeverhältnisse der Säuglinge auf. Dadurch ist der relative Anteil der 5–14jährigen im Modell noch niedriger als für den Demircihüyük ermittelt. Eine nahezu exakte Übereinstimmung der Sterbealtersverteilung wird mit dem Modell MT35-30 von Weiss (1973) erreicht. Aus der Demographie rezenter Bevölkerungen lässt sich schließen, dass eine Vielzahl von Einflussparametern die Sterbeverhältnisse in einem nicht simulierbaren Wirkungskomplex prägt. Ist daher eine ermittelte Sterbealtersverteilung einer prähistorischen Skelettserie mit dem gewählten Modell einer empirischen Bevölkerung aus einem neuzeitlichen Gesellschafts- und Umweltkontext identisch, erlaubt dies nicht einen Rückschluss von einer modernen Bevölkerung auf prähistorische Lebensbedingungen. Die paläodemographischen Kennwerte Ist auf einem dieser Wege die Sterbealtersverteilung einer historischen Skelettpopulation ermittelt worden, kann diese als Grundlage für die Kalkulation de- Prähistorische Anthropologie 117 mographischer Kennwerte dienen. Im Gegensatz zu der in Kap. 3.3 beschriebenen vorherrschenden Vorgehensweise bei der Sterbetafelberechnung in der modernen Demographie dokumentiert man die Fehlerspanne der individuellen Altersbestimmung in der Regel durch die Verwendung „verkürzter“ Sterbetafeln, die auch in der modernen Demographie bei kleinen Bevölkerungen oder unvollständigen Daten Anwendung finden. Sie zeichnen sich durch die Zusammenfassung einzelnen Altersjahre zu Altersklassen, üblicherweise 5-JahresKlassen, aus. Innerhalb einer derartig definierten Altersklasse werden, ebenso wie bei Jahresklassen, für alle ihre Mitglieder gleiche Sterbe- bzw. Überlebenswahrscheinlichkeiten berechnet. Wenn dies auch für die meisten Altersklassen eine vertretbare Unschärfe angesichts der ohnehin mit einer Fehlerspanne berücksichtigten Einteilung der Individuen bedeutet, so ist dies jedoch insbesondere für die jüngste Altersklasse der unter 5jährigen eine unzulässige Datenaggregierung. Da die Überlebenswahrscheinlichkeiten für Neugeborene mit zunehmendem Alter signifikant ansteigen, ist das derart berechnete mittlere Sterberisiko über die ersten fünf Lebensjahre wenig aussagekräftig. Es unterschätzt regelmäßig die Säuglingssterblichkeit und überschätzt die Risiken der älteren Kinder.Indem einer Anzahl von,tatsächlich in jüngerem Alter als angenommen, gestorbenen Kindern ein längerer Verbleib in der Bevölkerung zugeschrieben wird, tritt als Effekt eine Überschätzung der Lebenserwartung ein. Um dies zu umgehen, kann bei der Erstellung der Sterbetafel mit unterschiedlichen Spannweiten der Altersklassen operiert werden, beispielsweise 0–1 Jahr, 1–4 Jahre, ab 5–9 Jahre in regelmäßigen 5-Jahres-Altersklassen. Die auf der Besetzung der Sterbealtersklassen basierende Berechnung der verkürzten Sterbetafel geschieht wie in Kap. 3.3 beschrieben. Für die Interpretation der Sterbeverhältnisse besonders relevant ist dabei die Spalte qx, welche die Sterbewahrscheinlichkeit q innerhalb der betrachteten Altersklasse x angibt, das Risiko, dem eine Person bei Eintritt in diese Altersklasse ausgesetzt ist. Weiterhin steht die Lebenserwartung ex im Mittelpunkt des Interesses, da sie die durchschnittliche verbleibende Anzahl von Lebensjahren bei Eintritt in die jeweils betrachtete Altersklasse ausdrückt. Dass die verbleibende Lebenserwartung sich in Bevölkerungen mit hoher Kindersterblichkeit (somit auch für die meisten prähistorischen Populationen anzunehmen) für die älteren Kinder im Vergleich zu derjenigen der Neugeborenen erhöht, zeigt an, dass nach Überwinden dieses hohen Risikos der ersten Lebensjahre eine gute Chance bestand, das Erwachsenenalter zu erreichen. Für die zuvor beschriebene Skelettserie von Demircihüyük stellt sich eine Sterbetafel für beide Geschlechter wie folgt dar (Tabelle 2.9). Die Sterbetafel für die Gesamtheit der geborgenen Skelette aus dem Gräberfeld ist unter Einschluss der leeren Kindergräber berechnet worden. Die daraus ermittelte Sterbewahrscheinlichkeit von 0,247 besagt, dass etwa jedes vierte Neugeborene die ersten fünf Lebensjahre nicht überlebt. Im Alter zwischen fünf und unter zehn Jahren stirbt nur noch jedes zehnte Kind (q5-9 = 0,104). Wird angenommen, dass auch in der Frühen Bronzezeit die Sitte der Deponierung von Säuglingen in der Siedlung, wie für spätere Siedlungsschichten nachgewiesen, üblich war, erhöht sich die Sterbewahrscheinlichkeit sogar noch weiter. 118 Evolution des Menschen Tabelle 2.9. Sterbetafel der frühbronzezeitlichen Skelettserie Demircihüyük X Dx dx lx qx Lx Tx ex Zx 0–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 99,63 31,53 15,05 9,89 24,45 22,08 23,57 24,18 23,42 22,57 21,15 18,98 18,39 16,48 15,86 15,76 24,72 7,82 3,74 2,45 6,07 5,48 5,85 6,00 5,81 5,60 5,25 4,71 4,56 4,09 3,93 3,91 100,00 75,28 67,45 63,72 61,27 55,20 49,72 43,87 37,87 32,06 26,45 21,21 16,50 11,93 7,85 3,91 0,247 0,104 0,055 0,038 0,099 0,099 0,118 0,137 0,153 0,175 0,198 0,222 0,277 0,343 0,502 1,000 438,194 356,829 327,932 312,461 291,160 262,292 233,969 204,344 174,812 146,277 119,156 94,264 71,081 49,451 29,393 9,778 3121,394 2683,200 2326,370 1998,438 1685,977 1394,817 1132,525 898,555 694,211 519,398 373,121 253,966 159,702 88,621 39,171 9,778 31,21 35,64 34,49 31,36 27,52 25,27 22,78 20,48 18,33 16,20 14,10 11,98 9,68 7,43 4,99 2,50 31,21 40,64 44,49 46,36 47,52 50,27 52,78 55,48 58,33 61,20 64,10 66,98 69,68 72,43 74,99 77,50 Summe 403,00 100,00 3121,394 mit x=Altersklasse, Dx=Individuenzahl gemäß Modellverteilung (vgl. Box 2.3.7), dx=relative Anzahl der Individuen, lx=Überlebenswahrscheinlichkeit, qx=Sterbewahrscheinlichkeit, Lx=Anzahl der in der Altersklasse gelebten Jahre, Tx=Anzahl der von allen bei Eintritt in die Altersklasse noch zu lebenden Jahre, ex=durchschnittliche weitere Lebenserwartung bei Eintritt in die Altersklasse, Zx=durchschnittliche Gesamtlebenserwartung für Personen, die in die Altersklasse eintreten (zur Berechnung der Parameter vgl. Kap. 3.3). Abb. 2.35. Sterbewahrscheinlichkeiten qx in 5-Jahres-Altersklassen in der Skelettserie Demircihüyük aus der verkürzten Sterbetafel mit Modellbevölkerungen der United Nations level 30 und level 40 als Begrenzungen des Wahrscheinlichkeitsbandes (grau unterlegt), Gesamtbevölkerung (schwarzer Punkt), Männer (Kreuz), Frauen (Kreis) Prähistorische Anthropologie 119 Die Erwachsenen zeigen in der Sterbetafel für die Gesamtheit der Skelettfunde ein ausgesprochen gering modelliertes Bild, das niedrige Sterblichkeit für die unter 60jährigen suggeriert. Dieses Phänomen muss als Artefakt betrachtet werden. Es ist methodisch bedingt durch den hohen Anteil nicht näher altersbestimmter Erwachsener zwischen 20 und 80 Jahren, die aufgrund der gleichmäßigen Aufteilung über alle Altersklassen die Kurve nivellieren. Werden ausschließlich diejenigen Individuen betrachtet, von denen eine Sterbealtersbestimmung innerhalb enger Grenzen vorliegt, modelliert sich die Altersverteilung unter Erhöhung der Sterblichkeit in jüngerem Erwachsenenalter und nähert sich damit der Modellkurve der UN, level 40, dem Modell mit der ungünstigsten Lebenserwartung (Abb. 2.35). Das Einsetzen der Alterssterblichkeit zeigt sich im Vergleich zu den Modelldaten der United Nations verzögert und wird erst für die über 60jährigen evident. Dies kann wohl nicht als Ergebnis günstiger Lebensumstände angesehen werden, sondern muss auch weiterhin als methodischer Effekt der weiten Altersspannenangaben gesehen werden, der für die jüngeren Erwachsenen die Sterbewahrscheinlichkeit erhöht, im Gegenzug aber diejenige der älteren Erwachsenen künstlich erniedrigt. Um die Geschlechtsunterschiede in der Sterblichkeit zu verdeutlichen, werden die Sterbewahrscheinlichkeiten von Männern und Frauen, wiederum ausschließlich bei den altersbestimmten Erwachsenen, betrachtet (Tabellen 2.10; 2.11). Für die jüngeren Frauen ist das Sterberisiko gegenüber dem der Männern deutlich erhöht (Abb. 2.35). Eine Angleichung der Mortalitätsraten ist erst für die über 55-jährigen zu erkennen. Dies stellt eine für prähistorische Skelettserien typische Abfolge dar, die zumeist mit dem erhöhten Sterberisiko jüngerer Frauen im gebärfähigen Alter aufgrund von Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen erklärt wird. Bisher ist jedoch kein Nachweis eines derartigen Tabelle 2.10. Sterbetafel Demircihüyük, Männer, nur exakt altersgeschätzte Skelette X Dx dx lx qx Lx Tx ex Zx 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 5,33 4,18 5,32 5,19 6,16 6,21 5,72 4,49 3,07 2,16 1,73 1,64 9,87 7,75 9,84 9,61 11,41 11,50 10,59 8,31 5,69 4,00 3,20 3,03 94,80 84,94 77,19 67,34 57,73 46,33 34,83 24,24 15,92 10,23 6,23 3,03 0,104 0,091 0,128 0,143 0,198 0,248 0,304 0,343 0,357 0,391 0,514 1,000 449,352 405,311 361,328 312,695 260,148 202,882 147,660 100,395 65,382 41,160 23,153 7,571 2377,036 1927,684 1522,373 1161,045 848,350 588,202 385,320 237,660 137,265 71,883 30,723 7,571 25,07 22,70 19,72 17,24 14,69 12,70 11,06 9,81 8,62 7,03 4,93 2,50 45,07 47,70 49,72 52,24 54,69 57,70 61,06 64,81 68,62 72,03 74,93 77,50 Summe 54,00 100,00 Sterbetafelparameter vgl. Tabelle 2.9 4339,353 120 Evolution des Menschen Tabelle 2.11. Sterbetafel Demircihüyük, Frauen, nur exakt altersgeschätzte Skelette X Dx dx lx qx Lx Tx ex Zx 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 5–49 50–54 55–59 0–64 65–69 0–74 75–79 5,79 4,67 5,24 6,05 4,20 3,30 2,36 1,42 2,35 1,37 1,18 1,18 12,31 9,94 11,15 12,87 8,93 7,02 5,02 3,02 5,00 2,92 2,51 2,51 83,18 70,87 60,94 49,47 36,92 28,00 20,98 15,96 12,94 7,94 5,02 2,51 0,148 0,140 0,183 0,258 0,242 0,251 0,239 0,190 0,386 0,367 0,500 1,000 385,145 329,534 276,827 216,787 162,296 122,439 92,354 72,246 52,195 32,413 18,840 6,280 1767,357 1382,212 1052,677 775,850 559,064 396,767 274,329 181,975 109,729 57,533 25,120 6,280 21,25 19,50 17,27 15,58 15,14 14,17 13,08 11,40 8,48 7,24 5,00 2,50 41,25 44,50 47,27 50,58 55,14 59,17 63,08 66,40 68,48 72,24 75,00 77,50 Summe 47,00 100,00 4339,353 Sterbetafelparameter vgl. Tabelle 2.9 Kausalzusammenhanges für eine prähistorische Skelettserie gelungen. Vergleicht man die Situation mit aktuellen Verhältnissen in Entwicklungsländern, so sind die entsprechenden weiblichen Sterberaten, die aus perinatalen Risiken erwachsen, nicht immer eindeutig zu verfolgen. Die Kalkulation von Sterbetafeln in der Paläodemographie stellt zwar einerseits ein Werkzeug dar, das es erlaubt, die Sterblichkeit der verschiedenen Altersklassen in einem Risikomodell für die gesamte Bevölkerung auszudrücken, es birgt aber gerade aus diesem Grund auch zahlreiche Quellen der Fehlschätzung, die bei der Anwendung auf prähistorische Skelettserien zu berücksichtigen sind. Neben dem bereits diskutierten selektiven Defizit an Skeletten, das die Sterbeparameter beeinflusst, stellt die Bevölkerungsgröße ein weiteres Problem dar. Während die Demographie bei modernen Bevölkerungen mit großen Stichproben arbeitet, die zumindest in die Zehntausende, oft in die Millionen Menschen geht, ist die Paläodemographie auf die Untersuchung kleiner Bevölkerungen bzw. Bevölkerungsstichproben beschränkt, die oft nur wenige hundert Individuen umfassen. In großen Bevölkerungen wirken sich Einflussfaktoren, die eine Veränderung der demographischen Merkmale induzieren, durch die große Variabilität oft nur in Teilstichproben aus. Als Konsequenz daraus machen sich demographische Veränderungen oft moderat bemerkbar und führen allenfalls zu leichten Schwankungen in der Bevölkerungsstruktur. Wirken aber beispielweise Nahrungsknappheit oder Infektionskrankheiten auf eine Siedlungsbevölkerung mit wenigen hundert Einwohnern ein, so verzeichnet diese oft drastische Bevölkerungseinbrüche und ist in ihrer Existenz gefährdet. Sind derartige Krisen überwunden, folgen Erholungsphasen auf das ursprüngliche Niveau oder Konsolidierungen auf niedrigerem Niveau. Derartige Schwankungen entziehen sich jedoch in der paläodemographischen Forschung einer Analyse, da in den seltensten Fällen Prähistorische Anthropologie 121 Abb. 2.36. Simulation typischer Bevölkerungsfluktuationen in kleinen Bevölkerungen. Die Kumulierung aller Altersverteilungen über 500 Jahre führt zu einer regelmäßigen Bevölkerungspyramide (oben). Verfolgt man die Bevölkerung, so zeigt sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt innerhalb der 500 Jahre Siedlungsdauer unterschiedliche Alterszusammensetzung und Individuenzahl, deren Variabilität nicht aus der kumulierten Bevölkerungsverteilung ersichtlich ist (umgezeichnet nach Weiss 1976) ausreichende Informationen über die zeitliche Dynamik einer historischen Bevölkerung zur Verfügung stehen. Welches Ausmaß diese Fluktuationen annehmen können, ist von Weiss (1976) in einer Simulation anschaulich demonstriert worden (Abb. 2.36). Werden stochastische Einflüsse auf eine kleine Bevölkerung simuliert, kann diese mit extrem großer Variabilität ihrer demographischen Parameter reagieren, die über mehrere Jahrhunderte hinweg oszillieren. Im Umkehrschluss bedeutet dies für die paläodemographische Arbeitsweise, dass eine über diese Besiedlungsdauer ermittelte demographische Zusammensetzung in der Siedlung zu keinem Zeitpunkt existent gewesen sein muss. Damit liegt ein weiteres Problem der Paläodemographie vor, das Problem der Bevölkerungsdynamik. Die archäologischen Eckdaten der Siedlungschronologie liegen oft nur in einem groben Zeitraster vor, so dass es sich bei der Siedlungsdauer um einen Schätzwert handelt. Auch die Siedlungsabfolge liegt in den wenigsten Fällen in einer für paläodemographische Untersuchungen notwendigen Strukturierung vor, so dass die Siedlungsentwicklung nicht einzusehen ist. Nahezu gänzlich entziehen sich die Migrationsprozesse unserer Kenntnis. Ungleichgewichte der Wanderungsbilanz (s. Kap. 3.3) haben zur Folge, dass der Bevölkerungsbestand nicht mit hinreichender Genauigkeit geschätzt werden kann, da Bevölkerungsteile nicht ihre gesamte Lebenszeit in der Siedlung verbracht haben, sondern durch Zu- oder Abwanderung nur während bestimmter Altersgruppen vertreten sind. 122 Evolution des Menschen Verwendet man die zuvor beschriebenen Wege, um zu einer Sterbealtersverteilung zu gelangen, und setzt man diese Verteilung als Ausgangswerte dx in eine Sterbetafelberechnung ein, impliziert man mit dieser Vorgehensweise eine stationäre Bevölkerung. Sie kann als eine Sonderform der Bevölkerungsdynamik betrachtet werden, bei der sowohl das Mortalitäts-, als auch das Fertilitätsgeschehen unverändert bleiben und sich darüber hinaus in ihrer Wirkung auf die Bevölkerungsentwicklung aufheben. Eine solche Bevölkerung besitzt die Wachstumsrate r = 0. Dies ist die einfachste, aber in den seltensten Fällen zutreffende Variante zur Beschreibung der Bevölkerungsdynamik. Appliziert man dieses Modell der stationären Bevölkerung auf paläodemographische Skelettserien, postuliert man unveränderliche Sterbeverhältnisse über den in den Skeletten dokumentierten Siedlungszeitraum, eine konstante Geburtenrate, eine Isolatbevölkerung ohne Migrationsaktivität und als Folge davon eine unveränderliche Alterszusammensetzung (Wittwer-Backofen 1988). Geht man beispielsweise von zwei Bevölkerungen aus, die identische Sterbeverhältnisse aufweisen, sich aber bezüglich der Fruchtbarkeitsraten unterscheiden, resultieren daraus unterschiedliche Sterbealtersverteilungen, da die Wachstumsraten der Vergleichsbevölkerungen verschieden sind.In der paläodemographischen stationären Sterbetafelberechnung würde damit ein Unterschied der Mortalitätsverhältnisse anstelle des tatsächlichen Fertilitätsunterschiedes vorgetäuscht (Johanson u. Horowitz 1986). Nicht nur, dass Fertilität einen Einfluss auf die Sterbealterszusammensetzung hat, dieser ist auch stärker als die Modifikation durch Änderung des Sterbegeschehens. Es ist daher falsch zu glauben, dass die Sterbetafel überwiegend durch die Sterblichkeit beeinflusst wird. Es sind vielmehr bereits kleine Veränderungen der Fertilität, die zu einer signifikanten Veränderung der Sterbealterszusammensetzung führen. Lockert man die demographischen Anforderungen an die zu untersuchende Bevölkerung und geht davon aus, dass zwar Sterblichkeit und Fruchtbarkeit konstant bleiben, sich aber nicht gegenseitig aufheben, arbeitet man mit dem Modell der stabilen Bevölkerung. Es weist ein Ungleichgewicht zwischen Mortalität und Fertilität auf und dokumentiert eine gleichmäßig schrumpfende (r < 0) oder eine gleichmäßig wachsende Bevölkerung (r > 0). Dieses Ungleichgewicht ändert sich aber bei einer stabilen Bevölkerung nicht. Ist daher für eine prähistorische Skelettserie die Reproduktionsrate,die Anzahl geborener und überlebender Mädchen pro Frau, bekannt, läßt sich unter Verwendung der Funktionen einer Modellsterbetafel (z. B. Coale u. Demeny, Modelle West) die Geburtenrate bestimmen, aus der wiederum die Lebenserwartung bei Geburt ermittelt werden kann (McCaa 2002). Als statistische Anforderungen an eine paläodemographische Bevölkerungsrekonstruktion müssen daher gefordert werden: • • Die beobachteten Sterbefälle innerhalb der definierten Altersklassen müssen einer definierten Zeitperiode zugeordnet werden können. Die Anzahl der von allen Bevölkerungsmitgliedern gelebten Jahre in den Altersklassen muss bekannt sein. Dies sind jedoch in der Regel nicht erfüllbare Bedingungen. Ein befriedigender Ausweg aus diesem paläodemographischen Dilemma ist bisher nicht in Prähistorische Anthropologie 123 Sicht. Einige Vorschläge zur Modellierung von Wachstumsraten und damit Annäherungen an die geforderte Datenlage liegen von Milner et al. (2000) vor. Weiterführende paläodemographische Modellierungen zum Fertilitätsgeschehen, der Alterszusammensetzung der Lebendbevölkerung in der prähistorischen Siedlung oder der Bevölkerungsdynamik sind daher wenig aussagekräftig. Die aktuellen paläodemographischen Bemühungen zielen auf zuverlässige Sterbealtersverteilungen ab, die im Zusammenspiel mit paläoökologischen, paläopathologischen und archäologischen Daten zu einem Verständnis der ökotopabhängigen Überlebensfähigkeit der jeweiligen untersuchten Population führt. 2.3.5 Archäometrie „Archäometrie macht Spaß. Dies liegt an der besonderen Plazierung dieses Arbeitsfeldes zwischen Geistes- und Naturwissenschaften. Denn die Archäometrie umfasst das gesamte Gebiet des Einsatzes naturwissenschaftlicher Methoden in der kulturhistorischen Forschung, besonders in der Archäologie. Neueste Technologien und komplizierte Meßmethoden werden heute herangezogen,um Ergebnisse zu erzielen,die mit rein geisteswissenschaftlichen Methoden nicht oder nicht so eindeutig gewonnen werden können.“ (Mommsen 1986) Treffender als es Mommsen (1986) im Vorwort zu seiner klassischen Einführung in die Archäometrie ausdrückt, kann man das Arbeitsfeld der Archäometrie, der naturwissenschaftlichen Untersuchung von Sachüberresten (Herrmann 1994) kaum beschreiben. Der Einsatz naturwissenschaftlicher Methoden zur Klärung auch primär kulturwissenschaftlicher Fragen betrifft in besonderem Maße die prähistorische Anthropologie, stellt sich doch nach der Erhebung des Individualbefundes und der Verknüpfung der Individualdaten zu Kollektivdaten, welche frühe menschliche Bevölkerungen charakterisieren, jetzt unweigerlich die Frage nach den Ursachen von Bevölkerungsentwicklungen in Raum und Zeit. Soweit die bereits in Kapitel 2.3.3 aufgeführten Aspekte der ökologischen Einnischung, der habitatspezifischen Subsistenzstrategie, der Krankheitsbelastung, genealogischer Zusammenhänge und Migrationsereignisse nicht bereits auf der makro- und mikroskopischen Diagnoseebene erschließbar sind, können unter Einsatz geeigneter Methoden viele dieser Fragen mittels der Untersuchung der Skelettfunde auf der molekularen, submolekularen und kristallinen Ebene hinreichend beantwortet werden. Tatsächlich sind ganze Kapitel individueller und kollektiver Lebensgeschichte in der stofflichen Zusammensetzung des Skelettes niedergelegt, welche jedoch der Entschlüsselung bedürfen. Während das Arbeitsgebiet der Archäometrie traditionell in die Bereiche Prospektion, Materialanalyse und Datierung gegliedert wird (Mommsen 1986), soll an dieser Stelle aufgrund der Tatsache, dass 124 Evolution des Menschen das Untersuchungsgut im Wesentlichen bis ausschließlich aus Skelettfunden besteht, auf die verschiedenen Stoffklassen der mineralisierten Hartgewebe und deren spezifischen Informationsgehalt eingegangen werden. Strenggenommen gehören auch die radiologische Inspektion und die Untersuchung der Funde auf der mikro- und ultrastrukturellen Ebene mittels diverser lichtund elektronenoptischer Methoden zu dem Methodenkanon der Archäometrie. Sie sind jedoch häufig schon auf der Ebene der Individualdiagnose und Identifikation des Fundes unabweisbar (s. Kap. 2.3.3), so dass sie mehrheitlich bereits routinemäßig zur Anwendung kommen. Obgleich Skelettfunde auch direkt datiert werden (z. B. mittels 14C-Datierung), gehört die Datierung der Funde dagegen traditionell in das Arbeitsgebiet der Geochronologie und nicht in den Zuständigkeitsbereich der prähistorischen Anthropologie. Für sämtliche archäometrischen Applikationen an bodengelagerten Skelettfunden gilt, dass das jeweilige Zielmolekül (Kollagen, DNA) oder die Mineralfraktion (Karbonat, Apatit) auf seine Integrität geprüft werden muss. Da sämtliche Funde sich in einem mehr oder weniger fortgeschrittenen Dekompositionszustand befinden, ist stets mit einer Degradation der zu untersuchenden Stoffklasse zu rechnen bzw. mit zum Teil erheblichen Kontaminationen durch mikrobielle Biomasse (s. Kap. 2.3.2) oder andere allochthone Substanzen aus dem Liegemilieu. Die Validität archäometrischer Ergebnisse ist damit vor allen Dingen von der möglichst exakten Definition der aus den Funden extrahierbaren Stoffgruppe und einer erfolgreichen Dekontamination abhängig. Keinesfalls eignet sich das Untersuchungsgut der prähistorischen Anthropologie für Routineverfahren an frischem Material. Für die erforderlichen Qualitätskriterien, wie auch in Bezug auf die jeweiligen technischen Verfahren existiert eine Fülle von Spezialliteratur, auf welche an dieser Stelle verwiesen werden muss. Im Folgenden soll daher lediglich auf die wesentlichen Stoffklassen und deren Informationspotential bezüglich der anstehenden Fragestellungen eingegangen werden. Es bedarf aber der Betonung, dass angesichts der Interdisziplinarität der prähistorischen Anthropologie sehr hohe Erwartungshaltungen bezüglich moderner Technologie bei den involvierten Kulturwissenschaftlern geweckt werden, die substratbedingt nicht immer auch befriedigt werden können. Dekompositionsbedingt sind Fehlergebnisse oder fragliche Ergebnisse nicht unbedingt selten – es gehört zu den wichtigen Aufgaben der Archäometrie, das native biologische Signal sorgfältig von einer Fülle potentieller falsch-positiver Signale zu trennen. Paläoökosystemanalyse mittels stabiler Isotope leichter Elemente (C, N, O) Die Erschließung menschlicher Bevölkerungsentwicklung in Zeit und Raum bedarf insbesondere für frühe Zeiträume detaillierter Informationen über die naturräumlichen Bedingungen, unter denen die Bevölkerungen ihre jeweilige ökologische Nische erschließen konnten. In Abhängigkeit von paläoklimatischen Parametern, wie z. B. der Jahresdurchschnittstemperatur oder Niederschlagsmenge, von paläoökologischen Parametern, wie z. B. der Bewaldungsdichte sowie des Floren- und Faunenspektrums,entwickelten die Menschen ihre habitatspezifischen Subsistenzstrategien wie Jagen, Sammeln, Fischen und spä- Prähistorische Anthropologie 125 ter auch die Domestikation bestimmter Tier- und Pflanzenarten. Bei dauerhafter Besiedlung einer Region und bei Erreichen einer bestimmten menschlichen Populationsdichte ergaben sich in der Folge anthropogene Beeinflussungen der naturräumlichen Standorte, welche langfristig in die Schaffung anthropogener Ökosysteme mündeten. In den Verhältnissen stabiler Isotope der leichten Elemente Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) und Sauerstoff (O), welche im Kollagen bzw. der strukturellen Karbonatfraktion des Knochenminerales von Skelettfunden auch nach langer Liegezeit konserviert sein können, spiegeln sich sämtliche oben angeführte paläoökologisch relevanten Parameter wider. Archäologische Skelettfunde von Menschen und, wie zu zeigen ist, in diesem Falle unabweisbar auch Tieren sind somit das geeignete Substrat, regionalspezifische Paläoökosysteme mit deren Vernetzungen zwischen Flora und Fauna (einschließlich des Menschen) und bei entsprechender zeitlicher Stratifizierung auch deren Wandel und die Ursächlichkeit dieses Wandels zu rekonstruieren. Den stabilen Isotopen der o.a. leichten Elemente ist gemeinsam, dass sie sich lediglich in Bezug auf ein oder zwei Masseeinheiten voneinander unterscheiden (13C, 12C; 15N, 14N; 18O, 16O), was jedoch im Hinblick auf das insgesamt geringe Atomgewicht eine relativ große Differenz bedeutet. Moleküle, welche überwiegend leichtes Isotop enthalten, sind zum einen leichter flüchtig als ihr schwereres Pendant. Zum anderen treten insbesondere beim Transport der Elemente durch die Geo-, Hydro- und Biosphäre kinetische Isotopeneffekte auf (Hoefs 1997, Pollard u. Wilson 2001), da z. B. viele Enzyme dazu in der Lage sind, zwischen schweren und leichten Molekülen zu differenzieren (z. B. während der CO2-Assimilation durch grüne Pflanzen). Die stabilen Isotope der genannten Elemente zirkulieren somit in der belebten Welt zu unterschiedlichen Raten, getrieben von physikalischen, chemischen und biologischen Prozessen. Derartige Isotopenfraktionierungen führen dazu, dass nicht nur verschiedene Ökosysteme (z. B. marine und terrestrische), sondern auch die diversen Kompartimente eines Ökosystems sich durch signifikant unterschiedliche Isotopien voneinander unterscheiden. Das Verhältnis von schwerem zu leichtem Isotop in einer Probe wird gemäß internationaler Konvention auf einen Standard bezogen und in der δ-Notation als δ13C, δ15N bzw. δ18O, gemessen in Promille, ausgedrückt. Je positiver ein δ-Wert, desto stärker ist die untersuchte Probe mit dem jeweils schwereren Isotop angereichert. 13C- und 15N-Werte des Knochenkollagens spiegeln die Herkunft pflanzlichen bzw. tierischen Proteins wider. Der wesentliche Fraktionierungsfaktor für δ13C beruht auf der unterschiedlichen Diskriminierung gegen 13C von C4- und C3-Pflanzen aufgrund derer Photosynthesewege mit unterschiedlichen CO2Akzeptoren. δ13C-Werte von C3-Pflanzen betragen im Mittel –27‰, jedoch mit beträchtlicher Variation von –37‰ unter dichter Laubkrone („Baldachin-Effekt“) bis –22‰ bei Wasserstress (Ambrose 1993). Diese Variabilität ist beträchtlich eingeschränkt für C4-Pflanzen, welche z. B. nicht unter geschlossener Laubkrone wachsen und schwankt lediglich zwischen –13 und –10‰. Mit einem Fraktionierungsfaktor von rund +5‰ wird der δ13C-Wert der Nahrungspflanze in das Kollagen des Konsumenten verstoffwechselt mit der Folge, dass anhand δ13CKollagen bestimmt werden kann, ob ein Tier C3-Pflanzen (Laub, Büsche; z. B. Boviden, Cerviden) oder C4-Pflanzen (Gräser, z. B. Equiden) bevor- 126 Evolution des Menschen zugt oder beide Pflanzengruppen konsumiert, bzw. welche Pflanzengruppe von der Beute eines Jägers oder Karnivoren bevorzugt wurde (Ambrose u. Norr 1993). Besonders niedrige δ13C-Werte sprechen für ein dicht bewaldetes Habitat, werden aber auch in Flüssen und Seen angetroffen aufgrund der hohen Fraktionierung durch Phytoplankton. Da δ13C-Werte der Pflanzen klimasensitiv sind und ferner eine Anreicherung um +1,5‰ während der letzten 150 Jahre beobachtet wurde (fossil fuel effect) (Leuenberger et al. 1992), sind für jede Klimaepoche und für jeden Standort die Eckdaten für das zu untersuchende Ökosystem durch die Analyse von Skelettfunden von Tieren bekannter Ernährungsweise (z. B. Boviden und Equiden, s. oben) zu ermitteln. δ15N des Knochenkollagens ist ein ausgezeichneter Indikator für die Trophiestufe, auf der sich das untersuchte Individuum befindet. Beim Transport von einer Stufe des Nahrungsnetzes zur nächsten kommt es zur schrittweisen Anreicherung des Kollagens um +3 bis +6‰, im Mittel +4‰ in Bezug auf schweres N-Isotop. δ15N lässt daher die Unterscheidung zwischen Herbivoren, Omnivoren, primären und sekundären Karnivoren zu (Schwarcz u. Schoeninger 1991, Ambrose 1993). Laktierende Säugetiere produzieren diesen Trophiestufeneffekt innerhalb des weiblichen Organismus, so dass Milch und Milchprodukte durch besonders hohe δ15N-Werte gekennzeichnet sind. Für subadulte Säugetiere einschließlich des Menschen lässt sich daher die Stilldauer ermitteln (Abb. 2.37). Abb. 2.37. Bestimmung des Entwöhnungszeitraumes mittels δ15N, Kinderskelette aus dem frühmittelalterlichen Wenigumstadt, Bayern (Dittmann u. Grupe 2000). Im Alter von etwa vier Jahren ist die Sterblichkeit der Kinder am höchsten, Krankheitssymptome am Skelett legen einen Zusammenhang mit der Entwöhnung nahe. Tatsächlich sind die δ15N-Werte der 3–4jährigen Kinder um rund 3‰ und somit um eine Trophiestufe niedriger als jene der Säuglinge, Folge der Umstellung von Muttermilch auf feste Nahrung Prähistorische Anthropologie 127 Für menschliche Populationen konnte eindrucksvoll durch Ambrose (1986) gezeigt werden, dass sich Ackerbauern von Viehzüchtern signifikant trennen lassen und bei den Viehzüchtern wiederum erkannt werden kann, ob Fleischoder Milchwirtschaft betrieben wurde. An ariden Standorten, in denen Tiere verbreitet sind, welche nicht obligatorisch trinken müssen (z. B. Kamele), ist aus δ15N darüber hinaus ersichtlich, ob bevorzugt das Fleisch solcher „Wassersparer“ konsumiert wurde. Aufgrund des erforderlichen Isotopengleichgewichtes innerhalb eines Organismus ist das Fleisch nicht obligatorisch trinkender Tiere in Bezug auf δ15N angereichert, da der Effekt des Wassersparens durch die Ausscheidung eines hochkonzentrierten Urins mit isotopisch leichtem Harnstoff erreicht wird (Ambrose 1993). Bei der Nutzung von Süßwasserressourcen werden aufgrund des komplexen Nahrungsnetzes ebenfalls sehr hohe δ15N-Werte angetroffen (Abb. 2.38). Auch in Bezug auf δ15N ist eine Klimasensitivität evident (Heaton et al. 1986). Letztlich sind marine Standorte sowohl in Bezug auf δ13C als auch auf δ15N signifikant von terrestrischen unterschieden, da im marinen Ökosystem die Basiswerte für beide δ-Werte beträchtlich positiver sind. Der Grund hierfür ist das Vorkommen von gelöstem Bicarbonat im Meerwasser sowie das vermehrte Auftreten von Denitrifikationsprozessen mit hohem Fraktionierungsfaktor (Sealy 2001). Bei solchen Populationen, welche saisonal vom Binnenland zur Küste migrieren, resultiert daher eine charakteristische Mischisotopie. Die Analyse von 13C aus dem strukturellen Karbonat der Mineralfraktion (vgl. Kap. 2.3.2) wurde schon vor längerer Zeit (z. B. Lee-Thorp et al. 1994) als Alternative für die Ernährungsrekonstruktion mittels δ13CKollagen durchgeführt für solche Knochenfunde, welche über zu wenig konserviertes Kollagen verfügten. Die Informationen aus δ13CKarbonat sind jedoch unterschiedlich von jenen aus δ13CKollagen: Während letzte die Eiweißkomponente der Nahrung widerspiegeln, stammt der Kohlenstoff der Karbonatfraktion aus allen Nahrungskomponenten und reflektiert daher auch die Herkunft der Energieträger wie Fette oder Kohlenhydrate (Ambrose u. Norr 1993). Somit ändern sich auch die Fraktionierungsfaktoren mit dem Ergebnis, dass der Unterschied zwischen δ13CKarbonat und δ13CKollagen in Herbivoren signifikant höher ist als in Karnivoren. Die Situation kompliziert sich entsprechend, wenn die Nahrung eines Wirbeltieres aus beiden Komponenten gemischt ist,z.B.C3-Protein und C4-Energie. 18O wird aufgrund seiner Temperatursensitivität als Paläothermometer herangezogen und ist damit einer der wichtigsten Klimaindikatoren (Hoefs 1997). Für warmblütige Säugetiere mit konstanter Körperkerntemperatur besteht eine eindeutige Beziehung zwischen δ18OKarbonat und der Temperatur des Trinkwassers (Oberflächenwasser), welche auf dem Isotopengleichgewicht zwischen Sauerstoff-Input (Trinkwasser, feste Nahrung, Inhalation) und Sauerstoff-Output (Urin, Schweiß, Exhalation) beruht (Luz u. Kolodny 1989). Grundsätzlich kann Sauerstoff aus archäologischen Skelettfunden aus der Phosphatfraktion und der Karbonatfraktion gewonnen werden, welche jedoch gleichermaßen valide Daten liefern (Sponheimer u. Lee-Thorp 1999). Der Arbeitsaufwand wird durch die Analyse von δ18OKarbonat erheblich gemindert, da – ebenso wie C und N aus Kollagen – C und O aus demselben Substrat online am Massenspektrometer gemessen werden können. Es ist jedoch zu beachten, dass das O-Isotopenverhältnis im Abb. 2.38. Nahrungsnetz aufgrund δ13C und δ15N aus Knochenkollagen, neolithische Feuchtbodensiedlung von Pestenacker, Bayern (um 3600 v. Chr.). Angegeben sind die speziesspezifischen Medianwerte (insgesamt 123 Knochenfunde von Mensch und Tier), sowie die Variabilität der Nahrungsgruppen einschließlich der Süßwasserfische. Der Mensch steht an der Spitze der Nahrungskette. Süßwasserfische dürften bestenfalls saisonal zur menschlichen Ernährung beigetragen haben. delta 13C neolithisches Nahrungsnetz 128 Evolution des Menschen Abb. 2.39. Nahrungsnetz aufgrund von δ13C und δ18O aus Knochenkarbonat, vgl. Abb. 2.38. Die Süßwasserfische sind aufgrund der Kohlenstoffisotopien klar von den terrestrischen Wirbeltieren getrennt und spielen nur eine marginale Rolle in der menschlichen Ernährung. Die Sauerstoffisotopien variieren entsprechend des speziesspezifischen Metabolismus, vgl. z.B. die erniedrigten Werte für kleine, nacht- bis dämmerungsaktive Säugetiere (Dachs, Hase, Biber). neolithisches Nahrungsnetz Prähistorische Anthropologie 129 130 Evolution des Menschen Karbonat um bis zu 8‰ von jenem im Phosphat abweichen kann, wobei diese Differenz höchstwahrscheinlich speziesspezifisch ist. Neben seiner Funktion als Klimaindikator ist δ18O hervorragend geeignet, das Nahrungsverhalten verschiedener Wirbeltierspezies zu rekonstruieren und somit auch die bevorzugte Beute von Karnivoren und menschlichen Jägern. Viele Tiere müssen regelmäßig Trinkwasser zu sich nehmen,andere nur sehr selten und manche Spezies decken ihren Wasserbedarf ganz aus fester Nahrung.Letzte kommen vorwiegend in trockenen Regionen vor, in denen die pflanzliche Biomasse aufgrund der bevorzugten Transpiration von 16O generell mit 18O angereichert ist. Die Abundanz solcher Spezies lässt solide Rückschlüsse auf die Vegetation und damit auf das Paläoökosystem zu. Für die gemäßigten Breiten gilt aus demselben Grunde, dass laubfressende Herbivoren gegenüber grasfressenden höhere δ18O-Werte aufweisen. Süßgewässervertebraten sind wiederum von den terrestrischen deutlich verschieden (Abb. 2.39). Die Sauerstoffisotopie in Nahrung und Trinkwasser ist eine Funktion der Umweltparameter in Bezug auf Niederschlag und recycelter Wasservorkommen in Quellen, Flüssen und Seen. Da δ18O des atmosphärischen Sauerstoffes weitestgehend konstant ist, variiert das Isotopenverhältnis der naturräumlichen Wasservorkommen entsprechend den physikalischen und biologischen Umweltparametern einschließlich der Niederschlagsverhältnisse. Somit dient δ18OKarbonat als Marker für die ökologisch definierte Herkunft von Individuen. Auf diese Weise konnten bereits Migrationsmuster diverser Tierspezies erkannt werden, insbesondere für Fischpopulationen (z. B. Hobson 1999). Das Sauerstoffisotopenverhältnis in Knochenfunden ist daher besonders dafür geeignet, komplexe aquatische Paläoökosysteme zu erschließen. In Einzelfällen konnte δ18O im Karbonat menschlicher Skelettfunde zur Identifikation von Einwanderern herangezogen werden, sofern die untersuchte Region ökologisch hinreichend zoniert war (z. B. White et al. 1998). Herkunftsbestimmung mittels stabiler Isotope schwerer Elemente im biologischen Apatit Ein individueller Residenzwechsel zwischen zwei geologisch definierten Regionen ist anhand der stabilen Isotope schwerer Elemente, vorzugsweise Strontium (Sr) und Blei (Pb), im biologischen Apatit möglich. Beide Elemente werden überwiegend oral aufgenommen und zählen nicht zu den essentiellen Spurenelementen, so dass nicht ausgeschiedenes Strontium und Blei im Skelett quasi stillgelegt wird. Beide Elemente haben eine Massezahl größer als 50, so dass Veränderungen der Masse bei den jeweiligen stabilen Isotopen von nur wenigen Einheiten im Vergleich zum Gesamtatomgewicht klein sind und es zu keinen messbaren Isotopenfraktionierungen kommt. Bei stabilen Isotopen schwerer Elemente entfällt daher die δ-Notation. Pb kommt in Form von vier verschiedenen stabilen Isotopen vor: 204Pb, 206Pb, 207Pb und 208Pb. Im Zuge der geologischen Formation von Erzen kommt es zu einer Reihe masseabhängiger Diffusions- und anderer physikalischer Prozesse, so dass das Bleierzvorkommen als Ursprung von aus Blei gefertigten Gegenständen anhand des 208Pb/206Pb- bzw. 207Pb/206Pb-Verhältnisses ein- Prähistorische Anthropologie 131 deutig definiert werden kann – die Bleiisotopien stellen geradezu einen Fingerabdruck der Erzlagerstätten dar. Gleiches gilt für Bleiverunreinigungen in Silbermünzen. Dieser Fingerabdruck wird durch die Erzverhüttung und gegebenenfalls Korrosion nicht verändert, so dass z. B. die jüngeren Erzvorkommen der berühmten Silbermine von Laurion eine signifikant andere Blei-Isotopensignatur aufweisen als jene der älteren Silberminen auf Sardinien oder in Spanien (Mommsen 1986). Die orale Aufnahme von Blei in den menschlichen oder tierischen Körper erfolgt mehrheitlich akzidentell durch kontaminierte Nahrungsmittel. Sofern großräumige Handelsbeziehungen ausgeschlossen werden können, kann die Blei-Isotopensignatur von Skelettfunden als Indikator für die geographische Provenienz eines Individuums herangezogen werden (z. B. Molleson et al. 1986, Budd et al. 2000). Weit verbreitet ist die Provenienzanalyse von Individuen eines Gräberfeldes mit Hilfe stabiler Strontium-Isotope aus dem biologischen Apatit. Strontium ist wie Calcium ein Element der chemischen Hauptgruppe IIa und kann aufgrund seiner Ladung und seines Ionenradius Kalziumgitterplätze während der Apatitgenese ersetzen, so dass es fest in die mineralische Matrix der Hartgewebe inkorporiert wird. 99% des Gesamtstrontiumgehaltes eines Wirbeltieres findet sich entsprechend in dessen Knochen und Zähnen. Aufgrund fehlender Isotopenfraktionierung haben sämtliche mineralisierten Hartgewebe eines standorttreuen Organismus die selbe Isotopensignatur wie das jeweilige Habitat, dessen Signatur wiederum von jener des unterliegenden Gesteines bestimmt wird. Voraussetzung ist jedoch, dass die mobile (bioverfügbare) Phase dieselbe Strontium-Isotopensignatur aufweist wie die stationäre Phase. Strontium kommt in Form der vier stabilen Isotope 84Sr (0,56%), 86Sr (9,87%), 87Sr (7,04%) und 88Sr (82,53%) vor, wobei die Isotope 84Sr, 86Sr und 88Sr im Verlauf erdgeschichtlicher Zeiträume konstante Verhältnisse annehmen. 87Sr ist ein Zerfallsprodukt des radioaktiven 87Rb (t1/2 = 48,8 ×109 Jahre). Der 87Sr-Gehalt eines Gesteines ist somit eine Funktion des Ausgangsgehaltes an Rb und seines Alters, so dass in der Geologie das 87Sr/86Sr-Verhältnis zur Charakterisierung und Datierung von Gesteinen herangezogen wird (Faure 1986). Im Wesentlichen variieren die Werte zwischen 0,700 und 0,750, wobei höchste Werte in sehr alten Gesteinen mit hohen primären Rb/Sr-Verhältnissen gemessen werden. Die messtechnische Präzision des Isotopenverhältnisses ist außerordentlich hoch, so dass die auf den ersten Blick geringe Variabilität der Isotopenverhältnisse in der Realität hochsignifikant ist. Wenn die Strontiumisotopenverhältnisse in Knochen und Zähnen eines Skelettes von jener des umgebenden Sedimentes signifikant verschieden sind, muss es sich mit Sicherheit um ein primär ortsfremdes Individuum handeln, da eine Kontamination der Hartgewebe naturgemäß nur mit der lokalen Isotopensignatur des Liegemilieus möglich ist. Ferner muss der Residenzwechsel relativ kurz vor dem Tod des betrachteten Individuums stattgefunden haben,da während eines mehrjährigen Aufenthaltes an einem neuen Standort die Isotopenverhältnisse im Knochen aufgrund der lebenslangen Umbautätigkeit sich an die jeweils standorttypischen angleichen. Mehrheitlich wird ein individueller Residenzwechsel durch Vergleich zweier unterschiedlicher Hartgewebsqualitäten desselben Skelettes vorgenommen: Der Isotopie in einem kompakten Langkno- 132 Evolution des Menschen Abb. 2.40. Identifikation zugewanderter Individuen mittels Sr-Isotopie am Beispiel eines römischen Kastellfriedhofes (Schweissing u. Grupe 2003). Die Mehrzahl der Sr-Isotopenverhältnisse im Zahnschmelz und kompakten Knochen der Individuen ist ortstreu (karbonathaltige Böden, 87Sr/86Sr um 0,709). Eine nicht unerhebliche Anzahl der Söldner hat die frühe Kindheit jedoch in einer von Granitgestein dominierten Region verbracht (87Sr/86Sr > 0,71), ein Individuum stammt aus einer durch vulkanisches Gestein charakterisierten Gegend ( 87Sr/86Sr < 0,707) chen, welche die jahrzehntelange Akkumulation von Strontium widerspiegelt, wird jene des Zahnschmelzes, vorzugsweise des ersten Dauermolaren, gegenübergestellt. Zahnschmelz unterliegt nach seiner Bildung keinem weiteren Umbau, so dass der Schmelz des ersten Dauermolaren die Isotopie jenes Strontiums hat, welches während der ersten drei Lebensjahre inkorporiert wurde. Ist die Zahnschmelzisotopie signifikant von jener des Liegemilieus unterschieden, ist gesichert, dass das betreffende Individuum seine frühe Kindheit an einem geochemisch anders definierten Standort verbracht hat (Abb. 2.40). Mit Hilfe dieser Methode konnte bereits mehrfach das Ausmaß der tatsächlichen Mobilität ganzer Bevölkerungsteile in verschiedenen geschichtlichen Epochen erfasst werden. So waren rund 25% der Bestatteten auf den endneolithischen glockenbecherzeitlichen Gräberfeldern Südbayerns Immigranten (Grupe et al. 1997), die Stadt Teotihuacan auf dem Gebiet des heutigen Mexiko hat sich als ausgesprochener Schmelztiegel während der Klassischen Periode mit einem großen Einzugsgebiet erwiesen (Price et al. 2000). Die bislang noch nicht befriedigend gelöste Problematik dieses Verfahrens liegt darin begründet, dass es nicht mehr möglich ist, die Isotopie des zum damaligen Zeitpunkt bioverfügbaren Strontiums nachträglich zu bestimmen. Es hat sich gezeigt, dass in Abhängigkeit vom atmosphärischen Strontiumeintrag, von den Streifgebieten der Jagdtiere, von der kleinräumig variierenden Geochemie Prähistorische Anthropologie 133 des Muttergesteines und von anderen Faktoren eine bislang unterschätzte lokale Variabilität von Strontium-Isotopenverhältnissen vorliegt mit der Folge, dass den menschlichen Konsumenten bioverfügbares Strontium durchaus eine andere Isotopie aufweisen kann als jene des Muttergesteines oder der Böden. Es wurde vorgeschlagen, zur Definition der Isotopie des lokal bioverfügbaren Strontiums eine begleitende Untersuchung von zeitgleichen, sympatrischen Kleinsäugern vorzunehmen, da diese nicht nur kleine Streifgebiete haben, sondern in der Regel auch eine Mischung aus den lokal verfügbaren Pflanzen konsumieren. Die in den Kleinsäugerskeletten festgestellten Isotopien müssten demnach jener des seinerzeit bioverfügbaren Strontiums am nächsten kommen (Price et al. 2002). Spurenelemente im biologischen Apatit Spurenelemente haben in geringen Konzentrationen (<0,01% der Körpermasse) signifikante biologische Wirkungen (Fiedler u. Rösler 1993). Sie haben die Funktion von Enzymaktivatoren, sind Bestandteil von Metalloenzymen und -proteinen und wirken bei der Hormonfreisetzung und auch im Alterungsprozess mit. Essentielle Spurenelemente wie Kobalt (Co), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), Selen (Se) und Zink (Zn) haben lebenswichtige Funktionen und müssen regelmäßig mit der Nahrung zugeführt werden. Charakteristisch für sie ist, dass der Bedarf in der Regel um mehrere Zehnerpotenzen geringer ist als die im Organismus vorhandenen Reserven, so dass akut auftretende Mangelerscheinungen zu den seltenen Ereignissen zählen. Für eine Reihe von Spurenelementen, unter ihnen Gold (Au), Silber (Ag), Strontium (Sr) und Barium (Ba), ist bislang keine Essentialität bekannt. Als Elemente der chemischen Hauptgruppe IIa werden Sr und Ba spezifisch in das Knochenmineral inkorporiert. Da sowohl der Sr- als auch der Ba-Gehalt in den einzelnen Nahrungskomponenten beträchtlich variieren kann, beide Elemente aufgrund ihrer Nicht-Essentialität auch keiner homöostatischen Kontrolle unterliegen, bestand die Erwartung, mit Hilfe der Konzentrationen insbesondere dieser beiden Elemente das Nahrungsverhalten früher menschlicher Bevölkerungen rekonstruieren zu können. Bereits in den 1970er Jahren wurde mit der Erstellung von Spurenelementprofilen aus dem Knochenmineral die Applikation archäometrischer Verfahren in die prähistorische Anthropologie eingeführt. Elias et al. (1982) konnten nachweisen, dass biologische Prozesse sowohl gegen Sr als auch Ba zugunsten des lebensnotwendigen Mengenelementes Calcium (Ca) diskriminieren. Das Sr/Ca-Verhältnis eines Konsumenten entspricht lediglich etwa einem Fünftel des Sr/Ca-Verhältnisses in der Nahrung, ein Trophiestufeneffekt, den Elias et al. (1982) als biopurification bezeichneten. Es bestand daher die berechtigte Erwartung, vor allem anhand der Sr/Ca-Verhältnisse archäologischer Skelettfunde eine Jäger/Fischer-Subsistenz von einer überwiegend auf Sammelpflanzen basierenden Ernährungsweise unterscheiden zu können. Gezielte Fütterungsexperimente und Untersuchungen rezenter Nahrungsketten führten im Verlauf der letzten Jahre jedoch zu dem Ergebnis, dass die Relation des Sr/Ca-Verhältnisses im Knochen zu den Hauptnahrungskomponenten bei einer gemischten Kost alles andere als linear ist, sondern im We- 134 Evolution des Menschen sentlichen von derjenigen Nahrungskomponente bestimmt ist, welche den höchsten Ca-Gehalt hat (Burton u. Wright 1995). Ein weiteres Problem besteht in dem geographisch erheblich variablen Sr-Angebot mit der Folge, dass die Ausgangswerte für Trophiestufenanalysen signifikant voneinander verschieden sind und daher faktisch kein Interpopulationsvergleich möglich ist (Burton et al. 1999). Nicht zuletzt kommt es im Zuge der Dekomposition des Knochenminerales zu wechselnder Hydrolyse und erneuter Rekristallisation unter Einschluss von Elementen des Liegemilieus, so dass bei jedem Skelettfund von geringer bis erheblicher Kontamination ausgegangen werden muss. Aufgrund dieser Unwägbarkeiten spielen daher heute Spurenelementanalysen mit dem Ziel der Ernährungsrekonstruktion faktisch keine Rolle mehr in der prähistorischen Anthropologie und sind fast vollständig von der Analyse stabiler Isotope leichter Elemente (s. oben) abgelöst worden. Eine neue Perspektive der Spurenelementforschung zeichnet sich jedoch in jüngster Zeit in Bezug auf Herkunftsanalysen ab (s. oben), da Zahnschmelz das habitatspezifische Spurenelementprofil des Konsumenten konservieren kann (Burton u. Price 2003). Dauerhafte menschliche Hartgewebe sind die einzigen empirischen Quellen, welche Auskunft über die reale vorindustrielle Inkorporation von Schadstoffen in den menschlichen Körper geben können (Grupe 1991). Von den potentiell toxischen Schwermetallen wird speziell Blei (Pb) in Knochen und Zähne sequestriert, so dass Pb-Analysen archäologischer Skelettfunde die Entwicklung anthropogenen Schwermetalleintrages in die Umwelt in Raum und Zeit rekonstruieren lassen. Von Beginn der Metallverarbeitung an hat die Erzverhüttung mit steigender Bevölkerungszahl und entsprechend steigendem Bedarf an Gerät, Waffen und Haushaltswaren ständig zugenommen. Im mittelalterlichen Deutschland z. B. stieg der anthropogene Bleieintrag in die Umwelt merklich seit der karolingischen Münzreform im 8. Jahrhundert an, welche auf dem silbernen Pfennig beruhte und zur vermehrten Ausbeutung der Blei-Silber-Erzgänge vor allem im Schwarzwald und im Harz führte. Über die Bestimmung des Bleigehaltes in menschlichen Skelettfunden kann die reale Bleiexposition ermittelt werden (Fergusson 1990). Konservierte DNA Der Zugriff auf konservierte DNA in archäologischen Skelettfunden eröffnet potentiell die Möglichkeit zu erweitertem Erkenntnisgewinn, etwa in Bezug auf genealogische Zusammenhänge und populationsgenetische Prozesse. Im Vergleich zu dem Strukturprotein Kollagen, welches aufgrund seiner hochvernetzten Struktur und Wasserunlöslichkeit sehr gute Konservierungsaussichten hat, liegt konservierte DNA nach heutigem Kenntnisstand fast ausnahmslos in hochdegradiertem Zustand vor, so dass sich lediglich kurze Abschnitte von wenigen hundert Basenpaaren extrahieren und mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) amplifizieren lassen. Aufgrund der bevorzugten Amplifikation intakter, faktisch ubiquitärer DNA ist das Kontaminationsproblem hochevident, so dass sehr strenge Authentifizierungskriterien an das Amplifikationsprodukt gestellt werden müssen, denen nach Auffassung von Lalueza Fox (2003) in Zukunft noch höhere Aufmerksamkeit zuteil werden sollte. Prähistorische Anthropologie 135 Mehrheitlich werden Zahnwurzeln den Knochen als Ausgangssubstrat für die Gewinnung konservierter DNA vorgezogen, da die Odontoblastenschicht sowohl durch das Dentin als auch durch den Alveolarknochen geschützt ist, während Knochen ein hochporöses System darstellt und überproportional häufig zu Fehlschlägen bei der Gewinnung autochthoner DNA führt (Burger et al. 1997). Neben den unterschiedlichen Löslichkeiten von DNA und anderen, interstitiellen Biomolekülen besteht jedoch ein weiterer fundamentaler Unterschied in Bezug auf die DNA-Dekomposition: Die cytologischen und molekularen Prozesse während des Zelltodes sind im Detail bekannt (z. B. Gill-King 1997) und führen zu einer raschen DNA-Degradierung nach dem Tod. Während insbesondere vernetzende Moleküle des Knochens wie z. B. Kollagen somit erst einen dekompositionsbedingten Strukturverlust unter der Liegezeit im Erdreich erfahren, gilt für die DNA, dass Liegemilieufaktoren bereits auf deren Degradationsprodukte einwirken. mtDNA-Analysen dienen der Identifikation von Individuen und der Verwandtschaftsanalyse, aber auch zu Untersuchungen zur Populationsgenetik und Stammesgeschichte des Menschen. Neben Restriktionsschnittstellen werden hierbei vor allem Sequenzen der mitochondrialen Kontrollregion, die im Displacement(D)-Loop lokalisiert ist, analysiert. Die größte Variation innerhalb der Kontrollregion wird in der als „hypervariable Region I und II“ bezeichneten Region vorgefunden, wobei beim Sequenzvergleich die von Anderson et al. (1981) publizierte mtDNA-Sequenz als Referenz zugrunde gelegt wird. Stammesgeschichtliche Studien an menschlichen Skelettfunden bezogen sich vor allem auf den Sequenzvergleich der mitochondrialen Kontrollregion HVR I und HVR II von Neandertalerfunden und anatomisch modernen Menschen (vgl. Lalueza Fox 2003, Knight 2003). Insbesondere im Hinblick auf populationsgenetische Studien zur Besiedlungsgeschichte Amerikas konzentrieren sich mtDNA-Analysen auch auf bestimmte Restriktionsschnittstellen in der mtDNA sowie eine 9-bp Deletion, die eine Einteilung in mehrere Linien bzw. Haplogruppen zulässt (z. B. Malhi et al. 2003). Sowohl mitochondriale Kontrollregionsequenzen als auch Restriktionsschnittstellen wurden im Rahmen populationsgenetischer Studien zur Besiedlungsgeschichte Amerikas wiederholt auch an menschlichen Skelettfunden analysiert (z. B. Kolman u. Tuross 2000). Jüngere populationsgenetische Studien an menschlichen Skelettfunden beziehen auch die Rekonstruktion der Bevölkerungsgeschichte Europas ein (z. B. di Benedetto et al. 2000). Arbeiten mit chromosomaler konservierter DNA beschäftigen sich mehrheitlich mit molekulargenetischer Geschlechtsbestimmung, der Identifikation von Skelettfunden und der Rekonstruktion von Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb komplexer Grablegen. Die molekulargenetische Geschlechtsanalyse kann bei gut erhaltenen Funden als Kontrolle bzw. Bestätigung der konventionellen morphologischen Geschlechtsbestimmung dienen. Bei weitgehend zerstörten Skeletten, an denen morphologische Geschlechtsmerkmale kaum noch feststellbar sind, oder bei neonaten Kindern ist die molekulargenetische Geschlechtsbestimmung häufig jedoch die einzige Möglichkeit, das Geschlecht zu determinieren (z. B. Ovchinnikov et al. 1998, Faerman et al. 1998). 136 Evolution des Menschen Zur Identifikation von Individuen und Rekonstruktion von Verwandtschaftsbeziehungen dienen in der Regel Mikrosatelliten-Längenpolymorphismen (short tandem repeats, STRs). Bei sieben untersuchten Loci liegt nach Urquhart et al. (1995) die Wahrscheinlichkeit, dass zwei unverwandte Individuen das gleiche DNA-Profil aufweisen, die sogenannte Matching Probability, bei 10-8. Spektakuläre Fälle wie der Nachweis von Thomas Jeffersons Vaterschaft für eines der Kinder seiner Sklavin (Foster et al. 1998), die Identifikation Joseph Mengeles (Jeffreys et al. 1992) oder mutmaßlicher Mitglieder der Zarenfamilie Romanow (Gill et al. 1994, Stoneking et al. 1995) wurden unter anderem mithilfe von STRs geklärt. Zur Anwendung kommt diese Methode auch, wenn archäologische Befunde auf eine bestehende Verwandtschaft zwischen den Individuen hinweisen und durch genetische Analysen verifiziert werden sollen (z. B. Gerstenberger et al. 1999, Schultes et al. 2000). Molekulargenetische Analysen an menschlichen Skelettfunden haben bisher kaum Zugang zu chromosomalen Exonbereichen gefunden. Die Einbeziehung kodierender chromosomaler DNA-Sequenzen ermöglicht jedoch den Einblick in die den Genprodukten zugrunde liegenden Erbinformationen. Daher ist die Untersuchung kodierender DNA-Sequenzen in menschlichen Skelettüberresten zweifellos von großer wissenschaftlicher Relevanz sowohl im Hinblick auf medizinische, funktionsanalytische als auch populationsgenetische Fragestellungen. Hierbei ist die individualbezogene Befundanalyse ebenso einzubeziehen wie die Analyse größerer Kollektive. Kodierende Sequenzen, welche bereits aus archäologischen menschlichen Skelettfunden gewonnen werden konnten, betreffen z. B. den MIC A-Polymorphismus (Wiechmann u. Grupe, im Druck), einen in der HLA-Region lokalisierten Trinukleotid-Repeat-Polymorphismus (Heterozygotierate 76%), der nach neuesten Untersuchungen mit Autoimmunerkrankungen assoziiert ist (z. B. Park et al. 2001), oder das Transferrin-System (s. Kap. 3.1). Da die Affinität der Transferrin-Moleküle zu Al3+ jener zu Fe3+ vergleichbar ist, wird dem TF und seinem Rezeptor daher eine wesentliche Rolle bei der Ablagerung von Al3+ im Gehirn zugeschrieben. Hohe Al3+-Konzentrationen werden wiederum als wesentlicher pathologischer Faktor bei verschiedenen Krankheitsbildern des Gehirns, u. a. der Alzheimer-Krankheit, eingestuft (Connor et al. 1992). Die Untersuchung kodierender Sequenzen ist daher auch epidemiologisch hoch relevant. Analysen konservierter DNA sind gegenwärtig im Vergleich zu anderen archäometrischen Applikationen noch besonders zeit- und kostenintensiv, nicht zuletzt aufgrund des relativ hohen Aufwandes zur Authentifizierung des Amplifikationsproduktes (Mehrfachextraktionen und -amplifikationen, Interlaborvergleich, Sequenzierung etc.). Es ist daher wohl überwiegend technisch bedingt, dass die Mehrzahl der bislang publizierten erfolgreichen Analysen menschlichen Skelettgutes entweder Einzelfunde von herausragender wissenschaftlicher Bedeutung oder eher kleinere Skelettkollektive betreffen. Gute Erfolge hat die Analyse konservierter DNA daher insbesondere bei der Identifikation primär körperfremder DNA erzielt, und zwar in Bezug auf die Detektion der Erreger von Infektionskrankheiten, welche keine oder lediglich sekundäre Symptome am Skelett hinterlassen (Yersinia pestis, Wiechmann u. Grupe, im Druck; Mycobacterium tuberculosis, Spigelman et al. 2002) (Abb. 2.41). Prähistorische Anthropologie 137 Abb. 2.41. Nachweis von Yersinia pestis-DNA aus menschlichen Skeletten einer Pestbestattung des 14. Jahrhunderts (Wiechmann u. Grupe, im Druck). Polyacrylamidgel nach Silberfärbung mit dem 148-bp amplifiziertem Yersinia pestis pla-Fragment (YP12D/YP11R). Spuren 1-5, 10-14: DNA aus 10 Skelettindividuen, drei positive Resultate (Spuren 4, 10 und 11). Spuren 6, 15: Extraktionskontrollen (leer). Spuren 7, 16: PCR-Kontrollen (leer). Spur 8: 20bp-Leiter. Spur 9: 100 bp-Leiter Nicht-kollagene Proteine (NCP) Trotz ihrer Wasserlöslichkeit können auch viele der nicht-kollagenen Proteine potentiell nach langer Liegezeit im Knochen konserviert sein. Mehrheitlich dürfte dies auf solche Proteine zutreffen, welche über saure Valenzen verfügen und über die Carboxylgruppe an den Apatit binden (ApatitCa-OOC-Protein). Mehrfach wurden NCP wie die Serumproteine Albumin, Transferrin, α2-HSGlycoprotein, einige Immunglobuline und auch das Enzym alkalische Phosphatase in archäologischen Knochen und selbst auf Blutresten an prähistorischen Steinwerkzeugen nachgewiesen (z. B. Kooyman et al. 1992, Cattaneo et al. 1995, Grupe u. Turban-Just 1996, Weser et al. 1996). Grundsätzlich würde die zweifelsfreie Identifikation dieser nicht-kollagenen Proteine und gegebenenfalls ihrer Polymorphismen wertvolle Erkenntnisse über populationsgenetische (s. Kap. 3.1) und stammesgeschichtliche (s. Kap. 2.2) Prozesse liefern, ferner zur Speziesidentifikation bei stark fragmentiertem oder zu Artefakten bearbeitetem Fundgut oder auch zur Paläopathologie, etwa bei Nachweis von Akutphaseproteinen. Voraussetzung hierfür ist aber wiederum die Konservierung intakter Epitope, welche von den (vorzugsweise monoklonalen) Antikörpern erkannt werden können. Leider dürfte dies dekompositionsbedingt mehrheitlich nicht der Fall sein (Downs u. Lowenstein 1995, Fiedel 1996). Ferner ist bei bodengelagertem Material stets mit unspezifischen Kreuzreaktionen der Antikörper mit degradierten oder kontaminierenden Proteinen zu rechnen. Insbesondere die mittels ELISA erzielten unspezifischen positiven Reaktionen von anti-human α2-HS-Glycoprotein, anti-human Albumin und anti-human α1-Antitrypsin mit Oberflächenproteinen des nachweislich knocheninvadierenden Bacillus subtilis stimmen außerordentlich bedenklich (Brandt et al. 2002). Eine Validierung der 138 Evolution des Menschen immunologischen Detektion konservierter NCP kann nach derzeitigem Kenntnisstand letztlich – analog der Authentifizierung konservierter autochthoner DNA – nur die Mehrfachextraktion von Proteinen aus verschiedenen Elementen desselben Skelettes und anschließende Mehrfachidentifikation eines Targetproteins aus jedem separaten Extrakt auf somit statistischem Wege liefern. Zusammenfassung Kapitel 2.3 Prähistorische Anthropologie n Ziel der prähistorischen Anthropologie ist die Erschließung der Determinanten menschlicher Bevölkerungsentwicklung in Zeit und Raum. Sie versteht sich als Bevölkerungsbiologie von Menschen früherer Zeiten. n Das Arbeitsgebiet der prähistorischen Anthropologie setzt zeitlich in der Regel im Jungpaläolithikum ein und endet in der Neuzeit. n Untersuchungsgut sind im Wesentlichen die dauerhaften, mineralisierten Hartgewebe des menschlichen Körpers. Ihre häufigste Überlieferungsform sind menschliche Skelette nach Körperbestattung oder Leichenverbrennung. n Der Überlieferungsgrad archäologischer Skelettfunde ist weniger von der Liegezeit im Erdreich abhängig als von Liegebedingungen. n Die Diagnose der biologischen Basisdaten umfasst die Bestimmung des individuellen Sterbealters, des Geschlechtes, metrischer Merkmale, Varianten in Aufbau und Struktur des Skelettes, Aktivitätsmuster und gegebenenfalls Symptome von Erkrankungen oder Anzeichen für die Todesursache. n Die so erhobenen Individualdaten werden zu Kollektivdaten zusammengeführt, welche eine Rekonstruktion der ehemaligen Lebendpopulation aus den Skelettresten ihrer verstorbenen Mitglieder erlauben. n Der Einsatz archäometrischer Methoden erlaubt die Entschlüsselung von Skelettfunden auf der molekularen, submolekularen und kristallinen Ebene in Bezug auf die Stellung von Menschen in prähistorischen Nahrungsnetzen, von menschlicher Ernährungsweise, Migration und Handel, Herkunftsanalysen, Umweltverschmutzung und genetischer Beziehungen. Bevölkerungsbiologie 3.1 Populationsgenetik 3.1.1 Aufgaben und theoretische Grundlagen „Die Populationsgenetik untersucht das Schicksal von Allelen in Populationen“ (Hirsch-Kauffmann u. Schweiger 1992), d. h. auf welche Art und Weise Allele (Box 3.1) von der Elterngeneration auf die Nachkommengeneration verteilt werden. Die differentielle Häufigkeit von Allelen und die Gründe für die festgestellten Genfrequenzen in einer Population spielen eine Schlüsselrolle für das Verständnis der Evolution des Homo sapiens, in Bezug auf die angewandten Wissenschaften ebenso für das Verständnis der Epidemiologie genetisch bedingter Erkrankungen wie auch in der Forensik (s. Kap. 5.2). Die Populationsgenetik bedient sich hierbei mathematischer Modelle, welche zunächst für solche Allele entwickelt wurden, die im Zuge ihrer Neukombination bei der sexuellen Fortpflanzung zu verschiedenen Phänotypen führen. Sie schließen heute selbstverständlich DNA-Sequenzen mit ein (s. Box 3.1; Tabelle 3.1). Zunächst bedarf es jedoch der Definition des Untersuchungssubstrates, der Population. Diese entspricht einer Fortpflanzungsgemeinschaft von Individuen einer Spezies, welche über einen gemeinsamen Genpool (= Summe aller Gene und deren Allele, welche in dieser Population vorkommen) verfügen und fruchtbare Nachkommen hervorbringen. Bei Angehörigen einer Biospezies besteht potentiell die uneingeschränkte Möglichkeit der Paarung und Fortpflanzung, was bei Zufallspaarung und Fehlen von Partnerwahl als Panmixie bezeichnet wird. Da biologische Spezies voneinander reproduktiv isoliert sind, entspricht die größte denkbare Population der Zahl aller Angehörigen einer Spezies (Dobzhanski 1951). In der Regel finden sich aber innerhalb einer Art diverse kleinere Fortpflanzungsgemeinschaften, die etwa geographisch voneinander isoliert sind, im Falle des Menschen auch durch religiöse, soziale oder anderweitige kulturbedingte Mechanismen. Zwischen diesen Populationen besteht potentiell Genfluss (= Austausch von Genen oder derer Allele) in größerem oder geringerem Ausmaß in Abhängigkeit vom Grad der Isolation. Der Genfluss zwischen Populationen im Zentrum der geographischen Verbreitung einer Art oder deren Unterpopulationen ist in der Regel weit größer als jener in Richtung von Populationen an der Peripherie (Abb. 3.1), so dass 140 Bevölkerungsbiologie Box 3.1 Das menschliche Genom Das gesamte menschliche Genom besteht aus etwa 3 000 000 000 bp (= Basenpaaren) (oder 3000 Megabasenpaaren) der DNA.Das Genom des Zellkernes untergliedert sich wiederum in 24 lineare DNA-Moleküle zwischen 55 und 250 Megabasen Länge, welche sich in den 22 Autosomen und den beiden Gonosomen (X- bzw. Y-Chromosom) befinden. Das Genom der Mitochondrien besteht aus einem ringförmigen DNA-Molekül mit 16 569 bp. Mit Ausnahme jener Zellen, welche über keinen voll differenzierten Zellkern verfügen (z. B.die roten Blutkörperchen), besitzt jede menschliche Körperzelle einen kompletten Satz des Genoms.Somatische Zellen sind diploid und enthalten somit zwei Kopien eines jeden Autosoms zuzüglich der beiden Gonosomen (ergibt 46 Chromosomen), während die haploiden Gameten jeweils die 22 Autosomen und je ein Gonosom enthalten.Beide Zelltypen besitzen jeweils um die 8000 Kopien des mitochondrialen Genoms (Brown 1999).Im Folgenden wird als „Gen“ die kleinste Funktionseinheit im Genom bezeichnet, entsprechend einem Abschnitt auf der DNA eines Chromosoms oder Mitochondriums, welcher für ein Merkmal (struktureller oder funktioneller Natur) kodiert. Allele sind verschiedene Zustandsformen von Genen, welche durch Mutation entstehen und sich in der Nukleotidsequenz der DNA unterscheiden. Bei Homozygotie liegen identische Allele auf den korrespondierenden Abschnitten der Chromosomen, bei Heterozygotie verschiedene. Hemizygotie liegt vor, wenn zu einem Allel kein korrespondierender Abschnitt existiert, etwa bei den Gonosomen. letzte eher über einen Genpool verfügen, welcher für diese charakteristisch ist (Sperlich 1988). Lokale Populationen sind die aktuellen, real evolvierenden Einheiten einer Biospezies und werden auch als Mendel-Populationen bezeichnet (Hartl u. Clark 1997). Sämtliche bislang untersuchten Spezies sind genetisch polymorph1, d. h. ein Merkmal wird in der Population in der Form von mindestens zwei Phänotypen exprimiert (mit entsprechend mindestens zwei zugrunde liegenden Genotypen). „Seltene Allele“ treten mit geringerer Häufigkeit (in der Regel <0,5%) auf (Vogel u. Motulsky 1997). Diese Häufigkeitsgrenzen sind willkürlich festgelegt. Für menschliche Populationen wird davon ausgegangen, dass etwa ein bis zwei Individuen unter 1000 für ein solches seltenes Allel heterozygot sind, wobei viele seltene Allele nachteilige Effekte für ihren Träger haben und lediglich aufgrund 1 Genetischer Polymorphismus = Vorkommen von mindestens zwei unterschiedlichen Genotypen in einer Population, deren Häufigkeiten nicht der Mutationsrate entsprechen. Populationsgenetik 141 Abb. 3.1. Genfluss zwischen Populationen einer Spezies, nach Sperlich (1988). Während für die zentrale Population 1 Genfluss zu zahlreichen Nachbarpopulationen möglich ist, ist dieser für die periphere Population 11 stark eingeschränkt von wiederholten Neumutationen regelmäßig in der Population auftreten. Die Definition von Polymorphismen in Abhängigkeit von der Allelhäufigkeit hat also letztlich nur zum Ziel, sich auf solche Allelfrequenzen zu konzentrieren, welche zu häufig sind, um in Bezug auf ihre Existenz allein durch Neumutation erklärt zu werden (Hartl u. Clark 1997). Die für populationsgenetische Untersuchungen relevanten Polymorphismen beziehen sich zum einen auf Polymorphismen des exprimierten Genproduktes (Oberflächenantigene der roten Blutkörperchen, Leukozytenantigene, Serumproteine, Enzyme), zum anderen auf DNA-Polymorphismen (Tabelle 3.1). Aufgrund der großen Zahl der humanen Polymorphismen ist jeder einzelne Mensch „biochemisch einmalig“, ausgenommen eineiige Mehrlinge (Vogel u. Motulsky 1997). Unabhängig voneinander kamen im Jahr 1908 der englische Mathematiker G. Hardy (1877–1947) und der deutsche Biologe W. Weinberg (1862–1937) zu der Erkenntnis, dass in einer „idealen Population“ die prozentuale Häufigkeit von Allelen im Genpool (Genfrequenz) über die Abfolge der Generationen hinweg konstant bleibt (Hardy-Weinberg-Gesetz). Die Allelfrequenzen in dieser idealen Population verbleiben somit stabil, es herrscht der Gleichgewichtszustand (Box 3.2). Das Hardy-Weinberg-Gesetz bezieht sich ausdrücklich nur auf autosomale Allele, denn nur deren Häufigkeiten sind in männlichen und weiblichen Individuen gleich. Eine ideale Population ist selbstverständlich eine Modellannahme, welche durch folgende Merkmale charakterisiert ist: sie 142 Bevölkerungsbiologie Tabelle 3.1. Ausgewählte Polymorphismen auf der Ebene der DNA und des exprimierten Merkmales Blutgruppen: z. B. A1A2B0-System, MNSs-System, Rhesus-System, Diego-System, XG-System (X-chromosomal) Serumproteine: z. B. α1-Antitrypsin (wichtiger Protease-Inhibitor), Haptoglobin (bindet freies Hämoglobin im Serum), Transferrin (Transportprotein für Eisen im Serum) Enzyme: HämoglobinVarianten: z. B. Glucose-6-phosphat-dehydrogenase (Schlüsselrolle im Glukosestoffwechsel), Alkoholdehydrogenase (bewirkt den Abbau von Ethanol und längerkettigen Alkoholen zu den entsprechenden Aldehyden) können homozygot zu Hämoglobinopathien führen, z. B. Sichelzellanämie HLA-System: Human Leucocyte Antigens, Teil des Major Histocompatibility Complex (MHC), verantwortlich für die Gewebstypologie (Organtransplantationen) RFLPs: Restriction length fragment polymorphisms: Nukleotid-Unterschiede an DNA-Schnittstellen, welche von Restriktionsenzymen erkannt werden und nach Restriktion Fragmente unterschiedliche Länge produzieren VNTRs: variable number of tandem repeats (Minisatelliten): Repetitive DNA, bei welcher Sequenzen von bis zu 30 kb tandemartig hintereinander angeordnet sind STRs: short tandem repeats (Mikrosatelliten): Repetitive Sequenzen <1 kb mt-DNA hohe Mutationsrate führt zu variablen Sequenzen und Restriktionsmustern SNPs: single nucleotide polymorphisms: Sequenzvariation der DNA durch Veränderung eines einzelnen Nukleotides. SNPs kommen alle 100 bis 300 Basen im Genom vor Interspersed repeats: eingestreute Wiederholungssequenzen >300 bp, nicht unbedingt repetitiv oder tandemartig angeordnet ist unendlich groß, es herrscht Panmixie2, das betrachtete Allel unterliegt keinem Selektionsdruck, Mutationen treten nicht auf, es kommt zu keiner Separation von Lokalpopulationen. Es liegt auf der Hand, dass keines dieser Merkmale auf menschliche Populationen zutrifft, was allerdings auch zwingend notwendig ist, damit Evolution überhaupt stattfinden kann. Abgesehen davon, dass kodierende Allele naturgemäß der Selektion unterliegen und auch Mutationen vorkommen, sind insbesondere frühe menschliche Population eher klein gewesen, so dass die Genverteilung auch Zufälligkeiten unterlag (s. Kap. 3.2). Auch die Partnerwahl wird durch zahlreiche kulturelle Rahmenbedingungen gefördert. Es sind somit gerade festgestellte Abweichungen vom Hardy-Weinberg-Gleichgewicht, welche auf die Wirkursachen der Populationsentwicklung hinweisen und oft auch rückschließen lassen (Seyffert 1998). 2 Bei Panmixie herrscht Zufallspaarung, d. h. männliche und weibliche Gameten vereinigen sich zufällig zu einer Zygote. Jedes Individuum der Population hat die gleiche Chance, sich mit jedem anderen Individuum zu paaren. Populationsgenetik Box 3.2 Ableitung des Hardy-Weinberg-Gleichgewichtes Ein autosomaler Genlocus habe die Allele A und a, mit den zugehörigen Häufigkeiten p (für A) und q (für a). Da die Summe der Genfrequenzen die Gesamthäufigkeit der Allele an diesem Locus angibt,gilt p+q = 1 (100%). Für die Gameten gilt ebenfalls,dass p Eizellen das Allel A tragen und q Eizellen das Allel a, entsprechend p Spermien das Allel A und q Spermien das Allel a. Die Allelhäufigkeiten in den Zygoten ergibt sich wie folgt: Weibliche Gameten A (p) a (q) Männliche Gameten A (pp) a (q) AA (p2) Aa (pq) aA (pq) aa (q2) Da sich die Allelhäufigkeiten im Gesamtgenpool zu 100% summieren, gilt p2+2pq+q2 = 1. Es gilt der Grundsatz der Wahrscheinlichkeit, dass das gleichzeitige Eintreten zweier unabhängig voneinander ablaufender Ereignisse gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeiten der Einzelereignisse ist (vgl. Voraussetzung der Panmixie, zuzüglich gleiche Gametenfruchtbarkeit und Überlebenschancen der Zygoten). Die Häufigkeiten der Allele in der Nachkommengeneration ergeben sich wie folgt: Parentalgeneration Frauen: AA (p2) Aa (2pq) aa(q2) Parentalgeneration Männer: Aa (2pq) AA (p2) AA x AA (p4) AA x Aa (2p3q) Aa x AA (2p3q) Aa x Aa (4p2q2) aa x AA (p2q2) aa x Aa (2pq3) aa(q2) AA x aa (p2q2) Aa x aa (2pq3) aa x aa (q4) Die Genfrequenzen der Filialgeneration lauten folgerichtig: Zygoten: AA x AA (p4) AA x Aa (4p3q) AA x aa (2p2q2) Aa x Aa (4p2q2) Aa x aa (4pq3) aa x aa (q4) Genfrequenzen der Nachkommen: AA Aa aa p4 2p3q 2p3q 2p2q2 p2q 2p2q2 p2q2 3 2pq 2pq3 q4 Jeweilige Addition der drei Spalten für die Genfrequenzen der Nachkommen ergibt p2(p2+2pq+q2), 2pq(p2+2pq+q2) und q2(p2+2pq+q2), d. h. alle drei Genotypen der Kinder liegen in denselben Frequenzen wie jene der Elterngeneration vor. 143 144 Bevölkerungsbiologie 3.1.2 Veränderung von Genfrequenzen Das Maß für Veränderungen von Genfrequenzen in einer Population über längere Zeiten hinweg ist die Fitness, definiert als die Effizienz zum Überleben und zur Reproduktion (Vogel u. Motulsky 1997). Die Fitness einer Zygote eines bestimmten Typus X ist gleich der Wahrscheinlichkeit, dass sie bis zum Zeitpunkt der Fortpflanzung überlebt, gewichtet mit der erwarteten Anzahl lebensfähiger Nachkommen. Sie ist damit eine Eigenschaft einer Gruppe von Individuen, da Selektion am Phänotyp angreift, und bezieht sich ausdrücklich auf alle Mitglieder einer Population, welche in Bezug auf bestimmte Allele dem Typus X entsprechen. Die häufig angetroffene verkürzte Darstellung, in welcher die Fitness einem speziellen Genotyp zugeschrieben wird, ist somit nicht korrekt: sie bezieht sich auf eine Gruppe von Individuen mit gemeinsamen genetischen Eigenschaften (Smith 1992). Mutation und Selektion Mutation ist die unmittelbare Ursache für genetische Variabilität. Obgleich Mutationsraten mehrheitlich niedrig sind, können sich in großen Populationen Neumutationen rasch anhäufen. In einem hypothetischen Beispiel zeigen Hartl u. Clark (1997, S. 164), dass bei einer angenommenen niedrigen Mutationsrate von 10-9 pro Nukleotidpaar und Generation jede menschliche Gamete im Durchschnitt drei Neumutationen in jeder Generation tragen würde, und jede Zygote somit sechs. Bei einer Weltbevölkerung von etwa 6 Milliarden Menschen wären das 36 Milliarden Neumutationen im Vergleich zur vorangegangenen Generation! Zahlreiche Mutationen betreffen den nicht-kodierenden Teil des Genoms oder wirken sich nicht auf den Phänotyp aus. Sie verbleiben damit selektionsneutral und sind besonders gut für die retrospektive Erschließung evolutiver Prozesse geeignet („molekulare Uhr“, s. Kap. 3.1.3). Die Mehrzahl der dominanten Neumutationen wirken sich jedoch nachteilig auf das betroffene Individuum aus, welches geringere Überlebens- und/oder Reproduktionschancen aufweisen kann. Neue Allele, welche durch Mutation in den Genpool gelangen, unterliegen sofort der Selektion. Bevor auch rezessive Allele homozygot vorliegen und ihre gegebenenfalls nachteilige Wirkung zeigen können, existieren sie in heterozygoter Form. Dieser heterozygote Zustand kann für das betroffene Individuum unter bestimmten Bedingungen jedoch von Vorteil sein und seine Fitness sogar gegenüber den homozygot „gesunden“ Individuen erhöhen (Heterozygoten-Vorteil, s. unten). Ebenso kommt es vor, dass einzelne Allele eines polymorphen Genlocus unter bestimmten Umweltbedingungen vorteilhafter für ihre Träger sind als andere. Zahlreiche Selektionsmechanismen sorgen daher bei gemeinsamem Genpool für die unterschiedliche Häufigkeitsverteilung von Genen (und der zugehörigen exprimierten Merkmale) in den verschiedenen menschlichen Populationen. Zu den wichtigsten Selektionsfaktoren für Menschen zählen Infektionskrankheiten welche eine hohe Kindersterblichkeit bedingen, so dass ein signifikanter Anteil der nachwachsenden Population Populationsgenetik 145 Tabelle 3.2. Ausgewählte Allelfrequenzen (Walter 1998) Allel ABo*1 AB0*2 AB0*B AB0*0 RH*CDe RH*cDE RH*cDe RH*cde HB*S G6PD*def Europa Asien Amerika Inuit Afrika Australien Neu-Guinea Ozeanien 0,215 0,063 0,093 0,629 0,431 0,14 0,026 0,381 0,003 0,056 0,21 0,016 0,194 0,58 0,628 0,142 0,057 0,137 0,009 0,051 0,034 0,004 0,009 0,953 0,544 0,327 0,04 0,022 0 0,001 0,291 0,014 0,073 0,622 0,579 0,329 0,019 0,06 0 0 0,185 0,041 0,104 0,67 0,177 0,084 0,482 0,233 0,07 0,105 0,204 0 0,017 0,779 0,651 0,2 0,086 0 0 0 0,251 0 0,128 0,657 0,908 0,065 0,025 0 0 0,04 0,234 0,001 0,101 0,664 0,795 0,151 0,033 0,007 0 0,029 das reproduktive Alter nicht erreicht (Joblin et al. 2004). Nachfolgend seien einige gut untersuchte Beispiele aufgeführt: Das A1A2B0-Blutgruppensystem, die „klassischen Blutgruppen“ des Menschen, hat seinen Genlocus auf Chromosom 9q34.1-q34.2 und neben einigen seltenen Varianten die häufigen Allele AB0*A1, AB0*A2, AB0*B und AB0*0. Dabei verhalten sich die Allele AB0*A und AB0*B dominant über AB0*0 (AB0*A1 dominant über AB0*A2) und untereinander kodominant (Schenkel-Brunner 2000). Da auch die großen Menschenaffen über den AB0-Polymorphismus verfügen (Schmid u. Buschmann 1985), dürfte dieser bereits bei den frühen Hominiden (s. Kap. 2.2) ebenfalls bestanden haben. Dennoch ist die Häufigkeitsverteilung der Allele bei der autochthonen Bevölkerung der Kontinente deutlich verschieden (Tabelle 3.2). Das Allel AB0*0 ist weltweit häufig, jedoch überproportional häufig in solchen Populationen, welche über lange Zeiträume hinweg in relativer Isolation gelebt haben (z. B. Australien). Höchste Frequenzen finden sich bei den Zentral- und Südamerikanischen Indianern. Das Allel AB0*B tritt dagegen in Asien überproportional häufig auf (Vogel u. Motulsky 1997, Walter 1998). Obgleich diejenigen Mechanismen, welche zur heutigen Verteilung der Allelfrequenzen geführt haben, nicht mehr direkt beobachtbar sind, dürften häufig wiederkehrende Epidemien von Infektionskrankheiten eine bedeutende Rolle gespielt haben. So war z. B. die autochthone Bevölkerung Zentral- und Südamerikas dem Syphiliserreger Treponema pallidum ausgesetzt. Beobachtungen aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, zu einer Zeit also, in der es noch kein Penicillin zur Therapie gab, hatten zum Ergebnis, dass es zwar zu keiner differentiellen Anfälligkeit gegenüber der Treponematose3 von Angehörigen der verschiedenen AB0-Blutgruppen kam, dass aber Individuen der Blutgruppe 0 nach damaliger konventioneller Therapie rascher seronegativ wurden als Individuen der Blutgruppen A, B und AB und weniger häufig Symptome einer tertiären Syphilis 3 Treponematosen = durch Treponema-Bakterien hervorgerufene Erkrankungen (Syphilis, Frambösie, Pinta) 146 Bevölkerungsbiologie entwickelten. Ein Selektionsvorteil der Blutgruppe 0 gegenüber Treponematosen, insbesondere der Syphilis, liegt somit nahe. Studien aus Bangladesh hatten zum Ergebnis, dass diese Blutgruppe andererseits einen Selektionsnachteil gegenüber der Cholera besitzen dürfte (Glass et al. 1985). In Europa und Asien war eine andere Seuche endemisch: die Pest, hervorgerufen durch Yersinia pestis. Individuen der Blutgruppe 0 weisen eine schwächere Immunantwort und höhere Sterberate nach Pestinfektion auf. Kontrovers diskutiert wird die Frage, ob die Blutgruppe B einen Selektionsvorteil gegenüber dem Pockenvirus (Variolavirus) habe, doch zahlreiche Untersuchungen konnten bei diesen Individuen sowohl eine geringere Erkrankungsfrequenz und geringere Sterblichkeit als auch weniger schwerwiegende Symptome nach Variola-Infektion aufzeigen als bei Trägern des Alleles AB0*A (Blutgruppen A und AB).Da sämtliche genannten Infektionskrankheiten heute effizient therapiert werden können, ist die Schlussfolgerung zwar hypothetisch, aber plausibel: Die extrem hohe Frequenz der Blutgruppe 0 in Zentral- und Südamerika ist Folge eines Vorteiles gegenüber der Syphilis, das häufige Vorkommen dieser Blutgruppe in eher isolierten europäischen Bevölkerungen (z. B. Iren, Basken, Korsen, Sarden, Isländer) eine Folge geringerer Selektion durch Pest und Cholera, die geringe Frequenz von A und 0 in Asien ist Folge der Selektion durch Pocken, Pest und Cholera (ausführliche Darstellung bei Vogel u. Motulsky 1997, Walter 1998). Neben solcher Selektion aufgrund unterschiedlicher Anfälligkeit gegenüber Infektionskrankheiten dürfte auch die Tatsache der AB0-Blutgruppeninkompatibilität eine wichtige populationsgenetische Rolle spielen, da im Falle der Blutgruppenunverträglichkeit zwischen Mutter und Vater (z. B. Mutter AB0*0, Vater AB0*A oder AB0*B) eine starke pränatale Selektion gegen heterozygote Kinder wirkt. Immunisierung der Mutter gegen Kinder der Blutgruppen A oder B dürfte zum frühen Abort führen, denn tatsächlich werden signifikant weniger Kinder aus den genannten Mutter/Vater-Dyaden geboren als es der statistischen Erwartung entspricht (Walter 1998). Sichelzellanämie. Das Hämoglobin A von Erwachsenen besteht aus je einer Häm- und einer Globinkomponente, wobei letzte aus zwei α- und zwei β-Ketten zusammengesetzt ist (der Genlocus für die α-Ketten liegt auf dem Chromosom 16p13.3, jener für die β-Ketten auf Chromosom 11p15.5). Bei der Hämoglobinvariante HbS kommt es an der 6. Position der β-Kette zu einem Austausch von Glutaminsäure durch Valin. Die Allele HB*A und HB*S vererben sich kodominant, wobei Homozygote für HB*S an der Sichelzellanämie (Box 3.3) erkranken, Heterozygote phänotypisch in der Regel gesund sind (Walter 1998). Die Frequenz von HB*S ist in Afrika signifikant erhöht (Tabelle 3.2), wobei die Häufigkeit von Heterozygoten im periäquatorialen Gürtel von Zaire bis Tanzania bis zu 40% betragen kann. Hohe Heterozygotenhäufigkeiten finden sich ferner kleinräumig im Mittelmeerraum (Sizilien, Kalabrien, Teile von Griechenland) sowie in Bevölkerungen Südindiens. Das HB*S-Allel fehlt der autochthonen Bevölkerung Amerikas ebenso wie jenen Nord- und Nordwesteuropas. Die geographische Kartierung des Vorkommens dieses Alleles zeigt eine hohe Koinzidenz mit der Verbreitung der Malaria tropica, hervorgerufen durch Plasmodium falciparum (Abb. 3.2). Populationsgenetik 147 Abb. 3.2. Hauptsächliche geographische Verbreitung des HB*S-Alleles, des G6PD*def-Alleles und der Malaria Somit liegt ein Selektionsvorteil für HB*S in tropischen und subtropischen Regionen nahe, welcher aber nur die Heterozygoten betreffen kann, da HB*SHomozygote schwer an einer hämolytischen Anämie erkranken und ihre reproduktive Fitness lediglich ein Fünftel bis ein Viertel der HB*A-Homozygoten erreicht (Vogel u. Motulsky 1997). Bereits in den 50er Jahren stellte Allison (1954a,b) die Hypothese auf, dass die Persistenz des HB*S-Alleles Resultat eines balancierten Polymorphismus4 sei, da HB*S-Heterozygote einen Selektionsvorteil gegenüber der Malaria hätten. Tatsächlich konnte für normale Homozygote, welchen das Sichelzell-Allel fehlt, nachgewiesen werden, dass diese in ihrer frühen Kindheit eine höhere Anfälligkeit für Malaria und auch eine höhere malariabedingte Sterberate aufweisen. Bei heterozygoten Frauen werden weniger Aborte und eine höhere Fruchtbarkeit beobachtet (Murken u. Cleve 1994). Das Sichelzell-Allel ist daher ein eindrucksvolles Beispiel für einen Heterozygoten-Vorteil beim Menschen, abhängig von bestimmten Umweltgegebenheiten, in diesem Fall der Abundanz von Plasmodium falciparum. Weltweit dürften heute mehr als 60 Millionen Sichelzell-Heterozygote leben, überwiegend im tropischen Afrika (Walter 1998). Aus einer Reihe von Gründen produzieren manche Individuen einen Überschuss an fetalem Hämoglobin (HbF), welches physiologisch normal funktionsfähig ist. Eine Hämoglobinopathie kann sich erst dann manifestieren, wenn HbF durch das adulte Hämoglobin ersetzt wird, welches im Falle von HB*S die defekte β-Globin4 balancierter Polymorphismus = selektionsbedingter Erhalt der genetischen Diversität einer Population, z. B. in Form von genetischen Polymorphismen im Falle eines Heterozygoten-Vorteils. 148 Bevölkerungsbiologie Box 3.3 Sichelzellanämie und Malaria tropica Bei HB*S-Homozygoten kommt es unter Sauerstoffmangel (etwa bei schweren körperlichen Anstrengungen) durch Ausfällen des Sichelzellhämoglobins zu der namengebenden sichelartigen Verformung der Erythrozyten. Diese neigen dazu, Kapillaren zu verstopfen und rufen somit schmerzhafte Gelenkschwellungen und Gewebsinfarkte hervor. Die defekten Erythrozyten werden durch Hämolyse zerstört, und durch die resultierende hämolytische Anämie wird aufgrund von Organversagen rasch ein lebensbedrohlicher Zustand erreicht. Malaria tropica wird durch Infektion des Menschen mit Plasmodium falciparum nach dem Stich der weiblichen Anopheles-Mücke hervorgerufen. Bei akuter Erkrankung kommt es zu unregelmäßigen Fieberschüben, begleitet von Kopf- und Muskelschmerzen und Erbrechen. Die Erkrankung kann hauptsächlich durch Verklumpung der Parasiten in lebenswichtigen Organen tödlich verlaufen. Die Mücke überträgt mit ihrem Speichel Sporozoiten von Plasmodium in die Blutbahn, welche sich in den Leberzellen ungeschlechtlich vermehren. Es entwickeln sich Merozoiten, welche durch Platzen der Leberzellen frei werden und entweder neue Leberzellen oder rote Blutkörperchen infestieren. In den Erythrozyten findet eine erneute Vermehrung zu Merozoiten statt, welche wiederum Erythrozyten befallen und sich dort zu Gametenbildnern differenzieren. Diese werden durch erneuten Mückenstich in die Mücke eingesogen. Dort erfolgt die weitere Entwicklung von Plasmodium und gegebenenfalls erneute Infektion des Menschen durch Mückenstich. Der Heterozygotenvorteil dürfte darauf beruhen, dass die Erythrozyten von HB*S-Heterozygoten eine weniger geeignete Umwelt für die ungeschlechtliche Vermehrung der Plasmodium-Merozoiten darstellen. Die Malaria zählt zu den wichtigsten Infektionskrankheiten der Menschheitsgeschichte (Jackson 2000), welche in den betroffenen Populationen als Antwort auf den infektionsbedingten Selektionsdruck eine Modifikation der genetischen Ausstattung induziert hat. Heute sind mindestens zwölf verschiedene Gene bekannt,welche die individuelle Anfälligkeit bzw. Resistenz gegenüber Malaria beeinflussen, neben der beschriebenen Hämoglobin-Variante auch HLA-Polymorphismen und solche der Oberflächenrezeptoren der Erythrozyten (Hill 1998, Dessein 1997). Populationsgenetik 149 Kette trägt. Bei Überschuss von HbF wirken sich die defekten Ketten weit weniger gravierend aus, so dass ein gentherapeutischer Ansatz (verzögerte oder unvollständige Umstellung von HbF auf adultes Hämoglobin) für die Sichelzellanämie diskutiert wird (Trent 1994). Glucose-6-phosphat-dehydrogenase-Mangel (G6PD-Mangel). Das Enzym ist in die mehrstufige Reaktion von Glucose-6-phosphat zu reduziertem Glutathion involviert, einem Molekül mit vielfältigen biologischen Funktionen. Reduziertes Glutathion ist z. B. für den Erhalt der Integrität der Zellmembran unbedingt erforderlich. Das Allel G6PD*def ist verantwortlich für einen erblichen Enzymmangel. Genlocus ist Xq28, weshalb Männer aufgrund der Hemizygotie immer erkranken. Ein G6PD-Mangel besteht heute bei rund 100 Millionen Menschen weltweit (Johansen Mange u. Mange 1998). Da Plasmodium falciparum auf Glutathion in den Erythrozyten angewiesen ist, bietet auch ein G6PD-Mangel Schutz vor Malaria – die relative Häufigkeit des G6PD*def-Alleles in endemischen Malariagebieten findet somit ihre Erklärung (Abb. 3.2). Enzymmangel führt andererseits zu der bereits seit der Antike bekannten, heute als Favismus bezeichneten Überempfindlichkeit gegen Inhalation des Blütenstaubes der Saubohne (Vicia faba) bzw. deren Genuss, mit gegebenenfalls tödlich ausgehender hämolytischer Anämie. Der Malariaschutz dürfte daher zu einer Persistenz von G6PD*def in Malariagebieten geführt haben. Das Rhesus-System. Dieses Blutgruppensystem besteht im Wesentlichen aus sechs Antigenen C, c, D, d, E und e, deren gekoppelte Genloci auf dem Chromosom 1p36.2-p34 liegen (Walter 1998). Eine Kombination von Allelen an derart eng gekoppelten Loci wird als Haplotyp bezeichnet. Die häufigsten Haplotypen des Rhesus-Systems sind RH*cde, RH*cdE, RH*CdE, RH*cDe, RH*Cde, RH*cDE und RH*CDE, welche geographisch auffällig ungleich verteilt sind (Tabelle 3.2). Mit „D“ wird der eigentliche Rhesus-Faktor bezeichnet, der in den europäischen Bevölkerungen mit der geringsten Häufigkeit vertreten ist. Der Anteil Rhesus-negativer Individuen beträgt dort im Durchschnitt 15–20% (Walter 1998). Der RH*cDe-Haplotyp wird wegen seiner auffallend hohen Häufigkeit im subsaharischen Afrika auch als „afrikanischer Haplotyp“ bezeichnet und dürfte daher der anzestrale Typus dieses nach heutigem Kenntnisstand offenbar erst nach der Abspaltung der Hominidenlinie evolvierten Blutgruppensystems sein. Von außerordentlicher klinischer Bedeutung ist die Rhesus-Inkompatibilität zwischen Mutter und Kind: Da der Rhesus-Faktor autosomal-dominant vererbt wird, werden die Kinder einer Rhesus-negativen Mutter bei einem homozygot positiven Vater sämtlich RH*d/RH*D heterozygot sein, bei einem heterozygoten Vater 50% der Kinder. Während des Geburtsvorganges kann es geschehen, dass D-Erythrozyten des Kindes in den Blutkreislauf der Mutter gelangen, so dass diese gegen das D-Antigen immunisiert wird. Bei nachfolgenden Schwangerschaften können die gebildeten Antikörper über die Plazenta in den Fetus gelangen, was im Falle des nächsten erneut Rhesus-positiven Kindes zur Hämolyse der fetalen Erythrozyten führt. Folge ist der Morbus haemolyticus neonatorum, welcher zu schweren Schädigungen des Zentralnervensystems und oft zum Tod der Kinder führt. Durch Früherkennung und Einleitung geeigneter therapeutischer Maßnahmen ist 150 Bevölkerungsbiologie diese Todesursache für Neugeborene in den Industrienationen heute selten. Ohne diese Maßnahmen werden überproportional viele heterozygote Kinder nicht überleben, so dass im Falle des Rhesus-Systems im Gegensatz zu HB*S eine Selektion zum Nachteil der Heterozygoten vorliegt (Vogel u. Motulsky 1997). Zwei weitere Formen der Selektion, welche für den Erhalt genotypischer Variabilität in einer Population sorgen, sind die frequenz- und die dichteabhängige Selektion. Frequenzabhängige Selektion hat zumeist ökologische Gründe. Wesentlich ist hierbei die Koevolution zwischen Krankheitserregern und Parasiten sowie deren Wirten. Für den Erreger ist es sinnvoll, diejenigen Wirte bevorzugt zu befallen, welche dem häufigsten Genotypus in der Population entsprechen, da hiermit das größte Wirtspotential genutzt wird. Seltene Wirtsgenotypen werden damit auch selten infiziert und haben einen Selektionsvorteil (Smith 1992). Eine wirkungsvolle Gegenstrategie des Wirtes ist die Entwicklung hochpolymorpher Systeme bezüglich der Zelloberflächen-Antigene, was es dem Parasiten unmöglich macht, seinen Selektionsvorteil durch Adaptation an einen bestimmten Phänotypus zu entwickeln. Derart hochpolymorphe Systeme sind im Haupthistokompatibilitätskomplex (MHC), welcher die HLA-Loci enthält, verwirklicht. HLA-Loci sind bereits vor längerer Zeit mit einer Reihe von Infektionskrankheiten wie Lepra, Typhus, Tetanus und Streptokokken-Infektion (de Vries et al. 1976, Sazazuki et al. 1978) assoziiert worden, so dass populationsgenetische Effekte aufgrund der MHC-Komponenten noch viel höher sein dürften als z. B. jene des AB0-Systems (Vogel u. Motulsky 1997). Frequenzabhängige Selektion gilt explizit auch auf der Verhaltensebene (s. Kap. 6). Dichteabhängige Selektion hat in der Evolution des Menschen wahrscheinlich eine herausragende Rolle gespielt, da insbesondere in den jüngeren Evolutionsabschnitten die Populationsdichte stark zugenommen hat. Es liegt auf der Hand, dass eine polymorphe Population eine höhere Dichte erreichen kann als eine monomorphe. Veränderungen der Populationsdichte können wiederum zu Zufallseffekten in der Verteilung von Genfrequenzen führen. Zufällige Veränderungen Ohne das Wirken von Selektionsfaktoren können Genfrequenzänderungen schlicht zufallsbedingt sein, man spricht in diesem Falle von genetischer Drift oder auch dem Wright-Effekt (nach Wright 1931). Angenommen, zwei Allele A und a liegen in einer Population jeweils mit der Häufigkeit 0,5 vor (p = q = 0,5). Da sich stets nur ein gewisser Anteil der Individuen dieser Population im reproduktiven Alter befindet oder sich aus anderen Gründen nicht reproduziert (s. Kap. 6), ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Gameten, welche zu Zygoten führen, nicht exakt das Verhältnis 1:1 haben, ein Allel wird in der Nachkommengeneration zu Ungunsten des anderen überwiegen. Dieser Effekt ist naturgemäß in kleinen Populationen viel stärker als in großen. Würde man lediglich zehn Gameten zufällig aus dem Gesamtgenpool herausziehen, könnte z. B. das Allel A trotz seiner Gesamthäufigkeit von 0,5 kein einziges Mal, einmal, zweimal ... bis zehnmal in diesen zehn zufällig gezogenen Gameten vorliegen. Die Wahrschein- Populationsgenetik 151 lichkeit, dass eine dieser Möglichkeiten eintrifft, folgt einer Binomialverteilung (Hartl u. Clark 1997). Durch solche Zufallsdrift kann in einer kleinen Population die Frequenz eines Alleles innerhalb weniger Generationen stark ansteigen bis zu einer Häufigkeit von 1, das andere völlig verschwinden. Das Allel A könnte somit fixiert werden (p = 1), das Allel a verloren gehen (q = 0). Ist ein Allel erst einmal fixiert, kann die polymorphe Ausgangssituation nur durch Mutation oder Einwanderung wiederhergestellt werden. Über weite Strecken der Entwicklung des anatomisch modernen Menschen dürften die Populationen sehr klein gewesen sein, mit höchstens wenigen hundert Individuen. Für das Ausmaß genetischer Drift ist nicht nur der Anteil reproduzierender Individuen in einer Population ausschlaggebend, sondern z. B. auch die Familiengröße oder das zahlenmäßige Verhältnis von Männern und Frauen (Crow u. Kimura 1970, Hartl u. Clark 1997). Ausschlaggebend ist letztlich die effektive Populationsgröße, welche nicht mit der realen Populationsgröße identisch ist sondern nur solche Individuen umfasst, deren Allele auch in die nächste Generation einfließen. In einem angenommenen Beispiel (Seyffert 1998) liege eine starke Ungleichverteilung reproduzierender Männer und Frauen in einer Population vor, so dass lediglich zehn Männer (NM = 10), aber neunzig Frauen (NF = 90) zum gemeinsamen Genpool der Filialgeneration beitragen. Die effektive Populationsgröße Ne berechnet sich nach Ne = (4NMNF)/(NM+NF), so dass sich für dieses fiktive Beispiel eine effektive Populationsgröße von lediglich Ne = 4 · 10 · 90/100 = 36 ergibt. Es ist unmittelbar einsichtig, dass angesichts stets möglicher Fluktuationen der Populationsgröße selbst vorübergehende Perioden niedriger Bevölkerungszahl zu erheblicher Gendrift mit einer signifikanten Reduktion der Heterozygotenhäufigkeit führen können. Derartige Flaschenhalseffekte werden für verschiedene Perioden der Geschichte des anatomisch modernen Menschen angenommen (s. Kap. 3.1.3). Flaschenhalseffekte (bottleneck effects) und begleitende genetische Drift erklären den Gründereffekt (founder effect), im Zuge dessen eine kleine Subpopulation, welche ein neues Siedlungsgebiet erschließt, die künftigen Allelfrequenzen der sich dort etablierenden Population begründet. Gründereffekte sind insbesondere bedeutsam für medizinische Aspekte der Populationsgenetik (s. Kap. 3.1.4), da zufällig die geringe Anzahl der Einwandererfamilien eine erhöhte Häufigkeit anderweitig seltener Allele aufweisen kann. Gut untersuchte Beispiele sind die Tay-Sachs-Krankheit5 bei den Ashkenazi-Juden, welche dieses Gen nach Pennsylvania/USA brachten, die diastrophische Dysplasie6 bei den Finnen oder die Porphyria variegata7 bei den Afrikaans sprechenden Einwohnern Südafrikas (Hirsch-Kauffmann u. Schweiger 1992, Hartl u. Clark 1997, Vogel u. Motulsky 1997). Tay-Sachs-Krankheit = Störung des Fettstoffwechsels mit Akkumulation des Gangliosides GM2 in Nerven- und Gehirnzellen, mit der Folge des irreversiblen Verlustes mentaler und physischer Fähigkeiten. 6 Diastrophische Dysplasie = Seltene Form des angeborenen Zwergwuchses. 7 Porphyria variegata = Porphyrie mit erhöhter Kopro- und Protoporphyrinausscheidung im Stuhl; im Zusammenhang mit der Einnahme von Drogen (z. B. Barbituraten) kommt es zu neurologischen und abdominellen Krisenzuständen. 5 152 Bevölkerungsbiologie Siebungseffekte und Verwandtenehen Als Siebung bezeichnet man die nicht-selektionsgesteuerte Ungleichverteilung von Allelfrequenzen auf die einzelnen Teile einer Population. Partnerwahl spielt in der Natur, und insbesondere beim Menschen, hierbei eine herausragende Rolle. Diese basiert in der Regel auf dem Phänotypus (assortative Paarung, assortative mating) (Seyffert 1998), wozu beim Menschen neben äußeren Merkmalen wie Gestalt, Haarfarbe usw. auch soziokulturelle Aspekte gezählt werden müssen, wie z. B. die Religionszugehörigkeit, Ausbildungsgrad, oder Einkommensverhältnisse. Wesentliche exprimierte Merkmale wie z. B. die Blutgruppe, welche nicht unmittelbar mit den Sinnen erfasst werden können, unterliegen der Partnerwahl jedoch in der Regel nicht. Zumeist liegt positive assortative Paarung vor, d. h. die Partner stimmen in einer höheren Anzahl von phänotypischen Merkmalen überein als es dem Zufallsprinzip entsprechen würde. Die Auswirkungen auf die Allelverteilung sind sehr komplex, da die Mehrzahl der phänotypischen Merkmale polygen bedingt sind. Ferner spielen eine Rolle die Anzahl möglicher unterschiedlicher Allele, die Anzahl verschiedener Phänotypen, unter denen gewählt werden kann, von welchem Geschlecht die Partnerwahl ausgeht, und natürlich die Auswahlkriterien selbst. Generell trifft aber zu, dass aufgrund des mehrheitlich positiven assortative mating („Gleich und Gleich gesellt sich gern“ statt „Gegensätze ziehen sich an“) die Tendenz zur Erhöhung von homozygoten Genotypen entsteht (Hartl u. Clark 1997). Dies ist wiederum in Fällen bestimmter Erkrankungen relevant: Taubstumme sind zu einem gewissen Grad sozial isoliert und bilden eine eigene Gruppe, allein aufgrund ihrer speziellen Schulen und Kommunikation, so dass Taubstumme häufig untereinander heiraten. Wenn beide Partner das gleiche rezessive Gen für Taubheit tragen, werden auch alle ihre Kinder taub geboren werden (Vogel u. Motulsky 1997). Dieser Effekt der positiven assortativen Paarung fällt allerdings nur dann ins Gewicht, wenn der Grad der Bevorzugung gleicher phänotypischer Merkmale hoch ist, bei gleichzeitig niedrigen Genfrequenzen (Seyffert 1998). Auch Verwandtenehen beeinflussen nicht die Allelfrequenzen im Gesamtgenpool der Population, bewirken aber ebenfalls eine Erhöhung der Homozygoten unter ihren Nachkommen. Für solche erblichen Erkrankungen, welche homozygot letal sind, ist diese Verschiebung jedoch nicht von Dauer (HirschKauffmann u. Schweiger 1992). Vogel und Motulsky (1997) weisen mit Recht darauf hin, dass selbstverständlich alle Menschen miteinander verwandt sind und daher die Definition einer Verwandtenehe praktikablen Konventionen unterliegen muss. Für die klinische Humangenetik ist letztlich lediglich relevant, wie nahe die Eltern eines Kindes miteinander verwandt sind, d. h. wie hoch ihr Anteil abstammungsidentischer Allele ist. Bei diploiden Organismen erben die Kinder je 50% ihrer Gene von jedem Elter, mit jedem Großelter teilen sie 25% abstammungsidentische Allele, mit dem Urgroßelter 12,5%. Dieser Verwandtschaftsgrad, definiert über den Anteil abstammungsidentischer Allele, wird als Verwandtschaftskoeffizient bezeichnet (0,5 für Eltern/Kinder, 0,25 für Großeltern/Großkinder usw.). Der Inzuchtkoeffizient gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Kind von seinem Elter solche abstammungsiden- Populationsgenetik 153 tischen Allele geerbt hat, für die es in Bezug auf die DNA-Sequenz homozygot ist. Somit entspricht der Inzuchtkoeffizient der Wahrscheinlichkeit, dass die zwei Gene eines Genlocus des Kindes abstammungsidentisch sind und damit dem Verwandtschaftskoeffizienten der Eltern (Hirsch-Kauffmann u. Schweiger 1992, Vogel u. Motulsky 1997). Angenommen, ein rezessives Allel habe in einer Population eine Häufigkeit von 0,005 (1:200), dann beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass ein beliebiges Individuum für dieses Allel heterozygot ist aufgrund der Hardy-Weinberg-Gleichung (s. Box 3.2) 2pq = 0,0099 . 0,01 (1:100). Bei einer Ehe zwischen Cousin und Cousine ersten Grades entspricht der Verwandtschaftskoeffizient 0,0625 (1:16), d. h. die Wahrscheinlichkeit, dass sie beide das rezessive Allel tragen, beträgt 0,125 (1:8). Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Verwandten dieses rezessive Allel tragen, gegenüber jener, dass zwei nicht-verwandte Ehepartner dieses Allel tragen, rund zwölffach erhöht (Hirsch-Kauffmann u. Schweiger 1992). Unter Zuhilfenahme des Hardy-Weinberg-Gesetzes ist leicht nachzurechnen, dass sich das Risiko eines Kindes aus einer Verwandtenehe, homozygot für ein rezessives Allel zu sein, umso mehr erhöht, je seltener das Allel ist. Migration In den vorangegangenen Kapiteln wurde dargelegt, welche Ursachen den Unterschieden in den Allelhäufigkeiten der verschiedenen Populationen zugrunde liegen können. In der heutigen Zeit globaler Kommunikation und globalen Transportwesens steigt der Kontakt zwischen den menschlichen Populationen, und aufgrund des Genflusses kommt es zu erneuter Umverteilung der Allelfrequenzen. Die heutige europäischstämmige Bevölkerung der USA beruht z. B. auf der sukzessiven Einwanderung von unterschiedlichen europäischen Subpopulationen. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle diese Subpopulationen unterschiedliche Frequenzen für ein Allel A hatten, ist hoch. Um das Schicksal dieses Alleles im Verlauf der nachfolgenden Generationen zu verfolgen, bedient man sich des „Inselmodells“, da die Situation analog der Erstbesiedlung einer bislang unbewohnten Insel durch mehrere aufeinanderfolgende Einwanderungswellen aus unterschiedlichen Regionen ist. Es sei pi die Häufigkeit des Alleles A in der einwandernden Subpopulation, m sei die Migrationsrate (Anteil der emigrierenden Allele pro Generation), und px die durchschnittliche Häufigkeit des Alleles A in der Gesamtpopulation, welche schließlich diese Insel besiedelt (Summe aller eingewanderten Subpopulationen). In der Folgegeneration wird das Allel die Häufigkeit p1 = pi–mpi+mpx = (1–m)pi+mpx haben, wobei mpi denjenigen Anteil des Alleles A beziffert, welcher der Subpopulation durch Migration verloren geht, und mpx denjenigen Anteil, welcher aus der Gesamtpopulation in die Subpopulation einfließt. Solange keine Selektionskräfte, Partnerwahl oder andere Faktoren auf die Allelfrequenz einwirken, wird sich mit der Zeit jede initiale Häufigkeit pi dem Mittelwert px annähern, welcher konstant bleibt (Box 3.4). 154 Bevölkerungsbiologie Box 3.4 Das Inselmodell Angenommen, eine Population bestehe aus fünf gleichgroßen Subpopulationen mit den unterschiedlichen Frequenzen für das Allel von A: pi = 0,1;pj = 0,3;pk = 0,5;pn = 0,7;po = 0,9,und die Migrationsrate m betrage 10% (0,1) pro Generation. px ist 0,5. Es gilt: p1 = (1–m)pi+mpx. Daraus ergeben sich für die Nachfolgegenerationen folgende Allelfrequenzen: Parentalgeneration Filialgeneration 1 Filialgeneration 2 Filialgeneration 3 pi pj pk pn po 0,1 0,14 0,176 0,2084 0,3 0,32 0,338 0,3542 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,68 0,662 0,6458 0,9 0,86 0,824 0,7916 Die Frequenzen pi,j,k,n,o nähern sich sukzessive der Durchschnittsfrequenz px = 0,5 an, welche konstant bleibt (Evett u. Weir 1998). Die Situation ist anders, wenn die Insel (oder ein anderer Standort) bereits eine autochthone Bevölkerung hat und die Einwanderer sich mit dieser Bevölkerung reproduzieren, so dass es zur Bevölkerungsmischung kommt. Die Häufigkeit des Alleles A habe in der autochthonen Bevölkerung die Häufigkeit pa, in der einwandernden Bevölkerung die Häufigkeit pe. Die Häufigkeit der durch Reproduktion entstandenen Mischpopulation pm ist folgerichtig pm = (1-m)pa+mpe (Evett u. Weir 1998). Wenn eine Gesamtpopulation aus mehreren Subpopulationen zusammengesetzt ist, innerhalb derer jeweils Zufallspaarung, aber nur begrenzter Genfluss zwischen den Subpopulationen herrscht, liegt eine heterogene Population vor. Diese weist für die betrachteten Allele eine Abweichung vom Hardy-WeinbergGleichgewicht in Richtung eines Homozygoten-Überschusses auf, obgleich das Gleichgewicht in den einzelnen Subpopulationen gewahrt ist. Dieses Phänomen wird als Wahlund-Effekt (Box 3.5) bezeichnet (Smith 1992) und ist häufig dafür verantwortlich, dass Abweichungen von einer erwarteten Hardy-Weinberg-Verteilung gefunden werden. Diesem Effekt ist bei der Ziehung von Stichproben für populationsgenetische Untersuchungen daher hohe Aufmerksamkeit zu widmen. Populationsgenetik 155 Box 3.5 Der Wahlund-Effekt Angenommen, eine Population bestehe aus zwei Subpopulationen mit den drei Allelen A, B und C an einem Locus mit folgenden Häufigkeiten: Häufigkeit in der Subpopulation Allel 1 2 Durchschnitt (Gesamtpopulation) A B C 0,5 0,2 0,3 0,6 0,3 0,1 0,4 0,1 0,5 Liegt in jeder Subpopulation Hardy-Weinberg-Gleichgewicht vor, ergeben sich nachstehende Genotyphäufigkeiten für jede Subpopulation und den Durchschnitt der Gesamtpopulation. Die Häufigkeit der Homozygoten in der Gesamtpopulation ist höher als nach dem Hardy-Weinberg-Gesetz erwartet. Häufigkeit in der Subpopulation Allel 1 2 Durchschnitt erwartet nach (Gesamtpopulation) Hardy-Weinberg AA BB CC AB AC BC 0,26 0,05 0,13 0,22 0,26 0,08 0,36 0,09 0,01 0,36 0,12 0,06 0,16 0,01 0,25 0,08 0,40 0,10 0,25 0,04 0,09 0,20 0,30 0,12 (Evett u. Weir 1998) 3.1.3 Evolutionäre Aspekte der Populationsgenetik Genetische Polymorphismen können, wie im vorstehenden Kapitel aufgezeigt, Hinweise auf Selektionsprozesse geben, denen menschliche Bevölkerungen bis heute ausgesetzt sind. Sie sind aber insbesondere dazu geeignet, die genetischen Beziehungen von Subpopulationen einer Art aufzuklären (Joblin et al. 2004). Die verschiedenen menschlichen Bevölkerungen, welche heute auf der Erde leben, differieren in Bezug auf viele Allelfrequenzen, z. B. aufgrund von Migrationsereignissen. Gemeinsamkeiten im Genpool von Bevölkerungen beruhen jedoch in der Regel auf einem gemeinsamen Ursprung. Äußerliche Merkmale wie Haut- u. Haarfarbe können hierbei durchaus irreführend sein. So weisen zum Beispiel die Ainu, deren Verbreitung heute auf Nordjapan begrenzt ist, eine Reihe von Merkmalen auf wie z. B. eine helle Haut, eine relativ 156 Bevölkerungsbiologie starke Körperbehaarung und auch einige Merkmale des Gesichtes, welche sie den Europäern ähnlicher machen als den Asiaten. In Bezug auf ihre genetische Ausstattung zeigt sich jedoch eindeutig ihre nahe Verwandtschaft zu anderen asiatischen Gruppen, da sie mit diesen genetische Polymorphismen teilen (z. B. die des Diego-Blutgruppensystems oder der Transferrin-Polymorphismen), welche in europäischen Populationen fehlen (Hartl u. Clark 1997). Genetische Polymorphismen sind dermaßen häufig in menschlichen Populationen,dass Mutation und Selektion allein nicht mehr zur Erklärung ausreichen. Die auf Kimura (1983) zurückgehende Theorie der neutralen molekularen Evolution besagt, dass die Mehrzahl der auf der molekularen Ebene detektierbaren Polymorphismen selektionsneutral ist, so dass die unterschiedlichen Allelfrequenzen in den Populationen das Resultat zufälliger genetischer Drift seien. Obgleich gerade in jüngster Zeit mehr und mehr Fälle bekannt wurden, welche von diesem Neutralitätsprinzip abweichen, bleibt die Tatsache, dass trotz des Wirkens von Selektionsdrücken der Faktor der genetischen Drift dennoch immer präsent ist, so dass die Theorie der neutralen molekularen Evolution zumindest in Bezug auf die Formulierung adäquater Nullhypothesen von Bedeutung bleibt. Inhalt dieser Nullhypothese ist, dass die Mutationsrate gleich der Evolutionsrate an einem bestimmten Genlocus ist. In einer Population mit N Individuen existieren aufgrund des doppelten Chromosomensatzes für jeden Genort 2N Gene. Bei einer Mutationsrate µ treten pro Generation an jedem Genort 2Nì neue selektionsneutrale Mutationen ein.Da alle Gene in der Population im Zuge der Generationen Kopien von einem der 2N Gene sein müssen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine neutrale Mutation in der Population fixiert wird, ½N (die Chance der Fixierung ist bei Selektionsneutralität für sämtliche Gene gleich). In jeder Generation entspricht damit die Zahl neuer neutraler Mutationen, welche auch fixiert werden, genau 2Nì/2N, also ì. Somit ist bewiesen, dass die Evolutionsrate gleich der Mutationsrate ist (Smith 1992). Diese Theorie der neutralen molekularen Evolution wurde zunächst am exprimierten Merkmal getestet und es hat sich gezeigt, dass die Mutationsrate (und damit eben auch die Evolutionsrate) der verschiedenen Proteine stark unterschiedlich ist, wobei diesen Raten die Häufigkeit von Aminosäureaustauschen zugrunde gelegt wurde. Es werden zum Beispiel durchschnittliche Austausche je Position und 109 Jahre von 2,4 für das Insulin C, und von lediglich 0,01 für das Histon H4 geschätzt. Das aktive Insulinmolekül besteht aus zwei mit A und B bezeichneten Regionen, von denen im Zuge der Molekülreifung eine dritte Region C abgespalten wird. Die exakte Aminosäurefrequenz des Insulin C ist daher von untergeordneter Bedeutung, so dass sich hier neutrale Substitutionen anhäufen können. Das Histon H4 kann sich offenkundig nur sehr wenige Substitutionen leisten, ohne dysfunktional zu werden (Smith 1992). Auf der Ebene der DNA hingegen sind viele Basenaustausche möglich, welche plausibel als selektionsneutral angenommen werden können. Jeweils drei hintereinanderliegende Basen auf dem DNA-Molekül (Kodon) kodieren für eine Aminosäure, wobei Veränderungen an der dritten Stelle eines solchen Kodons keinen Einfluss mehr auf die Aminosäure haben, für welche sie kodieren. Weitere nicht-codierende Regionen der DNA sind die Introns, bei denen Basenaustausche durch Mutation wirkungslos bleiben. Nicht zuletzt seien die Populationsgenetik 157 so genannten Pseudogene genannt, duplizierte Gene, welche nicht mehr für ein Protein codieren (Smith 1992). Obgleich also die Substitutionsraten bei verschiedenen Genen stark unterschiedlich sein können, kann die durchschnittliche Rate der molekularen Evolution insbesondere über lange Zeiträume hinweg recht konstant sein, so dass sie als eine Art molekulare Uhr herangezogen werden kann (Zuckerkandel u. Pauling 1962). Somit wird die Rekonstruktion der Genealogie von Genen möglich. Das Konzept der molekularen Uhr liegt solchen Untersuchungen zugrunde, welche aufgrund von genetischen Polymorphismen neutraler Marker die genetische Nähe verschiedener Populationen und nachfolgend den Zeitpunkt ihrer Divergenz von einer gemeinsamen Ursprungspopulation bestimmen wollen. Für die Festlegung genetischer Abstände zwischen verschiedenen Populationen gibt es eine Reihe multivariatstatistischer Verfahren, wofür an dieser Stelle jedoch auf die verfügbare Spezialliteratur verwiesen werden muss (Übersicht z. B. bei Chopra 1992). Generell kann davon ausgegangen werden, dass diese errechneten genetischen Distanzen umso präziser sind, je polymorpher die einbezogenen Genloci sind, und je mehr Merkmalsysteme der Berechnung zugrunde liegen (Walter 1998). Die Interpretation dieser Distanzen kann jedoch sehr komplex sein und muss über das einfache Schauprinzip (großer/geringer Abstand) hinausgehen. Die Mehrzahl der vorliegenden Untersuchungen legt Polymorphismen der mitochondrialen DNA (mtDNA) zugrunde, da diese den Vorteil der fehlenden Rekombination und rein mütterlichen Vererbung hat. Auf der Nukleotid-Ebene ist sie durch eine höhere Substitutionsrate von circa 10 · 10-9 Substitutionen pro Nukleotid und Jahr gegenüber single-copy nukleärer DNA ausgezeichnet, vermutlich aufgrund einer verminderten Reparatureffizienz der DNA-Polymerase. Als Resultat dieser raschen Nukleotidsubstitutionen ist die molekulare Uhr, welche eine gleichmäßige Substitutionsrate über die Zeiten voraussetzt, nur für Zeiträume anwendbar, die kleiner sind als zehn Millionen Jahre (Hartl u. Clark 1997) – somit kann dieses Konzept auf evolutive Ereignisse der Menschwerdung und der weiteren Entwicklung des Homo sapiens angewendet werden (s. Kap. 2.2). In jüngerer Zeit wurden die auf der Analyse von mtDNA beruhenden Ergebnisse in fruchtbarer Weise durch die Untersuchung von Y-chromosomalen Haplotypen (mit rein väterlicher Vererbung) ergänzt. Ursprung des anatomisch modernen Menschen Die bereits 1987 publizierte Studie von Cann et al., derzufolge anhand der Variabilität von mtDNA der afrikanische Ursprung des Homo sapiens nachgewiesen werden könne, kann als bahnbrechend in der molekularen Evolutionsforschung gelten. Basierend auf lediglich 147 Probanden aus fünf Populationen identifizierten die Autoren 133 mtDNA-Haplotypen und stellten die höchste genetische Diversität in den afrikanischen Populationen fest. Aufgrund der (ebenfalls nach dem Prinzip der molekularen Uhr!) geschätzten Divergenz der Hominidenlinie vom letzten gemeinsamen Vorfahren des Menschen und der Schimpansen vor etwa fünf Millionen Jahren kommt man auf eine durchschnittliche Divergenz von mtDNA-Sequenzen von 2–4% pro Million Jahre. Entsprechend wurde der 158 Bevölkerungsbiologie gemeinsame Vorfahre aller beobachteten mtDNA-Haplotypen (die sogenannte Ur-Eva aufgrund der maternalen Vererbung von mtDNA) auf einen Zeitraum zwischen 140 000 und 280 000 Jahren vor heute datiert (Cann et al. 1987). Nachfolgende Untersuchungen, welche andere Regionen der mtDNA einbezogen (Vigilant et al. 1991, Hasegawa u. Horai 1991, Pesole et al. 1992, Ruvolo et al. 1993) kamen zu prinzipiell ähnlichen Ergebnissen und datierten die Ur-Eva zwischen 100 000 und 400 000 Jahren vor heute. Kritik an diesen Ergebnissen und der daraus abgeleiteten neuen Perspektive für die Evolutionsforschung durch den Einsatz molekularbiologischer Methoden kam nicht nur aus den Reihen der Paläoanthropologie, welche die auf Fossilfunden längst bestehende Theorie lediglich bestätigt sahen, sondern vor allem aus dem Vorwurf, dass die Evolutionsrate der mtDNA keineswegs gleich der Evolutionsrate rekombinierender DNA sei und dass so wesentliche Aspekte wie die effektive Populationsgröße, mögliche Flaschenhalseffekte u. a. gleichermaßen dafür verantwortlich sein könnten, dass die höhere Variabilität der mitochondrialen Marker in afrikanischen Populationen gefunden wurde (Relethford 1995). Die Diskussion kann auch heute noch nicht als abgeschlossen gelten, jedoch sprechen Ergebnisse, welche zwischenzeitlich an nukleären (z.B. Tishkoff et al. 1996) und Y-chromosomalen Genorten (Hammer et al. 1997) gewonnen wurden, für die Richtigkeit der Interpretation der mitochondrialen Daten. Es muss aber daraufhingewiesen werden, dass das Konzept der molekularen Uhr seine eigenen Schwächen bezüglich der Festlegung der Substitutionsraten hat, so dass eine befriedigende Eingrenzung des relevanten Zeitraumes, welcher präziser sein sollte als jener, welchen die Paläoanthropologie aufgrund der Interpretation gut datierter Fossilfunde zu liefern vermag, bislang nicht erreicht wurde. Besiedelung der Kontinente Genetische Abstände, zunächst beruhend auf den klassischen Markern des Blutes und zunehmend ergänzt und verfeinert durch Polymorphismen auf der DNA-Ebene, dienen als wertvolle Maße für die genetische Nähe der vielen menschlichen Populationen auf der Erde untereinander.Die geographische Verteilung dieser Polymorphismen lässt Rückschlüsse auf deren Genese zu, d. h. auf den Zeitraum und die erforderlichen Bevölkerungsbewegungen, welche zur sukzessiven Besiedelung der Kontinente durch Homo sapiens führten. Dabei gilt es, die unterschiedlichen Informationen, welche in der mtDNA, den Y-chromosomalen Markern und autosomalen Genorten vorhanden sind, korrekt einzuordnen und zu interpretieren. So lassen z. B. gleichermaßen Y-chromosomale und mitochondriale Marker eine voneinander unabhängige Bevölkerungsgeschichte in Australien und Papua-Neuguinea erkennen, wogegen autosomale Marker eher für eine größere genetische Nähe sprechen. Als Erklärung wurde vorgeschlagen, dass bei der Erstbesiedlung durch den Menschen vor mehr als 50 000 Jahren Australien und Neu Guinea noch eine zusammenhängende Landmasse bildeten, welche vor etwa 8000 Jahren unterbrochen wurde und die jeweiligen autochthonen Bevölkerungen daraufhin in Bezug auf die mitochondriale und Y-chromosomale DNA ihre eigenständige Entwicklung nahmen (Kayser et Populationsgenetik 159 al. 2001). Die weitaus höchsten Datendichten liegen derzeit für Europa und Amerika vor. Europa. Bereits in den 1970er Jahren gab es keinen Zweifel mehr daran, dass viele klassische Marker wie z. B. Blutgruppensysteme und Enzympolymorphismen in Europa weder zufällig noch gleichförmig verteilt, sondern in Form von Gradienten vorliegen. Lange Zeit war man der Annahme, dass größere Bevölkerungsbewegungen im Zuge der Neolithischen Revolution mitverantwortlich für die beobachteten Allelverteilungen waren. Neuere Untersuchungen der mtDNA zeigten jedoch eine eher unerwartete Homogenität auf, so dass der Schluss nahe lag, dass die vorliegenden Frequenzvariationen mit einer sehr viel früheren Bevölkerungsexpansion in Richtung Europa zu begründen sind, welche zeitlich der Verdrängung des Neandertalers durch den anatomisch modernen Menschen aus dem mittleren Osten entsprechen würde (Francalacci et al. 1996, Comas et al. 1996). Die Diversität der mtDNA-Sequenzen ist im Mittleren Osten höher als in europäischen Populationen, was für ein höheres Alter spricht. Im Vergleich mit der von Anderson et al. (1981) publizierten Referenzsequenz konnten Sykes et al. (1996) und Richards et al. (1996) einen mitochondrialen Haplotypen identifizieren, welcher der ältesten bisher bekannten europäischen Linie zugeordnet wird und vor ca. 50 000 Jahren entstanden sein dürfte. Charakteristische mtDNA-Sequenzen autochthoner nordafrikanischer Bevölkerungen legen eine Abspaltung von diesem ältesten europäischen Cluster im gleichen Zeitraum nahe (Macaulay et al. 1999). Sykes (1999) hat für die Genese des europäischen Genpools mindestens drei Einwanderungsereignisse postuliert, wobei die erste Einwanderung bereits im oberen Paläolithikum stattgefunden hat (vor ca. 50 000 Jahren) und die zweite vor 11 000–14 000 Jahren. Immerhin noch etwa 20% der derzeitig beobachtbaren mitochondrialen Variabilität dürfte auf die späteren neolithischen Expansionsbewegungen zurückzuführen sein. Auch die Untersuchung von Y-chromosomalen Polymorphismen konnte unterstützen, dass ein erheblicher Anteil des europäischen Genpools tatsächlich paläolithischen Ursprungs ist (Lucotte u. Loirat 1999). In ihrem 1994 publizierten Standardwerk haben Cavalli-Sforza, Menozzi und Piazza die genetischen Abstände für 26 europäische Bevölkerungen festgestellt und die Mehrzahl der europäischen Bevölkerungen in sieben Gruppen einteilen können: eine keltische Gruppe (Schotten und Iren), eine osteuropäische Gruppe (Russen, Ungarn, Polen), eine südwesteuropäische Gruppe (Spanier, Portugiesen und Italiener), eine tschechoslowakische Gruppe, eine nordwestskandinavische Gruppe (Norweger und Schweden), eine französische und eine germanische Gruppe, wobei letzte in zwei Untergruppen unterteilt werden kann (Niederländer, Dänen und Engländer einerseits, sowie Österreicher, Schweizer, Deutsche und Belgier andererseits). Die festgestellten genetischen Affinitäten werden mit verschiedenen Bevölkerungsexpansionen in Zusammenhang gebracht und stimmen außerordentlich gut mit der sprachlichen Gliederung Europas überein (zusammenfassende Darstellung bei Walter 1998). Es bedarf keiner besonderen Betonung, dass sprachliche Grenzen auch den Genfluss zwischen Angehörigen verschiedener Sprachfami- 160 Bevölkerungsbiologie lien limitieren. Als relativ eigenständige europäische Bevölkerungen konnten die Basken, die Saami und auch die Sarden identifiziert werden, ferner die Roma (Walter u. Danker-Hopfe 1993). Im Einklang mit archäologischen und linguistischen Daten haben sich die Basken als eigenständige Population sehr früh vor ca. 18 000 Jahren vor Ort herausdifferenziert und dürften in relativer Isolation gelebt haben (Calafell u. Bertranpetit 1994). Ortsnamen belegen, dass das Verbreitungsgebiet der Basken vormals sehr viel größer war als heute und dass diese Population auf die Region des heutigen Baskenlandes zurückgedrängt worden ist. Die heute in Europa lebenden Roma sind im 14. Jahrhundert aus dem nordwestlichen Indien in ihr heutiges Verbreitungsgebiet gekommen und haben sich im Wesentlichen soziokulturell, damit in der Folge aber auch genetisch von den übrigen europäischen Bevölkerungen isoliert. Die relative genetische Eigenständigkeit der Sarden und der Saami lässt sich aus einer gewissen Isolation aufgrund des Inselstatus bzw. der Verbreitung an der Peripherie Europas erklären. Während also Untersuchungen der mtDNA einen großen Teil der bestehenden Variabilität mit der paläolithischen Expansion vom mittleren Osten nach Europa erklären konnten, zeigen die offenkundigen Affinitäten der vorliegenden genetischen Gradienten mit den verschiedenen Sprachgruppen, dass auch die Bevölkerungsdynamik während und nach der neolithischen Transition eine wesentliche bevölkerungshistorische Rolle gespielt hat. Amerika. Ebenfalls sehr gut untersucht ist die Variabilität von mitochondrialen DNA-Haplotypen in Amerika. Der Kontinent ist über die Beringstraße besiedelt worden, welche während der Eiszeiten aufgrund des in Gletschern gebundenen Wassers und damit gesunkenen Meeresspiegels eine trockene Landbrücke zwischen Nordost-Sibirien und Alaska darstellte. Archäologische Funde legten bereits eine Besiedelung der Neuen Welt in mehreren Einwanderungswellen nahe. Aufgrund ausgedehnter Untersuchungen der mtDNA autochthoner Bevölkerungen Amerikas konnten Torroni et al. (1993) und Smith et al. (1999) fünf Haplogruppen detektieren, welche entsprechend auf fünf Bevölkerungsexpansionen hinweisen (Abb. 3. 3; Tabelle 3. 3). Bereits seit längerem war bekannt, dass die Haplogruppe B, welche durch eine Deletion von neun Basenpaaren in der Region V der mtDNA gekennzeichnet ist, besonders häufig bei der autochthonen Bevölkerung im Südwesten der heutigen Vereinigten Staaten und ebenso häufig in Individuen asia- Tabelle 3.3. Hauptsächliche amerikanische mtDNA-Haplotypen (nach Smith et al. 1999) mt Haplotyp Region V, HAE III, 9bp-Deletion np 663 Alu I, np 5176 Hinc II, np 13,259 Dde I, np 10,394 A B C D X – + – – – + + + – + + + – + + – – + + – + – – – – Populationsgenetik 161 Abb. 3.3. Schematische Darstellung des menschlichen mitochondrialen Genomes (16569 bp) tischer Herkunft ist, jedoch bei der Mehrzahl europäischer und afrikanischer Bevölkerungen nicht vorkommt. Die Haplogruppe A ist die insgesamt häufigste unter der autochthonen Bevölkerung Amerikas, allerdings ist sie gerade im Südwesten ausgesprochen selten bis fehlend. Da mit Ausnahme der Haplogruppe B alle anderen Haplotypen auch in einigen Populationen Nordost-Sibiriens vorkommen, haben Schurr et al. (1999) gefolgert, dass diese mitochondrialen Marker der autochthonen Bevölkerung Amerikas deren Ursprung aus Nordost-Sibirien belegen. Studien an Y-chromosomalen Markern legen dagegen nahe, dass der asiatische Ursprung der amerikanischen indianischen Bevölkerung zwar außer Zweifel steht, dass aber aufgrund des Bevölkerungsvergleiches mit sibirischen Populationen die ersten Einwanderer nach Amerika eher im südlichen Zentralsibirien angesiedelt gewesen sein dürften (Karafet et al. 1999, Santos et al. 1999). Die Bevölkerungsgeschichte Amerikas ist nach wie vor Gegenstand intensiver Forschung, und so kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass einige unterschiedliche Interpretationen, welche entweder auf mtDNA oder auf Y-chromosomaler DNA beruhen, auf unterschiedliche Wanderungsraten der Geschlechter zurückzuführen wären. Auch genetische Drift und Gründereffekte müssen in Betracht gezogen werden (O’Rourke 2000). 162 Bevölkerungsbiologie 3.1.4 Medizinische Aspekte Krankheiten können auf mehrere Art und Weise genetisch bedingt sein, etwa durch chromosomale Anomalien (z. B. Trisomie 21) oder auch durch Mutation in Körperzellen (z. B. manche Krebsarten). Populationsgenetisch relevant sind jedoch vor allem solche Erkrankungen, welche durch einzelne Gene bedingt sind (z. B. cystische Fibrose), und auch multifaktorielle Erkrankungen (z. B. Erkrankungen der Herzkranzgefäße, Bluthochdruck, verschiedene Krebsarten, Erkrankungen des Immunsystems). Die populationsgenetischen Modelle sind außerordentlich hilfreich, die Häufigkeit genetisch bedingter Erkrankungen in einer Population abzuschätzen,und spielen entsprechend auch bei der individuellen genetischen Beratung eine wichtige Rolle. Autosomal-dominante Krankheiten (z. B. Chorea Huntington) weisen im Stammbaum betroffener Individuen eine charakteristische vertikale Verteilung auf, da die Krankheit in jeder Generation auftritt, während autosomal-rezessive Erkrankungen (z. B. Cystische Fibrose) eher eine horizontale Verteilung aufweisen, da die betroffenen Personen oft Geschwister sind. Bei X-chromosomal gebundenen Erkrankungen (z. B. Hämophilie, fragiles X-Syndrom) ist das männliche Geschlecht aufgrund seiner Hemizygotie betroffen, während Frauen oft lediglich heterozygote Träger und damit phänotypisch gesund sind (Abb. 3. 4 a,b; Abb. 3.5). In wieweit sich genetische Erkrankungen im betroffenen Individuum klinisch manifestieren werden, hängt sowohl von der Penetranz (Wahrscheinlichkeit, mit der sich ein mutiertes Gen phänotypisch zeigt), als auch von der Expressivität (Schweregrad der Krankheit) des Gens ab. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand werden mehr als 70% der genetisch bedingten Erkrankungen autosomal-dominant und etwa 20% autosomal-rezessiv vererbt. Weniger als 10% aller Fälle sind an das X-Chromosom gekoppelt (Trent 1994). Nach einer Studie von Baird et al. (1988) in Kanada werden bis zum Alter von 25 Jahren 53 von 1000 Lebendgeborenen eine Erkrankung Abb. 3.4. a Schematischer Stammbaum bei einer autosomal-dominanten Erkrankung. (Betroffene: schwarz) Populationsgenetik 163 Abb. 3.4. b Schematischer Stammbaum bei einer autosomal-rezessiven Erkrankung. (Konduktoren: grau; Betroffene: schwarz) Abb. 3.5. Schematischer Stammbaum bei einer X-chromosomal gebundenen Erkrankung. (Konduktorinnen: grau; Betroffene: schwarz) mit genetischer Ursache ausprägen, wobei die Mehrzahl dieser Erkrankungen multifaktoriell ist, d. h. die Erkrankung beruht auf der Wechselwirkung zwischen mehreren Genen und vor allem auch Umwelteinflüssen. Autosomal-dominante Erkrankungen In diesen Fällen haben die Nachkommen eines jeden Patienten eine Wahrscheinlichkeit von 50%, ebenfalls zu erkranken. Einige autosomal-dominante Erkrankungen treten spontan durch Mutation auf, wie manche Fälle angeborenen Zwergwuchses (Trent 1994). In anderen Fällen, wie der Chorea Huntington („erblicher Veitstanz“) sind sporadische Fälle eher selten, da die Krankheit in typischer Weise erst nach dem vollendeten 30. Lebensjahr auftritt, zu einem Zeitpunkt also, an dem sich die betroffenen Individuen häufig bereits fortgepflanzt haben. Diese neurodegenerative Erkrankung manifestiert sich durch progressive Bewegungsstörungen, Demenz und auch psychische Affektionen. Der Genlocus liegt auf dem Chromosom 4p16.3. Die ge- 164 Bevölkerungsbiologie netische Ursache liegt in einer Verlängerung von repetitiven CAG-Tripletts (CAG kodiert für die Aminosäure Glutamin), welche im normalen Huntington-Gen 10 bis 30 Wiederholungen aufweisen, bei Huntington-Patienten jedoch 36 bis mehr als 120 Wiederholungen. In seltenen Fällen tritt die Chorea Huntington nicht erst im Erwachsenenalter, sondern bereits im Jugendalter auf, wobei es eine Korrelation zwischen der Häufigkeit der CAG-repeats und dem Zeitpunkt des Auftretens erster Symptome zu geben scheint. Da bei der Weitergabe des Gens im Zuge der Vererbung bevorzugt eine paternale Transmission beobachtet wird, dürfte es sich um ein genetisches Imprinting handeln. Für ein Imprinting ist letztlich verantwortlich, dass das mütterliche und väterliche Genom, welche zu einer Zygote beisteuern, nicht äquivalent sind. Für die Geschlechtschromosomen und die Vererbung zytoplasmatischer Faktoren, welche jeweils von der Eizelle stammen, liegt dies auf der Hand. Es gilt aber auch für die Autosomen, dass paternale und maternale homologe Chromosomen in einer Weise verändert sein können, dass es zu einer unterschiedlichen Genexpression kommt. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Methylierung der Base Cytosin des weniger exprimierten Gens. Genetisches Imprinting wird auch bei anderen erblichen Erkrankungen beobachtet, wie z. B. im Falle des Prader-Willi- und des Angelman-Syndroms. Beide Erkrankungen sind auf dem Chromosom 15 in der Region von q11 bis q13 lokalisiert. Trotz gleicher Genorte sind die phänotypischen Manifestationen der Erkrankungen sehr unterschiedlich. Patienten mit Prader-Willi-Syndrom zeichnen sich durch ausgeprägte Adipositas, geistige Retardierung, Verhaltensstörungen und charakteristische morphologische Merkmale aus, während Patienten mit Angelman-Syndrom eine schwere geistige Retardierung, fehlende Sprachentwicklung und psychomotorische Entwicklungsstörungen aufweisen. Diagnostisch für mehr als 70% der Patienten mit Angelman-Syndrom ist eine Mikrodeletion des mütterlichen Chromosoms 15. Autosomal-rezessive Erkrankungen Die Cystische Fibrose (synonym Mukoviscidose) ist die häufigste autosomal-rezessive Erkrankung bei Europäern mit einer Allelfrequenz von etwa 0,022 und einer Häufigkeit von etwa 1:2500 Geburten. Anwendung des Hardy-Weinberg-Gesetzes belegt, dass mehr als 4% der Europäer heterozygot und damit Träger der genetischen Erkrankung sind (Weiss 1993). Klinische Symptome sind zähe und dickflüssige Sekrete, welche zu chronischen Lungeninfektionen führen, im Kindesalter zu Pankreasinsuffizienz und bei Neugeborenen häufig zum Darmverschluss. Trotz vielfältiger therapeutischer Ansätze ist die cystische Fibrose heute immer noch die häufigste Ursache für Todesfälle in der Kindheit durch Atemwegserkrankungen (circa 90% der an Mukoviscidose Erkrankten sterben an Lungenkomplikationen). Betroffene werden selten älter als 40 Jahre (Trent 1994). Die Krankheit beruht auf einer Mutation des CFTRGenortes (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, Kerem et al. 1989) auf dem Chromosom 7. Bei erkrankten Personen fehlt im defekten CFTR-Protein an der Position 508 die Aminosäure Phenylalanin, so dass die- Populationsgenetik 165 ses für den Chloridtransport durch die Zellmembran verantwortliche Protein dysfunktional wird. Ein erhöhter Salzgehalt des Schweißes ist für Patienten aufgrund des gestörten Salzhaushaltes charakteristisch. Da diese Krankheit vor allem in früheren Zeiten unweigerlich zum Tod des betroffenen Individuums führte, ehe es zur Fortpflanzung kam, stellt sich die Frage, warum dieses Allel so häufig ist und ob Heterozygote (welche selber nicht erkranken) möglicherweise einen Selektionsvorteil haben. Es wurde vorgeschlagen, dass Heterozygote aufgrund der starken Schleimsekretion eine gewisse Resistenz gegenüber der Invasion von Tuberkulosebakterien haben (Meindl 1987). Aufgrund des gehemmten Chlorid-Transportes wird jedoch auch ein Selektionsvorteil gegenüber Cholera diskutiert. Das Gen für cystische Fibrose ist hoch polymorph, zwischenzeitlich wurden mehr als zweihundert verschiedene Mutationen beschrieben. In Nordeuropa weitaus am häufigsten ist die genannte, als ∆F508 bezeichnete Mutation, von der mehr als 70% der Patienten betroffen sind. Neugeborene werden routinemäßig auf das Vorhandensein mutierter Allele untersucht. Bis zu 90% aller Mutationen, welche zu einer cystischen Fibrose führen, können auf diesem Wege identifiziert werden (Trent 1994). Die Phenylketonurie (PKU) ist eine autosomal-rezessive Erkrankung, wobei das verantwortliche Gen auf dem Chromosom 12 lokalisiert ist und für das Enzym Phenylalaninhydroxylase codiert. Bei defektem Allel kommt es zu Störungen des Stoffwechsels der Aminosäure Phenylalanin, insbesondere ihrer Umwandlung zu Tyrosin. In den Patienten kommt es damit zu einer Akkumulation von Phenylalanin und zu schweren Schäden des Zentralnervensystems. Unbehandelt geht die Fitness von an PKU Erkrankten gegen Null. Die Häufigkeit der PKU bei Lebendgeborenen zeigt große geographische Schwankungen, allein in Europa reichen die Häufigkeiten von 1:4500 in Irland bis 1:16000 in der Schweiz (Weiss 1993). Mehr als fünfzig Haplotypen sind zwischenzeitlich identifiziert worden, wobei die Mehrzahl der europäischen PKU-Mutationen die Haplotypen 1 und 4 betrifft. Da der Haplotyp 4 auch in Asien ein hohes Vorkommen von ungefähr 80% hat, könnte dieser Haplotyp der ursprüngliche sein (Daiger et al. 1989). Die Frequenz der verschiedenen PKU-Haplotypen zeigt geographische Gradienten in einer Art und Weise, die nur so erklärt werden können, dass bestimmte Mutationen in einer Region entstanden sind und sich dann per Diffusion ausgebreitet haben (Hertzberg et al. 1989). X-chromosomal gekoppelte Erkrankungen Diese Krankheiten werden durch defekte Allele auf dem X-Chromosom hervorgerufen. Aufgrund ihrer Hemizygotie werden betroffene Männer das Krankheitsbild daher vollständig ausprägen, Frauen dagegen mehrheitlich lediglich heterozygote Trägerinnen dieses Defektes sein. Bekanntestes Beispiel dürfte die Bluterkrankheit sein, die Haemophilie, wobei der Typ A auf einem Mangel eines als Faktor VIII bezeichneten Gerinnungsproteins beruht, der Typus B auf einem Mangel des Gerinnungsfaktors IX. In jüngerer Zeit ist das fragile X-Syndrom gut untersucht worden, die häufigste erbliche Form geistiger Behinderung. Verantwortlich ist eine zerbrechliche 166 Bevölkerungsbiologie Stelle auf dem X-Chromosom, wovon etwa eines von 2000 Kindern betroffen ist. Ursächlich ist eine Mutation im FMR1-Gen (fragile X mental retardation gene) am Genort Xq27.3, welche in einer Verlängerung repetitiver CGG-Sequenzen besteht. Durch diese Verlängerung der CGG-repeats wird das FMR1Protein dysfunktional. Liegt die Anzahl der CGG-Wiederholungen zwischen 52 und 200, spricht man von einer Prämutation, welche als Vorstufe der Vollmutation mit mehr als 200 CGG-Wiederholungen anzusehen ist. Während Prämutationen von beiden Geschlechtern vererbt werden können, erfolgt die Längenveränderung der Prämutation zur Vollmutation nur bei der mütterlichen Vererbung. Eine Vollmutation in einem männlichen Patienten ist daher stets maternal vererbt und niemals Folge nur eines einzigen Mutationsgeschehens. Patienten mit fragilem X-Syndrom sind geistig retardiert und weisen einige morphologische Symptome z. B. des Gesichtes auf, darüber hinaus häufig auch Verhaltensauffälligkeiten. Die Ausprägung der Erkrankung ist bei Frauen in der Regel schwächer als bei Männern. Ein weiteres Beispiel für X-chromosomal gekoppelte Erkrankungen ist die Duchenne-Muskeldystrophie, von der etwa eines von 3000 männlichen Neugeborenen betroffen ist. Die Erkrankung äußert sich in progressivem Muskelschwund und führt zumeist im Alter von 20 bis 30 Jahren zum Tod. Das verantwortliche Gen ist sehr groß und umfasst mit über 2300 Kilobasen etwa 1% des gesamten X-Chromosoms. Möglicherweise ist diese beträchtliche Größe des Gens für die hohe Mutationsrate verantwortlich. Es wird geschätzt, dass etwa ein Drittel aller Fälle auf Neumutationen beruht (Trent 1994). Bei Patienten wird kein oder nur noch eine sehr geringe Menge an Dystrophin gebildet, eines wichtigen Bestandteiles der Muskelzellmembran. Fehlt dieses Protein, ist die Durchlässigkeit der Membran erhöht mit der Folge des erhöhten Einstromes von Schadstoffen und des Verlustes von Enzymen. In Folge dieses gestörten Zellstoffwechsels sterben die Muskelfasern ab. Nicht an das X-Chromosom gebunden, aber ebenfalls maternal vererbt sind Erkrankungen, die auf Mutationen der mitochondrialen DNA beruhen. Sie betreffen bevorzugt solche Organe, die einen hohen Energiebedarf haben, wie z. B. Gehirn und Herzmuskel. Charakteristisch ist in jedem Fall, dass die Symptome auch die mitochondriale oxidative Phosphorylierung betreffen. Aufgrund von Heteroplasmie (gleichzeitiges Vorliegen normaler und mutierter Mitochondrien in derselben Zelle) ist die Symptomatik bei den Patienten sehr heterogen. Beispiele für mitochondriale Erkrankungen sind die familiäre mitochondriale Encephalomyopathie (epileptische Anfälle, Muskelerkrankungen, gelegentlich Demenz und Ataxie), oder das Kearns-Sayre-Syndrom, eine progressive neuromuskuläre Erkrankung. Genetische Beratung In einer Population kann die Allelfrequenz für eine genetisch bedingte Erkrankung anhand der Häufigkeit der Homozygoten nach dem Hardy-Weinberg-Gesetz berechnet werden, um damit die Häufigkeit der phänotypisch gesunden Träger des Alleles zu bestimmen. Im Falle der PKU beträgt die Populationsgenetik 167 Häufigkeit Erkrankter im Durchschnitt 1:10 000 (entsprechend q2), d. h. q = 0,01. Da p+q = 1, gilt für p = 1-0,01 = 0,99 . 1. Es folgt für die Heterozygotenhäufigkeit 2pq = 2:100 = 1:50; d. h. jedes fünfzigste Individuum der Population ist heterozygot für PKU. Hieraus folgt, dass seltene rezessive Allele in einer Bevölkerung im Wesentlichen heterozygot vorliegen. Das Verhältnis Heterozygoter zu Homozygoter beträgt damit 2pq:q2 = 2p/q, woraus unmittelbar ersichtlich wird, dass das Verhältnis Heterozygoter zu Homozygoter größer wird, je kleiner q ist (Hirsch-Kauffmann u. Schweiger 1992). Alle in den vorangegangenen Kapiteln als Beispiel aufgeführten genetischen Erkrankungen können pränatal diagnostiziert werden. Die hierfür notwendigen fetalen Zellen können z. B. aus der Amnionflüssigkeit gewonnen werden; dieser als Amniozentese bezeichnete Vorgang wird etwa in der 15. Schwangerschaftswoche durchgeführt. Auch eine Gewebeentnahme aus den Chorionzotten, Gewebe fetalen Ursprungs welches den Embryo umgibt, ist bereits im ersten Drittel der Schwangerschaft möglich. Bei der Präimplantationsdiagnostik werden an einigen der noch undifferenzierten Zellen eines in vitro gezeugten Kindes die erforderlichen DNA-Untersuchungen durchgeführt. Sofern sich keine genetische Erkrankung nachweisen lässt, werden die übrigen Zellen in die Gebärmutter der Mutter eingepflanzt, wo sie sich zu einem normalen Embryo entwickeln. Obgleich eine Reihe von genetischen Erkrankungen einen Schwangerschaftsabbruch legitimieren würde, bleibt das unlösbare ethische Problem, dass die werdenden Eltern vor einer schweren Entscheidung stehen, bei denen ihnen letztlich niemand helfen kann. Jeder pränatalen Diagnostik sollte also zwingend eine genetische Beratung vorausgehen (Hirsch-Kauffmann u. Schweiger 1992). Im Zuge der genetischen Beratung wird das Erkrankungsrisiko eines Kindes abgeschätzt, wobei die a-priori-Risikofaktoren wie Genfrequenz in der Population, Mutationsrate und Stammbaum der Eltern ebenso einbezogen werden wie die konditionalen Faktoren wie z. B. biochemische und klinische Befunde. Es wäre in einem angenommenen Beispiel denkbar, dass eine gesunde Frau direkte Verwandte hat, welche eine an das X-Chromosom gekoppelte erbliche Erkrankung aufweisen, z. B. Hämophilie. Sie würde dann eine genetische Beratung wünschen, um abschätzen zu können, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie Überträgerin dieser Krankheit ist. Wenn in diesem Beispiel sowohl ihr Bruder als auch ihr Onkel an Hämophilie erkrankt sind, trägt sie ein Risiko von 50%, das defekte X-Chromosom von ihrer Mutter geerbt zu haben. Um die Wahrscheinlichkeit des Erkrankungsrisikos eines Kindes weiter eingrenzen zu können, werden im Zuge einer genetischen Beratung die genannten konditionalen Faktoren mit einberechnet. Zusätzlich zu der a-priori-Schätzung mit Hilfe des bekannten Stammbaumes der ratsuchenden Mutter und der a-posteriori-Schätzung für die nachfolgende Generation aufgrund etwa eines biochemischen Befundes wird die Wahrscheinlichkeitsberechnung für das Risiko des zu erwartenden Kindes in Abhängigkeit von seinem Geschlecht mit Hilfe des Bayes-Theorems (Evett u. Weir 1998) abgeschätzt (Hirsch-Kauffmann u. Schweiger 1992). Dieses Theorem, welches dem Kleriker Thomas Bayes des 18. Jahrhunderts zugeschrieben wird, ist ein sehr hilfreiches Modell nicht nur zur 168 Bevölkerungsbiologie Risikoabschätzung im Zuge der genetischen Beratung, sondern auch in Bezug auf forensische Fälle (s. Kap. 5.2). Zusammenfassung Kapitel 3.1 Populationsgenetik n Die differentielle Häufigkeit von Allelen und die Gründe für die festgestellten Genfrequenzen spielen eine Schlüsselrolle für das Verständnis der Evolution des Homo sapiens und die Epidemiologie genetisch bedingter Erkrankungen. Die Populationsgenetik untersucht, auf welche Weise Allele von der Eltern- auf die Nachkommengeneration weitergegeben werden. Von zentraler Bedeutung in der Populationsgenetik ist das Hardy-Weinberg-Gesetz. n Lokale Populationen sind die aktuellen, real evolvierenden Einheiten einer Biospezies. Sie sind genetisch polymorph. Aufgrund der hohen Zahl von Polymorphismen ist jedes Individuum „biochemisch einmalig“, ausgenommen eineiige Mehrlinge. n Veränderungen von Genfrequenzen beruhen auf Mutation und Selektion (wichtiger Selektionsfaktor beim Menschen sind Infektionskrankheiten), genetischer Drift, Flaschenhals- und Gründereffekten, Migration, assortativer Paarung und Verwandtenehen. Positive assortative Paarung und Verwandtenehen beeinflussen nicht die Allelfrequenzen im Gesamtgenpool der Population, führen aber zu einer Erhöhung der Homozygoten unter den Nachkommen. n Gemeinsamkeiten im Genpool von Bevölkerungen beruhen in der Regel auf einem gemeinsamen Ursprung. Die Theorie der neutralen Evolution besagt, dass eine Vielzahl der auf der molekularen Ebene detektierbaren Polymorphismen selektionsneutral ist. Bei konstanter Rate der molekularen Evolution kann über das Modell der molekularen Uhr die Genealogie von Genen rekonstruiert werden. n Populationsgenetische Modelle sind außerordentlich hilfreich, die Häufigkeit genetisch bedingter Erkrankungen in einer Population abzuschätzen und spielen eine entsprechend wichtige Rolle bei der genetischen Beratung. Jeder pränatalen Diagnostik sollte zwingend eine solche Beratung vorausgehen. Humanökologie 169 3.2 Humanökologie Der anatomisch moderne Mensch hat sämtliche Kontinente mit Ausnahme der Antarktis dauerhaft besiedelt, wobei sein Primatenerbe der Flexibilität und des eher Generalisiert- als Spezialisiertseins außerordentlich hilfreich war. Umweltadaptationen des Menschen sind jedoch nicht nur genetischer, sondern auch kultureller Natur bzw. Verhaltensanpassungen, welche es ihm ermöglicht haben, selbst in primär lebensfeindlichen Umwelten eine durchaus komfortable Mikroumwelt, z. B. in Form von beheizten Behausungen, zu etablieren, welche allerdings kaum kostenneutral zu erlangen ist. Diese kulturelle, gelegentlich als „zweite Natur“ bezeichnete Eigenschaft des Menschen ist Bestandteil seiner natürlichen Lebensform (Kastenholz 1993) und ermöglicht die Veränderung naturräumlicher Standorte gemäß den unmittelbaren Bedürfnissen einer Population, was zur Genese anthropogener Standorte mit den ihnen eigenen Charakteristika und Problemen führt. Kultur ist adaptiv, oft jedoch auch opportunistisch ohne Beachtung der langfristigen Konsequenzen (z. B. Ausbeutung fossiler Energieträger; Bates 2001). Tatsache ist, dass die geographisch weite Verbreitung von Menschen deren hohe Toleranz gegenüber vielen limitierende Faktoren, wie Temperatur, Sauerstoffpartialdruck, Nahrungsressourcen, UV-Strahlung, Konkurrenten usw. und deren Bewältigung bezeugt. Solche Faktoren werden dann als „Umweltstressoren“ bezeichnet, wenn sie potentiell ein Verletzungs- oder Schadenspotential für die betroffenen biologischen Systeme (Organismus oder einzelne seiner Organe und Zellen) in sich bergen (Hoffman u. Parsons 1991). Sie können zur Störung der Homöostase (= Gesamtheit der endogenen Regelvorgänge, welche für ein stabiles inneres Milieu sorgen) führen, zu welcher die Beibehaltung der Körperkerntemperatur, des pH-Wertes, des Blutdruckes, des Blutzuckerspiegels und viele andere Faktoren zählen. Biologische und kulturelle Adaptationen verleihen menschlichen Populationen eine besonders hohe Umweltplastizität im Sinne der speziesspezifischen Reaktionsnorm (= beobachtbare Veränderungen des Organismus, welche als Funktion von Umweltkonditionen variieren) (Stearns 1989). Folgende prinzipielle Adaptionsmechanismen sind voneinander zu unterscheiden: • • • • • Akklimatisation = die phänotypische Plastizität, die es dem Individuum ermöglicht, Umweltveränderungen innerhalb von Tagen oder Wochen zu kompensieren, z. B. saisonale Temperaturschwankungen. Akklimatisationen sind reversibel. Ontogenetische Adaptationen = Anpassung an Umweltstressoren während der Entwicklungsphase, z. B. an einen niedrigen Sauerstoffpartialdruck oder durch Erwerb von Immunität gegenüber endemischen Pathogenen. Demographische Adaptation, z. B. durch Anpassung der Bevölkerungsdichte an vorhandene und produzierbare Nahrungsressourcen. Genetische Adaptationen (vgl. Kapitel 3.1). Kulturelle und Verhaltensanpassungen. Diese können außerordentlich flexibel sein und das Resultat kurzfristiger strategischer Entscheidungen, sind 170 Bevölkerungsbiologie in Abhängigkeit gegebener Umweltparameter (z. B. der mittleren Jahrestemperatur) bei traditionaler Lebensweise aber auch sehr konstant. Aufgrund der Komplexität menschlicher Umweltbeziehungen bezieht sich die Mehrzahl der einschlägigen Publikationen auf Anpassungen an physikalische (klimatische) und biologische Umweltstressoren und basiert dabei auf der Benennung der jeweiligen limitierenden Faktoren (Kälte, Nahrungs- und Wasservorkommen) im Sinne von „single-stressor-Modellen“. Diese werden der Thematik jedoch nur bedingt gerecht (Kormondy u. Brown 1998). Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Terminus „Adaptation“ insofern doppeldeutig ist, als er gleichermaßen den Anpassungsprozess, als auch das angepasste Merkmal bzw. den angepassten Merkmalskomplex bezeichnet. 3.2.1 Homo sapiens – eine polytypische Spezies Das äußere Erscheinungsbild von Menschen ist vielfältig: es existieren Menschen mit verschiedenen Proportionen (gedrungene oder lineare Statur), Hautfarben, Haar- und Augenfarben, Haarformen (straff bis spiralig gelockt), Gesichtsformen usw. Derartige biologische Merkmale häufen sich in einigen Population, sind in anderen dagegen selten oder fehlen sogar. Ebenso verhält es sich mit biologischen Merkmalen, welche nicht unmittelbar mit den Sinnen erfasst werden können, wie Blutgruppen-, Enzym- und DNA-Polymorphismen (s. Kap. 3.1). Die Populationszugehörigkeit von Menschen wird häufig noch durch nicht-biologische Merkmale unterstützt, wie z. B. Tracht, Gebräuche, oder auch Religion. Als Angehörige der Primaten sind Menschen „Augentiere“ mit der Folge, dass die spontane Zuweisung der Gruppenzugehörigkeit eines Anderen primär nach den äußerlich sichtbaren Merkmalen, etwa der Hautfarbe, erfolgt. Noch immer hält sich hartnäckig der Begriff der „Menschenrassen“, wie z. B. in der Brockhaus-Definition (www.brockhaus.de): „Menschenrassen, geographisch lokalisierbare Formengruppen des heutigen Menschen; in typologischen Konzepten werden die Europiden, Mongoliden, Indianiden und Negriden unterschieden“. Richtig ist an dieser Definition, dass Menschen in Bezug einiger der oben angeführten biologischen Merkmale eine graduelle Variabilität hinsichtlich ihrer geographischen Verbreitung aufweisen und dass nur gemäß dem in der Anthropologie überholten Typologiekonzept (s. Kap 2.3.1) eine Einteilung in Europide, Mongolide usw. vorgenommen wird. Diese Definition könnte jedoch suggerieren, dass es eine biologische Grundlage für die Einteilung von Menschen in „Rassen“ gebe. Die Frage nach der Existenz von Menschenrassen wird bis in die Gegenwart heftig und kontrovers debattiert, wobei die Antwort aus biologischer Sicht rasch und sicher mit „nein“ gegeben werden kann. Rassen sind Zuchtprodukte, wie unsere heutigen Haus- und Nutztierrassen. Sie sind durch bestimmte Merkmale charakterisiert, wie Fellfarbe und -zeichnung, Größe und Proportionen, Fleischqualität, Milchleistung, Verhaltensmerkmale und vieles mehr. Die Einhaltung dieser Rassestandards ist Aufgabe der Züchter. Selbstverständlich gibt es auch innerhalb einer Rasse eine mehr oder weniger große Humanökologie 171 Merkmalsvariabilität, jedoch werden Tiere, welche den Standards nicht genügen, in der Regel von der Zucht ausgeschlossen. Rassen sind somit anthropogene Produkte, welche in freier Wildbahn nicht existent sind. Konsequent kommt die Subspezies-Kategorie der Rasse auch in der zoologischen Taxonomie und Nomenklatur nicht vor. Freilich ist die Debatte mit diesem einfachen und klaren Hinweis darauf, dass der Terminus „Rasse“ auf menschliche Populationen nicht zutrifft und daher falsch ist, keineswegs beendet. Hier helfen auch andere, auf dem dynamischen Populationskonzept beruhende Klassifikationsversuche nicht weiter, wie z. B. jene, dass Menschenrassen Populationen seien, welche sich bezüglich der Genfrequenzen voneinander unterscheiden. Solche Populationen existieren ohne Frage, aber gemäß dieser Definition würden sämtliche menschlichen Populationen das Rassekriterium erfüllen. Ferner seien Subspezieskategorien dann erkennbar, wenn 75% der Individuen einer Gruppe eindeutig dieser Gruppe zugeordnet werden können – hier könnte man sicherlich die autochthonen Bevölkerungen der Kontinente voneinander unterscheiden, jedoch gelingt eine Zuordnung sämtlicher Menschen dieser Erde keinesfalls, und das Ende ist eine vergleichsweise hilflose Auflistung von „Sondergruppen“ (Knußmann 1996). Wesentlich ist die Aussage von Harrison et al. (1988): „Race as such explains practically nothing.“, d. h. die Bildung von Menschenkategorien hat keinerlei Erklärungswert. Trotz aller sinnfälligen morphologischen Unterschiede und deren geographischer Verteilung ist die genetische Diversität von Menschen weltweit kleiner als z. B. in rezenten Schimpansenpopulationen, welche ihre genetische Diversität über einen vergleichbaren evolutiven Zeitraum akkumulieren konnten (Ferris et al. 1981, Ruano et al. 1992, Marks 1995, Gagneux et al. 1999). Bis heute glauben viele Nicht-Biologen, dass es inhärente, biologische Rasseunterschiede zwischen den menschlichen Populationen gebe (Almquist u. Cronin 1988). Dabei ist jeder Rassegedanke letztlich ein soziales oder sozialpolitisches Konstrukt, was sich unter anderem an dem Verhalten von Kleinkindern zeigt, welche zwar äußerliche Unterschiede zwischen Menschengruppen wahrnehmen, jedoch nicht als signifikant bewerten (Holmes 1995). Die rein fiktive Behauptung der Existenz von nicht-trivialen, erblichen und grundlegenden Merkmalen, welche die Mitglieder einer Population gemeinsam haben und welche in anderen Gruppen fehlen würden (Graves 2001), ist, vor allem bei suggestiver Präsentation, geeignet und auch die Grundlage für die Bewertung von Menschen außerhalb der eigenen Gruppe bis hin zu deren Diskriminierung und gibt damit die Legitimation für Rassismus. Selbst für kognitive Leistungen wurden signifikante Unterschiede zwischen Menschen verschiedener geographischer Herkunft vorgeschlagen (Herrnstein u. Murray 1994). Auch ein IQ-Wert ist grundsätzlich nicht anders zu bewerten als ein morphologisches Merkmal, und keines dieser Merkmale lässt Rückschlüsse auf Persönlichkeit und oder gar moralische Qualitäten des Probanden zu. Die phänotypische Varianz eines Merkmales ist hochkomplex und setzt sich nach Graves (2001) wie folgt zusammen: VarianzPhänotyp = Varianzgenetisch + Varianzumweltbedingt + VarianzGen/Umwelt-Interaktion + KovarianzGen/Umwelt + VarianzMessfehler. 172 Bevölkerungsbiologie Eine bestimmte Typologie erlaubt somit in der Regel keine sofortigen Rückschlüsse auf die genetische Grundlage. Die sozialpolitische Konstruktion von Menschenrassen zeigt sich z. B. in der Definition von Immigranten in die USA: So finden sich neben African-Americans, Caucasians, Asian-Americans und Native Americans auch Hispanics – es wird also willkürlich einmal nach geographischer Herkunft, ein andermal nach der Zugehörigkeit zu einer Sprachfamilie kategorisiert (Marks 1995). Angesichts der bis heute anhaltenden rassistischen bzw. rassistisch geprägten Übergriffe in allen Teilen der Welt besteht offenbar nach wie vor ein hoher Aufklärungsbedarf, obgleich das rassistische Vorurteil vermutlich so alt ist wie die geschriebene Geschichte. Das Bedürfnis nach einer Gruppenzugehörigkeit ist einem sozialen Primaten und damit auch Menschen inhärent, gleichzeitig ist eine wie auch immer geartete Definition der eigenen „Innengruppe“ und deren Absetzung von anderen „Außengruppen“ impliziert (s. Kap. 6). Die Einsicht, dass „Menschenrassen“ sozialpolitische Konstrukte und nicht biologische Realität sind, eröffnet zumindest potentiell eine Perspektive, rassistischem Gedankengut entgegenwirken zu können, da soziale Praxis rascher wandelbar ist als genetische Konstitution (Graves 2001). Es steht außer Frage, dass sich die Populationen auf den Kontinenten unserer Welt auch morphologisch unterscheiden, z. B. in Bezug auf die Körperstatur und die Hautfarbe. Diese Merkmale variieren jedoch graduell mit der Folge, dass die Merkmalsvariabilität innerhalb einer kontinentalen Gruppe größer ist als zwischen den Gruppen. Es kann gezeigt werden, dass wesentliche morphologische wie physiologische Merkmale und differentielle Genfrequenzen der Populationen als ökologische Anpassung an physikalische und biologische Charakteristika dieser Standorte verstanden und erklärt werden können. 3.2.2 Anpassung an physikalische Umweltparameter Temperatur: Adaptation an kalte und heiße Klimazonen Als warmblütiges Säugetier ist es für den Menschen lebensnotwendig, die Körperkerntemperatur in einem sehr engen Bereich konstant zu halten (normale Temperatur im Inneren des Rumpfes und Hirnschädels: 36,5–37°C; Schmidt et al. 2000), in welchem die inneren Organe funktional sind. Vom Körperkern unterschieden wird die Körperschale, welche alle jene Gewebsschichten unter der Haut umfasst, in denen ein nach außen gerichtetes Temperaturgefälle auftreten kann und deren Toleranz gegenüber Temperaturschwankungen größer ist. Grundsätzlich kann ein Temperaturausgleich mit der Außentemperatur über Konvektion (durch Bewegung der Wärmeträger, z. B. bewegte Luft), Konduktion (Wärmeleitung, Hautkontakt mit Oberflächen) und Aufnahme bzw. Abgabe langwelliger Infrarotstrahlung erfolgen. In Abhängigkeit von kalten oder heißen Außentemperaturen kommen physiologische Regulationsmechanismen dazu, welche im Dienst der Thermoregulation stehen und im Wesentlichen die Muskulatur, die Hautdurchblutung, den Humanökologie 173 Box 3.6 Kälteadaptation Standorte: Arktis, Binnenregionen der gemäßigten Breiten (saisonal intensive Kälte), Höhenlagen, trockene Standorte (nächtliche Kälte) Biologische Anpassung: Kulturelle und Verhaltensanpassung: Körperform (Oberflächen/VolumenVerhältnis), Vasokonstriktion, CIVD, Zittern, Unterhautfettgewebe, Bemuskelung, energiereiche Ernährung Bekleidung, isolierende Behausung, Feuer, heiße Nahrung und Getränke, zeitliche Aktivitätsmuster Demographische Effekte: Kosten: Hohe Risiken für Kinder und für Erwachsene bei bestimmten Arbeiten Rohstoffe und Arbeitsaufwand für die Herstellung von Kleidung, Behausung usw., Nahrungsenergie, Brennstoffe verändert nach Kormondy u. Brown (1998) Fettstoffwechsel und die Schweißsekretion betreffen. Grundsätzlich gilt, dass Menschen besser an Hitze als an Kälte adaptiert bzw. adaptierbar sind, wahrscheinlich als stammesgeschichtliches Erbe eines ehemals tropischen Primaten. Neben Thermorezeptoren in der Haut und einigen inneren Organen sind es insbesondere im Hypothalamus lokalisierte Zentren, welche die Körpertemperatur regeln (Möricke et al. 1991, Schmidt et al. 2000). Dauerhaft von Menschen besiedelte kalte Standorte sind die Arktis, aber auch das Innere der gemäßigten Breiten mit harten Wintern, sowie große Höhenlagen (Anden, Himalaja), welche starke tageszeitliche Temperaturschwankungen aufweisen (Box 3.6). Nicht zu vernachlässigen ist Wind als Temperaturfaktor, welcher einen Wärmeverlust durch Konvektion beschleunigt. Ebenfalls beträchtlich beschleunigt ist die Wärmeabgabe des Körpers im Wasser (bis zu 25fach; Kormondy u. Brown 1998), so dass selbst in warmen Klimaten ein verlängerter Aufenthalt im Wasser rasch zur Unterkühlung führt. Bei Unterschreitung der normalen Körperkerntemperatur kommt es zur Hypothermie, welche zu Erfrierungen und letztlich zum Tod führen kann. Sinkt die Körperkerntemperatur um lediglich 1°C, setzt eine kompensierende metabolische Wärmeproduktion ein. Von einer Körperkerntemperatur von 35°C an kommt es zum Kältezittern, ab 34°C sind physische und mentale Funktionen beeinträchtigt, und bei einer Körperkerntemperatur von 31–32°C tritt ohne Intervention von außen der Tod ein (Beall u. Steegmann 2000). So ist es nicht verwunderlich, dass es vornehmlich kulturelle und Verhaltensadaptationen 174 Bevölkerungsbiologie sind, welche es Menschen ermöglicht haben, an kalten Standorten komfortable Mikroklimate zu schaffen. Geeignete Kleidung und isolierende Behausungen gehören ebenso dazu wie ein den tageszeitlichen Temperaturschwankungen angepasstes Aktivitätsmuster sowie die Produktion von Wärme durch Feuer. Die Ernährungsweise muss den gesteigerten physiologischen Prozessen entsprechen, insbesondere heiße Nahrung und heiße Getränke sind geeignet, Wärme unmittelbar in den Körperkern zu transportieren (Kormondy u. Brown 1998, Moran 2000). Biologische Anpassungsmechanismen betreffen zunächst eine vom sympathischen Nervensystem gesteuerte periphere Vasokonstriktion (= Verengung der Blutgefäße) zur Reduktion der Wärmeabgabe nach außen. Eine möglicherweise populationsspezifische adaptive Fähigkeit ist die kälteinduzierte rhythmische Vasodilatation (= Erweiterung der Blutgefäße) (CIVD = cold induced vasodilation) in den Extremitäten, wodurch vor allem Finger und Zehen in zeitlichen Abständen durch die verbesserte Durchblutung kurzfristig wieder erwärmt werden, um Erfrierungen zu vermeiden und die Funktionalität zu gewährleisten (Nelms u. Soper 1962, Beall u. Steegmann 2000). Sehr effizient in Bezug auf die endogene Wärmeproduktion ist das Kältezittern, eine unwillkürliche, rhythmische Zunahme der Muskelaktivität, welche den Grundumsatz um das 2–5fache erhöht, aber hinsichtlich des erforderlichen Energieaufwandes sehr kostenintensiv ist. Gleiches gilt für die Wärmeproduktion durch körperliche Aktivität an sich (Kormondy u. Brown 1998). Viele Säugetiere verfügen über die Fähigkeit der zitterfreien Thermogenese über braunes Fettgewebe, welches über das Hormon Norepinephrin die Stoffwechselrate erhöht. Menschliche Neugeborene verfügen über braunes Körperfett, da sie aufgrund ihres hohen Oberflächen/Volumen-Verhältnisses, der geringen Dicke der Körperschale und der noch dünnen Fettschicht in großer Gefahr der Hypothermie sind (Schmidt et al. 2000). Die Bedeutung der zitterfreien Thermogenese für erwachsene Individuen ist nach wie vor strittig,jedoch ist diese zumindest für einige Populationen naheliegend (Hong 1973). Selbst für die Inuit8, jene menschlichen Populationen, die seit Jahrtausenden in einer besonders kalten und harschen Umwelt leben, ist die Frage nach genetisch bedingten physiologischen Adaptationen bis heute nicht vollständig geklärt. Tatsache ist, dass bei Inuit ein gegenüber Europäern um 25-50% erhöhter Grundumsatz gemessen wurde. Ob dies jedoch Folge einer genetisch bedingten hocheffizienten Thermoregulation oder eher Folge permanent hoher körperlicher Aktivität und spezieller Ernährungsweise ist, kann nicht klar voneinander getrennt werden (Schmidt et al. 2000). Eine Akklimatisierung an Kälte ist Menschen möglich, kenntlich u. a. an einer Absenkung der für das Einsetzen des Kältezitterns verantwortlichen Temperaturgrenze. Eine weitere biologische Anpassung, welche auch im Zuge einer Akklimatisierung erworben werden kann, ist eine isolierende Körperzusammensetzung mit einer dicken Unterhautfett- und Muskelschicht (Beall u. Steegmann 2000). 8 Inuit = autochthone Bevölkerung der Küsten Grönlands, Nordamerikas und Nordostasiens. Humanökologie 175 Box 3.7 Adaptation an heiße und trockene Standorte Standorte: Wüste, Savanne (tagsüber heiß bis sehr heiß, nachts kühl bis kalt) Biologische Anpassung: Kulturelle und Verhaltensanpassung: Körperform (Oberflächen/VolumenVerhältnis), Vasodilatation, Transpiration ventilierte Behausungen, zeitliche Aktivitätsmuster, Schaffen von Schatten, Kühlung durch Evaporation Demographische Effekte: Kosten: Hohe Risiken für Kinder, ältere Menschen Wasser, Ressourcen und Arbeitsaufwand und solche mit cardiovaskulären Erkran- für Kühlsysteme, Behausungen, Sonnenkungen und Adipositas schirme usw. verändert nach Kormondy u. Brown (1998) Bezüglich heißer Standorte ist zwischen trocken-heißen und feucht-heißen Umwelten zu unterscheiden: Beiden sind hohe Temperaturen gemeinsam, jedoch sind trocken/heiße Standorte (heiße Wüsten und Savannen) durch eine geringe Primärproduktion, dünne bis fehlende Pflanzenbedeckung (damit auch wenig Schatten) und ausgesprochene Wasserknappheit gekennzeichnet, während an feucht-heißen Standorten (tropische Regenwälder) die Temperaturen und tageszeitlichen Temperaturdifferenzen weniger extrem, eine üppige Primärproduktion und Pflanzenbedeckung sowie reichliches Vorkommen von Wasser typisch sind (Box 3.7; 3.8). Als biologische Anpassungen an trockene Hitze kommt es zunächst zu einer Vasodilatation und Vermehrung des Blutflusses in die Extremitäten, um Wärme aus dem Körperkern über die Körperschale abzuführen. In der Konsequenz wird der Herzschlag rascher und kräftiger, was für Risikopersonen ein besonderes Problem darstellt. Die normale Körperkerntemperatur des Menschen kommt der höchsten tolerierbaren Kerntemperatur von 40–42°C ohnehin nahe, bei deren Überschreiten es zu Hämorrhagien und Organversagen kommt. Allein aufgrund körperlicher Aktivität wird endogen Wärme produziert, und angesichts der Tatsache, dass der Zellstoffwechsel bei jedem Ansteigen der Körperkerntemperatur um 1°C seinerseits um 13% steigt, ist auch in Bezug auf Hitzestress die Spanne zwischen normaler Funktion und letaler Dysfunktion ausgesprochen gering. Hitzebedingte Erschöpfungszustände, gekennzeichnet durch Schwäche, Müdigkeit, Kopfschmerz, Krämpfe und Erbrechen sowie mentale Beeinträchtigung sind Folge von Dehydrierung und Verlust von Elektrolyten durch Schwitzen (s. unten) und können entweder kontinuierlich zu dem lebensbedrohlichen Hitzschlag führen, welcher (Na- 176 Bevölkerungsbiologie Box 3.8 Adaptation an heiße und feuchte Standorte Standorte: Regenwald (heiß und feucht mit geringer tageszeitlicher Schwankung) Biologische Anpassung: Kulturelle und Verhaltensanpassung: Körperform (Oberflächen/VolumenVerhältnis), Vasodilatation, Transpiration wenig effizient Ventilation, Kühlung durch Evaporation wenn möglich, Minimierung von Kleidung, ventilierte Behausung Demographische Effekte: Kosten: Hohe Risiken für Kinder, ältere Menschen Wasser, besondere Bauweise und solche mit cardiovaskulären Erkrankungen; Probleme bei schwererer körperlicher Arbeit verändert nach Kormondy u. Brown (1998) mensgebung!) jedoch auch plötzlich und ohne Vorwarnung eintreten kann. Klassische Symptome des Hitzschlages sind eine Körperkerntemperatur über 41°C, ausgetrocknete Haut und Dysfunktionalität des Zentralnervensystems mit Delirium oder Koma, Folge eines zu geringen Plasmavolumens durch fortschreitende Austrocknung und letztlicher Koagulation des Blutes (Beall u. Steegmann 2000). Ein wichtiges physiologisches System zur Abkühlung ist das Schwitzen, was bei Menschen durch die Anzahl von etwa 2 Mio. ekkriner Schweißdrüsen (= Schweißdrüsen, welche nur Wasser und Elektrolyte sezernieren), welche bis zu 2 L Schweiß pro Stunde produzieren können, in hoch effizienter Weise ausgeprägt ist. Die Befeuchtung der Haut mit Schweiß produziert Verdunstungskälte (Verdunstungswärme von reinem Wasser: ca 2400 kJ/L; Mörike/ Betz/Mergenthaler 1991). Angesichts der enormen Schweißmengen, die ein Mensch unter Hitzestress produzieren kann (10–12 L pro Tag bzw. 500 g/m2/ Stunde; Schmidt et al. 2000, Kormondy u. Brown 1998) ist es unbedingt erforderlich, dem Körper Wasser und Elektrolyte in ausreichender Menge wieder zuzuführen, wobei an heißen Wüstenstandorten der lokale Wassermangel zum physiologischen Problem werden kann. Kulturelle und Verhaltensanpassungen tragen diesem Umstand Rechnung, wie eine ausgeprägte Tageszeitrhythmik in Bezug auf körperliche Aktivitäten (Siesta), das Tragen leichter und lockerer Kleidung (welche zugleich das Risiko des Sonnenbrandes minimiert), der Bau isolierender Behausungen und die Induktion von Evaporation durch ausgeklügelte Kühlsysteme (Moran 2000). Humanökologie 177 An feucht-heißen Standorten nützt der physiologische Mechanismus des Schwitzens nichts mehr, da in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit die Verdunstung des Schweißes nicht mehr erfolgen kann. An diesen Standorten wird die Kleidung minimiert, in Bezug auf die Behausungen ist die Ventilation von allen Seiten notwendig, so dass die Häuser z. B. bevorzugt auf Stelzen errichtet werden (Moran 2000). Ebenso wie bei der Kälteadaptation kommt es bei Hitzestress zur Akklimatisierung, kenntlich z. B. an einem Nachlassen der Schweißsekretion und Zunahme des Plasmavolumens (Schmidt et al. 2000). Nach Roberts (1978) treffen die für warmblütige Tiere aufgestellten Regeln bezüglich der Adaptation von Körperform und -proportion an die unterschiedlichen Klimastandorte der Erde auch auf Menschen zu. Nach der Bergmann’schen Regel sind warmblütige Tiere im kalten Habitat größer. Da Volumen und Masse eines Körpers in drei Dimensionen zunehmen, die Oberfläche dagegen im Quadrat, haben gleichgeformte große Körper ein geringeres Oberflächen/Volumenverhältnis und besitzen somit einen besser gegen Kälte isolierten Körperkern. Die negative Korrelation zwischen mittlerer Jahrestemperatur und Körpervolumen ist daher größer als jene zwischen Temperatur und Körperhöhe. Zusätzlich besagt die Allen’sche Regel, dass warmblütige Tiere in kalten Klimaten kürzere Extremitäten haben als in warmen, wiederum eine Adaptation im Sinne der Reduktion der Körperoberfläche und damit der Wärmeabstrahlung. Tatsächlich zeichnen sich z. B. die Inuit durch einen kompakten, eher gedrungenen Körperbau aus, gegenüber der sehr viel lineareren Statur vieler Populationen des tropischen Afrika. Autochthone Bevölkerungen der Regenwaldbiome sind häufig von geringer Körperhöhe. Angesichts der o.a. biologischen Adaptationen, z. B. des isolierenden Faktors von Unterhautfettgewebe und Muskelmasse, sowie der zahlreichen hochwirksamen kulturellen und Verhaltensadaptationen sind die Klimagradienten in Bezug auf den Körperbau beim Menschen jedoch nicht ganz so klar wie bei Tieren (Walter 1994). Es ist jedoch denkbar, dass in der Vorzeit diese klimabedingten Proportionsunterschiede prononcierter waren als heute, da das Oberflächen/Volumen-Verhältnis ohne Zweifel in bestimmten Klimazonen adaptiv ist (Trinkaus 1981, Holliday 1997). Nach Katzmarzyk u. Leonard (1998) sind diese klimatischen Relationen zur Körperstatur in Rezentbevölkerungen eher schwach ausgeprägt, überwiegend aufgrund der seit einiger Zeit beobachtbaren Größenund Volumenzunahme von Populationen an tropischen Standorten, so dass auch andere Parameter wie eine zunehmend verbesserte Ernährungssituation eine mit den allgemeinen Klimaregeln interferierende Rolle spielen könnten (s. Kap. 4.1.2). Eine weitere Klimaregel die Nasenform betreffend (Thomson’s Regel), welche beinhaltet, dass Menschen in kühlen und vor allem trockenen Klimaten höhere und schmalere Nasen hätten, um die Atemluft anzuwärmen und anzufeuchten, konnte nicht wirklich bestätigt werden (Franciscus u. Long 1991). Selbst die Extremstandorte der Erde sind heute dauerhaft von Menschen der unterschiedlichsten Größen und Proportionen besiedelt. Es bleibt aber die Tatsache, dass bestimmte Mitglieder einer Population ein höheres Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko tragen (vgl. Box 3.6–3.8). 178 Bevölkerungsbiologie Strahlung: Anpassung an hohe und niedrige Intensität von UV-B-Strahlung Die Sonneneinstrahlung, welche die Erde erreicht, wird entsprechend des Wellenlängenspektrums eingeteilt in Infrarotstrahlung (> 750 nm), sichtbares Licht (400–750 nm) und ultraviolettes Licht (UV-Strahlung, < 400 nm), letztgenanntes wiederum in UV-A-(315–400 nm) und UV-B-Strahlung (280–315 nm). Die Intensität der UV-B-Strahlung variiert beträchtlich mit dem Breitengrad sowie saisonal. Sie ist für Menschen u. a. deshalb lebenswichtig, als UV-B-Strahlung von dem Steroid 7-Dehydrocholesterol (7DHC) in den Zellen der Epidermis absorbiert wird und dort eine photochemische Reaktion auslöst, welche essentiell für die Bildung des Vitamin D3 ist (Abb. 3.6). 7DHC wird durch die Ab- Abb. 3.6. Stufen der Vitamin D3-Synthese (vgl. Text) Humanökologie 179 Abb. 3.7. Vitamin D3 fördert die intestinale Calciumresorption und den Einbau von Calcium in das Osteoid (vgl. Kap. 2.3.2), jedoch auch die Freisetzung von Calcium aus dem Knochengewebe. In Bezug auf den Serum-Calciumspiegel steht das Vitamin in Wechselwirkung mit den Hormonen Calcitonin (hemmt die Demineralisierung des Knochens und die Rückresorption von Calcium aus der Niere) und dessen Antagonisten, Parathormon sorption von Photonen zunächst in Provitamin D photokonvertiert, welches seinerseits thermisch (durch die Körpertemperatur) in Vitamin D3 umgewandelt wird. Dieses wird an das Vitamin D-bindende Protein gebunden und aus der Haut über das Blut zunächst in die Leber, dann in die Niere transportiert, wo jeweils eine Hydroxylierung (an Position 25 bzw. 1) erfolgt und somit das Vitamin D3 in seine aktive Form (1,25-Dihydroxycholecalciferol bzw. 1,25-(OH)2D3) überführt wird. Eine Überproduktion von Vitamin D3 findet physiologisch nicht statt,da sowohl die Photokonversion von 7DHC nach Provitamin D3 reversibel ist als auch das Provitamin in Lumisterol und Tachysterol umgewandelt werden kann (Lexikon der Biochemie und Molekularbiologie 1990). Ein Mangel an Vitamin D3 führt zu massiven Erkrankungen des Skelettes (Rachitis im Kindesalter bzw. Osteomalazie im Erwachsenenalter), da das Vitamin eine unverzichtbare Rolle in der Calcium-Regulation durch Induktion des Calcium-bindenden Proteins in den Zellen des Dünndarmes spielt (Abb. 3.7). Vitamin D3-Mangel führt somit zu einem Calcium-Mangel im Skelett, was zu schweren Entwicklungsstörungen und Deformierungen führt. Rachitische Kinder weisen kein normales Wachstum und keine normale Entwicklung des Skelettes auf, Thoraxverengung beeinträchtigt die Atmung, Muskelschmerzen und schwache Gelenke machen es den Kindern unmöglich, sich normal zu bewegen bzw. in schweren Fällen sogar ihr eigenes Gewicht zu tragen. Die Mortalitätsrate rachitischer Kinder ist erhöht. Bei Frauen ist ein rachitisch defor- 180 Bevölkerungsbiologie miertes Becken nicht selten ein Geburtshindernis, was in früheren Zeiten für Mutter und Fetus gleichermaßen von tödlicher Konsequenz sein konnte. Eine Erkrankung an Osteomalazie bedeutet ein hohes Frakturrisiko, weitere Symptome sind Knochenschmerzen, Muskelschwäche und Anorexie. Osteomalazische Frauen bringen Kinder mit niedrigem Vitamin D-Status zur Welt und haben auch einen erniedrigten Vitamingehalt in der Muttermilch, so dass ein Teufelskreis induziert ist (Beall u. Steegmann 2000). Wie jede Strahlung kann auch UV-Strahlung die DNA in den Hautzellen schädigen und Hautkrebs auslösen. Insbesondere induziert ultraviolette Strahlung eine Mutation des p53-Tumorsuppressorgens und senkt die Immunkompetenz durch Schädigung der Langerhans-Zellen in der Epidermis, welche im funktionalen Zustand eine starke Expression von Histokompatibilitäts-Molekülen aufweisen. Beide Effekte führen zur malignen Entartung von Hautzellen (Vermeer u. Hurks 1994, Leffell u. Brash 1996). Diese Problematik gewann nicht zuletzt aufgrund der Reduktion der Ozonschicht in Folge anthropogener Klimaeffekte weltweite Bedeutung (Goudie 1994). Eine stark pigmentiere Haut schützt auch vor der UV-induzierten Photolyse von Folsäure (Jablonski u. Chaplin 2000). In Anpassung an eine Balance zwischen Nutzen und Schädigung der UV-B-Strahlung variiert die Pigmentierung der menschlichen Haut, welche in Abhängigkeit vom Breitengrad bei den autochthonen Populationen der Kontinente eine graduelle Änderung von stark (dunkle Haut) bis schwach (helle Haut) aufweist. Populationen mit der intensivsten Hautpigmentierung leben überwiegend in tropischen Regionen bzw. hochgelegenen Gebieten, also Gegenden höchster UV-Einstrahlung, was zur Formulierung der Gloger’schen Regel führte ( = positive Korrelation zwischen Pigmentierungsgrad und Intensität der Sonneneinstrahlung; Walter 1994). Verantwortlich für die Hautfarbe ist das Chromophor Melanin, welches Sonneneinstrahlung über einen breiten Wellenlängenbereich absorbiert und somit auch mit 7DHC um UV-B-Strahlung konkurriert. In Abhängigkeit von der Melaninkonzentration in der Epidermis dringt ein größerer oder geringerer Anteil der UV-B-Strahlung in die tieferen Hautschichten ein: etwa 29% bei hellhäutigen, aber lediglich 7% bei dunkelhäutigen Personen (Kaidbey et al. 1979). Eine hohe Melaninkonzentration hat daher eine protektive Wirkung gegenüber strahlungsbedingter DNA-Schädigung, setzt aber gleichzeitig die Kapazität zur Vitamin D3-Bildung herab. Mit anderen Worten haben hellhäutige Personen in Regionen geringer UV-Intensität den Selektionsvorteil genügender Vitamin D3-Synthese, in Regionen hoher Strahlungsintensität jedoch das Risiko der Erkrankung an Hautkrebs, wohingegen dunkelhäutige Individuen einen Schutz vor Hautkrebs haben, in Regionen geringer Strahlungsintensität jedoch den Selektionsnachteil durch ein hohes Risiko der Erkrankung an manifestem Vitamin D3-Mangel. Melanin wird durch spezielle Zellorganelle (Melanosomen) in den Melanozyten synthetisiert, welche sich in der Haut im Grenzbereich zwischen Epidermis und Dermis befinden und das Chromophor in benachbarte Keratinozyten abgeben (Rohen u. LütjenDrecoll 2000). Stark pigmentierte Populationen weisen mehr Melanozyten und größere Melanosomen auf als hellhäutige Menschen, so dass in Bezug auf die Pigmentierung eine genetische Adaptation vorliegt (Walter 1994). Humanökologie 181 Die Bräunung heller Haut bei saisonal intensivierter UV-Einstrahlung ist ein Akklimatisationseffekt als adaptive Antwort auf die UV-induzierte DNASchädigung der Hautzellen. Das Signal für eine erhöhte Melaninproduktion besteht in einer Anhäufung von DNA-Fragmenten, insbesondere von Pyrimidin-Dimeren, welche aufgrund des Strahlungsschadens entstanden sind und enzymatisch aus der DNA herausgeschnitten wurden (Eller et al. 1994). Die gesteigerte Melaninproduktion erhöht die Absorption der UV-B-Strahlung und schützt somit vor weiteren Schäden. Setzen sich hellhäutige Personen allerdings zu plötzlich einer intensiveren UV-B-Einstrahlung aus, kommt es zum bekannten Sonnenbrand: die zu große Menge strahlungsgeschädigter DNA initiiert den programmierten Zelltod (Apoptose), und die abgestorbenen Zellschichten werden abgestoßen („Schälen“ der Haut) (Kamb 1994). Eine genetisch bedingte metabolische Besonderheit, und zwar die Fähigkeit, noch im Erwachsenenalter das Milchzucker (Lactose) spaltende Enzym Lactase produzieren zu können, kann als Ko-Adaptation an ein Leben in Regionen geringer UV-Intensität angesehen werden. In Bezug auf den genetischen Polymorphismus der Lactasepersistenz (autosomal dominantes Merkmal, Genlocus auf Chromosom 2) ist ein klarer geographischer Gradient feststellbar: Mehr als 75% der Populationen, welche in nördlichen Regionen jenseits des 50. Breitengrades leben, sind lactasepersistente Phänotypen, jedoch weniger als 25% der Populationen zwischen dem Äquator und dem 30. Breitengrad (Durham 1991). Neugeborene Säugetiere werden zunächst ausschließlich von Muttermilch ernährt, welche Milchzucker enthält, so dass das Enzym Lactase für die Spaltung dieses Disaccharides in die Monosaccharide Glucose und Galactose unerlässlich ist. Auch Menschen produzieren im frühen Kindesalter Lactase, jedoch ist die Enzymproduktion bei der Mehrzahl der Populationen bereits im 5. Lebensjahr um rund 90% gesunken und wird später ganz eingestellt. Dies dürfte der ursprüngliche Zustand sein, denn für die längste Zeit der menschlichen Stammesgeschichte gab es für Erwachsene weder Milch noch Milchprodukte als Nahrungsmittel – hierzu bedurfte es der Haltung und Domestikation von Nutztieren, die gemolken werden konnten. Fehlt die Lactase, kommt es im Intestinaltrakt zur Milchzuckerspaltung durch Darmbakterien, begleitet von der Produktion organischer Säuren und H2. Symptome der Lactoseintoleranz sind Bauchschmerzen, Blähungen und Diarrhoe durch die Gasbildung, vermehrtes Einströmen von Wasser in den Darm und vermehrte Darmbewegungen. Das Phänomen der Lactosetoleranz im Erwachsenenalter ist demnach stammesgeschichtlich wahrscheinlich sehr jungen Ursprunges, jedoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine diesbezügliche Präadaptation im Zuge der Neolithisierung einen Selektionsvorteil erbrachte. Die Häufung lactosetoleranter Individuen in hellhäutigen Bevölkerungen der nördlichen Breitengrade könnte in einem Selektionsvorteil gegenüber saisonalem Calcium-Mangel in den strahlungsarmen Wintermonaten liegen, da lactosetolerante Phänotypen eine allgemein verbesserte Calcium-Absorption, vorzugsweise jedoch bei Präsenz von Milchzucker aufweisen und somit einem drohenden Calcium-Mangel entgehen können (Stinson 1992, Johansen Mange u. Mange 1998, Beall u. Steegmann 2000). Nicht mit der regionalen UV-B-Intensität ist jedoch das Vorkommen von Lactosetoleranz bei ei- 182 Bevölkerungsbiologie nigen äquatorialafrikanischen Populationen, sowie die geringe Frequenz dieses Merkmals bei den Inuit zu erklären. Im ersten Fall handelt es sich zumeist um Populationen, welche eine lange Tradition als Hirten aufweisen und bei denen die Milch der Nutztiere eine wichtige Nahrungsgrundlage darstellt, so dass auch hier eine junge Adaptation vorliegt. Bei den Inuit dürfte wiederum ihr spezielles Ernährungsverhalten für die geringe Verbreitung der Lactasepersistenz verantwortlich sein, da die Nahrung sehr viel Vitamin D-haltigen Seefisch enthält, welcher die geringe endogene Vitaminproduktion aufgrund der niedrigen UV-Einstrahlung balancieren kann (Beall u. Steegmann 2000) Höhenlagen: Anpassung an erniedrigten pO2 Die Besiedelung von Hochgebirgslagen stellt Menschen vor eine Reihe ökologischer Herausforderungen, wie geringe Primärproduktion („Hochgebirgswüsten“), nächtliche Kälte und hohe UV-B-Einstrahlung, vor allem aber vor das Problem des erniedrigten Sauerstoffpartialdruckes (pO2) (Box 3.9). Dieser wird ab Höhenlagen von 2500 m über dem Meeresspiegel relevant, da sämtliche Vitalvorgänge an die Verfügbarkeit von ausreichendem Sauerstoff gebunden sind, für den der Körper jedoch keinen wirklichen Speicher hat. Der geringere Atmosphärendruck in diesen Höhen bewirkt eine geringere Dichte von O2-Molekülen pro Volumeneinheit in der Luft, entsprechend wird dem Organismus auch weniger Sauerstoff pro Atemzug zugeführt. Dieser Mangel an absolut vorhandenem und physiologisch verfügbarem Sauerstoffgehalt bewirkt die hypobare Hypoxie, einen schwerwiegenden ökologischen Stressfaktor, dessen Ausmaß über den Prozentsatz von sauerstoffgesättigtem arteriellen Hämoglobin quantifiziert wird. In den heutigen Zeiten, in denen Touristen mittels Seilbahnen und Gondeln innerhalb kürzester Zeit von Meeresspiegelhöhe bis auf hohe Berggipfel transportiert und damit akut der hypobaren Hypoxie ausgesetzt werden, ist das Phänomen der akuten Höhenkrankheit zu Recht gefürchtet. Zu den Symptomen zählen Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Orientierungslosigkeit und Schwäche, Atemnot sowie Erbrechen und Krämpfe als Folge einer respiratorischen Alkalose (s. unten), welche sich aber in der Regel innerhalb weniger Tage abschwächen. Normale physiologische Werte und Wohlbefinden stellen sich jedoch erst bei Verlassen der Höhenlagen wieder ein. Von 3600 Höhenmetern an entwickeln etwa 1–2% der Individuen schwere Symptome mit Lungen- und/oder Hirnödemen und können nur durch den Abtransport in die Tallagen gerettet werden. Selbst prinzipiell an die Hypoxie adaptierte Menschen können noch an der chronischen Höhenkrankheit erkranken, welche sich in Kopfschmerzen, Atemnot, Knochenschmerzen, Müdigkeit, Schlaflosigkeit und Verwirrtheit äußert. Die durch den niedrigen pO2 ausgelösten Symptome sind somit vielfältig und oft genug auch fatal – dennoch leben menschliche Bevölkerungen seit Tausenden von Jahren permanent in Höhen über 2500 m, wie die Quechua und Aymara in den Anden oder die Einwohner Tibets (Beall u. Steegmann 2000, Moran 2000). Die einzige Verhaltensadaptation, welche in solchen Umwelten wirklich greift, ist eine Reduktion der körperlichen Aktivität. Das habituelle Kauen von Coca-Blättern bei den südamerikanischen Hochlandbevölkerungen soll eine Humanökologie 183 Box 3.9 Adaptation an Höhenlagen Standorte: Hochgebirge (niedriger pO2, nächtliche Kälte, geringe Primärproduktion) Biologische Anpassung: Kulturelle und Verhaltensanpassung: schnelle Ventilation, Polyzytämie, erhöhte Vaskularisation, vergrößertes Lungenvolumen, vergrößertes Residual-Volumen niedriges Aktivitätsniveau, Meiden großer Höhenlagen Demographische Effekte: Kosten: niedrige Geburtenrate, langsames Wachstum und Reifung, hohes Risiko für Kinder und Individuen mit Lungenerkrankungen keine weiteren Kosten verändert nach Kormondy u. Brown (1998) sofortige Steigerung des Blut-Glucose-Spiegels zur Folge haben, möglicherweise durch Stimulation der Glycogenspeicher (Bolton 1973, Baker u. Little 1976). Biologische Anpassungen zielen auf eine verbesserte Sauerstoffausnutzung: Stimuliert durch Chemorezeptoren in der Aorta und Karotis kommt es zu einer Erhöhung der Ventilationsrate und zu tieferen Atemzügen. In der Folge wird jedoch auch mehr CO2 exhaliert mit der Folge einer respiratorischen Alkalose, welche durch eine erhöhte Exkretionsrate von Bicarbonat durch die Nieren balanciert wird. Durch Dilatation der Lungenkapillaren und Aktivierung von Lungenalveoli wird eine größere Kontaktfläche für den Sauerstoffaustausch zwischen der Lunge und dem Blut geschaffen, auch die Kapillarität in den Zielorganen wird vergrößert. Ein vergrößertes Lungenvolumen stellt vermutlich eine genetische Anpassung bei den Quechua Indianern dar, findet sich aber z. B. nicht bei den Tibetern (Kormondy u. Brown 1998). Aufgrund der Sekretion von Erythropoietin werden mehr rote Blutkörperchen gebildet mit der Folge einer Polyzytämie (Albrecht u. Littell 1972). In den Zielzellen erhöht sich die Aktivität jener Enzyme, welche in den oxidativen Stoffwechsel involviert sind, der Herzmuskel zeichnet sich durch einen effizienteren Glucose-Stoffwechsel aus (Holden et al. 1995), wodurch die Energie für die erforderliche Mehrleistung des Herzens bereitgestellt wird. Neben der genannten vergrößerten Lungenkapazität südamerikanischer Indianer im Vergleich zu sympatrischen Tieflandbewohnern sind nur noch wenige Adaptationen bekannt, welche genetischer Natur sein dürften. Die Mehrzahl der oben angeführten Anpassungsmechanismen wirkt im Zuge der 184 Bevölkerungsbiologie Akklimatisation, wobei jedoch eine starke ontogenetische Komponente erkennbar wird: Die biologische Höhenanpassung ist umso effizienter, je jünger ein Individuum zum Zeitpunkt des Aufsuchens dieser Höhenlagen ist und je länger es dort lebt (Moran 2000). Bei den wenigen genetischen oder vermutet genetischen Adaptationen existieren zum Teil deutliche Unterschiede zwischen den Hochlandbevölkerungen Südamerikas, Tibets oder auch Äthiopiens, z. B. in Bezug auf einige Aspekte des Sauerstofftransportes, des Lungenvolumens oder der Ventilationsrate. Vermutlich genetisch bedingt ist der höhere Bohr-Effekt bei den südamerikanischen Hochlandbewohnern (= die Abhängigkeit der O2-Aufnahme- bzw. -Abgabekapazität des Blutes vom pCO2 und dem pH-Wert), welcher eine wesentliche Rolle bei der O2-Abgabe in die Zielzellen spielt (Walter 1994). Beall et al. (1994) konnten ein autosomal dominantes Allel feststellen, welches für die Sauerstoffsättigung des arteriellen Hämoglobins bei Tibetern verantwortlich ist und in den Populationen mit einer Frequenz von 0,56 vorkommt. Durch diese vielfältigen Anpassungsmechanismen wird die hypobare Hypoxie jedoch nicht vollständig kompensiert. Die dauerhafte relative Unterversorgung des Organismus, seiner Organe und Zellen äußert sich in einer relativen Kleinwüchsigkeit der Hochlandbewohner, einem verminderten Geburtsgewicht der Neugeborenen mit zunehmender Höhenlage (Moore u. Regensteiner 1983, Moran 2000) und begleitender erhöhten Neugeborenensterblichkeit, sowie einer verminderten Fertilität. Erniedrigter pO2 wirkt damit limitierend auf das Bevölkerungswachstum, was angesichts der marginalen Standorte allerdings wiederum als adaptiv aufgefasst werden kann. 3.2.3 Anpassung an biologische Umweltparameter Infektionskrankheiten Die Abundanz von Pathogenen an den Standorten menschlicher Bevölkerungen zählt zu den sehr effizienten Umweltstressoren, da Infektionen zu einer dauerhaften Beeinträchtigung des erkrankten Individuums oder sogar zu seinem Tod führen können und im Falle von Epidemien in hohem Maße bevölkerungswirksam sind. Noch heute sind weltweit Infektionserkrankungen verantwortlich für fast die Hälfte (48%) aller Sterbefälle von Erwachsenen unter 45 Jahren (Kapp 1999). Infektionskrankheiten können durch Viren (z. B. Influenza: RNA-Viren der Familie Orthomyxoviridae; AIDS: HIV = human immunodeficiency virus; Masern: Morbilli-Virus; Pocken: Variola-Virus), Bakterien (z. B. Pest: Yersinia pestis; Tuberkulose: Mycobacterium tuberculosis; Lepra: Mycobacterium leprae), Einzeller (z. B. Amöbenruhr: Entamoeba histolytica; Toxoplasmose: Toxoplasma gondii; Malaria: Plasmodium falciparum) und Helminthen (z. B. Bilharziose: Schistosoma haematobium; Spulwurm: Ascaris lumbricoides; Rinderbandwurm: Taenia saginata) ausgelöst werden. Die Infektionswege sind vielfältig und vom Erreger abhängig (Inhalation, Tröpfcheninfektion, verunreinigte Nahrungsmittel oder indirekt durch Vektoren wie z. B. Stechmücken oder Zecken) (Frauendorf 2001). Bei langfristiger Ko- Humanökologie 185 existenz von Menschen und Pathogenen kommt es zu genetischen Anpassungen: So wird z. B. das hohe Alter der HLA-Polymorphismen mit Koevolution erklärt, in populationsgenetischer Hinsicht sind unterschiedliche Allelfrequenzen beobachtbar (vgl. den Heterozygoten-Vorteil bei Malaria, Kap. 3.1). Zu den eher allgemeinbiologischen Anpassungen zählen Enzyme wie die bakteriolytischen Lysozyme, welche in Körperflüssigkeiten wie Speichel oder Tränenflüssigkeit vorkommen (Jackson 2000). Von herausragender Rolle, vor allem in prä-antibiotischen Zeiten, sind wiederum kulturelle und Verhaltensanpassungen, welche im Kontext hygienischer Maßnahmen und Kontaktvermeidung stehen. In Kriegszeiten oder nach Naturkatastrophen sind diese jedoch oft nicht einzuhalten, weshalb es in solchen Krisensituationen häufig zu den gefürchteten Seuchenausbrüchen kommt. Das Infektionsgeschehen in menschlichen Bevölkerungen war und ist in Raum und Zeit sehr variabel, wobei die Bevölkerungsdichte einen wesentlichen Faktor darstellt. Eingeweideparasiten haben sicherlich seit jeher auch in den kleinen Wildbeuterpopulationen eine wichtige Rolle gespielt. Infektionskrankheiten mit einer langen Inkubationszeit haben einen Selektionsvorteil in eher dünn besiedelten Gebieten (z. B. Lepra), wohingegen Erkrankungen mit kurzer Inkubationszeit einen Selektionsvorteil in Ballungsgebieten haben (Tuberkulose). Erkrankungen wie Pocken, Röteln, Masern, Ruhr und Typhus benötigen eine Wirtspopulation von mehreren Hunderttausend Individuen (Dobson 1992, Winkle 1997). Erreger mit hoher Virulenz lösen bei Erstkontakt mit nicht-immunisierten Populationen Epidemien mit hoher Sterblichkeit aus („virgin soil syndrome“) und dürften z. B. bei der Verdrängung und Eroberung der autochthonen Population Amerikas durch die Konquistadoren eine Schlüsselrolle gespielt haben (Crosby 1986). Seit der Schaffung ortsfester Siedlungen in Zuge der Neolithisierung kam der Mensch zunehmend in engen Kontakt mit Kulturfolgern und seinen eigenen Haus- und Nutztieren, was Zoonosen (= Krankheiten, welche zwischen Wirbeltier und Mensch übertragen werden) Tür und Tor öffnete. Bekannte Beispiele sind die Tollwut, Hundebzw. Fuchsbandwurm oder Nagetierpopulationen als Reservoir für Yersinia pestis bzw. Geflügel als Reservoir für Influenza-Epidemien. Während in den Industrienationen die ehemals „klassischen“ Zoonosen wie Rindertuberkulose, Tollwut, Milzbrand, Brucellose und Leptospirose kaum noch eine gesundheitliche Bedrohung für weite Bevölkerungsteile darstellen, sind andere auf dem Vormarsch (Borreliose) oder sogar weitgehend anthropogen (BSE = Bovine Spongiforme Encephalopathie). Nach wie vor größte Sorgfalt wird der Lebensmittelhygiene gewidmet, da die Infektion mit Salmonellen, Trichinen und Campylobakterien zumeist durch tierische Lebensmittel erfolgt. Die Mehrzahl der gefürchteten Epidemien sind viraler Natur, deren Ursache in einer Zoonose zu suchen ist. Die „Spanische Grippe“, welche in den Jahren 1917 bis 1919 weltweit 20 Mio. Menschen tötete, gehörte zum Influenza-Stamm H1N1, dessen Reservoir das Hausschwein war. Im Dezember 1998 kam es in der Demokratischen Republik Kongo zum Ausbruch der Marburger Krankheit, das Virus stammte primär von Fledermäusen. Bei der Enzephalitis-Epidemie in Malaysia 1999, hervorgerufen durch das Hendra-Virus, waren alle Opfer in der Schweineaufzucht tätig. Bis heute treten auch gänzlich neue Epi- 186 Bevölkerungsbiologie demien auf, z. B. eine auf dem Hantavirus beruhende Lungenerkrankung (HPS = Hantavirus pulmonary syndrome), welche erst vor kurzer Zeit im Südwesten der USA registriert wurde. Durch weltweiten Handel und Fernreisen werden Infektionserkrankungen in Regionen transportiert, in welchen sie vorher unbekannt waren. Die Legionärskrankheit (Legionellose, hervorgerufen durch das Bakterium Legionella pneumophila) ist gerade in unserer heutigen technisierten Welt gefürchtet, da die Bakterien in warmem Wasser sehr gut gedeihen und sich daher in der Warmwasserversorgung von Gebäuden und Schwimmbädern, aber auch in Luftbefeuchtern gut vermehren können (Scott u. Duncan 2001). Ernährung Im Kontext der Umweltadaptation spielt die Ernährung eine zweifache Rolle: zum einen ist Nahrungsmangel für sich allein genommen ein unabhängiger Umweltstressor, zum anderen kann er andere Stressoren modifizieren (Infektionsrisiko, Schwere einer Erkrankung; Stinson 1992). Bereits auf einer recht frühen Stufe in der Stammesgeschichte (vgl. Kap. 2.2) wurden Menschen omnivor, wobei sie sich weltweit als ausgesprochene Nahrungsgeneralisten und auch -opportunisten auszeichnen. In Abhängigkeit vom physiologischen Status, der physischen Arbeitsbelastung und den Umweltgegebenheiten sind die individuellen und populationsspezifischen Bedürfnisse durchaus voneinander verschieden. Zu diesem Aspekt existiert eine Fülle von Literatur zur Ernährungslehre (z. B. Senser u. Scherz 1991, Biesalski u. Grimm 2001), auf die an dieser Stelle deshalb nicht näher eingegangen werden soll. Selbst an extremen Standorten wie zum Beispiel der pflanzenarmen Tundra oder in arktischen Regionen, denen eine Pflanzendecke fehlt, konnten sich Nahrungsspezialisierungen entwickeln, welche dennoch für eine adäquate Ernährung sorgten, wie zum Beispiel bei den bereits mehrfach erwähnten Inuit Nordalaskas (Moran 2000). Fehlernährungen bei den Inuit sind heute Folge der Einführung einer westlichen Ernährungsweise (Draper 1977). Die außerordentliche Flexibilität im menschlichen Ernährungsverhalten erlaubte somit auch die langfristige Besiedlung von Extremstandorten. Jede Form der Fehlernährung kann dagegen als Maß bzw. als Anzeichen dafür gelten, dass sich eine Population nicht erfolgreich an ihren naturräumlichen Standort adaptiert hat, bzw. – angesichts der Fehlernährungen in den heutigen Überflussgesellschaften – psychosozialen Stressfaktoren ausgesetzt ist. Über die bei weitem längste Geschichte der Menschheit war jedoch nicht Überfluss, sondern Mangel ein potentielles Problem. Die heutigen zahlreichen Hungerkatastrophen sind Folge von Überbevölkerung (s. unten) bzw. anthropogener Umweltzerstörung (vgl. Kap. 3.2.4). Bei Proteinmangel ist eine Anpassung an mäßige oder vorübergehende Mangelsituationen biologisch möglich, vor allem durch Sekretion von Serumproteinen (Albumin) in den Intestinaltrakt, wo diese verstoffwechselt werden. Gleichzeitig erhöht die Albuminabgabe in den Intestinaltrakt die Effizienz der Aminosäureresorption aus der Nahrung. Bei schwerem oder langandauerndem Proteinmangel kommt es jedoch zum Abbau der Skelettmuskulatur, nachfolgend zur Verstoffwechselung von Proteinen, welche für die Immunabwehr unerlässlich sind. Proteinmangel Humanökologie 187 während der Schwangerschaft resultiert in einem geringen Geburtsgewicht des Neugeborenen mit begleitend erhöhtem Mortalitätsrisiko, Proteinmangel im Kindesalter verlangsamt Wachstum und Reife. Derart schwerer Proteinmangel führt zum Krankheitsbild des Kwashiorkor, zu dessen Symptomen Muskelatrophie, Wachstumsretardation, Ödeme, Hautausschlag und in einigen Fällen auch Depigmentierung zählen. Die charakteristisch vorstehenden Bäuche sind eine Folge des geringen abdominalen Muskeltonus. Herrscht nicht nur Protein-, sondern auch Protein-Kalorie-Mangel, leidet das betroffene Individuum an totaler Unterernährung. Es kommt zunächst durch den Abbau von Körperfett zum Gewichtsverlust, dann zum Verlust körpereigener Proteine. Die Körpertemperatur sinkt, die Stoffwechselrate wird reduziert. Im Zuge des Hungerstoffwechsels werden Ketonkörper produziert, welche das Gehirn ersatzweise anstelle der Glucose als Energieträger nutzen kann, jedoch wird der Bedarf hierdurch nicht vollständig gedeckt. Gluconeogenese aus Aminosäuren ist erforderlich, welche wiederum den Verlust von körpereigenem Protein beschleunigt. Symptome der als Marasmus bezeichneten totalen Unterernährung im Kindesalter sind neben dem genannten Gewichtsverlust Muskelschwund,Immundefizienz,Apathie und Inaktivität. Erbrechen und Durchfälle führen zur Dehydrierung. Aus heutiger Sicht sind Kwashiorkor und Marasmus mögliche Manifestationen ein und derselben Krankheit durch graduelle Übergänge von Protein- zum Protein-Kalorie-Mangel (Gopalan 1992). Selbst in solch fatalen Situationen kann es noch als adaptiv angesehen werden, in welcher Weise der Organismus sich gewissermaßen „aus sich selbst heraus“ ernährt: Das am wenigsten kritische Material (Fett) wird zunächst verstoffwechselt, dann die Muskulatur. Das Zentralnervensystem und das Reproduktionssystem, beide vital für die Aufnahme von Lebensprozessen bei Überwinden des Mangelzustandes, sind ganz zuletzt involviert (Kormondy u. Brown 1998). Fehl- bzw. Mangelernährung betrifft letztlich sämtliche Aspekte der Mensch/Umwelt-Beziehung, insbesondere aufgrund des Synergismus zwischen Mangelernährung und Infektion infolge des durch die Fehlernährung dysfunktionalen Immunsystems. Da Infektionen wiederum zu Mangelernährungen führen können, etwa durch Blutverlust oder durch Störung der Verdauung durch Pathogene (s. oben), wird sehr leicht ein Teufelskreis initiiert. Die Beeinträchtigungen spielen sich nicht nur auf individueller Ebene ab, sondern können die gesamte physische Kapazität einer Population betreffen, z. B. durch erniedrigte Produktivität im Sinne von Arbeitsleistung als Folge der Reduktion von Muskelmasse sowie der Beeinträchtigung der Kapazität des kardiovaskulären und respiratorischen Systems. Sämtliche Single-Stressor-Modelle (vgl. Kap. 3.2.2) haben somit in Bezug auf ihren Erklärungswert durchaus enge Grenzen. Heute leiden weltweit mehr als 500 Mio. Kinder an Protein-Kalorie-Mangel, 6 Mio. Einwohner der asiatischen Länder leiden unter Nachtblindheit aufgrund von Vitamin A-Mangel, Millionen Menschen sind nicht ausreichend mit Spurenelementen wie Eisen und Jod versorgt (Mascie-Taylor 1991). Genetisch bedingte Ernährungsadaptationen sind stets im Wechselspiel der Interaktion zwischen Genen und der Umwelt zu sehen. Ein prägnantes Beispiel ist die im Kapitel 3.2.2 genannte Lactosetoleranz, welche sich vermutlich in Koevolution mit geringer UV-B-Strahlung, Vitamin D3-Mangel und be- 188 Bevölkerungsbiologie stimmten Ernährungsweisen herausgebildet hat. In den westlichen Industrienationen nehmen chronische Erkrankungen zu, aber offensichtlich nicht allein aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung. Das Auftreten von Herz/ Kreislauferkrankungen und Krebs auch bei jungen Menschen spricht eher für ein psychosoziales Phänomen (Kormondy u. Brown 1998). Eine mit der Ernährung in Zusammenhang stehende Erkrankung, welche hauptsächlich in industrialisierten, hingegen kaum in traditionalen Bevölkerungen auftritt, allerdings nach deren „Modernisierung“ recht häufig sein kann, ist der nicht-insulinabhängige Diabetes mellitus (non-insulin dependent diabetes mellitus, NIDDM). NIDDM unterscheidet sich von der im Jugendalter einsetzenden insulinabhängigen Diabetes dadurch, dass nicht das Versagen der Betazellen der Bauchspeicheldrüsen zur Insulinproduktion verantwortlich ist, sondern dass die Körpergewebe insgesamt eine geringere Sensibilität gegenüber Insulin besitzen. Dass die allgemeinen Lebensgewohnheiten eine wichtige Rolle in der Ätiologie dieser Erkrankung spielen sollten, belegt deren Häufigkeit in übergewichtigen Menschen, welche charakteristischerweise älter als 40 Jahre sind. Durch die Übergewichtigkeit wird die Anzahl von Insulinrezeptoren der Zielzellen reduziert (Leonard 2000). Für die Genese der NIDDM wurde die Hypothese des „thrifty genotype“ formuliert: Populationen,deren Lebensraum durch regelmäßige, etwa saisonale Zyklen von Nahrungsmangel und reicher Ernte gekennzeichnet waren, mussten in der Lage sein, während der guten Zeiten effiziente Fettdepots anzulegen, von denen sie in den Mangelmonaten zehren konnten. Wenn solche Populationen aufgrund der Industrialisierung nunmehr durchgängig in guten Zeiten oder gar in Zeiten des Überflusses leben, entwickelt sich zwangsläufig Übergewicht mit Fettleibigkeit (Adipositas) und damit das Risiko für die Erkrankung an NIDDM (Neel 1982). Die metabolische Ursache wird in einer selektiven Insulinresistenz der Zielgewebe gesehen, woraus eine kompensatorische Hyperinsulinämie und Überstimulierung solcher Stoffwechselprozesse resultieren, welche von der Insulinresistenz nicht oder weniger betroffen sind, wie z. B. das Anlegen von Fettdepots. Physische Inaktivität, gekoppelt mit einer „westlichen“ Ernährung (hochenergetisch, reich an gesättigten Fettsäuren, arm an Ballaststoffen) fördert die Insulinresistenz (O’Dea 1995). Hales und Barker (1992) sowie Phillips et al.(1994) sehen in einer Mangelernährung in utero bzw. im frühen Kindesalter einen weiteren Risikofaktor für die Erkrankung an NIDDM durch ontogenetischen Erwerb der Insulinresistenz als Folge des frühkindlichen Nahrungsstresses. 3.2.4 Eingriffe von Menschen in die naturräumliche Umwelt Als einzige Spezies haben Menschen in einem Ausmaß gestalterisch in ihre naturräumliche Umwelt eingegriffen, dass weltweit eine Vielzahl anthropogener Ökosysteme entstanden ist. Die Mensch/Umweltbeziehungen lassen sich nach Boyden (1993) prinzipiell in vier zeitlich aufeinanderfolgende Stadien einordnen, wobei menschliche Bevölkerungen auf jeder dieser Stufen bereits einen spürbaren Einfluss auf die naturräumlichen Standorte ausübten. Auf der Stufe des Wildbeutertums spielte das Feuer eine gewichtige Rolle; durch Brandro- Humanökologie 189 dungen wurden Wälder in Savannenlandschaften transformiert. Mit dem Übergang zur produzierenden Lebensweise vom Neolithikum an begann die geographische Umverteilung von Pflanzen und Tieren, regional kam es bereits zur Bodenexhaustion. Im Zuge der Urbanisierung wurden gänzlich neue, anthropogene Systeme geschaffen, welche von den Ressourcen des Umlandes abhängig waren. Ökologisch spielen Städte somit die Rolle eines Konsumenten, welcher im wesentlichen Wärme und Müll produziert und diese wieder an das Umland abgibt. Seit der Industrialisierung hat der menschliche Einfluss auf die Umwelt globale Dimensionen, wobei die Effekte zunächst sehr subtil sein konnten und sich erst dann offenbarten, wenn ein manifester Schaden bereits eingetreten war (Boyle u. Boyle 1994). Manche Auswirkungen auf die unmittelbare Umwelt sind leicht und offenkundig auf ihre Ursache zurückzuführen, etwa ein gesunkener pH-Wert von Seen infolge saurer Präzipitation mit nachfolgendem Rückgang der Fischpopulationen. Die Akkumulation von Insektiziden wie z. B. DDT in der Nahrungskette mit Bedrohung der Raubvogelpopulationen ist dagegen ein Beispiel für Spätfolgen von anfänglich eher geringen Dosen des ausgebrachten, allerdings langfristig persistierenden Giftes. Das Verbrennen fossiler Energiequellen und das Einbringen anderer klimawirksamer Spurengase in die Atmosphäre ist vielleicht das eindringlichste Beispiel von anfänglich subtilen Ursache/Wirkungs-Gefügen, deren Langzeitfolgen erst sehr spät wahrgenommen wurden und damit ein umso rascheres Handeln auf globaler Ebene erfordern (Russel 1993). Nach Isermann (1993) sind heute natürliche Quellen wie Sümpfe, Moore, Seen, Tundren und Ozeane verantwortlich für ein Drittel der jährlichen globalen Methanemission, landwirtschaftliche Aktivitäten dagegen für rund die Hälfte, überwiegend durch Wasserreis-Feldbau und Wiederkäuer. Offensichtlich ist es Menschen immer wieder gelungen, durch Innovationen die naturgegebene Tragekapazität des Lebensraumes zu erweitern und auch marginale Standorte dauerhaft zu besiedeln, was ursächlich für die beständige Bevölkerungszunahme und heutige Situation der Überbevölkerung ist. Eingriffe in die Natur wie z. B. das Aufstauen und Begradigen von Flüssen, Trockenlegen von Sümpfen oder Bewässern arider Areale können kurz- oder mittelfristig neue Anbauflächen schaffen und das Transportwesen verbessern. Derartige künstliche Systeme bedürfen aber der ständigen Pflege durch den Menschen und verursachen damit auch langfristig hohe Kosten. Eine Monokultur wie ein Getreidefeld muss von Wildkräutern freigehalten werden, zudem bedarf sie der beständigen Zufuhr von Nährstoffen durch Düngung, da man nur aus einem solchen künstlich im Unreifezustand gehaltenen System Biomasse entnehmen (ernten) kann. Ebenso müssen bei größeren Maßnahmen die langfristigen Konsequenzen bedacht und eine sorgfältige Kosten/Nutzen-Bilanz erstellt werden, da die wirtschaftlichen Vorteile niemals frei von Nachteilen sind, welche sich längerfristig gravierend auswirken können (Box 3.10). Häufig wird die Ansicht vertreten, dass Überbevölkerung und die globalen Umweltprobleme der heutigen Zeit jungen Datums sind und erst aus der Zeit der Industrialisierung datieren, also erst seit Mitte des 18. Jahrhunderts. Die nach dem zweiten Weltkrieg einsetzende Wachstumsphase, auch als 1950erJahre-Syndrom (Pfister 1995) bezeichnet, ist durch eine jährliche Wachstums- 190 Bevölkerungsbiologie Box 3.10 Vor- und Nachteile von Eingriffen in die Natur am Beispiel des Assuanstaudammes Vorteile Nachteile – Wasserführung des Nils konstanter – Verlust von 500 000 ha Land durch (geringere Hochwasserspitzen) den Stausee – ganzjährige Schifffahrt möglich – Rückhalt des Nilschlammes im Stausee (Verlandung), dadurch – Bewässerung von 486 000 ha Neuland – Etablierung einer Fischereiwirtschaft – Düngung flussabwärts gelegener Felder erforderlich, Nährstoffmangel im (mehrere Tausend Arbeitsplätze) Mittelmeer – neue Elektrizitätswerke – Pflegeaufwand für das Kanalsystem zur Bewässerung – stehendes Wasser des Stausees führt zur Versalzung, Versumpfung, erhöhter Infektionsrate an Bilharziose nach Nentwig (1995) rate der Weltbevölkerung um 2% gekennzeichnet sowie durch den Einsatz des Erdöles als eines nahezu universellen Energieträgers und durch eine zunehmende Globalisierung. Das nunmehr konsequente Aufbrechen regionaler Stoff- und Energiekreisläufe führte zu einer weltweiten Abhängigkeit. Es ist allgemein bekannt, dass das Welthungerproblem heute nicht Folge einer weltweiten Nahrungsknappheit ist, sondern Folge einer nicht funktionierenden Verteilung. Einschlägige Lehrbücher zur Humanökologie widmen sich daher vornehmlich den Umweltproblemen der Moderne (z. B. Sukopp u. Wittig 1993, Goudie 1994, Campbell 1995, Nentwig 1995): • • • • • • • • • • • • Überbevölkerung und Geburtenkontrolle, Welternährungsproblem, Energieverbrauch und -bereitstellung, Rohstoffvorrat und -verfügbarkeit, Einflüsse auf die Bodenstruktur, Einflüsse auf stehende und fließende Gewässer, Verschmutzung und Ausbeutung der Weltmeere, Umweltverschmutzung durch anorganische, organische und synthetische Stoffe, Klimaveränderungen, Vernichtung von Tier- und Pflanzenarten, Import und Export von Tieren und Pflanzen, somit Floren- und Faunenfälschung, die Entstehung von Städten und Ballungsräumen als anthropogene Ökosysteme. Humanökologie 191 Das Eingehen auf jeden dieser Aspekte, welche eng miteinander verzahnt sind und nicht isoliert voneinander betrachtet werden können, würde ein eigenes Kapitel erfordern, weshalb auf die einschlägige Spezialliteratur verwiesen sei (s. oben). Zahlreiche Umweltprobleme sind jedoch bereits eindeutig historischer Natur und datieren z.T. bis in antike Zeiten, wie z. B. die großräumigen Naturzerstörungen im Mittelmeerraum mit Desertifikation von Nordafrika, Sizilien und Griechenland (Mensching 1983). Die heutigen Wälder Mitteleuropas haben mit „Natur“ in der Regel nichts mehr gemein, sondern sind Neuaufforstungen nach dem gewaltigen mittelalterlichen Raubbau an den Wäldern, zunächst als Nutz- und Wirtschaftswald, heute zunehmend aus Gründen der Naturkonservierung einschließlich der im Wald lebenden Tier- und Pflanzengemeinschaften (Küster 1998). Viele Savannenlandschaften in den tropischen und subtropischen Regionen sind Folge übermäßiger Brandrodung durch einen Bevölkerungsdruck in prähistorischen Zeiten (Boyden 1993), ebenso wie die tiefen Erosionsschluchten (Barrancas) in Mittelamerika Folge von gewaltigen Materialumschichtungen durch menschlichen Feldbau sind und eine mindestens 3000jährige Geschichte haben (Lauer 1981). Die Kenntnis über solche Langzeitfolgen menschlicher Einwirkung auf die Natur verdanken wir den Bemühungen der Historischen Umweltforschung (z. B. Herrmann 1986, Brimblecombe u. Pfister 1990, Crosby 1986, Brüggemeier 2001), welche zu Recht dazu mahnt, vielbenutzte Begriffe wie „Langzeitrisiko“ oder „Nachhaltigkeit“ einer sorgfältigen inhaltlichen Prüfung zu unterziehen. 3.2.5 Die Entwicklung der Weltbevölkerung „Die Erde heißt eine Mutter aller Dinge, nicht weil sie selbige hervorbringt, sondern weil sie das, was sie hervorbringt, erhält und ernähret.“ Dieses Zitat des berühmten Bevölkerungswissenschaftlers des 18. Jahrhunderts, Johann Süssmilch (Zitat nach Birg 1996), zeigt Problembewusstsein und Verantwortung gegenüber der Ressourcennutzung der Weltbevölkerung, während noch im gleichen Jahrhundert Robert Malthus mit seiner These der begrenzten Tragfähigkeit der Erde bei ungebremstem Bevölkerungswachstum die Angst der Wohlhabenden vor Umverteilungen von Ressourcen schürte (vgl. Kap. 3.3.1). Am 12.Oktober 1999 ist die Weltbevölkerung auf über 6 Mrd. Menschen gestiegen, mit weiterhin stark steigender Tendenz (vgl. Box 3.11). Die hohe Wachstumsrate ist ein geschichtlich noch junges Phänomen, das durch Verbesserungen der Lebensbedingungen, insbesondere der hygienischen Bedingungen, der medizinischen Fortschritte und der Entwicklung ertragssteigender landwirtschaftlicher Techniken, ermöglicht worden ist. Bevor das Wachstum sich rasant beschleunigte, lebten noch bis zum Jahr 1804 weniger als eine Milliarde Menschen auf der Erde bei einem bis dahin außerordentlich langsamen Wachstum von weit weniger als einem Promille pro Jahr. Erst mit der Industrialisierung stieg die Wachstumsrate allmählich auf 0,4 bis 0,5% zu Beginn des 19.Jahrhunderts an (Birg 1994b). Es dauerte nur ein weiteres gutes Jahrhundert, bis 1926 die zweite Milliarde hinzukam. 1960 wurde bereits die 3-Milliarden-Grenze über- 192 Bevölkerungsbiologie Box 3.11 Die Weltbevölkerung von 6 Milliarden – Einige wesentliche Fakten Die Weltbevölkerung hat nach statistischen Berechnungen am 12. Oktober 1999 sechs Mrd. Menschen überschritten. n n Die Weltbevölkerung übersteigt 2013 die 7 Mrd., 2028 die 8 Mrd., 2054 die 9 Mrd. Die Weltbevölkerung stabilisiert sich nach 2200 bei etwa 10 Mrd. n Innerhalb von nur 12 Jahren ist die Weltbevölkerung von 5 auf 6 Mrd.Menschen gestiegen.Dies ist der kürzeste Zeitraum des Bevölkerungswachstums in der Geschichte der Menschheit. n Bis 1804 blieb die Weltbevölkerung unter 1 Mrd. Menschen, die Zeiträume, in denen jeweils eine weitere Milliarde hinzukam, verkürzten sich auf 33, 14, 13 und nun 12 Jahre. n Die höchste Rate des Weltbevölkerungswachstums (2,04%) gab es in den 1960er Jahren. Die aktuelle Wachstumsrate (2003) beträgt 1,3%. n Der höchste jährliche Bevölkerungszunahme von 86 Millionen gab es in den späten 1980er Jahren. Momentan wächst die Weltbevölkerung jährlich um 78 Mio. Menschen. n An dieser Bevölkerungszunahme haben die weniger entwickelten Ländern einen Anteil von 95%. n In den weniger entwickelten Ländern leben 80% der Weltbevölkerung. Um 1900 waren dies 70%, Mitte des 21. Jahrhunderts werden dies 90% sein. n Die Weltbevölkerung altert. Das Medianalter stieg von 23,5 Jahren 1950 auf 26,4 Jahre 1999. 2050 wird das Medianalter 37,8 Jahre erreichen. Der Anteil der über 60jährigen steigt von 10% auf 22% in 2050. In den Industrieländern sind dies bereits jetzt 20%, in 2050 in diesen Ländern 33%. n Die durchschnittliche Lebenserwartung der Weltbevölkerung beträgt jetzt 67 Jahre, ein Anstieg um 20 Jahre seit 1950. 2050 wird die Lebenserwartung voraussichtlich 76 Jahre betragen. Einige Länder sind allerdings durch AIDS stark betroffen und weisen deutliche Einbrüche in der Entwicklung der Lebenserwartung auf. n In den Entwicklungsländern haben Frauen im Durchschnitt 3 Kinder, vor 30 Jahren waren es noch 6 Kinder. Über die Hälfte der Frauen in den Entwicklungsländern benutzen Kontrazeptiva. Humanökologie 193 Box 3.11 (Fortsetzung) n Die internationale Migration hat von etwa 75 Mio. 1965 auf über 125 Mio. zugenommen. n Die Welt urbanisiert zunehmend. Etwa 46% der Weltbevölkerung leben in urbanen Gebieten. 2006 werden es mehr als 50% sein. (übersetzt nach United Nations 1999) schritten und knapp 40 Jahre später hatte sich die Weltbevölkerung nochmals verdoppelt (Haub 2002). Mitte 2003 betrug die Weltbevölkerung 6 314 000 000 Menschen (Deutsche Stiftung Weltbevölkerung 2003). In Kap. 3.3.3 wird gezeigt, dass die Veränderungen des Bevölkerungsbestandes vor allem von den Sterblichkeitsverhältnissen und den Geburtenraten abhängt. Die Industrieländer haben den ersten und zweiten demographischen Übergang, geprägt durch einen Sterblichkeitsrückgang mit nachfolgendem Geburtenrückgang, bereits vollzogen und befinden sich in einer posttransformativen Phase, in der das Absinken der Geburtenrate unter die Sterberate einen Bevölkerungsrückgang bewirkt (vgl. Kap. 3.3.4, Abb. 3.3.9). Viele Entwicklungsländer sind zu Beginn des 21. Jahrhunderts jedoch durch den bereits deutlichen Rückgang der Sterblichkeit und damit der Erhöhung der Lebenserwartung bei gleichzeitig noch relativ hohem Fruchtbarkeitsniveau geprägt. Ihre Geburtenzahlen nehmen zwar seit den siebziger und achtziger Jahren ab, bevor sich jedoch auch die Bevölkerungszahlen reduzieren, werden von zahlenmäßig noch stark besetzten Kohorten weiterhin große Kinderzahlen hervorgebracht. In diesem Stadium findet ein besonders starkes Bevölkerungswachstum statt, das sich erst verlangsamt, wenn auch die Geburtenzahlen abnehmen. Erst die dann schwächer besetzte Elterngeneration führt zu wiederum schwächeren Kinderjahrgängen. Diese Entwicklung wird in den nächsten Jahrzehnten greifen und damit eine Verlangsamung des Weltbevölkerungswachstums mit sich ziehen. Aufgrund dieser in groben Zügen absehbaren quantitativen Entwicklung der Weltbevölkerung wird eine Zunahme um weitere 3 Mrd. Menschen auf etwa 9,4 Mrd. Menschen bis etwa 2050 erwartet (United Nations 2000, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 2000). Der Altersaufbau der Weltbevölkerung ist dadurch in den Weltregionen sehr heterogen und setzt sich aus sehr unterschiedlichen Bevölkerungsstrukturen zusammen. Er wird von der Bevölkerungszusammensetzung derjenigen Länder geprägt, die hohe Bevölkerungszahlen aufweisen, wie China und Indien, die 20,4% bzw. 16,9% der gesamten Weltbevölkerung stellen (Deutsche Stiftung Weltbevölkerung 2003). Die Alterszusammensetzung ist inzwischen deutlich durch die weltweite Entwicklung der sinkenden Sterberaten gekennzeichnet. Dies zeigt sich in der Bevölkerungspyramide der Weltbevölkerung, 194 Bevölkerungsbiologie Abb. 3.8. Altersaufbau der Weltbevölkerung 1950, 2000 und 2050 (nach Birg 1996, United Nations 2000) die noch vor einem halben Jahrhundert die Pyramidenform einer jungen Bevölkerung aufwies und sich allmählich bis 2050 zur Glockenform wandelt (vgl. Abb. 3.8). Die Prognosen des Weltbevölkerungswachstums Die grob skizzierten Annahmen des Weltbevölkerungswachstums gelten unter der Annahme bestimmter Entwicklungen der Sterbeverhältnisse und der Geburtenhäufigkeiten. Wenn auch der Prognosezeitraum der nächsten 50 Jahre recht überschaubar erscheint, so resultieren doch aus unterschiedlichen Modellannahmen sehr unterschiedliche Bevölkerungszahlen (vgl. Kap. 3.3.4). Für die Zunahme der Weltbevölkerung um weitere 3 Mrd. Menschen im nächsten halben Jahrhundert ist eine mittlere Variante der Sterblichkeits- und Geburtenentwicklung für die Entwicklungsländer zugrunde gelegt worden. Sie geht davon aus, dass bis zum Jahr 2045 die durchschnittliche Kinderzahl von derzeit etwa 2,8 auf 2,1 Kinder pro Frau absinkt. Dieser prognostizierte Wert entspricht dem Bestandserhaltungsniveaus, der unter Berücksichtigung der Sterblichkeit notwendig ist, um langfristig jeweils die Elterngeneration zu ersetzen (United Nations 2000). Für die Industrieländer wird eine weitere Entwicklung mit konstant anhaltenden niedrigen Kinderzahlen auf dem momentanen Stand von 1,7 Kindern pro Frau (niedrige Variante) und eine mittlere Variante mit einem wieder leichten Anstieg der durchschnittlichen Geburtenzahl auf 1,9 Kinder diskutiert (Schulz 1999). Wie anfällig derartige Prognosen gegenüber leichten Modifikationen der angenommenen Parameter sind und wie unsicher daher Langzeitprognosen der Bevölkerungsentwicklung erscheinen, zeigt sich, wenn die Kinderzahl um 0,5 Kinder pro Frau in den Entwicklungsländern und um 0,4 Kinder pro Frau in den Industrieländern niedriger ausfällt als erwartet (niedrige Variante). Bei identischer Entwicklung der Sterblichkeit resultiert eine Gesamtbevölkerung von unter 8 Mrd. Menschen, etwa 1,5 Mrd. weniger als nach dem mittleren Erwartungsmodell. Humanökologie 195 Abb. 3.9. Geschätzte Entwicklung der Weltbevölkerung unter der Annahme verschiedener Parameter der Geburtenentwicklung (nach Schulz 1999, United Nations 1999) Den größten Zuwachs der Weltbevölkerung auf etwa 13 Mrd. Menschen erhält man unter der Annahme, dass sich die Sterblichkeitsverhältnisse und Geburtenraten des ausgehenden 20. Jahrhunderts bis zum Jahr 2050 nicht ändern (vgl. Abb. 3.9). Eine derartige Persistenz der Parameter ist jedoch wenig plausibel. Ob jedoch die wahrscheinlichere mittlere Variante eintreten kann, ist schwer vorauszusagen. Aber auch wenn die niedrige Variante realisiert werden sollte, wozu nur eine geringe Wahrscheinlichkeit besteht, bedeutet dies auch im optimistischsten Fall einen weiteren Anstieg der Weltbevölkerung in den nächsten Jahrzehnten. Die Probleme des derzeitig starken Anwachsens der Weltbevölkerung sind mit der Tatsache verknüpft, dass die meisten Menschen in weniger entwickelten Ländern leben, in denen sich auch die stärkste Bevölkerungszunahme vollzieht. Dies betrifft praktisch alle Länder außer den Industrieländern Europa, Nordamerika, Japan, Australien und Neuseeland. Wesentliche Probleme des globalen Bevölkerungswachstums liegen in der Ungleichverteilung der Ressourcennutzung begründet. Der Konzentrierung des Reichtums auf wenige Länder mit geringem Anteil der Weltbevölkerung steht die Armut einer großen Menge Menschen in den weniger entwickelten Regionen gegenüber. Damit sind als ursächlich für die vergleichsweise noch geringe Lebenserwartung dieser Länder die mangelhafte Ernährung und die medizini- 196 Bevölkerungsbiologie sche Unterversorgung verknüpft. Deren Änderung kann jedoch erst zu einer nachhaltigen Verbesserung der Lebensbedingungen führen, wenn durchgreifende gesellschaftsstrukturelle und wirtschaftliche Parameter greifen, die unzureichenden Bildungs- und Informationssysteme und die Selbstbestimmung von Frauen verbessert worden sind (Kelley 1996, Montgomery u. Loyd 1996). Die Bevölkerungsentwicklung in den Weltregionen Für die Betrachtung der gesamten Weltbevölkerung spielen Wanderungsprozesse nur eine untergeordnete Rolle, da sich regionale Zu- und Abwanderungen gegenseitig aufheben. Allerdings ist die Dynamik des Bevölkerungswachstums in den Weltregionen sehr heterogen. Durch größere Bevölkerungsbewegungen zwischen strukturell unterschiedlichen Regionen können sich daher die Voraussageparameter ändern, woraus Fehlschätzungen der Bevölkerungsentwicklung resultieren. Aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit sollen hier jedoch die hauptsächlich steuernden Parameter Geburtenentwicklung und Sterblichkeit betrachtet werden. Während die meisten Industrieländer negative Wachstumsraten aufweisen, nehmen die Bevölkerungszahlen auf dem asiatischen und insbesondere dem afrikanischen Kontinent am stärksten zu. Hierbei ist jedoch zwischen absoluter zahlenmäßiger Zunahme und der relativen Wachstumsrate zu unterscheiden, um die Dynamik des Bevölkerungswachstums verstehen zu können; dies ist eine wesentliche Voraussetzung für bevölkerungspolitische Planungen. Der bevölkerungsreichste Kontinent ist Asien. Gemeinsam mit der Bevölkerung Europas setzte in Asien bereits im 18. Jahrhundert eine großräumige Beschleunigung des Bevölkerungswachstums ein, und heute weist Asien den stärksten absoluten Zuwachs auf, während die Bevölkerung Europas bereits abnimmt. In Amerika und Afrika begann erst ab 1950 eine starke Bevölkerungszunahme. Europa hatte auch zu Zeiten seines größten Bevölkerungswachstums zwischen 1800 und 1950 nie die hohen Wachstumsraten, die heute Asien und Afrika aufweisen. Im Jahr 1950 lebten in Europa zweimal so viele Menschen wie in Afrika, zu Beginn des 21. Jahrhunderts überstieg bereits die Bevölkerung Afrikas diejenige Europas (vgl. Tabelle 3.4) und bereits im Jahr 2050 werden mehr als dreimal so viele Menschen in Afrika leben wie in Europa (Bähr et al. 1992, Bähr 2000, Haub 2002). Insbesondere in der wirtschaftlich schwach entwickelten Zone Schwarzafrikas südlich der Sahara werden die weltweit höchsten Wachstumsraten verzeichnet. Damit muss der afrikanische Raum als eine der größten Problemzonen der Bevölkerungsentwicklung betrachtet werden, da die infrastrukturelle Situation der betroffenen Entwicklungsländer einer Versorgung der mit hohen relativen Zuwachsraten zunehmenden Bevölkerung nicht gewachsen ist. Mit den zunehmenden Bevölkerungszahlen in diesen Regionen wird aber auch mit einer politischen Gewichtsverlagerung zu rechnen sein, die sich im Weltmaßstab auswirkt und die dadurch wiederum den internationalen Stellenwert und die innere Struktur der Länder beeinflussen wird (Schmid 2000). Humanökologie 197 Ein wichtiger Indikator der Altersstruktur einer Bevölkerung ist das Medianalter (vgl. Kap. 3.3.3). Es lag für die Weltbevölkerung im Jahr 2000 bei etwa 26 Jahren. Die demographische Alterung der Industrieländer spiegelt sich in ihrem hohen Medianalter von 37,4 Jahren wider, die älteste Bevölkerung lebt in Italien mit einem Medianalter von 41 Jahren. In den am wenigsten entwickelten Ländern dagegen war die Hälfte der Bevölkerung unter 18,2 Jahre alt (vgl. Tabelle 3.4). Hierin zeigt sich wiederum sehr deutlich die zukünftige Problematik der Bevölkerungsentwicklung, wenn man bedenkt, dass in diesen Ländern 50% der Bevölkerung einen Familienbildungsprozess noch vor sich haben und dann entsprechend hohe Kinderzahlen hervorbringen werden. Fertilität als Motor der Bevölkerungsentwicklung Will man versuchen, Kinderzahlen in den Regionen mit hohen Geburtenraten dauerhaft zu senken, bedeutet dies, entsprechende Lebensbedingungen zu schaffen, auf deren Basis die individuelle Entscheidung für eine reduzierte Kinderzahl auch realisierbar ist. Will man die Senkung der Sterbeziffern erreichen, muss die Verbesserung des Gesundheitssystems erreicht werden. Sie unterliegt der direkt-kausalen bevölkerungspolitischen Kontrolle, deren Ergebnis zeitnah zu erkennbaren Verbesserungen führt, die oft auch mit einem wirtschaftlichen Interesse der Pharmaindustrie einhergehen. Um die hohen Kinderzahlen zu senken, bedarf es hingegen einer stärkeren Einflussnahme auf gesellschaftliche Umwälzungen, eine eher indirekte und langfristige Investition, die aber den wichtigsten Schlüssel für die Kontrolle des Bevölkerungswachstums darstellt. Erst wenn ein Selbstbestimmungsrecht für Frauen durchgesetzt worden ist, Aufklärung und Anwendung von Verhütungsmitteln bevölkerungsdeckend erreicht ist, gekoppelt mit Schulbildung für alle Bevölkerungsschichten und damit der drastischen Reduzierung des Analphabetentums, die Säuglingssterblichkeit weiter gesenkt werden kann, die sozioökonomische Situation sowie die Sicherung des Familieneinkommens und der Altersversorgung nicht durch eine hohe Kinderzahl gewährleistet werden muss, um nur einige der wesentlichsten Determinanten der Fertilität zu nennen, wird es gelingen, in den Bevölkerungen der am wenigsten entwickelten Länder mit heute noch hohen Kinderzahlen ein Bewusstsein für die Kontrolle und Reduzierung der Familiengröße zu vermitteln (Bundesministerium des Innern o.J). In vielen Ländern mit hohen Kinderzahlen steht Frauen das Bildungssystem nur begrenzt zur Verfügung, sie heiraten früh, haben wenig Mitspracherecht bei der Familienplanung und ihre gesellschaftliche Rolle definiert sich häufig über die Anzahl ihrer Kinder, insbesondere der Söhne. Wie auch bei der Betrachtung der Sterbeverhältnisse und der Ernährungssituation (s. unten), so hängt die realisierte Fruchtbarkeit einer Bevölkerung von einem komplexen Gefüge an Determinanten ab, in dem die ökonomische Situation eine Schlüsselrolle spielt. Herrscht weiterhin Armut vor, werden die Kinderzahlen nicht in dem erhofften Maße bis zum Niveau der Bestandserhaltung sinken (Ahlburg 1996, Lipton 1999). Dies wird sich erst dann regulieren, wenn aufgrund eines hohen volkswirtschaftlichen Sozialproduktes die ökonomischen und biographischen Op- 861 3830 727 540 323 32 Afrika Asien Europa Lateinamerika und Karibik Nordamerika Ozeanien (Quelle: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung 2003) 711 6314 1202 5112 Welt gesamt Industrieländer Entwicklungsländer Am wenigsten entwickelte Länder Weltregionen Bevölkerung 2003 in Mill. 2,4 1,3 -0,2 1,7 0,5 1,1 1,3 0,1 1,6 2,5 Wachstumsrate 2003 in % Tabelle 3.4. Aktuelle demographische Parameter der Weltbevölkerung 52 67 74 71 77 75 67 76 65 48 5,2 2,6 1,4 2,7 2,0 2,4 2,8 1,5 3,1 5,6 Lebenserwartung Gesamtfruchtbei Geburt barkeitsrate 2003 2003 18,4 26,2 37,7 24,4 35,6 30,9 26,5 46,4 24,3 18,2 Medianalter 2000 in Jahren 3 6 15 6 13 10 7 15 5 3 % älter als 60 Jahre 198 Bevölkerungsbiologie Humanökologie 199 Abb. 3.10. Selbstregulierende Wirkung des ökonomischen Systems auf die Geburtenrate einer Bevölkerung (nach Birg 1994a) portunitätskosten von Kindern derart gestiegen sind, dass die Entscheidung für eine Begrenzung der Kinderzahl im Hinblick auf konkurrierende biographische Entwicklungsmöglichkeiten für den individuellen Lebenslauf planungsrelevant wird (vgl. Kap. 3.3.6, Abb. 3.10). Ist jedoch die wirtschaftliche Lage wie in den am wenigsten entwickelten Ländern extrem schlecht und herrscht extreme Armut vor, so ist dieser selbstregulierende Regelkreis außer Kraft gesetzt und steigendes Elend verursacht weitere Bevölkerungszunahme (Birg 1994a,b). Dies mag verdeutlichen, wie stark die unterschiedliche Bevölkerungsdynamik zu relativen Umverteilungen der Bevölkerung in den Weltregionen zu führen vermag. Entwicklung der Sterblichkeit Die wesentlichen Errungenschaften des medizinisch-hygienischen Fortschrittes lassen sich direkt in der Reduzierung der Sterblichkeit ablesen. Es ist insbesondere das Absinken der Säuglings- und Kindersterblichkeit, das großen Einfluss auf die Erhöhung der durchschnittlichen Lebenserwartung einer Bevölkerung ausübt (vgl. Kap. 3.3.3). Das Überleben von Neugeborenen ist in höherem Maße als bei allen anderen Altersgruppen von den allgemeinen Lebensbedingungen abhängig. Schlechter Ernährungszustand der Mütter, schnelle Geburtenfolge, unzureichende hygienische Bedingungen und medizinische Betreuung der Schwangeren stellen ein großes Sterberisiko nicht nur für den 200 Bevölkerungsbiologie Säugling, sondern auch für die Mütter dar. So ist heute noch in den problematischen am wenigsten entwickelten Ländern Afrikas die Müttersterblichkeit die häufigste aller Todesursachen von Frauen im Alter unter 60 Jahren. In diesen Ländern beträgt die Säuglingssterblichkeit (Sterblichkeit innerhalb des ersten Lebensjahres) noch etwa 10%. Während sie in den Industrieländern heute schon auf den geringen Wert von 0,8% gesunken ist und damit nur noch geringfügige künftige Verbesserungen möglich sein werden, wird in den Entwicklungsländern und den am wenigsten entwickelten Ländern eine deutliche Reduzierung auf unter 3% in den nächsten Jahren erwartet. Die niedrige Lebenserwartung Afrikas von durchschnittlich 51 Jahren (vgl. Tabelle 3.4) ist hauptsächlich auf diese Sterberisiken zurückzuführen. Der zukünftige Sterblichkeitsrückgang und die damit zu erwartende Steigerung der durchschnittlichen Lebenserwartung wird weitestgehend dieser Entwicklung zu verdanken sein. Als wesentliche Todesursachen herrschen in den weniger entwickelten Ländern noch Infektionskrankheiten wie Malaria, Tuberkulose und AIDS vor, die als konkurrierende Sterberisiken des jüngeren Alters die erst in höherem Alter gehäuft auftretenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bösartigen Neubildungen (Karzinome) der hoch entwickelten Industrieländer gar nicht erst aufkommen lassen, da sie bereits eine hohe Sterblichkeit in jüngeren Altersklassen bewirken (vgl. Kap. 3.2.3; 3.2.6). Somit hängt das Todesursachenspektrum eng mit der Alterszusammensetzung einer Bevölkerung zusammen. Wie aus Tabelle 3.4 ersichtlich, ist die durchschnittliche Lebenserwartung in Europa nicht so hoch wie in den Vergleichsregionen Nordamerika oder Ozeanien (Australien, Neuseeland). Dies liegt an der sehr heterogenen Struktur der europäischen Länder, unter denen sich mit Island, Schweden, der Schweiz und Italien Länder befinden, die nach Japan zu den Ländern mit den höchsten Lebenserwartungen zählen, aber auch Länder wie die osteuropäischen strukturell schwachen Reformstaaten, die noch keinen Anschluss an die westeuropäischen Verhältnisse des Gesundheitssystems und der allgemeinen Lebensbedingungen gefunden haben. Die Ursachen und Konsequenzen der demographischen Alterung mit dem steigenden Anteil älterer Altersklassen an der Bevölkerung werden in Kap. 3.3.4 behandelt. Dies führt zu einer Verbreiterung des oberen Teils der Bevölkerungspyramide und trägt neben der Verschmälerung der Basis durch abnehmende Geburtenraten zu ihrer Glockenform bei, wie sie für die Mitte dieses Jahrhunderts prognostiziert wird. Die Verstädterung der Weltbevölkerung Die ersten Städte traten in der Region des „Fruchtbaren Halbmondes“ im Vorderen Orient vor etwa 6000–8000 Jahren auf, nachdem der Prozess des Überganges von der aneignenden zur produzierenden Lebensweise im Neolithikum erfolgreich beschritten war (vgl. Kap. 2.3). Sie unterschieden sich von den auf Ackerbau und Viehzucht basierenden dörflichen Siedlungen (primärer Sektor) durch eine differenzierte Bebauung und einen höheren Anteil an Bevölkerung mit handwerklicher Tätigkeit (heute auch industrieller Tätigkeit, Humanökologie 201 der sekundäre Sektor) sowie Dienstleistungen (der tertiäre Sektor). Diese frühen Städte waren im heutigen Maßstab klein und zählten kaum mehr als 5000 oder 10 000 Einwohner. Heute versteht man unter Verstädterung die Vermehrung, Ausdehnung und Vergrößerung von Städten nach Anzahl, Fläche und Einwohnern, mit Urbanisierung wird die Ausbreitung städtischer Lebensformen beschrieben. Während Städte oft mit einer Einwohnerzahl von mehr als 2000–5000 definiert werden, übersteigen Großstädte 100 000 Einwohner und Megastädte zählen nach der internationalen Definition der United Nations über 8 Mio. Einwohner (Bähr et al. 1992). Erst mit der Industrialisierung setzte im 19. Jahrhundert eine nennenswerte Verstädterung ein, die innerhalb eines Jahrhunderts den städtischen Anteil der Erdbevölkerung von 3% auf 15% um 1900 steigerte. Heute lebt nahezu jeder zweite Mensch in einer Stadt und mit dem weiteren Zuwachs der Weltbevölkerung geht eine zunehmende Konzentration der Bevölkerung in die städtischen Gebiete einher, so dass für 2030 ein Anteil der städtischen Bevölkerung in der Welt von über 60% erwartet wird. Diese Dynamik der Verstädterung übersteigt noch bei weitem diejenige der zahlenmäßigen Bevölkerungszunahme. Die Zunahme der städtischen Bevölkerung erfolgt auf drei unterschiedliche Arten: Zum einen durch den Wandel von ursprünglich ländlichen Siedlungen zu Städten durch Bevölkerungszunahme, zum zweiten durch das natürliche Bevölkerungswachstum aufgrund der sinkenden Sterblichkeit bei hohen Geburtenzahlen der städtischen Bevölkerung und zum dritten durch Wanderungsüberschuss, oft gezielte Zuwanderungsströme aus dem ländlichen Raum in städtische Agglomerationsgebiete (Bähr 2000). Die Zahl der Großstädte mit über 1 Mio. Einwohner nimmt drastisch zu. Insbesondere die strukturell höchst problematischen Megastädte nehmen zu und wachsen rasant weiter. Heute haben bereits 45 Städte über 5 Mio. Einwohnern und es existieren inzwischen 21 Städte, in denen jeweils über 10 Mio. Menschen leben. Vor 40 Jahren waren es lediglich New York und Tokio, die diese Grenze überschritten hatten. Allerdings sind es weniger die großen Zentren in den Industrieländern, in denen die Lebensbedingungen problematisch sind, als vielmehr die planlos und explosionsartig wachsenden Städte in den Entwicklungsländern. Heute leben bereits doppelt so viele Menschen wie in den Industrieländern, nämlich nahezu 2 Mrd., in diesen Bevölkerungsagglomerationen der Entwicklungsländer. Die starken Zuwanderungsströme aus den ländlichen Gebieten, unter denen diese Städte leiden, werden in starkem Maße durch die massiven Umweltzerstörungen verursacht, die langfristig zu nachlassenden landwirtschaftlichen Erträgen führen und der ländlichen Bevölkerung die Lebensgrundlage entziehen (vgl. Kap. 3.2.4). Sie stellen dann die Bewohner der Elendsviertel mit menschenunwürdiger Lebensweise, die „Pauper“. Damit muss die massive Verstädterung der Weltbevölkerung als ein globales Problem ersten Ranges angesehen werden (Khalatbari 2000, Deutsche Stiftung Weltbevölkerung 2001, Meusburger 1997). Letztlich erweist sich auch hier wieder die Armut als ein zentrales Problem: „Der schlimmste Feind der Umwelt ist Armut“ (Indira Gandhi). 202 Bevölkerungsbiologie Die Vergrößerung der bereits existierenden städtischen Bevölkerung geschieht heute unter anderen Vorzeichen als die Verstädterung in der Zeit der Frühindustrialisierung. Während um 1800 die Lebenserwartungen in den englischen Städten der Industriegebiete, Liverpool und Manchester, noch bei etwa 26 Jahren lag, die Geburtenzahlen durch Sterblichkeitsausfälle dadurch niedrig blieben und damit die Bevölkerungszahl begrenzt war, sind heute die Lebenserwartungen selbst in den am wenigsten entwickelten Ländern etwa doppelt so hoch (Bähr et al. 1992). Ernährungsprobleme Betrachtet man die heutige Ernährungssituation der Weltbevölkerung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass etwa ein Drittel der Menschen an Unter- bzw. Mangel- und Fehlernährung leidet (vgl. Kap. 3.2.3), dann ist schwer vorstellbar, worauf angesichts der weiterhin wachsenden Bevölkerungszahlen die Problematik in den wenig entwickelten Ländern hinauslaufen wird. Die weltweit zur Verfügung stehenden Ressourcen indes sind zur Ernährung der Weltbevölkerung ausreichend. So stehen heute den über 6 Mrd. Menschen pro Kopf durchschnittlich 15% mehr Nahrungsmittel zur Verfügung als den 4 Mrd. Menschen in den achtziger Jahren (Schulz 1999). Das größte Problem ist indes die regionale Verteilung der Nahrungsmittel und deren Nutzung beispielsweise als Tierfutter in den Industrieländern, wodurch einem kleinen Anteil an Menschen ein teuer erkauftes breites Nahrungsspektrum auf Kosten der Grundversorgung einer großen Anzahl an Menschen in den Problemregionen zur Verfügung steht. Rechnerisch lässt sich mit den gleichen pflanzlichen Nahrungsressourcen, die ausreichen, um 5,5 Mrd. Menschen zu ernähren, lediglich noch die Hälfte der Menschen ernähren, wenn diese ein Viertel ihres Kalorienbedarfs durch tierische Produkte decken. Auch politische und wirtschaftliche Interessen sowie logistische Probleme stehen einer gleichmäßigen Verteilung von Ressourcen entgegen. Die katastrophale Ernährungssituation in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara hat sich bei steigenden Bevölkerungszahlen derart verstärkt, dass sie pro Kopf 20% weniger Nahrungsmittel verfügbar haben als 1950 (Bohle 2001). Aufgrund der vorherrschenden Armut können die lebensnotwendigen Mittel, dazu gehören auch Brennstoff für die Nahrungszubereitung, nicht beschafft werden. Die resultierende Unterversorgung verstärkt die Anfälligkeit für Infektionskrankheiten und reduziert die Arbeitsfähigkeit, wodurch ein weiteres Absinken in die Armut vorgezeichnet ist und ein Überleben oft nur durch Einsatz aller Familienangehörigen, einschließlich der Kinder, gewährleistet werden kann, deren Anzahl bei reduzierter Arbeitsfähigkeit der Eltern dann ausschlaggebend für die Überlebenskraft der Familie ist (Livi-Bacci u. De Santis 1999). Diesen Kreislauf zu durchbrechen, bedarf es weltweiter intensiver Anstrengungen, die helfen, Armut abzubauen. Humanökologie 203 3.2.6 Epidemiologie und Public Health Die Gesundheit einer Bevölkerung gilt als wesentlicher Spiegel ihrer Lebensbedingungen.Als Ergebnis der biologischen Evolution ist der Mensch an ein Leben mit verschiedenen Krankheitserregern adaptiert (vgl. Kap. 3.2.3). Die Epidemiologie (griech.epidmios = im Volk verbreitet) befasst sich mit der Ursachenforschung von Krankheiten auf der Bevölkerungsebene und stellt ein Bindeglied zum öffentlichem Gesundheitswesen (Public Health) dar. Ihre Aufgabe ist die Erforschung von Krankheitsvorkommen und von biologischen, ökologischen, geomorphologischen, psychischen und soziokulturellen Einflussfaktoren auf ihre Verteilung. Ursprünglich standen die klassischen Epidemien,die der Epidemiologie ihren Namen gaben, im Zentrum des Interesses. Heute werden Krankheiten allgemein, vor allem weit verbreitete chronische Krankheiten, von der Epidemiologie untersucht. Neben der Erforschung von Krankheiten beschäftigt sich die Epidemiologie mit den möglichen Nebenwirkungen von Arzneimitteln, mit gesundheitsgefährdenden Belastungen am Arbeitsplatz und Umweltfaktoren (z. B. Ozonloch, Luftverschmutzung), die sich negativ auf die menschliche Gesundheit auswirken können (Kreienbrock u. Schach 2000). Die öffentliche Gesundheitsforschung oder Public Health-Forschung zielt auf die Prophylaxe, also die Vorbeugung und Verhütung von Krankheiten, ab. Public Health hat von jeher zwei Zielrichtungen: die Beseitigung oder Verringerung von Umweltrisiken und die „Erziehung“ der Bevölkerung zu einer gesünderen Lebensführung. Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert Public Health als „Wissenschaft und Praxis der Krankheitsverhütung, Lebensverlängerung und der Förderung psychischen und physischen Wohlbefindens durch gemeindebezogene Maßnahmen“ (Weitkunat et al. 1997). Die Aufgabengebiete von Public Health sind daher unter anderem die Verbesserung der medizinischen Versorgung, die Verstärkung „gesunden Verhaltens“ (z. B. durch Aufklärung) und die Registrierung und Eindämmung von Umweltbelastungen. Epidemiologie, Public Health und klinische Medizin ergänzen sich dabei gegenseitig (Polak 1999, Walter u. Paris 1996). Für die anthropologische Betrachtung einer Bevölkerung ist deren Krankheitsbelastung (Morbidität) von Bedeutung, die Rückschlüsse auf das biologische Gefüge aller Organismen eines Ökosystems erlaubt, sich auf das populationsgenetische Gleichgewicht einer menschlichen Bevölkerung auswirkt und deren demographische Entwicklung nachhaltig beeinflussen kann (Davey et al. 2001, Scott u. Duncan 1998). Insbesondere Infektionskrankheiten haben Entwicklung und Struktur von Bevölkerungen entscheidend geprägt, wie am Beispiel der Malaria gezeigt werden konnte (s. unten, auch Kap. 3.1). Epidemiologische Grundbegriffe und Methoden Eine Epidemie ist eine Krankheit, die in der Bevölkerung einer definierten Region häufig vorkommt. Sie tritt meist plötzlich auf, verbreitet sich schnell und verschwindet nach einer begrenzten Zeitdauer wieder. Als Endemie (von griech. endemios = daheim, an einem Ort verweilend) wird eine Krankheit bezeichnet, die in einem eng umgrenzten Gebiet vorkommt und meist von langer 204 Bevölkerungsbiologie Box 3.12 Epidemiologische Maßzahlen Prävalenz Die Prävalenz ist eine Maßzahl für die Wahrscheinlichkeit, mit der eine zufällig ausgewählte Person aus der betrachteten Bevölkerung an einem Stichtag von der untersuchten Krankheit betroffen ist. Sie berechnet sich aus der Anzahl der erkrankten Personen und der Größe der Population am Stichtag,also der Anzahl der Personen unter Risiko: Anzahl der erkrankten Personen Anzahl der Personen unter Risiko Vergrößert sich die Prävalenzrate in einer Bevölkerung, entwickelt sich eine Epidemie, bleibt sie konstant, befindet die Bevölkerung sich in einem epidemiologischen Gleichgewicht (endemische Phase), und verringert sie sich, spricht man von einer epidemiologischen Regression. Prävalenzrate (p) = Inzidenz Die Inzidenzrate ist ebenfalls ein Risikomaß, drückt aber die Wahrscheinlichkeit aus, mit der eine Person in einem betrachteten Zeitraum (beispielsweise einem Jahr) neu erkrankt. Die Inzidenz gilt als Maßzahl,um die Entstehung einer Krankheit und ihre Dynamik zu beschreiben. War die gesamte Population bei Beginn der Untersuchung gesund, spricht man von der kumulativen Inzidenz: Inzidenzrate (i) = Anzahl d. Neuerkrankungen im Studienzeitraum Anzahl d. Personen unter Risiko zu Beginn d. Studie (Robert-Koch-Institut o.J.) Dauer ist, da ein Wirt-Erreger-Gleichgewicht eintritt. Eine Krankheit, die (welt-)weit verbreitet ist bzw. ungewöhnlich häufig auftritt, bezeichnet man als Pandemie (von griech. pandemios = das ganze Volk betreffend). Eine Seuche ist nach heutigem Verständnis eine grassierende, ansteckende Krankheit. Im 15./16. Jahrhundert bezeichnete man allgemein eine „schleichende, langwierige Krankheit“ oder „Siechtum“ als Seuche. Im 17. Jahrhundert verwendete man den Begriff Seuche für „ansteckende Krankheiten“. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Seuche gleichgesetzt mit dem Begriff der Epidemie (Pfeifer 1995). Die deskriptive Epidemiologie erstellt zunächst für Vergleiche geeignete Datensammlungen. Eine mögliche Fragestellung wäre: Sterben in Deutschland mehr Personen an Lungenkrebs als in Frankreich? Um Krankheitsverläufe darstellen und über einen längeren Zeitraum Prognosen über Zu- oder Humanökologie 205 Abnahme der Erkrankungsfälle aufstellen zu können, sind epidemiologische Maßzahlen notwendig, von denen die beiden wesentlichsten, Prävalenz und Inzidenz, in Box 3.12 vorgestellt werden. Die analytische Epidemiologie baut auf diese Datensammlung auf und betreibt Ursachenforschung (Kausalität von Krankheiten). Das Hauptproblem bei der Auswertung von Daten ist die mögliche Falschzuweisung von Einflussfaktoren. Durch Einbeziehung von Faktoren in eine Kausalitätsanalyse, die nur scheinbar mit der zu untersuchenden Frage zu tun haben,können systematische Fehler die Ergebnisse verfälschen. Bei der Untersuchung von eindeutigen Kausalzusammenhängen unterscheidet man die Risikofaktoren, die eine klar erkennbare kausale Ursachen-Wirkungs-Beziehung zwischen Faktor und Effekt darlegen, von den Risikoprädiktoren, die eine Assoziierung mit einem Effekt nahe legen, aber teilweise ungeklärte Wechselwirkungen einschließen können. Die Validität einer Untersuchung kann vor allem aus zwei Gründen gestört sein. Zu vergleichende Bevölkerungen können von Störfaktoren, den Confoundern, überlagert sein, die nicht existierende Zusammenhänge vortäuschen. Informationen über Confounder sind die entscheidenden Voraussetzungen, um diejenigen Individuen herauszufiltern, die nicht von diesem Störfaktor betroffen sind.Eine weitere Fehlerquelle ist die fehlende Vergleichbarkeit der Informationen, wenn beispielsweise Mess-Ungenauigkeiten bei technischen Apparaten auftreten oder befragte Personen sich nicht ausreichend exakt an bestimmte Ereignisse in der Vergangenheit erinnern können. Infektionskrankheiten Zu den bedeutendsten Infektionskrankheiten in der Menschheitsgeschichte zählen die Pest, die Pocken, Lepra, Syphilis, Cholera, Tuberkulose, verschiedene Geschlechtskrankheiten und schließlich die auch als “Kriegsseuchen” bekannten Erkrankungen Fleckfieber, Ruhr, Malaria und Hepatitis epidemica (Leven 1997, Vasold 1991). Mittlerweile sind viele alte und auch neue Infektionskrankheiten wieder auf dem Vormarsch und stehen weltweit an der Spitze der Todesursachen. Als Ursachen gelten: • • • • • • Mängel in der öffentlichen Gesundheitsfürsorge, ökologische Veränderungen aufgrund von Wirtschaftswachstum und Neulandgewinnung, weltweite Mobilität von Menschen und internationaler Güteraustausch, Technikfolgen (z. B. falsche Anwendung von Antibiotika), demographische Veränderungen (Bevölkerungswachstum, Slumbildung in den Städten, freizügigeres Sexualverhalten), mikrobiologische Anpassungs- und Veränderungsprozesse, die z. B. Antibiotika-Resistenzen zur Folge haben. Die WHO führt seit den 1950er Jahren Kampagnen zur Eliminierung von Infektionskrankheiten durch. Aufgrund dieser Bemühungen gelten die Pocken seit 1979 als ausgerottet (Fenner et al. 1988, Gelderblom 1997). Dagegen scheiterte bis jetzt der Versuch, die Malaria einzudämmen, da die Anophelesmücke 206 Bevölkerungsbiologie als Wirt des Malariaerregers Resistenzen gegen bisher verwendete Insektizide und die üblichen Medikamente entwickelte. Für einige Infektionskrankheiten sind die Aussichten auf Ausrottung aufgrund ihrer Eigenschaften und Lebensbedingungen von vornherein sehr gering. Erreger, die ein Reservoir in Tieren (z. B. Gelbfieber in Affen), im Wasser (z. B. Cholera) oder im Boden (z. B. Wundstarrkrampf/Tetanus) haben, die im Körper infizierter Menschen lange persistieren, bevor die Krankheit zum Ausbruch kommt (z. B. Tuberkulose) oder die häufig mutieren (z. B. Influenza, AIDS), sind nur schwer zu fassen (Jütte 1997, Frendis u. Sauerwort 1999–2003). Die WHO teilt die 10 bedeutendsten Krankheiten unserer Zeit in drei Kategorien ein: • • • verheerende und unkontrollierte Krankheit, Kontrollstrategie vorhanden, aber das schwere Ausmaß der Krankheit besteht ungehindert fort und Kontrollstrategie erwies sich als erfolgreich, das Ausmaß der Krankheit nimmt ab und die Ausmerzung ist absehbar. Zur ersten Kategorie zählen die durch Treponematosen verursachte Schlafkrankheit, das Dengue-Fieber und die Leishmaniose; zur zweiten die Malaria, der Schistosoma-Befall und die Tuberkulose; schließlich zur dritten die Chagas-Krankheit, die Lepra, die lymphatische Filariose und die Onchocerciose (Remme et al. 2002, World Health Organization 2002c). Etwa die Hälfte der Mortalität durch Infektionskrankheiten kann allein drei Krankheiten zugeschrieben werden: HIV, Tuberkulose und Malaria (World Health Organization 2000, 2002a,b). In Deutschland regelt seit dem 01.01.2001 als Nachfolger des alten Bundesseuchengesetzes (BSeuchG) das „Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG)“ die Meldevorschriften für Infektionskrankheiten (Frendis u.Sauerwort 1999–2003). Diskurs 1. Malaria Die Kontrolle und Bekämpfung der Malaria ist eines der Hauptanliegen der WHO. Im „Roll Back Malaria“-Programm der WHO werden nationale und internationale Aktivitäten zur Bekämpfung der Malaria koordiniert. Die Maßnahmen haben unter anderem die Gesundheitserziehung, Unterrichtung und Verhaltensänderung der Bevölkerung endemischer Gebiete, Vektorkontrolle, epidemiologische Überwachungen, Maßnahmen zur Trockenlegung von Gewässern, Kanalisationen, Insektizidanwendungen und diagnostisch/therapeutische Bemühungen zum Inhalt (Meyer 2001). Mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung leben in malariagefährdeten Gebieten. 90% aller Malariafälle treten im tropischen Afrika südlich der Sahara auf, wo in jedem Jahr bis zu 280 Mio. Kinder im Alter unter 5 Jahren erkranken. Insgesamt kommt es weltweit jährlich zu 400–500 Mio. manifester Malariaerkrankungen und zu 1,5–2,7 Mio. tödlicher Verläufe, die vorwiegend Kleinkinder betreffen. Nach zunächst erfolgreichen Eradikationskampagnen der WHO vergrößern sich derzeit die endemischen Malariagebiete wieder. Dies findet seine Humanökologie 207 Ursache besonders in den rasch zunehmenden Insektizid- und Medikamentenresistenzen. Die erblichen und in Endemiegebieten in hohen Frequenzen auftretenden Erythrozytenanomalien, darunter in erster Linie die Sichelzellanämie (HbS/HbA), bestimmte Formen der Thalassämie, des Glucose-6-phosphat-dehydrogenase-Mangels, sowie das Fehlen bestimmter Duffy-Blutgruppen-Antigene (Fya, Fyb) bei der Vivax-Malaria wirken protektiv. Auch die genetisch determinierte Expression bestimmter humaner Leukozytenantigene (HLA) und Allele des Tumor-Nekrose-Faktors scheinen mit einem relativen Schutz gegen schwere Verlaufsformen der Malaria tropica assoziiert zu sein (vgl. Kap. 3.1.2). Der relativ langsame Aufbau schützender Immunantworten führt dazu, dass in Endemiegebieten Kinder sehr stark durch Malaria gefährdet sind. Im ersten Lebensjahr besteht meist ein partieller Schutz vor Infektionen, der auf mehrere Faktoren zurückgeht. In den ersten Lebensmonaten weisen Kinder noch einen Anteil fetalen Hämoglobins auf, das von Plasmodien nicht effizient verwertet werden kann. Zusätzlich können schützende IgG-Antikörper wirken, die von der Mutter diaplazentar übertragen wurden. Bei Säuglingen enthält das Blutserum, bedingt durch die Milchdiät, nur in geringem Maße para-Amino-Benzoesäure, die ein essentieller Wuchsstoff der Plasmodien ist. Mit dem Wegfall dieses Schutzmechanismus nach dem Abstillen sind Kinder bis zum Aufbau eigener Immunantworten gegen Plasmodien, was um das fünfte Lebensjahr geschieht, stark gefährdet. In manchen Verbreitungsgebieten von P. falciparum werden bis zu 50 % der Kindersterblichkeit auf Malaria tropica zurückgeführt. Wegen dieser hohen Sterblichkeit stellt P. falciparum einen bedeutenden Selektionsfaktor dar. Personen, die besonders gut Immunantworten gegen bestimmte Plasmodienantigene aufbauen können, haben deshalb eine bessere Überlebens- und Fortpflanzungschance. Das Potential, gegen bestimmte Antigene reagieren zu können, wird wesentlich mitbestimmt durch die Immunantwortgene des MHC-Systems, so dass der Selektionsdruck der Malaria zur bevorzugten Ausbildung bestimmter Immunantwortgene geführt hat (Lucius u. Loos-Frank 1997). Die Liste menschlicher Gene, für die gezeigt werden konnte, dass sie gegenüber der Malaria protektiv wirken, hat eine beeindruckende Länge erreicht und beinhaltet jetzt mehrere Hämoglobin-Typen, Enzyme und “Defekte” an den Membranen der Roten Blutkörperchen und sogar einen HLA-Typus. Diese Bandbreite lässt vermuten, dass starke Selektionsfaktoren einer endemischen oder pandemischen Krankheit wirken, die an vielen Genloci zugleich tätig werden. Malaria ist als selektive Kraft in der menschlichen Geschichte sehr wirksam gewesen. Um die weite Verbreitung der verschiedenen malariaresistenten Gene in der evolutionär kurzen Zeit, seit die Malaria bedeutend wurde, zustande zu bringen, bedarf es eines Mechanismus für ihre schnelle Ausbreitung. Kurzstrecken-Migration, selbst wenn sie verwandtenstrukturiert ist, liefert keine ausreichende Erklärung für diese Dynamik. Wichtig ist deshalb die Migration über weite Strecken hinweg, um die Verbreitungsrate und das Verbreitungsgebiet der Hämoglobinvarianten nach nur etwa 120 Generationen zu erklären. So sind das Hämoglobin E (HbE)und die Ovalozytose (hereditäre Elliptozytose, die mit einer Permeabilitätssteigerung der Erythrozytenmembran für 208 Bevölkerungsbiologie Natrium einhergeht), zwei Allele, die Malariaresistenz verleihen, sehr variabel in Siedlungen der Semai Senoi, eines Volkes der zentralmalaiischen Halbinsel. In ihren Genealogien tauchen einige Fälle von Langstreckenmigration aus anderen ethnischen Gruppen auf. Einige dieser Ereignisse scheinen wichtige Auswirkungen auf den Genpool der Semai gehabt zu haben, einschließlich der wahrscheinlichen Einführung des malariaangepassten Ovalozytose-Alleles (Fix 1999). Die Bedeutung der Landwirtschaft bei der Begünstigung von Malaria (Brutstätten der Anopheles-Mücke durch künstliche Bewässerung) lässt vermuten, dass die adaptiven Allele in Bevölkerungen mit landwirtschaftlicher Lebensgrundlage evoluiert sind. Setzte die Selektion für Malariaresistenz in einer ursprünglich kleinen, wachsenden Bevölkerung ein, konnte die Wachstumsrate der adaptiven Variante zunehmen. Das Bevölkerungswachstum erzeugt Migrationdruck, der zum Prozess der demischen Verbreitung (der Zerstreuung von Lokalpopulationen) führt. Die anfängliche Bevölkerungsgröße früher landwirtschaftlicher Dörfer konnte mit vielleicht nur 100 Individuen und HbE-Häufigkeiten von 0,05 beginnen. In ihnen kann HbE durch Malaria angereichert werden, im Gegensatz zu Jäger-Sammler-Bevölkerungen, denen aufgrund ihres fehlenden Kontaktes mit der landwirtschafltichen Bevölkerung die HbE-Variante fehlt (Fix 1999). Diskurs 2. AIDS Die weltweit häufigsten Todesursachen sind infektiöse und parasitäre Erkrankungen, denen insgesamt ein Drittel aller Menschen zum Opfer fallen. In den Entwicklungsländern gehen derzeit 43% aller Todesfälle auf das Konto von Infektionskrankheiten, in den Industrieländern dagegen nur 1,2%. Die sich am raschesten ausbreitende Infektionskrankheit ist AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), hervorgerufen durch HIV-Erreger (Human-Immunschwäche-Virus). Zahlreiche Arbeiten zur Biologie und Infektiologie des HIV-Virus liegen mittlerweile vor (z. B. Fan et al. 2000, Weinreich u. Benn 2003, Barnett u. Whiteside 2002, Hoffmann 1992 ff.), auf die an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden soll. Wichtig für die evolutionsbiologische Betrachtung der Entwicklung des Immunsystems sowie für die Verbreitungsdynamik ist die Tatsache, dass die beiden Haupttypen des HIV, HIV-2 und HIV-1, von unterschiedlichen Primatenarten auf den Menschen übertragen wurden. HIV-2 hat seinen Ursprung bei den Ruß-Mangaben (Cercocebus), wohingegen HIV-1 ursprünglich unter Schimpansen endemisch war. Die verschiedenen Varianten des HIV-1 gehen aus unabhängigen Übertragungsmechanismen vom Schimpansen zum Menschen hervor. Durch die Verbreitung des HIV-Virus ist die Übertragungsraten-Hypothese (transmission rate hypothesis) bestätigt worden: Sorgt der Wirt für eine schnelle Weitergabe des Erregers (häufiger Sexualpartnerwechsel im Fall von HIV), kommt einem besonders virulenten Erregerstamm eine gesteigerte Fitness zu. Er hat die Möglichkeit, zahlreiche neue Wirte zu infizieren, auch wenn er seinen ursprünglichen Wirt vergleichsweise schnell tötet. Wechselt der Wirt hingegen selten den Partner, hat ein weniger virulenter Stamm eine gesteigerte Fitness. Er erlaubt seinem Wirt lange genug Humanökologie 209 Abb. 3.11. Demographische Auswirkungen von HIV/AIDS: Bevölkerungspyramiden für Botswana im Jahr 2000 und Bevölkerungsprojektion für das Jahr 2025 (nach Haub 2002) zu überleben, um ihm die Möglichkeit zur Infektion eines neuen Wirtes zu geben. Virulente Stämme sexuell übertragener Pathogene sollten sich dann in einer Bevölkerung am wirkungsvollsten ausbreiten, wenn die Raten des Partnerwechsels hoch sind, währenddessen sich weniger virulente Stämme am wirkungsvollsten ausbreiten sollten, wenn die Raten des Partnerwechsels niedrig sind. Ist die Infektionsrate erhöht, wird die natürliche Selektion eine gesteigerte Virulenz bevorzugen. Ist jedoch die Infektionshäufigkeit gering, bevorzugt die Selektion gutartige Stämme. Im Sinne dieser evolutionären Analyse könnten sich auch die zu beobachtende Evolution von Medikamentenresistenzen bei den Grippe- und den Hepatitis-B-Viren sowie bei den die Tuberkulose hervorrufenden Stämmen des Bakteriums Mycobacterium tuberculosis (vgl. Kap. 3.2.3) erklären lassen (Freeman u. Herron 2001, Ewald 1997). Mit über 40 Mio. Infizierten, jährlich 6 Mio. Neuansteckungen und fast 3 Mio. Todesfällen pro Jahr (United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) u. World Health Organization 2003) hat sich AIDS zu einer Krankheit entwickelt, die mehr als jede andere Folgen für die Gesellschaftsstruktur, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die Lebensbedingungen in den betroffenen Gebieten hat. Vor allem im südlichen Afrika ist in mehreren Ländern die Lebenserwartung um 10 bis 20 Jahre zurückgegangen, während sie in allen übrigen Ländern der Welt gestiegen ist (vgl. Kap. 3.2.5). Am stärksten betroffen sind Botswana, Simbabwe und Sambia,wo die durchschnittliche Lebenserwartung heute um ein Drittel unter derjenigen der 1980er Jahre liegt.Die weltweit höchste Prävalenzrate hat Botswana, wo mit 38,8% der Bevölkerung im Jahr 2003 über ein Drittel der gesamten Bevölkerung infiziert war (United Nations 2003). Trotz der noch hohen Geburtenzahlen, die in anderen Ländern zu einem starken Bevölkerungswachstum führen (vgl. Kap. 3.2.5), wird die Bevölkerung Botswanas aufgrund der AIDS-Sterbefälle in den nächsten 20 Jahren um 10–20% zurückgehen. Vor 210 Bevölkerungsbiologie allem die Altersgruppe der über 40jährigen wird dann nahezu ausgestorben sein (vgl. Abb. 3.11). Bevor jedoch Verhaltensänderungen die Inzidenzraten senken,wird bis etwa 2010 ein weiteres Ansteigen der Zahlen von HIV-Infizierten in den am stärksten betroffenen Ländern befürchtet (United Nations 2003, Leisch 2001). Wie stark das Auftreten und die Verbreitung von AIDS mit der sozioökonomischen Situation verwoben ist und welche demographischen Konsequenzen daraus erwachsen, lässt sich am Beispiel zweier kulturell so unterschiedlicher Länder wie Simbabwe und Thailand zeigen, die beide zu den am stärksten betroffenen Ländern weltweit zählen (vgl. Tabelle 3.5). Neben den zahlreichen Kampagnen zur Aufklärung, Vorsorge und Therapie von AIDS bedarf es daher grundlegender sozialer Verbesserungen der Bevölkerung und nicht zuletzt der Beseitigung von Stigmatisierung und Diskriminierung der Betroffenen, um die HIV-Infektion, die derzeit weltweit mit größter Besorgnis beobachtet wird, kontrollieren zu können. Tab. 3.5. Wirtschaftliche und soziokulturelle Verknüpfungen der Verbreitung von HIV/AIDS und demographische Konsequenzen in Simbabwe und in Thailand (Daten nach United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) u. World Health Organization 2003, United Nations 2003) Anzahl Infizierter gesamt Ende 2003 Süd-/Südostasien Afrika (südlich der Sahara) 4,6–8,2 Mio. (30% Frauen) 25,0–28,2 Mio. (50% Frauen) Thailand Simbabwe Prävalenz bei Erwachsenen über 20 Jahre 1,8% 33,7% Lebenserwartung 1950 40 Jahre 44 Jahre Lebenserwartung 2003 (mit AIDS) 69,3 Jahre 39,7 Jahre potentielle Lebenserwartung 2003 ohne AIDS 73,0 68,1 Jahre Geschätzte Lebenserwartung 2010–2015 mit AIDS 72,9 31,6 Jahre Geschätzte Lebenserwartung 2010–2015 ohne AIDS 75,0 70,7 Jahre Ökonomisch-geographische Dynamisches Wirtschaftswachstum, große Landesteile Situation blieben davon jedoch unberührt (schwacher Nordosten) Agrarische Gesellschaftsform: Feldarbeit wird primär von Frauen ausgeführt Gesellschaftliche Verknüp- Saisonale Beschäftigung, Rest fung der AIDS-Problematik des Jahres Versuch Geld in den Großstädten zu verdienen; Prostitution, um Lebensunterhalt der Familie zu sichern; hohe räumliche Mobilität Hohe Prävalenz der Frauen hat einen Engpass bei der landwirtschaftlichen Produktion zur Folge; Schätzungsweise jedes sechste Kind auf einer Farm ist ein Waise (Verlust der Eltern, Mitversorgung durch andere Familienmitglieder) Humanökologie 211 Tab. 3.5. Fortsetzung Thailand Simbabwe Epidemiologie Sexualverhalten fördert die Aidsverbreitung; Aids wird als Problem von Homosexuellen und Fremden betrachtet; Beginn der Ausbreitung von AIDS in den Großstädten, Heterosexuelle mittlerweile Hauptübertragungsweg (Prostituierte, Kunden, Partner/innen); Übertragung über Hauptverkehrswege (Straßenbordelle/LKW-Fahrer) in ländliche Gebiete; Steigende Prävalenz auch durch intravenös Drogenabhängige Harare 1995: 26% aller Schwangeren unter 20 Jahren HIV-positiv, dadurch hohe Kindersterblichkeit; Außerhalb der Großstädte Anstieg der Prävalenz von 8% (1990) auf 40% (1995); Reproduktive Altersgruppe am stärksten betroffen (Arbeitskräfte u. Familieneinkünfte fallen aus); hohe Prävalenz bei Lehrern (weitere Schwächung des Bildungssystems) Bevölkerungspolitik AIDS wurde öffentlich problematisiert: Anti-AIDS-Kampagnen (Verteilung von 60 Mio. Kondomen pro Jahr); Rückgang des vorehelichen Geschlechtsverkehrs; Sinkende Neuinfektionsraten bewirkt verstärkte Sozialarbeit, Selbsthilfegruppen Fehlende Aufklärungskampagnen: vermutlich kein Rückgang der Neuinfektionen Prognosen Schätzung der Gesundheitsbehörden: etwa 38% Frauen betroffen; Anteil infizierter Frauen gibt Hinweise auf die weitere Bevölkerungsentwicklung 20%ige Verringerung der Fruchtbarkeit HIV-infizierter Frauen; langfristig dadurch weniger Kinder dem Infektionsrisiko ausgesetzt; Kindersterblichkeit steigt noch bis 2010 212 Bevölkerungsbiologie Zusammenfassung Kapitel 3.2 Humanökologie n Umweltadaptationen von Menschen sind sowohl genetischer und kultureller Natur als auch Verhaltensanpassungen. n Sie beziehen im Wesentlichen sich auf physikalische Umweltparameter (Hitze, Kälte, UV Strahlung, pO2), die Abundanz von Pathogenen, und die Ernährung. n Menschliche Populationen unterscheiden sich zwar sowohl morphologisch als auch physiologisch und hinsichtlich der Genfrequenzen, jedoch variieren diese Merkmale graduell mit der Folge, dass die Variabilität innerhalb einer kontinentalen Gruppe höher ist als zwischen den Gruppen. Es existieren keine Rassen von Menschen. Jegliche derartige Kategorisierung ist letztlich ein soziales oder sozialpolitisches Konstrukt. n Als einzige Spezies haben Menschen in einem Ausmaß gestalterisch in ihre naturräumliche Umwelt eingegriffen, dass weltweit eine Vielzahl anthropogener Ökosysteme entstanden ist. Zahlreiche Umweltprobleme sind nicht moderner Natur, sondern wurden bereits in historischen oder sogar prähistorischen Zeiten begründet. n „Die“ Weltbevölkerung gibt es nicht, da die Menschen in demographisch extrem unterschiedlichen Teilwelten unter sehr verschiedenen Bedingungen leben. n Die demographische Zukunft der Erde hängt nahezu ausschließlich von der Bevölkerungsdynamik der Entwicklungsländer ab, in denen ein rasantes Wachstum stattfindet. n Verstädterung und Urbanisierung stellen ein ernstzunehmendes Problem insbesondere in den ärmsten Ländern der Welt dar, welches nur durch eine nachhaltige Wirtschafts- und Umweltpolitik zu lösen ist. n Die derzeit in verschiedenen Regionen der Welt am stärksten vorherrschenden Infektionskrankheiten sind Malaria und AIDS. Die Epidemiologie erforscht u. a.die gesellschaftliche Vernetzung der Krankheiten. Demographie 213 3.3 Demographie 3.3.1 Aufgaben und Ziele, Geschichte Die Demographie oder Bevölkerungswissenschaft untersucht die Gliederung einer Bevölkerung (Population) nach regionaler Verteilung, Geschlecht, Alter, Familienstand, Kinderzahl und zahlreichen weiteren statistischen Parametern. Über diese enge Definition der formalen Demographie hinaus liefert die Demographie nicht nur derartige Zustandsdaten, sondern berechnet dynamische Maße der drei grundlegenden Prozesse, die eine Bevölkerung formen und verändern. Dies sind die Fertilität (Geburtsverhalten), die Mortalität (Sterblichkeit) und die Migration (Wanderungsbewegungen). Diese wesentlichen Zustandsund Prozessdaten einer Bevölkerung sind notwendige Voraussetzung zum Verständnis des Wandels von Populationen sowie der Variabilität innerhalb von Bevölkerungen und der Unterschiede zwischen Bevölkerungen. Die Demographie stellt eine essentielle Datenbasis für die Interpretation biologischer und sozialer Prozesse dar. Sind zugrunde liegende Einflussfaktoren in ihrer Wirkung hinreichend untersucht, lassen sich auch zukünftige Entwicklungen von Bevölkerungen abschätzen. Die Erfassung dieser Prozesse beruht auf der demographischen Definition von Bevölkerungen, die hierunter Gruppen von Menschen versteht, die zu einem Zeitpunkt oder innerhalb eines Zeitraumes einem definierten geographischen Raum zugeordnet sind (Preston et al. 2001, Müller et al. 2000a,b, Esenwein-Rothe 1982, Dinkel 1989, Müller 1993). Die Anthropologie bedient sich dieser demographischen Technik und ihrer Konzepte, um die Interaktionen zwischen biologischen und sozioökonomischen Merkmalen des Homo sapiens in ihrer räumlichen und zeitlichen Variabilität untersuchen zu können. Aufgabe der Anthropologie ist es, aus ihrem Verständnis der normalen Variabilität des Menschen heraus sich um Präventionsmaßnahmen gesundheitlicher Risikofaktoren zu bemühen, die noch nicht in den Aufgabenbereich der kurativ tätigen Medizin fallen. Neben den demographischen Parametern der Fertilität, Mortalität und Migration, die den Bevölkerungsbestand quantitativ prägen und verändern, spielt die Morbidität eine Rolle für die qualitative Beschreibung von Bevölkerungsprozessen. Sie beschreibt den Gesundheitszustand der Bevölkerung, der in der Epidemiologie mittels speziell angepasster demographischer Methoden ermittelt wird (vgl. Kap. 3.2). Damit stellt die Anthropologie eine der Disziplinen dar, die mit der Demographie eng verknüpft sind: „Man darf ohne Schaden an Allgemeingültigkeit die Demographie als Hilfswissenschaft für eine ganze Reihe anderer wissenschaftlicher Disziplinen verstehen, denen sie Konzepte bereitstellt, mit denen Struktur und Veränderung von solchen Gesamtheiten untersucht werden können, die sich auf natürlichem Weg erneuern.“ (Dinkel 1989, S.1). Dieses Kapitel betrachtet demzufolge die Demographie aus der Sichtweise der raumzeitlichen Variabilität des Menschen, welche die biologischen mit den 214 Bevölkerungsbiologie kulturellen Einflussfaktoren verbindet. Die natürliche Selektion wird durch die demographischen Prozesse Mortalität und Fertilität, durch die regionale Verteilung genetischer Merkmale (Genfluss) infolge Migration und deren Verbreitung (Gendrift) infolge der Bevölkerungsdichte gesteuert. Umgekehrt beeinflussen biologische Parameter der Individualentwicklung, insbesondere Wachstum, Menarche, Menopause und Alterung, die demographischen Prozesse Fertilität und Mortalität und tragen zur populationsspezifischen Bevölkerungsstruktur bei. Dadurch entsteht eine enge Verknüpfung zwischen den Disziplinen Demographie und Anthropologie. Da insbesondere die Sterblichkeit als ein wichtiger Biomarker des menschlichen Lebenslaufes für die Anthropologie von Bedeutung ist, soll ihr in diesem Kapitel besondere Aufmerksamkeit zuteil werden. Für eine umfassendere Beschäftigung mit der demographischen Erfassung von Fertilität und Wanderungsverhalten sei auf die einschlägige demographische Literatur verwiesen. „Bevölkerung: Das sind die einzelnen Menschen.“ Dieser Ausspruch des Historischen Demographen Artur Imhof mag verdeutlichen, dass Bevölkerung kein abstrakter Begriff für eine Menschengruppe ist, sondern dass individuelle Handlungsweisen in einer Gesamtheit aggregiert betrachtet werden. Der Lebenslauf jedes einzelnen Menschen ist von individuellen Erfahrungen und Handlungen geprägt, welche in ihrer Gesamtheit die demographischen Kenndaten zur räumlichen Mobilität, Heirat, der Geburt von Kindern und dem eigenen Tod ergeben. Zahlreiche Einflussfaktoren wirken auf diese Parameter. Unter den gegebenen räumlichen, kulturellen und sozialen Bedingungen reagieren Menschen mit ähnlichen sozialen Lebensgeschichten häufig mit ähnlichen Handlungsmustern. Diese Zusammenhänge werden hauptsächlich von der Soziologie (Joas 2001, Höpflinger 1997) und der Verhaltensökologie (Low et al. 2002) untersucht. Die Kenntnis demographischer Reaktionen unter bestimmten Bedingungen stellt eine wichtige Grundlage für raumstrukturelle Planungen dar. Daher werden oft weitergehende Differenzierungen in der demographischen Datenerhebung vorgenommen, beispielsweise nach Heiratsalter, Bildungsstand, Beruf, Einkommen, ethnischer Herkunft, Staatsbürgerschaft und vielen anderen Merkmalen mehr. Sie erlauben der Demographie Einsichten in die differentiellen bevölkerungsrelevanten Prozesse innerhalb von Teilpopulationen. Der Begriff der „Be-Völkerung“ ist ein dynamischer. Die große Herausforderung an die Bevölkerungswissenschaft stellt diese Dynamik von Populationen dar. Deren unterschiedliche Formen und Mechanismen zu modellieren, bedarf es eines umfangreichen mathematischen Methodenspektrums, das die moderne Demographie entwickelt hat. Demographie 215 Die Tage unserer Jahre (betragen) von sich aus 70 Jahre Und, wenn mit Krafttaten: 80 Jahre Aber ihr Drängen ist Mühsal und Unheil. Unsere Tage zu zählen, lehre uns so daß wir Weisheit ins Herz (ein)bringen. (Altes Testament, Psalm 90, 10–12; Übers. Krüger 1994). Diese in der Demographie häufig zitierte Textpassage des Alten Testaments wird als einer der frühesten Belege für eine populationsbasierte Betrachtung der Lebenslänge angesehen. Sie beschreibt nicht nur die auf Beobachtung basierenden Häufigkeiten der Lebenserwartung, sondern geht darüber hinaus auch auf deren Variationsbreite ein und zeigt damit, wie tiefgreifend demographische Veränderungen mit dem Verständnis des menschlichen Lebens verknüpft sind. In den letzten Jahren sind die naturwissenschaftlichen Disziplinen mit der Demographie enger zusammengewachsen und haben in der „biodemography“ zwei Forschungsrichtungen gefunden (Carey u. Vaupel i.Dr.). Die erste Richtung betrachtet die biologische Struktur, die Verhaltensstrategien und die demographische Dynamik menschlicher Bevölkerungen und versucht, die Veränderungen menschlicher Gesellschaften unter der Berücksichtigung evolutionsbiologischer Wurzeln zu erklären. Als Paradebeispiel für die praktische Umsetzung dieser neuen Forschungsrichtung kann das 1996 gegründete „Max-Planck-Institut für demografische Forschung“ in Rostock angesehen werden. In der Geschichte der Demographie kann als Vorläufer dieser Forschungsrichtung die Beschäftigung mit der ursprünglich als rein biologisches Phänomen verstandenen „natürlichen Fertilität“ angesehen werden. Dem französischen Demographen Louis Henry ist es zu verdanken, dass die Fertilität keineswegs mehr ausschließlich natürlich erscheint. Henry erkannte, dass das generative Verhalten vom menschlichen Bewusstsein in seiner sozial-kulturellen Umgebung geformt wird und dadurch hoch variabel ist (Henry 1961). Damit war der Grundstein für die Erklärung der bevölkerungsdynamisch so unterschiedlichen Verhaltensweisen durch die umweltabhängige Plastizität biologisch-demographischer Merkmale als evolutionäres Erbe gelegt (Wachter 2003). Die andere Forschungsrichtung der „biodemography“ kann auch als Medizinische Demographie oder als Epidemiologische Demographie bezeichnet werden. Sie bemüht sich um die Zusammenhänge und Auswirkungen genetischer und medizinischer Faktoren auf das demographische Geschehen. Regionalstatistisch zu erfassende Auswirkungen von genetischen Varianten, die sich beispielsweise auf differentielles Altern auswirken (vgl. Kap. 4.1.5), oder die demographischen Effekte verschiedener Krankheiten stehen dabei im Vordergrund (Carey u. Vaupel i.Dr.). Auch die Sterblichkeit unterliegt zwar einerseits biologischen Gesetzmäßigkeiten, wird aber auch durch kulturelle Faktoren überformt, so dass die Demographie zu einem wesentlichen anthropologischen Verständnis des Menschen beiträgt. 216 Bevölkerungsbiologie Die Demographie liefert wesentliche Grunddaten einer Bevölkerung, die erst gemeinsam mit der biologischen Variabilität von menschlichen Gruppierungen und der soziologischen Bevölkerungsanalyse das raum-zeitliche menschliche Verhalten erklären können. Das Interesse an Bevölkerungsstruktur und -entwicklung in Wissenschaft und Politik ist im 17. und 18. Jahrhundert aus pragmatischen Gründen erwachsen. Anlass für das Interesse war eine radikale Abnahme der Bevölkerungszahlen europäischer Länder in Folge des Dreißigjährigen Krieges und der Pest im 17. Jahrhundert. Im damals herrschenden Wirtschaftssystem des Merkantilismus sah man einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Größe der Bevölkerung und der wirtschaftlichen (Steuerzahler) und militärischen (Soldaten) Macht eines Staates. Das politische Ziel bestand in einer Zunahme der Population, wozu das Verständnis der zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten die Voraussetzung war (Birg 1996). Zeitgenössische Bevölkerungstheoretiker, so genannte Populationisten, empfahlen beispielsweise eine Beschränkung der Auswanderung, Bekämpfung der Kindersterblichkeit, Förderung von Eheschließungen und Kinderreichtum in Familien. Bald darauf jedoch wendete sich die Einstellung, bedingt durch die in Gang gesetzte Bevölkerungszunahme und nicht zuletzt durch die Diskussionen der Arbeiten von Süssmilch und Malthus. Zwei Klassiker der Bevölkerungswissenschaft: Süssmilch und Malthus Peter Süssmilch (1707 bis 1767) veröffentlichte 1741 „Die göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts, aus der Geburt, Tod und Fortpflanzung desselben erwiesen“, ein aktuelleres und wissenschaftlich haltbareres Buch als das ein halbes Jahrhundert später erschienene des viel einflussreicheren Thomas Robert Malthus (1766 bis 1834). Süssmilch lieferte erstmals realistische Schätzungen der maximalen Weltbevölkerung und prognostizierte eine Weltbevölkerung von 7 Milliarden Menschen. Er war der Auffassung, dass es einen selbstregulierenden Zusammenhang zwischen Bevölkerungswachstum und Tragfähigkeit der Erde gebe, denn die Geburtenrate passe sich auf natürliche Weise den äußeren Umständen (Nahrungsressourcen) an (Birg 1996). Malthus vertrat in seinem „Principle of population“ (1798) konträre Thesen. Zu seiner Zeit nahm die Bevölkerung stark zu und im Zuge der beginnenden Industrialisierung wuchs die Zahl der Armen.Malthus schürte die Angst vor Überbevölkerung und sah die Kapazität der Erde bei einer Zahl von einer Milliarde Menschen als erschöpft an. Er stellte die berühmte These auf, dass die Menge der Unterhaltsmittel in arithmetischer Reihe wachse, d. h. mit konstanten absoluten Zuwächsen (z. Bsp. 4, 6, 8, 10), während die Bevölkerung in geometrischer Reihe wachse, d. h. mit konstanten prozentualen Zuwächsen (z. Bsp. 1, 2, 4, 8). Der Sündenbock war für ihn die sich „wild vermehrende“ Unterschicht,die mit erhöhten Kinderzahlen auf die sich verbessernden Lebensumstände reagierte. Das Elend und die schlechte medizinische Versorgung der Unterschicht konnte somit als politisch notwendig legitimiert werden (Khalatbari u. Otto 1999). „Dass MALTHUS heute immer noch der weitaus bekannteste, um nicht zu sagen populärste Bevölkerungstheoretiker ist, liegt einerseits an seiner ein- Demographie 217 gängigen Argumentationsweise, aber auch daran, dass MALTHUS der Oberschicht eine wissenschaftlich untermauerte moralische Überlegenheit über die Unterschicht bescheinigte.“ (Birg 1994a) Malthus stützte seine Theorie auf zwei sowohl damals als auch heute noch nachweislich falsche Argumente: • • Mit einem Anstieg der Lebensqualität steigt die Geburtenrate. Das Bevölkerungswachstum hat die Tendenz, die Zunahme der Nahrungsmittelproduktion zu übersteigen. Das Gegenteil ist der Fall. In den Industrieländern sinkt die Geburtenrate bei steigender Lebensqualität und die quantitative Nahrungsmittelproduktion ist trotz der „Bevölkerungsexplosion“ (vgl. Kap. 3.2) ausreichend, um alle Menschen der Welt ernähren zu können. Allerdings nehmen inzwischen die Warnungen zu, dass Malthus doch in gewisser Weise Recht behalten könnte, wenn nicht aktiv in die Bevölkerungsentwicklung der Erde eingegriffen wird (Smail 2002). Der damalige Einfluss von Malthus auch auf die Anthropologie ist nicht zu unterschätzen. Charles Darwin wurde durch die Veröffentlichungen Malthus’ dazu inspiriert, dessen Lehre als „wissenschaftlich allumfassend auf das gesamte Tier- und Pflanzenreich“ in seine Evolutionstheorie anzuwenden. Aber auch kritische Stimmen wandten sich offen gegen Malthus’ Buch. Karl Marx bezeichnete es als „sensationelles Pamphlet“, Werner Sombart 1938 in seinem Buch „Vom Menschen – Versuch einer geistwissenschaftlichen Anthropologie“ als „das dümmste Buch der Weltliteratur“ (Khalatbari 1999). Auch die umgekehrte Beeinflussung durch die Biologie, insbesondere die Anthropologie, hat die Demographie stark geprägt. Die Bevölkerungswissenschaft ist als theoretische Disziplin in der Naturphilosophie und in der Geschichtsphilosophie verankert. Nach Malthus war sie vorwiegend naturphilosophisch ausgerichtet, wobei ihre Leitdisziplin die Biologie war. Dies kann als eine wesentliche Weichenstellung für die fatale Entwicklung zur Rassenpolitik des Dritten Reiches angesehen werden (Birg 1999). Wie die demographische Transition (vgl. Kap. 3.3.4) zeigt, kam es zu einem starken Anstieg der Bevölkerung in Europa am Übergang zur Industriegesellschaft. Ursache war einerseits die Abnahme der Sterberate, bevor die Geburtenzahlen sanken. Zum anderen überstieg die Zahl der Geburten die Zahl der Gestorben sowohl vor als auch nach der industriellen Revolution. Mit der Zunahme der Bevölkerung und verursacht durch die gesellschaftlichen Umstände (v.a. die kapitalistische Produktionsweise und eine liberale Politik) stieg die Zahl der Armen stark an und die damit einhergehenden sozialen Probleme nahmen in Ausmaß und Intensität zu. Politisch wurde das Bevölkerungswachstum für die auftretenden Probleme verantwortlich gemacht und man reagierte, gestützt durch die Theorie von Malthus, unter anderem mit einer verschärften Regelung der Eheschließung. So durfte nur bei einem gewissen Besitzvermögen geheiratet werden. Ziel war es, das schnelle Wachstum der Unterschichten aufzuhalten. Als weitere Möglichkeit, die „Überbevölkerung“ abzubauen, betrieb man ab Mitte des 19. Jahrhunderts die Übersiedlung in die Kolonien oder die USA. 218 Bevölkerungsbiologie In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die Bevölkerung als Gegenstand der Demographie mit den Epochen Stalins und Hitlers als ein Mittel der Herrschaft instrumentalisiert. Die machtpolitischen Interessen der Nationalstaaten bestimmten, ähnlich wie zu Zeiten des Merkantilismus, die Bevölkerungspolitik. Ihren negativen Höhepunkt erreichte die Bevölkerungspolitik im Nationalsozialismus (vgl. Box 3.13). Im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts fällt schließlich in beinahe allen entwickelten Staaten die Zahl der Neugeborenen unter die der Todesfälle, in der BRD z. B. 1974 (Birg 1994a). Die Folge ist ein Rückgang der Bevölkerung in jenen Ländern, der allerdings durch Zuwanderung abgebremst wird. Aus dem politischen Diskurs verschwindet dadurch die Idee, militärische und machtpolitische Stärke der Nation mit der Größe der Bevölkerung zu verknüpfen. Vielmehr rücken die Folgen der demographischen Verschiebung auf das soziale Sicherungssystem ins Zentrum des Interesses (Birg 1999). Box 3.13 „Volk und Raum“ – Zur Bevölkerungspolitik im Dritten Reich Die Grundvorstellungen des NS-Regimes von „Volk und Raum“ orientierten sich an dem Hauptziel der Gewinnung deutschen Lebensraums im Osten. Durch die Grenzveränderungen zwischen 1938 und 1942 wurden Pläne zur Volksordnung und Landschaftsgestaltung als Bestandteil der Reichspolitik laufend verändert und zeigten eine zunehmende Unterdrückungs- und Ausrottungspolitik gegen die nichtdeutsche Bevölkerung (Wichterich 1994). Anthropologen, insbesondere Eugen Fischer als Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts in Berlin, lieferten mit der Rassenkunde die biologische Begründung für die ‚Reinhaltung des deutschen Volkes’als Vertreter einer anderen Völkern überlegenen Rasse (s. hierzu insbesondere Müller-Hill 1984, Weindling 1989, Weingart et al. 1992, Becker 1988, Bäumer 1990, Shipman 1995, Lösch 1997). Die typische Argumentationsweise einiger anthropologischer Fachvertreter,wie sie im Dienst der NS-Ideologie eingesetzt wurde,verdeutlicht die Haltung gegenüber osteuropäischen Bevölkerungen, die der „ostbaltischen Rasse“ zugerechnet und aufgrund der ihr zugeschriebenen seelischen Eigenschaften als „unerwünscht“ beurteilt wurde: (1) „Wo Fröhlichkeit durchbricht, hat sie leicht etwas Wildes und Maßloses,Leidenschaft wird oft zur Brutalität.Ihr Handeln ist nicht von der kühlen Gradheit der Nordischen, verschlagene Umwege sind ihnen nicht fremd, Entschlüsse werden langsam, schwer und schwankend gefasst. Aber sie sind fügsam, genügsam und zähe – nicht gute Herren, aber gute Untertanen.“ (Holtz u. Schwidetzky 1933) Demographie Box 3.13 (Fortsetzung) Geographen unterstützten die massive Ausmerzung und Umsiedlung der Bevölkerung als raumstrukturelle Maßnahmen zur Expansion und ‚Pflege der deutschen Kulturlandschaft’. (2) So der Geograph Walter Geisler 1942: „Der Ausmerzung unliebsamer Elemente steht die Einwanderung der Bevölkerung gegenüber, die den Stamm der im Lande ansässigen Volksdeutschen verstärkt.… Wenn man aufbauen will, muss eine Säuberungsaktion vorausgehen, d. h. es muss vernichtet und ausgemerzt werden, was nicht in den neuen Plan hineinpasst oder sich ihm widersetzt.“ (3) Aus der ‚Landschaftsfibel’ Heinrich Wiepking-Jürgensmann 1941 stammen folgende Worte, die mit den Ansprüchen Hitlers konform sind: „Es gibt gesunde und kranke Landschaften. Immer ist die Landschaft eine Gestalt, ein Ausdruck und eine Kennzeichnung des in ihr lebenden Volkes. Sie kann das edle Antlitz seines Geistes und seiner Seele ebenso wie auch die Fratze des Ungeistes, menschlicher und seelischer Verkommenheit sein. In allen Fällen ist sie das untrügliche Erkennungszeichen dessen, was ein Volk denkt und fühlt, schafft und handelt.Sie zeigt uns in unerbittlicher Strenge,ob ein Volk aufbauend und ein Teil der göttlichen Schöpfungskraft ist oder ob das Volk den zerstörenden Kräften zugerechnet werden muss. So unterscheiden sich auch die Landschaften der Deutschen in all ihren Wesensarten von denen der Polen und Russen – wie die Völker selbst. Die Morde und Grausamkeiten der ostischen Völker sind messerscharf eingefurcht in die Fratzen ihrer Herkommenslandschaften. Je verwahrloster und verkommener,je ausgeräumter eine Landschaft ist,umso größer ist die Verbrechenshäufigkeit.“ (alle Zitate nach Fehn 1992) Mit den „Rasseformeln“ Egon von Eickstedt’s wurden Erhebungen vorgenommen, die zur Beurteilung „Rassisch Unerwünschter“ führte. Auch damals schon gab es Bedenken gegen derartige Klassifizierungen von Menschen (Lenz 1941). Sie werden heute als Projektionen von Vorurteilen in ein wissenschaftlich verbrämtes System angesehen, das einer Prüfung seines wissenschaftlichen Gehaltes nicht standhalten kann (vgl. auch Preuschoft u. Kattmann 1992). Insbesondere die Biodemographie mit der ihr eng verbundenen Anthropologie zeigt heute wertfrei, dass regionale Bevölkerungsunterschiede aufgrund von Anpassungsprozessen an die jeweilige Umweltsituation entstanden sind und somit als positives Kriterium der Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Überlebensfähigkeit einer Bevölkerung gelten. 219 220 Bevölkerungsbiologie Nach dem zweiten Weltkrieg wurden mit der Bevölkerungsentwicklung zusammenhängende politische und kulturelle Themen in Deutschland fast gänzlich ignoriert. Erst in jüngster Zeit ist die Wissenschaft aus ihrer Zurückhaltung herausgetreten und bemüht sich, die Verantwortung der Bevölkerungswissenschaftler für die Abschätzung und Beurteilung zukünftiger Bevölkerungsentwicklung auch aktiv zu übernehmen (Birg 1999). 3.3.2 Konzepte demographischer Messungen Wenn sich auch die Historische Demographie intensiv um die Rekonstruktion der Bevölkerungsdynamik in den Zeiten vor der amtlichen Einwohnerregistrierung bemüht und es ihr auch gelingt, kleinräumige Einheiten in ihrer Bevölkerungsentwicklung zu verfolgen, so lassen sich zuverlässige Informationen über die Sterblichkeitsentwicklung in Deutschland erst ab der Gründung des Deutschen Reiches im Jahr 1871 gewinnen, als die systematische Erfassung der relevanten Personendaten eingeführt wurde. Eine erste Sterbetafel (vgl. unten) konnte für Deutschland daher erst für die Jahre 1871/81 erstellt werden. In einigen Ländern wurden Bevölkerungsdaten bereits im 18. Jh gesammelt (Island seit 1703, Schweden seit 1749, Dänemark und Norwegen seit 1769) (Imhof 1995). In langfristigen demographischen Betrachtungen werden daher häufig Daten der skandinavischen Länder vorgestellt. Die Registrierung der demographischen Daten erfolgt in Deutschland mit dem Einwohnermelderegister (vgl. Tabelle 3.6), das in den Einwohnermeldeämtern oder Standesämtern geführt wird. Diese Daten werden als amtliche Daten bezeichnet. Die von den Statistischen Landesämtern auf der Länderebene verwalteten Bevölkerungsdaten werden im Statistischen Bundesamt für nationale Betrachtungen Deutschlands zusammengefasst. Die Führung und Nutzung der Bevölkerungsdaten unterliegen in Deutschland der Kontrolle durch den Datenschutz. Mit der Führung der Einwohnermelderegister kann durch die Bevölkerungsfortschreibung zu einem beliebigen Zeitpunkt der Bevölkerungsbestand, seine Geschlechts- und Altersstruktur sowie wenige weitere Daten, beispielweise zum Familienstand, ermittelt werden. Dazu wird der Bevölkerungsbestand P zu einem Zeitpunkt t aus dem Bestand zum Zeitpunkt t-1 und denjenigen Variablen berechnet, die eine Bestandsveränderung verursachen. Addiert werden die im Zeitraum ∆ t zwischen ∆ t-1 und t Geborenen G und zugewanderten Personen I (Immigranten), subtrahiert werden die im gleichen Zeitraum Gestorbenen D und abgewanderten Personen E (Emigranten) (Esenwein-Rothe 1982): Pt = Pt-1 + G t – D t + I t –E t Durch Nichtbeachtung von Meldevorschriften und aufgrund von organisatorischen Defiziten werden jedoch nicht alle Zuzüge und Fortzüge, Geburten und Todesfälle aus dem Zuständigkeitsbereich eines Einwohnermeldeamtes exakt erfasst. Dadurch kommt es zu Fortschreibungsfehlern, die sich von Jahr zu Jahr fortpflanzen und verstärken. Da dies vor allem jüngere Altersgruppen betrifft, die eine wesentliche Grundlage für die Berechnung der Geburtenzahlen Demographie 221 darstellen, stellen die Fortschreibungsfehler ein ernst zu nehmendes Problem bei der regionalen Strukturplanung dar (Dinkel 1989). Aus diesem Grund werden von Zeit zu Zeit Bereinigungen durch Vollerhebungen des Bevölkerungsbestandes notwendig. Diese Volkszählungen oder Zensuserhebungen erfassen als Stichtagsbevölkerungen alle Personen, die sich an einem festgelegten Stichtag in der zu erfassenden Gebietseinheit aufhalten bzw. wohnhaft sind. Es wurden Unterschiede von bis zu 8% zwischen dem mit einer Zensuserhebung erfassten und dem nach Bevölkerungsfortschreibungen über 10 Jahre geschätzten Bestand bei jüngeren Altersgruppen beobachtet, die durch ausbildungs- und arbeitsplatzbedingte Wanderungen besonders mobil sind. In der BRD haben die letzten Volkszählungen 1951, 1961, 1971 und 1987 stattgefunden. Sie stellen die umfassendste Datenerhebung einer Landesbevölkerung dar und erlauben eine Bestimmung des administrativen, kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklungsniveaus und der Wechselwirkungen der verschiedenen Faktoren innerhalb eines Landes (Knox u. Marston 2001). Mit ihrer Hilfe ist auch der internationale Vergleich regionaler, sozialer und demographischer Daten möglich. In den dazwischen liegenden Zeiträumen werden umfassende sozioökonomische Daten in einem jährlichen Mikrozensus an einer repräsentativen Stichprobe der Bevölkerung erhoben, die in Deutschland 1% der Gesamtbevölkerung umfasst. Diese ermöglichen die kurzfristige Darstellung demographischer Strukturveränderungen (Hall u. Rao 1992). Ergänzt werden diese amtlichen Daten durch nicht-amtliche Surveyerhebungen, in denen über das demographische Interesse hinaus strukturelle Daten erfasst werden können. Das seit 1982 in jährlichen Wellen fortgeführte Sozioökonomische Panel (SOEP) des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ist wohl das in Deutschland größte laufende Survey zur Erfassung des sozioökonomischen Gefüges (vgl. Tabelle 3.6). Demographische Daten lassen sich grundsätzlich auf zwei unterschiedliche Arten darstellen und analysieren. Einerseits können demographisch relevante Ereignisse wie Geburt, Heirat, Geburt eigener Kinder oder Tod gruppiert nach Lebensalter der sie betreffenden Personen in einer Bevölkerung betrachtet werden. Mit einer derartigen Kohortenanalyse (vgl. Box 3.14) lässt sich beispielsweise der Frage nachgehen, in welchem Alter die 1960 geborenen Frauen durchschnittlich ihr erstes Kind bekommen oder wie sich die Sterblichkeitsverhältnisse der 1910 Geborenen darstellen. Man verfolgt dabei eine Gruppe von Personen, eine Kohorte, die zu einem bestimmten Zeitpunkt einem bestimmten identischen Ereignis ausgesetzt war, zum Beispiel der eigenen Geburt. Eine Geburtskohorte umfasst demnach alle Personen, die in einem bestimmten Zeitraum (wie etwa einem Kalenderjahr) geboren wurden. Derart definierte Kohorten können bezüglich des Eintretens verschiedener Ereignisse beobachtet werden. Dies ist eine Längsschnittbetrachtung. Es lassen sich damit exakte Lebensläufe erstellen, ein großer Vorteil der Kohortenanalyse. Als nachteilig erweist sich dabei jedoch, dass diese Betrachtungsweise eine Sammlung gleichartiger Daten über einen langen Zeitraum hinweg erfordert. So kann beispielsweise die Betrachtung einer Geburtskohorte in einer reinen Kohortenanalyse bezüglich ihrer Sterblichkeitsverhältnisse erst dann abgeschlossen werden, wenn das letzte Mitglied dieser Kohorte gestorben ist. Da- 222 Bevölkerungsbiologie Tabelle 3.6. Die wichtigsten Datenquellen zur Gewinnung demographischer Daten in Deutschland Datenquelle Erhebungszeitraum und Umfang Verfügbare Daten Volkszählung (Zensus) regelmäßiger Abstand (z. B. alle fünf oder 10 Jahre); alle sich im Gebiet aufhaltenden Personen Einwohnerregister fortlaufende Bevölkerungsfortschreibung; alle sich im Gebiet aufhaltenden Personen 1%-Stichprobe der Bevölkerung Bevölkerungsgröße Alters- und Geschlechtsstruktur Haushalts- und Familienstrukturen Ausbildungs- und Berufsstrukturen Wohnungsmerkmale, Arbeitsplatzsituationen Querschnittsdaten Geburtsdatum, -ort, Geschlecht, Heirat, Familienstand Wohnsitzwechsel Längs- und Querschnittsdaten Sozioökonomische Strukturdaten (Querschnittsdaten) Sozioökonomisch Daten (Längs- und Querschnittsdaten) Mikrozensus Surveys (z. B. SOEP, ALLBUS)a in regelmäßigen Abständen; definierte Stichproben aSOEP- Sozioökonomisches Panel, ALLBUS- Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften) Box 3.14 Anlage demographischer Untersuchungen Periodenanalyse,Querschnittsuntersuchungen: Einmalige Datenerhebung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem kurzen Zeitraum (z. B. Volkszählung, jährliche Fortschreibung). Kohortenanalyse, Längsschnittuntersuchungen: Wiederholte Erhebungen derselben Variablen zu mehreren Zeitpunkten in Bevölkerungsgruppen, die durch ein gemeinsam eintretendes, längerfristig prägendes Startereignis definiert werden. Je nach Ereignis können dies Geburts-, Sterbe-, Heirats-, Berufeintritts- oder auch Rentenkohorten sein. Gegenstand der Analyse sind Verhaltensweisen der Kohortenmitglieder im Zeitverlauf, z. B. Familiengründung, -auflösung, Migration. Trenduntersuchung: Die gleiche Variable wird zu mehreren Zeitpunkten an jeweils anderen Stichproben erhoben. Paneluntersuchung: Mehrere gleiche Variablen zu mehreren Zeitpunkten, im Gegensatz zur Trenderhebung allerdings auf der Grundlage einer identischen Stichprobe (z. B. Mikrozensus) (Engelhardt 2000). Demographie 223 durch ist ihre Anwendung zumeist auf die Analyse exakter retrospektiver Daten ohne allzu großen aktuellen oder prognostischen Wert beschränkt. Im Gegensatz dazu steht die Periodenanalyse, die zu einem exakten Zeitpunkt einen Querschnitt durch die betrachtete Bevölkerung erstellt. Sie besitzt den großen Vorteil einer kurzfristig zu erreichenden Momentaufnahme der Bevölkerung. Der ideale Einsatz dieser Vorgehensweise ist die Erstellung von Alterspyramiden (s. unten), mit denen der Altersaufbau des Bevölkerungsbestandes zu einem bestimmten Zeitpunkt dokumentiert wird. Damit können aktuelle Daten schnell zur Verfügung gestellt werden. Allerdings wird jedes der Mitglieder nur in einem bestimmten Moment erfasst, so dass Betrachtungen von Lebensläufen nicht möglich sind. In der Regel wird jedoch auch mit der Periodenanalyse versucht, Fragen zu Lebensverläufen zu beantworten. Dann wird der erfasste Bevölkerungsquerschnitt als eine fiktive Kohorte behandelt. Mitglieder unterschiedlichen Alters dieser Momentaufnahme werden dann derart betrachtet, als handle es sich um die gleichen Personen, die alle diese Altersklassen sukzessiv durchlaufen. Identisch sind Kohorten- und Periodendaten jedoch nur, wenn sich die erfassten Merkmale im zeitlichen Verlauf nicht ändern (Dinkel 1984, 1989). Am Vergleich von Sterbetafeln werden weiter unten (vgl. Kap. 3.3.4) die unterschiedlichen Auswirkungen von Kohortenund Periodenbetrachtung bei sich ändernden Merkmalen erläutert. Veränderungen im Bevölkerungsbestand stellen somit eine Herausforderung an die Demographie dar. Gerade in dieser Populationsdynamik ist die Schnittstelle zwischen demographischer und anthropologischer Forschung zu sehen. Biologische Adaptationsmechanismen mit populationsgenetischen Konsequenzen (vgl. Kap. 3.1; 3.2) lassen sich nur mit Kenntnis der demographischen Strukturveränderungen adäquat interpretieren. Als ein wesentliches theoretisches Konzept der Demographie, auf dem die Populationsdynamik beruht, gilt das Modell der stabilen Bevölkerung, das sich auf den Mathematiker Euler (1707–1783) zurückführen lässt, der sich intensiv mit der Frage von Existenz und Stabilität eines bevölkerungsstrukturellen Gleichgewichtes beschäftigt hat. In der Demographie wie in der Ökologie ist dies ein gleichermaßen aktuelles Arbeitsgebiet, das alle Organismen der belebten Natur betrifft. Kennzeichen einer stabilen Bevölkerung ist die langfristige Konstanz von altersspezifischen Fertilitäts- und Mortalitätsraten bei Ausschluss von Wanderungen. Dabei geht man zumeist von der weiblichen Bevölkerung aus, um die Komplexität durch das geschlechtsspezifisch unterschiedliche Fortpflanzungsverhalten zu vermeiden. Bleiben Fertilitäts- und Mortalitätsraten konstant, ändert sich der Bevölkerungsbestand bei gleich bleibender Altersstruktur mit einer konstanten Rate. Übersteigt die Geburtenrate die Sterberate, so spricht man von einer stabil wachsenden Bevölkerung. Ist das Verhältnis umgekehrt, handelt es sich um eine stabil schrumpfende Bevölkerung. Bei dem Sonderfall der stationären Bevölkerung tritt ein Gleichgewicht zwischen Geburten- und Sterberate ein, so dass auch die Bevölkerungszahl konstant bleibt. Dieses Modell der stabilen Bevölkerungen vereinfacht die realen Verhältnisse stark, es erfüllt jedoch seinen Zweck zur Charakterisierung biologischer Gegebenheiten in Bevölkerungen. Drei Modellanwendungen stehen dabei im Vordergrund: 224 • • • Bevölkerungsbiologie Im Rahmen des Modells lassen sich bestimmte demographische Parameter eindeutig definieren und beschreiben, die in konkreten Bevölkerungen dann stets unterschiedliche und einander vielleicht sogar widersprechende Bedeutung erhalten. Im Rahmen des Modells lassen sich in bestimmten Grenzen Aussagen über die Auswirkungen von Parametervariationen auf die einzelnen Modellelemente machen. In diesem Punkt ähnelt das Modell der stabilen Bevölkerung in seinem Nutzen, aber auch in seiner möglichen Verführung zur Fehlinterpretation stark dem, was Modelle in den Sozialwissenschaften typischerweise auszeichnet.Die strengen und unrealistischen Grundannahmen können aber schrittweise aufgelöst werden und man kann von der Basis des stabilen Modells ausgehend die Möglichkeiten und Grenzen der Beschreibung von Entwicklungen verstehen, die nicht mehr den Stabilitätseigenschaften entsprechen. Eine wichtige Funktion des Modells, weshalb es vor allem in den letzten Jahrzehnten auch so intensiv ausgebaut wurde, ist eine ganz unmittelbare Anwendungsfrage. Immer noch ist es für den überwiegenden Teil der Weltbevölkerung nicht selbstverständlich, dass exakte Informationen über Stand und Entwicklung einer nationalen Bevölkerung vorliegen. Kennt man aber beispielsweise nur das Ergebnis einer einzigen Volkszählung oder gar einer einzigen Altersgruppe im Bestand einigermaßen genau, lassen sich nur mit Hilfe des stabilen Bevölkerungsmodells approximative Beschreibungen von Struktur und Entwicklung der Gesamtbevölkerung gewinnen. Wesentliche Aspekte des Modells der stabilen Bevölkerung sind alleine zu dem Zweck formuliert worden, demographische Schätzwerte trotz unvollständiger statistischer Basisinformationen zu geben (Dinkel 1989). 3.3.3 Demographische Maßzahlen Die Datenerhebung in der Demographie liefert die Grundlage für die Analyse von Strukturbeschreibungen und Wandlungsprozessen einer Bevölkerung. Hierfür hat sich in der Demographie ein umfangreiches Methodeninventar entwickelt, das demographische Maßzahlen bereitstellt. Grundsätzlich werden zwei Maßkonzepte demographischer Merkmale unterschieden: • • Die Strukturmaße liefern eine Beschreibung der Verteilung von Merkmalsausprägungen in einer Bevölkerung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie werden auch als Zustandsmaße bezeichnet, da sie sich auf das Vorhandensein von Zuständen zu einem definierten Zeitpunkt beziehen. Die Anzahl der über 60jährigen oder der Erwerbstätigen sind beispielsweise derartige Maße. Hingegen beschreiben Ereignismaße, auch als Dynamikmaße bezeichnet, das Auftreten von Ereignissen innerhalb eines Zeitraumes, wie beispielsweise die Anzahl an Geburten oder Sterbefällen in einem Kalenderjahr. Gelegentlich sind die absoluten Zahlen von Bedeutung, wenn daran infrastrukturelle regionale Maßnahmen wie die Anzahl benötigter Kindergarten- Demographie 225 plätze, Krankenhausbetten oder Einrichtungen des Rettungssystems bemessen werden. Für alle Arten von Vergleichen der Ereignis- und Dynamikmaße sind jedoch die relativen Maßzahlen aussagekräftiger als die absoluten Werte. Sie werden als Quotient aus der absoluten Zahl des auftretenden Merkmals in der Bevölkerung und der zugrunde liegenden Gesamtheit oder Teilen derselben berechnet. Bei dieser Vorgehensweise ist große Sorgfalt auf den inhaltlich richtigen Bezug zwischen Merkmalszahl und Grundgesamtheit zu legen und immer zu fragen, ob mit der gewählten Maßzahl tatsächlich eine adäquate Antwort auf die gestellte Frage zu erzielen ist. Bezieht man beispielsweise den Anteil an Gestorbenen auf die zugrunde liegende Gesamtbevölkerung, so erhält man einen allgemeinen Durchschnittswert, eine Rohe Ziffer, welche die realen Veränderungen in der Bevölkerung wiedergibt. Da jedoch das Sterberisiko sehr stark mit dem jeweiligen Alter variiert, ist die Rohe Sterbeziffer nicht geeignet, die Dynamik des Sterbegeschehens in den Altersgruppen einer Bevölkerung auszudrücken. Hierzu bedarf es der Kalkulation spezifischer Ziffern, in diesem Fall altersspezifischer Ziffern. Bestehen dabei beide Maßzahlen des Quotienten aus Dynamikmaßen, spricht man von einer Ziffer. Ziffern drücken das Ausmaß eines Ereigniseintrittes innerhalb eines definierten Zeitraumes im Vergleich zu der dem Ereignis exponierten Bevölkerung, der Risikobevölkerung, aus (Expositionsmaß). Sterbeziffern beispielsweise kennzeichnen den Anteil der Gestorbenen unter den dem Risiko ausgesetzten Personen, beispielsweise eines Geburtsjahrganges in einem bestimmten Zeitintervall. Aus Strukturmaßen hingegen ergeben sich Quoten. Das Vorhandensein eines Merkmals zu einem bestimmten Zeitpunkt wird dabei im Verhältnis zu der absoluten Zahl aller Personen betrachtet, die dieses Merkmal aufweisen können. Ein Beispiel ist der mit dem Stichtag einer Volkszählung erfasste Anteil an Müttern unter den Frauen im gebärfähigen Alter (Müller 1993, Esenwein-Rothe 1982). Bevölkerungsaufbau und Bevölkerungsstruktur Zur Beschreibung demographischer Strukturen gehört zunächst einmal die Analyse der Bevölkerungsverteilung. Sie beschreibt die Streuung der Bevölkerung im Raum nach ihrer absoluten Zahl. Faktoren wie z. B. Klima, Bodenfruchtbarkeit, Verfügbarkeit infrastruktureller Einrichtungen oder die bereits vorhandene Bevölkerungsstruktur spielen eine wichtige Rolle für die Herausbildung bestimmter Verteilungsmuster. Die Bevölkerungsstruktur lässt sich dabei mittels dreier unterschiedlicher Merkmalsgruppen charakterisieren (Bähr 2000): • • • demographische Merkmale (Geschlecht, Alter, Familienstand, Familienstruktur Haushaltstyp), sozio-ökonomische Merkmale (Erwerbstätigkeit, Beschäftigung nach Wirtschaftszweigen, Stellung im Beruf, Bildungsstand), ethnische und kulturelle Merkmale (Staatsangehörigkeit, Konfession, ethnische Herkunft, sprachliche Gliederung). 226 Bevölkerungsbiologie Offen gehandhabt wird die Eingruppierung der Daten zu Familie und Haushalt, da sie je nach Fragestellung oft auch in einem sozio-ökonomischen Zusammenhang betrachtet werden (Knox u. Marston 2001). Die Merkmale Alter und Geschlecht als natürliche demographische Merkmale nehmen darunter eine Sonderstellung ein, da sie als Bezugsdaten für viele demographische Untersuchungen herangezogen werden. Bei der Gliederung nach Geschlecht stehen drei wesentliche Maße zur Verfügung (vgl. Tabelle 3.7). Bei allen drei Maßen stellt der Anteil an Frauen den Bezugswert dar, er wird als Basis betrachtet, um die der Anteil an Männern variiert. Diese Sichtweise hat sich in der Demographie aus verschiedenen Gründen herauskristallisiert. Zum einen stellen Frauen den demographisch und biologisch ausschlaggebenden Faktor für die Fruchtbarkeit dar. Legt man den Anteil Frauen für diese Strukturmaße zugrunde, lassen sich Fruchtbarkeitsmaße biologisch sinnvoller darstellen, als wenn diese anhand des Anteils an Männern berechnet würden. Zum anderen spielt eine weitere biologische Gegebenheit eine Rolle. Kinder können bei der amtlichen Registrierung nach ihrer Geburt zweifelsfrei ihren Müttern zugeordnet werden und somit lassen sich Fertilitätsmaße verzerrungsfrei darstellen. Die Zuordnung von Kindern zu ihren Vätern ist ungleich schwieriger und in der amtlichen Statistik demographischer Daten auch nur bedingt möglich. Die Altersstruktur einer Population gibt Auskunft über den Anteil einzelner Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung. Die Kenntnis der Altersstruktur in einer Gesellschaft ist wichtig für die Beschreibung und Prognose demographischer Entwicklungen. Üblicherweise wird in der Demographie eine Bevölkerung in Altersklassen eingeteilt, die je nach Fragestellung in Ein-Jahres- oder Fünf-Jahres-Klassen vorgenommen wird. Setzt man die Anzahl an Personen eines bestimmten Altersbereiches mit der einer anderen Altersgruppe oder derjenigen der Gesamtpopulation in Bezie- Tabelle 3.7. Demographische Maße zur Gliederung einer Bevölkerung nach Geschlecht Demographisches Maß Berechnung der Geschlechtsverteilung Dimension Gleichverteilung bei Wert x Männerüberschuss bei Wert x Anteil des männlichen Geschlechts an der Gesamtbevölkerung Relativer Männerüberschuß Sexualproportion nm nm n f Anteil Männer an der Gesamtbevölkerung nm n f Überschuss an Männern 100 in % bezogen auf die nm n f Gesamtbevölkerung nm Zahl der Männer auf 100 100 Frauen nf 0,5 >0,5 0 >0 100 >100 mit nm= Anzahl Männer in der Gesamtpopulation, nf = Anzahl Frauen in der Gesamtpopulation Demographie 227 hung, erhält man Proportionen, die als Maßzahlen zur Beschreibung des Altersaufbaus einer Bevölkerung geeignet sind, wie beispielsweise das als Abhängigkeitsquotient bezeichnete Zahlenverhältnis der wirtschaftlich abhängigen Altersgruppen zur Bevölkerung im erwerbstätigen Alter. In den Industriestaaten geht man meist von einem produktiven Alter zwischen 20 und 60 Jahren aus, in weniger entwickelten Ländern ist eher ein Alter zwischen 15 und 65 Jahren anzunehmen. Der Abhängigkeitsquotient a berechnet sich dann aus dem Bevölkerungsanteil der unter 15jährigen n0-14,dem Anteil der 65jährigen und Älteren n65-x und dem Anteil der Personen im erwerbstätigen Alter n15-65 wie folgt: Abhängigkeitsquotient: a = n 0 –14 + n 65 –x (in Entwicklungsländern, n15 –64 in Industrieländern n0-19) Zur Charakterisierung des Altersaufbaus einer Bevölkerung mittels einer einzigen Maßzahl ist der arithmetische Mittelwert nur bedingt aussagekräftig, da die Altersverteilung nicht der einer statistischen Normalverteilung entspricht, sondern eine schiefe Verteilung hin zu den jüngeren Jahrgängen darstellt. Aussagekräftiger ist das Medianalter, das eine Population statistisch in zwei gleich große Gruppen teilt, von denen eine Bevölkerungshälfte jünger als das Medianalter, die andere älter ist. Auf dem Medianalter basiert die Einteilung in junge Bevölkerungen (Medianalter unter 20 Jahren), mittlere Bevölkerungen (Medianalter 20–30 Jahre) und alte Bevölkerungen (Medianalter über 30 Jahre) (vgl. Kap. 3.2). Einen guten graphischen Überblick liefert die Bevölkerungspyramide, eine Momentaufnahme der Geschlechts- und Altersstruktur einer Bevölkerung. In einem Koordinatensystem werden die Anzahl oder der Anteil an Personen in den jeweiligen Altersgruppen als liegender Balken dargestellt. Von einer Mittellinie werden die Männer nach links, die Frauen nach rechts abgebildet. Drei Standardtypen der Bevölkerungspyramide lassen sich bestimmen unter den Annahmen, • • • dass eine geschlossene Bevölkerung ohne Zu- und Abwanderung vorliegt, dass die altersspezifischen Sterberaten konstant bleiben, dass die Geburtenrate entweder konstant bleibt oder sich um einen konstanten Faktor ändert. Bei derartigen stabilen Verhältnissen nimmt in vormodernen, traditionellen Bevölkerungen diese Altersverteilung die Form einer Pyramide an (vgl. Abb. 3.12). Sie charakterisiert eine junge, wachsende Bevölkerung, wie sie heute in den weniger entwickelten Ländern vorliegt. Bei Zunahme der Geburtenzahlen wird die Pyramidenbasis von Jahr zu Jahr breiter. Durch die gleichmäßige Sterblichkeit bildet sich die Pyramidenspitze, da sich die Sterberaten mit zunehmendem Alter auf immer geringer besetzte Altersgruppen auswirken. Der zweite Modelltyp ist die Glockenform oder Bienenkorbform, bei der die Geburtenzahl konstant bleibt und dadurch ein immer gleich bleibender Pyramidensockel durch Geburten nachgeschoben wird. Durch die konstante Sterblichkeit wird die Altersverteilung gleichmäßig reduziert, wobei die Glockenform durch die mit zunehmendem Alter wachsende Sterbewahrscheinlichkeit zustande kommt. 228 Bevölkerungsbiologie Abb. 3.12. Die Grundformen der Bevölkerungspyramide. Sie beschreibt die Altersstruktur einer Bevölkerung (oberes Textfeld), die Besetzung der Altersklassen ist zudem ein wesentliches Merkmal der Bevölkerungsdynamik (unteres Textfeld) Diese Form der Altersverteilung wiesen die europäischen Länder gegen Ende des ersten demographischen Überganges auf (s. unten). Heute weisen einige Länder Südamerikas, wie Brasilien, eine Glockenform der Bevölkerungspyramide auf. Bei zurückgehender Fertilität und Mortalität kehrt sich die Bevölkerungspyramide um. Dann verschmälert sich die Basis und die Spitze verbreitert sich. Daraus resultiert eine Urnenform, die umso ausgeprägter ist, je weiter die Bevölkerung in die zweite Phase des demographischen Überganges vorgedrungen ist. Dies charakterisiert eine schrumpfende und alternde Bevölkerung. Typisch für diese Form sind die aktuellen Bevölkerungspyramiden der Industrieländer (vgl. Abb. 3.13). Ein Bevölkerungseinbruch durch Krieg, eine Infektionskrankheit oder Wanderungswelle bildet sich in den Bevölkerungspyramiden ebenso ab wie gegenteilige Effekte durch Einwanderungen oder kurzfristige Fertilitätssteigerungen („Babyboom“). Aber so nützlich derartige Darstellungen auch sind, sie bleiben auf einer pauschalen Ebene, so dass vor einer schablonenhaften Anwendung der Modelle, Raten und Quoten gewarnt werden muss. Reale Bevölkerungen lassen sich nicht in ein Standardschema hineinpressen, da ein die Grundannahmen der Modelle übersteigender Komplex aus zahlreichen Einzelfaktoren auf die Bevölkerungsstruktur einwirkt. Bei einer Analyse der Bevölkerungsstruktur ist daher immer auf eine adäquate Anwendung und vor allem Interpretation der gewonnenen Daten zu achten. Die demographische Methodenliteratur liefert hierzu reichhaltige Hilfestellung (Dinkel 1989, Preston et al. 2001). Demographie 229 Abb. 3.13. Bevölkerungspyramide Deutschland 2002 (Datenquelle: Statistisches Bundesamt) Die Erfassung der Sterblichkeit (Mortalität) Einer der demographisch zentralen Parameter, welcher zur Beurteilung der Bevölkerungsstruktur und der Bevölkerungsdynamik herangezogen wird, ist die Sterblichkeit. Die strukturelle und bevölkerungsbezogene Betrachtung der Sterblichkeit erlaubt Rückschlüsse auf Sterberisiken, denen Bevölkerungen bzw. Teilbevölkerungen ausgesetzt sind, auf den Gesundheitszustand einer Bevölkerung und die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems. Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Strukturmaßen werden mit der Sterblichkeit Ereignismaße aufgestellt. Als ein geeigneter Indikator für die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems sowie für die sozioökonomische Situation eines Landes gilt die Säuglingssterberate, obwohl sie nicht die gesamte Sterblichkeit einer Bevölkerung erfasst. Sie gibt die Zahl der Sterbefälle von Kindern unter einem Jahr je 1000 Lebendgeburten an. Da das Risiko, während der Geburt zu sterben (perinatales Sterberisiko) das höchste während des ersten Lebensjahres ist, bezieht sich der Wert nur nominell auf das gesamte erste Lebensjahr, wird aber im eigentlichen Sinn hauptsächlich vom perinatalen Risiko geprägt, das statistisch die Sterbefälle der ersten sieben Lebenstage nach der Geburt erfasst. Dabei hängt die Höhe der Säuglingssterberate nicht nur von der Mortalität der Neugeborenen selbst, sondern auch ganz entscheidend von der Definition einer „Lebendgeburt“ ab, weswegen gerade bei internationalen Vergleichen große Vorsicht geboten ist. Nach der internationalen Konvention der Weltgesundheitsorganisation WHO wird für die Definition einer Lebendgeburt das Auftreten von eigenständigen Lebenszeichen des Kindes gefordert. Dass die praktische Handhabung der Regel der Lebenszeichen durch religiöse und erbrechtliche Situationen beeinflusst werden kann, ist bei internationalen Vergleichen der Säuglingssterblichkeit zusätzlich zu jeweils unterschiedlichen Definitionen zu 230 Bevölkerungsbiologie beachten. Stirbt ein Neugeborenes kurz nach der Geburt, wird es in der Sterblichkeitsstatistik aufgeführt, während ein totgeborenes Kind nicht als Säuglingssterbefall, sondern lediglich als Totgeburt in der Statistik erscheint. In Deutschland wird ein Geburtsgewicht von mindestens 500g als Kriterium dafür gefordert, dass eine Totgeburt in die Statistik eingeht. Niedrigere Gewichte gelten als Fehlgeburt und erscheinen gar nicht in der Geburtenstatistik. Solch eine niedrige Gewichtsgrenze ist jedoch nur in Ländern sinnvoll, in denen, mit allerdings hohem medizinischen Aufwand und oftmals mit gesundheitlichen Folgeschäden für das Kind, eine Frühgeburt mit derart niedrigem Geburtsgewicht lebensfähig ist. Als einfachstes Maß der Sterblichkeit einer gesamten Bevölkerung dient die Rohe Sterberate (vgl. Tabelle 3.8), welche die absolute Zahl der Todesfälle eines definierten Zeitraumes (in der Regel ein Kalenderjahr) pro 1000 Einwohner angibt. Üblicherweise wird dazu der Bevölkerungsbestand zur Jahresmitte angenommen, der genau genommen aber nur unter sehr unwahrscheinlichen Voraussetzungen dem Expositionsrisiko über den Jahresverlauf entspricht (Preston et al. 2000). Da die Rohe Sterberate stark von der Altersstruktur abhängt, sagt sie allein nicht viel über den Gesundheitszustand und die Sterblichkeit einer Bevölkerung aus. So ist beispielsweise die Rohe Sterberate in einer jungen Bevölkerung bei gleichem altersspezifischen Sterberisiko naturgemäß niedriger als in einer alten Bevölkerung. Da ein demographisches Ereignis wie der Tod in einer Bevölkerung nicht für alle Menschen gleich wahrscheinlich ist, sind erst standardisierte Sterberaten geeignet, die tatsächlichen Risiken zu beschreiben. So beziehen die altersspezifischen Sterberaten die Anzahl der Sterbefälle in einer bestimmten Altersstufe auf je 1000 Personen gleichen Alters, wobei die Raten meist auch geschlechtsspezifisch berechnet werden. Eine aus der alters- und geschlechtsspezifischen Sterblichkeit abgeleitete Kennziffer ist die Lebenserwartung. Gegenüber anderen Mortalitätsziffern Tabelle 3.8. Demographische Basismaße zur Sterblichkeit Sterblichkeitsmaß Berechnung Rohe Sterberate m (crude death rate) Zahl der Todesfälle D in einem Jahr t0 Õ t1 je 1000 Personen der Bevölkerung P (dient als ein Faktor zur Bestimmung der Bevölkerungsgesamtzahl) Anteil der im ersten Lebensjahr gestorbeS t 0 t1 1000 m0 nen Säuglinge S pro 1000 Lebendgeborene Gt 0 t1 G des gleichen Zeitraumes t0 Õ t1 (wichtiger Indikator für Standard des Gesundheitswesens und allgemeines sozioökonomisches Entwicklungsniveau) Zahl der Todesfälle im Alter x, Dx, bezogen D x(t 0 t1) 1000 auf 1000 Personen des durchschnittlichen mx P x(t 0 t1) Bevölkerungsbestandes Px im gleichen Zeitraum t0 Õ t1 Säuglingssterberate m0 (infant mortality) Altersspezifische Sterberate mx m Dt 0 t1 1000 P t 0 t1 Bedeutung Demographie 231 wie der Rohen Sterberate oder altersspezifischen Sterberaten besitzt die Lebenserwartung den Vorteil, von der Altersstruktur der untersuchten Bevölkerung unabhängig zu sein, da zu ihrer Berechnung die altersspezifischen Ereigniswahrscheinlichkeiten standardisiert werden. Die Lebenserwartung kann mit Hilfe einer Sterbetafel (engl. life table) berechnet werden. Die Sterbetafel stellt ein Modell dar, mit dem sich die Sterblichkeitsverhältnisse einer gesamten Population darstellen lassen. Sterbetafeln können als das älteste Modell der demographischen Analyse angesehen werden. Erste Versuche gehen in das 17. Jahrhundert auf John Graunt 1662 und Edmond Halley 1693 zurück (Berlin Institut für Weltbevölkerung und globale Entwicklung o.J.). Mittlerweile stellen methodisch ausgereifte Sterbetafeln das am weitesten verbreitete Instrumentarium zum Vergleich von Sterblichkeitsverhältnissen dar. Ihre Funktion wird in der Beantwortung der folgenden Fragen gesehen (Dinkel 1984, Esenwein-Rothe 1982): • • • • Wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt? Wie viele Lebensjahre hat eine Person im Alter x noch zu erwarten (fernere Lebenserwartung)? Wie hoch ist das Risiko einer Person im Alter x, innerhalb des nächsten Altersjahres zu sterben? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit einer Person im Alter x, ein bestimmtes höheres Alter zu erreichen? Es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten zur Erstellung von Sterbetafeln. Die Kohortensterbetafel, die einen Geburtsjahrgang bezüglich seiner Sterblichkeit verfolgt, ist für amtliche Statistiken kaum von Bedeutung, da sie retrospektiv eine bereits durch Sterblichkeit aufgelöste Kohorte in einer Längsschnittuntersuchung verfolgen muss. Dies ist in der Praxis kaum möglich und liefert zudem Aussagen über die Sterblichkeit einer inzwischen historischen Bevölkerung, deren prognostischer Wert äußerst eingeschränkt sein dürfte (Feichtinger 1973). Aufgrund der größeren Aktualität und der besseren Erhebbarkeit gehen amtliche Sterbetafeln und zahlreiche Untersuchungen zur Mortalität daher von einem kurzen Zeitraum aus, dem eine Querschnittserhebung von Sterbefällen zugrunde liegt, die in Periodensterbetafeln beschrieben wird. Damit wird die gegenwärtig herrschende Sterblichkeit einer realen Bevölkerung in eine hypothetische Längsschnittbetrachtung für eine fiktive Kohorte umgesetzt. Dies hat eine Reihe von Konsequenzen für die berechnete Lebenserwartung, da Perioden- und Kohortensterbetafeln beträchtlich divergieren können. Für Schweden liegen seit dem 18. Jahrhundert Sterblichkeitsdaten in einer Weise vor, die geeignet ist, Vergleiche von Perioden- und Kohortensterbetafeln vorzunehmen. Ein Vergleich zeigte eine infolge des kontinuierlichen Rückganges der Sterblichkeit systematische Unterschätzung der Lebenserwartung in Periodentafeln. Weiterhin wurde beobachtet, dass Periodendaten stärkeren Schwankungen unterliegen als Kohortendaten, und in bestimmten Situationen kann die aus Periodendaten berechnete Lebenserwartung sinken, während diejenige aus Kohortendaten steigt (Dinkel 1984). Insbesondere ist problematisch, dass die in einem kurzen Zeitraum erhobenen Daten zur Erstellung einer Periodensterbetafel die momentanen Sterblichkeitsverhältnisse messen und diese in einen Längsschnitt 232 Bevölkerungsbiologie projizieren. So wird zum Beispiel für die heute 20jährigen angenommen, dass sie in 20 Jahren die Sterblichkeit der heute 40jährigen aufweisen, usw. Dies ist nicht gerechtfertigt, wenn sich die altersspezifischen Mortalitätsraten im Zeitverlauf derart verändern, wie dies seit Beginn des letzten Jahrhunderts der Fall ist. Vorhersagen der Lebenserwartung können daher mit zunehmendem zeitlichen Abstand von der Erhebung wachsende Verzerrungen liefern, die zu prognostischen Fehlinterpretationen großen Ausmaßes führen können (Klein 1988). Grundlage einer Periodensterbetafel sind die Sterblichkeitsverhältnisse zum Zeitpunkt ihrer Beobachtung als Querschnittsbetrachtung über alle Altersgruppen. Diese Sterblichkeitsverhältnisse werden auf eine fiktive Grundgesamtheit von in der Regel 100 000 Personen übertragen, die dann derart dargestellt wird, dass diese Grundgesamtheit die Sterberisiken aller Altersklassen von Geburt an durchläuft, bis die letzte, also älteste Person, gestorben ist. Die durch eine Querschnittsbetrachtung gewonnenen Kennziffern werden damit gewissermaßen als künstlicher Längsschnitt aufgefasst. Das Grundschema einer Sterbetafel stellt sich wie in Tabelle 3.9 dar. Die einzelnen Spalten errechnen sich dabei wir folgt: • x (vollendetes Alter x in Jahren): Die Breite der Altersklasse wird zumeist mit einem Jahr berechnet. Die abgekürzte Sterbetafel benutzt 5-JahresKlassen • lx (Überlebende im Alter x): lx kennzeichnet den Anfangsbestand bei Eintritt in die Altersklasse. Bei Geburt (Alter = 0) ist der Anfangsbestand per definitionem 100 000. Die Überlebenden bei Eintritt in die Altersklasse berechnen sich aus: lx = lx-1 – dx-1 • dx (Gestorbene im Alter x bis x+1): Differenz zwischen den Überlebenden bei Eintritt in die betrachtete Altersgruppe und den Überlebenden der folgenden Altersgruppe: dx = lx – lx+1 • • qx (Sterbewahrscheinlichkeit im Alter x bis x+1): altersspezifische Sterbewahrscheinlichkeit, d. h. innerhalb der Altersklasse Gestorbene bezogen auf den Bevölkerungsbestand zu Beginn der Altersklasse, also zum Zeitpunkt des exakten Erreichens des Alters x: d qx = x lx Lx (von den Überlebenden im Alter x bis zum Alter x+1 durchlebte Jahre): Anzahl der Lebensjahre, die von sämtlichen Lebenden in der Altersklasse x bis x+1 durchlebt werden. Die in die nächsthöhere Altersgruppe Eintretenden gehen mit jeweils einem ganzen Jahr in die Berechnung ein. Weiterhin geht man einfachheitshalber von der Annahme aus, dass sich die Sterbefälle für die jeweilige Altersklasse gleichmäßig über den Beobachtungszeitraum Demographie 233 Tabelle 3.9. Ausschnitt der Sterbetafel für deutsche Männer 2001 (Datenquelle: Statistisches Bundesamt) Vollendetes Alter x in Jahren Überlebende im Alter x Gestorbene Sterbeim Alter x wahrscheinbis unter x+1 lichkeit Überlebenswahrscheinlichkeit Von den Überlebenden im Alter x bis zum Alter x+1 durchlebte Jahre im Alter x bis x+1 Durchschnittliche fernere Lebenserwartung im Alter x in Jahren insgesamt noch zu durchlebende Jahre x lx Lx Tx ex 0 100 000 388 0,00388307 0,99611693 99 677 8 106 989 81,07 1 99 612 36 0,00036318 0,99963682 99 594 8 007 312 80,39 2 99 576 21 0,00021403 0,99978597 99 565 7 907 719 79,41 3 99 554 16 0,00016037 0,99983963 99 546 7 808 154 78,43 4 99 538 14 0,00013863 0,99986137 99 531 7 708 607 77,44 5 99 524 10 0,00010259 0,99989741 99 519 7 609 076 76,45 6 99 514 11 0,00011122 0,99988878 99 509 7 509 557 75,46 7 99 503 10 0,00010298 0,99989702 99 498 7 410 048 74,47 8 99 493 9 0,00009371 0,99990629 99 488 7 310 550 73,48 9 99 484 0,9999 99 479 7 211 062 72,48 10 99 474 9 0,0000926 0,9999074 99 469 7 111 583 71,49 11 99 464 10 0,00009676 0,99990324 99 460 7 012 114 70,50 12 99 455 10 0,00010206 0,99989794 99 450 6 912 655 69,51 13 99 445 12 0,00011875 0,99988125 99 439 6 813 205 68,51 14 99 433 15 0,0001502 0,9998498 99 425 6 713 766 67,52 15 99 418 18 0,00018384 0,99981616 99 409 6 614 341 66,53 16 99 400 21 0,00021593 0,99978407 99 389 6 514 932 65,54 17 99 378 28 0,00027782 0,99972218 99 364 6 415 543 64,56 18 99 351 34 0,0003434 0,9996566 99 334 6 316 179 63,57 19 99 316 37 0,00037143 0,99962857 99 298 6 216 845 62,60 20 99 280 33 0,00033394 0,99966606 99 263 6 117 547 61,62 75 77 054 2 101 0,02726904 0,97273096 76 003 905 703 11,75 76 74 953 2 329 0,03106984 0,96893016 73 788 829 700 11,07 77 72 624 2 537 0,03493483 0,96506517 71 355 755 912 10,41 78 70 087 2 771 0,03954067 0,96045933 68 701 684 557 9,77 79 67 315 3 140 0,04664825 0,95335175 65 745 615 856 9,15 80 64 175 3 304 0,0514897 0,9485103 62 523 550 110 8,57 81 60 871 3 555 0,0584044 0,9415956 59 093 487 587 8,01 82 57 316 3 601 0,062824 0,937176 55 515 428 494 7,48 83 53 715 3 918 0,0729438 0,9270562 51 756 372 979 6,94 84 49 797 4 228 0,0849148 0,9150852 47 683 321 223 6,45 85 45 568 4 323 0,094863 0,905137 43 407 273 540 6,00 86 41 246 4 425 0,1072826 0,8927174 39 033 230 133 5,58 87 36 821 4 377 0,1188641 0,8811359 34 632 191 100 5,19 88 32 444 4 307 0,1327437 0,8672563 30 291 156 468 4,82 89 28 137 4 183 0,1486788 0,8513213 26 046 126 177 4,48 90 23 954 100 132 100 132 4,18 dx qx 10 0,0001 px . . . 23 954 1 0 234 • Bevölkerungsbiologie verteilen und damit für die in der Altersklasse Gestorbenen jeweils die halbe Länge der Zeitraums angesetzt werden kann: d Lx = l x+1 + x 2 Tx (von den Überlebenden im Alter x insgesamt noch zu lebende Jahre): Die insgesamt zur Verfügung stehende Anzahl an Lebensjahren für alle Mitglieder der Bevölkerung im Alter x berechnet sich aus der Summe aller folgenden Lx-Werte. Dieser Wert steht für alle Geborenen im Alter 0 zur Verfügung und reduziert sich in jeder Altersklasse um die Anzahl der bei ihrem Durchleben „verbrauchten“ Jahre: T 0 = ∑L x , T x = T x −1 − L x −1 (mit x = 1 bis x = max) • ex (durchschnittliche Lebenserwartung im Alter x): ex ergibt sich durch Division der insgesamt noch zu lebenden Jahre Tx durch den Bestand an Personen bei Eintritt in die Altersklasse lx; daraus resultieren die durchschnittlich noch zu lebenden Jahre: T ex = x lx In der Sterbetafel ist die Lebenserwartung von Neugeborenen, zumeist als mittlere Lebenserwartung bezeichnet, die durchschnittliche Lebenszeit, die unter der Annahme unveränderter Sterblichkeit zu erwarten ist. Sie spiegelt demnach die derzeitige gesundheitliche Lage der Bevölkerung wider. Im Anschluss an Volkszählungen lassen sich Allgemeine Sterbetafeln erstellen, deren Daten von Stichprobeneffekten bereinigt und statistisch geglättet sind. Sie sind daher präziser als aus Daten der Bevölkerungsfortschreibung berechnete Tafeln. Gehen Sterbewahrscheinlichkeiten ungeglättet in die weiteren Berechnungen ein, spricht man von vollständigen Sterbetafeln in vereinfachter Form. Solche Berechnungen werden in der Regel von den statistischen Ämtern jährlich für den Zeitraum zwischen zwei Volkszählungen vorgenommen. Werden zudem Altersgruppen zusammengefasst, zumeist üblich in 5-Jahres-Klassen, spricht man von verkürzten Sterbetafeln. Die Parameter der Lebenserwartung, die in einer Sterbetafel berechnet werden, stellen Durchschnittwerte für die untersuchte Bevölkerung dar. Die Anwendung der individuellen Interpretation von Parametern der Lebenserwartung ist daher nicht möglich. Ein bei den Interpretationen von Sterbetafeln vielfach unberücksichtigter Effekt ergibt sich aus dem unterschiedlichen Mortalitätsrisiko in der beobachteten Bevölkerung. Da vor allem diejenigen Bevölkerungsmitglieder sterben, die (durch entsprechende gesundheitliche Risikofaktoren) auch einem hohen Mortalitätsrisiko unterliegen, findet damit eine Selektion statt, die in einer Bevölkerung mit hoher Sterblichkeit in jüngerem Alter folglich ältere Menschen von vergleichsweise guter Gesundheit hinterlässt. Diese Kumulation hat eine Unterschätzung der Mortalitätsentwicklung in höherem Alter zur Folge, wodurch die Lebenserwartung zu günstig eingeschätzt wird. Der gleiche Effekt mit umgekehrter Wirkung ist in der Folgezeit nach Selektionsmechanismen Demographie 235 zu beobachten, die eher Bevölkerungsteile mit gutem Gesundheitszustand dezimieren, die unter normalen Bedingungen einem niedrigen Mortalitätsrisiko ausgesetzt sind. So zeigte sich, dass in Bevölkerungen, die kriegsbedingt unter einem frühen Ausscheiden besonders viriler Männer zu leiden hatten, Männer mit schlechtem Gesundheitszustand überwiegen. Dies führt zu erhöhter Mortalität bei deren Alterung, was in sowjetischen Sterbetafeln sogar zeitweise zu einer scheinbar sinkenden Lebenserwartung geführt hat (Dinkel 1985). In der paläodemographischen Anwendung von Sterbetafeln (vgl. Kap. 2.3.4) ist die Besetzung der Altersgruppen lx, auf die sich die Anzahl der Gestorbenen im jeweiligen Alter bezieht, nicht verfügbar. Da Sterbetafeln eine stationäre Bevölkerung simulieren, lässt sich bei dieser Anwendung die Altersklassenbesetzung als komplementärer Wert derjenigen der Gestorbenen berechnen. Die Erfassung der Fruchtbarkeit (Fertilität) Von der biologischen Fruchtbarkeit, welche die Fortpflanzungsfähigkeit beschreibt, ist die demographische Definition der Fertilität zu unterscheiden, welche die Zahl der Lebendgeburten von Frauen beschreibt. Aufgrund von zwei Faktoren bedarf die demographisch gemessene Fertilität eines besonderen methodischen Zuganges: • • Sie stellt ein „Mehrfachrisiko“ dar, was bedeutet, dass das Ereignis im Gegensatz zu der Sterblichkeit mehrfach wiederholbar ist. Nicht alle Mitglieder einer Bevölkerung sind dem „Ereignisrisiko“ ausgesetzt. Die biologischen Möglichkeiten begrenzen bei Frauen diesen Zeitraum ab der Menarche bis zur Menopause (vgl. Kap. 4.2), bei Männern von der Pubertät bis in das hohe Erwachsenenalter. Daher werden Fruchtbarkeitsraten zumeist geschlechts- und altersspezifisch ermittelt. Die Fertilität ist der am stärksten eine Bevölkerungsstruktur formende Parameter. Veränderungen in der Fruchtbarkeit pflanzen sich über alle Altersklassen fort, während Veränderungen der Sterblichkeit sich lediglich ab dem entsprechenden Alter in der Bevölkerungsstruktur auswirken. Da sich die Sterblichkeit in den Industrieländern nahezu ausschließlich im Alter über 60 Jahre auswirkt, ist der Effekt von Sterblichkeitsveränderungen deutlich geringer als der Effekt sich verändernder Geburtenraten. Einige der wesentlichen Maßzahlen zur Berechnung der Fertilität sind in Tabelle 3.10 aufgeführt. Mit der als Rohe Geburtenrate bezeichneten Maßzahl wird die Anzahl der Lebendgeborenen auf je 1000 Personen der Bevölkerung bezogen. Bedeutung bekommt dieses Maß im Vergleich zu der Rohen Sterberate. Werden beide Werte in Bezug gesetzt, lässt sich daraus ermitteln, ob in der betreffenden Bevölkerung ein Geburten- oder ein Sterbeüberschuss herrscht. Allein betrachtet ist die Rohe Geburtenrate jedoch wenig aussagekräftig, da sie nicht auf die Personengruppe bezogen ist, welche die Geburtenstatistik formt, nämlich die Frauen im gebärfähigen Alter. Als erster Schritt zur Eliminierung an der Fertilität unbeteiligter Bevölkerungsanteile wird die allgemeine Geburtenrate angesehen. Die Gesamtzahl der erfassten Geburten wird dabei auf Frauen im Alter zwischen 15 und 45 Jahren bezogen. 236 Bevölkerungsbiologie Tabelle 3.10. Demographische Maßzahlen zur Fertilität Fertilitätsmaß Berechnung Bedeutung Rohe Geburtenrate gbr (crude birth rate) Zahl der Geborenen G in der ZeiteinG g br t 0 t1 1000 heit t0 bis t1 je 1000 Personen des P t 0 t1 Bevölkerungsbestandes P in der gleichen Zeiteinheit Allgemeine Geburtenrate g Zahl der Geborenen G in der ZeiteinGt 0 t1 1000 g heit t0 bis t1 je 1000 Frauen f im Alter (general fertility rate) P f ,15 44 15-44 Jahre in der gleichen Zeiteinheit Zahl der Geborenen G in der ZeiteinAltersspezifische FruchtG x (t 0 t1) barkeitsrate gx gx 1000 heit t0 bis t1 je 1000 Frauen f einer AlP f,x (age-specific fertility rate) tersklasse x in der gleichen Zeiteinheit Gesamtfruchtbarkeitsrate Summe der altersspezifischen Frucht44 TFR barkeitsraten gx, TFR g x fasst die Fertilität aller gebärfähigen (total fertility rate) x 15 Frauen in einem Zeitraum zusammen Um Veränderungen in der Altersstruktur der gebärfähigen Frauen zum Ausdruck zu bringen, wird in altersspezifischen Fruchtbarkeitsraten die Anzahl von Lebendgeborenen von Müttern einer bestimmten Altersklasse auf je 1000 Frauen der selben Altersklasse bezogen. Die Gesamtfruchtbarkeitsrate TFR gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Laufe ihres Lebens durchschnittlich bekommen würde, wenn die im erfassten Zeitraum beobachteten altersspezifischen Fruchtbarkeitsverhältnisse auf ihre gesamte fertile Alterspanne angewandt werden und sie die komplette reproduktive Lebensphase überlebt. Die Erfassung räumlicher Bevölkerungsbewegungen (Migration) Als Wanderungsvorgänge werden dauerhafte Wohnortwechsel über die Gemeindegrenze hinaus bezeichnet (Knox u. Marston 2001). Ihre Analyse erlaubt Rückschlüsse auf die Mobilität der betrachteten Bevölkerung. Es lässt sich ermitteln, ob die Region ein durch Zuwanderungen aus anderen territorialen Einheiten oder von Abwanderungen betroffenes Gebiet darstellt. So werden Sozial- bzw. Altersstrukturen in einer Population durch gezielte Wanderungsbewegungen bestimmter Teilgruppen geformt. Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebot, Wohnraumangebot, Gesundheitsversorgung, kulturelle Infrastruktur, landschaftliche Attraktivität und Familienzusammenführung sind die wesentlichsten Gründe für Wohnortwechsel. Der soziale Wandel einer Region mit seiner räumlichen Struktur und Ausstattung wird dadurch maßgeblich gesteuert. Neben der demographischen Bedeutung der infrastrukturellen Gliederung sind Wanderungsbewegungen auch von biologischer Bedeutung. Die Allelverteilung genetischer Merkmale wird direkt von der Tatsache beeinflusst, ob es sich um eine Isolatbevölkerung handelt oder ob Gendrifteffekte wirksam werden. Ebenso ist die endemische bzw. epidemische Krankheitsverbreitung eng an das Mobilitätsverhalten einer Bevölkerung gekoppelt (vgl. Kap. 3.2). Die po- Demographie 237 Tabelle 3.11. Demographische Maßzahlen zur Migration Maß zur Migration Berechnung Bedeutung Wanderungsbilanz, w n Wi t 0 t1 We t 0 t1 Wanderungssaldo, Nettowanderung wn (net migration) Wanderungsbilanzrate, wn 1000 Nettowanderungsrate wb wb P t 0 t1 (net migration rate) Allgemeine Mobilitätsrate (general mobility rate) wbr Wi, t 0 t1 We, t 0 t1 P t 0 t1 1000 Differenz zwischen Zahl der Zuzüge Wi und der Fortzüge We in der Zeiteinheit t0 bis t1 Wanderungsbilanz wn bezogen auf 1000 Einwohner der Bevölkerung P in der Zeiteinheit t0 bis t1 Summe aller Wanderungsvorgänge (Zuzüge Wi und Fortzüge We) für ein bestimmtes Gebiet im Zeitraum t0 bis t1, bezogen auf 1000 Einwohner der Bevölkerung pulationsgenetische und epidemiologische Untersuchung einer Region hat daher stets die Migrationsverhältnisse einzubeziehen (vgl. Kap. 3.1). Für die Analyse von Wanderungsprozessen können die Push- und Pull-Faktoren herangezogen werden, die vor allem in der geographischen Literatur intensiv beschrieben und diskutiert werden. Als Push-Faktoren werden Ereignisse oder Bedingungen bezeichnet, die eine Person veranlassen, ihren bisherigen Wohnstandort zu verlassen. Pull-Faktoren hingegen stellen attraktive Ereignisse oder Bedingungen dar, die eine Person veranlassen, in einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Region einzuwandern (Knox u. Marston 2001). Je nach Beweggrund für Wanderungen oder Distanzen werden verschiedene Begrifflichkeiten in der Wanderungsstatistik unterschieden. Unter Außenwanderungen versteht man Wanderungen über die Grenze des betrachteten geographischen Raumes, in der Regel über die Staatsgrenze hinaus, Binnenwanderungen umschreiben Wohnortwechsel innerhalb der betrachteten Gebietseinheit. Völkerwanderungen betreffen größere Bevölkerungsteile. Gründe für diese Art von Wanderungen können in schwindenden Ressourcen, der Suche nach neuen Siedlungsgebieten bzw. Arbeitsplätzen in einer wachsenden Population liegen oder durch militärische oder politische Veränderungen bedingt sein, die eine notgedrungene Suche nach neuem Lebensraum erzwingen (Müller et al. 2000a,b, Hoffmeyer-Zlotnik 2000). Das Wanderungsvolumen (vgl. Tabelle 3.11) drückt die Mobilität der Bevölkerung aus, unabhängig davon, ob es sich um Zu- oder Abwanderungen handelt. Ein hoher Wert bedeutet, dass es sich um eine Bevölkerung mit starker Bevölkerungsumschichtung aufgrund von Wanderungstätigkeit handelt. Die Berechnungen weiterer demographischer, sozioökonomischer und ethnisch-kultureller Strukturmaße von Bevölkerungen sollen hier nicht weiter ausgeführt werden. Sie finden sich in der allgemeinen demographischen Literatur (Müller 1993, Esenwein-Rothe 1982, Müller et al 2000a,b). 238 Bevölkerungsbiologie 3.3.4 Die demographische Alterung Während die biologische Alternsforschung die mit dem Alter korrelierten Veränderungen im menschlichen Körper dokumentiert, wird in der Demographie der Alternsprozess als zeitliche (kalendarische) Veränderung von Zuständen auf der Populationsebene verstanden. Diese Alterung kann man daher als durchschnittliche Veränderung der Altersstruktur von Bevölkerungsgesamtheiten umschreiben (Dinkel 1992). Allerdings sind die Faktoren des biologischen Alterns, des sozialen Alterns und des demographischen Alterns nicht unabhängig. Sie bedingen sich gegenseitig in einem komplexen Phänomen, das sich im zeitlichen und räumlichen Vergleich höchst variabel darstellt. Als wichtiges Merkmal des Altersstrukturwandels ist die stetige Zunahme der durchschnittlichen Lebenserwartung seit Beginn des 20. Jahrhunderts zu nennen. Während in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Lebenserwartung eines Neugeborenen noch zwischen 39 und knapp 50 Jahren lag (Imhof 1994), haben Neugeborene in den westlichen Industrieländern heute die Aussicht, über 80 oder sogar 100 Jahre alt zu werden (Vaupel 1997). Damit hat sich die durchschnittliche Lebenserwartung in den letzten 100 Jahren mehr als verdoppelt (Birg 1996). In den hochentwickelten Industrieländern werden bereits etwa zwei Drittel aller Menschen über 70 Jahre alt. Diese Entwicklung ist einerseits der gesunkenen Kindersterblichkeit zu verdanken, die seit prähistorischen und historischen Zeiten bis in das letzte Jahrhundert hinein vor allem durch das hohe Sterberisiko im Säuglingsalter große Verluste forderte (vgl. Kap. 2.3.4). So hatte im Mittelalter nur etwa jedes dritte Neugeborene die Chance, das erste Lebensjahr zu überleben. Noch 1855 starb in Deutschland ein Viertel der Geborenen im ersten Lebensjahr (Imhof 1994) Bis in unsere heutige Zeit sank die Säuglingssterblichkeit weiterhin stetig auf derzeit 4–5 Sterbefälle pro 1000 Lebendgeborene. Aufgrund der drastischen Reduzierung spezifischer Todesursachen, insbesondere der Infektionskrankheiten, erreichen nun 995 von 1000 Lebendgeborenen das 2. Lebensjahr (vgl. Abb. 3.14). Aber auch alle anderen Altersgruppen haben im Laufe der Zeit einen Rückgang der Sterberisiken erfahren. Dass dieser Trend weiterhin anhält, hat Dinkel (1992) dadurch nachweisen können, dass sich trotz eines immer enger werdenden biologischen Spielraumes der Rückgang der Sterbewahrscheinlichkeiten in den alten Bundesländern in den letzten Jahren nicht verringert hat, sich sogar eher noch beschleunigt. Somit lässt sich die demographische Alterung als ein Phänomen beschreiben, zu dem die gesamte Bevölkerung beiträgt. Sie kann nicht nur als isoliertes Produkt von Veränderungen in höherem Alter betrachtet werden, sondern ist durch das Zusammenwirken von sinkender Sterblichkeit in allen Altersgruppen und abnehmender Fruchtbarkeit gekennzeichnet. Eine besondere Dynamik der Bevölkerungsentwicklung, die in hohem Maße zu der demographischen Alterung beiträgt, ist vor allem bei den Bevölkerungsgruppen der Älteren zu beobachten. Diese zu beobachtenden Veränderungen sind derart ausgeprägt, dass man regelrecht von den „drei Gesichtern des Alterns“ sprechen kann (Wittwer-Backofen 2002a): Demographie 239 Abb. 3.14. Überlebenskurven unter verschiedenen Lebensbedingungen. Unter Ausschalten der extrinsischen Risiken ergibt sich das „rektanguläre Modell“ mit einer Kumulierung der biologischen Risiken am Ende der Lebenszeit (nach Fries 1989) „Kaum Sterberisiko unter 60“ – Immer mehr Menschen erreichen 60 Jahre Ein hohes Alter zu erreichen, ist nicht mehr ein rares Gut wie in der Vergangenheit. Noch 1890 waren lediglich 5 von 100 Deutschen über 60 Jahre alt. In den Industrieländern erreichen heute mehr als 90% aller Menschen dieses Alter. Dieser Wert sagt jedoch noch nichts über die Altersverteilung in einer Bevölkerung aus. Häufig wird daher der Anteil der über 60jährigen als Maß für die demographische Alterung herangezogen. Er steigt schnell an: Waren vor 50 Jahren 15% der deutschen Bevölkerung über 60 Jahre alt, sind es heute bereits über 20% und für das Jahr 2050 wird ein Anteil von über 30% prognostiziert. Im weltweiten Vergleich sind die höchsten Anteile älterer Menschen in Europa und Nordamerika zu beobachten. Für die nächsten Jahrzehnte wird jedoch insbesondere für die lateinamerikanischen und asiatischen Länder ein extremer Anstieg erwartet, da diese dem demographischen Trend der Steigerung der Lebenserwartung und dem Absinken der Fertilität den Industrieländern verzögert, aber umso schneller folgen. Das Medianalter, die Altersschwelle, oberhalb und unterhalb derer jeweils die Hälfte der Bevölkerung liegt, verdeutlicht diesen Trend (vgl. Abb. 3.15). Die Betrachtung des Anteils der über 60jährigen ist problematisch, da er von der Besetzung der anderen Altersklassen im zeitlichen Verlauf abhängig ist, vor allem von jener der Kinder. Als Hauptmechanismus der demographischen Alterung dient der Rückgang der Fertilität allerdings nur so lange, bis die geburtenschwachen Jahrgänge in das Alter über 60 Jahre eintreten. Bei einem dazu parallel verlaufenden weiteren Rückgang der Sterblichkeit unter der älteren Bevölkerung kommt es zu einem zusätzlichen und stärkeren Altern von der Spitze der Bevölkerungspyramide. Dies erklärt den momentanen im internationalen Vergleich relativ geringen Bevölkerungsanteil von Menschen 240 Bevölkerungsbiologie Abb. 3.15. Medianalter in den großen Weltregionen im Jahr 2000 und Prognose für das Jahr 2050 (Datenquelle: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, nach Wittwer-Backofen 2002a) Abb. 3.16. Entwicklung des Anteils der über 60jährigen in Relation zu den 20- bis 60jährigen in Deutschland im zeitlichen Verlauf (bis 1989 BRD, danach Deutschland gesamt, Prognosen für 2010 und 2020) (Datenquelle: Statistisches Bundesamt) Demographie 241 über 60 Jahre in Deutschland oder auch in Japan, obwohl diese Länder nach anderen Kriterien als überaltert gelten (Dinkel 1992). Als „Altenquotient“ hat sich der Quotient aus dem Bevölkerungsanteil der über 60jährigen zu dem der 20–60jährigen etabliert, ein für die Entwicklung der sozialen Sicherungssysteme wichtiges Maß. Da der Begriff in der bevölkerungspolitischen Diskussion (s. unten) häufig mit negativen Konnotationen besetzt ist, sollte er reflektiert eingesetzt werden. Neutraler ist die Nennung der in Relation gesetzten Altersklassen. Auf 100 Menschen im Alter von 20 bis 60 Jahren kommen zur Zeit in Deutschland etwa 40 über 60jährige. Modellrechnungen ergaben, dass es im Jahr 2030 über 70 sein könnten (Abb. 3.16). „Die Alten werden immer älter“ – Die Entwicklung der Hochaltrigkeit Wer heute 60 Jahre alt wird, und das sind die meisten Menschen in den Industrieländern, kann davon ausgehen, dass er durchschnittlich noch mehr als 18 Jahre (Männer) bzw. 22 Jahre (Frauen) leben wird. Betrachtet man die Periodensterbetafeln für Deutschland ab 1871/80, so lässt sich seit der Gründung des Deutschen Reiches eine stetige Zunahme der weiteren Lebenserwartung erkennen. Die Männer im Alter von 60 Jahren hatten vor rund 120 Jahren noch durchschnittlich 5,5 Jahre vor sich, die Frauen noch 9,3 Jahre. Vor einem Jahrhundert konnten bereits 13 bzw. 14 weitere Jahre erwartet werden. Mit anderen Worten: „Die Alten werden immer älter”. Messbar ist diese Entwicklung anhand der Zunahme der weiteren Lebenserwartung im Alter von 60 Jahren (vgl. Abb. 3.17). Abb. 3.17. Weitere Lebenserwartungen im Alter von 60 Jahren in Deutschland (bis 1933 Deutsches Reich, ab 1946 BRD) für Männer und Frauen (Datenquelle: Statistisches Bundesamt; nach Wittwer-Backofen 1999) 242 Bevölkerungsbiologie Box 3.15 Hundertjährige im demographischen Blick Noch 1950 waren Hundertjährige rar. Da verschiedene Krankheitsbilder, die früher vorzeitig zum Tode führten, in der modernen Medizin kein Sterberisiko mehr darstellen und sich zudem die sozialen und ökonomischen Bedingungen verbessert haben, erreichen heute mehr Menschen die Altersgruppe der Hochaltrigen. Im Jahr 1990 lebten in Westdeutschland 2206 Menschen im Alter von 100 Jahren oder mehr. Bereits 6 Jahre später waren es bereits knapp 4000 Menschen,mehr als 80% unter ihnen Frauen.Etwa 55 Frauen unter einer Million Frauen und 13 Männer unter einer Million Männer erreichten dieses Alter in Deutschland (Gjonca et al. 2000). Damit wächst diese Altergruppe der extrem Hochaltrigen besonders stark. Anhand der Daten aus der Kannisto-Thatcher Database on Oldest Old, die Daten von Hundertjährigen aus 12 Ländern Westeuropas und Japans seit 1950 beinhaltet, scheint ein erstes Auftreten dieser extremen Hochaltrigkeit erst nach 1800 plausibel. Neben dem Trend der Zunahme Hundertjähriger ist auch zu beobachten, dass deren verbleibende Lebenserwartung ansteigt. Ihre Sterberaten sinken mit 1% bis 2% jährlich schnell. Dies ist um so erstaunlicher, als es immer schwieriger wird, in diesem Alter noch Verbesserungen zu erreichen, welche die Sterblichkeit weiter senken können. Dennoch ist in verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Ausgangssterberaten der Anstieg der Lebenserwartung in dieser höchsten Altersstufe nahezu identisch (Kannisto et al.1994). Es ist nicht mehr ungewöhnlich, dass ein Alter zwischen 105 und 110 Jahren erreicht wird, wenn die magische Grenze von 100 Jahren erst einmal überschritten ist (Robine et al. 1997, Jeune u. Kannisto 1997). Es kann vermutet werden, dass in wenigen Jahrzehnten das Auftreten von extrem alten „Super-Centenarians“ in der Bevölkerung ebenso häufig ist wie das derjenigen, welche die Schwelle zum 100. Geburtstag heute überschreiten. Auffällig ist, dass Hundertjährige oft erstaunlich vital sind (Franke et al. 1985) und weniger stark durch Altersbeschwerden in ihrem täglichen Leben eingeschränkt sind als dies etwa bei 80–85jährigen der Fall ist. Aber auch bei Hundertjährigen ist der biologische Alternsprozess nicht aufzuhalten. Häufig wird in der demographischen Literatur das Sterberisiko in jüngerem Alter als stark durch extrinsische Faktoren (s. oben), das der Hundertjährigen nahezu vollständig durch intrisische Faktoren gesteuert erklärt, mit dem Verweis auf Alternstheorien, welche die Reparaturfähigkeit des biologischen Systems für begrenzt halten (vgl. Kap. 4.1.5). Diese Zusammenhänge sind jedoch nur schwer zu belegen. Vorerst bleibt es wichtig, die Entwicklung unter den Höchstaltrigen zu beobachten, um Alternstheorien belegen zu können (vgl. Kap. 4.1.5) (Vaupel 1997). Demographie 243 Auf den ersten Blick mag diese Entwicklung angesichts des sozialen, wirtschaftlichen und medizinischen Fortschritts in diesem Zeitraum nicht allzu viel erscheinen. Interpretiert man diese Zahlen jedoch im Zusammenhang mit dem enorm gestiegenen Bevölkerungsanteil, der in die Altersgruppe der über 60jährigen eintritt (s. oben), so wird deutlich, dass im Laufe der Zeit eine immer weniger nach gesundheitlichen Kriterien selektierte Altersgruppe entstanden ist. Gesundheitlich eingeschränkte Menschen überleben heute viel häufiger als in früheren Zeiten. Zu erwarten wären demnach höhere Sterberaten unter den Älteren, das Gegenteil ist jedoch der Fall. Die verbesserten Lebensbedingungen konnten sich in derart hohem Maße auswirken, dass sie nicht nur die negativen Selektionseffekte ausgleichen, sondern die Sterberaten noch weiter senken konnten. In diesem Licht betrachtet, demonstriert die beobachtete Zunahme der Lebenserwartung eine außerordentlich dynamische Entwicklung. Eine besonders rasante Veränderung vollzieht sich bei den extrem Hochaltrigen über Hundertjährigen (vgl. Box 3.15). Diese Gruppe erfährt eine besondere Aufmerksamkeit, da sich bei ihr die demographischen Beobachtungen und eine vermutete biologische Begrenzung der Lebensdauer (vgl. Kap. 4.1.5) annähern, woraus neue Erkenntnisse für die Alternsforschung auf verschiedenen Gebieten erwartet werden. „Das Altern ist weiblich“ – Die Entwicklung der Lebenserwartung von Männern und Frauen Der Anteil an Frauen in der Altersgruppe der über 60jährigen liegt in Deutschland bei über 60% und nimmt mit zunehmendem Alter weiter zu (vgl. Abb. 3.18). Dies hat viele Gründe. Neben den diskutierten biologischen Gründen (vgl. Kap. 4.1) spielen selektive Effekte eine Rolle, denn unter den ältesten Ko- Abb. 3.18. Männer- und Frauenanteil in der BRD nach Altersgruppen, Volkszählung 1987 (nach Wittwer-Backofen 1999) 244 Bevölkerungsbiologie Abb. 3.19. Geschlechtsunterschied der durchschnittlichen Lebenserwartung bei Geburt in Abhängigkeit von der weiblichen Lebenserwartung im weltweiten Ländervergleich. Punkte oberhalb der Referenzlinie kennzeichnen Länder mit einer höheren Lebenserwartung für Frauen, darunter liegende Punkte zeigen eine höhere Lebenserwartung für Männer (Liberia, Bangladesh, Nepal, Malediven) horten befinden sich noch Jahrgänge, die dem 2. Weltkrieg ausgesetzt waren und unter denen relativ mehr Frauen überlebt haben. Unabhängig von den quantitativen Kohorteneinflüssen zeigt die Lebenserwartung bei Geburt deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede. In allen Kulturen und auf allen Kontinenten ist die durchschnittliche Lebenserwartung im Ländervergleich für Frauen höher als für Männer, mit Ausnahme einiger weniger Länder wie Nepal, Bangladesh, Liberia oder den Malediven, in denen die Lebensbedingungen für Frauen ungleich schlechter sind als für Männer (vgl. Abb. 3.19). Weiterhin ist ein Zusammenhang zwischen dem allgemeinen Niveau der Lebenserwartung und dem Geschlechtsunterschied zu erkennen. Frauen scheinen aus günstigen Lebensbedingungen besonderen Vorteil zu ziehen, denn in den Ländern mit hoher Lebenserwartung ist der Geschlechtsunterschied sowohl absolut als auch relativ am höchsten.In den Industriestaaten beträgt dieser Unterschied zwischen 4 und 8 Jahre,zumeist 6 bis 7 Jahre.In Ländern mit niedriger Lebenserwartung, insbesondere in den Entwicklungsländern Afrikas, fällt Demographie 245 der Vorsprung der weiblichen Lebenserwartung mit 2 bis 3 Jahren deutlich niedriger aus (Luy 2002b, 2003a). Allein durch biologische Geschlechtsunterschiede ist diese Differenz nicht zu erklären. Es wird ein Ursachengefüge von sozioökonomischen Determinanten angenommen, unter denen die Senkung der Kinderund Müttersterblichkeit und damit die weiblichen Sterberisiken in jüngerem Alter den größten Einfluss haben. Andererseits ist aber auch zu beobachten, dass es Frauen erfolgreicher als Männern gelingt, die weitere Lebenserwartung im Alter von 60 Jahren zu steigern. Eine gesundheitsbewusstere Lebensführung, gekoppelt mit Risikovermeidung, mag hier eine Rolle spielen. In Deutschland erreichen Männer etwa 90% der weiblichen Lebenserwartung bei Geburt, im Alter von 80 Jahren stehen Männern nur noch etwa 80% der weiteren weiblichen Lebenserwartung zur Verfügung. Der demographische Übergang Mit dem demographischen Übergang, der auf die Transformationstheorie Mackenroths (1953) zurückgeht,wird die historische Entwicklung zu den alternden Gesellschaften Mitteleuropas beschrieben. Sie basiert auf zwei Kernthesen. Die erste These besagt, dass die Industrieländer einen Übergang von der vorindustriellen Bevölkerungsweise mit hohen Sterbe- und Geburtenraten zur industriellen Bevölkerungsweise mit niedrigen Sterbe- und Geburtenraten vollzogen haben. Die Differenz zwischen Geburten- und Sterberaten ist in beiden Fällen niedrig, allerdings ergibt sich durch das Absinken der Sterblichkeit bei zunächst noch hohen Geburtenzahlen eine enorm hohe Wachstumsrate (vgl. Abb. 3.20). Diese Phase wird umgangssprachlich oft als Bevölkerungsexplosion bezeichnet, was diesen Prozess jedoch nicht adäquat beschreibt, da er nicht unregelmäßig explosionsartig verläuft, sondern berechenbar und regelhaft. Erst verzögert sinkt auch die Geburtenrate ab und die Schere zwischen Geburten- und Sterberate schließt sich wieder. Das Wachstum, dessen Ausmaß von der Dauer des Überganges abhängig ist, wird infolgedessen wieder gebremst. Diese erste These, oder der erste demographische Übergang, ist für eine Vielzahl europäischer Länder bestätigt worden. Die zweite These, oder der zweite demographische Übergang, postuliert im Anschluss an den ersten Übergang eine positive Wachstumsrate. Sie geht davon aus, dass die Geburtenrate größer als die Sterberate bleibt und damit die Bestandserhaltung der Bevölkerung gewährleistet ist. In vielen Industrieländern hat sich diese zweite These bereits als falsch erwiesen, denn die Kinderzahlen bleiben dauerhaft unter dem Mindestwert, der erforderlich ist, um die Bevölkerung zu ersetzen. Dadurch sinkt die Bevölkerungszahl in Deutschland bereits seit drei Jahrzehnten. In Abb. 3.20 wird dieser demographische Übergang, den die Industrieländer durchlaufen haben, mit fünf Phasen dargestellt. Diese Länder befinden sich nach Durchlaufen des demographischen Überganges in der posttransformativen Phase (Phase fünf). Es ist zu erkennen, dass die Kurven sich in dieser Phase nicht nur, wie vorhergesagt, angenähert, sondern sogar überkreuzt haben und dass daraus ein negatives Wachstum resultiert. Die Positionen der verschiedenen Weltregionen werden in Kap. 3.2 besprochen. 246 Bevölkerungsbiologie Abb. 3.20. Die Phasen des demographischen Überganges in den Industrieländern und der Stand des demographischen Überganges in verschiedenen Regionen der Welt im Jahr 2001 (nach United Nations 2000, Birg 1996) Es zeigt sich, dass die demographische Alterung, wie sie in den Industrieländern zu beobachten ist, das Resultat dieser Transformationsprozesse ist, deren Verlauf in vielen Ländern bereits in dieser Form beobachtet wurde. Zukünftige Entwicklungen auf der Basis der aktuellen Bevölkerungsdaten sind jedoch nur schwer vorauszusagen (vgl. Kap. 3.3.7). Hierzu existiert kein der Transformationstheorie vergleichbares Konzept. 3.3.5 Biologische und soziale Determinanten der Sterblichkeit „Death strikes from every side, but not at random“ (March 1912). Die Sterblichkeit wurde schon sehr früh in der demographischen Forschung als ein zentraler Bevölkerungsprozess erkannt. Ebenso lange schon werden Einflussfaktoren beobachtet, die einerseits ein biologisch begründetes, artspezifisches Muster der Sterblichkeit bewirken und andererseits für eine hohe soziokulturell bedingte Variabilität innerhalb dieses Gefüges verantwortlich sind. 247 Demographie Die biomedizinische Alternsforschung untersucht das Zusammenspiel physiologischer Faktoren, die sich individuell sehr heterogen und umweltplastisch darstellen (vgl. Kap. 4.1). Die Konsequenz des biologischen Alterns ist als demographisch messbare Größe der Tod, das Ausscheiden der Individuen aus der Grundgesamtheit der Bevölkerung und damit ein die demographische Struktur und Dynamik einer Bevölkerung prägender Faktor. Würde eine Spezies nicht altern, wäre sie dennoch der Sterblichkeit durch Unfälle, andere gewaltsame Todesursachen, Ressourcenknappheit aufgrund von Hungersnöten oder durch Kriege ausgesetzt. Dann wäre die Mortalitätsrate für alle Altersgruppen etwa gleich hoch. Eine solche Bevölkerung dezimiert sich gleichmäßig. Hierzu ein Beispiel, wenn im Übrigen die Bedingungen des stabilen Bevölkerungsmodells erfüllt wären: Eine Kohorte von 128 Mitgliedern hat bei einer jährlichen Sterberate von 50% nach einem Jahr noch 64 Mitglieder, nach 2 Jahren noch 32 Mitglieder usw. Nach 8 Jahren wäre sie nicht mehr existent (vgl. Tabelle 3.12). Wird die Überlebenswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit des Alters aufgezeichnet, ergibt dies eine stetig abfallende Gerade. Das entspricht jedoch nicht der Realität. Das biologische Altern einer Spezies zeichnet sich durch eine mit zunehmendem Alter ansteigende Sterbewahrscheinlichkeit aus. Die artspezifische Regelmäßigkeit, mit der die Sterberate steigt, kann mit der Gompertz-Gleichung bzw. der Gompertz-Konstante ausgedrückt werden (vgl. Box 3.16). Die Folge ist eine zunächst noch hohe Überlebenswahrscheinlichkeit, die erst mit zunehmendem Alter abnimmt. Fries (1989) entwickelte daraus die Idealvorstellung der rektangularisierten Überlebenskurve bis hin zu einem optimistischen Zukunftsmodell, in dem aufgrund des medizinischen Fortschrittes das Sterberisiko so stark hinausgezögert werden kann, dass die Über- Tabelle 3.12. Gompertz-Konstante und MRDT in verschiedenen hypothetischen Bevölkerungen anfängliche Sterberate G Beginn nach 1 Jahr nach 2 Jahren nach 3 Jahren nach 4 Jahren nach 5 Jahren nach 6 Jahren nach 7 Jahren nach 8 Jahren (A) Ohne Seneszenz (B) Mit Seneszenz (C) Mensch (D) Laborratte 50% 50% 50% 50% 0 0,1 (10%) 0,09 (9%) 2,3 (230%) Sterberate Bevölk.- Sterbeanteil rate Bevölk.- Sterbeanteil rate Bevölk.- Sterbeanteil rate Bevölk.anteil 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 50 25 12,5 6,25 3,125 1,56 0,78 0,39 100 50 22,5 8,89 2,97 0,8 0,16 0,02 0 100 50 22,75 9,11 3,16 0,91 0,20 0,03 0,0 100 50 0 50 55 60,5 66,55 73,21 80,53 88,58 97,44 107,19 50 54,5 59,95 65,35 71,23 77,64 84,63 93,09 101,47 50 165 545 248 Bevölkerungsbiologie Box 3.16 Die Gompertz-Verteilung der Sterblichkeit Im Jahr 1825 machte der englische Versicherungsmathematiker Benjamin Gompertz die grundlegende Beobachtung, dass den meisten Sterbetafeln menschlicher Bevölkerungen ein geometrisches Gesetz zu Grunde liegt. Als Aktuar war er vor allem an dem praktischen Problem der Prämienberechnung von Lebensversicherungen interessiert. Auf der Basis von Bevölkerungsdaten aus England, Schweden und Frankreich aus dem 18.Jh.suchte er nach einem der Sterblichkeit von Bevölkerungen zugrunde liegenden Muster. Die einfache Formel besagt,dass die Sterberaten im Alter zwischen 20 und 60 Jahren exponentiell ansteigen. Anders ausgedrückt, steigt die logarithmierte Sterberate linear. Dieser Alternsverlauf wird beschrieben durch die Formel m(x) = aebx Dabei steht m(x) für die Sterberate m im Alter x und a dementsprechend für die anfängliche extrapolierte Sterberate im Alter 0. Der Exponent bx gibt den exponentiellen Anstieg dieser Rate mit zunehmendem Alter und damit die Geschwindigkeit an, mit der die Sterblichkeit im Alter x zunimmt. b ist eine artspezifische Konstante. Die Funktion beschreibt somit die Auswirkungen des Alterns mit zwei Zahlen: 1. der Anfangsmortalitätsrate a und 2. dem (exponentiellen) Anstieg der Mortalitätsrate b. Diese Formel hat sich als Gompertz-Gleichung zu einem wichtigen Instrument der demographischen Forschung entwickelt.Die mathematische Regelmäßigkeit,mit der die Sterberaten in den Sterbetafeln auftreten, führte dazu, dass die Gompertz-Gleichung als law of mortality, als Gesetz der Sterblichkeit, angesehen wird. Seit ihres Erscheinens ist die Gompertz-Gleichung das zum Vergleich von Mortalitätsraten zwischen Populationen am häufigsten angewandte Instrument. In einer Bevölkerung ohne Seneszenz (eine hypothetische, in der Natur nicht vorkommende Bevölkerung, deren Mitglieder niemals altern) würden Individuen (an Unfällen, Infektionskrankheiten, Hungersnöten und anderen nicht altersbedingten Todesursachen) zufällig verteilt über alle Altersstufen sterben. Die Mortalitätsrate bliebe damit konstant. In einer alternden Bevölkerung hingegen nimmt die Sterblichkeit mit zunehmendem Alter zu,wie in der Gleichung beschrieben. Es hat sich gezeigt, dass dieser Zusammenhang für eine Vielzahl von Organismen gilt, wobei die Geschwindigkeit bx auch als Gompertz-Konstante G die Geschwindigkeit des Alterns misst. Sie ist artspezifisch. Das bedeutet, dass jede Spezies eine ihr eigene Geschwindigkeit besitzt, mit der eine ursprünglich gleich große Bevölkerung auf den Bestand 0 dezimiert wird. Demographie 249 Box 3.16 (Fortsetzung) Im praktischen Gebrauch hat sich der anschaulichere reziproke Wert von G, multipliziert mit ln(2), zur Darstellung der artspezifischen Sterblichkeitsverhältnisse eingebürgert. Er beschreibt die Verdoppelungszeit der Mortalitätsrate (mortality rate doubling time, MRDT) und gibt damit das Alter an, bei dem die Mortalitätsrate auf das Doppelte ihres Ausgangswertes gestiegen ist: log e ( 2 ) MRDT = G Beispiel: In einer hypothetischen Bevölkerung (A in Tabelle 3.6) einer Spezies ohne Seneszenz mit einer konstanten Mortalitätsrate von 50% leben nach 5 Jahren noch gut 3% der Anfangsbevölkerung (vgl.Tabelle 3.6). Steigt in einer alternden ebenfalls hypothetischen Bevölkerung (B) mit einer Ausgangssterberate von ebenfalls 50% aber die Mortalitätsrate mit G = 10 (10%iger jährlicher Anstieg der Mortalitätsrate), sind nach 5 Jahren nur noch 0,8% der ursprünglichen Bevölkerung vorhanden.Beim Menschen (C) beträgt die Steigerung der Mortalitätsrate etwa 9% (G = 0,09). Bei Annahme der gleichen hypothetischen Anfangssterberate (reale Sterberaten liegen beim Menschen deutlich niedriger bei etwa 0,0002) ist nach 5 Jahren noch knapp 1% der ursprünglichen Bevölkerung vorhanden. Die Laborratte (D) weist eine jährliche Steigerung der Mortalitätsrate von etwa 2,3 (230%) auf.Wird die gleiche Anfangssterberate von 50% angenommenen, ist bereits nach 2 Jahren kein Tier mehr am Leben. Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass sich beim Menschen die anfängliche Sterberate von 50% auf 100% innerhalb von 8 Jahren verdoppelt hat. Die MRDT berechnet dies mit ln(2)/0,09 = 7,7 Jahren. Allgemein wird die MRDT beim Menschen mit etwa 8 angegeben. Im Vergleich dazu: Bei der Laborratte verdoppelt sich die Sterberate bereits nach 0,3 Jahren (ln(2)/2,3=0,3) (Olshansky u. Carnes 1997, Ricklefs u. Finch 1996) lebensrate in jüngeren Altersklassen idealerweise nahe bei 100% liegt. Die Sterblichkeit würde dann auf einen kurzen Zeitraum vor dem Erreichen eines biologischen Limits komprimiert und Todesursachen auf intrinsische Faktoren, im Individuum selbst begründete und auf Alternsprozessen basierende Ursachen reduziert. Die Überlebenskurve verläuft demnach zunächst über weite Altersbereiche waagerecht und fällt erst in hohem Alter steil ab, ein fast rechtwinkeliger oder rektangulärer Kurvenverlauf (vgl. Abb. 3.14). In den Industrienationen zeichnet sich ein Trend ab, welcher sich dem Modell von Fries zunehmend annähert, wie die Situation für Deutschland zeigt. 250 Bevölkerungsbiologie Trotz eines immer enger werdenden Spielraumes für eine weitere Verbesserung der Lebenserwartung hat sich der Rückgang der Sterbewahrscheinlichkeit in den letzten Jahren nicht verringert, sondern sogar eher noch beschleunigt (Oeppen u. Vaupel 2002, Dinkel 1992). Hält dieser Trend weiter an, wird das Risikomodell von Fries in den Industriestaaten zunehmend realisiert. In den Entwicklungsländern hingegen herrscht weiterhin ein hoher Anteil der extrinsischen Sterblichkeit, welche auf äußere Risikofaktoren wie Ressourcenknappheit, Kriege oder Infektionskrankheiten zurückzuführen ist. Ihre Überlebenskurve ist durch eine hohe Sterblichkeit in jüngerem Alter und ein selektives Überleben von wenigen widerstandskräftigen Individuen in höheres Alter geprägt (vgl. Abb. 3.14). Das Zusammenspiel der biologischen (intrinsischen) und sozialen (extrinsischen) Einflussfaktoren auf die Sterblichkeit ist dabei weitestgehend ungeklärt. Erst in den letzten Jahren wurde die Diskussion um ein komplexes Wirkungsgefüge beider Komponenten geführt (Wittwer-Backofen 1999), nachdem die disziplinären Untersuchungen zu Einflussfaktoren der Sterblichkeit weder aus der Soziologie noch aus der Biologie heraus alleinige befriedigende Erklärungen liefern konnten. So zeigte sich, dass Werte der Lebenserwartung im Alter über 50 Jahren in verschiedenen Ländern (Österreich, Dänemark) signifikant mit dem Geburtsmonat korrelieren.Dieser Effekt wird dabei nicht durch die saisonale Verteilung der Sterblichkeit hervorgerufen, sondern scheint für beide Geschlechter in Faktoren begründet zu liegen, die sich früh im Leben manifestieren und als Risikofaktoren in höherem Alter auswirken.Als Ursachen werden • • • selektives Überleben in früher Kindheit, pränatale Einflüsse, soziale Effekte diskutiert (Doblhammer 1999). Hingegen nehmen saisonale Unterschiede der Sterblichkeit mit zunehmendem Alter zu. Die Krankheitsanfälligkeit in Jahreszeiten mit ungünstigen Witterungsverhältnissen, insbesondere im Winter, aber auch im Hochsommer, ist in hohem Alter verstärkt. Interessant ist dabei die Beobachtung, dass Männer deutlich empfindlicher gegenüber derartigen Klimaeinflüssen reagieren und dies auch bereits in jüngerem Alter als Frauen (Rau u. Doblhammer 2003). Soziale Ungleichheit und Bevölkerungsentwicklung „Der Tod ist eine soziale Krankheit.“ Dieser Ausspruch des berühmten Mediziners Rudolf Virchow (1821–1902) zeigt, dass bereits seit langem der große Einfluss sozialer Faktoren auf die Sterblichkeit bekannt ist. Aus den ersten statistischen Beschreibungen demographischer Vorgänge mit dem Aufschwung des Merkantilismus und Frühkapitalismus entstand bereits die Erkenntnis einer sozialen Bedingtheit von Geburt- und Sterbeprozessen. In der klassischen Nationalökonomie wurde für die Steuerung der Bevölkerungsentwicklung ein theoretisches sozioökonomisches Entwicklungsmodell postuliert. Es besagt, dass • die Bevölkerungsentwicklung an den Fortschritt zur Produktion von Unterhaltsmitteln gekoppelt sei, welche die Ernährung der Bevölkerung sichern, Demographie • 251 dieses Bevölkerungsprinzip ergänzt wird durch die Bedeutung der Arbeitsplatzdynamik, die darin besteht, dass das Angebot und die Nachfrage nach Arbeitskräften und das damit verknüpfte Lohnniveau die Dynamik des Bevölkerungswachstums reguliert. Einen Überblick über den Stand soziologischer Ansätze zur Bevölkerungsentwicklung, die das Bild der Bevölkerungssoziologie geprägt haben, findet sich bei Huinink (2000). Dabei ist das Ziel der bevölkerungssoziologischen Forschung die Erklärung der Genese, der Stabilität und des Wandels kollektiver sozialer Phänomene. Im Vordergrund steht dabei die Erforschung der sozialen Bestimmtheit der natürlichen Bevölkerungsprozesse mit den Vorgängen der Geburten und Sterbefälle. Mit dem soziologischen Schlagwort der „Pluralisierung der Lebensformen“ wird ein mehrdimensionales Bedingungsgeflecht demographischen Handelns angesprochen, das eine differenzierte Betrachtung der Beziehung zwischen sozialen und demographisch relevanten Handlungsformen erfordert. Als ein makrosoziologisch orientierter Analyseansatz ist die Theorie des demographischen Übergangs zu nennen (vgl. Kap. 3.3.4), gemäß der durch demographischen Wandel die Sozialstruktur beeinflusst wird. Ergänzt wird der Ansatz um die mikrosoziologische Theorie der Sozialpsychologie mit der Betrachtung der Abfolge individueller Handlungen und Ereignisse (vgl. Kap. 6.3). Verknüpft werden die beiden Forschungsansätze durch die soziologische Lebenslaufforschung, die den Bezug demographischen Handelns zum individuellen Lebenslauf herstellt. Im Folgenden werden aus dem sozioökonomischen Bedingungsgeflecht des Bevölkerungsprozesses einige Determinanten der Sterblichkeit vorgestellt, die jedoch hier nicht erschöpfend behandelt werden können. Für eine weitere Beschäftigung mit der Thematik der Bevölkerungssoziologie sei das Handbuch der Demographie (Müller et al. 2000a,b) empfohlen. Auch heute noch, da die Lebenserwartung drastisch angestiegen ist, sind sozioökonomische Bedingungen weiterhin ausschlaggebend für den Gesundheitszustand und die Sterbeverhältnisse einer Bevölkerung. Sie stellen die wichtigsten Ursachen für die Unterschiede der Sterblichkeit zwischen Industrienationen und Entwicklungsländern sowie der diachronen Entwicklung der Lebenserwartung dar. Sozioökonomisch bedingte Unterschiede der Sterblichkeit haben nicht etwa abgenommen, wie mit der Verbesserung sozialer Arbeits- und Lebensbedingungen zu erwarten wäre, sondern eher noch zugenommen, wie beispielsweise für die USA belegt ist (House et al. 1990). Zahlreiche empirische Studien zeigen, dass sozial benachteiligte Bevölkerungsteilgruppen einem höheren Sterblichkeitsrisiko ausgesetzt sind als der Bevölkerungsdurchschnitt (Überblick bei Ellis 1994), was häufig als „Ungleichheit vor (dem) Tod“ bezeichnet wurde: „Ungleichheit vor Tod ist nur eine Dimension sozialer Ungleichheit. Es war eine Illusion zu glauben, dass die eine ohne die andere beseitigt werden könnte. Das bedeutet aber nicht, dass man sich mit der gegenwärtigen Lage abfinden müsste. Ungleichheit vor Tod ist immer noch eine der beschämendsten Konsequenzen sozialer Ungleichheit. Ihr Verschwinden muss weiterhin das 252 Bevölkerungsbiologie Ziel bleiben. Offensichtlich kann dieses Ziel jedoch nicht allein durch den Ausbau der Gesundheitsdienste erreicht werden.” (Vallin, zit. nach Ritz 1989: 10). Aus diesem Grund werden zur Charakterisierung von Risikogruppen häufig so genannte Indikatormerkmale der sozioökonomischen Schichtung herangezogen, deren Einzelwirkung oft nicht geklärt werden kann, die jedoch in einen Wirkungskomplex eingebunden sind. Insbesondere das Sterblichkeitsgeschehen ist von einem derartigen Ursachengefüge geprägt. So ist beispielsweise das Bildungsniveau eng mit dem Sterberisiko korreliert. Bevölkerungsteilgruppen mit höherer Bildung weisen signifikant höhere Lebenserwartung auf. Ob jedoch ein bildungsbedingtes Gesundheitsbewusstsein, die günstigeren Arbeits- und Wohnbedingungen, welche Personen mit höherer Bildung offen stehen, oder die allgemeine Lebensführung bei günstiger Einkommenssituation wirksam sind, lässt sich nicht quantifizieren. Ebenso denkbar wäre ein Selektionseffekt, der dazu führt, dass sich gesündere Menschen mit höherer Lebenserwartung das Bildungssystem besser zu Nutze machen können als dies gesundheitlich benachteiligte Personen vermögen. Einen ebenso engen Zusammenhang mit der Sterblichkeit zeigt der Familienstand. Anhand des Sozioökonomischen Panels konnte gezeigt werden, dass Menschen, die in einer dauerhaften Partnerschaft eingebunden sind, gegenüber Verwitweten eine deutlich erhöhte Lebenserwartung haben. Die ungünstigsten Verhältnisse treten bei geschiedenen Männern auf. Sie haben eine um mehr als elf Jahre herabgesetzte Lebenserwartung im Vergleich zu Männern in dauerhaften Lebensgemeinschaften. Bei Frauen ist dieser Effekt in abgeschwächtem Ausmaß ebenfalls zu beobachten (Klein 1993, vgl. Tabelle 3.13). Auch bei diesem Zusammenhang ist nicht geklärt, welche Rolle die Lebensführung spielt. Gemäß der Protektionshypothese steht in familiären Lebensabläufen im Krankheits- und Versorgungsfall ein unterstützender Partner zur Verfügung, die allgemeine Lebensführung ist geregelter und geht mit Tabelle 3.13. Lebenserwartung bei Geburt nach sozioökonomischen Merkmalen bei verschiedenen Geburtskohorten in Deutschland Gesamt Geburtskohorte 1880 Geburtskohorte 1900 Geburtskohorte 1920 Geburtskohorte 1940 Höhere berufliche Position Niedrigere berufliche Position In dauerhafter Partnerschaft Verwitwet im Alter über 60 Jahre Geschieden Männer 68,5 67,7 69,4 71,9 Ohne kriegsbedingte Sterblichkeitseffekte Frauen 73,4 76,6 80,0 83,4 (nach Klein 1993, Daten des Sozioökonomischen Panels) Männer 69,8 70,5 71,2 71,9 67,9 71,9 71,1 67,8 59,8 Frauen 73,8 77,0 80,2 83,4 79,0 79,9 82,2 77,1 75,0 Demographie 253 gesünderer Ernährung einher. Mit dem Verlust des Partners geht dieser Vorteil verloren. Auf der biologischen Ebene lässt sich die Protektionshypothese durch Ergebnisse der klinischen Stressforschung unterstützen (vgl. Kap. 6.3). Bei Männern konnte der Partnerschaftseffekt durch Drosselung der Androgenausschüttung nachgewiesen werden. Männer, die nicht in dauerhafte Partnerschaften eingebunden waren, zeigten deutlich höhere Testosteronwerte, welche die Prävalenz von Herz-Kreislauferkrankungen und risikoreicheres Verhalten fördern (Mazur u. Booth 1998). Insbesondere im Zusammenhang mit dem Migrationsverhalten zeigen soziale Unterschiede von Bevölkerungsteilgruppen eine deutliche Wirkung auf die demographische Bevölkerungsstruktur. Strukturelle regionale Unterschiede erzeugen gezielte Wanderungsströme, die für Persistenz und sogar Verstärkung räumlicher sozialer Unterschiede verantwortlich sind. Strukturell günstige Räume ziehen gezielt Bevölkerungsgruppen mit günstiger sozioökonomischer Konstellation aus bildungs-, arbeitsplatz-, verkehrs- und gesundheitsstrukturell benachteiligten Regionen an, in denen folglich sozioökonomisch schwächere Gruppen überwiegen (Wittwer-Backofen 1999). Raumstrukturelle Maßnahmen haben daher die Aufgabe der strukturellen Entwicklungssteuerung, um die Benachteiligung der Einwohnerschaft zu mindern und gleichwertige (jedoch nicht gleichartige) Lebensräume zu schaffen. Mit sozial bedingten Wanderungsströmen ist vielfach auch eine biologische Koselektion verknüpft, welche die räumliche und zeitliche Dynamik biologischer Merkmale bedingt und deren Kenntnis für die evolutionsökologische Betrachtung menschlicher Bevölkerungen unabdingbar ist (vgl.Kap.3.2).Ein umfassender Überblick über den Zusammenhang sozialer und biologischer Merkmalsverteilung beim Menschen findet sich bei Strickland u. Shetty (1998). 3.3.6 Der demographische Wandel in Deutschland im internationalen Vergleich. Die kinderlose Gesellschaft – Fertilität im demographisch-biologischen Kontext Anthropologische Überlegungen liefern Interpretationsansätze zum Zusammenspiel zwischen Geburtenverhalten und Sterblichkeit, die auf evolutionsbiologischen bzw. verhaltensbiologischen Aspekten beruhen (Henke 2002). Um diese Zusammenhänge untersuchen zu können, bedarf es demographischer Parameter, mit denen sich das Fertilitätsverhalten im Zusammenspiel mit anderen, die Bevölkerungszusammensetzung beeinflussenden Verhaltensweisen aufzeigen läßt. Diese sollen am Beispiel Deutschlands im Vergleich zu anderen europäischen Ländern aufgezeigt werden. Im europäischen Vergleich fallen vor allem Spanien und Italien, die klassischen kinderreichen Länder Europas, durch die mittlerweile niedrigsten Geburtenraten (TFR) von durchschnittlich unter 1,3 Kindern auf (Dorbritz 2000). Die höchsten Geburtenraten weisen mittlerweile die nordeuropäischen Länder auf (Hoem u. Hoem 2000, Frejka u. Calot 2001, Andersson 2002). Wie hat sich nun das Geburtenverhalten im Laufe der letzten Jahrzehnte in den Industrieländern entwickelt? Bis 1965 hielten sich die europäischen Län- 254 Bevölkerungsbiologie Abb. 3.21. Geburtenrückgang in den europäischen Ländergruppen (Datenquelle: Council of Europe 1999; nach Wittwer-Backofen 2002b) dergruppen auf einem relativ konstanten Niveau mit leichten Unterschieden, bis der „Pillenknick“ ab den späten 60er Jahren einen schnellen Effekt in den west- und nordeuropäischen Ländern erzeugte: Die Fertilität sank innerhalb von zehn Jahren um etwa 40% ab (vgl. Abb. 3.21). Während es allerdings in den mitteleuropäischen Ländern Mitte der siebziger Jahre zu einem Stillstand der Entwicklung kam, waren die Auswirkungen in den südeuropäischen Ländern und in den Reformstaaten, zu denen vor allem viele osteuropäische Länder mit politischen Neuordnungen in den 90er Jahren zählen, drastischer. Bei ihnen begann ebenso wie in den west- und nordeuropäischen Ländern ein Absinken der Fertilität, allerdings deutlich später und zögernder. Das führte dazu, dass um 1975 ein maximaler Unterschied der länderspezifischen Geburtenraten beobachtet wurde. Von einem zu dieser Zeit immer noch relativ hohen Niveau aus hielt das Absinken der Geburtenrate aber in den besagten süd- und osteuropäischen Ländern weiterhin an und kam erst zu Beginn der 90er Jahre auf einem niedrigeren Niveau als in den westeuropäischen Ländern zum Stillstand. In den europäischen Reformstaaten haben die politischen Umwälzungen von sozialistischen zu demokratischen Staaten zu einer tiefen Verunsicherung der Bevölkerung in den betroffenen Ländern mit der Folge der nachhaltigen Reduzierung der Kinderzahlen beigetragen (Dorbritz 1998a, 2000). Es ist jedoch zu erwarten, dass sich nach einem Verzögerungseffekt eine Kompensationsreaktion einstellt, wodurch zumindest das Fertilitätsniveau der südeuropäischen Länder wieder erreicht wird. Diese zeigen eine klarere Entwicklung, die mit tiefgreifenden Veränderungen in der Familienstruktur, verbunden mit dem Auflösen der Großfamilien und wachsender wirtschaftlicher Unsicherheit, zu interpretieren ist. In Deutschland stellt sich das Muster der westeuropäischen Länder durch die Wiedervereinigung heterogen dar. In der DDR fiel zunächst das Absinken Demographie 255 Abb. 3.22. Entwicklung der Gesamtfruchtbarkeitsrate (TFR) in der alten Bundesrepublik und in den neuen Bundesländern Deutschlands, 1950-1998 (Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Grünheid und Roloff 2000; nach Wittwer-Backofen 2002b) der Geburtenrate in den siebziger und achtziger Jahren deutlich schwächer aus als in Westdeutschland, was sich in den Kinderzahlen von Frauen der Geburtsjahrgänge 1950 bis 1960 ausdrückt, die um bis zu 15% über denjenigen gleichaltriger westdeutscher Frauen lagen (vgl. Abb. 3.22). Die Frage, ob sich die demographisch wirksamen niedrigen Kinderzahlen in Europa durch eine verzögerte Entscheidung zur Familienbildung ergeben, ist nicht ohne weiteres zu beantworten. Ein derartiger Zusammenhang würde durch niedrige Kinderzahlen bei einem hohen Erstgeburtsalter der Frauen aufgezeigt. Dies ist aber im Vergleich der europäischen Länder nicht durchgehend der Fall (vgl. Abb. 3.23). In einigen Staaten wie Bulgarien, Weißrussland oder der russischen Föderation sind niedriges Erstgeburtsalter mit einer niedrigen Gesamtkinderzahl gekoppelt. Das erste Kind wird zwar von recht jungen Müttern geboren, welche aber immer seltener Entscheidungen zu einem zweiten oder dritten Kind treffen. Aus diesem Muster fällt die Türkei völlig heraus, die bei niedrigstem Erstgeburtsalter der Frauen im europäischen Vergleich die mit Abstand höchste Gesamtkinderzahl von durchschnittlich 2,4 Kindern aufweist. Die westeuropäischen Länder zeigen allesamt bei einem hohen Alter der erstgebärenden Mütter niedrige Gesamtkinderzahlen, insbesondere in Spanien, in Italien, in Deutschland und in der Schweiz. Hier setzt die Familienbildung erst spät ein, wodurch die Kinderzahl aus biologischen Gründen nicht immer in ihrer geplanten Höhe oder überhaupt nicht mehr realisierbar ist. Es ist bezeichnend, dass der Anteil ungewollt kinderloser Paare insbesondere in die- 256 Bevölkerungsbiologie Abb. 3.23. Gesamtfertilitätsrate (GFR) und Alter der Mutter bei Geburt des ersten Kindes in Europa (Datenquelle: Council of Europe 1999, Dorbritz 2000; nach Wittwer-Backofen 2002b) sen Ländern im Ansteigen begriffen ist. Aber das Aufschieben des Kinderwunsches führt in zunehmendem Maße auch zu dem Effekt, dass er völlig aufgegeben wird bzw.in der eigenen Biographie der Frauen gar nicht erst vorgesehen ist. Allein in den nordeuropäischen Länder werden bei ähnlich hohem Alter der Mütter bei Geburt der ersten Kinder auch höhere Kinderzahlen erreicht. Mit der Entwicklung des zunehmenden Erstgeburtsalters steigt der Anteil kinderloser Frauen zunehmend. In Deutschland bleibt etwa jede dritte Frau der Geburtsjahrgänge 1965 oder jünger kinderlos. Im europäischen Kohortenvergleich der Frauen des Geburtsjahrganges 1955 sind in Westdeutschland neben der Schweiz und Österreich die höchsten Anteile kinderloser Frauen zu verzeichnen – bei niedrigen endgültigen Kinderzahlen im Durchschnitt aller Frauen (vgl. Abb. 3.24). Damit zeigt sich, dass die niedrige Fertilität einerseits durch die gedrosselte Entscheidung zu hohen Kinderzahlen verursacht wird. Einen größeren Anteil an dem Effekt hat aber die wachsende Zahl kinderloser Frauen. Das bedeutet,dass die Last der Bevölkerungsreproduktion sich auf immer weniger Frauen bzw. Paare konzentriert. Dadurch, dass sich eine nennenswerte Teilbevölkerung gebildet hat, die eine Lebensform ohne Kinder gesellschaftlich etabliert hat, wird auch kaum eine schnelle Änderung dieser demographischen Situation in Sicht sein. Wachsen dann aber zunehmend mehr Kinder als Einzelkinder auf? Am Beispiel Deutschlands kann gezeigt werden, dass dies nicht der Fall ist (vgl. Abb. 3.25). Der Anteil der Einzelkinder hat sich über die letzten 60 Jahre hinweg Demographie 257 Abb. 3.24. Gesamtfertilitätsrate (TFR) und Anteil kinderloser Frauen des Geburtsjahrganges 1955 in europäischen Ländern (Datenquelle: Council of Europe 1999, Dorbritz 2000; nach Wittwer-Backofen 2002b) Abb. 3.25. Entwicklung der Kinderzahlen in den Familien in Deutschland (Datenquelle: Schwarz 1997; nach Wittwer-Backofen 2002b). Die 3-Kind-Familie hat stark abgenommen, der Anteil der Ein-Kind-Familien ist etwa konstant geblieben. 258 Bevölkerungsbiologie nicht nennenswert geändert. Etwas weniger als jedes dritte Kind wächst ohne Geschwister auf. Neben dem zunehmenden Anteil der kinderlosen Frauen ist der Effekt der sinkenden Fertilität durch die Entwicklung der 2-Kind- und 3-Kind-Familien bedingt. Hatten die um 1900 geborenen Mütter in den dreißiger Jahren noch größtenteils drei Kinder, so änderte sich dies nach dem zweiten Weltkrieg. Seither wurde in zunehmendem Maße die 2-Kind-Familie bevorzugt. In den siebziger Jahren entschied sich nur noch jede fünfte Familie für ein drittes Kind (Schwarz 1997). Bisher ist im Zusammenhang mit der Elterngeneration lediglich die Fertilität von Frauen angesprochen worden. Dies hat mehrere Gründe. Einerseits stellen Frauen den biologisch limitierenden Faktor für die Bevölkerungsreproduktion dar. Die Anzahl der Frauen im reproduktiven Alter entscheidet über die maximale biologische Fortpflanzungskapazität der Bevölkerung. Dieses Limit ist aber demographisch weitestgehend irrelevant, da vor allem die von gesellschaftlichen und individuell-biographischen Faktoren abhängige Entscheidung zum Kind eine entscheidende Rolle für die Realisierung und partielle Ausschöpfung biologischer Möglichkeiten spielt. Diese biologischen Grenzen erlangen vielmehr heute eine neue Dimension: Mit der modernen fortpflanzungsmedizinischen Technik können die biologischen Grenzen aufgeweicht werden. Der größte Effekt dabei dürfte in dem Vertrauen in diese Technik gesehen werden, das zu einer biographischen und damit auch altersspezifischen Fixierung des Kinderwunsches führt, der dann in höherem Alter nicht mehr immer realisierbar ist. Welche Rolle spielen aber die Männer in der demographischen Dynamik des Fertilitätsgeschehen? Die Lockerung der klassischen Familienkonstellation rückt die Väter zunehmend aus dem Blickfeld der demographischen Erfassung. In Deutschland ist lediglich die statistische Erfassung beider Elternteile nach der Geburt eines ehelichen Kindes vorgeschrieben, nicht aber die des Vaters bei nichtehelichen Geburten. Zudem ist bei Kindern bevölkerungsstatistisch gesehen nur eine Verknüpfung zu dem Haushalt gegeben, in dem sie leben (Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes). Da dies bei getrennten Familien in der Regel die Mutter ist, besteht hier eine erhebliche Datenlücke. Aber auch die großen Surveys wie beispielsweise das Family and Fertility Survey (FFS) der achtziger und neunziger Jahre (Kreyenfeld 2001a) oder die LBS-Familien-Studie (Fthenakis et al. 2001) erlauben aufgrund ihrer Datenstruktur nur eine eingeschränkte Analyse der Vaterrolle (Pohl 2000). Ebenso ist wenig bekannt über die paardynamische Entscheidung für oder gegen Kinder (Roloff u. Dorbritz 1999) oder die Kinder betreffenden familiären Regelungen bei Familientrennungen (Oláh 2001). Ökonomische und biographische Kosten von Kindern Einerseits verursachen Kinder rein materielle Kosten, die in der Regel durch den Ausfall eines zweiten Einkommens empfindlich wahrgenommen werden. Andererseits verursachen Kinder einschneidende biographische Kosten für die Eltern, die eine Unterbrechung bzw. Einschränkung der beruflichen Karriere und des privaten Lebensstils beinhalten. Diese beiden Determinanten Demographie 259 der ökonomischen und biographischen Kosten der Fertilität sind in ihrer Auswirkung in besonderem Maße von dem Angebot institutionalisierter Kinderbetreuung und Kindererziehung abhängig. Die niedrigen Geburtenzahlen findet man demzufolge in denjenigen westlichen Industrienationen, in denen geringe staatliche Investitionen für Kinder geleistet werden. Vielfach wird aber die hohe Bewertung der biographischen Kosten bei einer Entscheidung gegen Kinder als ausschlaggebend angeführt, so dass eine nur auf die Verbesserung der Kinderbetreuung angelegte Intervention nur in geringem Maße zur Erhöhung der Geburtenrate beitragen würde. Dies ist allerdings ein sehr komplexes Thema, dessen Interaktionen und Verknüpfungen mit anderen Determinanten der Fertilität stark diskutiert werden (Birg et al 1991). Soziale Determinanten der Fertilität Ein weiterer Komplex an fertilitätsbestimmenden Determinanten ergibt sich aus sozialen Interaktionen, die im regionalen Kontext wirksam werden (Hank 2002). Hierbei bilden sich gesellschaftliche Normen aus, deren Wertigkeit sich von der jeweiligen Umweltsituation abhängig einpendelt. Aber oft ist auch nur bedingt der individuelle Wunsch nach einem Lebensstil mit oder ohne Kindern relevant für den weiteren Lebenslauf. Rückkoppelungen, die sich aus der Gesellschaftsstruktur ergeben, prägen einen Weg, der die individuelle Einstellung überformt: • • So ist eine sozialstrukturell geprägte Auswahl auf dem Partnermarkt ein „Nadelöhr“, das einer Entscheidung zum Kind vorgelagert ist. Ein zusätzlich einschränkender Rückkoppelungseffekt durch ein individuelles Filtersystem auf der Suche nach einem „geeigneten“ Partner ergibt sich durch gesellschaftliche Normen. Selbst bei geringer Orientierung an derartige Normen wie Bildungshomogenität, Altersdifferenz oder Religionszugehörigkeit sind nicht normgerechte Bindungen oft einer großen gesellschaftlichen Belastung ausgesetzt, die einer Realisierung des Kinderwunsches entgegenstehen. So ist in vielen Umfragen eine typische Erklärung für Kinderlosigkeit, dass man „prinzipiell Kinder haben möchte, aber mit dem richtigen Partner“. Weiterhin wirkt sich ein soziales Feedback durch konkurrierende Lebensinhalte aus. Der zunehmende Anteil kinderloser Paare oder ungebundener „Singles“ führt den jungen (noch) Kinderlosen alternative und als attraktiv angesehene Lebensinhalte mit beruflicher Karriere (bei Paaren zumeist Doppelverdiener) ohne die mit Kindern verbundenen Einschränkungen vor Augen. Dies betrifft zumeist soziale Teilgruppen mit qualifizierter Ausbildung und höherem Einkommen. Bei ungünstiger Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarktsituation stellt diese Lebensform keine realistische Alternative dar. In wirtschaftlich benachteiligten Regionen ist zu beobachten, dass Frauen in Ermangelung entsprechender Arbeitsplätze und mit Aussicht auf eine wenig attraktive Einkommenssituation in die klassische Hausfrauenund Mutterrolle ausweichen (Kreyenfeld 2001b). 260 • • Bevölkerungsbiologie Als weitere soziale Determinante der Fertilität ist der Zeitpunkt der Geburten zu nennen. Der gewünschte Zeitpunkt bzw. Zeitraum ist nicht allein von individuellen biographischen Faktoren abhängig. Gesellschaftliche Einflüsse tragen zu einem spezifischen Muster bei, welches das Alter der Mütter bei Geburt der Kinder beeinflusst. In den westlichen Industrienationen unterliegen beispielsweise die Phänomene „Teenager-Schwangerschaften“, teilweise auch noch „ledige Mütter“, einem derartigen gesellschaftlichen Negativ-Filter, der in anderen Gesellschaftsformen fehlt. Der gesellschaftsspezifisch optimale Zeitpunkt für die Geburt eines Kindes unterliegt einem Prozess des sozialen Lernens. Die Einbettung des Kinderwunsches in die Lebenslaufgestaltung (Ausbildung, beruflicher Werdegang, Alter) oder die Partnerschaftsdauer bzw. -intensität werden vorgelebt und fördern einen Lernprozess, der in einer Erkenntnis des optimalen Timings mündet. Dadurch wird der individuell gewünschte Zeitpunkt überformt. Der gesellschaftliche Einfluss auf die erreichte Kinderzahl bzw. Kinderlosigkeit ist vielschichtig. Durch die Abkoppelung der individuellen Kinderzahl vom sozialen Sicherungssystem wird die gesellschaftliche Belastung der niedrigen Geburtenzahlen auf die gesamte Bevölkerung umgelegt. Somit wird diejenige Teilbevölkerung, auf deren Schultern sich die Geburtenlast konzentriert, doppelt belastet. Solange Kinderreichtum dadurch gesellschaftlichen Sanktionen unterliegt, während Kinderlosigkeit in einigen sozialen Gruppen inzwischen mit einem neuen positiven Lebensstil verbunden wird, werden die Kinderzahlen niedrig bleiben. Interventionsmöglichkeiten und Erfolg Die Einbettung der fertilitätsbestimmenden Faktoren in Entscheidungen des Lebenslaufes, wie sie die Life History postuliert, zeigt einen engen Zusammenhang von Mensch-Umwelt-Beziehungen. Derartig prägende Einflussfaktoren sind aber bislang nicht bei der Umsetzung politischer Bemühungen zur Bremsung des Bevölkerungsrückganges berücksichtigt worden. Die sinkenden Kinderzahlen sind vor allem deshalb alarmierend, weil das Konzept der von Generation zu Generation weitergereichten Verantwortung für diejenigen, die nicht in den Wirtschaftsprozess eingebunden sind – der Generationenvertrag – nicht mehr tragbar ist. In Diskussion ist insbesondere die Sicherung der zukünftigen Renten, die durch die nachfolgende Kindergeneration nicht mehr gewährleistet werden kann. Das Problem verstärkt sich durch die fortschreitende Alterung in der Bevölkerung, wodurch die zunehmende Last der (finanziellen und sozialen) Verantwortung auf immer weniger Schultern verteilt wird. Dass das nicht mehr realisierbar ist, zeigt sich in den punktuellen Auflösungsprozessen des Generationenvertrages. Signale gesetzt wurden dabei einerseits durch Bemühungen, in der Bevölkerung das Bewusstsein für eine private Altersversorgung zu schaffen, sowie durch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes aus dem Jahr 2001. Grundlage für dieses Urteil ist die nicht verfassungskonforme Mehrfachbelastung von Familien für die Sicherung der sozialen Gesamtlast, welche die Bevölkerung zu erbringen hat. Mit der Entscheidung werden Familien von einer Demographie 261 Verpflichtung in die staatliche Pflegeversicherung freigesprochen. Dies führt zu der Frage, ob Kinder demzufolge erneut zu einer sozio-ökonomischen Versicherung für ihre Eltern werden. Oder wird dies gar ein Schritt zu einem historischen Muster des Reproduktionsverhaltens, in dem wieder ein soziales Netzwerk der familiären Eigenverantwortung an Bedeutung gewinnt? Dies ist wohl angesichts der sich auflösenden Familienstrukturen kaum zu erwarten. Aber auch die Schaffung von Anreizen zur Förderung des Geburtenverhaltens ist derzeit kaum erfolgversprechend. Kleinere finanzielle Entlastungen decken einerseits bei weitem nicht die hohen finanziellen Mehrbelastungen von Familien. Zudem sind in unserer Gesellschaftsform die hohen biographischen Kosten von Müttern bzw. Eltern anzurechnen, die nur partiell mit einem gut funktionierenden Betreuungs- und Erziehungssystem reduziert werden könnten. Dies ist aber nicht in Sicht und scheint auch angesichts der hohen damit verbundenen Kosten nicht realisierbar. Die Kalkulation dieser Kostenrechnung wird unter der Berücksichtigung der in der Life History und Soziobiologie aufgezeigten Einbindung des Fertilitätsverhaltens in den gesamten Mensch-Umwelt-Komplex aufgestellt. Solange jedoch eine ungleichgewichtige Kostenrechnung im individuellen Kalkül für bzw. gegen Kinder resultiert, wie dies heute in den europäischen Ländern der Fall ist, wird sich wohl kaum mit den bislang angebotenen Interventionen eine Erhöhung der Kinderzahlen bewirken lassen. Die Entwicklung der Fertilitätsraten dokumentiert die innerhalb kurzer Zeit drastischen Veränderungen als Spiegel der gesellschaftlichen Strukturen (Birg 1998). Eine der wesentlichen Fragen des weiteren zeitlichen Verlaufs ist, ob die Niedrig-Fertilität als Übergangsphänomen zu verstehen ist oder ob sie sich auf einem permanent niedrigen Stand einpendelt. Ist der niedrigste Stand bereits erreicht oder schreitet die Abnahme der Kinderzahlen weiter fort? Durch den Geburtenausfall fehlt eine komplette spätere Elterngeneration. Welcher langfristige Effekt ergibt sich dadurch? Betrachtet man die europaweiten Variationen, so stellt sich die Frage, ob die extrem niedrigen Geburtenraten der süd- und osteuropäischen Länder auch in anderen europäischen Ländern zukünftig erreicht werden. Verknüpft mit den sinkenden Geburtenraten ist das ansteigende Geburtsalter der Mütter zu betrachten. Ist eine weitere Ausschöpfung der biologischen Kapazität bis an die Grenzwerte zu erwarten? All diesen Fragen wird in der demographischen Literatur große Aufmerksamkeit gewidmet, da die Entwicklung der Geburtenraten in vielerlei Hinsicht einen wesentlichen Beitrag zu unserer Gesellschaftsstruktur liefert. Die demographischen Effekte der Wiedervereinigung Deutschlands Die neuere deutsche Geschichte eröffnet eine einzigartige Gelegenheit, die demographischen Effekte politischer, sozialer und ökonomischer Veränderungen zu untersuchen. Mit dem abrupten Übergang von der 40 Jahre währenden sozialistischen Planwirtschaft zur freien Marktwirtschaft änderten sich für die Bewohner der ehemaligen DDR die Bedingungen, unter denen sich Bevölkerungsstrukturen prägen, grundlegend. Dies hat bereits innerhalb weni- 262 Bevölkerungsbiologie ger Jahre nicht nur zu einer erstaunlich rapiden Angleichung der ostdeutschen demographischen Situation an die Verhältnisse der alten Bundesländer geführt, sondern diese sogar kurzzeitig noch überholt. Diese Veränderungen in den demographischen Verhaltensmustern sind derart drastisch, dass sie als ‚demographic shock’ bezeichnet werden (Eberstadt 1994). Der demographische Wandel dokumentiert besser als jedes andere messbare System die Schockreaktion aufgrund der Änderung von Lebensbedingungen, die einen sozialen Wandel bewirkten. Von Demographen werden diese Veränderungen als ein „natürliches Experiment“ beobachtet, das es erlaubt, die deutsche Gesamtbevölkerung, die vor 1945 eine identische Zusammensetzung und demographisches Verhalten aufwies, in ihrer Divergenz in den beiden deutschen Staaten und in ihrer Wiedervereinigung 45 Jahre später zu verfolgen. Bereits kurz nach der Grenzöffnung setzte 1989 eine Wanderungswelle von Ost nach West ein, die insbesondere durch eine Abwanderung der Altersgruppe der 18–30jährigen aus den peripheren ländlichen Regionen verursacht wurde. Dadurch verlor der Osten zwischen 1991 und 1999 knapp eine halbe Million Menschen, etwa jeden 30. Bewohner der ehemaligen DDR, an die alten Bundesländer. Danach wurde die Wanderungsbilanz wieder ausgeglichener, lediglich etwa 10 000 Personen beträgt der jährliche Verlust der östlichen Bundesländer derzeit noch pro Jahr. Diese Schrumpfungsprozesse sind ein Beispiel für unerwünschte räumliche Folgen der wirtschaftlich-politischen Veränderungen. Die Altersselektivität der Abwanderungen stellte die betroffenen Bundesländer vor das Problem der verbleibenden überalterten und geringer beruflich qualifizierten Bevölkerungsanteile, was die Benachteiligung der infrastrukturell unterversorgten Regionen im Osten noch verstärkte. Besonders einschneidend war der Geburtenrückgang in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung. Zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung war das Geburtenverhalten in West- und Ostdeutschland extrem unterschiedlich (vgl. Abb. 3.22). Die relativ hohe Geburtenzahl in der DDR ist 1990 abrupt und drastisch gesunken, teilweise sogar unter das derzeit niedrige Westniveau. Die soziale Unsicherheit nach der Wiedervereinigung führte dazu, dass zunächst der Kinderwunsch aufgeschoben wurde. Junge Frauen verzögerten ihre erste Geburt und in Familien mit Kindern wurde der weitere Kinderwunsch aufgeschoben und damit oftmals auch aufgegeben. Das zuvor niedrige Erstgeburtsalter von 22,9 Jahren im Jahr 1989 (im gleichen Jahr waren westdeutsche Mütter bei Geburt ihres ersten Kindes bereits 27,1 Jahre alt) stieg dadurch schnell an. Eine weitere Entwicklung, wie sie sich in Westdeutschland bereits zuvor abzeichnete, fand im Osten sehr schnell statt: Der Anteil kinderloser Frauen wuchs schnell an und wächst weiterhin. Mittlerweile hat sich das Geburtenverhalten im Osten wieder etwas verstärkt und dem Westen angeglichen. Der Nachholbedarf nach den ersten Jahren der sozialen und wirtschaftlichen Unsicherheit ist allerdings geringer ausgefallen als erwartet, so dass die Frage, ob es sich bei der Veränderung des Geburtenverhaltens in Ostdeutschland um eine Krise oder eine Anpassung an das Westniveau handelt, damit beantwortet werden kann, dass beide Komponenten die hohe Dynamik des Geburtenverhaltens in Ostdeutschland geprägt haben (Conrad et al. 1996, Eberstadt 1994). Als ursächlich für die zunächst zu beobachtende Krisensitua- Demographie 263 tion kann die Auflösung verlässlicher Rahmenbedingungen angesehen werden. Die übliche Vollerwerbstätigkeit von Müttern war nur noch erschwert möglich. Mit dem Übergang zur freien Marktwirtschaft entfielen die Arbeitsplatz- und Wohnungsgarantie, die institutionellen Rahmenbedingungen für die Kinderbetreuung bereits kurz nach der Geburt und weitere begünstigende Maßnahmen der natalistischen Familien- und Sozialpolitik der DDR. Die Gesamtfruchtbarkeitsrate ist dadurch von durchschnittlich 1,52 Kindern pro Frau im Jahr 1990 um ein Drittel auf 0,98 Kinder gesunken, bis sie 1993–94 den in Deutschland geschichtlich niedrigsten Stand von 0,77 Kindern (Grünheid u. Roloff 2000) erreichte. Als längerfristig kann der Anpassungsprozess an westdeutsche Verhältnisse angesehen werden, der vor allem mit folgenden Veränderungen gekoppelt ist: Durch die sich neu eröffnenden Perspektiven von selbstbestimmter Ausbildung und Karriere mit hoher Mobilität stiegen die Opportunitätskosten für Kinder. Neue Möglichkeiten der Lebensplanung konkurrierten plötzlich mit dem klassischen und nahezu alternativlosen Modell des niedrigen Erstgeburtsalters bei Vollerwerbstätigkeit. Zu dem weitgehenden Verlust der staatlichen finanziellen Unterstützung für Familien addierten sich nun die Kosten des Verlustes von Einkommen und Rentenanwartschaften nach der Geburt von Kindern, wie dies der Situation im Westen entsprach. Dadurch wurde im Osten nur zögerlich ein Nachholbedarf an Geburten realisiert, auch noch im Jahr 2000 lag die Geburtenrate unter derjenigen des früheren Bundesgebietes (vgl. Abb.3.22; Tabelle 3.14). Vieles in dieser Dynamik ist jedoch noch ungeklärt (Hullen 1998, Dorbritz 1998b, Kreyenfeld 2001b). Die Analyse der Sterblichkeitsveränderung in den neuen Bundesländern liefert nicht nur in den Augen der Demographie oder Medizin wichtige Hinweise auf die Bevölkerungsdynamik, sondern stellt auch für die Anthropologie eine Situation dar, in der biologische, medizinische und sozioökonomische Bedingungen eine komplexe Wirkung ausüben, welche die Variationsbreite menschlicher Verhaltensweisen in ihrer Umweltplastizität, wie sonst selten beobachtet, dokumentieren. Bis in die siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts entwickelte sich die Sterblichkeit in den beiden deutschen Staaten nahezu parallel. Seither setzte in Westdeutschland eine deutliche Steigerung der Lebenserwartung ein, vor allem ein Effekt der deutlichen Verbesserung des Gesundheitssystems und der sozioökonomischen Bedingungen, während die Lebenserwartung in der DDR nur leicht anstieg. Dies führte zu einer deutlichen Divergenz in den beiden deutschen Staaten, welche die Bevölkerung im Osten benachteiligte. Bis 1990 öffnete sich diese demographische Schere so weit, dass Männer im Osten eine um 3,5 Jahre, die Frauen eine um 2,8 Jahre niedrigere Lebenserwartung im Vergleich zum Westen hatten. Als Ursachen der ungünstigen Lebensbedingungen im Osten vor der Wiedervereinigung sind verschiedene Hypothesen diskutiert worden (Zusammenstellung s. Luy 2003b): • • • ungünstige Lebensbedingungen, ungünstige Arbeitsbedingungen, Gesundheitsbelastung durch Uranabbau und -verarbeitung, – 7,3 + 1,4 – 8,0 – 38,7 – 4,5 – 3,6 – 4,5 – 26,7 11,0 1,39 697,730 11,2 7,5 – 44,2 – 29,3 – 9,44 – 11,3 – 36,8 – 57,5 – 11,8 – 5,6 – 18,4 181,399 12,4 7,6 70,0 76,2 Gestorbene Rohe Sterberate Säuglingssterberate Lebenserwartung bei Geburt Männer Lebenserwartung bei Geburt Frauen + 4,3 + 3,4 (Quelle: Statistisches Bundesamt, Conrad et al. 1996, zur Berechnung der statistischen Maßzahlen s. Tab. 3.8) + 2,1 + 0,4 79,0 72,5 + 0,8 + 1,1 + 0,8 + 1,9 + 2,6 – 1,2 + 0,1 – 50,9 + 6,9 1,57 + 1,4 12,0 681,537 Gesamtfruchtbarkeitsrate + 5,3 62,679 – 48,3 Rohe Geburtenrate – 60,4 16,467 – 6,6 1998 Änderung in % gegenüber 1989 198,922 – 5,7 1994 Änderung in % gegenüber 1989 1989 absolute Werte Änderung in % gegenüber 1989 1998 Alte Bundesländer Geburten 1994 Änderung in % gegenüber 1989 1989 absolute Werte Neue Bundesländer Bevölkerung (x1000) Demographischer Wert Tabelle 3.14. Veränderungen der demographischen Struktur in West- und Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung 264 Bevölkerungsbiologie Demographie 265 Abb. 3.26. Entwicklung der durchschnittlichen Lebenserwartung von Männern und Frauen im früheren Bundesgebiet (davor Deutsches Reich) und in den neuen Bundesländern (Datenquelle: Statistisches Bundesamt) • • • • • psychische Belastung aufgrund der politischen Unterdrückung, selektive Ost-West-Wanderung, Unterschiede in Risikofaktoren und Lebensstilen, Immigration gesunder Einwanderer im Westen, fehlende Medizintechnologie Ein erstaunlicher Wandel vollzog sich nach der Wiedervereinigung bezüglich der Sterblichkeitsverhältnisse: Die Lebenserwartung näherte sich in den neuen Bundesländern innerhalb weniger Jahre weitestgehend an die westlichen Verhältnisse an (vgl.Tabelle 3.14).Hält der Trend weiter an,ist damit zu rechnen, dass ein regionaler Ost-West-Unterschied für beide Geschlechter ab 2005/6 vollständig abgebaut ist. Eine derartig drastische Reduktion der Übersterblichkeit ist kaum jemals beobachtet worden (vgl. Abb. 3.26) und findet auch nicht in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion statt (Council of Europe 1999). Erstaunlich ist die Entwicklung insbesondere, wenn man bedenkt, dass die Sterblichkeit in der Regel erst verzögert auf veränderte Bedingungen reagiert, da der Abbau von Risikofaktoren sich vielfach erst später in verlängerter Lebenszeit auswirkt, während die Lebenserwartung beeinflussende Morbiditäts-(Erkrankungs-)risiken deutlich früher im Lebenslauf auftreten können. Das lässt vermuten, dass als wesentliche Ursachen für die schnelle Änderung der Lebenserwartung direkte todesvermeidende Verbesserungen der Lebensbedingungen, insbesondere bei älteren Menschen, in Frage kommen. Hier wäre an Verbesserungen des medizinischen Rettungssystems – ein Zusammenhang zwischen der Lebenserwartung in höherem Alter und der Dichte von Rettungsleitstellen konnte in der regionalen Hessen-Studie bestätigt werden (Wittwer-Backofen 1999) der stationären Krankenhausversorgung oder der Altenbetreuung zu denken. Für Frauen scheint dies auch zuzutreffen, da der Gewinn an Lebenserwartung hauptsächlich den über 60jährigen zuzuschreiben ist,während Männer 266 Bevölkerungsbiologie aller Altersklassen ein Absinken der Sterblichkeit zeigen (Gjonca et al. 2000, Luy 2003b). In einer Vielzahl von Untersuchungen konnte in unterschiedlichsten Lebensräumen gezeigt werden, dass die sozioökonomischen Lebensbedingungen einen besonders hohen Einfluss auf die Lebenserwartung haben. Die Angleichung der Ost-West-Sterblichkeit kann ein weiteres und sehr deutliches Beispiel für einen derartigen Zusammenhang sein. 3.3.7 Bevölkerungsprognosen, Bevölkerungskontrolle und Bevölkerungspolitik Die zukünftige Entwicklung von Bevölkerungen ist eine der am häufigsten gestellten Fragen an die Demographie. Räumliche infrastrukturelle Planungen hängen von der Entwicklung von Fertilität, Mortalität und Migration ab. Werden unter der Annahme bestimmter Voraussetzungen reine formale Kalkulationen der Bevölkerungsentwicklung erstellt, spricht man von Bevölkerungsprojektionen. Sie modellieren den Einfluss bestimmter Faktoren auf die Bevölkerungsentwicklung und können eine rein theoretische Bedeutung haben, indem sie Antworten auf Fragen wie „Was wäre, wenn…“ liefern. Beispielsweise würde eine Simulation der Bevölkerungsstruktur Deutschlands unter der Annahme, dass sich die Fertilitätsrate seit 1900 nicht geändert hätte, einen rein theoretischen Aspekt liefern. Die Aufgabe, unter der Berücksichtigung anzunehmender Entwicklungen möglichst präzise Aussagen über die zukünftige Entwicklung einer Bevölkerung zu geben, wird als Bevölkerungsprognose oder Bevölkerungs(voraus)schätzung bezeichnet (Preston et al. 2001). Um den letzten Aspekt geht es in diesem Kapitel, dessen Bedeutung für die Biologische Anthropologie vor allem in der Interpretationshilfe für bevölkerungsbiologische Prozesse oder Veränderungen der Individualentwicklung sowie der angewandten Arbeitsgebiete der Industrieanthropologie oder Forensischen Anthropologie liegt. Im Zusammenhang mit der demographischen Alterung (s. oben) wird vor allem die Entwicklung der durchschnittlichen Lebenserwartung durch politische Institutionen und soziale Sicherungssysteme sorgfältig beobachtet. Nicht zuletzt sind auch individuelle Lebensplanungen von der Wahrscheinlichkeit abhängig, ein bestimmtes Alter zu erreichen. Die demographische Alterung wird von einer derartigen Dynamik getragen, dass eine große Unsicherheit über die weitere Entwicklung herrscht. Hat die durchschnittliche Lebenserwartung ihr Maximum bereits erreicht oder ist eine weitere Steigerung möglich? Einer der begrenzenden Faktoren wird in der biologisch erreichbaren Lebensspanne gesehen. Sollte ein derartiges Limit, wie es die biologische Alternsforschung postuliert, existieren, wäre dies unter Ausschalten aller nicht altersbedingter Sterberisiken auch eine natürliche maximale Grenze für die durchschnittliche Lebenserwartung. Zwischen dieser biologischen Grenze, die bei etwa 120–130 Jahren angenommenen wird und nie als durchschnittliche Lebenserwartung realisierbar ist, und der heute erreichten mittleren Lebenserwartung von etwa 85 Jahren für Frauen in den Industrieländern liegt jedoch ein breiter Gestaltungsspielraum. Will man Prognosen wagen, so gilt es, eine Demographie 267 Vielzahl von Einflussfaktoren mit ihren Entwicklungen vorauszusagen, darunter medizinische Fortschritte, die Wirksamkeit des Gesundheitssystems, die Gestaltung des Lebensraumes oder soziale Verbesserungen. Da diese Faktoren nur bedingt und nur über einen begrenzten Zeitraum verlässlich geschätzt werden können, werden Bevölkerungsprognosen mit der Vergrößerung des Schätzzeitraumes zunehmend fehleranfällig. Wie stark die Entwicklung der Lebenserwartung unterschätzt wurde, lässt sich an einer wissenschaftsgeschichtlichen Betrachtung demonstrieren. Die frühesten Schätzungen (länder- und geschlechtsspezifisch) stammen aus den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts (Dublin 1928). Bei einer damaligen Lebenserwartung von 57 Jahren in den USA wurde das erreichbare Maximum bei 64,75 Jahren gesehen: „… in the light of present knowledge and without intervention of radical innovations or fantastic evolutionary change in our physiological make-up, such as we have no reason to assume” (Dublin 1928, zit. nach Oeppen u. Vaupel 2002). Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war der prognostizierte Grenzwert von Frauen in Neuseeland bereits überschritten worden. Eine Vielzahl weiterer Prognosen folgte. Sie alle ereilte das Schicksal, dass im Durchschnitt bereits fünf Jahre nach der Postulierung eines neuen Grenzwertes dieser durch die rasante Entwicklung der Lebenserwartung (vgl. Kap. 3.3.4) überschritten wurde (Oeppen u. Vaupel 2002). Niemand der an der Diskussion beteiligten renommierten Demographen konnte sich vorstellen, dass die Lebenserwartung weiter ungebremst steigt und nicht, wie angenommen, in jeweils nächster Zukunft zum Stillstand kommt. Es zeigte sich, dass die Dynamik des Sterblichkeitsrückganges in höherem Alter unterschätzt wurde. Auch in jüngster Zeit wurden weiter neue Grenzwerte formuliert, die eine Obergrenze der durchschnittlichen Lebenserwartung von 85 Jahren postulierten (Olshansky et al. 2001), und in Frankreich für das Jahr 2033, in Japan für das Jahr 2035 vorausgesagt. Für eine derartige Schwelle, wie hoch sie auch liegen möge, gibt es aus retrospektiver Sicht jedoch keinerlei Anhaltspunkt. Verfolgt man die im weltweiten Ländervergleich erreichte maximale Lebenserwartung für Frauen seit 1840, so zeigt sich ein verblüffend linearer Trend mit einem Zugewinn von etwa drei Monaten pro Jahr. Angeführt von norwegischen Frauen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Frauen Neuseelands führend, bevor wiederum die Norwegerinnen die höchste Lebenserwartung entwickelten. In den letzten Jahren übernahm Japan die Führung mit einer Lebenserwartung von zuletzt über 85 Jahren. Würden wir uns einer Grenze der Entwicklung der Lebenserwartung annähern, so sollte eine Abflachung der Kurve mit einer Abweichung vom linearen Trend zu erwarten sein. Da dies nicht der Fall ist, ist eher mit einem weiteren Anstieg der Lebenserwartung zu rechnen, dessen Ende noch nicht abzusehen ist (Oeppen u. Vaupel 2002). Auf der Basis von Bevölkerungsprognosen wird mit unterschiedlichem Ergebnis versucht, in den Prozess der Bevölkerungsentwicklung steuernd einzugreifen, etwa durch Maßnahmen, mit denen man hofft, die Geburtenraten steigern oder Wanderungsströme beeinflussen zu können. Dies versucht die Bevölkerungspolitik, unter der man die Formulierung von politischen Programmen versteht, welche auf eine bewusste Veränderung 268 Bevölkerungsbiologie der Bevölkerungsstruktur abzielen. Die Sozialpolitik versteht ihren Aktionsspielraum in einem ganzheitlichen Ansatz, der als wesentlichen Aspekt der politischen Zielsetzung die soziale Strukturentwicklung der Bevölkerung beinhaltet (Tegtmeier 1999). Bevölkerungskontrolle ist die Durchführung der beschlossenen Maßnahmen. Dies kann auf dem Weg einer quantitativen (Größe) oder einer qualitativen (Zusammensetzung) Beeinflussung der Bevölkerung geschehen: „.. jede Art politischen Handelns (und Unterlassens) [hat] Auswirkungen auf die Zahl und Struktur der Bevölkerung hat. Sind diese Auswirkungen beabsichtigt, spricht man von Bevölkerungspolitik. Da die Wirkungen unabhängig davon eintreten, ob sie beabsichtigt sind oder nicht, können die bevölkerungspolitisch bedeutsamen demographischen Auswirkungen der Politik auch in einer Demokratie nicht vermieden, sondern nur anders benannt werden. Als Ersatzbezeichnungen für die bevölkerungspolitisch bedeutsamen Wirkungen der Politik auf die Geburtenzahl sind in Deutschland die Begriffe Familienpolitik, familienorientierte Sozialpolitik oder gesellschaftliche Nachwuchssicherung üblich. Die Politik zur Verringerung der Sterblichkeit bzw. zur Erhöhung der Lebenserwartung firmiert unter Gesundheitspolitik.“ (Birg 2002) Akteure der Bevölkerungspolitik sind nationalstaatliche oder internationale sowie auch private Institutionen bzw. Interessenverbände. Mittel der Bevölkerungspolitik sind Regelungen zur Eheschließung, Immigration sowie Emigration und Beeinflussung der Mortalität. Geburtenkontrolle kann in antinatalistische (z. B. Aufklärung über Verhütungsmittel) und pronatalistische (z. B. Abtreibungsverbot) Programme münden. Auch die räumliche Verteilung einer Bevölkerung im Raum ist Gegenstand der Bevölkerungspolitik (LandStadtverteilung). Bevölkerungspolitik auf internationaler Ebene wird von internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen (United Nations Population Fund-UNFPA sowie United Nations Population Division) und der Weltbank (International Development Association IDA) sowie von privaten Organisationen, z. B. der International Planned Parenthood Federation IPPF und dem Population Council betrieben. Der UNFPA formuliert bevölkerungspolitische Programme und ist an ihrer Anwendung beteiligt. Zu seinen Tätigkeitsbereichen gehören die Familienplanung, Aufklärungskampagnen (z. B. über Verhütungsmittel), Analyse von Todesursachen und auch generelle politische Einflussnahme auf Gesetzgebung und Wirtschaftspolitik der betreffenden Staaten. Die bevölkerungspolitische Arbeit der Vereinten Nationen wird ergänzt durch die ausführenden UN-Organisationen, z. B. die UN-Entwicklungsprogramme UNDP, UNICEF, UNESCO, WHO (vgl. Kap. 3.2). Die seit 1949 existierende Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen (UN Population Division) befasst sich mit der Sammlung demographischer Daten (Fertilität, Kindersterblichkeit, Migrationsbewegungen usw.), untersucht Zusammenhänge zwischen politischen, sozioökonomischen und demographischen Entwicklungen bzw. Entscheidungen und prognostiziert alle zwei Jahre den langfristigen Verlauf der Weltbevölkerung. Unter politischer Einflussnahme der USA, welche ihre globalen bevölkerungspolitischen Interessen nicht ausrei- Demographie 269 chend gewahrt sahen, verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen 1967 eine Resolution zur Bildung eines Bevölkerungsfonds. Dieser begann 1969 unter dem Namen United Nations Fund for Population Activity aktiv zu werden. Sein Etat speist sich aus freiwilligen Beitragszahlungen einzelner, zum größten Teil westlicher Regierungen, womit diese ihren Einfluss auf die bevölkerungspolitische Arbeit der UN sichern. Ebenfalls im Jahr 1969 begann die IDA, eine Abteilung der Weltbank, Bevölkerungspolitik in Entwicklungsländern zu betreiben. Als Druckmittel knüpft sie die Vergabe von Krediten an die Umsetzung ihrer bevölkerungspolitischen Programme. Eine politische Niederlage mussten die USA auf der ersten (politischen) Weltbevölkerungskonferenz 1974 in Bukarest hinnehmen. Ein „Weltbevölkerungsaktionsplan“ wurde beschlossen, der neben der Verringerung der Geburtenrate auch eine Eindämmung des überproportionalen Konsums der hoch industrialisierten Länder, nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und Entwicklung der Drittweltländer vorsah. Entwicklung wurde als effektives Mittel zur Abbremsung des notwendig erscheinenden Bevölkerungswachstums anerkannt. Zuvor fokussierten sich bevölkerungsreduzierende Maßnahmen lediglich auf die Senkung der Geburtenzahlen, was oft mit drastischen Mitteln erfolgte. Die Souveränität der einzelnen Staaten in der Bevölkerungspolitik wurde als Grundrecht verankert, wodurch private Organisationen für die Durchsetzung bevölkerungspolitischer Interessen der entwickelten Länder an Bedeutung gewannen, da diese keine restriktiven Vorschriften zu beachten haben (Schlebusch 1994). Eine dieser Organisationen, die 1948 gegründete IPPF mit Sitz in London, erarbeitet bevölkerungspolitische Strategien und ist unter anderem in der Erforschung von Verhütungsmitteln aktiv. So ließ sie die Antibabypille vor ihrer offiziellen Einführung an etwa 1000 nicht informierten Puerto-Ricanerinnen testen. Weitere Verhütungsmittel mit meist enormen Nebenwirkungen (Depo-Provera, Norplant etc.) wurden an Frauen der Dritten Welt experimentell erprobt. Mit der Geburtenkontrolle befasst sich eine weitere private Organisation, der 1952 ins Leben gerufene Population Council. Beide genannten Organisationen sind vor allem an medizinischen und technischen Lösungen sozialer und wirtschaftlicher Probleme interessiert (Kaupen-Haas 1997). 270 Bevölkerungsbiologie Zusammenfassung Kapitel 3.3 Demographie n Die Demographie liefert Methoden und Konzepte zur Kennzeichnung von Bevölkerungsstrukturen und deren Veränderungen. n Mittels mathematischer Techniken, die zur Berechnung spezifischer und standardisierter Raten in der Demographie entwickelt wurden, lassen sich Strukturparameter verschiedener Bevölkerungen vergleichen. n Der „demographische Übergang“ beschreibt die bevölkerungsstrukturellen Veränderungen der westlichen Industrieländer mit ihrem charakteristischen Absinken der Sterblichkeit und der Geburtenraten. Dadurch kommt es zur demographischen Alterung. n Das Muster der Sterbeverteilung kann für alle alternden Spezies mit der Gompertz-Funktion beschrieben werden. Lediglich die Geschwindigkeit, mit der die Sterblichkeit greift, ist artspezifisch. n Nach der Wiedervereinigung Deutschlands haben sich drastische Veränderungen der Bevölkerungsstruktur gezeigt,welche die Abhängigkeit der Bevölkerungsstruktur und -dynamik von zahlreichen sozioökonomischen und gesellschaftlich-kulturellen Einflussfaktoren dokumentieren. Lebenszyklus 4.1 Wachstum, Reifung, Altern Wachstum und Reifung sind charakteristische Merkmale vor allem der frühen Stadien der Ontogenese (= Individualentwicklung). In sowohl quantitativer als auch qualitativer Weise verändern sich die Körperform, die Körperzusammensetzung, die Physiologie, das Verhalten und die Funktion von Genen, Zellen und Organen des Individuums. Vor allem für Kinder und Jugendliche existieren Richtwerte für deren jeweiliges biologisches Alter und den entsprechenden Reifezustand, z. B. in Bezug auf den Zahnwechsel (Tabelle 4.1). Wachstum und Reifung können somit quantifiziert werden, allerdings unter Beachtung der sehr hohen interindividuellen Variabilität. Auch in diesem Aspekt zeigt sich die enorme Umweltplastizität von Menschen und ihre Fähigkeit, körperliche, physiologische und auch Verhaltensmodifikationen entsprechend veränderter Umweltgegebenheiten zu entwickeln (Bogin 1999). Wachstumsphänomene beruhen auf der Zunahme der Zellzahl bzw. Zellgröße und sind in der Regel von der zellulären Differenzierung untrennbar. Studien zum Thema Wachstum und Reifung werden heute unter dem Überbegriff der Auxologie1 zusammengefasst. Wachstum kann als Funktion der Produktivität einer Spezies aufgefasst werden, d. h. ihrer Fähigkeit, Nahrung und andere lebensnotwendige Ressourcen dauerhaft in einem Maße zu erlangen, welches über die unmittelbaren individuellen Bedürfnisse (Stoffwechselenergie, Erhalt und Reparatur des eigenen Körpers) hinausgeht und somit die erfolgreiche Reproduktion sichert. Primaten sind vergleichsweise langlebig und haben große, somit kostenintensive Gehirne (vgl. Kap. 2.1.2) und als Folge davon eine eher geringe Produktivität im Vergleich zu anderen Säugetieren. Charakteristisch für Primaten sind eine kleine Wurfgröße, die Geburt von gut entwickelten Jungen und deren langsames Wachstum mit einer längeren Periode sozialen Lernens, welche der sexuellen Reife vorgeschaltet ist (Sheen 1998). Speziesspezifische Unterschiede existieren und haben evolutive Gründe. Das menschliche Wachstum folgt prinzipiell dem Primatenmuster, jedoch ist z. B. der geringe Entwicklungsgrad der Neugeborenen auffällig (sekundäre Altrizialität, vgl. Kap. 2.1), sowie die lange Kindheitsphase (s. unten). 1 griechisch auxein = wachsen lassen, vergrößern 272 Lebenszyklus Tabelle 4.1. Mittlere Durchbruchszeiten der Milchzähne (Kleinbuchstaben) in Monaten, der Dauerzähne (Großbuchstaben) in Jahren. I=Incisivus (Schneidezahn), C=Caninus (Eckzahn), P=Prämolar (Vorbackenzahn), M=Molar (Backenzahn). Daten aus Scheuer u. Black (2000) Milch-Gebiss Oberkiefer Unterkiefer Zahntyp i1 i2 c m1 Mittelwert 10 11 19 16 m2 i1 i2 c m1 m2 29 8 13 20 16 27 I1 I2 C P1 P2 M1 M2 M3 Jungen Oberkiefer 6,9 8,3 12,1 10,2 11,4 6,4 12,8 17,7 Spanne 8–12 9–13 16–22 13–19 (Jungen) 14–18 (Mädchen) 25–33 6–10 10–16 17–23 14–18 23–31 (Jungen) 24–30 (Mädchen) Dauer-Gebiss Unterkiefer 6,3 7,3 10,4 10,3 11,1 6,3 12,2 18,1 Mädchen Oberkiefer 6,7 7,8 10,6 9,6 10,2 6,4 12,4 17,2 Unterkiefer 6,2 6,8 9,2 9,6 10,1 6,3 11,4 17,7 Das Studium menschlicher Wachstums- und Reifeprozesse ist ein wesentlicher Aspekt anthropologischer Forschung, da zum einen Größe, Form und Proportionen des Körpers Indikatoren für Umweltadaptationen sind (vgl. Kap. 3.2.2), zum anderen ein hohes pädiatrisches Interesse an jenen Faktoren besteht, welche diese Prozesse beeinflussen (s. Kap. 4.1.2). 4.1.1 Menschlicher Lebenszyklus und postnatales Wachstum Der menschliche Lebenszyklus reicht vom Beginn des individuellen Lebens bis zum Individualtod. Das zyklische Geschehen ergibt sich dadurch, dass mit dem Tod von Individuen der notwendige Raum für die Nachfolgegenerationen geschaffen wird, was Voraussetzung für die Evolution schlechthin ist. Obgleich man den Individualtod auf den ersten Blick vermeintlich relativ leicht als jenen Zustand definieren möchte, in dem alle Lebensfunktionen (Reizbarkeit, Wachstum, Reifung, Altern 273 Stoffwechsel, Wachstum und Differenzierung, Organfunktion etc.) erloschen sind, zeigt die Realität auf der Basis der modernen Intensivmedizin, dass auch das Sterben ein durchaus langer Prozess sein kann. In der Praxis wird heute zwischen dem klinischen Tod oder Herztod (= Zeitpunkt, an dem Herzschlag und Atmung aussetzen) und dem biologischen Tod oder dem Hirntod (= Zeitpunkt, an dem im Elektroencephalogramm keine Hirntätigkeit mehr feststellbar ist) unterschieden (vgl. Kap. 5.2). Die Zeitspanne zwischen klinischem und biologischem Tod kann z. B. für eine Organentnahme zu Transplantationszwecken genutzt werden. Noch schwieriger, wenn nicht letztlich sogar unmöglich, gestaltet sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Definition des Beginns des Lebens, da allein die Befruchtung bereits ein Vorgang ist, welcher sich über viele Stunden erstreckt. Die heftigen Diskussionen in jüngster Zeit über die Forschung an embryonalen Stammzellen (z. B. Niemitz u. Niemitz 1999) zeigen deutlich, dass bestenfalls ein pragmatischer Konsens gefunden werden kann. Nicht nur aufgrund der Komplexität der Embryonalentwicklung, sondern insbesondere auch im Hinblick auf die ethischen und gesellschaftlichen Implikationen im Zeitalter der Gentechnologie, soll das Thema der menschlichen Embryonalentwicklung in diesem Lehrbuch nicht behandelt werden, da es nur in unzulässiger Kürze geschehen könnte. An dieser Stelle sei daher auf die reichhaltige aktuelle Spezialliteratur verwiesen (Brauer 2003, Larsen 2001, Rohen u. Lüthjen-Drecoll 2003). In Bezug auf Wachstum und Reifung sind bis zum Erreichen des Erwachsenenalters die Merkmale des Skelettes und der Dentition gut geeignete Marker für den individuellen Entwicklungsstand (s. Kap. 2.3.2). Diese werden jedoch den zugehörigen kognitiven und physiologischen Reifemerkmalen nicht immer gerecht. Aufgrund der hohen interindividuellen Variabilität der Reifungsprozesse können biologisches und chronologisches Alter eines Heranwachsenden vorübergehend voneinander differieren. Das biologische Alter entspricht einem Entwicklungsstadium, welches im Populationsdurchschnitt in einem bestimmten chronologischen Alter erreicht wird (Knußmann 1996). Häufig wird die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen konform mit den anthropologischen Altersklassen Infans I, Infans II und Juvenis (s. Kap. 2.3.2) unterteilt in eine frühe Kindheit (von der Geburt bis 6 Jahre), die eigentliche Kindheit (7–12 Jahre) und die Reifezeit (13–20 Jahre). Die Pubertät2 kennzeichnet den Übergang von der Kindheit in die Reifezeit und wird ihrerseits wiederum unterteilt in die Vorpubertät (Zeitspanne zwischen dem ersten Auftreten der sekundären Geschlechtsorgane und deren Funktionsbeginn), die eigentliche Pubertät (Ausprägung der sekundären Geschlechtsmerkmale) und die Nachpubertät (Geschlechtsorgane voll entwickelt und funktional). Spezifischer auf den morphologischen Wandel in der menschlichen Ontogenese eingehend, unterscheiden Flügel et al. (1986) ein Neugeborenenstadium (von der Geburt bis zum Ende der zweiten Lebenswoche), gefolgt von einem Säuglingsstadium (bis zum Ende des ersten Lebensjahres) und dem Kleinkindstadium (bis zum Ende des 6. Lebensjahres). In Bezug auf das Wachstum findet nach 2 lateinisch pubertas = Mannbarkeit 274 Lebenszyklus Abb. 4.1. Alterstypisches Längenwachstum und Gewichtszunahme. Daten aus Eiben (1995) Abb. 4.2. Alterstypisches Längenwachstum im Vergleich zur Wachstumsgeschwindigkeit (cm/ Jahr, rechte Y-Achse). Deutlich ist das zeitlich versetzte Auftreten des puberalen Wachstumsschubes (PHV, s. Text) bei Mädchen und Knaben. Daten aus Eiben (1995) Wachstum, Reifung, Altern 275 der Geburt im Säuglingsalter die erste Fülle (Gewichtszunahme bei verlangsamtem Längenwachstum) statt, im Kleinkindalter die erste Streckung (deutliches lineares Wachstum). Mit dem sechsten Lebensjahr erfolgt der Eintritt in das Schulalter, gekennzeichnet durch den ersten Gestaltwandel (deutliche Proportionsänderung). Die Extremitäten strecken sich, und das Kind ist z. B. in der Lage, mit einem Arm den Kopf umfassend mit der Hand das Ohr der anderen Körperhälfte zu greifen (Philippinermaß). Dieses Merkmal ist häufig Bestandteil des Schulreifetests, da ein Zusammenhang zwischen körperlicher und kognitiver Entwicklung besteht (Flügel et al. 1986, Knußmann 1996). Diesem ersten Gestaltwandel folgt die Periode der zweiten Fülle, der sich mit Eintritt in die Pubertät ein zweiter Gestaltwandel und eine zweite Streckung anschließen (Abb. 4.1; 4.2). Im weiteren Verlauf dieses Kapitels soll der Definition menschlicher Entwicklungsstadien nach Bogin (1999) gefolgt werden, welche Beobachtungen auch an traditionalen menschlichen Sozietäten mit einbezieht: Geburt. Der Zeitpunkt der Geburt bedeutet für das Kind den einschneidendsten Wechsel seiner unmittelbaren Umweltbedingungen im gesamten Leben. Das Mortalitätsrisiko während der Neonatalperiode (= entspricht den ersten 28 Tagen post partum) ist entsprechend hoch. Als kritisches Merkmal wird das Geburtsgewicht gewertet, welches zwischen 3,0 und 4,5 kg als normal bezeichnet wird. Während der Neonatalperiode muss sich das Kind an seine neue Umwelt adaptieren. In dieser Zeit wird die höchste Rate an postnatalem Wachstum und postnataler Reifung beobachtet. Frühe Kindheit (0 bis 3 Jahre). Starkes Wachstum, insbesondere starkes Hirnwachstum mit entsprechendem Erwerb motorischer und kognitiver Fähigkeiten. Deutliche Abschwächung des Wachstumsspurtes gegen Ende des Kleinkindalters. Durchbruch des Milchgebisses, welches spätestens im Alter von 3 Jahren komplett ist. Kleinkinder werden mehrheitlich gestillt, bei traditionalen Bevölkerungen bis zu zwei oder drei Jahre lang. Im Vergleich zu anderen Säugetieren ist menschliche Muttermilch relativ arm an Fett und Protein, ein Indikator für ursprünglich häufiges Stillen bei abnehmender Wachstumsrate (Stinson 2000). Kindheit (3 bis 7 Jahre). Moderates Wachstum, insbesondere Einstellen des Gehirnwachstums gegen Ende der Kindheit. Ebenfalls gegen Ende dieser Lebensspanne häufig eine geringere Verstärkung des Wachstums („mid-growth spurt“, Tanner 1947, s. unten). Kinder diesen Alters sind abhängig von der Pflege der Eltern bzw. Erwachsener. Das Dauergebiss ist bei weitem noch nicht vollständig, die Intestinalorgane sind noch klein und unreif, jedoch ist das Gehirn noch im Wachstum begriffen. In der Folge benötigen die Kinder eine Ernährung, welche leicht zu Kauen ist und ein geringes Volumen hat, dabei zugleich eine hohe Dichte an Proteinen und Energieträgern. Die Kinder sind in dieser Zeit auch besonders verwundbar, sei es durch Krankheiten oder Beutegreifer. Es ist keine Gesellschaft bekannt, in welcher Kinder diese Lebensspanne ohne entsprechende Hilfestellung überleben können. 276 Lebenszyklus Jugendalter (7 bis 10 Jahre für Mädchen, 7 bis 12 Jahre für Jungen). Langsameres Wachstum, Erlernen sozialer und ökonomischer Fähigkeiten. Jugendliche sind in der Lage, sich selbst zu ernähren und sind daher in Bezug auf das Überleben potentiell nicht mehr von anderen abhängig. Pubertät. Vergleichsweise kurzer Zeitraum gegen Ende des Jugendalters. Sexuelle Reife, deutlicher Anstieg des Sexualhormontiters. Im weiblichen Geschlecht kommt es zur ersten Menstruation (Menarche), im männlichen Geschlecht zur Ejakularche (s. Kap. 4.2). Adoleszenz. Beginnt mit der Pubertät und dauert fünf bis acht Jahre. Erneuter Wachstumsspurt und deutliche Gewichtszunahme. Dauergebiss vollständig oder nahezu vollständig (Weisheitszahn, s. Kap. 2.3.2, Tabelle 4.1). Entwicklung sekundärer Geschlechtsmerkmale und Aufnahme sexueller Aktivitäten. Eintritt in die soziale und ökonomische Welt Erwachsener. Erwachsenenalter. Die Körperendhöhe ist erreicht. Frühes Erwachsenenalter: von ca. 20 Jahren an bis zum Ende der reproduktiven Phase, „Homöostase“ in Bezug auf Physiologie, Verhalten und Kognition. Spätes Erwachsenenalter und Seneszenz: vom Ende der reproduktiven Phase bis zum Tod. Wachstum und Reifung bedeuten somit sowohl eine Serie von Formmerkmalen, welche für bestimmte Altersgruppen charakteristisch sind, als auch eine Serie unterschiedlicher Wachstumsraten. Diese Serien können entweder mittels Longitudinal- oder Querschnittstudien erfasst werden. Während bei einer Longitudinalstudie eines oder viele Individuen über möglichst deren gesamten mehrjährigen Wachstumsverlauf beobachtet und an ihnen Körpermaße, -gewicht und andere Merkmale erhoben werden, bezieht sich eine Querschnittstudie auf die zeitgleiche Beobachtung und Vermessung vieler Individuen einer Altersgruppe. Individuelle zyklische und adaptive Variabilitäten im Wachstums- und Reifeprozess (s. Kap. 4.1.2) werden hierdurch jedoch nivelliert. Dies geschieht auch im Zuge etwa der altersgruppentypischen Mittelwertbildung für quantifizierbare Merkmale nach Abschluss einer Longitudinalstudie. Der generelle menschliche Wachstumsverlauf ist in Abb. 4.1 grafisch veranschaulicht. Die Daten beruhen auf den Mittelwerten aus der Budapester Longitudinalstudie der Jahre 1970 bis 1988 (Eiben 1995). Aufschlussreich ist insbesondere die Betrachtung der Wachstumsgeschwindigkeit bzw. Wachstumsrate (in cm/Jahr; Abb. 4.2). Es ergibt sich das prinzipielle Bild einer hohen Wachstumsrate gleich nach der Geburt, welche bis zum dritten Lebensjahr rasch abnimmt. Sie sinkt weiterhin langsam bis zum Beginn der Pubertät, in welcher sich der puberale Wachstumsschub mit einem neuerlichen Wachstumsspurt, der „peak height velocity“ (PHV) manifestiert. Während des PHV können europäische Heranwachsende bis zu 8 cm (Mädchen) bzw. 10 cm (Knaben) an Körperhöhe in nur einem Jahr zunehmen (Knußmann 1996). Anschließend sinkt die Wachstumsrate wieder rasch bis zum Abschluss des Wachstums bei Erreichen der Körperendhöhe ab. Die weiblichen Individuen eilen dabei den männlichen in ihrer Entwicklung deutlich voraus (Abb. 4.2). Wachstum, Reifung, Altern 277 Abb. 4.3. Beispiel für allometrisches Wachstum. Die funktionelle Beinlänge (Schritthöhe, innere Beinlänge) wächst stärker als die Rumpflänge, kenntlich an der stärkeren Steigung der eingefügten Trendlinie. Daten für männliches Geschlecht, aus Flügel et al. (1986) Als „mid-growth spurt“ wird eine kurzfristige Zunahme der Wachstumsrate im Alter von etwa sieben bis acht Jahren bezeichnet, welche bei zwei Dritteln aller gesunden Kinder beobachtet wird (Karlberg 1998). Dieser wird allerdings bei Daten aus Querschnitt- oder gemittelten Longitudinalstudien kaum deutlich. Der mid-growth spurt wird im Zusammenhang mit dem Beginn der progressiven Sekretion von Androgenen aus der Nebennierenrinde („Adrenarche“) gesehen (Bogin 1999). Nicht alle Teile des Körpers wachsen mit der gleichen Intensität und Geschwindigkeit (Abb. 4.3). In der Folge kommt es zu dem bereits genannten mehrfachen Gestaltwandel (s. oben) und ausgeprägten Proportionsänderungen. Das Vorauseilen bzw. Zurückbleiben von Körperstrukturen während des Wachstums in Bezug auf den Gesamtorganismus oder in Relation zueinander wird als allometrisches Wachstum bezeichnet (Box 4.1). Vergleicht man z. B. die Proportionen eines Erwachsenen mit jenen eines Neugeborenen, so entspricht die erwachsene Kopfhöhe in etwa dem Zweifachen der Kopfhöhe des Neugeborenen, die Rumpflänge dem Dreifachen, die Armlänge dem Vierfachen und die Beinlänge dem Fünffachen (Flügel et al. 1986). Die gebräuchlichsten Körperdimensionen zur Erfassung der Proportionsänderungen sind die Körperhöhe, die Rumpflänge, die Beinlänge, die Schulter- und Hüftbreite, die relative Körperhöhe in Bezug auf die Rumpflänge sowie die Relation von Schulter- zu Hüftbreite. Letzte ändert sich z. B. während des Gestaltwandels in der Pubertät und führt zu einem deutlichen Geschlechtsdimorphismus (Johnston 1998). 278 Lebenszyklus Box 4.1 Das Allometrie-Konzept Gegenstand allometrischer Untersuchungen sind die strukturellen und damit auch funktionellen Konsequenzen von Größenunterschieden bei Organismen mit prinzipiell gleichartigen Bauplänen. Zu den untersuchten Merkmalen zählen gleichermaßen morphologische (z. B. die Länge der Extremitäten) und physiologische (z. B. Stoffwechselrate) Merkmale. Im engeren Sinne wird unter Allometrie das Vorauseilen bzw. Zurückbleiben einzelner Körperstrukturen in Bezug auf den Gesamtorganismus verstanden. Das Konzept ist daher für das Verständnis ontogenetischer Prozesse ausgezeichnet geeignet. Bei positiver Allometrie nimmt die betrachtete Struktur schneller an Größe zu als der Gesamtorganismus, bei negativer Allometrie langsamer. Diese unterschiedlichen Wachstumsraten der einzelnen Körperteile führen im Verlauf der Ontogenese zu Formveränderungen des Gesamtorganismus. Sind die Wachstumsraten dagegen gleich, liegt isometrisches Wachstum vor und es kommt zu einer Größenveränderung ohne begleitende Formveränderung. Bei isometrischem Wachstum wachsen Längenmaße proportional zu Längenmaßen1,0, zu Flächenmaßen0,5 und zu Volumenmaßen0,33. Die allometrische Formel Y = k · Xa beschreibt das Wachstumsverhalten einer untersuchten Variablen Y in Relation zum Körpergrößenmaß X, der allometrische Exponent sowie der allometrische Koeffizient k sind strukturabhängige biologische Konstanten (Jungers 1985). Üblicherweise wird diese Gleichung in ihrer logarithmierten Form verwendet (logY = · logX + logk),da lineare Beziehungen mathematisch einfacher erfassbar sind (Martin 1992b). Es ist zu beachten, dass die allometrische Formel zwar sehr gut für die Beschreibung von Wachstumsvorgängen geeignet ist, jedoch nicht automatisch auch für deren Erklärung (Jungers 1984). Interspezifische allometrische Analysen beziehen sich auf verschiedene, zumeist näher verwandte Spezies unterschiedlicher Körpergröße und dienen der Erfassung von evolutiven Trends innerhalb von Gattungen, sie sind auch erfolgreich auf stammesgeschichtliche Fragestellungen angewendet worden (z. B. Hartwig-Scherer u. Martin 1992). Intraspezifische allometrische Analysen beziehen sich auf Körpergrößenunterschiede von erwachsenen Individuen einer Art, z. B. von Männchen und Weibchen. Die ontogenetische Allometrie hat Individuen unterschiedlicher Alters- und Entwicklungsstufen einer Spezies zum Gegenstand. Wachstum, Reifung, Altern 279 Tabelle 4.2. Relative Organgröße (%) bei Neugeborenen und Erwachsenen. Aus Forbes (1987). Die Daten für Erwachsene beziehen sich auf den „Reference Man“ (International Commission on Radiological Protection 1975) Organ Neugeborenes Erwachsener Gehirn Leber Nieren Herz Haut Muskeln Knochen Knorpel Körperfett Oberfläche/Gewicht 13 5 1 0,7 15 25 4 9 10–15 0,1 2 2,6 0,5 0,5 7 40 7 1,6 15–25 0,027 Wachstum und Reifung beschränken sich jedoch nicht auf Form und Funktion des Körpers, sondern betreffen selbstverständlich auch dessen Zusammensetzung. In Tabelle 4.2 sind die relativen Organgrößen (in Prozent) Neugeborener und Erwachsener gegenübergestellt. Neugeborene haben relativ viel größere Gehirne und Intestinalorgane als Erwachsene, somit ausgesprochen kostenintensive Organe. Ein menschliches Neugeborenes muss allein bis zu 87% seines Grundumsatzes für Wachstum und Funktion des Gehirns aufwenden. Im Alter von etwa fünf Jahren sind es immer noch 44%, im Erwachsenenalter 20–25%. Vergleichswerte für die entsprechenden Entwicklungsstadien bei Schimpansen sind 45%, 20% und 9% (Bogin u. Smith 2000). Das Verhältnis von Körperoberfläche zum Körpergewicht beträgt beim Neugeborenen das Drei- bis Vierfache des Verhältnisses von Erwachsenen, in der Folge sind potentielle Verluste von Wärme, Wasser und Elektrolyten beim Neugeborenen höher. Auch die ontogenetischen Veränderungen der Körperzusammensetzung sind weder uniform noch linear: Während der Zuwachs an Muskelmasse im Kindesalter noch eher langsam ist, erfolgt während der Adoleszenz ein regelrechter Spurt, welcher im männlichen Geschlecht intensiver erfolgt und auch länger anhält, so dass Männer höhere Adultwerte haben als Frauen (Forbes 1987). In Bezug auf den Körperfettanteil kommt es zu einer ersten raschen Akkumulation im ersten Lebensjahr und einer weiteren kurz vor Erreichen des PHV (Fomon et al. 1982). Nach einer Hypothese von Frisch u. McArthur (1974) ist für die Menarche ein Mindestkörpergewicht und ein Mindestanteil an Körperfett erforderlich, für eine fortgesetzte Menstruation sei ein Körperfettanteil von 22% notwendig. In der Tat weisen unterernährte Frauen oder auch Sportlerinnen, welche einen hohen Energieumsatz bei gleichzeitig restriktiver Gewichtskontrolle haben, häufig Zyklusstörungen auf bzw. die Menstruation bleibt ganz aus. Derart einfach dürften die Zusammenhänge zwischen Körperzusammensetzung und sexueller Reifung jedoch nicht sein (Scott u. Johnston 1982). 280 Lebenszyklus 4.1.2 Steuerung des postnatalen Wachstums Der menschliche Wachstums- und Reifeprozess ist im Wesentlichen genetisch vorgegeben, kann jedoch durch zahlreiche Umweltfaktoren sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden. Wie für viele komplexe biologische Phänomene, ist auch der Weg von der DNA zum Phänotyp einschließlich der zahlreichen differentiellen Genexpressionen für das Wachstum noch bei weitem nicht aufgeklärt, und es bestehen derzeit weit bessere Kenntnisse über das pränatale Wachstum als über das postnatale (z. B. Homöobox-Gene3; Muragaki et al. 1996). Für wesentliche Merkmale scheint die genetische Kontrolle jedoch recht hoch zu sein: So beträgt z. B. die 95%-Grenze normaler Variabilität der Körperendhöhe für nicht-verwandte europäische Männer 25 cm, für Brüder 16 cm, und für eineiige Zwillinge lediglich 1,6 cm (Hauspie u. Suzanne 1998). Y-chromosomale Gene sind dafür verantwortlich, dass Knaben länger wachsen als Mädchen und erwachsene Männer daher im Durchschnitt die größere Körperendhöhe erreichen (s. Abb. 4.2; Stinson 2000). Bezüglich der Endokrinologie spielt ein im Hypothalamus gebildetes Peptid, das Growth hormone-releasing hormone (GHRH; Genort 20q11.2) eine wesentliche Rolle, da es die Synthese und Sekretion des eigentlichen Wachstumshormones Somatotropin (growth hormone, GH) aus dem Hypophysenvorderlappen stimuliert. Antagonist für das GH ist das im Hypothalamus gebildete Somatostatin. Das GHRH seinerseits wird durch Sexualhormone (Androgene, Östrogen) beeinflusst und dürfte daher auch an der Ausprägung von Sexualdimorphismen beteiligt sein. Weitere endokrine Hormone, welche Wachstum und Reifung steuern, sind z. B. Insulin und das Schilddrüsenhormon Thyroxin. Darüber hinaus ist eine ganze Reihe von gewebs- bzw. zellspezifischen Wachstumsfaktoren (growth factors, GF) aktiv, z. B. epidermaler GF, Fibroblasten-GF oder hepatocytärer GF. Die aufgrund ihrer strukturellen Verwandtschaft mit dem Insulin als insulin-like growth factors (IGF) bezeichneten, überwiegend in den Leberzellen gebildeten Peptide sind starke Wachstumsfaktoren, welche in ihren Zielzellen die Synthese von DNA und Proteinen stimulieren, die Zellteilungsrate und den Zellstoffwechsel erhöhen. Das IGF-1 (Somatomedin) interagiert mit zahlreichen Hormonen, vermittelt aber vor allem die Wirkung des GH auf das Skelett. Das IGF-2 (multiplication stimulating activity, MSA) spielt eine wesentliche Rolle in der embryonalen und fetalen Entwicklung. Die Wirkung der IGFs wie jene der anderen Hormone wird über spezifische Rezeptoren auf ihren Zielzellen vermittelt. Die kleinwüchsigen Efe, eine Population in Zaire, bei welcher die erwachsenen Männer in der Regel kleiner als 150 cm und die erwachsenen Frauen kleiner als 140 cm sind, scheinen resistent gegenüber IGF-1 zu sein, da sie nur über eine geringe Rezeptorendichte verfügen (Geffner et al. 1995). Der Selektionsvorteil der Kleinwüch- 3 Homöobox-Gene, syn. homeotische Gene: wirken auf die Musterbildung während der Embryonalentwicklung vielzelliger Organismen. Die Mehrzahl der homeotischen Gene enthält eine konservative Sequenz von 190 bp, die Homöobox. Wachstum, Reifung, Altern 281 Abb. 4.4. Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse am Beispiel des Ovars: GnRH stimuliert den Hypophysenvorderlappen zur Sekretion von LH und FSH, welche die Produktion von Ovarialhormonen anregen. Diese wirken ihrerseits im Sinne eines negativen Feedback-Mechanismus auf Hypophyse bzw. Hypothalamus zurück. Nach Ellison (1998) sigkeit dürfte standortbedingt sein und im Dienst der Thermoregulation stehen (s. Kap. 3.2). Beim Eintritt in die Pubertät wird im Zuge der Reifung der primären Geschlechtsmerkmale die Hypothalamus-Hypophysen-Gonadenachse aktiviert (Abb. 4.4), welche für die Reifung und Ausprägung der sekundären Geschlechtsmerkmale erforderlich ist. Das Gonadotropin-releasing hormon (GnRH) aus dem Hypothalamus stimuliert den Hypophysenvorderlappen zur Sekretion der Gonadotropine luteinisierendes Hormon (LH) und follikelstimulierendes Hormon (FSH). Bei Frauen stimulieren LH und FSH das Wachstum der Ovarien und die Sekretion von Östrogenen, bei Männern bewirkt LH die Sekretion von Androgenen und FSH den Beginn der Produktion von Spermatozoen. Die Hormone der Gonaden wirken ihrerseits im Sinne eines negativen Feedback-Mechanismus auf den Hypothalamus und den Hypophysenvorderlappen zurück. Der höhere Titer von Androgenen und Östrogenen initiiert den puberalen Wachstumsschub (Preece 1986, Smith u. Korach 1996). Jedoch nicht nur in der Pubertät, sondern auch während der ersten beiden Lebensjahre ist der LH- und FSH-Titer besonders hoch, korreliert mit der hohen Wachstumsgeschwindigkeit und der raschen neurologischen Entwicklung. Erst mit etwa zwei Jahren wird der negative Feedback-Mechanismus aktiviert und der Titer der Gonadotropine verbleibt bis zur Pubertät auf einem niedrigen Level (Hayes u. Crowley 1988). 282 Lebenszyklus Ein gesundes Kind, das unter guten Umweltbedingungen aufwächst, wird ein Wachstums- und Reifungsmuster aufweisen, welches dem in Kap. 4.1.1 beschriebenen folgt. Zahlreiche Umweltbedingungen können jedoch zu erheblichen Abweichungen führen, so wirken z. B. Mangelernährung, Infektionserkrankungen oder auch psychische Deprivation hemmend. Zahlreiche Länder haben daher Referenzdaten für normales Wachstum und normale Entwicklung aufgestellt, mit denen die individuellen Daten eines potentiellen Patienten abgeglichen werden können (z. B. Tanner et al. 1966, Roede u. van Wieringen 1985, Wachholder u. Hauspie 1986). Derartige Referenzdaten bedürfen der regelmäßigen Überprüfung und gegebenenfalls Aktualisierung. Darüber hinaus ist zu beachten, dass es offenbar innerhalb des Gesamtprozesses zu zyklischen Ereignissen rascheren oder langsameren Wachstums kommt, welche sich im Rahmen von wenigen Wochen („mini growth spurts“, Hermanussen et al. 1988), saisonal im Rahmen von Monaten (Cole 1993) oder als zweijähriger Zyklus (Butler et al. 1989) manifestieren. Klinisch manifeste Abweichungen vom normalen Wachstums- und Entwicklungsmuster können zunächst angeboren sein, wie im Falle von Chromosomenaberrationen (z. B. Turner-Syndrom4), Genmutationen (z. B. Achondroplasie5) oder endokrinologischen Störungen. Es sind z. B. vier Typen isolierter GHDefizienz (IGHD, isolated GH deficiency) mit Mendel-Erbgang bekannt: IGHD IA (autosomal rezessiv, GH fehlt), IGHD IB (autosomal rezessiv, GH vermindert), IGHD II (autosomal dominant, GH vermindert), und IGHD III (X-chromosomal, GH vermindert). Umweltfaktoren, welche das Wachstum retardieren können, sind vor allem mangelhafte Ernährung und damit der Mangel an erforderlicher Stoff- und Energiezufuhr sowie häufige Erkrankungen und mangelnde Hygiene. Die verwundbarste Zeit ist die Kindheit: unter ungünstigen Bedingungen bleiben die betroffenen Individuen dauerhaft kleiner. Manifeste Körperhöhenunterschiede im Alter von vier bis sechs Jahren sind im Wesentlichen verantwortlich für beobachtbare Körperhöhenunterschiede bei Erwachsenen (Stinson 2000). Diese Umwelteffekte haben sehr viel geringere Auswirkungen, wenn die Betroffenen bereits im juvenilen oder Adoleszentenalter sind, vermutlich ist die genetische Wachstums- und Reifungskontrolle in diesem Lebensabschnitt stärker. Nicht nur zwischen Populationen, sondern auch innerhalb sozial stratifizierter Bevölkerungen wirken sich die allgemeinen Lebensbedingungen messbar auf das Wachstum aus (Gronkiewicz 2001). Dass in westlichen Sozietäten eine hochgewachsene Statur mehrheitlich positiver bewertet wird, mag in diesem Phänomen begründet sein (Cassidy 1991). Umweltbedingte Wachstumsretardationen können jedoch bei Verbesserung der Lebensverhältnisse wieder aufgeholt werden, und zwar durch einen als „catch-up growth“ bezeichneten Wachstumsspurt (Steckel 1987, Bogin 1999). Ursprünglich wurde als catch-up growth eine Periode rascheren WachsTurner-Syndrom: Betrifft das weibliche Geschlecht; typischer Karyotyp ist 45X, d. h. ein X-Chromosom fehlt völlig. Charakteristisch ist eine geringe Körpergröße, unterentwickelte Gonaden und weitere Dysmorphien in der Gestalt und der inneren Organe. 5 Achondroplasie: Knochendysplasie aufgrund einer dominanten Mutation des FGFR 3-Gens (fibroblast growth factor receptor type 3), Folge ist Kleinwuchs und disproportioniertes Wachstum. 4 Wachstum, Reifung, Altern 283 tums bezeichnet, welche einer Periode retardierten Wachstums folgt. In der erweiterten Fassung fällt heute ebenfalls ein stärkeres Längenwachstum als Folge einer längeren Wachstumsperiode unter diesen Begriff (Stinson 2000). Der Effekt dieses catch-up Phänomens ist abhängig von der Dauer und Intensität der Wachstumsretardation, sowie von der Altersstufe der Betroffenen. Die allgemein verbesserten Lebensbedingungen vor allem in den westlichen Nationen haben zu einem Phänomen geführt, welches für Europäer seit etwa 150 Jahren beobachtbar ist und daher als säkularer Trend bezeichnet wird: nicht nur die Körperendhöhe im Erwachsenenalter ist gestiegen, auch die sexuelle Reife (Zeitpunkt des PHV, Menarchealter) findet früher statt. Diese Trends können sehr ausgeprägt sein,so ist z. B.in Schweden die Körperendhöhe im Verlauf von 100 Jahren um circa 10 cm gestiegen, das Menarchealter ist von durchschnittlich 15,8 Jahren auf 13 Jahre gesunken (Lindgren 1998). Nach Meredith (1976) ist im Verlauf der letzten rund 150 Jahre die Körperhöhe in der späten Kindheit um 1,3 cm pro Dekade gestiegen, im Adoleszentenalter um 1,9 cm pro Dekade und im Erwachsenenalter um 0,6 cm. Die geringeren Unterschiede in der Körperendhöhe erklären sich durch die gleichzeitige Vorverlegung der Reife. Einen besonders starken Trend konnte Japan verzeichnen: Während die mittlere Körperhöhe junger erwachsener Männer im Jahre 1950 noch bei 160 cm lag, war diese im Jahre 1995 auf 172 cm gestiegen, wobei die Steigerung allerdings von Dekade zu Dekade geringer wurde (Hauspie et al. 1996). Aufgrund des allometrischen Wachstums (s. oben) werden diese säkularen Trends auch von einer Proportionsverschiebung begleitet. Als weitere denkbare Ursachen für diese in vielen Ländern beobachtbaren säkularen Trends wurden Heterosiseffekte, Heterozygotie, verstärkter überregionaler Genfluss und assortative Paarung (s. Kap. 3.1.2) vorgeschlagen. Aufgrund der eindeutigen sozioökonomischen Einflüsse auf Wachstum und Reifung und der Tatsache, dass die säkularen Trends in Kriegs- und Notzeiten vermindert sind (Flügel et al. 1986, Knußmann 1996),dürften die genannten Faktoren der verbesserten Hygiene,medizinischen Versorgung und Ernährung tatsächlich im Wesentlichen für das Phänomen verantwortlich sein. Im Falle von starken Einbrüchen in der Lebensqualität infolge Krieg oder politisch motivierter Repression kann es sogar zu negativen säkularen Trends kommen, wie z. B. in Guatemala während des Bürgerkrieges 1974 bis 1983 (Bogin u. Keep 1999). Während die säkularen Trends vielerorts noch beobachtbar sind, scheinen sie vor allem in den westlichen Nationen zum Stillstand zu kommen oder bereits stagniert zu haben. Dieser Stillstand ist gegenwärtig noch Gegenstand der Diskussion, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die speziesspezifische Körperendhöhe zwischenzeitlich erreicht wurde (Stinson 2000). Für die Bundesrepublik Deutschland konnte Greil (2001a) feststellen, dass die Trends noch in jüngster Zeit fortbestanden haben müssen, da die Körpermaße von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zum Teil deutlich von jenen durch das Deutsche Institut für Normung (1986) veröffentlichten abweichen. Dabei haben die säkularen Trends wahrscheinlich auch eine negative Seite: Nach Daten, welche von Davies (1998) im Jahre 1992 erhoben wurden, haben Kinder aller Altersgruppe einen signifikant höheren Körperfettanteil als in der zehn Jahre zuvor publizierten Studie von Fomon et al. (1982; s. oben). Ein solcher 284 Lebenszyklus Trend in der Veränderung der Körperzusammensetzung spricht für ein deutliches Missverhältnis von Energieaufnahme und Energieabgabe, welches vielfach bereits zu einem pädiatrischen Problem geworden ist. Säkulare Trends werden noch immer aktiv und intensiv erforscht, da die hohe Plastizität menschlicher Phänotypen den direkten Rückschluss auf die Ursächlichkeiten erlaubt. 4.1.3 Evolution des menschlichen Wachstums- und Reifemusters Die menschliche Ontogenese ist in mehrere Abschnitte gegliedert,welche sich in Bezug auf körperliche und kognitive Entwicklung voneinander abgrenzen lassen. Wie alle sozial lebenden Säugetiere haben Menschen eine Jugendzeit, in welcher soziale Kompetenz durch Lernen erworben wird. Im Vergleich zu anderen Säugetieren einschließlich der Primaten zeichnen sich Menschen durch ein relativ kurzes Kleinkindalter, dafür eine verlängerte Kindheit aus, zuzüglich einer Zeit der Adoleszenz. Es gilt also, nach den evolutiven Randbedingungen und Selektionsdrücken zu fragen, welche dieses spezifisch menschliche Wachstumsund Reifungsmuster hervorgebracht haben. Verlängerte Kindheit In einer Untersuchung zum Entwöhnungsalter für Säuglinge in den verschiedensten menschlichen Kulturen und im Vergleich zu 88 großen Säugetieren einschließlich zahlreicher Primatenspezies haben Lee et al. (1991) und Bowman u. Lee (1995) als bemerkenswerte Konstante feststellen können, dass erste feste Nahrung dann zugefüttert wird, wenn das Junge ungefähr das 2,1fache seines Geburtsgewichtes erreicht hat, und dass keine Muttermilch mehr gegeben wird (= vollständige Entwöhnung), wenn das Junge etwa das 3,2 bis 4,9fache seines Geburtsgewichtes erreicht hat. Weitgehend unabhängig von der Stillpraxis der Mütter (wenige Monate oder mehrere Jahre des Stillens) wird auch menschlichen Säuglingen feste Nahrung bei Erreichen des zweifachen Geburtsgewichtes gereicht. Im Gegensatz zu anderen Säugetieren erfolgt die vollständige Entwöhnung von der Muttermilch aber bereits bei einem geringeren Entwicklungsgrad von weniger als dem Dreifachen des Geburtsgewichtes. Menschen unterscheiden sich ferner von nicht-menschlichen Primaten und anderen Säugetieren dadurch, dass die Entwöhnung vor dem Durchbruch des ersten Dauerzahnes erfolgt (Smith et al. 1994). Wie bereits erwähnt, ist die Fütterung einer speziellen, altersgerechten Nahrung für das menschliche Kleinkind erforderlich. Aufgrund seines unterentwickelten Intestinaltraktes wären Fehlernährung und Unterentwicklung sonst unausweichlich (Bogin 1999). Dies dürfte folgerichtig mit der „expensive-tissue hypothesis“ von Aiello u. Wheeler (1995) zu erklären sein: Erwachsene Menschen haben im Vergleich zu gleichgroßen Säugetieren ein sehr großes Gehirn, aber einen kleinen Intestinaltrakt. Da beide Organe energieintensiv sind, wurde im Verlauf der menschlichen Evolution der Verdauungstrakt zugunsten des Gehirnes bei hierdurch insgesamt ausgeglichener Energiebilanz reduziert. Als Konsequenz fand eine Nahrungsanpassung der Menschen statt, welche im Vergleich zu Wachstum, Reifung, Altern 285 Menschenaffen mehr Fleischnahrung konsumieren, und ferner die Fähigkeit erworben haben, die Nahrung mit dem Ziel einer Energiemaximierung zuzubereiten. Ein großes Gehirn und ein wenig entwickelter Intestinaltrakt erzwingen also eine spezielle Nahrungszubereitung für das Kleinkind,erklären jedoch noch nicht die im Vergleich zu anderen Säugetieren relativ frühe Entwöhnung. Ein weiteres menschliches Spezifikum sind die Adrenarche und der mid-growth spurt (s. oben) des menschlichen Kleinkindes. Beide finden in einem Alter statt, in dem die Hirnentwicklung abgeschlossen und auch ein kognitiver Entwicklungssprung vollzogen wird, welcher als „5 to 7 year old shift“ bezeichnet wird (Bogin 1999). Die rund vier Jahre dauernde menschliche Kindheit endet somit mit messbaren physiologischen und psychologischen Parametern und mündet dann in das Jugendalter. Die verlängerte menschliche Kindheit kann zunächst dahingehend erklärt werden, dass menschliche Neugeborene aufgrund eines Missverhältnisses von fetaler Hirngröße und mütterlichen Beckenmaßen relativ unterentwickelt zur Welt kommen müssen (sekundäre Altrizialität, s. Kap. 2.1). In der Folge kommt es nach der Geburt zu dem spezifisch menschlichen Wachstumsmuster mit einem raschen weiteren Gehirnwachstum bei verlangsamtem Körperwachstum, was darüber hinaus eine besondere kindliche Lernphase ermöglicht. Tatsächlich könnte aber die lange Kindheitsphase zugleich, wenn nicht primär, auch einen Selektionsvorteil in Bezug auf den Reproduktionserfolg der Gattung Homo bedeutet haben. Ein bereits entwöhntes Kind, welches noch seiner speziellen Nahrung bedarf, muss nicht mehr ausschließlich von seiner Mutter betreut werden – diese Funktion können andere Erwachsene übernehmen, vorzugsweise die Großeltern, oder aber auch Jugendliche, welche noch nicht selbst in der reproduktiven Phase sind. Noch während das Kind dieser Pflege bedarf, kann seine Mutter ihrerseits wieder schwanger werden und ein weiteres Kind zur Welt bringen, ohne dass sie nun für zwei abhängige Kinder gleichzeitig sorgen müsste. Auf diese Weise kann jede Mutter ihre eigene Reproduktion durch verkürzte Intergeburtenintervalle erhöhen. Hiermit offenbart sich ein erneuter Aspekt, in welchem Menschen eine höhere Plastizität zeigen als z. B. ihre nächsten Verwandten im Tierreich (Bogin 1999). Adoleszenz Eine wirklich schlüssige Erklärung für das spezifisch menschliche Wachstums- und Reifungsmuster während der Adoleszenz steht noch aus. Das herausragende Merkmal ist der puberale Wachstumsspurt (PHV), für welchen es kein Pendant bei Primaten gibt und welcher vordergründig auch nur schwer verständlich ist, da die Körperendhöhe auch durch kontinuierliches Wachstum erreicht werden könnte. Sowohl Jungen als auch Mädchen erfahren vor der Pubertät ein eher gebremstes Wachstum, und beide Geschlechter treten in den puberalen Schub ein, die Mädchen eher als die Jungen. Der frühere Wachstumsabschluss im weiblichen Geschlecht trägt erheblich zum Geschlechtsdimorphismus der erwachsenen Bevölkerung bei. Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern besteht in dem Beginn der Fertilität: 286 Lebenszyklus Während Mädchen im Durchschnitt ein Jahr nach dem PHV ihre Menarche haben, durchlaufen sie eine weitere, bis zu fünf Jahre währende Zeit der Adoleszentensterilität, d. h. die volle Fertilität ist erst Jahre nach der sexuellen Reife gegeben (s. Kap. 4.2.2). Die biologische Ursache liegt vermutlich an der notwendigen Zeit für die volle Ausprägung der erwachsenen Beckenkonfiguration, ein Tribut an den Erwerb der Bipedie (Trevathan 1987). Knaben sind jedoch bereits fertil bevor sie ihre Körperendhöhe und das charakteristisch männliche morphologische Erscheinungsbild erreicht haben. Bogin (1999, 2001) schlägt eine evolutionsbiologische Begründung vor, welche biologische und kulturelle Faktoren miteinander verknüpft: Adoleszente Mädchen wirken in ihrem gesamten physischen Erscheinungsbild bereits als Frau, bevor sie ihre volle Fertilität erreicht haben und damit in das reproduktionsfähige Alter eintreten. Sie werden in die weiblichen Geschlechterrollen eingeführt und lernen vor allem den Umgang mit und die Pflege von Kindern (s. oben, verlängerte Kindheit). In der Folge sei die Überlebenswahrscheinlichkeit erstgeborener Kinder höher als bei Primaten, da die Erstgebärende ihre Mutterrolle bereits hinreichend erlernt hat. Knaben hingegen sind sexuell gereift, ehe sie in ihrem gesamten Habitus (z. B. Entwicklung der Muskulatur) auch als gereifter Mann erscheinen. Gegenüber gleichaltrigen Mädchen wirken sie weit kindhafter und sind in der Regel auch von kleinerer Statur. Dies gibt den Heranwachsenden wiederum die notwendige Zeit, um männliche Geschlechterrollen zu erlernen und zu praktizieren, bevor die Verantwortung für eine eigene Familie oder für eigene Nachkommen zu übernehmen ist. In dieser Hypothese wird die menschliche Kultur, welche als Produkt der Evolution integraler Bestandteil der menschlichen Ausstattung ist, in den Prozess der Selektion und Erhöhung des Reproduktionserfolges einbezogen, was der Hypothese eine hohe Attraktivität verleiht. Das spezifische, geschlechtertypische Wachstums- und Reifungsmuster menschlicher Heranwachsender signalisiert den erwachsenen Mitgliedern der Population den Beginn des intensiven Erlernens männlicher und weiblicher Verhaltensmuster, was letztlich den Nachkommen zugute kommt. Diese einzigartige Version des sozialen und kulturellen Lernens ist daher unmittelbare Folge des spezifischen Entwicklungsmusters. 4.1.4 Altern und Seneszenz Altern ist unvermeidbar. Es betrifft alle Organismen, überall und zu jeder Zeit. Biologisches Altern bezieht sich auf biologische Prozesse, durch die der Organismus mit zunehmendem chronologischem Alter immer weniger in der Lage ist, die Homöostase, das physiologische Gleichgewicht des Körpers, in einem normalen Rahmen aufrecht zu erhalten. Gelingt das nicht mehr, treten Alterskrankheiten auf. Altern in biologischen Systemen kann als ein Prozess chronologisch aufeinander folgender Lebenszyklen definiert werden, der genetisch determiniert ist, umweltplastisch reagiert und ereignisabhängig ist (Arking 1998). Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die maximale Lebensspanne, das höchste erreichbare Lebensalter innerhalb einer Spezies, einen limitierenden Wachstum, Reifung, Altern 287 Faktor darstellt. In diesem biologischen Rahmen wirken intrinsische (im Körper manifeste) wie auch extrinsische (durch die Umwelt bedingte) Faktoren, die das Altern steuern bzw. zu beschleunigen oder zu verzögern vermögen. Spezifische Ereignisse wie Alterskrankheiten tragen dazu bei, dass die biologisch maximal verfügbare Lebensspanne nur in den seltensten Fällen ausgeschöpft werden kann.Altern wirkt sich zeitabhängig durch progressive nicht-reversible Veränderungen aus, die im Erwachsenenalter auftreten und kumulieren. Meistens, jedoch nicht immer, ist dies mit Funktionsverlusten verbunden. Operationalisiert werden kann diese Definition durch die allgemeine Formel CPID (cumulative, progressive, intrinsic, deleterious) (Arking 1998). Ein weiteres Kennzeichen von Altern ist seine Universalität. Innerhalb einer Spezies durchlaufen alle Individuen ein vergleichbares Muster gradueller Veränderungen, wenn auch mit einer zeitlich großen Variationsbreite. Da der Alternsablauf eng mit dem Sterberisiko verknüpft ist, folgt demnach die Sterblichkeit einem spezifischen Muster, die sich in größeren Bevölkerungen statistisch mit der Gompertz-Verteilung beschreiben lässt, nach der die logarithmierte altersspezifische Sterberate linear mit dem Alter ansteigt (vgl. Kap. 3.3). Stadien des Alterns lassen sich nur bedingt durch das Alter beschreiben. Der Begriff „alt“ leitet sich aus dem indogermanischen Wortstamm al- ab, der sich im gotischen alan wiederfindet und „aufwachsen, machen, ernähren“ bedeutet. Heute hat sich aus dem ursprünglich einen Prozess beschreibenden Begriff eine Zustandsangabe entwickelt, die mit dem chronologischen Alter den exakt ereignisdefinierbaren kalendarischen Zeitraum erfasst, der seit der Geburt vergangen ist. Spricht man vom biologischen Alter, so ist ein Funktionszustand gemeint, der Organismen gleicher biologischer Leistungsfähigkeit beschreibt, die aber nicht zwingend das gleiche chronologische Alter aufweisen. Die Abgrenzung zur Seneszenz (lat. senescere, alt werden) ist fließend. Mit ihr wird ein fortschreitender Funktionsverlust bezeichnet, der in postreproduktivem Alter auftritt und in eine herabgesetzte Überlebenskapazität mündet (Strehler 1982). Noch stärker grenzt der Begriff der Senilität (lat. senilis, greisenhaft) diese letzte Phase vor dem Tod ein, in der das Sterberisiko drastisch ansteigt (Finch 1997). In Ergänzung zu diesen Definitionen der Gerontologie, der interdisziplinären Wissenschaft vom Alter und Altern (Reimann u. Reimann 1994 a,b; Baltes u. Baltes 1992), wird in der biologischen Forschung der Begriff der Seneszenz bevorzugt für Alternsprozesse auf der molekularen und Zellebene angewandt (Finch 1990). Dieser semantischen Konvention schließt sich das vorliegende Kapitel an. Warum Organismen altern, ist eine essentielle biologische Frage. Es existieren über 300 Theorien zur Kausalität und zum Ablauf menschlichen Alterns, die sich in zwei Betrachtungsebenen gruppieren lassen. Zum einen ist dies die Gruppe der Theorien um evolutive Zusammenhänge, die ultimate Begründungen des Alterns und damit des Überlebens der Spezies liefern. Die zahlreichen Alternstheorien hingegen versuchen, mit der Frage nach dem „Wie“ die proximaten Ursachen des Alterns zu erklären, welche die Steuerung der Alternsprozesse betreffen (Bittles u. Collins 1986). So verschieden sie auch sein mögen, alle diese Theorien tragen einen mehr oder minder großen Teil zum Verständnis der Alternsabläufe bei. Sie alle ver- 288 Lebenszyklus bindet die Erkenntnis, dass die Lebenserwartung artspezifisch ist, der Alterungsprozess organspezifisch stattfindet und sich auf der Zellebene vollzieht. Auf allen Ebenen unterliegt dies sowohl genetischer Steuerung als auch Umwelteinflüssen (Steinhardt 1990, Dandekar 1996, Prinzinger 1996). Diese phänotypische Plastizität kann durch zwei unterschiedliche genetische Mechanismen erzeugt werden. Bestimmte Allele eines Genes können in verschiedenen Umwelten unterschiedlich exprimiert werden (wirksam sein), oder gegenüber Umwelteinflüssen empfindliche Regulatorgene sorgen für das Ein- oder Ausschalten bestimmter Zielgene. Die Messung des biologischen Alters Für die Biologie ist der Ablauf von Alternsprozessen im menschlichen Körper (vgl. Box 4.2) und das damit verbundene Sterberisiko von primärem Interesse. Die biologischen Merkmale können mit dem Vitalitätszustand beschrieben werden, der den Erhaltungsgrad rein biologischer Funktionen bewertet (Beier 1989). Es wird damit nur ein Teil der Alternsprozesse betrachtet, die neben den biologischen auch psychische und soziale Merkmale umfassen (Ries 1991) (vgl. Kap. 3.3; 6.3). Allein die Angabe des chronologischen Alters reicht bei weitem nicht aus, den Alterungszustand des menschlichen Körpers zu beschreiben, der zwar mit dem kalendarischen Alter korreliert ist, aber eine hohe individuelle Variationsspanne aufweist. Ein Muster der individuellen Alternsabläufe lässt sich dabei nur anhand von Längsschnittstudien erkennen, welche die Probanden über mehrere Jahre hinweg verfolgen. Die grundlegenden Erkenntnisse der menschlichen Alternsabläufe, ihrer Interaktionen und Einflussfaktoren sind diesen großen Alternsstudien zu verdanken (Mayer u. Baltes 1996). Für die Messungen des biologischen Alters wurden auf der Basis der ersten großen Längsschnittstudie, der Baltimore Longitudinal Study of Aging (Shock et al. 1984),zahlreiche sogenannte Testbatterien entwickelt, welche die Vitalität eines Organismus zu einem bestimmten Zeitpunkt seines kalendarischen Alters erfassen (Übersicht bei Dean 1988). Prinzipiell funktionieren diese nach dem System: 1. Erprobung von Organfunktionstests an einer Referenzpopulation, 2. Berechnung von Durchschnittswerten für das entsprechende chronologische Alter, 3. Erstellung eines Bewertungssystems, 4. Ermittlung eines Altersindex. Der so berechnete Altersindex lässt sich dann bei Probanden mit deren chronologischem Alter vergleichen und erlaubt eine Aussage, ob sich die Testperson in einem altersgerechten biologischen Zustand befindet oder ob sie abweichend von ihrem chronologischen Alter biologisch jünger oder älter ist. Da die Studiendesigns der Alternsstudien bezüglich der erfassten Variablen, der Stichprobenzusammensetzung und des Zeitraumes zwischen den Untersuchungsintervallen sehr unterschiedlich sind, sind die Ergebnisse zumeist nicht direkt vergleichbar. Es lassen sich aber generelle Zusammenhänge formulieren, Wachstum, Reifung, Altern 289 Box 4.2 Ausgewählte körperliche Alternsveränderungen beim Menschen Eine Vielzahl körperlicher Veränderungen findet mit dem Alternsprozess statt. Einige wenige aus dem gesamten Spektrum werden kurz vorgestellt, ausführlich werden altersabhängige körperliche Veränderungen bei Arking (1998) und Ricklefs u. Finch (1996) beschrieben. Die Leistung vieler Organe nimmt mit steigendem Alter ab, wodurch normale körperliche Funktionen aufrecht erhalten werden können, unter physiologischen Stresssituationen der Körper jedoch oft nicht mehr adäquat kompensieren kann. Beim jungen Erwachsenen ist eine reichlich bemessene Reservekapazität vorhanden, die in verschiedenen Organen mit unterschiedlicher Rate abnimmt (vgl. Abb. 4. 5). Haut: Wesentliches Merkmal ist die senile Elastose, die Faltenbildung. Die Kollagen- und Elastinfasern der Haut unterliegen einem intensiven Stoffwechsel, der im Alter verlangsamt ist. Durch die längere Verweilzeit können sich die langen Kollagenfasern vernetzen und die Abbaurate wird dadurch weiter herabgesetzt, woraus ein Kreislauf entsteht. Als Folge des herabgesetzten Kollagenumsatzes bilden sich Falten.Dieser Prozess setzt insbesondere an Stellen ein, die der Sonne ausgesetzt sind.Der Bildungsprozess von Falten ist irreversibel, Kosmetika können allenfalls den Feuchtigkeitsverlust der Haut ausgleichen, einen „repair“- Effekt erzielen sie nicht. Braune Altersflecken entstehen durch Ablagerung von Lipofuscin aus Lysosomen,ein Verdauungsenzym,das normalerweise für den Abbau abgestorbener Zellen verantwortlich ist. Bei der Bildung von Altersflecken wird dieses Enzym ohne Nebenwirkung in der lebenden Zelle abgelagert. Nach Hautverletzungen schüttet die Nebennierenrinde vermindert Hormone aus, welche die Zellteilung an den Wundrändern anregt. Dadurch heilen Wunden im Alter schlechter. Auge: Der ganze Sehapparat unterliegt einem Alterungsprozess. Zur sogenannten Altersweitsichtigkeit führt die Abnahme der Linsenelastizität. Dadurch verschiebt sich der Nahakkomodationspunkt von etwa 7 cm im Alter von 10 Jahren über 12 cm im Alter von 30 Jahren auf über 30 cm im Alter von 50 Jahren. Durch Zelleinwanderung verdickt sich die Linse und trübt ein (Grauer Star, Alterskatarakt). Muskeln: Die Anzahl von Muskelzellen wird bereits in der fetalen Entwicklung festgelegt und ändert sich lebenslang nicht.Durch körperliche Aktivität kann das Volumen der vorhandenen Muskelfasern gesteigert werden,durch extrinsische Faktoren wie Inaktivität,schlechte Ernährung oder Störung der Innervierung atrophieren Muskeln.Im alternden Organismus finden zudem intrinsische strukturelle Verände 290 Lebenszyklus Box 4.2 (Fortsetzung) rungen statt, die Muskelfibrillen werden durch Bindegewebe oder Fett ersetzt.Im Alter zwischen 30 und 80 Jahren werden durchschnittlich etwa 30% der Muskelzellen abgebaut. die studienübergreifend darauf hinweisen, dass nicht nur einzelne physiologische Parameter altersabhängigen Veränderungen unterworfen sind. Ein Charakteristikum des Alterns ist demnach die Interaktion physiologischer Variablen, über die bislang nur sehr wenig bekannt ist. Anhand mathematischer Modellierung ist von Manton et al. (1995) mit Daten der Framingham Studie eine optimale Konstellation der zehn wichtigsten das Altern beeinflussenden Parameter errechnet worden. Sie sagt aus, welche bei einem 30jährigen auftretenden Werte zu den günstigsten Überlebensraten führen würden. Aufgrund anderer Risiken jedoch können diese Optimalwerte real nicht erreicht werden (vgl. Tabelle 4.3). Die erste „Duke-University-Studie“ zeigte, dass individuelle physiologische und Persönlichkeitsmerkmale über den Lebenslauf weitestgehend konstant bleiben, eine der wesentlichsten Erkenntnisse für die systematische Alternsforschung, insbesondere die Risikoeinschätzung für Krankheitsin- Tabelle 4.3. Optimale Merkmalskonstellation physiologischer Merkmale bei 30jährigen Männern und Frauen zum Erreichen der maximalen Lebenserwartung anhand von Daten der Framingham Altersstudie (nach Manton et al. 1995) Männer Frauen Beobachteter Optimaler Wert Wert Beobachteter Optimaler Wert Wert 1. Blutdruckdifferenz, 48,5 Systolischer-diastolischer Wert (mm/Hg) 2. Diastolischer Blutdruck 82,0 (mm/Hg) 3. Body Mass Index (kg/m²) 254,1 4. Gesamtcholesterin (mg/dl) 212,3 5. Blutzucker (mg/dl) 79,5 6. Hämatokrit (%) 47,1 7. Vitalkapazität der Lunge 136,8 (Liter/Körperhöhe²) 8. Rauchen (Zigaretten/Tag) 15,0 9. Linksherzhypertrophie (%) 2,0 10. Puls (Schläge/Minute) 72,4 Weitere Lebenserwartung 43,7 im Alter von 30 Jahren 31,0 43,8 46,8 75,8 76,6 78,0 241,9 176,8 84,1 46,7 159,7 233,0 195,2 77,9 42,2 114,0 267,6 221,7 124,4 44,6 121,6 0,0 0,0 67,8 81,0 8,0 1,0 75,6 49,6 0,0 0,0 55,5 73,2 Wachstum, Reifung, Altern 291 Tabelle 4.4. Statistisch signifikante soziale Faktoren zur Beeinflussung der Lebenserwartung anhand der ersten Duke-Studie (nach Palmore 1982) Faktor Wirkung 1. Lebenserwartung des Vaters 2. Mentale Leistungen 3. Sozio-ökonomischer Status (Bildung, Einkommen, Beruf) 4. Aktivitäten Physische Mobilität Soziale Aktivitäten Aktivitäten in der Gruppe Individuelle Aktivitäten 5. Sexuelle Aktivitäten Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs sexuelle Aktivitäten in der Vergangenheit positiv Sexuelle Aktivitäten momentan positiv 6. Rauchen 7. Positive Lebenseinstellung bezüglich Arbeit, Religion und familiäre Einbindung Fröhlichkeit nur bei Männern positiv korreliert bei Männern und Frauen positiv korreliert nur bei Männern positiv korreliert 8. Gesundheit Objektive Beurteilung des Arztes Subjektive Einschätzung des eigenen Gesundheitszustandes Zufriedenheit mit der eigenen Gesundheit nur bei Frauen positiv korreliert nur bei Frauen positiv korreliert bei Männern und Frauen positiv korreliert bei Männern und Frauen positiv korreliert nur bei Männern positiv korreliert nur bei Frauen positiv korreliert nur bei Frauen positiv korreliert bei Männern und Frauen negativ korreliert nur bei Männern positiv korreliert bei Männern und Frauen positiv korreliert bei Männern und Frauen positiv korreliert bei Männern und Frauen positiv korreliert nur bei Frauen positiv korreliert zidenz (Palmore 1982). In dieser spezifischen Stichprobe erwiesen sich über die physische Gesundheit und Nichtrauchen hinaus die berufliche Zufriedenheit und Ausgeglichenheit als die stärksten Einflussparameter. Unter den 50 erhobenen Merkmalen hatten 22 einen signifikanten Einfluss auf die Lebensspanne (vgl. Tabelle 4.4). Maximale biologische Lebensspanne Da Alternserscheinungen die Vulnerabilität des Organismus (Krankheitsanfälligkeit, s. Kap. 3.2) erhöhen, drücken sich fortschreitende Alternsprozesse in der Sterbewahrscheinlichkeit und der daraus berechneten Lebenserwartung aus, die sich im demographischen Konzept der Sterbetafel kalkulieren lässt (vgl. Kap. 3.3). Die Sterbetafelparameter besitzen eine statistische Aussagekraft auf der Bevölkerungsebene, während sich das biologische Potential einer Spezies geeigneter mit dem maximum life span potential (MLP) darstellen lässt. Dieses theoretische Konzept beruht auf der maximal möglichen Lebensspanne, gemessen an den ältesten Vertretern der Spezies in ihrer naturräumlichen Umwelt (Weiss 1981). Während die Lebenserwartung stark umweltsensibel reagiert, bleibt der MLP-Wert konstant, sofern die Anzahl der Individuen in einer Spezies 292 Lebenszyklus Abb. 4.5. Funktionskontinuität und -verluste mit zunehmendem Alter nach Daten der Baltimore-Studie (nach Arking 1998) groß genug ist, um mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einige wenige Individuen hervorzubringen, die sich der maximalen Lebensspanne annähern. Das MLP wird als Maß für die genetische Überlebenskapazität einer Spezies angesehen.Seine Bestimmung ist jedoch in kaum einer Art sicher möglich,da Geburtsund Sterbedaten bei freilebenden Arten schwer zu bestimmen sind. Auch beim Menschen gibt es kaum verlässliche Daten. In vielen europäischen Ländern werden erst seit 200 bis 300 Jahren amtliche Bevölkerungsdaten geführt, welche die Authentizität des Lebensalters belegen können. Diese Spanne reicht nicht aus, um eine statistisch ausreichende Sicherheit über die maximale Lebensspanne zu gewinnen. Berichte über angeblich 150jährige oder noch ältere Menschen konnten nicht bestätigt werden. Auch Angaben über die Häufung von Hundertjährigen in einigen Regionen der Erde wie z. B. in Georgien als dem Land mit der angeblich größten Anzahl extrem alter Menschen halten keiner Überprüfung stand (Medvedev 1986). Daher ist man weiterhin auf mathematische Modellierungen der maximalen Lebensspanne auf der Basis von Altersabläufen und Beobachtungen der Bevölkerungsentwicklung, insbesondere der über 100jährigen, angewiesen (Robine et al. 1997). Als einziger hinreichend authentischer Beleg für die vermutete Grenze von etwa 120 Jahren als maximale menschliche Lebensdauer (Berinaga 1991, Olshansky et al. 1990) wird die Französin Jeanne Calment angeführt, die 1997 im Alter von 122 Jahren starb. Es ist oft zu beobachten, dass sich Hochaltrige jenseits der 90 Jahre in erstaunlich guter körperlicher und geistiger Verfassung befinden (Perls 1995). Nach dem Konzept des selektiven Überlebens haben 100jährige die risikoreichen Altersphasen typischer Alterskrankheiten überlebt, an denen die meis- Wachstum, Reifung, Altern 293 ten Personen ihrer Geburtsjahrgänge gestorben sind. Sie können mehr oder weniger beschwerdefrei mit einem sogar abnehmenden Sterberisiko in den Folgejahren rechnen (Franke et al. 1985, Franke u. Schmitt 1971). Diese typische Altersdynamik zeigt sich in jener des Alzheimer-Syndroms. Betroffene Menschen sterben zumeist vor oder kurz nach dem 90. Lebensjahr, und jenseits des Alters von 95 Jahren sinkt die Erkrankungswahrscheinlichkeit. Frauen leben länger als Männer Abgesehen von wenigen Ausnahmen leben überall auf der Welt Frauen im Bevölkerungsdurchschnitt länger als Männer. Dies war nicht immer so (Tabutin 1978, Kertzer u. Laslett 1995). Zu den wichtigsten, heute in vielen Ländern beseitigten Ursachen zählen perinatale Risiken, die unter Müttern in Entwicklungsländern noch immer die häufigste Todesursache im fertilen Altersbereich darstellen (WHO 1996), hohes Infektrisiko durch überwiegend weibliche Pflegetätigkeit, ungünstigere Ernährungssituation der Frauen oder auch differentielles Elterninvestment (Voland 1984). Gerade diese Risiken vermögen aufgrund ihrer Wirkung im Kindesalter und jüngeren Erwachsenenalter die durchschnittliche Lebenserwartung von Frauen deutlich zu senken. Vermutlich erst in neuester Zeit, während des letzten Jahrhunderts, hat sich das Verhältnis zugunsten der Frauen deutlich gewandelt. Sowohl genetische Faktoren als auch deren Zusammenspiel mit Umweltfaktoren werden diskutiert (Waldron 1983). In modernen Industriegesellschaften sind diese Risiken weitestgehend ausgeschaltet und Frauen haben eine um durchschnittlich 7 Jahre erhöhte Lebenserwartung (vgl. Kap. 3.3). Umstritten ist bislang noch, ob die differentielle Sterblichkeit bereits kurz nach der Konzeption in der frühen Embryonalentwicklung beginnt. Das primäre Geschlechterverhältnis bei der Konzeption wurde in der älteren Literatur mit etwa 115–130 männlichen zu 100 weiblichen Föten angegeben, geschätzt aus der Annahme eines höheren Anteils an Jungen unter den Frühaborten (nach Knußmann 1996). Da sich die Abortrate der Geschlechter mit zunehmender Schwangerschaftsdauer egalisiert (McMillen 1979) und molekulargenetische Geschlechtsbestimmungen an Frühaborten eine paritätische Geschlechtsrelation aufzeigen (Degenhardt u. Michaelis 1977), entspricht der hohe Anteil an gezeugten Jungen wohl nicht der Realität. Außer Frage ist jedoch, dass das sekundäre Geschlechterverhältnis, die quantitative Geschlechterproportion der Lebendgeborenen, in einem Bereich bleibt, in dem weltweit auf 100 Mädchen 102–108 Jungen kommen. Dieses quantitative Übergewicht des männlichen Geschlechts wird allerdings bis zur Geschlechtsreife nahezu ausgeglichen, da im Kindesalter und unter den Jugendlichen die Sterblichkeit im männlichen Geschlecht erhöht ist. Die Untersuchung von Todesursachen weist auf eine höhere Anfälligkeit von Jungen gegenüber Infektionskrankheiten hin. Umstritten ist die erst vor wenigen Jahren gemachte Beobachtung X-chromosomal lokalisierter Gene der Immunregulation, woraus eine verbesserte Immunantwort bei Mädchen resultieren soll. Dem steht die Beobachtung entgegen, dass in jeder Körperzelle jeweils eines der beiden X-Chromosomen organspezifisch inaktiviert wird. Es ist noch nicht geklärt, ob es dem 294 Lebenszyklus Zufall unterliegt, welches der beiden X-Chromosomen exprimiert wird oder ob bestimmte Selektionskriterien bei der Inaktivierung wirksam werden. Eine Konsequenz der differentiellen genetischen Ausstattung ist die höhere Anfälligkeit von Männern gegenüber X-chromosomal gebundenen rezessiven Erbkrankheiten (s. Kap. 3.1). Eine pathogene X-chromosomale Vererbung führt daher bei Männern häufiger zu einer Krankheitsausprägung, wie z. B. bei der Duchenne-Muskeldystrophie oder der Rot-Grün-Blindheit. Weiterhin könnte sich eine Reihe X-chromosomal gebundener Mutationen im Bereich des endokrinen Systems, des Nervensystems oder der inneren Organe (Vogel u. Motulsky 1997) über differentielle Krankheitsanfälligkeit der Geschlechter auswirken. Ein solches genetisch bedingtes Ursachengefüge kann zu einer erhöhten Vulnerabilität bei Männern beitragen, aber nur zum Teil für die Übersterblichkeit im männlichen Geschlecht verantwortlich gemacht werden (Waldron 1976). Insbesondere in höherem Alter werden hormonelle Gründe für die höhere Anfälligkeit von Männern gegenüber verschiedenen Alterskrankheiten wie z. B. Herzund Gefäßerkrankungen angenommen. So haben Frauen im Alter von 65 Jahren unter günstigen Bedingungen ein den Männern gegenüber um mindestens 25% verlängertes Leben vor sich (Baltes et al. 1996, Wittwer-Backofen 1999). Mit zunehmendem Alter verstärkt sich der Unterschied sogar noch. Ein bedeutender Einfluss kann den Sexualhormonen zugeschrieben werden (vgl. Kap. 4.2). Unter den männlichen Androgenen scheint vor allem das Testosteron Stoffwechselprozesse zu beschleunigen, eine höhere Infektionsanfälligkeit zu bewirken und dadurch direkt auf den Alterungsprozess im Sinne eines bei hohen Leistungen stärker verschleißenden Motors einzuwirken. Als Nachweis für diesen Zusammenhang dient die Beobachtung, dass die Lebenserwartung bei kastrierten Männern erhöht ist (Hamilton u. Mestler 1969). Der weibliche Schutz vor Herz-Kreislauferkrankungen im fertilen Alter und das Absinken des Brustkrebsrisikos im postmenopausalen Alter wird dem Östrogen zugeschrieben. Damit scheint die unterschiedliche Lebenserwartung von Männern und Frauen evolutionsbiologisch so stark verwurzelt zu sein, dass eine völlige Angleichung männlicher und weiblicher Sterblichkeit unwahrscheinlich ist, auch wenn sich die Lebensbedingungen zunehmend angleichen. Dies formulierte Madigan (1957) mit der Gleichung: Wenn ein Mann sich entschließt, in einen Orden einzutreten, hat er zwar eine um 10% erhöhte Lebenserwartung als die Menschen außerhalb der Klostermauern, stirbt aber dennoch im Durchschnitt früher als eine Nonne. (Madigan 1957, nach Vogel u. Sommer 1992). Unter der Annahme, in Klöstern seien Mönche und Nonnen den gleichen sozialen Gesundheitsrisiken ausgesetzt und die dort beobachtete Geschlechterdifferenz der Lebenserwartung sei den biologischen Unterschieden zu verdanken, wurden in einer aktuellen Studie bayerische Klosterbevölkerungen ausgewertet (Luy 2002). Im Zeitraum zwischen 1920 und 1985 ist ein relativ Wachstum, Reifung, Altern 295 konstanter Unterschied der Lebenserwartung zwischen Mönchen und Nonnen von 0-2 Jahren zugunsten der Frauen beobachtet worden, während sich in der deutschen Allgemeinbevölkerung ein Unterschied von bis zu 7 Jahren entwickelt hat. Dies spricht einerseits für einen biologisch bedingten Alternsvorteil der Frauen. Andererseits zeigt es auch, dass die sozial bedingten Einflussfaktoren die biologisch bedingten in ihrer Wirkung noch übersteigen. Epidemiologie des Alterns – Alternskrankheiten Der überwiegende Anteil, aber nicht alle molekularen, zellulären und physiologischen Parameter reduzieren ihre Funktion mit zunehmendem Alter. Einige unter ihnen bleiben stabil, andere zeigen sogar gesteigerte Aktivität, wie beispielsweise die Synthese von Prostaglandinen, die unter anderem eine pathophysiologische Rolle bei der Entstehung von Fieber, Schmerzen und Entzündungsprozessen spielen oder verschiedene Faktoren des Immunsystems (Mayer 1994). Dabei ist die Grenze zwischen normaler biologischer Alterung und krankhafter Veränderung fließend und individuell sehr variabel. Grundsätzlich jedoch wird die Gruppe der systembedingten und altersabhängigen graduellen Veränderungen wie fortschreitende Demenz, erniedrigte Immunantwort, Reduktion der Hormonproduktion, Muskelatrophie, Verringerung der Knochendichte usw. von altersabhängigen krankhaften Prozessen wie der Alzheimer-Erkrankung, Osteoporose oder Arteriosklerose unterschieden. Diese können sich unter bestimmten Bedingungen in einigen Bevölkerungen manifestieren, in anderen hingegen nicht. In der praktischen Gerontologie lässt sich eine derartige Differenzierung jedoch nicht aufrechterhalten, da die Übergänge oft fließend sind und altersgerechte degenerative Erscheinungen oft mit Alternskrankheiten gemeinsam auftreten und dann das typische Bild der Multimorbidität auftritt (Arking 1998). Im Folgenden werden die wesentlichsten dieser Veränderungen vorgestellt. Alterung des Hormonsystems: Im Tierreich wurde gelegentlich ein Zusammenhang der Sterblichkeit mit hormonellen Faktoren beobachtet, wie die Verlängerung der Lebensspanne bei Laborratten, deren Hypophyse entfernt wurde (Everit et al. 1968, nach Holliday 1995). Nicht erfolgreich war allerdings die Suche nach „Todeshormonen“, deren Ausschüttung zur Alterung beitragen soll. Hormonspiegel liegen im Alter zumeist unter den Werten jüngerer Erwachsener, wie beispielsweise die Corticoide oder der postmenopausal sinkende Östrogenspiegel, der das Brustkrebsrisiko senkt, das Osteoporoserisiko hingegen steigert (Ricklefs u. Finch 1996). Ein Zusammenhang des Alterns mit der Ausschüttung von Sexualhormonen wird auch dadurch deutlich, dass Frauen mit früh einsetzender Menopause eine erhöhte Sterblichkeit im Vergleich zu Frauen aufweisen, deren natürliches Nachlassen der Fortpflanzungsfunktion erst im Alter über 50 Jahren auftritt (Snowden et al. 1989). Die Hormonregulation der Hypothalamus-Hypophysen-Achse ist demzufolge nicht nur für die Wachstums- und Entwicklungsphase des Lebenslaufs verantwortlich, sondern spielt darüber hinaus auch eine Rolle bei der Regulierung von Alternsprozessen. 296 Lebenszyklus Alterung des Immunsystems: Ein gut beobachtetes Phänomen ist die nachlassende primäre Immunantwort im Laufe des Alterns (Holliday 1995).Sie beruht auf der im Alter geringeren Zahl ruhender T-Lymphozyten bzw. auf nachlassender Aktivität der B-Lymphozyten (vgl. Kap. 3.2). Da die Zahl der zeitlebens verfügbaren T-Lymphozyten limitiert ist, nimmt sie mit dem Alter und der Zahl erlittener Infektionen ab. Daher steigt das Mortalitätsrisiko bei Infektionen im fortgeschrittenen Alter. Die Auswirkung von Grippewellen auf die Sterberaten älterer Menschen lässt sich vielfach in den Sterbetafeln ablesen (Mayer u. Rückert 1975). Nimmt die Aktivität des Immunsystems einerseits ab, so scheint andererseits die Gefahr einer Autoimmunantwort zu steigen. Einige Zellen des Immunsystems zeigen keine Beeinträchtigung im Alter, wie die Makrophagen oder Mikroglia-Zellen des Gehirns, die bei der AlzheimerErkrankung sogar hyperaktiviert sind (Finch 1990). So zeigen 35% der Alzheimer-Patienten Antikörper gegen das körpereigene Gefäßprotein Heparinsulfat-Proteoglykan (Ricklefs u. Finch 1996). Ob allerdings durch die erhöhte Anzahl Auto-Antikörper das Risiko von Autoimmunkrankheiten wie z. B. Multipler Sklerose steigt, ist nicht schlüssig zu belegen (Mayer 1994). Kardiovaskuläre Alterung: Altersabhängige Veränderungen des kardiovaskulären System lassen sich anschaulich über deren Auswirkungen, die ischämischen Herzerkrankungen, allen voran der akute Herzinfarkt und der Schlaganfall, messen. Diese Erkrankungen als „Zivilisationskrankheiten“ zu bezeichnen, ist jedoch nicht gerechtfertigt. Sie treten vor allem deshalb als häufigste Todesursache in den Industrieländern auf, weil durch Verbesserungen der medizinischen Versorgung die Lebenserwartung derart gesteigert werden konnte, dass andere Risiken überlebt werden können und infolgedessen Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Erkrankungen des hohen Alters relativ zunehmen (vgl. Kap. 3.3). Eine wesentliche physiologische Ursache der HerzKreislauf-Erkrankungen stellt die Arteriosklerose dar, eine chronische Erkrankung, die durch Placques-Ablagerungen aus Cholesterol, Lipiden und Zellfragmenten an den Gefäßwänden entsteht. Diese tritt auch bei verschiedenen nicht-menschlichen Primaten auf und kann daher als Alternsmerkmal der langlebigen höheren Primaten angesehen werden (Arking 1998). Altersbedingte Demenzerkrankungen: Die Alterung des Gehirns kann allgemein mit einem Gewichtsverlust von rund 11% bzw. dem Schwund an Neuronen, insbesondere den Schaltneuronen, beschrieben werden. Assoziative Zentren der Großhirnrinde, in denen mentale Prozesse wie das Gedächtnis lokalisiert sind, sind sogar einem altersbedingten Schwund zwischen 25% und 40% ausgesetzt. Diese progressive Reduktion findet hauptsächlich im Alter zwischen 55 und 80 Jahren statt. Übersteigen die Abbauprozesse diese Grenzwerte, entstehen Demenzerkrankungen mit wesentlichen Funktionseinbußen wie Orientierungsverlust in Zeit und Raum, Verlust des Lang- und Kurzzeitgedächtnisses, des Urteilsvermögens, der Muskelkontrolle und allgemeiner neurologischer Funktionen. Dabei sind einige Hirnareale von dem Verlust an Neuronen besonders betroffen. Durch die nachlassenden geistigen Fähigkeiten werden die Betroffenen zunehmend in der Ausübung ihrer Aktivitäten des täglichen Lebens beeinträchtigt. Nach dem sechzigsten Lebensjahr verdoppelt Wachstum, Reifung, Altern 297 sich das Demenzrisiko etwa alle fünf Jahre und übersteigt dabei in seiner Zuwachsrate die Mortalität, die sich im gleichen Alter etwa alle 8 Jahre verdoppelt. Dadurch steigt die relative Erkrankungsrate mit dem Alter deutlich an. Drei wesentliche Krankheitsbilder spielen eine Rolle bei dem Erkrankungsrisiko. Die im Alternsprozess auftretenden Gefäßveränderungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Schlaganfällen (Apoplexie), infolge derer Hirngewebe aufgrund von Durchblutungsmangel nach Gefäßverschluss absterben kann. Die daraus resultierenden Beeinträchtigungen der Hirnleistung hängen von dem Umfang der Schädigung und dem betroffenen Areal ab. Oft akkumulieren die Ereignisse und führen nach mehrfachen Gefäßverschlüssen zur Multi-Infarkt-Demenz. Eine besondere Erscheinungsform ist die Alzheimer-Erkrankung, die erstmals 1898 von dem Psychiater Alois Alzheimer anhand der seltenen Fälle von präseniler Demenz bei 20- bis 30jährigen beschrieben wurde. Üblicherweise tritt sie erst ab einem Alter von etwa 60 Jahren auf. Unter der Altersgruppe der über 65jährigen beträgt die Prävalenzrate (der Anteil der Betroffenen) für die Alzheimer Erkrankung rund 5%, unter den 85jährigen findet man bei nahezu jedem Zweiten Anzeichen von Demenz. Die Alzheimer-Erkrankung lässt sich auf die Degeneration von Nervenzellen in definierten Hirnarealen zurückführen. Sie geht einher mit Ablagerungen extrazellulärer Plaques, die aus dem Protein β-Amyloid bestehen, sowie knäuelartig verdichteter Fibrillenbündel aus dem Tau-Protein, einem phosphorylierten Protein des Neuronen-Cytoskelettes. Die Rolle des Apo-E-Gens in diesem Zusammenhang wird weiter unten beschrieben (vgl. Intrinsische Alternstheorien). Dieser genetische Faktor kann zu der familiär gehäuft auftretenden Form der Alzheimer-Erkrankung beitragen (Steinhardt 1990). Von dem Parkinson-Syndrom sind vor allem ältere Männer betroffen. Es äußert sich als „Schüttellähmung“ in unkontrolliertem Zittern von Händen und Kopf (Tremor,) stark reduzierter Beweglichkeit (Hypokinese) und Gelenksteifheit (Rigor). Ausgelöst werden diese Symptome durch die Degeneration der Substantia nigra im Mittelhirn, die den Neurotransmitter Dopamin ausschüttet. Dessen Aufgabe ist es, das Corpus striatum in den Basalganglien des Stammhirns in seiner Funktion zu hemmen. Geschieht dies nicht mehr in ausreichendem Maße, produziert das Corpus striatum vermehrt Acetylcholin, was zu der „Trias“ der beobachteten Symptome führt. Alterung des Skelettsystems: Die Altersveränderungen des Skelettsystems zeigen durch die unterschiedliche Hormonsituation deutliche Geschlechtsunterschiede. Bis zur Menopause bewirkt der hohe Östrogenspiegel einen in beiden Geschlechtern vergleichbaren ausgewogenen Calciummetabolismus. Der postmenopausal dramatische Abfall des Östrogenlevels führt aufgrund des nunmehr unausgewogenen Calciumstoffwechsels zur Aktivierung des Mineraldepots im Knochen und infolge dessen zur Osteoporose (vgl. Kap. 2.3). Der Verlust an Knochensubstanz bei postmenopausalen Frauen beträgt etwa das Zwei- bis Dreifache dessen der Männer. Als Konsequenz können Spontanfrakturen oder Frakturen bei relativ leichter Beanspruchung des Skelettsystems auftreten. Insbesondere gefürchtet sind Oberschenkelhalsfrakturen, die bei Frauen drei- bis 298 Lebenszyklus viermal häufiger auftreten als bei gleichaltrigen Männern und die oftmals durch lange Bettlägerigkeit weitere gesundheitliche Komplikation nach sich ziehen (Stini 1990, Harper u. Crews 2000). Abnorme Alternsabläufe – Vorzeitiges Altern Obwohl derzeit bereits mehr als 3000 genetische Faktoren des Menschen in ihrer Funktion bekannt sind, findet sich darunter keiner, der signifikant lebensverlängernd wirken könnte. Gelegentlich wurde aufgrund dessen polygene Vererbung der Lebensspanne postuliert, in die bis zu 7000 Gene involviert seien (Finch 1990). Auf der Suche nach einem „Jungbrunnen“ sind viele derartige Spekulationen genährt worden. Bekannt sind hingegen einzelne Gene, die zu einer Akzeleration von Alternsprozessen führen. Sie simulieren normale Alternsprozesse, die aber in den meisten Fällen nur einzelne Organe betreffen und somit nur einen Ausschnitt der normalen Alterung eines Organismus widerspiegeln. Über zweihundert solcher genetischer Einzelfaktoren sind bekannt, welche die Lebenserwartung signifikant herabsetzen, wie beispielsweise Diabetes, Arthritis, zystische Fibrose und viele andere mehr. Aber nur wenige erlauben durch Vergleich genetischer Faktoren Gesunder und Erkrankter Erkenntnisse über die normalen Alternsabläufe. Die bekannteste unter diesen Erkrankungen dürfte das Hutchinson-Gilford-Syndrom oder auch Progeria infantilis (vorzeitige Vergreisung im Kindesalter) sein. Weltweit etwa 15 bis 30 Kinder sind von dieser Krankheit betroffen, deren erste Anzeichen von retardiertem Wachstum und Zwergwuchs bereits während der ersten zwei Lebensjahre auftreten. Typische Alternserscheinungen, die üblicherweise erst im späten Erwachsenenalter auftreten, spielen sich in ihnen wie in einem Zeitraffer ab, während andere Körpergewebe, wie das Gebiss, in ihrer Entwicklung sogar zurückbleiben. Mit vier Jahren ist oft schon das Haar ergraut und ausgefallen, die Alternskrankheiten Arteriosklerose oder Osteoporose setzen vor dem zehnten Lebensjahr ein (vgl. Box 4.2) und führen dazu, dass die Lebenserwartung der erkrankten Kinder nur zwischen 14 und 20 Jahren liegt. Therapiemöglichkeiten gibt es keine, allenfalls können die Altersbeschwerden gelindert werden. Die geistige Entwicklung der Kinder ist normal und altersgerecht. Im Bewusstsein ihrer seltenen und progressiven Erkrankung sind diese Kinder einer enormen psychischen Belastung ausgesetzt, die sich durch die öffentlichen Medien und das Forschungsinteresse der Alternsforschung noch verstärkt. Die Ursachen der Progeria infantilis sind noch unbekannt. Es tritt keine familiäre Häufung auf, die auf einen Vererbungsprozess hinweisen würde. Es wird eine Spontanmutation vermutet, die sich dominant verhält. Einziger Hinweis ist eine deutlich erniedrigte Zellteilungsrate in Fibroblasten-Zellkulturen (s. unten) erkrankter Kinder, die nur etwa ein Drittel jener gesunder Kinder beträgt. Im Gegensatz zu Progeria infantilis stellt das Werner-Syndrom mit einem autosomal-rezessiven Erbgang eine auf Chromosom 8 lokalisierte Erbkrankheit dar. Sie äußert sich als vorzeitiges Altern beim Erwachsenen und manifestiert sich zwischen dem 12. und 18. Lebensjahr. Die Alternserscheinungen, ins- Wachstum, Reifung, Altern 299 besondere Arteriosklerose und Hautveränderungen, sind ähnlich wie bei der Progeria infantilis beschleunigt und treten nach einem verzögerten Wachstumsverlauf auf (Martin u. Oshima 2000). 4.1.5 Ursachen des Alterns Ultimate Ursachen des Alterns: Evolutions- und soziobiologische Erklärungsansätze Warum nun kann sich eine Eigenschaft des Lebens wie das Altern im Laufe der Evolution erhalten, obwohl sie sich negativ auf das einzelner Individuen auswirkt? Warum können nicht alternsfreie Lebensformen existieren, die dazu führen, dass lediglich extrinsische Faktoren wie Krankheitserreger, Fressfeinde oder Unfälle dem Leben ein Ende bereiten? Das hätte den Vorteil, dass nur ein relativ geringer Energieaufwand betrieben werden müsste, um Nachkommen zu produzieren, welche die Arterhaltung gewährleisten. Die Beantwortung dieser Frage erfordert eine evolutionsbiologische Betrachtungsweise, mit deren Hilfe ein Erklärungsmodell für das Muster der altersabhängigen Alternsprozesse und das Niveau der (menschlichen) Lebensspanne gewonnen werden kann. Einen Erklärungsansatz, der nicht nur nach der Kausalität, sondern auch nach dem biologischen Sinn der evolutionsbiologisch erfolgreichen Alterungsprozesse fragt, liefert die life history theory (Alexander 1979, 1990, Stearns 1992, Charnov 1993, Chisholm 1993, Roff 1992), auch als Theorie der Evolution der Lebensgeschichte bezeichnet. Sie fußt auf der Darwin’schen Evolutionstheorie von Mutation und Selektion als wesentliche Mechanismen der umweltabhängigen biologischen Anpassungsprozesse. Die life history theory versucht, die fundamentalen Lebensabschnitte wie die Ontogenese, die reproduktive, sowie die postreproduktive Phase der Alterung mit einer evolutiven Anpassung im Dienste der Arterhaltung zu erklären. Die Überlebensfähigkeit einer Art erfordert bei sich ändernden Umweltbedingungen erfolgreiche Adaptationsmechanismen. Dies kann nur durch neue Genkombinationen und Spontanmutationen ermöglicht werden, unter denen sich auch solche mit einem Selektionsvorteil finden. Erreicht werden kann eine derartige genetische Vielfalt nur durch ein erfolgreiches Reproduktionsgeschehen, dessen Intensität sich theoriegemäß an dem notwendigen Selektionsdruck orientiert. Damit wird auch die Notwendigkeit von Altern und Tod erklärt, denn nur mit einer evolutiv gut eingependelten Lebensdauer lässt sich in einer Umwelt mit limitierten, für das Überleben notwendigen Ressourcen die besser angepasste Folgegeneration platzieren, welche die Arterhaltung garantiert. Die life history theory hinterfragt, wie im Rahmen dieses Systems die vorhandenen Ressourcen, hauptsächlich Nahrung und die daraus produzierte Energie, in der verfügbaren Lebenszeit zwischen Wachstum, Reproduktion und Selbsterhaltung aufgeteilt werden (vgl. Kap. 2.1.2). Welche der Merkmale jedoch dem Selektionsprozess unterliegen, hängt vom Zeitpunkt ihrer Exprimierung ab. Individuen, die in der Wachstums- bzw. Fort- 300 Lebenszyklus pflanzungsphase überlebensstrategisch günstigere Merkmalskombinationen besitzen, haben ihren Partnerwahlkonkurrenten gegenüber Fitnessvorteile. Durch bevorzugten Zugang zur Fortpflanzung reichern sich ihre Merkmale in der Folgegeneration an, während benachteiligte Individuen sich nicht in dem Maße fortpflanzen können. Anders ist dies bei Merkmalen, deren Fitnessvorteile sich erst nach Abschluss der reproduktiven Altersphase äußern und die damit zu besserer Überlebenschance in höherem Alter beitragen. Deren Träger haben sich lediglich ebenso erfolgreich fortgepflanzt wie Individuen, die diesen Fitnessvorteil nicht besitzen. Daher unterliegen Gene, die einen Überlebensvorteil oder -nachteil in höherem Alter bewirken, nicht der Selektion. Sie können sich über lange Zeiträume in Bevölkerungen erhalten (Voland 2000). Ein Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch genetische Varianten des Lipoproteins APO-E wird sich deshalb nicht durchsetzen können. Dies ist auch evolutiv nicht opportun, da in der Regel zahlreiche andere Sterberisiken wie Unfälle oder Infektionskrankheiten in einem Alter zum Tragen kommen, bevor Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Ausbruch kommen können. Nur relativ wenige Individuen, die unter günstigen Bedingungen ein hohes Alter erreichen, sind betroffen. Der Selektionsdruck nimmt also mit dem Alter ab (Kirkwood u. Holliday 1986).Ein Beispiel stellt die Krankheit Chorea Huntington („Veitstanz“) dar, eine autosomal-dominant vererbte Atrophie der Nervenzellen in den Basalganglien dar, die erst im Alter von 40 bis 50 Jahren auftritt und sich ähnlich wie beim Parkinson-Syndrom in unkontrollierten Muskelkontraktionen äußert. Deren Genfrequenz (vgl. Kap. 3.1) bleibt nahezu konstant (Vogel u. Motulsky 1997). Von Medawar (1952) stammt die daraus weiterentwickelte Theorie der Mutationsakkumulation, nach der schädliche Gene, die im späteren Leben exprimiert werden, akkumulieren. Der Körper wird als „genetic dustbin“ (genetischer Mülleimer) angesehen. Beim Menschen werden diese Mutationen mit Formen von Seneszenz in Verbindung gebracht, da im Vergleich zu vielen Tierarten die extrinsischen Mortalitätsrisiken reduziert sind und daher nur beim Menschen ein Alter erreicht werden kann, in dem diese schädlichen Einflüsse wirksam werden. Genetisch determinierte Merkmale jedoch, welche die Eigenschaft besitzen, früh im Leben einen Fitnessvorteil, später aber negative Effekte wie Alterungsbeschwerden und Alterskrankheiten hervorzurufen, unterliegen der Selektion. Dieser Zusammenhang wurde als antagonistische Pleiotropie beschrieben (Williams 1957). Das Altern wird nicht direkt beeinflusst, sondern als „kleineres Übel“ einer Anpassungsstrategie gesehen. Als Beispiel können die Wirkungsmechanismen der Sexualhormone angeführt werden (Dandekar 1995, vgl. auch Kap. 4.2). Während der weibliche Fortpflanzungserfolg mit der Höhe der Östrogenausschüttung steigt, erhöht sich in gleichem Maße das spätere Brustkrebsrisiko. Umstritten ist der Einfluss dieser „Gene mit Janusgesicht“ insbesondere dadurch, dass er nur für bereits (potentiell) alternde Organismen gültig ist (Kirkwood u. Holliday 1986). Eine extreme Interpretation dieser Theorie stellt die sogenannte disposable-soma-theory dar (Kirkwood u. Rose 1991), die Rusting (1993) mit „Wegwerf-Körper mit Verfallsdatum“ übersetzte. In ihrer Kernaussage werden Wachstum, Reifung, Altern 301 körperliche Leistungsfähigkeit, Reparatur- und Schutzmechanismen ausschließlich für den Fortpflanzungserfolg bereitgestellt. Das postreproduktive Überleben wird lediglich als Effekt einer reichlich bemessenen Reservekapazität betrachtet. Mit dieser Theorie findet das bei älteren Menschen auftretende Phänomen der Multimorbidität einen Erklärungsansatz, bei der Alterskrankheiten gehäuft dann auftreten, wenn die altersabhängige Leistungsreduktion der Organe so weit fortgeschritten ist, dass die Körperfunktionen unterhalb eines kritischen Schwellenwertes sinken. Zusammenfassend lässt sich die evolutionsbiologische Sichtweise wie folgt charakterisieren: ... the human biological machinery assigns priorities in a way that does not emphasize maximum longevity, a fact that has not been appreciated by the human biologists, public health specialists, social scientists, and members of the medical establishment who are telling us what is best for us. (Hill 1993: 79) Proximate Ursachen des Alterns: Biologische Alternsmechanismen Die Mechanismen des Alterns werden mit den biologischen Alternstheorien zu erklären versucht. Bisher ist allerdings wenig über die genetischen Einflüsse auf die Lebensspanne des Menschen bekannt. Lediglich auf Beobachtungen reduzierte Studien am Menschen selbst erlauben oftmals keine Aussagen über Wirkungsmechanismen, da der Mensch immer einem Komplex zahlreicher Einflussparameter des Alterns ausgesetzt ist, was eine kausale Ursachen-Wirkungs-Interpretation erschwert. Um Aussagen über den Menschen treffen zu können, bedient sich die biologische Alternsforschung oder „biogerontology“ oftmals sehr unterschiedlicher Organismen, deren Alternsprozesse unter spezifischen experimentellen Bedingungen reproduzierbar untersucht werden können. Da die Organisation des Genoms bei diesen Modellorganismen sehr unterschiedlich ist, lassen sich die an einer Spezies gewonnenen Erkenntnisse zur Wirkung bestimmter Gene auf die Lebensspanne ihrer Träger nicht auf den Menschen übertragen. Die wesentlichen Erkenntnisse, die aus Experimenten an Modellorganismen gewonnen werden, liegen in der Aufdeckung von Mechanismen der Interaktion zwischen Genom, Genexpression und ihrer phänotypischen Wirkung auf die Lebensspanne. Prinzipiell können Wirkungen einzelner Gene oder Genkombinationen unter Laborbedingungen durch Inaktivieren, Mutieren oder durch Speziestransfer bei Modellorganismen geprüft werden (Guarante u. Kenyon 2000). Dazu sind solche Organismen besonders geeignet, die ein einfaches Genoms sowie eine kurze Generationsfolge besitzen und unter Laborbedingungen anspruchslos zu halten sind. Der einfachste und häufig für Zellexperimente verwendete Modellorganismus ist die Bierhefe Saccharomyces cerevisiae, ein einzelliger Hefepilz. Zunehmend höher 302 Lebenszyklus organisierte Modellorganismen sind der Fadenwurm Caenorrhabditis elegans, die Fruchtfliege Drosophila melanogaster und unter den Säugetieren insbesondere die Maus Mus musculus oder die Laborrate Rattus norvegicus. Eine zweite Möglichkeit, genetische Einflussfaktoren auf die Alterung des Menschen zu erkennen, stellen genealogische Untersuchungen dar. Wird ein Zusammenhang zwischen der Lebensdauer von Eltern und ihren Kindern festgestellt, so kann dieser durch genetische Faktoren, Umwelteinflüsse oder einen Komplex aus beiden verursacht sein. In verschiedenen Studien wurde versucht, Umweltfaktoren konstant zu halten und damit die genetischen Einflüsse aufzudecken. Eine der ersten Untersuchungen diese Art umfasste eine Familiengenealogie mit knapp 9000 Personen, die bis in das Jahr 1680 zurückverfolgt werden konnte. Die Ergebnisse zeigten anschaulich, dass Kinder von Eltern mit einer hohen Lebenserwartung wiederum länger lebten und Kinder jung gestorbener Eltern ebenfalls eine niedrige Lebenserwartung hatten. Der Unterschied in der Lebensdauer zwischen beiden Gruppen betrug bis zu 40% (Bell 1918). Für das Verständnis genetischer Zusammenhänge war auch die Beobachtung wichtig, dass Personen mit einer mittleren Lebenserwartung auch wieder Nachkommen hatten, die im Durchschnitt ein mittleres Sterbealter aufwiesen. Eine Vielzahl weiterer Untersuchungen mit ähnlichen Ergebnissen folgte (eine Zusammenstellung findet sich bei Gavrilova u. Gavrilov 1999). Unter ihnen ist insbesondere eine skandinavische Studie zu nennen, die über 12 000 Personen aus dem Bürgertum und Kleinadel einschloss, deren Geburts- und Sterbedaten zwischen den Jahren 1500 und 1829 authentisch vorlagen (Jalavisto 1951). Sie zeigte, dass die Lebenserwartung der Kindergeneration in stärkerem Maße von jener der Mutter als von der des Vaters abhing. Lediglich Väter, die ein sehr hohes Alter erreichten, konnten dieses Merkmal auch an ihre Kinder weitergeben (vgl. Abb. 4.6). Mayer (1991) ging in einer ebenfalls groß angelegten genealogischen Studie in New England der Frage nach, welcher Anteil der beobachteten Lebensspanne einer genetischen Komponente zuzuschreiben ist. Im Wesentlichen ließen sich die Ergebnisse dahingehend interpretieren, dass eine genetische Komponente einen moderaten Einfluss auf die Lebenserwartung ausübt. Mit ihr können zwischen 10% und 33% der Unterschiede in der Lebenserwartung erklärt werden. Die verbleibende Variabilität wird durch soziale und biologische Umweltfaktoren erklärt. Die biologische Diskussion um die Alternsmechanismen und ihren qualitativen und quantitativen Einfluss auf die menschliche Alterung wird ebenso lange wie kontrovers geführt. Dabei zeichnen sich in der Fülle der Theorien über das Altern zwei Grundlinien ab, unter denen die eine stochastische, zufällige Ereignisse anführt, die in ihrer Summe den Körper zunehmend schädigen und damit zum Altern führen. Die andere konzentriert sich auf genetisch programmierte, intrinsische Prozesse, welche die Lebensspanne bestimmen (Medvedev 1990, Finch 1990). Die Stochastischen Alternstheorien erklären Altern anhand einer Kumulation von Einzelschäden an Zellen oder Geweben, die nicht mehr zu kompensieren sind und in der Folge eine komplexe Wirkung ausüben. Zu ihnen gehören die folgenden Theorien: Wachstum, Reifung, Altern 303 Abb. 4.6. Korrelation der Lebenserwartung von Eltern und ihren Kindern in skandinavischen Genealogien zwischen 1500 und 1829 (nach Arking 1998) Theorie der freien Radikale: Freie Radikale sind chemisch reaktionsfreudige Moleküle oder Atome, denen im Zuge normaler enzymatischer Prozesse oder in Folge von Strahlung (z. B. Röntgenstrahlungen oder UV-Lichteinstrahlung) oder von toxischen Agenzien ein Elektron entzogen wurde. Aufgrund ihrer hohen Elektronenaffinität lösen sie in dem Bestreben, einen stabilen Zustand zu erreichen, chemische Oxidationsprozesse aus, die schädigende Kettenreaktionen bewirken können. Die Theorie besagt, dass die Akkumulation der durch Umwelteinflüsse entstandenen Schäden in den Körperzellen im Laufe des Lebens mit zunehmendem Funktionsverlust der Zellaktivität verbunden ist (Harman 1956, 1981). Schäden durch freie Radikale können durch Oxidation von Lipiden und Proteinen an Membranen, Enzymen und DNA, insbesondere in den Mitochondrien, entstehen. Auch die Entstehung des für die „Altersflecke“ verantwortlichen Pigmentes Lipofuscin lässt sich zum Teil auf Prozesse mit freien Radikalen zurückführen. Den Organismen stehen üblicherweise Antioxidantien zur Verfügung, die der schädlichen Wirkung entgegenwirken. Antoxidantien sind Enzyme wie die Superoxid-Dismutase, die speziell Superoxid-Radikale in Wasserstoffperoxid abbaut, oder Katalase und Glutathion-Peroxidase, die Wasserstoffperoxid in Wasser und molekularen Sauerstoff umwandeln. Daneben gibt es nichtenzymatische Antioxidantien wie die Vitamine E und C, Beta-Carotin, Harnsäure und Metall-Chelat-Komplexe, die durch ihre Reaktion mit den freien Radikalen oder durch die Hemmung von Katalysatoren oxidativer Reaktionen die Zelle vor Schäden schützen (Rusting 1993). Zahl und Wirkungspotential der natürlichen Schutzmechanismen korrelieren mit der maximalen Lebensdauer (Bernstein u. Bernstein 1991). Transgene Fruchtfliegen (Drosophila) mit fünf statt der üblichen zwei Kopien für Superoxid-Dismutase und -katalase haben eine um ein Drittel verlängerte Lebens- 304 Lebenszyklus spanne im Vergleich zum Wildtyp (Orr u. Sohal 1994). Allerdings trägt eine zusätzliche Genkopie für die Superoxid-Dismutase, wie sie im Menschen bei Trisomie 21 (Mongolismus) vorliegt, nicht zu einer höheren Lebenserwartung bei. Die Betroffenen habe eine deutlich verringerte Lebenserwartung (Bernstein u. Bernstein 1991). Wie schädlich sich Radikale auf die Funktion der DNA auswirken, lässt sich an der im Vergleich zur Kern-DNA nicht durch Histone abgeschirmten mitochondrialen DNA zeigen. Sie ist deutlich häufiger von DNA-Schäden betroffen als die Kern-DNA (Lindahl 1993). Derart geschädigte Mitochondrien produzieren aber keine Energie mehr (Wallace 1992).Dies ist besonders problematisch in Geweben erhöhter Zellatmungsaktivität, in denen die Mitochondrien der größten potentiellen Beschädigung ausgesetzt sind. Die freien Radikale und die von ihnen ausgelösten Reaktionen sind für eine große Anzahl der beobachteten Alternsprozesse verantwortlich. Dies wird beispielsweise durch den Zusammenhang mit dem Typ-II-Diabetes deutlich, der in höherem Alter durch die verringerte Funktion des glukoseregulierenden Insulins zur Hyperglykämie (= Überzuckerung) führt. Überschüssige Glukose kann mit für den Sauerstofftransport im Blut verantwortlichem Hämoglobin eine freie Radikalreaktion eingehen, die nicht-enzymatische Glykosylierung. Dadurch entsteht eine modifizierte Hämoglobin-Form mit reduzierter Funktion. Dieser Prozess ist im Falle des Hämoglobins innerhalb weniger Monate reversibel, wenn der Glukosespiegel dauerhaft abgesenkt wird, da die Lebensdauer von Hämoglobinmolekülen im Blut etwa drei Monate beträgt. Nichtgeschädigte Hämoglobinmoleküle ersetzen dann allmählich die modifizierten Hämoglobine. Ungünstiger für den Alternsablauf sind derartige nicht-enzymatische Glykosylierungen allerdings in langlebigen Zellen, die nicht in dem Maße regeneriert werden. Altersbedingte Schäden in den Gelenken, der Augenlinse (grauer Star, Alterskatarakte) oder Arteriosklerose beispielsweise können auf nicht mehr voll funktionsfähigen glykolysierten Kollagen- und Elastinmolekülen der Bindegewebe beruhen, die ihre Elastizität einbüßen. Die zugrunde liegenden biochemischen Reaktionen sind äußerst komplex, ihnen allen ist aber gemeinsam, dass verschiedene Substanzen, zusammengefasst als advanced glycosylation end products (AGEs), an verschiedene Proteine gebunden werden (Cerami et al 1998).Die AGEs spielen eine bedeutende Rolle in zahlreichen Alternsprozessen. „Wear-and-tear“-Theorie: In der Übersetzung könnte diese Theorie „Verbrauchen und Wegwerfen“ oder salopp „Ex und hopp“ lauten, gemäß welcher der Organismus die Funktion einer Maschine oder anderer abiotischer Systeme erfüllt, die im Laufe der Zeit zunehmend funktionsuntüchtiger wird und schließlich ihre Funktion vollständig einstellt. Der Vergleich mit unbelebten Systemen wird durch die Anwendung eines Gesetzes der Thermodynamik gerechtfertigt, demzufolge eine verringerte Entropie (Maß für die Ordnung in einem geschlossenen System) nur für eine gewisse Zeit aufrechterhalten werden kann: „Wear and tear must affect all machinery in a world subject to the Second Law of thermodynamics, and the machinery of living things cannot be an exception.“ (Rose 1991, 101). Als Beispiele für „Wear and Tear“ lassen sich die Wachstum, Reifung, Altern 305 Zähne adulter Säuger anführen, die sich mit der Zeit abnutzen und schließlich ausfallen können. Ein derart beeinträchtigtes Tier wird durch Einschränkungen in der Nahrungsaufnahme geschwächt und unterliegt damit einem höheren Sterberisiko. So einleuchtend dieser Zusammenhang auch erscheinen mag, das Phänomen Altern lässt sich dadurch nicht erschöpfend beschreiben, denn es gibt neben Materialermüdung auch geeignete Reparaturmechanismen. So wachsen manchen Organismen fortlaufend Zähne nach. In Ergänzung zum ultimaten Erklärungsansatz der disposable-soma-Theorie kann die wear-andtear-Theorie jedoch die proximaten Gründe des Alterns in weiten Teilen treffend beschreiben. „Somatic-mutation“-Theorie: Die Theorie der „somatischen Mutation“ macht eine präzise Voraussage: Die Langlebigkeit von Organismen sollte direkt von ihrer Ploidie (Anzahl der Chromosomenkopien in den Körperzellen) abhängig sein. Haploide Tiere wären demnach schneller von schädlichen Mutationen betroffen als di-, tri- oder tetraploide Organismen, bei denen erst mehrfache Schädigungen zur Seneszenz führen.Eine Variation der „somatic-mutation“-Theorie ist die „mutation-catastrophe“-Theorie, die sich darin unterscheidet, dass funktionseinschränkende Punktmutationen im Sinne eines „multiple hit“ akkumuliert werden. Das Problem beider Theorien ist der direkte Nachweis, da Punktmutationen angesichts der Zahl von 12 Mrd. DNA-Basen extrem selten sind (Comfort 1979, Kirkwood 1988). Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass DNA-Schäden, Mutationen und Chromosomenanomalien im Zuge zunehmenden Alters akkumulieren (Rattan 1989, nach Holliday 1995). Inwieweit aber diese als Erklärungsansätze für Alternsprozesse dienen können, bleibt abzuwarten. Genetik des Alterns Die genetisch festgelegten Alternsprogramme werden auch als intrinsische Alternsmechanismen bezeichnet und zählen damit zu den deterministischen Theorien zur Alterung. Ein Charakteristikum vielzelliger Organismen ist die begrenzte Teilungsfähigkeit einzelner Zellen zugunsten der Ausbildung spezialisierter Gewebe. Die Effekte dieser genetischen Programme sind Funktionsverluste einzelner Organe mit zunehmendem Alter. Diese Teilungslimitierungen werden durch genetische Programme und zellbiologische Uhren als Taktgeber gesteuert, deren Konsequenz eine determinierte Lebensspanne für jede Spezies ist, die in begrenztem Rahmen umweltplastisch variiert (Finch 1990, Hayflick 1996). An Modellorganismen lassen sich diese Zusammenhänge bereits an einer Vielzahl an Beispielen belegen. Durch Mutation eines einzigen Gens konnte die durchschnittliche Lebenszeit des Nematoden Caenorrhabditis elegans um 70% erhöht werden (Johnson 1990), durch Geninteraktionen ließ sich am gleichen transgenen Modell die Lebenserwartung nach multiplen Mutationen gar vervierfachen (Larsen et al. 1995). Am besten erforscht ist bisher lag-1 (longevity assurance gene 1), das in jungen Hefezellen eine stärkere Expression (Genaktivität) zeigt als in älteren Zellen. In älteren Zellen kann durch genetisch induzierte Steigerung der lag- 306 Lebenszyklus 1-Aktivität die Lebenszeit um ein Drittel gesteigert werden (Egilmez et al. 1989). Beim Menschen ist die Suche nach genetischen Faktoren, die einen direkten Einfluss auf das Altern besitzen, noch nicht sehr erfolgreich verlaufen. Lediglich die inzwischen aufgeklärten Zusammenhänge des Apolipoproteins E mit verschiedenen Alternsprozessen liefern eindeutige Hinweise auf eine Beeinflussung der Lebenserwartung (vgl. Box 4.3) Zellteilungs-Theorien: Anfang der 60er Jahre gelang Hayflick und Moorehead mit der Entdeckung, dass Zellen nicht unbegrenzt teilungsfähig sind, ein wesentlicher Fortschritt in der zellbiologischen Alternsforschung (Hayflick u. Moorehead 1961). Zuvor ging man von potentiell unsterblichen Zelllinien aus (Carrel nach Rose 1991). In seinen Versuchen wies Hayflick jedoch nach, dass Kulturen menschlicher Fibroblasten (Bindegewebszellen) sich nur etwa 40– 60mal teilen, bevor sie ihre Teilungsaktivität zunächst verlangsamen und sie schließlich ganz einzustellen. Die derart in vitro ermittelte Anzahl maximal erreichbarer Zellteilungen, das sogenannte Hayflick-Limit, variiert zwischen verschiedenen Spezies. Es korreliert positiv mit der maximalen Lebensdauer der Spezies. Dies erfordert eine Art inneren Taktgeber, der den Zellen eine bestimmte Zahl von Teilungen ermöglicht. Auch alternde Zellkulturen, die 20 Jahre lang tiefgefroren wurden, bewahrten ihre „Erinnerung“ bereits vollzogener Mitosen. Wieder aufgetaute Zellen fuhren exakt mit der noch verbliebenen Anzahl an Teilungen fort. Ein weiterer Hinweis auf die Relevanz des Hayflick-Limits als eine Grundlage für das Altern von Zellen ist die in vitro reduzierte Teilungsfähigkeit von Zellen beim Hutchinson-Gilford-Syndrom oder Werner-Syndrom (s. oben) (Finch 1990). Inwieweit sich die in vitro gewonnenen Ergebnisse von Zellkulturen jedoch auf in-vivo-Verhältnisse übertragen lassen, bei denen komplexe Interaktionen zwischen Geweben und Organen bestehen, wird seit langem ohne eindeutiges Ergebnis diskutiert. Zudem scheint sich die Limitierung der Zellteilungsaktivität erst deutlich jenseits des durchschnittlichen Sterbealters auszuwirken. Das zeigt die Tatsache, dass selbst Zellen von über 90jährigen sich noch bis zu 20mal teilen können. Aus den Ergebnissen lässt sich interpretieren, dass die verbliebene Zellteilungskapazität zwar eng mit dem Alter korreliert ist, aber nur in den seltensten Fällen direkte Todesursache sein kann. Sie wird vielmehr als eine Ursache der maximalen Lebensspanne des Menschen diskutiert. Telomer-Theorie: Im Zusammenhang mit dem Hayflick-Limit wird die Telomer-Theorie diskutiert. Zur Vermeidung von Substanzverlusten innerhalb von Genen, die fatale Folgen für ihren Träger haben können, sind den Chromosomenenden Telomere angelagert. Bei diesen Pufferzonen handelt es sich um repetitive, nicht-codierende und damit genetisch funktionslose Basenabfolgen, die bei jeder DNA-Replikation im Rahmen der Zellteilung durch die Funktionsweise der DNA-Polymerase um einige Basen verkürzt werden (Harley et al. 1990, Greider u. Blackburn 1998). Die Telomere fungieren damit als eine Art innere Uhr. Ist sie abgelaufen, werden Proteine fehlerhaft oder gar nicht mehr gebildet. In den Zellen der Keimbahn und in Krebszellen verhindert das erst kürzlich nachgewiesene RNA-Enzym Telomerase das Verkürzen Wachstum, Reifung, Altern Box 4.3 Apolipoprotein E und Altern Ein erster Anhaltspunkt für genetische Einflussfaktoren des Alterns beim Menschen ist mit dem auf Chromosom 19 lokalisierten Apolipoprotein-Gen Apo-E gewonnen worden. Das Gen kodiert ein in Gehirn, Leber, Lunge, Nieren und Milz synthetisiertes Protein, das einen wesentlichen Einfluss auf den Gesamtcholesterinspiegel im Blut hat.Drei verschiedene Allele mit unterschiedlichen physiologischen Charakteristika sind beim Menschen bekannt. Die drei Lipoproteine Apo-E2, Apo-E3 und Apo-E4 unterscheiden sich in drei unterschiedlichen Eigenheiten, die zu verschiedenen Risikofaktoren für Erkrankungen in höherem Alter beitragen: 1. Apo-E4 fehlt die Eigenschaft, sich mittels Disulfidbrücken an das Tau-Protein (s. oben) zu binden, wodurch das ungebundene TauProtein hyperphosphoryliert wird und zu den für die Alzheimer-Erkrankung charakteristischen neurobifrillären Placques-Ablagerungen führt (Kamboh 1995). Homozygote Apo-E4-Träger entwickeln signifikant häufiger eine Alzheimer-Erkrankung als homozygote Apo-E3-Träger. Das geringste Erkrankungsrisiko haben homozygote Träger des Apo-E2-Allels (Poirier et al. 1995). 2. Die gleiche fehlende Bindungskapazität des Apo-E4 ist eine plausible Erklärung für das gehäufte Auftreten ischämischer Herzkrankheiten und Arteriosklerose in homozygoten Apo-E4-Trägern (Kamboh 1995). 3. Die drei Allele des Apo-E unterscheiden sich in ihre Aktivität gegenüber den zellschädigenden freien Radikalen (s. Theorie der freien Radikale).Aus Forschungsergebnissen lässt sich schließen,dass die Schutzfunktion für die Zelle in der Reihenfolge E2>E3>E4 abnimmt (Miyata u. Smith 1996). Das Apo-E4-Allel ist am niedrigsten in asiatischen Bevölkerungen mit etwa 0,07% vertreten,die höchste Genfrequenz findet sich in Neuguinea mit 0,37%. Die Genfrequenzen sind umgekehrt proportional zu dem Auftreten ischämischer Herzerkrankungen in den Bevölkerungen (Kamboh 1995). Weiterhin ist mit der Anreicherung des ApoE3-Allels um das Doppelte und einer Verringerung des Apo-E4-Allels in Hundertjährigen (Schächter et al. 1994) ein Selektionseffekt beobachtet worden, der für ein Risikomodell der Apo-E-Polymorphien spricht.Die Varianten des Apolipoproteins scheinen auf verschiedene Weise zur differentiellen Alterung beizutragen, wenn auch die Ergebnisse für die Interpretation direkter Kausalzusammenhänge noch nicht ausreichend ist (Arking 1998). 307 308 Lebenszyklus der Telomere durch einen Reparaturmechanismus (Kelner 1997). Diese Entdeckung hatte eine euphorische Aufbruchsstimmung in der Entwicklung geriatrischer Pharmaka zur Folge in dem Glauben, mit der Telomerase einen zellbiologischen „Jungbrunnen“ gefunden zu haben. Die Anwendung dieser Kenntnis ist jedoch durch Rückschläge bei Experimenten mit Modellorganismen in weite Ferne gerückt. Theorie der Kalorienrestriktion: Schon früh ist beobachtet worden, dass kalorienreduzierte Nahrung ein vermindertes Auftreten spontaner Tumore bei Mäusen bewirkt, solange der Bedarf an Aminosäuren, Vitaminen und Spurenelementen gedeckt ist. Durch Einschränkung der Fett- und Kohlehydratzufuhr konnte die Lebensspanne bei Mäusen von durchschnittlich 600 Tagen auf bis zu 900 Tage gesteigert werden. Tiere, die im Versuch bereits nach der Entwöhnung einer derartigen Diät ausgesetzt waren, blieben kleiner und weniger muskulös im Vergleich zu ad libitum gefütterten Tieren und zeigten: • • • • • • eine verbesserte Immunantwort durch verstärkte Lymphozytenteilung in der Milz, weniger oxydative Schäden durch freie Radikale, verringerte Wachstumshormonkonzentration, verbesserte DNA-Reparaturmechanismen, herabgesetzten Glucose- und Insulinmetabolismus, erniedrigte Körpertemperatur. Weibliche Tiere wurden später fertil, blieben dann aber länger fruchtbar. Unter konstanten Bedingungen bevorteilt, waren die Diättiere in Stresssituationen durch weniger Fettreserven, höhere Sensibilität gegenüber bakteriellen Infektionen und niedrigerer Körpertemperatur allerdings stärker gefährdet. Erfolgte jedoch die Nahrungsumstellung auf kalorienreduzierte Nahrung erst im adulten Alter, lebten die Mäuse weniger lang als normal ernährte Vergleichstiere (Weindruch u. Walford 1988, Austad 2001, Masoro 1995, 2003, Masoro u. Austad 1996). Demzufolge wird vermutet, dass die Kalorienrestriktion zu einer Retardierung der Alternsprozesse führt und als adaptiver Prozess eines verzögerten und verlängerten reproduktiven Lebensabschnittes betrachtet werden kann. Ergebnisse beim Menschen sind widersprüchlich, die Datenlage zumeist unbefriedigend. „Burn out“: Der Theorie liegt die Idee einer sich erschöpfenden Quelle oder Substanz zugrunde, die im Laufe des Lebens verbraucht wird und nicht ersetzt werden kann. Treffende Beispiele mögen Insekten (z. B. Eintagsfliegen Ephemeroptera) sein, die als Imago keine Mundwerkzeuge mehr besitzen und nach Verbrauch ihrer Kalorienreserve verhungern. Auch die Verwendung von Stoffwechselleistung für die Reproduktion anstatt für die Selbsterhaltung wird in diesen Zusammenhang gesetzt, gestützt auf die Beobachtung, dass nichtreproduktive Organismen oft länger leben als ihre reproduktiven Artgenossen, wie z. B. kastrierte Lachse Oncorhynchus nerka kennerlyi (Robertson 1961, zit. nach Rose 1991) oder an der Paarung gehinderte Fruchtfliegen Drosophila melanogaster (Partridge u. Farquhar 1981). Beim Menschen sind die Ergebnisse widersprüchlich, da eine direkte Kausalität nicht nachgewiesen werden kann. Wachstum, Reifung, Altern 309 „Protein-error“-Theorie: Während sich die „somatic-mutation“- und die „mutation-catastrophe“-Theorie auf die genetischen Ursachen von Seneszenz beschränken, wird in der „protein-error“-Theorie (Orgel 1963, nach Rose 1991) Seneszenz mit fehlerhafter Transkription vom Gen zum Protein erklärt. Tritt ein Fehler bei der Proteinsynthese auf, resultieren daraus entweder keine oder nur geringe Veränderungen, die Inaktivität des Proteins oder eine fehlerhafte Funktion des Proteins. Ist ein Protein von einem derartigen Fehler betroffen, kann daraus ein exponentiell wachsendes Auftreten von Folgefehlern resultieren. Die verkürzte Lebensspanne bei Tieren, in deren Entwicklungsphase durch aminosäureanaloge Nahrungszusatzstoffe künstlich provozierte Proteinanomalien auftraten, wird als Beleg für diese Theorie angeführt (Holliday 1995). Direkte Nachweise sind allerdings nur schwer zu führen. Zusammenfassende Bemerkungen Die Fülle der beschriebenen Theorien und Mechanismen des Alterns lässt nur den Schluss zu, dass es die Alternstheorie nicht gibt. Alle hier vorgestellten Überlegungen weisen experimentelle Evidenzen auf und erklären einzelne Phänomene des Alterungsprozesses, liefern Erkenntnisse über allgemeine Mechanismen oder beschreiben die Folgen der zu beobachtenden Prozesse: This broader view of theories of aging, namely, that there is some truth in all of them, implies that the deleterious events that finally lead to aging can occur in many types of molecules and can be brought about by many inducing events. (Holliday 1995: 66) So kann die hier nicht näher vorgestellte, aber bekannte „rate of living theory“, nach der die für den gesamten Lebenslauf limitierte Stoffwechselenergie für erhöhte Fruchtbarkeit oder verlängertes Leben eingesetzt werden kann (Promislow u. Harvey 1990), im Einklang mit sowohl der „Theorie der freien Radikale“ als auch der „nichtenzymatischen Glykolysierung“ gesehen werden. Beide Theorien beruhen auf dem Grundsatz „mehr Stoffwechsel bedeutet höhere potentielle Schädigung“. Sie sind wiederum mögliche Ursachen für „Somatische Mutationen“ oder „protein errors“. Allgemein kann man sie auch als Folge eines übermäßigen „wear and tear“ sehen. Die „Einschränkung der Kalorienzufuhr“, die „Temperaturabsenkung“ oder die „Aktivitätseinschränkung“ würden dann aufgrund ihrer stoffwechseldrosselnden Wirkung lebensverlängernd einem „wear and tear“ entgegenwirken. Die lang geführte Diskussion, ob die Alternsabläufe stochastischer oder genetischer Natur sind, erweisen sich als obsolet, denn die Umwelteinflüsse machen den Genotyp zum individuell angepassten Phänotyp, auf den sowohl Umweltbedingungen als auch genetische Limits einwirken, die artspezifische und individuelle Alternsprozesse ausmachen (Mockett u. Sohal 1997). 310 Lebenszyklus Zusammenfassung Kapitel 4.1 Wachstum, Reifung, Altern n Die menschliche Ontogenese ist in mehrere Abschnitte gegliedert, welche sich in Bezug auf körperliche und kognitive Entwicklung voneinander abgrenzen lassen. n Während der postnatalen Entwicklung kommt es zu einer Serie altersgruppenspezifischer Wachstumsraten. Altersgruppentypische Formmerkmale sind Folge allometrischen Wachstums. n Im Vergleich zu anderen Säugetieren einschließlich der Primaten zeichnen sich Menschen durch ein relativ kurzes Kleinkindalter, dafür eine verlängerte Kindheit und eine Phase der Adoleszenz aus. n Umweltfaktoren, welche das Wachstum retardieren können, sind vor allem mangelhafte Ernährung und damit der Mangel an erforderlicher Stoff- und Energiezufuhr sowie häufige Erkrankungen und mangelnde Hygiene. Das individuelle Wachstum reflektiert somit unmittelbar die Lebensbedingungen. n Verbesserte Lebensbedingungen haben in vielen Bevölkerungen zu einer größeren Körperendhöhe, sowie zeitlicher Vorverlegung der sexuellen Reife geführt (säkulare Trends). n Altern ist ein genetisch determinierter Prozess, der umweltabhängig beeinflusst werden kann.Er äußert sich darin,dass das physiologische Gleichgewicht des Körpers zunehmend gestört ist. n Altern unterliegt einem artspezifisch universalen Muster, das auf evolutionsbiologische Wurzeln zurückzuführen ist. Fortpflanzungsbiologie 311 4.2 Fortpflanzungsbiologie Fortpflanzung ist eine der zentralen Aufgaben unseres Lebens, ungeachtet der individuellen Möglichkeit eines Menschen, sich dagegen zu entscheiden. Durch unsere Fortpflanzungsfähigkeit werden immer neue Individuen in die Population hineingeboren, die unsere menschliche Spezies darstellt, so dass sie seit Millionen von Jahren über die Lebensspanne eines einzelnen Menschen hinaus bestanden hat und bis heute besteht. So wird der unvermeidbare Tod der individuellen Mitglieder durch den Fortbestand unserer Spezies kompensiert. In der Fortpflanzungsbiologie geht es letztendlich um die Beantwortung der Frage, warum die Fertilität von Individuum zu Individuum variiert und warum es Fertilitätsdifferenzen zwischen verschiedenen menschlichen Gruppen gibt. Die Ursachen liegen einerseits in der vorhandenen oder nicht vorhandenen Fekundität, der biologischen Voraussetzung für die Fortpflanzungsfähigkeit eines Menschen. Dazu gehören die vorgeburtliche sexuelle Differenzierung des Embryos in weibliche oder männliche Richtung (s. Kap. 4.2.1), die sexuelle Reifung der Jugendlichen in der Pubertät (s. Kap. 4.2.3) und die damit einsetzende Produktion von Sexualhormonen, die neben geschlechtsspezifischen, körperlichen Veränderungen auch zur Entwicklung von reifen Eizellen bei Frauen bzw. befruchtungsfähigen Spermatozoen bei Männern (s. Kap. 4.2.5) benötigt werden. Fekundität ist daher eine unerlässliche Voraussetzung für die Fertilität6 eines Menschen, in der Definition der Demographie die Geburt eines eigenen, lebenden Kindes. Ein fekunder Mensch ist jedoch nicht immer auch ein fertiler Mensch. Große Bedeutung kommt sozialen Einflüssen und Verhaltensstrategien wie die Verfügbarkeit von Sexualpartnern, erfolgreicher Partnerwerbung, Häufigkeit und Zeitpunkt des Geschlechtsverkehrs und bewusster Familienplanung zu. Als natürliche Fertilität eines Paares oder einer Population gilt in der Fortpflanzungsbiologie die Fertilität, die ohne feste Vorstellung über die endgültige Familiengröße und damit ohne bewusste Geburtenplanung erreicht wird (Wood 1994),wie sie heute z. B. noch bei den strenggläubigen Amischen (Mennoniten) in den USA zu finden ist (Greksa 2002). Die natürliche Fertilität eines Paares hängt von verschiedenen Einflüssen ab, die als proximate Determinanten einen direkten Effekt auf die Kinderzahl haben (Tabelle 4.5). Zusätzlich können distale (entfernte) Einflussfaktoren mittels eines der proximaten Faktoren einen Einfluss ausüben (z. B. religiöse Zugehörigkeit und damit verbundene Tabus bestimmen den erlaubten Zeitpunkt des Geschlechtsverkehrs). 6 In der Medizin wird unter Fertilität die Fähigkeit verstanden, zu konzipieren bzw. eine Schwangerschaft zu induzieren. Beim Mann ist demnach Fertilität gleichbedeutend mit Zeugungsfähigkeit. Infekundität bedeutet, dass eine Schwangerschaft nicht ausgetragen werden kann. 312 Lebenszyklus Tabelle 4.5. Proximate Faktoren der natürlichen Fertilität. Proximate Faktoren, die einen direkten Effekt auf die Fertilität eines Menschen oder Paares haben, müssen mindestens einmal im Reproduktionsprozess auftreten, damit Fortpflanzung überhaupt stattfinden kann (erweitert nach Wood 1994) A. Faktoren, welche die Möglichkeit zum Geschlechtsverkehr beeinflussen 1. Faktoren, welche die Gründung oder Auflösung von Verbindungen während der reproduktiven Phase bestimmen: n Alter bei Beginn der sexuellen Beziehungen n Andauernder Zölibat: Prozentsatz der Frauen und Männer, die niemals eine sexuelle Beziehung haben n Ausmaß der Reproduktionsperiode nach oder zwischen sexuellen Beziehungen (Ende einer Beziehung durch Scheidung, Trennung, Tod des Partners) 2. Faktoren, welche die Möglichkeit zum Geschlechtsverkehr in einer sexuellen Beziehung beeinflussen: n freiwillige Enthaltsamkeit n unfreiwillige Enthaltsamkeit (Impotenz, Krankheit, zeitweilige Trennung der Partner) B. Faktoren, welche die Möglichkeit zur Konzeption beeinflussen 1. Dauer der fekunden Zeit bis zur Konzeption der Frau n Häufigkeit der Insemination durch den Mann n Spermatozoenqualität und -quantität n Länge der ovariellen Zyklen der Frau n Prozentsatz der Zyklen mit einem Eisprung n Dauer der fertilen Phase eines Paares n Wahrscheinlichkeit der Konzeption durch eine einzige Insemination in der fertilen Phase der Frau 2. Wahrscheinlichkeit des Verlustes eines Fötus 3. Dauer der nicht empfängnisbereiten Phase der Frau nach dem Verlust eines Fötus 4. Dauer der Schwangerschaft bis zur Geburt eines reifen Kindes 5. Dauer der Infekundität der Frau durch Laktation (Stillen des Kindes) Die Betonung des weiblichen Einflusses auf die Fertilität eines Paares oder einer Bevölkerung hat ihre Ursache in der biologischen Begrenzung der Befruchtungsfähigkeit bei der Frau, da bei ihr die zyklische (diskontinuierliche) Produktion von Eizellen, Schwangerschaften und Stillzeiten die Zahl möglicher Nachkommen erheblich stärker einschränkt als bei Männern. Der männliche Einfluss auf die Fertilität eines Paares ist naturgemäß ausschließlich auf die Zeit der Zeugung beschränkt. Die Häufigkeit der Inseminationen kann ebenso wie die Qualität und Quantität der Spermatozoen mit dem Alter des Mannes geringer werden. Als beschränkender Faktor gilt bei Männern auch die altersbedingte, permanente Zeugungsunfähigkeit durch sexuell übertragene Krankheiten sowie der allmähliche Abfall der Testosteronkonzentration, der zu absinkender Libido bis zur Impotenz führen kann (s. Kap. 4.2.3). Einen wichtigen Einfluss auf die Konzeptionschancen eines Paares hat die Dauer der gemeinsamen Lebensphase von Eizelle und Spermium, die bestenfalls 24 Stunden beträgt. Die Überlebensdauer einer menschlichen Eizelle wird Fortpflanzungsbiologie 313 Tabelle 4.6. Schätzung der durchschnittlichen Überlebensdauer (in Stunden) von fertilen Gameten im Reproduktionstrakt der Frau/des weiblichen Tieres (nach Wood 1994) Spezies Sperma Eizelle Mensch Rind Schaf Pferd Schwein Maus Kaninchen 30–40 Std. 30–48 Std. 30–48 Std. 140–150 Std. 25–50 Std. 6–12 Std. 30–36 Std. 6–24 Std. 12–24 Std. 15–25 Std. 15–25 Std. 10–20 Std. 6–15 Std. 6–8 Std. Tabelle 4.7. Stufen der Geschlechtsdifferenzierung (nach Josso 1996) Spezies Fertilisation Genetisches Geschlecht Gonadales Geschlecht Somatisches Geschlecht Legales Geschlecht Geschlechtsidentität mit sechs Stunden bis zu einem Tag angegeben, die Spermatozoen des Mannes bleiben maximal 40 Stunden befruchtungsfähig. Diese Zeitspannen sind typisch für viele Säugetiere (Tabelle 4.6) Ist es zur Befruchtung der Eizelle (s. Kap. 4.2.5) gekommen, beginnt die komplizierte Entwicklung des neuen Individuums aus der Zygote bis zu einer geschlechtsreifen Frau oder eines Mannes. Die sexuelle Differenzierung kann in verschiedene Stadien unterteilt werden (Tabelle 4.7), die sich nacheinander in einer festgelegten Abfolge bedingen. Normalerweise stimmen das genetische, gonadale und somatische Geschlecht überein. Das legale Geschlecht wird dem Neugeborenen durch die Geburtshelfer aufgrund seines körperlichen Erscheinungsbildes (somatisches Geschlecht) zugewiesen und dem Standesamt gemeldet. Die Geschlechtsidentität eines Menschen entwickelt sich jedoch erst im Laufe der Ontogenese und kann sich gelegentlich durchaus vom legalen Geschlecht unterscheiden. 4.2.1 Geschlechtsdetermination und sexuelle Differenzierung Das Geschlecht eines Menschen ist wie bei allen Säugetieren genetisch determiniert. Normale Individuen mit einem Karyotyp 46,XX entwickeln sich zu Frauen, ein 46,XY-Chromosomensatz steuert die Entwicklung zum männlichen Geschlechtstyp. In dem Moment, in dem ein Spermium mit einem Xbzw. Y-Chromosom in die weibliche Eizelle eingedrungen ist und mit dem 314 Lebenszyklus X-Chromosom der Eizelle verschmilzt, ist das chromosomale Geschlecht dieses Individuums festgelegt. Weibliche und männliche Embryonen sehen in den ersten Wochen nach der Zeugung zunächst gleich aus. Die Anlagen der Gonaden, Keimleiter (Gonodukte) und der äußeren Genitalien können sich in weibliche und männliche Richtung entwickeln, wobei die Entwicklung zum weiblichen Phänotyp die Grundform darstellt, während für die Differenzierung zum männlichen Erscheinungsbild zusätzliche genetische Anlagen notwendig sind. Fehlen diese, erfolgt automatisch die Feminisierung der betroffenen Gewebe. Geschlechtsunterschiede werden erst sichtbar, wenn das entscheidende Gen, der Testis-Determinierende Faktor (TDF) auf dem Y-Chromosom aktiv wird. Es ist ein Gen auf dem kurzen Arm des Y-Chromosoms, das „Sex Determining Region Y“ (SRY) benannt wurde. Es kodiert ein 204 Aminosäuren langes Protein, dem DNA-bindende und DNA-biegende Eigenschaften zu geschrieben werden (Ostrer 1996). Das SRY-Gen setzt mit seinen Genprodukten jene Prozesse in Gang, welche die undifferenzierten Gonaden (Keimdrüsen) des Embryos zu Hoden ausdifferenzieren und so die genetisch vorprogrammierte Entwicklung der Urgonaden zu Eierstöcken unterdrücken. SRY-Genprodukte haben auch eine indirekte Wirkung auf die undifferenzierten Keimdrüsen, indem sie Gene autosomaler Chromosomen (9: SF-1; 11: WT-1; und 17: SOX-9) dabei mit einbeziehen, da sie deren Transkription regulieren können (Sultan et al. 1997). Zusätzlich zur SRY-Region spielt das Gen DAX-1 auf dem X-Chromosom für die Gonadenentwicklung eine Rolle, dessen Genprodukte die Wirkung der SRY-Region bei der Entwicklung der ableitenden Genitalwege (Gonodukte) überlagern können. So entstehen weibliche Individuen mit dem Karyotyp 46,XY, die eine Verdoppelung des kurzen Arms des X-Chromosoms aufweisen, auf dem sich der Genlocus für das DAX-1 Gen befindet (Bardoni et al. 1994). Die Urgonaden oder Genitalleisten werden zunächst im Embryo paarig für beide Geschlechter gleich angelegt. Um den 32. Tag der Embryonalentwicklung herum entstehen sie als eine Verdickung an der Oberfläche der Urnieren (Mesonephron) und sind das gemeinsame somatische Blastem7 für die zukünftigen Follikelzellen in den Eierstöcken oder die androgenbildenden Interstitiumzellen in den Hoden. Die Urgeschlechtszellen, die als Stammzellen der Oogonien bzw. Spermatogonien gelten, sind zuerst um den 21. Tag außerhalb der Gonadenanlage extraembryonal im Entoderm des Dottersackes nachzuweisen. Mit Hilfe ihrer Eigenbeweglichkeit wandern sie in der 5. Schwangerschaftswoche beiderseits zu den Gonadenanlagen und breiten sich dort entlang der Oberfläche aus (Abb. 4.7). Sobald sich die Keimzellen in der Gonadenregion angesiedelt haben, setzt in der Tiefe des Blastems eine rapide Zellvermehrung ein, und die Keimzellen beginnen selbst aktiv in das Blastem einzudringen. Die Spermatogonien verbleiben in den Rindenschichten der Gonadenanlage. Dort verharren 7 indifferentes Keimgewebe aus teilungsfähigen Stammzellen, aus dem sich in der Embryonalentwicklung differenziertes Gewebe entwickelt Fortpflanzungsbiologie 315 Abb. 4.7. Wanderung der Urgeschlechtszellen in die Gonaden (nach Knörr et al. 1972) sie in der G1-Phase des Zellzyklus ohne weitere Teilungen in einer Ruhephase bis zum Einsetzen der Pubertät. Die Oogonien dringen bis in die inneren Schichten des Blastems ein, wo sich bei weiblichen Embryonen aus der Tiefe des Blastems Zellstränge entwickeln, welche die Vorstufen der Follikelzellen enthalten. Sie nehmen die Oogonien auf, umschließen sie mit einer einschichtigen Zelllage und bilden so die Primärfollikel. Die Kontaktaufnahme mit den Follikelzellen veranlasst einen entscheidenden Funktionswechsel der weiblichen Keimzellen. Ihre Vermehrungsphase ist abgeschlossen, und die mitotischen Teilungen der Oogonien werden nun gestoppt. Es beginnt die Vorbereitungsphase für die späteren, generativen Aufgaben, indem Oozyten in die Prophase der ersten meiotischen Teilung eintreten und darin bis zur Geschlechtsreife der Frau verweilen werden (s. Kap. 4.2.5). Die Oogonien sind nun zu Oozyten oder Primordialfollikeln differenziert, die jeweils aus Eizelle und Epithelzellen bestehen. Zu diesem frühen, vorgeburtlichen Zeitpunkt sind ungefähr 10 Mio. Follikelapparate in den weiblichen Gonaden eingebettet, von denen bis zur Geburt des Mädchens bereits 90% zugrunde gehen. Bis zur Pubertät werden weitere 90% atretisch (Abkapselung und Abbau), so dass noch ungefähr 100 000 der ursprünglich angelegten Primordialfollikel übrig bleiben (Neulen 1997). Parallel zur Entwicklung der Urgonaden haben sich die ableitenden Gonodukte ausgebildet, die anfänglich bei beiden Geschlechtern gleich angelegt sind: die Wolff’schen Gänge als potentiell männliche Anlage und die Müller’schen Gänge als primäre Struktur der weiblichen Geschlechtswege (Tabelle 4.8). Die sexuelle Differenzierung beginnt bei weiblichen Embryonen mit der genetisch vorprogrammierten Entwicklung der Urgonaden zu Ovarien.Bei männlichen Individuen erfolgt zwischen der 6. und 8. Schwangerschaftswoche die 316 Lebenszyklus Tabelle 4.8. Zeitplan der wichtigsten Ereignisse der fetalen sexuellen Differenzierung fetales Alter (Wochen) 4 4,5 5 6 6–7 8 8 9 10 10 10 10 10 12–14 15–17 17 24 28 28 Ereignis Entwicklung der Wolff´schen Gänge Entwicklung der Urgonaden Wanderung der Ur-Geschlechtszellen Entwicklung der Müller’schen Gänge (MG) Bildung von Sertoli-Zellen in den männlichen Gonaden, Beginn der AMHSekretion* männlicher MG beginnt Rückentwicklung Auftauchen von Leydig-Zellen in den Hoden und Beginn der TestosteronSekretion Entwicklung der Vaginalplatte aus den weiblichen MG Beginn der meiotischen Prophase der Oogonien Ende der Rückbildungsphase des männlichen MG Entwicklung der männlichen Wolf’schen Gänge zu Nebenhoden, Prostata, Penis und peniler Harnröhre Beginn Rückbildung der weiblichen Wolff’schen Gänge Entwicklung der weiblichen Müller’schen Gänge zu Eileitern, Uterus, Cervix, Vagina und Hymen Ende der Penisausbildung Maximum an Leydig-Zellen und Testosteronproduktion erste Follikel im Ovar Ausbildung der Vagina Ende der mitotischen Oogonienvervielfältigung Abstieg der Testes aus dem Bauchraum *AMH: Anti-Mullerian Hormone (=Oviduktrepressor) wird von den Sertoli-Zellen gebildet, die durch das Protein SOX-9 des entsprechenden Gens auf dem Chromosom 17 aktiviert werden. Ausbildung der bis dahin indifferenten Gonadenanlage zum Hoden. Die Genprodukte des SRY-Gens veranlassen in den Gonaden die Entwicklung von Sertoli-Zellen, die das Glykoprotein Anti-Mullerian-Hormone (AMH) produzieren. AMH wird auch als Oviduktrepressor bezeichnet, weil es die Rückentwicklung der Müller’schen Gänge bei männlichen Embryonen bis zur vollständigen Regression einleitet. So können sich diese Strukturen nicht wie bei Frauen vorgeburtlich zu Eileitern, Gebärmutter, Cervix (Muttermund), Vagina und Hymen ausdifferenzieren (Tabelle 4.8). Bei weiblichen Embryonen gibt es wegen des fehlenden SRY-Gens kein AMH, so dass sich die Müller’schen Gänge bis zur Geburt voll entwickeln können. Andererseits bilden sich bei ihnen die Wolff ’schen Gänge vollständig zurück (Josso 1996). Die Wolff ’schen Gänge der männlichen Embryonen beginnen sich ab der 10. Schwangerschaftswoche zu Nebenhoden, Samenleitern, Prostata, Penis und peniler Harnröhre auszubilden. Der Wolff ’sche Gang unterliegt einer positiven Regulierung durch Testosteron, das zu diesem Zeitpunkt durch die Leydig-Zellen im Hoden ausreichend produziert werden kann, da bereits in Fortpflanzungsbiologie 317 der 8. Schwangerschaftswoche die Differenzierung der Stammzellen zu Hormon produzierenden Leydig-Zellen erfolgte. In der 14. bis 17. Gestationswoche erreicht der Testosteronspiegel bei männlichen Feten sein Maximum, bevor er nach der 24. Woche auf das Niveau der weiblichen Feten sinkt. In diesen Wochen ist die Konzentration des freien, biologisch aktiven Testosterons bei den männlichen Feten höher als das geschlechtsreifer Männer, was nicht nur die Ausbildung der Geschlechtsorgane ermöglicht, sondern auch eine vorgeburtliche Prägung bestimmter Regionen des Gehirns mit sich bringt (Christiansen 2004). Die Differenzierung der Wolff ’schen Gänge zu den äußeren männlichen Genitalien kann nicht direkt durch Testosteron erfolgen, sondern sie unterliegt dem Einfluss von Dihydrotestosteron (DHT). DHT wird aus Testosteron durch das Enzym 5α-Reduktase gebildet. Unterbleibt diese Umwandlung in der Zielzelle, resultiert eine unzureichende Maskulinisierung der Geschlechtsorgane, die dem Ausmaß des normalen, jetzt aber fehlenden DHT-Effektes entspricht (Weinbauer et al. 2000). Störungen der sexuellen Differenzierung Chromosomale Anomalien: Der Zusammenhang zwischen den Geschlechtschromosomen und dem Geschlechtsphänotyp wurde von Wilson (1911) entdeckt, aber erst Ende der sechziger Jahre konnte die Bedeutung des Y-Chromosoms für die männliche sexuelle Differenzierung belegt werden (Jacobs 1969). Ein Y-Chromosom steuert normalerweise die Ausbildung männlicher Gonaden und Keimbahnen, unabhängig von der Zahl vorhandener X-Chromosomen, während das Fehlen des Y-Chromosoms in der Regel den Phänotyp des Individuums in eine weibliche Richtung differenziert (Abb. 4.8). Der normale Karyotyp eines Mannes ist 46,XY. • • • Liegt bei vorhandenem Y-Chromosom eine Vervielfachung des X-Chromosoms vor (47,XXY; 48,XXXY; 49,XXXXY), wird diese Chromosomenaberration als Klinefelter-Syndrom bezeichnet. Die numerischen Aberrationen entstehen durch sogenanntes Non-Disjunction in den meiotischen Teilungen während der Keimzellentwicklung (mütterliche Oogenese und väterliche Spermatogenese oder während der frühembryonalen mitotischen Teilungen). Die phänotypischen Männer zeigen das klinische Bild des Hypogonadismus (Hodenunterfunktion), das durch sehr kleine Hoden, Infertilität aufgrund fehlender Spermatozoen und Gynäkomastie (weibliche Fettverteilung) gekennzeichnet ist. Ein überzähliges Y-Chromosom (Karyotyp 47,XYY) führt bei den XYY-Männern zu Hochwuchs, normaler bis leicht eingeschränkter Hodenfunktion, gelegentlich entsteht dadurch ein Testosteronmangel, der behandlungsbedürftig sein kann. Die Ursache des überzähligen Y-Chromosoms ist eine Verteilungsstörung in der väterlichen Meiose. Eine Ausnahme bezüglich der Notwendigkeit eines Y-Chromosoms für die Ausbildung eines männlichen Phänotyps sind Männer mit 46,XX- oder 45,X-Karyotyp. Bei ihnen liegt eine Translokation zwischen X- und Y-Chro- 318 Lebenszyklus Abb. 4.8. Geschlechtschromosomenkonstitution und phänotypische sexuelle Differenzierung • • mosom während der väterlichen Meiose vor, bei der unter anderem das SRY-Gen auf das X-Chromosom übertragen wurde („sex reversal“). Die Folgen sind eine eingeschränkte Maskulinisierung mit kleinen Hoden, Gynäkomastie, Azoospermie und meist erniedrigter Testosteronspiegel; allerdings sind die Körperproportionen der Männer normal. Für die Ausbildung weiblicher Gonaden und Keimbahnen sind mindestens zwei X-Chromosomen notwendig. Überzählige oder ein fehlendes X-Chromosom bringen vielfältige Störungen mit sich. Bei weiteren X-Chromosomen (47,XXX, 48,XXXX und 49,XXXXX) sind die Frauen, Superfemales, in ihrem äußeren Erscheinungsbild unauffällig weiblich. Bei rund einem Drittel von ihnen treten aber eine Unterentwicklung der Eierstöcke, Menstruationsstörungen, gelegentlich sogar Sterilität auf. Ist nur ein X-Chromosom vorhanden (Karyotyp 45,XO), handelt es sich um das Ullrich-Turner-Syndrom (Abb. 4.9). Die Gonaden der phänotypischen Frauen entwickeln sich bis zur 12. Gestationswoche normal, und es bilden sich auch die ersten Primordialfollikel. Danach beginnt eine gonadale Dysgenesie, so dass bei der Geburt des Kindes nur noch Gonadenreste mit erkennbarem Ovarialgewebe vorhanden sind. Zusätzlich gibt es Fehlbildun- Fortpflanzungsbiologie 319 Abb. 4.9. Erscheinungsbild bei phänotypischen Frauen mit Turner-Syndrom: Kleinwuchs, Faltenhals, Knochen-, Herz, Gefäßund Nierenmissbildungen, Pigmentationsanomalien (nach Lauritzen 1987) • gen (Abb. 4.9) wie einen Faltenhals, Schildthorax, Kleinwuchs, Herz-, Gefäß-, Nieren und Knochenmissbildungen. Das Phänomen, dass ein offensichtlich intakter, gonosomal eindeutiger Genotyp in einem „falschen“ Phänotyp mündet, gibt es auch bei 46,XY-Frauen. Da 85% dieser Frauen ein intaktes SRY-Gen aufweisen, könnte als Erklärung die Verdoppelung des kurzen Arms des X-Chromosoms (Genlocus für DAX-1) gelten. Es scheinen hier aber auch noch andere, bisher noch nicht identifizierte Faktoren für das „sex reversal“ verantwortlich zu sein (Puschek et al. 1994). Testikuläre Feminisierung: Beim klassischen Bild der testikulären Feminisierung (46,XY Karyotyp) handelt es sich um eine genetisch bedingte Störung, bei der die Zielorgane nicht auf Testosteron ansprechen, da aufgrund eines rezessiven Defektes des Androgen-Rezeptor-Gens auf dem X-Chromosom (Xq11- q12) in den Zielzellen kein Androgenrezeptor-Protein erzeugt wird. In der Embryonalentwicklung sind noch Hoden entstanden, diese steigen aber auch nach der Geburt meist nur bis in den Leistenkanal ab. Die inneren Genitalien fehlen, da die unbeeinträchtigte testikuläre Sekretion des Anti- 320 Lebenszyklus Mullerian-Hormone (AMH) die Entwicklung von Eileitern und Gebärmutter verhinderte, und die Stimulation der Wolff ’schen Gänge zu Nebenhoden, Samenleitern, Samenblase durch Testosteron aufgrund des Androgen-Rezeptor-Defektes unterblieb. Es ist ein unverminderter Testosteronspiegel im Blut vorhanden, aber das Testosteron kann nicht wirksam werden. Trotz der geringen Östrogenproduktion entwickeln diese Menschen einen normalen weiblichen Phänotyp. Sie haben eine Vagina (die blind endet), die Labien sind oft unterentwickelt, die Klitoris ist klein bis normal. Die Brüste sind nach der Pubertät gut entwickelt, die Körperfettverteilung und psychische Entwicklung sind normal weiblich, aber die Menarche bleibt aus. Das Kopfhaar zeigt eine unauffällige weibliche Verteilung und Qualität, aber es gibt keine Achsel- und Genitalbehaarung, da diese bei beiden Geschlechtern androgenabhängig ist. Hermaphroditismus verus: Beim echten Hermaphroditismus haben die Individuen eindeutig testikuläres und ovarielles Gewebe. Die Gonaden können aus ein- oder beidseitigen Ovotestes mit gemischtem Gewebe bestehen, es können aber auch ein Eierstock (fast immer auf der linken Körperseite in normaler Lage) und ein Hoden meist auf der rechten Seite, allerdings häufig nicht im Hodensack sondern im Bauchraum vorhanden sein (Abb. 4.10). Die äußeren Genitalien von Hermaphroditen sind meist männlich, so dass die meisten von ihnen als Jungen großgezogen werden, obwohl sich bei allen Individuen in der Pubertät Brüste entwickeln. Der Karyotyp von Hermaphroditen ist in 60% der Fälle 46,XX, von diesen Individuen menstruieren nach der Geschlechtsreife auch ungefähr 40%. Einen 46,XY-Karyotyp haben 10–15%, bei den restlichen Formen findet man verschiedene Mosaikformen, wie z. B. 49, XXYYY (Hasty u. Rock 1996, Ostrer 1996). Viele, aber nicht alle Hermaphroditen haben das Testis-Determinierende Gen SRY, bei echten Hermaphroditen ohne Y-chromosomale Gensequenzen werden X-chromosomale oder autosomale Mutationen in den SRY-Gen untergeordneten Sequenzen diskutiert (Slaney et al. 1998). 5 -Reduktasestörung: Es gibt eine Pseudoform von Protogynie8 bei Menschen, die von Imperato-McGinley und Mitarbeitern 1979 auf einer Karibikinsel der Dominikanischen Republik entdeckt wurde (Imperato-McGinley 1996). Es handelt sich um 22 Familien, die alle nachweislich von einer Ahnfrau mit dem Mutanten-Gen abstammen. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurden 37 Kinder (normaler, männlicher Karyotyp 46,XY) mit der autosomal-rezessiv vererbten 5 -Reduktase-Störung geboren. Dieser Störung der sexuellen Differenzierung liegt eine Mutation des Gens für das Enzym Typ II auf dem Chromosom 2 zugrunde (Thipgen et al. 1992). Testosteron ist das Pro-Hormon für 5 -Dihydrotestosteron (DHT) und wird in den Zielzellen durch das Enzym 5 -Reduktase zu diesem umgewandelt. Während der Phase der vorgeburtlichen sexuellen Differenzierung des 8 Wird aus einem weiblichen Tier allmählich ein männliches Tier, so wird das Protogynie genannt, im umgekehrten Fall Protandrie. Dieser serielle Hermaphroditismus (Zwittertum) ist bei einigen Korallenfischen der normale Entwicklungsgang. Bei einer Überzahl des weiblichen Geschlechts können die größeren Weibchen das Geschlecht wechseln und damit das Geschlechterverhältnis in einer Population ausgleichen. Fortpflanzungsbiologie 321 Abb. 4.10. Das innere Genitale eines Individuums mit Hermaphroditismus verus. Es sind ein Eierstock mit Eileiter, die Gebärmutter, ein Hoden mit Samenleiter und der Penis vorhanden Embryos liegt dieses Enzym in besonders hoher Konzentration im Sinus urogenitalis vor, aus dem bei Knaben die äußeren Genitalien hervorgehen. Aufgrund des angeborenen 5α-Reduktase-Mangels unterbleibt die Differenzierung dieser Anlagen zum männlichen Phänotyp, so dass bei der Geburt das äußere Genitale der Kinder weiblich differenziert ist, obwohl andererseits Gebärmutter und Eileiter nicht angelegt wurden. Die betroffenen Individuen haben Hoden und ihre inneren Geschlechtswege sind männlich. Die Lage der Hoden ist entweder im Bereich der Leisten oder in den Hodenbeuteln, die als große Schamlippen gedeutet werden. Die Kinder haben durch den 5α-Reduktasemangel einen Mikrophallus, der als Klitorishypertrophie angesehen wird. Der Harnleiter und die Harnblase können als solche erhalten geblieben sein oder es kann – wie beim weiblichen Geschlecht – eine separate Vaginalöffnung bestehen, die jedoch blind endet. Die betroffenen Knaben werden bis zur Geschlechtsreife als Mädchen aufgezogen. Da die 5α-Reduktase-Störung nicht absolut ist, kann mit der Pubertät und den dann stark ansteigenden Testosteronkonzentrationen eine Maskulinisierung eintreten. Vermutlich sorgt die in extragenitalem Gewebe aktive 5α-Reduktase-1 dafür, dass sich im Blutserum dann relativ viel DHT nachweisen lässt, so dass es für die Entwicklung des Penis zu einem normalen Phallus ausreicht. Die Hoden vergrößern sich ebenfalls, auch wenn das Hodenvolumen meist geringer bleibt und es Fertilitätsstörungen geben kann, aber nicht muss. Die Samenproduktion ist dann unterdurchschnittlich und häufig wird eine Azoospermie (keine Spermien im Ejakulat) diagnostiziert. Die Mehrzahl der Männer entwickelt nach der Pubertät eine normale männliche Geschlechtsidentität, heiratet und kann auch Kinder zeugen. Die Muskelentwicklung und Stimmbruch setzen ebenfalls mit der 322 Lebenszyklus Pubertät ein, die Behaarung im Gesicht und am Körper bleibt wegen des erniedrigten DHT-Spiegels aber spärlich. Inzwischen wurden auch in anderen Teilen der Welt Männer mit der 5α-Reduktase-Störung-2 entdeckt. In einem entlegenen Dorf des Taurus-Gebirges in der Türkei (Akgun et al. 1986), im Hochland von Papua-Neuguinea (Herdt u. Davidson 1988, Imperato-McGinley et al. 1991) und in Mexiko (Canto et al. 1997) konnte sich dieser Enzymdefekt aufgrund der Isolation der Bevölkerung durchsetzen. 4.2.2 Sexuelle Reifung Nach der Geburt ruht die weitere sexuelle Entwicklung und Differenzierung während der Kindheit. Es besteht eine endokrinologische Funktionsruhe der Ovarien und Testes, die durch die „Unreife des Hypothalamus“ gewährleistet ist. In diesem Lebensabschnitt verharren die Spermatogonien in den Hoden wie seit der frühen Embryonalphase ohne weitere Teilungen in ihrer Ruhephase. In den Ovarien lassen sich auch in dieser Zeit Follikelreifungen und -rückbildungen (Atresien) nachweisen (Peters et al. 1976), aber nie die Entwicklung eines dominanten Follikels (s. Kap. 4.2.5) oder gar ein Eisprung. Welcher der zahlreichen postulierten Einflussfaktoren letztendlich den Beginn der Pubertät auslöst, ist weitgehend ungeklärt. Neben genetischen Faktoren (Rowe 2002: Zwillingsuntersuchungen; Cambell u. Udry 1995: Menarchealter der Mutter), spielen auch Ernährungsgewohnheiten (Protein-, Fett- und Faseranteil der Nahrung), erkennbar am Körperbau eines Mädchen oder Jungen eine wichtige Rolle. Der Anteil des Körperfetts des Jungen oder Mädchens sollte ca. 15% betragen, da er dann die kritische Größe erreicht, um in den Fettzellen ausreichend das Hormon Leptin zu produzieren. Leptin9 spielt eine auslösende Rolle für den Beginn der sexuellen Reifung, indem es über eine positive Rückkoppelung dem Hypothalamus signalisiert, dass die Körpermasse zur Initiierung der reproduktiven Fähigkeiten des Kindes ausreicht (Clayton u. Trueman 2000). Der Einfluss sozioökonomischer Faktoren auf den Pubertätszeitpunkt wirkt indirekt über den Ernährungsstatus des Mädchens oder Jungen, der durch schwere körperliche Arbeit, mangelnde Qualität und Quantität der Nahrung beeinflusst wird (s. Kap. 4.1.2). Dieser Zusammenhang wurde in Langzeitstudien schlüssig nachgewiesen (Eveleth u. Tanner 1976, DankerWyshak u. Frisch 1982, Loesch et al. 2000, Hwang et al. 2003), in denen gezeigt werden konnte, wie die Menarche der Mädchen im Laufe des letzten Jahrhunderts in unterschiedlichen Kulturen mit zunehmender Verbesserung des Lebensstandards und damit der Ernährung ständig früher stattfand (Abb. 4.11). Besonders deutlich ist dieser Effekt bei Mädchen aus sozioökonomisch schwächeren Schichten, bei denen sich der Ernährungsstatus erheblich mehr verbesserte. Je mehr Proteine und Fette und je weniger Faseranteile die Nahrung 9 Die im Blutserum vorhandene Leptin-Konzentration korreliert beim Menschen direkt mit der Masse des Fettgewebes. Fortpflanzungsbiologie 323 Abb. 4.11. Der säkulare Trend zum früheren Menarchealter in Europa (nach Eveleth u. Tanner, 1976) enthält, desto früher setzt unter ansonsten konstanten Lebensbedingungen die Pubertät ein. Seit einigen Jahren werden soziologische Parameter wie Familiengröße (Apraiz 1999: je kleiner die Zahl der Familienmitglieder, desto früher beginnt die Pubertät) und die An- bzw. Abwesenheit des Vaters als Determinanten des Menarchealters genannt (Draper u. Harpending 1982; Belsky et al. 1991; Comings et al. 2002). Der Zusammenhang zwischen väterlicher An- oder Abwesenheit und der sexuellen Reifung der Tochter wird von Belsky und seinen Mitarbeitern (1991) mit der Stressbelastung des Mädchens erklärt, das früh als Kleinkind vom Vater verlassen wurde und ihre Verunsicherung durch einen frühen Pubertätszeitpunkt, sexuelle Betätigung und eigenen Nachwuchs zu stabilisieren versucht. Comings et al. (2002) suchten nach einer Erklärung dafür, wie dieser Zusammenhang zwischen väterlichem Verhalten und dem der Tochter zustande kommen kann. Sie hatten die Hypothese, dass ein bestimmtes Allel des Androgenrezeptor-Gens auf dem X-Chromosom vom Vater auf die Tochter vererbt wird, von dem relevante Verhaltensmerkmale gesteuert werden könnten. Sie entdeckten in einer Stichprobe von erwachsenen Frauen und Männern einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem AR GGC 16-Repeat Allel des Androgenrezeptor-Gens und verschiedenen Verhaltensmerkmalen wie Aggressivität, Impulsivität und Wutanfällen und übertrugen diese Ergebnisse auf die Vater-Tochter-Beziehung. Beim Vater könnte dieses Allel in Zusammenhang mit seinem ehelichen Konfliktverhalten und dem Verlassen der Familie stehen, bei der Tochter könnte es ebenfalls zu einer geringeren Anpassung an gesellschaftliche Normen, zu Impulsivität und Aggressivität führen sowie zu einer frühen Menarche, die das Ende der Kindheit signalisiert. 324 Lebenszyklus Fast alle der eingangs erwähnten Faktoren wurden in Bezug auf den Pubertätszeitbeginn bei Jungen nicht untersucht, da das Äquivalent zur Menarche, die Ejakularche (der erste, spontane Samenerguss) kaum erfragt wurde und wird10. Im klinischen Bereich bei Jungen mit einer Pubertas tarda (Entwicklungsverzögerung) wurde jedoch als Erklärung auch ein humanbiologisch relevanter Parameter wie der Ernährungsstatus als Ursache für den verspäteten Pubertätsbeginn bei Jungen nach dem 14. Lebensjahr gefunden. Es gibt auch einen interessanten Beleg für die historische Vorverlegung des Pubertätsbeginns bei Jungen in den letzten 200 Jahren, der sich auf ein rein männliches Pubertätsgeschehen bezieht, den Stimmbruch. Von 1727 bis 1749 wurde der Stimmbruch von Chorknaben des Leipziger Thomaschors durchschnittlich mit 16 Jahren angegeben. Heute verlieren Jungen durchschnittlich bereits im Alter von 13½ Jahren ihre Sopranstimmlage. Hormonelle Steuerung der Pubertät Die Veränderungen der sekundären Geschlechtsmerkmale während der Pubertät werden durch die Sexualhormonausschüttung der Nebennierenrinde und der reifenden Gonaden veranlasst. Die endokrinologischen Veränderungen beginnen mit der zunehmenden Aktivität der Nebennierenrinde (NNR). Die Adrenarche ist durch kontinuierliche, wenn auch zunächst nur langsam ansteigende Serumspiegel der adrenalen Androgene Androstenedion, Dehydroepiandrosteron (DHEA) und seines Sulfats DHEAS gekennzeichnet. Sie beginnt bei Mädchen zwischen dem 6. und 8. Lebensjahr (Bing et al. 1988), bei Jungen durchschnittlich 2 Jahre später (Yanowski u. Cutler 1996). Aufgrund der Stimulation durch die adrenalen Androgene findet der „mid-growth-spurt“ statt (s. Kap. 4.1.1). Er liefert einen Beleg für die Beteiligung adrenaler Androgene (neben Östrogen bei den Mädchen und Testosteron bei den Jungen) an der Skelettreifung des Kindes. Der kontinuierliche Anstieg der DHEA- und DHEAS-Spiegel dauert ungefähr bis zum 15. Lebensjahr, dann sind die durchschnittlichen Serumwerte von Erwachsenen erreicht. Die wichtigste Zielwirkung des DHEA(-S) besteht in der Stimulation der Pubes- und Axillarbehaarung, das erste sichtbare Zeichen der Pubertät. Zusammen mit den Androgenen aus den Ovarien bzw. Testes lösen die Nebennierenrindenandrogene bei Mädchen und Jungen die Pubarche aus, bei Mädchen (Tabelle 4.9) im Durchschnitt ein halbes Jahr früher als bei Jungen (Tabelle 4.10). Die Adrenarche geht stets der Gonadarche (Reifung der Eierstöcke und Hoden) voraus, dennoch werden beide unabhängig voneinander initiiert. Die Adrenarche findet auch bei Individuen ohne funktionierende Gonaden (z. B. XY-Frauen mit Turner-Syndrom) statt, und auch eine vorzeitige Adrenarche 10 Während es früher vermutlich als Tabuthema galt, lässt sich der Zeitpunkt der Ejakularche heute kaum mehr feststellen. Der erste Samenerguss erfolgt aufgrund der freieren Einstellung zu Masturbation im pubertären Alter in der Regel nicht mehr spontan. Fortpflanzungsbiologie 325 Tabelle 4.9. Pubertätsphasen bei Mädchen Altersmittel in Jahren; Monaten Ereignis Altersspanne in Jahren; Monaten 8;0 9;0 Hüftschweifung Adrenarche: DHEA/DHEAS Ausschüttung der Nebennierenrinde (NNR) steigt an Telarche: Beginn der ovariellen Östrogenausschüttung Pubarche: Anstieg der Androgene aus Ovar und NNR: Sexual- und Achselbehaarung beginnt Puberaler Wachstumsschub: maximale Konzentration des IGF-1 (Insulinlike Growth Factor I) Menarche: erste Monatsblutung durch Funktionsaufnahme der Ovarien Brustentwicklung abgeschlossen Schambehaarung voll entwickelt; Duftdrüsen am Genitale, Achsel, Nase, Augenlidern, Ohren und Brustwarzen voll funktionsfähig 7;0–9;0 8;0–10;0 11;2 11; 7 12;1 13;5 14;4 15;3 9;0–13;6 9;5–14;2 10;5–14;0 11;6–15;6 12;3–16;6 11;8–18,8 Tabelle 4.10. Pubertätsphasen bei Jungen Altersmittel in Jahren; Monaten Ereignis Altersspanne in Jahren; Monaten 9;5 11;2 Adrenarche: DHEA/DHEAS-Ausschüttung Beginn der Genitalentwicklung: Wachstum von Hoden, Fältelung des Skrotums und Längenwachstum des Penis Pubertätsbeginn: mindestens 1 Hoden >3ml Pubarche: Anstieg der Androgene aus Hoden und der NNR; Beginn der Sexualund Achselbehaarung Beginn des Peniswachstums im Umfang Stimmbruch Puberaler Wachstumsschub (max.IGF-1-Konzentration) Ejakularche: erste spontane Ejakulation Penisentwicklung abgeschlossen Schambehaarung voll entwickelt Hodenentwicklung abgeschlossen, Duftdrüsen am Genitale, Achsel, Gesichts- und Kopfregion voll funktionsfähig 8;2–10;3 8;2–14;2 11;8 12;4 12;10 13;5 14;0 14;6 (?) 14;9 14;10 15;3 10;0–13;10 9;3–15;4 10;5–15;5 12;2–17;0 12;4–15;8 12;6–16;0 (?) 12;9–16;10 12;0–16;11 13;0–17;10 326 Lebenszyklus Box 4.4 Hormonelle Steuerung der Pubertät: Definitionen n Gonadotropin-Releasing Hormon (GnRH): ein Peptidhormon, das vor allem im Nucleus arcuatus aber auch von Neuronen in weiteren Arealen des Hypothalamus synthetisiert und ausgeschüttet wird. GnRH ist ein Neurotransmitter und stimuliert die Synthese und Freisetzung der Gonadotropine LH und FSH aus dem Hypophysenvorderlappen n GnRH-Pulsgenerator: neurale Struktur (vermutlich) im Hypothalamus, welche die pulsatile Ausschüttung von GnRH steuert n Luteinisierendes Hormon (LH): ein Gonadotropin (Glycoprotein) zur Steuerung der Ausschüttung von Sexualhormonen in den Zielzellen der Gonaden. Frauen: Östradiol aus den Granulosa-Zellen des Follikels im Ovar Männer: Testosteron aus den Leydig-Zellen des Hodens n Follikel-stimulierendes Hormon (FSH): steuert das Wachstum der Follikel im Ovar der Frau und die Spermatogenese in den Sertoli-Zellen im Hoden des Mannes n Progesteron: Sexualhormon der Frau, hauptsächlich gebildet durch das Corpus luteum im Ovar und von den heranwachsenden Follikeln während des LH/FSH-Anstiegs vor dem Eisprung n Östradiol: wichtigstes Sexualhormon der Frau, gebildet von den reifenden Follikeln im Ovar,wird auch vom Corpus luteum ausgeschüttet n Androgene: Oberbegriff für Steroidhormone, die bei Männern und Frauen die sexuelle Differenzierung von Körper und Verhalten in männliche Richtung bewirken: Testosteron, 5α-Dihydrotestosteron, Dehydroepiandrosteron und Dehydroepiandrosteron-Sulfat n Testosteron: wichtigstes Sexualhormon des Mannes, gebildet in den Leydig-Zellen des Hodens n 5 -Dihydrotestosteron: durch 5α-Reduktase von Testosteron entstandenes Sexualhormon des Mannes n Dehydroepiandrosteron DHEA und sein Sulfat DHEAS: adrenale Androgene gebildet in der Nebennierenrinde bei Frauen und Männern n IGF-1: Insulin-like Growth Factor ist ein insulinähnlicher Wachstumsfaktor, in der Leber unter Einfluss von Wachstumshormonen aus der Hypophyse gebildet Fortpflanzungsbiologie 327 Box 4.4 (Fortsetzung) n positive Rückkoppelung (Feedback): Kommunikation zwischen Ovar bzw. Testis und Hypophyse/Hypothalamus, welche die LH- und FSH-Ausschüttung steigert n negative Rückkoppelung(Feedback): Kommunikation zwischen Ovar (Testis) und Hypophyse/Hypothalamus, welche die LH und FSH-Ausschüttung bremst. führt normalerweise nicht zu einer vorgezogenen Gonadarche (Yanowski u. Cutler 1996). Die Gonadarche hängt von der Reifung des Hypothalamus-Hypophysen-Systems ab (Box 4.4). Es beginnt mit der Aktivierung des GnRH-Pulsgenerators, der die Ausschüttung des Gonadotropin-Releasing Hormons (GnRH) aus dem Hypothalamus steigert und damit die zunehmende Hormonproduktion im Regelkreis der nachfolgenden endokrinen Organe (Hypophyse, Ovarien bzw. Testes) auslöst. Zunächst erfolgt die pulsatile GnRH-Ausschüttung aus dem Hypothalamus nur nachts, führt konsekutiv in der Hypophyse zur Ausschüttung des Luteinisierenden Hormons (LH) und des Follikel-stimulierenden Hormons (FSH) und löst damit die Pubertätsentwicklung aus. LH bewirkt die langsam einsetzende Produktion von Testosteron in den Leydig-Zellen der Hoden, und durch die stimulierende Wirkung von FSH auf die Follikelreifung in den Eierstöcken beginnt die Östrogensynthese. Anfangs wird der GnRH-Pulsgenerator nur durch die Aktivität des ZNS gesteuert, die Ovarien und Hoden sind noch unbeteiligt,da sich der positive bzw.negative Rückkoppelungsmechanismus des Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Systems erst gegen Ende der Pubertät voll ausgebildet hat. Spätestens dann zeigt die deutliche pulsatile Ausschüttung von LH die Reifung des Systems an. Testosteron und Östradiol bewirken bei ausreichender Sekretion der Gonaden die typischen körperlichen Veränderungen in der Pubertät, die in einem festgelegten Ablauf entsprechend der endokrinen Reifung erfolgen (Tabelle 4.9; 4.10). Die Dauer der einzelnen Pubertätsphasen weist jedoch innerhalb und zwischen den Geschlechtern eine große Varianz auf, so dass die volle geschlechtliche Reife bei einigen Jungen erst mit 19 Jahren erreicht wird (Willers et al. 1996), während Mädchen in Ausnahmefällen bereits im 13. Lebensjahr die Pubertät abgeschlossen haben können (Marshall u. Tanner 1969). Die Telarche, die beginnende ovarielle Östrogenproduktion, wird zunächst an der Brustentwicklung mit Knospung des Brustdrüsenkörpers bei den Mädchen sichtbar. Auch bei knapp der Hälfte der pubertierenden Jungen kommt es ebenfalls zu einer leichten Entfaltung des Brustdrüsenkörpers nach Beginn der testikulären Androgenproduktion. Sie kann bei ihnen gelegentlich auch von einer Brustwarzenschwellung bis hin zu einer Pubertätsgynäkomastie (Vergrö- 328 Lebenszyklus Tabelle 4.11. Ovulationsfähigkeit der heranreifenden Ovarien (Alter in Jahren) Anovulation Gelbkörperschwäche Normaler Zyklus 12–14a 15–17a 18–20a 60% 30% 10% 43% 40% 17% 27% 37% 36% ßerung des männlichen Brustdrüsengewebes) begleitet werden, die sich aber fast immer spontan zurückbildet. Östrogene und Testosteron bewirken auf hypophysärer Ebene einen Wachstumsschub, weil sie dort eine verstärkte Freisetzung von Wachstumshormonen auslösen und abhängig davon eine vermehrte Ausschüttung von IGF-1 (Insulin-like Growth Factor) aus der Leber. Dieser insulinähnliche Wachstumsfaktor erreicht während des puberalen Wachstumsschubs seine maximale Konzentration, und es kann zu einer Körperlängenzunahme von bis zu 10 cm pro Jahr kommen. Der weiter steigende Sexualhormonspiegel wirkt dann auch direkt an den Knorpelwachstumszonen, so dass es schließlich zum Schluss der Epiphysenfugen und damit letztendlich zum Abschluss des Längenwachstums kommt. Gut ein Jahr nach dem puberalen Wachstumsschub erfolgt bei Jungen die Ejakularche und bei Mädchen die erste Regelblutung, die Menarche. In der Regel findet die Menarche ohne vorangegangenen Eisprung statt, erst im weiteren Verlauf der Pubertät entwickeln sich Zyklen mit Ovulation und nachfolgender Bildung des Corpus luteum (Gelbkörper). Selbst Frauen im Alter von 18 bis 20 Jahren haben erst in 36% der Fälle einen normalen Zyklus mit Eisprung und anschließender Progesteronausschüttung aus dem Gelbkörper (Tabelle 4.11). Nur so ist es möglich, dass sich eine befruchtete Eizelle in der Gebärmutterschleimhaut einnisten kann, da das Endometrium ausreichend durch Progesteron aufgebaut wurde und dadurch eine erfolgreiche Schwangerschaft gewährleistet ist. Der Abschluss der Pubertät findet individuell und geschlechtsspezifisch unterschiedlich zwischen 12 und 19 Jahren statt. Er ist durch allmähliche Ausreifung der Genitalien, der Behaarung und der Duftdrüsen in der Genitalregion, Achselhöhle, an den Brustwarzen und am Kopf gekennzeichnet. Dort werden Pheromone (Sexuallockstoffe) produziert, die zur chemischen Kommunikation zwischen Individuen und letztendlich der Fortpflanzung dienen sollen. Als Störungen der Pubertätsentwicklung werden sexuelle Reifungsvorgänge bezeichnet, die deutlich früher oder später als der ohnehin zeitlich sehr variable normale Pubertätsbeginn einsetzen (Yanowski u. Cutler 1996). Man spricht von Pubertas praecox bei vorzeitiger sexueller Reifung mit der Entwicklung äußerer Sexualmerkmale vor dem 8. Lebensjahr, in Extremfällen bei Mädchen und Jungen sogar bereits im Alter von 4 Jahren. Die häufigste Form der Pubertas praecox wird durch eine vorzeitige Reifung des Hypothalamus mit pulsatiler GnRH-Freisetzung ausgelöst, die ohne erkennbare Ursache erfolgt und die deshalb als idiopathische, hypothalamische Pubertas praecox bezeichnet wird. Sehr selten hingegen kann eine organisch bedingte Pubertas Fortpflanzungsbiologie 329 praecox auftreten, die durch hirnorganische Veränderungen (Hirntumor) oder durch einen Nebennierenrinden- oder Eierstocktumor mit autonomer Östrogenausschüttung (Mädchen) bzw. bei Jungen durch eine LH-unabhängige Aktivität der Leydig-Zellen in den Hoden (Mutation des LH-Rezeptors) verursacht werden kann (Themmen et al. 1998). Eine Pubertas tarda oder sexueller Infantilismus wird diagnostiziert, wenn sich bei Mädchen bis zum 14. Lebensjahr noch keine Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale zeigt und bis zum 16. Lebensjahr die Menarche noch nicht eingetreten ist. Bei Jungen wird von verspäteter Pubertät gesprochen, wenn nach dem 14. Lebensjahr die Hoden kleiner als 4 mL sind oder nach dem 15. Lebensjahr noch keine Schambehaarung erkennbar ist. Die bei weitem häufigste Ursache für eine Pubertas tarda ist bei beiden Geschlechtern die konstitutionelle Entwicklungsverzögerung, die ein Ausdruck der individuellen Schwankungen der Hypothalamusreifung ist. Bei Tumoren im Hypothalamus-Hypophysenbereich oder bei magersüchtigen Jugendlichen kann als Folge ein LH- und FSH-Mangel eintreten, der ebenfalls den Pubertätsbeginn verzögert bzw. verhindert. Als weitere klinische Ursachen für eine Pubertas tarda sind chromosomale Störungen zu nennen, die zu einer Insuffizienz der Eierstöcke bzw. Hoden oder sogar zu einer Gonadendysgenesie führen können (s. Kap. 4.2.1). 4.2.3 Sexualhormone und Sexualverhalten Die vorgeburtliche sexuelle Differenzierung und die Reifungsvorgänge in der Pubertät sind unerlässliche Voraussetzungen für die Fekundität eines Menschen. Um auch fertil zu sein, sind weitere Faktoren von entscheidender Bedeutung (Abb. 4.12). Es müssen Sexualpartner vorhanden und zu einer sexuellen Partnerschaft bereit sein, es muss Geschlechtsverkehr mit einer Ejakulation stattfinden und zwar zum Zeitpunkt der Ovulation bei der Frau. Die Funktionstüchtigkeit der Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse ist für die biologischen Vorgänge der Spermatogenese beim Mann und der Eireifung bis zur Ovulation bei der Frau unerlässlich, da sie durch die Botenstoffe aus dem Hypothalamus und der Hypophyse sowie durch die Sexualhormone Testosteron, Östradiol und Progesteron aus den Hoden bzw. Eierstöcken gesteuert werden (Box 4.4). Die Wirkungen von Testosteron, Östradiol und Progesteron gehen über diese rein biologischen Prozesse hinaus, denn für das sexuelle Interesse und das sexuelle Verhalten eines Menschen sind die Sexualhormone aus den Gonaden ebenfalls von Bedeutung. Sie beeinflussen die sexuelle Lust und das Sexualverhalten eines Mannes oder einer Frau. Damit bestimmen sie indirekt die Häufigkeit sexueller Betätigungen und den Zeitpunkt des Geschlechtsverkehrs mit, da beide Verhaltensweisen durch das Ausmaß der Libido (Sexualtrieb) eines Menschen gesteuert werden, obwohl seelische, soziale und kulturelle Faktoren ebenfalls von entscheidender Bedeutung sind. Die komplexen Steuerungsfaktoren des Sexualhormonspiegels und vor allem des menschlichen Verhaltens sorgen jedoch dafür, dass „…ein Hormon oder eine Kombination 330 Lebenszyklus Abb. 4.12. Fekundität und Fertilität: soziale Parameter und Sexualhormone von Hormonen die Wahrscheinlichkeit erhöhen kann, dass ein bestimmtes Verhaltensmuster auftritt, aber Hormone nicht selber Verhalten auslösen können.“ (Beach 1977). Hormonelle Steuerung des Sexualverhaltens von Frauen Der Menstruationszyklus galt lange als eine wesentliche Informationsquelle für die Wirkung von Gonadenhormonen auf das Sexualverhalten von Frauen. Ergebnisse über die Verteilung der sexuellen Aktivität und sexuellen Verlangens im Menstruationszyklus der Frau sind widersprüchlich. Die Mehrzahl der Befunde stützt nicht die Annahme, dass die sexuelle Lust und Aktivität in der Zyklusmitte zur Zeit des Eisprungs am größten ist, was biologisch sinnvoll wäre. In einer Überblicksarbeit von Sanders et al. (1983) wurden insgesamt 32 Studien zusammengefasst. In acht Untersuchungen wurde von einem Anstieg sexueller Aktivitäten um den Zeitpunkt der Ovulation herum berichtet, in vier Fällen lag der Gipfel sexueller Aktivität während der Menstruation, in 18 Studien war dieser Anstieg nach der Menstruation und in 17 dieser Untersuchungen während der prämenstruellen Phase. Abgesehen von der Möglichkeit, dass Frauen in dieser Hinsicht eben unterschiedlich sind, kann man einige methodische Unzulänglichkeiten für die widersprüchlichen Ergebnisse verantwortlich machen, z. B. die verschiedenen Methoden der Identifikation von Zyklusphasen und der Verzicht auf Hormonmessungen zur exakten Identifikation des Zykluszeitpunktes. Auch wurde in kaum einer Studie zwischen dem spontanen sexuellen Verlangen einer Frau und der sexuellen Aktivität unterschieden, die von ihrem Partner initiiert wurde. Adams und Mitarbeiter (1978) berücksichtigten diesen Fortpflanzungsbiologie 331 Box 4.5 Forschungsgeschichte der endokrinologischen Steuerung von Sexualität Die ersten Forschungen über eine endokrinologische Steuerung des Sexualverhaltens wurden 1849 von dem Göttinger Physiologen A. Berthold unter dem Titel „Transplantation der Hoden“ publiziert. Berthold hatte sechs junge Hähne kastriert und reimplantierte vier von ihnen jeweils einen Hoden des Artgenossen in den Bauchraum, wo dieser eine neue Blutversorgung ausbildete und überlebte. Berthold beschreibt ihr Verhalten: „Diese 4 Hähne verrieten in ihrem allgemeinen Benehmen die Natur uncastrirter Tiere; sie kräheten ganz gehörig, waren häufig untereinander und mit anderen jungen Hähnen im Kampf verwickelt, und sie äußerten die gewöhnlich Neigung zu Hühnern; auch entwickelten sich ihre Kämme und Halslappen wie bei gewöhnlichen Hähnen.“ Über die zwei Hähne ohne implantierte Testes berichtete er, dass sie echte Kapaune wurden. Es war der erste experimentelle Nachweis für eine endokrine Funktion der Hoden und damit auch der Beginn der Endokrinologie als wissenschaftlicher Disziplin. Berthold erklärte die Wirkungen der implantierten Hoden damit, dass bestimmte Substanzen (den Begriff Hormon gab es noch nicht) von den Hoden gebildet und über das Blut ins Gehirn transportiert werden, wo sie ihre Wirkung auf Verhalten ausüben würden. Zwar war der Einfluss von Kastration der Hoden auf das Verhalten bei Menschen und Tieren bereits lange vorher bekannt, doch beim Menschen ist die Variabilität der Verhaltensantworten beim Verlust der Hoden groß. Es gibt eine Vielzahl von Kastrationsstudien seit der Antike, die zeigen, dass der Verlust der Gonaden die Sexualität eines Mannes zwar auf einer rein biologischen Basis beeinträchtigt, emotionale Faktoren das Ausmaß seiner Sexualfunktionen dennoch stärker bestimmen. Kastration vor Einsetzen der Pubertät soll zu schwerwiegenden Störungen des Sexuallebens führen,wenn nicht,wie heute üblich, eine Hormonsubstitution durchgeführt wird. Zwischen 1920 und 1950 berichteten etliche Forscher über derartige Fälle von frühzeitiger Kastration, die mit einem Totalverlust an Libido und sexueller Funktionsfähigkeit endeten.Bei einer Kastration nach Erreichen der vollen sexuellen Reife ist es schwer vorherzusagen, wie sich das Sexualleben eines kastrierten Mannes entwickeln wird.Unser Wissen beruht nur auf den subjektiven Schilderungen der Betroffenen. Ganz generell lässt sich auf Grund dieser Einzelfallstudien sagen, dass eine graduelle Abnahme der sexuellen Potenz eintreten wird, aber durchaus nicht sofort nach dem Hodenverlust,sondern in Einzelfällen erst bis zu 30 Jahre danach, was dann vielleicht schon als natürlicher Alterungsprozess zu werten ist. Die verbleibende sexuelle Reaktionsfähigkeit wird mögli 332 Lebenszyklus Box 4.5 (Fortsetzung) cherweise durch die Androgene aus der Nebennierenrinde mitbedingt. Der heutige Wissensstand in der endokrinologischen Forschung erlaubt es, über den Extremfall der Kastration hinaus die Wirkungsweise von Sexualhormonen bei gesunden Frauen und Männern zu untersuchen, deren Funktionsfähigkeit der Gonaden voll erhalten geblieben ist.Seit ungefähr 30 Jahren kann man aus minimalen Blut- oder Speichelproben die Konzentration der Sexualhormone spezifisch und exakt bestimmen, so dass die beobachtbare Variabilität im Sexualverhalten zu individuellen Sexualhormonwerten in Bezug gesetzt kann. Seit Ende der siebziger Jahre ist belegt, dass Sexualhormone tatsächlich elektrische und biochemische Charakteristika der Nervenzellen verändern können, wenn sie an spezifische Rezeptoren gebunden und in den Kern der jeweiligen Nervenzelle transportiert werden. Dadurch beeinflussen sie die Produktion von Enzymen und anderen Proteinen, welche die hormonelle Wirkung repräsentieren. So können sie mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung die Auftretenswahrscheinlichkeit eines bestimmten Verhaltens beeinflussen (Christiansen 2004). Unterschied und fanden heraus, dass die von der Frau initiierte sexuelle Aktivität gehäuft in der Zyklusmitte zum Zeitpunkt des Eisprungs auftreten würde. Die Stichprobe dieser Studie war allerdings sehr klein und bei diesem Untersuchungsansatz blieb offen, welches Sexualhormon für die zyklusabhängige sexuelle Aktivität entscheidend war.Da der Testosteronspiegel um den Zeitpunkt des Eisprungs am höchsten ist, wenn die Östradiolausschüttung kurz vor dem Eisprung Spitzenwerte erreicht (Ferin 1996), konnte allein mit der Erfassung des Zykluszeitpunktes nicht geklärt werden, welches Sexualhormon das Verteilungsmuster sexueller Aktivität bei Frauen bedingt. In mehreren sorgfältig kontrollierten Studien wurde deshalb der körpereigene Sexualhormonspiegel der Frauen gemessen und mit verschiedenen Aspekten des sexuellen Verhaltens in Beziehung gesetzt. Es zeigen sich keine Hinweise für Auswirkungen des endogenen Östrogenspiegels auf Veränderungen des sexuellen Verlangens und Erlebens, obwohl minimale Östrogenmengen nötig sind, um normale sexuelle Reaktionen zu gewährleisten. Es gibt aber eine deutliche, testosteronabhängige Steigerung der Libido (sexuelle Lust) und des Sexualverhaltens (Überblick in Christiansen 2004). Der körpereigene Testosteronspiegel korreliert positiv mit sexuellem Interesse, dem Ausmaß der sexuellen Initiative, Erregung und Befriedigung. Auch die Stärke der Reaktion auf erotische Reize, die Koitus- und Masturbationshäufigkeit, Zahl der Sexualpartner und Häufigkeit von Sex ohne feste Bindung scheinen bei den untersuchten Frauen testosteronbedingt zu sein (Tabelle 4.12). Fortpflanzungsbiologie 333 Tabelle 4.12. Sexualhormone und Sexualverhalten bei Frauen: die Bedeutung des endogenen Testosteronspiegels sowie einer Testosteron- oder Östrogensubstitution – signifikant positive Korrelationen (nach Christiansen 2004) endogener Testosteronspiegel Testosteronsubstitution Östrogensubstitution sexuelle Erregung sexuelles Interesse Orgasmushäufigkeit Reaktion auf erotische Reize Koitushäufigkeit Masturbationshäufigkeit sexuelle Initiative der Frau Zahl der Sexualpartner Sex ohne feste Bindung Zufriedenheit mit Sex – – – sexuelle Erregung sexuelles Interesse Orgasmushäufigkeit Reaktion auf erotische Reize – – – – – Zufriedenheit mit Sex sexuelle Phantasien sexuelle Befriedigung sexuelle Attraktivität des Mannes sexuelle Erregung sexuelles Interesse Orgasmushäufigkeit – – – – – – – – – – Aussagekräftiger als die Messungen des körpereigenen Sexualhormonspiegels sind klinische Studien mit Frauen, die nach der operativen Entfernung ihrer Eierstöcke (Ovarektomie) mit Sexualhormonen substituiert werden müssen, um bei ihnen vor allem eine ausreichende Versorgung mit Östrogenen zu gewährleisten. Hier wurde deutlich, dass eine physiologische Östrogensubstitution z.B.für die Knochensubstanz,Haut und psychische Befindlichkeit wichtig ist, aber eben auch für die Sexualität. Die behandelten Patientinnen berichteten über eine Steigerung ihrer Libido, sexuellen Erregung und Interesses sowie der Orgasmushäufigkeit, sobald die Östrogenbehandlung nach der Operation einsetzte (Tabelle 4.12). Bezüglich vieler Aspekte des Sexualverhaltens erwiesen sich Testosterongaben ebenfalls als positiv, die zum Ausgleich der fehlenden körpereigenen ovariellen Testosteronproduktion gegeben wurden. (Dennerstein 1980, Sherwin u. Gelfand 1987, Sherwin 1991, Shifren et al. 2000, Sherwin 2002). Wurde den ovarektomierten Frauen zusätzlich das Gelbkörperhormon Progesteron verabreicht, das im normalen weiblichen Zyklus nach dem Eisprung gebildet wird, wirkte es sich hemmend auf das sexuelle Erleben aus. Diese Wirkung dürfte indirekt sein, da Progesteron in den Zielzellen die Umwandlung von Testosteron zu 5α-Dihydrotestosteron negativ beeinflusst und damit die Wirkung von Testosteron auf das Sexualverhalten einschränkt bzw. unterdrückt (Dennerstein et al. 1980, Sherwin 1991). Der Progesteronanstieg dient zum Aufbau der Gebärmutterschleimhaut nach dem Eisprung, damit die Einnistung und Versorgung des Embryos optimal gewährleistet ist (s. Kap. 4.2.5). Man könnte spekulieren, ob die negative Wirkung von Progesteron auf die Libido der Frau vielleicht auch zum Schutz des Embryos vor äußeren Einflüssen durch Sexualkontakte in der kritischen Phase der Nidation dient. 334 Lebenszyklus Hormonelle Steuerung des Sexualverhaltens von Männern Die Bedeutung des Testosterons für die männliche Sexualität ist unumstritten, obwohl seelische, körperliche, soziale und kulturelle Faktoren ebenso eine wichtige Rolle spielen. Augenfällig sind in der Pubertät bei jungen Männern zunehmendes sexuelles Interesse und Aktivität, die mit einem ansteigenden Testosteronspiegel assoziiert sind. Ebenso gehen nachlassendes sexuelles Interesse und Potenz älterer Männer mit absinkenden Testosteronwerten einher (s. Kap. 4.2.8). Testosteronwerte im Blut von 3–12 ng/mL gelten als Normbereich, in dem die sexuelle Funktionstüchtigkeit eines Mannes aus endokrinologischer Sicht gewährleistet ist. Erst unterhalb von 3ng/mL sind sexuelle Funktionsstörungen zu beobachten (Nieschlag 1979), allerdings sind sie individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt deshalb keinen absoluten Grenzwert, bei dem testosterongesteuertes sexuelles Verhalten bei einem Mann gänzlich unmöglich ist. Es kann ein relativ normales Muster körperlicher sexueller Reaktionen – mit Ausnahme der Ejakulation – auch ohne normalen Androgenspiegel bestehen bleiben. Der Unterschied zwischen hypogonadalen und eugonadalen Männern dürfte hauptsächlich in der Motivation liegen, aktiv sexuelle Stimulation zu suchen und in der damit verbundenen Libido. Selbst eine Kastration führt nicht unweigerlich dazu, dass ein Mann keine Erektionen und keinen Geschlechtsverkehr mehr haben kann (Box 4.5). Eindeutige Belege für die Rolle des Testosterons als wichtigster biologischer Faktor für die Ausbildung und Aufrechterhaltung männlichen Sexualverhaltens liefern vor allem klinische Studien, die zumeist an Männern mit Hodenunterfunktion (Hypogonadismus) und einem dadurch deutlich erniedrigten Testosteronspiegel durchgeführt wurden. Die Ergebnisse zeigen eindeutig (Tabelle 4.13), dass sich bei diesen Patienten die Substitution mit Testosteron auf die Frequenz fast aller sexuellen Verhaltensmerkmale bis auf die Orgasmushäufigkeit positiv auswirken kann (Literaturüberblick in Christiansen 2004). Bei eugonadalen Männern mit Testosteronwerten im Normbereich ließ sich hingegen eine Steigerung des Sexualverhaltens durch zusätzliche Testosteronsubstitution nur schwer nachweisen. Es konnte zwar eine Steigerung des sexuellen Interesses bei Männern erreicht werden, die wegen einer sexuellen Störung in Behandlung waren. Eine weitergehende Wirkung, etwa eine Zunahme der sexuellen Kontakte mit der Partnerin, konnte nicht erzielt werden. Selbst supraphysiologische Testosterongaben zur Erprobung der Kontrazeption beim Mann steigerten lediglich das sexuelle Interesse und die Erregbarkeit der Männer, nicht aber ihr sexuelles Verhalten wie Masturbation, morgendliche Erektionen und Geschlechtsverkehr (Anderson et al. 1992, Bagatell et al. 1994). Es ist allerdings zu bedenken, dass es nicht eindeutig nachgewiesen ist, ob eine künstliche Erhöhung des Testosteronspiegels bei eugonadalen Männern nicht doch eine Wirkung auf die verschiedenen Parameter des Sexualverhaltens ausüben würde – wenn sich der Testosteronspiegel durch Hormongaben beliebig erhöhen ließe. Mit steigendem Testosteronspiegel wird es nämlich immer schwieriger, den endogenen Androgenspiegel zu beeinflussen, da die starken homöostatischen Mechanismen dazu führen, dass bei zuneh- Fortpflanzungsbiologie 335 Tabelle 4.13. Testosteron und Sexualverhalten bei Männern: positive Wirkungen des endogenen Testosteronspiegels und der Testosteronsubstitution (nach Christiansen 2004) endogener Testosteronspiegel Testosteronsubstitution sexuelles Interesse und Phantasien – spontane Erektion (nachts, morgens) Ejakulationshäufigkeit sexuelle Aktivitäten mit Partnerin/Partner Orgasmushäufigkeit Koitushäufigkeit (Masturbation oder Geschlechtsverkehr) sexuelles Interesse und Phantasien sexuelle Erregung spontane Erektion (nachts, morgens) Ejakulationshäufigkeit sexuelle Aktivitäten mit Partnerin/Partner Orgasmushäufigkeit – menden Testosterongaben entweder die endogene Testosteronproduktion gebremst oder die Abbaurate des Testosterons erhöht wird. So stellten Benkert et al. (1979) fest, dass bei eugonadalen Männern mit geringer oder fehlender Erektionsfähigkeit der Testosteronspiegel nach Hormoninjektionen nicht anstieg und diese damit therapeutisch wirkungslos bleiben mussten. Obwohl für eine normale männliche Sexualität eine wesentlich geringere Menge als die im Normalfall verfügbare Androgenkonzentration nötig ist, zeigt sich auch im Bereich normaler Testosteronwerte, dass das Sexualverhalten mit der absoluten Höhe des Androgenspiegels variiert. In einer schwedischen epidemiologischen Untersuchung (Nilsson et al. 1995) an fast 500 Männern gleichen Alters hing ein geringes sexuelles Interesse mit einem ebenfalls niedrigen freien11 Testosteronspiegel zusammen. In einer weiteren Studie an gesunden jungen Männern ohne Androgendefizit oder Sexualstörungen korrelierte die Testosteronkonzentration im Blut signifikant positiv mit der Orgasmushäufigkeit in einem Zeitraum von 48 Stunden nach der Blutentnahme (Knußmann et al. 1986). Dieses Ergebnis galt für die Gesamtstichprobe, während bei den intraindividuellen Korrelationen (jeweils sechs Hormonwerte und Verhaltensmaße pro Person) zwar überwiegend ebenfalls ein positiver Zusammenhang bestand, aber bei einzelnen Männern auch ein signifikant negativer Zusammenhang zwischen Testosteronwert und nachfolgender sexueller Aktivität oder keine Korrelation bestanden. Das könnte die uneinheitlichen Ergebnisse etlicher anderer Studien erklären, die ebenfalls positive, negative oder überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Testosteronwert und Koitushäufigkeit bei eugonadalen Männern aufzeigen. Einfluss von Sexualverhalten auf den Testosteronspiegel Nicht nur Hormone beeinflussen Verhalten, sondern sexuelles Verhalten und Erleben kann ebenso deutlich den Testosteronspiegel verändern (Literaturhinweise in Christiansen 2004). Als erstes erschien zu diesem Aspekt in der Zeit11 bioverfügbares Testosteron, das im Blutserum nicht an das Trägereiweiß SHBG (Sexualhormon bindendes Globulin) gebunden ist 336 Lebenszyklus schrift Science (Anonymous 1970) eine viel zitierte Arbeit eines ungenannten Wissenschaftlers, der berichtete, dass vor der Rückkehr von einer einsamen Insel bereits intensive Gedanken an den sexuellen Kontakt mit seiner Partnerin zur Erhöhung seines Androgenspiegels führten. Er schloss das aus seinem vermehrten Bartwuchs an diesen Tagen, der vom Androgen Dihydrotestosteron gesteuert wird. Nach dieser Arbeit erschien eine Reihe von weiteren Studien, in denen verschiedene Parameter sexuellen Erlebens wie sexuelle Anregung, Erregung, Masturbation und Koitus mit und ohne Orgasmus untersucht wurden. Generell ließ sich zeigen, dass jede Form sexueller Betätigung den Sexualhormonspiegel von Männern messbar beeinflussen kann, auch wenn psychische Faktoren diesen Zusammenhang erheblich modifizieren können. Fast alle Untersuchungen fanden an Männern statt, bei denen sich Veränderungen des Testosteronspiegels nach einem Orgasmus und Ejakulation vielfach nachweisen ließen, sich aber als besonders anfällig für psychische Begleitprozesse zeigten. Dies führte je nach emotionaler Beteiligung eines untersuchten Mannes zu unterschiedlichen Resultaten, die es nicht erlauben, generell die hormonelle Reaktion auf Koitus und Masturbation für eine Untersuchungsstichprobe oder einen bestimmten Mann vorherzusagen, da auch noch intraindividuell kognitive und emotionale Faktoren von Mal zu Mal einen anderen Einfluss ausüben können. Messbare Reaktionen der Hypophysen-Gonaden-Achse auf sexuelle Erlebnisse treten bei Männern auch nach sexueller Aktivität ohne Orgasmus (Petting) und nach sexueller Anregung ohne sexuelle Handlungen auf, wie z. B. durch attraktive Frauen und Männer, erotische Fotos und Sexfilme (Überblick in Christiansen 2004). Dass bereits sexuelle Anregungen zu einer Erhöhung des Testosteronspiegels führen, ist biologisch durchaus sinnvoll, um den männlichen Organismus auf einen Koitus vorzubereiten. Die hormonelle Reaktion kann erstaunlich schnell bereits nach 10 bis 15 Minuten erotischer Stimulation durch einen Sexfilm auftreten (Hellhammer et al. 1985), vermutlich aufgrund einer erhöhten arteriellen Durchblutung der Hoden und zwar unabhängig von einer verstärkten LH-Ausschüttung der Hypophyse (Box 4.5). Lediglich eine Untersuchung beschäftigte sich mit der Wirkung von sexuellem Verhalten auf den Sexualhormonspiegel bei Frauen. Dabbs u. Mohammed (1992) entdeckten einen signifikanten Testosteronanstieg bei Frauen nach einem Koitus im Vergleich zum vorher gemessenen Basiswert. Welche physiologischen Mechanismen zu dem höheren Testosteronspiegel geführt haben, diskutieren die Autoren allerdings nicht. 4.2.4 Evolutionsbiologische Aspekte der Fertilität Sexuelle Fortpflanzung und sexuelle Differenzierung sind eine Grunderscheinung des Lebens. Die biologische Bedeutung der Sexualität ist für alle Organismen einheitlich: Die im Laufe der Bildung von Keimzellen auftretende Reduktionsteilung in der Meiose und die Verschmelzung von Samenzelle (Spermium) und Ei zur Zygote (s. Kap. 4.2.5) führen zu einer Trennung und Rekombination der auf den Chromosomen lokalisierten väterlichen und mütterlichen Erbanla- Fortpflanzungsbiologie 337 gen. Sexualität ist damit eine Voraussetzung für die Veränderlichkeit der Organismen und die Grundlage ihrer Anpassungsfähigkeit an die Umwelt. Die Sexualität hat sekundär dazu geführt, dass im Laufe der Evolution getrennte Geschlechter hervorgebracht wurden, die jeweils einen andersgeschlechtlichen Partner zur Vermehrung benötigen. Vor rund 600 Mio. Jahren war die Entstehung einer neuen Generation durch asexuelle Fortpflanzung die allgemein verbreitete Form. Bei der Agamie, der mitotischen Zellteilung bei Einzellern (z. B. Bakterien, Amöben) enthalten die Tochterzellen exakte Kopien der genetischen Information der elterlichen Zelle, nur Mutationen schaffen Veränderungen im Genom. Ungeschlechtliche Fortpflanzung durch Knospung existiert auch bei vielzelligen Tieren (Metazoen), das neue Individuum stammt von mehreren elterlichen Zellen ab. Bei der Parthenogenese entwickelt sich der Embryo aus einem unbefruchteten Ei; bei dieser unisexuellen Fortpflanzung wird kein genetisches Material ausgetauscht (Wehner u. Gehring 1995). Bei der asexuellen Fortpflanzung ist das Individuum nicht auf Partner angewiesen, aber die Nachkommen sind genetisch mit vorangegangenen Generationen weitgehend identisch. Bei der sexuellen Fortpflanzung kommt es hingegen zu einer nahezu beliebigen Durchmischung der genetischen Information. Es müssen aus den diploiden Körperzellen haploide Keimzellen gebildet werden, da sonst in den nachfolgenden Generationen jeweils eine Verdoppelung der Chromosomenzahl erfolgen würde. Beim Menschen mit 22 Autosomen-Paaren und den Geschlechtschromosomen X und Y ergäben sich theoretisch für jede Keimzelle mehr als 8 Mio. mögliche Kombinationen der Genverteilung. Der Vorteil der sexuellen gegenüber der asexuellen Vermehrung ist die Rekombination der genetischen Information und dadurch die Steigerung des Evolutionstempos für die Weiterentwicklung der Lebensformen. Allerdings tauchen durch die Notwendigkeit zweier Elternteile auch neue Probleme auf: ein passender Sexualpartner/Sexualpartnerin muss gefunden sowie eine Kommunikation und Synchronisation des sexuellen Verhaltens erfolgen. Die Evolution der sexuellen Vermehrung führte zu einem Sexualdimorphismus in körperlichen Merkmalen und im Verhalten der Partner, der sich in verschiedenen Merkmalen manifestiert hat. • • • Die Anisogamie (Vielgestaltigkeit von Keimzellen) erwies sich als optimale Strategie für die Reproduktion. Es entwickelten sich zwei Morphen. Es gibt Spermatozoen als Keimzellen an der unteren Größengrenze mit geringem Nährstoffgehalt bei gleichzeitiger Steigerung der Gametenanzahl, um die Trefferwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Die zweite Keimzellform, das Ei evolvierte bis an die obere Größengrenze, hat einen hohen Nährstoffgehalt, dafür aber eine geringe Beweglichkeit. Der Gonochorismus (Zweihäusigkeit) soll den Vorteil der biparentalen Fortpflanzung erhalten, da so die Gefahr der Selbstbefruchtung ausgeschlossen ist. Ein Individuum kann sich allein nicht vermehren, da es auf die Keimzelle eines zweiten Organismus angewiesen ist. Die Organdifferenzierung der Genitalien erwies sich als vorteilhaft, da die Verlegung der Befruchtung in den ovaproduzierenden, weiblichen Organis- 338 • Lebenszyklus mus möglich wurde und dadurch die „wertvollere“ Eizelle geschützt werden konnte. Der Sexualdimorphismus im engeren Sinne betrifft anatomische Merkmale bei weiblichen und männlichen Individuen, die nicht direkt in Beziehung zum Akt der Fortpflanzung stehen. Diese Merkmale12 haben den Zweck, den jeweiligen andersgeschlechtlichen Sexualpartner anzulocken und zu beeindrucken, sollen aber auch dazu dienen, Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen. Vor allem bei männlichen Tieren werden die körperlichen Eigenschaften bei intrasexuellen Auseinandersetzungen um Geschlechtspartnerinnen oder Ressourcen (Reviere, Nahrung) durch Verhaltensmerkmale wie Kampfbereitschaft und Aggression ergänzt (McFarland 1989). Die intrasexuelle Selektion hat beim modernen Menschen – wenn auch im Vergleich mit rezenten Primaten und fossilen Hominoidea – zu einem moderaten Sexualdimorphismus des Körpergewichts und der Eckzahngröße geführt. Diese Entwicklung beruht nicht allein auf der intrasexuellen Konkurrenz bei männlichen Primaten, sondern ist unabhängig davon auch durch Veränderungen bei weiblichen Primaten bedingt (Plavcan 2001). Die Selektion begünstigt diejenigen Individuen, die in der Lage sind, ihren Fortpflanzungserfolg im Vergleich zu Artgenossen zu erhöhen. Das kann auf zwei Wegen geschehen: Während es bei der intrasexuellen Selektion um den Zugang zum Gegengeschlecht geht, spielt bei der intersexuellen Selektion die Auswahl eines optimalen gegengeschlechtlichen Partners für die Zeugung und Aufzucht von Nachwuchs eine Rolle. Bei der Wahl des richtigen Geschlechtspartners ist es für weibliche Primaten besonders wichtig, auf die Qualität des Sexualpartners zu achten, da ihr Aufwand an Zeit und Ressourcen durch Schwangerschaft, Laktation und Fürsorge für das Kind erheblich größer als der des Männchens ist, der nur in die Kopulation investiert. Trivers (1972) brachte als erster die sexuelle Konkurrenz mit der Investition in die Nachkommenschaft in Verbindung. Er verwendete den Ausdruck elterliches Investment (parental investment) für den Aufwand an Zeit und Ressourcen, der für die Aufzucht eines Nachkommen geleistet wird. Das Weibchen als das stärker investierende Geschlecht muss deshalb bei der Auswahl ihres Sexualpartners wählerischer sein als das Männchen. Für weibliche Individuen können folgende Eigenschaften bei der Partnerselektion von Bedeutung sein: • • • Das Männchen bietet dem Weibchen wertvolle Ressourcen an, z. B. ein hochwertiges Territorium, das er kontrolliert. Das Männchen bietet sich als guter Verteidiger und Ernährer der künftigen Nachkommen an. Das Männchen wirbt mit Signalen, die bei den Weibchen als Indikatoren für seine genetische Qualität gelten. 12 Beispiele sind das Hirschgeweih, die Löwenmähne, Federfärbung und Gesang bei Vögeln so- wie Muskelmasse, Stimmlage und Körperbehaarung beim Mann; Körperbauproportionen wie die Tailleneinziehung und waist-to-hip-ratio (Björntorp 1991), Brüste, ein prozentual hoher Anteil an Unterhautfettgewebe bei der Frau. Fortpflanzungsbiologie 339 Für Männchen ist im Sinne seines Reproduktionserfolges die Anzahl und Fruchtbarkeit der Fortpflanzungspartnerinnen wichtiger als sein zeitliches und körperliches Investment in Brutpflegeleistungen. Wenn sie in Nachwuchs investieren sollen oder wollen, streben sie nach Vaterschaftsicherheit und versuchen durch Kontrolle des Weibchens („mate guarding“) dafür zu sorgen. Buss (1989) untersuchte in einer vergleichenden Studie bei Menschen aus 37 Kulturen die praktische Umsetzung der postulierten Reproduktionsstrategien von Trivers (1972). Für Frauen sind in Buss’ Modell die Abschätzung des männlichen Investitionspotentials und die langfristige Sicherung des väterlichen Investments in die gemeinsamen Nachkommen wichtig. Bei Männern lauten die Strategien: häufiger Partnerinnenwechsel, Fruchtbarkeit der gewählten Partnerin, streben nach Vaterschaftssicherheit bei Investition in Nachwuchs und Monopolisieren von Frauen. Die Ergebnisse von Buss’ Befragung bestätigten weitgehend seine Hypothesen (Tabelle 4.14). Bei diesen Ergebnissen über geschlechtsspezifische Partnerwahlstrategien taucht die Frage auf, ob die untersuchten Verhaltensweisen eine Relevanz für den tatsächlichen Fortpflanzungserfolg haben. Kann ein hoher sozialer Status die Fertilität eines Mannes steigern? Erhöht sich die Kinderzahl, wenn ein Mann eine möglichst junge Frau heiratet? Würde es sich positiv auf die Fertilität einer fekunden Frau auswirken, wenn sie einen etwas älteren, wohlhabenden Mann heiratet, der ihr ausreichend Ressourcen zur Verfügung stellt? Es gibt zu diesen Fragen eine Anzahl von Untersuchungen in vorindustriellen Gesellschaften, in denen Ackerbau, Viehzucht und Fischfang den Lebensunterhalt der Menschen sicherten. Kultureller Erfolg wurde in diesen Studien mit Wohlstand, religiösem Rang, politischem Status und Landbesitz definiert, den der Mann unabhängig von seiner Frau und seinen Kindern erworben hatte. Als Maße für den reproduktiven Erfolg galten die Zahl der geborenen Kinder bzw. die Zahl der überlebenden Kinder. In fast allen untersuchten Gesellschaften (die Daten betreffen Bevölkerungen aus der Zeit des Mittelalters bis Tabelle 4.14. Geschlechtsspezifische Reproduktionsstrategien bei der Partnerwahl (Buss 1989) 1. Erstreben von Ressourcen In 36 von 37 Kulturen bewerten Frauen gute finanzielle Aussichten, Fleiß und Ehrgeiz des Partners höher als Männer bei ihrer Partnerin (Ausnahmen: Zulus, Spanier, Kolumbianer). 2. Fruchtbarkeit und Reproduktionswert In allen Kulturen wollen Männer jüngere Frauen und Frauen wollen ältere Männer. n Männer wollen durchschnittlich 2,66 Jahre jüngere Frauen n Frauen wollen durchschnittlich 3,42 Jahre ältere Männer n tatsächlich gefundene Differenz ist 2,99 Jahre (Ausnahme Nigeria mit über 6 Jahren wegen häufig praktizierter Polygynie). 3. Vaterschaftssicherheit In 62% der Stichproben zeigte sich, dass die sexuelle Unberührtheit der Frau wichtiger ist als die des Mannes. Allerdings gab es Länder, in denen die sexuelle Unberührtheit von Frauen und Männern gleichermaßen gewünscht wird 340 Lebenszyklus Tabelle 4.15. Männliche Reproduktionsstrategien: Investment in Ressourcen oder väterliches Investment (Heath u. Hadley 1998) Variable Investment in Ressourcen (“high quality”Männer) Anzahl Ehefrauen Kinder geboren Kinder über 15 Jahre Reproduktionsphase (Rp) (in Jahren) Kinder/Jahr während Rp Alter des Mannes bei Geburt des 1. Kindes (in Jahren) Alter des Mannes bei Geburt des letzten Kindes (in Jahren) geborene Kinder pro Frau Kinder über 15 J. pro Frau Investment in Kinder (“low quality”SignifikanzMänner) niveau 3,2 23,3 16,9 32,9 0,7 1,4 12,3 9,3 21,8 0,6 P<.001 P<.001 P<.001 P<.001 P<.01 25,3 26,4 – 58,2 7,7 5,5 48,3 8,8 6,9 P<.001 P<.03 P<.02 in die Gegenwart) konnte ein signifikant positiver Zusammenhang von väterlichem Status und seinem Fortpflanzungserfolg gefunden werden (Mealey 1985; Turke u. Betzig 1985; Boone 1986; Flinn 1986; Hughes 1986; Borgerhoff Mulder 1987; Christiansen 2002). Der Einfluss des gesellschaftlichen Status eines Mannes darf jedoch nicht überbewertet werden. Wertvolle Ressourcen eines Mannes sind auch in vorindustriellen Gesellschaften nicht der einzige Weg zum reproduktiven Erfolg eines Mannes gewesen. Heath und Hadley (1998) verglichen unterschiedliche Reproduktionsstrategien von Mormonen, die im 19. Jahrhundert in Utah (USA) lebten. Sie werteten Zensus-Daten aus den Jahren 1850, 1860 und 1870 sowie Aufzeichnungen in der Family History Library in Salt Lake City über die Lebensgeschichte der ausgewählten Familien aus. So konnten sie den Reproduktionserfolg von Männern vergleichen, die mindestens 60 Jahre alt geworden waren und in Polygamie leben durften. Sie verglichen den Reproduktionserfolg dieser Männer, die entweder als „high quality“-Männer eingestuft wurden, wenn ihr Vermögen zu den oberen 2% gehörte, als „low quality“- Männer galten diejenigen,deren Besitz in die Kategorie der 16% ärmsten Mormonenhaushalte gehörte. Heath und Hadley bestätigten zunächst den bekannten Befund, dass der Wohlstand und das Ansehen eines Mannes in der polygynen Mormonengesellschaft mit einer höheren Anzahl von Ehefrauen und auch mit einer größeren Kinderzahl und bis zur Pubertät überlebenden Kindern des Mannes korrelieren (Tabelle 4.15).„High quality“- Männer haben eine längere Reproduktionsphase, da sie die finanziellen Mittel haben, immer wieder jüngere Frauen dazu zu heiraten, und sie bleiben dadurch auch länger in der Lage, mit einer ihrer noch fertilen Frauen Kinder zu zeugen. Der Beginn der Reproduktionsphase unterscheidet sich zwischen den beiden Statusgruppen nicht. Erstaunlich ist aber, dass statusniedrigere Männer signifikant mehr Kinder pro Ehefrau zeugen und von ihren Kindern (pro Ehefrau) im Vergleich mit „high quality“-Männern mehr das reproduktive Alter erreicht haben. Diese Fortpflanzungsbiologie 341 Väter haben die Möglichkeit einer Fitnessmaximierung durch ein verstärktes elterliches Investment in ihre Kinder nach der Geburt erkannt und sich deshalb in der „Brutpflege“ engagiert. In modernen Industriegesellschaften lässt sich der Zusammenhang zwischen Status des Mannes und dem Reproduktionserfolg so jedoch nicht mehr nachweisen. Bereits vor der Verbreitung hormoneller Kontrazeption, die in westlichen Industriegesellschaften, vor allem in Europa, zu einem drastischen Geburtenrückgang führte, änderte sich das generative Verhalten der Menschen. Der hohe gesellschaftliche Status eines Mannes korreliert nun nicht mehr positiv mit der Familiengröße. Vining (1986) wertete den Japanischen „Who’s Who“ von 1955 aus, in dem die Kurzbiographien von rund 70 000 gesellschaftlich hoch stehenden Männern aus Politik, Wirtschaft, Universität, Medizin, Kunst, Gewerkschaft, Sport und Adel veröffentlicht wurden. Nach Geburtsjahrgängen (vor 1896 bis 1920 und später) getrennt errechnete Vining die durchschnittliche Kinderzahl der Männer, die jemals verheiratet gewesen waren. Diese Zahlen verglich er mit den Angaben aus dem Japanischen Statistischen Jahrbuch für verheiratete Frauen aus den gleichen Jahrgängen. Die durchschnittliche Kinderzahl sank sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen kontinuierlich, je später sie geboren wurden. In allen Geburtsjahrgängen seit 1896 hatten die japanischen Frauen der Gesamtbevölkerung mehr Kinder als die Männer der gesellschaftlichen Auslese, ungefähr im Verhältnis von 1:0,7. Ganz ähnliche Werte ergab der Vergleich von der Kinderzahl hochintelligenter männlicher Mitglieder des Amerikanischen MENSA-Clubs mit den Geburtenraten weißer amerikanischer Frauen (Vining 1986). Große intellektuelle Begabung mit allen ihren gesellschaftlichen Vorteilen resultierte bei den Männern in Kinderzahlen, die bei den Mitgliedern der letzten Geburtskohorte von 1941–1945 gerade noch die Hälfte der von gleichaltrige Frauen ausmachten (Abb. 4.13). In der modernen Industriegesellschaft gilt das Paradigma der Evolutionsbiologie bezüglich der Fitnessmaximierung offensichtlich nicht mehr. Die wohlhabenden und gebildeten Männer übertragen ihren höheren Status in der Gesellschaft nicht in eine höhere reproduktive Fitness. Zweifellos überlagern kulturelle Einflüsse, wie Monogamie und Geburtenkontrolle (meistens von den Frauen praktiziert), die evolutionsbiologisch abgeleiteten Fortpflanzungsstrategien und ihre geschlechtsspezifischen Umsetzungen. Der Kanadier Daniel Pérusse versuchte in seiner Studie (1993) an weit über 400 kanadischen Männern den Fitness reduzierenden Einfluss von Einehe und Geburtenkontrolle auszuschalten, um die Gültigkeit der sexuellen Selektionsmechanismen in modernen Gesellschaften zu überprüfen. Er befragte die 30- bis über 40jährigen Männer bezüglich ihres Status nach Bildungsniveau, Beruf und Einkommen. Die reproduktive Fitness erfasste er konventionell mit der Frage nach den leiblichen Kindern der Männer, wobei ehelicher und außerehelicher Nachwuchs angegeben werden sollte. Um die Einflüsse der Fitnesseinschränkung durch Monogamie und Geburtenkontrolle durch den Mann oder die Geschlechtspartnerin auszuschalten, errechnete er die Zahl möglicher Konzeptionen. In die Formel gehen die Zahl der Sexualpartnerinnen in der Befragungszeit, die Zahl der Geschlechtsakte mit jeder Partnerin und die Konzep- 342 Lebenszyklus Abb. 4.13. Geburtenraten (nur weiße Nord-Amerikaner) von Frauen und männlichen Mitgliedern des MENSA Clubs für Hochintelligente (aus Vining 1986) tionswahrscheinlichkeit pro Koitus ein. Dieser Index bezieht also die Zahl der Geschlechtspartnerinnen und die Zahl der sexuellen Kontakte pro Menstruationszyklus der Frauen ein. Die Ergebnisse bestätigten zunächst, dass der soziale Status der Männer keinen Einfluss auf ihren tatsächlichen reproduktiven Erfolg, nämlich die Anzahl der leiblichen Kinder hatte. Die Zahl möglicher Kinder, errechnet aus der Zahl potentieller Schwangerschaften der Partnerin, korrelierte in der Gesamtstichprobe signifikant, in den Altersklassen von 30–39 Jahren sogar hochsignifikant mit dem sozialen Status der Männer. Aus diesem Ergebnis zieht Pérusse den Schluss, dass evolutionäre Erklärungen menschlichen Verhaltens in modernen Gesellschaften ihre Gültigkeit behalten haben. Wie sieht es mit der Relevanz der zweiten Reproduktionsstrategie von Frauen und Männern bezüglich der gewünschten Altersdifferenz zwischen den Ehepartnern aus, die Buss (1989) bei seiner weltweiten Befragung nachweisen konnte? Bekommen Paare mehr Kinder, wenn tatsächlich ein Altersunterschied zugunsten des Mannes besteht, er also ungefähr 3 Jahre älter ist als seine Partnerin? Zwei Datenerhebungen aus vorindustrieller (Voland 1990) und heutiger Zeit (Berecskei u. Csanaky 1996) befassen sich mit diesem Thema. Voland untersuchte den Reproduktionserfolg in der ostfriesischen Landgemeinde Krummhörn anhand von Aufzeichnungen in Kirchenbüchern über Eheschließungen und Geburten aus der Zeit von 1720 bis 1874. Das Heiratsalter der Männer betrug bei der ersten Ehe in allen Bevölkerungsschichten knapp 30 Jahre, so dass zwischen den sozialen Ständen (Großbauern, Kleinbauern mit politischen Rechten, Kleinbauern ohne politische Rechte und Fortpflanzungsbiologie 343 Landlose) diesbezüglich kein Unterschied zu finden war. Die Bräute der Großbauern waren im Mittel knapp 25 Jahre alt und somit durchschnittlich 2,3 Jahre jünger als die Frauen der landlosen Männer. Hier zeigte sich, dass das Heiratsalter der Bräute mit dem Status des Bräutigams variiert. Unabhängig davon hatten in allen sozialen Schichten die jung heiratenden Frauen am Ende ihres Lebens mehr Kinder geboren als die Frauen, die erst mit über 30 Jahren eine Ehe geschlossen hatten. Die Altersdifferenz zwischen den Geschlechtern spielt für die Fertilität also durchaus eine Rolle, wobei zwei unterschiedliche Faktoren für den Effekt der Paarung „jüngere Frau und älterer Mann“ von Bedeutung sein dürften. Ein älterer Mann – aus allen sozialen Schichten – hat mit größerer Wahrscheinlichkeit schon Ressourcen in Form von Bildung, Status und Besitz akkumulieren können, und eine jüngere Frau ist mit größerer Wahrscheinlichkeit fertiler als eine ältere Frau (s. Kap. 4.2.7). Berecskei u. Csanaky (1996) untersuchten im Rahmen einer Befragung in Ungarn in den Jahren 1988 bis 1989, ob die Auswirkungen der Altersdifferenz zwischen Ehepartnern auch im Industriezeitalter noch eine relevante Rolle für die Fertilität des Paares spielen. Von über 1800 Personen (Männer älter als 40 Jahre, Frauen älter als 35 Jahre) bekamen sie vollständige Datensätze, die zunächst einmal die klassische Altersdifferenz von 3,5 Jahren auch für diese Stichprobe bestätigten. Tatsächlich hatten Männer, die jüngere Frauen geheiratet hatten, nahe dem Ende ihrer reproduktiven Phase im Durchschnitt signifikant mehr Nachwuchs (1,82 Kinder) gezeugt als Männer mit älteren Ehefrauen (1,43 Kinder). Auch hier spielt das Alter der Frau eine entscheidende Rolle aufgrund der Fertilitätsminderung, die bei ihr bereits mit dem 35. Lebensjahr einsetzen kann (s. Kap. 4.2.6). 4.2.5 Keimzellentwicklung, Befruchtung und Implantation: Die ersten Phasen menschlichen Lebens Jede der Milliarden von Zellen eines erwachsenen menschlichen Körpers stammt ursprünglich von einer einzigen Zelle ab, der Zygote, die aus der Verschmelzung einer Eizelle von der Mutter und eines Spermiums vom Vater entstanden ist. Im reproduktiven Lebensabschnitt einer Frau werden bei einem regelmäßigen Zyklus ohne Schwangerschaften ungefähr 300 bis 500 Eizellen reifen und könnten nach der Ovulation durch die Spermien ihres Sexualpartners befruchtet werden. Ein junges Mädchen hat zu Beginn der Pubertät noch ungefähr 20 000 Follikelapparate, aus denen sich reife Eizellen im Eierstock entwickeln werden. Es ist ein Vielfaches dessen, was an Eizellen jemals mit den Spermien eines Mannes in Kontakt kommen wird, die anderen Oozyten werden lediglich Begleitfollikel einer Kohorte von Eizellen sein, aus denen monatlich ein dominanter Follikel heranreifen wird (Neulen 1997). Für diese Begleitkohorte, die der Sexualhormonproduktion im Ovar dient, werden im Leben einer Frau ungefähr 15 000 Follikel benötigt, das sind 0,15% der ursprünglich in der frühen Embryonalphase angelegten Primordialfollikel (s. Kap. 4.2.1). Durch den stetigen Abbau der Follikel nach der Geschlechtsreife des Mädchens bleiben bis zur Menopause knapp 10 000 Primordialfollikel übrig, die 344 Lebenszyklus Box 4.6 Entdeckungsgeschichte der Keimzellen Galen von Pergamon (129–199), Leibarzt des römischen Kaisers Marc Aurel, beschrieb die Hoden des Mannes als Ort der Samenbereitung,glaubte aber,dass die zu den Hoden ziehenden Arterien und Venen bereits eine Vorstufe des Samens enthielten. Eine weißliche Flüssigkeit (Tubenschleim aus den Eileitern, den er in der Gebärmutter entdeckte) deutete er als weiblichen Samen. Er charakterisiert ihn – im Vergleich zum männlichen Sperma – als schwächer,flüssiger,kälter und in der Spannkraft geringer. Männlicher und weiblicher Samen sind nicht gleichwertig,sondern der weibliche Samen dient in der Gebärmutter dem männlichen Keim nur als Nahrung, bis sich aus dem weiblichen Samen die Allantois (Dottersack) bildet, die den Keim ernährt. Der Anatom William Harvey (1578–1657) aus England entwarf das Modell von der Urform eines Eies, das aus 2 Grundbestandteilen besteht: der Hülle und der Flüssigkeit im Inneren, aus der sich ein Lebewesen entwickelt.Er orientierte sich an der Entwicklung eines Hühnerembryos, geprägt durch die Bebrütungsexperimente des 16. Jahrhunderts. Da die Experimentatoren keine Spur von Gockelsamen im Hühnerei feststellen konnten, wurde von Harvey eine Theorie der immateriellen Zeugung entwickelt: Der vom Ei ferngehaltene Samen würde über den trennenden Zwischenraum hinweg eine Art Fernwirkung, „aura seminalis“, ausstrahlen und damit seinen zeugenden Einfluss auf das Hühnerei ausüben. Die Gebärmutter ist der Ort der Zeugung, in ihr bilden sich Flüssigkeit und Hülle, die Grundbestandteile des Ur-Eies,das durch die Eihüllenfunktion der Gebärmutter zum vollständigen Ei der Säugetiere wird. Eine wesentliche Korrektur zu Harveys Ei-Theorie brachten mikroskopische Befunde. Mit einem von ihm entwickelten Lupenmikroskops erzielte der Niederländer Antoni van Leeuwenhoek (1632– 1723) aus Delft bis zu 500fache lineare Vergrößerungen.Einzeller hatte er damit bereits 1674 entdeckt. Wenige Jahre später entdeckte der Medizinstudent Johan Ham mit so einem Mikroskop im Sperma eines Patienten „dierkens“, die Leeuwenhoek nun auch im Sperma von Insekten, Fischen, Reptilien, Vögeln und Säugern nachweisen konnte (Abb. 4.14). Er kam anhand seiner „dierkens“ zu einer neuen Zeugungslehre, die der Harveyschen Ei-Theorie widersprach: Das Ei spielt bei der Zeugung nur eine untergeordnete Rolle, die Samentierchen sind das eigentlich Lebendige. Das unbewegliche Ei liefert ihnen nur Nahrung, wenn die Samentierchen in das Ei hineinschlüpfen und sich dort entwickeln. Leeuwenhoek hat sich vier Jahrzehnte mit den Spermien beschäftigt und seine Entdeckung wurde weltweit bekannt.Der niederländische Begriff diercken wurde lateinisch als animalculum Fortpflanzungsbiologie 345 Box 4.6 (Fortsetzung) und griechisch als Spermatozoon in die internationale Fachterminologie übertragen. Die ungezügelte Phantasie einiger „dierckens“-Beobachter führte bei etlichen Wissenschaftlern zu Behauptungen, dass sie Samen-Menschen oder Samen-Pferdchen unter dem Mikroskop gesehen hätten, zwar winzig klein, aber doch schon voll entwickelt. Sogar Geschlechtsunterschiede wären festzustellen. Die Anhänger dieser neuen Zeugungstheorie bezeichneten sich als Animalkulisten, während die Vertreter der Harvey’schen Ei-Theorie als Ovisten galten. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts gelang es dem Anatom und Biologen Karl Ernst von Baer (1792–1876) nach vielen vergeblichen Versuchen im Mai 1827 als Erster das Ei eines Säugetiers zu finden. In den Graaf-Follikeln aus dem Eierstock einer Hündin entdeckte er „ein kleines gelbes Fleckchen in einem Bläschen“, er öffnete das Bläschen und hob vorsichtig das Fleckchen mit einem Messer heraus und betrachtete es unter einem Mikroskop: „Ich sah ein scharf umschriebenes, von einer starken Haut umschlossenes, regelmäßiges Kügelchen vor mir, von einem Vogeldotter nur durch eine derbe, etwas abstehende äußere Haut unterschieden“. Von Baer hatte das Säugetierei entdeckt. Der Streit der Ovisten und Animalkulisten um den Zeugungsvorgang wurde aber erst 1875 durch Oskar Hertwig beigelegt, der demonstrierte, dass eine Befruchtung durch Verschmelzen der Kerne von Ei und Samenzelle zustande kommt. Abb. 4.14. Die erste Darstellung von Spermatozoen unter einem Lupenmikroskop im Jahr 1677 von Antoni van Leeuwenhoek 346 Lebenszyklus Box 4.7 Oogenese – Begriffsdefinitionen n Theka-Zellen: Bindegewebszellen im Follikel, die Androgene, vornehmlich Testosteron und Androstenedion produzieren n Granulosa-Zellen: hormonproduzierende Zellen im Follikel mit FSH-Rezeptoren, die im Follikel die Androgene aus den Theka-Zellen in Östrogene umwandeln n IGF 1: Insulin-like growth factor 1 wird in der Leber gebildet und durch das Blut in das Ovar transportiert n IGF 2: Insulin-like growth factor 2 wird in den Granulosa-Zellen gebildet n Atresie/atretisch: Rückbildung einer Zelle, z. B. ausgelöst durch Androgene in den nicht-selektierten Follikeln n Inhibin und Activin: Wachstumshormone (Peptide),die in den Follikeln gebildet werden dann aber nicht mehr auf die Gonadotropine aus der Hypophyse reagieren und bis zur Befruchtungsfähigkeit heranreifen können (s. Kap. 4.2.7). Die Mechanismen, die den ständigen Verbrauch der Follikel von der Embryonalphase bis zur Menopause regeln, sind bisher unbekannt. Oogenese – die Reifung der Eizellen Die Oozyten oder Primordialfollikel, die sich vorgeburtlich in den Gonaden der weiblichen Embryonen aus den Oogonien (Stammzellen) entwickeln, bestehen aus der Eizelle und dem Epithel aus abgeflachten Granulosa- und Thekazellen. Sie befinden sich seit der Embryonalzeit im Status der Vorphase der 1. Reifeteilung (Meiose) im Ovar. Nachdem die Hypophysen-Gonaden-Achse in der Pubertät ihre Funktion aufgenommen hat (s. Kap. 4.2.2), können sich die Oozyten durch die hormonelle Stimulation zu Primärfollikeln oder primären Oozyten entwickeln. Die Oozyten vergrößern sich, weil sie nun kubisch aufgebaute Granulosa-Zellen und eine Basalmembran zwischen Granulosa und Thekazellen ausgebildet haben (Abb. 4.15). Aus diesem Stadium heraus entwickeln sich einige Primärfollikel durch die Steigerung der Expression von FSH-Rezeptoren in den Granulosazellen zu Gonadotropin-sensiblen Sekundärfollikeln, die auf die Ausschüttung des Follikel-stimulierenden Hormons (FSH) aus der Hypophyse ausreichend reagieren. Je größer die FSH-Konzentration im Blut bzw. Ovar ist, desto größer ist die Kohorte der Follikel, die sich in einem Zyklus zu Sekundärfollikeln entwickeln, meist sind es 3 bis 7 Follikel. Fortpflanzungsbiologie 347 Abb. 4.15. Der Aufbau eines reifen Follikels mit der Balsalmembran, Theka- und Granulosazellschicht (aus Felberbaum und Ortmann, 1998) Zunächst werden durch FSH die Granulosazellen der Sekundärfollikel stimuliert, IGF 2 (Insulin-like Growth Factor 2) zu synthetisieren. IGF 2 regt zusammen mit IGF 1 aus der Leber die Theka-Zellen an, Rezeptoren für das luteinisierende Hormon (LH) zu exprimieren und dadurch sensitiv für die steigende LH-Ausschüttung aus der Hypophyse zu werden. Dadurch wird in den Theka-interna-Zellen der Follikel die Produktion von Androstenedion und Testosteron angeregt (Hillier 1994). In der darunter liegenden Schicht aus Granulosazellen erfolgt unter dem Einfluss von FSH die Umwandlung der Androgene in Östrogene und die Produktion von Activin, das wiederum die Freisetzung von FSH in der Hypophyse fördert. Aus der Kohorte der Sekundärfollikel differenziert sich nach 5 bis 7 Tagen der spätere Graaf-Follikel heraus, der von allen heranreifenden Eizellen die größte Anzahl von FSH-Rezeptoren hat. Dieser Follikel bildet nun verstärkt Östrogene und durch die Rückkoppelung von Östradiol mit der Hypophyse sinkt der FSH-Spiegel im Blut, während der LH-Spiegel weiter ansteigt (Ferin 1996). Follikel, die in der Granulosazellreifung nicht weit genug vorangekommen sind, bleiben nun durch die verminderte FSH-Stimulation in ihrer Entwicklung zurück und ihre Östrogenproduktion sinkt. Der Testosterongehalt dieser Follikel steigt aber dennoch weiter an, da die Thekazellen durch den LH-Anstieg zur Androgenbildung angeregt werden. Schließlich kommt es durch den hohen Androgenspiegel zur Atresie (Rückbildung) dieser Follikel. Der selektierte Graaf-Follikel setzt nun noch Inhibin frei, ein Peptid, das ebenfalls die FSH-Bildung in der Hypophyse hemmt und damit das Wachstum der übrigen Kohortenfollikel (Hillier u. Miro 1993). Der Graaf-Follikel wird den- 348 Lebenszyklus noch weiter durch die verminderte FSH-Ausschüttung ausreichend stimuliert, da er eine hohe Rezeptordichte in seinen 16 bis 20 Schichten von Granulosazellen aufgebaut hat. Das Antrum (Follikelhöhle) ist nun deutlich ausgebildet (Abb. 4.15). Die Aktivität der Granulosazellen des Graaf-Follikels führt zu einem exponentiellen Anstieg der Östradiolkonzentration im Serum, der durch einen positiven Feedback-Mechanismus zu einem LH-Peak (massive Freisetzung von LH aus der Hypophyse) führt, der ca. 12 Stunden später die Ovulation (Eisprung) auslöst. Fehlt dieser plötzliche Anstieg, kommt es nicht zu einer Ovulation. Wenige Stunden vor dem Eisprung vervollständigt sich die Meiose (1. Reifeteilung) der Eizelle, in der sie seit der Embryonalphase verharrte, und ein Polkörperchen entsteht. Nach dem Eisprung luteinisieren die Granulosa-Zellen unter dem Einfluss von LH und bilden das Corpus luteum (Gelbkörper), das nun stark zunehmend das Gestagen Progesteron produziert (Abb. 4.15). Tritt keine Schwangerschaft ein, kommt es nach 14 Tagen zur Luteolyse, der Rückbildung des Corpus luteum. Hat eine Fertilisation der Eizelle im Eileiter stattgefunden, wird das Corpus luteum durch das plazentare Hormon HCG (human chorionic hormone oder Choriongonadotropin) stimuliert und wird zum Corpus luteum graviditate. Spermatogenese: die Reifung männlichen Keimzellen Als Spermatogenese bezeichnet man den Vorgang der gesamten männlichen Keimzellentwicklung von den Spermatogonien (diploide Stammzellen, die in der frühen Embryogenese in den Hoden eingewandert und dort verblieben sind) bis zu den Spermatozoen. Diese Entwicklung dauert ca. 64 bis 74 Tage. Als Spermiogenese wird nur der letzte Abschnitt der Spermatogenese bezeichnet. Es ist die Entwicklung nach der 2. Reifeteilung von der haploiden Spermatide bis zum Spermatozoon, der reifen, befruchtungsfähigen Keimzelle (Tabelle 4.16). Die wesentlichen Schritte der Spermiogenese, der Transformation der haploiden Keimzellen, sind die Kernkondensation, die Akrosombildung und die Geißelbildung. Alle Entwicklungsschritte durchlaufen die Spermatogonien erstmals in der Pubertät eines Jungen, wenn nach der Reifung der Hypothalamus-Hypophysen-Gonadenachse die Testosteronproduktion eingesetzt hat. Der Hoden erreicht nach der Ausdifferenzierung während der sexuellen Reifung ein durchschnittliches Volumen von 12 bis 20 ml. Von diesem ZeitTabelle 4.16. Ablauf der Spermatogenese Spermatogonien (diploid) nach mitotischen Reifeteilungen: Spermatozyte I (diploid) nach 1. meiotischen Teilung: Spermatozyte II (haploid) nach 2. Reifeteilung: Spermatide (haploid) durch Spermiogenese: Spermatozoon (haploid) Fortpflanzungsbiologie 349 Box 4.8 Spermatogenese – Begriffsdefinitionen n Sertoli-Zellen: Sie bilden das Stützgerüst des Keimepithels. Ihnen kommt eine zentrale Bedeutung zu, weil sie mit ihren Zellfortsätzen die Keimzellen umgreifen und so lange im Keimepithel festhalten, bis sie ausgereift das Samenkanälchen verlassen können n Leydig-Zellen: steroidhormonproduzierende Zellen im interstitiellen Kompartiment,die unter dem Einfluss von LH (luteinisierendes Hormon) aus der Hypophyse das Sexualhormon Testosteron bilden n Hodenparenchym: Es besteht aus speziellen Zellen des Hodens (z. B. Leydig-Zellen), die im Gegensatz zum Gerüstgewebe (Bindegewebe mit Gefäßen und Nerven) seine Funktion bedingen n Tucica albuginea: Kapsel um das Hodenparenchym n Tubuli seminiferi: Samenkanälchen, die Keimzellen in verschiedenen Entwicklungsstadien sowie die Sertoli-Zellen enthalten n Interstitium oder Interstitielles Kompartiment: Der Raum zwischen den Samenkanälchen, in dem sich die Leydig-Zellen, Blut- und Lymphgefäße,Nerven,lockeres Bindegewebe und Zellen des Immunsystems befinden n Rete testis: System netzartig verbundener Spalträume, in das die Tubuli seminiferi münden n Nebenhoden: Sie sind mit den Hoden verwachsen und bestehen jeweils aus einem Nebenhodenkopf (Caput), -körper (Corpus) und -schweif (Cauda) punkt an werden bei gesunden Männern lebenslang männliche Gameten (Spermatozoen bzw. Spermien) in den Sertoli-Zellen gebildet, und die Leydig-Zellen produzieren und sezernieren das Sexualhormon Testosteron, wenn auch in Abhängigkeit vom Lebensalter des Mannes in unterschiedlicher Qualität der Spermien und Ausmaß der Testosteronausschüttung (s. Kap. 4.2.8). Die Funktion der Hoden wird primär endokrin durch die Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse reguliert. Es gibt zwei Hauptachsen: die Verbindung Hypothalamus-Hypophyse-Leydig-Zellen für die Testosteronproduktion unter LH-Einfluss und die Verbindung Hypothalamus-Hypophyse-Sertoli-Zellen für die Spermatogenese unter FSH-Einfluss (Weinbauer et al. 2000). Das Hodenparenchym wird von einer derben Hülle, der Tunica albuginea umgeben. Die Spermatogenese findet im tubulären Kompartiment des Hodens statt, das aus den Tubuli seminiferi (Abb. 4.16) und dem Interstitium besteht, das zwischen den Samenkanälchen liegt. 350 Lebenszyklus Abb. 4.16. Anatomie des Hodens (verändert nach Mader 1977) Fortpflanzungsbiologie 351 Abb. 4.17. Spermatozoon (verändert nach Mader 1977) Die Spermatogenese vollzieht sich im Lumen der Samenkanälchen (Tubuli seminiferi). Jede einzelne Sertoli-Zelle steht mit einer bestimmten Anzahl von Keimzellen im morphologischen und funktionellen Kontakt und steuert den Ablauf der Spermatogenese in funktioneller Hinsicht. Sertoli-Zellen produzieren und sezernieren Proteine, Zytokine, Wachstumsfaktoren, Modulatoren der Zellteilung und vor allem Flüssigkeit in das tubuläre Lumen (Röhre). In dieser Flüssigkeit werden die Samenfäden transportiert, und der flüssigkeitsbedingte Druck hält das Lumen aufrecht. Von hier aus gelangen die Spermatozoen im Laufe ihrer Entwicklung von der Spermatogonie bis zum Spermatozoon vom Rand bis ins Zentrum des Tubulus und dann über das Rete Testis in die Nebenhoden. Während der Passage durch die Nebenhoden vollziehen die Spermatozoen in ungefähr 8 bis 17 Tagen weitere Reifungsprozesse. Die Spermien (Abb. 4.17) können in den Nebenhoden gespeichert werden und erhalten ihre progressive Motilität (Vorwärtsbeweglichkeit), da das Nebenhodenepithel Substanzen (u. a. Glykoproteine) produziert, die für die Reifung der Spermatozoen von Bedeutung sind. Auch der Zona-Rezeptor am Spermienkopf, der Moleküle enthält, die für die artspezifische Bindung eines Spermatozoons an die Eizelle entscheidend sind, reift nach13. Von den Nebenhoden gelangen die Spermatozoen über die Ductus deferentes (ableitende Samenwege) in die Samenblasen, deren Sekret zwischen 50% 13 Wie wichtig diese Prozesse sind, zeigt sich bei einem Verschluss im Nebenhoden oder des Duc- tus deferens. Für eine künstliche Befruchtung der Partnerin müssen dort Spermien entnommen werden. Die Schwangerschaftsrate nach der Samenübertragung steigt in Abhängigkeit von der Strecke, welche die Spermien im männlichen Genitaltrakt vorher auf natürlichem Weg zurücklegen konnten von 9% bis (Nebenhoden-Kopf) bis zu 51% bis (Nebenhoden-Schweif). 352 Lebenszyklus und 80% des Ejakulates ausmacht. Dieses Sekret besteht hauptsächlich aus Fructose, zusätzlich noch aus Elektrolyten, Enzymen und Prostaglandinen (Weinbauer et al. 2000). Bevor die Spermatozoen durch die Harnröhre während der Ejakulation den Geschlechtsweg verlassen, passieren sie noch die Prostata (Vorsteherdrüse), aus deren Sekret das Ejakulat zu 15–30% besteht und das ebenfalls für die Fertilisierungsfähigkeit der Spermatozoen wichtige Inhaltsstoffe (Immunoglobuline, Lipide und Serumproteine) enthält. Befruchtung und Implantation Wenn Spermien nach einer Ejakulation in den weiblichen Genitaltrakt gelangen, müssen sie die Wanderung bis in die Eileiter (Tuben) überleben, wo die Eizelle befruchtet wird. Die Überlebenszeit der Spermien liegt zwischen 24 und 48 Stunden, in Einzelfällen auch bis zu vier Tagen. Von ursprünglich 40 Mio. Spermien im Ejakulat, die durch einen Koitus in die Vagina gelangt sind, erreichen ca.1–2% die Gebärmutter. Nur ein sehr geringer Teil, ungefähr 200 Spermatozoen, kommt schließlich bis in die Eileiter. Über die notwendige Energie für ihre Motilität verfügen die Spermien selbst in ihren Mitochondrien (Abb. 4.17) oder sie gewinnen diese aus der Samenflüssigkeit, mit der sie in die Vagina gelangt sind. Die Aktivierung der notwendigen glykolytischen und oxidativen Prozesse zur Energiegewinnung aus der Samenflüssigkeit ist von einer Östrogen- oder Progesterondominanz im Genitaltrakt abhängig. Nur Östrogene aktivieren die Stoffwechselprozesse und erreichen gerade in der Ovulationsphase Maximalwerte. Dieses östrogendominierte endokrine Milieu ermöglicht den Spermien auch die Passage durch den Muttermund (Zervix), dessen Verschluss durch Zervikalmukus nur zu diesem Zeitpunkt für sie penetrierbar ist. Morphologisch abnormal geformte Spermien haben dennoch Schwierigkeiten, den Mukus zu durchdringen, der aus einer Vielzahl ineinander verwobener Fibrillen (Mucin) besteht, die ihm eine hohe Viskosität verleihen. So kann es zu einer gewissen, mechanischen Spermienselektion kommen. Nach dem Erreichen des Uterus bewegen sich einige Spermatozoen weiter in Richtung der Eileiter, andere verbleiben vorerst in den Krypten der Zervix, von wo aus sie später langsam weiterwandern und eine kontinuierliche Spermienfreisetzung ermöglichen. Zusätzlich zur Eigenbewegung der Spermien wird ihre Fortbewegung durch die Kontraktionen des weiblichen Genitaltraktes stimuliert (Kunz et al. 1996). Wenn die Spermatozoen die Tuben erreichen, werden sie durch Inhaltsstoffe der Follikelflüssigkeit, die durch die Ovulation in die Eileiter gelangt, in ihrer Beweglichkeit wieder angeregt. Die Tuben zeigen zwar ein kontinuierliches, komplexes Muster von spontanen Kontraktionen, aber diese pflanzen sich gleichzeitig in entgegengesetzte Richtungen fort. Ihre Bedeutung für den Spermientransport ist unklar. Da der Zilienschlag (Wimpernschlag) in der Tube zu einer Bewegung in Richtung Uterus führt, um eine fertilisierte Eizelle zur Gebärmutter zu transportieren, kann der Transport der Spermien in die Gegenrichtung nur durch deren Eigenbewegung erfolgen. Im Glykoproteinsekret der Tuben ist es den Spermien möglich, sich durch eigene Kraft in Rich- Fortpflanzungsbiologie 353 Tabelle 4.17. Ablauf der notwendigen Ereignisse für die Fertilisation Spermium (S) aus den Tubuli seminiferi gelangt in den Nebenhoden Nachreifung des S im Nebenhoden und den Samenleitern Platzierung des S mit der Samenflüssigkeit in die Vagina S durchdringt den zervikalen Mukus am Muttermund Kapazitation des S im weiblichen Genitaltrakt Eisprung/Wanderung des S bis in die Tuben S erreicht die ovulierte Eizelle im Eileiter Penetration des Cumulus oophorus der Eizelle durch S Bindung des S an die Zona pellucida der Eizelle durch Hyperaktivität, Akrosomreaktion S durchdringt die Zona pellucida Passieren des pervitellinen Spaltes der Eizelle Bindung des S an die Vitellinmembran der Eizelle Verschmelzung des S mit dem Vitellus Bildung der Befruchtungsmembran aus dem Vitellus Aktivierung der Eizelle, Abschnürung des 2. Polkörperchen der Eizelle Organisation der Spindelbildung und Dekondensation des Chromatins des S Bildung des männlichen Pronucleus/Bildung des weiblichen Pronucleus Verschmelzung der Kerne zur Zygote (Fertilisation) tung Ovar fortzubewegen, zumal der Wimpernschlag der Tuben durch die Viskosität des Tubensekretes stark gedämpft wird. Nach der Freisetzung der Eizelle aus dem Graaf-Follikel an der Oberfläche des Ovars muss die Oozyte, die vom Cumulus oophorus (Anhäufung von Granulosazellen) umgeben ist, zunächst den freien Bauchraum passieren. Normalerweise ist die Stelle des Eisprungs am Ovar von dem Fimbrientrichter des seitenzughörigen Eileiters abgedeckt, so dass die Eizelle direkt in die Tube hinein geschleudert wird. Landet sie im Bauchraum, kann es zu einer gefährlichen Bauchhöhlenschwangerschaft kommen. Die aus dem Follikel geschwemmte Eizelle macht zum Zeitpunkt des Follikelsprungs ihre erste Meiose durch. Dabei 354 Lebenszyklus wird ein Zellkern fast ohne Plasma als Polkörperchen abgeschnürt und geht zugrunde. Die zweite Reifeteilung, die nur durch einen von außen kommenden Reiz, normalerweise die bei der Befruchtung eindringende Samenzelle, ausgelöst wird, muss innerhalb von 12 Stunden erfolgen, sonst stirbt die Eizelle ab. Bei ihrer Wanderung durch den weiblichen Genitaltrakt müssen die Spermien den Parallelvorgang, die Kapazitation durchlaufen, mit der sie in 5 bis 6 Stunden auf die spätere Interaktion mit der Eizelle vorbereitet werden. Unter dem Einfluss von Progesteron aus dem Corpus luteum strömen Phospholipide aus den Spermienhüllen aus, die dadurch labil werden. Ohne Kapazitation könnten Spermien eine Eizelle nicht befruchten, denn die Folgen dieses Vorgangs führen dazu, dass die Spermatozoen eine hyperaktivierte Motilität zeigen, die sich im Absinken der bisherigen vorwärtsgerichteten Motilität und einer erhöhten Schlagfrequenz des Flagella äußert. Wenn kapazitierte Spermien mit der Eizelle in Berührung kommen, müssen sie zunächst zwei Umhüllungen der Eizelle durchdringen. Die äußere Hülle ist der Cumulus oophorus aus Granulosazellen, eingebettet in einer viskösen Schicht aus Hyaluronsäure. Das lytische Enzym Hyaluronidase auf der Spermienoberfläche löst die visköse Schicht auf, und das Spermium kann sich mittels seiner drillbohrerähnlichen Eigenbewegung durch den Cumulus vorarbeiten. Die innere Hülle bildet die nichtzelluläre Zona pelludica, die aus einem Netzwerk von den Glycoproteinen besteht, von denen ZP3 der entscheidende Rezeptor für die artspezifische Bindung (Hägele et al. 1998) ist14. Nach der Bindung an ZP3 wird am Spermienkopf die Akrosomreaktion ausgelöst, die eine Voraussetzung für die Durchdringung des Spermiums von der Zona pellucida und den Perivitellinspalt bis zur Vitellinmembran ist. Sobald das Spermium durch den perivitellinen Spalt bis zur Eizelloberfläche, der Vitellinmembran, gelangt ist, verschmelzen der Vitellus und die Spermienmembran. Das Spermium dringt in die Eizelle ein. Es entsteht sofort durch die Fusion kortikaler Granula aus dem Cumulus oophorus mit dem Vitellus eine Befruchtungsmembran als physische Blockade, um eine Polyspermie durch weitere eindringende Spermien zu verhindern. Der Inhalt der Corticalgranula wird außerdem freigesetzt, diffundiert zur Zona pellucida und wandelt dort das Glykoprotein ZP3 in ZP3f um, das nicht mehr die notwendigen Kohlehydrate zur Spermienerkennung enthält. So können nachfolgende Spermatozoen nicht an die Zona pellucida binden. Im Inneren des Eies wird vom Spermatozoon der Schwanz abgelöst und die mitochondriale DNA des Spermiums abgebaut. Aus dem Mittelstück des Spermatozoons bilden sich zwei Zentriolen (Zentralkörperchen), die mit dem männlichen Keim zur Mitte des Eies wandern. Gleichzeitig kommt es zur Abschnürung des 2. Polkörperchens von der Eizelle, und es bildet sich der weibliche Pronucleus aus dem haploiden Chromosomensatz der Eizelle. Auch der weibliche Pronucleus bewegt sich zum männlichen Nucleus hin, und beide Kerne verschmelzen zu einem gemeinsamen Kern. 14 Am Spermienkopf befindet sich der Zonarezeptor des Spermiums, ein Adhäsionsmolekül β-1,4-Galaktosyltransferase, das wahrscheinlich an den ZP3-Rezeptor binden kann. Abb. 4.18. Entwicklung des Embryos bis zur Implantation (verändert nach Mader 1977) Fortpflanzungsbiologie 355 356 Lebenszyklus Nach der Bildung der Zygote erfolgen noch im Eileiter die ersten Teilungen des Embryos. Dadurch wird vor allem die genetische Information vervielfacht15, während die Masse des Embryos, der noch von der Zona pellucida umgeben ist, nur gering zunimmt (Abb. 4.18). Eine Differenzierung der Blastomeren tritt nach der dritten Furchungsteilung im Achtzellstadium ein. Diese Zelltraube wird Morula genannt und wird ausschließlich von Pyruvat (Salz der Brenztraubensäure) und Laktat (Salz der Milchsäure) aus dem mütterlichen Milieu im Eileiter ernährt. Der Embryo hat keine Eigenbewegung, sondern er wird durch das Flimmerepithel des Eileiters passiv transportiert. Nach zwei bis drei Tagen erreicht der Embryo im späten Morulastadium mit Embryoblast und Trophoblast (äußere Zellschicht) den Uterus. Etwa am 4. Tag nach der Befruchtung bildet sich eine Blastozyste aus (Abb. 4.18). Diese besteht aus einem trophoblastärem Zellkranz, einer Blastozystenhöhle sowie einem Embryoblasten, der an der späteren Implantationsstelle liegt. Der Implantationsvorgang ist ein genetisch gesteuerter Prozess. Sechs bis sieben Tage nach der Fertilisation und nach ca. 3 Tagen „freien“ Aufenthaltes im Uterus legt sich die Blastozyste, von der Zona pellucida umhüllt, mit der Embryonalplatte (Embryoblast) an die Gebärmutterschleimhaut an. Die zunächst lockere Anheftung wird zu einem intensiven Zellkontakt zwischen der Trophoblastzellschicht und dem Epithel der Gebärmutterschleimhaut. Kurz vor der Implantation schlüpft die Eizelle aus der Zona pellucida und trennt sich von ihr. Dieser Vorgang wird durch steroidhormonabhängige lytische Faktoren gesteuert. Am 20. bis 21. Tag nach der Befruchtung der Eizelle wächst der Trophoblast invasiv in das endometriale Stroma (bindegewebiges Stützgewebe der Uterusschleimhaut) ein. Ab dem Achtzellstadium hat der Embryo bereits Wachstumsfaktoren, Interleukine und andere Cytokine produziert, welche die Einnistung steuern. Die mütterliche Immunabwehr muss soweit beeinflusst werden, dass der Embryo nicht als fremd erkannt und somit keine Abstoßungsreaktion ausgelöst wird. Die Blastozyste bringt das Schleimhautepithel und das darunter liegende Bindegewebe durch Enzymwirkungen zur Auflösung und senkt sich in die so entstandene Höhle ein. Nur dann können die mütterlichen Blutgefäße eröffnet und die Ausbildung der Plazenta vorbereitet werden. Wenn die Blastozyste vollständig in die Schleimhaut der Gebärmutter eingedrungen ist, verschließt mütterliches Fibrin (Blutfaserstoff) die Öffnung. 15 Die durch Furchung der Zygote entstehenden Zellen (Blastomeren) teilen sich ohne Wachstum und werden so bei jeder Teilung kleiner. Das Verhältnis von Zellplasma zu Zellkern verschiebt sich zugunsten der Kerne. Fortpflanzungsbiologie 357 4.2.6 Störfaktoren der Fertilität bei Frauen und Männern Die Nichterfüllung des Wunsches nach einem Kind bedeutet für die meisten Betroffenen eine psychische Belastung, da die Geburt des eigenen Kindes heute zu einem weitgehend bewussten und planbaren Lebensziel geworden ist. Es wird heute allgemein von einem jederzeit einsetzbaren generativen Potential ausgegangen. Aber die Angaben über die Anzahl ungewollt kinderloser Paare im reproduktionsfähigen Alter mit primärer (noch kein Kind) oder sekundärer Infertilität (Ausbleiben einer erneuten Schwangerschaft) machen deutlich, dass nicht für alle Paare die Erfüllung des Kinderwunsches so problemlos ist, wie es vielen zunächst erscheint. Schätzungen für Deutschland gehen von einer Prävalenz der Infertilität zwischen 5% und 15% aus, das heißt, es ist bei regelmäßigem, ungeschütztem Sexualverkehr innerhalb eines Jahres nicht zu einer Schwangerschaft gekommen (Bruckert 1991). Eine WHO-Studie ergab die Zahl von weltweit 60 bis 80 Mio. ungewollt kinderlosen Paaren, die Schätzungen schwanken je nach Region zwischen 3,6% im Mittleren Osten und 14,3% in Zentralafrika (Farley u. Belsey 1988). In den vergangenen 20 Jahren hat die natürliche Reproduktion in den Industrienationen signifikant abgenommen, im gleichen Zeitraum haben medizinische Kinderwunschbehandlungen sowie die Zahl der publizierten klinischen Studien auf dem Gebiet der assistierten Reproduktion exponentiell zugenommen. Die Ursachen der ungewollten Kinderlosigkeit liegen bei Paaren, die deswegen in ärztliche Behandlung gegangen sind, ungefähr zu 40% nur bei der Frau, zu 20% nur beim Mann, in 26% der Fälle sind die Ursachen bei beiden Partnern zu finden. Trotz ständig verfeinerter Diagnosemethoden bleibt bei 15% der Paare die Ursache für die Kinderlosigkeit unentdeckt. Nahe liegend, aber vielen Paaren offensichtlich nicht bewusst oder bewusst umgesetzt, ist die Bedeutung der Koitusfrequenz für eine Schwangerschaft. Bereits 1955 stellten MacLeod u. Gold fest, dass bei einer mittleren Koitusfrequenz von weniger als 1 Mal pro Woche die spontanen Konzeptionschancen (ohne intervenierende Behandlung) innerhalb von 6 Monaten bei nur 16% liegen, bei Verkehr von mehr als 3 mal pro Woche steigt die Chance einer Befruchtung auf über 90%. Oft wird auch die Bedeutung des Alters der Frau für die Konzeptionswahrscheinlichkeit von den Paaren unterschätzt. In kontrollierten Studien, in denen die Samenqualität des Mannes durch spezielle Aufbereitung konstant gehalten wurde, sank die Konzeptionswahrscheinlichkeit der Partnerin ab der Gruppe der Mitdreißigjährigen konstant mit zunehmendem Lebensalter. Körperliche Faktoren der Infertilität bei Frauen Im weiblichen Körper werden die Gameten (Eizellen) produziert, dort findet die Befruchtung sowie die Entwicklung von der Zygote zum reifen Kind statt, das auch nach einer Geburt unter natürlichen Bedingungen zunächst von der Fürsorge der Mutter durch das Stillen abhängt, wenn auch nicht mehr von der Funktion ihrer Fortpflanzungsorgane. Bei Frauen sind deshalb nicht nur die 358 Lebenszyklus Tab. 4.18. Infertilität bei Frauen Körperliche Faktoren n n n n n n n n n n Chromosomale Abberationen: z. B. Turner-Syndrom mit XO-Karyotyp, nach der Geburt nur Reste von Primordialfollikeln mit erkennbarem Ovarialgewebe Endokrine/ovarielle Sterilität: gestörte Follikelreifung mit Anovulation und Gelbkörperschwäche Zervix bedingte Sterilität: gestörte Sekretion des Zervixmukus Periovarielle und peritubare Verwachsungen: Bindegewebswucherungen oder Verwachsungen in den Eileitern, fehlende Tubendurchgängigkeit Adnexitis: Eileiterentzündung mit fehlender Tubendurchgängigkeit Endometriose: Entzündungen anTuben oder Ovarien durch Wucherungen der Gebärmutterschleimhaut Uterus myomatosus: Wucherungen von Polypen an der Uteruswand, Ovarialgewebe nach der Geburt Hyperprolaktinämie: erhöhte Prolaktinkonzentration Fehlbildungen: Uterusmissbildungen, Vaginalaplasie Spermienantikörperbildung Keimzellbildung und die Fähigkeit zum Geschlechtsverkehr von Bedeutung für die Fertilität, sondern auch die Fähigkeit des weiblichen Fortpflanzungssystems, eine befruchtete Eizelle im Körper bis zur Geburt eines extrauterin lebensfähigen Kindes heranreifen zu lassen. Abgesehen von Frauen, deren vorgeburtliche sexuelle Differenzierung aufgrund einer chromosomalen Abberation gestört ist wie z. B. beim Turner-Syndrom (s. Kap. 4.2.1), können alle anderen angeführten Infertilitätsfaktoren Frauen betreffen, die vor ihrem unerfüllten Kinderwunsch nicht an mögliche Komplikationen gedacht haben. Die wichtigsten Ursachen für Infertilität bei Frauen sind (Tabelle 4.18): Störungen in der Funktion der Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse können • durch die mangelnde Östrogenbildung in den Hormonzellen der Follikel zum Ausbleiben der Follikelreifung im Eierstock und zur Anovulation führen. Selbst nach erfolgter Ovulation kann aufgrund einer zu geringen LH-Ausschüttung der Hypophyse die Progesteronbildung im Gelbkörper nicht ausreichend stimuliert werden und als Folge die Einnistung des Embryos in die Gebärmutterschleimhaut nicht gelingen (s. Kap. 4.2.5). Aufgrund einer fehlerhaften Regulation der Biosynthese der Sexualsteroide im Eierstock kann es zu einem erhöhten Androgenspiegel der Frau kommen, der für ein polyzystisches Ovar, das PCO-Syndrom16 verantwortlich ist. 16 Eine gesteigerte Anzahl von heranreifenden Follikeln (20-100) anstatt der normalen Zahl von 3-7 Eizellen führt dazu, dass sich kein Leitfollikel ausbildet und bis zum Eisprung heranreift. Alle Follikel im polyzystischen Ovar werden atretisch. Fortpflanzungsbiologie • • • • • 359 Eine erhöhte Prolaktinkonzentration im Blut – ein Prolaktinspiegel über 20 ng/mL gilt als pathologisch – kann eine Vielzahl von Ursachen haben: Medikamente (Psychopharmaka), Schilddrüsenunterfunktion und chronische Niereninsuffizienz. Können diese körperlichen Erkrankungen ausgeschlossen werden, ergibt sich anamnestisch relativ häufig eine erhöhte Stressbelastung der Frauen und in der Folge ein erhöhter Prolaktinspiegel. Daher ist Prolaktin nicht nur als Milchhormon (Steuerung der Milchsekretion in den Brustdrüsen), sondern auch als „Stresshormon“ bekannt. Aus biologischer Sicht ist diese endokrine Reaktion unter körperlichen und psychischen Belastungen adaptiv, denn sie erschwert oder verhindert bei Stress die (erneute) Schwangerschaft einer Frau.17 Die Folge der Hyperprolaktinämie ist eine reduzierte GnRH-Sekretion durch den Hypothalamus, wobei die Pulsfrequenz und die Menge des Releasing-Hormons absinken. Dadurch kommt es zu einer mangelnden Stimulation der Hypophyse, die weniger LH und FSH ausbildet. Diese Veränderungen führen zur Störung der Follikelreifung, Anovulation und schließlich zu mangelnder Progesteronsynthese im Corpus luteum (Knuth et al. 2000). Die Passage der Spermien bis zur Eizelle kann durch die gestörte Bildung des Zervixmukus, Entzündungen der Eileiter z. B. durch Chlamydien (bakterienähnliche Mikroben), Endometriose18, Verwachsungen oder Bindegewebswucherungen in den Eileitern blockiert sein und die Befruchtung des Eies verhindern, bzw. das befruchtete Ei kann den Eileiter nicht verlassen und in die Gebärmutter gelangen, um sich dort einzunisten. Angeborene Fehlbildungen im Urogenitaltrakt sind durch Störungen während der embryonalen, sexuellen Differenzierung bedingt, welche die Müller’schen Gänge betreffen (s. Kap. 4.2.2.). Es können der Uterus, die Eileiter und die Vagina betroffen sein, gegebenenfalls wird durch eine Operation die Funktionsfähigkeit der Organe wieder hergestellt werden müssen. Eine erworbene Fehlbildung des Uterus stellen Myome (Geschwulst aus Muskelfasern der Gebärmutterwand) dar, die sich bei ca. 20% der über dreißigjährigen Frauen feststellen lassen. Sie können die Ursache für eine ausbleibende Schwangerschaft bzw. für einen Abort sein, so dass die Myome durch eine Operation entfernt werden müssen, wenn sie die Konzeption und das Austragen der Schwangerschaft gefährden. Liegen bei einer Frau keine hormonellen oder anatomischen Faktoren der Infertilität vor, kann das Immunsystem des Zervikal- oder Vaginalmukus Antikörper gegen Spermien ausgebildet haben. Obwohl das weibliche Immunsystem typischerweise trotz der großen Anzahl an potentiell antigen 17 Die Unterdrückung der normalen Funktion der Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse und damit das Ausbleiben von Follikelreifung und Ovulation funktioniert auch bei stillenden Frauen unter der Bedingung, dass der Prolaktinspiegel einen gewissen Minimalwert nicht unterschreitet. Dafür muss eine Mutter ihr Kind täglich mehrmals stillen. 18 Ansiedelung von Endometriumgewebe (Gebärmutterschleimhaut) in den Eileitern, teilweise bis hin in den Bauchraum der Frau. Endometriumzellen und -fragmente können während der Menstruation retrograd aus dem Uterus in die Eileiter und darüber hinaus gelangen und sich dort implantieren. 360 Lebenszyklus wirkenden Spermien, die beim ungeschützten Koitus aufgenommen werden, nicht aktiviert wird, haben sich vermutlich bei 2–3% der Frauen Spermienantikörper ausgebildet. Die Anwesenheit von Spermienantikörpern im Mukus der Frau ist mit der Zahl lebender Spermien negativ korreliert, aber ein signifikanter Zusammenhang von Spermienantikörpern mit der Schwangerschaftsrate konnte bisher nicht direkt nachgewiesen werden. Körperliche Faktoren der Infertilität bei Männern Der Beitrag des Mannes zur Fertilität eines Paares beschränkt sich im somatischen Bereich auf die Produktion der Spermatozoen und die Befruchtung seiner Partnerin während des Sexualaktes, also auf den Zeugungsakt. Danach ist der Einfluss des Mannes auf die Entstehung eines neuen Menschen nur noch indirekt durch den Schutz und die Versorgung seiner Partnerin möglich. Störungen der Fertilität des Mannes beruhen auf der Funktionsunfähigkeit der Testes, der ableitenden Samenwege (Nebenhoden und Samenleiter) und der Samendisposition, also auf der Unfähigkeit, seine Spermien in den Körper der Frau zu bringen. Obwohl der Mann nicht mehr für die Versorgung und Weiterentwicklung der von ihm befruchteten Eizelle zuständig ist, gibt es in seinem reproduktiven System eine große Zahl möglicher Ursachen für Infertilität (Tabelle 4.19). Nach Schätzungen dürften im Laufe ihres Lebens ungefähr 7% der Männer mit der Störung ihrer Zeugungsfähigkeit konfrontiert sein (Nieschlag 2000). • • • Aufgrund einer angeborenen Störung im Bereich des Hypothalamus, dem idiopathischen hypogonadotropen Hypogonadismus, der durch eine zu geringe Ausschüttung des Gonadotropin-Releasing Hormons (GnRH) gekennzeichnet ist, kommt es bei Männern in der Folge zu einem Mangel der Hypophysenhormone FSH (Follikelstimulierendes Hormon) und LH (Luteinisierendes Hormon). Durch den Mangel an LH und FSH kann in den Hoden weder eine Reifung der Keimzellen noch eine nennenswerte Testosteronproduktion stattfinden, so dass in der Pubertät die Entwicklung bei den betroffenen Jungen ausbleibt oder nur ansatzweise erfolgt. Ohne Hormonsubstitution mit GnRH oder den Gonadotropinen LH und FSH bleiben die Männer aufgrund ihrer Azoospermie (keine Spermatozoenbildung) lebenslang infertil. Eine konstitutionelle Entwicklungsverzögerung (KEV) liegt vor, wenn die Pubertätsentwicklung (s. Kap. 4.2.2) bei einem Jungen nicht bis zum Alter von 14 Jahren eingesetzt hat. Die normale Alterspanne liegt zwischen 8 Jahren bis zum 14. Geburtstag. Die KEV wird als extreme zeitliche Variante der normalen pubertären Entwicklung angesehen, da sie in ihrer zeitlichen Abfolge und in der Reihenfolge der Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale der Jungen der Norm entspricht. Dieses Phänomen der „nachgehenden biologischen Uhr“ tritt familiär, allerdings auch spontan auf. Prolaktin produzierende Adenome in der Hypophyse sind die häufigste Ursache für eine Hyperprolaktinämie, den erhöhten Spiegel des Prolaktins (bei der Frau bekannt als „Milchhormon“ in der Stillphase), aber auch ver- Fortpflanzungsbiologie 361 Tab. 4.19. Infertilität bei Männern Körperliche Faktoren Störungen des Hypothalamus/Hypophyse n Idiopathischer hypogonadotroper Hypogonadismus: angeborene Störung der GnRHSekretion n konstitutionelle Entwicklungsverzögerung: „nachgehende biologische Uhr“ n Hyperprolaktinämie: Auslöser können Adenome, Medikamente und Drogen sein Störungen im Bereich der Hoden n Anorchie (fehlende Hoden): Angeborene Anorchie (fetaler Hodenverlust), erworbene Anorchie (Erkrankung) n Lageanomalien der Hoden: Testes sind im Bauchraum verblieben (Maldescensus testis) n Germinalaplasie bzw. Sertoli-Cell-Only Syndrom: Hodenepithel enthält keine Keimzellen n Chromosomenanomalien mit angeborenem Hypogonadismus: Testesvolumen: < 3 mL n Hodenatrophie: durch systemische Erkrankungen (Leberzirrhose, Niereninsuffizienz, Arteriosklerose) n Orchitis: Entzündung der Hoden mit Keimzellschädigung Störungen im Bereich der ableitenden Samenwege n Angeborene Anomalien oder Obstruktionen: Verschluss der Samenwege n immunologische Infertilität: Autoimmunreaktionen gegen Spermien n Infektionen durch Bakterien, Viren und Chlamydien im Ejakulat n Störungen der Samendisposition: Penisdeformation, Erektionsstörung, Ejakulationsstörung • • schiedene Medikamente, chronische Niereninsuffizienz oder eine Schilddrüsenunterfunktion können eine Hyperprolaktinämie auslösen. Leichte Erhöhungen des Prolaktinspiegels als Stressreaktion können auch beim Mann durch körperliche und psychische Belastungen ausgelöst werden. Ungünstige Stressverarbeitungsstrategien, die eher zur Stressverstärkung als zum Stressabbau führen, korrelieren bei Männern und Frauen, die sich wegen ihres Kinderwunsches in Therapie befinden, ebenfalls signifikant positiv mit ihrem Prolaktinspiegel (Hars 2002). Die Folge ist eine Störung der pulsatilen GnRH-Freisetzung im Hypothalamus, die wiederum die Ausschüttung von FSH und LH vermindert und dadurch die männlichen reproduktiven Funktionen beeinträchtigt. Zu den schwersten Störungen im Bereich der Testes gehört die Anorchie, die angeboren (Häufigkeit 1:20 000, Monoorchie: Häufigkeit 1:5000) oder durch Verletzungen, Entzündungen oder aufgrund der Operation eines Tumors entstanden sein kann. Bei der angeborenen Anorchie, bei der die Hoden zur Zeit der sexuellen Differenzierung noch das Anti-Mullerian Hormone (AMH) aber kein Testosteron mehr produziert haben, haben die betroffenen Männer ein weibliches äußeres Genitale, obwohl ein XY-Geschlechtschromosomensatz vorliegt (Nieschlag et al. 2000). Es gibt verschiedene Lageanomalien der Hoden, die bei bestimmten Krankheitsbildern aufgrund von angeborenem Hypogonadismus oder Chromo- 362 • • • • • • Lebenszyklus somenaberrationen auftreten, sie können aber auch ungeklärte Ursachen (idiopathische Störungen) haben. Wenn der Hoden entweder oberhalb des Inguinalkanals (Leistenkanal) im Bauchraum liegt, im Leistenkanal steckt oder dort mobil liegt und nur ins Skrotum herabgedrückt werden kann, kommt es durch Überhitzung zu histologischen Veränderungen des Hodenepithels. Die Folgen reichen von einer verringerten Spermatogenese bis zu einem Sertoli-Cell-only-Syndrom mit einem vollständigen Ausbleiben der Spermatogenese. Die Fertilitätseinschränkungen bis hin zur Infertilität sind zudem von einem 4-5fach erhöhten Hodentumor-Risiko begleitet. Bei der Germinalzellaplasie oder dem Sertoli-Cell-Only-Syndrom befinden sich in den Hodentubuli nur Sertoli-Stützzellen, aber keine Keimzellen. Die Testosteronproduktion in den Leydig-Zellen des Hodens (s. Kap. 4.2.5) ist ungestört, so dass die Männer ansonsten eine normale männliche körperliche Entwicklung haben und von ihrer Infertilität erst erfahren, wenn sie kein Kind zeugen können. Ursachen für die Germinalzellaplasie sind Mikrodeletionen des Y-Chromosoms, exogene Schädigungen durch ionisierende Strahlen oder Lageanomalien der Testes. Chromosomenanomalien wie z. B. das Klinefelter-Syndrom (Häufigkeit von 0,2% in der männlichen Bevölkerung) sind die häufigste Ursache für den angeborenen Hypogonadismus (Hodenvolumen 1-2 mL, normale Werte beim Mann zwischen 12 und 30 mL). Das Klinefelter-Syndrom beruht auf einer angeborenen Chromosomenaberration (47, XXY-Karyotyp bis 49,XXXXY-Karyotyp), die durch Non-Disjunction in den meiotischen Teilungen während der Keimzellentwicklung oder in frühembryonalen mitotischen Teilungen entsteht (Nieschlag et al. 2000). Durch eine Vielzahl von systemischen Erkrankungen wie z. B. Leberzirrhose, Nierenerkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen, Diabetes mellitus und Arteriosklerose (Durchblutungsstörungen) kommt es sekundär zu Schädigungen der Hoden, die zu Hypogonadismus und Störungen der Spermatogenese führen, die in ihrem Ausmaß mit der Schwere der Erkrankung variieren (Handelsman 2000). Eine Entzündung der Hoden, die Orchitis, ist die Folge von Viruserkrankungen (z. B.Mumps), Pneumokokken, Salmonellen, Gonokokken oder unspezifischen bakteriellen Erregern, deren zunächst im Körper ausgelöste Entzündungen auf die Hoden übergreifen können. Gefährlich ist insbesondere eine Mumpserkrankung, die nach Eintreten der Pubertät ohne Behandlung zu irreversiblen Schäden der Spermatogenese (Keimzellenschädigung bis hin zum Sertoli-Cell-Only-Syndrom) führen kann und dadurch im Extremfall zu lebenslanger Infertilität des Mannes. Zu den wichtigsten Störungen im Bereich der ableitenden Samenwege gehören Infektionen durch Chlamydien, Viren und Bakterien. Die entzündlichen Prozesse führen aufgrund der Infektion zu Narbenbildungen und dadurch zum Verschluss der Samenwege, der nur durch rechtzeitige medikamentöse Behandlung reversibel ist. Angeborene anatomische Anomalien oder durch Vasektomie (operative Durchtrennung der Samenleiter) entstandene Verschlüsse sind hingegen nicht immer operativ zu beheben. Den betroffenen Männern bleibt dann Fortpflanzungsbiologie • • 363 nur noch die Möglichkeit, durch eine künstliche Befruchtung ihrer Partnerin mit Spermien, direkt aus dem Hoden oder Nebenhoden gewonnen, ein Kind zu zeugen. Es kann zur Bildung von Anti-Spermien-Antikörpern (ASA) kommen, wenn durch Verletzungen oder Infektionen die Blut-Hoden-Schranke zerstört wurde und immunkompetente Zellen aus dem Serum mit Spermatozoen in Kontakt kommen. Die ASA sind im Serum, frei im Seminalplasma und direkt an Spermatozoen gebunden nachweisbar. ASA können zu einer Störung der Fertilität führen, indem sie die Beweglichkeit der Spermien im weiblichen Genitaltrakt behindern sowie ihre Fähigkeit, den Zervixmukus zu durchdringen. Störungen der Samendisposition beruhen größtenteils auf sexuellen Funktionsstörungen wie Libidostörungen (fehlende sexuelle Lust), mangelnder Erektionsfähigkeit des Penis und Ejakulationsproblemen, die hauptsächlich auf psychische Ursachen zurückzuführen sind. Es gibt auch anatomische Penisveränderungen, die angeboren oder durch Verletzungen verursacht sein können. Die Erektionsfähigkeit des Penis kann durch organische (Gefäße, Nerven) oder hormonelle Faktoren beeinträchtigt sein, wobei vermutlich 50-80% aller organisch bedingten Erektionsstörungen auf arterielle Durchblutungsstörungen der Gefäße im Penis zurückzuführen sind (Ahlen u. Hertle 2000). Einfluss von Umweltfaktoren auf die Fertilität von Frauen und Männern Bei Frauen und Männern kann die Fruchtbarkeit durch natürlich vorkommende und synthetische Stoffe negativ beeinflusst werden. Die Angriffspunkte der Umwelteinflüsse sind vielfältig: Schädigung der noch nicht ausgereiften Keimzellen (Primordialfollikel und Spermatogonien), Störung der Oogenese und Spermatogenese, nach erfolgreicher Verschmelzung von Eizelle und Spermium kann die Einnistung des befruchteten Eies behindert oder das Absterben des bereits eingenisteten Embryos bewirkt werden. In vielen Lebensbereichen lässt sich die Exposition des Menschen gegenüber fertilitätsmindernden Fremdstoffen nicht immer leicht vermeiden, besonders wenn es sich um Umweltchemikalien oder ionisierende Strahlung (Radioaktivität) handelt. Sehr viel bedeutender in der Wirkungsbreite sind jedoch alltäglich konsumierte „Genussgifte“, denn sie werden meistens freiwillig in einer Dosis mit viel höheren Wirkungsgraden zugeführt als klassische Umweltchemikalien. Kaum jemand macht sich klar, welches Risiko der Fertilitätsminderung eingegangen wird, wenn Alkohol, Tabak, Marihuana, Opiate, selbst koffeinhaltige Getränke (im Übermaß) konsumiert werden oder der Lebensstil zu einer starken Stressbelastung führt. Gerade deshalb ist es wichtig, das Ausmaß möglicher Toxizität dieser Parameter auf Keimzellen und Fertilität von Frauen und Männern zu kennen. Umweltchemikalien und ionisierende Strahlung. Schädigungen der Fruchtbarkeit von Frauen und Männer sind bei einigen Chemikaliengruppen und für ionisierende Strahlung inzwischen vielfach untersucht worden (Hanf 1998, Brink- 364 Lebenszyklus worth u. Handelsman 2000). Es konnten bei Frauen und Männern schädigende Wirkungen auf etliche Organe nachgewiesen werden: die Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse (GnRH-, LH-, FSH-, und Testosteronproduktion), Entwicklung der Eizellen bzw. Spermatozoen, Produktion genitaler Sekrete im Nebenhoden und der Samenblase beim Mann, Motilität und Durchblutung des inneren Genitale bei der Frau und auf die Libido von beiden Geschlechtern. Ständiger Kontakt mit Asbest, Anästhetika (Glykolether), Lösungsmitteln, chemischen Reinigungsmitteln, Schwermetallen wie Blei19, ionisierender Strahlung aus der natürlichen Umgebung oder Röntgenstrahlung z. B. bei medizinischen Untersuchungen20, Pestiziden und Holzschutzmitteln führt bei Frauen und Männern nachweislich zur Einschränkung ihrer Fertilität. Sexualhormone: Östrogene. Bereits pränatal können künstliche Östrogene wie Diethylstilbroestol (DES), die über die Versorgung durch die schwangere Mutter aufgenommen werden, den männlichen Fötus schädigen. In der Zeit von 1940–1971 wurde schwangeren Frauen DES verabreicht, um bei Abortgefahr die Schwangerschaft zu erhalten. Bei männlichen Embryonen kam es dadurch während der pränatalen Zeit zu einer verminderten Sertoli-ZellenReplikation. Nach der Geburt wiesen die Jungen verschiedene genitale Fehlbildungen (z. B. Hodenhochstand) auf, im Erwachsenenalter hatten die betroffenen Männer eine verminderte Spermatozoenproduktion, auch eine erhöhte Neigung zu Hodenkrebs wurde festgestellt. Mindestens bis Anfang der siebziger Jahre wurde DES auch dem Futter für die Rindermast beigefügt und ist dadurch vermutlich über die Nahrungskette in den menschlichen Körper gelangt, wobei Knaben vorgeburtlich über die Mutter, postnatal durch ihren eigenen Milch- und Fleischkonsum geschädigt werden konnten. Östrogene haben bei Männern eine hemmende Wirkung auf die Ausschüttung des Follikelstimulierenden Hormons und damit auf die Sertoli-Zellen, wodurch sich durch das Hodengewicht verringert und die Stimulation der Spermatogenese unterdrückt wird. Zu weiterem Kontakt mit Östrogenen kann es bei der (ungeschützten) Herstellung östrogenhaltiger Kontrazeptiva bzw. der Handhabung von östrogenwirksamen Pflanzengiften kommen. Auch Phytoöstrogene aus Pflanzen (z. B. bei Soja-Bohnen), östrogenähnliche Inhaltsstoffe in Bier oder in Milch schwangerer Kühe haben bei Männern durch übermäßigen Genuss eine negative Wirkung auf die Fertilität. Auch für Frauen ist eine unkontrollierte 19 Eine Gefährdung der Fertilität bei Frauen oder Männern durch Amalgamfüllungen, die Blei enthalten, wurde nicht gefunden. Bei zahnärztlichem Personal, das durch Ausbohren alter Füllungen im Sprühnebel der Bohrung mit Wasserkühlung intensiv mit Amalgam in Kontakt kommt, wurde bei 30 Füllungen pro Woche ein signifikanter Effekt auf die Fruchtbarkeit (nur noch 63% der Fertilisierungschancen unbelasteter Frauen) nachgewiesen. 20 Geringe Strahlenbelastung führt beim Mann zur Reduzierung der Spermienanzahl im Ejakulat, hohe Dosen können ein Ausbleiben der Spermatogenese über mehrere Jahre bewirken bis hin zu irreversiblen Schädigungen der Keimzellen. Bei Frauen lösen niedrige Dosen von Röntgenstrahlen eine temporäre Amenorrhoe (Ausbleiben der Regelblutung) aus. Bei stärkerer Belastung können Mutationen im Genom der Eizelle auftreten und je nach Ausmaß der Strahlenbelastung eine bleibende Sterilität. Für elektromagnetische Strahlung (Elektrosmog) ist bisher noch kein nachweisbarer Effekt auf die Fertilität von Frauen und Männern nachgewiesen worden. Fortpflanzungsbiologie 365 Zufuhr von exogenen Östrogenen keinesfalls unbedenklich, denn diese sind nicht wie körpereigene Östrogene an inaktivierende Trägerproteine gebunden, sondern sofort biologisch aktiv, wenn sie in den Blutkreislauf gelangen. So können sie unkontrolliert in den Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Regelkreis eingreifen und ihn möglicherweise stören. Lebensstil Stress. Für etliche Infertilitätssyndrome ist in den letzten Jahren eindeutig Stress als Ursache ausgemacht worden. Psychosoziale Belastungen können über verschiedene Kommunikationswege zwischen Gehirn und Fortpflanzungsorganen die Fertilität beeinflussen. Stress setzt neuroendokrinologische Mechanismen in Gang, die durch die Aktivierung des autonomen Nervensystems oder erhöhte Cortisolausschüttungen aus der Nebennierenrinde zu einer erniedrigten Pulsrate von GnRH im Hypothalamus führen. Bei Männern kann dadurch die Spermiogenese beeinträchtigt werden, bei Frauen kommt es durch diese psychosomatischen Abläufe zu Zyklusstörungen. Aufgrund kontrollierter Fallstudien wurden bei infertilen Paaren mit diesen Symptomen signifikant häufiger psychosoziale Belastungen als bei fertilen Kontrollgruppen gefunden. Selbst die Auseinandersetzung mit dem unerfüllten Kinderwunsch korreliert signifikant mit entscheidenden Fertilitätsparametern. Die Folgen waren bei den Männern eine deutliche Einschränkung der Spermienqualität, Spermienanzahl und Spermienmorphologie21 aufgrund der verringerten FSH-Ausschüttung, bei infertilen Frauen war dementsprechend die Eireifung gestört, und es kam nicht zur Ovulation (Hars 2002). Nikotingenuss. Die negativen Auswirkungen von Nikotingenuss bei Frauen in der Schwangerschaft auf die Entwicklung eines ungeborenen Kindes sind gut dokumentiert, der Einfluss auf die Fekundität ist hingegen schwerer nachzuweisen. Ein Einfluss von moderatem Rauchen (bis zu 10 Zigaretten pro Tag) auf die Konzeptionschancen ist bisher nicht gefunden worden, obwohl in experimentellen Studien gezeigt wurde,dass Nikotin die Kontraktilität von Uterus- und Eileitermuskulatur und dadurch den Gametentransport beeinträchtigt. Auch kann Nikotin die Durchblutung der Einnistungsstelle im Endometrium des Uterus herabsetzen sowie direkt auf die Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse negativ wirken. Es gibt Hinweise für eine direkte schädigende Wirkung auf die Primordialfollikel noch ungeborener Mädchen mit rauchenden 21 Männer mit ausgeprägt maskulinem Rollenideal sind in modernen Gesellschaften starkem sozialem Stress ausgesetzt, der durch ihre Konkurrenz- und Wettstreitmentalität bedingt ist. In einer eher anonym lebenden Großstadtbevölkerung sind sie ständig zu neuen „Rangordnungskämpfen“ gezwungen, um ihren Status aufrecht zu erhalten. Es ließ sich in einer psychobiologischen Studie (Christiansen et al. 1997) belegen, dass gerade diese Männer eine hochsignifikant schlechtere Spermienqualität (Morphologie, Motilität und Quantität) hatten als androgyn typisierte Männer, die sich eine weibliche und männliche Rollenausrichtung zuschreiben und nicht so stark zu intramännlichen Positionskämpfen neigen. 92% der maskulin orientierten Männer wiesen pathologische Spermiogramme auf, und auch der tatsächliche Schwangerschaftserfolg war bei androgynen Männern viermal höher, unabhängig von der Fertilitätsdiagnose bei ihrer Partnerin. 366 Lebenszyklus Müttern, die bei den betroffenen Mädchen im Erwachsenenalter zu einer höheren Wahrscheinlichkeit der Kinderlosigkeit führt. Auch die Follikel im Ovar von Raucherinnen werden geschädigt, so dass diese Frauen früher in die Menopause (s. Kap. 4.2.7) kommen als Nichtraucherinnen. Wissenschaftliche Studien über den Einfluss von Rauchen auf die Fertilität der Männer belegen eine leichte Reduzierung der Spermienzahl und der Spermienbeweglichkeit im Ejakulat. Bei einem Nikotinkonsum von mehr als 20 Zigaretten pro Tag wurde eine direkte Wirkung auf die innere Faserstruktur der Spermatozoenflagella nachgewiesen, die zur Verminderung der Spermatozoenmotilität führt. Nikotin im Sekret des Ejakulats wirkt zusätzlich schädlich auf die Beweglichkeit der Spermatozoen. Experimentell wurde nachgewiesen, dass in Spermaflüssigkeit von starken Rauchern die Motilität der Spermien von Nichtrauchern deutlich sinkt und ebenso Spermien von Rauchern in der Samenflüssigkeit ohne Nikotinbelastung ihre Beweglichkeit verbessern (Zavos et al. 1998a, 1998b). Alkohol. Exzessiver Alkoholkonsum übt bei Männern eine direkte, toxische Wirkung auf die Spermiogenese aus. Indirekt kommt es durch eine alkoholbedingte Leberzirrhose zu einer Hodenatrophie und Hypogonadismus (verminderte Testosteronsynthese in den Leydig-Zellen) mit negativen Auswirkungen auf die Spermatozoenreifung und auf die Zeugungsfähigkeit. Bei Frauen sind schädigende Wirkungen von Alkohol auf die Entwicklung des ungeborenen Kindes, die Alkoholembryopathie (Wachstumsverzögerung, Fehlbildungen am Schädel und postkranialen Skelett und geistige Retardierung) eindeutig belegt. Eine Minderung der Fekundität ist bisher nicht nachgewiesen worden, allerdings scheint die Abortrate bei Alkoholkonsum erhöht zu sein. Überhitzung. Erhöhte Temperatur in der direkten Umgebung der Hoden gehört zu den am besten untersuchten schädigenden Einflüssen. Selbst kurze Perioden erhöhter Temperatur durch umwelt- oder arbeitsplatzbedingte Hitzeexposition führen zu einem deutlichen Abfall der Spermienproduktion und damit der Fekundität eines Mannes. Experimentell konnte durch lokale Erhitzung des Skrotums sogar eine kontrazeptive Wirkung erzielt werden, die sich jedoch nicht praktisch umsetzen ließ. Ungewollt ist wohl die Hitzeeinwirkung bei Männern, die als Berufsfahrer durch längeres Sitzen am Steuer (ohne Unterbrechung über 3 Stunden) oder durch Tragen von sehr engen Hosen ihre Fertilisierungschancen ebenfalls verringern dürften. Sportausübung. Junge Sportlerinnen, die Sportarten (Ballett, Laufen, Radfahren, Triathlon) ausüben, bei denen ein geringes Körpergewicht von Vorteil ist, haben häufig eine verspätete Menarche. Viele von ihnen werden bereits im Kindergarten ausgewählt, früh gefördert und intensiv trainiert (Wolf u. Sterzik 1998). Als Ursachen für das Ausbleiben der ersten Regelblutung wurden neben dem niedrigen Körpergewicht der Mädchen vor Beginn des Leistungssports die physische Belastung durch das Training, extreme Ernährungsgewohnheiten oder auch Essstörungen genannt. Sobald das intensive Training eingestellt wird und sich das Körpergewicht normalisiert, setzt die normale pubertäre Entwicklung ein. Fortpflanzungsbiologie 367 Bei erwachsenen Leistungssportlerinnen (vor allem bei Langstreckenläuferinnen, Balletttänzerinnen und Gymnastinnen), welche die Pubertät mit Menarche vor dem Beginn des Leistungssports durchlaufen haben, kann es während der Belastungsphasen durch intensives Training immer wieder längere Zeiten mit anovulatorischen Zyklen und ausbleibender Menstruation geben. Als Ursachen für die Zyklusstörungen wurden eine genetische Disposition, ein geringes Körpergewicht verbunden mit einer signifikanten Abnahme des Körperfettanteils22, einer Kalorienreduktion23 oder einer hohen Trainingsintensität24 gefunden. Bei Männern haben kurzzeitige, körperlich anstrengende Sportübungen (5–30 Minuten) einen stark aktivierenden Effekt auf die Produktion von Testosteron sowie auf die Ausschüttung von LH und FSH aus der Hypophyse (Überblick in Christiansen 1999). Von geringer Bedeutung scheint die ausgeübte Sportart zu sein, solange der Körper wie beim Kurzstreckenlauf, Rudern, Schwimmen, Ergometertraining und Judokämpfen stark belastet wird. Ebenso typisch wie die schnelle Erhöhung des Gonadotropinspiegels und der Testosteronwerte ist bereits nach 15-60 Minuten der rapide Abfall aller Werte unter den Basiswert vor Trainingsbeginn. Bis sich die Hormonspiegel wieder normalisiert haben, vergehen in Abhängigkeit von der Intensität der vorangegangenen körperlichen Belastung 3 Stunden bis zu 3 Tage. Etwas überraschend dürfte der Befund sein, dass hochtrainierte Leistungssportler trotz ihres athletischen Erscheinungsbildes niedrigere Androgenwerte als untrainierte Männer haben. Elias und Wilson (1993) erklärten dieses Phänomen mit einer unterdrückten Hypophysen-Gonaden-Funktion durch körperlichen Stress. Langfristiges Leistungstraining löse im Körper eine „Kampfoder-Flucht-Reaktion“ aus, die zu einer Absenkung der Testosteronproduktion unter lebensbedrohlichen oder feindlichen Umweltbedingungen führe. Dadurch werde die Fertilität eines Mannes verringert, was seine Überlebenschancen oder die seiner Gruppe erhöhen solle,da weniger Geburten mehr Flexibilität im Verhalten zulassen. Die Androgenausschüttung beim Mann würde deshalb unter Dauerbelastung nicht kompensatorisch erhöht, sondern die normale Testosteronproduktion beibehalten. Diese diene aber vordringlich der Sicherung des überlebenswichtigen Kampf- oder Fluchtverhaltens. Die dadurch ebenfalls 22 Das von den Fettzellen produzierte Leptin ist für die Steroidhormonsynthese wichtig (s. Kap. 4.2.2). Es wurden bei Sportlerinnen mit Amenorrhö signifikant niedrigere Körperfettanteile und signifikant geringere Leptinwerte als bei einer nicht Sport treibenden Kontrollgruppe festgestellt (Laughlin et al. 1997). Weiterhin leisten Fettzellen einen wichtigen Beitrag zur peripheren Umwandlung von Androgenen im Blut in Östrogene. 23 Eine Erklärung für Zyklusstörungen durch Kalorienreduktion könnte die Energiekonservierung des Körpers sein. (Williams et al. 1995) Bei unzureichender Kalorienzufuhr werden Prozesse des Körpers heruntergefahren, die Energie verbrauchen aber nicht direkt zur Lebenserhaltung notwendig sind. Hierzu gehört zu Beispiel ein ovulatorischer Zyklus für die monatliche Bereitstellung einer befruchtungsfähigen Eizelle. 24 Die pulsatile LH-Sekretion der Hypophyse wird durch die erhöhte β-Endorphinausschüttung während des intensiven Trainings oder Wettkampfes gehemmt und dadurch die Follikelreifung im Eierstock unterdrückt (Harber et al. 1997). 368 Lebenszyklus verursachte Absenkung von Libido und Fertilität werde in Kauf genommen und sei aus evolutionsbiologischer Sicht ein „erwünschter“ Nebeneffekt. 4.2.7 Menopause Im Laufe der Individualentwicklung der Frau gibt es in Bezug auf ihre Fortpflanzungsfähigkeit verschiedene Lebensphasen. Obwohl bereits vorgeburtlich ungefähr 10 Millionen Oozyten oder Primordialfollikel in den Ovarien eingebettet sind, hat ein Mädchen nach der Geburt noch nicht die Fähigkeit zur Fortpflanzung. Erst mit ihrer Geschlechtsreife im Alter von 11 bis 15 Jahren können sich die Primordialfollikel unter dem Einfluss der Gonadotropine LH und FSH aus der Hypophyse so weit entwickeln, dass monatlich eine Oozyte heranreifen und als befruchtungsfähige Eizelle den Eierstock verlassen wird (s. Kap. 4.2.5). Die fruchtbare Phase einer Frau endet meist gegen Ende des fünften Lebensjahrzehnts zwischen dem 45.–55. Lebensjahr. Das äußerlich sichtbare Kennzeichen für den unwiderruflichen Verlust der Fortpflanzungsfähigkeit ist nach einer Zeit mit unregelmäßigen, seltener werdenden Menstruationsblutungen das endgültige Ausbleiben der Blutung, das klinische Zeichen für das Erlöschen der generativen Ovarialfunktion25 (Box 4.9). Das Ende der Reproduktionsfähigkeit der Frau ist die Folge der unzureichenden Östrogenproduktion in den Ovarien, da die Granulosazellen der Follikel (s. Kap. 4.2.5) jetzt nur schwach oder gar nicht mehr auf die Stimulation durch das Follikelstimulierende Hormon (FSH) reagieren (Adashi 1996). Dadurch können die Androgene aus den Stromazellen von den Granulosazellen nicht mehr in Östrogene umgewandelt werden.26 So gibt es keine Eireifung mehr, und die noch im Eierstock vorhandenen primordialen Keimzellen werden allmählich fest vom Ovarialgewebe eingeschlossen. Hingegen bleibt die Sekretion von Androstenedion, einem männlichen Sexualhormon, aus den Stromazellen und Hilarzellen des Ovars27 auch in der Postmenopause lange erhalten. Sie sind jetzt die einzige Quelle der Sexualhormonsynthese. Aller25 Die Ovarien sind neben der Thymusdrüse die einzigen endokrinen Organe, die ihre Funktion lange vor Ende des Lebens einstellen. Die Ovarien erreichen ihr maximales Gewicht ungefähr im 28. Lebensjahr, danach beginnt zunächst ein langsamer Gewichtsverlust der Ovarien, der bis zum 40. Lebensjahr zunimmt und mit der Menopause beendet ist. Der Substanzverlust geht von durchschnittlich 12 cm3 auf 4 cm3. 26 Die Östrogenproduktion im Ovar dürfte nach der Menopause auch in den Stromazellen stattfinden, allerdings auf einem sehr niedrigen Niveau, das bei weitem nicht für die Follikelreifung ausreicht. Verschiedene Studien belegen, dass die Östradiol- und Östronkonzentration im ovariellen Blut noch zweimal höher als im peripheren Blut außerhalb des Eierstocks ist. Die bei weitem überwiegende Menge an Östrogenen im Blutserum wird jedoch außerhalb des Ovars im Unterhautfettgewebe sowie der Haut durch Aromatisation von Androstenedion zu Östron gewonnen. 27 Stromazellen sind lipidreiche Zellen, die den Thekazellen (Bindegewebszellen im Ovar) ähneln, die während der reproduktiven Phase der Bildungsort für Androgene sind. Hilarzellen liegen im Zentrum des Ovars. Ihre embryonale Herkunft ähnelt den Leydig-Zellen (Ort der Testosteronbiosynthese) im Hoden. Sie reagieren im Gegensatz zu den Granulosazellen jetzt sogar verstärkt auf das Gonadotropin LH mit der Androgensynthese. Fortpflanzungsbiologie 369 Box 4.9 Erlöschen der generativen Ovarialfunktion – Begriffsdefinitionen n Klimakterium oder Perimenopause: die Zeitspanne, die von der reproduktiven Phase zur nicht mehr reproduktiven Phase einer Frau überleitet.Das Klimakterium wird durch die Menopause in einen prä- und postmenopausalen Abschnitt geteilt. n Prämenopause: klimakterische Phase vor der letzten Menstruationsblutung, gekennzeichnet durch Gelbkörperinsuffizienz und dadurch entsprechend niedrige Progesteronwerte. n Menopause: die letzte vom Ovar gesteuerte Regelblutung. Dieser Zeitpunkt kann erst retrospektiv nach mindestens einjähriger Amenorrhö (Ausbleiben der Regelblutung) bestimmt werden. n Postmenopause: Zeit nach der letzten Regelblutung, das Erlöschen der generativen Ovarialfunktion. Die endokrine Ovarialfunktion (Produktion von Sexualhormonen) verringert sich in Bezug auf Östrogene und Progesteron, erlischt aber nicht für Androgene. dings werden die Stromazellen in der Menopause hyperplastisch, und ihre Androgenproduktion steigt deshalb gelegentlich so an, dass Androgenwerte im männlichen Normalbereich synthetisiert werden. Das führt zu einer unerwünschten Maskulinisierung der betroffenen Frauen, insbesondere zu einer verstärkten männlichen Behaarung (Bart, Schambehaarung bis an die Oberschenkel und bis zum Bauchnabel hochgezogen). Obwohl die physiologischen Vorgänge für das Erlöschen der reproduktiven Funktionen des Ovars ausschlaggebend sind, bestimmen weitere exogene und endogene Parameter den Zeitpunkt der Menopause bei jeder Frau individuell (Kirchengast 1999). Es werden diesbezüglich folgende Einflüsse diskutiert: genetische Determination (signifikante Korrelationen des Menopausealters zwischen Mutter und Tochter und weiteren weiblichen Verwandten), psychosoziale Faktoren wie der Familienstand (Verheiratete und Ledige kommen später in die Menopause als geschiedene oder verwitwete Frauen); sozioökonomischer Status und damit verbundene Parameter wie Schulbildung und Beruf (je höher der gesellschaftliche Status, desto später setzt die Menopause ein), Körperfett bzw. Ernährungsstatus (früheres Menopausealter bei vegetarischer oder sehr kalorienarmer Ernährung), Körperbautyp (Frauen mit gynoider Fettverteilung haben eine spätere Menopause als bei männlicher Fettverteilung), Kinderzahl (zumeist ein positiver Zusammenhang von Geburtenzahl und Menopausealter) und Nikotinkonsum (starkes Rauchen führt zu deutlicher Vorlegung der Menopause um bis zu fünf Jahre). Die Folgen des Rauchens für die weibliche Fertilität betreffen die Funktion des Hypothalamus-Hypohysenvorderlappens sowie di- 370 Lebenszyklus rekt die Follikel im Ovar der erwachsenen Frau. Die Follikel bilden sich dadurch früher zurück und werden atretisch (abgeschlossen im Ovar). Die Abnahme der Oozytenzahl ist direkt abhängig von der Nikotindosis. Zusätzlich wurde in Experimenten auch die Hemmung der Umwandlung von Androgenen in Östrogene in den Granulosazellen des Follikels festgestellt (Lauritzen 1989). Der zeitliche Beginn der Menopause scheint wie das Menarchealter einem säkularen Trend zu folgen. Zur Vorlegung des Menarchealters (s. Kap. 4.2.2) kommt jedoch eine später einsetzende Menopause hinzu, so dass insgesamt die reproduktive Lebensspanne der Frauen im letzten Jahrhundert immer länger wurde (Panke-Koschinke 1996). Es gibt jedoch auch eine Reihe von Studien, in denen keine Verzögerung des Menopausebeginns gefunden wurde (Kirchengast 1999). Klimakterisches Syndrom. Während des Klimakteriums können vegetative, somatische und psychische Symptome (Tabelle 4.20) auftreten, die für diese Phase der hormonellen Umstellung typisch sind, aber keinesfalls nur im Klimakterium auftreten können. Das Ausmaß der Beschwerden variiert bei den betroffenen Frauen sehr stark, obwohl das Östrogendefizit bei allen vorhanden ist. Etwa ein Drittel aller Frauen durchlebt diese Zeit ohne subjektive Symptomatik im vegetativen, somatischen oder psychischen Bereich. In einem weiteren Drittel der Fälle werden subjektive Veränderungen besonders im Bereich des vegetativen Nervensystems wahrgenommen, insbesondere Hitzewallungen und Schweißausbrüche. Sie werden aber als natürliche Begleiterscheinungen der Wechseljahre registriert und verlieren sich nach einiger Zeit ohne ärztliche Behandlung. Beim letzten Drittel der klimakterischen Frauen werden die Veränderungen so belastend erlebt, dass eine medizinische Behandlung notwendig wird. Die unterschiedliche Reaktion der Frauen ist medizinisch schwer zu erklären. Eine modifizierende Rolle für das Erleben der klimakterischen Symptomatik scheinen psychosoziale Variablen zu spielen wie Zufriedenheit mit der Partnerschaft und der eigenen Erwerbstätigkeit bzw. Hausfrauenrolle, Aus- Tabelle 4.20. Häufigkeit klimakterischer Beschwerden Symptom Hitzewallungen, Schweißausbrüche Schlafstörungen Reizbarkeit, Nervosität, Stimmungsschwankungen Atrophie und Trockenheit der Haut Atrophie und Trockenheit des Vaginalepithels urologische Symptome wie Zystopathie Schwindel Absinken der Libido Herzklopfen, Herzrasen, Herzrhythmusstörungen Depressive Verstimmungen Osteoporose (Risiko einer Fraktur) mit 50 bzw.75 Jahren Häufigkeit in % 79,9 78.5 61,2 58,7 46,7 25,8 43,6 43,2 41,2 16,2 1 bzw. 32 Fortpflanzungsbiologie 371 maß der sexuellen Aktivität, gemeinsames Leben mit Kindern (Seehafer 2001, Seehafer u. Christiansen 2001) und die Geschlechtsrollenidentifikation in männliche Richtung (Armin-Baas 1995). Von Bedeutung ist sicher auch die angeborene oder erworbene hohe Sensibilität für hormonelle Schwankungen, wie sie viele Frauen schon während des normalen Menstruationszyklus haben. Es zeigte sich bei Hormonmessungen, dass Frauen mit starken klimakterischen Beschwerden tatsächlich niedrige Östrogenspiegel haben, vor allem aber starke Schwankungen der Östrogenwerte im Tagesverlauf erleben. Die klimakterischen Beschwerden stehen nachweislich in ätiologischem Zusammenhang mit dem Östrogenentzug, da sie durch Östrogengaben deutlich gebessert werden oder ganz abklingen können. Zu den wichtigsten vegetativen Symptomen gehören Hitzewallungen28, meist in Kombination mit Schweißausbrüchen, Herzrhythmusstörungen und Schwindel. Die häufigsten organischen Symptome sind Osteoporose (Knochenabbau), Zystopathie (Blasenstörungen mit Harninkontinenz), Arteriosklerose, Atrophie der Haut und des Vaginalepithels. Psychische Symptome betreffen depressive Verstimmungen, erhöhte Reizbarkeit, Aggressivität, Stimmungsschwankungen, erhöhte Empfindsamkeit, Spannungsgefühle und Schlafstörungen. Alle vegetativen Symptome lassen sich vorübergehend durch Östrogensubstitution behandeln, wobei vor allem in der Zeit des Klimakteriums, also der „Wechseljahre“ bei einigen Frauen aufgrund starker Beeinträchtigungen der Wunsch danach besteht. Allerdings müssen Kontraindikationen wie ein erhöhtes Brustkrebsrisiko berücksichtigt werden. Auch bei den organischen Veränderungen verhindert eine Östrogensubstitution bereits auf einem niedrigen Niveau die Abbauprozesse. Die Osteoporose beruht auf einer Störung des Knochenstoffwechsels, dem ständigen Umbau des Knochens auf zellulärer Ebene29. Im Alter wird die “Knochenbilanz“ leicht negativ, durch den peri- und postmenopausalen Östrogenmangel beschleunigt sich die Demineralisierung des Knochens um 5% bis 7% pro Jahr30. Nach dieser Zeit geht der rasche Substanzverlust wieder in einen langsameren Knochensubstanzabbau über, hört aber nicht ganz auf (Husmann 1995). Zudem verstärken körperliche Inaktivität, mangelnde Kalziumaufnahme mit der Nahrung und Vitamin D-Mangel den Knochenabbau. Durch die Osteoporose treten vor allem distale Speichen- und 28 Hitzewallungen entstehen durch akute Herabsetzung des „set point“ des thermoregulatorischen Zentrums im Hypothalamus, die durch den Zustand des fortschreitenden Östrogenentzugs im Klimakterium und nicht durch andauernd niedrige Östrogenspiegel ausgelöst wird. In der Menopause mit konstant niedrigem Östrogenspiegel hören auch die Hitzewallungen allmählich auf. 29 Durch ständige Knochenresorption auf zellulärer Ebene durch Osteoklasten (Makrophagen, welche die Knochensubstanz abbauen) und Knochenneubildung durch Osteoblasten (plasmareiche, knochensubstanzaufbauende Zellen) wird ca. 4-10% des Knochenvolumens pro Jahr erneuert. 30 Bei Männern hat ein Testosteronmangel den gleichen Effekt des Knochenabbaus wie Östrogenmangel bei Frauen. Sinken bei Männern im Alter die Testosteronspiegel im Blut langsam, aber kontinuierlich ab, kommt es bei ihnen ebenfalls zu Osteoporose, die sich durch Bruchverletzungen bereits bei kleinen Stürzen zeigt. 372 Lebenszyklus Oberarmknochenbrüche, Oberschenkel- und Beckenfrakturen und Wirbelbrüche auf. Letztere verursachen eine schubweise Verformung der Wirbelkörper („Sinterung“). Osteoporose ist schließlich im Senium eine Ursache für die Reduktion der Körperhöhe um ca. 3%. Neben der Absenkung des Fußgewölbes verursachen zusätzliche die Einsturzbrüche an den Wirbelkörpern einen Rundrücken, den „Witwenbuckel“, der zu einer gebeugten Haltung und somit zu einer geringeren Körperlänge führt. In der Menopause wird durch geringe Konzentrationen die schützende Wirkung des Östrogens auf das Gefäßendothel31 (Innenauskleidung der Blutgefäße) deutlich geringer, was zu einer Arteriosklerose („Arterienverkalkung“ durch Verhärtung, Verdickung, Elastizitätsverlust der Arterienwand) wie z. B. der Herzkranzgefäße führen kann. Dadurch erhöhen sich die Thrombosegefahr und die Häufigkeit und Schwere von Herzkreislauferkrankungen. Bereits im Klimakterium beginnen typische Veränderungen des Körperbaus der Frau, die bis in die Postmenopause anhalten. Es kommt zu einer Erhöhung des Körpergewichts um durchschnittlich 5–10 kg, so dass Frauen im Alter von 50 bis 55 Jahren im Allgemeinen das höchste Körpergewicht im Verlaufe ihres Lebens erreichen, da sich im Senium das Körpergewicht allmählich wieder verringern wird. Als Ursachen gelten die Reduktion des Grundumsatzes (herabgesetzter Stoffwechsel), eine Abnahme der Schilddrüsenfunktion sowie eine Verringerung der Konzentration von Wachstumshormonen, die eine stark lipolytische32 Wirkung haben. Proportionsverschiebungen des Körperbaus von Frauen entstehen durch die Veränderungen des Sexualhormonspiegels. Geringere Östrogenwerte bei gleichzeitig erhöhtem Androgenspiegel verändern die typisch weibliche Fettverteilung der Frau in Richtung einer männlichen Fettverteilung. Der quantitativ größere Anteil des Körperfettes befindet sich bei Frauen im Bereich des Unterkörpers im Bereich der Brust, Oberschenkel, Hüften und des Gesäßes. Zusätzlich wird nun Fett am Schultergürtel, Oberarmen und Rücken eingelagert. Evolution der Menopause: Das Ende der reproduktiven Phase lange vor dem Tod einer Frau ist aus evolutionsbiologischer Sicht ein erstaunliches Phänomen. Es steht im Widerspruch zum Prinzip der Fitnessmaximierung, wenn eine Frau nicht während ihres ganzen Lebens Nachwuchs bekommt, sondern fast 25 bis 30 Jahre vor ihrem Tod ihre reproduktive Phase beenden muss. Lange Zeit wurde angenommen, dass die Menopause ein einzigartiges, menschliches Phänomen darstellt. Erst ab den späten siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurde in Labor und Freilandstudien bei einigen Säugetieren das Ende der reproduktiven Phase, eine „Menopause“, in einem beträchtlichen Zeitraum vor dem Tod des Tieres beobachtet. Es handelt sich dabei hauptsäch- 31 Unter dem Einfluss von Östrogenen vermindert sich die Aufnahme von LDL-Cholesterin in die Gefäßwände, was z. B. der Vorbeugung von Thrombosen dient. 32 Der Abbau von Körperfett durch Wachstumshormone wird seit einigen Jahren bei der Behandlung von Übergewicht auch aus rein kosmetischen Aspekten genutzt, was medizinisch umstritten ist. Fortpflanzungsbiologie 373 Tabelle 4.21. Menopause bei Säugetieren Weibchen der Spezies Menopausealter (in Jahren) Maximales Lebensalter (ungefähre Angaben in Jahren) Rhesusaffe Schimpanse Bonobo (Zwergschimpanse) Hausrind Pferd Büffel Ratte, Hamster, Kaninchen, Meerschweinchen 25–30 40–44 35–40 15–21 15–21 15–21 48–50 40 30 30 30 1 ¼– 1 ½ 3 lich um sozial lebende Spezies, bei denen Großmütter, Mütter, Kinder und Tanten usw. in einer Gruppe leben (Tabelle 4.21). Da bei den beobachteten Gruppen von Primatenweibchen und weiblichen Tieren anderer Spezies der Zeitpunkt der Menopause äußerst variabel zu sein scheint, die Tiere im Freiland auch oft früh sterben und somit das artspezifische Menopausealter oft gar nicht erreicht wird, können diese Befunde nur bedingt als Modell für die Menopause bei Frauen dienen. Erschwerend kommt hinzu, dass bei Untersuchungen an Tieren kein Alterszeitpunkt gefunden wurde, wo alle noch lebenden Weibchen der Spezies keine Kinder mehr bekamen. Es gibt einen weiteren wichtigen Unterschied zwischen dem Ende der Reproduktionsfähigkeit nicht-menschlicher Primaten und der Menopause bei Menschen. Frauen erleben die Menopause im zweiten Drittel ihres Lebens, bei den anderen Primaten wurde das Ende der reproduktiven Phase erst in einem Alter relativ kurz vor dem artspezifischen Todeszeitpunkt gefunden. Die lange postreproduktive Lebensphase bei Frauen ist daher einmalig im Tierreich, und es stellt sich die Frage, warum durch die natürliche Selektion beim Menschen ein Ende der weiblichen Reproduktionsfähigkeit hervorgebracht wurde, das im Durchschnitt 20 bis 30 Jahre vor dem Tod einer Frau liegt. Der wissenschaftliche Diskurs über den adaptiven Wert der Menopause betrifft zwei unterschiedliche Ansätze: Das erste Modell, die Großmutter-Hypothese (Box 4.10), postuliert, dass sich im Laufe der Evolution ein „Menopause-Gen“ im Genpool ausbreitete, da die natürliche Selektion jene Frauen bevorzugt hätte, die ihre eigene Reproduktionsfähigkeit frühzeitig beendeten. Die Menopause ist danach eine selbständige Anpassung und nicht als ein Nebenprodukt anderer adaptiver Merkmale entstanden. Der zweite Ansatz, die Pleiotropie33-Hypothese (Box 4.11) geht davon aus, dass die Menopause und damit eine längere Lebenszeit nach dem Ende der eigenen fertilen Lebensphase nicht direkt selektiert wurden, sondern dass diese Merkmale nichts als ein Nebenprodukt eines anderen adaptiven Merkmals seien. Nur aufgrund der Verlängerung der maximalen Lebensspanne der Men- 33 gleichzeitige Beeinflussung und Ausprägung mehrerer Merkmale durch ein Gen 374 Lebenszyklus Box 4.10 Evolution der Menopause, Großmutter-Hypothese oder Theorie des elterlichen Investments in eigene Kinder (Mutter-Theorie) Durch die Menopause erhöht sich die Fitness einer Frau, denn sie hat nach dem Ende ihrer eigenen Reproduktionsfähigkeit mehr Zeit, um n bei der Aufzucht ihrer Enkelkinder zu helfen und deren Überlebenschancen zu erhöhen.Dadurch steigen die Zahl ihrer Nachkommen und der Erfolg bei der Reproduktion ihrer Gene (Großmutter-Hypothese). n verstärkt in bereits vorhandene Kinder zu investieren und damit deren Überlebenschance bis zur eigenen Reproduktionsfähigkeit zu steigern (Mutter-Theorie).Empirische Belege und Gegenbeweise für diese Theorien liefern folgende Arbeiten: n Bei Frauen, die zwischen 1675 bis 1875 in Nordamerika lebten, war der Reproduktionserfolg höher als der jener Frauen, die vor der Menopause verstorben waren (Mayer 1982).Keinen entsprechenden Unterschied fanden dagegen Hill & Hutardo (1991), die Ache-Frauen in Paraguay untersuchten. n Bei den Hazda in Tansania wurde das Food-sharing Modell bei Jägern und Sammlern untersucht (Hawkes et al.1997, 1998; Blurton Jones et al.1996). Ihre Studien zeigten,dass postmenopausale Frauen erfolgreicher sammeln und daher besser eigene abhängige Kinder und auch ihre Enkelkinder unterstützen können. n Die durch höhere Gehirnentwicklung bedingte physiologische Frühgeburt der Kinder und die lange postnatale Abhängigkeit verlangt eine längere intensive Pflege der Mutter. Das ist ein Vorteil für Kinder, die keine nachgeborenen Geschwister mehr haben (Peccei 1995, 2001). schen trete bei Frauen das Phänomen des Erlöschens der generativen Ovarialfunktion überhaupt offen zu Tage. An diesem Punkt setzt auch Kritik an der Großmutterhypothese an. Die Selektion eines Merkmals, das im Laufe der menschlichen Evolution aufgrund der kurzen Lebensspanne nicht auftauchen konnte, sei nicht möglich. Erst durch verbesserte Umweltbedingungen in den letzten Jahrtausenden stieg die mittlere Lebenserwartung der Menschen soweit, dass die Menopause überhaupt erlebt werden konnte. Die Menopause könne daher kein Ereignis sein, dass unabhängig von anderen genetisch determinierten Merkmalen entstanden sei. Sie sei vielmehr der Schlusspunkt eines Fortpflanzungsbiologie 375 Box 4.11 Evolution der Menopause, Pleiotropie-Hypothese n Menopause als Konsequenz der Verlängerung der maximalen Lebensspanne Die Arbeit von Williams (1957) über „Pleiotropy, natural selection, and the evolution of senescence“ stellte eine Theorie vor, die erklärt, warum derselbe Mechanismus, der in frühen Lebensphasen für die Reproduktionsfähigkeit der Frau optimal ist, im fortgeschrittenen Lebensalter zur Erschöpfung des Vorrats an entwicklungsfähigen Priomordialfollikeln führt. n Diese antagonistische Pleiotropie ermöglicht zunächst, dass die große Zahl von Oozyten im Eierstock durch die gleichzeitige Reifung einer Kohorte von Follikeln, sich der dominante Graf-Follikel optimal weiter entwickeln kann, während die anderen mit heranreifenden Follikel noch im Ovar atretisch werden, bevor es zum Eisprung des Leitfollikels nach seiner voller Entwicklung kommt (s. Kap. 4.2.5). Als Nebeneffekt dieses aufwendigen Prinzips kommt es zur relativ raschen Degeneration des ovariellen Systems, lange bevor andere Organe es Körpers ähnliche Abbauerscheinungen zeigen. Erhöhte Missbildungs- und Fehlgeburtsraten bei älteren Müttern sowie die ovarielle Erschöpfung lange vor der genetisch vorprogrammierten maximalen Lebensspanne von 100 bis 150 Jahren sind die Folge unseres Fortpflanzungssystems (Pawelka u. Fedigan 1991). Jahrzehnte langen Entwicklungsprozesses der Primordialfollikel oder Oozyten, der schließlich in der Atresie der Follikel endet (s. Kap. 4.2.5). Auf Basis der Kenntnisse über die Funktionsweise des weiblichen Fortpflanzungssystems ist der antagonistischen Pleiotropie-Hypothese am ehesten zuzustimmen. Die sehr große Zahl von Follikeln, die in den zwanziger und dreißiger Jahren einer Frau zur Optimierung der Reifung des Leitfollikels für den Fortpflanzungserfolg unerlässlich sind, kompensiert bei weitem die relativ frühe Beendigung der Fertilität lange vor dem zu erwartenden Lebensende der Frau und ist deshalb als adaptives Merkmal anzusehen. 4.2.8 Vitalität und Reproduktionsfähigkeit des älteren Mannes Mit zunehmendem Alter verringert sich bei Männern stetig die Produktion des wichtigsten Sexualhormons Testosteron. Auch die Androgene aus der Nebennierenrinde, Dehydroepiandrosteron (DHEA) und sein Sulfat DHEAS, die peripher in Testosteron umgewandelt werden können, nehmen mit steigendem Alter kontinuierlich ab (Vermeulen et al. 1996). Das dadurch allmählich entste- 376 Lebenszyklus hende Androgendefizit des älteren Mannes wird mit verschiedenen Begriffen wie Testosteron-Mangel-Syndrom (TMS) oder „late onset“-Hypogonadismus (spät einsetzende Hodenunterfunktion) belegt. International hat sich die Bezeichnung PADAM durchgesetzt, das in der deutschen Sprache für partielles Androgendefizit des alten Mannes steht. Nicht mehr gebräuchlich sind heutzutage die Bezeichnungen „Klimakterium virile“ oder „Andropause“ die als Analogien für das Klimakterium und die Menopause der Frau (s.Kap.4.2.7) verstanden werden könnten, die aber dem biologischen Geschehen beim Mann in wesentlichen Punkten nicht entsprechen. Obwohl bei beiden Geschlechtern die Produktion des jeweils wichtigsten, in den Keimdrüsen produzierten Sexualhormons betroffen ist, kommt es bei Männern altersbedingt lediglich zu einem partiellen Androgendefizit. Von der Menopause sind ausnahmslos alle Frauen ab einem bestimmten Alter betroffen, während nur ca. 20–35% der erwachsenen Männer ein erhebliches Androgendefizit (Testosteronwerte zwischen 2–4 ng/ mL bzw. 7–12 nmol) aufweisen, das sich schleichend über Jahrzehnte entwickelt hat. Zwischen dem vierzigsten und siebzigsten Lebensjahr sinkt das biologisch aktive, freie Testosteron im Blutserum um ca. 1,2% im Jahr (Vermeulen et al. 1972), so dass 20% der Männer über 60 Jahre, 30% der über Siebzigjährigen und 50% der Männer über 80 Jahre einen deutlich erniedrigten Testosteronspiegel aufweisen. Vor allem die biologisch aktive Form, das freie, nicht an das sexualhormonbindende Globulin (SHBG) gebundene Testosteron verringert sich besonders stark und dadurch zwangsläufig die Verfügbarkeit des Hormons (Feldman 2002, Harman et al. 2001, Kaufman u. Vermeulen 2004). Auch die DHEA-Konzentration im Blut verringert sich nach den Maximalwerten im jungen Erwachsenenalter stetig, so dass im 8. und 9. Lebensjahrzehnt die DHEA-Titer nur noch 10-20% der Werte junger Männer erreichen (Bélanger et al.1994). Im Gegensatz zu den hormonellen Veränderungen in der Menopause der Frauen verläuft der Abfall der Androgenproduktion bei alternden Männern jedoch nicht einheitlich und zeitlich relativ schwer vorhersagbar. Vor allem gibt es keinen Lebensabschnitt, in dem alle Männer als Folge des Androgenmangels ihre reproduktiven Fähigkeiten verloren haben. Ursächlich für das Androgendefizit ist nicht wie bei menopausalen Frauen die zunehmende Unfähigkeit der östrogenproduzierenden Follikel in den Ovarien auf die Ausschüttung der gonadotropen Hormone LH und FSH zu reagieren, sondern die Leydig-Zellen in den Hoden werden vor allem durch eine zu geringe Gonadotropinausschüttung aus der Hypophyse nicht mehr ausreichend zur Testosteronsynthese stimuliert. Durch die Verringerung der GnRH-Produktion des Hypothalamus kommt es bei gleicher Pulsfrequenz zu einer verminderten Pulsamplitude der LH-Ausschüttung. Als Folge ist auch die Tagesrhythmik der Testosteronsekretion in den Hoden aufgehoben, so dass bei älteren Männern statt eines morgendlichen Gipfels nur noch Testosteronwerte auf dem niedrigen,abendlichen Niveau gemessen werden können (Veldhuis et al.1992). Androgenmangelsyndrom Allein in Europa lebten im Jahr 2000 nach Angaben des United Nations Department of Economic and Social Affairs - Population Division knapp 59 Mio. Fortpflanzungsbiologie 377 Männer über 60 Jahre. Die Prognosen für das Jahr 2050 gehen von 96 Mio. Männern dieses Alters aus. Die Zahl sehr alter Männer über 80 Jahre wurde im Jahr 2000 mit 22 Mio. angegeben, wobei eine Steigerung auf rund 60 Mio. im Jahr 2050 erwartet wird (Diszfalusy 2000). In Anbetracht dieser Zahlen sind die Folgen eines Androgenmangelsyndroms bei älteren Männern von erheblicher Bedeutung – für die betroffenen Männer und die Gesellschaft. Die Folgen des absinkenden Androgenspiegels sind vielfältig und umfassen vor allem körperliche Veränderungen, Libidoverlust, Störungen der Stimmungslage und Absinken der geistigen Leistungsfähigkeit. Die Symptome können das Ausmaß klinischer Relevanz mit objektivierbaren Kriterien erreichen, aber auch als subjektive Beschwerden ohne Krankheitswert bis hin zu Befindlichkeitsstörungen auftreten. Zu den somatischen Veränderungen gehören eine verminderte Mineralisation des Knochens mit der Folge einer Osteopenie (Abnahme von Knochengewebe im höheren Alter) oder Osteoporose (Verlust bzw. Verminderung der Knochensubstanz und -struktur ) mit Knochenschmerzen zumeist am Rücken und einem erhöhten Frakturrisiko (Snyder et al. 1999a, Rolf u. Nieschlag 2000, Orwoll 1996), Reduktion der Muskelmasse bis hin zu Atrophie der Muskulatur (Bross et al. 1999), Zunahme des viszeralen Fettgewebes (Snyder et al. 1999b) und Gewichtszunahme (Rolf et al. 2002), vasomotorische Symptome wie aufsteigende Hitze, Hitzewallungen, Frösteln (Ginsburg 1996), Verringerung der männlichen Körperbehaarung (Jockenhövel 2003), eine erhöhte Inzidenz von Autoimmunerkrankungen (Tenover 1994) sowie Verlust der sexuellen Potenz durch erektile Dysfunktion (Swerdloff u. Heber 1982, Morgentaler 1999). Als psychosomatische Beschwerden werden die Verringerung der Libido (Hajjar et al. 1997), vegetative Dysfunktionen wie Schwindelgefühl, Pulsrasen, Gleichgewichtsstörungen, chronische Müdigkeit und Antriebsschwäche (Tietz et al. 1992) genannt. Niedrige Testosteronspiegel stehen auch mit einer depressiven Stimmungslage älterer Männer in Zusammenhang (Seidman et al. 2002), die sich durch Testosteronsubstitution signifikant verbessern lässt (Wang et al. 1996, Nieschlag u. Behre 2000, Christiansen 2004). In Querschnittsuntersuchungen bei alternden Männern wurde eine positive Korrelation zwischen freiem Testosteronspiegel und kognitiver Leistungsfähigkeit festgestellt, die sich insbesondere bei Gedächtnis, Konzentrationsfähigkeit und sprachlichen Leistungen zeigte (Literaturüberblick in Janowsky et al. 1994, Yaffe et al. 2002). Altersassoziierte körperliche und psychische Veränderungen werden oft durch ein erhöhtes Anspruchsdenken der betroffenen Männer an die eigene Virilität, Aktivität und Leistungsfähigkeit als besonders belastend erlebt. Die Befragung von Degenhardt u. Schmidt (1994) mittels eines „Klimakterium-Virile“-Inventars zeigte dementsprechend, dass die befragten Männer im Alter von 46 bis 55 Jahren ihre Befindlichkeit hauptsächlich als „Psychisches Energieverlustsyndrom“34 wahrnehmen, obwohl die klinischen Daten einschlägi- 34 Der Faktor „ Psychisches Energieverlustsyndrom“ ist geprägt durch Gefühle der Sinnlosigkeit und Minderwertigkeit, depressive Verstimmung, Störungen der Konzentration und des Gedächtnisses und gesteigerte Reizbarkeit. 378 Lebenszyklus ger Studien gerade im körperlichen Bereich objektiv erheblich mehr Einschränkungen erkennen lassen. Eine Therapie des Androgenmangelsyndroms bei älteren Männern, deren Testosteronwerte im hypogonadalen Bereich liegen (unter 4 ng/mL bzw. 12 nmol/l), birgt wie alle Hormontherapien erhebliche Risiken (Nieschlag u. Behre 2000). So bedeutet ein latentes Prostatakarzinom (eine Testosteronsubstitution kann aber kein Prostatakarzinom induzieren!) eine absolute Kontraindikation. Bei der Einbindung in ein regelmäßig durchgeführtes Überwachungsprogramm, das auch weitere Risiken wie z. B. kardiovaskuläre Erkrankungen oder ein Schlafapnoe-Syndrom (schlafbezogene Atemstörung) kontrolliert, kann die Testosteronsubstitution zur Behandlung der somatischen und psychischen Beschwerden eingesetzt werden, um die Lebensqualität hypogonadaler Männer wieder zu verbessern. Reproduktive Funktionsfähigkeiten älterer Männer In der Regel nimmt die Häufigkeit sexueller Aktivitäten mit zunehmendem Alter der Männer ab. Für diesen Rückgang gibt es viele Gründe – medizinische Probleme wie kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes mellitus, Einnahme von Psychopharmaka und oft auch psychische Faktoren wie Langeweile beim Sexualverkehr, geringes Interesse bei der Partnerin und der Glaube, Sex sei nichts für Alte und körperlich Schwache. (Zilbergeld 1983). Andererseits ergab eine Befragung von Männern von 16 bis über 55 Jahre, dass eine erhebliche Diskrepanz zwischen der männlichen Libido (Sexualtrieb) und der tatsächlichen sexuellen Betätigung bei den befragten Männern im Alter über 40 Jahren besteht. Der mit dem Alter stetig zunehmend geäußerte Wunsch nach mindestens täglichem Sexualverkehr wird von deutlich abnehmender sexueller Aktivität des älter werdenden Mannes begleitet: im Durchschnitt gaben die über 55-jährigen Männer an, seltener als ein Mal pro Woche Sex zu haben, womit sie exakt der sexuellen Aktivität und erwünschten Häufigkeit von den befragten gleichaltrigen Frauen entsprechen (Eysenck 1980). Trotz der deutlich verringerten sexuellen Aktivität älterer Männer bleibt ihre Zeugungsfähigkeit grundsätzlich erhalten. Beim vorhandenen Kinderwunsch eines Paares ist die relativ seltene Vaterschaft von Männern über 60 Jahre vor allem durch die verminderte oder gänzlich erloschene Fekundität der Frau bedingt. Während Geburten von 50jährigen Frauen extreme Einzelfälle darstellen, können Männer durchaus noch im Alter von über 70 Jahren Vater werden, wenn ihre Partnerin noch konzeptionsfähig ist. Eine Untersuchung von Centola u. Eberly (1999) über die Zeugungsfähigkeit älterer Männer ergab keine altersbedingten Veränderungen des Ejakulatsvolumens, der Spermatozoenzahl und -morphologie, lediglich die Motilität der Spermatozoen verringerte sich signifikant mit dem Alter der Männer, die Werte gaben aber keinen Hinweis auf eine generelle Fertilitätseinschränkung. Es gibt etliche Hinweise für die Bedeutung des Alters bezüglich der Qualität des genetischen Materials der Spermatozoen. Als Ursache für diese Störungen gelten erhöhte Mutationsraten durch Strahlung und chemische Noxen; außerdem teilen sich ab der Pubertät die Spermatogonien 23mal pro Jahr. Das heißt, Fortpflanzungsbiologie 379 Tabelle 4.22. Dominant oder rezessiv vererbte Syndrome beim Kind in Abhängigkeit vom Alter des Vaters n Achondroplasie (Störung der Knochenbildung, Minderwuchs) n Apert-Syndrom (u. a. Turmschädel, Löffelhände, d. h. die Finger (2–5) sind zusammengewachsen) n Marfan-Syndrom (Bindegewebserkrankungen im kardiovaskulären System und in den Augen) n Aniridie (vollständiges oder teilweises Fehlen der Iris) n Bilaterales Retinoblastom (Netzhauttumor) n Crouzon-Syndrom (Störung der Knochenbildung) n Lesch-Nyhan-Syndrom (Störung des Harnsäurestoffwechsels, Muskelhypotonie, geistige Behinderung) n Treacher-Collins-Syndrom (Dysplasien am Gesichtsschädel) n Renales polyzystisches Syndrom (Nierenfehlbildung) n Progerie (vorzeitige Vergreisung) im Alter des Mannes von 35 Jahren haben die Urkeimzellen bereits 540 Zellteilungen durchgemacht, die Spermatogonien eines 45jährigen Mannes haben ungefähr 750 Zellteilungen, so dass Mutationen als Resultat von Fehlern bei den wiederholten DNA-Replikationen im Alter vermehrt auftreten können (Crow 1997). Ungefähr 50% der Fälle von Klinefelter-Syndrom (s. Kap. 4.2.1) werden auf altersabhängige Störungen der meiotischen Teilungen beim Vater zurückgeführt. Außerdem gilt mittlerweile für etliche autosomal dominant vererbte Krankheiten das erhöhte Alter des Vaters als Erklärung (Tabelle 4.22). Das Risiko für diese Erkrankungen liegt in der Höhe von ~ 0,3 bis 0,5% der geborenen Kinder mit einem Vater über 40 Jahre, was dem Risiko für eine Trisomie 21 (Down-Syndrom) bei Kindern mit Müttern zwischen 35 und 40 Jahren entspricht (Auroux 1998). Das väterliche Alter und damit die Qualität des genetischen Materials hat sogar für die Leistungsfähigkeit des Gehirns einen messbaren Einfluss. Versuche an Ratten (Auroux 1983) hatten gezeigt, dass Versuchstiere von älteren Vätern in einem Lernexperiment signifikant schlechtere Leistungen als Tiere von jüngeren Vätern (bei gleichbleibend jungen Müttern) hatten. Reihenuntersuchungen an über 12 000 französischen Rekruten (Auroux et al. 1989, Auroux 1998) belegen, dass das väterliche Alter auch Auswirkungen auf deren Ergebnisse in psychometrischen Tests hatte. Es ergab sich ein parabolischer Zusammenhang zwischen Testleistung und väterlichem Zeugungsalter: Am besten schnitten Rekruten mit Vätern ab, die zum Zeitpunkt der Zeugung um 30 Jahre alt waren, während die Söhne von jüngeren Männern und Vätern über 30 bis 60 Jahre schwächere Leistungen zeigten. Die Autoren interpretierten ihre Ergebnisse dahingehend, dass die genetische Qualität der Spermatozoen nach der Pubertät ansteigt, im Alter von 30 Jahren ein Maximum erreicht und danach kontinuierlich abfällt. In Bezug auf die psychologischen Testleistungen 380 Lebenszyklus müssten jedoch auch psychosoziale Einflüsse berücksichtigt werden, die in dieser Studie jedoch nicht gemessen wurden. Zusammenfassung Kapitel 4.2 Fortpflanzungsbiologie n Die Evolution der sexuellen Vermehrung führte zu einem Sexualdimorphismus in körperlichen Merkmalen und im Verhalten der Partner, der sich in zahlreichen Merkmalen manifestiert. n In der Fortpflanzungsbiologie geht es um die Frage,warum die Fertilität von Individuum zu Individuum variiert und warum es Fertilitätsdifferenzen zwischen verschiedenen menschlichen Gruppen gibt. n Die sexuelle Differenzierung eines Individuums kann in verschiedene Stadien unterteilt werden, die sich nacheinander in einer festgelegten Abfolge bedingen. Die Geschlechtsidentität eines Menschen entwickelt sich jedoch erst im Laufe der Ontogenese. n Die Wirkungen von Testosteron, Östradiol und Progesteron gehen über die biologischen Prozesse der Sexualentwicklung hinaus und sind ebenfalls von Bedeutung für das sexuelle Interesse und das sexuelle Verhalten eines Menschen. n Sexuelle Konkurrenz steht mit der Investition in die Nachkommenschaft inVerbindung und führt zur Ausprägung geschlechtsspezifischer Verhaltensstrategien. n Nach der Pleiotropie-Hypothese sind Menopause und damit längere Lebenszeit nach dem Ende der fertilen Lebensphase der Frau nicht direkt selektiert worden, sondern ein Nebenprodukt anderer adaptiver Merkmale. n Im Gegensatz zu den hormonellen Veränderungen in der Menopause der Frau verläuft der Abfall der Androgenproduktion bei Männern nicht einheitlich und es gibt keinen Lebensabschnitt,in dem alle Männer ihre reproduktiven Fähigkeiten infolge Androgenmangels verloren haben. Angewandte Anthropologie 5.1 Industrieanthropologie 5.1.1 Definition und Forschungsgegenstand In einer Welt, in der fast alle Gegenstände der Arbeits- und Wohnumwelt industriell gefertigt sind, ist es erforderlich, Produkte und Arbeitsmittel den körperlichen Bedürfnissen und Gegebenheiten des Menschen anzupassen. Die dafür notwendige Datenbasis liefert die Industrieanthropologie, die sich – mit Blick auf die industrielle Gestaltung unserer Arbeits- und Wohnumwelt – mit den morphologischen, physiologischen und verhaltensbiologischen Eigenschaften des Menschen befasst. Dabei ist es von vorrangiger Bedeutung, geeignete Daten zu erheben und die Menschen gewissermaßen als Nutzerpopulation industriell gefertigter Produkte angemessen zu beschreiben. Damit ist die Industrieanthropologie ein spezielles Gebiet der angewandten Anthropologie. Ursprünglich stand die Bereitstellung von anthropometrischen Daten, die auf der Basis der traditionellen standardisierten Messtechnik gewonnen wurden, für industrielle Zwecke im Vordergrund der Forschung, wobei Normung (Box 5.1) und Unfallschutz zu den wichtigsten Aufgabenfeldern gehörten (Jürgens 1977). Mittlerweile haben zahlreiche neue anwendungsbezogene Fragen und neue Methoden das Forschungsgebiet der Industrieanthropologie erheblich erweitert, wodurch es auch zu etlichen Überschneidungen mit der Ergonomie (Arbeitswissenschaft) gekommen ist. Heute befasst sich die Industrieanthropologie auch mit der Entwicklung, Optimierung und Prüfung von Produkten unter humanbiologischen oder ergonomischen Gesichtspunkten. Basierend auf der klassischen statischen Anthropometrie wurden neue industrieanthropologisch relevante Körpermaße, wie etwa Reichweiten, Greifräume oder Körperwinkelketten, entwickelt, die besondere Funktionen berücksichtigen. Darüber hinaus wird die Schnittstelle zwischen Mensch und industriell gestalteter Wohn- und Arbeitsumwelt auch mit Methoden untersucht, die sich von der klassischen Anthropometrie recht weit entfernt haben. 382 Angewandte Anthropologie Box 5.1 Normung Durch Normung werden Standards für Erzeugnisse und Verfahren festgelegt. Die entstehenden Normen sind anerkannte Regeln, die als allgemein gültige Empfehlungen zu sehen sind. In Deutschland ist das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN) der Träger der Normung, innerhalb dieser Organisation gibt es für verschiedene Fachgebiete Normenausschüsse. Das DIN ist auch Mitglied des Europäischen Komitees für Normung (CEN – Commission Européenne de Normalisation) und als nationales Normeninstitut Mitgliedskörperschaft der Internationalen Normenorganisation (ISO – International Standards Organisation). Das CEN dient vorrangig der Harmonisierung innerhalb der EU, um die Vollendung des europäischen Binnenmarktes zu unterstützen.Das Ziel der ISO ist die Förderung der Normung in der Welt, um den Austausch von Dienstleistungen und Gütern in der Welt zu vereinfachen und die gegenseitige Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen voranzutreiben. Einige DIN-Normen sind von vorrangiger Bedeutung für die Industrieanthropologie, dies gilt insbesondere für DIN 33402-1(Körpermaße des Menschen; Begriffe, Messverfahren), DIN 33402-2 (Körpermaße des Menschen; Werte), DIN 33402-3 (Körpermaße des Menschen; Bewegungsraum bei verschiedenen Grundstellungen und Bewegungen) sowie für DIN EN 547 (1-3), die sich mit den Körpermaßen mit Blick auf die Sicherheit von Maschinen befasst. 5.1.2 Die Variabilität von industrieanthropologisch relevanten Körpermaßen Ein besonderes Problem für die Industrieanthropologie stellt die enorme Variabilität des Menschen dar. Durchschnittswerte allein beschreiben den Menschen nur höchst unzureichend. Wir wissen beispielsweise, dass der „deutsche Durchschnittsmann“ (Abb. 5.1) eine Körperhöhe von 178,8 cm, ein Körpergewicht von 73,1 kg, eine Stammlänge von 93,8 cm, eine Greifweite nach vorn von 75,9 cm und eine Gesäß-Knie-Tiefe von 61,6 cm aufweist (Mittelwertangaben nach Jürgens 2000, die Maßdefinitionen sind in Tabelle 5.3 dargestellt). Gleichzeitig ist es aber höchst unwahrscheinlich, in der Realität einem Menschen zu begegnen, der genau diesen Körpermaßen entspricht, denn der „Durchschnittsmensch“ ist ein statistisches Artefakt. Würde man die Gestaltung unserer Wohn- und Arbeitsumwelt an solchen Durchschnittswerten orientieren, wären viele Menschen von der Benutzung ausgeschlossen. Am schlichten Beispiel der Türhöhe lässt sich das leicht erklären. Eine Tür, für deren Höhe die durchschnittliche Körperhöhe als Kon- Industrieanthropologie 383 Abb. 5.1. Industrieanthropologisch relevante Messstrecken und deren Mittelwerte (links Körperhöhe und Reichweite nach vorn, in der Mitte die Körpersitzbreite und rechts die Unterschenkelhöhe mit Fuß, die Stammlänge und die Sitztiefe). Es sind die Mediane für erwachsene Männer dargestellt (Maße nach Jürgens, 2000) struktionshilfe herangezogen würde, wäre eben nur 180 cm hoch, und etwa die Hälfte aller männlichen Nutzer müsste beim Durchgang den Kopf einziehen. Diese einfache Betrachtung lässt bereits erahnen, dass die statistische Beschreibung der menschlichen Variabilität in der Industrieanthropologie von großer Bedeutung ist. Als Streuungsmaß haben sich die Perzentile (Punkte auf einer kumulativen Prozentskala) bewährt, weil bei deren Verwendung genaue Aussagen darüber gemacht werden können, wie viel Prozent einer Nutzerpopulation berücksichtigt werden. Als Mittelwertangabe wird dem entsprechend der Median, also das 50. Perzentil bevorzugt. Die üblichen Grenzen sind das 5. und das 95. Perzentil, so dass ein industriell gefertigter Gegenstand, für dessen Konstruktion diese Werte verwendet wurden, von 90 Prozent der Menschen angemessen benutzt werden kann. Bei sicherheitsrelevanten Fragen gelten hingegen das 1. und das 99. Perzentil als Konstruktionsgrenzen, so dass lediglich 2% der Menschen keine „angemessene“ Berücksichtigung erfahren. In vielen Fällen ist eine allgemeine Nutzbarkeit industriell gefertigter Güter nur gewährleistet, wenn entsprechende Verstellmöglichkeiten vorgesehen sind. Jeder kennt solche vielfältigen Verstellvorrichtungen z. B. vom Schreibtischstuhl oder vom Fahrzeugsitz. Mit Blick auf die Körperabmessungen ist eine Fülle von Gruppenunterschieden festzustellen. Zu den wichtigsten Gruppenunterschieden gehören: 384 Angewandte Anthropologie Abb. 5.2. Regionale Differenzierung der Körperhöhe in Europa am Beispiel der männlichen Bevölkerung (Quelle der Daten: Jürgens et al. 1989) • • • die regionale Differenzierung, die Geschlechterdifferenzierung, die alterstypische Differenzierung. Betrachten wir zunächst die geographische Variabilität von Körpermessdaten am Beispiel europäischer Menschen (Abb. 5.2). Die Körperhöhe, die als ein wichtiges Indikatormaß gilt, zeigt ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. Die größten Europäer leben in Nordeuropa, speziell in den Niederlanden, die kleinsten in Südosteuropa und auf der Iberischen Halbinsel, speziell in Portugal. Als nächster wichtiger Gruppenunterschied ist der Sexualdimorphismus des Menschen zu nennen. Bei den meisten Körpermaßen weisen Frauen bekanntermaßen kleinere Werte auf als Männer (Tabelle 5.1). Es gibt jedoch auch Tabelle 5.1. Geschlechtsunterschiede bei 26–40jährigen für ausgewählte industrieanthropologisch relevante Körpermaßen (Daten aus Jürgens 2000) Frauen Sitzhöhe Unterschenkellänge Sitzbreite 87,3 cm 45,9 cm 39,3 cm Männer < < > 92,6 cm 48,8 cm 37,4 cm Industrieanthropologie 385 einige Maße, in denen die weiblichen Durchschnittswerte die männlichen Durchschnittswerte übertreffen, dies gilt beispielsweise für die Körpersitzbreite. Die Sitzbreite ist nämlich kein reines Knochenmaß, sondern auch ein Weichteilmaß, und die durchschnittlich höheren Werte bei Frauen spiegeln die geschlechtstypisch unterschiedliche Verteilung des Fettgewebes wider. Weitere wichtige Gruppenunterschiede bei den Körpermaßen finden wir zwischen Menschen unterschiedlichen Alters. Bei den meisten Körpermessdaten erreichen jüngere Menschen auf Grund der säkularen Akzeleration größere Werte als ältere (Kap. 4.1). Dieses von Greil (2001a) als „Biomorphose der Generationenfolge“ bezeichnete Phänomen äußert sich in einer Entwicklungsbeschleunigung,zu deren bekannten Aspekten größere und schwerere Neugeborene, ein früherer Eintritt der Geschlechtsreife und ein stärkeres Längenwachstum gehören. Infolgedessen übertreffen jüngere Menschen die älteren Generationen in den meisten Körpermaßen. Verstärkt wird dieser Unterschied dadurch, dass die Körpermaße auch vom physiologischen Alterungsprozess, der Involution, beeinflusst werden. Körpermaße verändern sich auch noch nach abgeschlossenem Wachstum. Daher gilt auch die Regel, dass in der jüngeren Altersgruppe durchschnittlich größere Körpermaße festzustellen sind, nicht ohne Ausnahme (Abb. 5.3). Während beispielsweise die Stammlänge ein Maß ist, das eine alterstypische Abnahme aufweist und Involutionserscheinungen an der Wirbelsäule widerspiegelt, nimmt die Sitzbreite mit dem Alter zu. Die Zunahme der Sitzbreite mit steigendem Alter findet ihre Entsprechung darin, dass auch das durchschnittliche Körpergewicht mit zunehmendem Alter ansteigt. Altersabhängige Gruppenunterschiede ergeben sich daher aus der Kombination von zwei verschiedenen humanbiologisch relevanten Entwicklungen: Akzeleration und Involution. Die höheren Werte, die bei jüngeren Menschen festzustellen sind, spiegeln einerseits den allgemeinen Akzelerationstrend wider, andererseits sind die häufig niedrigeren Messdaten Älterer auch die Konsequenz der Involution. Bei industrieanthropologischen Fragestellungen ist weiterhin zu berücksichtigen, dass es in vielen Fällen zu additiven Effekten kommt, bzw. dass solche Gruppenunterschiede interferieren. So sind bei der Konstruktion eines Stuhls mit individuell einstellbarer Sitzhöhe nicht nur die verschiedenen Unterschenkellängen von Männer und Frauen zu berücksichtigen, sondern bei europaweiter Vermarktung müssen die entsprechenden Körpermessdaten von Südeuropäern und Nordeuropäern zu Grunde gelegt werden. Konkret bedeutet dies, dass als Rahmendaten die Werte für eine kleine Frau von der iberischen Halbinsel einerseits und einen großen Mann aus Nordeuropa zu berücksichtigen sind. Auch Alters- und Geschlechtsunterschiede zeigen industrieanthropologisch relevante interferierende Effekte. Die seitliche Rotation des Kopfes beispielsweise, die für die Gestaltung des Fahrzeuginnenraums mit Blick auf das Rückwärtsfahren von Bedeutung ist, zeigt nicht nur alterstypische sondern auch geschlechtstypische Unterschiede (Abb. 5. 4). Matzdorff (1999) konnte an einer Stichprobe von insgesamt 299 speziell nach Altersgruppe ausgewählten Probandinnen und Probanden zeigen, dass nicht nur 20- bis 25-jährige höhere Rotationswinkel erzielen als 60- bis 70-Jährige, sondern dass Frauen in beiden Altersgruppen den Kopf weiter seitlich drehen können als Männer desselben Alters. 386 Angewandte Anthropologie Abb. 5.3. Veränderungen von Körpermaßen mit dem Alter: Die obere Abbildung zeigt die Zunahme der Sitzbreite bei Frauen, die untere Abbildung die Abnahme der Sitzhöhe bei Männern (Daten nach Flügel et al. 1986) Abb. 5.4. Die maximale seitliche Rotation des Kopfes zeigt altersund geschlechtstypische Unterschiede (verändert nach Matzdorff 1999) Industrieanthropologie 387 Tabelle 5.2. Korrelationsmatrix für ausgewählte Körpermaße 1. (KH) 2. (SH) 3. (USL) 4. (OAL) 5. (SiB) 1. Körperhöhe (KH) 2. Sitzhöhe (SH) 0,79 3. Unterschenkellänge (USL) 0,80 0,45 4. Oberarmlänge (OAL) 0,68 0,43 0,67 5. Sitzbreite (SiB) 0,14 0,14 0,04 0,18 6. Schulterbreite (SchB) 0,11 0,09 0,02 0,22 0,65 Für die Industrieanthropologie folgt aus den hier dargestellten Gruppenunterschieden als zentrale Aufgabe die fortlaufende Aktualisierung der vorhandenen Datenbasis, da sich die durchschnittlichen Körpermaße und deren Streuung einerseits durch den noch andauernden Akzelerationsprozess verändern und andererseits auch demographische Entwicklungen, wie z. B. Migration und Verschiebungen der Alterszusammensetzung einer Bevölkerung, einen erheblichen Einfluss auf die Durchschnittswerte und die Streuung haben. Menschen sind nicht nur in ihren Körpermaßen sondern auch in ihren Körperproportionen höchst unterschiedlich. Bereits durch einfache Beobachtung lässt sich feststellen, dass eher hochgewachsene Menschen nicht immer auch eine große Schulterbreite oder lange Arme haben. Jeder kennt so genannte Sitzriesen, also Menschen, die im Sitzen groß, im Stehen jedoch eher durchschnittlich wirken. Bei ihnen ist der Rumpf im Verhältnis zu den Beinen besonders lang. Verdeutlichen lässt sich diese Problematik durch einen Blick auf eine Korrelationsmatrix industrieanthropologischer Maße (Tabelle 5.2). Etliche Korrelationskoeffizienten, z. B. Unterschenkellänge/Schulterbreite oder Oberarmlänge/Sitzbreite zeigen, dass zwischen etlichen Körpermaßen faktisch kein Zusammenhang besteht. Aus industrieanthropologischer Perspektive gilt: Alle Menschen sind ungleich! 5.1.3 Stichproben Die umfangreichen Datensammlungen mit industrieanthropologisch relevanten Körpermaßen (z. B. Flügel et al. 1986, DIN 33402 1986, Küchmeister et al. 1990, Jürgens 2000) müssen – wie bereits ausgeführt – laufend aktualisiert und ergänzt werden, um z. B. die Auswirkungen der Akzeleration oder der Migration auf die Körpermaße und ihre wichtigsten statistischen Kenngrößen (Mittelwert und Streuung) zu erfassen. Die Erhebung entsprechender Daten stellt sehr hohe Anforderungen an die zu untersuchenden Stichproben. Um eine repräsentative Stichprobe zusammenzustellen, ist darauf zu achten, dass die Alterszusammensetzung, die Anteile der Stadt- und Landbevölkerung und bestimmte Berufsklassen so gewählt werden, dass sie der Verteilung in der Population entsprechen, auf die Bezug genommen werden soll (Greil 2001 a,b). Sehr problematisch ist auch die angemessene Berücksichtigung von Migrantinnen und Migranten 388 Angewandte Anthropologie in einer Bevölkerung. In Deutschland lebende Ausländerinnen und Ausländer und Deutsche ausländischer Herkunft gehören demographisch zur deutschen Wohnbevölkerung, können sich jedoch – je nach Herkunft – in ihrem Körperbau beträchtlich von den Deutschen im ethnischen Sinne unterscheiden. Die in Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten stammen überwiegend aus Regionen, in denen die Menschen nicht nur kleiner sondern oft auch anders proportioniert sind. Damit stellt sich für die Zusammensetzung einer repräsentativen Stichprobe die Aufgabe, diese Bevölkerungsgruppen entsprechend ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung zu berücksichtigen. Greil (2001a) stellt darüber hinaus auch die Forderung, Migrantinnen und Migranten, die zur Wohnbevölkerung gehören, in anthropometrischen Datensammlungen getrennt auszuweisen, weil ihr Anteil quantitativen Schwankungen unterworfen ist. Eine allein auf das Erwachsenenalter beschränkte Stichprobe, in der Faktoren wie Geschlecht, Alter und geographische Herkunft adäquat berücksichtigt sind, bedarf eines Umfangs von mindestens 6000 Personen (Greil 2001a). Werden auch Daten von jüngeren Menschen benötigt, sind erheblich größere Probandenzahlen erforderlich, um geschlechtstypische Unterschiede und akzelerationsbedingte Veränderungen in den Wachstums- und Reifungsmustern zu erfassen. Der Vergleich verschiedener anthropometrischer Datensammlungen (Greil 2001 a,b,c, DIN 33402-2, Küchmeister et al. 1990, Jürgens 2000) hat gezeigt, dass Abweichungen zwischen den einzelnen Untersuchungen bestehen, deren Ursachen nicht eindeutig zu klären sind, vermutlich aber auch auf den jeweiligen Zusammensetzungen der Stichproben beruhen. Speziell eine Neufassung der DIN 33402 (1986) erscheint dringend erforderlich, weil die Daten veraltet sind. Die Maße für das Kinder- und Jugendalter sind nicht mehr zutreffend (Greil 2001 a) und die zahlenmäßig angestiegene Altersgruppe der 40- bis 65-jährigen ist nur unzureichend berücksichtigt. Diese Neufassung sollte auf einer grundlegend neuen anthropometrischen Messung beruhen. Sobald eine neue Datensammlung vorliegt, die den veränderten Anforderungen genügt, ist eine fortlaufende Aktualisierung auch möglich, ohne jeweils das gesamte anthropometrische Programm an einer repräsentativen Stichprobe zu messen. Diese Anpassung der Daten kann an vergleichsweise kleinen, sorgfältig ausgewählten Kontrollstichproben anhand weniger Leitmaße erfolgen, aus denen andere relevante Maße über bekannte Regressionsgleichungen hochgerechnet werden können. Bei Fragestellungen, in deren Vordergrund die Prüfung, Optimierung oder Weiterentwicklung von Produkten, Arbeitsplätzen usw. stehen, sind manchmal ganz andere Stichprobendesigns erforderlich (Box 5.2). Oft geht es darum zu prüfen, wie sich Menschen, deren Körperabmessungen stark vom Durchschnitt abweichen, in einer Mensch-Maschine-Schnittstelle, beispielsweise dem Fahrersitz eines PKW, verhalten. In solchen Fällen werden gezielt Stichproben zusammengestellt, welche die Ränder einer Verteilung repräsentieren, also besonders kleine, besonders kurzbeinige, besonders füllige oder anderweitig vom Durchschnitt abweichende Personen berücksichtigen. Die Grundforderung, den Menschen bei bestimmten Fragestellungen als „Prüfmittel“ einzusetzen, ist so weit anerkannt, dass sie sich auch in Normen niederschlägt. Basierend auf einer deutschen Norm (DIN 33419) entstand die Industrieanthropologie Box 5.2 Menschen als „Prüfmittel“ In der Entwicklungsphase eines Produkts mit einer komplexen Mensch-Maschine-Schnittstelle werden die physischen Eigenschaften und Bedürfnisse der zukünftigen Nutzer zunächst durch statistische Tabellenwerke und Normen repräsentiert. Diese Vorgehensweise bedingt, dass lediglich die relevant erscheinenden Einzelkomponenten des real existierenden „Aggregats“ Mensch (Jürgens 2001) Berücksichtigung finden. Etliche morphologische und physiologische Gegebenheiten entziehen sich jedoch aufgrund ihrer Komplexität einer rein technischen Zerlegung in Einzelkomponenten. Daher reichen die Beachtung der gültigen Normen und die Verwendung der umfangreichen Tabellenwerke mit anthropometrischen Daten sowie der darauf basierenden Menschmodelle (Box 5.4) oft nicht aus, um ein Produkt menschengerecht zu gestalten. Spätestens wenn die Vorentwicklung eines Produkts abgeschlossen ist, sollte eine Prüfung der ergonomischen Qualität und der Gebrauchstauglichkeit erfolgen, die sich ausschließlich an der Nutzerpopulation und ihrer Variation orientiert (Jürgens, 2001). Für solche menschenbezogenen Produktprüfungen gibt es seit 1993 mit der Norm DIN 33 419 (ISO 15 537) eine allgemein verbindliche Grundlage.Zusammenstellung und Umfang des Probandenkollektivs müssen sich an der Fragestellung orientieren. Je nach in Frage kommender Nutzergruppe können Versuchspersonen nach Geschlecht, Alter, geographischer Herkunft oder speziellen Körpermaßen ausgewählt werden. Problematischer gestaltet sich dieser Schritt der Produktprüfung, wenn physiologische Merkmale des Menschen zu berücksichtigen sind. Im Gegensatz zu den umfangreichen Datensammlungen bezüglich morphologischer und biomechanischer Eigenschaften liegen für zahlreiche physiologische Charakteristika keine repräsentativen Grundlagendaten vor.Will man also beispielsweise die mikroklimatischen Eigenschaften eines körperunterstützenden Systems (z. B. einer Matratze) evaluieren, sind erheblich größere Stichprobenumfänge erforderlich. Für große Herstellerfirmen besteht die Möglichkeit, sich aus den eigenen Betriebsangehörigen ein Panel von freiwilligen Versuchspersonen zusammenzustellen, deren Körpermaße (und ggf. andere physische Eigenschaften) bekannt sind, so dass bei spezifischen Fragestellungen ein Prüfkollektiv gezielt ausgewählt werden kann. Die großen Automobilhersteller haben diese Vorgehensweise bereits umgesetzt, kleinere Betriebe haben alternativ die Möglichkeit, solche Produktprüfungen als wissenschaftliche Dienstleistung von Spezialisten erbringen zu lassen. 389 390 Angewandte Anthropologie ISO-Norm (ISO 15537), die Grundsätze festlegt, nach denen die Prüfung anthropometrischer Aspekte von Produktentwürfen und Industrieprodukten in einem Versuchspersonenkollektiv erfolgen soll. 5.1.4 Methoden Das Arsenal industrieanthropologischer Methoden ist angesichts der Vielzahl von Fragestellungen überaus vielfältig. Bis heute nimmt die Anthropometrie eine zentrale Rolle ein, wobei im Laufe der Zeit etliche neue Maße definiert wurden, um die Schnittstelle zwischen dem Menschen und seiner industriell gestalteten Umwelt zu erfassen und zu beschreiben. Hier sind vor allem Bewegungsmaße zu nennen, denn die Möglichkeiten der statischen Anthropometrie reichen in vielen Fällen nicht aus, um die Interaktionen zwischen dem Menschen und seiner selbst geschaffenen körpernahen Umgebung angemessen zu beschreiben. Hinzu kommen neuerdings auch berührungslose Messverfahren, mit deren Hilfe die Körperform des Menschen optisch erfasst wird und die gewonnenen Daten direkt digitalisiert werden (Bodyscanning, Box 5.3). Um die Vielzahl der Messwerte und Daten über Tabellen hinaus für Anwender wie Designer oder Konstrukteure einfacher nutzbar zu machen, sind inzwischen etliche Menschmodelle entwickelt worden, die in anschaulicher Form die Referenzdaten zur Verfügung stellen sollen (Box 5.4) Im Zusammenhang mit körperunterstützenden Systemen wie Stühlen, Autositzen oder Matratzen werden Kontaktflächenmessungen und Druckverteilungsuntersuchungen ebenso angewandt wie die Analyse von Körperwinkelketten. Bei körperunterstützenden Systemen werden heute auch physiologische Reaktionen auf Materialeigenschaften untersucht, wobei die Wechselwirkungen zwischen Transpiration und den mikroklimatischen Eigenschaften der verwendeten Materialien im Vordergrund stehen. Schließlich werden heute auch Aspekte menschlichen Verhaltens sowie das subjektive Komfortempfinden der Nutzer von Industrieprodukten in industrieanthropologische Fragestellungen einbezogen. Etliche Untersuchungen, die mit dem Ziel der Produktentwicklung, -optimierung oder -prüfung durchgeführt wurden, sind Auftragsarbeiten für Hersteller entsprechender Produkte und somit aus Wettbewerbsgründen oft unveröffentlicht geblieben. Die Bandbreite von Methoden, die in entsprechenden Untersuchungen zur Anwendung gekommen sind, kann daher hier nur exemplarisch an einigen Beispielen verdeutlicht werden. Klassische Anthropometrie Die standardisierten international anerkannten Verfahren, die angewandt werden, um die umfangreichen, meist in tabellarischer Form vorliegenden Körpermessdaten zu ermitteln, beruhen auf einer einheitlichen Messmethodik, die in ihrem Ursprung auf Rudolf Martin (1924) zurückgeht. Er hat Messstrecken und -methoden so definiert und beschrieben, dass sie den Anspruch auf Reproduzierbarkeit erfüllen. Die entsprechenden Beschreibungen umfas- Industrieanthropologie 391 Abb. 5.5. Lokalisation und Bezeichnung wichtiger anthropometrischer Messpunkte, oben in Frontalansicht, unten in Lateralansicht (verändert nach Greil 2001b) 392 Angewandte Anthropologie Tabelle 5.3. Definitionen einiger industrieanthropologisch relevanter Körpermaße Maß Definition Körperhöhe vertikale Entfernung von der Standfläche zum höchsten Punkt des Kopfes in der Medianebene horizontale Entfernung von einer Wand, an die sich die Person mit den Fersen, dem Gesäß und den Schulterblättern anlehnt, zu dem am weitesten distal befindlichen Punkt des Endes des rechten Mittelfingergliedes bei zur Faust geschlossener Hand und horizontal nach vorn gestrecktem rechtem Arm vertikale Entfernung von der Sitzfläche zum höchsten Punkt des Scheitels in der Medianebene größte horizontale Entfernung zwischen den am weitesten lateral ausladenden Punkten im Bereich der Oberschenkel und der Hüfte (Coxalia) im Sitzen gemessene vertikale Entfernung von der Auflageebene der Füße zur Unterseite des gegen den rechten Unterschenkel rechtwinklig angebeugten rechten Oberschenkels unmittelbar hinter der Kniekehle, das heißt Abstand von der Auflageebene der Füße zur Sitzfläche von der Rückenlehne gemessene horizontale Entfernung des am weitesten dorsal vorragenden Punktes im Bereich des rechten Knies am Unterrand der Kniescheibe Greifweite nach vorn Stammlänge Körpersitzbreite Unterschenkelhöhe mit Fuß Gesäß-Knie-Tiefe sen Messpunkte (Abb. 5.5), Messstrecken, Körperhaltung des Probanden während der Messung und eine Festlegung des zu verwendenden Messgerätes. In Tabelle 5.3 sind die Definitionen einiger Maße exemplarisch dargestellt. Definitionen zu zahlreichen anderen Körpermaßen sind in verschiedenen Standardwerken publiziert, beispielsweise im Anthropologischen Atlas (Flügel et al. 1986), im Band I des Handbuchs für vergleichende Biologie des Menschen (Knußmann 1988), im Handbuch der Ergonomie (Jürgens 2000) oder in der DIN 33402 (Deutsches Institut für Normung 1986). Etliche der definierten Messpunkte am Lebenden beziehen sich auf das Skelett, so dass vor dem Abnehmen der Messstrecke die jeweiligen Messpunkte durch Palpieren lokalisiert werden müssen. Dies gilt beispielsweise für die an den Gelenken definierten Messpunkte, wie etwa Akromiale (Schultergelenk), Radiale und Olecranale (Ellenbogengelenk), Stylion radiale und Stylion ulnare (Handgelenk), Femorale proximale (Hüftgelenk), Patellare und Tibiale (Kniegelenk) oder Sphyrion (Fussgelenk). Andere Messpunkte hingegen berücksichtigen gezielt die Weichteilauflagerungen, wie etwa Deltoidale, Abdominale, Glutaeale oder Coxale. Von großer Bedeutung in der Anthropometrie ist die standardisierte Körperhaltung der Probanden bei der Messung: Die zu messende Person nimmt – stehend oder sitzend – eine Grundhaltung ein, wobei der Körper voll aufgerichtet ist, die Schultern aber nicht hochgezogen sind. Der Kopf ist in der Ohr-Augen-Ebene (Frankfurter Horizontale) ausgerichtet, d. h. der Oberrand des Ohrdeckelknorpels (Tragion) liegt mit dem unteren Rand der knöchernen Industrieanthropologie 393 Box 5.3 Bodyscanning In jüngerer Zeit treten mit zunehmend verfügbarer Rechenleistung und leistungsfähigen Systemen zur rechnergestützten Bildverarbeitung die Bodyscanning-Verfahren in Konkurrenz zur konventionellen Körpermessung mit Anthropometer, Taster und Maßband. Mit Bodyscanning bezeichnet man ein komplexes technologisches bildgebendes Verfahren, das den menschlichen Körper berührungslos mit hoher Auflösung optisch abtastet und die „gemessenen“ Daten digital durch entsprechende Softwareprogramme weiterverarbeitet. Der Computer erzeugt dann eine exakte dreidimensionale Kopie des Körpers, gewissermaßen einen elektronischen „Gipsabdruck“. Die Bodyscanning-Verfahren sind entweder kamera- oder laserbasierte Messsysteme. Heute wird diese Technologie bereits verstärkt in der Bekleidungsbranche eingesetzt, wo sie, integriert in eine Prozesskette zur Herstellung von Maßkonfektion, eine neue Form der kundenindividuellen Massenproduktion gestattet. Obwohl die Vorteile solcher Verfahren auf der Hand liegen, können sie jedoch derzeit die herkömmliche Anthropometrie nicht ersetzen.In der klassischen Anthropometrie werden, wie Abb. 5.5 zeigt, ganz überwiegend Messpunkte benutzt, die sich auf die knöcherne Unterlage, das Skelett, beziehen, die Körperoberfläche jedoch wird vielfach vernachlässigt. Die computergestützten optischen Verfahren hingegen benutzen zur Darstellung die Körperoberfläche des Menschen, während das Skelettsystem unberücksichtigt bleibt. Tatsächlich können optisch basierte Verfahren nicht zwischen Weichteilgewebe und knöchernem Skelett unterscheiden. Es ist vor diesem Hintergrund auch kein Zufall, dass die Bekleidungsindustrie derjenige Bereich ist, in dem Bodyscanning-Verfahren am schnellsten Fuß fassen konnten, denn viele der für die Konfektion benötigten Körpermaße sind Weichteilmaße, wie etwa Körperumfänge,die mittels optischer Abtastung gut feststellbar sind. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil des Bodyscanning-Verfahrens besteht darin, dass aus einmal erhobenen Datensätzen nachträglich viele Körpermaße abgeleitet oder errechnet werden können, die bei der Erstellung des Scans gar nicht von Interesse waren (Greil 2001b). Ein industrieanthropologisch äußerst relevantes Problem kann derzeit weder durch die klassische Anthropometrie noch durch Bodyscanning zufriedenstellend bearbeitet werden. Beide Systeme berücksichtigen nicht, dass sich bei Bewegungen die Weichteile über den Gelenken verschieben. Bei der berührungslosen optischen Abtastung des Körpers kommt noch hinzu, dass ein direkter Rückschluss auf Gelenkdrehpunkte und Gelenkbewegungsbahnen nicht möglich ist, weil das Skelett mit dieser Methode nicht erfasst wird. 394 Angewandte Anthropologie Box 5.3 (Fortsetzung) Die unterschiedlichen methodischen Ansätze beider Verfahren gestatten es nicht, die so gewonnenen Daten direkt miteinander zu vergleichen. Erst, wenn in einer soliden Stichprobe dieselben Personen sowohl klassisch anthropometrisch untersucht als auch gescannt werden,werden Rückschlüsse vom Scan auf das Skelett möglich sein. Augenhöhle (Orbitale) in einer horizontalen Ebene. Die Messungen werden mit Präzisionsinstrumenten (Anthropometer, Tasterzirkel, Gleitzirkel, Maßband und Caliper) durchgeführt. Zu diesen Verfahren kommen neuerdings die Bodyscan-Verfahren hinzu, die jedoch die bisher üblichen anthropometrischen Methoden noch nicht ersetzen können (Box 5.3). Reich- und Greifweiten Zwar stellte die eben geschilderte statische Anthropometrie das methodische Basisinventar der Industrieanthropologie, doch besondere Anforderungen haben dazu geführt, dass eine Reihe von speziellen Messverfahren entwickelt wurde. Menschen befinden sich in ihrer Wohn- und Arbeitsumwelt nicht in der vom Anthropologen vorgeschriebenen, reproduzierbaren Körperhaltung, sondern sie bewegen sich. Aus industrieanthropologischer Sicht sind beispielsweise Reich- oder Greifweiten von besonderer Bedeutung: Zum einen muss an Arbeitsplätzen gewährleistet sein, dass bestimmte Bedienelemente, beispielsweise Schaltknöpfe, Hebel oder Griffe, auch für kleine Menschen noch gut erreichbar sind. Andererseits muss sichergestellt sein, dass Gefahrenpunkte, wie beispielsweise Motoren, Getriebe oder Rotorblätter, auch für große Menschen im wörtlichen Sinne außer Reichweite liegen. Für solche Probleme sind statische Maße ungeeignet, weil sie die reale Bewegung nur unzureichend beschreiben. Die meisten Bewegungen sind das Ergebnis des Zusammenspiels von Muskeln, wobei Skelettteile und Gelenke einbezogen sind. Die dadurch bedingten komplexen anatomischen und morphologischen Gegebenheiten von Bewegungsabläufen, Bewegungsbahnen und Bewegungsräumen gestatten keine einfache mechanistische Analyse. Die Greifweite nach vorn (Abb. 5.1) gibt beispielsweise den Abstand zwischen Schulterblatt und Mittelhand bei gestrecktem Arm wieder, wobei die zu messende Person mit dem Gesäß und dem Schulterblatt eine hinter ihr befindliche Wand berührt. Ein Mensch, der in einer alltäglichen Situation nach vorne greift, bewegt jedoch den Rumpf mit, so dass ganz andere Reichweiten erzielt werden können. An einer solchen komplexen Bewegung sind außerdem zahlreiche Verschiebungen der Weichteile über der knöchernen Unterlage beteiligt, die zusätzlich erhebliche messtechnische Probleme bereiten. Daher werden in der Industrieanthropologie auch Bewegungsmaße oder dynamische Maße erhoben, Industrieanthropologie 395 Abb. 5.6. Bewegungskurven von Greifweiten in unterschiedlichen Körperhaltungen, links Greifen nach vorn im Hocken, rechts Greifen zur Seite im Knien (verändert nach Flügel et al. 1986) Abb. 5.7. Bewegungskurven von Greifweiten über unterschiedlich hohe Barrieren hinweg, links Greifen nach vorn über eine hohe Barriere, rechts Greifen zur Seite über eine niedrige Barriere (verändert nach Flügel et al. 1986) wie etwa Bewegungskurven von Greifweiten in unterschiedlichen Körperhaltungen und auch über Hindernisse (Barrieren) hinweg. Eine Auswahl solcher Greifweitenkurven ist in den Abb. 5.6 und 5.7 dargestellt. Körperwinkel Bei Bewegungen von Gelenken, die grundsätzlich in Flexion und Extension, Adduktion und Abduktion sowie Außenrotation bzw. Pronation und Innenrotation bzw. Supination unterteilt werden, ändern sich deren Winkel. In der Literatur werden im Allgemeinen die maximalen Werte dieser Winkel angege- 396 Angewandte Anthropologie Abb. 5.8. Ausschnitt aus einer Körperwinkelkette: Bei der Beugung der Knie im Stehen ist nicht nur das Kniegelenk betroffen, sondern auch das Fußgelenk. ben. Die Messung erfolgt nach der Neutral-0-Methode, das heißt von einer definierten Nullstellung aus (s. z. B. Abb. 5.4). Eine gute Übersicht über die anthropologisch relevanten Winkel gibt der Anthropologische Atlas (Flügel et al. 1986), dort werden Bewegungswinkel für 20- bis 60-jährige Frauen und Männer mitgeteilt. Für industrieanthropologische Zwecke sind solche Angaben, die eine mechanistische Sichtweise widerspiegeln, allerdings nur begrenzt verwendbar, denn im Vordergrund der Industrieanthropologie steht die interindividuelle Variabilität. Wenn nur die Maximalwerte einer nicht nach Lebensalter differenzierten Stichprobe zu Grunde gelegt werden, dann bleiben ganz besonders die altersabhängigen Unterschiede der Gelenkfunktion unberücksichtigt. Mindestens ebenso wichtig ist es aber, dass sich diese Werte auf isolierte Gelenke beziehen, denn bei natürlichen Bewegungsabläufen spielen isolierte Gelenkbewegungen aus den unterschiedlichsten Gründen faktisch keine Rolle. Die Gelenke des Körpers sind auf vielfältige Weise sowohl morphologisch (durch Sehnen, Bändern etc.) als auch funktional miteinander verbunden und bilden Winkelketten: Geht man aus dem Stand in die Knie, so wird nicht nur der Winkel im Kniegelenk kleiner, sondern gleichzeitig ändern sich auch die Winkel im Fußgelenk und im Hüftgelenk entsprechend (siehe Abb. 5.8). Schiebt man im Sitzen seinen Stuhl nach hinten und lässt die Position der Füße auf dem Boden unverändert, so wird der Kniewinkel und gleichzeitig auch der Fußwinkel größer. Mehrere funktionelle Ursachen bedingen, dass bei Bewegungen einzelner Gelenke stets auch andere Gelenke mit betroffen sind: • • Oft werden mehrere Gelenke von einem einzigen Muskel oder ein und derselben Muskelgruppe bewegt, wodurch die Autonomie jedes einzelnen Gelenkes eingeschränkt ist. Der Musculus biceps humeri, beispielsweise, entspringt zweiköpfig am Schulterblatt und am Humerus und setzt distal vom Ellbogen am Radius an. Er erstreckt sich also über zwei Gelenke, Schulter und Ellbogen. Häufig erfordert die Bewegung eines Gelenks kompensatorische Bewegungen anderer Gelenke. Wenn z. B. eine stehende Person das Becken zur Seite schiebt und damit ein Bein stärker belastet, kommt es nicht nur zu einer Industrieanthropologie • 397 Verbiegung der gesamten Wirbelsäule, sondern gleichzeitig auch zu einer Beugung im Kniegelenk des anderen Beins. Menschen erlernen keine singulären Bewegungskompon