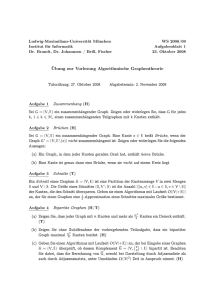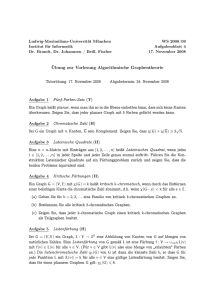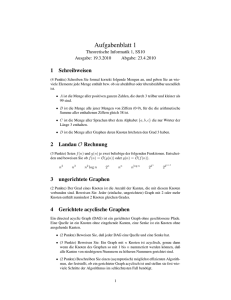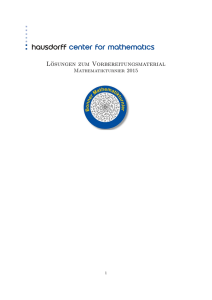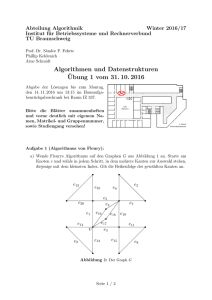Skript - Universität zu Köln
Werbung

Mathematik ist überall
Vorlesung im Rahmen der
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Grundlegung
im
Sommersemester 2015
von
Dr. Markus Schulz
Inhaltsverzeichnis
1 Grundlagen
1.1 Mengen und Zahlbereiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Aussagenlogik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Mathematische Beweisverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
3
6
2 Der
2.1
2.2
2.3
2.4
goldene Schnitt
Definition und Eigenschaften . . . . . . .
Konstruktionen des goldenen Schnitts . .
Fibonacci-Zahlen und goldener Schnitt .
Auftreten des goldenen Schnittes und der
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Fibonacci-Zahlen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
. 8
. 11
. 14
. 19
3 Die
3.1
3.2
3.3
3.4
Mathematik in der Musik
Tonerzeugung . . . . . . . . . . .
Tonabstände und Stimmungen . .
Fourier-Analyse . . . . . . . . . .
Mathematik als Kompositionshilfe
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
23
23
28
32
36
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
41
41
45
47
51
Mathematik der Finanzmärkte
Ein einführendes Beispiel . . . . . .
Einperioden-Modelle . . . . . . . .
Binomialmodelle . . . . . . . . . .
Das Black-Scholes-Modell . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
58
58
60
65
67
4 Graphentheorie
4.1 Grundlagen . . . . . .
4.2 Eulersche Graphen . .
4.3 Hamiltonsche Graphen
4.4 Kürzeste Wege . . . .
5 Die
5.1
5.2
5.3
5.4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ii
1
1
Grundlagen
Ein berühmtes Zitat von Galileo Galilei besagt sinngemäß, dass das Buch der Natur in der Sprache der Mathematik geschrieben ist. Um die Vorgänge in der Natur
und die hier geschilderten Anwendungen zu verstehen, müssen wir uns also mit der
Sprache der Mathematik vertraut machen. Natürlich wird – zumindest in deutschen
Sprachraum – auch in der Mathematik die deutsche Sprache verwendet. Mathematische Texte weisen jedoch eine spezielle Struktur auf und verwenden besondere
Formulierungen und Symbole. Dies ließ schon Johann Wolfgang von Goethe sagen
„Die Mathematiker sind eine Art Franzosen: redet man zu ihnen, so übersetzen sie
es in ihre Sprache, und dann ist es alsobald ganz etwas anderes.“ Bevor wir uns also
mit der Mathematik und ihren Anwendungen beschäftigen können, müssen wir zunächst ein wenig Vokabular lernen. Als Basis unserer Betrachtungen führen wir im
ersten Abschnitt dieses Kapitels verschiedene Mengen ein. Neu eingeführte Begriffe
werden dabei fett gedruckt.
1.1
Mengen und Zahlbereiche
Definition 1.1. Unter einer Menge verstehen wir die Zusammenfassung von wohlunterschiedenen Objekten unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen. Ein in einer Menge enthaltenes Objekt heißt auch ein Element der Menge. Ist
x ein Element einer Menge M , so schreiben wir x ∈ M , ist x keine Element der
Menge M , so drücken wir dies durch x ∈
/ M aus. Besitzt eine Menge keine Elemente, so nennen wir sie die leere Menge und schreiben ∅ oder {}.
Eine Menge A ist Teilmenge einer anderen Menge B, geschrieben A ⊂ B, genau
dann, wenn jedes Element x von A auch ein Element von B ist.
Zwei Mengen können wir auf verschiedene Weisen verknüpfen.
Definition 1.2. Der Durchschnitt zweier Mengen A und B, geschrieben als A∩B,
besteht aus allen Elementen, die sowohl zu A als auch zu B gehören. Man drückt
dies mathematisch so aus:
A ∩ B = {x : x ∈ A und x ∈ B}.
Die Vereinigung A ∪ B zweier Mengen A und B besteht aus allen Elementen, die
zu A oder zu B (oder zu beiden) gehören, also
A ∪ B = {x : x ∈ A oder x ∈ B}.
Die Differenz A\B zweier Mengen A und B bezeichnet die Menge aller Elemente
von A, die nicht gleichzeitig zu B gehören. Es gilt also
A\B = {x : x ∈ A und x ∈
/ B}.
Im nächsten Abschnitt werden wir die mathematischen Symbole für die Verknüpfungen „und“ und „oder“ kennenlernen.
Besondere Mengen, die mit eigenen Symbolen bezeichnet sind, sind die verschiedenen
Zahlbereiche. Höchstwahrscheinlich sind Sie schon als Kind mit den natürlichen
2
1 GRUNDLAGEN
Zahlen in Kontakt gekommen. Diese Menge wird immer dann benutzt, wenn Dinge
zu zählen sind. Wir bezeichnen die natürlichen Zahlen mit
N = {1, 2, 3, 4, . . .}.
Oft nimmt man auch die 0 dazu. Die so entstehende Menge bezeichnen wir mit N0 .
Wir können zwei natürliche Zahlen addieren und multiplizieren, ohne aus der Menge
„herauszufallen“. So gilt z.B.
3 + 4 = 7 ∈ N und 3 · 4 = 12 ∈ N.
Doch schon die Subtraktion zweier natürlicher Zahlen führt manchmal zu Problemen. Beispielsweise gilt 9 − 5 = 4 ∈ N, aber 5 − 9 ∈
/ N. Um beliebig subtrahieren
zu können, benötigen wir die ganzen Zahlen
Z = {. . . , −4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, . . .}.
Die eben problematische Aufgabe ist nun lösbar: 5 − 9 = −4 ∈ Z. Wenn zusätzlich
auch die Division möglich sein soll, reichen die ganzen Zahlen nicht mehr aus. Dazu
müssen wir unseren Zahlbereich auf die rationalen Zahlen
np
o
Q=
: p ∈ Z und q ∈ Z\{0}
q
erweitern. Die Zahl 0 ist als Nenner nicht zulässig. Neben der Bruchdarstellung ist
auch die Dezimalschreibweise gebräuchlich, also z.B. 54 = 1, 25 oder 13 = 0, 33333 . . ..
Jedoch kommt man selbst mit dieser relativ umfangreichen Menge nicht immer aus.
2
Beispielsweise gibt es keine rationale
√ Zahl a mit a = 2. Dennoch gibt es eine (nicht
endende) Dezimaldarstellung a = 2 = 1, 4142135 . . ..
Alle Zahlen der Zahlengerade zusammengenommen ergeben die reellen Zahlen R.
Gegenüber den rationalen Zahlen sind alle nichtendenden und nicht-periodischen
Dezimalzahlen hinzugekommen, beispielsweise ist auch π = 3, 14159 . . . eine reelle
Zahl. Anzumerken ist, dass je zwei reelle Zahlen nach ihrer Größe sortiert werden
können, d.h. für zwei reelle Zahlen a und b gilt a ≤ b oder a ≥ b (oder beides, dann
ist a = b). Manchmal beschränken wir uns auch auf folgende Teilmengen der rellen
Zahlen:
[a, b] ={x ∈ R : a ≤ x ≤ b}
[a, b) ={x ∈ R : a ≤ x < b}
(−∞, b] ={x ∈ R : x ≤ b}
[a, ∞) ={x ∈ R : a ≤ x}
(a, b] ={x ∈ R : a < x ≤ b}
(a, b) ={x ∈ R : a < x < b}
(−∞, b) ={x ∈ R : x < b}
(a, ∞) ={x ∈ R : a < x}.
Alle derartigen Mengen werden unter dem Oberbegriff „Intervalle“ zusammengefasst. Die reellen Zahlen sind in der Praxis häufig völlig ausreichend, gelegentlich,
z.B. wenn man die Gleichung x2 = −2 lösen will, benötigt man die komplexen
Zahlen
C = {a + ib : a, b ∈ R}.
Der Buchstabe i wird auch imaginäre Einheit genannt und ist definiert durch
√
i = −1 bzw. i2 = −1.
Für eine komplexe Zahl mit der Darstellung a + ib bezeichnet man a als Realteil
und b als Imaginärteil. Jede reelle Zahl x kann man durch a = x und b = 0 auch
als komplexe Zahl auffassen. Insgesamt gelten also die Beziehungen
N ⊂ N0 ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R ⊂ C.
1.2 Aussagenlogik
1.2
3
Aussagenlogik
Wie in der Sprache bringt es auch in der Mathematik wenig, die einzelnen Wörter
zu kennen, ohne zu wissen, wie man sie zu Aussagen zusammenfügt. Deshalb wollen
wir nun definieren, was wir unter einer mathematischen Aussage verstehen. Danach
werden wir verschiedene Möglichkeiten betrachten, Aussagen logisch zu verknüpfen.
Einige der entwickelten Regeln werden im nächsten Abschnitt die Grundlage für
verschiedene Beweismethoden bilden.
Definition 1.3. Aussagen sind sprachliche Gebilde, von denen objektiv feststeht,
dass sie entweder wahr oder falsch sind, die also von zwei möglichen Wahrheitswerten
genau einen annehmen.
„Objektiv festehender Wahrheitswert“ bedeutet, dass eine Aussage entweder wahr
oder falsch ist, unabhängig von der Person, die diese Aussage macht, unabhängig von
Ort und Zeitpunkt, an dem bzw. zu dem die Aussage gemacht wird und unabhängig
von einer Person, die diese Aussage beurteilt. Beispielsweise ist der gemäß historischer Anekdote überlieferte Satz „Alle Kreter lügen“ keine Aussage, denn spricht
ein Kreter diesen Satz aus, so würde er demzufolge die Wahrheit sagen, also nicht
lügen, was dem Satz widerspricht. Auch der berühmte Ausspruch des Babiers von
Sevilla „Ich rasiere alle Männer meiner Heimatstadt, die sich nicht selbst rasieren.“
gehört in diese Kategorie, denn wer rasiert den Barbier? Lassen Sie uns noch einige
weitere Beispiele behandeln:
Beispiel 1.1.
1. Dem Satz „Heute ist ein wunderschöner Herbsttag.“ ist kein objektiver Wahrheitsgehalt zuzuordnen, es ist also keine Aussage im mathematischen Sinn.
2. Der Satz „Die Bauarbeiten am Kölner Dom begannen im Jahr 1248.“ ist dagegen eine wahre Aussage.
3. Die Frage „Gefällt es Ihnen an der Universität zu Köln?“ ist wiederum keine
Aussage, da man ihr keinen Wahrheitswert zuordnen kann.
4. Der Satz „Der Kölner Hauptbahnhof liegt auf der rechten Rheinseite.“ ist eine
falsche Aussage.
5. Der Satz „Karl der Große hatte 24 Kinder.“ ist eine Aussage, obwohl es hier
kaum möglich sein dürfte, den Wahrheitswert festzustellen. Es genügt, dass
ein eindeutiger Wahrheitswert existiert.
Jede Aussage kann auch verneint werden. Formal definieren wir
Definition 1.4. Unter der Negation einer Aussage A verstehen wir die verneinte
Aussage ¬A, die zu A den gegensätzlichen Wahrheitswert hat: Ist A wahr, so ist ¬A
falsch, und ist A falsch, so ist ¬A wahr.
Beispiel 1.2. Die Negation der Aussage aus 2. des vorangegangenen Beispiels lautet
„Die Bauarbeiten am Kölner Dom begannen nicht im Jahr 1248.“ Da „nicht rechts“
gleichbedeutend mit „links“ ist, kann man die Negation von 4. auch formulieren als
„Der Kölner Hauptbahnhof liegt auf der linken Rheinseite.“
4
1 GRUNDLAGEN
Zwei Aussagen lassen sich außerdem auf verschiedene Weisen verknüpfen. Bei zwei
Aussagen wird eine solche Verknüpfung beispielsweise dadurch definiert, dass man
für alle vier möglichen Kombinationen von Wahrheitswerten der Verknüpfung einen
Wahrheitswert zuordnet. Dies kann durch Angabe einer sog. Wahrheitstafel geschehen.
Definition 1.5. Die Konjunktion ∧ zweier Aussagen A und B ist definiert durch
A
w
w
f
f
B
w
f
w
f
A∧B
w
f
f
f
Die Aussage A ∧ B ist also nur wahr, wenn sowohl A als auch B wahr sind. Die
Verknüpfung entspricht dem sprachlichen ’und’.
Definition 1.6. Die Disjunktion ∨ zweier Aussagen A und B ist definiert durch
A
w
w
f
f
B
w
f
w
f
A∨B
w
w
w
f
Die Aussage A ∨ B ist also wahr, wenn mindestens eine der beiden Aussagen A oder
B wahr ist. Die Verknüpfung entspricht dem sprachlichen ’oder’ im nichtausschließlichen Sinn.
Definition 1.7. Dem sprachlichen ’Wenn ..., dann ...’ entspricht die Implikation
⇒, deren Wahrheitstafel wie folgt definiert ist:
A B
w w
w f
f w
f f
A⇒B
w
f
w
w
Definition 1.8. Die Äquivalenz ⇔ zweier Aussagen A und B ist definiert durch
A B
w w
w f
f w
f f
A⇔B
w
f
f
w
Sprachlich drücken wir eine Äquivalenz häufig durch ’genau dann, wenn’ aus. Die
Aussage A ⇔ B ist also genau dann wahr, wenn die Aussagen A und B die gleichen
Wahrheitswerte besitzen.
1.2 Aussagenlogik
5
Gerade in der Mathematik kommen häufig Aussagen vor, die von einem Platzhalter
x abhängen. Auch Zusammenfassungen solcher Aussagen der Form „Für alle x ∈
M gilt...“ oder „Es existiert ein x ∈ M , so dass gilt ...“ sind allgegenwärtig. Zur
Abkürzung definieren wir
Definition 1.9. Es sei M eine Menge und A(x) eine Aussage, die von einer Variable
x ∈ M abhänge.
(a) Ist A(x) für alle x ∈ M eine wahre Aussage, dann sagt man „Für alle x ∈ M
gilt A(x)“ oder „Für jedes x ∈ M gilt A(x)“ und schreibt kurz
∀x ∈ M : A(x).
(b) Ist A(x) für mindestens ein x ∈ M eine wahre Aussage, dann sagt man „Für
ein x ∈ M gilt A(x)“ oder „Es gibt ein x ∈ M mit A(x)“ und schreibt kurz
∃x ∈ M : A(x).
(c) Ist A(x) für genau ein x ∈ M eine wahre Aussage, dann sagt man „Für genau
ein x ∈ M gilt A(x)“ oder „Es gibt genau ein x ∈ M mit A(x)“ und schreibt
∃!x ∈ M : A(x).
(d) Ist A(x) für kein x ∈ M eine wahre Aussage, dann sagt man „Für kein x ∈ M
gilt A(x)“ oder „Es gibt kein x ∈ M mit A(x)“ und schreibt
@x ∈ M : A(x).
Die hier eingeführen Symbole heißen Quantoren. Es können auch mehrere Quantoren miteinander verschachtelt werden. Als Faustregel kann man sich merken, dass
bei der Negation aus einem ∀ ein ∃ wird und umgekehrt.
Beispiel 1.3. Ist (xn )n∈N eine reelle Zahlenfolge, dann wird durch die Aussage
∀ε > 0∃n0 ∈ N∀n ≥ n0 : |xn | < ε
definiert, dass die Folge gegen Null konvergiert. Formulieren würde man die Aussage z.B. als „Für jedes ε > 0 gibt es einen Index n0 ∈ N, so dass alle weiteren
Folgenglieder betraglich kleiner als ε sind.“ Die Negation der Aussage ist
∃ε > 0∀n0 ∈ N∃n ≥ n0 : |xn | ≥ ε.
Anwendung findet die mathematische Aussagenlogik v.a. zur Begründung mathematischer Beweisprinzipien und in der Mengenlehre. Die Logik ist also eine wesentliche
Grundlage der Mathematik – man spricht ja auch immer von der Mathematik als
logische Wissenschaft. Darüber hinaus ist die Logik aber auch Grundlage der Computerwissenschaft und künstlichen Intelligenzforschung. Es gibt ganze Programmiersprachen, die auf Fragmnenten der Logik beruhen, z.B. PROLOG (Programming in
Logic). Weitere Stichworte sind Logikprogrammierung, maschinelles deduktives Beweisen, regelbasierte Expertensysteme und nichtmonotone Logik. Außerdem wird
die Logik in der Philosophie angewandt, um Argumente und Folgerungen zu formalisieren und Argumente auf ihre Gültigkeit zu untersuchen.
6
1.3
1 GRUNDLAGEN
Mathematische Beweisverfahren
Mathematische Beweismethoden basieren auf aussagenlogischen Gesetzen. Im Folgenden werden wir nun diejenigen Gesetze kennenlernen, die vielen Beweisen zugrunde liegen und somit häufig angewandte Beweismethoden darstellen. Das erste
grundlegende Prinzip erlaubt es uns, den Beweis einer Äquivalenz A ⇔ B durch den
Nachweis der Folgerungen A ⇒ B und B ⇒ A zu führen. Formal gilt
Proposition 1.1. Für zwei mathematische Aussagen A und B gilt
(A ⇔ B) ⇔ ((A ⇒ B) ∧ (B ⇒ A)).
Beweis. Die Behauptung beweisen wir mittels folgender Wahrheitstafel:
A
w
w
f
f
B
w
f
w
f
A⇔B
w
f
f
w
A⇒B
w
f
w
w
B⇒A
w
w
f
w
(A ⇒ B) ∧ (B ⇒ A)
w
f
f
w
Ebenfalls sehr wichtig ist der Beweis durch Kontraposition. Statt eine Folgerung
A ⇒ B direkt zu beweisen, beweist man, dass aus ¬B die Aussage ¬A folgt.
Proposition 1.2. Für zwei mathematische Aussagen A und B gilt
(A ⇒ B) ⇔ (¬B ⇒ ¬A).
A
w
Beweis. w
f
f
B
w
f
w
f
A⇒B
w
f
w
w
¬B
f
w
f
w
¬A ¬B ⇒ ¬A
f
w
f
f
w
w
w
w
Oft werden Aussagen auch durch die Herleitung von einer anderen bereits verifizierten Aussage bewiesen.
Proposition 1.3. Für zwei mathematische Aussagen A und B gilt
(A ∧ (A ⇒ B)) ⇒ B.
A
w
Beweis. w
f
f
B
w
f
w
f
A⇒B
w
f
w
w
A ∧ (A ⇒ B) A ∧ (A ⇒ B) ⇒ B
w
w
f
w
f
w
f
w
Manchmal ist es nicht so einfach, eine Aussage direkt zu beweisen. Häufig hilft
es in solchen Fällen, einen indirekten Beweis (oder auch Widerspruchsbeweis
genannt) zu führen. Wollen wir beispielsweise A beweisen, dann können wir dies
tun, indem wir die Annahme, dass A falsch ist bzw. ¬A wahr ist, zum Widerspruch
(B ∧ ¬B) führen.
1.3 Mathematische Beweisverfahren
7
Proposition 1.4. Für eine mathematische Aussage A gilt
(¬A ⇒ (B ∧ ¬B)) ⇔ A,
wobei B eine weitere mathematische Aussage bezeichnet.
Beweis. Die Aussage B ∧ ¬B ist immer falsch. Wir erhalten also die Wahrheitstafel
A
w
f
¬A
f
w
B ∧ ¬B
f
f
¬A ⇒ (B ∧ ¬B)
w
f
Eine besondere Stellung nimmt das Beweisverfahren der vollständigen Induktion
ein. Mit ihm ist es möglich, Aussagen der Form „Für alle n ∈ N gilt ...“ zu beweisen.
Das Beweisprinzip basiert auf gewissen sog. Axiomen, also mathematischen Aussagen, die die Grundlage der Mathematik bilden und als wahr angenommen werden.
Proposition 1.5. Für n ∈ N sei A(n) eine Aussage. Es gelte
(1) A(1) ist wahr.
(2) Für alle n ∈ N gilt: Ist A(n) wahr, so ist auch A(n + 1) wahr.
Dann gilt A(n) für alle n ∈ N.
Beweis. Der Proposition 1.4 folgend nehmen wir an, dass A(n) nicht für alle n ∈ N
wahr ist. Dann gibt es darunter eine kleinste natürliche Zahl n1 , die wegen (1) größer
als 1 sein muss. Daher gilt A(n) für alle n = 1, . . . , n1 − 1. Da A(n1 − 1) also wahr
ist, ist nach (2) auch A(n1 ) wahr, was der Definition von n1 widerspricht. Unsere
Annahme war also falsch und demzufolge die Behauptung richtig.
Das Beweisprinzip funktioniert auch, wenn A(n) für alle n ≥ k, k ∈ N0 , wahr sein
soll. Es erinnert an Proposition 1.3. Ausgehend von der wahren Aussage A(1) wird
mittels (2) darauf geschlossen, dass auch A(2) wahr ist. Wendet man (2) nun hierauf
an, so folgt, dass auch A(3) wahr ist usw. Ein Beweis mittels vollständiger Induktion
besteht immer aus zwei Teilen: dem Induktionsanfang (1) und dem Induktionsschritt
(2). Wir wollen uns das Beweisprinzip an einem Beispiel anschauen:
Beispiel 1.4. Für n ∈ N beweisen wir die Summenformel
1 + 2 + 3 + ··· + n =
n
X
k=1
k=
n(n + 1)
.
2
P
Für n = 1 steht auf der linken Seite 1k=1 k = 1, auf der rechten Seite 1·2
= 1. Also
2
Pn
n(n+1)
ist A(1) richtig. Sei nun A(n) richtig, also gelte k=1 k = 2 . Zu zeigen ist, dass
P
(n+1)(n+2)
auch A(n + 1) richtig ist, nämlich n+1
. Es gilt
k=1 k =
2
n+1
X
k=1
k=
n
X
k=1
I.V.
k +(n+1) =
n(n + 1)
n(n + 1) + 2(n + 1)
(n + 2)(n + 1)
+n+1 =
=
.
2
2
2
Damit ist A(n + 1) hergeleitet und somit die Aussage bewiesen.
8
2
2 DER GOLDENE SCHNITT
Der goldene Schnitt
Im Gegensatz zur symmetrischen Teilung einer Strecke gibt es unzählige Möglichkeiten, eine gegebene Strecke asymmetrisch zu teilen. Unter diesen hat der goldene
Schnitt eine besondere Bedeutung. Die auch als Proportio divina bzw. göttliche Proportion bezeichnete Aufteilung übt schon seit Jahrtausenden eine besondere Faszination auf die Menschen aus, auch weil sie als harmonisch empfunden wird. Wie wir
später sehen werden, hat der goldene Schnitt zahlreiche Anwendungen in Architektur und Kunst und kommt auch in der Natur vor. In einem engen Zusammenhang
zum goldenen Schnitt stehen die sog. Fibonacci-Zahlen, die ebenfalls in der Natur
beobachtet werden können und schon bei den alten Griechen und den Indern bekannt
waren.
2.1
Definition und Eigenschaften
Schon im zweiten Buch der Reihe Elemente formulierte Euklid (365 - 300 v. Chr.)
folgende Aufgabe:
Eine gegebene Strecke ist so zu teilen, dass das Rechteck aus der ganzen Strecke und dem einen Abschnitt dem Quadrat über dem anderen
Abschnitt gleich ist.
Die Elemente sind das älteste mathematische Werk, in dem der goldene Schnitt
behandelt wird. Wir wollen ihn jedoch ein wenig anders definieren:
Definition 2.1. Sei AB eine Strecke. Ein Punkt S von AB teilt AB im goldenen Schnitt, falls sich die größere Teilstrecke zur kleineren so verhält wie die
Gesamtstrecke zum größeren Teil.
Es gibt offensichtlich zwei mögliche Punkte, die AB im goldenen Schnitt teilen, je
nachdem, ob die größere Strecke bei A oder B liegt. Wenn nichts anderes gesagt
wird, wollen wir den Punkt S so wählen, dass er „näher bei“ B liegt. Bezeichne |AS|
die Länge der Strecke AS. Dann können wir die Definition wie folgt umformulieren:
Der Punkt S teilt AB im goldenen Schnitt, falls gilt
|AS|
|AB|
=
.
|SB|
|AS|
Wir bezeichnen die Länge der größeren Strecke mit M und die Länge der kleineren
mit m. Hat nun AB die Länge a, so ist dies gleichbedeutend zu
a
M
=
M
m
bzw. am = M 2 .
Letzteres entspricht der Formulierung von Euklid. Den Wert des Quotienten
man genau angeben:
M
m
kann
Satz 2.1. Ein Punkt S teilt die Strecke AB genau dann im goldenen Schnitt, wenn
√
M
1+ 5
=
≈ 1, 6180339.
m
2
2.1 Definition und Eigenschaften
9
Beweis. Nach Definition teilt S die Strecke AB genau dann im goldenen Schnitt,
wenn
|AB|
M
=
.
M
m
Wegen |AB| = M + m ist dies äquivalent zu
M + m M 2
=
m
m
M
M 2
⇔
+1=
m
m
M 2 M
− 1 = 0.
−
⇔
m
m
√
Das Polynom x2 −x−1 besitzt die Nullstellen x1/2 = 1±2 5 (z.B. durch die
p-q-Formel
√
1+ 5
M
M
ermittelt). Da M und m und somit auch m positiv sind, folgt m = 2 .
Die im Satz gefundene Konstante bezeichnen wir ab jetzt mit φ. Der Ausdruck
„goldener Schnitt“ kann in dreifacher Weise gebraucht werden:
• als Bezeichnung für den Vorgang der Teilung („S teilt AB im goldenen
Schnitt“),
• als Bezeichnung für den Teilungspunkt S oder
• als Bezeichnung für die Zahl φ.
Die folgende Proposition gibt einige nützliche Eigenschaften des goldenen Schnittes
an.
Proposition 2.2. (a) Es gilt φ2 = φ + 1. Umgekehrt gilt: Ist x eine positive, reelle
Zahl mit x2 = x +
√ 1, so ist x = φ.
1
(b) φ = φ − 1 = 5−1
2
√
(c) φ + φ1 = 5.
Beweis. zu (a): Teil (a) ergibt sich direkt aus dem Beweis von Satz 2.1.
zu (b): Multipliziert man die Gleichung in (a) mit φ1 , so erhalten wir
φ=1+
und damit
1
φ
√
√
1
1+ 5
5−1
=φ−1=
−1=
.
φ
2
2
zu (c): Mit (b) rechnet man
√
√
1
1+ 5
5−1 √
φ+ =
+
= 5.
φ
2
2
Bemerkung 2.1. Aus Proposition 2.2 folgt u.a., dass sich beliebige positive und negative Potenzen von φ als lineare Ausdrücke in φ, d.h. in der Form aφ + b mit
ganzzahligen a und b, schreiben lassen.
10
2 DER GOLDENE SCHNITT
Beispiel 2.1. Mit Hilfe von Proposition 2.2 rechnet man nach:
1 1
φ3 +φ−2 = φ·φ2 + · = φ(φ+1)+(φ−1)2 = 2φ2 −φ+1 = 2(φ+1)−φ+1 = φ+3.
φ φ
Wir fassen alle wichtigen Eigenschaften des goldenen Schnittes in dem folgenden
Satz zusammen:
Satz 2.3. Eine Strecke AB habe die Länge a, und S sei ein Punkt dieser Strecke.
Wenn wir mit M die Länge der längeren Teilstrecke und mit m die Länge der kürzeren Teilstrecke bezeichnen, dann sind folgende Aussagen äquivalent:
(1) S teilt AB im goldenen Schnitt
(2)
(3)
M
m
=φ
M 2
=
m
M
m
(4)
a
M
=φ
(5)
a
m
=φ+1
+1
Beweis. Die Äquivalenz von (1) und (2) ist Aussage des Satzes 2.1.
Die Äquivalenz von (2) und (3) folgt direkt aus Teil (a) der Proposition 2.2.
(1) ⇔ (4): Nach Definition des goldenen Schnittes ist (1) genau dann wahr, wenn
am = M 2 gilt. Wegen a = M + m folgt daraus
am = M 2
⇔ a(a − M ) = M 2
⇔ a2 = M 2 + aM
a 2
a
=
+ 1.
⇔
M
M
Nach Proposition 2.2 ist dies gleichbedeutend zu Ma = φ.
(1) ⇔ (5): Wegen M = a − m erhalten wir
⇔
⇔
⇔
⇔
M 2 = am
(a − m)2 = am
a − m 2
a
a−m
=
=
+1
m
m
m
a−m
=φ
m
a
a−m
=
+1=φ+1
m
m
Aus Proposition 2.2 kann man noch zwei weitere Darstellung der Zahl φ herleiten.
Nach Teil (b) der Proposition gilt die Gleichung φ = 1+ φ1 . Durch dieselbe Gleichung
können wir das φ im Nenner ersetzen, so dass φ = 1+ 1+1 1 . Setzen wir dies unendlich
φ
oft fort, so erhalten wir für φ den (unendlichen) Kettenbruch
φ=1+
1
1+
.
1
1+
1
1
1+ 1+...
2.2 Konstruktionen des goldenen Schnitts
11
Bemerkenswert ist, dass dieser Kettenbruch
√ nur aus Einsen besteht. Aus Teil (a)
der Proposition 2.2 folgt außerdem φ = 1 + φ. Ersetzt man
das φ unter der
phier √
Wurzel wieder durch dieselbe Gleichung, so erhält man φ = 1 + 1 + φ. Iterativ
ergibt sich also für φ die Darstellung
s
r
q
√
φ = 1 + 1 + 1 + 1 + . . ..
In Erweiterung des goldenen Schnittes nennen wir ein Rechteck golden, falls sich
die Längen seiner Seiten wie φ : 1 verhalten.
2.2
Konstruktionen des goldenen Schnitts
Unter Verwendung der Konstante φ aus dem vorangegangenen Abschnitt kann man
zu einer vorgegebenen Strecke den goldenen Schnitt berechnen und mit einem hinreichend genauen Lineal (zumindest annähernd) abmessen. Im Falle des goldenen
Schnittes sind aber auch Konstruktionen mit Zirkel und Lineal möglich, von denen
ich hier einige vorstellen möchte. Dabei unterscheidet man eine innere und eine äußere Teilung. Bei der inneren Teilung wird ein Punkt einer vorgegebenen Strecke
konstruiert, der die Strecke im goldenen Schnitt teilt. Im Gegensatz dazu wird bei
der äußeren Teilung ein Punkt auf der Verlängerung der ursprünglichen Strecke
konstruiert, der die vorhandene Strecke zum (größeren) Teil des goldenen Schnittes
macht.
Ein klassisches Verfahren der inneren Teilung, das auf Heron von Alexandria (1.
Jh. n. Chr.) zurückgeht und wegen seiner Einfachheit sehr beliebt ist, funktioniert
folgendermaßen:
1. Man errichte auf der gegebenen Strecke AB im Punkt B eine Senkrechte der
halben Länge von AB mit dem Endpunkt C.
2. Der Kreis um C mit Radius |CB| schneidet die Verbindung AC in einem Punkt
D.
3. Der Kreis um A mit dem Radius |AD| teilt die Strecke AB im Verhältnis des
goldenen Schnittes.
Die Konstruktionen im ersten Schritt (Fällen des Lots und Abtragen der halben
Länge einer Strecke) erläutere ich hier nicht näher. Die folgende Grafik verdeutlich
das Verfahren:
C
D
A
S
B
12
2 DER GOLDENE SCHNITT
Begründung. Sei a die Länge der Strecke AB. Nach dem Satz des Pythagoras gilt
√
a 2 5a2
5
2
2
2
2
|AC| = a + |BC| = a +
⇒ |AC| =
a.
=
2
4
2
Aufgrund der Konstruktion des Punktes D gilt |CD| = |BC| = a2 . Mit Proposition 2.2 folgt dann
√
√
5 a
5−1
a
|AS| = |AD| = |AC| − |CD| = a
− =a
= .
2
2
2
φ
Für das Verhältnis der Seitenlängen erhalten wir also
|AB|
a
= a = φ.
|AS|
φ
Nach Satz 2.3 ist dies gleichbedeutend dazu, dass S die Strecke AB im goldenen
Schnitt teilt.
Die folgende Konstruktion stammt von Euklid und ist somit älter als die soeben
vorgestellte. Wir beginnen wieder mit einer gegebenen Strecke AB, die nach dem
goldenen Schnitt zu teilen ist.
1. Errichte auf der gegeben Strecke AB im Punkt A eine Senkrechte der halben
Länge von AB mit dem Endpunkt C.
2. Schlage um C einen Kreis mit Radius |CB| und finde den Punkt D als Schnittpunkt dieses Kreises mit der Verlängerung der Strecke CA über A hinaus.
3. Schlage um A einen Kreis mit Radius |AD| und finde den Punkt S als Schnittpunkt mit der Strecke AB. Im Punkt S wird die Strecke AB im goldenen
Schnitt geteilt.
C
A
B
D
Begründung. Nach Konstruktion in Schritt 3 und aufgrund der Lage der Punkte A,
C und D gilt
|AS| = |AD| = |CD| − |AC|.
2.2 Konstruktionen des goldenen Schnitts
13
Aufgrund der Konstruktion in Schritt 2 ist |CD| = |CB|. Mit Schritt 1 folgt
|AS| = |CB| −
|AB|
.
2
Mit Hilfe des Satzes von Pythagoras ergibt sich
5
|AB|2
= |AB|2 .
|CB| = |AB| + |AC| = |AB| +
4
4
2
2
2
2
Mit Proposition 2.2 erhalten wir insgesamt
√5 − 1 |AB|
|AS| =
|AB| =
,
2
φ
also
|AB|
|AS|
= φ.
Als Beispiel für eine äußere Teilung einer gegebenen Strecke AS betrachten wir das
folgende erst 1982 vom amerikanischen Künstler George Odom entdeckte Konstruktionsverfahren:
1. Konstruiere ein gleichseitiges Dreieck mit Eckpunkten X, Y und Z. Die Seitenlänge des Dreiecks sei 2a.
2. Konstruiere den Umkreis, also den Kreis, der durch alle Ecken des Dreiecks
verläuft.
3. Halbiere zwei Seiten des Dreiecks in den Punkten A und S.
4. Die Verlängerung der Strecke AS schneidet den Kreis in den Punkten B (Verlängerung über S hinaus) und C (Verlängerung über A hinaus). S teilt die
Strecke AB im Verhältnis des goldenen Schnittes.
Ist die Strecke AS gegeben, so beginnt man mit der Konstruktion des gleichseitigen
Dreiecks mit Grundseite AS, verlängert die anderen Seiten auf die doppelte Länge,
konstruiert den Umkreis des entstehenden großen gleichseitigen Dreiecks und kann
dann auch hier den Schnittpunkt B der Verlängerung von AS mit dem Umkreis
bestimmen.
Z
A
C
X
S
B
Y
14
2 DER GOLDENE SCHNITT
Begründung. Nach Konstruktion ist |Y S| = |SZ| = a. Aus den Strahlensätzen
ergibt sich dann |AS| = a. Mit b sei die Länge der Strecke SB bezeichnet. Aus
Symmetriegründen ist dann auch |AC| = b. Die Strecken Y Z und BC bilden zwei
Sehnen, die sich in S schneiden. Nach dem Sehnensatz gilt
a2 = |SY | · |SZ| = |SB| · |SC| = b(a + b).
Division durch b2 liefert die Gleichung
a 2
b
=
a
+ 1.
b
Nach Proposition 2.2 bzw. Satz 2.3 ist dies äquivalent zu
S die Strecke AB also im goldenen Schnitt.
a
b
= φ, nach Satz 2.3 teilt
Bemerkung 2.2. Es gibt eine weitere Begründung, die ohne den Sehnensatz auskommt. Dazu zeichnet man die Höhe auf der Grundseite XY ein. Den Schnittpunkt
mit AS bezeichne man mit P . Auch der Mittelpunkt M des Umkreises liegt auf
dieser Strecke. Nach den Strahlensätzen ist |P S| = 12 a. Als Höhe des gleichseitigen
√
√
Dreiecks XY Z ermittelt man 3 a. Der Umkreisradius beträgt r = 23 3 a. Wendet
man den Satz des Pythagoras auf das rechtwinklige Dreieck M P B an, so erhält man
√ 2 2 √
1
3 2 2 √ 2
2
2
2
a+b +
3a −
a =
3a .
|P B| + |P M | = |M B| ⇔
2
3
2
3
Umformen liefert die Gleichung
b2 + ab − a2 = 0.
Die einzige positive Lösung dieser Gleichung ist b = − a2 +
a
2
= √5−1
= φ teilt S die Strecke AB im goldenen Schnitt.
b
2.3
√
5
2
√
a =
5−1
2
a. Wegen
Fibonacci-Zahlen und goldener Schnitt
Diesen Abschnitt möchte ich mit einem einführenden Beispiel beginnen. Wir betrachten die Vermehrung von Kaninchenpaaren unter idealisierten Bedingungen.
Man macht folgende Annahmen:
• Jedes Kaninchenpaar wird im Alter von zwei Monaten fortpflanzungsfähig.
• Jedes fortpflanzungsfähige Kaninchenpaar bringt jeden Monat ein neues Paar
zur Welt.
• Alle Kaninchen leben ewig.
Im ersten Monat beginnen wir mit einem neugeborenen Kaninchenpaar. Dieses ist
noch nicht fortpflanzungsfähig, so dass auch im zweiten Monat nur dieses eine Kaninchenpaar lebt. Jetzt ist das Paar jedoch fortpflanzungsfähig und bringt ein neues
Kaninchenpaar zur Welt. Im dritten Monat sind also insgesamt zwei Kaninchenpaare
vorhanden. Das neugeborene Kaninchenpaar kann sich im dritten Monat noch nicht
fortpflanzen, das ursprüngliche Paar bringt aber erneut ein Kaninchenpaar zur Welt,
so dass im vierten Monat insgesamt drei Kaninchenpaare existieren. Das folgende
Diagramm veranschaulicht die Vermehrung der Kaninchenpaare. Dabei steht „x“ für
ein nicht fortpflanzungsfähiges Paar und „o“ für ein gebärfähiges Paar.
2.3 Fibonacci-Zahlen und goldener Schnitt
15
x
o
o
x
o
x
o
o
x
o
x
o
x
o
x
o
o
o
x
o
Bezeichne fn die Anzahl der Kaninchenpaare im n-ten Monat. Treiben wir unser
Gedankenexperiment weiter, so erhalten wir die Folge
f1 = 1, f2 = 1, f3 = 2, f4 = 3, f5 = 5, f6 = 8, f7 = 13, . . .
Doch wie geht es dann weiter? Eine Antwort gibt
Proposition 2.4. Für alle n ∈ N gilt
fn+2 = fn + fn+1 .
Beweis. Wir betrachten die Situation im (n + 1)-ten Monat. Zu diesem Zeitpunkt
gibt es nach Definition genau fn+1 Kaninchenpaare. Von diesen sind genau fn Paare
gebärfähig, nämlich diejenigen, die schon im n-ten Monat gelebt haben. Im (n + 2)ten Monat bringen also genau fn der fn+1 Paare ein junges Paar zur Welt, d.h. es
gilt
fn+2 = Anzahl der Kaninchenpaare im (n + 1)-ten Monat
+Anzahl der Paare, die im (n + 2)-ten Monat geboren werden
= fn+1 + fn .
Zu Ehren von Leonardo von Pisa (ca. 1170-ca. 1240), der auch Leonardo Fibonacci
(kurz für „filius bonacci“ – Sohn des Bonacci) genannt wurde und die Folge 1227
anhand der obigen Aufgabe in seinem Buch Liber Abaci beschrieb, definiert man
Definition 2.2. Die Zahlenfolge (fn )n∈N mit f1 = 1, f2 = 1 und
fn+2 = fn+1 + fn ,
für alle n ∈ N,
heißt Fibonacci-Folge.
Die Folge war jedoch schon in der Antike um 100 v. Chr. bekannt, im asiatischen
Raum sogar noch früher.
Das einführende Beispiel ist zugegebenermaßen unrealistisch: Kein Kaninchen lebt
ewig und bringt immer ein Kaninchenpaar zur Welt. Auch gibt es natürliche Wachstumshemmnisse (Futtermangel, Raubtiere), die den Bestand der Kaninchen nicht
beliebig anwachsen lassen. Realistischer ist da schon das folgende Beispiel aus der
Natur.
16
2 DER GOLDENE SCHNITT
Beispiel 2.2. Eine Drohne (männliche Biene) schlüpft aus einem unbefruchteten
Ei einer Bienenkönigin, während aus den befruchteten Eiern die weiblichen Arbeiterbienen und Königinnen schlüpfen. Eine Drohne hat also nur ein Elter, während
Königinnen zwei Eltern haben.
Anhand des folgenden Diagramms wird klar, dass in der n-ten Vorfahrengeneration
genau fn Vorfahren existieren, und zwar fn−1 weibliche und fn−2 männliche.
D K
K
D K
K
K
D
K
D
D
K
D K D K
K
K
K
K
D
D
D
K
D K
D
K
K
K
K
K
D
Es gibt jedoch weitere Folgen, die die Rekursionseigenschaft der Fibonacci-Folge
besitzen.
Definition 2.3. Eine Folge (an )n∈N reeller Zahlen heißt eine Lucas-Folge, falls für
alle n ∈ N gilt
an+2 = an+1 + an .
Die Lucas-Folge mit den beiden Anfangswerten a1 = 1 und a2 = 1 ist gerade die
Fibonacci-Folge.
Beispiel 2.3. Bezeichnet man die Potenzen φn der Zahl φ mit un , so gilt nach Proposition 2.2 für alle n ∈ N
un+2 = φn+2 = φn · φ2 = φn (φ + 1) = φn+1 + φn = un+1 + un .
Die Folge (un )n∈N ist also ebenfalls eine Lucas-Folge. Gleiches gilt für die Folge
n
(vn )n∈N mit vn = − φ1 , denn nach Proposition 2.2 gilt
vn+2
1 n+2 1 n 1 2 1 n 1
= −
= −
· −
= −
· 2
φ
φ
φ
φ
φ
1 n 1 1 n 1 n+1
= −
· 1−
= −
+ −
= vn + vn+1 .
φ
φ
φ
φ
Zwischen der Fibonacci-Folge und einer beliebigen Lucas-Folge besteht folgender
Zusammenhang:
Proposition 2.5. Für jede Lucas-Folge (an )n∈N und für jede natürliche Zahl k ≥ 2
gilt
ak+1 = fk · a2 + fk−1 · a1 .
2.3 Fibonacci-Zahlen und goldener Schnitt
17
Beweis. Die Aussage beweisen wir mittels Induktion nach k. Für k = 2 gilt nach
Definition 2.3 und Definition 2.2
a2+1 = a3 = a2 + a1 = 1 · a2 + 1 · a1 = f2 a2 + f1 a1
und
a3+1 = a4 = a3 + a2 = a2 + a1 + a2 = 2 · a2 + 1 · a1 = f3 a2 + f2 a1 .
Wir nehmen nun an, dass die Formel für k − 1 und k (k ≥ 3) bereits bewiesen sei.
Dann folgt
ak+1+1 = ak+2 = ak+1 + ak = fk a2 + fk−1 a1 + fk−1 a2 + fk−2 a1
= (fk + fk−1 )a2 + (fk−1 + fk−2 )a1 = fk+1 a2 + fk a1 .
Die Formel gilt also auch für k + 1.
Mit Hilfe der bisherigen Ergebnisse können wir die berühmte Binet-Formel herleiten,
die eine explizite Darstellung der Fibonacci-Zahlen mit Hilfe des goldenen Schnittes
erlaubt. Sie ist nach dem französischen Mathematiker Jaques Philippe Marie Binet
(1786-1856) benannt, der die Formel 1843 fand. In manchen Quellen wird die Formel
korrekterweise auch Moivre-Binet-Formel genannt, da sie bereits im Jahr 1718 durch
den französischen Mathematiker Abraham de Moivre (1667-1754) entdeckt wurde.
Satz 2.6 (Binet-Formel). Für alle natürlichen Zahlen n gilt
n
√
√
φn − − φ1
1 h 1 + 5 n 1 − 5 n i
√
.
−
fn =
=√
2
2
5
5
Beweis. Wegen
φ − − φ1
φ + φ1
√
= √ = 1 = f1
5
5
ist die Binet-Formel auch für n = 1 richtig.
Wendet man Proposition 2.5 auf die beiden Lucas-Folgen (un )n∈N und (vn )n∈N aus
Beispiel 2.3 an, so erhält man für n ≥ 2 die Gleichungen
φn = fn · φ + fn−1
und
1 n
fn
= fn−1 − .
−
φ
φ
Dies sieht man auf folgende Weise ein:
Für n = 2 entspricht die erste Gleichung dem Teil (a) von Proposition 2.2. Für n ≥ 3
erhalten wir mit Proposition 2.5 und Proposition 2.2
φn = un = fn−1 u2 + fn−2 u1 = fn−1 φ2 + fn−2 φ
= fn−1 (φ + 1) + fn−2 φ = (fn−1 + fn−2 )φ + fn−1 = fn φ + fn−1 .
Nach Proposition 2.2 gilt
1
φ−1
1
f2
=
= 1 − = f1 − .
2
φ
φ
φ
φ
18
2 DER GOLDENE SCHNITT
Die zweite der Gleichungen ist also für n = 2 richtig. Mit Proposition 2.5 und
Proposition 2.2 ergibt sich zudem für n ≥ 3
1 n
fn−1 fn−2
−
= vn = fn−1 v2 + fn−2 v1 = 2 −
φ
φ
φ
1
1
fn
1
− fn−2 = fn−1 − (fn−1 + fn−2 ) = fn−1 − .
= fn−1 1 −
φ
φ
φ
φ
Durch Subtraktion der beiden Gleichungen folgt für n ≥ 2 mittels (c) aus Proposition 2.2
1 n
√
1
fn
n
= fn φ +
= fn · 5.
φ − −
= fn · φ +
φ
φ
φ
Bemerkung 2.3. Erstaunlicherweise heben sich für alle n ∈ N die irrationalen Terme
gegenseitig auf, so dass die Formel stets ganzzahlige Werte liefert.
Nun betrachten wir die „Fibonacci-Quotienten“ fn+1
. Die ersten Werte der Folge
fn
fn+1
lauten
fn n∈N
1; 1, 5; 1, 666 . . . ; 1, 6; 1, 625; . . .
Wir erkennen, dass sich die Quotienten der Zahl φ annähern. Tatsächlich gilt:
Satz 2.7. Die Folge fn+1
konvergiert gegen φ.
fn n∈N
für n ≥ 1.
Beweis. Setze xn = fn+1
fn
1
1. Schritt: Es gilt xn = 1 + xn−1
für n ≥ 2, denn
1+
1
xn−1
=1+
fn−1
fn + fn−1
fn+1
=
=
= xn .
fn
fn
fn
2. Schritt: Für n ≥ 2 gilt
|φ − xn | =
|φ − xn−1 |
,
φ · xn−1
denn mit dem ersten Schritt und (b) aus Proposition 2.2 folgt
1 1 xn−1 − φ
=
.
φ − xn = 1 + − 1 +
φ
xn−1
φ · xn−1
3. Schritt: Für n ≥ 2 gilt
|φ − xn | ≤
|φ − x2 |
.
φn−2
Wegen xn+1 ≥ 1 folgt aus dem zweiten Schritt nämlich
|φ − xn | ≤
|φ − xn−1 |
,
φ
woraus sich iterativ die behauptete Ungleichung ergibt.
2|
Da φ > 1, wird |φ−x
für wachsendes n beliebig klein. Nach der Ungleichung aus
φn−2
dem dritten Schritt konvergiert dann aber (xn )n∈N gegen φ.
2.4 Auftreten des goldenen Schnittes und der Fibonacci-Zahlen
2.4
19
Auftreten des goldenen Schnittes und der Fibonacci-Zahlen
Im Fruchtstand der Sonnenblume sind die Kerne in spiralförmigen Linien angeordnet. Jeder Kern gehört zu genau einer linksdrehenden und zu genau einer rechtsdrehenden Spirallinie.
Abbildung 1: Spiralenförmige Anordnung der Kerne in der Sonnenblume.
Quelle: http://members.chello.at
Die Anzahlen der linksdrehenden Spirallinien sind keine beliebigen Zahlen, sondern
Fibonacci-Zahlen. Auch als Anzahl der rechtsdrehenden Spirallinien erhalten wir eine Fibonacci-Zahl, allerdings nicht die gleiche, sondern eine benachbarte. Das gleiche
Prinzip findet man auch bei Gänseblümchen, bei Tannenzapfen, bei Pinienzapfen,
beim Kohl und bei der Ananas. Dies hängt damit zusammen, dass das Keimzentrum
den jeweils nächsten Samen immer um einen Winkel von etwa 137,5◦ bzw. 222,5◦
(wenn man in der anderen Richtung misst) versetzt entstehen lässt. Es gilt
360
≈ 1, 618 und
222, 5
222, 5
≈ 1, 618,
137, 5
Beide Winkel teilen den Vollwinkel also im Verhältnis des goldenen Schnittes, man
spricht deshalb auch vom goldenen Winkel. Dieses Verhältnis kann nach Satz 2.7 gut
durch das Verhältnis zweier benachbarter Fibonacci-Zahlen approximiert werden.
Pflanzen bevorzugen den goldenen Winkel, weil mit ihm auf kleiner Fläche viele
Samen untergebracht werden können.
Wir treffen erneut auf die Fibonacci-Zahlen bzw. den goldenen Schnitt, wenn wir
die Blattstellungen verschiedener Pflanzen – in der Biologie Phyllotaxis genannt –
betrachten. Bei Ulme und Linde sind die Blätter abwechselnd auf der einen oder
der anderen Seite angeordnet, man spricht hier auch von 21 -Phyllotaxis. Bei Buche
und Haselnuss bilden benachbarte Blätter einen Winkel von 31 eines Vollkreises.
Biologisch ausgedrückt liegt hier 13 -Phyllotaxis vor. Weitere Werte sind:
• Aprikose, Apfelbaum, Eiche: 25 -Phyllotaxis
• Pappel, Birnbaum: 83 -Phyllotaxis
• Weide, Mandelbaum:
5
-Phyllotaxis
13
Wir erkennen, dass es sich stets um Quotienten von Fibonacci-Zahlen handelt. Wenn
wir bedenken, dass eine Drehung um 83 eines Vollwinkels im Uhrzeigersinn einer
Drehung um 58 eines Vollwinkels gegen den Uhrzeigersinn entspricht, so handelt es
20
2 DER GOLDENE SCHNITT
sich sogar um Quotienten benachbarter Fibonacci-Zahlen, die nach Satz 2.7 eine
gute Näherung an den goldenen Schnitt darstellen.
Der goldene Schnitt ist auch bei den Proportionen des Körpers von Bienen zu finden.
Abbildung 2: Der goldene Schnitt bei der Biene. Quelle: www.michael-holzapfel.de
Neben dem natürlichen Auftreten des goldenen Schnittes wurde dieses besondere
Teilungsverhältnis aufgrund seiner harmonischen Wirkung auch oft in der Architektur angewendet. Vielfach ist jedoch umstritten, ob dies bewusst geschehen ist, da
eindeutige Hinweise darauf mitunter fehlen. So ist auch nicht sicher, ob die alten
Ägypter den goldenen Schnitt beim Bau der Pyramiden verwendet haben. Hingegen sprechen viele Anzeichen dafür, dass der goldene Schnitt in der griechischen
Architektur eine große Rolle gespielt hat, und zwar schon 150 Jahre vor der schriftlichen, systematischen Behandlung durch Euklid. Als Beispiel sei hier der Parthenon
genannt, den Perikles zwischen 447 und 432 v. Chr. bauen ließ.
Abbildung 3: Der goldene Schnitt am Parthenon.
Quelle: www.golden-section.eu
Gemäß Bild 3 stehen der Oberbau, der vom Giebel bis zu den Säulen reicht, und der
Unterbau, der die Säulen und Stufen umfasst, überraschend exakt im Verhältnis des
goldenen Schnittes. Zudem passt die Vorderfront fast exakt in ein goldenes Rechteck
(vgl. Bild 4). Auch an Kapitellen und Gebälk verschiedener klassischer Bauten in
Athen findet sich der goldene Schnitt.
Abbildung 4: Der Parthenon im goldenen Rechteck.
Quelle: www.golden-section.eu
2.4 Auftreten des goldenen Schnittes und der Fibonacci-Zahlen
21
Seine Blütezeit erlebte der goldene Schnitt in der Renaissance. Als Beispiel für seine
Verwendung in dieser Epoche wird häufig das Alte Rathaus in Leipzig angeführt,
das in den Jahren 1556/57 im Auftrag des regierenden Bürgermeisters Hieronymus
Lotter umgebaut wurde.
Abbildung 5: Altes Rathaus Leipzig, Quelle: wikipedia
Der Turm des Rathauses teilt das Gebäude (in etwa) im Verhältnis des goldenen
Schnittes.
Auch an vielen Gemälden, Reliefs und Plastiken wurde der goldene Schnitt nachgewiesen bzw. nachgemessen. Seine Funktion ist einerseits, zur harmonischen Aufteilung des gesamten Kunstwerkes beizutragen; zum anderen dient er dazu, wichtige
Details besonders zu betonen. Wie bei den architektonischen Beispielen ist hier jedoch ebenfalls häufig umstritten, ob der goldene Schnitt bewusst angewendet wurde,
da keine Aufzeichnungen dazu existieren.
Albrecht Dürer (1471-1528), der nicht nur Maler sondern auch Mathematiker war,
hat den goldenen Schnitt höchstwahrscheinlich als Gestaltungsgrundlage einiger Bilder verwendet. Als Beispiel betrachten wir das „Selbstbildnis mit Pelzrock“ von 1500.
Abbildung 6: Albrecht Dürer: Selbstbildnis im Pelzrock, 1500
Quelle: wikipedia
22
2 DER GOLDENE SCHNITT
Auffällig ist, dass der Kopf mit den wallenden Haaren ein gleichseitiges Dreieck bildet. Die Basis dieses Dreiecks, die mit der Spitze des weißen Hemdes zusammentrifft,
teilt die Höhe des Gesamtbildes im goldenen Schnitt. Ebenso teilen die senkrechten, das Gesicht begrenzenden Linien die Breite des Bildes annähernd im goldenen
Schnitt.
In der Sixtinischen Madonna (1514) von Raffaelo Santi (genannt Raffael) (14831520) lässt sich der goldene Schnitt ebenfalls mehrfach nachweisen.
Abbildung 7: Raffael: Sixtinische Madonna, 1514
Quelle: www.michael-holzapfel.de
Auch in der Fotografie wird häufig die Aufteilung des Bildes im Verhältnis des
goldenen Schnittes empfohlen, um einen harmonischen Gesamteindruck zu erzeugen.
In der Musik gibt es zwei Möglichkeiten, wie der goldene Schnitt zur Gestaltung
herangezogen werden kann. Zum einen können Tonintervalle gemäß dem goldenen
Schnitt gewählt werden. Zum anderen können musikalische Werke aus mehreren Teilen bestehen, deren Längen zueinander im Verhältnis des goldenen Schnittes stehen.
Es gibt Untersuchungen, nach denen z.B. Béla Bartók (1881-1945) seine Kompositionen gemäß dem goldenen Schnitt gestaltet haben könnte, dies ist allerdings
umstritten. Als Beispiel wird häufig die Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug
angeführt. Auffällig ist, dass die gesamte Sonate genau 6432 Achtelnoten umfasst
und der zweite Satz nach 3975 Achtelnoten beginnt – dies entspricht ziemlich genau
dem goldenen Schnitt. In neueren Werken werden jedoch bewusst Fibonacci-Zahlen
zur Proportionierung benutzt, etwa im Klavierstück IX von Karlheinz Stockhausen oder in der Spektralmusik von Gérard Grisey. Auch im Musikinstrumentenbau
selbst findet der goldene Schnitt gelegentlich Verwendung. Insbesondere beim Geigenbau soll er für einen besonders schönen Klang der Instrumente sorgen. Es wird
sogar behauptet, dass der berühmte Geigenbauer Stradivari den goldenen Schnitt
verwendete, diese Behauptung basiert jedoch nur auf nachträglichen Analysen.
23
3
Die Mathematik in der Musik
Mathematik und Musik erscheinen auf den ersten Blick sehr verschieden. Dennoch
gibt es zahlreiche Aspekte der Musik, in denen Mathematik eine Rolle spielt. Dies
fängt schon damit an, dass Klänge nichts anderes als Schallwellen sind, zu deren
Beschreibung die Mathematik herangezogen werden muss. Auch die Abstände zwischen verschiedenen Tönen sind nicht beliebig gewählt, sondern beruhen auf mathematischen Überlegungen. Bei der Festlegung dieser sog. Tonintervalle tritt ein
Problem zutage, das historisch durch verschiedene Stimmungen gelöst wurde. Mit
diesem Hintergrundwissen wollen wir dann untersuchen, wie man Klänge verschiedener Instrumente mit Hilfe der Mathematik synthetisieren kann. Und auch beim
Komponieren selbst kann Mathematik eingesetzt werden.
3.1
Tonerzeugung
Bei allen Musikinstrumenten entstehen Töne durch einen Schwingungsvorgang: Bei
einer Geige schwingt die Saite, wenn sie gezupft oder gestrichen wird. In einem
Klavier oder Flügel entstehen die Töne ebenfalls durch das Schwingen der Saiten,
die jedoch diesmal von Hämmerchen angeschlagen werden. Auch in Orgelpfeifen
oder Flöten entstehen Töne durch die Schwingung der darin befindlichen Luftsäule.
Sogar der Mensch selbst kann beim Singen (mehr oder weniger wohlklingende) Töne
produzieren, wenn er seine/ihre Stimmbänder in geeignete Schwingungen versetzt.
In diesem Abschnitt wollen wir kurz auf die mathematischen und physikalischen
Hintergründe von Schwingungen eingehen. Dabei wird eine Funktion vorkommen,
die von zwei Variablen abhängt. Für derartige Funktionen müssen wir einen neuen
Ableitungsbegriff einführen.
Wir wollen damit beginnen, festzulegen, was wir unter einer Funktion verstehen.
Definition 3.1. Eine Funktion ist eine Beziehung zwischen zwei Mengen D und
W , die jedem Element x aus dem Definitionsbereich D genau einen Wert f (x)
aus dem Wertebereich W zuordnet.
Neben der aus der Schule bekannten Notation ist in der Mathematik auch die Notation f : D → W, x 7→ f (x) gebräuchlich. Weiterhin benötigen wir den Begriff der
Konvergenz. Dabei kann man sich eine reelle Folge (xn )n∈N als unendlich lange Liste
(x1 , x2 , x3 , . . .) von reellen Zahlen vorstellen.
Definition 3.2. Eine reelle Folge (xn )n∈N heißt konvergent gegen x ∈ R, wenn
gilt
∀ε > 0∃n0 ∈ N∀n ≥ n0 : |xn − x| < ε.
In diesem Fall schreiben wir limn→∞ xn = x.
Anschaulich heißt das, dass es zu jedem ε > 0 einen Index n0 ∈ N gibt, ab dem
alle Folgenglieder xn von x um weniger als ε entfernt sind. Die Folgenglieder nähern
sich also beliebig nah dem Wert x an. Diese Definition ist uns bereits in Beispiel 1.3
begegnet.
Ohne Beweis bemerken wir:
24
3 DIE MATHEMATIK IN DER MUSIK
Bemerkung 3.1. Sind (xn )n∈N und (yn )n∈N konvergente Zahlenfolgen mit limn→∞ xn =
x und limn→∞ yn = y, dann gilt auch
xn
x
lim (xn + yn ) = x + y ; lim (xn · yn ) = x · y ; lim
= , falls y 6= 0.
n→∞
n→∞
n→∞ yn
y
Es gibt Funktionen, bei denen eine kleine Änderung im Definitionsbereich nur zu
einer geringfügigen Änderung des Funktionswerts führt. Formal definiert man
Definition 3.3. Sei D ⊂ R. Eine Funktion f : D → R heißt stetig im Punkt
a ∈ D, wenn
∀ε > 0∃δ > 0∀x ∈ D : (|x − a| < δ ⇒ |f (x) − f (a)| < ε).
Eine Funktion f : D → R heißt stetig, wenn sie in jedem Punkt a ∈ D stetig ist.
Da wir uns hier ausschließlich im Reellen befinden, genügt es, sich statt der Definition
das folgende Kriterium zu merken:
Satz 3.1. Eine Funktion f : D → R ist in a ∈ D genau dann stetig, wenn für jede
Folge (xn )n∈N in D, die gegen a konvergiert, die Folge (f (xn ))n∈N der Funktionswerte
gegen f (a) konvergiert.
Nun zur Differenzierbarkeit. Anschaulich ist durch zwei Punkte (x0 , f (x0 )) und
(x, f (x)) des Graphen der Funktion f eine Gerade festgelegt, die durch diese Punk(x0 )
. Diesen Quotienten bezeichnet man
te geht. Die Steigung der Geraden ist f (x)−f
x−x0
auch als Differenzenquotient. Verschieben wir nun x immer näher an x0 , so wird
aus der Sekante im Grenzfall eine Tangente an den Punkt (x0 , f (x0 )), sofern diese
existiert. Das bekannteste Beispiel einer in 0 nicht differenzierbaren Funktion ist
die Betragsfunktion | · |. Die Steigung der entstehenden Tangente wollen wir als
Ableitung der Funktion im Punkt x0 definieren.
Definition 3.4. Sei [a, b] ⊂ R. Eine Funktion f : [a, b] → R heißt in x0 ∈ (a, b)
differenzierbar, wenn es eine reelle Zahl A gibt, so dass
lim
x→x0
f (x) − f (x0 )
= A.
x − x0
df
Der Wert A heißt dann Ableitung von f in x0 und wird mit f 0 (x0 ) oder dx
(x0 )
bezeichnet. Die Funktion f heißt differenzierbar, wenn sie in allen Punkten x0
differenzierbar ist. Die Funktion f heißt stetig differenzierbar (in x0 ), wenn
sie (in x0 ) differenzierbar und f 0 (in x0 ) stetig ist. Die Funktion f heißt zweimal
differenzierbar (in x0 ), wenn f und ihre Ableitung f 0 (in x0 ) differenzierbar sind.
Man kann zeigen, dass jede in einem Punkt x0 differenzierbare Funktion auch stetig
in x0 ist. Der folgende Satz fasst einige Rechenregeln für Ableitungen zusammen.
Satz 3.2. Seien f, g : (a, b) → R in einem Punkt x0 differenzierbare Funktionen
und α, β ∈ R. Dann sind auch die Funktionen αf + βg, f · g und, falls g(x0 ) 6= 0,
die Funktion fg differenzierbar in x0 . Für die Ableitungen gilt
(αf + βg)0 (x0 ) = αf 0 (x0 ) + βg 0 (x0 ) , (f · g)0 (x0 ) = f 0 (x0 ) · g(x0 ) + f (x0 ) · g 0 (x0 )
sowie
f 0
g
(x0 ) =
f 0 (x0 ) · g(x0 ) − f (x0 )g 0 (x0 )
.
g 2 (x0 )
3.1 Tonerzeugung
25
Einen Beweis finden Sie in Analysisbüchern. Darin schreibt man zunächst die jeweiligen Differenzenquotienten auf, zerlegt sie in eine Summe von Termen und untersucht
die einzelnen Summanden auf Konvergenz. Mit Bemerkung 3.1 folgt dann die Konvergenz des Differenzenquotienten und somit die Differenzierbarkeit.
Ferner gilt die Kettenregel:
Satz 3.3 (Kettenregel). Ist f : (a, b) → R differenzierbar in (a, b), J = f ((a, b)) =
{y ∈ R : ∃x ∈ (a, b) : y = f (x)} und ist g : J → R differenzierbar in J, so ist die
Hintereinanderausführung g ◦ f : (a, b) → R, x 7→ g(f (x)) differenzierbar in (a, b)
und es gilt die Kettenregel
(g ◦ f )0 (x) = g 0 (f (x)) · f 0 (x).
Beispiel 3.1. Eine konstante Funktion, d.h. eine Funktion mit f (x) = c für alle
x ∈ R und ein c ∈ R, ist differenzierbar mit Ableitung f 0 (x) = 0.
Man kann elementar nachrechnen, dass die Funktion f (x) = x differenzierbar ist mit
Ableitung f 0 (x) = 1. Durch Induktion nach n folgt daraus mit Satz 3.2, dass auch
f (x) = xn für n ∈ N auf R differenzierbar ist P
mit f 0 (x) = nxn−1 . Ebenfalls nach
Satz 3.2 ist dann auch jedes PolynomP
f (x) = nk=0 ak xk = an xn + · · · + a1 x + a0
differenzierbar mit Ableitung f 0 (x) = nk=1 ak kxk−1 = an nxn−1 + · · · + a1 .
Ohne Beweis stellen wir weitere Ableitungen verschiedener Funktionen zusammen:
exp0 (x) = exp(x) ,
sin0 (x) = cos(x) ,
cos0 (x) = − sin(x) ,
ln0 (x) =
1
.
x
Sei nun eine Funktion f gegeben, die von zwei Variablen x und y abhänge. Für
festes y = y0 können wir f (x, y0 ) als Funktion von x auffassen, für festes x =
x0 die Funktion f (x0 , y) als Funktion von y. Beide Funktionen können wir nun
gemäß Definition 3.4 auf Differenzierbarkeit untersuchen. Dies führt uns zur nächsten
Definition.
Definition 3.5. Eine Funktion f : [a, b] × [c, d] → R heißt an einer Stelle (x0 , y0 ) ∈
(a, b) × (c, d) partiell nach x (bzw. y) differenzierbar, wenn bei festgehaltenem
y = y0 (bzw. x = x0 ) die Funktion x 7→ f (x, y0 ) (bzw. y 7→ f (x0 , y)) in x0 (bzw. y0 )
differenzierbar ist, wenn also
f (x0 + h, y0 ) − f (x0 , y0 )
h
bzw.
f (x0 , y0 + h) − f (x0 , y0 ) h
für h → 0 gegen eine reelle Zahl konvergiert. Der Grenzwert heißt partielle Ableitung nach x in (x0 , y0 ) (bzw. nach y in (x0 , y0 )) und wird mit
∂f
∂f
(x0 , y0 )
bzw.
(x0 , y0 )
∂x
∂y
bezeichnet. Die Funktion f heißt partiell nach x (bzw. nach y) differenzierbar,
wenn sie in allen Punkten (x0 , y0 ) ∈ (a, b) × (c, d) partiell nach x (bzw. y) differenzierbar ist.
Das Zeichen „∂“ ersetzt in der partiellen Ableitung das „d“ der klassischen Ableitung
und wird „del“ gesprochen.
26
3 DIE MATHEMATIK IN DER MUSIK
Beispiel 3.2. Bei den folgenden Berechnungen wird das Beispiel 3.1 herangezogen.
a) Wir betrachten die Funktion f (x, y) = 6x2 +5xy −7y 2 +3x+2y −13. Als partielle
Ableitungen berechnen wir
∂f
(x, y) = 12x + 5y + 3 und
∂x
∂f
(x, y) = 5x − 14y + 2.
∂y
b) Die Funktion f (x, y) = ln(xy 2 ) ist partiell nach x und y differenzierbar mit
partiellen Ableitungen
∂f
1
1
(x, y) = 2 · y 2 =
∂x
xy
x
und
∂f
1
2
(x, y) = 2 · 2xy = .
∂y
xy
y
Hierbei wird u.a. die Kettenregel aus Satz 3.3 verwendet.
Wir betrachten nun eine vollkommen elastische und biegsame Saite mit konstanter
linearer Massendichte ρ0 (Masse pro Längeneinheit), die an beiden Enden zwischen
den Punkte 0 und L fixiert ist. Die konstante Spannung der Saite sei mit S bezeichnet. Wir lenken nun die Saite vertikal aus ihrer Ruhelage aus und wollen die
vertikale Auslenkung u = u(t, x) in Abhängigkeit von Zeit und Ort bestimmen. Dabei nehmen wir an, dass die Auslenkung „klein“ ist, so dass horizontale Bewegungen
vernachlässigt werden können. Auch gehen wir davon aus, dass sich die Saite wieder
vollständig in ihre Ruhelage zurückbewegen kann, also keine plastischen Veränderungen auftreten. Wir betrachten nun ein kleines Stück [x, x + ∆x] der Saite. Unsere
Herleitung beruht auf dem Newtonschen Gesetz
Kraft = Masse · Beschleunigung.
Die Beschleunigung in vertikaler Richtung ist die zweite Ableitung des vertikalen
Weges (also der Auslenkung u) nach der Zeit t, d.h.
∂2
u(t, x) = utt (t, x).
∂t2
Also ist (ρ0 ∆x)utt (t, x) die Kraft, die auf das Stück der Saite mit Länge ∆x wirkt.
Um eine Differentialgleichung für die Auslenkung u(t, x) zu erhalten, werden wir
einen Zusammenhang zwischen der Kraft und der Spannung S herleiten. Seien S(x)
und S(x+∆x) die tangentialen Spannungskomponenten an den Punkten x, x+∆x ∈
[0, L]. Sei weiter α der Winkel zwischen der tangentialen Komponente S(x) in x und
der Horizontalen und β der entsprechende Winkel in x + ∆x. Daraus ergeben sich
die horizontalen Spannungskomponenten, die aufgrund der Annahme den konstanten
Wert S haben, also
Beschleunigung =
S(x + ∆x) cos β = S(x) cos α = S. (∗)
Die vertikalen Spannungskomponenten können ebenso leicht ermittelt werden, und
die Differenz der beiden stimmt mit der Kraft überein, die wir mit Hilfe des Newtonschen Gesetzes bestimmt haben:
S(x + ∆x) sin β − S(x) sin α = (ρ0 ∆x)utt (t, x). (∗∗)
∂
∂
u(t, x) = ux (t, x) bzw. tan β = ∂x
u(t, x+∆x) =
Andererseits erhalten wir tan α = ∂x
ux (t, x + ∆x). Dividieren wir Gleichung (∗∗) durch S, so folgt mit Gleichung (∗)
ρ0 ∆x
utt (t, x) = tan β − tan α = ux (t, x + ∆x) − ux (t, x).
S
Division durch
ρ0 ∆x
S
und Grenzübergang ∆x → 0 liefert den Satz
3.1 Tonerzeugung
27
Satz 3.4. Die Auslenkung einer an beiden Enden fixierten Saite der Länge L mit
konstanter linearer Massendichte ρ0 und konstanter Spannung S erfüllt die Wellengleichung
utt − c2 uxx = 0
mit Wellengeschwindigkeit c2 =
S
,
ρ0
c > 0.
Diese Gleichung geht auf Jean-Baptiste le Rond d’Alembert im Jahre 1746 zurück.
Nachdem wir die Wellengleichung hergeleitet haben, wollen wir nun Lösungen dieser
Gleichung suchen, die die aus der Fixierung der Saite resultierenden Randbedingungen u(t, 0) = u(t, L) = 0 erfüllen. Hilfreich ist dabei der Ansatz
u(t, x) = v(t) · w(x)
mit zweimal stetig differenzierbaren Funktionen v und w. Diese erfüllen die Wellengleichung genau dann, wenn
v 00 (t)w(x) − c2 v(t)w00 (x) = 0,
also
w00 (x)
v 00 (t)
= c2
bis auf Nullstellen der Nenner.
v(t)
w(x)
Die letzte Gleichung kann aber, da die linke Seite nur von t und die rechte Seite nur
von x abhängt, nur bestehen, wenn mit einer gewissen Konstante λ gilt
v 00 (t)
= −c2 λ und
v(t)
w00 (x)
= −λ.
w(x)
Mit anderen Worten genügen v und w den Gleichungen
v 00 (t) + c2 λv(t) = 0 bzw. w00 (x) + λw(x) = 0. (#)
Umgekehrt löst u(t, x) = v(t) · w(x) die Wellengleichung, wenn v und w die Gleichungen (#) erfüllen. Durch den Produktansatz u(t, x) = v(t) · w(x) können wir
also die Wellengleichung in zwei Gleichungen mit jeweils einer Variable auflösen.
Ein derartiger Ansatz wird daher auch Separationsansatz genannt. Da v(t) nicht für
alle t Null ist (sonst hätten wir den uninteressanten Fall einer ruhenden Seite), muss
w(0) = w(L) = 0 sein. Durch mathematische Überlegungen folgt, dass λ positiv sein
muss. Als Lösung der zweiten Gleichung in (#) findet man
√
√
w(x) = C1 cos( λx) + C2 sin( λx) , mit beliebigen Konstanten C1 , C2 .
Wegen
w(0) = 0√muss gelten C1 = 0. Damit auch w(L) = 0 ist, muss gelten
√
λ L = nπ bzw. λ = nπ
. Entsprechend erhalten wir für v
L
cnπ cnπ v(t) = C̃1 cos
t + C̃2 sin
t , mit beliebigen Konstanten C̃1 , C̃2 .
L
L
Zusammenfassend ergibt sich
Proposition 3.5. Die Funktionen
nπ cnπ cnπ un (t, x) = sin
x · An cos
t + Bn sin
t
, n = 1, 2, . . .
L
L
L
mit Konstanten An , Bn sind Lösungen der Wellengleichung.
28
3 DIE MATHEMATIK IN DER MUSIK
Besondere Bedeutung hat die sog. Grundschwingung, die sich für n = 1 ergibt. Die
anderen Lösungen für n = 2, 3, . . . nennt man auch Oberschwingungen.
Bemerkung 3.2. Äquivalent ist die Darstellung
nπ cnπ
un (t, x) = sin
x · Cn sin
t + ϕn
L
L
mit Phasenverschiebungen ϕn . Ausgenutzt wird hierbei das Additionstheorem
sin(α + β) = sin α cos β + cos α sin β.
x die Einhüllende der stehenden Welle an,
In beiden Fällen gibt der Term sin nπ
L
der zweite von t abhängige Term beschreibt jeweils die eigentliche Schwingung. Die
cn
Schwingungen erfolgen mit den Frequenzen fn = 2L
und besitzen die Wellenlängen
2L
c
λ n = fn = n .
Leider sind dies jedoch noch nicht alle möglichen Lösungen der Wellengleichung mit
u(t, 0) = u(t, L) = 0. Vielmehr kann man mit mathematischen Mitteln zeigen
Satz 3.6. Alle Lösungen der Wellengleichung sind von der Form
u(t, x) = f (x − ct) + g(x + ct)
mit geeigneten zweimal stetig differenzierbaren Funktionen f und g.
Der Summand f (x − ct) beschreibt dabei eine nach rechts laufende Welle, der Summand g(x+ct) dagegen eine nach links laufende Welle. Die allgemeine Lösung ergibt
sich durch Überlagerung dieser beiden Wellen.
Ein weiteres Additionstheorem macht man sich beim Stimmen z.B. einer Geigensaite zunutze. Beim Stimmen wird die Spannung der Saite verändert, was sich auf
die Wellengeschwindigkeit c und somit auch auf die Frequenzen fn auswirkt. Wir
vergleichen nun die von zwei gleichartigen aber geringfügig verstimmten Saiten gleicher Länge erzeugten Töne. Der Einfachheit halber gehen wir davon aus, dass beide
Saiten Schallwellen der Form A sin(2πνt) mit leicht verschiedenen Frequenzen ν1
bzw. ν2 erzeugen. Die Frequenz ν1 sei ohne Einschränkung die größere der beiden
Frequenzen. Werden beide Saiten mit gleicher Lautstärke gleichzeitig gespielt, so
überlagern sich die entstehenden Schallwellen gemäß
A sin(2πf1 t) + A sin(2πf2 t) = 2A sin(π(f1 + f2 )t) · cos(π(f1 − f2 )t).
2
, dessen Lautstärke (Amplitude) mit
Es entsteht also ein Ton der Frequenz f1 +f
2
f1 −f2
Frequenz 2 an- und abschwillt. Ein solches Phänomen bezeichnet der Physiker
2
als Schwebung, die Frequenz f1 −f
wird daher auch Schwebungsfrequenz genannt.
2
Der Musiker stimmt die Saite nun so lange, bis kein An- und Abschwellen mehr
wahrnehmbar ist, bis also annähernd ν1 = ν2 gilt.
3.2
Tonabstände und Stimmungen
c
Im letzten Abschnitt haben wir bereits die Grundschwingung mit Frequenz f1 = 2L
und Wellenlänge 2L einer Geigensaite der Länge L kennengelernt. Halbiert man die
Saitenlänge, z.B. durch Einfügen eines Steges, so entsteht ein Ton mit Grundfrequenz
3.2 Tonabstände und Stimmungen
29
c
L
und Wellenlänge 21 L. Die größere Frequenz steht also zur kleineren im Verhältnis 2:1, die Wellenlängen entsprechend im umgekehrten Verhältnis. Den Abstand –
musikalisch auch Intervall genannt – der beiden Töne bezeichnet man als Oktave.
Im Zusammenklang werden beide Töne vom Menschen als angenehm empfunden.
Durch Verschieben des Stegs kann man untersuchen, für welche Teilungsverhältnisse
weitere wohlklingende Tonpaare entstehen. Derartige Experimente wurden bereits
von Pythagoras von Samos (ca. 580 v. Chr.-ca. 500 v. Chr.) und seinen Anhängern
an einem aus einer Saite bestehenden Instrument namens Monochord durchgeführt.
Eine Oktave ergibt sich dort, indem man die Saite im Verhältnis 1:2 teilt und beide
Seiten zupft. Ebenfalls gut klingende Intervalle erklingen, wenn man die Saite in den
Verhältnissen 2:3 und 3:4 teilt. Die zugehörigen Intervalle heißen Quinte (Seitenverhältnis 2:3) und Quarte (Seitenverhältnis 3:4). Zusammen mit dem Grundton und
der Oktave bildeten diese Intervalle den sog. Tetrachord. Platon erklärt das arith= 3 : 2 als Quinte und das harmonische
metische Mittel aus dem Oktavsprung 1+2
2
Mittel 2·2·1
=
4
:
4
als
Quarte.
Quinte
und
Quarte zusammen ergeben wieder eine
1+2
Oktave, denn
(3 : 2) · (4 : 3) = 2 : 1.
Durch weiteres Probieren erhält man
Intervall
Seitenverhältnis
Oktave
1:2
Frequenzverhältnis
2:1
Quinte Quarte große Terz kleine Terz Sekunde
2:3
3:4
4:5
5:6
8:9
3:2
4:3
5:4
6:5
9:8
Die Sekunde fällt dabei ein wenig aus dem Rahmen, aber wir können das Verhältnis
leicht nachrechnen. Die Sekunde ist der Unterschied zwischen einer Quarte und einer
Quinte. Ausgehend von der Quarte müssen wir also ein noch unbekanntes Verhältnis
x bilden, um eine Quinte zu erhalten, d.h.
2
2 4
8
3
·x=
⇒ x= · = .
4
3
3 3
9
Die Pythagoräer machten bei ihren Experimenten zudem folgende Beobachtung: Je
komplizierter das Zahlenverhältnis, desto dissonanter wurden die Zweiklänge empfunden.
Es war der Pythagoräer Philolaos, der sich genauer mit den Intervallen befasste und
eine erstaunliche Entdeckung machte. Er berechnete zuerst das Verhältnis für eine
kleine Sekunde, also einen Halbton, als Unterschied h zwischen zwei aufeinanderfolgenden großen Sekunden und der Quarte:
3
3 9 9
243
8 8
· ·h=
⇒ h= · · =
.
9 9
4
4 8 8
256
Auf dem Klavier sind nun zwei kleine Sekunden stets eine große Sekunde, zwei
Halbtöne ergeben dort also einen Ganzton. Stimmt das auch mathematisch? Zwei
Halbtöne hintereinander ergeben das Verhältnis 243
· 243 ≈ 0, 901016235, ein Ganzton
256 256
hat aber das Verhältnis 89 = 0, 8̄. Rechnerisch sind also zwei Halbtöne etwas höher
als ein Ganzton. Zu Ehren von Philolaos wird dieser Unterschied auch Pythagoräisches Komma genannt. Es ist das kleine Intervall x zwischen zwei Halbtönen
und dem Ganzton, also
243 243
8
8 256 256
524288
·
·x=
⇒ x= ·
·
=
.
256 256
9
9 243 243
531441
30
3 DIE MATHEMATIK IN DER MUSIK
Euklid hat diese Formel noch ein wenig umgestellt:
1 7
2 12
524288
219
x=
= 12 ⇒
·x=
.
531441
3
2
3
Das gleiche Pythagoräische Komma begegnet uns also auch, wenn wir 7 Oktaven
mit 12 Quinten vergleichen. Verallgemeinern wir nun das Verfahren, indem wir m
Quinten nach oben und n Oktaven nach unten gehen und danach fragen, für welche m und n wir ungefähr zum Ausgangston zurückkommen. Formal suchen wir
Näherungslösungen der Gleichung
2 m
2n = 1.
3
Dies ist äquivalent zu 2m+n = 3m . Es ist klar, dass dies nie exakt gelten kann. Durch
Logarithmieren erhalten wir
(m + n) · log 2 = m · log 3
⇔
log 3
m+n
=
≈ 1, 585.
m
log 2
Durch eine Kettenbruchentwicklung, die ich hier aber nicht ausführen möchte, ergeben sich für den Bruch die folgenden Näherungswerte:
1 für n = 0 und m = 1
2 für n = 1 und m = 1
3
für n = 1 und m = 2
2
8
für n = 3 und m = 5
5
19
für n = 7 und m = 12
12
65
für n = 24 und m = 41.
41
Die fünfte Zeile ist uns oben schon begegnet und entspricht den 12 Tönen einer
Oktave. In der vierten Zeile bestünde mit m = 5 Tönen in einer Oktave zu wenig
Auswahl, m = 41 Töne in einer Oktave wären dagegen ziemlich unhandlich.
Ein ähnliches Phänomen wie das des Pythagoräischen Kommas tritt auf, wenn man
die große Terz (Verhältnis 4:5) mit zwei Ganztonschritten (jeweils Verhältnis 8:9)
vergleicht. Auch hier stimmen die entstehenden Intervalle nicht genau miteinander
überein. Als Abweichung x berechnet man
8 8
4
4 9 2 81
· ·x=
⇒ x= ·
= .
9 9
5
5
8
80
Diesen Fehler nennt man das syntonische Komma. Das syntonische Komma tritt
ebenfalls auf, wenn man vier Quinten aufwärts und zwei Oktaven abwärts geht und
das sich ergebende Intervall mit einer großen Terz vergleicht. Als Unterschied x
zwischen diesen beiden Intervallen erhält man nämlich
2 4
4
4 3 4 1 2 81
· 22 · x =
⇒ x= ·
·
= .
3
5
5
2
2
80
Diese Diskrepanzen auszugleichen, führte über die Jahrhunderte zu verschiedenen
Stimmungen.
3.2 Tonabstände und Stimmungen
31
Pythagoräische Stimmung
Beginnend bei einem Referenzton – hier hat man sich im Laufe der Zeit auf das a mit
Frequenz 440 Hz (Schwingungen pro Sekunde) geeinigt – stimmen wir zunächst alle
Oktaven rein, d.h. gemäß dem Verhältnis 2:1. Dann stimmt man ausgehend von a
alle Quinten im Verhältnis 3:2. Kommen wir aus dem gegebenen Tonumfang hinaus,
müssen wir einen Oktave nach unten springen. Nach 12 sauberen Quinten gelangen
wir ungefähr wieder zu einem a, hier macht sich allerdings das Pythagoräische Komma bemerkbar, so dass wir das a nicht genau treffen. Diese Diskrepanz nimmt man
aber in Kauf. Aufgrund der Dissonanz wird die letzte der 12 Quinten auch Wolfsquinte genannt. Pythagoras zu Ehren nennt man diese Stimmung Pythagoräische
Stimmung.
Die Stimmung war im Mittelalter gebräuchlich. Man konnte mit ihr zwar einige Tonarten gut spielen, wenn man die schwarzen Tasten möglichst vermieden hat. Das war
bei der einfachen Melodik des Mittelalters kein großes Problem. Wenn man aber in
eine andere Tonart übergehen wollte, gab es Misstöne.
Mitteltönige Stimmung
Ab 1450 wurden Terzen in der Musik wichtiger als Quinten, so dass man bestrebt
war das syntonische Komma zu beseitigen. Basierend auf den obigen Rechnungen
bestand die Grundidee darin, jede Quinte um 14 syntonisches Komma zu vermindern,
so dass tatsächlich nach vier Quinten aufwärts und zwei Oktaven abwärts eine reine
Terz entsteht. Wie bei der Pythagoräischen Stimmung stimmen jedoch 12 Quinten
nicht mit 7 Oktaven überein. Auch nach Aufrechnen mit dem pythagoräischen Komma bleibt immer noch eine Wolfsquinte, die 18 Ton zu weit ist.
Diese Stimmung klingt nahe der Ausgangstonart gut, ist aber weit weg davon praktisch nicht mehr spielbar. In der Musikpraxis führte das zur Konstruktion von Orgeln, Cembalos und Klavieren mit zwei verschiedenen Tasten für Zwischentöne wie
Des oder Cis. Als Nebeneffekt der Stimmung wiesen verschiedene Tonarten nun
verschiedene Charakteristika auf.
Irreguläre, wohltemperierte Stimmungen
Bekannteste Stimmung dieser Kategorie ist die nach dem Organisten Andreas Werckmeister (1645-1706) benannte Stimmung Werckmeister III. Bei ihr wird das
pythagoräische Komma gleichmäßig auf die vier Quinten C-G, G-D, D-A und H-Fis
aufgeteilt. Alle anderen Quinten sind rein (d.h. im Frequenzverhältnis 3:2). Aufgrund
der unterschiedlich großen Quinten weisen in ihr verschiedene Tonarten ebenfalls verschiedene Toncharakteristika auf. Sie stellt durch die Aufteilung des pythagoräischen
Kommas einen ersten Schritt in Richtung gleichschwebender Stimmung dar. Welche Stimmung J. S. Bach verwendete, ist zwar nicht bekannt, Werckmeister III ist
aber eine Kandidatin. Weitere bekannte irreguläre Stimmungen stammen z.B. von
Kirnberger.
Gleichschwebende Stimmung
Als weitere Möglichkeit eines Ausgleichs wurde im 18. Jahrhundert die gleichschwebende Stimmung entwickelt. Um das pythagoräische Komma, das nach 12 Quintschritten im Vergleich zur Oktave auftritt, zu beseitigen, wird es einfach gleichmäßig
32
3 DIE MATHEMATIK IN DER MUSIK
auf alle 12 Quinten
aufgeteilt, die Oktave also in 12 gleiche Halbtonschritte mit Ver√
hältnis 1 : 12 2 unterteilt. In dieser Stimmung ist also abgesehen von der Oktave
kein Intervall wirklich rein. Die Abweichungen sind aber so gering, dass sie für das
menschliche Ohr immer noch akzeptabel sind. Alle Tonarten sind nun gleichberechtigt spielbar, die bisher existierende Charakteristik der einzelnen Tonarten sind dadurch allerdings nicht mehr vorhanden. Das war auch der Hauptgrund, warum sich
diese Stimmung erst im 19. Jahrhundert mit der romantischen Musik durchsetzte.
3.3
Fourier-Analyse
In Proposition 3.5 hatten wir gesehen, dass wir für die Wellengleichung durch den
Separationsansatz u(t, x) = v(t) · w(x) die Lösungen
cnπ cnπ nπ x · An cos
t + Bn sin
t
, n = 1, 2, . . .
un (t, x) = sin
L
L
L
mit Konstanten An , Bn erhalten. Aufgrund der Rechenregeln für Ableitungen lösen
auch Summen dieser Funktionen die Wellengleichung. Derartige Überlagerungen von
Schwingungen verschiedener Frequenzen sind auch die Ursache für die Entstehung
der verschiedenen Klangfarben von Instrumenten. Umgekehrt lassen sich aber auch
allgemeinere periodische Funktionen mit Hilfe der Fouriertransformation in (möglicherweise unendlich viele) Sinus- und Kosinusanteile zerlegen.
Um alle HörerInnen auf einen Stand zu bringen, gebe ich zunächst einen Überblick
über wichtige Aspekte der Integration. Für eine auf einem Intervall [a, b] definierRb
te Funktion f bezeichnet das Integral a f (x) dx die Fläche unter dem Graphen
von f zwischen a und b. Diese Fläche kann approximiert werden, indem man das
Intervall [a, b] in kleine Teile zerlegt, Recktecke über diese Teile bildet, die gerade
über oder unter dem Graphen liegen, und deren Fläche berechnet. Durch Verfeinern
der Zerlegung näheren sich – zumindest bei integrierbaren Funktionen – die Werte
dieser Ober- und Untersummen
R b einander an, im Falle der Existenz bezeichnet man
den Grenzwert als Integral a f (x) dx. Formal ist eine Zerlegung ein (r + 1)-Tupel
Z = (x0 , x1 , . . . , xr ) mit
a = x0 < x1 < · · · < xr−1 < xr = b.
Weiter bezeichne mk den kleinsten Wert der Funktion f auf [xk−1 , xk ] und Mk den
größten Wert der Funktion f auf [xk−1 , xk ].
Definition 3.6. Sei Z eine Zerlegung des Intervalls [a, b] und f eine auf [a, b] definierte Funktion. Dann heißt
r
X
mk (f (xk ) − f (xk−1 )
SZ =
k=1
die Untersumme von f bzgl. der Zerlegung Z und
SZ =
r
X
Mk (f (xk ) − f (xk−1 )
k=1
die Obersumme von f bzgl. der Zerlegung Z.
Eine beschränkte Funktion f : [a, b] → R heißt (Riemann-)integrierbar, wenn
Unter- und Obersumme bei Verfeinerung der Zerlegung gegen Reinen gemeinsamen
b
Grenzwert konvergieren. Diesen Grenzwert bezeichnet man als a f (x) dx.
3.3 Fourier-Analyse
33
Dabei nennen wir eine Zerlegung Z 0 eine Verfeinerung einer Zerlegung Z, wenn die
Zerlegungspunkte xk von Z auch in Z 0 vorkommen.
Bemerkung 3.3. Man kann zeigen, dass stetige Funktionen integrierbar sind.
Rb
Rc
Bemerkung 3.4. Jedes Integral a f (x) dx lässt sich in Teilintegrale a f (x) dx +
Rb
f (x) dx mit beliebigem c ∈ [a, b] zerlegen.
c
Für Berechnungen ist das Approximieren durch Unter- und Obersumme zu aufwendig. Stattdessen nutzt man den Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung,
der einen Zusammenhang zwischen Differenzieren und Integrieren herstellt. Darin
kommt der Begriff der Stammfunktion vor, der zunächst erläutert werden muss.
Definition 3.7. Es sei f : [a, b] → R eine Funktion. Eine Funktion F : [a, b] → R
heißt Stammfunktion von f , wenn F differenzierbar ist und F 0 = f .
Satz 3.7 (Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung). Ist f : [a, b] → R eine
stetige Funktion, so gilt:
(1) Die Funktion
Z
x
F : [a, b] → R, x 7→
f (t) dt
a
ist eine Stammfunktion von f .
(2) Wenn G eine Stammfunktion von f ist, so gilt
b
Z
a
b
f (t) dt = Ga = G(b) − G(a).
Auf einen Beweis verzichten wir hier, obwohl er nicht sehr kompliziert ist. Im Wesentlichen sagt der Hauptsatz aus, dass die Integration in gewisser Weise die Umkehrung der Differentiation ist. Im Folgenden stelle ich ohne Beweis noch zwei wichtige
Integrationsregeln zusammen.
Proposition 3.8 (partielle Integration). Sind f : [a, b] → R und g : [a, b] → R
stetig und sind F, G Stammfunktionen zu f, g, so gilt:
Z
a
b
b
f (x)G(x) dx = F · Ga −
Z
b
F (x)g(x) dx.
a
Proposition 3.9 (Substitutionsregel). Sei f : [a, b] → R stetig und g : [a0 , b0 ] → R
stetig differenzierbar mit g(x) ∈ [a, b] für alle x ∈ [a0 , b0 ]. Dann gilt:
Z
g(b0 )
Z
b0
f (y) dy =
g(a0 )
f (g(x))g 0 (x) dx.
a0
Nun verfügen wir über das für eine Fourier-Analyse nötige Handwerkszeug. Formal
definieren wir
Definition 3.8. Eine Funktion f : R → R heißt T -periodisch, wenn gilt
f (t + T ) = f (t) für alle t ∈ R.
34
3 DIE MATHEMATIK IN DER MUSIK
Definition 3.9. Sei f : R → R eine T -periodische, über [0, T ] integrierbare Funktion. Dann heißen die Zahlen
Z
2 T
ak =
f (x) cos(kωx) dx für k ≥ 0
T 0
Z
2 T
f (x) sin(kωx) dx für k ≥ 1
bk =
T 0
mit ω =
2π
T
die Fourier-Koeffizienten von f und die Reihe
∞
a0 X
+
ak cos(kωt) + bk sin(kωt)
2
k=1
Fourierreihe von f .
Bemerkung 3.5. Bei der Berechnung der Fourier-Koeffizienten kann das Intervall
[0, T ] durch ein anderes Intervall der Länge T ersetzt werden, ohne dass sich der Wert
der Integrale ändert. Für 2π-periodische Funktionen ist somit neben der Integration
über [0, 2π] auch eine Integration über [−π, π] möglich. Allerdings ist immer darauf
zu achten, dass die Funktionsvorschrift richtig eingesetzt wird.
Wir schauen uns das Ganze zunächst anhand eines Beispiels an.
Beispiel 3.3. Wir betrachten die Funktion f , die auf dem Intervall [−π, π] durch
f (t) = t2 gegeben und außerhalb des Intervalls 2π-periodisch fortgesetzt (durch
„Aneinanderkleben“ des Parabelteils) sei. Mit Hilfe der Formeln aus Definition 3.9
berechnen wir die Fourier-Koeffizienten. Aufgrund von Bemerkung 3.5 gilt
Z
1 x3 π
2
1 π 2
x dx =
a0 =
= π2
π −π
π 3 −π 3
und für k = 1, 2, . . .
2
Z
Z π
π
1 π 2
2
part. Int. 1 x
ak =
x cos(kx) dx =
sin(kx)−π −
x sin(kx) dx
π −π
π k
k −π
Z π
Z π
π
2
2 −x
1
part. Int.
= −
x sin(kx) dx = −
cos(kx)−π +
cos(kx) dx
kπ −π
kπ k
k −π
π
2 2π
2
4
=
(−1)k − 3 sin(kx)−π = 2 (−1)k .
kπ k
k π
k
Auf die gleiche Weise kann man auch bk berechnen und erhält bk = 0 für alle k.
Schneller ginge es, wenn man sich bewusst macht, dass in bk eine ungerade Funktion, d.h. eine Funktion mit f (−x) = −f (x), über ein um 0 symmetrisches Intervall
integriert wird. Dies ergibt jedoch 0. Insgesamt ist die Fourierreihe von f also gegeben durch
∞
π2 X 4
+
(−1)k cos(kx).
2
3
k
k=1
Wie soeben gesehen, lässt sich der Rechenaufwand verringern, falls die betrachtete
Funktion gewisse Symmetrieeigenschaften besitzt.
Proposition 3.10. Sei f eine T -periodische über [0, T ] integrierbare Funktion.
3.3 Fourier-Analyse
35
(1) Falls f (−x) = f (x), so ist bk = 0 für alle k ∈ N. Eine Funktion f mit
f (−x) = f (x) heißt gerade Funktion.
(2) Falls f (−x) = −f (x), so ist ak = 0 für alle k ∈ N ∪ {0}. Eine Funktion f mit
f (−x) = −f (x) heißt ungerade Funktion.
Beweis. Man überlegt sich leicht, dass cos eine gerade und sin eine ungerade Funktion ist. Beim Multiplizieren zweier gerader bzw. ungerader Funktionen g und h
können vier Fälle auftreten:
Sind g und h gerade Funktionen, so ist auch das Produkt g · h eine gerade Funktion.
Ist eine der beiden Funktionen g und h gerade und die andere ungerade, so ist das
Produkt g · h eine ungerade Funktion.
Sind g und h ungerade Funktionen, so ist das Produkt g · h wegen g(−x) · h(−x) =
(−g(x)) · (−h(x)) = g(x) · h(x) eine gerade Funktion.
Für eine ungerade Funktion g gilt
T
Z
T
2
Z
g(x) dx
=
g(x) dx +
0
g(x) dx
T -periodisch
T
2
Z
=
Z
g(x) dx +
0
Z
T
2
=
T
2
0
Subst.
T
Z
Z
g(x) dx +
0
T
2
g(−t) dt
g ungerade
=
0
g(x) dx
− T2
0.
0
zu (1): Ist f eine gerade Funktion, so ist f · sin ungerade. Folglich gilt
2
bk =
T
Z
T
f (x) sin(kωx) dx = 0 für alle k ∈ N.
0
zu (2): Ist f eine ungerade Funktion, so ist f · cos ebenfalls ungerade. Folglich gilt
2
ak =
T
Z
T
f (x) cos(nωx) dx = 0 für alle k ∈ N ∪ {0}.
0
Unter welchen Voraussetzungen die Funktion f tatsächlich durch ihre Fourierreihe
dargestellt wird, sagt uns der nächste Satz. Der Beweis dieses Satzes würde jedoch
den Rahmen der Vorlesung sprengen, so dass wir darauf verzichten wollen.
Satz 3.11. Sei f : R → R eine T -periodische, stetige und stückweise stetig differenzierbare Funktion. Dann konvergiert die Fourierreihe
∞
a0 X
+
(ak cos(kωx) + bk sin(kωx))
2
k=1
von f (vgl. Definition 3.9) gleichmäßig gegen f .
Bemerkung 3.6. Einige Begriffe des Satzes bedürfen der Erklärung:
1. Eine Funktion f heißt stückweise stetig (differenzierbar), wenn sie abgesehen von endlich vielen Ausnahmestellen x1 < x2 < · · · < xm stetig (differenzierbar) ist und in den Ausnahmestellen die rechts- und linksseitigen Grenzwerte existieren.
36
3 DIE MATHEMATIK IN DER MUSIK
P
2. Man sagt, dass eine Reihe ∞
k=1 ck konvergiert, wenn die Folge ihrer PartialPN
summen k=1 ck konvergiert.
3. Eine Folge (fn ) von Funktionen konvergiert gleichmäßig gegen eine Funktion f , wenn
∀ε > 0∃n0 ∈ N∀n ≥ n0 ∀x ∈ R : |fn (x) − f (x)| < ε,
wenn also das n0 , ab dem die Differenz zwischen fn (x) und f (x) betraglich
kleiner als das vorgegebene ε ist, unabhängig vom speziellen Wert x gewählt
werden kann.
Als Anwendung der Fourier-Analyse überlegen wir uns, wie man eine bestimmte
Klangfarbe synthetisieren kann. Durch ein Oszilloskop lässt sich ein Klang sichtbar machen. Sinus- und Kosinusschwingungen können durch ein technisches Bauteil
namens Oszillator synthetisiert werden, allgemeine Klänge sind hingegen technisch
nicht direkt synthetisierbar. Um einen Klang dennoch synthetisieren zu können,
zerlegt man daher die gesehene (periodische) Schwingung mittels Fourier-Analyse
in ihre Sinus- und Kosinusanteile. Durch Überlagerung der ersten durch die Fourierreihe bestimmten Sinus- und Kosinusschwingungen ergibt sich schon eine relativ gute Näherung an den zu synthetisierenden Klang. Durch Hinzunahme weiterer
Schwingungen wird die Näherung immer feiner. Entsteht ein Klang wie hier beschrieben durch Überlagerung von harmonischen Schwingungen (d.h. Sinus- und
Kosinusschwingungen), so spricht man auch von additiver Klangsynthese.
3.4
Mathematik als Kompositionshilfe
Auf die Verwendung des goldenen Schnitts bei der Komposition sind wir bereits im
Abschnitt 2.4 kurz eingegangen. Aber auch in der Motivbearbeitung selbst gibt es
Parallelen zur Mathematik. Ein Motiv ist eine kurze Tonfolge, die von den Komponisten häufig nach bestimmten Regeln abgewandelt wird. Diese Transformationen
können in einem Tonhöhe-Zeit-Diagramm auch geometrisch gedeutet werden. Häufig
verwendete musikalische Methoden sind die Transposition (Ändern der Tonart),
der Krebs (Rückwärtsspielen), die Umkehrung (Spiegelung der Noten an einer Notenlinie oder einem Zwischenraum) und die Krebsumkehr (Spiegelung rückwärts
gespielt). Geometrisch entspricht die Transposition einer Verschiebung des Motivs
in Richtung der Tonhöhen-Achse, der Krebs einer Spiegelung an einer senkrechten
Achse, die Umkehr einer Spiegelung an einer waagerechten Achse und die Krebsumkehr einer Doppelspiegelung, die auch als Punktspiegelung aufgefasst werden kann.
Daneben kann ein Stück auch durch Wiederholen eines Motivs verlängert werden.
Dies lässt sich als Verschiebung in Zeit-Richtung deuten. Ferner stehen dem Komponisten die Techniken der Verkleinerung oder Vergrößerung zur Verfügung.
Hierbei werden die Notenwerte eines Motivs um einen gewissen Faktor geändert.
Geometrisch entspricht dies einer Stauchung bzw. Dehnung in Zeit-Richtung.
Die zuvor beschriebenen Techniken wurden besonders professionell von J. S. Bach
angewendet. Darüber hinaus hat Bach anscheinend die Zahl 14, die sich durch Addition der zu den Buchstaben B, A, C und H gehörenden Zahlen 2, 1, 3 und 8 ergibt,
besonders geschätzt. Zumindest wird es wohl eher kein Zufall sein, dass sein Werk
„Die Kunst der Fuge“ aus 14 Sätzen besteht, er 14 Rätsel-Kanons komponiert hat
und auf seinem Trinkpokal 14 Punkte eingraviert sind.
3.4 Mathematik als Kompositionshilfe
37
Durch Anwenden der hier eingeführten Techniken entstehen in den entsprechenden
Werken teilweise auch Symmetrien, die manchmal nur schwer oder gar nicht zu hören und im Notenbild nicht immer zu entdecken sind. Mit einer graphischen Analyse
lassen sich die Symmetrien jedoch aufdecken.
Eine weitere interessante Parallele zur Mathematik ergibt sich, wenn wir die Operationen Transposition, Krebs und Umkehrung noch einmal genauer betrachten. Eine
Transposition um n Halbtöne bezeichnen wir mit Tn . Die Operation T5 verschiebt
also z.B. ein Motiv um eine Quarte nach oben. Wir können auch negative Zahlen
zulassen und Tn dann als Verschiebung des Motivs nach unten interpretieren. Für
n = 0 würde das Motiv um 0 Halbtöne verschoben, das Motiv bleibt also unverändert. Bei Verschiebung um eine Oktave ändert sich zwar die Tonhöhe, die Töne
selbst bleiben aber unverändert (das C wird beispielsweise zum c, das c zum c’
usw.). Daher unterteilen wir die Transpositionen in verschiedene Klassen, indem wir
Verschiebungen um Oktaven zusammenfassen und dafür jeweils einen Vertreter benennen. Beispielsweise bilden T1 , T13 , T25 , . . . aber auch T−11 , T−23 , . . . eine Klasse,
für die wir T1 als Vertreter der Klasse wählen. Uns interessieren also im Wesentlichen die Reste bei Division durch 12. Für Transpositionen gilt (im Sinne dieser
Klasseneinteilung)
Tm Tn = Tm+n
∀m, n ∈ {0, 1, . . . , 11}. (T )
Zwei hintereinander ausgeführte Transpositionen liefern also das gleiche Ergebnis
wie eine einzige Transposition, die das Motiv um die Summe der Anzahlen der
Halbtöne verschiebt.
Die Operation Krebs bezeichnen wir mit K. Offensichtlich gilt KK = T0 , d.h. durch
Rückwärtsspielen eines Krebsmotivs ergibt sich wieder das ursprüngliche Motiv. Es
leuchtet außerdem ein, dass für alle n gilt
KTn = Tn K. (KT )
Der Mathematiker sagt, die beiden Operationen kommutieren. Durch Ausnutzen
dieser Eigenschaft können wir beliebige T-K-Kombinationen immer in der Form
Tn K schreiben.
Beispiel 3.4. Die Operation KT5 KT2 KT8 lässt sich aufgrund der Regeln auch schreiben als
KT5 KT2 KT8
Kommutativität
=
T5 T2 T8 KKK = T5 T2 T8 T0 K = T3 K.
Im letzten Schritt wird u.a. benutzt, dass T15 in der gleichen Klasse wie T3 liegt.
Aufgrund dieser Eigenschaft gibt es nur 24 verschiedene T-K-Kombinationen.
Streng genommen gibt es viele mögliche Umkehrungen, abhängig von der Notenlinie oder dem Notenzwischenraum, an dem man das Motiv spiegelt. Eine beliebige
Umkehrung ist aber immer auch darstellbar durch eine Spiegelung am hohen C –
die wir im Folgenden U nennen wollen – gefolgt von einer geeigneten Transposition.
Im Einzelnen werden durch U folgende Änderungen vorgenommen:
C ↔ C , C ] ↔ H , D ↔ B , D] ↔ A , E ↔ A[ , F ↔ G , F ] ↔ G[ (= F ] )
38
3 DIE MATHEMATIK IN DER MUSIK
Die Spiegelung an einer festen waagerechten Achse ist zu sich selbst invers, d.h. es
gilt U U = T0 . Die Krebsumkehr entsteht nun durch Hintereinanderausführung der
Umkehrung und des Krebses. Hierbei ist die Reihenfolge irrelevant, d.h. es gilt
U K = KU. (KU )
Anders verhält es sich bei einer Hintereinanderausführung von Umkehrung und
Transposition. Hier gilt i.a. U Tn 6= Tn U . Stattdessen kann man sich überlegen, dass
U Tn = T12−n U. (U T )
Daraus folgt, dass U nur mit T6 und T0 kommutiert. Aufgrund dieser Regeln lässt
sich jede beliebige Kombination von Transpositionen Tn mit n ∈ {0, 1, . . . , 11}, K
und U in einer der Formen Tn , Tn U , Tn K oder Tn U K schreiben. Insgesamt ergeben
sich dadurch 48 verschiedene Operationen, die wir zu einer Menge zusammenfassen
können.
Definition 3.10. Sei G eine nichtleere Menge und ∗ : G×G → G, (a, b) 7→ a∗b eine
Verknüpfung. Das Paar (G, ∗) oder kurz G heißt Gruppe, wenn folgende Axiome
erfüllt sind:
(G1) Für alle a, b, c ∈ G gilt
a ∗ (b ∗ c) = (a ∗ b) ∗ c (Assoziativgesetz).
(G2) Es gibt ein e ∈ G mit
e ∗ a = a ∗ e = a für alle a ∈ G.
Das Element e heißt neutrales Element.
(G3) Zu jedem a ∈ G gibt es ein inverses Element a−1 ∈ G mit
a ∗ a−1 = a−1 ∗ a = e.
Für die soeben diskutierten Operationen ergibt sich basierend auf Definition 3.10
folgende Aussage:
Satz 3.12. Alle Operationen der Form Tn , Tn U , Tn K und Tn U K mit n ∈ {0, 1, . . . , 11}
zusammen mit der Hintereinanderausführung als Verknüpfung bilden eine Gruppe.
Beweis. Die Assoziativität ist klar. Als neutrales Element dient T0 . Zudem gilt für
alle n ∈ {0, 1, . . . , 11}:
(T )
Tn T12−n = T12 = T0
(U T )
also ist T12−n zu Tn invers;
(T )
Tn U Tn U = Tn T12−n U U = T0
(KT )
also ist Tn U zu sich selbst invers;
(T )
Tn KT12−n K = Tn T12−n KK = T0
(KT )
(U T )
also ist T12−n K invers zu Tn K;
(T )
Tn U KTn U K = Tn U Tn KU K = Tn T12−n U U KK = T0 ,
also ist Tn U K zu sich selbst invers.
3.4 Mathematik als Kompositionshilfe
39
Für Teilmengen von Gruppen definiert man
Definition 3.11. Es sei (G, ∗) eine Gruppe und U eine Teilmenge von G. Man
nennt U eine Untergruppe von G, wenn U mit der gegebenen Verknüpfung selbst
wieder eine Gruppe ist, d.h. wenn gilt:
(a) Für alle a, b ∈ U ist a ∗ b ∈ U , d.h. die Menge U ist abgeschlossen bzgl. der
Verknüpfung ∗.
(b) (U, ∗) ist eine Gruppe.
Zum Nachprüfen eignet sich auch das folgende Kriterium.
Lemma 3.13. Sei (G, ∗) eine Gruppe. Eine nichtleere Teilmenge U von G ist genau
dann eine Untergruppe von G, wenn für alle a, b ∈ U gilt a ∗ b−1 ∈ U .
Beweis. „⇒“: Sei U eine Untergruppe von G und bezeichne u0 das neutrale Element
in U . Dann folgt
−1
−1
u0 = e ∗ u0 = (u−1
0 ∗ u0 ) ∗ u0 = u0 ∗ (u0 ∗ u0 ) = u0 ∗ u0 = e.
Das Inverse von a ∈ U ist also in beiden Gruppen dasselbe. Mit b ∈ U liegt nach
Voraussetzung auch b−1 in U und mit einem weiteren Element a ∈ U auch a ∗ b−1 .
„⇐“: Sei umgekehrt U eine nichtleere Teilmenge, für die die angegebene Bedingung
gelte. Aus b ∈ U folgt e = b ∗ b−1 ∈ U und somit b−1 = e ∗ b−1 ∈ U . Für ein weiteres
Element a ∈ U gilt also a ∗ b = a ∗ (b−1 )−1 ∈ U . Bedingung (a) der Definition 3.11
ist also erfüllt. Für a, b ∈ U ist also durch (a, b) 7→ a ∗ b eine Verknüpfung auf U
gegeben, die als Einschränkung der Verknüpfung auf G ebenfalls assoziativ ist. Nach
Definition 3.11 ist U also eine Untergruppe von G.
Durch Nachrechnen folgt nun
Proposition 3.14. Die Mengen {T0 , T1 U, K, T1 U K} und {T0 , T3 U K, T9 U, T6 K} zusammen mit der Hintereinanderausführung sind Untergruppen der Gruppe aller Operationen. Ebenso ist {T0 , T3 U K, T9 U, T6 K, T6 , K, T9 U K, T3 U } eine Untergruppe.
Auch der Zufall, der in der Stochastik genauer untersucht wird, findet gelegentlich Anwendung bei der Komposition. Zur Zeit Mozarts waren Würfelmusiken zur
Unterhaltung von Gesellschaften sehr beliebt. Es handelt sich dabei um Systeme
vorkomponierter Takte, aus denen durch Würfeln mit Hilfe von Tabellen Kompositionen zusammengestellt wurden. Überliefert sind z.B. die Werke
• W. A. Mozart: „Anleitung zum Componieren von Walzern vermittels zweier
Würfel ...“, erstmals 1793 (nach Mozarts Tod) erschienen
• J. Ph. Kirnberger: „Der allzeit fertige Polonaisen- und Menuettenkomponist“
(1767)
Wer Lust bekommen hat, es einmal selbst zu versuchen, kann sich z.B. im Haus der
Musik in Wien durch Würfeln seinen eigenen kleinen Walzer komponieren.
In der neueren Musik wird der Zufall hingegen noch in anderer Weise eingesetzt.
So besteht die Partitur des Werks „Klavierstück XI“ von K. H. Stockhausen aus 18
Taktgruppen, die alle miteinander verknüpfbar sind. Bei der Aufführung geht der
Musiker folgendermaßen vor:
40
3 DIE MATHEMATIK IN DER MUSIK
• Er schaut absichtslos auf den Papierbogen und beginnt mit irgendeiner zuerst
gesehenen Taktgruppe. Diese spielt er mit beliebiger Geschwindigkeit (die klein
gedruckten Noten ausgenommen), Grundlautstärke und Anschlagsform.
• Ist die erste Gruppe zu Ende, so liest er die folgenden Spielbezeichnungen für
Geschwindigkeit, Grundlautstärke und Anschlagsform ab, schaut absichtslos
weiter zu irgendeiner anderen Taktgruppe und spielt diese den drei Bezeichnungen gemäß.
„Absichtslos“ ist hier im Sinne von zufällig zu verstehen.
Um weitere komplexere Anwendungsmöglichkeiten des Zufalls in der Musik zu diskutieren, beschränken wir uns ab jetzt auf den Parameter „Tonhöhe“. Eine Möglichkeit
der Komposition besteht nun darin, aus einem gegebenen Vorrat an verschiedenen
Tonhöhen sukzessive zufällig Tonhöhen auszuwählen und diese zu einem Musikstück
zusammenzusetzen. Die gegebenen Tonhöhen können dabei beliebig gewählt sein
oder einem bereits existierenden Werk entnommen sein. Ein derartiges Auswählen
von Tonhöhen entspricht in der Stochastik den sog. Urnenmodellen.
Möchte man ein Musikstück im Stil eines bestimmten Komponisten kreieren, so
hilft die Mathematik auch hierbei. Statistische Analysen verschiedener Werke eines
Komponisten wie z.B. Bach zeigen, dass einige Tonintervalle – gemessen in Halbtonschritten – häufiger benutzt werden als andere. Oft trifft man sogar verschiedene
Motive – also bestimmte Abfolgen von Intervallen – an, die ebenfalls bei einer Komposition a la Bach verwendet werden sollten. Zur Untersuchung notiert man sich für
ein zu untersuchendes Stück zunächst die Abfolge der Intervalle.
Anschließend zerlegt man die Intervallfolge in aufeinanderfolgende sich überlappende Ereignisse. Es fällt auf, dass einige Abfolgen häufiger vorkommen als andere.
Anhand dieser Daten kann man nun Schätzwerte für die Wahrscheinlichkeiten verschiedener Abfolgen bestimmen.
Gibt man noch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung der Anfangstöne (Sammlung der
Wahrscheinlichkeiten aller möglichen Anfangstöne mit der Nebenbedingung, dass
ihre Summe 1 ergibt) an, so hat man mathematisch betrachtet eine Markovkette
der Ordnung 1 definiert. Ausgehend von einem mit entsprechender Wahrscheinlichkeit gewählten Anfangston kann man sich z.B. durch Bilden von Zufallszahlen
für verschiedene Übergänge entscheiden und auf diese Weise ein komplettes Musikstück zusammensetzen. Analoge Verfahren können auch auf Sequenzen der Längen
3, 4 usw. angewendet werden. In diesen Fällen arbeitet man mit Markovketten der
Ordnungen 2, 3 usw.
41
4
Graphentheorie
Viele Alltagsprobleme lassen sich mittels Graphen modellieren. Dazu gehört beispielsweise auch das allseits bekannte Problem, das „Haus des Nikolaus“ zu zeichnen, ohne den Stift dabei abzusetzen und eine Linie doppelt zu zeichnen. Ihren
historischen Ursprung hat die Graphentheorie in dem später genauer betrachteten Königsberger Brückenproblem, das der schweizer Mathematiker Leonhard Euler
(1707-1783) im Jahr 1736 durch die Entwicklung dieser neuen Theorie löste. Angewendet wird die Graphentheorie v.a. in der Logistik, aber auch Materialströme
und Arbeitsabläufe in Großbetrieben können mit graphentheoretischen Methoden
behandelt werden.
4.1
Grundlagen
Als Motivation betrachten wir das Haus des Nikolaus. Es hat die Gestalt:
Will man nun das Haus zeichnen, ohne den Stift abzusetzen und eine Linie doppelt zu zeichnen, so muss man links oder rechts unten anfangen, da nur dort drei
Linien zusammentreffen. In allen anderen Schnittpunkten treffen zwei oder vier Linien aufeinander – zu diesen Punkten kann man also (ein- oder zweimal) mit dem
Stift hinkommen und wieder weggehen, anders als bei den beiden unteren Eckpunkten. Die Zeichnung funktioniert also nur, wenn man in dem einen unteren Eckpunkt
startet, in dem anderen endet und zusätzlich noch durch beide einmal hindurchgeht.
Mit dem Haus des Nikolaus haben wir im Prinzip den ersten Graph kennengelernt.
Allgemein verstehen wir unter einem Graphen ein Gebilde, das aus Ecken und Kanten besteht. Als Graph würde das Haus des Nikolaus folgende Gestalt haben:
Der mittlere Punkt ist keine Ecke, sondern nur ein Kreuzungspunkt, an dem kein
Richtungswechsel stattfindet. Formal definiert man
Definition 4.1. Ein Graph G ist ein geordnetes Paar (V, E); dabei ist V eine
Menge und E ist eine Menge zweielementiger Teilmengen von V . Die Elemente der
Menge V heißen Ecken oder Knoten des Graphen G und die Elemente von E
heißen Kanten von G.
42
4 GRAPHENTHEORIE
Die Menge aller zweielementigen Teilmengen von V bezeichnet man auch mit V2 .
Die Kanten müssen nicht gerade gezeichnet werden, auch krummlinige Verläufe sind
möglich. Ebenso muss nicht jede Ecke mit jeder anderen Ecke verbunden sein (vgl.
den höchsten Punkt im Haus vom Nikolaus). Es kann sogar isolierte Ecken geben,
die mit keiner weiteren Ecke verbunden sind. Andererseits kann es zwischen zwei
Ecken auch mehrere Kanten geben, sie heißen parallele Kanten bzw. Mehrfachkanten. Es darf sogar eine Ecke mit sich selbst verbunden sein, die entsprechende
Kante nennt man Schlinge. Zur Abgrenzung wird ein Graph ohne Schlingen und
Mehrfachkanten auch als einfacher Graph bezeichnet. Um Mehrfachkanten und
Schlingen zu erlauben, muss die Definition geeignet modifiziert werden, da durch sie
zunächst nur jeweils eine Kante zwischen zwei Ecken zugelassen ist.
Bemerkung 4.1. Damit auch Mehrfachkanten zulässig sind, kann man die Definition
wie folgt modifizieren:
1. Die Kanten können statt als Mengen als Funktionen aufgefasst werden, die jedem
Paar (u, v) von Ecken eine nicht negative ganze Zahl m(u, v), die Vielfachheit der
Kante {u, v} zuordnet. m(u, v) = 0 bedeutet dann, dass zwischen u und v keine
Kante vorhanden ist, im Falle m(u, v) = 1 sind u und v durch eine Kante verbunden
und für m(u, v) > 1 gibt es mehrere
Kanten zwischen u und v. Man würde also den
Graphen G als (V, m) mit m : V2 → {0, 1, 2, . . .} definieren.
2. Die elegantere Variante ist, für E eine endliche Menge zu wählen, die von der
Eckenmenge V disjunkt ist. Für jede Kante e ∈ E bestimmt
man das Paar der
Endecken von e. Dies fasst man als Abbildung ε : E → V2 auf und definiert den
Graphen durch (V, E, ε).
Entsprechend der gewählten Definition kann man auch Schlingen erlauben. In Definition 4.1 kann dies durch Kanten derForm {v} erreicht werden, in 2. durch Erweiterung des Bildbereiches von ε auf V2 ∪ V .
Um auch Wege modellieren zu können, die nur in einer Richtung durchlaufen werden
dürfen (wie z.B. Einbahnstraßen im Straßennetz) definiert man
Definition 4.2. Ein gerichteter Graph G ist ein geordnetes Paar (V, E); hierbei
ist V die Menge aller Ecken, die Menge E besteht aus geordneten Paaren von Ecken,
also E ⊂ {(u, v) : u, v ∈ V } = V × V . Für eine Kante e = (u, v) bezeichnen wir u
als Anfangsknoten und v als Endknoten der Kante e.
Die Richtungen in einem gerichteten Graphen werden durch Pfeile dargestellt.
Definition 4.3. Ein Graph
(bzw. ein gerichteter Graph) G = (V, E) heißt voll
V
ständig, wenn E = 2 (bzw. E = (V × V )\{(v, v) : v ∈ V }).
Ein Graph wird also als vollständig bezeichnet, wenn jede Ecke mit jeder anderen
Ecke verbunden ist.
Beispiel 4.1. Die Abbildungen zeigen vollständige Graphen mit |V | = 2, |V | = 3,
|V | = 4 und |V | = 5.
4.1 Grundlagen
43
Definition 4.4. Ein Graph G0 = (V 0 , E 0 ) heißt Teilgraph eines weiteren Graphen
G = (V, E), wenn V 0 ⊂ V und E 0 ⊂ E. Ein Teilgraph
G0 = (V 0 , E 0 ) eines Graphen
0
G = (V, E) heißt Untergraph, wenn E 0 = V2 ∩ E.
0
Die Bedingung E 0 = V2 ∩ E besagt, dass eine Kante aus E, die zwei Ecken aus V 0
verbindet, bereits in E 0 liegen muss.
Es kann vorkommen, dass in zwei Graphen, die unterschiedlich aussehen, ähnliche
Ecken auf die gleiche Art durch Kanten verbunden sind und somit beide Graphen
die gleichen Eigenschaften besitzen.
Definition 4.5. Zwei Graphen G = (V, E) und G0 = (V 0 , E 0 ) heißen isomorph,
wenn es eine bijektive Abbildung f : V → V 0 gibt, so dass
{x, y} ∈ E
genau dann, wenn {f (x), f (y)} ∈ E 0
für alle x, y ∈ V , x =
6 y gilt. Eine solche Abbildung f heißt ein Isomorphismus
der Graphen G und G0 . Wenn G und G0 isomorph sind, schreiben wir G ∼
= G0 .
Beispiel 4.2. Die beiden Graphen
sind isomorph. Hingegen sind die Graphen
nicht isomorph. Die Anzahlen der Ecken und Kanten sind zwar identisch, jedoch
sind im linken Graphen keine zwei Ecken, in denen drei Kanten zusammentreffen,
benachbart, im rechten allerdings schon. Die Struktur hat sich also geändert.
Definition 4.6. Ein Kantenzug (der Länge n) in einem Graphen G = (V, E) ist
eine nicht leere Folge (v0 , e0 , v1 , e1 , . . . , en−1 , vn ) von abwechselnd Ecken und Kanten
aus G mit ei = {vi , vi+1 } für alle i < n. Ist v0 = vn , so heißt der Kantenzug geschlossen. Sind die Ecken vi eines Kantenzuges paarweise verschieden, so bezeichnet man
den Kantenzug auch als Weg. Sind die Ecken v0 , v1 , . . . , vn−1 paarweise verschieden
und gilt vn = v0 , so spricht man von einem Kreis.
Als Weg kann man z.B. die Route eines Reisenden auffassen: Er startet seine Reise
an einem Ort, reist zum nächsten Ort usw. Auf seiner Reise wird er keinen Ort
zweimal besuchen wollen, da er ja neue Eindrücke sammeln will. Kehrt der Reisende
am Schluss wieder an den Startpunkt zurück, durchläuft er einen Kreis.
44
4 GRAPHENTHEORIE
Bemerkung 4.2. Jeder Weg der Länge n ist isomorph zum Graph Pn = (Vn , En )
mit Vn = {0, 1, . . . , n} und En = {{i, i + 1} : i = 0, 1, . . . , n − 1}. Ein Kreis der
Länge n ist hingegen isomorph zum Graph Cn = (Vn0 , En0 ) mit Vn0 = {0, 1, . . . , n}
und En0 = {{i − 1, i} : i = 1, . . . , n} ∪ {{0, n}}.
Definition 4.7. Ein nicht leerer Graph G = (V, E) heißt zusammenhängend,
wenn er für je zwei seiner Ecken u, v ∈ V einen Weg von S
u nach v enthält. Existieren
paarweise disjunkte Mengen Vi , i = 1, . . . , k, mit V = ki=1 Vi , so dass zwei Ecken
u und v genau dann durch einen Kantenzug verbunden sind, wenn sie in derselben
Menge Vj liegen, so heißen die Mengen Vi Zusammenhangskomponenten von G.
Dass die Anzahl der Kanten, die in einer Ecke zusammenlaufen, von Bedeutung ist,
haben wir bereits beim Haus vom Nikolaus gesehen. Man definiert
Definition 4.8. Sei G ein Graph und v eine Ecke von G. Die Anzahl der Kanten von
G, die die Ecke v enthalten, heißt Grad von v in G und wird mit dG (v) abgekürzt.
Einen interessanten Zusammenhang zwischen den Graden und der Anzahl der Kanten |E| liefert die folgende Proposition.
Proposition 4.1 (Handshake-Lemma). Für jeden Graphen G = (V, E) gilt
X
dG (v) = 2|E|.
v∈V
Beweis. dG (v) gibt an, wie viele Kanten es gibt, die v als Eckpunkt enthalten. Jede
Kante hat jedoch zwei Ecken, durch Aufsummieren aller Grade werden also alle
Kanten doppelt gezählt.
Daraus können wir direkt folgern:
Korollar 4.2. In jedem Graphen ist die Anzahl der Ecken mit ungeradem Grad eine
gerade Zahl.
Beweis. Jeder Knoten v ∈ V hat entweder geraden oder ungeraden Grad. Wir
können also V auteilen auf die Mengen
V1 = {v ∈ V : dG (v) ist ungerade} und V2 = {v ∈ V : dG (v) ist gerade}.
Dann ist V1 ∪ V2 = V und V1 ∩ V2 = ∅. Aus dem Handshake-Lemma 4.1 folgt
X
v∈V1
dG (v) = 2|E| −
X
dG (v).
v∈V2
Da die Summe gerader Zahlen wieder gerade ist, steht auf der rechten Seite eine
gerade Zahl. Auf der linken Seite werden jedoch ungerade Zahlen summiert. Damit also auch auf der linken Seite eine gerade herauskommt, muss die Anzahl der
Elemente von V1 gerade sein.
4.2 Eulersche Graphen
4.2
45
Eulersche Graphen
In diesem Abschnitt werden wir uns das eingangs erwähnte Königsberger Brückenproblem, das Leonhard Euler 1736 löste, genauer ansehen. Königsberg, das heutige
Kaliningrad, liegt am Fluss Pregel, der in den Alten und Neuen Pregel geteilt in
die Stadt hineinfließt. Um die Insel Kneiphof vereinigen sich die beiden Arme, bevor
der Pregel schließlich westlich von Königsberg in die Ostsee mündet. Folgende Zeichnung, die Euler damals anfertigte, verdeutlicht die Situation. Ebenfalls eingezeichnet
sind die sieben Brücken, die die verschiedenen Teile Königsbergs verbanden.
Abbildung 8: Königsberg und die sieben Brücken über den Pregel
Das Königsberger Brückenproblem besteht nun darin, einen Weg durch Königsberg
zu finden, der jede Brücke genau einmal überquert und wieder am Startpunkt endet. Um das Problem zu abstrahieren, fasste Euler die einzelnen Teile der Stadt zu
Punkten A, B, C und D zusammen. Dies ist ebenfalls in der Zeichnung zu erkennen.
Dann ersetzte er die Brücken durch Verbindungslinien zwischen den Punkten und
ließ alle weiteren Details weg. Das Ergebnis war ein zu
C
A
D
B
isomorpher Graph.
Definition 4.9. Ein geschlossener Kantenzug (v0 , e1 , v1 , . . . , em−1 , vm−1 , em , v0 ), der
jede Kante genau einmal durchläuft, heißt geschlossene Euler-Tour in G. Ein
Graph G, der eine geschlossene Euler-Tour enthält, heißt eulersch.
Lemma 4.3. Sei G ein Graph mit dG (v) ≥ 2 für alle v ∈ V . Dann enthält G einen
Kreis.
Beweis. Im Falle einer Schlinge oder von Mehrfachkanten gilt die Behauptung. Sei
also G ein Graph ohne Schlingen und Mehrfachkanten. Wir konstruieren dann einen
geschlossenen Weg wie folgt: Wähle v0 ∈ V beliebig. In der Ecke v0 laufen mindestens zwei Kanten zusammen, wähle eine davon und nenne sie e1 . Der andere
46
4 GRAPHENTHEORIE
Endpunkt der Kante heiße v1 . Neben der bereits durchlaufenen Kante besitzt v1
nach Voraussetzung noch mindestens eine weitere Kante, wähle daraus eine Kante e2 mit Endpunkt v2 . Allgemein wähle man für i ∈ N in vi eine Kante ei+1 mit
ei+1 6= {vi−1 , vi }. Der Endpunkt heiße vi+1 . Auf diese Weise entsteht ein Weg, der
wegen |V | < ∞ irgendwann einen Knoten zum zweiten Mal erreicht, so dass sich ein
Kreis ergibt.
Satz 4.4. Ein zusammenhängender Graph G = (V, E) ist genau dann eulersch,
wenn alle Ecken geraden Grad haben.
Beweis. ⇒: Da eine geschlossene Euler-Tour aus allen Ecken, in die sie hineinführt,
auch wieder herausführen muss, sind alle Eckengrade gerade.
⇐: Diese Richtung ist komplizierter. Die Existenz eine geschlossenen Euler-Tour
zeigen wir mittels Induktion über die Anzahl k der Kanten. Für k = 1 ist unter
den gegebenen Bedingungen nur eine Schlinge möglich, die Behauptung trifft also
in diesem Fall zu. Nehmen wir an, das Resultat gelte für alle Graphen mit weniger
als k Kanten. Sei G ein zusammenhängender Graph mit k Kanten, so dass der Grad
jeder Ecke gerade ist. Da der Graph zusammenhängend ist, ist der Grad jeder Ecke
mindestens 2. Nach Lemma 4.3 enthält G einen Kreis C. Wenn wir die Kanten in C
aus G entfernen, erhalten wir einen Teilgraphen G0 mit weniger als k Kanten, und alle
Ecken dieses Graphen haben einen geraden Grad. Der Graph G0 muss jedoch nicht
zusammenhängend sein. Seien also H1 , . . . , Hi die Zusammenhangskomponenten von
G0 . Nach der Induktionsannahme enthält jedes Hj eine geschlossene Euler-Tour Wj .
Darüber hinaus haben Hj und C eine Ecke vj gemeinsam. Wir können annehmen,
dass Wj mit vj anfängt und endet. Nun konstruieren wir eine geschlossene Euler-Tour
in G auf folgende Weise: Wir laufen C entlang, bis wir zu einer Ecke vj gelangen.
Von hier aus folgen wir der geschlossenen Euler-Tour Wj bis zur Rückkehr nach vj
und setzen dann unseren Weg entlang C fort.
Da im Graph des Königsberger Brückenproblems alle Ecken ungeraden Grad besitzen, kann es somit keine geschlossene Euler-Tour geben. Folglich existiert kein
Rundgang, der über alle Brücken jeweils nur einmal führt und am Startpunkt endet.
Auch der Graph des Hauses vom Nikolaus ist nach Satz 4.4 nicht eulersch. Verzichtet
man auf die Forderung, dass der gesuchte Kantenzug wieder im Startpunkt enden
soll, und bezeichnet den Kantenzug, der jede Kante genau einmal durchläuft, als
offene Euler-Tour, so folgt aus Satz 4.4
Korollar 4.5. Ein zusammenhängender Graph G = (V, E) enthält genau dann eine
offene Euler-Tour, wenn er genau zwei Knoten ungeraden Grades besitzt.
Beweis. Wenn G eine offene Euler-Tour enthält, dann sind der Start- und Endknoten
dieses Kantenzuges von ungeradem Grad.
Seien umgekehrt u und v die beiden Knoten ungeraden Grades. Wir betrachten den
aus G durch Hinzufügen einer Kante zwischen u und v hervorgehenden Graphen G0 .
Da nun alle Knoten von G0 geraden Grad besitzen, enthält G0 nach Satz 4.4 eine
geschlossene Euler-Tour. Durch Entfernen der soeben hinzugefügten Kante zwischen
u und v erhalten wir einen Kantenzug zwischen u und v, der jede Kante genau einmal
durchläuft, also eine offene Euler-Tour.
Nach Korollar 4.5 enthält das Haus vom Nikolaus also zumindest eine offene EulerTour. In Beispiel 4.4 finden Sie weitere Beispiele eulerscher Graphen.
4.3 Hamiltonsche Graphen
4.3
47
Hamiltonsche Graphen
Wir stehen vor einem neuen Problem, wenn wir folgende Situation betrachten. Eine
Gruppe Jugendlicher möchte mit einem Euro-Ticket mit der Bahn kreuz und quer
durch Europa fahren. Für die Planungen stehe den Jugendlichen der dargestellte
Netzplan zur Verfügung.
Hamburg
Amsterdam
Köln
Berlin
Hannover
Brüssel
Frankfurt
Nürnberg
Dresden
Prag
Paris
Stuttgart
München
Wien
Die Fahrt soll in Köln beginnen, durch alle im Netzplan aufgeführten Städte führen
und wieder in Köln enden. Dabei soll jede Stadt genau einmal besucht werden.
Anders als bei einer Euler-Tour müssen nun aber nicht alle Strecken abgefahren
werden. Gibt es einen derartigen Weg überhaupt?
Zur Beantwortung der Frage definieren wir zunächst
Definition 4.10. Ein geschlossener Kantenzug (v0 , e1 , v1 , . . . , em−1 , vm−1 , em , v0 ),
der jede Ecke genau einmal enthält, heißt hamiltonscher Kreis. Ein Graph, der
einen hamiltonscher Kreis enthält, heißt hamiltonscher Graph.
Benannt sind die hamiltonschen Kreise nach dem irischen Physiker und Mathematiker William Rowan Hamilton (1805-1865), der 1857 ein Spiel erfand, bei dem man
die Flächen eines Ikosaeders so ablaufen musste, dass jede Fläche genau einmal
besucht wird.
Beispiel 4.3. Wir betrachten die beiden Graphen
Der linke Graph ist hamiltonsch, der rechte hingegen nicht.
Bevor wir uns mit den Eigenschaften hamiltonscher Graphen näher befassen, vergleichen wir sie zunächst mit eulerschen Graphen. Die Definitionen sind recht ähnlich:
Bei den eulerschen Graphen sollte jede Kante genau einmal durchlaufen werden,
bei hamiltonschen Graphen ist ein geschlossener Kantenzug gesucht, der jede Ecke
genau einmal besucht. Trotz dieser Ähnlichkeit handelt es sich bei hamiltonsch und
eulersch um zwei verschiedene Eigenschaften. Dies verdeutlicht das folgende Beispiel:
48
4 GRAPHENTHEORIE
Beispiel 4.4. Wir betrachten die folgenden Graphen:
Der erste Graph ist hamiltonsch und eulersch. Der zweite ist zwar hamiltonsch, aber
nicht eulersch. Beim dritten Graphen ist es genau umgekehrt: Er ist eulersch, aber
nicht hamiltonsch. Der vierte Graph ist weder hamiltonsch noch eulersch.
Für hamiltonsche Kreise ist bis jetzt keine so handliche notwendige und hinreichende
Bedingung bekannt wie für Euler-Touren. Wir können uns aber zumindest einige
hinreichende Kriterien ansehen.
Proposition 4.6. Für alle
natürlichen Zahlen n ≥ 3 besitzt der vollständige Graph
{1,...,n}
Kn = ({1, . . . , n},
) einen hamiltonschen Kreis.
2
Beweis. Der Kantenzug
(1, {1, 2}, 2, {2, 3}, 3, . . . , n − 1, {n − 1, n}, n, {n, 1}, 1)
ist ein hamiltonscher Kreis in Kn .
Bemerkung 4.3. Die Anzahl hamiltonscher Kreise in einem vollständigen Graph mit
n = |V | Ecken (n ≥ 3) beträgt (n−1)!
= (n−1)(n−2)···2·1
. Ein beliebiger Graph kann
2
2
(n−1)!
also höchstens 2 hamiltonsche Kreise besitzen.
Als Vorbereitung auf einige hinreichende Bedingungen betrachten wir das folgende
Lemma.
Lemma 4.7. Seien u und v zwei nicht benachbarte Knoten eines Graphen G =
(V, E) mit dG (u) + dG (v) ≥ |V |. Dann ist G genau dann hamiltonsch, wenn G0 =
(V, E ∪ {u, v}) hamiltonsch ist.
Beweis. Wenn G hamiltonsch ist, dann natürlich auch G0 . Sei also G0 hamiltonsch
mit einem Hamiltonkreis C und |V | = n. Falls C die Kante {u, v} nicht benutzt, so
ist C offensichtlich auch ein Hamiltonkreis in G. Sei andernfalls
C = (u = v1 , {v1 , v2 }, v2 , . . . , vn−1 , {vn−1 , vn }, vn = v, {v, u}, u).
Es genügt nun, einen Index i ∈ {2, . . . , n − 2} zu finden, so dass eR := {u, vi+1 } ∈ E
und eL := {vi , v} ∈ E, denn wenn man die Kanten {u, v} und {vi , vi+1 } aus C
entfernt und die Kanten eR und eL hinzufügt, erhält man einen Hamiltonkreis in G.
v1 = u
vn = v
v1 = u
vn = v
vn−1
v2
vn−1
v2
vn−2
v3
vn−2
v3
vi+2
vi−1
vi+2
vi−1
vi
vi+1
vi
vi+1
4.3 Hamiltonsche Graphen
49
Eine solche „Überkreuzung“ wird aber durch die Bedingung dG (u) + dG (v) ≥ |V |
garantiert: Wir setzen
R = {i ∈ {2, . . . , n − 2} : {u, vi+1 } ∈ E} und
L = {i ∈ {2, . . . , n − 2} : {vi , v} ∈ E}.
Wegen L ∪ R ⊂ {2, . . . , n − 2} gilt |L ∪ R| ≤ n − 3. Der Knoten u ist Randknoten
der Kante {u, v1 } und der Kanten {u, vj+1 } mit j ∈ R, also gilt |R| = dG (u) − 1. Der
Knoten v ist Randknoten der Kante {vn−1 , v} und der Kanten {vj , v} mit j ∈ L,
also gilt |L| = dG (v) − 1. Daher folgt
|R| + |L| = dG (u) − 1 + dG (v) − 1 ≥ |V | − 2 > n − 3 ≥ |L ∪ R|.
Also muss R ∩ L 6= ∅ sein, da sonst Gleichheit gelten würde. Es gibt also einen Index
j ∈ {2, . . . , n − 2}, so dass {u, vj+1 }, {vj , v} ∈ E.
Mit Hilfe dieses Lemmas lässt sich eine hinreichende Bedingung für die Existenz
eines hamiltonschen Kreises in einem gegebenen Graphen herleiten.
Satz 4.8 (Ore 1960). Ein einfacher Graph G = (V, E), in dem für je zwei nicht
benachbarte Knoten u und v die Ungleichung
dG (u) + dG (v) ≥ |V |
erfüllt ist, besitzt einen hamiltonschen Kreis.
Beweis. Durch sukzessives Ergänzen von Kanten zwischen nicht benachbarten Knoten gelangen wir zu einem vollständigen
Graphen G. Dieser ist isomorph zu Kn
V
mit V = {1, . . . , n} und E = 2 . Nach Proposition 4.6 ist Kn und somit auch
G hamiltonsch. Wegen Lemma 4.7 (mehrfach angewendet) muss also auch G einen
hamiltonschen Kreis enthalten.
Die nächste hinreichende Bedingung formulieren wir als Folgerung des Satzes von
Ore, historisch gesehen ist die Aussage jedoch älter als besagter Satz.
Korollar 4.9 (Dirac 1952). Ein einfacher Graph G = (V, E) mit dG (u) ≥
alle Knoten u ∈ V besitzt einen hamiltonschen Kreis.
|V |
2
für
Beweis. Aufgrund der gegebenen Voraussetzungen erfüllt jedes Paar u und v nichtbenachbarter Knoten die Ungleichung dG (u)+dG (v) ≥ |V |. Damit folgt die Behauptung aus dem Satz von Ore (Satz 4.8).
Eine notwendige Eigenschaft hamiltonscher Graphen gibt der nächste Satz an.
Satz 4.10. Kann der Zusammenhang eines Graphen G durch die Entnahme eines einzigen Knotens und sämtlicher in diesem Knoten endender Kanten zerstört
werden, dann besitzt G keinen hamiltonschen Kreis.
Beweis. Sei G ein zusammenhängender Graph und bezeichne v einen Knoten mit
der Eigenschaft, dass der Graph G0 , der durch Löschen des Knotens v und aller
darin endenden Kanten entsteht, nicht zusammenhängend ist, also wenigstens aus
den beiden nicht leeren Zusammenhangskomponenten G1 und G2 besteht.
Jeder Kreis, der durch sämtliche Knoten von G führt und nicht im Knoten v beginnt,
50
4 GRAPHENTHEORIE
muss v mindestens zweimal durchlaufen: Von seinem Ausgangspunkt in der Zusammenhangskomponente G1 bzw. G2 ausgehend, muss der Kreis mindestens einmal zu
den Knoten der Komponente G2 bzw. G1 wechseln und von dort in die Komponente
G1 bzw. G2 zurückkehren, um tatsächlich alle Knoten von G zu durchlaufen. Dabei
wird der Knoten v mindestens zweimal berührt.
Hat der Kreis seinen Ausgangspunkt im Knoten v, dann muss er der selben Argumentation folgend mindestens dreimal besucht werden.
In beiden Fälle kann es also keinen hamiltonschen Kreis geben.
Ein hamiltonscher Graph muss also nach Entfernen einer Ecke und aller Kanten, die
darin enden, zusammenhängend bleiben. Die Aussage lässt sich verallgemeinern zu
Satz 4.11. Entfernt man in einem hamiltonschen Graphen k Ecken und mit ihnen
alle darin endenden Kanten, so zerfällt der Graph in höchstens k Teilgraphen.
Diese beiden Aussagen können häufig genutzt werden, um nachzuweisen, dass ein
gegebener Graph nicht hamiltonsch ist.
Beispiel 4.5. Mit Satz 4.10 können wir begründen, warum der zweite in Beispiel 4.3
gezeigte Graph nicht hamiltonsch sein kann.
Entfernt man nämlich die mittlere Ecke samt aller zugehöriger Kanten (in der Zeichnung grau), so zerfällt der Graph in zwei Zusammenhangskomponenten.
Der Graph
A
B
ist ebenfalls nicht hamiltonsch, denn wenn man die Ecken A und B samt der zugehörigen Kanten entfernt, zerfällt der Graph in drei Zusammenhangskomponenten.
Ein hamiltonscher Graph würde jedoch nach Satz 4.11 nur in maximal zwei Zusammenhangskomponenten zerfallen.
Die Sätze von Ore (Satz 4.8) und Dirac (Korollar 4.9) helfen leider nicht dabei, zu
entscheiden, ob der eingangs betrachtete Graph des Eisenbahnnetzes hamiltonsch ist.
Da z.B. dG (Amsterdam) = 2 < 7 = |V2 | , sind die Voraussetzungen von Korollar 4.9
nicht erfüllt. Ebenso gilt dG (Amsterdam) + dG (Dresden) = 4 < 14 = |V |, so dass
auch Satz 4.8 nicht angewendet werden kann. Der Graph ist dennoch hamiltonsch.
Ein hamiltonscher Kreis ist in der folgenden Grafik angegeben.
4.4 Kürzeste Wege
51
Hamburg
Amsterdam
Köln
Berlin
Hannover
Brüssel
Frankfurt
Nürnberg
Dresden
Prag
Paris
Stuttgart
München
Wien
Ein klassisches Anwendungsbeispiel, das dem hier betrachteten Eisenbahnnetz-Problem ähnelt, ist das Problem des Handlungsreisenden (engl.: Traveling Salesman
Problem). Ein Vertreter möchte seine Kunden besuchen und dazu seine Reise so
organisieren, dass er jede Stadt nur einmal besuchen muss. Stellt man sich die zu
besuchenden Städte als Knoten eines Graphen vor und verbindet zwei Knoten, wenn
es eine direkte Verbindung zwischen den beiden Städten gibt, so ist eine derartige
Rundreise genau dann möglich, wenn der Graph hamiltonsch ist. (Realistischer wird
das Problem, wenn man die Kanten des Graphen noch mit Kosten versieht und nach
einem hamiltonschen Kreis sucht, der die Gesamtkosten minimiert.)
4.4
Kürzeste Wege
Häufig möchte man nicht unbedingt alle Kanten bzw. alle Ecken eines Graphen
besuchen, sondern fragt nach dem kürzesten Weg zwischen zwei Ecken u und v.
Dieses Problem tritt beispielsweise bei der Routenplanung von einem Ort A zu
einem anderen Ort B in einem gegebenen Straßennetz auf.
Definition 4.11. Es sei G = (V, E) ein Graph und c : E → R eine Abbildung. Dann
wird G auch als bewerteter Graph mit Bewertungsfunktion (bzw. Gewichtsfunktion) c bezeichnet. Für eine Kante e ∈ E nennen wir c(e) die Bewertung (bzw.
das Gewicht bzw. die Länge) der Kante e. Ist K = (v0 , e1 , v1 , e2 , v2 , . . . , en , vn ) ein
Kantenzug in G, so heißt
n
X
c(K) =
c(ei )
i=1
das Gewicht (bzw. die Länge) von K.
In grafischen Darstellungen schreibt man die Gewichte an die zugehörigen Kanten.
Definition 4.12. Sei G = (V, E) ein bewerteter Graph mit Gewichtsfunktion c.
Ein Weg P zwischen zwei Knoten s und t von G heißt kürzester Weg, wenn sein
Gewicht c(P ) verglichen mit dem Gewicht jedes anderen Weges zwischen s und t
minimal ist.
Die Bewertungsfunktion ist relativ abstrakt und lässt daher eine Vielzahl von Interpretationen zu. Beispielsweise können die Kanten mit Preisen, Entfernungen, Zeiten
o.ä. bewertet sein.
52
4 GRAPHENTHEORIE
Beispiel 4.6. Als Studierende der Universität zu Köln sind Sie höchstwahrscheinlich
vertraut mit dem Liniennetz der Kölner Straßen-, U- und S-Bahnlinien.
Abbildung 9: Liniennetz der Kölner Straßen-, U- und S-Bahnen, www.kvb-koeln.de
Um von einer Station zu einer anderen zu gelangen, werden Sie Ihren Fahrtweg
sicherlich optimal wählen wollen. Doch was soll optimiert werden: Zeit, Strecke, Anzahl der Stationen, Umsteigen? Wollte man z.B. die kürzeste Fahrtzeit zwischen zwei
Stationen ermitteln, so kann man die Kanten mit der jeweiligen Fahrzeit zwischen
den zugehörigen Ecken bewerten und den Weg mit der kleinsten Gesamtfahrzeit
suchen. Soll stattdessen die zurückgelegte Strecke minimiert werden, so würde man
die Kanten mit der Entfernung zwischen den beiden zugehörigen Ecken versehen.
Konkret wollen wir z.B. das Problem betrachten, von der Haltestelle „Universität“
der Linie 9 zur Fachhochschule zu gelangen und dabei möglichst wenige Stationen
passieren zu müssen. Die Kanten können wir jeweils mit 1 bewerten.
Abbildung 10: Ausschnitt des Liniennetzplanes
4.4 Kürzeste Wege
53
Der direkte Weg wäre, mit der Linie 9 ohne Umsteigen bis zur Haltestelle „Deutz
Fachhochschule“ zu fahren. Auf diesem Weg durchfahren wir insgesamt (ohne die
Starthaltestelle) 8 Stationen. Dies ist jedoch nicht der kürzeste Weg (im Sinne passierter Haltestellen), denn wenn wir stattdessen an der Dasselstraße/Bf. Süd in die
RE-Linien 5, 12, 22 oder die RB-Linien 24, 48 oder die MRB 26 umsteigen, von dort
bis zum Bahnhof Deutz fahren und anschließend wieder mit der Linie 1 oder 9 eine
Station bis „Deutz Fachhochschule“ fahren, passieren wir lediglich 6 Stationen (von
denen eine oder bei der RE 5 oder RE 12 sogar zwei ohne Halt durchfahren werden).
Der direkte Weg muss somit nicht immer der kürzeste sein. Doch wie findet man
nun einen kürzesten Weg, ohne alle Möglichkeiten auszuprobieren?
Sind viele Ecken vorhanden, empfiehlt es sich, das Problem zunächst zu vereinfachen. So können Haltestellen, in denen kein Richtungswechsel möglich ist, eliminiert
(in unserem Beispiel etwa die Haltestelle „Mauritiuskirche“) und die jeweiligen Kantenbewertungen angepasst werden.
Definition 4.13. Der Abstand dist(u, v) zweier Ecken u und v eines bewerteten
Graphen G ist definiert als
dist(u, v) = min{c(P ) : P ist Weg von u nach v}.
Ferner sei dist(u, u) = 0. Existiert kein Weg von u nach v, so setzt man dist(u, v) =
∞.
Bemerkung 4.4. a) Die Definition ist eindeutig, denn auf jeden Fall gibt es nur
endlich viele Wege zwischen zwei Ecken, und somit existiert auch das Minimum. Es
kann jedoch vorkommen, dass es mehrere verschiedene kürzeste Wege zwischen zwei
Ecken gibt.
b) Ordnet man jeder Kante eines unbewerteten Graphen die Bewertung 1 zu, so kann
man Definition 4.13 auf unbewertete Graphen erweitern. Für zwei Ecken u 6= v, die
durch Wege verbunden sind, gibt der Abstand dann die minimale Anzahl von Kanten
an, die nötig sind, um von u nach v zu gelangen.
Bei negativen Kantenbewertungen kann es vorkommen, dass zwischen zwei Ecken
u und v Kantenzüge existieren, deren Länge echt kleiner ist als die Länge des kürzesten Weges von u nach v. Das Phänomen tritt beispielsweise auf, wenn es einen
geschlossenen Kantenzug mit negativer Länge gibt. Dieser kann dann beliebig oft
durchlaufen werden, wobei die Gesamtlänge jedes Mal sinkt. Negative Kantenbewertungen kommen z.B. in Anwendungen vor, in denen die Bewertungen Gewinne und
Verluste darstellen. Um dieses Problem zu vermeiden, werden wir uns auf den Fall
nichtnegativer Bewertungen beschränken. In hier betrachteten ungerichteten Graphen ist dies äquivalent dazu, dass es keinen geschlossenen Kantenzug mit negativer
Länge gibt. Es gilt
Lemma 4.12. Sei G ein bewerteter Graph mit nichtnegativer Bewertungsfunktion
c. Sind u und v Ecken von G und W ein kürzester Weg von u nach v, dann gilt für
jeden Kantenzug Z von u nach v
c(W ) ≤ c(Z);
d.h. es gibt einen kürzesten Kantenzug von u nach v, der zu einem Weg zusammengezogen werden kann.
54
4 GRAPHENTHEORIE
Beweis. Sei Z ein Kantenzug von u nach v. Wir nehmen an, dass Z kein Weg ist.
Dann gibt es eine Ecke w, die in Z mehrfach vorkommt. Bezeichne Z den geschlossenen Kantenzug aus Z vom erstmaligen bis zum zweitmaligen Besuch in w. Nach
Voraussetzung ist c(Z) ≥ 0. Entfernt man Z aus Z, so entsteht ein Kantenzug Z1
von u nach v mit c(Z1 ) ≤ c(Z). Auf diese Weise zeigt man, dass es zu jedem Kantenzug Z von u nach v einen einfachen Weg Z 0 von u nach v gibt, so dass c(Z 0 ) ≤ c(Z).
Nach Definition von W gilt c(W ) ≤ c(Z 0 ) ≤ c(Z). Die Längen der Kantenzüge sind
also nach unten beschränkt. Folglich gibt es einen Kantenzug minimaler Länge, der
zu einem Weg zusammengezogen werden kann.
Ebenfalls interessant ist die Feststellung, dass Teilstrecken eines kürzesten Weges
ebenfalls kürzeste Wege zwischen den entsprechenden Endpunkten sind. Wir formulieren
Proposition 4.13. Seien u und v Ecken eines bewerteten Graphen G mit nichtnegativer Bewertungsfunktion, W ein kürzester Weg von u nach v und w eine Ecke
von G auf dem Weg W . Dann gilt:
dist(u, v) = dist(u, w) + dist(w, v).
Insbesondere ist der Teilweg Wuw von u nach w ein kürzester Weg von u nach w.
Ferner ist der Teilweg Wwv ein kürzester Weg von w nach v.
Beweis. Für w = u und w = v ist die Gleichung trivialerweise erfüllt. Sei also w 6= u
und w 6= v. Für den Teilweg Wuw von u nach w und den Teilweg Wwv von w nach
v gilt c(Wuw ) ≥ dist(u, w), c(Wwv ) ≥ dist(w, v) und c(Wuw ) + c(Wwv ) = c(W ).
Angenommen, es gelte c(Wuw ) > dist(u, w). In dem Fall existiert ein kürzester Weg
0
0
0
Wuw
von u nach w mit c(Wuw
) = dist(u, w) < c(Wuw ). Die Wege Wuw
und Wwv
0
bilden zusammen einen Kantenzug von u nach v mit der Länge c(Wuw
) + c(Wwv ).
Folglich gilt
0
c(Wuw
) + c(Wwv ) < c(Wuw ) + c(Wwv ) = c(W ).
Dies widerspricht jedoch der Aussage von Lemma 4.12. Daher ist c(Wuw ) = dist(u, w)
und somit Wuw ein kürzester Weg von u nach w. Analog zeigt man c(Wwv ) =
dist(w, v). Folglich gilt
dist(u, v) = c(W ) = c(Wuw ) + c(Wwv ) = dist(u, w) + dist(w, v).
Bei der Suche nach kürzesten Wegen in Graphen unterscheidet man drei verschiedene
Probleme:
(1) Kürzeste Wege zwischen zwei Ecken
(2) Kürzeste Wege zwischen einer Ecke und allen anderen Ecken
(3) Kürzeste Wege zwischen allen Paaren von Ecken
Besonders interessiert sind wir an einer Lösung von Problem (1). Da ein Verfahren
zur Lösung von Problem (2) jedoch auch eine Lösung von Problem (1) liefert und
keine besseren Verfahren für Problem (1) bekannt sind als die für (2) optimalen,
betrachten wir ein Konstruktionsverfahren für Problem (2). Der vorgestellte sog.
4.4 Kürzeste Wege
55
Algorithmus (eine Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems, die aus mehreren Einzelschritten besteht und in einem Computerprogramm implementiert werden
kann) stammt von dem niederländischen Informatiker Edsger Wybe Dijkstra (19302002).
Gegeben sei ein bewerteter (gerichteter oder ungerichteter) Graph G = (V, E) mit
Bewertungsfunktion c ≥ 0. Zusätzlich sei ein Knoten u ∈ V ausgezeichnet. Mit Hilfe
des Dijkstra-Algorithmus wollen wir nun den kürzesten Weg von u zu allen anderen Knoten bestimmen. Dabei wird eine Menge M von Knoten, für deren Elemente
v ∈ M wir bereits einen kürzesten Weg von u nach v gefunden haben, schrittweise
vergrößert. Der Algorithmus basiert dabei auf Proposition 4.13. Für einen gerichteten Graphen ist der Algorithmus wie folgt definiert:
1. Setze `(u) = 0, M = ∅ und `(v) = ∞ für alle v ∈ V \{u}.
2. Wähle w ∈ V \M mit `(w) = min{`(v) : v ∈ V \M }.
3. Falls `(w) = ∞, dann STOP. Sonst ersetze M durch M ∪ {w}.
4. Für alle v ∈ V \M mit (w, v) ∈ E und `(v) > `(w) + c((w, v)) setze
`(v) = `(w) + c((w, v)) sowie Vor(v) = w.
5. Ist V 6= M , so gehe zu Schritt 2.
In Schritt 4 bezeichnet Vor(v) = w den Knoten, von dem aus wir zu v gelangt sind.
Durch Zusammensetzen erhalten wir kürzeste Wege zu allen Knoten v 6= u.
Bemerkung 4.5. 1. Wenn nur ein kürzester Weg von u zu einem bestimmten Knoten
v ∈ V gesucht ist, so kann der Algorithmus mit der Aufnahme von v in die Menge
M abgebrochen werden.
2. Genau dann, wenn ein Knoten ŵ ∈ V nicht vom Knoten u aus erreichbar ist,
endet der Algorithmus mit `(ŵ) = ∞.
3. Der Algorithmus lässt sich auf ungerichtete Graphen übertragen, indem man in
Schritt 4 (w, v) durch {w, v} ersetzt.
Wir wollen uns das Verfahren anhand eines Beispieles klar machen.
Beispiel 4.7. Gegeben sei der folgende gerichtete Graph:
80
a
d
40
e
10
50
20
b
50
20
50
c
56
4 GRAPHENTHEORIE
Der Startknoten sei a. Gesucht sei ein kürzester Weg nach c. Im ersten Schritt
setzen wir nun `(a) = 0, M = ∅ und `(b) = `(c) = `(d) = `(e) = ∞. Der minimale
`-Wert im zweiten Schritt ist also `(a) = 0. Wir setzen im dritten Schritt also
M = {a}. Im vierten Schritt schauen wir uns dann alle Knoten an, die wir von a
aus erreichen können, das sind b und d. Wegen ∞ = `(b) > `(a) + c((a, b)) und
analog für d, setzen wir in Schritt 4 `(b) = `(a) + c((a, b) = 0 + 10 = 10 und
`(d) = `(a) + c((a, d)) = 0 + 80 = 80 sowie Vor(b) = Vor(d) = a. Die Situation nach
dieser ersten Iteration stellt sich wie folgt dar:
Knoten
`
Vorgänger
a b
c
0 10 ∞
a
d
e
80 ∞
a
Da wir c noch nicht erreicht haben, müssen wir erneut bei Schritt 2 beginnen. In
Schritt 2 wird nun b ausgewählt, da `(b) = 10 im Vergleich zu den anderen Werten –
diesmal ohne `(a) – minimal ist. Wir ersetzen also in Schritt 3 M durch {a, b}. Von
b aus erreichen wir c und e, wir setzen `(c) = `(b) + c((b, c)) = 10 + 50 = 60 und
`(e) = `(b) + c((b, e)) = 10 + 20 = 30 sowie Vor(c) = Vor(e) = b. Nun haben wir
Knoten
`
Vorgänger
a b c d e
0 10 60 80 30
a b a b
Da wir auch jetzt noch nicht c in die Menge M aufgenommen haben, müssen wir
das Verfahren erneut durchführen. Wegen `(e) < `(c) < `(d) wird in Schritt 2 nun
e ausgewählt. Wir setzen somit M = {a, b, e}. Von e aus gelangen wir zu c oder d.
Wegen `(c) = 60 > 30+20 = `(e)+c((e, c)) und `(d) = 80 > 30+40 = `(e)+c((e, d))
setzen wir zudem `(c) = `(e) + c((e, c)) = 50 und `(d) = `(e) + c((e, d)) = 70. Die
Werte Vor(c) und Vor(d) überschreiben wir mit Vor(c) = Vor(d) = e. Nach dieser
Iteration gilt also
Knoten
`
Vorgänger
a b c d e
0 10 50 70 30
a
e
e b
Da c immer noch nicht in M enthalten ist, starten wir erneut bei Schritt 2. Wegen
`(c) = 50 < 70`(d) wird nun endlich c ausgewählt und M = {a, b, c, e} gebildet. An
dieser Stelle können wir abbrechen, da M nun den gesuchten Zielknoten c enthält.
Aneinandersetzen der gefundenen kürzesten (Teil-)Wege liefert den kürzesten Weg
(a, (a, b), b, (b, e), e, (e, c), c) und somit dist(a, c) = 50.
80
a
d
40
e
10
50
20
b
50
20
50
c
4.4 Kürzeste Wege
57
Im Beispiel haben wir gesehen, dass der Algorithmus funktioniert. Dies wollen wir
aber noch formal beweisen.
Satz 4.14. Sei G = (V, E) ein gerichteter bewerteter Graph mit nichtnegativer Bewertungsfunktion c und sei u ∈ V . Dann gelten zu jedem Zeitpunkt des Algorithmus:
(a) Für jedes v ∈ V \{u} mit `(v) < ∞ gilt Vor(v) ∈ M und `(Vor(v)) +
c((Vor(v), v)) = `(v), und die Folge v, Vor(v), Vor(Vor(v)), . . . enthält u.
(b) Für jedes v ∈ M gilt `(v) = dist(u, v).
Der Algorithmus arbeitet also korrekt.
Beweis. Nach Beendigung von Schritt 1 des Algorithmus sind beide Aussagen des
Satzes trivialerweise erfüllt. In Schritt 4 wird nur dann `(w) auf `(v) + c((v, w))
reduziert und Vor(w) = v gesetzt, wenn v ∈ M und w 6∈ M . Induktiv zeigt sich,
dass die Folge v, Vor(v), Vor(Vor(v)), . . . den Knoten u enthält, aber keinen Knoten
außerhalb M , insbesondere auch nicht den Knoten w. Aussage (a) bleibt also in
Schritt 4 erhalten.
Die Aussage (b) ist trivial für v = u. Wir führen nun eine Induktion über die
Anzahl der Elemente von M durch. Da `(w) die Länge eines Weges von u nach
w angibt, gilt stets `(w) ≥ dist(u, w). Angenommen, der Knoten w ∈ V \{u} wird
in Schritt 3 zu M hinzugefügt, und es gäbe einen kürzesten Weg P von u nach w
mit Länge kleiner als `(w), es gelte also dist(u, w) < `(w). Sei y der erste auf P
liegende und zu (V \M ) ∪ {w} gehörende Knoten und x der Vorgänger von y auf P .
Nach Proposition 4.13 ist der Teilweg von P , der von u nach y führt, ebenfalls ein
kürzester Weg von u nach y. Da x ∈ M , folgt mit Schritt 4, der Nichtnegativität
der Kantengewichte und der Induktionsvoraussetzung:
`(y) ≤ `(x) + c((x, y)) = dist(u, x) + c((x, y))
= dist(u, y) ≤ dist(u, w) < `(w),
im Widerspruch zur Wahl von w in Schritt 2.
Dass die Nichtnegativität der Kantengewichte eine notwendige Voraussetzung für
den Dijkstra-Algorithmus ist, verdeutlicht das folgende Beispiel.
Beispiel 4.8. Wir betrachten den gerichteten Graphen
1
u
2
w
-2
v
Gesucht sei ein kürzester Weg von u nach w. Im ersten Schritt setzt der DijkstraAlgorithmus `(u) = 0, `(v) = `(w) = ∞ und M = ∅. Zunächst wird also u gewählt
und zu M hinzugefügt. Im folgenden Schritt werden `(v) = `(u)+c((u, v)) = 0+2 =
2 und `(w) = `(u) + c((u, w)) = 0 + 1 = 1 gesetzt. Im nächsten Duchlauf wählt
der Algorithmus wegen `(w) < `(v) den Knoten w und fügt ihn zu M hinzu. An
dieser Stelle würden wir nun abbrechen. Der Algorithmus liefert uns also den Weg
(u, (u, w), w) der Länge 1. Der Weg über (u, (u, v), v, (v, w), w) besitzt jedoch Länge
0 und ist somit kürzer. Im vorliegenden Fall arbeitet der Algorithmus also nicht
korrekt.
58
5
5 DIE MATHEMATIK DER FINANZMÄRKTE
Die Mathematik der Finanzmärkte
Diese Kapitel fällt ein wenig aus dem Rahmen, aber wie heißt es so schön: Geld
regiert die Welt. Aufgrund der Wichtigkeit des Finanzsektors wollen wir an dieser
Stelle die Mathematik dahinter ein wenig beleuchten. Der Einfachheit halber konzentrieren wir uns dabei auf ein diskretes Modell, dass einen Handel nur zu bestimmten
Zeitpunkten zulässt.
5.1
Ein einführendes Beispiel
Wir nehmen an, dass wir es mit einem Markt zu tun haben, in dem es nur erlaubt
ist, heute oder in einem Monat zu handeln. In diesem Markt gibt es eine Aktie, die
heute für 100 Euro gehandelt wird. In einem Monat wird der Preis entweder auf 130
Euro steigen oder auf 70 Euro sinken. Der Markt (d.h. ein typischer Händler) glaubt,
dass die Aktie mit Wahrscheinlichkeit 23 im Wert steigen und mit Wahrscheinlichkeit
1
im Wert fallen wird. Der Einfachheit halber werde Bargeld nicht verzinst (oder
3
der Preis wird gemäß der heutigen Kaufkraft umgerechnet, der Finanzmathematiker
nennt das „diskontiert“).
Ein Händler benötigt in einem Monat zehn Aktien. Er hat Angst, dass der Preis
steigen könnte, und kauft sich daher eine Option auf zehn Aktien zum heutigen Preis.
Eine Option ist das Recht, aber nicht die Verpflichtung, eine Aktie zum vereinbarten
Preis zu kaufen. Wenn der Preis steigt, dann wird der Händler die Option einlösen
und sich zehn Aktien zum Preis von je 100 Euro kaufen. Falls der Preis sinkt, wird
der Händler die Option verfallen lassen und sich im Markt zehn Aktien zu je 70
Euro kaufen.
Eine solche Option ist natürlich nicht kostenlos. Bis 1972 wurde der Preis wie folgt
festgesetzt: Der Händler mach mit Wahrscheinlichkeit 32 (die Aktie steigt) einen
Gewinn von 300 Euro, mit Wahrscheinlichkeit 13 macht er keinen Gewinn. Der Preis
sollte daher
1
2
· 300 + · 0 = 200
3
3
betragen.
Der Verkäufer der Option kauft schon heute fünf Aktien, so dass er, falls der Preis
steigt, später nur noch fünf Aktien dazukaufen muss. Daraus ergibt sich folgende
Bilanz:
+
-
Optionspreis
+200
+200
Optionsgewinn
-300
+0
Aktienkauf Aktienverkauf
-500
+650
-500
+350
Gewinn
+50
+50
Der Verkäufer macht also einen sicheren Gewinn von 50 Euro. Da ein anderer Anbieter auch gerne einen sicheren Gewinn machen möchte, kann man erwarten, dass man
die Option billiger erwerben könnte. Da ein funktionierender Markt einen sicheren
Gewinn nicht erlauben würde, kann der Preis nicht mehr als 150 Euro betragen. Eine
Möglichkeit, einen Gewinn zu erzielen, ohne ein Risiko einzugehen, heißt Arbitrage.
Wir sehen uns als nächstes mögliche Strategien an. Nehmen wir an, der Verkäufer
kauft θ Aktien. Falls θ negativ ist, bedeutet dies, dass der Verkäufer einen ForwardVertrag abschließt, d.h. in einem Monat −θ Aktien ausliefert, die die Gegenpartei
5.1 Ein einführendes Beispiel
59
heute schon bezahlt. Falls die Aktie steigt, ist der Gewinn dieses Vorgehens (ohne
den Optionspreis)
−300 − 100θ + 130θ = 30θ − 300.
Falls der Preis sinkt, ist der Gewinn
0 − 100θ + 70θ = −30θ.
Der minimale Gewinn ist daher
min{30θ − 300, −30θ}.
Dieser minimale Gewinn ist maximal für θ = 5, das heißt −150. Somit kann der
Optionspreis nicht höher als 150 Euro liegen.
Der Käufer der Option kann auch in Aktien investieren. Ohne Optionspreis wird der
Gewinn
300 − 100θ + 130θ = 300 + 30θ,
falls der Preis steigt, und
0 − 100θ + 70θ = −30θ,
falls der Preis sinkt. Der minimale Verlust wird maximal, falls θ = −5, das heißt der
Gewinn ist 150 Euro. Daher kann die Option nicht billiger als 150 Euro gehandelt
werden. Wir haben dadurch den Preis der Option bestimmt. Wie Sie sehen, spielt
die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis steigt, keine Rolle.
Wir haben auf diesem Weg nicht nur den Preis der Option bestimmt, sondern gleichzeitig auch eine Handelsstrategie gefunden, die den Wert der Option erzeugt. Eine
derartige Handelsstrategie nennt man Hedging Strategie.
Nehmen wir nun an, die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie steigt, sei p. Nach der
alten Methode müsste der Preis der Option dann 300p betragen. Dies stimmt mit
unserem Preis überein, falls p = 21 . In diesem Fall ist der erwartete Kurs der Aktie
in einem Monat
1
1
· 130 + · 70 = 100.
2
2
1
Im Fall p = 2 würde die Aktie in einem Monat im Mittel den heutigen Wert haben,
d.h. der Aktienpreis ist ein faires Spiel. Die Mathematiker nennen so ein faires Spiel
ein Martingal.
Ändern wir nun den Aktienpreis so ab, dass neben 130 und 70 auch der Wert 100 in
einem Monat möglich ist. Wir versuchen erneut, eine Hedging Strategie zu finden.
Der Gewinn (für den Verkäufer) in den drei möglichen Fällen wird
30θ − 300,
0,
−30θ.
Das Minimum wird wieder maximal für θ = 5, der Wert der Option darf also nicht
höher als 150 Euro liegen. Der Preis darf auch nicht 150 Euro betragen, da der
Verkäufer im Fall eines gleichbleibenden Preises einen Gewinn von 150 Euro macht
und andernfalls nichts verliert.
Der Gewinn für den Käufer wird
30θ + 300,
0,
−30θ.
60
5 DIE MATHEMATIK DER FINANZMÄRKTE
Dieser Preis wird minimal, falls θ ∈ [−10, 0]. Der Preis sollte also mindestens 0
Euro betragen. Der Preis kann aber natürlich nicht 0 Euro betragen, da sonst eine
Arbitragemöglichkeit besteht. Unser Argument liefert uns somit keinen eindeutigen
Preis mehr. Falls der Preis nicht 150 Euro beträgt, gibt es auch keine Hedging
Strategie für den Verkäufer mehr. Falls der Preis höher als Null liegt, gibt es keine
Hedging Strategie mehr für den Halter der Option.
Wir hatten im Fall zweier möglicher Preise bemerkt, dass der Preis mit der ’alten
Methode’ berechnet werden kann, sofern der Aktienpreis ein faires Spiel ist. Wir
nehmen an, der Aktienpreis steige mit Wahrscheinlichkeit p, falle mit Wahrscheinlichkeit q und bleibe mit Wahrscheinlichkeit 1 − p − q unverändert. Dann ist der
Preis in einem Monat im Mittel
130 · p + 100 · (1 − p − q) + 70 · q = 100 + 30p − 30q.
Dies ist im Mittel der heutige Preis, falls p = q. Damit alle drei Preise möglich sind,
müssen wir p ∈ 0, 21 wählen. Die ’alte’ Methode liefert dann den Optionspreis
300 · p + 0 · (1 − p) = 300p.
Somit erhalten wir das Intervall (0, 150) als mögliche Preise. Dies ist das gleiche
Intervall, das wir auch mit dem „keine Arbitrage“-Argument erhalten haben.
5.2
Einperioden-Modelle
Wir betrachten nun n Aktiva, die zur Zeit 0 die Preise q1 , q2 , . . . , qn besitzen. Diese
Werte fassen wir in einem Vektor q = (qi ) zusammen. Zur Zeit 1 gebe es s Szenarien. Die Werte der Aktiva fassen wir in der Matrix D = (Dij ) zusammen. Dabei
bezeichne Dij den Preis des i-ten Aktivs im j-ten Szenario. Ein Agent kann sich nun
ein Portfolio, also eine Sammlung verschiedener Aktiva, zusammenstellen. Formal
definiert man
Definition 5.1. Ein Portfolio ist ein Vektor
θ = (θ1 , . . . , θn ) ∈ Rn ,
dessen i-te Komponente θi die Stückzahl des i-ten Aktivs angibt.
Der Preis des Portfolios ist gegeben durch
n
X
θi qi = θq.
i=1
Der Wert des Portfolios im Szenario j ist dann
n
X
θi Dij = (θD)j .
i=1
Die einzelnen Werte der Szenarien fassen wir zum Vektor θD zusammen.
5.2 Einperioden-Modelle
61
Bemerkung 5.1. Bei der Definition der Stückzahlen θi werden sowohl nichtganzzahlige als auch negative Werte zugelassen. Während die Zulassung nichtganzzahliger
Werte vorwiegend technische Gründe hat, haben negative Werte eine ökonomische
Bedeutung. Enthält ein Portfolio etwa eine negative Anzahl θi an Aktien des Typs
i, so bedeutet dies, dass |θi | Aktien des Typs i von einer Finanzinstitution geliehen
und diese anschließend am Markt verkauft wurden. Damit bestehen beim Verleiher
der Aktien Schulden der Höhe θi qi .
Beispiel 5.1. Wir betrachten zwei Aktiva. Der erste Aktiv sei eine festverzinsliche
Kapitalanlage, der zweite eine Aktie. Zur Zeit 0 habe die festverzinsliche Anlage
den Wert q1 = 1 und die Aktie den Wert q2 = 10. Als Portfolio wählen wir θ =
(−10, 1). Die Schulden von 10 Stück der festverzinslichen Anlage entspricht eine
Kreditaufnahme von 10 Euro. Daneben besitzen wir eine Aktie. Zur Zeit 0 hat
unser Portfolio also den Wert
θq = (−10) · 1 + 1 · 10 = 0.
Zum Zeitpunkt 1 habe die festverzinsliche Anlage den Wert 1,02, was einer Verzinsung von 2% entspricht. Wir nehmen an, dass der Wert der Aktie zur Zeit 1 entweder
auf 12 Euro steigen oder auf 9 Euro fallen kann. Die Matrix D hat dann die Form
1, 02 1, 02
D=
.
12
9
Steigt die Aktie (Szenario 1), hat das Portfolio den Wert
θ1 D11 + θ2 D21 = (−10) · 1, 02 + 1 · 12 = 1, 8.
Fällt die Aktie jedoch (Szenario 2), so hat das Portfolio nur den Wert
θ1 D12 + θ2 D22 = (−10) · 1, 02 + 1 · 9 = −1, 2.
Wichtige von den Finanzprodukten abgeleitete Instrumente, die auch Derivate genannt werden, sind u.a. die im einführenden Beispiel erwähnten Optionen und
Forward-Kontrakte.
Definition 5.2. Eine Call-Option beinhaltet das Recht, ein bestimmtes Wertpapier zu einem in der Zukunft liegenden Zeitpunkt, dem Fälligkeitszeitpunkt, zu
einem heute schon festgesetzten Preis K, dem Basispreis, zu kaufen.
Sollte zum Fälligkeitszeitpunkt der Wert der Aktie unterhalb des festgesetzten Preises K liegen, so ist es nicht sinnvoll, die Option auszuüben. Ist hingegen der Wert
der Aktie zum Fälligkeitszeitpunkt größer als der festgesetzte Preis, so wird man
die Option ausüben, da sich durch sofortigen Weiterverkauf der Aktie zum höheren
Marktpreis einen Gewinn erzielen lässt.
Bezeichnen wir den Wert der Aktie zum Fälligkeitszeitpunkt mit S, so lautet der
Wert der Option bei Fälligkeit somit
(S − K)+ = max{S − K, 0}.
Betrachten wir auch hier s mögliche Szenarien und bezeichnen den Wert der Aktie
in Szenario j mit Sj , so bilden die Werte
cj = (Sj − K)+
einen Vektor c, der auch als Auszahlungsprofil bezeichnet wird.
62
5 DIE MATHEMATIK DER FINANZMÄRKTE
Definition 5.3. Eine Put-Option beinhaltet das Recht, ein bestimmtes Wertpapier zu einem in der Zukunft liegenden Zeitpunkt, dem Fälligkeitszeitpunkt, zu
einem heute schon festgesetzten Preis K, dem Basispreis, zu verkaufen.
Analog zur Call-Option lautet der Wert der Put-Option bei Fälligkeit
(K − S)+ = max{K − S, 0},
wenn wir den Wert der Aktie zum Fälligkeitszeitpunkt wieder mit S bezeichnen. Das
Auszahlungsprofil einer Put-Option besitzt also die Komponenten cj = (K − Sj )+ .
Definition 5.4. Ein Forward-Kontrakt ist eine zum Zeitpunkt 0 eingegangene
Verpflichtung, ein bestimmtes Wertpapier zu einem in der Zukunft liegenden Zeitpunkt, dem Fälligkeitszeitpunkt, zu einem heute, bei t = 0 festgesetzten Preis F ,
dem Forward-Preis, zu kaufen. Dabei wird der Forward-Preis so bestimmt, dass
das Eingehen der Kauf- bzw. Verkaufsverpflichtung zum Zeitpunkt 0 kostenlos ist.
Anders als bei den Call- oder Put-Optionen ist der Käufer eines Forward-Kontraktes
zum Kauf verpflichtet, und zwar auch dann, wenn er das betreffende Wertpapier an
der Börse billiger erwerben könnte. Der Wert des Forward-Kontrakts bei Fälligkeit
ist also einfach
S − F.
Die Komponenten des Auszahlungsprofils c sind also gegeben durch
cj = Sj − F.
Der im einführenden Beispiel angedeutete Ansatz zur Bewertung von Derivaten mit
Auszahlungsprofil c besteht nun darin, ein Portfolio θ zu finden, das die Gleichung
θD = c
löst, und den Preis c0 zum Zeitpunkt 0 als c0 = θq zu definieren. Dabei kann es u.U.
passieren, dass es ein derartiges Portfolio nicht gibt oder dass das Portfolio nicht
eindeutig bestimmt ist. Existiert zu jedem Vektor c ∈ Rn eine Lösung θ der Gleichung θD = c, so heißt das Modell vollständig. Wichtig ist zudem die Erkenntnis,
dass in einem sinnvollen Markt gilt „Kein Gewinn ohne Risiko“. Die mathematische
Charakterisierung dieses Prinzips wird in der folgenden Definition gegeben.
Definition 5.5. Eine Handelsstrategie θ heißt Arbitrage, falls θq < 0 und θD ≥ 0
(alle Koordinaten nichtnegativ); oder falls θq = 0 und θD > 0 (alle Koordinaten
nichtnegativ und mindestens eine positiv). Ein Modell, in dem es keine Arbitrage
gibt, heißt arbitragefrei.
Im ersten Fall wird direkt zu Beginn ein Gewinn realisiert (θq < 0), und auch später
(θD ≥ 0) bestehen keine Zahlungsverpflichtungen, es ist eventuell sogar ein Gewinn
möglich. Im zweiten Fall kostet das Portfolio anfangs nichts (θq = 0), und auch zum
Zeitpunkt 1 bestehen keine Zahlungsverpflichtungen, es besteht sogar die Chance
auf einen positiven Gewinn (θD > 0).
Äquivalent zu Definition 5.5 kann eine Arbitragegelegenheit auch als ein Portfolio
θ ∈ Rn definiert werden, für das gilt
(−θq, θD) > 0. (alle Koordinaten nichtnegativ, mindestens eine positiv)
5.2 Einperioden-Modelle
63
Eine Arbitrage sollte in einem Markt nicht existieren.
Alle möglichen θ durchzuprobieren, kann sehr aufwendig sein. Wir werden jedoch
ein äquivalentes Kriterium für die Arbitragefreiheit beweisen. Die eine Richtung ist
Gegenstand des folgenden Satzes.
Satz 5.1. Es gibt keine Arbitrage, wenn ein Vektor ψ = (ψ1 , . . . , ψs )> mit positiven
Koordinaten existiert, so dass q = Dψ.
Beweis. Aus Dψ = q folgt
s
X
θq = θDψ =
(θD)j ψj .
j=1
Ist θD > 0, d.h. alle Koordinaten (θD)j , j = 1, . . . , s, sind nichtnegativ und eine
davon, sagen wir (θD)j0 positiv, so folgt θq > 0 mittels der Positivität der Komponenten ψj . Ist dagegen θD ≥ 0, d.h. alle Komponenten (θD)j sind nichtnegativ, so
erhalten wir entsprechend θq ≥ 0. Es kann also keine Arbitrage existieren.
Die Rückrichtung ist schwieriger zu beweisen und erfordert einen technischen Hilfssatz, den ich ohne Beweis angeben möchte.
Satz 5.2 (Trennungssatz). Sei K eine kompakte und konvexe Teilmenge des Rn
und sei V ein Untervektorraum des Rn . Wenn V und K disjunkt sind, so gibt es ein
x0 ∈ Rn mit folgenden Eigenschaften:
1. x>
0 x > 0 für alle x ∈ K.
2. x>
0 x = 0 für alle x ∈ V .
Daher ist der Unterraum V in einer Hyperebene enthalten, die K nicht schneidet.
Satz 5.3. Wenn es keine Arbitrage gibt, dann existiert ein Vektor ψ = (ψ1 , . . . , ψs )>
mit positiven Koordinaten, so dass q = Dψ.
Beweis. Aufgrund der Arbitragefreiheit gibt es kein θ ∈ Rn mit
L(θ) = (−θq, θD) > 0.
Die Abbildung L : Rn → Rs+1 ist linear, so dass die Menge L(Rn ) = {L(h) : h ∈ Rn }
ein Untervektorraum des Rs+1 ist, der den positiven Quadranten {x ∈ Rs+1 : x >
0} nicht schneidet. Insbesondere schneidet L(Rn ) nicht die kompakte und konvexe
Menge M = {x ∈ Rs+1 : x > 0, x0 + · · · + xs = 1}. Also folgt aus Satz 5.2 die
Existenz eines φ ∈ Rs+1 mit φ> x = 0 für alle x ∈ L(Rn ) und φ> x > 0 für alle
x ∈ M . Wählen wir für x die Einheitsvektoren ej , j = 0, . . . , s, so folgt, dass φ
ausschließlich positive Koordinaten besitzt.
>
s
Wir schreiben nun φ = (φ0 , φ>
1 ) mit φ ∈ R und φ1 ∈ R . Damit erhalten wir
>
0 = φ> L(h) = (φ0 , φ>
1 )(−θq, θD) = −φ0 (θq) + θDφ1 ,
also θq = θD φφ01 . Mit ψ = φφ01 gilt ψ ∈ Rs mit ψj > 0 für alle j = 1, . . . , s und
θq = θDψ für alle θ ∈ Rn . Daraus folgt q = Dψ.
64
5 DIE MATHEMATIK DER FINANZMÄRKTE
Beispiel 5.2. Wir betrachten den Markt mit
1
1, 02 1, 02
q=
und D =
10
12
9
aus Beispiel 5.1. Das Gleichungssystem
1, 02 1, 02
ψ1
1
=
12
9
ψ2
10
besitzt die eindeutig bestimmte Lösung
0, 392
ψ=
.
0, 588
Nach Satz 5.1 ist der Markt also arbitragefrei.
In einem arbitragefreien Markt lässt sich eine einfache und vom Portfolio unabhängige Formel für den Preis eines Aktivs mit Auszahlungsprofil c herleiten.
Proposition 5.4. In einem arbitragefreienP
Markt ist der Preis c0 eines Finanzprodukts mit Auszahlungsprofil c durch cψ = sj=1 cj ψj gegeben, wobei ψ den Vektor
aus den Sätzen 5.1 und 5.3 bezeichnet.
Beweis. In einem arbitragefreien Markt gibt es nach Satz 5.3 einen Vektor ψ =
(ψ1 , . . . , ψs )> mit positiven Koordinaten, so dass q = Dψ. Mit c = θD gilt dann
c0 = θq = θDψ =
s
X
(θD)j ψj =
j=1
s
X
cj ψj = cψ.
j=1
Beispiel 5.3. Wir betrachten wieder den Markt aus Beispiel 5.1. Nach Beispiel 5.2
ist der Markt arbitragefrei, da
0, 392
ψ=
0, 588
die Gleichung Dψ = q löst. In diesem Markt betrachten wir eine Call-Option auf
die Aktie mit Basispreis 11. Das Auszahlungsprofil dieser Option lautet
1
+
c = (S − K) =
.
0
Zu bestimmen ist der Preis c0 der Option. Nach dem bisherigen Verfahren berechnen
wir zunächst ein replizierendes Portfolio θ als Lösung des Gleichungssystems θD = c.
Als Lösung erhalten wir
θ = (−2, 941; 0, 3333).
Als Preis c0 der Option ergibt sich somit
c0 = θq = θ1 + 10θ2 = −2, 941 + 3, 333 = 0, 392.
Proposition 5.4 liefert das gleiche Resultat c0 = cψ = 0, 392.
Für eine Put-Option mit Basispreis 10,5 lautet das zugehörige Auszahlungsprofil
0
+
c = (K − S) =
.
1, 5
Mit Hilfe von Proposition 5.4 berechnen wir den Preis
c0 = cψ = 1, 5 · 0, 588 = 0, 882.
5.3 Binomialmodelle
5.3
65
Binomialmodelle
Wir betrachten zunächst ein Einperioden-Modell mit einem risikolosen Aktiv, dessen
Wert zum Zeitpunkt t = 0 durch B0 gegeben sei, und eine Aktie, deren Startwert
mit S0 bezeichnet werde. Der risikolose Aktiv werde mit r% verzinst, d.h. zur Zeit
t = 1 (also nach der Periode) hat der risikolose Aktiv den Wert B1 = (1 + r)B0 .
Weiter wird angenommen, dass sich der Wert der Aktie mit Wahrscheinlichkeit
p zu uS0 und mit Wahrscheinlichkeit 1 − p zu dS0 mit u > d > 0 ändert. Ein
solches Modell heißt (Einperioden-)Bimomialmodell. Wir wollen das Modell auf
Arbitragefreiheit untersuchen. Nach Satz 5.1 und Satz 5.3 ist das Modell genau
dann arbitragefrei, wenn das Gleichungssystem Dψ = q eine Lösung mit positiven
Komponenten besitzt. Im speziellen Fall hat das Gleichungssystem die Form
(1 + r)B0 (1 + r)B0
ψ1
B0
=
.
uS0
dS0
ψ2
S0
Nach Division der ersten Gleichung durch B0 und der zweiten Gleichung durch S0
ist das Gleichungssystem äquivalent zu
1+r 1+r
ψ1
1
=
.
u
d
ψ2
1
Daraus folgt
1 = (1 + r)(ψ1 + ψ2 )
1 = uψ1 + dψ2 .
Dieses Gleichungssystem besitzt die Lösung ψ mit Komponenten
ψ1 =
1 (1 + r) − d
1+r u−d
und
1 u − (1 + r)
.
1+r u−d
Die Komponenten des Vektors ψ hängen somit nicht von den Anfangskursen B0 und
S0 ab. Die Komponenten sind genau dann positiv und das Modell somit arbitragefrei,
wenn
d < 1 + r < u.
ψ2 =
Mit q =
(1+r)−d
u−d
und 1 − q =
u−(1+r)
u−d
lässt sich ψ schreiben als
1
ψ=
1+r
q
.
1−q
Dieses Modell lässt sich auf mehrere Perioden erweitern. Der Wert des risikolosen
Aktivs ändert sich ausgehend vom B0 zum Startzeitpunkt t = 0 gemäß Bt+1 =
(1 + r)Bt . Der Wert der Aktie startet zum Zeitpunkt t = 0 bei S0 . Besitzt die
Aktie zum Zeitpunkt t den Wert St , so ändert sich der Wert beim Übergang zum
Zeitpunkt t + 1 auf uSt oder auf dSt . Den Pfad nach uSt gewichten wir mit dem
Faktor q, den Pfad nach dSt mit dem Faktor q 0 = 1 − q. Auch hier gelte d < u. Jeder
Zustand zu einem Zeitpunkt t spaltet sich also in zwei Zustände zum Zeitpunkt t + 1
66
5 DIE MATHEMATIK DER FINANZMÄRKTE
auf. Grafisch verzweigen sich die Zustände wie in einem Baum, weshalb man auch
von einem Binomialbaum-Modell spricht. Nach n Perioden beinhaltet das Modell
2n mögliche Pfade. In unserem Modell ist es unerheblich, ob sich der Wert der
Aktie erst auf uS0 und dann auf dS1 = duS0 ändert oder erst auf dS0 und dann auf
uS1 = udS0 . Obwohl es sich also formal um verschiedene Pfade handelt, stimmen die
Werte schließlich überein. Nach n Perioden kann die Aktie also nur n+1 verschiedene
Werte haben, nämlich
Snj = un−j dj S0 ,
für j = 0, . . . , n. Zu dem Wert Snj gelangt man durch n − j Aufwärts- und durch j
1
n−j
(1−
Abwärtsbewegungen. Jeder Pfad, der zu diesem Ergebnis führt, ist mit (1+r)
nq
n
q)j gewichtet. Insgesamt existieren j derartige Pfade. Unter Berücksichtigung der
Gewichte ergibt sich als Preis für ein Finanzprodukt mit Auszahlungsprofil f (Sn ) =
(f (Sn0 ), . . . , f (Snn ))> der Wert
n X
1
n n−j
c0 =
q (1 − q)j f (un−j dj S0 ).
n
(1 + r) j=0 j
Für eine Call-Option mit f (x) = (x − K)+ folgt
n X
1
n n−j
c0 =
q (1 − q)j (un−j dj S0 − K)+
n
(1 + r) j=0 j
j0 X
n n−j
1
=
q (1 − q)j (un−j dj S0 − K)
n
(1 + r) j=0 j
j0 j0 n−j j
X
X
K
n n−j
n n−j
d
j u
−
= S0
q (1 − q)j ,
q (1 − q)
n
n
(1
+
r)
(1
+
r)
j
j
j=0
j=0
wobei j0 die größte natürliche Zahl ≤ n mit der Eigenschaft f (Snj ) = un−j dj S0 −K >
qu
, so lässt sich dies schreiben als
0 sei. Setzen wir q 0 = 1+r
j0 j0 X
X
n
K
n n−j
0 n−j
0 j
c0 = S0
(q ) (1 − q ) −
q (1 − q)j .
n
j
(1
+
r)
j
j=0
j=0
Mit der Verteilungsfunktion
Bn,p (k) =
k X
n
j=0
j
pj (1 − p)n−j
ergibt sich schließlich
c0 = S0 Bn,1−q0 (j0 ) −
K
Bn,1−q (j0 ).
(1 + r)n
Für eine Put-Option erhalten wir auf ähnliche Weise
c0 =
K
Bn,q (k0 ) − S0 Bn,q0 (k0 ).
(1 + r)n
Für einen Forward errechnen wir den Preis
c0 = S0 −
F
.
(1 + r)n
5.4 Das Black-Scholes-Modell
5.4
67
Das Black-Scholes-Modell
Der Börsenkurs einer Aktie fluktuiert sehr stark. Betrachten wir das Binomialmodell
aus dem letzten Abschnitt, so geschieht dies auch, wenn wir sehr viele Handelszeitpunkte in einer Sekunde zulassen. In einer Sekunde sehen wir dann so etwas wie den
durchschnittlichen Anstieg der Aktie in der Sekunde. Aufgrund des zentralen Grenzwertsatzes der Stochastik ist der Anstieg einer Aktie annähernd normalverteilt. Dies
hat Bachelier 1900 dazu veranlasst, die Zuwächse unabhängig und normalverteilt zu
modellieren. Etwa 1905 hat Albert Einstein diesen Prozess auch in der Physik eingeführt. Zu Ehren des Botanikers Robert Brown, der 1828 die zufällige Bewegung von
Pollen in Wasser beobachtete, wurde der Prozess Brownsche Bewegung genannt.
Bezeichne Wt den Wert der Brownschen Bewegung zur Zeit t. Man definiert diese
so, dass W0 = 0 und für s < t der Zuwachs Wt − Ws normalverteilt mit Mittelwert
0 und Varianz t − s ist, unabhängig von den vergangenen Werten Wu , u < s. Erst
einige Jahre nach der Einführung von Brownschen Bewegungen gelang es Norbert
Wiener 1923, die Existenz der Brownschen Bewegung im wahrscheinlichkeitstheoretischen Sinn nachzuweisen. Die Brownsche Bewegung nutzend modellierte Bachelier
den Preis einer Aktie durch St = S0 + µt + σWt . Der Faktor µ wird auch Trend und
der Faktor σ Volatilität genannt.
Die Brownsche Bewegung hat zwei Nachteile: Sie wird mit positiver Wahrscheinlichkeit negativ, und Preisänderungen St − Ss hängen nicht von der Größe von Ss ab.
In Wirklichkeit aber beobachtet man stärkere Änderungen, wenn der Preis hoch ist,
als wenn er tief ist. Daher sollten die relativen Preisänderungen ähnlich sein und
nicht die absoluten. Paul Samuelson hat aus diesem Grund Log-Preise betrachtet,
ln St = ln S0 + µt + σWt .
Dieses Modell wurde auch von Fisher Black, Myron Scholes und Robert Merton
betrachtet. Der Wert einer Aktie wird in ihm durch St = S0 eµt+σWt und der Wert
einer risikolosen Anlage durch Bt = B0 ert modelliert. Die grundlegende Idee war,
keine-Arbitrage-Argumente zur Berechnung des Werts einer Option anzuwenden.
Nehmen wir also an, wir besitzen eine Option, deren Wert zur Zeit t sich durch
eine Formel f (St , t) ausdrücken lässt. Die Funktion f (x, t) sei partiell nach x und t
differenzierbar gemäß Definition 3.5. In einem kleinen Zeitintervall ∆t ändert sich
der Wert der Aktie um ∆x = St+∆t − St . Der Wert der Option ändert sich dann um
∆f (St , t) ≈
∂f
∂f
(St , t)∆x +
(St , t)∆t.
∂x
∂t
Wenn wir also ∂f
(St , t) in die Aktie investieren und den Betrag ∂f
(St , t) in den
∂x
∂t
risikolosen Aktiv, so ändert sich der Wert unseres Portfolios genau so, wie sich der
Wert der Option ändert. Die Strategie funktioniert jedoch nur, wenn
∂f
∂f
(St , t)St +
(St , t)Bt = f (St , t),
∂x
∂t
also wenn der Wert des gewählten Portfolios mit dem Wert der Option übereinstimmt.
Wir nehmen an, dies sei nicht der Fall. Ist
f (St , t) >
∂f
∂f
(St , t)St +
(St , t)Bt ,
∂x
∂t
68
5 DIE MATHEMATIK DER FINANZMÄRKTE
so kauft man, so lange die Bedingung erfüllt ist, das Absicherungsportfolio und
verkauft eine Option. Dann bleibt etwas Geld übrig, das man dann in den risikolosen
Aktiv investieren kann. Im Moment, wo das Gleichheitszeichen auftritt, verkauft man
das Portfolio und kauft sich eine Option. Mit der Option kann man die verkaufte
Option abdecken. Aber man hat zusätzlich immer noch den Überschuss, den man
am Anfang erwirtschaftet hatte. Also hat man einen risikolosen Gewinn erzielt. Das
kann jedoch aufgrund der Arbitragefreiheit nicht sein.
Ist
∂f
∂f
(St , t)St +
(St , t)Bt ,
f (St , t) <
∂x
∂t
so kauft man eine Option und macht Leerverkäufe der Aktiven. Auf diese Weise
erzielt man wieder einen risikolosen Gewinn. Folglich muss der Wert der Option
gleich dem Wert des Portfolios sein.
Mit Hilfe der stochastischen Analysis kann man den Preis der Option berechnen. Der
gleiche Preis ergibt sich auch als Grenzwert der Formel im Binomialbaummodell.
Satz 5.5 (Black-Scholes-Formel). Die Preisformeln für (europäische) Call- und PutOptionen im Binomialbaummodell konvergieren für n → ∞ gegen die Black-ScholesFormeln
C = S0 Φ(d+ ) − e−rc T KΦ(d− )
P = e−rc T KΦ(−d− ) − S0 Φ(−d+ ),
wobei rc = ln(1 + r),
d± =
und
ln
S0
K
+ rc ±
√
σ T
σ2
2
T
Z z
1
2
e−y /2 dy
Φ(z) = √
2π −∞
die sog. Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung ist.
LITERATUR
69
Literatur
[AW05] Adelmeyer, M., Warmuth, E., 2005. Finanzmathematik für Einsteiger: Von
Anleihen über Aktien bis Optionen, Vieweg Verlag, 2. Auflage.
[AB08] Aigner, M., Behrends, E., 2008. Alles Mathematik: Von Pythagoras zum
CD-Player, Verlag Vieweg+Teubner
[BGZ08] Behrends, E., Gritzmann, P., Ziegler, G. M. (Hrsg.), 2008. Pi und Co.:
Kaleidoskop der Mathematik, Springer-Verlag.
[Ben08] Benson, D., 2008. Music: A Mathematical Offering, Cambridge University
Press.
[BP95] Beutelspacher, A., Petri, B., 1995. Der goldene Schnitt, Spektrum-Verlag,
2. Auflage.
[BZ11] Beutelspacher, A., Zschiegner, M.-A., 2011. Diskrete Mathematik für
Einsteiger: mit Anwendungen in Technik und Informatik, Verlag Vieweg+Teubner, 4. Auflage.
[Dau09] Daume, P. 2009. Finanzmathematik im Unterricht: Aktien und Optionen: Mathematische und didaktische Grundlagen mit Unterrichtmaterialien, Verlag Vieweg+Teubner.
[Gla14] Glaeser, G., 2014. Der mathematische Werkzeugkasten: Anwendungen in
Natur und Technik, Springer Verlag, 4. Auflage.
[GB05] Gritzmann, P., Brandenberg, R., 2005. Das Geheimnis des kürzesten Weges:
Ein mathematisches Abenteuer, Springer, 3. Auflage.
[Her14] Herrmann, N., 2014. Mathematik und Gott und die Welt, Springer Spektrum.
[Kre11] Kremer, J., 2011. Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung
von Derivaten, Springer, 2. Auflage.
[MM11] Meinel, Ch., Mundhenk, M., 2011. Mathematische Grundlagen der Informatik: Mathematisches Denken und Beweisen. Eine Einführung, SpringerVerlag.
[Nit09] Nitzsche, M., 2009. Graphen für Einsteiger: Rund um das Haus vom Nikolaus, Vieweg + Teubner, 3. Auflage.
[Rei11] Reimer, M., 2011. Der Klang als Formel: Ein mathematisch-musikalischer
Streifzug, Oldenbourg Verlag, 2. Auflage.
[Sch12] Schüffler, K., 2012. Pythagoras, der Quintenwolf und das Komma, Vieweg+Teubner Verlag.
[War06] Warlich, L., 2006. Grundlagen der Mathematik für Studium und Lehramt,
AULA-Verlag GmbH.
[Zie13] Ziegler, G. M., 2013. Mathematik – Das ist doch keine Kunst, Knaus-Verlag.