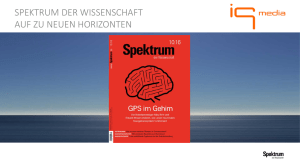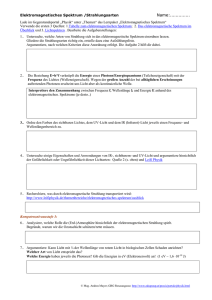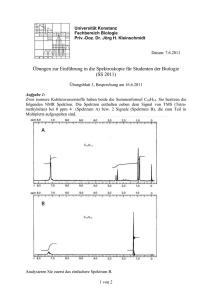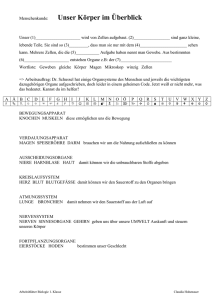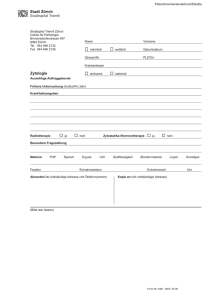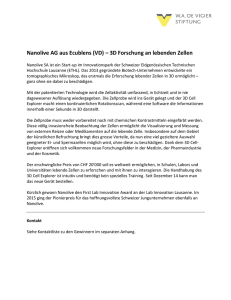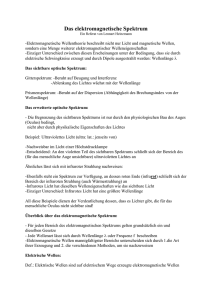Spektrum der Wissenschaft 2010 03
Werbung

ESSAY Die Würde des Menschen ist antastbar! MÄRZ 2010 MOR PHO GENE SE ME TROLO GIE A RCH ÄOLO GIE Wie entwickeln Lebewesen ihre Form? Die Zukunft der physikalischen Einheiten 7000 Jahre alte Basttaschen und Schnüre Geschwister der Sonne Unser Heimatstern entstand inmitten explodierender Himmelskörper 7 ,40 € (D/A) · 8,– € (L) · 14,– sFr. D6179E 03/10 DEUTSCHE AUSGABE DES EDITORIAL Reinhard Breuer Chefredakteur Rettung aus der Retorte ? SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · MÄRZ 2010 als Haut- und Knorpelstücke haben die Bioingenieure auch nach Jahrzehnten intensiver Laborforschung nicht auf den Markt gebracht. Das ist enttäuschend, vor allem für jene, die dringend auf ein Ersatzorgan warten. Eines der Probleme ist offenbar die Zucht künstlicher Blutge­ fäße für Gewebe, die mehr Energie ver­ brauchen als die Haut und deshalb über Adern versorgt werden müssen. Drei Pioniere des Tissue Engineering schildern in dieser Ausgabe den Stand der Dinge und eine Perspektive, die immerhin zu vorsichtiger Hoffnung Anlass gibt (S. 88). Bioethische Debatten haben das Land in den letzten Jahren immer wieder erschüt­ tert, zumal bei neuen Gesetzgebungs­ verfahren – ob zu Genetik, Embryonen­ schutz, Stammzellen oder Sterbehilfe. Häufig wird dabei die »Würde des Men­ schen« ins Feld geführt, was auf den ersten Blick einleuchtet und oft die Debat­ te beendet. Doch ist dieses Argument immer ehrlich und stichhaltig? Oder handelt es sich manchmal um eine vorge­ schobene Leerformel, die als Totschlag­ argument genutzt wird? Der Bioethiker Edgar Dahl geht dieser Frage in unserem Essay nach. Nach seiner provokanten Meinung hat der Begriff der Menschenwür­ de in der bioethischen Diskussion einfach »nichts verloren« (S. 70). mit frdl. Gen. von Edgar Dahl Seit geraumer Zeit trage ich einen Organspendeausweis bei mir. Das ist eine Not­ hilfe im Dienst am Nächsten. Und ich wäre glücklich, wenn dadurch vielleicht einmal einem Unbekannten in lebensbedrohlicher Situation geholfen werden könnte. Damit zähle ich laut Statistik zu den 14,6 Men­ schen pro eine Million Bundesbürger, die für den Fall ihres Todes einer Organspende zugestimmt haben. Das ist viel zu wenig, und daher läuft hier auch permanent ein stilles Drama ab. Jährlich werden in Deutschland knapp 4700 Organe (Stand 2008) transplantiert, nach ihrer Häufigkeit hauptsächlich Niere und Leber, gefolgt von Herz, Bauchspei­ cheldrüse und Lunge. Dazu kommen allerlei Gewebe, von der Augenhornhaut über Knorpel bis zu Darmteilen. Doch dem stehen aktuell 12 000 Patienten gegen­ über, die dringend auf ein Spenderorgan warten. Da ist es kein Wunder, dass nicht wenige von ihnen sterben, bevor ihnen Hilfe zuteilwerden kann. Die zögerliche Haltung vieler Menschen zu Organspenden kann man nachvollzie­ hen, auch wenn mir manche Befürchtungen irrational und unangebracht erscheinen. Aber trotz Aufklärung wird sich an diesem Missstand, schätze ich, so rasch nichts ändern. Umso bedeutender sind alterna­ tive Wege, die das Übel zumindest tenden­ ziell lindern können. Ich spreche vom Organ­ersatz »aus der Retorte«. Mensch­ liche Gewebe künstlich zu erzeugen, ist ein Traum der Biotechnologen. Doch mehr Der Bioethiker Edgar Dahl fordert ehrliche Debatten ohne Totschlagargumente. Herzlich Ihr 3 Inhalt 44 medizin & biologie Neues vom Ursprung des Lebens mensch & geist Bast und Schnüre aus der Jungsteinzeit 62 34 astronomie & physik Nur noch mit Naturkonstanten: die physikalischen Einheiten der Zukunft aktuell 12Spektrogramm astronomie & physik medizin & biologie Schlichting! 44Wie das Leben entstand 25Wie aus dem Nichts geschöpft Dank einer menschlichen »Leinwand« wird ein Puzzle aus Spiegelungen durchschaubar Wächter der Weiblichkeit · Exoplanet mit kochendem Ozean · Vogelsaurier mit Giftzähnen · Bruchfestes Sandwich · Gut organisierte Frühmenschen u. a. 15Bild des Monats Feuerwerk der Gene 16Vierzig Tage in der Wasserwüste 26 r Die Suche nach den Geschwistern der Sonne Suche nach Leben unter Extrem­ bedingungen im Meeresboden 18Gelähmte Abwehr Ein Protein des Aidserregers macht Immunzellen bewegungsunfähig TITEL Geburtsort unseres Zentralgestirns war ein Sternhaufen. Seine ehema­ ligen Mitglieder vermuten Forscher nun ganz in der Nähe Für immer mehr der noch ungeklärten Schritte auf dem Weg zu den ersten Lebewesen finden sich plausible bioche­ mische Mechanismen 52r Embryonalentwicklung – mathematisch modelliert Die Eigenschaften der Stoffe, welche die Entwicklung vom Ei zum vollständigen Organismus steuern, lassen sich durch Computersimulationen bestimmen, bevor die Stoffe selbst bekannt sind 20Heilende Textilien Wie Kleidungsstücke als Depot für Medikamente dienen können 22Kopenhagen – quo vadis? Kommentar zum Scheitern des Klimagipfels 24Springers Einwürfe Schluss mit der Klimakatastrophe! 34r Die Zukunft von Kilogramm und Co. Immer höhere Anforderungen an die Präzision der Messtechnik verlangen neue Standards. Das internationale System physikalischer Einheiten der Zukunft wird deshalb nur noch anhand von Naturkonstanten definiert sein Titelmotiv: Ron Miller Die auf der Titelseite angekündigten Themen sind markierten Artikel mit r gekennzeichnet; die mit finden Sie auch in einer Audioausgabe dieses Magazins, zu beziehen unter: www.spektrum.de/audio 70 mensch & geist Menschenwürde in der Bioethik 88 Titel Geschwister der Sonne 26 technik & computer Organersatz aus der Retorte mensch & geist erde & umwelt technik & computer 62r Steinzeit jenseits der Steine Porträt Wissenschaft im Alltag 78Spurenleser im Klimalabyrinth 86Auf den Punkt gehört Hölzer, Bast und Rindenpech aus der Jungsteinzeit, in Brunnen entdeckt, beleuchten den Alltag vor 7000 Jahren Essay 70r Die Würde des Menschen ist antastbar! Der Klimaforscher Gerald Haug gewinnt aus dem Studium einstiger Klimaände­ rungen Erkenntnisse von hoher Brisanz für die Zukunft der Menschheit 88Tissue Engineering – Gewebezucht im Labor Einfachere biologische Strukturen aus der Retorte sind schon klinisch im Einsatz. Ein nächster großer Schritt wird sein, größere Züchtungen mit Blutge­ fäßen zu versehen Edgar Dahl begründet, warum der Begriff der Menschenwürde in bioethi­ schen Debatten nichts zu suchen hat Mathematische Unterhaltungen Wissenschaft & KArriere 74Das optimale Straßennetz Der Punkt, von dem aus die Summe der Entfernungen zu den Ecken eines Drei­ ecks minimal ist, hat interessante Eigen­ schaften – physikalisch wie geometrisch Richtlautsprecher können Informationen gezielt übertragen Seite 104 102Damit der Fan seine Schokolade wiedererkennt Interview mit dem Lebensmitteltechno­ logen Günther Fischer über die Kunst, neue Schokoladensorten zu entwickeln Weitere Rubriken 3Editorial: Rettung aus der Retorte? 6Onlineangebote 8Leserbriefe/Impressum 85Im Rückblick 106Vorschau 98Rezensionen: J . Elphick (Hg.) Atlas des Vogelzugs – Die Wanderung der Vögel auf unserer Erde C. Drösser Hast Du Töne? – Warum wir alle musikalisch sind H. Dambeck Numerator – Mathematik für jeden Wiley-VHC Orbit Molekülbaukasten Chemie Online fotolia / Laurence Gough Ronald C. James, aus: Ronald G. Garraher und Jacqueline B. Thurston, Optical illusions and the visual Arts, 1966 Dies alles und vieles mehr finden Sie in diesem Monat auf www.spektrum.de. Lesen Sie zusätzliche Artikel, diskutieren Sie mit und ­stöbern Sie im Heftarchiv! spektrumdirekt Was kommt nach dem Öl? www.spektrumdirekt.de/energie tipps Formen sehen, wo keine sind www.spektrum.de/artikel/1020817 Tipps Interaktiv Was kommt nach dem Öl? Formen sehen, wo keine sind Die Frage nach der Energie der Zukunft oder dem richtigen Energiemix ist noch längst nicht beantwortet. spektrumdirekt berichtet unter anderem über Designerbakterien, die Biodiesel herstellen, Chancen der geothermischen »Energie aus dem Untergrund« sowie eine Solarzelle aus Glas­fasern und Nanoröhrchen Experimentatoren ist es ein Leichtes, ihre Versuchspersonen dem Gefühl eines teilweisen Kontrollverlustes auszusetzen. Diese beginnen dann, Bedeutungsvolles auch dort wahrzunehmen, wo nur der Zufall herrscht. »Scientific American«-Kolumnist Michael Shermer über eine »Science«-Studie, die zeigt, wie Aberglaube und Verschwörungstheorien gedeihen können Wunschartikel – 14. Runde: »Der Glücksfall als Programm« Nur einen Klick entfernt Machen Sie mit! Die Wissenschaftszeitung im Internet www.spektrumdirekt.de/energie www.spektrum.de/artikel/1020817 Aufstieg und Niedergang Tod auf dem Dach der Welt Derzeit läuft wohl die sechste große ­Aussterbewelle der Erdgeschichte über den Planeten. Was bedroht die Tier- und ­Pflanzenarten? Und wie können sie gerettet werden? Fünf neue Bücher, vorgestellt vom SpektrumSchwestermagazin epoc, berichten unter an­derem über das rätselhafte Ende des Bergsteigers George Mallory auf dem Mount Everest, zeichnen die Entstehungsgeschichte der Bibel nach und stellen Pioniere der Archäologie vor www.spektrumdirekt.de/artenvielfalt Weit über 800 Leserinnen und Leser haben sich an unserer 14. Wunschartikelrunde beteiligt und überraschend einige unserer eigenen Favoriten auf die Plätze verwiesen. Hier stellt Spektrum-Chefredakteur Reinhard Breuer die Ergebnisse vor; Ihren Wunschartikel veröffentlichen wir in der Aprilausgabe www.spektrum.de/artikel/1015414 www.epoc.de/artikel/1019641 Alle Publikationen unseres Verlags sind im Handel, im Internet oder direkt über den Verlag erhältlich FReigeschaltet »Geheimgang zum Gehirn« www.gehirn-und-geist.de/artikel/1018714 Hamburger Sternwarte Spektrum in den sozialen Netzwerken Für Abonnenten »Ein Hamburger Auge in Mexiko« Für Abonnenten Ihr monatlicher Plus-Artikel zum Download »Ein Hamburger Auge in Mexiko« Jahrelang ist das »Hamburg Robotic Telescope« getestet worden, nun reist das 1,2-­Meter-Instrument zur Sternwarte der mexikanischen Universidad de Guanajuato. Hier sollen spektroskopische Langzeitüber­ wachungen unter günstigen astronomischen Bedingungen neue Einblicke in die magnetische Aktivität von Sternen erlauben Dieser Artikel ist für Abonnenten frei zugänglich unter www.spektrum-plus.de www.spektrum-plus.de www.spektrum.de/studivz www.spektrum.de/facebook www.spektrum.de/twitter Freigeschaltet Ausgewählte Artikel aus epoc und Gehirn&Geist kostenlos online lesen »Die Rettung des Königreichs der Himmel« Kaum etwas hat die Beziehungen zwischen Christen und Muslimen so nachhaltig belastet wie die Kreuzzüge ins Heilige Land. Den zahlreichen Motiven für die kriegerischen Unternehmungen geht der britische Religionswissenschaftler John Bowker auf den Grund Diesen Artikel finden Sie als KOSTENLOSE Leseprobe von epoc unter www.epoc.de/artikel/1019621 »Geheimgang zum Gehirn« www.spektrum.com [email protected] Telefon 06221 9126-743 Eine Behandlung mit Stammzellen verheißt Heilung für viele neurologische Krankheiten. Doch wie befördert man sie durch die BlutHirn-Schranke? Vielleicht ist das gar nicht nötig, sagen die Mediziner Lusine Danielyan, Christoph Gleiter und Felix Bernhard. Sie erforschen eine Alternativroute ins Gehirn, die von der Nase über den Riechnerv führt Diesen Artikel finden Sie als kostenlose Leseprobe von gehirn&geist unter www.gehirn-und-geist.de/artikel/1018714 Die Wissenschaftsblogs Mit Verstand und Hammer Nein, es war kein Nanothermit-Sprengstoff, der 2001 die Türme des World Trade Center zum Einsturz brachte. Eine 2009 veröffentlichte Studie, die genau dies andeutet, wird von Gunnar Ries nun regelrecht seziert. »Mente et malleo«, mit Verstand und Hammer, so hat der neue WissensLogger vom Geologisch-Paläontologischen Institut und Museum der Universität Hamburg angekündigt, will er die Erde erkunden, und nimmt künftig auch seine Leser mit in die Welt der Mineralogie und Geologie. Derweil sinniert ein Mathematiker (»Mathematik im Alltag«) über die Frage, wie dicht sich Tetraeder packen lassen, eine Physikerin (»Zündspannung«) hält uns über ein Plasmakristall-Experiment auf der ISS auf dem Laufenden, und ein Chemiker (»Fischblog«) berichtet über den Vormarsch neuartiger Pilzinfektionen www.wissenslogs.de leserbriefe Liberal in die Krise? Organisationsformen jenseits des Marktes – Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften, Forschung aktuell, Dezember 2009 Mit der Vergabe des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften an Elinor Ostrom hielt das Nobelkomitee respektvollen Abstand zur Thematik der Bankenkrise. Die Laureatin befasste sich schließlich mit dem Agrarbereich. Ich denke jedoch, dass die Finanzmisere bei der Nobelpreisentscheidung sehr wohl eine Rolle spielte. Es war liberales Gedankengut – der Verzicht auf staatliche Einmischung –, das zu der Krise führte. Noch ist sie nicht völlig überwunden, da geht die Finanz­ welt schon wieder zur Tagesordnung über. Es wird weiter spekuliert, die Boni sind immer noch unverschämt hoch. Offensichtlich soll alles beim Alten bleiben. Dazu passt der diesjährige Wirtschaftsnobelpreis an Elinor Ostrom, die wie ihr Mann Vincent klassischem liberalem Gedankengut zugeneigt ist. Zentrales Ergebnis ihrer Arbeiten ist, dass Kollektive Gemeingüter oft besser ohne staatliches Eingreifen verwalten. Nachgewiesen hat Ostrom dies jedoch nur für kleine, überschaubare Gruppen, deren Mitglieder sich in der Regel persönlich gekannt haben dürften. Das geht auch aus den von Ostrom aufgestellten Bedingungen für die erfolgreiche Selbstverwaltung hervor. So ist eine Mitwirkung aller Betroffenen nur bei kleinen Gruppen möglich (Bedingung 3). Um ihren Ansatz auf größere Gruppen auszudehnen, führt Ostrom die Unterteilung Chefredakteur: Dr. habil. Reinhard Breuer (v.i.S.d.P.) Stellvertretende Chefredakteure: Dr. Inge Hoefer (Sonderhefte), Dr. Gerhard Trageser Redaktion: Thilo Körkel (Online Coordinator), Dr. Klaus-Dieter Linsmeier, Dr. Christoph Pöppe, Dr. Adelheid Stahnke; E-Mail: [email protected] Ständiger Mitarbeiter: Dr. Michael Springer Schlussredaktion: Christina Meyberg (Ltg.), Sigrid Spies, Katharina Werle Bildredaktion: Alice Krüßmann (Ltg.), Anke Lingg, Gabriela Rabe Art Direction: Karsten Kramarczik Layout: Sibylle Franz, Oliver Gabriel, Marc Grove, Anke Heinzelmann, Claus Schäfer, Natalie Schäfer Redaktionsassistenz: Britta Feuerstein, Petra Mers Redaktionsanschrift: Postfach 10 48 40, 69038 Heidelberg, Tel. 06221 9126-711, Fax 06221 9126-729 Verlag: Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 10 48 40, 69038 Heidelberg; Hausanschrift: Slevogtstraße 3–5, 69126 Heidelberg, Tel. 06221 9126-600, Fax 06221 9126-751; Amtsgericht Mannheim, HRB 338114 Verlagsleiter: Dr. Carsten Könneker, Richard Zinken (Online) Geschäftsleitung: Markus Bossle, Thomas Bleck Herstellung: Natalie Schäfer, Tel. 06221 9126-733 Marketing: Annette Baumbusch (Ltg.), Tel. 06221 9126-741, E-Mail: [email protected] Einzelverkauf: Anke Walter (Ltg.), Tel. 06221 9126-744 Übersetzer: An diesem Heft wirkten mit: Dr. Markus Fischer, Dr. Rainer Kayser. und Bestellservice: Helga Emmerich, Sabine Häusser, LeserUte Park, Tel. 06221 9126-743, E-Mail: [email protected] 8 www.spektrum.de/leserbriefe in Verbände ein. Die hierarchische Erweiterung eines Kollektivs ist aber nicht trivial. Die Aufteilung muss organisiert werden. Oft spielen Interessen dabei eine Rolle. Falls eine solche Erweiterung trotzdem gelingt, kommt man bei etwa 30 Mitgliedern für ein überschaubares Kollektiv und 30 Verbänden aber auch nur auf 900 Individuen. Das ist nicht viel. Bei noch größeren Organisationen liefert Ostroms Arbeit keinen Grund, warum die Selbstverwaltung besser funktionieren sollte als die staatliche Lenkung. So ist nicht zu erwarten, dass die weltweite Ausbeutung von Umweltgütern durch eine freiwillige Übereinkunft zwischen denen, die sich daran bereichern, beendet wird. Roland Maier, Riemerling Darwins Zuchtwahl Haben schöne Eltern mehr Töchter? Februar 2010 Clevere Thermoskanne Vorsicht, heiß!, Wissenschaft im Alltag, Dezember 2009 Für den Temperaturbereich 0 °C bis 100 °C liegt die thermische Strahlung im Wellenlängenbereich 2 µm bis 100 µm (mittleres Infrarot). Praktisch alle Flüssigkeiten und Feststoffe sind dafür undurchsichtig, so dass Wärmestrahlung innerhalb des Gefäßes keine Rolle spielt. In der Flüssigkeit selbst wird Wärme durch Leitung und (freie) Konvektion transportiert, in der Wandung ausschließlich durch Wärmeleitung. Interessant wird es erst im gasgefüllten Hohlraum: Dort gibt es alle drei Phänomene. Soll der Hohlraum thermisch isolieren, verhindert ein ausreichend gutes Vakuum Leitung und Konvektion. Es bleibt der Strahlungsaustausch der einander gegenüber­ liegenden Hohlraumoberflächen. Um diesen zu verhindern, verspiegelt man sie beispielsweise mit Silber. Ganz ähnlich, wenn auch nicht evakuiert, funktionieren Isolierglasscheiben. Hier scheint die »Verspiegelung« auch noch durchsichtig! Doch nur für unsere Augen, der Wärmetransport findet, wie gesagt, im mittleren Infrarot statt. Die Frage, ob bestimmte Eigenschaften der Eltern das Geschlecht der Nachkommen beeinflussen, ist so dumm nicht, und schon Darwin hat sich hiermit in seinem Buch »Die Abstammung oder der Ursprung des Menschen« (8. Kapitel) im Zusammenhang mit der sexuellen Zuchtwahl beschäftigt. Er referiert ausführlich die ihm zugänglichen Geburtsregister von Menschen und Pferden, weiterhin Beobachtungen bei Hunden, Schafen, Rindern, Vögel, Fischen und Insekten. Rein statistisch müsste sich bei großen Zahlenreihen etwa ein Verhältnis von 1 : 1 ergeben, was aber offensichtlich nicht immer der Fall ist. Darwin selbst berichtet über die Beobachtung, dass uneheliche Kinder häufiger Mädchen sind, und führt dies zurück auf die größere Robustheit der Mädchen, welche die Risiken einer Stressschwangerschaft besser über­ Die des »multiplen Universums« Vertrieb Idee und Abonnementverwaltung: Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH, c/o ZENIT Pressevertrieb GmbH, verspricht viel und hält wenig. Die EinPostfach 81 06 80, 70523 Stuttgart, Tel. 0711 7252-192, Fax 0711 7252-366, E-Mail: [email protected], Vertretungsberechbeziehung des Messapparats in die quantigter: Uwe Bronn Bezugspreise: Einzelheft �€Beschreibung � 7,40/sFr. 14,00; im Abonnement � tentheoretische ist nahelie€� 79,20 für 12 Hefte; für Studenten (gegen Studiennachweis) gend und wurde von J. von Neu€�� 66,60. Die Preise beinhaltenschon �€� 7,20 Versandkosten. Bei Versand ins Ausland fallen €� 7,20 Portomehrkosten an. Zahlung sofort mann (1932)Konto: verfolgt. nach Rechungserhalt. Postbank Stuttgart 22 706 708 (BLZ 600 100 70). Die Mitglieder des Verbands Biologie, BiowissenDas resultierende Messproblem der schaften und Biomedizin in Deutschland (VBio) und von Mensa e. V. erhalten SdW zum Vorzugspreis. Quantentheorie besteht im Kern darin, Anzeigen: iq media marketing gmbh, Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH; Bereichsleitung Marianne Anzeigenleitung: dass die lineareAnzeigen: Struktur desDölz; Hilbertraums Jürgen Ochs, Tel. 0211 6188-358, Fax 0211 6188-400; verantwortlich für Anzeigen: Ute Wellmann,Möglichkeiten) Postfach 102663, 40017 mit (quantenmechanische Düsseldorf, Tel. 0211 887-2481, Fax 0211 887-2686 den eindeutigen jeder MesAnzeigenvertretung: Berlin: Ergebnissen Michael Seidel, Friedrichstraße 150, 10117 Berlin, Tel. 030 61686-144, Fax 030 61696-145; Hamburg: sung (klassische Fakten) nicht übereinMatthias Meißner, Brandstwiete 1 / 6. OG, 20457 Hamburg, Tel. 040 30183-210, Fax 040 30183-283; Düsseldorf: Hans-Joachim stimmt. Beier, Kasernenstraße 67, 40213 Düsseldorf, Tel. 0211 887-2053, Fax 0211 887-2099; Frankfurt: Thomas Eschersheimer Dieses Problem wirdWolter, man gerade Landbei straße 50, 60322 Frankfurt am Main, Tel. 069 2424-4507, Fax 069 2424-4555;Anwendung Stuttgart: Andreas Vester, Werastraße 23, universeller der Quantenthe70182 Stuttgart, Tel. 0711 22475-21, Fax 0711 22475-49; München: Jörg Bönsch, Straße 14, 80335 München, orie nicht los. Nymphenburger Zudem lassen sich alle AusTel. 089 545907-18, Fax 089 545907-24 sagen von an: »kopenhagenerisch« in »mulDruckunterlagen iq media marketing gmbh, Vermerk: tiversisch« übersetzen. Wer statt »Eine Möglichkeit wurde realisiert, und die anderen sind weggefallen« sagt: »Unser Universum hat sich geteilt, und wir sehen nur einen Zweig«, der liefert nicht mehr als ein fantasieanregendes Erklärungs­ placebo. Denn Universenteilung ist nicht leichter zu verstehen als Faktenentstehung. Schon gar nicht kann sie »aus den Gleichungen selbst« abgelesen werden. Letztlich werden hier einfach nicht realisierte Möglichkeiten mit fernen WirklichISSN 0170-2971 keiten verwechselt. SCIENTIFIC AMERICAN Mein hartes Fazit: Everetts Ansatz wur75 Varick Street, New York, NY 10013-1917 Editor nicht in Chief: Mariette DiChristina, Stevenignoriert, Inchcoombe, de damals zu President: Unrecht Vice President, Operations and Administration: Frances Newburg, Vice President,er Finance, Businesszu Development: Michael Florek, sondern wirdandheute Unrecht hofiert. Managing Director, Consumer Marketing: Christian Dorbandt, Vice and Publisher: Bruce Brandfon Helmut Fink, Nürnberg President Spektrum der Wissenschaft, Kasernenstraße 67, 40213 Düsseldorf, Tel. 0211 887-2387, Fax 0211 887-2686 Anzeigenpreise: Gültig ist die Preisliste Nr. 31 vom 01. 01. 2010. Gesamtherstellung: L.N. Schaffrath Druckmedien GmbH & Co. KG Marktweg 42 – 50, 47608 Geldern Franz Feldmeier, Rosenheim Sämtliche Nutzungsrechte an dem vorliegenden Werk liegen bei der Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH. Jegliche Nutzung des Werks, insbesondere die Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Wiedergabe oder öffentliche Zugänglichmachung, ist ohne die vorherige schriftliche Einwilligung des Verlags unzulässig. Jegliche unautorisierte Nutzung des Werks berechtigt den Verlag zum Schadensersatz gegen den oder die jeweiligen Nutzer. Bei jeder autorisierten (oder gesetzlich gestatteten) Nutzung des Werks ist die folgende Quellenangabe an branchenüblicher Stelle vorzunehmen: © 2010 (Autor), Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH, Heidelberg. Jegliche Nutzung ohne die Quellenangabe in der vorstehenden Form berechtigt die Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH zum Schadensersatz gegen den oder die jeweiligen Nutzer. Wir haben uns bemüht, sämtliche Rechteinhaber von Ab­bildungen zu ermitteln. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt. Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte und Bücher übernimmt die Redaktion keine Haftung; sie behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen. Erhältlich im Zeitschriften- und Bahnhofs­ SPEKTRUM DER · März 2010 buchhandel undWISSENSCHAFT beim Pressefachhändler mit diesem Zeichen. Spektrum der Wissenschaft / Meganim Thermoskanne mit Silberbeschichtung Trinkbehälter Außengefäßwand (z. B. Kunststoff) Wärmetransport durch Konvektion Wärmeleitung Wärmestrahlung Wärmeleitung Glasgefäß mit Silberbeschichtung Wärmestrahlung Vakuum heißes Getränk heißes Getränk Eine Thermoskanne hält Flüssigkeiten lange heiß beziehungsweise kalt. stehen als Jungen. Und er schreibt: »Wir haben Grund zu vermuten, dass der Mensch in manchen Fällen durch Zuchtwahl indirekt sein eigenes, Geschlecht erzeugendes Vermögen beeinflusst hat.« Dr. Georg Stürmer, Stuttgart Englisch vs. deutsch Schwarze Sterne an Stelle Schwarzer Löcher?, Februar 2010 Der Artikel verwendet offenbar nicht die im deutschen Sprach­gebrauch üblichen Fachbegriffe. Aus dem stress energy tensor wurde so ein »Spannungs-Energie-Tensor«, der aber meines Wissens im Deutschen »Energie-Impuls-Tensor« heißt. Dr. Jürgen Clade, Würzburg Antwort der Redaktion: Der Leser hat Recht. Jedoch sprach Einstein 1913 selbst vom »Spannungs-Energietensor der materiellen Strömung«. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Vorsicht Selbstzensur Lebensborn statt Todesbote Forschung aktuell, November 2009 Selbstverständlich gehe ich mit Ihnen absolut d’accord, wenn es darum geht, Sprache mit Anstand und unter Wahrung der guten Sitten zu verwenden. Gerade der Begriff »Lebensborn« ist geeignet, Betroffene empfindlich zu verletzen. Andererseits ist nicht akzeptabel, dass irgendwelche Politideologen wert- und bedeutungsvolle Begriffe aus unserem Wortschatz zweckentfremden, geradezu entweihen und für alle Zeiten für sich allein beanspruchen. Wir dürfen unsere mühsam errungene Presse- und Meinungsfreiheit nicht durch unterschwellige und beliebige Selbstzensur unter­graben. Vielmehr haben wir die Pflicht und Verantwortung, derart unschuldig befleckte Vokabeln mit der Zeit behutsam im Sinn ihrer ursprünglichen Bedeutung zu rehabilitieren und in den alltäglichen Sprachgebrauch zurückzuführen. Der Artikel von Stefanie Reinberger steht in keinerlei politischem Kontext. Schon deshalb spricht nichts dagegen, seinen Inhalt mit den in der Überschrift gewählten Worten treffend zu titulieren. Ganz im Gegenteil: Um sich der tatsächlichen Bedeutung des Begriffs wieder bewusst zu werden, kann der anfängliche kleine Schock dem Leser durchaus hilfreich sein. Martin Janicijevic, Diepenau Briefe an die Redaktion … … sind willkommen! Schreiben Sie uns auf www.spektrum.de/leserbriefe oder direkt beim Artikel: Klicken Sie bei www.spektrum.de auf das aktuelle Heft oder auf »Magazin«, »Magazinarchiv«, das Heft und dann auf den Artikel. Oder schreiben Sie mit kompletter Adresse an: Spektrum der Wissenschaft Redaktion Leserbriefe Postfach 104840 69038 Heidelberg E-Mail: [email protected] 9 Spektrogramm Paläanthropologie Gut organisierte Frühmenschen q Dass der Homo erectus, unser unmittelbarer Vorfahr, bereits mit Feuer umgehen konnte und ausgefeilte Steinwerkzeuge herstellte, ist bekannt. Doch sein Lebensstil galt als eher primitiv. Zu Unrecht, wie sich nun zeigt. Jüngste Ausgrabungen in Israel belegen, dass bei Frühmenschen schon vor 790 000 Jahren unerwartet geordnete Verhältnisse herrschten. Den Lebensmittelpunkt bildete die Feuerstelle. In deren Umkreis gab es für verschiedene Aktivitäten wie die Herstellung von Werkzeugen oder die Zubereitung von Nahrung eigene Bereiche. Diese moderne Aufteilung erfordert eine soziale Organisation unter den Gruppenmit- Leore Grosman, The Hebrew University of Jerusalem Faustkeile (oben) und Steinbeile (unten) fanden sich in der Ausgrabungsstätte Gesher Benot Ya’aqov in Israel vorwiegend rund um die Feuerstelle, die den Lebensmittelpunkt der dort lebenden Frühmenschen bildete. gliedern, die Anthropologen eigentlich erst dem Homo sapiens zugetraut hatten, der mehr als 600 000 Jahre später auftauchte. Archäologen um Nira Alperson-Afil von der Hebräischen Universität in Jerusalem analysierten die Verteilung der Artefakte in der Ausgrabungsstätte Gesher Benot Ya’aqov im Norden Israels, in der vor 790 000 Jahren eine Horde Frühmenschen hauste. Rund um die Feuerstelle im Süd­ osten des Lagers am Ufer eines ehemaligen Sees befand sich demnach offenbar das Zentrum der Aktivitäten. Hier fanden sich neben Holzfragmenten und Rindenstücken Überreste von Samen und Früchten sowie Karpfen und Krabben. Zudem wurden im Lager mehr als 80 000 Werkzeuge entdeckt. Deren Verteilung war jedoch keineswegs homogen, sondern legt nahe, dass sie je nach Material an unterschiedlichen Stellen hergestellt und verwendet wurden. Science, Bd. 426, S. 1677 Biologie Wächter der Weiblichkeit Folgen waren viel dramatischer«, berichtet Treier. Die für die Reifung der Oozyten zuständigen Zellen nahmen binnen drei Wochen Merkmale ihrer männlichen Gegenstücke an, die an der Bildung von Spermien und Testosteron in den Hoden mitwirken. Die weiblichen Tiere hatten danach ebenso hohe Testosteronwerte wie ihre männlichen Artgenossen. Gemeinsam mit einem Team des National Institute for Medical Research in London konnten die Forscher auch den zu Grunde liegenden Mechanismus aufklären. Demnach findet der Kampf um das Geschlecht zwischen Foxl2 und einem anderen Gen namens Sox9 statt. Letzteres sorgt dafür, dass sich aus Keimdrüsen Hoden statt Eierstöcke entwickeln. Foxl2 unterdrückt dieses Gen jedoch lebenslang. Sein Gegenspieler ist übrigens das eingangs erwähnte Sry, das die Ausprägung von Sox9 fördert. Cell, Bd. 139, S. 1130 Mathias Treier, EMBL Heidelberg q X und X ergibt ein Mädchen, X und Y dagegen einen Jungen – das lernen schon Schüler im Biologieunterricht. Standardmäßig entwickelt ein Embryo weibliche Geschlechtsmerkmale, wenn nicht ein Gen namens Sry auf dem Y-Chromosom den Schalter in Richtung Männchen umlegt. Doch das ist offenbar nicht die ganze Wahrheit. Wie nun Mathias Treier vom European Molecular Biology Laboratory in Heidelberg und Kollegen herausfanden, haben die Eierstöcke weiblicher Wirbeltiere eine natürliche Tendenz, sich nachträglich in Hoden zu verwandeln. Nur das Gen Foxl2 hält sie davon ab und sorgt so dafür, dass die Mäusedame eine solche bleibt. Als die Forscher dieses Gen in den Eierstöcken erwachsener Mäuseweibchen ausschalteten, erwarteten sie, dass keine Eizellen mehr produziert würden. »Aber die Die Granulosa-Zellen in den Eierstöcken von Mäuseweibchen (links) tragen zur Reifung der Eizellen bei. Beim Ausschalten des Gens Foxl2 entwickeln sie jedoch Merkmale von SertoliZellen, die in den Hoden von Männchen an der Bildung von Spermien mitwirken (rechts). 12 SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · märz 2010 PALÄONTOLOGIE q Vor etwa 128 Millionen Jahren lebten in China truthahngroße, gefiederte Raptoren, die als Sinornithosaurier (chinesische Vogelechsen) bezeichnet werden. Diese frühen Verwandten der heutigen Vögel besaßen lange Reißzähne, mit denen sie vermutlich Gift in ihre Beute injizieren konnten. Das haben Forscher um David Burnham von der University of Kansas in Lawrence nun festgestellt, als sie das Gebiss von fossilen Exemplaren unter die Lupe nahmen. An den Seiten des Sinornithosaurier-Schädels entdeckten die Wissenschaftler zwei Ver­tiefungen, die über eine Rille mit den langen, eingekerbten Reißzähnen im Oberkiefer verbunden sind. Das erinnert an die Anatomie heutiger Giftschlangen mit weit hinten im Maul sitzenden Giftzähnen. Die Forscher vermuten deshalb, dass die Vertiefungen einst Giftdrüsen beherbergten. Von diesen wurde das Toxin durch die Kraft des Bisses ausgepresst und gelangte über die Rille und die Kerben in den Reißzähnen in das Opfer. Burnham zufolge jagten die Saurier, indem sie sich von einem Baum aus von hinten auf ihre Opfer stürzten, ihre Zähne durch die Haut stießen und das Toxin injizierten. Anschließend fraßen sie das bewegungsunfähige Tier bei lebendigem Leib. Aus dem relativ schmalen Kiefer schließen die Forscher, dass Sinorni- David A. Burnham, University of Kansas Biodiversity Institute Vogelsaurier mit Giftzähnen thosaurus außer kleinen Sauriern vor allem andere primitive Vögel erlegte. Darauf deuten auch die ungewöhnlich langen Giftzähne hin, die es ihm vermutlich erleichter­ ten, selbst dichtes Gefieder zu durchdringen. Das Fossil eines Sinornithosaurus-Kiefers lässt die langen Reißzähne gut erkennen, mit denen der gefiederte Raptor vermutlich Gift in seine Opfer injizierte. PNAS, Bd. 107, S. 766 ASTRONOMIE q Nur 42 Lichtjahre von der Erde entfernt kreist ein Planet, der vermutlich mehr als zur Hälfte aus Wasser besteht. Astronomen um David Charbonneau von der Harvard University in Cambridge (Massachusetts) entdeckten den Himmelskörper, weil er alle 38 Stunden in sehr geringem Abstand vor seinem Mutterstern vorbeizieht und dessen Licht teilweise abblockt. Aus dem Anteil der geschluckten Strahlung und der bekannten Größe der fernen Sonne schätzten die Forscher, dass GJ 1214b etwa den dreifachen Erddurchmesser hat. Seine Masse – sie beträgt knapp das Siebenfache der Erdmasse – ergab sich aus der Schlinger­ bewegung des Sterns, die der Planet durch seine Schwerkraft verursacht. Wie Charbonneau und seine Kollegen aus beiden Werten ableiten konnten, besitzt GJ 1214b etwa die doppelte Dichte von Wasser. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · märz 2010 Laut den Forschern kann es sich bei einem Himmelskörper mit dieser Größe und Umlaufbahn nicht um einen Gasplane­ ten handeln. Demnach lässt sich die geringe Dichte nur dadurch erklären, dass GJ 1214b größtenteils aus Wasser besteht und lediglich einen kleinen festen Kern besitzt. Während die meisten Exoplaneten mit enger Umlaufbahn viele hunderte Grad heiß sind, bleibt GJ 1214b mit geschätzten 200 Grad relativ kühl, weil er einen nicht sehr aktiven roten Zwergstern umkreist. Ob es sich tatsächlich um eine kochende Ozeanwelt – und damit den ersten Beleg für Wasser außerhalb des Sonnen­systems – handelt, soll nun das Weltraum­teleskop Hubble klären, indem es den Planeten direkt ins Visier nimmt und nach Zeichen einer Wasserdampfatmosphäre sucht. Nature, Bd. 462, S. 891 David A. Aguilar, Center for Astrophysics (CfA) Exoplanet mit kochendem Ozean Der Planet GJ 1214b, hier eine künstlerische Darstellung, umkreist einen erdnahen roten Zwergstern. Wegen seiner geringen Dichte dürfte er großenteils aus Wasser bestehen. 13 werkstoffe Pons Fremde Hirnzellen voll integriert Bruchfestes Sandwich James M. Weimann et al., Stanford Medical School q Abgestorbene Hirnzellen zu ersetzen ist der große Traum vieler Stammzellforscher; denn so ließen sich zahlreiche Leiden wie Parkinson, ALS-Lähmung oder Schlag­ anfälle behandeln. Bisher konnte man zwar schon embryonale Stammzellen in Neurone verwandeln und im Gehirn ansiedeln. Doch sie verbanden sich dort nicht korrekt mit anderen Hirnteilen. Genau dies haben Neurologen unter Leitung von James Weimann von der Stanford Medical School (Kalifornien) nun erstmals erreicht. Die Forscher kultivierten embryonale Mäusestammzellen auf speziell gezüchtetem Bindegewebe, wo sie sich zu unreifen Neuronen entwickelten. Als diese etwa denen eines zwölf Tage alten Embryos entsprachen, injizierten Weimann und seine Kollegen Proben der Kultur in die Gehirne neugeborener Mäuse. Nach mehreren Wochen untersuchten sie die Verbindungen der implantierten Neurone, die zur Unterscheidung ein Gen trugen, das sie gelb Ins Bewegungszentrum einer Maus implantiert, bilden einstige Stammzellen (gelb) gezielt Fortsätze in die Mittelhirnbrücke (Pons) und von dort weiter ins Rückenmark. leuchten ließ. Es zeigte sich, dass die Zellen sich stets genauso verschaltet hatten wie das umliegende Hirngewebe: Im Bewegungszentrum waren ihre Axone (langen Fortsätze) zum Rückenmark gerichtet, im Sehzentrum zogen sie dagegen zum Mittelhirndach. Während die Stammzellen reiften, verfolgten die Forscher zudem die Aktivität verschiedener Entwicklungsgene. Bei fünf davon zeigten sich Unterschiede zwischen Zellen, die sich erfolgreich verschalteten, und solchen aus anderen Kulturen. Durch gezielte Manipulation dieser Gene sollten sich zukünftig womöglich Ersatzneurone in größeren Mengen erzeugen lassen, so die Hoffnung der Neurologen. q Die innerste Schicht von Muschelschalen ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern auch besonders bruchfest. Das liegt daran, dass es sich um ein Verbundmaterial handelt, in dem sich das harte Kalkmineral Aragonit und weiche, klebrige Proteinschichten im richtigen Verhältnis zueinander abwechseln. Diesen Aufbau hat nun ein Forscherteam um Zaklina Burghard vom Max-Planck-Institut für Metallforschung in Stuttgart nachgeahmt. Dabei ersetzte es den Aragonit und die Proteine allerdings durch Titandioxid beziehungsweise synthetische Polymere, weil diese Materialien für technische Anwendungen interessanter sind. Um das optimale Verhältnis der beiden Komponenten zu finden, variierten die Forscher die Dicke der weichen Polymerlage zwischen fünf und 20 Nanometern. Die harte Keramikschicht maß dagegen durchweg 100 Nanometer. Grundsätzlich brach MPI für Metallforschung Spektrogramm STAMMZELLen The Journal of Neuroscience, Bd. 30, S. 894 Alligatoren atmen wie Vögel q Vögel haben unter allen Tieren das am höchsten entwickelte Atmungssystem. Darin strömt die Luft nicht vor und zurück, sondern durch eine komplizierte Anordnung von Säcken und Einbahnstraßen im Kreis. So kann sie deutlich mehr Sauerstoff an den Körper abgeben. Bisher hatten In den ventralen Bronchien (grün) der Alligatoren strömt Luft beim Aus- wie Einatmen von Kopf- in Schwanzrichtung, in den dor­ salen Bronchien (blau) genau andersherum. So genannte Parabronchien verbinden diese beiden Hauptäste des Atmungssystems. C. G. Farmer, University of Utah Mitarbeit: J. Eder, R. Strobel, D. Lingenhöhl, J. von Sengbusch EVOLUTION Forscher dieses Hochleistungsorgan für eine Spezialentwicklung der Vögel gehalten, die deren hohe Stoffwechselraten beim energiezehrenden Fliegen ermöglicht. Collen Farmer and Kent Sanders von der University of Utah in Salt Lake City zeigten nun jedoch, dass auch in den Lungen von Alligatoren die Luft nur in eine Richtung fließt. Das Prinzip könnte somit bereits auf den gemeinsamen Vorfahren von Krokodilen, Dinosauriern und Vögeln zurückgehen, der vor rund 250 Millionen Jahren lebte. Die zwei Forscher setzten Strömungs­ sensoren in das Bronchiensystem lebender Tiere ein. Die Messungen ergaben beim Einund Ausatmen stets den gleichen Luftstrom: Er war bauchseits zum Schwanz und rückenseits zum Kopf hin gerichtet. Computerto­mo­ grafischen Aufnahmen der Lungen zufolge verfügen die Echsen wie die Vögel über ein System klappenloser Ventile: Stark abknickende Verzweigungen führen den Luftstrom im Kreis durch die diversen Lungenteile und wieder zur Luftröhre zurück. 14 Science, Bd. 327, S. 338 Eine Wechselfolge aus Titandioxid (TiO2) und Polyethylen (PE) im Dickenverhältnis 10 : 1 gleicht dem Aufbau von Perlmutt und ist deshalb besonders bruchfest. das Verbundmaterial weniger leicht als reines Titandioxid. Die größte Stabilität erreichte es bei einer Dicke der Polymerschicht von zehn Nanometern. Dann war die Bruchfestigkeit vierfach erhöht. Auch im Perlmutt beträgt das Dickenverhältnis zwischen Aragonit- und Proteinschichten zehn zu eins. In beiden Fällen erklärt sich die größere Festigkeit des Verbundmaterials dadurch, dass die Keramikkomponente zwar sehr hart, aber auch spröde ist. Deshalb pflanzt sich ein einmal entstandener Riss durch das gesamte Material fort. Die Polymerschicht fängt solche Risse dagegen ab und hindert sie an der Ausbreitung. Nanoletters, Bd. 9, S. 4103 SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · märz 2010 bild des monats Die meisten Gene erfüllen ihre Funktion erst im Zusammenwirken mit anderen. Kommt zu einer Mutation eine zweite hinzu, kann diese den Effekt der ersten deshalb verstärken oder abschwächen. Solche Wechselwirkungen haben Michael Costanzo von der University of Toronto (Kanada) und Kollegen nun am Beispiel der Backhefe Saccharomyces cerevisiae mit ihren etwa 6000 Genen erstmals detailliert untersucht. Für 5,4 Millionen Genpaare erstellten sie ein Interaktionsprofil. Die Ergebnisse der Analyse verarbeiteten sie per Computer zu der hier gezeigten Karte. Darin erscheinen die Gene als weiße Punkte, die mit ihren Wechselwirkungspartnern durch eine Linie verbunden sind. Sie liegen umso näher beieinander, je mehr sich ihr Interaktionsmuster gleicht. An einer Funktion beteiligte Gene bilden dabei Knäuel, die farbig hervorgehoben wurden. Mit solchen Netzen sollten sich die Wirkungen von Medikamenten sehr viel differenzierter beurteilen lassen, als das bisher möglich war. Michael Costanzo et al., University of Toronto / Science - AAAS Feuerwerk der Gene FORSCHUNG AKTUELL Meeresforschung Vierzig Tage in der Wasserwüste Eine Expedition in eine extrem nährstoffarme Zone im Südpazifik galt der Suche nach Leben unter Extrembedingungen. Tief im Sediment unter dem Meeresboden fanden sich überraschend große Mengen an Mikroben, die möglicherweise natürliche Radioaktivität als Energiequelle nutzen. Von Jan P. Fischer und Timothy G. Ferdelman von einzelligen, fotosynthetischen Algen, welche die Basis des Nahrungsnet­zes in den Meeren bilden. Deshalb ist das Was­ ser so klar und blau wie nirgendwo sonst auf der Erde. Da hier so wenige Organismen leben, setzt sich auch kaum organisches Mate­ rial am Meeresgrund in 4000 bis 5000 Meter Wassertiefe ab. Zudem tragen die Winde nur geringe Mengen an Staub in diese entlegene Region. Die Folge sind extrem geringe Sedimentationsraten: In einer Million Jahren lagert sich nur eine maximal einen Meter dicke Schicht ab. Als Wissenschaftler am Max-PlanckInstitut für Marine Mikrobiologie in Bremen brachen wir jüngst zusammen mit Kollegen von der University of Rhode Island in Kingston mit dem ame­ rikanischen Forschungsschiff Roger Re­ velle zu einer 40-tägigen Expedition in diese kaum erforschte Region auf. Ziel war es, neue Erkenntnisse über das Le­ ben tief in den Ablagerungen am Mee­ resboden zu gewinnen. Aber warum suchten wir zu diesem Zweck ausgerech­ net den vermutlich lebensfeindlichsten Ort im Ozean auf? Die Antwort auf die­ se Frage erfordert etwas Hintergrundwis­ D 0 0 Sauerstoffgehalt in Mikromol pro Liter 100 0 100 200 300 0 – 10 – 2 – 15 – 3 – 20 – 4 – 25 – 5 – 30 – 35 – 6 – 40 – 7 –45 – 8 – 50 16 Tiefe im Sediment in Millimetern – 5 – 1 Tiefe im Sediment in Metern 200 Jan P. Fischer und Timothy G. Ferdelman reht man den Pazifischen Ozean auf einem Globus ins Zentrum, so sieht man fast ausschließlich Wasser mit einigen versprengten kleinen Inseln. Nur am Rand dieses Ausschnitts der Erdku­ gel sind noch die Kontinente zu erah­ nen. Der Anblick macht deutlich, dass der Pazifik die mit Abstand größte zu­ sammenhängende Formation der Erde ist. Mehr als die Hälfte der riesi­gen Was­ serfläche liegt auf der Südhalbkugel. Dort befindet sich ein giganti­scher Wirbel, be­ grenzt durch den Südäquatorialstrom im Norden, den Ostaustralstrom im Wes­ ten, den Antarktischen Zirkumpolar­ strom im Süden und den Humboldt­ strom im Osten. Nur wenige Fische und Vögel durch­ queren diesen Südpazifischen Wirbel, eine ozeanische Wüste, in der es nur äu­ ßerst wenig Nahrung gibt. In seinem In­ neren findet nämlich fast kein vertikaler Wasseraustausch statt. Dadurch unter­ schreitet die Nährstoffkonzentration an der Oberfläche teilweise die Nachweis­ grenze. Das beschränkt das Wachstum Das Sauerstoffprofil im Sediment des Südpazifischen Wirbels (links; rechts eine Ausschnittsvergrößerung) zeigt, dass die Konzentration des gelösten Gases schon nach wenigen Zentimetern mit der Tiefe kaum noch weiter abnimmt. Das ist höchst ungewöhnlich. In Sedimenten an Küsten (schwarz) kommt schon nach wenigen Millimetern und in nährstoffarmen Tiefseeregionen (blau) spätestens nach einigen Dezimetern Tiefe kein Sauerstoff mehr vor. sen über mikrobielle Prozesse in marinen Sedimenten. Alle Lebewesen beziehen ihre Energie aus so genannten Redoxreaktionen: Eine Substanz wird oxidiert (gibt Elektronen ab) und eine andere dafür reduziert (nimmt Elektronen auf ). Höhere Orga­ nismen oxidieren organisches Material – die Nahrung – zu Kohlendioxid und re­ duzieren dabei Sauerstoff. Bei Bakterien und Archaeen existiert daneben eine ver­ blüffende Vielfalt an Stoffwechselwegen. Thermodynamisch ist zwar Sauerstoff das optimale Oxidationsmittel; viele Mikro­ ben können jedoch stattdessen zum Bei­ spiel Nitrat oder Sulfat oder sogar Fest­ stoffe wie Mangan- und Eisenoxide redu­ zieren. Hungerkünstler im Tiefseeboden In den obersten Schichten der marinen Sedimente lebt eine hochaktive mikro­ bielle Gemeinschaft, die das herabreg­ nende organische Material oxidiert. Tief im Sediment, in viele Millionen Jahre al­ ten Schichten, ist der größte Teil der or­ ganischen Ablagerungen jedoch abge­ baut. Dort herrscht deshalb Nahrungs­ mangel, und es wurde lange vermutet, dass in dieser »oligotrophen Zone« kaum Leben zu finden sei. Im Verlauf des letzten Jahrzehnts ha­ ben sich jedoch die Anzeichen dafür ver­ dichtet, dass auch in Sediment, das sich mehrere hundert Meter bis Kilometer unter dem Meeresboden befindet, noch zwischen 100 000 und zehn Millionen Mikroben pro Kubikzentimeter hausen. Mehr noch: Ein erheblicher Prozentsatz der gesamten lebenden Biomasse auf der Erde kommt, wie man inzwischen weiß, in Form von Bakterien und Archaeen in den tiefen Ozeansedimenten vor. Wie und wovon leben sie? Das ist noch weit gehend ungeklärt. Unsere Un­ wissenheit rührt vor allem daher, dass die SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · MÄRZ 2010 Aktuell Jan P. Fischer und Timothy G. Ferdelman 0,1 0,3 1 3 Chlorophyll a in Milligramm pro Kubikmeter 10 30 60 Wie diese Darstellung des langjährigen Mittelwerts der Chlorophyllkonzentrationen im Oberflächenwasser der Ozeane zeigt, findet in den nährstoffarmen subtropi­schen Wirbeln besonders wenig Fotosynthese statt. Die weißen Punkte markieren die Probenahmeorte während der jüngsten Expedition der Autoren in den Südpazifik. etablierten biologischen Labormethoden nicht zur Untersuchung dieser Frage tau­ gen. Während sich die klassi­sche Mikro­ biologie hauptsächlich mit schnell wach­ senden, leicht in Kultur­medien zu züch­ tenden Organismen beschäftigt, domi­ nieren in den tiefen Meeressedimenten die Hungerkünstler. Diese nutzen die ge­ ringe verfügbare Energie in höchst effizi­ enter Weise, um sich gerade noch am Le­ ben zu erhalten. Wachstum findet kaum mehr statt: Schätzun­gen zufolge gibt es in hunderten bis tausenden Jahren nur eine Zellteilung. Bei solchen Zeitspan­ nen sind Laborversuche offensichtlich ein Problem. Zwar lässt sich die Aktivität mikrobi­ eller Gemeinschaften im Prinzip messen, indem man die Organismen mit radio­ aktiv markierten Substraten füttert und so ihren Umsatz bestimmt. Diese Me­ thode ist bei den sehr geringen Stoff­ wechselraten in tiefen Sedimenten aber nicht genau genug. Dort lassen sich mi­ krobielle Umsätze besser auf eine andere, indirekte Art bestimmen: Man ermittelt die Konzentrationsänderungen der ver­ schiedenen von den Lebewesen veratme­ ten Stoffe (allen voran Sauerstoff) im Po­ SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · MÄRZ 2010 renwasser und zieht daraus Rückschlüsse auf die Atmungsraten. Im oberen Meeresboden findet sich, wie erwähnt, meist eine aktive Gemein­ schaft von Lebewesen mit hohem Bedarf an Sauerstoff. Da dieser praktisch nur durch langsame Diffusion im Sediment transportiert und ausgetauscht wird, ist er schnell aufgebraucht. Wie tief er in den Boden eindringt, hängt zum großen Teil davon ab, wie viel oxidierbares orga­ nisches Material vorhanden ist: Je weni­ Jan P. Fischer und Timothy G. Ferdelman 0,03 10 – 3 10 – 2 Marine Ablagerungen enthalten große Mengen an Mikroben. Selbst in einem Kilometer Tiefe finden sich in normalem Meeresboden noch mehr als eine Million lebende Zellen pro Kubikzentimeter Sediment (schwarze Punkte). Im Südpazifischen Wirbel ließen sich in zehn Meter Tiefe, bis zu der Proben genommen wurden, auch noch etwa 10 000 Mikroben pro Kubikzentimeter nachweisen (offene Kreise und Dreiecke), obwohl dort kaum noch Nährstoffe vorhanden sind. Tiefe im Sediment in Metern 0,01 ger davon den Meeresboden erreicht, ­desto weniger Sauerstoff wird für die ­Atmung verbraucht und umso tiefer ge­ langt das gelöste Gas. Typische Sauer­ stoffeindringtiefen liegen in der Größen­ ordnung von wenigen Millimetern in Küstensedimenten bis zu mehreren Dezi­ metern in nährstoffarmen Tiefseeregio­ nen. Unterhalb dieser oxischen Zone kommen jene Organismen zum Zuge, die alternative Oxidationsmittel verwen­ den können. Unser Ziel war es, nach dem absolu­ ten energetischen Limit für Leben zu su­ chen. Dazu mussten wir dem »Hinter­ grundrauschen« der fotosynthetischen Welt entkommen, wo es leicht verfüg­ bare Kohlenstoffverbindungen in Hülle und Fülle gibt. Der Südpazifischen Wir­ bel war daher ein ideales Untersuchungs­ gebiet für uns. Wegen der geringen Sedimentations­ raten ist das Sediment hier schon in we­ 10 – 1 10 0 10 1 10 2 10 3 2 10 10 4 10 6 10 8 10 10 Zellen pro Kubikzentimeter 17 10 12 Jan P. Fischer und Timothy G. Ferdelman FORSCHUNG AKTUELL Hier wird ein Gerät ausgesetzt, das selbstständig Sauerstoffprofile in der oberen Sedimentschicht mit einer Auflösung von 0,1 Millimetern messen kann. nigen Metern Tiefe viele Millionen Jahre alt. In den meisten anderen Gebieten müsste man dafür hunderte oder gar tau­ sende Meter tief bohren. Wir erwarteten in dieser extremen marinen Wüste sehr geringe Atmungsra­ ten und somit große Sauerstoffeindring­ tiefen. Doch die Ergebnisse unserer Mes­ sungen waren selbst für uns eine Überra­ schung: Nur in den obersten ein bis zwei Zentimetern nahm die Sauerstoffkonzen­ tration überhaupt nennenswert ab. Hier wird praktisch der gesamte bioverfügbare Kohlenstoff aufgebraucht. Darunter fehlt den Zellen dann die Nahrung, und die Atmungsrate pro Kubikzentimeter Sedi­ ment fällt so stark ab, dass der Sauerstoff ungehindert weiter in die Tiefe diffun­ dieren kann. Wie eine Extrapolation un­ serer Profile ergibt, liegt das gelöste Gas im gesamten Sediment bis hinunter zur Aids basaltischen Erdkruste in hohen Kon­ zentrationen vor. Möglicherweise ist das nicht einmal ungewöhnlich; schließlich sind die tiefen Sedimente in den anderen wüstenartigen Meeresgebieten ebenfalls noch kaum erforscht. Unser Kollege Jens Kallmeyer von der Universität Potsdam fand im extrem nährstoffarmen Sediment des Südpazifi­ schen Wirbels in zehn Meter Tiefe noch etwa 1000 bis 10 000 lebende Zellen pro Kubikzentimeter. Wie und wovon diese Organismen in mehrere zehn Millionen Jahre alten Ablagerungen ohne die Zu­ fuhr von frischem organischem Material leben, bleibt rätselhaft. Unsere Kollegen Steven D’Hondt und Arthur Spivack aus Rhode Island haben zusammen mit Bo Barker Jørgensen vom Bremer Max-Planck-Institut eine inte­ ressante Erklärung vorgeschlagen. Ihrer Diesen Artikel können Sie als Audiodatei beziehen; siehe www.spektrum.de/audio Gelähmte Abwehr Ein bislang rätselhaftes Virusprotein macht Immunzellen bewegungsunfähig und trägt so entscheidend zum Ausbruch und Fortschreiten der Immunschwächekrankheit Aids bei. Von Stefanie Reinberger S eit seiner Entdeckung im Jahr 1983 hat der Aidserreger HIV (HumanImmunschwäche-Virus) Forschern viele Rätsel aufgegeben. Zu den schwierigsten zählt die Rolle eines seiner Eiweißstoffe namens Nef (negative factor). Es handelt sich um ein regulatorisches Protein, von 18 dem bislang nicht viel mehr bekannt war, als dass es der Erreger zu seiner mas­ senhaften Vermehrung braucht. Nur wenn das HI-Virus über ein funktions­ fähiges Nef verfügt, bricht die Immun­ schwäche mit ihren typischen Sympto­ men aus. »Es gibt in der Fachliteratur seit Lan­ gem Berichte über Patienten, die sich Meinung nach nutzen die Organismen auch Radioaktivität als Energiequelle. Al­phastrahlung aus natürlichen radio­ aktiven Zerfällen in Sedimentkörnern spaltet Wasser in seine Bestandteile. Den frei werdenden Wasserstoff können man­ che Mikroorganismen enzymatisch mit Sauerstoff umsetzen. Die so gewonnene Energie nutzen sie dazu, gelöstes Kohlen­ dioxid zu reduzieren und in Biomasse um­zuwandeln. Wie unsere Kollegen be­ rechnet haben, sollte die radioaktive Was­serstoffproduktion ausreichen, um etwa die Hälfte der Zellen im Sediment des Südpazifischen Wirbels mit Energie zu versorgen. Zur genaueren Untersuchung dieser und anderer Hypothesen ist in den kom­ menden Jahren eine Bohrexpedition des Integrated Ocean Drilling Program (IODP) in diese Region geplant. Dabei wollen wir in bis zu 100 Millionen Jahre alte Sedimentschichten vorstoßen und mehrere 100 Meter Basalt erbohren. Bis­ her ist das ultimative energetische Limit für mikrobielles Leben im Meeresboden jedenfalls noch nicht gefunden. Jan P. Fischer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie in Bremen, wo Timothy G. Ferdelman die Arbeitsgruppe Biogeochemie leitet. mit einem HI-Virus infiziert haben, dem auf Grund eines genetischen Defekts das Nef-Protein fehlt«, erklärt Oliver Fackler, Professor für Virologie an der Universi­ tät Heidelberg. »Die Betroffenen entwi­ ckeln erst lange nach der Infektion Krankheitssymptome – oder sogar über­ haupt nicht.« Ähnliches ergaben Versuche an Rhe­ susaffen, die mit SIV, der Affenvariante des Aidserregers, infiziert wurden. Hatten Forscher das Nef-Gen ausge­ schaltet, vermehrte sich das Virus nur sehr langsam; die typischen Merkmale der Immunschwächekrankheit traten stark verzögert oder gar nicht auf. Um­ gekehrt ließen sich bei Mäusen Aids­ symptome hervorrufen, wenn sie gene­ tisch derart manipuliert wurden, dass sie SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · MÄRZ 2010 Aktuell das Nef-Protein in ihren Immunzellen bildeten. Ein Virus war dafür gar nicht erforderlich. »Wie Nef dies bewerkstelligt, war bis­ lang völlig unklar«, berichtet Fackler, der sich schon seit seiner Diplomarbeit vor rund 15 Jahren mit dem geheimnis­ vollen Protein beschäftigt. Jetzt hat der Virologe gemeinsam mit seinem Team und Kooperationspartnern an der Uni­ versität Münster zumindest einen Teil der Antwort gefunden. Demnach hin­ dert Nef befallene Immunzellen daran, gegen das Virus zu Felde zu ziehen, in­ dem es sie regelrecht lähmt (Cell Host & Microbe, Bd. 6, S. 174). Um Krankheitserreger zu bekämpfen, muss die Körperpolizei beweglich sein: Die Immunzellen wandern – angelockt durch Botenstoffe, fachlich Chemokine genannt – etwa zu Entzündungsherden oder in die Lymphknoten und interagie­ ren dort mit weiteren Komponenten der Körperabwehr. Nur so kann sich die Im­ munantwort entfalten und beispielsweise die Produktion von Antikörpern oder die Vermehrung von spezifischen Killer­ zellen angekurbelt werden. Schon länger war den Heidelberger Wissenschaftlern aufgefallen, dass sich bestimmte Lymphozyten – die so ge­ nannten T-Helferzellen – nach der In­ fektion mit dem HI-Virus äußerlich von ihren gesunden Mitstreitern unterschei­ den. Allem Anschein nach ist das Zyto­ skelett, der Stütz- und Bewegungsap­ parat der Zelle, bei ihnen verändert. ­Zugleich gab es Indizien dafür, dass Nef eine zentrale Rolle bei diesen Verän­ derungen spielt. »Doch so richtig konn­ ten wir uns in den letzten zehn Jahren keinen Reim darauf machen«, erzählt Fackler. Dass sich die Puzzleteile nun zu einem stimmigen Bild zusammenfügen, ist vor allem der Beharrlichkeit von Fack­lers Mitarbeiterin Bettina Stolp zu verdanken. Der jungen Biologin kam im Rahmen ihrer Doktorarbeit ein Ver­ dacht: Wenn Nef das Zellskelett verän­ dert, könnten T-Helferzellen dadurch ihre Beweglichkeit und damit ihre Schlag­ kraft einbüßen. Immerhin sind andere Fälle bekannt, in denen Viren die Stütz­ proteine einer befallenen Zelle manipu­ lieren, um sich unbehelligt vermehren zu können. Nachweis mit gläsernen Fischen Stolp überzeugte ihren Doktorvater von der Idee, und die Heidelberger Wissen­ schaftler prüften zunächst in Zellkultur, ob Nef die Beweglichkeit von Lympho­ zyten blockieren kann. Dazu schleusten sie das betreffende Gen in T-Helferzellen ein. Tatsächlich verloren diese daraufhin die Fähigkeit, über den Boden der Kul­ turschalen zu kriechen. »Entscheidend war jedoch, zu bewei­ sen, dass Nef auch im lebenden Organis­ mus diese Wirkung hat«, sagt Fackler. Als Versuchsobjekt wählten die Wissen­ schaftler Zebrafische. Das klingt zu­ nächst einmal weit hergeholt; denn die bei Entwicklungsbiologen beliebten Ver­ suchstiere lassen sich nicht mit dem HIVirus infizieren. Doch darauf kam es den Forschern auch gar nicht an. »Während der Embryonalentwicklung der Fische wandern so genannte primordiale Keim­ zellen vom Ort ihrer Entstehung zu den Gonaden, den Vorläufern der Geschlechts­ organe«, erklärt der Virologe. »Diese Wanderung vollzieht sich auf genau die gleiche Art wie die Fortbewegung der THelferzellen.« Sollte Nef also in der Lage sein, die Helfer zu lähmen, dürften sich unter dem Einfluss des Proteins auch die primordialen Keimzellen beim Zebra­ fisch nicht mehr bewegen können. »Der Clou dabei ist, dass Zebra­fisch­embry­o­ nen durchsichtig sind, wir den Effekt von Nef also einfach unter dem Mikro­ skop beobachten konnten«, begeistert sich Fackler. Gemeinsam mit den Zellbiologen Michal Reichman-Fried und Erez Raz aus Münster, die Zebrafische und das nötige Knowhow mitbrachten, manipu­ lierten die Forscher die Embryonen also derart, dass die primordialen Keimzellen das Nef-Protein produzierten. Diesen verging daraufhin prompt jedwede Wan­ derlust. War das eingeschleuste Nef-Gen dagegen defekt, bewegten sie sich ganz normal zu den Gonaden. Damit war der Beweis erbracht, dass Nef Zellen, in denen es vorkommt, zur Unbeweglichkeit verdammt. Auch den Mechanismus der Lähmung konnten die Forscher aufklären. Im Mittelpunkt steht das Protein Aktin, das bekannt dafür ist, zusammen mit Myosin die Muskelkon­ Ideen für einen smarten Planeten Städte, die uns das Leben leichter machen. Bis 2050 werden 70 % der Weltbevölkerung in Städten leben. Wenn die urbanen Infrastrukturen mit diesem Ansturm Schritt halten sollen, müssen wir sie intelligenter gestalten. Zum Beispiel, indem wir Städte als komplexe Ökosysteme begreifen und die Infrastrukturen für Verkehr, Wasser, Abfall, Verwaltung, Sicherheit, Energie miteinander vernetzen. Davon profitieren alle Aspekte der Lebensqualität – von sauberer Luft über staufreie Straßen bis zur Schulbildung unserer Kinder. Es ist, mit einem Wort, smart. Welchen Beitrag IBM dazu leistet, erfahren Sie unter ibm.com/think/de/city 19 IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken eingetr. Marken der International ·Business Machines Corp. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Andere Namen von Firmen, Produkten und Dienstleistungen können Marken oder eingetr. Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. © 2009 IBM Corp. Alle Rechte vorbehalten. SPEKTRUM DERoderWISSENSCHAFT MÄRZ 2010 O&M IBM L 48/09 Nach Überzeugung von Fackler lässt sich aber nicht nur der Funktionsverlust der T-Helferzellen auf diese Weise erklä­ ren. Auch B-Lymphozyten, die Antikör­ perlieferanten unseres Immunsystems, arbeiten bei HIV-Infizierten nicht ord­ nungsgemäß. Sie sind unfähig, wirklich wirksame Abwehrmoleküle zu produzie­ ren und gegen das Virus ins Gefecht zu werfen. Zwar verfügen Aidspatienten über große Mengen an Antikörpern, doch die heften sich nur sehr schwach an den Erreger und können ihn deshalb nicht ausmerzen. Ansatzpunkt für neue Therapiemethode Wie Fackler vermutet, ist daran ebenfalls die Lähmung der T-Helferzellen schuld. Diese müssen nämlich mit den B-Lym­ phozyten interagieren, damit hochspezi­ Bettina Stolp, Universität Heidelberg FORSCHUNG AKTUELL traktion zu bewirken. Es ermöglicht aber auch die Wanderung von Zellen. Dabei verändert es periodisch seine Gestalt: Es entspannt sich gewissermaßen und muss dann wieder gespannt werden. »Genau das wird in den Nef-Zellen blockiert, und zwar auf völlig überraschende Wei­ se«, erläutert Fackler. Wie das Team von Fackler heraus­ fand, interagiert Nef mit einem Enzym, das im Normalfall gar nichts mit dem Zytoskelett zu tun hat, und bringt es dazu, einen Regulator für das Aktin-Re­ cycling auszuschalten. Das HIV-Protein verursacht also quasi einen Kurzschluss zwischen zwei Signalwegen in der Zelle – mit dem Ergebnis, dass Aktin nicht mehr in seine aktive Form versetzt wird und die infizierten Zellen dadurch ihre Beweglichkeit und Funktionsfähigkeit einbüßen. T-Lymphozyten des Immunsystems können, angelockt von einem Botenstoff, amöben­ artig auf einer Unterlage entlangkriechen. Dabei wird ihr inneres Fasergerüst kontinuierlich umstrukturiert. Aktin als Hauptbestandteil dieses so genannten Zytoskeletts wurde hier mit einem roten Fluoreszenzfarbstoff markiert. Ist eine Zelle mit HIV infiziert, was sich an viruseigenen Eiweißstof­ fen – hier grün angefärbt – erkennen lässt, blockiert das Protein Nef die Reorganisation der Aktinfasern und damit die Wanderung. Die Zelle bleibt kugelig und unbeweglich. Stefanie Reinberger ist freie Wissenschaftsjournalistin in Köln. Pharmakologie Heilende Textilien Erstmals haben Forscher im Tierversuch bestimmt, wie schnell Wirkstoffe je nach der Art, wie sie an Textilien gebunden sind, an die Haut abgegeben werden. Als optimal erwies sich eine chemische Verknüpfung mit dem Gewebe. Von Fritz Höffeler B eschichtete oder chemisch modifi­ zierte Textilien erleben derzeit einen Boom. Sie bilden einen der am schnell­s­ ten wachsenden und am härtesten um­ kämpften Sektoren innerhalb der Beklei­ dungsindustrie. Von besonderem Inter­ 20 fische Antikörper entstehen, die den Er­ reger wirksam bekämpfen. Sind die Hel­ fer gelähmt, können sie nicht mehr in die Lymphknoten einwandern und sich dort mit den B-Zellen in Verbindung setzen. Tatsächlich haben andere Wissen­ schaftler in den letzten Jahren beobach­ tet, dass bei HIV-Patienten die Architek­ tur der Lymphknoten gestört ist: Es mangelt an T-Helferzellen – und zwar genau in den Bereichen, in denen sie normalerweise die Antikörper produzie­ renden B-Lymphozyten stimulieren. »Das sind Ergebnisse ganz nach dem Geschmack von uns Virologen«, resü­ miert Fackler. »Wir haben einen klar nachweisbaren Effekt, mit dem ein Virus die befallene Zelle für seine Zwecke ma­ nipuliert.« Indem die Erkenntnisse des Heidelberger Teams neue Einblicke in das Krankheitsgeschehen nach der HIVInfektion eröffnen, decken sie auch neue Ansatzspunkte für die Therapie auf. Noch ist Nef kein Ziel antiviraler Medi­ kamente. »Aber es ist ein äußerst interes­ santer Kandidat«, meint Fackler. Der Vi­ rologe hält es für lohnend, nach Mitteln und Wegen zu suchen, dieses regulatori­ sche Protein außer Gefecht zu setzen. »Die Hoffnung wäre, das Virus damit zusätzlich in Schach zu halten – vor allem direkt nach der Infektion, wenn es in seinem neuen Wirt erst noch Fuß fas­ sen muss«, sagt er mit optimistischem Blick in die Zukunft. es­se bei der neuen Stoffgeneration sind für therapeutische Zwecke eingesetzte textile Biomaterialien. Beim Kontakt mit dem Körpergewebe des Trägers treten sie auf vielfältige Weise mit ihm in Wechsel­ wirkung. Chemiker und Textilingenieure haben verschiedene Verfahren entwickelt, thera­ peu­tische Substanzen so auf dem Klei­ derstoff anzubringen, dass er sie beim Be­ rühren der Haut wieder abgibt. Grund­ sätzlich bestehen drei Möglichkeiten der Beschichtung. Man kann den Wirkstoff über eine chemische Bindung direkt an die Textilfaser koppeln oder ihn einem Gel beimischen, das dann auf den Stoff appliziert und getrocknet wird. Bei der raffiniertesten Methode knüpft man so genannte Käfigmoleküle an die Fasern und befüllt diese mit dem Medikament. Von allen drei Verfahren existieren Varianten, die in den letzten Jahren zum Patent angemeldet wurden. Aber wie verhält es sich mit der Wirksamkeit der textilen Biomaterialien bei den verschie­ denen Beschichtungsmethoden? Das hat eine Forschergruppe um Marieta Nichi­ SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · MÄRZ 2010 SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · MÄRZ 2010 Freisetzung von Troxerutin in die Haut freies Troxerutin (Salbe) physikalisch gebundenes Troxerutin chemisch gebundenes Troxerutin Troxerutin Cyclodextrin Polyamid schnelle Diffusion schnelle Diffusion langsame Hydrolyse kein Wirkstoff kein Wirkstoff hohe Konzentration nach rund 10 Stunden Acryloyl-Brücke nach rund 50 Stunden for am Petru-Poni-Institut in Iasi (Rumä­ nien) nun untersucht (Journal of Materials Science: Materials in Medicine, Bd. 20, S. 975). Das Team verglich erstmals die Wirk­ samkeit zweier Textiltypen, die mit dem­ selben Arzneimittel beladen waren – nur eben auf unterschiedliche Weise. Als Testsubstanz diente Troxerutin, ein bekanntes Medikament, das häufig bei Krampfadern oder Wassereinlagerung in den Beinen verabreicht wird. Es wirkt, indem es kleine und kleinste Gefäße ver­ engt. Die Substanz ist außerdem fluores­ zierend, wodurch sich an Gewebeschnit­ ten leicht erkennen lässt, wo und in wel­ cher Menge sie sich angesammelt hat. In einem Fall koppelten die Forscher die Troxerutin-Moleküle über eine Acry­ loyl-Gruppe direkt chemisch an die Poly­ amidfasern des Gewebes. Bei dem ande­ ren Stofftyp verbanden sie – ebenfalls mit einer Acryloyl-Gruppe als Zwischen­ stück – das Käfigmolekül Cyclodextrin mit den Textilfasern. Dann beluden sie die Käfige mit Troxerutin. Das Arzneimittel war hier also nur physikalisch gebunden. Zunächst badeten die rumänischen Forscher Proben der beiden Textilsorten in warmem Wasser, dessen Zusammen­ setzung dem menschlichen Schweiß nachempfunden war, und prüften die Abgabe des Troxerutins in die Lösung. Der in den Käfigmolekülen unterge­ brachte Wirkstoff löste sich schon inner­ halb einer Stunde zu 90 Prozent vom Gewebe. Von dem chemisch gebun­ denen Troxerutin waren dagegen auch Art for Science Aktuell Wurde das Arzneimittel Troxerutin physikalisch an einen Kunststoff gebunden, ging es ebenso schnell auf die Haut über wie beim Auftragen in Salbenform. Nach zwei Tagen war nichts mehr davon im Körpergewebe nachweisbar. Bei chemischer Kopplung des Troxerutins an den Kunststoff erfolgte die Freisetzung viel langsamer durch allmähliche Hydrolyse der Bindung. Die Haut wurde dadurch wesentlich länger mit dem Präparat versorgt; zudem war dessen Konzentration im Körpergewebe zu jeder Zeit höher als bei physikalischer Kopplung. 21 FORSCHUNG AKTUELL nach einem Tag nur 15 Prozent in das Wasserbad übergegangen. Für das nächste Experiment rasierten die Forscher Ratten ein kleines Areal am Rücken. Dann teilten sie die Nager in vier Gruppen. Eine blieb unbehandelt. Bei der zweiten wurde Troxerutin-Salbe auf die nackte Stelle aufgetragen. In der dritten und vierten Gruppe befestigten die Forscher ein Stück Stoff mit physika­ lisch beziehungsweise chemisch gebunde­ nem Troxerutin auf dem Rücken. Mittels histologischer Untersuchun­gen ermittelten die Forscher anschließend wiederum den Zeitverlauf der Wirkstoff­ abgabe. Dabei zeigte sich kein Unter­ schied zwischen der Behandlung mit Sal­ be und mit einem Gewebestück, an das Troxerutin physikalisch gebunden war. In beiden Fällen wurde der Wirkstoff sehr schnell freigesetzt und fand sich in allen Bereichen unterhalb der Haut – auch in den Gefäßwänden, wo er seine Wirkung entfalten soll. Die Konzentra­ tion erreich­te nach zwölf Stunden Ein­ wirkdauer ihr Maximum und fiel dann Kommentar sehr schnell wieder auf das Niveau der unbehandelten Referenzgruppe ab. Das chemisch gebundene Troxerutin wurde auch in diesem Fall sehr viel lang­ samer abgegeben. Seine Konzentration erreichte erst nach ein bis zwei Tagen ihr Maximum. Trotzdem war sie in allen Hautschichten und in den Gefäßwänden die ganze Zeit hindurch deutlich höher als bei der Behandlung mit Salbe oder physikalisch gebundenem Wirkstoff. Der Grund für diesen günstigen Effekt ist unklar. Vielleicht dringen die Troxeru­ tinmoleklüle nur langsam in die Zellen ein, und eine schnell freigesetzte hohe Dosis wird abtransportiert, bevor sie das Zielgewebe erreicht. Unabhängig vom konkreten Ergebnis belegt diese Untersuchung erstmals im Tierversuch, dass sich darüber, wie ein Arzneimittel an ein Kleidungsstück ge­ koppelt ist, seine Abgabegeschwindigkeit regulieren lässt. Vielleicht noch wichtiger ist eine zweite Erkenntnis: Nicht nur die Wirkstoffkonzentration im Präparat ist ausschlaggebend für die Konzentration im Zielgewebe; die Geschwindigkeit der Freisetzung hat einen mindestens ebenso großen Einfluss darauf, wie viel von dem Medikament sich in dem Gewebe anrei­ chert, in dem es wirken soll. Aus den Laborversuchen lässt sich aber auch die praktische Empfehlung ableiten, Kompressionsstrümpfe mittels chemi­ scher Bindung mit Troxerutin zu beladen. Das würde gewissermaßen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Zur Kompres­ sion der Wade, die kurzfristig Wasserein­ lagerungen verhindert, käme die konti­ nuierliche Freisetzung eines Therapeuti­ kums, welches das Problem langfristig löst und den Strumpf überflüssig macht. Bislang müssen sich veneninsuffiziente Patienten mehrmals am Tag mit einer Troxerutin-Salbe einreiben. Bioaktive Kompressionsstrümpfe wären da nicht nur eine wesentlich komfortablere, son­ dern auch effektivere Alternative. Diesen Artikel können Sie als Audiodatei beziehen; siehe www.spektrum.de/audio Die Größenverhältnisse werden deut­ lich, wenn man sieht, dass die Bemühun­ gen der Unterzeichner des Kioto-Abkom­ mens, den Ausstoß von Treib­haus­gasen zu reduzieren, allein durch China zunich­ tegemacht werden, das seine Emissio­nen zwischen dem Jahr 2000 und 2010 um 600 Millionen Tonnen gesteigert hat – das Fünffache der Reduktion um 118 Millionen Tonnen durch die Unterzeich­ ner des Kioto-Protokolls. Über die Ent­ wicklung des Weltklimas entscheiden also die drei Großmächte China, USA und Indien, und die handeln nach ihren Interessen. Da sie glauben, dass der Kli­ mawandel sie in den nächsten 20 Jahren nicht wesentlich treffen wird – womit sie Recht haben könnten –, fühlen sie sich nicht genötigt, ihre innen- und außen­ politischen Ziele zu Gunsten einer auf starke Emissionsminderung gerichteten, kostspieligen Umsteuerung ihrer Wirt­ schaftspolitik zurückzustellen. Deutschland trägt lediglich drei Pro­ zent zu den globalen Kohlendi­oxid­emis­ sionen bei. Selbst drastische Reduktio­ nen hier zu Lande hätten also wenig Ein­ fluss auf das Weltklima. Sie könnten nur als Signal und Beispiel wirken. Doch die Großen haben sich durch gute Beispiele bisher nicht beeindrucken lassen. Kopenhagen – quo vadis? Globale Klimapolitik wird nur Erfolg haben, wenn die größten Kohlendioxid­ emittenten – China, USA und Indien – mitwirken. Deshalb müssen die Europäer wohl oder übel auf deren Vorstellungen eingehen. Von Konrad Kleinknecht D as Scheitern der Klimakonferenz in Kopenhagen vergangenen Dezem­ ber spiegelt die realen Machtverhältnisse auf der Welt besser wider als die voll­ mundigen Erklärungen der Regierungs­ chefs. Die teilnehmenden Länder hatten versucht, eine Nachfolgeregelung für das Kioto-Protokoll zu finden. Dabei geht es um die Begrenzung der Emissionen der Treibhausgase Kohlendioxid, Methan und Distickstoffmonoxid. Der Misserfolg war abzusehen, seit die Mitglieder der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemein­ schaft (APEC) bei ihrem Treffen Mitte November in Singapur beschlossen hat­ ten, keine bindenden Verpflichtungen zur Reduktion der künftigen Emissionen einzugehen. Die APEC-Länder verursa­ chen mehr als die Hälfte der weltweiten 22 Emissionen, allen voran China, die USA und Indien. Der chinesische Regierungschef Wen Jiabao nahm zwar an der Kopenhagener Konferenz teil, machte aber keinerlei Konzessionen: China ist nicht bereit, sei­ ne wirtschaftliche Entwicklung zu Guns­ ten des Klimaschutzes zu bremsen. Es wird keine absoluten Begrenzungen für die Emissionen akzeptieren, sondern nur eine Reduktion im Verhältnis zur wirt­ schaftlichen Leistung. Auch in den USA, die pro Kopf der Bevölkerung am meis­ ten Kohlendioxid emittieren, gibt es im Senat und im Repräsentantenhaus mas­ sive Widerstände gegen staatliche Ein­ griffe zum Klimaschutz. Ähnliches gilt für Indien. Alle drei Länder haben das Kioto-Protokoll nicht unterschrieben und lehnen den Handel mit CO2-Emis­ sionszertifikaten ab. Fritz Höffeler ist Diplombiologe und arbeitet als wissenschaftlicher Illustrator sowie Autor in Hamburg. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · MÄRZ 2010 Aktuell Reuters / Ints Kalnins Alle Proteste und Appelle an die verantwortlichen Politiker wie den US-Präsidenten Obama konnten das Scheitern der Klimakonferenz in Kopenhagen nicht verhindern. Der Wissenschaftliche Beirat für glo­ bale Umweltveränderungen (WBGU) der Bundesregierung hat einen Katalog von Forderungen zur Reduktion der Kohlen­ dioxidemissionen aufgestellt, der in die deutsche Verhandlungsposition für Ko­ penhagen eingegangen ist. Dazu gehört die völkerrechtliche Verankerung des Ziels, den von Klimamodellen prognos­ tizierten Temperaturanstieg bis zum Jahr 2100 auf zwei Grad zu begrenzen. Da­ raus berechnen die WBGU-Mitglieder eine Gesamtmenge von 750 Milliarden Tonnen Kohlendioxid, die weltweit noch emittiert werden dürfen – eine Zahl, die naturgemäß mit großen Unsicherheiten behaftet ist. Diese Kohlendioxidmenge soll auf »Pro-Kopf-Basis« auf die Länder verteilt werden. Wenn man die Deutschland zugeteilte Ration durch die gegenwärtige jährliche CO2-Emission teilt, bleiben uns noch zehn Jahre normaler industrieller Pro­ duktion, bis das vom Komitee dekretierte Budget aufgebraucht ist; für die USA wä­ ren es sechs, für China 24 Jahre. Spätes­ tens ab 2020 müssten deutsche Unter­ nehmen also CO2-Emissionsrechte bei Entwicklungsländern kaufen, die diese nicht benötigen. Für die hiesige Industrie würde das – bei einem geschätzten Preis von 20 Euro pro Tonne CO2 – eine kaum zu verkraftende Belastung von rund zehn Milliarden Euro im Jahr be­ deuten. Dabei wäre mit diesem Opfer weder dem Weltklima noch der Welt­ wirtschaft geholfen. Wir würden unsere Sozialsysteme destabilisieren, den bis 2100 prognostizierten Temperaturanstieg aber nur um zwei Jahre hinauszögern. Nach dem Scheitern von Kopenhagen dürfte China seine jährlichen Emissionen in den nächsten zehn Jahren um 80 Pro­ zent steigern – so die Einschätzung der Internationalen Energieagentur IEA. Bei ungebremstem Wachstum von sechs bis zehn Prozent wird sich in diesem Zeit­ raum die Wirtschaftsleistung verdoppeln. Immerhin will die chinesische Regierung die Kohlen­dioxid­emis­sio­nen »pro erwirt­ schafteten Yuan« um etwa 40 Prozent senken, indem sie in den kommenden zehn Jahren 30 neue Kernkraftwerke in Betrieb nimmt, die Wasserkraft ausbaut und Kohlekraftwerke modernisiert. Trotzdem werden die jährlichen CO2Emissionen von sechs auf zehn Milliar­ den Tonnen steigen und damit ein Drit­ tel der globalen Emissionen ausmachen. Nimmt man die etwas reduzier­­ten ameri­ kanischen und die steigen­den indischen Emissionen hinzu, ergibt eine grobe Ab­ schätzung, dass schon bis zum Jahr 2020 etwa 320 Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre gelangen. Das ist fast die Hälfte der vom WBGU als globale Ober­ grenze definierten Menge. Angesichts dieser Aussichten muss man sich fragen: Leisten die Forderun­ gen des WBGU einen positiven Beitrag auf dem Weg zu einem weltweiten Ab­ kommen, wie es für Kopenhagen vorge­ sehen war, oder sind sie wenig hilfreich? Ist die Festlegung einer Verteilung auf Pro-Kopf-Basis wirklich »fair«, wie es im Text der WBGU heißt? Ist es angemes­ sen, dass einem Staat wie Deutschland, der die Welt mit hochwertigen Maschinen beliefert, pro Einwohner dieselbe Emis­ sion zugeteilt wird wie irgendeinem Ent­ Ideen für einen smarten Planeten Supercomputer arbeiten für jedermann. Muss wirklich jeder, der Rechenleistung benötigt, den Aufwand für ein eigenes Rechenzentrum betreiben: für Stromversorgung, Kühlung, Sicherheit – und für Reservekapazitäten, die dann doch die meiste Zeit brachliegen? Es ist an der Zeit, den Umgang mit dieser Ressource einfacher und intelligenter zu gestalten. Mit innovativen Technologien wie Cloud Computing kann man Rechenleistung heute zuverlässig und nach Bedarf punktgenau zur Verfügung stellen, wo, wann und wie sie gebraucht wird. Mit einem Wort, smart. Welchen Beitrag IBM dazu leistet, erfahren Sie unter ibm.com/think/de/cloud 23 IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken eingetr. Marken der International Business Machines Corp. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Andere Namen von Firmen, Produkten und Dienstleistungen können Marken oder eingetr. Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. © 2009 IBM Corp. Alle Rechte vorbehalten. SPEKTRUM DERoderWISSENSCHAFT · MÄRZ 2010 O&M IBM L 48/09 FORSCHUNG AKTUELL Springers Einwürfe Schluss mit der Klimakatastrophe! Ein Skeptiker sieht sich bestätigt. Einer meiner Freunde ist radikaler Klimaskeptiker. In seinem Blog spottet er tagtäglich über die Meinung, der Mensch erwärme durch den Ausstoß industrieller Treibhausgase die Erde. Er wittert eine Verschwörung der etablierten Klimaforscher und regt sich darüber ungeheuer auf. Das geht so weit, dass seine Frau und seine Kinder uns schon in der Tür hinter seinem Rücken anflehen, bloß nicht auf das heiße Thema einzusteigen, sonst sei der ganze Abend im Eimer. Das nützt aber nichts. Trotz lautstarker Proteste der Übrigen konfrontiert er mich mit einem Schwall von Argumenten gegen den anthropogenen Klimawandel und will hören, was ein doch immerhin naturwissenschaftlich Gebildeter darauf zu sagen weiß. Vorsichtig erwidere ich: Klimaexperte sei ich zwar nicht, aber dass die Mehrheit der Forscher irrt, fände ich schon sehr unwahrscheinlich. Darauf kommt mein Freund mit dem Fall Galilei als schlagendes Beispiel dafür, dass die herrschende Meinung durchaus im Unrecht sein kann. Da mag ich ihm ungern widersprechen. Wer will schon als einer dastehen, der ­kritiklos alles nachbetet? Nur gebe ich zu bedenken, der vermehrte Ausstoß des Treib­haus­gases Kohlendoxid seit Beginn der industriellen Revolution sei eine unbestreitbare Tatsache. »Ha!«, schreit mein Freund, »aber wieso kommt dann in der Klimageschichte oft zuerst die Erwärmung und erst danach der CO2-Anstieg?« Darauf kenne ich zwar eine Antwort der etablierten Klimaforscher, aber damit stecken wir schon mitten im Gestrüpp der Argumente für und wider. Schließlich spielt mein Klimaskeptiker seine stärksten Trümpfe aus: Kürzlich sind interne E-Mails von britischen Forschern an die Öffentlichkeit gelangt, in denen an einer Stelle ein »Trick« bei der Datenpräsentation erwähnt wurde, um den Klimawandel zu untermauern. Noch peinlicher: In den offiziellen Bericht des Weltklimarats IPPC für 2007 hat sich die groteske Behauptung eingeschlichen, bei anhaltendem CO2-Ausstoß würden die Gletscher des Himalaja bis zum Jahr 2035 komplett abschmelzen. Da hilft es mir wenig, den »Trick« als letztlich harmlosen Kunstgriff zu deuten und den demnächst vermeintlich eisfreien Himalaja als Schlamperei im leider zu wenig kontrollierten Teil II des IPCC-Reports zu bedauern. Offenbar haben sich in der Klima­debatte reine Forschung und politische Interessen so heillos vermengt, dass der Streit eine nur noch psychologisch erklärbare Härte angenommen hat. Wie Dan Kahan, Professor an der Yale Law School in den USA, zu diesem Thema anmerkt, ist jeder Mensch normalerweise bestrebt, in einer unübersichtlichen Problemlage seine vorgefasste Meinung emotional zu schützen, indem er sich die ihm passenden Argumente zu eigen macht und die übrigen ausblendet (Nature, Bd. 463, S. 296). Darum sind der E-Mail-»Trick« und die Himalaja-Gletscher-Katastrophe für meinen Freund ein gefundenes Fressen, für mich nur zwei Anekdoten aus einem weltumspan­ nenden Forschungsprozess. Um meinen Skeptiker wenn nicht umzustimmen, so doch wenigstens argumentativ zu erreichen, nehme ich mir vor, beim nächsten Schlagabtausch seiner Skepsis weit entgegenzukommen und zu sagen: »Ja, der anthropogene Klimawandel ist keine a priori feststehende Tatsache, sondern ein Forschungsgegenstand mit – wie in der Wissenschaft immer üblich – offenem Ergebnis. Nur: Bitte prüfe möglichst unvoreingenommen die vorläufigen Resultate. Und: Frage dich, wie plausibel die Gründe für eine weltweite Verschwörung der Klimaforscher sind.« Michael Springer Ich bin gespannt, wie mein Versuch ausgehen wird. 24 wicklungsland? Die deutschen Export­ güter gehen auch in diese Länder; deshalb sollten die mit der Fertigung notwen­dig verbundenen CO2-Emissionen dem Pro­ duzenten gutgeschrieben werden. Plädoyer für Pragmatismus Die Pro-Kopf-Regelung kommt den un­ terentwickelten Staaten zwar entgegen. Für die Hauptemittenten USA, China und Indien ist sie aber inakzeptabel. Die WBGU-Forderung hat die Verhand­lun­ gen in Kopenhagen deshalb eher er­ schwert als erleichtert. Will man das wichtigste Ziel der Klimapolitik errei­ chen, nämlich die großen CO2-Emit­ tenten für eine globale Regelung zu gewinnen, muss man auf deren Vor­ stellun­gen eingehen. Das hat die Bundes­ kanzlerin in Kopenhagen erfahren, wo sie auf »sehr selbstbewusste« Chinesen traf. Deren Vorstellung, die Emissionen in Bezug zur Wirtschaftsleistung setzen, sollte also ernsthafter in Betracht gezo­ gen werden. Zwar wollen die Chinesen derzeit ihre Emissionen nur um 40 Pro­ zent pro zusätzlicher Wirtschaftsleistung reduzieren. Doch vielleicht ließen sie mit sich darüber reden, den Reduktionssatz im Lauf der Zeit zu erhöhen und schließ­ lich auf die gesamte Wirtschafts­leis­tung auszudehnen. Es ist eine Illusion, zu glauben, ein kleines Land könne seine idealistischen Vorstellungen global durchsetzen. Ein pragmatischer Vorschlag wie der, die zu­ gelassenen CO2-Emissionen nach einem auszuhandelnden Schlüssel an der Wirt­ schaftsleistung auszurichten, könnte eher die Zustimmung der Großmächte fin­ den und zu einer globalen Reduzierung der Emissionen führen. Diese fiele zwar geringer aus als der zum Erreichen des Zwei-Grad-Ziels postulierte Wert. Aber wie so oft im Leben gilt auch hier: Bes­ ser das Machbare realisieren, als auf den eigenen Maximalforderungen zu behar­ ren und gar nichts zu erreichen. Im Al­ leingang kann weder Deutschland noch die Europäische Union die Welt retten! Konrad Kleinknecht ist Professor für Physik an der Universität Mainz und beschäftigt sich mit Hochenergiephysik sowie mit der Energieversorgung und dem Klimawandel. Er gehört dem Arbeitskreis Energie der Deutschen Physikalischen Gesellschaft an, deren Klimabeauftragter er zehn Jahre lang war. Sein Buch »Wer im Treibhaus sitzt – wie wir der Klima- und Energiefalle entkommen« ist 2007 erschienen. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · MÄRZ 2010 Schlichting! Astronomie & Physik Bilder wie aus dem Nichts geschöpft In einem komplexen Puzzle aus Spiegelungen sorgt erst eine menschliche »Leinwand« für Durchblick. Noch viel wunderbarer als der einfache Spiegel ist der durchsichtige Spiegel, z. B. ein Fenster, das auf eine Landschaft hinausgeht und in dem sich zugleich die Gegenstände unseres Zimmers spiegeln. Christian Morgenstern (1871 – 1914) Foto: H. Joachim Schlichting; Schemazeichnung: Spektrum der Wissenschaft, nach: H. Joachim Schlchting Von H. Joachim Schlichting Z uweilen überrascht die Wirklichkeit mit Szenerien, die man sich selbst kaum hätte ausdenken können. Vor ein regelrechtes Rätselraten stellen uns nun die in nebenstehendem Schnappschuss sichtbaren optischen Überlagerungen realer Ansichten sowie spiegelnder und diffuser Reflexionen. Wie lässt sich dieses Puzzle – das eigentlich eine ganz alltägliche Situation zeigt, fotografiert in einem Restaurant – wieder in seine Bestandteile zerlegen? Eine schematische Darstellung (Skizze rechts außen) hilft dabei. Sie zeigt die Gesamtsituation, von der das Foto nur in etwa den rot umrandeten Ausschnitt zeigt. Eine Frau (F) sitzt in einem Restaurant mit dem Rücken zu einem Fenster (Fenster 2), ihr gegenüber der Fotograf. Ein Raumteiler, nämlich eine spiegelnde Glasscheibe, ragt senkrecht zur Fensterfront in den Raum. Sie trennt den nebenan vor Fenster 1 stehenden Tisch, an dem ein Mann sitzt, von jenem des Fotografen. Der Fotograf hat eigentlich nichts anderes getan, als diesen Mann durch die Spiegelscheibe hindurch zu fotografieren. Alles andere ergibt sich von selbst, man könnte auch sagen: ist Physik. Denn die Frau spiegelt sich in der Scheibe, so dass sich ihr Spiegelbild (F*) mit dem Bild des Manns teilweise überlagert. Mit der Frau wird auch der durch Fenster 2 wahrnehmbare Hintergrund gespiegelt, ein von der Abendsonne hell erleuchtetes und von blauem Himmel überragtes Haus. Aber nur jene Teile der Spiegelung lassen sich überhaupt erkennen, für die insbesondere der Kopf des Manns als Leinwand dient. Denn er blendet das Tageslicht aus, das durch Fenster 1 in den Raum gelangt. Um seinen Kopf herum hingegen löscht die große Intensität des Tageslichts die Spiegelung am Raumteiler aus. Über dem Kopf des Manns ist schließlich ein dreieckiger Ausschnitt des blauen HimSPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · MÄRZ 2010 Optisches Rätsel – wie lässt es sich lösen? mels zu sehen. Hier setzt sich die Spiegelung an der Raumteilerscheibe fort, wie der obere Teil des gespiegelten Dachs erkennen lässt. Dieser wiederum wird nur deshalb sichtbar, weil außerhalb der Fenster auch eine heruntergelassene Markise das durch Fenster 1 dringende Tageslicht abblendet. Wie es dem Mann »gelingt«, Teile des gespiegelten Hauses und des Gesichts der Frau gleichsam aus dem Nichts heraus zu schöpfen und mit ihnen zu einem hybriden Gebilde aus Virtualität und Realität zu verschmelzen, lässt sich nicht ganz leicht reproduzieren. Optische Ansichten wie diese werden uns zwar auch in den interaktiven Stationen mancher Science Center geboten. Dort setzt man sich an einen Tisch und blickt durch eine Glasscheibe auf sein Gegenüber. Durch Variation der Beleuchtung lassen sich dann gezielt eindrucksvolle Verschmelzungen der Gesichter herbeiführen. Die Komplexität und Ästhetik solcher Installationen bleibt jedoch weit hinter dem zurück, was uns der Alltag häufig genug ganz absichtslos vor Augen führt. Man muss nur lernen, dies auch so zu sehen – und dafür genügen bereits geringe Kenntnisse in geometri­scher Optik. Fenster 1 Fenster 2 Männerkopf Frauen kopf* (F*) H* Frauen kopf (F) lscheibe Spiege Alles nur vorgespiegelt? Schema der Topologie des Fotos H. Joachim Schlichting ist Professor und Direktor des Instituts für Didaktik der Physik an der Univer­sität Münster. 25 H Ron Miller Titelthema: Titelthema: stellare stellare Dynamik dynamik 26 Diesen Artikel können Sie als Audiodatei beziehen; siehe www.spektrum.de/audio Bis zu 3500 Sterne könnten einst in unmittelbarer Nähe des gerade entstehenden Sonnen­ sys­tems geleuchtet haben, einer von ihnen explodierte sogar in direkter kosmischer Nachbarschaft. Sie alle sind oder waren Geschwister der Sonne: Entstanden aus ein und derselben interstellaren Wolke, drängten sie sich ursprünglich in einer Region mit einem Durchmesser von wenigen Lichtjahren. Obwohl sie mittlerweile rund um die Milch­ SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 straße verteilt sind, könnten Astronomen einige von ihnen schon bald aufspüren. Astronomie & Physik Auf der Suche nach den Geschwistern der Sonne Heute ist die Sonne eine Einzelgängerin. Entstanden ist sie jedoch gemeinsam mit Tausenden anderer Sterne. Nach ihren stellaren Geschwis­ tern fahnden Forscher nun in direkter kosmischer Nachbarschaft. Von Simon F. Portegies Zwart S o manchen ergreift unter dem dunklen Himmel einer sternklaren Nacht das Gefühl der Einsamkeit. Kein Wunder: Der Nachthimmel ist genau deshalb so dunkel, weil auch unser Sonnensystem recht abgelegen ist. Selbst unsere nächsten stellaren Nach­ barn erscheinen gerade einmal als win­ zige Lichtpunkte, und unsere schnellsten Raumsonden wären Zehntausende von Jahren zu ihnen unterwegs. Wir leben also auf einer kleinen Insel in einem rie­ sigen kosmischen Meer. Doch nicht jeder Stern ist so abgelegen. Etwa jeder zehnte gehört zu einem Sternhaufen, einem we­ nige Lichtjahre durchmessenden Schwarm aus Hunderten oder auch Zehntausenden von Sternen. Tatsächlich entstehen sogar die meisten Sterne in solchen Haufen. Gewöhnlich lösen sich diese Ansamm­ lungen aber im Verlauf von Jahrmilliar­ den wieder auf, und ihre Mitglieder ver­ teilen sich in der Milchstraße. Immer mehr Indizien sprechen dafür, dass auch die Sonne erst allmählich in ihre SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 abgeschiedene Lage geriet. Während die Astronomen unser Zentralgestirn lange Zeit für ein »Einzelkind« hielten, gehen mittlerweile viele von ihnen davon aus, dass es vielleicht 1000 oder mehr Ge­ schwister besitzt, die alle etwa zur selben Zeit geboren wurden. Anders gesagt: Als das Sonnensystem im Entstehen begriffen war, erschien der umgebende Weltraum möglicherweise bei Weitem nicht so leer. Hätten wir schon damals die Gelegenheit gehabt, ihn zu betrachten, wären unsere Augen vom Licht geblendet worden. Unser Blick wäre auf einen mit hellen Sternen übersäten Nachthimmel gefallen, von de­ nen einige heller leuchteten als der heutige Vollmond. Manche von ihnen hätten wir sogar am Taghimmel entdecken können. Doch der Sternhaufen, zu dem unsere Sonne vermutlich gehörte, existiert schon lange nicht mehr. Wie er ausgesehen ha­ ben könnte, darüber lassen sich allerdings eine ganze Reihe von Überlegungen an­ stellen. Aus vielen Beobachtungsdaten habe ich einige Eigenschaften dieses Hau­ fens ermittelt und daraus auf die Bahnen geschlossen, auf denen die früheren Hau­ In Kürze r Lange vermuteten Astro­ nomen, die Sonne sei schon immer ein einsamer Stern gewesen. Doch die meisten Sterne entstehen in Stern­ haufen. Untersuchungen an Meteoriten und Kometen­ bahnen deuten nun darauf hin, dass auch die Sonne keine Ausnahme machte. r Der Geburtshaufen der Sonne könnte aus bis zu 3500 Sternen bestanden haben, die sich in einer Region mit nur zehn Licht­ jahren Durchmesser drängten. Dann fiel dieser Haufen allerdings auseinander. r Längst haben sich die Geschwister der Sonne, die dort etwa zeitgleich mit ihr entstanden waren, rund um die halbe Galaxis verteilt. Doch die Chancen stehen gut, dass der Astrometrie­ satellit Gaia einige von ihnen identifizieren wird. So ließen sich zahlreiche Lücken unseres Wissens über die Frühzeit des Sonnensystems schließen. 27 Titelthema: stellare dynamik Als unsere Sonne gerade einmal 1,8 Millionen Jahre alt war, explodierte in nächster Nähe ein riesiger Stern fenmitglieder durch die Galaxis unterwegs sein könnten, und auf ihre jetzigen Aufent­ haltsorte. Obwohl sie sich mit Millionen an­ derer Sterne vermischt haben, können wir sie so vielleicht doch identifizieren. Hierzu bietet das Satellitenobservatorium Gaia, das die eu­ ropäische Raumfahrtorganisation Esa 2012 starten will, die nächste große Chance. Dem »Global Astrometric Interferometer for Astro­ physics« würden sich die stellaren Geschwister der Sonne durch entsprechende Bahnen eben­ so wie durch ihre sonnenähnliche Zusammen­ setzung verraten. Und im Erfolgsfall böte sich endlich die Gelegenheit, die Bedingungen zu rekonstruieren, unter denen unser Sonnen­ system einst aus einer formlosen Wolke aus Gas und Staub entstanden ist. Den bislang überzeugendsten Beleg dafür, dass unsere Sonne tatsächlich Geschwister be­ sitzt, fanden Shogo Tachibana, der jetzt an der Universität Tokio lehrt, und Gary R. Huss, jetzt an der University of Hawaii in Manoa, im Jahr 2003. Als die beiden Forscher zwei Mete­ oriten aus der Frühzeit des Sonnensys­tems un­ tersuchten, welche die Jahrmilliarden wohl na­ hezu unverändert überstanden haben, stießen sie in chemischen Verbindungen, in denen sie mit Eisen gerechnet hatten, auf Nickel-60. Dieses Isotop entsteht, wenn Eisen-60 radio­ aktiv zerfällt – die bewussten Verbindun­gen aber bilden sich nur, wenn tatsächlich Eisen vorliegt. Folglich muss das Eisen-60 – in einem seiner Halbwertszeit entsprechenden Zeit­raum – sowohl synthetisiert worden als auch ins Sonnensystem gelangt und schließlich in die Meteoriten eingelagert worden sein, denn sonst hätten sich diese chemischen Verbin­ dungen nicht bilden können. Nach neuesten Schätzungen beträgt die radioaktive Halbwerts­ zeit von Eisen-60 rund 2,6 Millionen Jahre. Kosmisch gesehen ist dies nur ein Augenblick: Das Eisen muss also aus unmittelbarer Nach­ barschaft stammen, und als wahrscheinlichste Quelle gilt die Explosion eines Sterns. Eine Supernova in weniger als fünf Lichtjahren Entfernung Aus den Ergebnissen von Tachibana und Huss sowie aus weiteren Isotopenmessungen zog das Team um Leslie Looney von der University of Illinois im Jahr 2006 den Schluss: Als unsere Sonne gerade einmal 1,8 Millionen Jahre alt war, muss es in weniger als fünf, vielleicht so­ gar in gerade einmal 0,07 Lichtjahren Entfer­ nung zu einer Supernova gekommen sein. (Die­se Abschätzungen müssen nun unwesent­ lich korrigiert werden, da die genannte, erst im August 2009 veröffentlichte Halbwertszeit von Eisen-60 um 1,1 Millionen Jahre höher liegt als ursprünglich vermutet.) Die Geburt des Urhaufens Welche Ereignisse haben zur Geburt der Sonne geführt? Und was geschah danach? J. Jeff Hester und Steven J. Desch von der Arizona State University und ihre Kollegen haben diesen Pro- Ionisationsfront zusammenge­ balltes Gas massereicher Stern Zunächst bildet sich eine riesige Wolke aus molekularem Gas und beginnt, unter ihrem eigenen Gewicht zu kollabieren. 28 In den dichtesten Regionen der Wolke entstehen ein oder mehrere massereiche Sterne. Schockfront Jeder dieser massereichen Sterne emittiert ultraviolette Strahlung und ionisiert so das Gas in seiner Umgebung. In der Folge breitet sich eine Schockfront oder Dichtewelle mit einer Geschwindig­ keit von einigen Kilometern pro Sekunde nach außen aus. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Wäre die Sonne damals genauso einsam gewesen wie heute, müsste der Zufall bei die­ sem Ereignis eine große Rolle gespielt haben. Schließlich wären die Supernova und die Ent­ stehung der Sonne räumlich wie zeitlich fast zusammengefallen. Geriet also ein masse­ reicher Stern zufällig in die Umgebung der jungen Sonne, um just dort zu explodieren? Doch keine andere Supernova fand je so nahe bei der Sonne statt; ein solches Ereignis hätte wahrscheinlich alles Leben auf der Erde aus­ gelöscht. Weitaus plausibler ist die Annahme, dass die junge Sonne und der explodierte Stern ein und demselben dicht gepackten Sternhau­ fen angehörten. Dann ist eine nahe Supernova längst nicht mehr so unwahrscheinlich. Die Vorstellung, dass die Sonne Teil eines Sternhaufens war, steht im Widerspruch zu dem, was noch immer in vielen Lehrbüchern zu lesen ist. Traditionell fassten Astronomen Sternhaufen in zwei Kategorien: galaktische oder offene Haufen sowie Kugelsternhaufen. Offene Sternhaufen sind jung, ihre Sterndichte ist nicht sehr hoch, und sie finden sich haupt­ sächlich in oder nahe der Milchstraßen­ebene. Das protoypische Beispiel für sie ist M44, die Krippe oder Praesepe. Diesen Sternhaufen kann man unter bestimmten Bedingungen selbst mit unbewehrtem Auge als Nebelfleck am Nacht­ himmel entdecken, tatsächlich aber ist er eine Nolan Walborn (NASA, STScI), Jesús Maíz-Apellániz (NASA, STScI) und Rodolfo Barbá (La Plata Observatorium, Argentinien) Astronomie & Physik Ansammlung von bis zu 350 Sternen, die alle vor rund 700 Millionen Jahren entstanden. Im Gegensatz zu offenen Sternhaufen sind Kugelsternhaufen sehr alt, dicht bevölkert und rund um die Galaxis zu finden. Den ers­ ten seiner Art hatte der italienische Astronom Giovanni Maraldi im Jahr 1746 entdeckt: M15 enthält etwa eine Million Sterne und ist rund zwölf Milliarden Jahre alt. Doch unsere Sonne passt weder in die eine noch in die andere Kategorie von Sternhaufen. Ihr relativ hohes Alter von 4,6 Milliarden Jah­ ren deutet auf einen Ursprung in einem Kugel­ Der Sternhaufen R136 im Tarantelnebel ähnelt dem Geburtshaufen der Sonne, weist allerdings eine erheblich höhere Sterndichte auf. zess rekonstruiert. Dabei stützten sie sich auf Beobachtungen zahlreicher Sternhaufen ebenso wie auf die möglichen Eigenschaften jenes Haufens, zu dem einst auch unsere Sonne gehörte. Don Dixon neugeborene Sonne Binnen weniger Millionen Jahre erreicht die Schockfront Regionen bereits verdichteten Gases und komprimiert diese weiter. Sie kollabieren, so dass Sterne entstehen – darunter auch unsere Sonne. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Einige 100 000 Jahre später erreicht auch die Ionisationsfront die neu­geborene Sonne. Das sie umgebende dünne Gas wird nun von dem eintreffenden heißen, ionisierten Gas erhitzt. 29 Titelthema: stellare dynamik Den Geschwistern Auf der Spur Mehrere Indizien deuten darauf hin, dass die Sonne in einem Sternhaufen entstanden ist: ➤ Meteoriten aus der Frühzeit des Sonnensystems enthalten die Zerfallspro­ dukte kurzlebiger Radio­ nuklide wie Eisen-60 und Aluminium-26. Quelle der Isotope ist wahrscheinlich ein in der Nähe explodierter Stern. Die räumliche Nähe und das ungefähre zeitliche Zusammentreffen dieser Supernova mit der Entste­ hung der Sonne ist höchst unwahrscheinlich – es sei … >>> Fortsetzung auf gegenüberliegender Seite sternhaufen hin, ihre Position in der Milchstra­ ßenebene eher auf einen galaktischen Haufen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde allerdings klar, dass sich nicht alle Sternhaufen eindeutig einem der beiden klassischen Typen zuordnen lassen (siehe SdW 1/2004, S. 24). Zu verdanken ist dies ursprünglich dem Sternhaufen R136 in der Großen Magellan­ schen Wolke. Als ihn die Astronomen im Jahr 1960 entdeckt hatten, hielten sie R136 zu­ nächst für einen einzelnen, riesenhaften Stern mit 2000-facher Sonnenmasse, der 100 Milli­ onen Mal stärker als die Sonne leuchtet. Im Jahr 1985 zeigten jedoch Gerd Weigelt und Gerhard Baier, beide damals an der Universi­ tät Erlangen-Nürnberg, mit Hilfe eines hoch­ auflösenden Abbildungsverfahrens, dass R136 ein nur wenige Millionen Jahre alter Haufen ist, der aus rund 10 000 Sternen besteht. Sei­ ne Sterndichte ist so groß wie die eines Kugel­ sternhaufens, doch sein Alter ist das eines ga­ laktischen Sternhaufens. R136 ist also das feh­ lende Glied, das beide Typen von Sternhaufen miteinander verbindet. Seither haben Beobachter viele weitere ähn­ liche Haufen aufgespürt, doch damals herrsch­ te großes Erstaunen unter den Theoretikern. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass Sterne auch heute noch in derart dichten Haufen entstehen. Gleichzeitig waren wir erleichtert, denn wir konnten die Daten auch nicht durch die Existenz eines einzelnen Riesensterns er­ klären. So oder so waren wir aber gezwungen, all unser Wissen über Sternhaufen zu über­ denken. Mittlerweile gehen wir davon aus, dass alle Sterne einschließlich der Sonne in dichten Haufen wie R136 entstehen. Ein Sternhaufen wie dieser bildet sich aus einer interstellaren Gaswolke, um sich dann je nach seiner Masse und physikalischen Umgebung entweder zu einem galaktischen oder zu einem Kugelsternhaufen weiterzuentwickeln. In solchen Haufen werden einige wenige sehr massereiche Sterne von vielen Leichtge­ wichten begleitet. Die Exemplare mit der ge­ ringsten Masse, etwa einem Zehntel der Son­ nenmasse, stellen die Mehrzahl der Haufen­ mitglieder. Darüber hinaus gilt auf der gesamten Massenskala die Faustregel: Betrach­ tet man Sterne einer bestimmten Masse, so ist ihre Anzahl 20-mal höher als jene von Ster­ nen der zehnfachen Masse. Wenn wir davon ausgehen, dass einst ein Stern von 15- bis 25-facher Sonnenmasse in der Nähe der Sonne zur Supernova wurde, können wir also schließen, dass der Geburts­ haufen der Sonne rund 1500 kleinere Sterne als diesen enthielt, und kennen so auch seine Min­ Das langsame Sterben des Urhaufens Bevor der Geburtshaufen der Sonne sich auflöst, drückt er dem Sonnensystem noch seinen Stempel auf. Die Strahlung anderer Sterne »stanzt« seine Form aus, eine nahe Supernova protoplanetare Scheibe durch Radioaktivität aufgeheizter Asteroid Binnen 10 000 Jahren hat die durchziehende Ionisationsfront das zirkumsolare Gas weit im Weltraum verteilt. Die protoplanetare Scheibe um die Sonne ist der ultravioletten Strahlung nun direkt ausgesetzt. 30 In den nachfolgenden 10 000 Jahren werden außen liegende Bereiche der Scheibe durch die Strahlung verdampft, bis sie einen Radius von nur noch rund 50 Astronomischen Einheiten besitzt. Etwa zwei Millionen Jahre später explodiert ein masse­ reicher Stern. Seine Trümmer, darunter gerade erst erbrütete Radioisotope, erreichen das Sonnensystem. Sie reichern die Vorläufer unserer Planeten an und liefern die Energie für deren frühe geologische Aktivität. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Astronomie & Physik destmasse. Die maximale Masse ergibt sich aus einer weiteren Überlegung. Damit massereiche Sterne, die als Supernova explodieren, ihre kleineren Geschwister nennenswert mit Mate­ rie anreichern können, müssen sie sich eher nahe dem Haufenzentrum befinden. In einem größeren Haufen aber benötigen massereiche Sterne längere Zeit, um sich dort anzusam­ meln. Auf Basis dieser Rahmenbedingungen zeigen meine Simulationen, dass der Haufen vermutlich weniger als 3500 Sterne enthielt. Sterne mit 15- bis 25-facher Sonnenmasse explodieren nach einer Lebensdauer von etwa sechs bis zwölf Millionen Jahren, das Exem­ plar im Geburtshaufen muss also entspre­ chend lange Zeit vor der Sonne entstanden sein. Dass sich besonders massereiche Sterne eines künftigen Haufens gewöhnlich als erste bilden – mehrere Millionen Jahre vor sonnen­ ähnlichen Sternen –, konnten Astronomen an anderen Himmelsobjekten wie etwa dem be­ rühmten Trapez-Haufen im Orionnebel be­ reits nachweisen. Ein Haufen der vermuteten Größe ist allerdings gravitativ zu schwach, um sich zu einem Kugelsternhaufen zu entwi­ ckeln. Stattdessen geschah wohl Folgendes: Vor ihrem Ende als Supernovae schleuderten die massereichen Sterne im Haufenzentrum riesige Mengen Gas in den Raum und explo­ dierten schließlich. Dadurch verringerte sich die Materiedichte im Haufen und auch sein Gravitationsfeld, so dass er expandierte und nach einer Lebensdauer von 100 bis 200 Mil­ lionen Jahren langsam auseinanderfiel. Doch zurück zu der Zeit, bevor das geschah und die Sterne im Haufen noch dicht gepackt waren: Es ist leicht vorstellbar, dass es einen von ihnen damals auf eine Bahn verschlug, die quer durch das Sonnensystem führte. Durch einen solchen engen Vorübergang wären Pla­ neten, Asteroiden und Kometen aus ihren ur­ sprünglichen kreisförmigen Bahnen, die alle in ein und derselben Ebene lagen, herausgerissen und in stark elliptische und geneigte Bahnen geworfen worden. Derartige Umlaufbahnen besitzen tatsächlich viele Kometen, die mehr als 50 Astronomische Einheiten (AE, etwa die mittlere Entfernung Erde – Sonne) von der Sonne entfernt sind (und sie damit auch jen­ seits der Bahn von Pluto umrunden). Die innere Dynamik des Sonnensystems, nicht einmal der gravitative Einfluss des Pla­ neten Jupiter, scheint dafür eine Erklärung zu liefern. Am wahrscheinlichsten ist daher, dass die Kometenbahnen einst durch einen Stern durcheinandergebracht wurden, der in einem Abstand von etwa 1000 AE an der Sonne vorüber­zog. Daraus lässt sich auch schließen, >>> Fortsetzung von S. 30 … denn, unser Zentralgestirn besaß einst noch viele Begleiter. ➤ Schwere Elemente sind in der Sonne häufiger, als es ihre Position in der Galaxis erwarten lässt. Möglicher­ weise stammen auch diese Elemente teilweise von dem explodierten Stern. ➤ Dass Uranus und Neptun wesentlich kleiner als Jupiter und Saturn sind, könnte sich durch die starke Strahlung eines nahen Sterns erklä­ ren lassen, der einst ihre Außenschichten verdampft hat. Näher bei der Sonne gelegene Planeten entgingen diesem Schicksal, weil interplanetarisches Gas sie von der Strahlung abschirmte. reichert die wachsenden Planeten mit radioaktiven Isotopen an, und die Schwerkraft eines vorbeiziehenden Sterns wirbelt die Umlaufbahnen der Kometen durcheinander. Don Dixon Zu einem unbekannten Zeitpunkt während der folgenden etwa 100 Millionen Jahre zieht ein anderer Stern des Haufens in wenigen tausend Astronomischen Einheiten Entfernung an der Sonne vorüber. Seine Anziehungskraft wirft Kometen in den Außen­ bereichen des Sonnensystems aus der Bahn. Ihre neuen Umlaufbahnen sind nun stark gegen die Ebene des Systems geneigt, in der sich die Planeten bewegen. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Die Anziehungskraft des Sternhaufens nimmt durch die Selbstzerstörung seiner massereichsten Mit­ glieder ab, so dass er binnen 100 bis 200 Millionen Jahren zerfällt. Die Haufenmitglieder, darunter die Sonne, treiben nun langsam auseinander. 31 Titelthema: stellare dynamik dass kein stellarer Eindringling je näher als 100 AE an die Sonne herangekommen ist, denn die Planeten selbst besitzen außeror­ dentlich reguläre Umlaufbahnen. Diese Überlegungen erlaubten mir nun, die Ausdehnung des Haufens abzuschätzen. Eine hinreichend große Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Stern während der Lebensdau­ er des Haufens in einem Abstand von 1000 AE an der Sonne vorüberzieht, ergibt sich erst bei einem Haufendurchmesser von weniger als zehn Lichtjahren. Andererseits muss er größer als drei Lichtjahre gewesen sein, damit im gleichen Zeitraum und wiederum mit hin­ reichender Wahrscheinlichkeit kein Stern nä­ her als 100 AE an die Sonne herankam. Kurz gesagt: Der Geburtshaufen der Sonne ähnelte R136, wies aber eine deutlich geringere Stern­ dichte auf. So standen die Sterne auch weit genug auseinander, um die Entstehung von Planeten nicht zu behindern. Doch wo in der Galaxis befand sich dieser Geburtshaufen einst? Das Sonnensystem be­ wegt sich mehr oder weniger innerhalb der ga­laktischen Scheibe auf einer nahezu kreis­ förmigen Bahn um das galaktische Zentrum. Derzeit ist es rund 30 000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt, befindet sich etwa 15 Licht­ jahre oberhalb der galaktischen Ebene und be­ wegt sich mit einer Geschwindigkeit von rund 234 Kilometer pro Sekunde. Die Sonne hat das galaktische Zentrum seit ihrer Entstehung also schon 27-mal umrundet. Allerdings ist ihre Bahn nicht geschlossen. Vielmehr wurde ihr vom Gravitationsfeld der Milchstraße – das Astronomen aus der Bewegung von Sternen und interstellaren Gaswolken ermitteln kön­ nen – eine komplexere Bahn aufgezwungen. Unerklärliches Ergebnis Unter der bislang vorläufigen Annahme, dass dieses Gravitationsfeld in den vergangenen 4,6 Milliarden Jahren unverändert blieb, habe ich die Bahn des Sonnensystems zeitlich zurück­ verfolgt. Das Ergebnis meiner Berechnungen: Die Sonne entstand 33 000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt und etwa 200 Lichtjahre oberhalb der galaktischen Ebene. Dieses Resultat ist allerdings verwirrend. Denn die Region um den berechneten Geburtsort der Sonne ist ärmer an schweren Elementen – deren Häufigkeit zu den Außenbezirken der Milchstraße hin abnimmt –, als es ihr Vor­ kommen in der Sonne erwarten ließe. Mach­ ten die Forscher allein die solaren Werte zur Basis ihrer Überlegungen, würden sie vielmehr erwarten, dass die Sonne 9000 Lichtjahre nä­ her am galakti­schen Zentrum entstanden ist. Eine Erklärung für diese Diskrepanz steht indessen noch aus. Vielleicht hat ja dieselbe Supernova, die einst die Meteoriten mit Ei­ sen-60 anreicherte, auch die Sonne mit zu­ Do n Di xo n Die Kometenbahnen wurden einst durch einen Stern durch­ einander­gebracht, der nahe an der Sonne vorüberzog Die nächsten Nachbarn Die Sonne ist gegenwärtig rund 30 000 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt. In einem Umkreis von zehn Licht­ jahren um unser Zentralgestirn kennen die Astro­nomen nur elf weitere stellare Nach­ barn. Im einstigen Geburtshaufen der Son­ ne hingegen befanden sich im selben Vo­ lumen über 1000 Sterne. Barnards Stern Alpha Centauri Sonne Trifidnebel Adlernebel Sirius Lagunennebel Plejaden hre tja Sonne ich 0L 2 32 Orion-Arm Orionnebel SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Eine Familie zerfällt Astronomie & Physik unterstützen. Bereits die Entdeckung eines einzigen solchen Sterns würde den Forschern helfen, den Ursprung des Son­ nensystems zu rekonstruieren. Don Dixon Indem sie die wahrscheinlichen Bahnen der Geschwister der Sonne berechnen, können Theoretiker abschätzen, wo sich diese heute befinden, und die Beobachter so bei ihrer Suche 10 000 Lichtjahre Sonne posi­ ursprünglicher original Sternhaufen tion of the sun 200 Millionen Jahre nach Entstehung der Sonne Während sie mit mehr als 200 Kilometer pro Sekunde um das Zentrum der Galaxis kreisen, entfernen sich die Sonne und ihre Geschwister mit einer Geschwindigkeit von nur einigen Kilometern pro Sekunde voneinander. 250 Millionen Jahre nach Entstehung der Sonne Nachdem sie das galaktische Zentrum zu einem Nach 27 Umläufen bilden die Sterne einen Viertel umrundet haben, sind die Sterne erst über Zehntausende von Lichtjahren langen Strom. eine Strecke von etwa 100 Lichtjahren verstreut. Etwa 50 von ihnen dürften noch immer maximal 300 Lichtjahre von der Sonne entfernt sein. sätzlichen schweren Elementen versorgt? Oder meine Bahnberechnungen sind falsch, weil sich das Gravitationsfeld der Milchstraße im Lauf der Zeit doch verändert hat. Oder aber die Bahn des Sonnensystems unterlag zeitwei­ se dem Einfluss naher Sterne oder Gaswolken. Widmen wir uns indessen den Geschwis­ tern der Sonne. Auch sie dürften das Milch­ straßenzentrum mit Geschwindigkeiten von über 200 Kilometer pro Sekunde umkreisen. Ihre Relativgeschwindigkeiten, also die Ge­ schwindigkeitsunterschiede zwischen den ehe­ maligen Haufenmitgliedern, hängen aber vor allem von den gegenseitigen Anziehungskräf­ ten im ursprünglichen Haufen ab und betra­ gen lediglich wenige Kilometer pro Sekunde. Der ursprüngliche Sternschwarm hat sich wäh­ rend der 27 Umläufe um das galaktische Zen­ trum darum langsam zu einem gestreckten Bo­ gen ausgebreitet, der sich mittlerweile über die Hälfte einer Umlaufbahn erstrecken dürfte. Meinen Berechnungen zufolge heißt das aber, dass sich innerhalb eines Radius von 300 Lichtjahren um unsere gegenwärtige Position noch immer etwa 50 Geschwister der Sonne aufhalten. Sucht man in bis zu 3000 Lichtjah­ ren Entfernung, könnte man sogar auf 400 solcher Sterne stoßen! Diese würden der Bahn der Sonne entweder folgen oder ihr voraus­ eilen, je nachdem, welche Relativgeschwindig­ keiten sie ursprünglich besaßen und wann sie sich von dem Sternhaufen ablösten. Am besten sucht man nach ihnen in der Milchstraßenebene, und zwar entweder in Be­ wegungsrichtung des Sonnensystems oder ge­ SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 nach 4,6 Milliarden Jahren (heute) nau in entgegengesetzter Richtung. Einer mei­ ner Studenten fahndet bereits in einem Kata­ log von Sternen, die der europäische Satellit Hipparcos in den frühen 1990er Jahren aus­ findig gemacht hat. Doch die Messungen wa­ ren wahrscheinlich nicht genau genug, um die gesuchten Exemplare sicher zu identifizieren. Anders Gaia: Der Satellit soll binnen fünf Jahren mit höchster Genauigkeit die dreidi­ mensionalen Raumpositionen und Geschwin­ digkeiten von etwa einer Milliarde Sterne messen. Diese Volkszählung wird nahezu alle Sterne erfassen, die sich in einem Radius von mehreren tausend Lichtjahren um die Sonne aufhalten. In diesen Daten können wir dann nach viel versprechenden Kandidaten Aus­ schau halten und auch ihre Zusammenset­ zung überprüfen. Sie sollte jener der Sonne ähneln, da die einstige Supernova natürlich nicht nur das junge Sonnensystem, sondern auch andere Sternsysteme im Haufen mit schweren Elementen angereichert hat. Identifizieren wir auch nur einen einzigen Geschwisterstern der Sonne, würde uns dies wertvolle Informationen über die Frühzeit des Sonnensystems verschaffen – eine Epoche, über die wir bislang kaum etwas wissen. Zu­ dem bieten die Geschwister der Sonne auch exzellente Voraussetzungen für die Suche nach lebensfreundlichen Planeten. Die Sonne treibt heute zwar relativ isoliert durchs Weltall, doch viele ihrer Besonderheiten – nicht zuletzt die Tatsache, dass ihr Licht auch auf einen be­ wohnten Planeten fällt – lassen sich nur im Kontext ihrer Familiengeschichte begreifen. Simon F. Portegies Zwart ist Pro­fessor für Computer-Astrophysik an der Sternwarte der niederländischen Universität Leiden. Seine Spezial­ gebiete sind Anwendungen für Hochleistungsrechner und gravitative stellare Dynamik insbeson­dere in Systemen hoher Sterndichte. Elmegreen, B. et al.: The Formation of Star Clusters. In: American Scientist 86(3), S. 264 – 273, Mai-Juni 1998. Hester, J. J. et al.: The Cradle of the Solar System. In: Science 304, S. 1116 – 1117, 21. Mai 2004. Looney, L. W. et al.: Radioactive Probes of the Supernova-Contaminated Solar Nebula: Evidence That the Sun Was Born in a Cluster. In: Astrophysical Journal 652(2), S. 1755 – 1762, 1. Dezember 2006. Portegies Zwart, S. F.: The Lost Siblings of the Sun. In: Astro­physical Journal Letters 696(1), S. L13 – L16, 1. Mai 2009. Weblinks zu diesem Thema finden Sie unter www.spektrum.de/ artikel/1019950. 33 Metrologie Die Zukunft von Kilogramm und Co. Im internationalen Einheitensystem der Zukunft werden auch Maßeinheiten wie Kilogramm oder Ampere anhand von Naturkonstanten definiert sein. Das aktuelle Einheitensystem ➤ Die Sekunde ist das 9 192 631 770-Fache der ­ Periodendauer der Strahlung, die dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustands von Atomen des Nuklids 133 Cs entspricht. ➤ Der Meter ist die Länge der Strecke, die Licht im Vakuum während der Dauer von 1/299 792 458 Se­kunden durchläuft. ➤ Das Kilogramm ist die Einheit der Masse; es ist gleich der Masse des internationalen Kilogramm­ prototyps. ➤ Das Ampere ist die Stärke eines konstanten elektrischen Stroms, der, durch zwei parallele, geradlinige, unendlich lange und im Vakuum im Abstand von einem Meter angeordnete Leiter von vernachlässigbar kleinem, kreisförmigem Querschnitt fließend, zwischen je einem Meter Leiterlänge die Kraft 2 · 10 –7 Newton hervorrufen würde. >>> Fortsetzung auf S. 37 34 Von Robert Wynands und Ernst O. Göbel M ögen Juristen und Politiker noch darüber debattieren, wie Euro­ pas Staaten enger miteinander zu verknüpfen seien, beim Mes­ sen und Wiegen ist die Einheit Eu­ropas längst erreicht. Schon 1875 vereinbarten näm­ lich 17 Staaten aus aller Welt, darunter auch das Deutsche Reich, in der »Inter­natio­nalen Konvention für Maße und Gewichte« (kurz: »Meterkonvention«) einen gemeinsamen Satz von Maßeinheiten. Sie verwirklichten damit den Traum der französischen Revolu­tionäre, die gut 80 Jahre zuvor ein von lokalen Gege­ benheiten unabhängiges System anstrebten – an Stelle der üblichen Maßeinheiten wie Elle und Zoll, die oft von den Unterarmlängen oder Daumenbreiten der jeweiligen Herrscher abgeleitet waren. Allein in den deutschen Territorien gab es Dutzende von Ellen, die von 40,38 Zentimeter (cm) Länge in Erfurt bis 79,90 cm in München reichten. Eine Ver­ einheitlichung hatte nicht nur ideologische Gründe: Die Vielzahl an Standards er­ schwerte den freien Handel und bremste da­ mit die wirtschaftliche Entwicklung. Heute erscheinen uns Einheiten wie Meter, Kilogramm und Grad Celsius als selbstver­ ständlich, gelten sie doch fast überall auf der Welt. Eine Ausnahme machen beispielsweise die USA, wo noch heute Meile, Unze und Grad Fahrenheit das Alltagsleben durchdrin­ gen. Das ist umso bemerkenswerter, als die Vereinigten Staaten seit Anbeginn Mitglied der Meterkonvention waren. Dass auch hier zu Lande Zollangaben bei Computerfestplat­ ten und Fernsehschirmen üblich sind, darf nicht irritieren, denn sie werden eher als Typ­ bezeichnung denn als Maßeinheit verstanden. Wie es der Name sagt: Maßeinheiten die­ nen dem Messen und damit dem Vergleichen von Objekten. Ob die Breite dieser Heftseite 210 Millimeter beträgt, lässt sich beispielswei­ se anhand der Zahl von Millimeterstrichen auf einem Lineal als Vergleichsmaßstab bestim­ men. Die Sekundenbruchteile, die im Hoch­ leistungssport über Siegen oder Verlieren ent­ scheiden, ergeben sich anhand der Zeitmar­ ken eines Taktgebers. Was immer es zu messen gilt: Stets zählt man ab, wie oft der Standard einer Messgröße in das fragliche Intervall passt. Dabei kann das Ergebnis nur so präzise sein wie der Vergleichsstandard. Um für den Alltagsgebrauch festzustellen, ob ein Blatt Pa­ pier der DIN-Norm genügt, reicht besagtes Lineal. Zur Prüfung der Gewindesteigung ei­ ner Schraube sind schon feinere Standards er­ forderlich, von der Halbleiterindustrie mit ih­ ren tausendstel oder gar millionstel Millime­ ter breiten Transistoren ganz zu schweigen. Vielleicht der bekannteste Standard ist der internationale Kilogrammprototyp, das »Ur­ kilogramm« (siehe Bild S. 36), ein Zylinder aus einer Platin-Iridium-Legierung von defini­ tionsgemäß einem Kilogramm Masse; er liegt seit 1889 in einem Safe beim Internationalen Büro für Maße und Gewichte (BIPM) in ­Sèv­res bei Paris. Damals ersetzte er die ältere Definition über die Masse von einem Liter Wasser bei maximaler Dichte. Ein Fortschritt, denn diese verlangte, Temperatur und Druck SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Astronomie & Physik zu ermitteln, in deren Festlegung aber die Masse mit einging – ein Zirkelschluss. Mit dem Urkilogramm und seinen an die Mit­ glieder der Meterkonvention verteilten Kopien war somit ein von anderen Größen sowie Ort und Zeit unabhängiger Standard gegeben. Einmal im Jahr wird in einer feierlichen Zeremonie überprüft, ob der Zylinder noch vorhanden und unversehrt ist. 1950 und 1990 erfolgte zudem ein Vergleich der Kopien mit dem Original. Das Ergebnis: Die meisten Kopien sind nun etwa 50 Mikrogramm schwerer als das Urkilogramm. Vermutlich aber ist der Prototyp auf Grund von Alte­ rungsprozessen oder durch Masseverluste beim Reinigen leichter geworden – und somit streng genommen auch das Kilogramm! Die geringe Differenz hat für das Alltags­ leben wenig Bedeutung, ein Bäcker könnte sie kaum auswiegen. Für die Wissenschaft ergibt sich ein anderes Bild, denn das Kilogramm geht in die Definition weiterer Einheiten ein, etwa in die der elektrischen Spannung oder der Magnetfeldstärke. Streng genommen müss­ten nun also die Zahlenwerte in physika­ lischen Formeln dem Masseverlust des Urki­ logramms gemäß angepasst werden – ein wi­ dersinniges Vorhaben. Solche Probleme von Verlust, Beschädi­ gung oder Alterung sind ein grundsätzliches Problem bei Standards, die auf den Eigen­ schaften von Artefakten beruhen, seien sie na­ türlich – etwa die erwähnte Definition des Ki­ logramms über die Masse von einem Liter Wasser – oder künstlich. Schon vor über 100 Jahren schlug der schottische Physiker James Clerk Maxwell (1831 – 1879) daher vor, Maß­ einheiten an unveränderlichen Eigenschaften von Molekülen beziehungsweise Atomen fest­ zumachen. Ein nahezu perfekt kugelförmig polierter Einkristall aus fast isotopenreinem Silizium soll helfen, das Kilogramm neu zu definieren: Dank seiner hochgenauen Geometrie lässt sich die Zahl der in einem Mol des Stoffs enthaltenen Atome, die so genannte Avogadro-Konstante, präziser als bislang ermitteln. Diese Naturkonstante könnte also die Grundlage einer neuen Definition des Kilogramms abgeben. alle Fotos des Artikels (sofern nicht anders angegeben): Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 35 Metrologie Ohne exakte Zeit­ angaben wären beispielsweise die Datenströme in Kommunikations­ netzen nicht zu synchronisieren Der Kilogrammprototyp aus einer Platin-Iri­dium-Legierung wird in einem Safe in Sèvres bei Paris auf­bewahrt. Seine Masse ist angelehnt an die Masse eines Liters Wasser unter bestimmten Umgebungsbedingungen. 36 Für die Einheit der Zeit, die Sekunde, ist dies inzwischen geschehen. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war sie noch über die Tageslänge, also die Drehung der Erde um ihre eigene Achse, festgelegt, später dann über die Länge des Jahres, also die Bewegung der Erde um die Sonne. Doch auch unser Planet eignet sich nur bedingt als Standard, denn die Erdrota­tion ist unvorhersehbaren Schwankungen unterworfen – etwa infolge von Erdbeben – und wird überdies durch die Gezeitenreibung allmählich abgebremst, was etwa alle zwei Jahre das Ein­ fügen einer Schaltsekunde erforderlich macht. Als die Technik dazu verfügbar war, be­ schloss die Generalkonferenz für Maße und Gewichte (CGPM) der Meterkonvention 1967, die Dauer der Zeiteinheit anhand einer bestimmten Schwingung in einem Zäsium­ atom festzulegen: Eine Sekunde entspricht der Dauer von 9 192 631 770 ihrer Perioden. Zu­ nächst auf etwa neun Stellen hinter dem Komma genau, erreichen die besten Uhren der Welt, so genannte Zäsium-Fontänenuhren, heute eine Präzision von mehr als 15 Stellen (siehe Bild S. 39). Davon profitieren nicht al­ lein Wissenschaftler: Ohne derart exakte Zeit­ angaben wären beispielsweise die Datenströ­ me in Kommunikationsnetzwerken nicht zu synchronisieren, Positionsbestimmun­gen an­ hand von Satellitennavigation nicht möglich. In einigen Jahren wird wahrscheinlich ein an­ deres chemisches Element dem Zäsium den Rang ablaufen, das dann nicht mit einer Mi­ krowelle, sondern mit Laserlicht zum Schwin­ gen angeregt wird. Wegen der viel höheren Frequenz des Lichts kann eine »optische Atom­ uhr« noch einmal 100-fach genauer sein. Gleich mehrmals wurde die Einheit der Länge, der Meter, der technologischen Ent­ wicklung angepasst. Als »Urmeter« fungierte eine Platin-Iridium-Stange mit speziellem Querschnitt und einer Länge, die sich vom Erdumfang ableitete. 1960 wurde er durch eine bestimmte Anzahl von Wellenlängen des Lichts ersetzt, das Kryptonatome zum Beispiel in einer Gasentladungsröhre aussenden. Da­ mit war immerhin ein atomarer Standard ein­ geführt, der aber schon bald nicht mehr den gestiegenen Anforderungen von Technik und Wissenschaft gerecht werden konnte. Dies zeigte sich besonders deutlich, als in den 1970er Jahren bei der Messung der Lichtge­ schwindigkeit im Vakuum die Präzision des Endergebnisses praktisch allein davon be­ stimmt und begrenzt wurde, wie gut sich die Referenzstrecke auf die Definition der Länge des Meters zurückführen ließ. Daher wurde der Spieß 1983 gewisserma­ ßen umgedreht: Die gemessene Geschwindig­ keit des Lichts im Vakuum, 299 792 458 Me­ ter pro Sekunde, wurde nun als exakter Wert dieser Naturkonstanten festgelegt und ein Meter damit als diejenige Strecke definiert, die Licht in einer 299 792 458stel Sekunde im Vakuum zurücklegt. Dringender Handlungsbedarf Das heutige Einheitensystem SI, nach »Sys­ tème International des Unités«, nahm auf Sit­ zungen der CGPM ab 1954 Gestalt an (siehe Kasten S. 34 und rechts). 1960 unter dieser Bezeichnung offiziell eingeführt, wurde es zwischenzeitlich mehrfach angepasst, zum Beispiel 1967 durch die Neudefinition der Se­ kunde anhand atomarer Eigenschaften. Seit­ her hat sich die Technik aber rasant weiterent­ wickelt, und heute begrenzen Unsicherheiten der Darstellung von Maßeinheiten weiterer Größen die Messgenauigkeit. Deshalb steht eine grundlegende Erneuerung des SI an. Ins­ besondere sollen das Kilogramm, das Mol (die Einheit der Stoffmenge), das Kelvin (die Ein­ SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Astronomie & Physik heit der thermodynamischen Temperatur) und das Ampere (die Einheit der elektrischen Stromstärke) in naher Zukunft auf Naturkon­ stanten bezogen werden, vielleicht auch die Candela (die Einheit der Lichtstärke). Wie beim Meter wird man versuchen, diese Kon­ stanten jeweils so genau zu bestimmen, wie es das aktuelle SI ermöglicht, diese Werte dann als verbindlich festlegen und daraus schließ­ lich die Neudefinitionen ableiten. Der größte Handlungsbedarf aber besteht wohl beim Kilogramm (kg). Hier haben sich die Metrologen auf zwei aussichtsreiche Wege verständigt: die Neubestimmung und an­ schließende Festlegung entweder der Avoga­ dro-Konstanten NA oder des planckschen Wirkungsquantums h (siehe Spektrum der Wissenschaft 6/2007, S. 76). Der erste Ansatz definiert das Kilogramm als Masse einer genau bestimmten Anzahl von Atomen der gleichen Sorte. Der Gedanke liegt nahe, ein »Urkilogramm 2.0« gezielt auf­ zubauen. Eine anspruchsvolle Aufgabe, denn die Masse eines Atoms ist 10 25-mal kleiner als ein Kilogramm, so dass entsprechend viele da­ von abgezählt werden müssten. Tatsächlich ist genau das versucht worden, nämlich eine wägbare Menge von Atomen (in diesem Fall Wismut) aus einem Ionenstrahl auf einem Substrat abzuscheiden. Diese Arbeiten sind inzwischen eingestellt worden, denn es hätte noch Jahre intensiver Forschungsarbeiten be­ durft, um zu entscheiden, ob die geforderte niedrige Ungenauigkeit von 10 – 8 (1 zu 100 Millionen) auf diesem Weg erreichbar wäre. Stattdessen wird ein anderes Verfahren an­ gewandt, das sich durch einen Vergleich an­ schaulich erklären lässt: Sollen die Flaschen eines bestimmten Getränks in einem bela­ denen Laster gezählt werden, könnte man ihn ausräumen und jede einzelne Flasche in jeder Kiste notieren. Die periodische Anordnung der Getränkekisten bietet eine weniger auf­ wändige Möglichkeit: Man bestimme das Vo­ lumen des Laderaums und teile es durch das einer einzelnen Kiste; die so ermittelte Zahl muss nur noch mit der Anzahl von Flaschen pro Kiste multipliziert werden. Diese Rech­ nung stimmt freilich nur dann, wenn das Las­ tervolumen ganz mit regelmäßig angeord­ neten Kisten gefüllt ist und in keiner Kiste Flaschen fehlen oder solche einer anderen Sor­ te stecken. Diesen Weg beschreitet ein internationales Konsortium unter der Projektleitung der Phy­ sikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB). Die Rolle des Laderaums übernimmt dabei ein Silizium-Einkristall aus nahezu isotopen­ reinem 28Si. Silizium wurde deshalb gewählt, weil die Halbleiterindustrie jahrzehntelange SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Die »Braunschweiger Elle« wurde in die Mauer des historischen Rathauses eingelassen, damit sich Händler danach richten konnten. Wer es nicht tat, musste mit empfindlichen Strafen rechnen. Erfahrung damit hat, einen möglichst per­ fekten Kristall, weit gehend frei von Fremd­ atomen und Stapelfehlern, herzustellen. Aus dem Kristall wird eine Kugel von etwa 9,4 cm Durchmesser geschnitten und auf möglichst exakte Rundheit poliert (siehe Foto S. 35). Diese Größe wurde gewählt, weil dann die Kugel eine Masse möglichst nahe an 1 kg be­ sitzt, so dass ein Massevergleich mit dem Ur­ kilogramm mit höchster Präzision möglich ist. Das Kugelvolumen wird mit einem eigens entwickelten optischen Interferometer gemes­ sen – das entspricht der Bestimmung des La­ deraumvolumens in der Lkw-Analogie. Im Kristallgitter sind die Atome regelmä­ ßig angeordnet. Röntgenstrahlbeugung verrät den Abstand der Atome im Kristallgitter, ana­ log zur Größe einer Getränkekiste. Als Konsis­ tenzcheck wird auch die Dichte des Materials bestimmt, um zu überprüfen, ob es beispiels­ weise Hohlräume gibt. Mit einem Massen­ spektrometer lässt sich außerdem die relative Atommasse eines Siliziumatoms (gemäß bis­ heriger Kilogrammdefinition) sehr genau er­ mitteln. Und schließlich muss man noch wis­ sen, wie dick die unvermeidliche Oxidschicht auf der Oberfläche der Kugel ist, um ihren Einfluss herauskorrigieren zu können, denn das Oxid hat eine andere Dichte als der Silizi­ umkristall. Dann sind alle Zutaten beisammen, um eine Masse von 1 kg, also eine makroskopi­ >>> Fortsetzung von S. 34 ➤ Das Kelvin, die Einheit der thermodynamischen Temperatur, ist der 273,16te Teil der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunktes von Wasser. ➤ Das Mol ist die Stoff­ menge eines Systems, das aus ebenso viel Einzelteilchen besteht, wie Atome in 0,012 Kilogramm des Kohlenstoffnuklids 12C enthalten sind. Bei Benutzung des Mols müssen die Einzelteilchen spezifiziert sein. Sie können Atome, Moleküle, Ionen, Elektronen sowie andere Teilchen oder Gruppen solcher Teilchen genau angegebener Zusammensetzung sein. ➤ Die Candela ist die Lichtstärke in einer bestimmten Richtung einer Strahlungsquelle, die monochromatische Strahlung der Frequenz 540 · 1012 Hertz aussendet und deren Strahlstärke in dieser Richtung 1/683 Watt je Raumwinkeleinheit beträgt. 37 Metrologie Das Kilogramm könnte künftig die Masse von 5,0184515XX · 10 25 12 C-Atomen im Grundzustand sein sche Größe, mit der mikroskopischen Masse­ skala, der Atommasse relativ zu Atomen des Isotops 12C, zu verknüpfen: V 1 MKugel = Kugel a3 mSin NA Hier ist n die Zahl der Atome in einer kubischen Elementarzelle mit Kantenlänge a (analog der Zahl der Flaschen in einer Ge­ tränkekiste) und m Si die molare Masse von 28 Si, also etwa 28 Gramm. Dabei taucht als Skalierungsfaktor die nach dem italienischen Physiker und Chemiker Amedeo Avogadro (1776 – 1856) benannte Avogadro-Konstante NA auf. Diese gibt die Anzahl von Einzelteil­ chen in der Stoffmenge 1 Mol der jeweiligen Teilchensorte an. Durch Auflösen der Glei­ chung nach NA und Festlegung des so gewon­ nenen Zahlenwerts als verbindlich ergäbe sich dann ein Kilogramm als die Masse einer ge­ nau bestimmten Anzahl von Atomen. Grundsätzlich könnte sich die neue Defi­ nition auf 28Si stützen. Allerdings ist die tradi­ tionelle, auf dem Kohlenstoffisotop 12C auf­ bauende atomare Masseskala so sehr in Wis­ senschaft und Technik etabliert, dass eine Umstellung sehr aufwändig wäre, ohne ir­ gendeinen Vorteil zu bringen. Deshalb lautet eine mögliche Neudefinition: Das Kilogramm Vorschlag für ein modernisiertes Einheitensystem Die Gremien der internationalen Meterkonvention streben die folgenden, auf Naturkonstanten bezogenen und stets gleich formulierten Definitionen an. Ein »X« bedeutet, dass die Ziffer noch genau bestimmt werden muss. Zudem wird die Festlegung der Sekunde statt auf Zäsium in naher Zukunft auf ein anderes Atom oder Ion bezogen werden. Name Die Einheit der ... wird so definiert, dass ... Sekunde Zeit die Grundzustandshyperfeinaufspaltung des Zäsium-133-Atoms exakt 9 192 631 770 Hertz beträgt. Meter Länge die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum exakt 299 792 458 Meter pro Sekunde beträgt. Kilogramm Masse das plancksche Wirkungsquantum exakt 6, 626 068 96XX · 10 – 34 Joule-Sekunden beträgt. Ampere elektrischen Stromstärke die Elementarladung exakt 1,602 176 487XX · 10 –19 Coulomb beträgt. Kelvin thermodynamischen Temperatur die Boltzmann-Konstante exakt 1,380 650 4XX · 10 –23 Joule pro Kelvin beträgt. Mol Stoffmenge einer gegebenen Teilchensorte die Avogadro-Konstante exakt 6,022 141 79XX · 10 23 pro Mol beträgt. Candela Lichtstärke die spektrale Strahlstärke mono­chromatischer Strahlung der Frequenz 540 · 10 12 Hertz exakt 683 Lumen pro Watt beträgt. 38 ist die Masse von 5,0184515XX · 10 25 12CAtomen in Ruhe und im Grundzustand. An­ gegeben haben wir hier den besten bisher be­ kannten Zahlenwert für die Avogadro-Kon­ stante geteilt durch die Masse eines Mols von 12 C-Teilchen (12 Gramm), gefolgt von »XX« als Hinweis darauf, dass die letzten Ziffern erst noch endgültig bestimmt werden müssen. Die Siliziumkugel soll allerdings nicht das Urkilogramm ersetzen. Sie wurde zunächst nur für die Bestimmung der Avogadro-Kon­ stante angefertigt. Um Inkonsistenzen zu ver­ meiden, müsste die aktuelle Definition des Mols etwas angepasst werden: Das Mol, die Einheit der Stoffmenge einer gegebenen Teil­ chensorte, ist so festgelegt, dass die AvogadroKonstante exakt 6,022 141 79XX · 10 23 pro Mol beträgt. Massenbestimmung mit Magnetfeld und Quanteneffekt Der alternative Weg nutzt eine so genannte Watt-Waage, die eine Beziehung zwischen dem Kilogramm und einer anderen Natur­ konstante, dem planckschen Wirkungsquan­ tum h, herstellt. Dazu wird die Gewichtskraft eines Objekts auf einer Waagschale durch eine magnetische Kraft kompensiert. Diese ent­ steht auf Grund der Wechselwirkung zwi­ schen einem statischen, räumlich inhomogen gestalteten Magnetfeld und dem Feld einer stromdurchflossenen Spule, die mit der Waag­ schale verbunden ist. Aus der zur Kompensa­ tion erforderlichen Stromstärke I1 lässt sich auf die Masse des Objekts schließen, sofern die lokale Fallbeschleunigung und die genaue Inhomogenität des Magnetfelds bekannt sind. Um Letztere mit der erforderlichen Genauig­ keit zu ermitteln, wird die Spule im zweiten Teil des Experiments mit konstanter Ge­ schwindigkeit durch dieses Feld bewegt. Da­ bei verändert sich zwangsläufig der magne­ tische Fluss durch ihre Spulenwicklung, und eine elektrische Spannung U2 wird induziert. Diese ist ein Maß für die Inhomogenität des Feldes, deren Einfluss somit genau charakteri­ siert werden kann. Dem ohmschen Gesetz zufolge entspricht I1 dem Quotienten einer Spannung und eines elektrischen Widerstands U1/R1. Auf höchs­ tem Niveau werden Spannungen (wie U1 und U2) heute unter Ausnutzung eines Quanten­ effekts über so genannte Josephson-Kontakte dargestellt (Spektrum der Wissenschaft 7/1980, S. 90). Dabei handelt es sich um Bauteile aus zwei Supraleitern, die durch eine dünne nor­ malleitende Schicht voneinander getrennt sind. Bei Einstrahlung einer Mikrowelle der Frequenz fJ fließt ein Gleichstrom, der zu ei­ ner Spannung von genau Un = n (h/2e) fJ zwi­ SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Astronomie & Physik schen den Enden des Josephson-Kontakts führt (wobei n eine ganze Zahl ist). Die Kon­ stante KJ = 2e/h (e ist die Elementarladung) ist nach dem britischen Physiker Brian Josephson benannt, der wichtige Aspekte sol­ cher Kontakte als 23-jähriger Doktorand vo­ rausgesagt hatte und 1973 dafür den Nobel­ preis erhielt. Um den elektrischen Widerstand hochprä­ zise zu messen, bedient man sich des Quan­ ten-Hall-Effekts, dessen Entdeckung dem deutschen Physiker Klaus von Klitzing 1985 den Nobelpreis einbrachte. Er tritt bei Strom­ fluss in dünnen Halbleiterschichten auf, wenn ein starkes Magnetfeld angelegt wird (Spek­ trum der Wissenschaft 3/1986, S. 46). Dann wird nämlich senkrecht zur Stromrichtung eine Spannung induziert, deren Verhältnis zur Stromstärke als Hall-Widerstand RH bezeich­ net wird. Dieser ist auf feste, quantisierte Werte beschränkt: RH = h/(p e2), wobei p eine ganze Zahl ist. Hier treten die Naturkon­ stanten h und e in der Kombination h/e 2 = RK auf, der Von-Klitzing-Konstante. Zurück zur Watt-Waage. Werden die Grö­ ßen U1, U2 und R1 über obige Quanteneffekte gemessen, so erhält man nach einigen mathe­ matischen Umformungen der verschiedenen Formeln eine Gleichung, die bei bekannter Testmasse und genauer Kenntnis der Erdbe­ schleunigung am Ort der Messung die Be­ stimmung des planckschen Wirkungsquan­ tums erlaubt. Von nun an ließe sich im Um­ kehrschluss die gesuchte SI-Einheit auf die folgende, etwas ungewöhnlich klingende ­Weise definieren: Eine Masse von einem ­Kilogramm ist künftig so festgelegt, dass die Naturkonstante h = 6,626 068 96XX · 10 – 34 Joule-Sekunden groß ist. Die große Schwierigkeit beider Ansätze be­ steht darin, Störeffekte so weit zu reduzieren, dass die geforderte Ungenauigkeit im Bereich von 10 – 8 erreicht wird (so genau nämlich kann man bisher Massen auf das Urkilogramm be­ ziehen). Weder mit dem Avogadro-Experiment noch mit einer der fünf in Aufbau beziehungs­ weise Betrieb befindlichen Watt-Waagen ist dies bisher zufrieden stellend gelungen. Schlim­ mer noch: Die beiden Verfahren kommen der­ zeit nicht zu konsistenten Ergebnissen. Hier wird aktuell weiter nach den Ursachen ge­ forscht, zum Beispiel durch genaue Analyse der Apparaturen auf mögliche, bisher unentdeckte Fehlerquellen hin. Zwischenzeitlich haben Gre­ mien der Meterkonvention beschlossen, für die Neudefinition des Kilogramms den Weg über das plancksche Wirkungsquantum zu wählen, sobald hinreichende Übereinstimmung zwi­ schen den Ergebnissen der Watt-Waagen und des Avogadro-Experiments erreicht ist. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Eine weitere problematische Definition im Reigen der SI-Basiseinheiten ist die des Kel­ vins (K) als der Einheit der thermodyna­ mischen Temperatur. Dabei kommt reinstes Wasser zum Einsatz: Bei 273,16 Kelvin er­ reicht H2O seinen Tripelpunkt, jenen thermo­ dynamischen Zustand, in dem Dampf, Flüs­ sigkeit und Eis im Gleichgewicht miteinander vorliegen. Da die Isotopenzusammensetzung des Wassers sowie kleinste Verunreinigungen die Lage dieses Punkts beeinflussen, gibt es eine präzise Vorschrift, wie eine zur Beobach­ tung des Tripelpunkts gedachte Wasserprobe aus Entnahmen der Ozeane der Welt zu mi­ schen ist, denn in jedem Ozean ist die Isoto­ penzusammensetzung der H2O-Moleküle in charakteristischer Weise verschieden. De facto hat man es also erneut mit einem künstlichen Objekt, einem Artefakt, als Standard zu tun. Abhilfe soll wieder eine Naturkonstante schaffen, diesmal die Boltzmann-Konstante kB, die den Zusammenhang zwischen der Tempe­ ratur T und der thermischen Energie herstellt: Eine der modernsten Atomuhren der Welt ist die Fontänenuhr CSF2 der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. In ihrem Inneren werden Zäsiumatome mit Laserlicht bestrahlt und nahe an den absoluten Temperaturnullpunkt gekühlt. Durch Einstrahlen von Mikrowellen genau angepasster Frequenz wird eine Schwingung in den Atomen angeregt, die zur Bestimmung der Dauer der Sekunde herangezogen wird. Etwa ein Dutzend solcher Uhren weltweit sichert die Genauigkeit der internationalen Zeitskalen. 39 Metrologie Die Candela soll auch heute so groß sein wie zu jener Zeit, als sie durch Flammen­ normale oder glühende­Metalle bestimmt wurde 40 Eth = kBT, mit T = 0 am absoluten Nullpunkt. Sofern sich diese Konstante auf sechs Stellen genau bestimmen ließe, könnte das Kelvin ohne Genauigkeitsverlust folgendermaßen de­ finiert werden: Eine Temperaturänderung von 1 K entspricht einer Änderung der thermi­ schen Energie kBT von 1,380 650 4XX · 10 – 23 Joule. Damit wäre die Temperatur- zu einer Energiemessung in Beziehung gesetzt. Man hat sich allerdings dafür entschieden, die Definition bei äquivalentem physikali­schem Inhalt in der folgenden Weise zu formulieren: Das Kelvin ist so definiert, dass die BoltzmannKonstante exakt kB = 1,380 650 4XX · 10 – 23 Joule pro Kelvin beträgt. Dadurch wird die Definition des Kelvins unabhängig von einer bestimmten experimentellen Realisierungsart. Weltweit sind auch hier wieder Experi­ mente im Gang, diese Neubestimmung auf verschiedenen Wegen zu erreichen. An der PTB zum Beispiel wird dazu die Dielektrizi­ tätskonstanten-Gasthermometrie eingesetzt. Diese Konstante, auch Permittivität genannt, beschreibt die Durchlässigkeit von Materia­ lien für elektrische Felder. Bringt man Mate­ rie in das elektrische Feld zwischen den Plat­ ten eines Kondensators, beeinflusst ihr Wert dessen Kapazität, also sein Speichervermögen für elektrische Ladungen. Misst man diese Kapazität, lässt sich bei bekannter Geometrie der Kondensatorplatten die Permittivität be­ rechnen. Für ein Gas hängt die Dielektrizitätskon­ stante von der Temperatur ab. Wird also, wie im PTB-Experiment, Helium in einen Präzi­ sionskondensator gefüllt, so ändert sich des­ sen Kapazität mit der Temperatur, ebenso mit der Menge des Gases, also dessen Druck im nominell festen Volumen des Behälters. Eine genaue Analyse der Verhältnisse erlaubt es, durch Messungen bei verschiedenen Tempera­ turen und Drücken die Größe der Boltz­ mann-Konstante zu ermitteln. Auch die Definition des Amperes, der Ein­ heit der elektrischen Stromstärke, genügt heut­ zutage den Ansprüchen nicht mehr. Getreu dem Wortlaut lässt sich ein »Ampere-Lineal« im Labor gar nicht darstellen, denn man be­ nötigt dafür zwei unendliche lange, gerade Drähte. Stattdessen werden beispielsweise spe­ zielle Anordnungen aus aufgewickelten Dräh­ ten genutzt und die Messungen rechnerisch korrigiert. Eine Größenordnung genauer sind Apparaturen, die das Ampere über das ohm­ sche Gesetz festlegen, also durch das Verhält­ nis von einem Volt Spannung und einem Ohm Widerstand, die wiederum mit Hilfe von Josephson- und Quanten-Hall-Effekt ab­ geleitet werden. Elektronen zählen, 100 Millionen Takte lang Für eine Neudefinition bietet es sich an, den Wert der Elementarladung (gemessen in Cou­ lomb) zu Grunde zu legen, da der elektrische Strom der pro Zeiteinheit transportier­ten La­ dungsmenge entspricht: Das Ampere ist dann so definiert, dass die Elementarladung exakt e = 1,602 176 487XX · 10 – 19 Coulomb beträgt. Zur direkten Realisierung, also ohne den Umweg über das ohmsche Gesetz, benötigt man elektronische Bauteile, die nur jeweils ein Elektron nach dem nächsten passieren lassen – wie eine Drehtür, die nur einzelne Personen durchlässt. Wird solch ein Bauteil mit einer periodischen Steuerspannung ge­ taktet, so tritt bei jedem Puls genau ein Elek­ tron hindurch. Die Taktfrequenz kann aus ei­ ner Atomuhr präzise abgeleitet werden. Der durch das Bauteil fließende Strom ergibt sich dann in geradezu wörtlicher Übersetzung der neuen Definition, indem der Betrag der La­ dung eines Elektrons, 1,602 176 487XX · 10 – 19 Coulomb, durch die Dauer eines einzelnen Takts geteilt wird. Das hört sich einfacher an, als es ist. Denn die Methode funktioniert nur, wenn nicht ge­ legentlich zwei Elektronen durchschlüpfen – oder gar keines. Die Anforderungen sind ­enorm: Auf 100 Millionen Takte darf nicht mehr als ein Verzähler auftreten! Dabei kämp­ fen die Forscher noch damit, solche Einzel­ elektronenbauteile überhaupt zuverlässig her­ zustellen. Dazu erschaffen sie auf einem Halb­ leiterchip oder in einer supraleitenden Leiterbahn eine winzige, weniger als einen tausendstel Millimeter große »Insel«, auf die immer nur ein zusätzliches Elektron aufge­ bracht und dann auf der anderen Seite wieder abgezogen werden kann. Derartige kleine Strukturen sind nicht nur schwer reproduzier­ SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 bar herzustellen, es genügen auch bereits schwache elektrische Störpulse, um sie zu zer­ stören. Zudem sind die abzählbaren Strom­ stärken derzeit noch zu klein für eine prakti­ kable Messtechnik, sie liegen im Bereich von milliardstel Ampere und darunter. Über die Erhöhung der Taktfrequenz, Parallelschaltung mehrerer solcher Stromquellen oder mit so genannten Kryostromkomparatoren – Spe­ zialtransformatoren zur Stromverstärkung – versuchen die Forscher dem Problem beizu­ kommen. Noch ganz am Anfang stehen jene Kolle­ gen, die sich um eine Neudefinition der Can­ dela bemühen. Im heutigen Einheitensystem ist diese Einheit der Lichtstärke immerhin schon durch eine monochromatische Strah­ lung festgelegt: 540 · 10 12 Hertz (das ent­ spricht einer Wellenlänge von 0,555 tausends­ tel Millimetern, also grünem Licht), Strahl­ stärke 1/683 Watt in einem Raumwinkel von einem Steradiant. Die krummen Zahlen er­ klären sich durch die Geschichte dieser Ein­ heit: Die Candela soll auch heute so groß sein wie zu jener Zeit, als sie durch Flammen­ normale oder glühende Metalle bestimmt wurde. Letztlich handelt es sich um eine Einheit, die sich aus Sekunde, Meter und Kilogramm herleiten lässt. Dass dennoch nach einer un­ abhängigen Definition geforscht wird, ist nicht zuletzt in der großen wirtschaftlichen Bedeutung begründet: Die Candela dient als Bezugseinheit für die Beleuchtungsindustrie. Um sie auf Größen aus der Quantenwelt be­ ziehen zu können, nutzen Wissenschaftler neuartige Lichtquellen, die definiert einzelne Photonen mit sehr präzise zu messender Ener­ gie aussenden. Diese werden von genau cha­ rakterisierten Detektoren mit Einzelphoto­ nen-Empfindlichkeit aufgefangen, um so den Zusammenhang zwischen mikroskopischer und makroskopischer Strahlungsleistung her­ zustellen. Angesichts der extrem kleinen Ener­ gie eines Photons ist es auch hier, ähnlich wie beim Ampere, allerdings sehr problematisch, eine makroskopisch bestimmbare Strahlungs­ leistung zu erhalten. Gemäß der Struktur der Meterkonvention kann nur die Generalkonferenz für Maße und Gewichte, die zurzeit alle vier Jahre tagt, eine Veränderung des SI beschließen. Das ist frü­ hestens 2011 der Fall, die beschriebenen For­ schungsarbeiten haben dieses Zieldatum vor Augen. Nach einer Neudefinition, ob schon 2011 oder erst später, werden die Zahlen­ werte der Konstanten h, NA, kB und e festlie­ gen. Der Versuch, sie dann ein weiteres Mal experimentell neu zu bestimmen, würde, wie bereits jetzt bei der Lichtgeschwindigkeit im SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 VISUM / Marc Steinmetz Astronomie & Physik Vakuum der Fall, zu einem Zirkelschluss füh­ ren. Wichtiger als eine schnelle Neudefinition ist jedoch die fortdauernde Konsistenz des Einheitensystems, sowohl was die interne Wi­ derspruchsfreiheit angeht als auch zur Ver­ meidung von Skalensprüngen. So soll das neue Ampere genauso groß sein wie das alte, ein Kilogramm Platin nicht plötzlich mehr Masse beinhalten als zuvor. Weder im Alltag noch in der Wissenschaft dürfen sich die Neubezüge in geänderten Zahlenwerten be­ merkbar machen. Natürlich soll die gefundene Lösung von Dauer sein und nicht nach wenigen Jahren er­ neut geändert werden müssen. Das ist auch der Grund, warum es bis zur Neudefinition der Sekunde noch dauern wird: Es gibt noch keinen Konsens darüber, welcher atomare Übergang langfristig die beste Wahl als Ersatz für den des Zäsiums ist. Angesichts der fundamentalen wissen­ schaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung, die das korrekte Messen hat, werden bei der Neudefinition von Einheiten keine Schnell­ schüsse gemacht. Die beteiligten Institutionen sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Sollten die laufenden metrologischen Forschungs­ arbeiten bis 2011 zu keinem befriedigenden Abschluss kommen, werden die Gremien der Meterkonvention der Forschergemeinde eben bis zum nächsten Treffen 2015 Zeit geben. Was ist schon diese kleine Verzögerung gegen­ über der Aussicht, ein dauerhaftes Maßsystem zu errichten, das sich ausschließlich auf Na­ turkonstanten stützt? Messen mit dem Laserstrahl: In einer 299 792 458stel Se­kunde legt Licht im Vakuum exakt einen Meter zurück, so die Definition von 1983. Robert Wynands (rechts) und Ernst O. Göbel arbeiten an der Physi­ kalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Wynands war dort zunächst für die Atomuhren zuständig und leitet nun den präsidialen Stab. Göbel ist Präsident der Bundesanstalt; zurzeit ist er außerdem Präsident der internationalen Meterkonvention. Das Internationale Einheitensystem (SI). PTB-Mitteilungen 2/2007, auf www.ptb.de. Göbel, E. O.: Quantennormale im SI-Einheitensystem. In: Physikalische Blätter 53, S. 217 – 223, 1997. Weitere Weblinks zu diesem Thema finden Sie unter www.spektrum.de/ artikel/1019952. 41 Metrologie 42 SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Astronomie & Physik SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 43 Lebensentstehung Diesen Artikel können Sie als Audiodatei beziehen; siehe www.spektrum.de/audio Der Ursprung irdischen Lebens Allmählich lichtet sich der Nebel um eines der größten Geheimnisse der Natur. Im Labor wiederholen Forscher die tastenden Schritte, mit denen einst aus unbelebter Materie die ersten Organismen entstanden. Von Alonso Ricardo und Jack W. Szostak In Kürze r Forscher haben vor­ eführt, wie das Erb­ g molekül RNA aus Chemikalien entstehen konnte, die auf der unbelebten Früherde vorhanden waren. r Andere Experimente stützen die Hypothese, dass am Ursprung allen irdischen Lebens primitive Zellen standen, die RNA-ähnliche Moleküle ent­hielten. Diese Zellen konnten sich spontan bilden, reproduzieren und weiter­ entwickeln. r Wissenschaftler versuchen jetzt künst­ liche Organismen zu kreieren, die sich komplett selbst zu repli­ zieren vermögen. Wenn im Labor praktisch ein zweites Mal Leben entsteht, lässt sich besser verstehen, wie es ursprünglich entstand. 44 J ede lebende Zelle, selbst das einfachste Bakterium, wimmelt nur so von molekularen Maschinen, die einen Nanotechniker vor Neid erblassen lassen. Sie zappeln, krabbeln und schrauben sich rastlos durch die Zelle, sie zerschneiden, kleben und kopieren Erbmoleküle, sie transportieren Nährstoffe hin und her oder verwandeln sie in Energie, sie bauen und reparieren Zellmembranen, sie übertragen mechanische, chemische oder elektrische Signale – die Aufzählung scheint gar kein Ende zu nehmen, und mit jeder neuen Entdeckung wird sie länger. Wie um alles in der Welt soll sich diese Zellmaschinerie, die vorwiegend aus Katalysatoren auf Eiweißbasis – so genannten Enzymen – besteht, vor rund 3,7 Milliarden Jahren ganz von selbst zusammengebaut haben? Gewiss, unter geeigneten Bedingungen entstehen einige Proteinbausteine, die Aminosäuren, ohne Weiteres aus einfacheren Chemikalien; das haben Stanley L. Miller und Harold C. Urey in den 1950er Jahren an der University of Chicago mit ihren legendären Experimenten nachgewiesen. Doch von dort zu Proteinen und Enzymen ist es noch ein gewaltiger Schritt. Wenn eine Zelle Proteine synthetisiert, trennen komplizierte Enzyme die beiden Stränge der DNA-Doppelhelix voneinander, andere Enzyme lesen die darauf in Genen kodierten Protein-Bauanleitungen ab und übersetzen sie in die fertigen Produkte. So- mit tritt bei dem Versuch, den Anfang allen Lebens zu erklären, ein paradoxes Problem auf: Anscheinend sind – abgesehen von der in der DNA gespeicherten Information – Proteine nötig, um Proteine zu fabrizieren. Das Paradoxon verschwände allerdings, wenn die ersten Organismen ganz ohne Proteine ausgekommen wären. Neue Experimente zeigen, dass Erbmoleküle, die der DNA oder der strukturell nahe verwandten RNA ähneln, spontan hätten entstehen können. Und da solche Moleküle sich unterschiedlich zusammenzufalten und einfache Reaktionen zu katalysieren vermögen, wurden sie vielleicht fähig, sich ohne die Hilfe von Proteinen selbst zu kopieren. Schwieriger Beginn Wie konnte in der Frühzeit der Erde aus einfachen Molekülen genetisches Material entstehen? Betrachtet man die Funktion der RNA in heute lebenden Organismen, so liegt es nahe, dass die RNA vor der DNA auftrat. Wenn heutige Zellen ein Protein fabrizieren, kopieren sie zunächst das entsprechende Gen von der DNA in RNA und benutzen die RNA dann als Bau­ anleitung für das Protein. Dieser zweite Schritt könnte anfangs unabhängig exis­ tiert haben; erst später wäre die DNA dank ihrer besseren chemischen Stabilität als dauerhaftere Speicherform aufgetreten. Es gibt noch einen weiteren Grund, weshalb Forscher annehmen, die RNA sei zuerst entstanden. Ribozyme – Enzyme aus RNA statt Protein – spielen auch in heu- SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Holly Lindem und Gene Burkhardt medizin & biologie tigen Organismen noch eine zentrale Rolle. Die Gebilde, welche die als RNA angelieferten Baupläne in Proteine umsetzen, sind selbst Komplexe aus RNA und Protein, wobei die RNA den eigentlichen Katalysator darstellt. Anscheinend enthält jede unserer Zellen in ihren Ribosomen »fossile« Relikte einer urtümlichen RNA-Welt. Darum konzentrieren sich viele Forscher auf den Ursprung der RNA. Erbmoleküle wie DNA und RNA sind Polymere, das heißt Stränge aus kleineren Molekülen, in diesem Fall aus Nukleotiden. Die wiederum bestehen aus drei Komponenten: einem Zucker, einer Phosphatgruppe und einer Nukleinbase. Es gibt vier verschiede­ SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 ne Nukleinbasen; sie bilden das Alphabet, mit dem das Polymer seine Information kodiert. DNA-Nukleotide enthalten jeweils eine der Nukleinbasen A, G, C oder T (Adenin, Guanin, Cytosin oder Thymin). Im Alphabet der RNA steht U (Uracil) an Stelle von T (siehe Kasten S. 46/47). Die Nukleinbasen sind stickstoffreiche Verbindungen, die sich nach einer einfa­ chen Regel paaren: A bindet immer an U – beziehungsweise an T –, und G bindet stets an C. Diese Basenpaare bilden die Sprossen der spiralförmigen DNA-Leiter, der bekannten Doppelhelix. Die korrekte Paarung ist entscheidend dafür, dass bei der Reproduktion der Zelle exakte DNA- Basenpaare ordnen das Alphabet der Vererbung in der RNA-Welt: Adenin mit Uracil, Guanin mit Cytosin. 45 Lebensentstehung Was ist Leben? Wissenschaftler bemühen sich seit Langem, den Begriff »Leben« so weit zu fassen, dass er auch noch unentdeckte Lebensformen einschließt. Hier sind nur einige der vielen vorgeschlagenen Definitionen aufgeführt: 1. Der Physiker Erwin Schrödinger­postulierte als grundlegende Eigenschaft lebender Systeme, dass sie sich entgegen der natürli­ chen Tendenz zu wachsender Entropie – oder Unordnung – selbst organisieren. 2. Nach der von der NASA übernommenen Arbeits­ definition des Chemikers Gerald Joyce ist Leben »ein chemisches System mit der Fähigkeit zur Selbster­ haltung und zur darwinschen Evolution«. 3. Gemäß der »kyber­ netischen Definition« von Bernard Korzeniewski ist Leben ein Netzwerk von Rückkopplungs­ mechanismen. Kopien entstehen. Zucker und Phospatgruppen bilden das Rückgrat jedes Strangs. Nukleinbasen können in wenigen Schritten spontan aus Zyanid, Azetylen und Wasser entstehen – aus einfachen Molekülen, die auf der präbiotischen Erde sicherlich vorhanden waren. Auch Zuckermoleküle lassen sich leicht aus einfachen Ausgangssubstanzen synthetisieren. Schon seit gut 100 Jahren ist bekannt, dass beim Erhitzen einer alkalischen Lösung von Formaldehyd – auf der jungen Erde sicher verfügbar – Mischungen vieler verschiedener Zuckermoleküle entstehen. Das Problem ist nur: Wie gewinnt man den speziell zum Bau von Nukleotiden geeigneten Zucker? Im Fall der RNA ist das die Ribose. Sie ist chemisch labil und zerfällt schon in schwach alkalischen Lösungen rasch. Daraus schlossen viele Forscher bis vor Kurzem, das erste Erbmolekül habe keine Ribose enthalten können. Doch einer von uns (Ricardo) und andere Forscher haben herausgefunden, wie die Ribose stabilisiert werden kann. Auch der Phosphatanteil der Nukleotide bereitet Kopfzerbrechen. Phosphor, das Zentralatom der Phosphatgruppe, ist in der Erdkruste zwar reichlich vorhanden, jedoch meist in Form von Mineralien, die sich in Wasser Tricks beim Zusammenbau Im Jahr 2005 entdeckten Matthew Pasek und Dante Lauretta von der University of Arizona, dass die Korrosion von Schreibersit in Wasser den Phosphoranteil freisetzt. Dieser Mechanismus erscheint viel versprechend: Der freigesetzte Phosphor ist nicht nur viel besser wasserlöslich als Phosphat, sondern reagiert auch viel bereitwilliger mit organischen – auf Kohlenstoff basierenden – Verbindungen. Damit hätten wir also eine grobe Vorstellung der möglichen Abläufe, die zur Entstehung von Nukleinbasen, Zuckern und löslichem Phosphat führen. Der nächste Schritt wäre logischerweise, diese Komponenten in korrekter Weise zu verbinden. Doch gerade das Die ersten genetischen Moleküle Die ersten irdischen Lebewesen, die fähig waren, sich zu reproduzieren und weiterzuentwickeln, speicherten ihre Erbinformationen wahrscheinlich in Form von Molekülen, die der RNA ähnelten, einer der DNA strukturell verwandten Nukleinsäure. DNA und RNA sind Ketten aus so genannten Nukleotiden (links hervorgehoben). Aber wie konnten Nukleotide einst aus einfacheren Chemikalien entstehen? Die drei Bestandteile eines Nukleotids – Nukleinbase, Phosphatgruppe und Zucker – bilden sich zwar mitunter spontan, fügen sich jedoch nicht von selbst richtig zusammen (Mitte). Wie neue Experimente zeigen, können zumindest zwei Typen von RNA-Nukleotiden, welche die Nukleinbasen C und U enthalten, auf anderem Weg entstehen (ganz rechts). In heutigen Organismen gibt es vier Typen von RNA-Nukleinbasen: A, C, G und U. 46 kaum lösen. Darum ist nicht offensichtlich, wie Phosphate in die präbiotische Mixtur gelangt sein sollen. Die hohen Temperaturen von Vulkanschloten können phosphathaltige Mineralien in lösliche Formen überführen, doch die so freigesetzten Mengen sind, zumindest in der Nähe heutiger Vulkane, gering. Eine völlig andere Quelle für lösliche Phosphatverbindungen ist Schreibersit oder Glanzeisen – ein seltenes Mineral, das vor allem in bestimmten Meteoriten auftritt. doppelsträngige RNA A U A U G C Zucker Nukleinbase C Phosphatgruppe G ZuckerPhosphatRückgrat komplementäre Nukleinbasenpaare SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 bildete in den vergangenen Jahrzehnten die hartnäckigste Hürde in der präbiotischen Chemie. Einfaches Mischen der drei Komponenten in Wasser löst noch lange nicht die spontane Bildung eines Nukleotids aus – hauptsächlich deshalb, weil jede der erforderlichen Bindungsreaktionen auch ein Wassermolekül freisetzt, und so etwas kommt in wässrigen Lösungen von selbst kaum vor. Damit sich die chemischen Bindungen bilden können, muss darum Energie zugeführt werden, zum Beispiel in Form energiereicher Substanzen, an denen in der präbiotischen Welt vermutlich kein Mangel herrschte. Im Labor erwiesen sich Reaktionen, die von solchen Molekülen angetrieben werden, allerdings als völlig ineffizient. Doch das Frühjahr 2009 brachte eine große Überraschung: John Sutherland und seine Mitarbeiter von der University of Manchester (England) verkündeten, sie hätten einen viel plausibleren Mechanismus der Nukleotidsynthese gefunden, der auch das Problem der Instabilität von Ribose umgeht. Diese raffinierten Chemiker brachen mit der Tradition, Nukleotide aus Nukleinbase, Zucker und Phosphat herstellen zu wollen. Ihr Ansatz beruht zwar auf denselben einfachen Substanzen wie früher, die aus Zyanid, Azety- Laurent Villeret Medizin & Biologie len und Formaldehyd entstehen. Doch statt Nukleinbase und Ribose getrennt herzustellen und erst danach zu versuchen, sie zu verbinden, mischten sie gleich alle Ausgangsstoffe zusammen, und obendrein Phosphat. Im Verlauf einer komplizierten Reaktionsfolge, bei der das Phosphat mehrmals als unersetzlicher Katalysator wirkte, entstand ein kleines Molekül namens 2-Aminooxazol; es lässt sich als Fragment eines Zuckers auffassen, das an ein Stück einer Nukleinbase gebunden ist (siehe Kasten unten). Vermutlich entstanden einst in einem früh­ irdischen Tümpel nebst einem Mischmasch anderer Substanzen auch geringe Mengen von 2-Aminooxazol. Dieses kleine, stabile Molekül Gescheiterte Nukleotidsynthese Ein neuer Weg Lange Zeit gelang es den Chemikern nicht, einen Weg zu entdecken, auf dem Nukleinbasen, Phosphat und Ribose – die Zuckerkomponente der RNA – sich spontan zu RNA-Nukleotiden verbinden konnten. In Gegenwart von Phosphat bilden die Ausgangsstoffe für Nukleinbasen und Ribose zunächst 2-Aminooxazol. Dieses Molekül enthält Teile eines Zuckers sowie Teile der Nukleinbasen C oder U. Weitere Reaktionen ergeben zunächst einen kompletten Baustein aus Ribose und Base und anschließend ein komplettes Nukleotid. Daneben entstehen zwar auch »falsche« Verbindungen, doch diese werden durch Bestrahlung mit ultraviolettem Licht ausgemerzt. Chemikalien, die vor den ersten lebenden Zellen vorhanden waren Im Mai 2009 lösten John Su­ther­ land und seine Kollegen von der University of Manchester (England) ein hartnäckiges Problem der präbiotischen Chemie. Sie zeigten, dass Nukleotide sich durch eine spontan ablaufende Folge chemischer Reaktionen bilden können. Das Foto zeigt Sutherland (zweiter von links) mit seiner Labormannschaft. Zucker Nukleinbase C Phosphat 2-Aminooxazol x Phosphat Arabinooxazolin C Zucker Sauerstoff Kohlenstoff Stickstoff Phosphor Phosphat RNA-Nukleotid SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Andrew Swift, nach: Matthew W. Powner, Beatrice Gerland & John D. Sutherland, »Synthesis of activated pyrimidine ribonucleotides in prebiotically plausible conditions«, in: nature, Bd. 459, 14. Mai 2009 Chemikalien, die vor den ersten lebenden Zellen vorhanden waren 47 Auf dem langen Weg zum Leben Lebensentstehung Alternativen zu »RNA zuerst« PNA zuerst Peptid-Nukleinsäure ist ein Molekül, bei dem die Nukleinbasen auf einem proteinähnlichen Rückgrat sitzen. PNA ist einfacher aufgebaut als RNA und auch chemisch stabiler. Daher glauben einige Forscher, dass dieses Polymer in den ersten Lebensformen die Erbinformationen trug. Stoffwechsel zuerst Da es schwierig ist, die Entstehung von RNA aus unbelebter Materie zu erklären, bevorzugen manche Forscher die Annahme, das Leben sei in Form von vernetzten Katalysatoren entstanden, die gemeinsam Energie verarbeiteten. Panspermie Weil zwischen der Entstehung der Erde und dem Auftreten erster Lebensformen »nur« ein paar hundert Millionen Jahre liegen, meinen einige Wissenschaftler, die aller­ ersten Organismen seien aus dem Weltall auf die Erde gelangt. 48 ist sehr flüchtig. Sobald das Wasser verdunstete, verdampfte darum auch das 2-Aminooxazol, um andernorts in reiner Form wieder zu kondensieren. Dort bildete es das Ausgangsmaterial für weitere chemische Reaktionen, die zu einer Verbindung aus einem vollständigen Zucker und einer Nukleinbase führten. So elegant dieser Weg auch erscheint, er liefert leider nicht ausschließlich die »richtigen« Nukleotide; manchmal sind Zucker und Nukleinbase nicht korrekt angeordnet. Doch erstaunlicherweise zerstört Bestrahlung mit ultraviolettem Licht – wie in seichten Gewässern auf der frühen Erde, die starker UV-Strahlung ausgesetzt waren – die »falschen« Nukleotide und lässt nur die »richtigen« übrig. Alles in allem ergibt sich ein blitzsauberer Reaktionsverlauf zu den C- und U-Nukleotiden. Freilich fehlt noch ein ebenso schöner Reaktionspfad zu G und A, aber Sutherlands Team hat jedenfalls einen wesentlichen Beitrag zur Antwort auf die Frage ge­ leis­tet, wie ein so komplexes Molekül wie die RNA einst überhaupt entstehen konnte. Künstliches Leben im Labor Wenn wir einmal Nukleotide haben, fehlt als letzter Schritt zur Synthese eines RNA-Moleküls noch die Polymerisation: Der Zucker des einen Nukleotids bildet eine chemische Brücke zur Phosphatgruppe des nächsten, so dass sich die Nukleotide kettenförmig aneinanderreihen. Da sich die Ketten in wässriger Lösung nicht spontan bilden, benötigt auch dieser Schritt Energiezufuhr. Forschern gelang es, kurze Ketten von 2 bis 40 Nukleotiden Länge zu produzieren, indem sie einer Lösung chemisch reaktiver Nukleotidderivate verschiede­ ne Chemikalien beifügten. Gene heute lebender Organismen sind allerdings Tausende bis Millionen Nukleotide lang. Ende der 1990er Jahre konnten Jim Ferris und seine Mitarbei- Nachdem durch chemische Reaktionen die ersten genetischen Bausteine und andere organische Moleküle entstanden waren, brachten geophysikalische Prozesse sie in neue Umgebungen und reicherten sie dort an. Die Chemikalien fügten sich zu größeren Molekülen und schließlich zu primitiven Zellen zusammen. Vor rund 3,7 Milliarden Jahren brachten güns­ tige Umweltbedingungen diese Protozellen dazu, sich zu reproduzieren. mikroskopische Tonschichten Polymerisation von Nukleotiden Brutstätten der RNA In den wässrigen Lösungen, in denen die Nukleotide entstanden, konnten sie sich kaum zu langen Strängen zusammenlagern und Erbinformationen speichern. Dafür waren spezielle Bedingungen nötig – zum Beispiel molekulare Adhäsionskräfte, welche die Nukleotide zwischen mikroskopisch dünnen Tonschichten eng zusammenbrachten (oben). ter vom Rensselaer Polytechnic Institute zeigen, dass Tonmineralien den Prozess begüns­ tigen, wodurch Ketten mit bis zu 50 Nukleotiden entstehen. Da mineralische Oberflächen die Eigenschaft haben, Nukleotide zu binden, bringen sie die reaktiven Moleküle nahe zusammen und erleichtern so die Brückenbildung (siehe Kasten oben). Diese Entdeckung bestärkte einige Forscher in ihrer Annahme, das Leben sei auf mineralischen Oberflächen entstanden – möglicherweise im lehmreichen Schlamm auf dem Grund von Tümpeln, die aus heißen Quellen gespeist wurden (siehe »Der steinige Weg zum Leben« von Robert M. Hazen, Spektrum der Wissenschaft 6/2001, S. 34). Selbst wenn man genau wüsste, wie genetisch nutzbare Polymere erstmals entstanden sind, wäre das Problem der Lebensentstehung damit noch nicht gelöst. Um als »lebendig« zu gelten, muss sich ein Organismus vermehren, das heißt seine genetische Information kopieren. In modernen Zellen erfüllen Enzyme auf Proteinbasis diese Aufgabe. Doch wenn genetische Polymere aus geeigneten Nukleotidsequenzen bestehen, können sie durch Faltung komplexe Formen annehmen und chemische Reaktionen katalysieren – genau wie die heutigen Enzymproteine. Daher ist denkbar, dass die RNA in den allerersten SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 warme Seite des Tümpels kalte Seite des Tümpels 4 D ie Membran nimmt ● neue Fettsäuremoleküle auf und wächst. 5 D ie Protozelle teilt ● sich, die Tochter- zellen wiederholen den Zyklus. Kon ve Unterstützte Reproduktion un ht ic g Tochterzellen Fettsäure­ moleküle Protozelle und bilden einen komplementä­ ren Strang. ● ● ● ● ● Nukleotide ärme 3 W ● spaltet den Doppelstrang in Einzelstränge. RNADoppelstrang mutationen auch die Evolution zu wirken, bis die Protozellen irgendwann fähig wurden, sich eigenständig zu vermehren. Das Leben war geboren. Organismen ihre eigene Replikation steuerte. Das hat uns sowie David Bartel am Massa­ chusetts Institute of Technology auf die Idee gebraucht, durch Evolution im Labor neue Ribozyme zu züchten. Wir begannen mit Billionen zufälliger RNA-Sequenzen. Dann wählten wir diejenigen mit katalytischen Eigenschaften aus und kopierten sie. Bei jedem Kopiervorgang traten in einigen RNA-Strängen Mutationen auf, die deren katalytische Eigenschaften verbesserten. Wieder selektierten wir diese Moleküle für den nächsten Kopierschritt. Mit derart gerichteter Evolution vermochten wir Ribozyme zu schaffen, die das Kopieren anderer, relativ kurzer RNA-Stränge katalysieren. Allerdings sind sie nicht fähig, RNAs mit ihren eigenen Sequenzen zu kopieren; das heißt, sie produzieren keine direkten Nachkommen. Vor Kurzem erhielt die Idee der RNASelbstreplikation neuen Auftrieb durch Tracey Lincoln und Gerald Joyce vom Scripps Research Institute in La Jolla (Kalifornien). Sie entwickelten zwei Ribozyme, die Kopien des jeweils anderen Moleküls erzeugen können, indem sie zwei kürzere RNA-Stränge verbinden. Leider gelang das Experiment nur, wenn bereits lange und komplexe RNA-Stücke vorhanden waren, die nicht spontan hätten entstehen können. Dennoch legen die Resultate SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 nahe, dass die katalytischen Fähigkeiten der RNA im Prinzip für die Selbstreplikation ausreichen. Gibt es vielleicht eine einfachere Alterna­ tive? Wir und andere Forscher versuchen derzeit, genetische Moleküle ohne Hilfe von Katalysatoren zu kopieren. Wir benutzen DNAEinzelstränge als Kopiervorlage, da DNA einfacher und billiger zu handhaben ist als RNA; wir hätten die gleichen Experimente aber auch mit RNA durchführen können. Wir fügten zuerst den Mustersträngen eine Nukleotidlösung zu und hofften, dass sich die Nukleotide gemäß den Regeln komplementärer Basenpaarung – A zu T und C zu G – an die Musterstränge binden und dann polymerisieren würden, so dass schließlich eine komplette Doppelhelix entstünde. Dies wäre der erste Schritt zur vollständigen Replikation: Nach Bildung der Doppelhelix müsste man die beiden Stränge trennen, damit der komplementäre Strang als Vorlage zur Synthese einer Kopie des Originalstrangs dient. Mit normaler DNA oder RNA verläuft dieser Vorgang extrem langsam. Doch durch kleine Änderungen an der chemischen Struktur der Zuckerkomponente – Austausch einer Hydroxylgruppe aus Sauerstoff und Wasserstoff gegen eine Aminogruppe aus Stickstoff und Wasserstoff – geht die Polymerisation 2 a usgereifte ● Protozelle In Wasser gelöste Fettsäure­ moleküle setzen sich spontan zu Lipidmembranen zusammen. Anfangs sind die Membranen kugelförmig, doch bald wachsen aus ihnen durch Absorption weiterer Fettsäuren dünne Filamente (Mikroskopaufnahme unten). So entstehen lange, dünne Röhrchen, die bald in viele kleine Kügelchen zerfallen. Auf diese Weise haben sich vielleicht die ersten Protozellen geteilt. wachsendes Filament Membran 49 aus: Jack W. Szostak & Ting F. Zhu: »Coupled growth and division of model protocell membranes«. in: journal of the american chemical society 131(15), 22. April 2009 1 N ukleotide ● dringen in die Andrew Swift Manche der neu gebildeten Polymere wurden in wassergefüllte Bläschen eingeschlossen, die entstanden, indem Fettsäuren sich spontan zu Membranen zusammenlagerten. Wahrscheinlich war ein äußerer Anstoß nötig, damit diese Protozellen durch Duplizierung des Erbmaterials mit ihrer Reproduktion begannen. In einem Szenario (rechts) zirkulierten die Protozellen zwischen den kalten und warmen Zonen eines Tümpels, der auf einer Seite zugefroren war, während die andere Seite vulkanisch erwärmt wurde. Auf der kalten Seite dienten RNA-Einzelstränge 1 als Vorlagen, an denen neue Nukleotide durch Basenpaarung – A paart sich mit U, C mit G – einen Doppelstrang 2 bildeten. Auf der warmen Seite brach die Hitze die Doppelstränge in komplementäre Einzelstränge auf 3 . Dort konnten die Membranen auch langsam wachsen 4 und sich in »Tochterprotozellen« teilen 5 , die den Zyklus von Neuem begannen. Nachdem der Reproduktionsprozess in Gang gekommen war, begann durch Zufalls- kti on sr Lebensentstehung Unterwegs zur heutigen Zelle Lipidmembran ie Evolution beginnt 1 D ● hunderte Male schneller vor sich, so dass die Gegenstränge in Stunden statt Wochen entstehen. Das neue Polymer verhält sich wie normale RNA, obwohl es Stickstoff-Phosphor-Bindungen statt der normalen Sauerstoff-Phosphor-Bindungen trägt. Wie entstand die erste Zelle? Leben neu erschaffen Um den Ursprung des Lebens zu enträtseln, versuchen einige Wissenschaftler, aus künstlichen Materialien einen selbstreplizierenden Organismus zu fabrizieren. Am schwierigsten ist es, ein genetisches Molekül zu finden, das sich selbst autonom zu replizieren vermag. Die Autoren entwerfen und synthetisieren zu diesem Zweck chemisch modifizierte Versionen von RNA und DNA. Die RNA selbst löst das Problem wahrscheinlich nicht, denn ihre Doppelstränge trennen sich nur schwer in Einzelstränge für die Re­plikation. 50 Ribozym RNA wird dupliziert Die erste Protozelle ist bloß ein wasser­ gefülltes Bläschen, das RNA enthält. Sie benötigt zur Reproduktion einen externen Anstoß, etwa zyklische Tempera­ turschwankungen. Doch bald erwirbt sie neue Eigenschaften. Andrew Swift Energie A b fal RNADoppelstrang Ribozyme entstehen; diese gefalte­ ten RNA-Moleküle haben ähnliche Fähigkeiten wie Enzyme auf Proteinbasis. Sie beschleunigen die Re­ produktion und verstärken die Membran der Protozellen. Nun beginnen die Protozellen sich selbstständig zu reproduzieren. toffe hrs Nä Nachdem das Leben auf die Welt ge­ kommen war, trieb der Konkurrenzkampf unter den Lebensformen die Entwicklung zu immer komplexeren Organismen voran. In allen Einzelheiten werden wir die frühe Evolution wohl nie rekonstruieren können, doch hier ist ein plausibles Modell der wichtigsten Prozesse, die von der ersten Protozelle bis zu Bakterien und anderen DNA-haltigen Zellen führten. l NA-Katalysatoren 2 R ● Nehmen wir einmal an, dass wir unsere Wissenslücken hinsichtlich der Chemie der Lebensentstehung bald ganz schließen werden. Dann können wir schon überlegen, wie einst aus der Interaktion von Molekülen die ersten zellenähnlichen Gebilde hervorgingen. Die Außenmembranen moderner Zellen bestehen in erster Linie aus Lipid-Doppelschichten, die sich ihrerseits aus fettigen Molekülen wie Phospholipiden und Cholesterin aufbauen. Membranen halten die einzelnen Zellkomponenten physikalisch zusammen und bilden eine Barriere gegen das unkontrollierte Ein- und Austreten großer Moleküle. In die Hülle eingebettete Proteine agieren quasi als Türhüter: Sie befördern Moleküle in die Zelle hinein oder aus ihr heraus. Andere Proteine wirken bei der Konstruktion und Reparatur der Membran mit. Wie konnte eine kümmerliche Protozelle, ganz ohne raffinierte Proteinmaschinerie, all diese Aufgaben bewältigen? An einem einfachen Modell demonstrierten wir die Fähigkeit einer Protozelle, ihre genetische Information mit Hilfe von Nährstoffen aus der Umgebung zu kopieren. Wir präparierten Vesikel – kleine Bläschen – aus Fettsäuremembranen mit einem kurzen Stück einzelsträngiger DNA im Inneren, die als Schablone zur Herstellung eines Gegenstrangs gedacht war. Dann setzten wir den Vesikeln neuer Strang Ribozym er Stoffwechsel setzt ein 3 D ● Andere Ribozyme katalysieren den Stoffwechsel: Sie setzen Ketten chemischer Reaktionen in Gang, mit denen Protozellen Nährstoffe aus der Umwelt zu nutzen vermögen. chemisch reaktive Versionen von Nukleotiden zu. Diese durchdrangen spontan die Membranbarriere, lagerten sich an den DNA-Strang in der Modellprotozelle an und erzeugten einen Komplementärstrang. Das Experiment stützt die Idee, dass die ers­ ten Protozellen nicht viel mehr als RNA – oder etwas Ähnliches – enthielten und ihr Erbmaterial ohne Hilfe von Enzymen zu replizieren vermochten. Um sich zu reproduzieren, mussten die Protozellen fähig sein, zu wachsen, ihr Erbgut zu duplizieren und sich in gleichwertige Tochterzellen zu teilen. Wie Versuche gezeigt haben, können primitive Vesikel auf mindestens zwei Arten wachsen. In einer Pionierarbeit aus den 1990er Jahren fügte Pier Luigi Luisi von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich der Lösung, in der die Vesikel schwammen, frische Fettsäuren hinzu. Die Membranen bauten die Fettsäuren ein und vergrößer­ ten ihre Oberfläche. Indem Wasser und darin gelöste Substanzen nachströmten, vergrößerte sich auch das Zellvolumen. Einen zweiten Ansatz, der auf der Konkurrenz zwischen Protozellen beruht, untersuchte Irene Chen, damals Doktorandin in unserem Labor. Modellprotozellen, die RNA oder ähnliche Moleküle enthielten, schwollen an, weil durch Osmose Wasser in die Zelle strömte. Die dadurch gedehnten Membranen wuchsen, indem sie den entspannten Membranen der Nachbarvesikel Fettsäuren stahlen – wodurch diese schrumpften. Im Jahr 2008 beobachtete Ting Zhu, ebenfalls Doktorand in unserem Labor, das Wachstum der Modellprotozellen, nachdem er sie mit frischen Fettsäuren gefüttert hatte. Zu unSPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Medizin & Biologie Aminosäurekette Ribozyme roteine dominieren 5 P ● Katalysatoren auf Proteinbasis – das heißt Enzyme – ersetzen Zug um Zug die meisten Ribozyme der Protozellen. DNA Ribosom Enzyme gefaltetes Protein A bfa ll gefaltetes Protein Energie roteine treten auf 4 P ● serem Erstaunen streckten die anfangs kugelförmigen Bläschen zunächst ein dünnes Filament aus, das im Lauf einer halben Stunde länger und dicker wurde, wodurch sich das ganze Vesikel allmählich in eine lange, dünne Röhre verwandelte. Diese Struktur war sehr zerbrechlich. Schon durch leichtes Schütteln – wie durch die Wellen, die der Wind auf einem Tümpel erzeugt – zerfiel sie in kleinere, kugelförmige Tochterprotozellen, die dann selbst wuchsen und den Zyklus wiederholten (siehe Mikroskopaufnahme S. 49 unten). Teile dich und herrsche Wenn die richtigen Bausteine vorhanden sind, erscheint demnach die Bildung von Protozellen nicht allzu schwierig: Membranen fügen sich selbst zusammen, genetische Polymere ebenfalls, und die beiden Komponenten können auf vielfältige Weise zusammenfinden – beispielsweise, indem die Membranen um bereits existierende Polymere herum entstehen. Diese mit Wasser und RNA gefüllten Säckchen wachsen, absorbieren neue Moleküle, konkurrieren um Nährstoffe und teilen sich. Um wirklich zu leben, müssen sie sich jedoch reproduzieren und weiterentwickeln. Insbesondere müssen sie ihre RNA-Doppelstränge trennen, damit jeder Einzelstrang als Vorlage für einen neuen Doppelstrang dienen kann, der an eine Tochterzelle weitergegeben wird. Dieser Vorgang kam nicht ganz von selbst in Gang, sondern brauchte ein wenig Hilfe. Stellen wir uns zum Beispiel eine Vulkangegend auf der ansonsten kalten Früherde vor; damals schien die Sonne mit nur 70 Prozent ihrer heutigen Kraft. Vermutlich gab es Kaltwassertümpel, die teilweise von Eis bedeckt, SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Enzym toffe hrs Nä Komplexe Systeme von RNA-Kata­ lysatoren beginnen RNA-Nukleotidsequenzen (Gene) in Ketten von Aminosäuren (Proteine) zu überset­ zen. Später erweisen sich Proteine als die besseren Katalysatoren, die vielfältige Aufgaben übernehmen Membranprotein können. eburt der DNA 6 G ● Andere Enzyme beginnen DNA herzustellen. Dank ihrer überlegenen Stabilität übernimmt die DNA die Rolle des primären Erbmoleküls. Die RNA hat nun vor allem die Aufgabe, als Brücke­zwischen der DNA und den Proteinen zu wirken. aber von heißem Gestein flüssig gehalten wurden. Die Temperaturunterschiede riefen Konvektionsströme hervor, und dadurch wurden die Protozellen im Wasser höheren Temperaturen ausgesetzt, wenn sie die heißen Steine passierten, aber fast augenblicklich vom kalten Wasser wieder abgekühlt. Die plötzliche Erwärmung spaltete die Doppelhelix in Einzelstränge, und bei der Rückkehr in die Kälte konnten sich nach diesen Vorlagen neue Doppelstränge bilden – getreue Kopien des Originals (siehe Kasten S. 49 oben). Sobald die Umwelt die Protozellen zur Reproduktion anregte, setzte auch die Evolution ein. Insbesondere mutierten einige RNA-Sequenzen irgendwann zu Ribozymen, die das Kopieren der RNA beschleunigten – ein klarer Wettbewerbsvorteil. Schließlich begannen Ribozyme die RNA ohne Hilfe von außen zu kopieren. Es ist leicht vorstellbar, wie RNA-Protozellen sich dann weiterentwickelt haben (siehe Kasten oben). Der Stoffwechsel entstand allmählich, indem neuartige Ribozyme den Zellen ermöglichten, in ihrem Inneren Nährstoffe aus einfacheren und häufiger vorkommenden Ausgangsmaterialien selbst herzustellen. Als Nächstes erweiterten die Organismen ihre chemische Trickkiste um die Proteinsynthese. Mit ihrer erstaunlichen Vielseitigkeit haben die Proteine dann die Rolle der RNA beim Kopieren der Erbinformation und im Stoffwechsel übernommen. Später lernten die Organismen, DNA herzustellen, und kamen dadurch in den Besitz eines robusteren Trägers der Erbinformation. Erst an diesem Punkt wurde die RNA-Welt zur DNA-Welt – und das Leben, wie wir es kennen, begann. ie Welt der Bakterien 7 D ● Organismen, die modernen Bakterien ähneln, passen sich an unterschiedlichste Umweltbedingungen überall auf der Erde an. Sie herrschen unangefochten Milliarden Jahre lang. Einige entwickeln sich allmählich zu komplexeren Organismen weiter. Alonso Ricardo, geboren in Cali (Kolumbien), ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Howard Hughes Medical Institute der Harvard Univer­ sity. Derzeit forscht er über selbst­ replizierende chemische Systeme. Jack W. Szostak ist Professor für Genetik an der Harvard Medical School und am Massachusetts General Hospital. Er konstruiert biologische Strukturen im Labor, um auf diese Weise Lebensvorgänge besser zu verstehen. 2009 erhielt Szostak den Medizin-Nobelpreis. Gesteland, R. F. et al. (Hg.): The RNA World. Cold Spring Harbor Laboratory Press, 3. Auflage 2006. Hazen, R. M.: Genesis: The Scientific Quest for Life’s Origins. Joseph Henry Press, Washington 2005. Nielsen, P. E.: Ein neues Molekül des Lebens? In: Spektrum der Wissenschaft 10/2009, S. 42 – 49. Shapiro, R.: Ein einfacher Ursprung des Lebens. In: Spektrum der Wissenschaft 11/2007, S. 64 – 72. Szostak, J. et al.: Synthesizing Life. In: Nature 409, S. 387 – 390, 2001. Weblinks zu diesem Thema finden Sie unter www.spektrum.de/ artikel/1019953. 51 Entwicklungsbiologie Die Simulation der Embryonalentwicklung Die Bildung eines komplexen Organismus aus einer einzigen Zelle – der befruchteten Eizelle – ist ein faszinierender Prozess. Mathematisch fundierte Modellbildung hat zum Verständnis der zu Grunde liegenden komplexen Mechanismen wesentlich beigetragen. Von Hans Meinhardt In Kürze r Die Entstehung von lokalen Signalzentren in einem ursprünglich strukturlosen Gewebe, wie sie für die Embryonalentwicklung erforderlich ist, kann durch das Wechselspiel zweier chemischer Substanzen namens Aktivator und Inhibitor mathematisch modelliert werden. r In den letzten fast 40 Jahren ist dieses Modell in verschiedene Richtungen weiterentwickelt worden; es erfasst mittlerweile viele Details der Embryonalentwicklung wie die Ausbildung der Körper­ achsen, die Entstehung bilateral symmetrischer Strukturen und das Wachstum von Adern und Nerven. r Viele zunächst nur hypo­thetische Wechselwirkungen sind inzwischen in der Realität nachgewie­ sen worden. 52 A lle Zellen eines höheren Organis­ mus einschließlich des Menschen tragen in ihrem Kern dieselbe ge­ netische Information; denn diese wird bei jeder Zellteilung an beide Tochter­ zellen weitergegeben. Trotzdem bilden die Zellen während der Entwicklung sehr ver­ schiedene Strukturen wie Kopf, Arme, Blut­ gefäße oder Nerven, und zwar mit großer Zuverlässigkeit zur richtigen Zeit an der rich­ tigen Stelle. Die Ähnlichkeit eineiiger Zwil­ linge zeigt, bis in welche Details die gene­ tische Festlegung geht. Was veranlasst die Zellen, in verschiedenen Regionen verschie­ dene Strukturen zu bilden, wo doch ihre ge­ netische Ausstattung stets dieselbe ist? Lange bevor man auch nur daran denken konnte, irgendwelche dafür verantwortlichen Substanzen ausfindig zu machen, haben Bio­ logen Teilantworten auf diese Frage gefunden. In mittlerweile klassischen Experimenten stör­ ten sie die normale Entwicklung und beob­ achteten die Folgen. Vor mehr als 250 Jahren hat der Schweizer Zoologe Abraham Trembley (1710 – 1784) entdeckt, dass man den kleinen Süßwasserpolypen Hydra in mehrere Stücke zerscheiden kann und jedes von ihnen wieder einen vollständigen Polypen bildet. Offenbar findet zwischen den Zellen eine Kommunika­ tion statt, wodurch das Fehlen von Strukturen erkannt wird und Signale zur Regeneration gebildet werden. Selbst nach einer Zerlegung in Einzelzellen und anschließender Reaggre­ gation können sich wieder lebensfähige Poly­ pen bilden (Kas­ten S. 54). Offenbar ist die bio­logische Strukturbildung ein sehr robuster und sich selbst organisierender Prozess, der auch von einem mehr oder weniger struktur­ losen Anfangszustand ausgehen kann. Viele höhere Organismen sind zumindest in frühen Stadien zu einer ähnlichen Um­ strukturierung fähig. So besteht der Embryo eines Huhns anfänglich aus einer scheiben­ artigen Anordnung von Zellen (kleines Bild rechts), die auf dem großen Dotter liegt. Zer­ teilt man die­se Scheibe in zwei oder drei Teile, so kann jedes der Fragmente einen vollstän­ digen Embryo bilden. Die fertige Struktur kann also nicht schon in der Scheibe festge­ legt sein; sonst würde jedes Fragment nur ei­ nen Teil des Embryos bilden. Bestimmte Regionen im Organismus spie­ len bei der Entwicklung eine besondere Rol­ le. Diese so genannten Organisatorregionen üben einen maßgeblichen Einfluss auf das Schicksal ihrer Umgebung aus. Eine klas­ sische Vorstellung ist, dass dort Moleküle produziert werden, die sich in die Umgebung ausbreiten. Je weiter eine Zelle von einem solchen Zentrum entfernt ist, desto geringer ist die Konzentration dieses Signalstoffs (des »Morphogens«). Jede Zelle misst die in ihr vorliegende Konzentration, erkennt daran ihre Entfernung von der Organisatorregion SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 mit frdl. Gen. von Nicolas Denans, IGBMC Medizin & Biologie mit frdl. Gen. von Lydia Lemaire und schaltet daraufhin auf das positionsge­ rechte Verhalten um. Die Mundöffnung der Hydra ist eine sol­ che Organisatorregion. Transplantiert man wenige Zellen von der Mundöffnung in eine seitliche Region dieses schlauchartigen Tieres, so bildet sich dort ein neuer und vollständiger Kopf. Mit verschieden gefärbten Transplan­ tats- und Wirtszellen zeigte 1909 die amerika­ nische Zoologin Ethel Browne (1885 – 1965), dass die implantierten Zellen das umgebende Wirtsgewebe umprogrammieren: Nicht die im­plantierten Zellen, sondern das Wirtsgewe­ be bildet die Tentakeln an jener ungewöhn­ lichen Stelle. Berühmt wurde der Organisator im frühen Amphibienembryo, den 1924 die Freiburger Biologen Hans Spemann (1869 – 1941, Nobelpreis 1935) und Hilde Mangold (1898 – 1924) entdeckten. Transplantiert man dieses spezielle Gewebestück auf die gegen­ überliegende Seite des kugelförmigen Em­ bryos, so kann ein zweiter Embryo entstehen; beide sind entlang der Bauchseite miteinander verwachsen. Mittlerweile kennen wir auch eine Vielzahl von Genen, die in solchen organisierenden Regionen aktiviert werden. Aber weder aus dieser Kenntnis noch aus den Transplantati­ onsexperimenten kann man direkt auf die molekularen Wechselwirkungen schließen, die der Bildung von Signalzentren zu Grunde lie­ gen. Aber man kann die Frage stellen: Welche Art von Wechselwirkung wäre im Prinzip in SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 der Lage, eine Erklärung für die Beobachtun­ gen zu liefern? In den Naturwissenschaften sind Theorien eine unverzichtbare Brücke zwischen experi­ mentellen Beobachtungen auf der einen Seite und dem Auffinden von Naturgesetzen und Grundprinzipien auf der anderen. Damit eine Theorie hinreichend bestimmt ist, um durch Beobachtungen überprüfbar zu sein, muss sie in aller Regel durch mathematische Gleichun­ gen ausgedrückt werden. Der Versuch, die ungeheuer komplexe Embryonalentwicklung in ein paar Gleichun­ gen zu fassen, mag zunächst hoffnungslos er­ scheinen. Man kann jedoch den Prozess in klar getrennte elementare Schritte zerlegen, die dann einer Theoriebildung zugänglich sind. Zusammen mit Alfred Gierer habe ich ab 1972 mathematische Modelle für einzelne Teilschritte entwickelt. Diese Modelle mach­ ten konkrete Voraussagen über den Charak­ ter der beteiligten molekularen Wechselwir­ kungen. Insbesondere müssen gewisse Bedin­ gungen mindestens erfüllt sein, damit lokale Signalzentren gebildet werden. Durch Com­ putersimulationen haben wir gezeigt, dass die von uns postulierten Wechselwirkungen die beobachteten Vorgänge und ihre Eigen­ schaften sehr gut wiedergeben können. Viele der Voraussagen haben in der Zwischenzeit eine experimentelle Bestätigung erfahren. Ei­ nige dieser Modelle sollen hier beschrieben werden. Der frühe Hühnerembryo besteht aus einer Scheibe, die auf dem großen Dotter liegt. An einem Rand bildet sich ein Organisationszentrum mit zunächst sichel­artiger Form aus (kleines Bild oben, blau eingefärbt). Durch Kommunikation zwischen den Zellen und intensive Bewegung der Zellen entsteht der lang gestreckte Embryo mit einer anteroposterioren (KopfSchwanz-)Achse und, senkrecht dazu, einer mediolateralen Achse, die an den paarweise angelegten Somiten (Vorläufern für Muskeln und Wirbel) links und rechts von der Mittellinie erkennbar ist. Es bildet sich ein weit verzweigtes Adersystem, das den Embryo mit Nährstoffen aus dem Dotter versorgt. Als erstes sichtbares Zeichen des Lebens macht sich früh das Herz bemerkbar. Aristoteles nannte es den »springenden Punkt« und prägte damit die Redensart. 53 Entwicklungsbiologie a a und b: Bert Hobmayer und Thomas Holstein, aus: Bert Hobmayer et al., Nature Bd. 407, S. 186 – 189, 14. Sept. 2000, fig. 2 a und 4 a–c; mit frdl. Gen. der Nature Publishing Group Musterbildung aus dem Nichts Der Süßwasserpolyp Hydra (a) hat an einem Ende seines schlauchförmigen Körpers eine von Tentakeln umgebene Öffnung, das Hypostom, mit dem er Nahrung aufnimmt. Diese Stelle ist eine Organisatorregion. Mehrere Gene sind dort aktiviert, darunter b-Catenin und Tcf (blau eingefärbt), zentrale Komponenten des so genannten WNT-Signalwegs. Hohe b-Catenin- und Tcf-Konzentrationen gehen auch der Knospenbildung voraus. Zerlegt man ein Tier in Einzelzellen und fügt diese wieder zu einem Zellklumpen zusammen, so entstehen dort neue Organisatorregionen, hier sichtbar gemacht durch die Aktivität von Tcf (b). Nach einer zunächst mehr wolkigen Aktivierung bilden sich lokale Maxima heraus. Dort werden später neue Hypostome gebildet. Diese spontane Musterbildung kann durch die Annahme eines Aktivator-Inhibitor-Systems (Kasten rechts) erklärt werden. In dieser Computersimulation (c) erscheinen mehrere Maxima gleichzeitig, da die Reichweite der Inhibition kleiner ist als die Ausdehnung des Zellhaufens. b Hans Meinhardt c 54 Strukturbildung ist kein Privileg der Biolo­ gie. Auch in der unbelebten Natur entstehen strukturierte Gebilde aus mehr oder weniger strukturlosen Anfangsbedingungen. Aus einer diffusen Wolke schlägt ein Blitz mit allen sei­ nen Verästelungen. Gleichmäßig über das Land verteiltes Regenwasser formt im Lauf der Zeit durch Erosion scharf begrenzte Flüsse. Den strukturerzeugenden Prozessen ist gemeinsam, dass kleine Abweichungen von einer Gleich­ verteilung durch eine starke Rückwirkung auf sich selbst weiter anwachsen. Eine Sanddüne hat vielleicht mit einem einzelnen Stein ange­ fangen, in dessen Windschatten sich Sand ab­ lagerte. Dadurch vergrößerte sich der Wind­ schatten, woraufhin noch mehr Sand abgelagert wurde … ein sich selbst verstärkender Prozess. Lokale Selbstverstärkung und langreichweitige Inhibition Selbstverstärkung allein ist aber nicht ausrei­ chend. Damit der sich selbst verstärkende Prozess räumlich begrenzt bleibt, so dass sta­ bile Muster entstehen können, muss es einen weiteren Prozess geben, der dem ersten entge­ genwirkt und auf größere Entfernungen sogar die Oberhand gewinnt. Die lokale Selbstver­ stärkung erfolgt also auf Kosten der Umge­ bung. Dieser Typ von Wechselwirkung liegt auch vielen Strukturbildungen im sozialen Bereich zu Grunde. Bei einem Kampf um eine Führungsposition kann ein ursprünglich kleiner Vorsprung entscheidend für dessen weiteren Ausbau sein. Am Ende gibt es einen Gewinner und neben ihm mehrere Verlierer. Molekular kann dieses Prinzip durch die Wechselwirkung von zwei Substanzen reali­ siert werden. Im einfachsten Fall stimuliert ein »Aktivator« seine eigene Produktion, zu­ gleich aber auch die Produktion eines »Inhibi­ tors«, welcher der Selbstaktivierung entgegen­ wirkt (Kas­ten rechts). Wenn sich, zum Bei­ spiel durch eine statistische Schwankung, die Konzentration des Aktivators ein wenig er­ höht, steigt sie daher rasch weiter an. Gleich­ zeitig steigt jedoch die Konzentration des In­ hibitors und zwingt den Aktivator in die nied­ rige Gleichgewichtskonzentration zurück. Nun findet dieses Wechselspiel in einem Verbund mehrerer Zellen statt. Durch einen diffusionsähnlichen Prozess können beide Stoffe von Zelle zu Zelle wandern, und zwar – das ist die entscheidende Annahme – der Inhi­ bitor viel schneller als der Aktivator. Steigt die Konzentration des Aktivators in einer Zelle an, fließt der Inhibitor so rasch in die Nach­ barzellen ab, dass er den Anstieg des Aktivators nicht vollständig unterdrücken kann. Dessen Konzentration steigt also weiter, bis sich ein neues Gleichgewicht eingestellt hat. Es entste­ SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Medizin & Biologie Ein Gleichungssystem für eine Muster bildende Reaktion ρa 2 h µa a Da ∂2a ∂x2 ρa ∂h ∂t ρa 2 µh h Dh ∂2h ∂x2 ρh Diese Gleichungen beschreiben die Konzentrationsände­ rungen zweier Substanzen, eines Aktivators a und eines Inhibitors h, in Abhängigkeit von der Zeit t und von der Ortskoordinate x. Das Modell ist also eindimensional, kann aber ohne Weiteres auf realistischere zwei oder drei Dimensionen erweitert werden. Die rechts und im Kasten links gezeigten Simulationen wurden mit einer zweidimensionalen Version durchgeführt. Die erste Gleichung besagt, dass die zeitliche Änderung ∂a/∂t der Aktivatorkonzentration durch folgende Terme bestimmt wird: ➤ Die Produktionsrate ra2/h des Aktivators a ist umso größer, je größer a schon ist, und zwar nicht nur proportional zu a, sondern zu a2. Diese nichtlineare Selbstverstärkung wird von der Theorie vorausgesagt. Sie ist in der Natur dann realisiert, wenn zwei Aktivatormoleküle zunächst einen Komplex bilden müssen, um die Synthese weiterer Moleküle auszulösen. Die Produktion wird umso stärker gehemmt, je mehr Inhibitor vorhanden ist (h steht im Nenner). Der Proportionalitätsfaktor r beschreibt die Fähigkeit der Zellen, diese autokatalytische Reaktion durchzuführen. ➤ Abbau –a a: Die Anzahl der Moleküle, die pro Zeiteinheit verschwinden, ist proportional zur Zahl der zum jeweiligen Zeitpunkt vorhandenen Moleküle, ähnlich wie die Zahl der Menschen, die im Mittel in einer Stadt sterben, proportional zur Zahl der Einwohner ist. ➤ Diffusion Da (∂2a/∂x2): Musterbildung kann nur stattfinden, wenn die Zellen untereinander Signale austauschen können. Eine Möglichkeit dazu ist die Diffusion des Aktivators. Sie ist proportional zur zweiten Ableitung der Konzentration. ➤ Eine geringe Grundproduktion ra stellt sicher, dass bei sehr niedrigen anfänglichen Aktivatorkonzentrationen überhaupt etwas passiert; dieser Fall kann bei einer Regeneration vorliegen. In der zweiten Gleichung besagt der erste Term, dass der ­Aktivator proportional zu seiner eigenen Produktion auch die des Inhibitors anregt. Dieser unterliegt im Übrigen im Prinzip denselben Abbau-, Diffusions- und Grundproduktionsprozessen, nur mit anderen Proportionalitätskonstanten. hen zeitlich stabile, inhomogene Verteilungen beider Substanzen (Kästen links und oben). Selbst unvermeidliche Fluktuationen sind aus­ reichend, um die Strukturbildung auszulösen. Damit ist eine Erklärung für einen zentra­ len Vorgang in der Entwicklung von Organis­ men gefunden. Auch wenn alle Zellen die gleiche genetische Information haben und in ihnen ursprünglich die gleichen Bedingungen herrschen: Nachdem die stabile Aktivator-In­ hibitor-Struktur sich eingestellt hat, sind die SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Für Computersimulationen diskretisiert man diese Differenzialgleichungen; das bedeutet im einfachsten Fall, dass man die räumlichen und zeitlichen Ableitungen durch Differenzenquotienten annähert. Damit wird die x-Achse ersetzt durch einzelne, getrennte (»diskrete«) Punkte, die man sich als Zellen vorstellen darf. Man gibt dann einen gewissen Anfangszustand für das Sys­ tem vor, zum Beispiel in jeder Zelle die Gleichgewichtskonzentrationen, und berechnet daraus mit Hilfe der diskretisierten Gleichungen den Zustand einen kleinen Zeitabschnitt später, daraus dessen Folgezustand und so weiter. Durch eine vielfache Wiederholung solcher Rechenschritte kann man den gesamten Zeitverlauf einer solchen Reaktion bestimmen. Hans Meinhardt ∂a ∂t In dieser Computersimulation genügen kleine Fluktuationen, um die Musterbildung auszulösen. Wenn die Reichweite des Inhibitors (die durch seine Diffusionsrate und seine Lebensdauer bestimmt ist) genügend groß ist, entsteht ein einziges Maximum in einer Randposition. Damit erhält das ursprünglich strukturlose Gewebe eine Polarität. Thierry Lepage, aus: V. Duboc, T. Lepage et al., Developmental Cell, 2004, Bd. 6, S.397 – 410, fig. 2 B; mit frdl. Gen. von Elsevier Dieselbe Dynamik findet man in der Natur zum Beispiel bei der Bildung des Oralfelds im Seeigel. Die Rolle des Aktivators übernimmt hier das Gen Nodal, die des Inhibitors das Gen Lefty2. Chemisch wirksam sind nicht die beiden Gene, sondern deren Produkte, die jeweils denselben Namen tragen. Die Bilder zeigen verschiedene Stadien der Embryonalentwicklung; das Produkt von Nodal ist angefärbt. Einige Programme, die auf jedem PC laufen sollten, sind von der Webseite www.eb.tuebingen.mpg.de/meinhardt abrufbar. Zellen in verschiedenen Positionen verschie­ denen Signalen ausgesetzt. Abhängig davon werden verschiedene Gene aktiviert, und die Zellen übernehmen die entsprechenden Funk­ tionen im sich entwickelnden Organismus. Eine wichtige Eigenschaft solcher Systeme ist die Fähigkeit zur Regulation. Entfernt man die aktivierten Zellen, so zerfällt der im Ge­ webe verbliebene Inhibitor, bis sich durch die Selbstverstärkung ein neues Aktivatorma­ ximum bildet. 55 mit frdl. Gen. von Rohan Penthiyagoda Entwicklungsbiologie Streifenmuster wie auf diesem Zebrafisch (oben) entstehen durch Muster bildende Systeme, bei denen die Selbstaktivierung nach oben begrenzt ist. In der Computersimulation (unten) wurden kleine statistische Schwankungen in der Fähigkeit zur Selbstverstärkung angenommen. Die entstehenden Streifen haben daher keine feste Orientierung und können sich verzweigen. Als wir die Theorie entwickelten, war die­ ser Typ von Reaktion noch hypothetisch. Heute kennen wir mehrere solche Systeme. Zum Beispiel verhalten sich die Produkte der Gene Nodal and Lefty2 wie von der Theorie vorausgesagt (Kasten S. 55). Die räumliche Begrenzung der selbstakti­ vierenden Reaktion kann statt durch einen Inhibitor auch durch eine Verarmung von Ressourcen in der Umgebung erfolgen. Da­ rauf beruht das oben erwähnte Beispiel der Sanddüne: Je mehr Sand in einer Düne ge­ bunden ist, desto weniger kann durch den Wind noch umverteilt werden, da die Ge­ samtmenge des Sands konstant bleibt. Die­sen Reaktionstyp beobachtet man vor allem bei Musterbildun­gen innerhalb einer Zelle. Durch Aggregation gleichartiger Moleküle an der Zellmembran entstehen lokale Konzen­ trationsmaxima. Das geschieht auf Kosten der Vorläufermoleküle, die sich in Zytoplasma der Zelle noch frei bewegen können, mit der Folge, dass ein weiteres Maximum sich nicht bilden kann. Die Selbstverstärkung kann auch auf einer indirekten Reaktion beruhen. Wenn zwei Mo­ lekülarten A und B sich gegenseitig in ihrer Produktion hemmen, dann führt eine Erhö­ hung der A-Konzentration zu einer Vermin­ derung der B-Produktion, was zu einer wei­ teren Erhöhung der A-Produktion führt. Eine solche indirekte Selbstverstärkung durch ge­ genseitige Inhibition spielt in der Bildung des oben erwähnten Spemann-Organisators eine entscheidende Rolle; involviert dabei sind die Produkte der Gene Chordin und BMP. Wie viele Maxima entstehen, hängt von der Größe des Gewebes und der Reichweite der Signalmoleküle ab. Als »Reichweite« be­ zeichnet man die Distanz, die ein Molekül zwischen seiner Entstehung und seinem Ver­ schwinden zurücklegen kann. Zebra- und andere Streifen Durch welche Wechselwirkung kann erreicht werden, dass eine Region, in der ein be­ stimmter Stoff produziert wird, in einer Rich­ tung eine sehr große, senkrecht dazu aber nur eine kleine Ausdehnung hat (Bild links oben)? Bei der Modell­bildung hat sich gezeigt, dass Streifen entstehen können, wenn der Selbst­ verstärkungsmechanismus eine Obergrenze hat, so dass die Produktionsrate des Ak­tivators – und damit des Inhibitors – nicht über eine ge­ wisse Grenze hinaus ansteigt. Da die Konzen­ tration des Aktivators nicht mehr so in die Höhe steigen kann, wächst sie in die Breite, das heißt, die aktivierten Regionen dehnen sich weiter aus, bis die dadurch ansteigende Achsenbildung bei Amphibien 56 entsteht im mesodermalen Ring durch die lokale Aktivierung spezifischer Gene. Mesodermale Zellen mit der Aktivität des Spemann-Organisators wandern unter das Ektoderm (nach oben in b). Sie bilden die Mittellinie im Gehirn und bestimmen die a Ektoderm Position des zentralen Nervensystems (orange). Der Abstand von der Mittellinie (Pfeile) bestimmt die mediolaterale Posi­ tion der Zellen, mit der zum Beispiel die paarweise Anordnung der Augen gesteuert wird. Beide Signalsysteme zusammen defi- b c V M 1 2 3 V M Mesoderm SpemannOrganisator Entoderm 4 4 4 4 SpemannOrganisator SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Hans Meinhardt Aus der befruchteten Eizelle bildet sich zunächst ein kugelförmiger Zellhaufen, der sich später einstülpt. Noch während der kugelförmigen Phase wird der Zellhaufen in Bereiche unterteilt, die nach der Einstülpung an verschiedene Stellen zu liegen kommen (a): das äußere Ektoderm (aus dem später unter anderem Haut und Nerven entstehen, blau), das innere Entoderm (innere Organe, braun) und das dazwischenliegende Mesoderm (Muskeln, Knochen und Blut, rot). Die Einstülpung findet entlang des mesodermalen Rings statt. Dieser wird zur Organisatorregion für die anteroposteriore Achse. Der dort produzierte Signalstoff (Wnt; blau bis grau) bestimmt den Ort von Vorder- (V) und Mittelhirn (M). Der Spemann-Organisator (gelb) Medizin & Biologie Siegfried Roth, aus: G. Chen, K. Handel und S. Roth, Development Bd. 127, 2000, S. 5145 – 5156, fig. 3 E – H; mit frdl. Gen. der Company of Biologists Ltd. c Hans Meinhardt a Hans Meinhardt b Menge an Inhibitor dem ein Ende setzt. Um stabil zu bleiben, brauchen aktivierte Regio­ nen in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft nicht­aktivierte Regionen, in die der Inhibitor abfließen kann. Beide Bedingungen, große zusammenhängende aktivierte Areale und die direkte Nachbarschaft aktivierter und nicht­ aktivierter Bereiche, sind bei streifenartigen Mus­tern erfüllt und für sie charakteristisch. Evolution der Körperachsen Höhere Organismen haben sich im Lauf der Evolution aus einfachen Organismen gebildet. Es hat sich gezeigt, dass die für die Entwick­ lung verwendeten Signalsysteme in der Evolu­ tion sehr früh erfunden wurden und sich spä­ ter kaum verändert haben. Höhere Organis­ men haben ihre große Komplexität nicht in erster Linie durch neue Signalsysteme, son­ dern durch neue Antworten der Zellen auf die früh erfundenen Signale sowie durch die Bil­ dung neuer Zelltypen erreicht. nieren ein kartesisches Koordinatensystem und machen für die Zellen eine Positionsinformation verfügbar. Bei der späteren Rumpfbildung (c) wandern Zellen von beiden Seiten in Richtung Spemann-Organisator und Mittellinie. Der Umfang schrumpft; dafür wird die Kopf-Rumpf-Achse immer länger. Zellen in der Nähe des Rings erhalten im Lauf der Zeit Merkmale, die sie als immer mehr zum posterioren Ende gehörig kennzeichnen (1, 2, 3, …), was nach Einordnen nahe der Mittellinie zur Bildung der endgültigen anteroposterioren Achse führt. Beide Mittellinien, die im evolutionär frühen Gehirn (orange) und die im evolutionär späteren Rumpf (rot), werden durch den Spemann-Organisator initiiert. Allerdings unterscheiden sich die Mechanismen im Detail. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Damit stellte sich insbesondere die spannen­ de Frage: Gibt es in der Bildung der Körper­ achsen bei höheren Organismen Prozesse, die ihren Ursprung bei unseren primitiven Vorfah­ ren haben? Welche unserer Körperachsen ent­ spricht der einzigen Achse, die man in primi­ tiven Organismen findet? Früh in der Evolu­ tion gab es offenbar kleine schlauchartige Tiere, die nur eine Öffnung hatten; die Hydra kann als einer ihrer Nachfahren betrachtet werden. Es ist aufschlussreich zu vergleichen, wo ei­ nander entsprechende Gene in primitiveren und höheren Organismen aktiviert sind. Im Polypen Hydra wird das Gen Otx fast überall aktiviert, mit Ausnahme der beiden Enden. Ebendieses Gen ist bei höheren Organismen für den Bereich des Vorder- und Mittelhirns charakteristisch. Das legt den überraschenden Schluss nahe, dass aus dem Otx-aktivierten Bereich, also der Körpermitte polypenähn­ licher Vorfahren, im Lauf der Evolution sich das Gehirn gebildet hat, das raffinierteste Or­ gan höherer Organismen. Am offenen Ende der Hydra, im so genannten Kopf, sind Gene aktiviert, die charakteristisch sind für das hin­ tere Körperende höherer Organismen. Die Schlauchöffnung mit dem Tentakelkranz, oft als Kopf der Hydra bezeichnet, entspricht also nicht dem Mund, sondern dem Anus. Der Rumpf höherer Organismen samt seiner Struktur und alle Extremitäten sind evolutio­ när später entstanden. Mit dieser Annahme stimmt überein, dass Gene, die für den Rumpf höherer Organismen charakteristisch sind, die so genannten HOX-Gene, in der Hydra nicht anzutreffen sind. In der individuellen Ent­ wicklung wird auch zuerst die Kopfregion und erst später der Rumpf angelegt. In dieser Hin­ sicht wiederholt bei den meisten höheren Or­ ganismen »die Ontogenese die Phylogenese«. Für einen im Wesentlichen schlauchartigen Organismus wie Hydra genügt es, wenn die Strukturen entlang der Längsachse definiert werden. Das leisten lokal begrenzte Organisa­ torregionen an einem oder beiden Enden. Im Modell für die Mittellinien­ bildung in einem Insekten­ embryo bilden sich zunächst eine vordere und eine hintere Organisatorregion (a, rot und blau), dann in größtmöglichem Abstand von ihnen eine weitere (grün); sie definiert die Dorsal(Rücken-)seite des Insekts. Die vom dorsalen Organisator ausgehende Inhibition erzwingt die Entstehung einer Mittellinie (b, braun) auf der gegenüber­ liegenden (Ventral-)Seite, die sich dort zunehmend verschärft. Genau dieses Verhalten beob­ achtet man am Embryo des Käfers Tribolium (c). Die Bilder zeigen aufeinander folgende Stadien in der Aktivität des entsprechenden Gens im Blick auf die Ventralseite. 57 Entwicklungsbiologie Höhere Organismen haben von ihren hydraartigen Vorfahren den Körperbauplan übernommen – allerdings unter Vertauschung von vorn und hinten Höhere Organismen benötigen darüber hi­ naus noch eine zweite Koordinate: Der mehr oder weniger zylinderförmige Embryo muss gewissermaßen nicht nur wissen, wo bei ihm vorn und hinten ist, sondern auch noch ver­ schiedene Stellen entlang des Umfangs unter­ scheiden können. Das Mittellinienproblem Konkreter gesprochen, muss es eine Organisa­ torregion in Form einer Mittellinie geben, die von vorn nach hinten auf dem Zylinderman­ tel (oder auf den Zellschichten, die sich später zu einem Zylinder schließen werden) verläuft. Zellen auf dem Umfang des Zylinders bestim­ men auf die oben ausgeführte Art ihren Ab­ stand von der Mittellinie und verhalten sich entsprechend. Auf diese Weise kommt die durchgängig zu beobachtende bilaterale Sym­ metrie zu Stande. Das zentrale Nervensystem und die Wir­ belsäule werden dicht an der Mittellinie ange­ legt. Strukturen wie Augen, Arme und Beine erfordern zwei Positionswerte für ihre Anlage: für den Abstand von der Mittellinie und für den vom Kopf- oder Hinterende. Eine Mittellinie ist ein Streifenmuster mit nur einem schmalen Streifen (der Mittellinie) und einer sehr breiten Lücke (dem Rest des Zylinders). Die Bildung eines solchen Musters ist ein sehr diffiziler Prozess, der nicht mit ei­ ner einzigen Reaktion zu realisieren ist. In dem oben beschriebenen Modell zur Streifen­ bildung durch molekulare Wechselwirkungen (Bild S. 56 oben) werden Streifen und Lücken charakteristischerweise stets annähernd gleich breit – wie beim Zebra. Man könnte die Pro­ duktion des Inhibitors so stark erhöhen, dass der eine Streifen jeden anderen entlang des Umfangs unterdrückt. Dann würde jedoch die Streifenbildung instabil, und der Streifen würde in fleckenartige Regionen zerfallen. Die Natur hat für dieses Problem verschiedene Lö­ sungen gefunden, die auf der Kopplung meh­ rerer strukturbildender Reaktionen beruhen. Am Beispiel von Insekten und Wirbeltieren seien zwei solche Strategien erläutert. Bei den Insekten ist es hilfreich, sich den Embryo entgegen den Tatsachen kugelförmig vorzustellen, wie einen Globus. Nehmen wir an, dass Nord- und Südpol gebildet worden sind, das heißt, dass sich Organisatorregionen Modell zur Bildung einer Armanlage 58 anteriore Position (e), so kann eine symmetrische Hand mit zwei kleinen Fingern entstehen. Nach dem Modell ist dann die A-­ Region an beiden Seiten durch eine P-Region begrenzt, und die Konzentration des Morphogens nimmt eine U-Form an. Transplantiert man umgekehrt Gewebe aus der Armregion in eine mehr posteriore Position (f), so bilden sich zwei Arme, die spiegelbildlich zueinander angeordnet sind. Nach dem Modell entstehen durch die Anordnung A–P–A zwei getrennte A-Regionen, die jeweils von einer P-Region begrenzt sind. Die beiden Morphogengradienten sind spiegelsymmetrisch zueinander. Die ARegion, die entgegen der natürlichen Anordnung anterior durch die P-Region begrenzt wird, bildet einen Arm mit umgekehrter Polarität. Aus derartigen Experimenten und dem Modell ist zu erschließen, dass bei Wirbeltieren im Gegensatz zu Insekten für die Anlage der Extremitäten nur die Morphogenkonzentration auf der A-Seite, nicht aber auf der P-Seite verwendet wird. d e f alle Abbildungen: Hans Meinhardt Wenn zwei verschieden determinierte Re­ gionen A und P zusammenarbeiten müssen, um eine neue Signalsubstanz (ein »Mor­ phogen«) zu produzieren, kann diese Produktion nur nahe der gemeinsamen Grenze stattfinden (a, gelbe Region). Die lokale Konzentration des Morphogens ist ein Maß für die Entfernung von der Grenze und damit geeignet, die Regionen A und P weiter zu unterteilen. Betrachten wir b c vereinfachend einen Embryo als einen Zylinder. Die Organisatorregionen für die Armbildung werden durch den Schnittpunkt zweier Grenzen festgelegt: zwischen anterior und posterior (A/P; rot/blau) einerseits und zwischen dorsal und ventral (D/V; weiß/punktiert) andererseits. Diese Schnittpunkte entstehen in natürlicher Weise immer in Paaren, eines auf der linken, das andere auf der rechten Seite (b). Die Finger entstehen entlang einer D/V-Grenze (c); die Innenund Außenseite der Hand werden von verschiedenen Regionen gemacht und sind deshalb verschieden. In diesem Fall hat mein Modell von 1982 eine klare Bestätigung erfahren; die Substanzen, die zusammen die Grenze definieren, sind die Produkte der Gene Wnt-7a auf der dorsalen und En-1 auf der ventralen Seite. Der Fingertyp ist von der Entfernung zur A/P-Grenze abhängig. Der kleine Finger benötigt die höchste Signalkonzentration (d). Mit diesem Modell erklärt sich ein klassisches Experiment. Transplantiert man Gewebe von der posterioren Seite in eine a SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 an zwei gegenüberliegenden Punkten der Ku­ gel etabliert haben. Ein weiteres Zentrum ent­ steht dazwischen in einer äquatorialen Posi­ tion, zum Beispiel nahe Australien. Es sendet ein Signal aus: »keine Mittellinie in meiner Nähe«. Es kann nur eine Mittellinie in größt­ möglicher Distanz gebildet werden. Das er­ zwingt einen einzigen Streifen ungefähr ent­ lang des Gebirges auf dem amerikanischen Kontinent von Alaska bis nach Feuerland. Durch jüngere Experimente hat die Arbeits­ gruppe von Siegfried Roth an der Universität zu Köln diesen schon 1989 vorhergesagten Mechanismus bei dem Käfer Tribolium nach­ gewiesen (Bild S. 57 oben). Bei Wirbeltieren wurde offenbar die kleine Öffnung der schlauchartigen Tiere zu einem großen Ring erweitert, bei Amphibien nennt man ihn »marginale Zone«. Er definiert das hintere (posteriore) Ende des werdenden Tiers. In der Frühphase der Entwicklung bestimmt der Abstand einer Region von diesem Ring, ob zum Beispiel das Vorder- oder das Mittel­ hirn gebildet wird (Kasten S. 56/57). Ein klei­ ner Teil des Rings bildet den Spemann-Orga­ nisator, der für die Bildung der Mittellinie entscheidend ist. Bei der Rumpfbildung wan­ dern Zellen nahe dem Ring in Richtung Spe­ mann-Organisator, verlassen ihn dort in Rich­ tung nach vorn (anterior) und bilden einen Streifen senkrecht dazu – die zukünftige Mit­ tellinie. Die sich relativ zum anderen Gewebe bewegende Organisatorregion hinterlässt die streifenartige Mittellinie, vergleichbar dem Kondensstreifen eines Flugzeugs. Während also bei Insekten die Mittellinie gleich die volle Kopf-Schwanz-Ausdehnung hat, aber im Lauf der Zeit immer schmaler wird, hat bei Wirbeltieren die Mittellinie von Anfang an eine geringe Breite, wird jedoch durch Bewegung des Spemann-Organisators immer länger. In beiden Fällen bewirkt eine mehr oder weniger eng lokalisierte Organisa­ torregion, dass in der Folge nur ein streifen­ förmiger Organisator gebildet wird. Arme, Beine, Ohren und Augen Von der Festlegung der Achsen bis zum ferti­ gen Organismus mit all seiner Komplexität ist es noch ein weiter Weg. Einige Modelle für die entsprechenden Mechanismen können hier nur stichwortartig aufgeführt werden. Damit das durch lokale Produktion und Diffusion erzeugte Signal wirksam wird, muss es auch »zur Kenntnis genommen« werden. Das geschieht dadurch, dass die empfangende Zelle bestimmte Gene aktiviert. Die Aktivie­ rung muss in der Regel auch dann erhalten bleiben, wenn das auslösende Signal nicht mehr vorhanden ist. Denn durch das Wachs­ SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 D D D C B C B C B A A A tum des Gesamtorganismus entfernt sich die Zelle immer weiter von dem signalisierenden Zentrum, darf aber deswegen ihr Programm nicht ändern. Das Gen muss also wie ein Kippschalter arbeiten, der auf ein kurzes Si­ gnal hin vom »Aus«- in den »Ein«-Zustand übergeht und dort verbleibt. Schon lange vor allen molekulargenetischen Untersuchungen haben wir 1978 in einem Modell gezeigt, dass dieser Effekt durch eine positive Rückwirkung eines Genprodukts auf die Aktivität des Gens selbst erreicht werden kann. Eine Erweiterung des Modells erklärt auch, wie verschiedene Gene unter dem Einfluss ei­ ner gradierten, das heißt entlang einer räum­ lichen Koordinate ansteigenden oder abfal­ lenden Signalkonzentration aktiviert werden können (Bild oben). Anfänglich ist in allen Zellen ein bestimmtes Gen aktiv. Wenn die Signalkonzentration einen bestimmten Wert übersteigt, wird ein zweites Gen aktiviert (und häufig das erste Gen abgeschaltet). Zellen, die einer noch höheren Konzentration ausgesetzt sind, aktivieren noch ein drittes Gen, und so weiter. Die Zellen werden sozusagen »beför­ dert«. Jeder dieser Schritte ist unumkehrbar. Es entstehen scharf begrenzte Regionen, in denen jeweils ein bestimmtes Gen aktiv ist. Während der Entwicklung werden an be­ stimmten Stellen neue Strukturen wie Augen, Ohren, Arme und Beine angelegt. Die klas­ sische Vorstellung war, dass als Erstes eine Gruppe von Zellen ein Signal zum Beispiel zur Beinbildung bekommt und dann in dem da­ durch entstehenden »Beinfeld«, ähnlich wie im Kasten S. 55 dargestellt, neue Gradienten auf­ gebaut werden, welche die Strukturbildung im Detail steuern. Bei der Modellbildung hat sich aber gezeigt, dass mit dieser Vorstellung viele klassische Experimente nicht zu erklären sind. Stattdessen ergab sich, dass der entschei­ dende erste Schritt die Ausbildung von Gren­ zen zwischen Bereichen verschiedener Gen­ aktivierung ist, wie sie als Antwort der Zellen auf gradierte Signale entstehen können (Bild oben). Wenn Zellen, in denen verschiedene Gene aktiviert sind, zusammenwirken müs­ sen, um ein neues Signal zu produzieren, kann dieses Signal nur an der gemeinsamen Grenze gebildet werden (Kasten links). Das ist ein sehr zuverlässiger Mechanismus zur fei­ne­ Hans Meinhardt Medizin & Biologie Feinunterteilung einer Region: Anfänglich ist in allen Zellen das Gen A aktiviert. Wo die Konzentration des Signalmoleküls (grüne Kurve) einen gewissen Wert übersteigt, wird das Gen B aktiv und das Gen A abgeschaltet. Bei noch höheren Konzentrationen erfolgt eine Umschaltung auf Gen C und schließlich D. Auf diese Weise etabliert ein einziger Konzentrationsgradient mehrere scharf voneinander abgegrenzte Bereiche. Manche Gene arbeiten wie Kippschalter: Einmal aktiviert, bleiben sie aktiv, auch wenn das auslösende Signal längst verschwunden ist 59 Hans Meinhardt hat Physik in Köln und Heidelberg studiert. Nach der Promotion 1966 und zweijährigem Aufenthalt am CERN arbeitete er von 1969 bis zu seiner Emeritierung 2003 am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen. Dort erarbeitete er gemeinsam mit seinem Kollegen Alfred Gierer die im Artikel beschriebenen Modelle für die Strukturbildung während der Entwicklung höherer Organismen. Er dankt Alfred Gierer für die sehr schöne Zusammenarbeit. Gierer, A., Meinhardt, H.: A Theory of Biological Pattern Formation. In: Kybernetik 12, S. 30 – 39, 1972. Meinhardt, H.: The Algorithmic Beauty of Sea Shells. Mit Simula­ tionsprogrammen und animierten Simulationen auf CD-Rom. Springer, Heidelberg, 4. Auflage 2009. Meinhardt, H.: Models of Biological Pattern Formation: From Elementary Steps to the Organization of Embryonic Axes. In: Current Topics in Developmental Biology 81, S. 1 – 63, 2008. Meinhardt, H., Klingler, M.: Schnecken- und Muschelschalen: Modellfall der Musterbildung. In: Spektrum der Wissenschaft 8/1991, S. 60 – 69. Weblinks zu diesem Thema finden Sie unter www.spektrum.de/ artikel/1019955. 60 alle Abbildungen: Hans Meinhardt Adern in der Realität (oben) und im Modell (unten). Überall im Gewebe wird eine Substanz X produziert (grün), die durch die Adern (blau) abtransportiert wird. Lokale Wachstumszentren (rot) an der Spitze verlängern die Adern in Richtung hoher X-Konzentrationen. Neue Zentren entstehen entlang existierender Adern, wo die Konzentration von X hoch genug ist; diese initiieren Verzweigungen dort, wo weitere Adern gebraucht werden. Am Ende durchzieht das Adergeflecht das ganze Gewebe. ren räumlichen Unterteilung. Ein primäres Si­ gnalsystem erzeugt eine Unterteilung in Regio­ nen mit scharf abgegrenzten Genaktivierun­ gen. Diese Unterteilung kann relativ grob sein. An den Grenzen dieser Regionen werden neue Signalsysteme generiert, durch welche die fei­ nere Unterteilung erreicht wird. Dieses Mo­ dell erklärt viele klassische Beobachtungen und hat durch neuere molekulargenetische Unter­ suchungen volle Unterstützung erfahren. Adern und Nerven In allen höheren Organismen dienen verzweigte Strukturen wie Blutgefäße, Nerven, Lymph­ gefäße, Tracheen, Nierentubuli oder Blattadern zur Versorgung des Gewebes mit Nährstoffen, Wasser, Informationen und Sauerstoff oder zum Abtransport von Abfall. Für die Bildung solcher Strukturen haben wir folgendes Modell vorgeschlagen (Bild oben): Eine Substanz X wird überall im Gewebe produziert. Wo bereits Adern vorhanden sind, transportieren sie die Substanz weg oder bauen sie ab. Das Wachs­ tum einer Ader wird durch – zum Beispiel – ein Aktivator-Inhibitor-System ausgelöst, das sei­ nerseits von der Konzentration von X abhängig ist. Im Effekt verlängert sich eine Ader stets dorthin, wo ihre Dienste am dringendsten be­ nötigt werden. Verzweigungen entstehen durch Neuzündungen von Signalen entlang existie­ render Adern, wenn an dieser Stelle die Inhibi­ tion von anderen Spitzen gering genug und die Konzentration von X hoch genug ist. Dieses vor über 30 Jahren vorgeschlagene Modell hat ebenfalls Unterstützung durch jüngere molekulargenetische Untersuchungen erhalten. So produziert das Gewebe bei Sauer­ stoffmangel einen Faktor namens VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) – die Sub­ stanz X im obigen Modell. Sauerstoffmangel wird durch einwandernde Adern verringert. Das Signal zum Auswachsen an den Spitzen von Blutgefäßen wird durch das so genannte Delta-Notch-System realisiert. Wie vom Mo­ dell erwartet, ist dessen Aktivierung vom VEGF abhängig. Nach diesem Modell sind nur die Substan­ zen und ihre Wechselwirkung in den Genen kodiert, nicht aber die Details der entstehen­ den Muster. In der Simulation bleibt es zum Beispiel dem Zufall überlassen, ob die erste Abzweigung nach links oder rechts erfolgt. Jede einmal getroffene Entscheidung hat aber einen großen Einfluss auf die Bildung weiterer Äste. Minimale Unterschiede in den Zellen führen dann zu Verschiedenheiten im Detail. Darum hat jedes Blatt eines Baums eine im Detail verschiedene Äderung, obwohl die ge­ netische Information in allen Zellen dieselbe ist. Auch bei eineiigen Zwillingen ist das im Augenhintergrund sichtbare Muster der Blut­ gefäße trotz gleicher Erbinformation nicht identisch. Wichtig sind nicht die Details, son­ dern dass alle Zellen versorgt sind. Mit Hilfe von Modellbildungen war es möglich, den Grundcharakter der Strukturbil­ dung und die dafür erforderlichen Minimal­ bedingungen zu bestimmen. Reaktionen mit starker positiver Rückwirkung auf sich selbst, die mit antagonistischen Reaktionen gekoppelt sind, spielen sowohl in der Musterbildung als auch in der lokalen Genaktivierung eine ent­ scheidende Rolle. Die Hydra mit ihrer einen Körperachse, ursprünglich gewählt, um die pri­ märe Musterbildung zu studieren, hat sich als ein Schlüssel herausgestellt, um die Evolution der Körperachsen auch bei höheren Organis­ men zu verstehen. Mit der Modellbildung wurden für die Entwicklungsbiologie Werk­ zeuge erschlossen, die sonst mehr der Physik und der Chemie vorbehalten waren. Theore­ tische Voraussagen wurden möglich. Mathe­ matisch fundierte Modellbildungen kombi­ niert mit Computersimulationen werden auch weiterhin dazu beitragen, diese so komplexen Vorgänge besser zu verstehen. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Archäologie steinzeit jenseits der Steine Noch sind Brunnen aus der Jungsteinzeit eine Rarität, doch die bereits entdeckten ­Exemplare verändern drastisch unseren Blick auf die bandkeramische Kultur. Denn in diesen Wasserstellen überdauerten Hölzer, selbst Schnüre und Bast die Jahrtausende. Von Harald Stäuble V or zwölf Jahrtausenden begann eine so radikale Veränderung menschlicher Kultur, dass sich da­ für in der Fachwelt die Bezeich­ nung neolithische Revolution eingebürgert hat: Unsere Vorfahren gaben ihre nomadisie­ rende Lebensweise auf und gründeten feste Dörfer; aus Jägern und Sammlern wurden Ackerbauern und Viehzüchter. Sie lernten neue Techniken, etwa Häuser zu bauen und Ton zu Keramik zu brennen. Ihren Ursprung nahm die Jungsteinzeit, so der deutsche Epo­ Insgesamt 18 neolithische Brunnen wurden bis heute in Mit­ teleuropa entdeckt, davon allein sechs im Bundesland Sachsen. Brodau AltscherbitzAltscherbitzSchkeuditz Schkeuditz Leipzig-Plaußig Leipzig Nords Dresden-Cotta MeuselwitzZipsendorf Rehmsdorf-Rumsdorf Dresden ee S C H D E U T S Altscherbitz Rehmsdorf Arnoldsweiler C S E Most Brodau Plaußig Niederröblingen Erkelenz-Kückhoven A H N Zipsendorf Eythra (zwei Brunnen) Brunnen der Linienbandkeramik Cotta Most Fundstellen Bandkeramik L Mohelnice Straßenheim A Bohunice D N Fußgönheim linienbandkeramische Brunnen Schletz Füzesabony-Gubak 62 Spektrum der Wissenschaft / Emde-Grafik, nach: Landesamt für Archäologie Sachsen Eythra-Zwenkau Eythra-Zwenkau (ZweiBrunnen) Brunnen) (zwei chenbegriff, im Gebiet des fruchtbaren Halb­ monds am Oberlauf von Euphrat und Tigris. Von dort verbreiteten sich frühe Getreide­ sorten wie Emmer und Einkorn in der Alten Welt und gelangten im Verlauf von drei Jahr­ tausenden bis nach Mitteleuropa. Auch Schaf und Ziege wurden im nördlichen Zweistrom­ land domestiziert. Jüngste Vergleiche der Erb­ substanz von Hausrind und Schwein legen den Schluss nahe, dass selbst diese nicht, wie früher vermutet, vom europäischen Aueroch­ sen beziehungsweise Wildschwein abstam­ men, sondern ebenfalls im Ursprungsgebiet des Neolithikums aus dort vorkommenden anderen Wildformen gezüchtet wurden. Was unsere Vorfahren motivierte, ihre seit Hunderttausenden von Jahren bewährte Wirt­ schaftsweise aufzugeben, darüber wird kontro­ vers diskutiert. Erzwangen wachsende Bevöl­ kerung und sesshafte Lebensweise die Abkehr von der Wildbeuterei, oder waren sie das Re­ sultat einer auf Zucht und Anbau basierenden Lebensweise, die eventuell sogar klimatisch bedingt war? Ebenso strittig ist, ob kleine oder große Gruppen von Vorderasien aus im Lauf der Jahrtausende in alle Welt zogen, das neue Wissen im Gepäck; möglich wäre genauso ein Technologietransfer über Handelskontakte. Wahrscheinlich wird auch diese Frage in na­ her Zukunft geklärt werden können, einer­ seits durch molekulargenetische Vergleiche (sozusagen eine Art Vaterschaftstest), anderer­ seits anhand von Spurenelementen und be­ stimmten Isotopen in den Knochenresten, aus denen Rückschlüsse auf die Lebensbedingun­ gen der Menschen und Tiere gezogen werden können. Vermutlich liegt die Wahrheit jeweils in der Mitte. Sicher ist, dass die neolithische Revolution im pannonischen Raum, etwa im Gebiet des heutigen Ungarn, Anfang des 6. Jahrtausends v. Chr. angekommen war und einige Jahrhun­ SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Mensch & geist MEnsch & Geist Spektrum der Wissenschaft / Meganim derte später von dort aus Mitteleuropa er­ reichte. Ein gemeinsames Merkmal der in Pan­ nonien entstandenen Kulturausprägungen sind charakteristische Linien, später Stichbandmus­ ter der gebrannten Keramik, die dem Prähisto­ riker heute zur Unterscheidung dieser Kultur – der »Bandkeramik« (5500 – 4500 v. Chr.) – von früheren und späteren Epochen dient. Rohstoff Holz – eine Spurensuche Mit dem Neolithikum hielten auch neue Steinbearbeitungstechniken Einzug in unseren geografischen Raum. Hatte man zuvor vor allem Feuerstein gespalten und behauen, um Werkzeuge und Waffen herzustellen, so lernte man nun, andere Steinsorten durch Schleifen zu bearbeiten. So konnte man zusätzlich zu den zwar mal messerscharfen, mal spitzen, aber auch leicht splitternden Feuersteingeräten stabilere Werkzeuge wie Beile und Äxte her­ stellen. Und die wurden benötigt, um Bäume zu fällen und um beispielsweise daraus Pfosten für die großen Häuser zu fertigen. Bislang wussten wir von solchen Techniken nur auf Grund indirekter Hinweise, denn organische Materialien vergehen innerhalb von Jahrhun­ SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 derten. Doch Archäologen lernten, jene mit Erde wieder aufgefüllten Löcher zu erkennen, in denen einstmals tragende Hölzer steckten. Offenbar lebten unsere Vorfahren in fünf bis sieben Meter breiten, meist um die 30, mitun­ ter mehr als 50 Meter langen Gebäuden. Da­ rin gab es funktional und wahrscheinlich sogar auch physisch durch Wände getrennte Wohnund Wirtschaftsbereiche. Auch Gruben kom­ men bei Ausgrabungen zum Vorschein, aus denen vielleicht der Lehm gewonnen wurde, den man für die Füllung und Abdichtung der aus Flechtwerk bestehenden Wände verwendet hat; andere wiederum dienten als Speicher für Getreide und sonstige Vorräte. Steingeräte, gebrannte und verzierte Kera­ mik, Knochenreste und in Glücksfällen auch verkohlte und so vor dem Verfall bewahrte Getreidekörner und Holzfragmente, die sich in den Gruben finden – nichts anderes stand Prähistorikern bislang zur Verfügung, um den Alltag in der Jungsteinzeit zu rekonstruieren. Erst vor wenigen Jahren sollte sich dies än­ dern. Eine neue Kategorie von archäologi­ schen Befunden wurde entdeckt: Brunnen, in denen Reste von hölzernen Einbauten und Als die jungsteinzeitliche Kultur in Mitteleuropa Fuß fasste, verstanden es die Menschen nicht nur, Getreide anzubauen und Vieh zu züchten, Stein zu schleifen und Keramik zu brennen. Sie verfügten nach jüngsten Grabungsfunden auch schon über gute Kenntnisse in der Holz­bearbeitung, bauten Langhäuser und Brunnen, Letztere dienten aber wohl nicht allein zur Wasserversorgung, sondern auch als kultische Orte. 63 Archäologie Die vier Bohlen der untersten Lage waren sogar miteinander verzapft worden. Dies war der erste Nachweis einer Holzverzapfung in Europa überhaupt! alle Fotos dieser Doppelseite: Landesamt für Archäologie Sachsen Als der Braunkohletagebau in Zwenkau erweitert werden sollte, untersuchten Archäologen zuvor das Gelände. Im Bereich des aufgegebenen Dorfs Eythra entdeckten sie 1993 eine große Siedlung der frühen Jungsteinzeit. An deren Rand – und direkt an der damaligen Tagebaukante – entdeckten sie 1997 einen Brunnenkasten, von dem noch einige Bohlenlagen erhalten waren. 64 vielerlei andere organische Überreste die Jahr­ tausende überdauert haben. So viel ist nun si­ cher: Unsere Vorfahren verfügten über Kennt­ nisse und Fertigkeiten, die wir ihnen nicht zu­ getraut haben. Ohne Ausgrabung in die Tiefe erscheinen solche Brunnen lediglich wie eine weitere Grube der Siedlung. Wohl aus diesem Grund hat man sie lange übersehen beziehungsweise falsch verstanden. So wurden etwa Hölzer, die 1907 im thüringischen Zipsendorf entdeckt wurden, als Grabeinbauten gedeutet – heute wissen wir es besser. Erstmals erkannten For­ scher 1970 bei einer Notgrabung im tsche­ chischen Mohelnice, dass sie es mit einem li­ nienbandkeramischen Brunnen zu tun hatten. Doch erst ab 1990, mit der Entdeckung und Ausgrabung einer aufwändigen Brunnenkon­ struktion bei Erkelenz-Kückhoven im Rhein­ land, trat diese neue Befundkategorie ins Rampenlicht der Forschung. Heute – und die Zahl kann morgen schon nicht mehr aktuell sein – kennen wir 18 jung­ steinzeitliche Brunnen in Mitteleuropa (siehe Karte S. 62), allein sechs davon in Sachsen. Die Bedingungen, die Siedler in der Dresdner Elb­ talweitung, dem Lössgefilde westlich von Mei­ ßen sowie in der Region um Leipzig vorfan­ den, unterschieden sich nicht von denen in ­anderen Regionen. Die vergleichsweise große Häufigkeit an Brunnenfunden beruht wohl vor allem auch auf der Arbeitsweise der archäolo­ gischen Denkmalpflege in unserem Bundes­ land. Seit einer Gesetzesänderung 1993 werden hier insbesondere Großbaustellen intensiv be­ treut und das Gelände im Vorfeld untersucht. Seitdem hat nicht nur die Zahl der Fundstellen um 500 Prozent zugenommen; die entdeckten Siedlungen werden auch so vollständig und so gründlich wie möglich untersucht – und un­ scheinbare Gruben in der Peripherie der Dör­ fer entpuppten sich als Brunnen. Mal war es ein umfangreiches Vorhaben im Rahmen des Braunkohletagebaus, der Bau eines BMW-Werks, die Erweiterung des Flug­ hafens Leipzig/Halle oder der Bau einer Trasse für einen Wasserableiter, dann aber auch »nur« der Bau eines Einfamilienhauses, der uns Ar­ chäologen einen solchen Fund bescherte. Zu­ sammen mit der hohen neolithischen Sied­ lungsdichte und bedingt durch die Konzentra­ tion von großen archäologischen Projekten im dortigen Braunkohle- und Industriegebiet hat sich das Gebiet der Leipziger Tieflandbucht zu einem Schwerpunkt der »Brunnenlandschaft« entwickelt. Es begann 1997, als im Bereich der damals schon abgerissenen Ortschaft Eythra im Braunkohletagebau Zwenkau, etwa 13 Kilometer südlich der Leipziger Innen­ stadt, der erste linienbandkeramische Brun­ nen Sachsens entdeckt wurde. Eythra – es ist Usus, die heutigen geografischen Bezeichnun­ gen als Namen der jungsteinzeitlichen Orte zu verwenden – war vor 7500 Jahren eine recht große Siedlung. Gut 15 bis 30 Häuser stan­ den auf der 28 Hektar großen Ausgrabungs­ fläche; wie weit sich das Dorf noch erstreckte, ließ sich auf Grund der Ausdehnung der Tage­ bauflächen nicht ausmachen. Bohlen verkämmt und verschränkt Der Brunnen reichte 4,5 Meter unter die heutige Oberfläche, davon war etwas über ein Meter von der Holzkonstruktion erhalten. Unser Team legte einen aus Brettern aufge­ bauten quadratischen Kasten frei mit 80 bis 90 Zentimeter langen Innenseiten – genauer gesagt die unteren vier bis fünf Bohlenlagen (Bild links). Diese zeigten sehr schön die ty­ pische Machart: Die Brunnenbauer hatten wahrscheinlich einen Baumstamm mit Stein­ beilen auf 1,5 bis 1,8 Meter Länge gebracht, dann mit Meißeln aus Stein, Knochen oder Holz der Länge nach gespalten und die Hälf­ ten auf die gleiche Weise immer weiter geteilt. So ließen sich aus einem Stammabschnitt sechs bis acht Spaltbohlen fertigen. Anschließend wurden diese zugehauen, um sie miteinander zu verbinden (siehe Grafik S. 66): meist durch Verkämmen – ein Brett griff mit einer Kerbe in das darüber- beziehungs­ weise darunterliegende – oder durch Ver­ schränken – Kerben wurden sowohl auf der Ober- wie auf der Unterseite der Eckverbin­ dung eingelassen. Die vier Bohlen der un­ tersten Lage waren sogar miteinander verzapft worden. Dies war der erste Nachweis einer Holzverzapfung in Europa überhaupt! Dank des guten Zustands der Hölzer konnten die Dendrochronologen nachweisen, dass alle aus der gleichen, 120 Jahre alten Eiche stammten, die im Winterhalbjahr 5098/97 v. Chr. gefällt worden war. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Mensch & geist Nur etwa 170 Meter von diesem ersten sächsischen Brunnen entfernt kam im Jahr da­ rauf ein zweiter zum Vorschein, der sich in einem Punkt unterschied: Unter einem Bret­ terbau befanden sich Reste eines ausgehöhlten, einst etwa 80 Zentimeter starken Baum­ stamms. Zwar ließ er sich botanisch als Ahorn identifizieren, doch auf Grund fehlender Jah­ resringe nicht datieren. Man hatte ihn aber auf vier Eichenbretter gesetzt, deren Alter nun dendrochronologisch auf 5230 v. Chr. be­ stimmt wurde. Weil die jüngsten Jahresringe, die so genannte Waldkante, nicht erkennbar waren, ist diese Angabe nur auf 10 bis 15 Jah­ re genau – eine dennoch sehr präzise Angabe angesichts der für diese Zeit bekannten C-14Daten, die größere Fehlerbreiten aufweisen, oder der noch ungenaueren »Typochronolo­ gie«, die archäologische Schichten anhand von Keramikstilvergleichen zeitlich einordnet. Die Toleranz von maximal 15 Jahren gilt auch für die Eichenhölzer des aufsetzenden Kasten­ brunnens, von dem bloß die unterste Lage er­ halten ist. Auf rund 5200 v. Chr. bestimmt, war er offenbar nur ein bis zwei Jahrzehnte jünger. Die ursprüngliche Konstruktion – den ausgehöhlten Stamm – hatte man beim Ein­ bau vermutlich teilweise entfernt und den Kas­ ten leicht versetzt aufgesetzt. Offensichtlich befand er sich immer noch im Bereich des Grundwassers, obwohl er etwa einen Meter höher lag als der ältere Schacht. Damit vereint dieser Brunnen von Eythra die beiden Grundtypen von Einbauten, die auch andernorts in Europa entdeckt wurden: Zylinder- und Kastenbrunnen. Einzelne Fugen waren mit Moos oder Holzstücken abgedich­ tet worden – offensichtlich sollte das Wasser nicht von der Seite, sondern nur von unten her eindringen. Mitunter machten die Gegebenheiten vor Ort auch Varianten erforderlich. So etwa im Dresdner Stadtteil Cotta, wo 2004 ein von SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 der Grabungsoberfläche nur 1,8 Meter tief hi­ nabreichender Brunnenschacht ans Licht kam. In allen vier Ecken entdeckte man Abdrücke von senkrecht eingetieften Rundhölzern, die wohl die Eckkonstruktion zusätzlich abstützen sollten – dergleichen hatte man seinerzeit auch in Mohelnice angetroffen. In Brodau bei De­ litzsch hatte eine Konstruktion aus Spalthöl­ zern einen hohlen Stamm in einem vier Meter tiefen Schacht umgeben. Weil die Bohlen aber nicht blockartig aufeinandergestapelt worden waren, handelte es sich offenbar um ein Ge­ rüst: Unterhalb des kompakten Geschiebe­ lehms lagen feinsandige Schichten, die immer wieder nachgerutscht wären, hätte man nicht solch eine Sicherheitsvorkehrung getroffen. Beide Brunnen ließen sich zeitlich nur grob einordnen: Keramikfunden in der Füllung des Schachts zufolge wurde der von Dresden-Cot­ ta zwischen 5300 und 5100 v. Chr. aufgege­ ben, bei Brodau ergab die Dendrochronologie ein Baudatum um 5200 v. Chr., jedoch mit einer Ungenauigkeit von 20 Jahren. Eine Überraschung bot ein 2001 in Plau­ ßig bei Leipzig entdeckter Brunnen, der mit zwei bis drei Bau- oder Reparaturphasen auf­ wartet. Die ältesten Spaltbohlen stammen aus der Mitte des 53. Jahrhunderts v. Chr., die jüngsten von gut 150 Jahre später ge­ fällten Bäumen. Zunächst war ein quadratischer Kasten aus rund zwei Meter langen und bis zu 30 Zentimeter hohen Spaltbohlen ins Grundwasser gesetzt worden. Er erwies sich bei der Rekonstruktion als etwas größer als andere – mit durchschnittlich 1,4 Meter Seitenlänge – und besaß außen wie innen Pfähle in den Ecken. Etwa 100 Jahre später wurde ein kleinerer Kasten aus kürzeren Spalt­ bohlen in den älteren, nun aufgefüllten Schacht gesetzt, der die üblichen Innenmaße von 80 bis 90 Zentimetern besaß. Noch jün­ geres Holz im oberen Bereich könnte auf spä­ tere Reparaturphasen hindeuten – oder der Zu den Glücksfällen der prähis­ torischen Forschung zählt sicher auch die Entdeckung eines neolithischen Brunnens auf dem Gebiet der Erweiterung des Flughafens Leipzig­/Halle. Weil die Zeit für eine Ausgrabung vor Ort zu knapp war, wurde er 2005 samt umgeben­dem Erdreich als Block geborgen (links) und in einen Hangar transportiert (Mitte). Seit 2008 arbeiten sich Archäologen Zentimeter für Zentimeter zum Grund vor (rechts). Brunnen der Jungsteinzeit in Sachsen – eine Ausstellung zum Thema in Leipzig Brunnen der Jungsteinzeit in Sachsen Eine des Lan Sonderausst ellu desamte s für Arch ng äologie Funde, die es nicht geben dürfte 24.02. — 11.0 2010 4.2010 im Stad tgeschic htlichen Museum Leipzig Eine Sonderausstellung des Landesamtes für Archäologie im Stadt­ geschichtlichen Museum Leipzig 24. 2. 2010 bis 11. 4. 2010 Böttchergäßchen 3, 04109 Leipzig www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de 65 Archäologie Zu den schönsten Funden im Altscherbitzer Brunnen gehören diese beiden reich dekorierten Tongefäße. Sie waren einst zerbrochen und wieder geflickt, anschließend mit Birkenpech ummantelt und mit Holz­ auflagen verziert worden. Ihre Fundlage im mittleren Teil des Brunnenkastens deuten die Archäologen als Indiz für eine gezielte Deponierung im Rahmen einer Kulthandlung. Schon vor 8000 Jahren kannte man die grundlegenden Techniken der Holzverbindung Verkämmen, Verschränken und Verzapfen, wie die Einbauten der Brunnen zeigen (a: verzapfte Bohlen aus Eythra; b: Fehlfarben­ bild zu Altscherbitz, c: Verbin­ dungstechniken). a gesamte Kasten ist jünger, und es wurden für manche Teile Althölzer wiederverwendet. Auf ein solches Recycling deutet nämlich das jüngste Mitglied der sächsischen Brun­ nenfamilie hin. Es wurde im Vorfeld einer ge­ planten Erweiterung des Flughafens Leipzig/ Halle bei Altscherbitz im Frühjahr 2005 ent­ deckt. Weil die Zeit drängte, wurde es als bis­ lang größter Block geborgen – und als ein­ ziges, das auch die Brunnengrube einfasste. Die Oberkante lag etwa 3,5 Meter unter der Erdoberfläche, dort nämlich, wo die ersten Holzspuren zu erkennen waren, und setzte sich noch weitere vier Meter in die Tiefe fort, bis man sich Bohrungen zufolge mit Sicher­ heit unterhalb der eigentlichen Konstruktion befand. Inklusive Sicherungshölzern und -stahlkonstruktionen mussten rund 90 Ton­ nen per Tieflader etwa 120 Kilometer weit in eine eigens dafür umgebaute Bauhalle des Landesamts für Archäologie nach Dresden transportiert werden. Zwei Jahre gingen ins Land, in denen der Block konserviert und »frischgehalten« wurde. Erst Anfang 2008 konnten wir beginnen, das Material Zentime­ ter für Zentimeter unter Laborbedingungen von oben nach unten abzutragen; dabei wird die »Grabungsstätte« immer wieder mit mo­ dernsten Techniken präzise vermessen, auch mittels 3-D-Laserscan abgetastet. Auch bei diesem Brunnen waren wie fast stets Spaltbohlen aus Eiche verwendet worden, die Dendrochronologie ergab als Fälldatum das Winterhalbjahr 5102/01 v. Chr. Dieser Brunnen entstand also möglicherweise vier Jahre vor dem ersten von Eythra. Allerdings la­ gen außerhalb der eigentlichen Konstruktion noch weitere Bretter im Schacht, die 100 bis 150 Jahre älter waren. Vielleicht dienten sie zur seitlichen Stabilisierung, vielleicht als Auf­ lage beim Aufbau des Brunnenkastens. Offen­ bar aber – so ein vorläufiges Ergebnis der noch Jahre andauernden Auswertung aller Daten – hatte man Bretter aus einer anderen, aufgege­ benen Anlage wiederverwendet. Wahrschein­ lich stammten sie von einem verlassenen Haus b c rechts: Spektrum der Wissenschaft / Meganim, nach: Dietrich hakelberg; alle übrigen Abbildungen dieser Doppelseite: Landesamt für Archäologie Sachsen verkämmt 66 verschränkt verzapft SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Mensch & geist der Siedlung, denn sie waren schmaler als die üblichen Bohlen der Brunnenkästen. Dank dieser Funde mit den zahlreichen Bearbeitungsspuren kennen wir nun endlich mehr als die Abdrücke der Pfosten jener Häu­ ser. Wir wissen auch, welche Holzverbindungen möglich waren. Unsere Vorfahren lebten nicht in Verschlägen aus grob bearbeiteten Brettern, nicht in zugigen Räumen. Ihre Zim­ merleute verfügten bereits über eine ausge­ feilte Technik, wussten mit ihrem Werkstoff so geschickt umzugehen, dass sie heutigen Handwerkern nur wenig nachstanden. Lange galt das geschliffene Steinbeil als Sinnbild die­ ser Kultur, nun endlich kennen wir auch Pro­ dukte, die damit gefertigt wurden. Bast, Pech und Rinde All diese Brunnen waren irgendwann aufgege­ ben und verfüllt worden. Von Luft weit ge­ hend abgeschlossen und vor allem stets im feuchten Milieu haben sich auch organische Materialien erhalten, mit denen niemand ge­ rechnet hat. Und die vermitteln völlig neue Einblicke in den neolithischen Alltag. Beispielsweise aus Rindenbast hergestellte Taschen oder Beutel, zu denen es noch nicht einmal eine Terminologie gibt, weil diese Fund­ kategorie neu ist. Vermutlich dienten solche Behältnisse zum Wasserschöpfen (siehe S. 69). Bislang wurden neun mehr oder weniger voll­ ständige Taschen geborgen; acht davon in Eythra und unlängst eine in Altscherbitz. Sie bestehen aus dem Rindenbast von Ulme, Birke, Linde oder Eiche. Mal wurde der Rindenstrei­ fen quer zur Faser in der Mitte zusammenge­ schlagen, so dass der Falz den Gefäßgrund bil­ dete; die sich überlappenden Seiten hatte man mit Bastschnüren vernäht. Dann wiederum SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 waren andere seitlich oder auch unten mit ge­ spalteten Haselstrauchstäben zusammenge­ klemmt. Ein Spreizholz oder ein Ring am obe­ ren Ende hielt die Tasche offen, so dass sie beim Schöpfen nicht zusammenfallen konnte. Als Henkel dienten ein Ast oder Schnüre. Ebenso wie Gefäße aus Keramik wurden sie mitunter wohl über Umlenkrollen hinabgelassen, da­ rauf deuten Schleifspuren an einem Rinder­ halswirbel aus Brodau (Bild unten rechts) und an einem Holzbalken aus dem Brunnen vom Fundort Erkelenz-Kückhoven im Rheinland. Es war auch eine Sensation, als 1997 im ersten Eythraer Brunnen drei nur wenige Zen­ timeter große, aber sehr gut erhaltene Scher­ ben geborgen wurden – mit einem Überzug aus Birkenpech. Darin eingedrückt war ein Dekor aus zwei bis drei Millimeter großen Dreiecken, angeordnet zu dünnen Bändern. Zunächst dachte man, diese »Intarsien« be­ stünden aus Knochenplättchen, doch Unter­ suchungen zeigten, dass es sich um Birkenbast handelt. Zudem kam darunter das für die Li­ nienbandkeramik typische Verzierungsmuster einer eingekerbten Linie zum Vorschein. Auch Altscherbitz hielt solche Überra­ schungen bereit. Nicht nur legten wir zwei komplette Gefäße frei, von deren Art in ganz Europa bisher erst wenige Scherben sowie nur drei weit gehend vollständige Exemplare be­ kannt waren. Sie werden einem als Šarká be­ zeichneten Keramiktyp zugeordnet, benannt nach dem gleichnamigen, seit 100 Jahren be­ kannten Fundort im Prager Stadtgebiet. Beide waren zudem irgendwann wohl zerbrochen, dann aber mit Birkenpech und Schnüren wie­ der geflickt und anschließend mit einer Pech­ schicht überzogen worden (Bilder linke Seite oben). Dabei verpasste man ihnen gleich eine In Brodau entdeckten die Forscher das Skelett eines Ferkels, vermutlich eine Opfergabe für ergiebiges Wasser. Auf dem Grund eines Brunnens von Eythra kam diese mit Pech und Rinde geflickte Tonflasche (links) zum Vorschein. Vielleicht war das Gefäß zum Wasserschöpfen an einem Seil hinabgelassen worden, wie die erhaltene Schnürung vermuten lässt. Aus dem gleichen Brunnen, allerdings aus einer tieferen Schicht, stammt ein Rinderhalswirbel mit Schleifspuren (Pfeile) – er könnte als Umlenkrolle für ein Seil gedient haben. 67 Archäologie Literaturhinweise Elburg, R.: Luftige Zukunft. Siebzig Tonnen Steinzeit. Die Ausgrabungen des Bandkeramischen Brunnens von Altscherbitz hat vielversprechend begonnen. In: Archaeo – Archäologie in Sachsen 5/2008, S. 12 – 17. Stäuble, H.: Vom Wasser- zum Wissensspeicher. In: Damals 4/2008, S. 47 – 48. Stäuble, H., Fröhlich, M.: Zwei Ferkel im Bandkeramischen Brunnen. Sachsen entwickelt sich zu einer wahren Fundgrube für steinzeitliche Brunnen. In: Archaeo – Archäologie in Sachsen 3/2006, S. 16 – 21. neue Verzierung im aktuel­leren, jüngeren Stil und nutzte sie weiter! Bei einem der Töpfe war der Pechüberzug schlechter erhalten, so dass man darunter die »klassische«, in den Ton eingeritzte Bandverzierung mit bloßem Auge erkennen kann, beim anderen brachte eine Computertomografie diesen Untergrund zum Vorschein. Im ersten Fall hatte man bei der Verzierung allerdings erheblich größeren Aufwand getrieben. Mühevoll waren aus Bir­ kenrinde Spiralen und Dreiecksbänder he­ rausgeschnitten und auf die gesamte Ober­ fläche geklebt worden. Die Vermutung liegt nahe, dass man dieses ältere Gefäß nach der Mode der jüngsten Bandkeramik modernisie­ ren wollte. Fast 40 weitere Tongefäße, davon knapp die Hälfte vollständig, sind im Altscherbitzer Brunnen bislang »ausgegraben« worden, viele mit Pech und Rindenstreifen repariert. Damit nicht genug, fanden sich hier wie auch in an­ deren Brunnen Reste von Bastschnüren an Henkeln und Ösen. Bislang hatten Prähistori­ ker eine solche Aufhängung etwa zum Wasser­ schöpfen nur annehmen können – nun sind sie nachgewiesen. All diese Gefäße lagen in Paketen im mittle­ ren bis unteren Bereich des Brunnenschachts. Hineingefallen sind sie also nicht, so wie man­ che anderen Objekte aus der untersten Partie. Wurden sie nach der Aufgabe des Brunnens, als altmodisch angesehen, dort entsorgt? Da­ gegen spricht allein schon der Aufwand, mit dem manche repariert und modernisiert wor­ den waren. Sollte man also besser von einer Gefäßdeponierung sprechen? Einkorn 68 Im Unterschied zu herkömmlichen Siedlungsgruben erhielten sich in den unteren, stets feuchten und somit von Luft abgeschlossenen Brunnensedimenten auch unverkohlte Reste von Pflanzen: Äste, Blätter und Rindenfragmente, Früchte und Samen sowie mikroskopisch kleine Pollen, die einst hineingeweht worden waren. Das erlaubt nunmehr, den Bewuchs im Siedlungsumfeld zu rekonstruieren. Demnach standen die Dörfer nicht inselartig auf kleinen Lichtungen in ansonsten dichten Wäldern, sondern bereits in einer weit gehend offenen Landschaft, die zumindest teilweise kulturell geprägt war. Als einzigartig erweist sich der Fund der ersten unverkohlten Emmergetreideähre aus der frühen Jungsteinzeit. Aber auch Pflanzen, die wir in verkohltem Zustand aus den Siedlungsfunden kennen, haben sich im Brunnen hervorragend erhalten. Zahlreiche Funde von Moos, mit dem offensichtlich die Spaltbohlen abgedichtet worden waren, waren bei der Bergung für einige Minuten sogar noch in ihrer ursprünglichen Farbe Grün zu sehen. Im Altscherbitzer Brunnen kamen ganze Blütenstände von Klette zu Tage, orangefarbene Beeren der Judenkirsche und eine leicht zerquetschte, aber noch rote Hagebutte, so frisch wie am Tag vor 7100 Jahren, als sie gesammelt wurde. Vermutlich zu medizinischen oder gar kultischen Zwecken wurden Mohn und Bilsenkrautsamen verwendet. Beide rufen rauschartige Zustände hervor, und beide sind in Mitteleuropa ursprünglich nicht heimisch. Da sie in fast allen Brunnen gefunden wurden, hat man die Pflanzen offenbar gezielt gesammelt, wenn nicht sogar angebaut. Auch Kleintiere und Insekten verirrten sich in die Brunnen. Weil sich die häufig vertretenen Dungkäferarten oft den domestizierten Tierarten zuweisen lassen, erhalten wir somit indirekt Informationen zur Tierhaltung. Besonders wichtig sind vor allem Funde des Kornkäfers und des Schwarzen Getreidenagers insoweit, als die noch heute gefürchteten Getreideschädlinge in Mitteleuropa ebenfalls nicht heimisch sind. Da sie flugunfähig sind und nur in den Vorräten überleben können, müssen sie mit Getreide­ importen eingeführt worden sein. Selbst der Nachweis einer Skarabäenart ist gelungen, die heute im Mittelmeerraum heimisch ist. Auch wenn die mittlere Jahrestemperatur im 6. Jahrtausend v. Chr. vermutlich etwa zwei Grad Celsius über der heutigen lag, hätte das nicht genügt, damit diese Tiere einwandern konnten. In den Brunnenschächten fanden wir auch Reste von Igel und Maulwurf, von Frosch und Krötenarten, von Echsen und Mäusen. Sogar der Unterkiefer einer Hausmaus konnte bestimmt werden, deren Art in Mitteleuropa bislang erst aus dem 1. Jahrtausend v. Chr. bekannt war. Angesichts der Larven von Stubenfliegen und noch einer Fülle anderer Repräsentanten diversen Hausungeziefers scheint sich ein bandkeramisches Bauernhaus diesbezüglich nicht wesentlich von einem aus dem letzten Jahrhundert unterschieden zu haben. Samen der Judenkirsche wikimedia / USDA – ARS, José R. Hernández Emmer oder Zweikorn Schwarzer Getreidenager wikimedia / Thomas Springer USDA – ARS, GMPRC wikimedia / Sten Porse Vom Winde verweht – Pflanzen und Tiere aus vergangener Zeit SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Mensch & geist beide Fotos: Landesamt für Archäologie Sachsen Aus Rindenbast fertigten die Einwohner der Siedlung von Alt­ scherbitz eine Tasche, die mittels gespaltener Hölzer in Form gebracht und dann mit einem Seil in den Brunnen zum Schöpfen hinabgelassen wurde. Gänzlich neu wäre solch eine Erkenntnis nicht, wir kennen beispielsweise Steinbeil­ depots aus der Jungsteinzeit oder Niederlegun­ gen von Bronzeobjekten aus jüngeren Epo­ chen der Menschheitsgeschichte. Stets bieten sich zwei Deutungen an: Lagerung bezie­ hungsweise Versteck auf der einen Seite, Op­ fergabe auf der anderen. Erstere Option lässt sich hier wohl ausschließen, zu groß wäre der Aufwand gewesen, das verborgene Gut wieder auszugraben. Handelt es sich aber um eine ­religiös motivierte Darbringung, erhält der Brun­nen über seine Funktion als Wasserspen­ der hinaus eine Bedeutung als kultischer Ort, an dem man sich auch nach der Außerbetrieb­ nahme noch traf und einem oder mehreren übernatürlichen Wesen opferte. Waren die Brunnen »heilig«? Ein starkes Indiz für eine Art religiöse Be­ handlung zumindest mancher Brunnen er­ brachte die Ausgrabung in Brodau. Dort wur­ den am äußeren Rand der Grube die Über­ reste eines aufrecht gesetzten Ferkels entdeckt (siehe Bild S. 67 oben), auf der gegenüberlie­ genden Seite die Hälfte eines zweiten. Wahr­ scheinlich wurden sie vor der Inbetriebnahme als Opfer dargebracht. Es ist nur ein kleiner Schritt zu der Hypo­ these, dass bandkeramische Brunnen lediglich zum Teil für den alltäglichen Wasserbedarf ge­ dacht waren. Denn angesichts der großen An­ zahl an Siedlungen ist die der Brunnen klein, und das liegt nicht nur an den Problemen, sie zu finden – auch in gut untersuchten Ort­ schaften wie Altscherbitz oder Eythra würden ein oder maximal drei Brunnen nicht ausrei­ chen, um alle Haushalte, geschweige denn das Vieh mit Frischwasser zu versorgen, und das über Jahrhunderte hinweg. Zudem befanden sich fast alle nicht weiter als ein paar hundert SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Meter vom nächsten fließenden Gewässer ent­ fernt. Nein, solche Anlagen waren nicht für den Alltag gedacht, sondern wahrscheinlich besonderen Gelegenheiten oder bestimmten Menschen vorbehalten. Dazu passt auch die geringe Größe der erwähnten Schöpftaschen aus Bast: Sie fassten gerade mal einen halben bis knapp über einen Liter, sollten also wohl eher heiliges Wasser denn Brauchwasser he­ raufholen. Die neue Befundkategorie der Brunnen mit den darin enthaltenen Funden, die von Menschenhand hergestellt (Artefakte) wur­ den, wie auch jene zufällig in den Brunnen geratenen sonstigen Objekte (siehe Kasten links) werfen ein vollständig neues Licht auf bisher unbekannte Fertigkeiten, Techniken und Materialien der frühen Jungsteinzeit. Wahrscheinlich teilten die Dorfbewohner die anfallenden Arbeiten untereinander auf, vermutlich spezialisierten sich manche zumin­ dest zeitweilig auf ein bestimmtes Handwerk. Ihre »Zimmerleute« wussten sehr genau, wel­ ches Holz für welchen Zweck in Frage kam. Die Epochenbezeichnung Steinzeit jedenfalls vermittelt ebenso wie die Deklarierung als bandkeramische Kultur ein viel zu einseitiges Bild. Die noch heute durch ihre Ästhetik be­ eindruckenden Gefäße führen uns vor Augen, dass unsere Vorfahren einen ausgeprägten Sinn für Schönes hatten und ihre Welt alles andere als trist war, auch wenn der Überle­ benskampf dieser frühen landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft sicherlich zentral war. Wo sich dieser Sinn sonst noch gezeigt haben mag – bei der Wohnungseinrichtung, im Schmuck, bei der Kleidung oder vielleicht so­ gar in einer Form von Körperbemalung –, bleibt uns aber noch verborgen. Wir sind Ge­ fangene der Erhaltungsbedingungen während der Jahrtausende. Der Prähistoriker Harald Stäuble betreut am Landesamt für Archäologie Sachsen archäologische Großprojekte, die sich etwa im Rahmen des Braunkohleabbaus oder von Trassenprojekten (wie Autobahnen oder Pipelines) ergeben. An den Ausgrabungen und der Auswertung der zahlreichen Brunnen sind neben dem Autor noch zahlreiche weitere Archäologen des LfA, Grabungsmitarbeiter, Restauratoren und Naturwissenschaftler beteiligt gewesen. Weblinks zu diesem Thema finden Sie unter www.spektrum.de/ artikel/1019956. 69 ESSAY: Menschenwürde Diesen Artikel können Sie als Audiodatei beziehen; siehe www.spektrum.de/audio Die Würde des Menschen ist antastbar ! In fast allen bioethischen Debatten wird auf die Unantastbarkeit der Menschenwürde verwiesen. Ein genauerer Blick zeigt, dass der Begriff viel zu beliebig verwendet werden kann, als dass man sich auf ihn berufen sollte. Von Edgar Dahl O Der Mensch als Hybrid r Durch Darwins Evolu­ tionstheorie geriet das christliche Menschenbild mehr und mehr in die Kritik, wonach der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wude, das Tier aber nicht. Den Biologen gilt seitdem der Mensch lediglich als ein Tier unter Tieren, wenn auch ein besonderes. Forschungen in den USA deuten darauf hin, dass sich die Vorfahren von Mensch und Schimpanse vor über sechs Millionen Jahren mehrmals kreuzten. Danach wäre also der Mensch selbst ein Hybrid. 70 b das Klonen von Lebewesen, die Erzeugung genetischer Chimä­ ren oder neuerdings gar das so genannte Neurodoping (die Ver­ stärkung von Hirnleistungen per Pille) – na­ hezu alle neuen biomedizinischen Technolo­ gien werden zumeist mit dem Hinweis auf die »Menschenwürde« abgelehnt. Der Appell an die vermeintlich unantastbare Würde des Menschen ist inzwischen so inflationär ge­ worden, dass es höchste Zeit wird, ihn etwas genauer zu betrachten. Wohl nirgends sieht man die Notwendig­ keit einer solchen Analyse deutlicher als in der Debatte um die Sterbehilfe. Denn hier berufen sich bekanntlich sowohl Verächter als auch Verfechter gern auf die Menschenwür­ de. Für die einen verbietet es die Würde des Menschen, dass man das Leben eines unter schrecklichen Qualen leidenden Patienten auf dessen Wunsch hin einfach beendet. Für die anderen dagegen gebietet sie es, dass man den selbstbestimmten Wunsch eines Sterbenden gefälligst zu respektieren habe. Angesichts der Beliebigkeit, mit der man die Idee der Menschenwürde also verwenden kann, wird er denn auch immer häufiger als eine bloße Leerformel abgetan. So hat etwa Wolfgang Wickler kürzlich die Frage »Was ist Würde?« bissig beantwortet: »Würde ist ein Konjunktiv!« Möglicherweise hilft ja ein kurzer Blick in die Geschichte, um zu entscheiden, ob die Verwendung des Begriffs Menschenwürde in der heutigen Zeit noch sinnvoll ist. Obgleich das Konzept bereits den Griechen und Rö­ mern bekannt war, war es in erster Linie das Christentum, das der Menschenwürde eine so zentrale Bedeutung einräumte. Nach christ­ licher Vorstellung beruht die Würde des Men­ schen auf seiner Rolle als »Ebenbild Gottes«: Im Unterschied zu allen anderen Wesen habe der Schöpfer nur ihn nach seinem Bild ge­ formt. Spätestens seit der Veröffentlichung von Charles Darwins »Die Entstehung der Arten« hat diese Begründung der Menschenwürde er­ heblich an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Doch auch ohne religionskritische Argumente zu bemühen, dürfte es offenkundig sein, dass eine explizit christliche Begründung der Men­ schenwürde für eine säkulare und pluralis­ tische Gesellschaft wie der unseren denkbar ungeeignet ist. Bereits der deutsche Idealismus hatte daher versucht, die Menschenwürde ohne Rückgriff auf eine Religion zu begründen. Statt der christlichen Gottesebenbildlichkeit rückte er die so genannte Vernunftnatur des Menschen in den Blick. So heißt es beispielsweise bei Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831): »Der Mensch, da er Geist ist, darf und soll sich selbst des Höchsten würdig achten; von der Größe und Macht seines Geistes kann er nicht groß genug denken.« Hegels Zeitgenosse Johann Gottlieb Fichte (1762 – 1814) zeigte sich ähnlich betört vom Mirakel der menschlichen Vernunft und stell­ te die rhetorische Frage: »Sollte der Mensch nicht eine heilige Ehrfurcht vor sich selbst tra­ gen, und schaudern und erbeben vor seiner eigenen Majestät?« Wir müssen den Menschen SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Mensch & Geist sondern höchstens graduell unterscheiden. Statt der Unvergleichlichkeit der Vernunft ist es heute eher die Fehlbarkeit der Vernunft, die ins Auge sticht. Sicher ist es eine bemerkens­ werte Fähigkeit, zu wissen, dass wir nichts wissen. Doch ließe sich daraus kaum die ver­ meintlich unantastbare Würde aller Menschen ableiten. Der bedeutendste und einflussreichste Ad­ vokat der Menschenwürde war zweifellos Im­ manuel Kant (1724 – 1804). Nach Ansicht des Königsberger Philosophen beruht die Würde des Menschen auf dessen »sittlicher Autono­ mie«. Anders als alle anderen Lebewesen ver­ mag sich der Mensch nämlich über seine natür­ lichen Triebe zu erheben und von morali­schen Normen leiten zu lassen. Diese Fähigkeit zum Auf sittlicher Autonomie beruht nach Immanuel Kant die Würde des Menschen. Gegen die Todesstrafe war er nicht. Stich von Johann L. Raab, nach einem Original von G. T. Döbler, 1791 mit Michel de Montaigne (1533 – 1592) nicht unbedingt als »das unglückseligste und ge­ brechlichste aller Geschöpfe« betrachten, um ihm darin Recht zu geben, dass »die Anma­ ßung unsere natürliche Erbkrankheit« ist. Es sei, wie der Politiker und Philosoph in seinen »Essais« notiert, offenbar wohl in der Tat ein Ausdruck »des Hochmuts des Menschen, dass er sich dem Schöpfer gleichstellt, sich gött­ liche Eigenschaften beimisst und sich vom großen Haufen der übrigen Kreatur auserle­ sen dünkt«. Anders als der deutsche Idealismus be­ trachtet der moderne Naturalismus den Men­ schen denn auch als ein bloßes Tier unter Tieren, dessen geistige Fähigkeiten sich von denen anderer Lebewesen nicht prinzipiell, Der Artikel 1 im Grundgesetz war zur Zeit seiner Entstehung durchaus umstritten. Ursprünglich hieß es: »Der Staat ist um des Menschens willen da, nicht der Mensch um des Staates willen.« fotolia / Karl-Heinz Spremberg SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 71 ESSAY: Menschenwürde Gemälde von Daniel Dumonstier, 1578 »Gehorsam gegenüber dem Sittengesetz« ma­ che den Menschen zum »Gegenstand höchster Bewunderung, die ihn gleichsam einen heili­ gen Schauer über die Größe und Erhabenheit seiner wahren Bestimmung fühlen« lasse. Da Adel bekanntermaßen verpflichtet, nö­ tigt uns die Menschenwürde nicht nur Respekt vor anderen, sondern auch vor uns selbst ab. Sie erlegt dem Menschen laut Kant die Pflicht auf, die Würde, »die ihn vor allen Geschöpfen auszeichnet, auch in seiner eigenen Person niemals zu beleidigen«. Hierzu gehöre, dass wir niemals vor unseren Mitmenschen krie­ chen sollen. »Wer sich zum Wurme mache, darf nicht darüber klagen, mit Füßen getreten zu werden.« Leerheit des Klangs Gemälde von Jakob Schlesinger, 1831 »Die Anmaßung ist unsere natürliche Erbkrankheit.« Michel de Montaigne »Der Mensch, da er Geist ist, soll sich des Höchsten würdig achten.« Friedrich Hegel 72 Wer sich von Kants Begriff der Menschen­ würde ein auch heute noch gültiges Kriterium für Moral und Recht erhofft, wird sich aber bald enttäuscht sehen. Denn nach seiner Auf­ fassung ist beispielsweise die Todesstrafe durchaus mit der Menschenwürde vereinbar; die Selbsttötung dagegen sei der Menschen­ würde zuwider. Insbesondere die Homosexua­ lität ist nach Kant ein verabscheuungswürdi­ ges Verbrechen, »da sie die Menschheit unter die Tierheit« erniedrige und »den Menschen der Menschheit unwürdig« mache. Aber bereits Kants Schüler Arthur Scho­ penhauer (1788 – 1860) ist sauer aufgestoßen, dass man mit diesem Begriff der Menschen­ würde allerlei Schindluder treiben und nahe­ zu jedes beliebige Verhalten ächten kann. Nicht zu Unrecht beklagte der Danziger sich über die Leerheit des Ausdrucks »Würde des Menschen«, der durch seinen »erhabenen Klang« dermaßen imponiere, dass »nicht leicht einer sich untersteht, heranzutreten, um ihn in der Nähe zu untersuchen, wo er dann finden würde, dass er nur eine bloße Hyper­ bel« sei. Entsprechend Kants zweiter Formulierung des kategorischen Imperativs versucht man die Menschenwürde denn auch konkreter zu fassen. Danach legt uns die Würde des Men­ schen folgendes Gebot auf: »Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.« Mit anderen Worten: Wir dürfen einen Menschen niemals als bloßes Mittel zu unserem Zweck gebrauchen. Um diese umständliche Formulierung zu umgehen, spricht man heute lieber einfach von dem Verbot der Instrumentalisierung. Wenn ich einen Taxifahrer als Mittel zum Zweck meiner Beförderung gebrauche, instru­ mentalisiere ich ihn nicht, sofern er in die Fahrt einwilligt und ich ihn entsprechend ent­ lohne. Wenn ich ihn dagegen unter Andro­ hung von Gewalt und ohne jede Bezahlung zu einer Fahrt zwinge, habe ich ihn instru­ mentalisiert. So einleuchtend der Gedanke auch erschei­ nen mag, eine Verletzung der menschlichen Würde mit der Instrumentalisierung eines Menschen gleichzusetzen, so führt er jedoch nicht weit. Nach allgemeiner Auffassung hat das Prinzip der Unantastbarkeit der Men­ schenwürde absolute Geltung. Das heißt, eine Verletzung der Menschenwürde darf niemals und unter keinen Umständen geduldet wer­ den. Wie der Mainzer Rechtsphilosoph Nor­ bert Hoerster gezeigt hat, gibt es nun aber In­ strumentalisierungen und Instrumentalisie­ rungen. Neben dem Mann, der eine Frau vergewaltigt, um seine Lust zu befriedigen, gibt es beispielsweise auch die Frau, die mit einem Mann flirtet, um ihren Partner eifer­ süchtig zu machen. Müssen wir beide Hand­ lungen nun gleichermaßen verurteilen, nur weil beide Handlungen gleichermaßen einen Menschen instrumentalisieren? Sicher nicht! Dass durch einen solchen Hinweis wenig gewonnen ist, wird spätestens dann klar, wenn wir Handlungen wie Mord oder Totschlag mit Handlungen wie Folter oder Geiselnahme vergleichen. Letztere enthalten offensichtlich eine Instrumentalisierung ihrer Opfer, erstere dagegen nicht. Für die Beurteilung ist dies je­ doch ohne jeden Belang. Alle vier Hand­ lungen stellen Verbrechen dar, für die unser Gesetzbuch einen eigenen Straftatbestand ent­ hält. Und die Strafwürdigkeit aller vier Hand­ lungen besteht einzig und allein darin, dass sie alle eine Verletzung unserer moralisch und ju­ ristisch geschützten Rechte darstellen. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Mensch & Geist Dies bringt mich zu meinem Hauptargu­ ment. Offenbar können wir jede Verletzung der Menschenwürde genauso gut, ja sogar noch weit besser, als eine Verletzung eines Menschenrechts beschreiben. Wenn dem so ist, dann wird aber der Verweis auf die Würde des Menschen nicht nur inhaltsleer, sondern geradezu überflüssig. Wozu sollen wir bei­ spielsweise eine Geiselnahme als Würdeverlet­ zung bezeichnen, wenn wir sie viel präziser als eine Beeinträchtigung des Rechts auf persön­ liche Freiheit fassen können? Und warum sol­ len wir eine Vergewaltigung als Würdeverlet­ zung bezeichnen, wenn wir sie viel konkreter als eine Beschädigung des Rechts auf körper­ liche Unversehrtheit brandmarken können? Kurzum: Solange sich keine Verletzung der Menschenwürde findet, die nicht zugleich auch einen Verstoß gegen ein Menschenrecht darstellt, ist der Begriff der Menschenwürde schlicht und einfach redundant. Gegner mundtot machen Natürlich will ich mit alldem nicht sagen, dass wir den Begriff der Würde ein für alle Mal aus unserem Vokabular streichen sollten. Noch viel weniger will ich behaupten, dass wir ihn aus unserer Verfassung eliminieren müssen. Wie wir alle wissen, ist der Satz »Die Würde des Menschen ist unantastbar« als Reaktion auf die unvergleichlichen Gräueltaten des Na­ tionalsozialismus in unser Grundgesetz aufge­ nommen worden, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass Menschen mit ihresgleichen nicht nach Belieben umgehen dürfen. Und hier erweist sich der Appell an die Würde des Menschen auch als das, was er in Wirklichkeit ist, nämlich eine bloße Deklaration. In der bioethischen Diskussion, und da­ rum geht es mir hier, hat der Begriff der Men­ schenwürde jedoch nichts verloren. Hier dient er fast ausnahmslos als ideologische Waffe, mit der man seine Gegner mundtot machen will. In Ermangelung eines Arguments zieht man das Schlagwort der Menschenwürde aus dem Ärmel, um die Diskussion zu beenden. Wer will schließlich auch weiterdiskutieren, sobald eine biomedizinische Technologie ein­ mal als eine grobe Verletzung der Menschen­ würde entlarvt worden ist? Um zu verdeutlichen, dass uns der Rekurs auf die Menschenwürde keinen Schritt weiter­ bringt, möchte ich auf die eingangs erwähnten Technologien des Neurodopings sowie der Chimärenbildung zurückkommen. Unter En­ hancement versteht man generell die Verbes­ serung menschlicher Fähigkeiten. Mit Hilfe des so genannten Neuro-Enhancements mö­ gen wir vielleicht eines Tages unsere kogni­ tiven und emotionalen Fähigkeiten verbes­ SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 sern. So genannte Smart Pills könnten unsere Konzentrationsfähigkeit und unser Erinne­ rungsvermögen erhöhen; Happy Pills könnten Befinden und Antrieb steigern. Sofern solche Präparate sicher, zuverlässig und nebenwirkungsarm wären, spräche ei­ gentlich nichts gegen ihre Einnahme. Den­ noch sehen Bedenkenträger auch hier wieder die Würde des Menschen in Gefahr. Doch in­ wieweit verletzt jemand, der seine Stimmung mit einer Glückspille aufhellt, seine Würde? Nicht einmal Kant würde etwas dagegen ein­ zuwenden haben. Seiner Meinung nach ist es gerade die Menschenwürde, die es uns verbie­ tet, ihm vorzuschreiben, wie er sein Leben zu leben hat: »Niemand kann mich zwingen auf seine Art glücklich zu sein, sondern ein jeder darf seine Glückseligkeit auf dem Wege su­ chen, welcher ihm selbst gut dünkt, wenn er nur der Freiheit anderer nicht Abbruch tut.« Unter Chimären versteht man Lebewesen, die Zellen verschiedener Spezies enthalten. Wenn wir einem menschlichen Embryo tieri­ sche Zellen hinzufügen, würde er also zu einer Chimäre heranwachsen. Wie nicht anders zu erwarten, ist selbstverständlich auch die Bil­ dung von Chimären als ein Angriff auf die Würde des Menschen diffamiert worden. Doch wer so spricht, weiß in aller Regel gar nicht, wozu diese Art von Forschung überhaupt be­ trieben wird. Es geht nicht darum, irgendwel­ che Monster zu schaffen, sondern uns von ei­ nigen Geißeln der Menschheit zu befreien. Ein Beispiel: Wie weithin bekannt, gibt es eine Vielzahl von Tieren, die gegenüber dem HI-Virus resistent sind. Sollte diese Immunität auf einem speziellen Gen beruhen, ist es denk­ bar, dieses Gen zu isolieren und in das Genom der Menschen einzuschleusen. Auf diese Wei­ se würden unsere Kinder und Kindeskinder schon bald vor Aids gefeit sein. Ähnliches ver­ sucht man mit Genen, die uns vor bestimm­ ten Arten von Krebs bewahren sollen. Was also könnte dagegen sprechen, künf­ tige Generationen vor Aids und Krebs zu schützen? Wie beim Enhancement, so kommt es auch bei der Bildung von Chimären auf das Risiko an, das mit diesem Eingriff verbunden ist. Sofern die Eingriffe sicher sind, spricht nichts, aber auch gar nichts dagegen. Wer sich dennoch vor Chimären ekelt, sei daran erin­ nert, dass wir streng genommen alle Chimä­ ren sind. Denn jeder von uns enthält tierische Zellen in seinen Gedärmen, nämlich Bakte­ rien. Hat sich deswegen jemals einer in seiner Würde verletzt gefühlt? Lasst uns also die Konsequenzen ziehen und den Einwand der Verletzung der Men­ schenwürde ein für alle Mal aus der bioethischen Diskussion verbannen. Edgar Dahl ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin und Dozent am Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Neben Problemen der Bioethik beschäftigen ihn Fragen der Moral-, Rechts- und Religionsphilosphie. Beck, M.: Mensch-Tier-Wesen. Zur ethischen Problematik von Hy­ briden, Chimären und Parthenoten. Schöningh, Paderborn 2009. Bommarius, C.: Das Grundgesetz – eine Biographie. Rowohlt, Reinbek 2009. Hoerster, N.: Ethik der Embryo­ nenforschung. Ein rechtsphilosophischer Essay. Reclam, Stuttgart 2002. Schöne-Seifert, B., Talbot, D. (Hg.): Enhancement. Die ethische Debatte. Mentis, Paderborn 2008. Wetz, F. J.: Illusion Menschen­würde. Aufstieg und Fall eines Grundwerts. Klett-Cotta, Stuttgart 2005. Weblinks zu diesem Thema finden Sie unter www.spektrum.de/ artikel/1019958. 73 MATHEMATISCHE UNTERHALTUNGEN Dreiecksgeometrie Torricelli und der fünfte Mittelpunkt des Dreiecks Mit physikalischen oder elementargeometrischen Methoden kann man einen der vielen »merkwürdigen Punkte« des Dreiecks finden, den die Antike nicht kannte. C rei – sozusagen punktförmige – Städte wollen sich miteinander durch ein Straßen- oder Kabelnetz verbinden, das aus Kostengründen eine möglichst geringe Gesamtlänge haben soll. Wie finden wir dieses Netz? Wenn die Städte – nennen wir sie A, B und C – nahezu auf einer Linie liegen, das Dreieck ABC also sehr stumpfwinklig ist, besteht das Netz aus den Dreiecksseiten AB und BC. In allen anderen Fällen verbindet es alle drei Ecken mit einem Punkt, der irgendwie »in der Mitte« des Dreiecks liegt und von allen drei Punkten in gleicher Weise abhängt. Seit der Antike (und aus dem Schulunterricht) kennt man vier »Mittelpunkte« des Dreiecks mit dieser Eigenschaft: den Mittelpunkt des Umkreises, der durch die Ecken geht, den des Inkreises, der die drei Seiten berührt, den Höhenschnittpunkt und den Schwerpunkt der Fläche, der zugleich auch der gemeinsame Schwerpunkt von drei gleichen Gewichten in den Ecken ist. Aber keiner von ihnen ist das Zentrum unse­ res minimalen Netzes. Das sieht man an den sehr stumpfen Dreiecken: Umkreismittelpunkt und Höhenschnittpunkt wandern aus dem Dreieck heraus, Inkreismittelpunkt und Schwerpunkt blei74 B Für jeden Punkt der Ebene ist die Summe der Entfernungen zu den drei Eckpunkten eines Dreiecks aufgetragen: Jede Grenze zwischen hellblau und gelb beziehungsweise weiß ist eine Linie konstanter Entfernungssumme. Für ein sehr stumpfes Dreieck (links) fällt der optimale Punkt in die entsprechende Ecke. ben im Inneren, aber keiner gerät auf die Ecke mit dem stumpfen Winkel. Die Lösung des Problems heißt »Fermat-Punkt«. Pierre de Fermat (1607 oder 1608 bis 1665, das falsche Geburtsjahr 1601 beruht auf einer Verwechslung mit seinem früh verstorbenen gleichnamigen Bruder) hatte ein Faible für Extremwerte und für Probleme, die dann von anderen gelöst wurden; das berühmteste Beispiel ist »Fermats letzter Satz«, den erst Andrew Wiles 1994 endgültig bewiesen hat. So stellte er die Frage nach unserem Punkt mit der minimalen Summe der Entfernungen von den Ecken eines allgemeinen Dreiecks (Bild oben). Den geometrischen Lösungsweg fand Fermats Zeitgenosse Evangelista Torricelli (1608 – 1647), der neben Viviani einer der bekanntesten Schüler Gali­leis war und uns vor allem wegen seiner Forschungen zum Luftdruck und durch die alte Druckeinheit Torr bekannt ist. Den Mathematikern ist derselbe Punkt unter der irre­ führenden Bezeichnung »Steiner-Punkt« ­geläufig, weil viel später Jakob Steiner (1796 – 1863) auch über das Problem ge- arbeitet hat; er soll im Folgenden »Fermat-Torricelli-Punkt« heißen. Wir schauen erst einmal nach physikalischen Lösungen, sozusagen mit Analogrechnern. Wir knoten drei (fast masselose) Fäden zusammen, stecken sie durch drei Löcher (die Eckpunkte des Dreiecks) in einem flachen Brett und hängen an jedes der freien Enden ein gleich schweres Gewicht. Wenn wir dann vorsichtig rütteln, wird die Haftreibung ant / Robbins D A enschaft, nach: Cour Von Norbert Treitz B Spektrum der Wiss A alle Abbildungen (sofern nicht anders angegeben): Christoph Pöppe, nach Norbert treitz C Minimum finden mit Seifenwasser: Der »Stei­ner-Baum«, das heißt die kürzeste Verbindung zwischen den drei gegebenen Punkten, stellt sich als Minimalfläche ein. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 C mensch & geist T A B Wandert der Zentralpunkt T von seiner optimalen Lage weg, wobei die Summe der Längen AT + BT konstant bleibt (hellblau), das heißt auf einer Ellipse mit den Brennpunkten A und B (rot), so kann CT nur länger werden. Im optimalen Fall trifft CT rechtwinklig auf die Ellipse. ausgetrickst, und der Knoten findet sich in dem gesuchten optimalen Punkt des Dreiecks aus den drei Löchern ein. Der Grund ist einfach: Der Schwerpunkt der Gewichte und damit die Gesamtenergie des Systems liegt umso niedriger, je länger die senkrechten Teile der Fäden in summa sind. Die anderen Teile der Fäden (praktisch in der Ebene des Bretts, die waagerecht sein kann, aber nicht muss) liegen dann in dem Dreieck; sie haben die verbleibende und darum minimale Summe ihrer Längen. Im Knoten treffen sich drei Fäden mit gleichen Zugkraftbeträgen und im Gleichgewicht mit der Kraftvektorsumme 0. Das Kräftedreieck ist also gleichseitig und daher auch gleichwinklig. Aus diesen physikalischen Betrachtungen folgt, dass man die Seiten des Dreiecks von dem gesuchten Punkt aus unter jeweils 120 Grad sehen kann. Wenn allerdings ein Innenwinkel größer als 120 Grad ist, dann ist diese »sehr stumpfe« Ecke selbst der optimale Punkt. Im Folgenden soll »sehr stumpf« die präzise Bedeutung »größer als 120 Grad« haben. Außer der Energie des Schwerefelds gibt es noch eine andere Energie, deren Minimierung man elegant für geometrische Probleme einsetzen kann, nämlich die Oberflächenenergie (siehe meinen Beitrag in Spektrum der Wissenschaft 9/2007, S. 98), die auf der Bindung zwischen Molekülen beruht und die man auch weniger klar mit einer »Oberflächenspannung« beschreibt. Wir nehmen zwei Acrylglasscheiben und bohren in jede drei Löcher an den Ecken zweier deckungsgleicher Dreiecke. Die Scheiben werden genau parallel zueinander im Abstand weniger Zentimeter montiert, und SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 durch die Löcher werden drei gerade Drahtstücke passender Dicke gesteckt, rechtwinklig zu beiden Scheiben. Nun tunkt man das Ganze in verdünntes Spülmittel und zieht es wieder heraus. Die Flüssigkeit bildet zwischen den Scheiben, den drei Drähten und einer sich selbst einstellenden Kante drei rechteckige Lamellen mit minimaler Gesamtfläche. Zwischen je zwei dieser Lamellen besteht dabei ein Winkel von 120 Grad. Denn wenn das noch nicht zutrifft, verlagern sich die Lamellen so, dass zwei mit einem spitzeren Winkel kleiner werden und die verbleibende zugleich größer wird. Die Summe der Lamellenflächen wird dabei kleiner (Bild links unten). Bei einem sehr stumpfen Dreieck entartet die Anordnung zu zwei Lamellen, die sich in der sehr stumpfen Ecke treffen. Torricellis Ellipsen Kann man diesen Befund auch rein geometrisch beweisen? Nach Torricelli kann man folgendermaßen mit Ellipsen argumentieren (Bild oben): Es seien A, B und C die Ecken eines nicht sehr stumpfen Dreiecks, T sei (Torricelli zu Ehren) der gesuchte Punkt mit der kleinsten Entfernungssumme AT + BT + CT. Wir verschieben nun in Gedanken T infinitesimal, wobei AT + BT konstant bleiben soll. Dazu muss T auf einer Ellipse mit den Brennpunkten A und B wandern. Die kürzestmögliche Strecke CT muss den Ellipsenbogen rechtwinklig treffen; sonst könnte man sie durch Bewegen von T entlang der Ellipse verkürzen. Nach einem Satz aus der ebenen Geometrie halbiert das Lot zur Tangente durch einen Punkt T auf einer Ellipse mit den Brennpunkten A und B den Winkel ATB. Damit haben wir die Gleichheit der Winkel CTA und CTB. Die Argumentation, die wir hier für die Punkte A und B durchgeführt haben, gilt ebenso für B und C sowie für C und A. Also sind alle drei Winkel CTA, ATB und BTC gleich und daher wegen ihrer Summe je 120 Grad. Um T mit Zirkel und Lineal zu konstruieren, nutzen wir einen Satz über Vierecke, die einen Umkreis haben, so genannte Sehnenvierecke. In einem solchen Viereck sind die Gegenwinkel paarweise zusammen gleich 180 Grad. Wir tun zunächst so, als hätten wir zu unserem Dreieck ABC bereits den optimalen Punkt T. Dann wählen wir ir- gendwo auf dem außerhalb von ABC liegenden Bogen des Umkreises von ABT einen neuen Punkt D (Bild unten). Das Viereck BTCD hat dann auch diesen Umkreis, und wegen BTC = 120° muss BDC = 60° sein. Wählen wir umgekehrt einen Punkt D mit der Eigenschaft, dass BDC = 60° ist, dann geht der Umkreis des Dreiecks BDC durch unseren gesuchten Punkt T. Dasselbe gilt für die analog zu konstruierenden Dreiecke ABF und CAE. Die Umkreise dieser drei angefügten Dreiecke schneiden sich in einem einzigen gemeinsamen Punkt, nämlich dem gesuchten T, und wir sind fertig. Es gehört zu den Merkwürdigkeiten der Dreiecksmittelpunkte wie T oder auch der klassischen Mittelpunkte, dass sie überbestimmt sind: In einem solchen Punkt schneiden sich nicht nur zwei, sondern drei zueinander analoge Linien. Bei der Konstruktion hat man dadurch immer eine gewisse Kontrolle der Zeichengenauigkeit. Wir haben bisher die angefügten Dreiecke gleichseitig gewählt, ohne dass es für die Umkreise nötig wäre. Nun setzen wir diese spezielle Wahl aber ausdrücklich voraus und verbinden die Ecken A, B und C einzeln mit den gegenüberliegenden Spitzen D, E und F der angefügten (gleichseitigen) Dreiecke. Tatsächlich tref­fen sich diese drei Verbindungsgeraden in einem gemeinsamen Punkt, und o Wunder, dieser ist T. Aber warum? Nach dem Mathematikhistoriker Joseph Ehrenfried Hofmann (1900 – E C D T B A F Der Fermat-Torricelli-Punkt T ist der Schnittpunkt der Umkreise von gleichseitigen Dreiecken, die über den Seiten des Dreiecks ABC konstruiert werden, und zugleich Schnittpunkt der Verbindungsgeraden zwischen gegenüberliegenden neuen und alten Ecken. 75 KiepertHyperbel Umkreismittelpunkt MATHEMATISCHE UNTERHALTUNGEN C 1973) nehmen wir einen Punkt U im Inneren eines nicht sehr stumpfen Dreiecks und drehen ihn mitsamt der Seite CA um 60 Grad um den Eckpunkt C (Bild unten). Aus A entsteht dabei der Eckpunkt E des gleichseitigen Dreiecks über CA und aus U der Punkt U´. Nun ist der Streckenzug EU´UB genauso lang wie die Summe der Verbindungen von den Ecken zu U. Offensichtlich ist dieser Streckenzug von minimaler Länge, wenn er zur geraden Linie entartet. Deshalb liegt der optimale Punkt T auf der Geraden EB und, da man diese Konstruktion mit jeder anderen Dreiecksseite ebenfalls durchführen kann, auch auf AD und CF. Obendrein sind die drei Strecken AD, BE und CF gleich lang. Beispielsweise bilden AD und CF mit B zwei deckungsgleiche Dreiecke, die man durch Drehung um 60 Grad ineinander überführen kann. Falls unser Dreieck ABC sehr stumpf ist, kann man gleichwohl diesen Schnittpunkt T konstruieren. Er hat zwar seine Minimumseigenschaft verloren, ist aber immer noch isogonal (»gleichwinklig«) in einem verallgemeinerten Sinn. Dreiecksgeometrie: Kurzfassung für Marsmenschen Ist mit den klassischen vier Punkten und dem Torricelli-Punkt das Sortiment der be­sonderen Punkte im Dreieck erschöpft? Mitnichten! Clark Kimberling von der University of Evansville (Indiana) führt eine Liste solcher Punkte und ist inzwischen bei der Nummer 3587 angelangt. Die »Encyclopedia of Triangle Centers« (ETC) beginnt mit dem Inkreismittelpunkt und dem Schwerpunkt; der Fermat-Torricelli-Punkt ist die Nummer 13, unmittelbar gefolgt von dem Punkt, der bei der analogen Konstruk­tion mit einwärts geklappten gleichseitigen Dreiecken entsteht. Alle diese Punkte haben gemeinsam, dass man sie aus den Lagen der Ecken ohne Rücksicht auf VertauE C U' U T B A Konstruktion des Fermat-Torricelli-Punkts T nach Joseph Hofmann 76 Umkreis Fermat-Torricelli-Punkt T1 NapoleonPunkt N2 Neunpunktekreis (Feuerbach-Kreis) Mittelpunkt der Kiepert-Hyperbel Schwerpunkt Napoleon-Punkt N1 Spieker-Punkt A FermatTorricelliPunkt T2 KiepertHyperbel B Die Kiepert-Hyperbel geht durch zahlreiche der über 3500 besonderen Punkte im Dreieck. schung der Nummern der Ecken bestimmen kann. Wie kann man in dieser unglaublichen Masse an Punkten den Überblick behalten? Manche von ihnen liegen auf der so genannten Euler-Geraden, manche auf dem Neunpunktekreis, der im Deutschen meistens Feuerbach-Kreis heißt. Es gibt zum Dreieck noch viel mehr Geraden, Kreise und allgemeiner Kegelschnitte mit besonderen Eigenschaften. Aber nehmen wir an, die Besucher vom Mars kommen, wollen etwas über Dreiecksgeometrie lernen, halten es aber nur eine Stunde lang auf der Erde aus: Was erzählt man ihnen dann? Die emeritierten Professoren Roland Eddy von der Memorial University of Newfoundland (Kanada) und Rudolf Fritsch von der Universität München empfehlen die Kiepert-Kegelschnitte, allen voran die Kiepert-Hyperbel. Ludwig Kiepert (1846 – 1934) verallgemeinerte die Dreiecke, die an die Seiten des Dreiecks ABC angefügt werden: Sie müssen nicht mehr gleichseitig, sondern nur noch gleichschenklig sein. Ihr Basiswinkel ist variabel, muss aber für alle drei angefügten Dreiecke stets der­ selbe sein. Negative Basiswinkel ergeben einwärts geklappte Dreiecke. Wieder treffen sich die Verbindungslinien AD, BE und CF zwischen den neu geschaffenen Eckpunkten und den gegenüberliegenden Ecken von ABC in einem Punkt. Die Menge dieser Punkte für alle Basiswinkel ist die Kiepert-Hyperbel. Sie geht nicht nur durch die drei Eckpunkte A, B und C, sondern durch eine erstaunlich hohe Anzahl an besonderen Punkten aus Kimberlings Liste. So gehört der Schwerpunkt zum Basiswinkel 0°, der Höhenschnittpunkt zu 90°, die beiden Fermat-Torricelli-Punkte zu ±60°. Selbst der aus anderem Zusammenhang besser bekannte Napoleon Bonaparte hat sich mit zwei besonderen Punkten (zu ±30°) in der Dreiecksgeometrie verewigt. Wenn das Dreieck ABC gleichschenklig ist, liegen alle 3587 Punkte auf seiner Symmetrieachse, und wenn es sogar gleichseitig ist, fallen sie alle in einen einzigen Punkt zusammen – wenn sie nicht ins Unendliche auswandern. Norbert Treitz ist pensionierter Pro­fessor für Didaktik der Physik an der Universität DuisburgEssen. Courant, R., Robbins, H.: Was ist Mathematik? Springer, Berlin, 5. Auflage 2000. Eddy, R. H., Fritsch, R.: The Conics of Ludwig Kiepert: A Comprehensive Lesson in the Geometry of the Triangle. In: Mathematics Magazine 67, S. 188 – 205, 1994. Online unter epub.ub.unimuenchen.de/4550/1/Fritsch_Rudolf_4550.pdf. Nahin, P. J.: When Least is Best: How Mathematicians Discovered Many Clever Ways to Make Things as Small (or as Large) as Possible. Princeton University Press, Princeton 2007. Stewart, I.: Steiners Verhältnis. Mathematische Unterhaltungen, Spektrum der Wissenschaft 4/1995, S. 10 – 15. Weitere Weblinks zu diesem Thema finden Sie unter www.spektrum.de/artikel/1019959. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Porträt: Gerald Haug Spurenleser im Klimalabyrinth Der Klimaforscher Gerald Haug sucht in der Vergangenheit den Schlüssel zum Verständnis der Gegenwart. Indem er einstige Klimaänderungen rekonstruiert­und interpretiert, gewinnt er Erkenntnisse von hoher Brisanz für die Zukunft der Menschheit. Von Sven Titz alle Fotos des Artikels: Spektrum der Wissenschaft / Esther Michel S 78 ein adrett aufgeräumter Arbeitsplatz befindet sich in einem modernen Gebäude der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. In dem geräumigen, lichtdurchfluteten Zimmer fühlt sich Gerald Haug sichtlich wohl. Durch eine großzügige Fensterfront hat er immer einen ungehinderten Blick auf das Hauptgebäude der ETH. Der Entwurf für den 145 Jahre alten Bau im Stil der Neorenaissance – errichtet als Polytechnikum Zürich – stamme von Gottfried Semper, dem Architekten der Oper in Dresden, erzählt mir mein Interviewpartner. Der studierte Geowissenschaftler ist mit Untersuchungen zur Klimaund Menschheitsgeschichte bekannt geworden, in denen er mehrere Disziplinen virtuos kombiniert hat: Da ging die Geologie Hand in Hand mit der Ozeanografie, der Meteorologie, der Biogeochemie und der Geschichtsforschung. Der Niedergang der Maya-Hochkultur und der TangDynastie, so glaubt Haug, hänge womöglich mit einer Wanderungsbewegung des tropischen Regengürtels zusammen. Wenn er im Interview seine großen Bögen von den Sedimentfunden über die Simulationen der ozeanischen und atmosphärischen Zirkula­ tion bis hin zu historischen Entwicklungen spannt, ist deutlich zu spüren, wie ihn die komplexen Zusammenhänge auf der Erde faszinieren. Seine Begeisterung wirkt geradezu jungenhaft – der Leibniz-Preisträger von 2007 zählt in der Tat erst 41 Lenze, und man könnte ihn sogar noch jünger schätzen. An der Wand hängen Abbildungen mit den gezackten und gepunkteten Linien seiner paläoklimatologischen Befunde. Er streicht mit dem Finger darüber wie ein Musikkritiker über die Partitur einer neuen Oper. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 & UMWELT ERDE &ERDE UMWELT ZUR PERSON Gerald Haug wurde am 14. April 1968 in Karlsruhe geboren, wo er später auch Geologie studierte. Seine Doktorarbeit schloss er 1995 an der Universität Kiel ab. Dort blieb er bis 1996 als Postdoc. Danach zog es ihn für ein Jahr an die University of British Columbia im kanadischen Vancouver; ein weiteres Jahr verbrachte Haug im US-Bundesstaat Massachusetts an der Woods Hole Oceanographic Institution. 1998 wechselte er an die University of Southern California in Los Angeles, wo er zwei Jahre lang als Research Assistant Professor arbeitete. Im Jahr 2000 kehrte Haug nach Europa zurück und wurde Oberassistent an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. 2001 verlieh ihm die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) den Albert Maucher-Preis für Geowissenschaften. 2002 habilitierte sich Haug in Zürich. Ein Jahr darauf ging er ans Geoforschungszentrum in Potsdam. Die Universität der Stadt berief ihn sogleich zum Professor. Spektrum der Wissenschaft: Herr Professor Haug, Sie sind heute Klimaforscher, haben aber Geologie studiert. Bedauern Sie diesen Umweg? Prof. Dr. Gerald Haug: Überhaupt nicht. Schauen Sie, die Geologie ist ja eine systemi­ sche Wissenschaft. Wer das Fach studiert, er­ hält eine Grundausbildung in Physik, Che­ mie und Biologie. Aber am Ende steht ein viel umfassenderes Bild. Mein Vater ist analytischer Chemiker. Ich selbst konnte mich nie für eine einzelne Grundlagenwissenschaft entscheiden. Das Systemverständnis, auf das die Geologie zielt, empfand ich schon beim Studium als ex­ trem reizvoll, und es fasziniert mich bis heute. Spektrum: Was war denn Ihr ursprüngliches Berufsziel? Haug: Ich wollte Umweltgeologe werden, um etwas Nützliches zu leisten. Aber dann entwi­ ckelte ich schon im Grundstudium durch sehr gute Lehrer großes Interesse an der Grund­ lagen­forschung. Ich habe in Karlsruhe studiert und arbeitete in einem Sonderforschungs­ bereich zur Riftentwicklung in Ostafrika. In Manfred Strecker, der heute Professor an der Universität Potsdam ist, hatte ich damals einen hervorragenden Lehrer. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Spektrum: Was brachte Sie unter diesen Um­ ständen denn dazu, nach dem Diplom fah­ nenflüchtig zu werden und in die Klimafor­ schung zu wechseln? Haug: In Karlsruhe hielt ich einmal einen Vortrag zum Kohlenstoffkreislauf, in dem es um eine Untersuchung des Meeresgeologen und Klimaforschers Michael Sarnthein an der Universität Kiel ging. Bei ihm hatte ein Freund von mir gerade eine Doktoranden­ stelle an­genommen. Eines Tages erzählte er mir, sein Betreuer plane ein Projekt für eine paläoklimatische Rekonstruktion im Nord­ pazifik. Das erschien mir reizvoll. Also be­ kundete ich Sarnthein in einem Brief mein Interesse. Bei dem Vorstellungsgespräch, zu dem er mich daraufhin einlud, bombardierte er mich eine halbe Stunde lang mit seinen Ideen zu dem Vorhaben. Ich verstand so we­ nig, dass ich schon kapitulieren wollte. Doch Sarnthein störte sich nicht im Geringsten an meiner Unbedarftheit, sondern ermunterte mich: Es habe noch keinem geschadet, mal etwas anderes zu tun. Ich solle morgen früh um neun Uhr kommen, um einen Doktoran­ denvertrag abzuschließen. Spektrum: Haben Sie den Schritt je bereut? Im Jahr 2007 wurde Haug mit dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der DFG ausgezeichnet und wechselte wieder nach Zürich. Dort arbeitet er heute als Professor für Klimageologie im Departement Erdwissenschaften. Seine Hauptforschungsgebiete sind der Einfluss des Klimas auf die Zivilisation, die Abkühlung der Erde im späten Neogen, das vor 23 Millionen Jahren begann, und die Biogeochemie in Ozeanen und Seen. 79 Porträt: Gerald Haug Mit wissenschaftlichen Instrumenten wird das Erdklima erst seit ungefähr 150 Jahren vermessen. Für die Zeit davor bedarf es indirekter Methoden. Sie beruhen vor allem auf Proxys (nach lateinisch proximus, »das Nächste«). Das sind natürliche Indikatoren früherer Klimabedingungen wie etwa Baumringe, Eisbohrkerne, Stalagmiten oder Sedimente in Meeren und Seen. Zu ihrer Nutzung benötigt man eine Eichmethode. Bei den Baumringen muss es zum Beispiel einen Zeitraum geben, für den sowohl exakte Messdaten als auch Proxywerte vorliegen. Dann wird die Ringdicke mit der Temperatur in Beziehung gesetzt. Diese Relation nutzt man, um frühere Temperaturen aus Baumringen zu erschließen. Die von Gerald Haug und Kollegen gemessene Titankonzentration in den Sedimentschichten des Cariacobeckens vor Venezuela spiegelt die Regenhäufigkeit in Mittelamerika wider. Minima weisen auf drei Dürre­perioden hin, die mit den drei Phasen zusammenfallen, in denen sich nach archäologischen Befunden der Untergang der Maya vollzog. ~ 810 n. Chr. ~ 860 n. Chr. ~ 910 n. Chr. 0,30 Klima nass Haug: Nein. In Kiel habe ich nicht nur ausge­ feilte Methoden der Meeresgeologie kennen gelernt, sondern durfte auch gleich beim inter­ nationalen Ocean Drilling Program mitarbei­ ten. Das gehörte zum Besten, was mir damals passieren konnte. An den Projekten waren Forscher aus 17 Nationen beteiligt. Als Dok­ torand da von Anfang an mitzumachen, gab meiner Karriere einen entscheidenden Impuls. Die Meeresgeologie ist völlig international aus­ gerichtet. Gleich zu Beginn mit dieser Welt­ offenheit konfrontiert zu werden, hatte eine befreiende Wirkung. Spektrum: Welches waren Ihre wissenschaft­ lichen Vorbilder? Haug: Da ist natürlich vor allem Manfred Strecker zu nennen. Er faszinierte mich als Pro­ totyp des jungen, dynamischen Hochschulleh­ rers. In ihm habe ich nach wie vor einen sehr guten Freund. Und Michael Sarnthein ist ja ein berühmter Meeresgeologe. Neulich durfte ich eine Laudatio auf ihn halten, als er die höchste Auszeichnung der Geologischen Verei­ nigung, die Gustav-Steinmann-Medaille, über­ reicht bekam. Sarnthein hat 70 Stunden die Woche gearbeitet und unglaublich viel bewegt. Allerdings war er ein sehr anspruchsvoller Mentor. Die es bei ihm geschafft haben, sind alle Professoren geworden. Ein weiteres Vor­ bild für mich war und ist sicherlich der Ozea­ nograf Wallace Broecker – er hat mit seinen pointiert formulierten Thesen zum Klimawan­ del großen Einfluss auf mich ausgeübt. Spektrum: Sie waren als Doktorand auch schon bei Bohrprojekten auf Schiffen dabei? Haug: Das stimmt. Damals war ich auf dem Forschungsschiff Sonne im Indischen Ozean unterwegs. Als Postdoc bin ich dann auf dem internationalen Tiefseebohrschiff Joides Reso­ lution in die Karibik gefahren. Später war ich auch noch auf anderen Forschungsschiffen. Neuerdings schicke ich aber lieber Doktoran­ den auf die See. Man ist acht Wochen unter­ wegs – eine lange Zeit für jemanden, der Ver­ pflichtungen an der Universität hat. Außer­ 0,15 trocken 80 Stephanie Freese 80 8 60 42 Jahre 3 47 Jahre 40 Tiefe in der Bohrkernprobe in Millimetern 20 6 0 0 Titan in Prozent Proxys dem werde ich seekrank (lacht). Ich reiße mich also nicht darum, mitzufahren. Spektrum: Auf Ihre Expeditionen mit Bohr­ schiffen und auf Bohrungen in Seen gehen Entdeckungen zurück, die auch in einer breiteren Öffentlichkeit Aufsehen erregten. Demnach beruhte der Niedergang der Maya auf einer lang anhaltenden Trockenphase. Des­ gleichen haben Sie politische Umstürze in Chi­ na auf Klimaänderungen zurückgeführt. Was sind die wissenschaftlichen Hintergründe? Haug: Über den Untergang der Mayakultur wurde viel gerätselt. Ähnlich mysteriös sind die Gründe für Umsturzphasen in verschie­ denen Epochen der chinesischen Geschichte. Eine Hypothese lautete, dass das Klima eine entscheidende Rolle gespielt haben könnte. Die Maya und die chinesische Tang-Dynastie hatten sich im 8. Jahrhundert in eine prekäre Situation gebracht. Es herrschte Überbevöl­ kerung. Hinzu kamen Probleme mit der Ent­ waldung und der Bodenerosion. Äußere Um­ welteinflüsse wie die Klimaänderung haben die Situation verschärft und den Niedergang so beschleunigt. Über die Geschichte Chinas weiß man, dass sie von Bauernaufständen, Re­ bellionen, Hungersnöten und Kriegen geprägt war. Oft wechselten die Dynastien genau dann, wenn die Monsunregenfälle nicht aus­ reichten. Es ist klar, dass eine Dynastie nicht zusammenbricht, wenn die Lebensbedingungen optimal sind. Ich gehöre aber nicht zu de­ nen, die sagen: Der Untergang lag nur am Klimawandel. Spektrum: Historiker und Archäologen sehen eher innere Gründe dafür. Haug: In der Tat gibt es eine Fraktion, die einen Klimawandel auch als Katalysator des Untergangs vehement ablehnt. Sie umfasst etwa ein Drittel der auf dem Gebiet tätigen Forscher. Es sind vor allem Kollegen, die sich als geisteswissenschaftlich verstehen oder sich ganz auf ihre Ausgrabungen stützen. Ein wei­ teres Drittel ist indifferent. Das letzte Drittel schließlich hält es für bewiesen, dass Umwelt und Klima eine entscheidende Rolle gespielt haben. Zu ihm zählen vor allem Vertreter von Disziplinen, die sich wie etwa die Umwelt­ archäologie mehr als naturwissenschaftlich orientiert verstehen. Spektrum: Wie sieht denn die Rollenvertei­ lung unter den Fachgebieten aus? Haug: Wir rekonstruieren nur das Klima. Mit Auskünften zu diesem Teilaspekt klinken wir uns in die Diskussion ein. Die Kollegen aus der Archäologie und Anthropologie stellen in­ terpretierende Hypothesen auf. Ich denke, unsere Erklärungsansätze ergänzen sich. Spektrum: Welche Indizien für Klimaände­ rungen haben Sie gefunden? SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 ERDE & UMWELT Haug: Anhand von Sedimenten, die wir im Cariacobecken vor Venezuela und in chinesi­ schen Seen erbohrten, konnten wir die tropi­ schen Regenfälle rekonstruieren. Im Cariaco­ becken sind die Ablagerungen jahreszeitlich geschichtet. Ein Jahr entspricht einer Helldunkel-Abfolge, wissenschaftlich auch Warve genannt. In der Regenzeit werden vom Land her dunkle Sedimente angeschwemmt. Wenn dann im Jahresverlauf der tropische Regengür­ tel weiter nach Süden gewandert ist, tritt im Cariacobecken eine Algenblüte auf. Die ab­ sterbenden Mikroorganismen bilden nun eine helle Sedimentschicht. Aus der chemischen Zusammensetzung der Warven lässt sich die jährliche Niederschlagsmenge ablesen. Aller­ dings treten jahreszeitlich geschichtete Sedi­ mente nur dort auf, wo am Meeresgrund weit gehend anoxische, also sauerstofffreie Bedin­ gungen herrschen wie im Cariacobecken. Deshalb haben wir uns zusätzlich ein spezielles Element ausgesucht, das ebenfalls nieder­ schlagsabhängig vom Festland eingeschwemmt wird, nämlich Titan. Es hat den Vorteil, dass es sich mit geochemischen Messinstrumenten wie dem Röntgenfluoreszenz-Scanner nicht nur besonders einfach, sondern auch noch be­ sonders präzise messen lässt. Spektrum: Und was verraten die Sediment­ funde? Haug: Im 8. und 9. Jahrhundert war es 150 Jahre lang allgemein trockener. Das lässt sich gut im Rahmen der El-Niño-Schwankungen verstehen … Spektrum: … also der Erwärmung des tro­ pischen Pazifiks alle paar Jahre … Haug: Die Maya lebten ja auf der YukatanHalbinsel im heutigen Mexiko. Dort gab es wegen der jahreszeitlichen Wanderung des tropischen Regengürtels eine Regen- und eine Trockenzeit. El-Niño-Jahre waren durch die Fernwirkung aus dem Pazifik trockener. Das ist auch heute noch so. Die Maya hatten zwar Wasserspeicher, die der Bevölkerung ein oder zwei Jahre durch die Dürre halfen, wenn eine El-Niño-Schwankung besonders stark und lang­ anhaltend war. Blieb aber das dritte Jahr ebenfalls trocken, war das eine Katastrophe. Verheerend wirkte sich dann auch aus, dass sich die Regenzeit um zwei bis drei Monate verspätete. Mitten in der tropischen Hitze säten die Bauern ihren Mais aus – in der Hoff­ nung auf Regen, der nicht rechtzeitig kam. Spektrum: Es gibt ja unzählige Indikatoren für einstige Klimaänderungen, die so genannten Proxys – neben Metallen auch fossile Algen, Fettstoffe und dergleichen mehr. Wie behalten Sie da als Paläoklimatologe die Übersicht? Haug: Na ja, so viele Proxys sind es auch wie­ der nicht. Aber es hat in jüngster Zeit einen SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 fantastischen Fortschritt in der analytischen Chemie gegeben, so dass immer mehr mach­ bar wurde. Die Kunst besteht darin, jeweils den richtigen Proxy zu wählen – je nachdem, wo man sich befindet, ob in den Tropen oder den hohen Breiten. Wo muss ich nachschau­ en, um mehr über die Prozesse, die ich verste­ hen möchte, herauszufinden? Auf welcher Zeitskala? Das ist die Kunst. Spektrum: Kann man das lernen? Haug: Ich bin ja, wie gesagt, Geologe, und Geo­logen sind dafür hervorragend ausgebil­ det. Wir haben immer eine Zeitachse, die von Dekaden bis Jahrmillionen reicht, und eine y-Achse, die den Niederschlag, die Tempera­ tur oder die Treibhausgaskonzentration wie­ dergibt. Dieser klassische geologische Ansatz lässt sich sehr gut mit modernen chemischen Methoden verbinden. Dabei wurden in den letzten 10 bis 15 Jahren enorme Fortschritte gemacht. Hätte man mir als Doktorand vo­ rausgesagt, dass irgendwann im Sediment eine Mikrometerauflösung möglich sein würde, hätte ich das als Fantasterei abgetan. Spektrum: Sie meinen, Sie können heute Schichten im Abstand von tausendstel Milli­ metern getrennt messen!? Haug: Ja, im Cariacobecken sind wir bei Ska­ lierungen von 100 bis 200 Mikrometern. Wenn Warven, also Jahresschichten, einen Millimeter dick sind, kann man somit alle 100 Mikrometer eine Messung machen und bekommt zehn Messpunkte pro Jahr. Spektrum: Welche Rolle spielen beim Zu­ sammenführen dieser Proxydaten die Klima­ modelle? Haug: Die Klimamodelle sind ganz entschei­ dend – sonst würden wir Unsinn in die Daten hineininterpretieren. Es gibt da eine erfreu­ liche Entwicklung. Die Paläoklimatologen und die Modellierer bewegen sich stark aufei­ »Klimamodelle sind ganz entscheidend – sonst würden wir Unsinn in die Daten hineininterpretieren« Klima­sensitivität Sie gibt an, wie das Klima auf die Anreicherung von Treibhausgasen in der Luft reagiert. In der Regel bezieht sie sich auf die Verdopplung des Kohlendioxidgehalts der Atmosphäre. Die mittlere Lufttemperatur an der Erdoberfläche steigt dabei nach Simulationen mit Klimamodellen langfristig um 2 bis 4,5 Grad Celsius. Kleinere und größere Werte lassen sich nicht ganz ausschließen. Bezugspunkt ist das Temperaturniveau vor der Industrialisierung, also am Beginn des 19. Jahrhunderts. Der größte Unsicherheitsfaktor bei der Berechnung der Klimasensitivität ist das Verhalten der niedrigen Wolken, wenn sich die Erde erwärmt. 81 Porträt: Gerald Haug »Die deutsche Forschung ist – mit wenigen Ausnahmen – zu deutsch geblieben« Der Leibniz-Preis Der nach dem Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz benannte Preis wird seit 1986 jährlich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) an in Deutschland arbeitende Wissenschaftler aller Fachrichtungen verliehen. Mit einem Preisgeld von jeweils 2,5 Millionen Euro ist er der höchstdotierte wissenschaftliche Förderpreis weltweit. Die bewilligten Mittel müssen innerhalb von sieben Jahren projektbezogen verwendet werden. Sie sollen herausragenden Nachwuchswissenschaftlern bessere Arbeitsbedingungen ermöglichen, sie von Verwaltungstätigkeiten entlasten und es ihnen erleichtern, besonders qualifizierte junge wissenschaftliche Mitarbeiter zu beschäftigen. Die Entscheidung über die Preisträger trifft der Hauptausschuss der DFG auf der Grundlage einer Empfehlung des Nominierungsausschusses für das Leibniz-Programm. 82 nander zu. Ein Beispiel: Der Modellierer Mi­ chael Schulz, der Eisbohrkernforscher Huber­ tus Fischer und ich haben bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein Schwerpunktpro­ gramm initiiert. Schon im Antrag lautete die Vorgabe, dass es eine Datenseite und eine Mo­ dellseite geben musste. Das läuft jetzt seit zwei Jahren und funktioniert wirklich sehr schön. Spektrum: Betreiben Sie hier in Zürich beides – die Analyse von Sedimenten und das Modellieren? Haug: Wir analysieren Sedimente, aber wir modellieren hier nicht selbst. Bei der heutigen Spezialisierung wäre das nicht sinnvoll. Ich habe jedoch früh gute Erfahrungen mit Mo­ dellierern gemacht, vor allem als Postdoc an der Woods Hole Oceanographic Institution und mit den Kollegen am Lamont-Doherty Earth Observatory sowie in Princeton. Bei den Ozeanphysikern Mark Cane und George Philander standen für uns Paläoklimatologen die Türen weit offen. In den USA hatte sich diese Zusammenarbeit früher als in Deutsch­ land etabliert. Spektrum: Bedenkt man das Zusammenfüh­ ren von Indizien und Hypothesen in der Paläo­klimatologie, so hat Ihre Arbeit ja im Grunde etwas Detektivisches. Lesen Sie ei­ gentlich Krimis? Haug: Das habe ich immer gerne gemacht. Als Kind waren das so Sachen wie »Die drei Fragezeichen« und später Agatha Christie. Was gibt es Größeres als Miss Marple, nicht? (lacht laut) Hinter diesem Interesse steckt wahrscheinlich so etwas wie die kindliche Neugier des Forschers. In der Paläoklimatolo­ gie gehört aber sehr viel Hartnäckigkeit, Ge­ duld und Mühe dazu, bis man gelernt hat, die Sedimente richtig zu lesen. Oft lassen sich die Ergebnisse auch nicht so gut verkaufen und gleich mit der Entwicklung von Hochkultu­ ren in Verbindung bringen. Spektrum: Von 2003 bis 2007 haben Sie am Geoforschungszentrum in Potsdam geforscht, unter anderem über die Schließung der Pana­ ma-Landenge vor 2,7 Millionen Jahren. Eine fruchtbare Zeit? Haug: Die Arbeiten zur Panama-Schließung und der Rolle speziell des subarktischen Pazi­ fischen Ozeans auf das Nordhemisphärenklima sind eigentlich schon älter und stammen aus meiner Zeit als Doktorand und Postdoc. In Potsdam profitierte ich dann von einer ausge­ zeichneten Zusammenarbeit mit Andrej Gano­ polski am Potsdam-Institut für Klimafolgen­ forschung, einem weiteren tollen Modellierer. Das war sicher eines meiner Highlights damals. Da haben wir Modelle mit Daten kombiniert und eine spannende Publikation über die Ver­ eisung der Nordhalbkugel geschrieben. Spektrum: Die Schließung der PanamaLandenge hängt damit zusammen? Haug: Schauen Sie, für die Vereisung der Nordhalbkugel muss es so kalt sein, dass der Regen im Winter als Schnee fällt. Im Sommer darf nicht so viel Schnee schmelzen, wie im Winter niedergeht. Und es muss feucht sein. Als Erklärung für die Herkunft der Feuchtig­ keit, die für die Schneefälle benötigt wurde, galt damals die Schließung der Panama-Land­ enge. Dadurch ist die Ozeanzirkulation im Atlantik angesprungen, die Wärme nach Nor­ den bringt. Die Hypothese war 100 Jahre alt, konnte aber nicht völlig überzeugen. Die Zir­ kulation scheint nämlich vor der endgültigen Schließung bereits in Gang gekommen zu sein. Mein Kollege Ralf Tiedemann vom Al­ fred-Wegener-Institut und ich konnten nun zeigen, dass schon vor 4 bis 4,5 Millionen Jahren nur noch eine sehr eingeschränkte Wasserverbindung zwischen Karibik und Pa­ zifik bestand. Deshalb wurde damals bereits die Atlantikzirkulation angekurbelt. Spektrum: In Potsdam haben Sie sich auch mit einem Kälterückfall auf der Nordhalbku­ gel zu Beginn des Holozäns beschäftigt – der Jüngeren Dryas. Haug: Ja, das war ein weiteres Highlight. Zu­ sammen mit Achim Brauer und anderen habe ich Sedimente von Seen in der Eifel mit Fun­ den aus dem Nordatlantik kombiniert. So konnten wir sehr schön zeigen, wie schnell dieser Klimawechsel ablief. Innerhalb weniger Jahre drehten die Winde und sanken die Tem­ peraturen! Spektrum: Vor drei Jahren erhielten Sie dann den Leibniz-Preis, den wichtigsten deutschen Forschungspreis. Welche Möglichkeiten hat er Ihnen eröffnet? Haug: Mir war immer klar: Wenn ich den Leibniz-Preis im Sinn der Erfinder nutzen will, dann soll das in Deutschland geschehen. Manfred Strecker und ich hatten vorgeschla­ gen, in Potsdam ein DFG-Leibniz-Zentrum zu gründen, um Untersuchungen der Erd­ oberfläche und des Klimas zu verknüpfen. Dort betreuen wir heute gemeinsam Dokto­ randen; es springt also ein echter Mehrwert für die Universität Potsdam heraus. Spektrum: Bei der Preisverleihung zitierten Sie Dieter Imboden, den Forschungsrat des Schweizerischen Nationalfonds, mit der Aus­ sage, ein Forscher sei ein »Anarchist des Geistes«. Was bedeutet das für Sie? Haug: Sie kennen doch sicher das Schlagwort von der Freiheit der Forschung. Politiker spre­ chen inzwischen allerdings lieber von »pro­ grammorientierter« Forschung. Nur habe ich noch keinen Kollegen gefunden, der damit et­ was anfangen konnte. Als Grundlagenforscher SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 ERDE & UMWELT will man keinem wissenschaftlichen Vorstand weisungsgebunden sein, wie es in der Helm­ holtz-Gemeinschaft üblich war. Erhält man dann die Chance, wie ich 2007, an die Co­ lumbia University oder ETH Zürich zu ge­ hen, wo einem niemand Vorschriften macht, fällt die Entscheidung sehr leicht. Ich habe aber immer betont, dass ich eine sehr gute Zeit in Potsdam hatte. Spektrum: Beim Wechsel zur ETH Zürich im Jahr 2007 bezeichneten Sie Ihre neue Stelle­ als »besten Job der Welt«. Sehen Sie das heute noch genauso? Haug: Ja. Der Beruf des Hochschullehrers hier erscheint mir als einer der besten Jobs, die man haben kann. Er ist unglaublich viel­ seitig. Der Umgang mit den Studierenden und Doktoranden hält dynamisch. Man hat natürlich seine Unterrichtspflicht, aber auch alle wissenschaftlichen Freiheiten. Ich bin ja als begeisterter Humboldtianer der Überzeu­ gung, dass Forschung und Lehre verknüpft werden müssen, die Forscher ansonsten aber die größtmögliche Freiheit genießen sollten. An der ETH Zürich zu arbeiten, empfinde ich in dieser Beziehung als ein echtes Privileg. Die Unterrichtsbelastung ist geringer als an deutschen Universitäten. Wenn man an einer deutschen Exzellenz-Universität arbeitet, muss man absurderweise neun bis elf Stunden Leh­ re absolvieren. Ein Harvard-Professor hat zwei Stunden Lehre. Wir liegen hier mit vier bis fünf Stunden so in der Mitte. Spektrum: Sie haben sich in der Vergangen­ heit nicht immer positiv über die Forschungs­ förderung in Deutschland geäußert. Einmal andersherum gefragt: Welche Aspekte der For­ schungsförderung in der Schweiz fallen Ihnen denn als positiv und nachahmenswert auf? Haug: Die ETH Zürich ist eine bundesfinan­ zierte Forschungsuniversität. Deutschland hat mit seinen länderfinanzierten Hochschulen ein etwas anderes, differenzierteres System. Hier in Zürich ist jede Professur wie die Lei­ tung einer kleinen Max-Planck-Gruppe – aber an einer Universität mit einem Ausbildungs­ auftrag. Da hat Deutschland mit der Exzellenz­ initiative einen richtigen Schritt gemacht, wenn auch einen bescheidenen. Die ETH Zü­ rich ist finanziell immer noch deutlich besser ausgestattet als jede deutsche Universität. Die Kritik, die ich nach dem Erhalt des LeibnizPreises 2007 geäußert habe, richtete sich ge­ gen die pro­grammorientierte Forschung der Helmholtz-Gemeinschaft, die von einer Mehr­ heit der Helmholtz-Forscher nach wie vor als Behinderung empfunden wird. Es war aber auch eine Art Hilferuf für die unterfinanzierten deutschen Universitäten. Ich denke, dass bei ihnen das größte intellektuelle Potenzial SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 liegt. Durch eine entsprechende Finanzierung müsste man diese Plattform anheben. Spektrum: Könnten Sie das präzisieren? Haug: Wenn ich einen Vorschlag machen darf: Man verdopple das Budget der Deut­ schen Forschungsgemeinschaft aus Bundes­ mitteln! Diese Institution funktioniert ja nach einem Bottom-up-Prinzip, bei dem die For­ scher selbst den Zweck der Projekte vorgeben. Ich sehe da in letzter Zeit erfreuliche Entwick­ lungen. Dazu gehört, dass bei erfolgreichen Projekten nach der Bilanzierung Geldmittel von der DFG als so genannter positiver Over­ head an die Universität fließen – das heißt zu­ sätzlich zur Forschungsförderung gehen 20 Prozent an die Hochschule. So kann sich für die Universitäten profilierte Forschung richtig auszahlen. Spektrum: Sie haben mehr als drei Jahre in den USA und Kanada gearbeitet und können vergleichen: Ist die Schweiz in der Forschung besonders stark, weil amerikanischer? Haug: Nun, 63 Prozent der Professoren an der ETH Zürich sind Ausländer, ähnlich wie an den Universitäten der Ivy League in den USA. Einzige Wertmaßstäbe sind die Exper­ tise und ein hohes wissenschaftliches Niveau. In den Erdwissenschaften sprechen wir bei den Kaffeerunden nur Englisch; denn das ist die einzige für alle verständliche Sprache. So lassen sich unterschiedliche Kulturen und wis­ senschaftliche Ansätze sehr gut integrieren. Die deutsche Forschung ist – mit wenigen be­ merkenswerten Ausnahmen – häufig zu deutsch geblieben. Spektrum: Kommen wir zum Schluss zu den aktuellen Veränderungen des Klimas. Manche Geologen und Paläoklimatologen, die lange Zeiträume von teils mehreren Millionen Jahren überblicken, sehen die momentane Erderwär­ mung relativ gelassen. Wie ist es bei Ihnen? Haug: Mir scheint die Gefahr eher noch grö­ ßer, als die doch recht konservativen IPCCSzenarien nahelegen. Dort sind einige KlimaSchwellenwerte nicht berücksichtigt worden, bei deren Überschreiten es zu plötzlichen dras­tischen Änderungen kommen kann. Ich denke, dass die Achillesferse des Klimas die Polarregionen sind, etwa wegen der empfind­ lichen Meereisbedeckung in der Arktis. Spektrum: Gibt es weitere Aspekte, die Ihnen als Paläoklimatologen in der Diskussion fehlen? Haug: Was praktisch alle Klimamodelle in den Szenarien der Erderwärmung falsch ma­ chen, ist der Gasaustausch zwischen Ozean und Atmosphäre. In den Zirkulationsmodel­ len verstärkt sich in einer wärmeren Welt die Temperaturschichtung des Ozeans. Das hie­ ße, dass aus dem Meer weniger Kohlendioxid in die Atmosphäre entweichen würde. Nach DAs IPCC Das 1988 gegründete Intergovernmental Panel on Climate Change (Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen) hat als Organ der Klimarahmenkonvention die Aufgabe, Ausmaß, Ursachen und Risiken der globalen Erwärmung zu beurteilen und mögliche Gegenmaßnahmen sowie Anpassungsstrategien vorzuschlagen. Der Ausschuss betreibt selbst keine Wissenschaft, sondern fasst nur die Forschungsergebnisse aus relevanten Fach­ gebieten zusammen und bewertet sie. Das geschieht in regelmäßig erscheinenden Sachstandsberichten. Der vierte und jüngste solche Report kam 2007 heraus. »Was praktisch alle Klimamodelle falsch machen, ist der Gasaustausch zwischen Ozean und Atmosphäre« 83 Porträt: Gerald Haug Sven Titz ist promovierter Meteo­ rologe und arbeitet als freier Wissenschaftsjournalist in Berlin. Haug, G. H. et al.: Climate and the Collapse of Maya Civilization. In: Science 299, S. 1731 – 1735, 2003. Haug, G. H., Tiedemann, R.: Effect of the Formation of the Isthmus of Panama on Atlantic Ocean Thermohaline Circulation. In: Nature 393, S. 673 – 676, 1998. Haug, G. H. et al.: Role of Panama Uplift on Oceanic Fresh­ water Balance. In: Geology 29, S. 207 – 210, 2001. Yancheva, G. et al.: Influence of the Intertropical Convergence Zone on the East Asian Monsoon. In: Nature 445, S. 74 – 77, 2007. Weblinks zu diesem Thema finden Sie unter www.spektrum.de/ artikel/1019957. 84 den Paläodaten trifft aber das Gegenteil zu. Bei warmem Klima hat sich in den polaren Gebieten stets die Schichtung des Ozeans ab­ geschwächt, da sie dort hauptsächlich auf einem sehr dünnen Süsswasserdeckel beruht, der in einer wärmeren Welt verschwindet. Da­ durch konnte CO2 leichter an die Oberfläche gelangen und in die Atmosphäre übertreten – eine positive Rückkopplung also. Die IPCCModelle enthalten stattdessen eine negative Rückkopplung. Spektrum: Wie beurteilen Sie also die Erd­ erwärmung? Haug: Der Zusammenhang zwischen Treib­ hausgasen und Klima ist eindeutig. Fest steht auch, dass sich die atmosphärischen Bedin­ gungen in der Erdgeschichte noch nie derart schnell verändert haben. Die Menschheit hat es geschafft, unseren Planeten in einem Jahr­ hundert um fast ein Grad aufzuheizen. Das ist viel schneller als die Erwärmung am Ende der letzten Eiszeit, als es innerhalb von 3000 Jah­ ren global um etwa vier Grad wärmer wurde. Überhaupt ist nach neuesten Paläoklimadaten die Klimasensitivität gegenüber Treibhausgasen höher als früher gedacht. Spektrum: Können Sie das genauer erläutern? Haug: Im Pliozän, das heißt vor 5,3 bis 2,6 Millionen Jahren, gab es eine eisfreie Nord­ halbkugel. Alles andere war wie heute. Den besten CO2-Rekonstruktionen zufolge ent­ hielt die Atmosphäre damals 420 ppm, also millionstel Anteile Kohlendioxid. Zum Ver­ gleich: In den letzten Eiszeiten lag der Wert bei 200, in den Warmzeiten zwischen 280 und 300 ppm, aber nie darüber. Menschenge­ macht haben wir aktuell 380 ppm – das liegt also ganz nah an den 420 ppm im Pliozän. Damals gab es kein Eis auf der Nordhalbku­ gel, auch nicht auf Grönland. Die Welt war drei Grad wärmer. Ohne CO2 geht das nicht. Spektrum: Woher wissen Sie das? Haug: Die Erdgeschichte zeigt einfach: Nie waren beide Pole vereist, wenn der CO2-Ge­ halt der Luft 360 ppm überstieg. Im warmen Eozän vor 50 Millionen Jahren betrug der CO2-Anteil mehr als 2000 ppm. Das war eine ganz eisfreie Welt. Der Zusammenhang zwi­ schen Kohlendioxid und der Temperatur ist in den geologischen Daten eindeutig. Spektrum: Welche Rolle spielt denn die Paläo­klimatologie im Konzert der verschiede­ nen Teildisziplinen der Klimaforschung? Haug: Wir Paläoklimatologen erkennen ganz andere Geschwindigkeiten und Größenord­ nungen von Klimaänderungen, als sie in den letzten 50 Jahren beobachtbar waren. Außer­ dem offenbart der historische Blickwinkel Faktoren, welche die heutigen Computermo­ delle noch nicht abbilden können. Wir Paläo­ klimatologen weisen etwa auf zusätzliche Schwellenwerte hin, die bisher wohl unter­ schätzt wurden, speziell im Bereich der po­ laren Ozeane und der Eiskappen. Zum Bei­ spiel kann CO2 aus dem tiefen Ozean aus­ gasen, und in der Arktis gibt es den Eis-Albedo-Effekt, der das Abschmelzen des Eises beschleunigt. Dadurch dürfte vor allem der Anstieg des Meeresspiegels sehr viel stär­ ker ausfallen als vom IPCC extrapoliert. Spektrum: Welche Bedeutung haben Hypo­ thesen in der Paläoklimatologie? Haug: Wir machen Messungen und publizie­ ren zunächst nur diese Messergebnisse. Zu­ gleich versuchen wir sie aber – idealerweise anhand eines physikalischen Modells – zu ve­ rifizieren und eine passende Interpretation zu finden. Ich stimme die gemessenen Daten im­ mer mit Kollegen ab, die sich mit den physi­ kalischen Modellen auskennen. Eventuell sa­ gen die: »Das ist ja totaler Blödsinn, das kann gar nicht sein – messt noch einmal nach!« So etwas kommt vor allem bei der Entwicklung neuer Proxys vor. Spektrum: Aber eigentlich verwendet man Proxydaten ja umgekehrt, um Modellvorstel­ lungen zu testen. Haug: Richtig, und da kenne ich auch ein nettes Beispiel. Zwei modellierende US-Kolle­ gen hatten die Hypothese aufgestellt, dass die indonesische Meerenge entscheidend für den Wasseraustausch zwischen dem Pazifik und dem Indischen Ozean ist. Als sich durch die Nordverlagerung einer indonesischen Insel die Meerenge öffnete, könnte kälteres pazifisches Wasser in den Indischen Ozean vorgedrungen sein. Das sollte die Zunahme der Trockenheit in Afrika vor 2,7 Millionen Jahren erklären. Anfangs faszinierte mich die Idee. Später fiel mir aber ein, dass es eine Paläo-Zeitreihe von Nick Shackleton gibt, die die Hypothese wi­ derlegt: eine planktische Isotopenkurve. Sie zeigt eine Erwärmung in der Region, keine Abkühlung. Das habe ich einem der ameri­ kanischen Kollegen geschickt. Der meinte: Wenn Shackleton richtig gemessen hat, dann war es das wohl mit unserer Hypothese. So et­ was passiert eben. Spektrum: Woran arbeiten Sie ganz aktuell? Haug: Nun, nächste Woche muss dieser Arti­ kel hier heraus zur Begutachtung. Da geht es wieder um die Bedeutung der Polarmeere für den Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre. Und dann ist hier der Artikel eines Postdocs zur Klimadynamik vor 3,5 Millionen Jahren. Die dritte Untersuchung dreht sich um die Verbin­ dung von Eisbohrkerndaten mit Monsundaten und Sedimentdaten aus dem Cariacobecken. Da beschreiben wir die Klimaentwicklung in den letzten 100000 Jahren. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Wissenschaft im Rückblick »Am 5. Februar wurde in Mey­ rin bei Genf von Niels Bohr das 25 GeV-Protonensynchrotron der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) offiziell eingeweiht. Damit steht nun der gegenwärtig stärkste Beschleuniger den Physikern der westeuropäischen Mitgliedstaaten und Gästen aus aller Welt zur Verfügung. Im September gelang es, in dem ringförmigen Edelstahl-Vakuumrohr (Länge 628 m; Querschnitt 7x14 cm) einen Umlauf der Protonen zu erzielen; im Oktober wurden die 16 Hochfrequenzbeschleu- »Diese batteriegespeiste, drahtlose Kleinst-Fernsehreportageanlage besteht aus einer Fernsehkamera und einem Kleinsender (Bild), welcher das von der Kamera aufgenommene Bild auf drahtlosem Wege zu einem in der Nähe befindlichen Übertragungswagen sendet. Von da gelangt es, wiederum auf drahtlosem Wege, zum Studio und wird schließlich über die Fernsehsender ausgestrahlt. Der Kamerakopf wiegt 2,9 kg, das Tornister­ gerät mit Sendeantenne und Traggestell 8,4 kg. Ein erster Einsatz der beschriebenen Anlage ist bei den Olympischen Sommerspielen in Rom ge­ plant.« Die Umschau in Wissenschaft Zeitschrift, 16. Jg, Heft 3, März 1960, S. 132 und Technik, 60. Jg., Heft 6, 15. März 1960, S. 186 Steinzeitliche Schönheit Erdöl ohne Ende? »Regierungsrat Joseph Szombathy und Dr. Joseph Bayer haben in einem Lößhange nahe bei Willendorf neun Schichten aufeinander folgender Kulturstätten des diluvialen Menschen gefunden. Neben Werkzeugen, Schmuck und Graphit zur Körperbe­ malung wurde ein plastisches Kunstwerk zutage gefördert. Dr. Bayer berichtet über diesen Fund wie folgt: ›Wir hatten eine 11 cm hohe Statuette aus feinporösem Kalkstein in Händen, eine fettleibige, überreife Frau darstellend; die Milchdrüsen und der Spitzbauch sind ganz hervorragend ausgebildet. Die Schamlippen sind sorgfältig dargestellt, die Unterschenkel schon stark verkürzt, die Vorderfüße weggelassen. Von Details, wie Nase, Augen, Mund, Kinn oder Ohren findet sich keine Spur. Das kleine Kunstwerk gibt Zeugnis von einer ganz hervorragenden künstlerischen Beherrschung des menschlichen Körpers seitens seines Verfertigers, der offenbar in der Absicht, ein Idol der Fruchtbarkeit zu schaffen, die darauf bezüglichen Teile auffallend betonte, das übrige dagegen nach Manier eines Karikaturenzeichners unterdrückte.‹« Die Umschau, 14. Jg., »In der letzten Versammlung der Buffalo Society of Natural Sciences hielt Dr. David T. Day vom Washingtoner Bergamt einen Vortrag über Erdöl und seinen Ursprung, in welchem er für die Carbidtheorie eintrat, im Gegensatz zu der heute verbreitetsten Annahme, daß Petroleum aus tierischen und pflanzlichen Überresten entstanden ist. Die in Niagara Falls bei der Darstellung von Carborundum und Calcium gemachten Beobachtungen inbezug auf chemische Vorgänge bei hohen Temperaturen be- Nr. 13, 26. März 1910, S. 257 Jg., Nr. 11, 12. März 1910, S. 220 Die Venus von Willendorf – heute schätzen Forscher ihr Alter auf mehr als 24 000 Jahre. Der Umstieg von Röhren auf Transistoren macht auch Kameras erstmals handlich. weisen, daß die nach genügender Abkühlung der Erde zuerst gebildeten Stoffe aus Carbiden bestanden haben. Die Bildung von Öl geht in ununterbrochener Weise vor sich, so daß nicht zu befürchten ist, daß ein Mangel an Vorräten eintreten werde, solange der Verbrauch diese Neubildung nicht übersteigt.« Chemiker-Zeitung, 34. Jg., Nr. 31, 15. März 1910, S. 270 Reichsdampfer auf Eisfahrt »Der Kaiser hat bestimmt, daß der Reichsdampfer ›Poseidon‹ als Aufklärungs- und Begleitschiff der Zeppelin-Nordpolexpedition für die nächsten beiden Jahre in Dienst gestellt wird. Der ›Poseidon‹ fährt am 25. Juni nach dem hohen Norden ab und wird sich am 7. Juli in Narwick mit seinem Begleitschiff, einem schwedischen Holzdampfer, vereinigen. Beide Fahrzeuge erhalten funkentelegraphische Apparateinrichtung.« Die Umschau, 14. 85 Kürzungen werden nicht eigens kenntlich gemacht. Schnelle Teilchen in Genf Kleinst-Kamera macht Reporter mobil niger eingeschaltet und der erste beschleunigte Protonenstrahl beobachtet. Nach ei­ nigen Änderungen während der ersten Novemberwochen konnte am Monatsende der Protonenstrahl bei 12 000 Gauß auf 24,3 GeV beschleunigt werden; Anfang Dezember wurde die Energie von 28,3 GeV nachgewiesen. Wäh­ rend einer internen Feier erhob der Leiter der Abteilung, John B. Adams (früher Harwell), eine Flasche Wodka, die ihm während der CERNKonferenz im September 1959 von russischen Physikern geschenkt worden war. ›Die Flasche ist jetzt leer, ich werde in sie das Oszillogramm hineinstecken, das die Erreichung von 24 GeV beweist und die Flasche nach Moskau zurückschicken‹, sagte John B. Adams am Ende der Feier.« Physikalische WISSENSCHAFT IM ALLTAG richtlautsprecher Auf den Punkt gehört Eng gebündelte Schallsignale könnten Informationen gezielt übertragen. Richtlautsprecher strahlen gebündelte Ultraschallwellen ab und erzeugen in diesem schmalen Kegel hörbare Töne. Ein konventioneller Lautsprecher strahlt in weitem Bereich ab. Von Mark Fischetti und Bernhard Gerl S 86 Verstärker Spannung vom Verstärker nicht modulierter Ultraschall hintere Abdeckung dünne Folie Netzgitter Kunststoffauflage Gewebeabdeckung Ein nur einen Zentimeter dicker Lautsprecher wird von einem Verstärker gespeist, der eine Spannung an eine leitfähige Kunststofffolie schickt. Die Folie schwingt mit 60 000 Hertz oder mehr und erzeugt dabei Ultraschallwellen. überlagerte Welle mit normalem Schalldruck Spektrum der Wissenschaft / Meganim Mark Fischetti ist Redakteur bei »Scientific American«, Bernhard Gerl ist freier Technikpublizist in Mainz. Ultraschalllautsprecher Musik aus einem konventionellen Lautsprecher 70 dB Lautstärke tellen Sie sich vor, Sie kommen im Supermarkt am Getränkeregal vorbei und plötzlich flüstert eine Stimme: »Pst, haben Sie Durst? Ich erfrische ganz herr­ lich!« Niemand sonst scheint diese Werbebotschaft gehört zu haben – Sie sind in den schmalen Schallkegel eines Richtlautsprechers geraten. Besitzer einer Heimkinoanlage wissen aus eigener Erfahrung: Schall breitet sich von seiner Quelle in einem Winkel aus, der mit der abgestrahlten Wellenlän­ ge wächst beziehungsweise umgekehrt proportional zur Frequenz ist. Deshalb vernimmt man den Bass des Subwoofers (Wellenlänge etwa 3,4 Meter bezie­ hungsweise Frequenz rund 100 Hertz) im ganzen Wohnzimmer, während ein Hochtonlautsprecher (Wellenlänge etwa 3,4 Zentimeter, Frequenz etwa 10 000 Hertz) eher nach vorn sendet. Auch die Größe der Schallquelle spielt eine Rolle: je kleiner die abstrahlende Fläche, desto weiter der Schallkegel. Soll der Kegel zu einem gerichteten Strahl verengt werden, benötigt man also entweder einen riesigen Lautsprecher oder viele kleine, die synchron schwin­gen – oder Ultraschall. Denn bei dessen Frequenzen von 20 bis 100 Kilohertz weitet sich Schall selbst auf mehrere Meter Distanz kaum auf. Das nutzt man beispielsweise in der medizinischen Diagnostik; Fledermäuse erkennen anhand von Ultraschall­ reflexionen des Nachts Hindernisse und Beute. Für das menschliche Gehör sind ­diese Signale jedoch zu hochfrequent, Luftdruckschwingungen von mehr als 20 Kilohertz vermögen die Knöchelchen unseres Mittelohrs nicht mehr zu folgen. Doch es gibt einen Trick: das Phänomen der Differenztöne. Überlagern sich Schallwellen geringfügig verschiedener Frequenzen, entsteht ein Gesamtsignal, dessen Amplitude schwingt (Amplitudenmodulation). Das entspricht einem Ton, dessen Frequenz sich aus der Differenz der beiden Ausgangstöne ergibt. Auch der ist aber noch nicht hörbar. Ein weiteres Phänomen hilft: Ab einer Lautstärke von etwa 125 Dezibel (zum Vergleich: Das entspräche im hörbaren Frequenzbereich einem in drei Meter Entfernung startenden Düsenflugzeug) verhält sich Luft nicht­ linear. Der Überdruck im Bauch einer Schallwelle ist dann viel größer als der Un­ terdruck im Wellental. Diese Luftdruckdifferenzen sind nun endlich hörbar. Erst Joseph Pompei gelang es 1998 am Massachusetts Institute of Technology, geeignete Computeralgorithmen zu entwickeln, um Ultraschalllautsprecher ent­ sprechend anzusteuern. Er gründete das Unternehmen Holosonic und bringt seit­ dem die Richtlautsprecher »Audio Spotlight« auf den Markt. Ein Jahr später stell­ te die Firma Sennheiser ein ganz ähnliches Produkt vor, den »Audiobeam«; sie erhielt dafür im gleichen Jahr den Innovationspreis der deutschen Wirtschaft. Die akustische Qualität entspricht ungefähr der konventioneller Lautsprecher, mit Schwächen im Bassbereich. Das wird in Kauf genommen, denn nicht Hörge­ nuss ist das Ziel, sondern das gezielte Versorgen von Einzelpersonen mit Musik oder Informationen. Mit solchen Systemen lässt sich beispielsweise ein Muse­ umsbesucher über ein Exponat unterrichten. Kritiker wenden ein, dass Kopfhörer oft den gleichen Dienst tun, aber viel billiger sind als die mehrere tausend Euro teuren Richtlautsprecher. Zudem gibt es lästige Nebeneffekt: Tritt jemand in den Strahlengang, unterbricht er die Signalübertragung; fällt der Strahl auf ein Objekt mit fester Oberfläche, erzeugt er Geräusche, wo Ruhe herrschen sollte. Allen Un­ kenrufen zum Trotz werden aber weltweit bereits Zehntausende dieser Lautspre­ chersysteme eingesetzt, primär bei Ausstellungen und für Werbezwecke. 0 dB t SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · märz 2010 & Computer Technik TECHNIK & Computer Wussten Sie schon? das sich in Phase, Frequenz und Verzögerung unterscheidet, was den abgestrahlten Schallkegel auf 1 bis 20 Grad Öffnungswinkel bündelt. Der extrem laute und schrille Ton löst auf kurze Distanz Schmerzen aus. Das System eignet sich aber auch, um in lauter Umgebung Alarmsignale zu senden. r Menschen hören im Bereich von 20 bis 20 000 Hertz. Hunde nehmen noch 40 000 Hertz wahr, Mäuse bis zu 90 000 Hertz und Fledermäuse, Tümmler sowie Belugawale bis zu 100 000 Hertz und mehr. Ultraschalllautsprecher strahlen Fre­ quenzen zwischen 20 und 100 Kilohertz ab. r Forscher haben Freiwillige Ultraschall bis zu 200 Kilohertz ausgesetzt; einige Probanden gaben an, Geräusche gehört zu ha­ ben. Vermutlich hatten ihre Schädelknochen die Schwingungen verzerrt, so dass sie die Nervenzellen in der Innenohrschnecke erregen konnten. Illustrationen: 5 W Infographics; Foto: Holosonics Inc. r Lagert man einen Richtlautsprecher drehbar und lässt den Schallstrahl über die Decke wandern, wird er reflektiert und der Zuhörer gewinnt den Eindruck eines beweglichen Objekts. So ließe sich beispielsweise in einem Naturkundemuseum der Ein­ druck eines vorbeifliegenden, zwitschernden Vogels erzeugen. r Als Long Range Acoustic Device (LRAD) oder Schallkano­ne bezeichnet man Richtlautsprecher, die ursprünglich vom ame­ rikanischen Militär als Waffe gegen Aufständische und Piraten konzipiert wurden. Das Braunschweiger Unternehmen Pan Acoustics will in diesem Jahr mit »Jericho-64« auf dem Markt sein. LRAD basiert nicht auf Differenztönen, sondern verwendet ein Raster aus vielen – hier 64 – kleinen, hocheffizienten Schall­ wandlern, die bei hörbaren Frequenzen, aber mit einem Schall­ druck von gut 150 Dezibel (dB) in einem Meter Abstand arbeiten. Jeder Wandler wird mit einem etwas anderen Signal angesteuert, modulierter Ultraschall In der öffentlichen Bibliothek von New York können einzelne Besucher die Audiosignale eines Lautsprechers hören, sofern sie sich in seinem engen Abstrahlbereich befinden. hörbarer Schall Spektrum der Wissenschaft / Meganim überlagerte Welle mit sehr hohem Schalldruck und nichtlinearem E ekt Lautstärke 140 dB 70 dB 0 dB t mittlerer Luftdruck hoch tief hoch SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · märz 2010 Wenn sich zwei Ultraschallwellen ähnlicher Frequenz überlagern, entsteht eine amplitudenmodulierte Differenzschwingung (links). Ab Lautstärken von 125 Dezibel (dB) kommen nichtlineare Effekte zum Tragen, der mittlere Luftdruck variiert – es entsteht ein hörbarer Ton (rechts). 87 Biotechnologie Organersatz aus der Retorte Von Ali Khademhosseini, Joseph P. Vacanti und Robert Langer H In Kürze r Das letzte Jahrzehnt brachte die Forschung zur Zucht von lebendem Ge­ webeersatz ein großes Stück voran. Mit einigen eher einfach strukturierten Konstrukten werden schon Menschen behandelt. r Die Fortschritte beruhen wesentlich einerseits auf einem tieferen Verständnis der Zellbiologie, andererseits auf immer besser geeigneten, ausgeklügelten Gerüstmaterialien für die Gewebezucht. r Eine Anzahl weiterer Produkte steht vor der Marktreife. Doch auch die Prüfverfahren für die Zulassung erfordern Zeit. 88 irngespinste!, dachten viele, als zwei von uns (Langer und Vacanti) vor zehn Jahren an dieser Stelle über die Zukunft der Gewebezucht, englisch tissue engineering, schrieben. Wir diskutierten Möglichkeiten, lebende Gewebe mittels Zellen und nichtlebenden Materialien nach technischen Prinzipien für Transplantationen zu konstruieren (siehe SdW-Spezial 4/1999, S. 26). Nach wie vor besteht in der Medizin dringender Bedarf, Organe zu ersetzen, zu reparieren oder ihre Leistung zu verbessern. Allein in den USA verdanken fast 50 Millionen Menschen ihr Leben einer Organersatztherapie im weitesten Sinn. In den Industrienationen dürfte etwa jedem fünften über 65-Jährigen irgendwann solch eine Behandlung zugutekommen. Die heutigen Methoden von Organersatz, ob eine Transplantation oder die Blutwäsche für Nierenkranke, retten zwar Leben. Aber solche Maßnahmen sind keineswegs eine ide­ ale Lösung und belasten die Patienten stark. Viel besser, weil nebenwirkungsärmer, würden sich auf Betroffene zugeschnittene, auch immunologisch individuell angepasste Bioge­ webe eignen. Ein weiterer Vorteil von Tissue Engineering: Künstlich hergestellte lebende »Organe auf Mikrochips« wären geeignet, um etwa die Giftigkeit neuer medikamentöser Wirkstoffe auszutesten. Mancherlei Zuchtgewebe stehen schon zur Verfügung. Sehr vielen Menschen wurde mit Haut- oder Knorpelersatz geholfen. In klini­ schen Tests werden Gewebe unter anderem für die Harnblase, Bronchien, Blutgefäße und Augenhornhaut erprobt. Die größte Herausforderung ist jedoch, funktionstüchtige kom- plette Organe herzustellen. Immerhin bringt die Forschung zur Konstruk­tion komplexerer Gewebe bereits viel versprechende Ergebnisse. Obwohl noch manche Hürden bleiben: Der Ansatz ist inzwischen den Kinderschuhen entwachsen. Künstlich erzeugte Gewebe für medizinische Zwecke gehören nicht mehr ins Reich der Fantasie. Die Fortschritte in den letzten Jahren verdanken wir insbesondere Erkenntnissen darüber, wie Gewebe natürlicherweise entstehen, etwa beim Embryo oder bei einer Wundheilung. Schon wegen der verbesserten chemischen, biologischen und mechanischen Eigenschaften der eingesetzten Materialien wurden die Methoden des Gewebeaufbaus immer raffinierter. Hürde inneres Adersystem Zu den ersten verfügbaren solchen Kunstprodukten, die am Menschen ausgetestet wurden, gehörten Haut und Knorpel. Der Grund: Sie erfordern relativ wenig Blutgefäße im Inneren. Die meisten anderen Gewebe sind dagegen auf ein dichtes inneres Adernetz angewiesen, damit jede einzelne Zelle nah genug an einer Blutkapillare liegt, um mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt zu werden. Bis heute begrenzt dieser Faktor die Größe der gezüchteten Strukturen. Darum arbeiten viele Forscher an der Konstruktion von Blutgefäßen, die sie in die Zuchtgewebe integrieren können. Jedes Gewebe von mehr als ein paar hundert Mikrometern Dicke benötigt ein inneres Adersystem. In den letzten Jahren entstanden etliche neue Verfahren, um Blutgefäße außerund innerhalb von Geweben zu züchten. Hilfreich war in vielen Fällen, dass die Forscher die Bedürfnisse und Umweltansprüche der so genannten Endothelzellen heute besser verstehen. Aus solchen Zellen bestehen zum SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 aus: Borenstein, Weinberg, Orrick, Sundback, Kaazempur-Mofrad und Vacanti, »Microfabrication of three-diMensional engineered scaffolds«, in: TISSUE ENGINEERING, Bd. 13, Nr. 8, 2007 Im Labor konstruierte lebende Strukturen bewähren sich als Implantat umso besser, je genauer die Bioingenieure Details der Natur nachahmen. Pioniere­des Gewebedesigns erörtern wichtige Fortschritte der letzten Jahre. Technik & Computer Eine Membran mit winzigen Poren trennt eine Schicht Leberzellen von künstlich hergestellten, sehr feinen »Blutgefäßen«. Neue Materialien und Technologien machen solche Vorrichtungen möglich. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 89 Biotechnologie Vom natürlichen Vorbild lernen Die Funktionsweise von Organen hängt eng mit ihrem inneren Aufbau zusammen. Oft arbeiten in ihren Geweben verschiedene Zellsorten streng aufeinander abgestimmt. Um die komplexen Strukturen und Funktionen nachbilden zu können, benötigen Bioingenieure möglichst genaue Kenntnisse – bis hin zur molekularen Ebene – darüber, wie die Organe ausgebildet werden und leistungsfähig bleiben. Leber Zu den wichtigsten Aufgaben der Leber, dem Zentralorgan des Stoffwechsels, gehören Filter­ funktionen. Dabei verwerten die Leberzellen Nährstoffe und bauen Gifte ab. Die Leber besteht aus stark durchblutetem, schwammartigem Gewebe. Dieses setzt sich aus unzähligen gut millimetergroßen Läppchen (Lobuli) zusammen, die von einem sehr feinen Gefäßnetz durchzogen sind. Im Querschnitt sind sie wabenförmig angeordnet. Zwischen den Lobuli liegen Triaden aus jeweils einem feinen Gallengang (für in der Leber produzierte Verdauungssekrete), einer Sauerstoff zuführenden Arterie und einer Pfortadervene, die Nährstoffe aus dem Darm mitbringt. In der Mitte jedes Läppchens liegt ein abführendes Gefäß, eine so genannte Lebervene – für Produkte, die mit dem Blut in den übrigen Körper gelangen. Das Blut aus Leberarterie und Pfortader durchströmt die Zellreihen der Leberläppchen in erweiterten Kapillaren aus Endothelzellen (so genannten Sinusoiden) von außen nach innen. Dieses kompakte System aus vielen gleichen Einheiten vermag die gro­ ßen Blutmengen zu bewältigen, welche die Leber immerfort umsetzen muss. Lebervene Leberläppchen (Lobulus) Leber Gefäßtriade Sinusoid Arterie Pfortaderast Gallengang Leberzellen Jen Christiansen Photo Researchers / Innerspace Imaging Herzmuskel Das Herz fungiert vor allem als hochleistungsfähige Muskelpumpe, die das Blut über die Arterien zu den Organen und Geweben treibt. Der Herzmuskel besteht aus langen, faserartigen Muskelzellen, die in Kollagenhüllen eingebettet und von Blutgefäßen umsponnen sind (links). Das Kollagen verbindet zudem die Enden der Faserbündel und leitet kontraktionsauslösende elektrische Reize. Form und Anordnung der Muskelzellen bestimmen ganz entscheidend die elektrischen und mechanischen Eigenschaften des Herzgewebes. einen die feinen Blutkapillaren; zum anderen sind größere Adern mit Endothelzellen ausgekleidet. Des Weiteren gelingt es immer besser, aus Kunstmaterialien winzigste Struktu­ ren zu formen. Zum Beispiel kann man Endothelzellen auf ein Kultursubstrat mit ultrafeinen Furchen aufbringen, die tausendmal dünner sind als ein Menschenhaar. Die Zellen erzeugen dann ein Netzwerk kapillarähnlicher Röhrchen (Kasten S. 93, oben). Die Furchen imitieren die Textur natürlicher Gewebe – ein 90 wichtiger Umgebungsreiz –, woran sich neu wachsende Blutgefäße anlagern. Um Adernetze zu gewinnen, nutzen Ge­ webeingenieure auch Techniken der Mikrochip­ fabrikation. Ein Beispiel: Vacanti und Jeffrey T. Borenstein vom Draper Laboratory in Cambridge (Massachusetts) erzeugten in biologisch abbaubaren Polymeren winzigste Kanälchen, die das Kapillarnetz von Geweben nachahmen. In diesen feinen Röhrchen lassen sich dann Endothelzellen kultivieren und dazu anregen, darin Blutgefäße auszubilden. Gleichzeitig schirSPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Technik & Computer SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Zellen sterben an Unterversorgung, denn es dauert einige Zeit, bis neue körpereigene Blutgefäße in die Struktur einwachsen. Wahrscheinlich müssen große Gewebeimplantate deswegen von vornherein ein Gefäßsystem enthalten. Das ließe sich mit Faktoren für ein zusätzliches Adernwachstum kombinieren, die kontrolliert freigegeben werden. Zudem kommt es natürlich darauf an, dass die gezüchteten Gefäße im Implantat mit denen des Empfängers Verbindung aufnehmen. Wenn die Forscher genauer verstünden, welche Signalmuster von beiden Seiten hierbei mitwirken müssen, so könnten sie das Zusammenwachsen unterstützen. Mehr Kenntnisse über die Kommunikation von Zellen untereinander und mit ihrer sonstigen Umwelt wären ohnehin für Gewebekonstrukteure wünschenswert – etwa, um die geeignetsten biologischen Materialien auszuwählen. Was die Medizin heute schon kann Genzyme Corporation Eine Reihe von Produkten von nicht so komplexer Machart sind bereits im Einsatz oder stehen vor der Marktreife. Hier einige Beispiele: Haut Epicel, als dauerhafter Er­satz der Oberhaut, wird aus Hautzellen von Patien­ten gezüchtet. Es soll bei Verbrennungen eingesetzt werden. Ideal sind Zellen des Patienten Knorpel Carticel, einer der ersten Behandlungsansätze auf Zellbasis auf dem Markt zur Reparatur von Knorpeldefek­ ten. Mit Wachstumsfaktoren kultivierte Knorpelzellen des Patienten werden als Suspension ins Gelenk injiziert. Genzyme Corporation In den meisten Fällen würde man das Implantat idealerweise mit Zellen des Patienten herstellen, weil es sich dann am besten mit seinem Immunsystem vertrüge. Zudem wäre so sicherlich eine Genehmigung der Maßnahme leichter zu erhalten. Allerdings lassen sich normale – ausdifferenzierte – Körperzellen nur sehr begrenzt im Labor vermehren. Bereitwilli­ ger teilen sich so genann­te adulte (nicht mehr embryonale) Stammzellen. Sie finden sich in vielen Geweben und können je nach Herkunft zu verschiedenen für das Herkunfts­ gewebe typischen Zellsorten ausreifen. Man kann sie etwa aus Blut, Knochen, Muskulatur, Blut­gefäßen, Haut, Haarwurzeln, Darm, Gehirn oder Leber isolieren. Solche adulten Stammzellen sind allerdings schwer von den normalen Gewebezellen zu unterscheiden. Die Forscher orientieren sich an bestimmten Oberflächenproteinen, also an molekularen Markierungen. Für das Gewebedesign wäre es hilfreich, noch mehr solche Oberflächenmarker zu finden. Glücklicherweise gab es auf dem Feld in den letzten Jahren ein paar gute Fortschritte. Insbesondere entstanden neue Methoden, um adulte Stammzellen zu isolieren, sie zur Vermehrung anzuregen und sie dazu zu bringen, sich im Labor in verschiedene Zell- und Gewebetypen auszudifferenzieren. So genannte mesenchymale Stammzellen reagieren auf mechanische Umgebungsreize, wie Christopher Chen und Dennis Discher von der University of Pennsylvania in Philadelphia zeigten. Gewöhnlich gewinnt man solche Stammzellen aus Muskel-, Knochenoder Fettgewebe. Das gezüchtete Gewebe wird zu der Sorte Zellen, die in ihrer Festig- Blutgefäße Mit frdl. Gen. von Jack Harvey, Pervasis Therapeutics, Inc. men diese Zellen das Gerüstmaterial gegen das Blut ab, das die Polymere sonst zu schnell zerstören würde. In einem anderen Ansatz trennt eine Filtermembran die Blutkanälchen von den Zellen für die Organfunktion, die im Kunstgewebe eingebettet sind (Bilder S. 89 und S. 93). Dem gleichen Zweck können Hydrogele die­nen. Sie trennen Blut und Funktionszellen voneinander, erlauben aber den Austausch wichtiger Stoffe. Die gelatineartigen Materia­ lien bestehen aus wasserhaltigen Polymernetzen. In ihren chemischen Eigenschaften ähneln Hydrogele der natürlichen Stützsubstanz (Matrix) um die Zellen in Geweben. Die funktionstragenden Zellen lassen sich darin einbetten, und Kanälchen in der Matrix werden mit Endothelzellen ausgekleidet – eine primitive Gefäßversorgung (Bild S. 93 unten). Die Zucht von größeren Blutgefäßen gelang in den Labors von Laura Niklason von der Yale University in New Haven (Connecticut) und von Langer in folgender Weise: Die Forscher versetzten Gerüststrukturen mit glatten Muskel- und mit Endothelzellen und hielten sie in einem Bioreaktor in einem pulsierenden Flüssigkeitsstrom. Das sollte den Blutfluss im Körper nachahmen. Die entstandenen Ersatzarterien erweisen sich nach der Transplantation auf Tiere als mechanisch robust und funktionstauglich. Solche Adern ließen sich in größere Gewebekonstrukte einbauen oder womöglich sogar als Bypässe bei Gefäßverengung verwenden. Zwar bedeutet die erfolgreiche Zucht feiner Kapillaren und größerer Gefäße im Labor einen Durchbruch. Allerdings überlebt ein außerhalb des Körpers konstruiertes Gewebeimplantat nur dann, wenn es schnell Kontakt zu Blutgefäßen des Empfängers findet. Den Körper des Patienten seinerseits zur raschen Gefäßneubildung anzuregen ist daher essenziell. Einen Weg zeigte David Mooney von der Harvard University in Cambridge auf: Polymerkügelchen oder das Matrixmaterial setzen kontrolliert Wachstumsfaktoren frei; diese treiben die Bildung von Blutgefäßen an, die in das implantierte Gewebe einwachsen. Eine Variante dieses Prinzips erprobt die Biotechnologiefirma Pervasis Therapeutics (an der Langer und Vacanti beteiligt sind) bereits in fortgeschrittenen klinischen Studien bei Gefäßverletzungen. Am betroffenen Ort wird ein dreidimensionales Gerüst mit glatten Muskelzellen und Endothelzellen implantiert. Das Gerüst gibt wachstumsstimulierende Sig­ nale ab, die eine natürliche Reparatur fördern (siehe Bild rechts unten). Die Bioingenieure haben aber immer noch Schwierigkeiten, taugliche Gefäßtransplantate und durchblutete Gewebe von einiger Größe zu konstruieren. Viele der übertragenen Vascugel wird aus Endothelzellen erzeugt. Mit den Flicken werden verletzte Blutgefäße abgedeckt. Die gesunden Zellen des Präparats liefern den Zellen im geschädig­ ten Gefäß Signale, die zur Regeneration anregen und Entzündungs­ reaktionen sowie Narbenbildung hemmen. 91 aus: Engelmayr Jr, Cheng, Bettinger, BorEnstein, Langer und Freed, »Accordion-like honeycombs for tissue engineering of cardiac anisotropy”, in: NATURE MATERIALS, Bd. 7, 2008; Nachdruck genehmigt von Macmillan Publishers Ltd. Biotechnologie Ein Menschenherz muss rund 300 Millionen Mal schlagen und darf nie ermüden. Forscher am MIT ersannen ein Gerüst (blau) zur Anzucht von Herzmuskelzellen (grün, hier von Ratten), das deren Kontraktionsfähigkeit steigern hilft. Es besteht aus einem speziellen Gummi, in das mit einem Laser Waben geschnitten wurden, und lässt sich wie ein Akkordeon dehnen und stauchen. 92 keit der des Kultursubstrats am ehesten ähneln. Andere Forscher erkannten einen Einfluss chemischer Signale von Substrat und Umgebung darauf, zu welchem Gewebetyp adulte Stammzellen sich ausdifferenzieren. Uneins sind die Experten aber noch darin, ob sie Zelltypen außerhalb von deren eigener Gewebe­familie hervorbringen können, ob also etwa eine mesenchymale Stammzelle Leberzellen zu produzieren vermag. Anders als die adulten lassen sich so genannte embryonale Stammzellen nicht nur leicht vermehren, sie können auch sämtliche Zellsorten hervorbringen. Langer und der Arbeitsgruppe von Shulamit Levenberg vom Technion-Israel Institute of Technology in Haifa gelang die Differenzierung von gewünschten Gewebetypen sogar auf einem synthetischen Trägergerüst. Demnach müsste es möglich sein, mit embryonalen Stammzellen auf einer Vorlage direkt ein dreidimensionales Gewebe zu erzeugen. Allerdings lässt die Handhabung embryonaler Stammzellen noch zu wünschen übrig. Bisher ist es schwierig, ihnen eine einheitliche Richtung vorzugeben, in die sie sich ausdifferenzieren sollen. In der Natur geschieht das durch recht komplexe Einflüsse. Um diese mög­lichst nachzuahmen, erproben die Forscher jetzt verschiedenste Kombinationen von Matrixmaterialien und Signalsubstanzen. Gleichzeitig suchen sie unter zahlreichen kleinen Molekülen und diversen Signalproteinen nach Kontrollfaktoren für die Stammzelleigen­schaf­ ten: Die Zellen sollen zwar differenzierte Nach­kommen hervorbringen, selbst aber undifferenziert bleiben, damit sie später neuen Bedarf decken können. Vielleicht lassen sich mit solchem Wissen auch Zellen produzieren, die nur die günstigen, nicht aber die uner- wünschten Eigenschaften von embryonalen Stammzellen aufweisen. Leider können die Wissenschaftler immer noch nicht genau voraussagen, wie sich transplantierte Stammzellen im Patienten verhalten werden. Beispielweise besteht die Gefahr, dass undifferenzierte embryonale Stammzellen Tumoren bilden. Falls nicht sämtliche übertragenen Zellen vor der Implantation ein Stück weit ausdifferenziert sind, stellt das somit ein Krebsrisiko dar. Überdies müssen die Forscher ethischen Bedenken Rechnung tragen, aus menschli­ chen Embryonen Stammzellen zu gewinnen. Sie verfolgen mittlerweile Ansätze, ähnlich geartete Zellen aus nichtembryonalen Geweben zu erzeugen. Damit kamen sie in den letzten Jahren ein gutes Stück weiter. Es gelingt bereits, zum Beispiel Hautzellen in einen früheren, weniger differenzierten Zustand zurückzuprogrammieren. Für das Gewebedesign wären solche so genannten induzierten pluripotenten Stammzellen eine begrüßenswerte, hochinteressante Alternative. Rückwege zu Stammzellen Im Jahr 2007 konnten Shinya Yamanaka, damals an der Kyoto University, und James A. Thomson von der University of Wisconsin in Madison erstmals reife Zellen in den Zustand pluripotener Stammzellen zurückverwandeln, indem sie einige genetische Signalwege reaktivierten, die für solche Stammzellen offenbar vonnöten sind. Damals gelang das mit nur vier eingebrachten Regulatorgenen. Später vermochten Forscher die Anzahl der aktivierten Erbfaktoren sogar immer weiter zu reduzieren. Zum Einschleusen der Gene in die Zellen dienten zunächst Viren. So erzeugte Implantate für Menschen bergen aber Risiken. Umso besser, dass die Rückprogrammierung des Zellgenoms inzwischen auch auf andere Weise gelingt, selbst ohne Genübertragung und durch Ansprache eines einzigen Gens. Angesichts der raschen Entwicklungen auf diesem Forschungsfeld sind die Bioingenieure zuversichtlich, schon bald Ersatzgewebe aus umprogrammierten patienteneigenen Zellen herstellen zu können. Das wäre dafür das ideale Ausgangsmaterial. Wenn man nun die passenden Zellen gewonnen hat – wie entsteht daraus im Labor ein funktionsfähiges Gewebe? Noch vor zehn Jahren glaubten die Wissenschaftler, die verschiedenen reifen Zellen wüssten praktisch von allein, wie sie miteinander zum korrekten Gewebetyp – dem ihrer Herkunft – zusammenfinden. Bis zu einem gewissen Grad funktioniert das tatsächlich. Doch wird mittlerweile immer klarer, welch komplexe SignalSPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Technik & Computer muster zwischen ihnen sowie im Austausch mit der Umgebung auftreten, wenn sich Organe und Gewebe ausbilden beziehungsweise später, wenn die reifen Strukturen arbeiten. Wichtig sind zudem offenbar klare räumliche Vorgaben, sozusagen ein Maßrahmen. Ein Ersatzgewebe sollte die gleichen spe­ zifischen Aufgaben erfüllen können wie sein natürliches Vorbild. Nach aller Erfahrung ­gelingt das am besten durch möglichst genaues Nachahmen der betreffenden biologischen Eigenschaften. In komplexeren Organen arbeiten verschiedene Zelltypen zusammen. So gehören zu den Funktionen der Leber unter anderem Entgiftung und Nährstoffverwertung. Soll ein Kunstprodukt die gewünschten Leistungen etwa eines Organs erbringen, kommt es folglich darauf an, auch die Mikroarchitektur des natürlichen Gewe- bes und die Lage der Zellen zueinander nachzubilden. Damit die Zellanordnung einer dreidimensionalen Struktur grob den natürlichen Verhältnissen entsprach, verwendeten Gewebe­ designer früher Gerüste aus unterschiedlichen Materialien. Mittlerweile gelingen zunehmend komplexere Zuchtgewebe. Selbst die Umgebungsbedingungen lassen sich immer genauer nachempfinden. Als Matrix kann beispielsweise ein »Gewebeskelett« dienen: Aus einem natürlichen Gewebe werden alle Zellen entfernt, so dass nur die Bindegewebsfasern übrig bleiben. In dieser Struktur wird mit frischen Zellen ein neues Gewebe herangezüchtet, das wieder einen Großteil der ursprünglichen Funktionen erbringt. Ein eindrucksvolles Beispiel: Zellfreie Gerüste von Nagetierherzen wurden mit Herzmuskel- und Endothelzellen Organersatz Rund 55 000 Menschen in Deutschland sind Dialysepatienten. Jährlich werden über 2000 Nieren transplantiert. Im letzten Jahr erhiel­ ten fast 400 Menschen ein fremdes Herz. Gut 1100 Patienten bekamen im Jahr 2008 ein Lebertransplantat. Blutgefäße konstruieren Außer auf chemische Signale reagieren Endothelzellen auf mechanische und strukturelle Reize. Hier dient eine gefurchte Oberfläche als Unterlage. Die Furchen sind 600 Nanometer tief und 1200 Nanometer breit. Das regt die Zellen an, sich umzuformen, zu wandern und sich zu teilen (➊). Nach sechs Tagen vermehren sie sich und richten sich entlang der Furchen aus (➋). So entsteht schließlich eine Art Kapillarnetz (➌). 2 1 und 4: Draper Laboratory 1 3 aus: Bettinger, Weinberg, Kulig, Vacanti, Wang, Borenstein und Langer, »Three-Dimensional Microfluidic Tissue-Engineering Scaffolds Using a Flexible Biodegradable Polymer«, in: Advanced Materials, Bd. 18, 2006 SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 4 2 1 3 Draper Laboratory aus: Khademhosseini, Langer, Borenstein und VacantI, »Microscale technologies for tissue engineering and biology«, in: PNAS, 21.02.2006, Bd. 103, Nr. 8 Oberflächenreize im Nanomaßstab sie mit Endothelzellen nachzubilden, orientieren sich Bioingenieure auch an fachfremden Technologien der Mikrofabrikation, wie etwa der Halbleiterindustrie. beide aus: Bettinger, Zhang, Gerecht, Borenstein und Langer, »Enhancement of In Vitro Capillary Tube Formation by Substrate Nanotopography«, in: ADVANCED MATERIALS, Bd. 20, 2008 Ohne stete Zufuhr von Sauerstoff und Nährstoffen sterben­Gewebe rasch ab. Jedes Konstrukt aus mehr als ein paar Zellschichten benötigt darum Blutgefäße. Um Eine künstliche Leber Die Schablone für ein Blutgefäßsystem wird in Silikon gefertigt (➊). Das dient als Vorlage für ein bioverträgliches Polymergerüst (➋). Dieses wird mit Endothelzellen bepflanzt, welche die Hohlräume auskleiden. In ähnlichen Gerüsten werden Leberzellen kultiviert (➌). Die Kunstleber enthält abwechselnd Lagen beider Konstrukte (➍), jeweils durch eine feinporige Membran getrennt – also abwechselnd eine Leberzell- und eine Blutkapillarschicht. Das Konstrukt soll die Wartezeit bis zu einer Lebertransplanta­tion überbrücken helfen. 93 Biotechnologie bepflanzt. Daraufhin entstanden tatsächlich Herzmuskelfasern sowie Gefäßstrukturen und schließlich wieder ein schlagendes Herz. Auch mit Druckverfahren lassen sich Zellen präzise anordnen. Modifizierte Tintenstrahldrucker verteilen Zellen oder Matrixmaterial so, dass Gewebe beziehungsweise Strukturen entstehen, auf denen Zellen wachsen. Ist die Schablone den natürlichen Verhältnissen nachempfunden, können sich die Zellen daran wunschgemäß orientieren. Eine andere Technologie aus dem Ingenieur­ wesen, das Elektrospinnen, eignet sich, um Gerüste mit einer Textur wie natürliche Gewebematrix zu produzieren. Hierbei werden sehr dünne Polymerfasern netzartig versponnen und ergeben räumliche Gebilde nach dem Organbedarf Mit schwer, irreparabel geschädigter Leber oder Lunge überleben viele Patienten höchstens einige Monate. Die für Tansplantationen verfügbaren Organe decken jedoch lange nicht den Bedarf. Vorbildgewebe. Die mechanischen und chemischen Eigenschaften des Materials lassen sich zudem bedarfsgerecht anpassen. Ähnliche Gerüste hat David Kaplan von der Tufts University in Bos­ton aus Seide hergestellt – »Spinnennetze« als Grundlage für Bänder und Knochengewebe. Hydrogele eignen sich ebenfalls gut, weil sie so angepasst werden können, dass sie die Zellen umhüllen, stützen und zugleich die Gewebefunktion verbessern. Denn ihre biologischen, chemischen und mechanischen Eigenschaften lassen sich recht einfach beeinflussen. Auch ein Hydrogel kann man mitsamt darin enthaltenen lebenden Zellen mit Druckverfahren ausbringen oder auf andere Weise nach Erfordernis verteilen und schichten. Einem von uns (Kha- Die Kunst der Gewebeingenieure Wenn Zellen Gewebe ausbilden, achten sie auf verschie­ denartige Signale und Reize. Auch funktionstüchtige Gewebe sind auf solche Umweltbedingungen angewie- sen. Mit raffinierten Verfahren und neuen Materialien gelingt es immer besser, wesentliche Komponenten der natürlichen Verhältnisse nachzuahmen. Fasergerüste durch Elektrospinnen 1 2 mit frdl. Gen. von Suwan Jayasinghe Aus ultradünnen Fasern von einigen Mikrooder Nanometern Durchmesser lassen sich – etwa aus Seide oder synthetischen Polymeren – netzartige Zellgerüste spinnen, die in manchem einer natürlichen extrazellulären Matrix ähneln. Eingebrachten Zellen bietet das viel Raum. Auch können sie damit Kontakte herstellen, und das Gerüst kann wachstumsfördernde Stoffe enthalten. Es lassen sich sogar Zellen (grüne Punkte) in die Fasern einbetten, um sie gleichmäßig zu verteilen. 3 4 alle aus: Du, Lo, Ali und Khademhosseini, »Directed assembly of cell-laden microgels for fabrication of 3D tissue constructs«, in: pnas, 15.07.2008, Bd. 105, Nr. 28 94 Bausteine aus Hydrogel Polymerhydrogele eignen sich, um Zellen einzubetten und in Blöcken weiterzuverarbeiten. Fest wird das Material durch UV-Bestrahlung. So lassen sich auch die Blöcke zur gewünschten Form zusammenschweißen. Im Beispiel links werden die Zellen in »Wasser liebendes« (hydrophiles) Material eingelassen und zu Blöcken verfestigt (➊). Diese werden in Öl aufgeschwemmt und geschüttelt, wodurch sie zueinander finden (➋). Die Aggregate werden ebenfalls durch UV-Licht verfes­tigt. Die Zellen (➌, grün) überleben die Behandlung. Die unteren Bilder (➍) zeigen, wie sich verschieden geformte Gelblöckchen, die unterschiedliche Zelltypen enthalten, von allein zu größeren Konstrukten zusammenlagern ließen. Das könn­te natürliche Gewebe­strukturen etwa von Sinusoiden in der Leber nachahmen. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Technik & Computer demhosseini) gelang es, zellhaltige Hydrogelbausteine – auch mit jeweils andersartigen Zellen – in verschiedensten zueinander passenden Formen herzustellen, die sich dann selbst zu größeren, komplexen Aggregaten zusammenlagern (Kasten links unten). In der Art ließe sich die natürliche Anordnung von Zellen etwa in der Leber nachbilden. Manche speziellen Hydrogele vernetzen sich unter UV-Licht und lassen sich damit in der gewünschten Form verfestigen. Kristi Anseth von der University of Colorado in Boulder und Jennifer Elisseeff von der Johns Hopkins University in Baltimore (Maryland) bauten auf die Weise Knorpel- und Knochengewebe nach. Auf die Signale kommt es an Zudem lässt sich das Material mit Stoffen versetzen, die das Wachstum des Gewebes oder die Zelldifferenzierung fördern. Nach Samuel Stupp von der Northwestern University (Illinois) werden neuronale Stammzellen in einem Gel zu Nervenzellen, sofern dieses bestimmte kleine Signalproteine für ihre Ausreifung enthält. Helen M. Blau von der Stanford University (Kalifornien) hat untersucht, wie sich individuelle Stammzellen mittels Hydrogelen erforschen und beeinflussen lassen, wenn dieses Medium Komponenten der natürlichen extrazellulären Matrix aufweist. Nicht zuletzt hilft Nanotechnologie, transplantierbare Zellschichten herzustellen. Teruo Okano von der Tokyo Women’s Medical University hat dafür spezielle Oberflächen entwickelt, die mit einem temperaturempfindlichen Polymer beschichtet sind. Dieses schwillt an, wenn die Temperatur von 37 auf 20 Grad sinkt. Darauf werden Zellen einschichtig kultiviert. Später wird die Temperatur abgesenkt, das Substrat verdickt sich und die gewachsene Zellschicht hebt sich ab. Die Zellen selbst haben zuvor genug Matrixmoleküle produziert, um zusammenzuhalten. Solche Schichten lassen sich nun stapeln oder rollen, so dass man daraus größere Gewebekonstrukte erzeugen kann. So groß die Fortschritte beim Tissue Engineering im Ganzen sind – es gibt immer noch manche Hindernisse. Zum Beispiel kennen wir bisher die natürlichen Konzentrationen und Kombinationen von Wachstumsfaktoren und extrazellulären Molekülen in den einzelnen Entwicklungsstadien der verschiedenen Gewebe oder auch bei deren Wundheilung nicht gut genug. Die Bioingenieure müssten die­se Prozesse im Detail noch besser verstehen, damit die Konstrukte sich mehr wie natürliche Organe und Gewebe verhalten. Mitunter suchen die Designer gern in anderen Forschungsgebieten neue Ideen. So interesSPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 sieren sie sich für Studien über Gen- und Proteininteraktionen in reifendem und regenerierendem Gewebe. Deren Ergebnisse, angewandt bei fortschrittlichen Zellkultursystemen, lassen uns das Zellverhalten unter künstlichen Bedingungen immer besser beherrschen. Zwar bleibt noch manches zu wünschen. Trotzdem ist die Gewebezucht im Labor kein reines Hirngespinst mehr. Einfachere Produkte sind schon im klinischen Einsatz. Bald dürften von den Technologien Millionen Patienten profitieren. Schon im Jahr 2008 lag der Umsatz mit gezüchteten Geweben nah an 1,5 Milliarden US-Dollar. Solche Zahlen sind angesichts der zunächst erlebten harten Rückschläge umso bemerkenswerter. Während zur Jahrtausendwende noch Optimismus herrschte und viel in das Feld investiert wurde, gingen nach der Internetkrise die Investitionen in neue Biotechnologiefirmen zurück. In den USA waren selbst Unternehmen, die für Gewebekonstrukte Zulassungen besaßen, gehalten, ihr Geschäftsmodell zu überdenken, und so manches Produkt kam verzögert auf den Markt. Naturgemäß sind die Zulassungs- und Prüfverfahren für solche Erzeugnisse zeitaufwändig und teuer. Sie enthalten lebende Zellen, biologisch aktive Wirkstoffe und nichtbiologische Materialien. Damals erschwerten fehlende finanzielle Zuschüsse die Durchführung umfangreicher klinischer Studien. Doch die Verzögerungen hatten eine positive Seite: Die Technologien konnten weiter reifen und die Geschäftsmodelle besser angepasst werden. Zulassungsverfahren werden schon dadurch erschwert, dass sich gleiche Zellen von verschiedenen Personen nicht immer gleich verhalten. Ebenso reagieren Empfänger manchmal auf das gleiche Produkt unterschiedlich. Solche Unwägbarkeiten erfordern weitere Forschung zur individuellen Variabilität, auch klinische Testreihen mit Gewebeimplantaten. Die hohen Kosten dafür müssen Geschäftsmodelle künftig einkalkulieren. Ungehindert all der Einschränkungen haben die Gewebekonstrukteure schon eine zweite Produktgeneration im Blick. Dabei wollen sie auf neue Einsichten zugreifen, die über die Ausbildung und Regeneration von natürlichen Strukturen vorliegen. Die angestrebten Konstrukte sollen sich mechanisch, chemisch und funktional enger als bisher möglich an das Vorbild anlehnen. Trotz der angespannten ökonomischen Lage erwarten wir, dass Ansätze aus der Nanotechnologie, Stammzellforschung, Systembiologie und dem Gewebedesign in naher Zukunft zusammenwachsen. Das sollte neue Ideen für hochentwickelte Ersatzorgane bringen, die so viele Menschen dringend benötigen. Ali Khademhosseini (oben) ist Assistenzprofessor an der HarvardMIT’s Division of Health Sciences and Technology und an der Harvard Medical School in Cambridge (Massachusetts). Er hat bei Langer promoviert. Joseph P. Vacanti (Mitte) ist Professor an der Harvard Medical School. Er hat unter anderem am Massachusetts General Hospital mehrere leitende Positio­ nen in der Chirurgie, Kinderchirurgie und Transplantationsmedizin inne. Robert Langer ist am MIT (Massachusetts Institute of Technology) Instituts­professor. Er gilt als meistzitierter Ingenieur. Zusammen mit Vacanti hat er das Tissue Engineering auf den Weg gebracht. Khademhosseini, A. et al.: Microscale Technologies for Tissue Engineering and Biology. In: Proceedings of the National Academy of Sciences USA 103(8), S. 2480 – 2487, 21. Februar 2006. Lysaght, M. J. et al.: Great Expectations: Private Sector Activity in Tissue Engineering, Regenerative Medicine, and Stem Cell Therapeutics. In: Tissue Engineering A 14(2), S. 305 – 315, Februar 2008. Mikos, A. G. et al.: Engineering Complex Tissues. In: Tissue Engineering 12(12), S. 3307 – 3339, Dezember 2006. Preti, R. A.: Bringing Safe and ­Effective Cell Therapies to the Bedside. In: Nature Biotechnology 23(7), S. 801 – 804, Juli 2005. Weitere Weblinks zu diesem Thema finden Sie unter www.spektrum.de/ artikel/1019954. 95 REZENSIONEN Ornithologie In ihrem Reich geht die Sonne nicht unter Jedes Jahr fliegt die nordeuropäische Küstenseeschwalbe vom Nord- zum Südpol und zurück – der spektakulärste unter vielen Rekorden zum Thema Vogelzug. A uch Schmetterlinge, Heuschrecken, Lachse, Meeresschildkröten, Fledermäuse, Lemminge und Antilopen legen in ihrem Leben große Entfernungen zurück. Doch das spektakuläre Naturschauspiel, das viele Milliarden ziehender Vögel rund um den Globus alljährlich aufführen, vermag auf besondere Weise zu faszinieren. Denn es liefert einige der aufwändigsten, spannendsten und gefährlichsten Szenarien zum Thema Tierwanderung. Ein internationales Expertenteam unter Federführung des britischen Ornithologen Jonathan Elphick hat die wichtigsten Erkenntnisse, die faszinierendsten Fallbeispiele und die größten Rätsel des Vogelzugs in einem Bildatlas zusammengefasst. Der Wanderalbatros Diomedea exulans – hier ein balzendes Paar – nutzt seine großen Flügel (mehr als 3,5 Meter Spannweite) fast ausschließlich zum Segelflug. 98 Viele Jahrhunderte lang erklärten sich die Menschen das herbstliche Verschwinden mancher Vogelarten und ihre Wiederkehr im Frühjahr mit den abenteuerlichsten Vorstellungen. So glaubten sie allen Ernstes, unsere Störche würden gemeinsam mit den Fröschen zum Winterschlaf im Moor versinken. Nach und nach konnte die Wissenschaft mit solchen Legenden aufräumen; revolutionäre Fortschritte gelangen ihr jedoch erst vor rund 100 Jahren durch die Beringung der Vögel. Inzwischen verfolgt man den Weg einzelner Tiere mit Hilfe von Minisendern und Satelliten. Und manchmal genügt bereits die chemische Analyse einer einzigen Feder, um Genaueres über die Winterquartiere und Durchzugsgebiete der zugehörigen Art zu erfahren. Heute wissen wir: Die Hälfte aller Vogelarten sind Zugvögel – und jede Wanderung ist einzigartig. Dieser Bildatlas listet in seinem Anhang die Zugrouten von über 500 Arten auf. Ausführlich besprochen werden allerdings im Hauptteil nur etwas mehr als 100 von ihnen – insofern nämlich ihr Zugverhalten exemplarischen Charakter hat oder be­ merkenswerte Einzelheiten aufweist. Die Darstellung stützt sich auf eine Vielzahl größerer und kleinerer Textblöcke, ergänzt durch rund 300 farbige Bilder, Karten und Diagramme. Beinahe ein Viertel des Bands dient der einführenden Klärung grundlegender Fragen: Wie haben sich die komplexen Zugmus­ ter, die wir heute beobachten, überhaupt entwickelt? Wie gelingt es Vögeln, Jahr für Jahr solch gewaltige Entfernungen zurückzulegen, ohne dass sie sich verirren oder an Erschöpfung zu Grunde gehen? Woher kennen sie die Richtung ihres Flugs, und wie können sie dessen Dauer einschätzen? Die heutigen Zugmuster sind maßgeblich vom Vordringen und Zurückweichen eiszeitlicher Gletscher, aber auch von der Kontinentalverschiebung beeinflusst worden. Wie viel Zeit solche Anpassungsprozesse in Anspruch nehmen, zeigt etwa der Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe), dessen Zugroute sich pro Jahr um rund einen Kilometer verschiebt – und dies seit fast 10 000 Jahren. Die enormen Strecken bewältigen die Vögel durch ein fein abgestimmtes Gefüge morphologischer und physiologischer Anpassungen einschließlich des Verhaltens. Dies betrifft vor allem Flugtechniken und Energiebilanzen, aber auch die Fähigkeit, sich auf tages- und jahreszeitliche Rhythmen einzustellen, ohne zugleich die Flexibilität gegenüber der aktuellen Situation zu verlieren. Das zentrale Thema des Vogelzugs lautet jedoch Orientierung und Navigation. Und so bietet die Erläuterung der Frage, woher denn nun Vögel eigentlich ihre Zugrichtung und Zugdauer kennen, besonders spannende Einblicke in den aktuellen Stand der Forschung. Allein schon die Vorstellung, dass Vögel den magnetischen Nordpol höchstwahrscheinlich mit Hilfe von Magnetitkris­ tallen im Schnabel wahrnehmen können, vermag Laien wie Experten zum »Abheben« zu verführen. Auch wenn nun Magnet-, Sonnen- und Sternenkompass vor allem auf Grund genetischer Vorgaben funktionieren, so haben Vögel doch nicht einfach einen »Autopiloten« eingebaut. Ganz ohne »Handsteuerung« erreicht kein Vogel sein Ziel. Irgendetwas gibt es immer über Zugrouten, Zugbarrieren oder Rastplätze zu lernen. Die eigentlichen Highlights dieses Buchs bilden indes die überall eingestreuten Beschreibungen herausragender Zugleistun­ SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 gen. Hierzu gehören etwa die 3000 Kilo­ meter langen Nonstop-Flüge des Schilfrohrsängers (Acrocephalus schoenobaenus) und die Höhenflüge der Streifengans (Anser indicus), die den Himalaja in bis zu 9000 Meter Höhe überquert. Unerreichte Rekordhalterin aller Langstreckenzieher ist die nord­ europäische Küstenseeschwalbe (Sterna ­paradisea): Sie legt, zwischen arktischem Brutgebiet und antarktischem Winterquartier pendelnd, pro Jahr rund 40 000 Kilometer zurück. So werden manche der im Mai von skandinavischen Ornithologen beringten Vögel bereits im nachfolgenden Februar auf dem antarktischen Festland gesichtet. Kein anderes Lebewesen auf Erden erlebt mehr Tageslicht; denn an beiden Standquartieren geht während des Aufenthalts der Küstenseeschwalbe die Sonne nicht unter. Man erkennt unschwer, dass Großbritannien die Heimat der Autoren und die Vorgeschichte der Arktis ihr Lieblingsforschungsthema ist. Aber sie nehmen durchaus auch einen globalen Standpunkt ein und widmen sowohl den nordamerikanischen Zugvögeln als auch denen der Südhalbkugel eigenständige Kapitel. Der Wüstensteinschmätzer Oenante deserti bricht zu seinem Zug fast immer in der Abenddämmerung auf; er orientiert sich an der sinkenden Sonne westwärts und navigiert in der Nacht nach den Sternen. Wer nun nach allem, was er über Zugvögel erfahren hat, den Zug gern aus eigener Wahrnehmung erleben möchte, dem verrät das Buch die weltweit wichtigsten Orte (»Hotspots«), an denen sich Zugvögel in größerer Zahl beobachten lassen. Für Verdruss beim Lesen sorgt einzig die extrem kleine Schrift mancher ergänzender Textblöcke. Nicht jeder, der sich für Ornithologie interessiert, hat Augen wie ein Adler. Der übersichtliche thematische Aufbau, die elegant formulierten Texte, die verständlichen Grafiken und die betörend schönen Bilder machen diese so umfassende und zugleich so kompakte Darstellung zu einer der besten, die in den letzten Jahren zum überaus komplexen Thema »Vogelzug« erschienen sind. Reinhard Lassek Der Rezensent ist promovierter Biologe und arbeitet als freier Journalist in Celle. Musik und Hirnforschung Jeder hat Töne Christoph Drösser reißt die Sing- und Spielmuffel vom Konsumentensofa. S pielen Sie ein Instrument? Singen Sie im Chor? Nein? Macht nichts, Sie können morgen damit anfangen! Dass das unein­ geschränkt für uns alle gilt, unabhängig davon, ob wir uns bisher für ganz und gar unmusikalisch hielten, ist die zentrale Aussage des vorliegenden Buchs. Es will zum Dilettieren auf dem Instrument und mit der Stimme ermutigen und tritt die (vorwiegend hirnphysiologisch gestützte) Beweisführung an, dass (fast) jeder von uns die notwendigen Voraussetzungen dafür mitbringt – nicht anders als zum Sprechen auch. Dementsprechend wendet sich der Autor vorrangig an bislang passive Musikkonsumenten, die zum aktiven Musizieren ermuntert und mit passenden Argumenten gerüs­ tet werden sollen; Kenntnis der Notenschrift ist zur Lektüre nicht erforderlich. Aber auch für längst Überzeugte hält das Buch genug Neues und Interessantes bereit. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Christoph Drösser, Jahrgang 1958, studierte Mathematik und Philosophie in Bonn. Er ist Wissenschaftsredakteur bei der Wochenzeitung »Die Zeit«, wo er vor allem durch die Kolumne »Stimmt’s?« und als Entwickler des Magazins »ZEIT Wissen« auf sich aufmerksam machte. Im Jahr 2008 wurde ihm der Medienpreis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung verliehen. Musikalität ist nur eine Gabe der wenigen; eine späte Liebe zum Instrument ist von vornherein zum Scheitern verurteilt – so oder ähnlich lauten weit verbreitete Vorurteile. Sie zu entkräften hat der Autor sich zum Ziel gesetzt und argumentiert dabei auf allen Ebenen. Er referiert nicht nur neueste Ergebnisse der Hirnforschung, sondern führt auch aktuelle Theorien zum Verhältnis von Sprach- und Musikentwicklung sowohl in der Frühgeschichte der Menschheit als auch bei Babys und Kleinkindern an. Zudem gibt er dem Leser eine gut verständliche Jonathan Elphick (Hg.) Atlas des Vogelzugs Die Wanderung der Vögel auf unserer Erde Aus dem Englischen von Coralie Wink und Monika Niehaus. Haupt, Bern 2008. 176 Seiten, € 39,90 Einführung in grundlegende Phänomene der Akustik sowie in die erstaunlichen Fähigkeiten des menschlichen Gehörsinns, die es uns ermöglichen, aus einer einzigen Druckschwankung eine Vielzahl von Einzelklängen herauszufiltern. Ausgehend von der Beschreibung der einzelnen musikalischen Parameter wie Tonhöhe, Harmonie, Rhythmus, Takt und Klangfarbe gibt Drösser Beispiele für das, was sich als Grammatik der Musik beschreiben lässt: Warum erscheint uns eine musikalische Phrase logisch, eine andere aber nicht? Anders gefragt: Welche Musik »verstehen« wir? Entsprechende Studien zeigen, dass fast alle Befragten grobe grammatische Verstöße hören, auch wenn nur die wenigsten entsprechende Regeln formulieren können. Wir haben also ein umfangreiches musikalisches Wissen, welches das Zurechtfinden in der eigenen Lieblingsmusik weit übersteigt und trotzdem von den meisten nicht bewusst angewandt wird. Musikalisch ist bereits, wer zur differenzierten Klangverarbeitung und Interpretation fähig ist – und das sind nach dem hirnphysio­ logischen Befund wirklich fast alle Menschen – oder über die weit schwerer zu definierende ability to make sense of music, 99 REZENSIONEN vergleichbar dem akustischen und inhaltlichen Verständnis von Sprache, verfügt. Der Interpret eines Klavierkonzerts hat dem Hörer nicht unbedingt das Talent, wohl aber viele tausend Stunden Übung voraus. Die gut funktionierende Website www. hast-du-toene.net ergänzt das Buch mit Klangbeispielen und diversen Links (Amusie-Test, singende Gibbons …); hier können Interessenten einen ersten Eindruck gewinnen. Problematisch ist die Beschränkung des Autors auf die Jazz-, Rock- und Popmusik. Zwar lassen sich viele Phänomene daran genauso gut beschreiben; oft lässt sich Drösser aber zu vorschnellen Verallgemeinerungen und allzu pauschalen Aussagen über »die« abendländische Musik hinreißen. Etikettierungen wie »schräge Experimente der Zwölftöner« (die sich entgegen den Vorstellungen des Autors sehr viele Gedanken über die Fasslichkeit ihrer Musik gemacht haben) können mich genauso wenig begeistern wie sorglose Feststellungen (»das, was Musik ausmacht, [ist] das Gefühl«) oder mitunter geradezu banale Schlussfolgerun­ gen (»die Ergebnisse legen nahe, dass uns Musiker tatsächlich etwas sagen, wenn sie spielen«). Auch wenn Drösser kein musikwissenschaftliches Buch schreiben wollte – es wäre durchaus bereichernd gewesen, wenn unter den von ihm befragten »Musikforschern« nicht nur Neurophysiologen, Psychologen und Musikermediziner, sondern auch ein Musikwissenschaftler gewesen wäre. So hätten sich nicht zuletzt ein paar sachliche Fehler vermeiden lassen: Das einzige Notenbeispiel ist eine Kadenz, die jedem Tonsatzschüler rot angestrichen würde. Im Ganzen ist das Buch aber sehr überzeugend und kann mit vielen Vorurteilen aufräumen, die selbstkritische Gemüter möglicherweise bisher vom Musizieren abhielten. Dem im Klappentext formulierten Anspruch, zu erklären, »was Musik ist, woher sie kommt und wie sie funktioniert« und sogar »die Geheimnisse von Musik und Musikalität« zu lüften, kann es zwar nicht genügen – welches Buch könnte das schon? Mathematik Mathematische Appetithäppchen Holger Dambeck versäumt nicht, seine kleinen Leckereien mit etwas Realitätsbezug zu würzen. »S teigt Ihre Lebenserwartung, wenn Sie älter werden?« Dies ist nur eine der zahlreichen, auf den ersten Blick harmlos anmutenden Knobelaufgaben, die der Wissenschaftsjournalist Holger Dambeck dem Der energetisch günstigste Weg zum Gipfel eines kegelförmigen Bergs ist gerade für einen flachen und spiralförmig für einen steilen Berg. Beim Abstieg ist ein Zickzackweg zweckmäßig, da es schwierig ist, mit einem ungebrochenen Spiralweg einen vorgegebenen Punkt am Bergfuß zu treffen. 100 Leser zum kognitiven Verzehr vorlegt. Die Mischung dieser Grüße aus der Logikküche ist bunt: Einige sind leicht zu vernaschen, an anderen beißt man sich die Zähne aus. Zusammen mit Anekdoten und Zitaten aus der Geschichte der Mathematik hat Dambeck die Aufgaben zu appetitlichen Häppchen angerührt, die er teils neu verfasst, teils schon als »Numerator«-Kolumnen auf »Spiegel Online« veröffent­licht hat. Ob Geometrie, Graphentheorie, Logik, Wahrscheinlichkeits- oder Zahlentheorie – zu jedem Thema stellt der Autor einen handfesten Bezug zur Realität her. Dambeck bringt Licht in die Unterwelt der Zahlen, indem er zum Beispiel konzis darlegt, warum Primzahlen nicht nur für Mathe-Nerds, sondern auch für alle Bankkonto­inhaber von größter Bedeutung sind. Flugs kommt er von den allbekannten Sudokus zur Optimierung von U-Bahn-Fahrplänen – über die beiden gemeinsame Graphentheorie. Logarithmen sind für viele böhmische Dörfer; Aber Drösser belegt glaubhaft seine These von der Musikalität aller Menschen und preist darüber hinaus leidenschaftlich den sinnlichen Genuss des Musizierens, der den des passiven Hörens um ein Vielfaches übersteigt. Dank dem lockeren Stil, der übersichtlichen Gliederung und der Anreicherung mit persönlichen Anekdoten und einigen Kuriositäten liest sich das Buch leicht und vergnüglich; die einzelnen Abschnitte sind auch für sich verständlich. Obwohl professionelle »Klassikforscher« vielleicht über manches hinwegsehen müssen, ist »Hast du Töne?« sehr zu empfehlen. Almut Gatz Die Rezensentin hat in Freiburg Schulmusik, Mathematik und Musiktheorie studiert und unterrichtet seit 2009 Musiktheorie an den Hochschulen Freiburg und Karlsruhe. Christoph Drösser Hast Du Töne? Warum wir alle musikalisch sind Rowohlt, Reinbek 2009. 315 Seiten, € 19,90 dass aber sogar die mathematisch unbeleckten Munduruku aus dem Amazonaswald instinktiv logarithmisch denken, illustriert der Autor unter Heranziehung einer faszinierenden Studie. Überaus erhellend ist auch die anschauliche Erklärung des von Google verwandten Page-Rank-Verfahrens anhand eines Miniatur-Internets. Abgerundet wird das Ganze schließlich durch allerlei Rätselhaftes aus dem Kosmos der Kabbalistik. Dieses kleine Taschenbuch ist ein äußerst bekömmliches Stückchen Mathematik. Es lüftet so manchen Vorhang, hinter dem das Abstrakte an alltäglichen Problemen zum Vorschein kommt. Nur das etwas lieblose papierne Grau in Grau könnte das Lesevergnügen etwas trüben. Nach der Lektüre dieses Buchs werden die Laune merklich und die Lebenserwartung unmerklich gestiegen sein. Arim Shukri Der Rezensent ist Diplommathematiker und Lehrbuchautor. Er arbeitet als Dozent für Statistik an der Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation und als Datenanalytiker in Köln. Holger Dambeck Numerator Mathematik für jeden Goldmann, München 2009. 223 Seiten, € 7,95 SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Chemie Spielzeug für Chemiker Der neue Molekülbaukasten »Orbit« bietet Vielfalt und Exaktheit. A uf den ersten Blick sehen die zahlreichen bunten Plastikkleinteile aus wie aus dem Überraschungsei gepellt. Und schon fühlt man sich zur Konstruktion kleiner Molekülbauwerke angeregt. Das Basis­ set des Molekülbaukastens von Wiley-VCH bietet 160 Teile und wurde für den Schul­ unterricht und die Chemiegrundausbildung an den Hochschulen entwickelt, während das Profiset aus 460 Teilen besteht und Unterrichts- und Demonstrationszwecken dienen soll. Auf den zweiten Blick fällt auf, dass der Herausgeber mit viel Liebe zum Detail ge­ arbeitet hat. So gibt es drei verschiedene Varianten zur Darstellung von Doppelbindungen zwischen zwei Atomen und von vielen Atomsorten je nach Anzahl der möglichen Bindungspartner vier bis sechs verschiedene Modellbausteine mit den richtigen Bindungswinkeln. Damit man die verschiedenen Bindungslängen korrekt wiedergeben kann, liegen dem Basisset Verbindungsstäbchen in zwei, im Profiset in drei verschiedenen Längen bei. Dadurch – möglicherweise mit Zuschneiden – sind bereits mit dem Basisset Modelle der gängigsten Moleküle, wie einfache und zyklische Kohlenwasserstoffe, Aromaten, einfache anorganische Verbindungen und organische Verbindungen mit funktionellen Gruppen, im exakten Maßstab von 1 : 300 Millionen darzustellen. Das beigefügte, farbig gestaltete Booklet geht ausführlich auf die BerechAlle rezensierten Bücher können Sie in unserem Science-Shop bestellen direkt bei: www.science-shop.de per E-Mail: [email protected] telefonisch: 06221 9126-841 per Fax: 06221 9126-869 SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 nung und die Verwendung der verschiedenen Bauteile ein und zeigt übersichtliche und aussagekräftige Fotos verschiedener Molekülmodelle. Komplexverbindungen sowie größere biochemische Moleküle sind nur mit dem Profiset zu bauen. Nun gibt es ja Molekülmodelle zum Anschauen in Hülle und Fülle kostenfrei im Internet. Auch mit einfachen Rechnern kann man mit diesen Programmen Moleküle nach Belieben »bauen«, drehen und vermessen und gewinnt dadurch einen guten Überblick über die Bindungsverhältnisse. Aber sie können ein dreidimensionales Modell, das man wirklich – und nicht nur virtuell – bauen, anfassen, verändern und im Wortsinn »begreifen« kann, nicht ersetzen. Schon wegen des motivierenden Moments: Nicht nur Schülerinnen und Schüler lieben es, einfach mal draufloszubauen und dadurch die wildesten Modelle entstehen zu lassen. Für wen eignen sich diese speziellen Molekülbaukästen? Studierenden können sie eine nützliche Hilfestellung sein, da ihre Stärke in der großen Vielfalt und der Exaktheit liegt. Das Kohlenstoffatom liegt in fünf verschiedenen Versionen vor, für zwei bis sechs Bindungspartner; Stickstoffatome stehen zwei-, drei, vier- und fünfbindig zur Verfügung. Damit sind stereochemische Fragestellungen und Probleme detailgetreu zu veranschaulichen. Das Basisset stößt allerdings bald an seine Grenzen, weil auf Grund der großen Vielfalt von jedem einzelnen Teil nur relativ wenige Exemplare zur Verfügung stehen. Der Einsatz der Orbit-Baukästen in den Schule stellt sich deutlich problematischer dar. Die große Vielfalt und Flexibilität ist hier eher von Nachteil. Schülerinnen und Schülern fällt es schwer, die fünf Varianten des Kohlenstoffatoms, die alle durch schwarze Kugeln dargestellt sind, auseinanderzuhalten. Warum muss ein Wasserstoffatom ein Loch haben, andere Atome jedoch nicht? Solche Verwirrungen lenken von der eigentlichen Fragestellung ab. Didaktische Reduktion ist hier vonnöten. Konkurrenzprodukte bieten Kohlenstoffatommodelle mit ausschließlich vier Bindungsmöglichkeiten an, entsprechend der Anzahl seiner Außenelektronen. Mehrfachbindungen werden dann durch gekrümmte Einfachbindungen dargestellt. Das ist für Schülerinnen und Schüler viel leichter zu begreifen. Auch das System »Orbit« bietet flexible Bindungen für den beschriebenen Zweck an, aber relativ wenige, die auch noch der hohen Beanspruchung durch Schülerhände nicht lange standhalten. Auf dieses Manko hat der Hersteller reagiert und den Baukästen einige dickwandige Verbindungsstücke beigelegt. Diese gibt es dann aber nur in einer Einheitslänge, und sie sind schwer zu benutzen. Aber das größte Problem für den Einsatz im Schulunterricht: Die Molekülbauteile sind einfach zu klein. Als Demonstrationsobjekte im Frontalunterricht sind sie kaum sichtbar, in Gruppenarbeit drohen schnellster Materialschwund und schlechte Handhabbarkeit. Lediglich sehr große Moleküle wie ATP oder Phenolphthalein lassen sich durch die kleinen Bausteine übersichtlicher und auch stabiler darstellen als durch größere Molekülbaukästen der Konkurrenz. Hingegen eignen sich die Orbit-Baukästen im Rahmen von Zusatzaufgaben für besonders interessierte oder motivierte Schülerinnen und Schüler, in Arbeitsgemeinschaften oder im binnendif­ ferenzierten Unterricht. Hier ist die Vielfalt wieder mehr Stärke als Hindernis. In Zeiten chronisch knapper Kassen kommunaler Schulträger ist dieses relativ preiswerte Produkt zweifellos besser als gar kein Molekülbaukasten. Aber die etablierten »Minnit«-Baukästen sind den Orbit-Modellen sehr ähnlich und noch billiger. Auf lange Sicht wird sich für Schulen die Anschaffung eines etwas teureren Baukastensystems wie »Molymod« lohnen, das nicht nur didaktische Vorteile bringt, sondern auch weitaus haltbarer ist. Im Hochschulbereich und für den privaten Gebrauch kann der Orbit-Molekülbaukasten aber durchaus seinen festen Platz finden. Elke Bieler Die Rezensentin ist Fachleiterin für Chemie, Naturwissenschaft und Technik und Naturphänomene an der Elisabeth-von-Thadden-Schule in Heidelberg. Orbit Molekülbaukasten Chemie Basis Set mit 160 Teilen, Profi Set mit 460 Teilen Wiley-VCH, Weinheim 2009. 20,– € (Basis Set), 40,– € (Profi Set) 101 Wissenschaft & Karriere »Damit der Fan seine Schokolade wieder­ erkennt « Kraft Foods Deutschland Günther Fischer, geboren 1958, hat von 1978 bis 1983 Lebensmitteltechnologie an der Universität in Weihenstephan in der Nähe von München studiert. Nach einem halben Jahr als wissenschaftlicher Assis­ tent an der Universität sammelte er erste Berufserfahrungen in einem Chemieunter­ nehmen, das Zusatzstoffe für die Milch­ industrie herstellt. Dabei war er für Produktentwicklung und anwendungstech­ nische Beratung in verschiedenen Ländern zuständig. 1988 fing Fischer in dem neuen Forschungszentrum von Kraft Foods in München-Perlach als Spezialist für Schmelzund Frischkäse an. Seit 2002 ist Fischer dort Bereichsleiter Neuproduktentwicklung für die weltweite Schokoladenproduktion. 102 Für Schokoladenfans hat er wohl einen Traumjob: Der Lebensmitteltechnologe Günther Fischer leitet einen Teilbereich der Neupro­duktentwicklung Schokolade im Münchner Forschungszentrum von Kraft Foods. Einen Schwerpunkt seiner Arbeit bilden­Strategien für die Weiterentwicklung von umsatzstarken Marken wie Milka und Côte d’Or. Spektrum der Wissenschaft: Hier in Ihrem Labor entstehen die Schokoladensorten, die der Verbraucher demnächst als Neuheit im Regal findet. Gehen neue Geschmacksrichtungen auf Ihre Einfälle zurück? Günther Fischer: Nein, sie entstehen aus dem Zusammenspiel vieler Abteilungen innerhalb des Konzerns. Nehmen Sie die Idee, Chili zu verwenden. Sie kam unter anderem aus der Spitzengastronomie und wurde so weiterentwickelt, dass sie zur Marke passte. Wir haben dazu in unserem Testlabor eine komplette Schokoladenfabrik im Kleinformat und eine eigene Konfiserie, in der meine Mitarbeiter alle Schokoladen- und Pralinensorten herstellen können, die vorstellbar sind. Die Prototypen werden in der Abteilung Sensorik von ausgebildeten Testpersonen probiert und bewertet. Die Ergebnisse bestimmen, welche neuen Produkte schließlich in den Regalen des Einzelhandels zu finden sein werden. Spektrum: Sie haben Lebensmitteltechnologie studiert. Waren Sie von Anfang an auf Schokolade spezialisiert? Fischer: Nein, aber auf die Milchindustrie, denn auf diesem Gebiet genießt die Universität Weihenstephan, wo ich studiert habe, Weltruf. Mit der Lebensmit- teltechnologie kam ich erstmals in einer Wurstfabrik in Kontakt. Ein Freund meiner Eltern arbeitete dort in der Produktentwicklung und verhalf mir zu einem Praktikum. Das hat Spaß gemacht, und außerdem wollte ich einen zukunftsträchtigen Beruf. Gegessen wird ja schließlich immer! Spektrum: Vor allem Schokolade. Die Deutschen liegen im internationalen Vergleich regelmäßig an der Spitze. Wie ging es weiter? Fischer: In meiner ersten Anstellung entwickelte ich Nahrungszusatzstoffe, wie zum Beispiel Schmelzsalze oder Stabilisatoren für die Milchverarbeitung. Der Job war mit vielen Reisen in die ganze Welt verbunden, und ich konnte Erfahrungen sammeln. Nach ein paar Jahren wechselte ich zu Kraft Foods, zunächst wieder als Spezialist für Schmelz- und Frischkäse, dann als Mitglied der Bereichsleitung für die Schokoladenentwicklung. Spektrum: Das war doch bestimmt viel spannender als Schmelzkäse? Fischer: Beides sind komplexe Gemische unterschiedlicher Rohstoffe, deren Zusammenspiel alles andere als trivial ist. Natürlich bietet Schokolade allein durch die Vielfalt der möglichen Produkte eine breite Palette an interessanten Aufgaben. SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 Kraft Foods ist eines der weltweit führenden Markenartikelunternehmen in der Lebensmittelindustrie. Rund 98 000 Mitarbeiter stellen in über 180 Fabriken Produkte her, die in über 155 Ländern verkauft werden. Allein mit den neun wichtigsten Marken, darunter Milka, erzielt Kraft Foods über eine Milliarde Dollar Umsatz im Jahr. Das Unternehmen be­ treibt weltweit elf Forschungszentren mit über 2000 Mitarbeitern, ver­ gangenes Jahr investierte es 500 Millionen Dollar in Forschung und Ent­ wicklung. Das Münchner Zentrum wurde 1985 gegründet und ist mit 270 Mitarbeitern das größte in Europa. In acht Labors und sechs Pilot­anlagen testen die Lebensmittelforscher dort neue Produkte und Geschmacks­ richtungen, entwickeln Verfahren für die Lebensmittelsicherheit sowie neue Produktionsprozesse. Schokolade ist das wichtigste For­schungs­gebiet in München, aber auch Frisch- und Schmelzkäse, Milch­ mixgetränke oder Majonäse werden dort unter die Lupe genommen. Kraft Foods Deutschland Spektrum: Was sind Ihre Aufgaben? Fischer: Ich erarbeite in erster Linie langfristige Projekte und Strategien. Das Spannende daran ist, dass ich an sehr vielen Prozessen beteiligt bin: von der Rohstoffbeschaffung über die Produktentwicklung und Produktionsoptimierung bis hin zu Verbraucheranalysen und Marketing. Natürlich muss ich mich hierzu ständig auf dem neuesten Stand halten und mich mit involvierten Abteilungen und Produktionsstätten in der ganzen Welt abstimmen. Spektrum: Was muss man sich denn unter einer Strategie im Schokoladenbereich vorstellen? Fischer: Zum Beispiel die Positionierung auf dem Markt. Nehmen Sie Milka, unsere größte Marke. Das ist ein Produkt für den breiten Geschmack, und deshalb passen keine ausgefallenen Extravaganzen. Veränderungen müssen genau geplant werden, damit der Fan seine Schokolade wiedererkennt und Stammkunde bleibt. Gleichzeitig wollen wir neue Verbraucher gewinnen, und dazu müssen wir die Marke weiterentwickeln. Vor einigen Jahren haben wir eine »Zartheitsoffensive« gestartet. Das war kein bloßer Marketinggag: Milka bekam tatsächlich eine andere Textur. Damit verbesserte sich das Mundgefühl, der Schmelz wurde zarter. Zudem SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · März 2010 In der Konfiserie des Kraft-Food-Forschungszentrums entstehen Prototypen neuer Schokoladensorten. Hier wird eine Tafelform mit flüssiger Schokolade ausgeschwenkt und der Überschuss herausgeschüttelt. Nach dem Erstarren werden die einzelnen Felder beispielsweise mit einer Himbeer-Jogurt-Masse gefüllt und mit einer Schicht Schokolade bedeckt. wurde die Schokoladenmasse lediglich anders konchiert, also in einer speziellen Rührmaschine mit Walzen bearbeitet und erwärmt. Derzeit platzieren wir eine neue Premiummarke namens Milka Amavel Duo, denn es gibt einen Trend zu ausgefallenen Schokoladensorten im oberen Preissegment. Die Sorten dieser neuen Marke sind doppelt gefüllt, und fragen Sie nicht, wie lange wir tüfteln mussten, um die Tafel trotzdem sehr flach zu halten. Der Trick war, sie statt in kleine in größere Stücke und dadurch flachere Kammern aufzuteilen, außerdem das Gewicht auf 130 Gramm pro Tafel zu er­ höhen. Übrigens modellierten unsere De­ signer die neuen Tafeln am Computer und erstellten dann 3-D-Modelle mittels Stereolithografie, so eine Art räumliches Drucken in Kunstharz. Die gesamte Produktentwicklung erforderte eine gute Zusammenarbeit als Team und viel Abstimmung zwischen Marketing, Verbrauchertestern und Produktentwicklern. Spektrum: Ist Milka Ihr Hauptarbeitsgebiet? Fischer: Nein, zurzeit bin ich mit Kol­ legen aus anderen Ländern auch dabei, neue Produkte unserer belgischen Marke Côte d’Or einzuführen. Das Besondere dieser Schokoladensorten wird sein, dass der eingesetzte Kakao zu mindestens 30 Prozent von Plantagen stammt, die von der Umweltschutzorganisation Rainforest Alliance zertifiziert wurden. Dazu haben wir unter anderem einige Kakaoplantagen in Ecuador besucht, um die Produktionsbedingungen vor Ort beurteilen zu können. Weil sich dieser Kakao von dem bisher verwendeten geschmacklich unterscheidet, versucht unser Team nun, die Rezeptur anzupassen, damit das schon bekannte Geschmacksprofil erreicht wird und auch konstant bleibt. Spektrum: An sich stehen Verbraucher der Lebensmittelindustrie oft kritisch gegenüber. Wie gehen Sie damit um? Fischer: Kraft Foods hat eine ganze Reihe von Initiativen für Bewegung und Ernährung begründet. Die Kontrolle der Rohstoffe und der Produkte ist beispielhaft. Außerdem bin ich kaum betroffen: Schokolade ist immer ein Naturprodukt aus Kakaobohnen, Milchpulver, Zucker und Lezithin. Natürlich soll man nicht gleich eine ganze Tafel essen. Ein paar Stückchen am Tag sind ein netter und erschwinglicher Luxus, der bei ausgewogener Ernährung durchaus seinen Platz hat. Das Interview führte die Münchner Wissenschafts­ journalistin Katrin Nikolaus. 103 stellenanzeigen Laboratory Manager (Reference No. 8) Molecular Biology, Chemistry Laboratory (f/m) Lexogen is a biotechnology start-up based in Vienna, Austria, focusing on the development of innovative tools for transcriptome research. Our proprietary highly automatable gene expression analysis platform can detect known and unknown sequences equally well. We are operating a state-of-the-art R&D facility and are determined to successfully launch our first products to a growing market. Position We are looking for a Laboratory Manager with strong organizing skills and a hands-on mentality to run our laboratory. This position is available from April 2010. Responsibilities • Organise and control all aspects of laboratory environment • Coordinate distribution and training of SOPs / MSDS / lab security • Requirements planning • Prepare GLP/ GMP qualification • Supervision of lab assistants Requirements Application This is an exceptional opportunity to join a fast growing biotech company at an early stage and to help shaping a future leader in the gene expression analysis market. To apply to this position, please send your detailed CV and covering letter to [email protected]. Lexogen GmbH | Brunnerstrasse 69/Obj. 3 1230 Vienna | Austria, Europe • Excellent communication skills • Excellent organization skills • Sound knowledge of GLP / GMP regulations • 3 to 5 years in laboratory management • Good scientific background in molecular biology or biochemistry • Advanced computer user skills • Excellent command of the English language Wir suchen 15 Wissenschaftler und Doktoranden KIT-ZenTrum KlIma und umwelT Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist aus der Fusion von Universität Karlsruhe und Forschungszentrum Karlsruhe hervorgegangen. Damit entstand deutschlandweit eine einmalige Institution, mit der die Missionen einer Universität und eines Großforschungszentrums in der Helmholtz-Gemeinschaft vereint sind. Als eines von vier neuen Zentren wurde das KIT-Zentrum Klima und Umwelt gegründet. Am KIT werden an verschiedenen Standorten für neue Forschungsvorhaben im Bereich der Atmosphären- und Klimaforschung insgesamt 15 Wissenschaftler und Doktoranden 104 gesucht. In einer anspruchsvollen Forschungslandschaft und in qualifizierten Teams im Institut für Meteorologie und Klimaforschung (IMK) arbeiten Sie an zukunftsweisenden Projekten mit. Sie sind dabei in das Helmholtz-Programm Atmosphäre und Klima und das KIT-Zentrum Klima und Umwelt eingebunden. Wir suchen Wissenschaftler und Doktoranden, die mit Motivation und Engagement Ihren persönlichen Beitrag zur Spitzenforschung leisten möchten. Hierzu ist ein überdurchschnittlicher Diplom- oder Masterabschluss in Meteorologie, Physik oder verwandten Studiengängen vorzuweisen. dungszentren. Insbesondere für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler bietet das Karlsruhe House of Young Scientists (KHYS) ein breites Qualifizierungsangebot und unterstützt Sie bei Ihren vielfältigen Aufgaben in Forschung, Lehre und Management. Detaillierte Stellenausschreibungen finden Sie unter: www.imk.kit.edu. Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung die Kennziffer IMK-I an. Sie werden in Ihrer international ausgerichteten Arbeit unterstützt durch eine individuelle Personalentwicklung und eigene Fortbil- SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · märz 2010 www.spektrum.com/naturejobs Sie sind interessiert zum Erfolg unseres Unternehmens beizutragen? Sie suchen nach einer spannenden beruflichen Herausforderung? Wir bei Bausch & Lomb sind derzeit in der erfreulichen Situation folgende Stellen in unserer Pharmaorganisation zu besetzen: Competitive Intelligence / Portfolio Management Specialist Ein marktgerechtes und zukunftsgerichtetes Produktportfolio macht den entscheidenden Unterschied am Markt – helfen Sie uns, dieses zu gestalten! Sehen ist ein Geschenk ... BAUSCH & LOMB ist weltweit einer der größten EyeCare-Spezialisten und Komplettanbieter von innovativen Lösungen, die den Menschen ein gesundes Augenlicht ermöglichen. Sales Force Effectiveness Analyst Nur wenn wir wissen, wie der Markt agiert, indem wir relevante Kennzahlen entwickeln und zur Steuerung unseres Geschäftes einsetzen, können wir erfolgreich sein! Wollen Sie Teil davon sein? Aus dieser Vision heraus entsteht unsere Motivation: Besseres Sehen für bessere Lebensqualität. Unsere Produktpalette umfasst Augenarzneimittel, Kontaktlinsen und -pflegemittel, intraokulare Linsen und Operationsgeräte. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Eintrittstermin direkt per Mail an Stefan Kohr (eMail: [email protected]). Für mögliche Rückfragen steht Ihnen Herr Kohr vorab telefonisch unter 0228 - 33656584 gerne zur Verfügung. Sales & Marketing Trainer Die kontinuierliche Ausrichtung von Produktmanagement und Vertrieb an zukünftige Markterfordernisse ist nur mit unseren bestens ausgebildeten Mitarbeitern/innen möglich! Machen Sie hier den Unterschied! Regional Sales Manager East sowie Pharmaberater und Bezirksleiter im Apothekenaußendienst für diverse Vertriebsregionen in Deutschland Unser Vertrieb ist jeden Tag der Schlüssel unseres Erfolges – seien Sie mit dabei – als Regionalleiter, Pharmaberater oder Bezirksleiter! Wollen Sie mehr darüber erfahren? Dann besuchen Sie unsere Homepage, auf der Sie detaillierte Informationen erhalten. www.bausch-lomb.de (Stellenangebote) Pharma-Sales_173x117.indd 1 29.01.2010 11:18:27 Uhr Spektrum der Wissenschaft and Naturejobs have joined forces. Now, with Naturejobs, you can place your jobs, courses, announcements and events in Spektrum as well as Nature, extending your reach among scientists, academics and students in Germany, Austria and Switzerland. For more information, please contact Naturejobs: Hildi Rowland T: +44 (0)20 7014 4084 E: [email protected] Kerstin Vincze T: +44 (0)20 7843 4970 E: [email protected] www.naturejobs.com 21925-01 Half page ad for Naturejobs in Spektrum.indd 1 SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · märz 2010 3/11/09 13:55:45 105 Heft April 2010 ab 30. März im Handel Im April-Heft 2010 Vorschau MandelbrotMenge in 3-D Je näher man hinschaut, desto mehr überraschende Details zeigen sich: Diese faszinierende Eigenschaft des »Apfelmännchens« ließ sich nun auch auf dreidimensionale Gebilde übertragen Weitere Themen im April Antrieb für Nanoroboter Sich autonom bewegende Nanoroboter können keinen Treibstofftank mitschleppen und müssen deshalb von außen Energie beziehen Kenn Brown, Mondolithic Studios Daniel White (www.skytopia.com/project/fractal/mandelbulb.html) Ackerbau in der Vertikalen Stadtplaner wollen mit Wolkenkratzern, in denen auf verglasten Etagen Nahrungsmittel angebaut werden, die Landwirtschaft in die Metropolen holen. Davon würden Verbraucher und Umwelt profitieren Tod dem »Superkeim«! Multiresistente Erreger stellen eine wachsende Bedrohung dar. Der Kampf gegen sie erfordert neue Strategien der Antibiotika-Entwicklung Möchten Sie stets über die Themen und Autoren eines neuen Hefts auf dem Laufenden sein? Woher die Hauskatze stammt Nicht in Ägypten, sondern im Nahen Osten lebten die ersten Hauskatzen. Sie wurden viel früher domestiziert als bisher angenommen. Alle heutigen Stubentiger haben Vorfahren aus dieser Region Wir informieren Sie gern per E-Mail – damit Sie nichts verpassen! Kostenfreie Registrierung unter: www.spektrum.com/newsletter 106 Getty images / Jane Burton