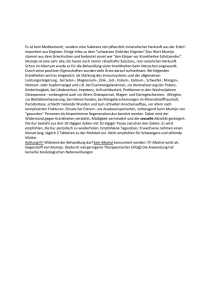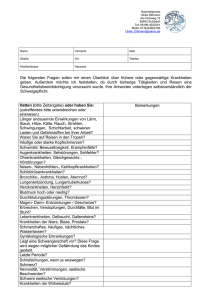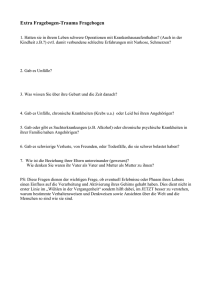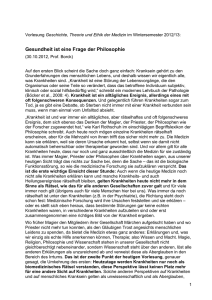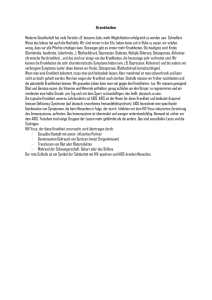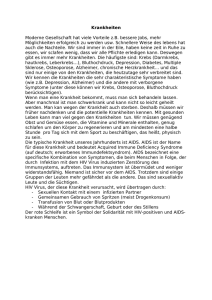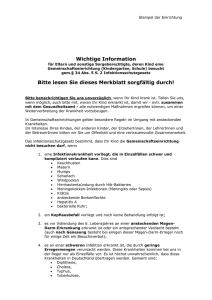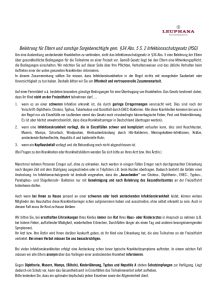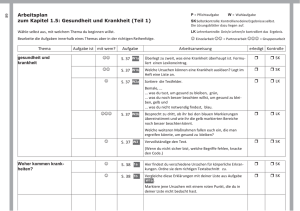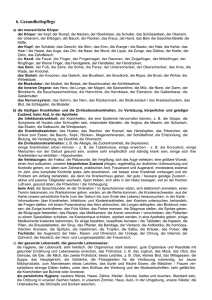GTE Vorlesung 2 Gesundheit
Werbung
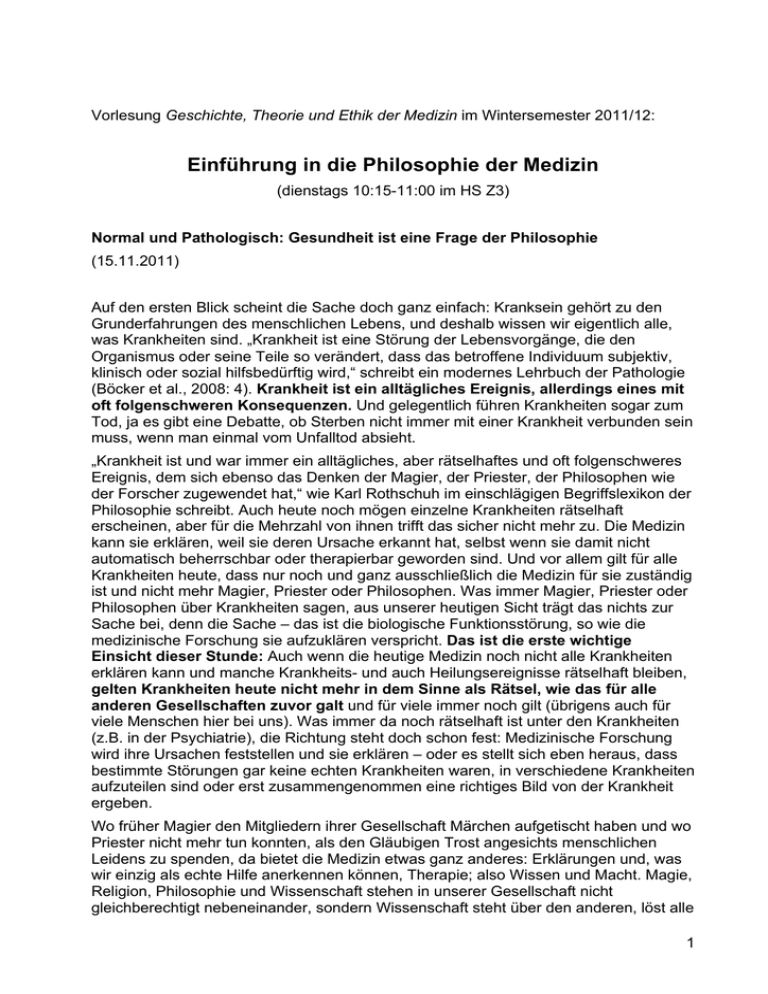
Vorlesung Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin im Wintersemester 2011/12: Einführung in die Philosophie der Medizin (dienstags 10:15-11:00 im HS Z3) Normal und Pathologisch: Gesundheit ist eine Frage der Philosophie (15.11.2011) Auf den ersten Blick scheint die Sache doch ganz einfach: Kranksein gehört zu den Grunderfahrungen des menschlichen Lebens, und deshalb wissen wir eigentlich alle, was Krankheiten sind. „Krankheit ist eine Störung der Lebensvorgänge, die den Organismus oder seine Teile so verändert, dass das betroffene Individuum subjektiv, klinisch oder sozial hilfsbedürftig wird,“ schreibt ein modernes Lehrbuch der Pathologie (Böcker et al., 2008: 4). Krankheit ist ein alltägliches Ereignis, allerdings eines mit oft folgenschweren Konsequenzen. Und gelegentlich führen Krankheiten sogar zum Tod, ja es gibt eine Debatte, ob Sterben nicht immer mit einer Krankheit verbunden sein muss, wenn man einmal vom Unfalltod absieht. „Krankheit ist und war immer ein alltägliches, aber rätselhaftes und oft folgenschweres Ereignis, dem sich ebenso das Denken der Magier, der Priester, der Philosophen wie der Forscher zugewendet hat,“ wie Karl Rothschuh im einschlägigen Begriffslexikon der Philosophie schreibt. Auch heute noch mögen einzelne Krankheiten rätselhaft erscheinen, aber für die Mehrzahl von ihnen trifft das sicher nicht mehr zu. Die Medizin kann sie erklären, weil sie deren Ursache erkannt hat, selbst wenn sie damit nicht automatisch beherrschbar oder therapierbar geworden sind. Und vor allem gilt für alle Krankheiten heute, dass nur noch und ganz ausschließlich die Medizin für sie zuständig ist und nicht mehr Magier, Priester oder Philosophen. Was immer Magier, Priester oder Philosophen über Krankheiten sagen, aus unserer heutigen Sicht trägt das nichts zur Sache bei, denn die Sache – das ist die biologische Funktionsstörung, so wie die medizinische Forschung sie aufzuklären verspricht. Das ist die erste wichtige Einsicht dieser Stunde: Auch wenn die heutige Medizin noch nicht alle Krankheiten erklären kann und manche Krankheits- und auch Heilungsereignisse rätselhaft bleiben, gelten Krankheiten heute nicht mehr in dem Sinne als Rätsel, wie das für alle anderen Gesellschaften zuvor galt und für viele immer noch gilt (übrigens auch für viele Menschen hier bei uns). Was immer da noch rätselhaft ist unter den Krankheiten (z.B. in der Psychiatrie), die Richtung steht doch schon fest: Medizinische Forschung wird ihre Ursachen feststellen und sie erklären – oder es stellt sich eben heraus, dass bestimmte Störungen gar keine echten Krankheiten waren, in verschiedene Krankheiten aufzuteilen sind oder erst zusammengenommen eine richtiges Bild von der Krankheit ergeben. Wo früher Magier den Mitgliedern ihrer Gesellschaft Märchen aufgetischt haben und wo Priester nicht mehr tun konnten, als den Gläubigen Trost angesichts menschlichen Leidens zu spenden, da bietet die Medizin etwas ganz anderes: Erklärungen und, was wir einzig als echte Hilfe anerkennen können, Therapie; also Wissen und Macht. Magie, Religion, Philosophie und Wissenschaft stehen in unserer Gesellschaft nicht gleichberechtigt nebeneinander, sondern Wissenschaft steht über den anderen, löst alle 1 anderen Erklärungen als unzureichend ab und verweist diese als Aberglauben in den Bereich des Irrtums. Das ist der zweite Punkt der heutigen Vorlesung, genauer gesagt, die Umkehrung des ersten: Heutzutage werden Krankheiten nur noch als biomedizinisches Rätsel verstanden, diese Perspektive lässt keinen Platz mehr für eine andere Sicht auf Krankheiten. Solche anderen Perspektiven auf Krankheiten und auf menschliches Kranksein gelten als unwissenschaftlich und als Aberglauben, bestenfalls sind sie Privatsache, aber eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Mensch, der sie vertritt nicht wirklich ernst genommen kann – und auch nicht ernst genommen zu werden braucht. Was diese Ausschließlichkeit der wissenschaftlichen Perspektive bedeutet, was diese Rangordnung gegenüber anderen Weltbildern heißt, lässt sich aus dieser Perspektive selbst heraus nur noch ganz schwer nachvollziehen: Einerseits stellt sie eine bemerkenswerte Entlastung dar, weil Menschen jetzt nicht mehr für ihre Krankheiten verantwortlich gemacht werden können (wenigstens nicht mehr so leicht) bzw. weil Krankheiten nun nicht mehr als Strafe für bestimmte Vergehen oder Verfehlungen gelten. Außerdem weisen wissenschaftliche Erklärungen einen Weg aus der Ohnmacht einer allmächtigen und unkalkulierbaren Natur gegenüber; gerade als Erklärungen machen sie Natur verständlich, weniger unheimlich und typischerweise führen sie zu neuen, wirkungsvollen Strategien der Intervention in die Natur. Aber auf der anderen Seite lassen wissenschaftliche Erklärungen keine anderen Weltbilder neben sich gelten und delegieren mit Gesundheit und Krankheit einen ganz zentralen Bereich menschlichen Lebens an die Medizin. Das ist nicht nur an sich schon problematisch (man denke nur an die Selbstverständlichkeit, mit der heute eine Hausgeburt als unkalkulierbares Risiko gilt, als hätte die Evolution zuerst das Krankenhaus erfinden müssen, bevor sie den Menschen entstehen ließ), sondern schafft auch kulturell eine völlig neue Situation, weil die Medizin ehemals gleichberechtigte Umgangsweisen mit Gesundheit und Krankheit nicht mehr gelten lässt. Es ist die für unsere Kultur typische Perspektive, allein die Biomedizin für Gesundheit und Krankheit zuständig zu erklären (Rosenberg, 1992). Sie werden sich fragen, was das heute noch heißen kann, weil doch die Medizin selbstverständlich dabei ist festzustellen, was Krankheiten „wirklich“ sind – und nur dann lässt sich doch auch wirkungsvoll etwas gegen sie tun. Das ist gerade der Punkt: Die Medizin – und nur die Medizin – kann heute sagen, was Krankheit ist; tertium non datur. Einzelne Krankheitserklärungen mögen zwar wahnsinnig kompliziert sein, und vor allem das Medizinstudium, in dem Sie jetzt gleich alle Krankheiten kennenlernen und verstehen müssen, ist als Ganzes kompliziert, aber die Sache selbst scheint heute doch sonnenklar: Gesundheit und Krankheit sind eine Sache der Medizin. Sie stellt fest, wann ein Organismus nicht mehr normal, also krank ist, sie identifiziert die vorliegende Krankheit, und wenn es gut läuft, hat sie ein paar handfeste Ratschläge oder effiziente Therapien parat, um den Organismus wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Wie könnte es anders sein? Und was soll es dann heißen, dass Gesundheit eine Sache der Philosophie ist? Die erste – und eigentlich schon eine ganz erstaunliche – Antwort auf diese Frage lautet schlicht, dass die Medizin selbst offenbar nicht zu wissen scheint, was Gesundheit ist. Wenigstens kommt Gesundheit bei ihr nicht vor, weder im Studium, noch in den Lehrbüchern, noch in der Praxis: Harrison’s Principles of Internal Medicine beginnen z.B. mit einer großen „Introduction to Clinical Medicine“ und auch dem neuen Thema Gender wurde eigens ein ganzes Kapitel gewidmet, aber über Gesundheit gibt’s nichts, nicht einmal einen Eintrag im Register. Das ist in der deutschen Ausgabe genauso, und der Vergleich mit anderen Lehrbücher beweist, dass dies keine Ausnahme oder schlicht 2 Zufall, sondern ein systematischer Trend ist: Der Schettler beginnt klassisch mit der Kardiologie, der Siegenthaler jetzt modisch mit der Genetik, auch hier fehlt überall „Gesundheit“ als Stichwort in den Registern. Kaum besser sieht es in den PathologieBüchern aus, auch hier nirgends ein Kapitel zur Gesundheit oder ein entsprechender Register-Eintrag, allerdings oft ein paar einleitende Bemerkungen zur Geschichte der Pathologie, zur Krankheitslehre und zum Begriff Krankheit, wie eingangs aus dem Böcker zitiert. Der Befund ist eindeutig: Gesundheit ist kein Gegenstand der heutigen Medizin. Natürlich darf man daraus jetzt nicht schließen, der Medizin sei ihr Gegenstand abhanden gekommen. Vielmehr ist es wohl eher umgekehrt: Für die Medizin ist es so selbstverständlich, was gesund und krank heute meinen, dass sie sich gar nicht mehr mit diesen Fragen aufhält. Es mag viele gute Gründe geben, warum in der Medizin nicht mehr über Gesundheit nachgedacht wird, und warum „Krankheit“ auch nur noch für Fachphilosophen ein problematischer Begriff ist. Offenbar funktioniert die Medizin ja sehr gut mit dem pragmatischen Überspringen dieser Fragen, aber deshalb sind diese Fragen eben noch nicht beantwortet. Georges Canguilhem (von dem auch der Titel dieser Vorlesung entlehnt ist) wird uns später in dieser Vorlesung noch näher beschäftigen, denn von ihm stammen zentrale und bis heute gültige Überlegungen zum Normalen und zum Pathologischen. Im Kontext der hier zunächst gemachten Beobachtung, dass die Unterscheidung von Gesundheit und Krankheit offenbar eine so fundamentale Grundoperation der Medizin darstellt, dass sie selbst gar nicht mehr als Problem vorkommt, findet sich bei Canguilhem eine erstaunlich passende Definition, die diesem Befund zugleich eine neue Deutung gibt: „Gesundheit ist das Leben im Schweigen der Organe.“ (Canguilhem zitiert hier eine Definition seines Straßburger Kollegen in de Physiologie René Leriche aus der Encyclopedie francaise von 1936). So wie die Medizin gut damit fährt, Gesundheit zunächst einmal als unproblematisch gegeben anzunehmen, erleben wir alle uns ja meist erstmal schlicht als gesund dadurch, dass uns unser Körper stillschweigend zur Verfügung steht und nicht auf sich aufmerksam macht. Genau ein solches Auf-sich-aufmerksam-Machen des Körpers ist ja der Zustand des Krankseins, das Leiden an einer Krankheit, wenn nämlich die Organe nicht mehr schweigend ihren gewohnten Dienst tun. Andererseits besticht diese Definition dadurch, dass sie offen lässt, worin genau die Leistung der Gesundheit besteht, wie sie sich positiv beschreiben ließe; sie bleibt inhaltlich unterbestimmt als der Bereich, in dem die Organe schweigend mittun. Wie immer das im Einzelfall aussieht, fest steht, dass hier nicht von vornherein an Normalparameter, Durchschnittswerte und Standardabweichungen gedacht ist. An diesem Punkt berührt sich Leriches Definition von Gesundheit mit einer noch berühmteren, die Sie alle kennen und die genau zehn Jahre später ganz und gar nicht wissenschaftlich gefunden, sondern regelrecht politisch aufgestellt wurde, nämlich die Gesundheitsdefinition der WHO: Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. So heißt es im ersten Paragraphen der Verfassung der Weltgesundheitsorganisation, wie er 1946, also unmittelbar nach Ende des zweiten Weltkriegs, als Beitrag der Weltgesellschaft zu Frieden und Wohlergehen beschlossen wurde. Diese Definition taugt für den Alltag wenig. Man darf mit Recht bezweifeln, ob überhaupt jemals ein Mensch nach dieser Definition wirklich als gesund bezeichnet werden kann. – Und 3 dennoch hat sich diese Definition gehalten, nicht nur als Gründungsdokument der WHO, der heute ohne Zweifel wichtigsten internationalen Gesundheitsorganisation, sondern auch als fortbestehende Mahnung daran, dass Gesundheit eben mehr ist, als eine Reihe von Parametern, die begründen, dass keine akute medizinische Hilfe erforderlich ist. Gesundheit, das besagt die WHO-Definition, bemisst sich an einer je individuellen Utopie, am Gelingen des Lebens, das eben immer schon mehr als dessen bloßes Funktionieren. Diese Gesundheit hat von vornherein immer schon mehrere Dimensionen als allein die Organfunktionen, wie sie von der Biomedizin ins Zentrum gestellt werden. Wohlergehen vollzieht sich mindestens entlang der drei Achsen Körper, Geist, Gesellschaft. Und für diese Gesundheit gibt es per definitionem keine Normen; was zählt, ist allein das Wohlergehen. Dafür lassen sich hinsichtlich der genannten körperlichen Dimension vielleicht noch gewisse Erwartungsparameter aus der medizinischen Erfahrung heranziehen, aber die klinische Praxis kann ein Lied davon singen, wie oft Wohlergehen mit eigentlich pathologischen Messwerten verknüpft ist und umgekehrt auch bei hochgradigem auf ein Organ gerichtetem Leiden gelegentlich doch nur Normalparameter zu finden sind. Gerade hier beweist die WHODefinition ihre Stärke, weil sie sich gar nicht auf eine Diskussion einlässt, wie Normalwerte und Gesundheit zusammenpassen sollten. Was sind eigentlich Normalwerte, welche Rolle spielen sie in der gegenwärtigen Medizin und wie verhalten sie sich zu einem angemessenen Verständnis von Gesundheit? Die moderne Biomedizin beruht auf der Leitvorstellung, dass Gesundheit und Krankheit sich nicht radikal ihrem Wesen nach, sondern lediglich qualitativ ihrem Ausprägungsgrad nach unterscheiden. Ein quantitativer Begriff von Gesundheit: Das Gesunde ist das Normale, das um einen bestimmten Mittelwert herum streut, sobald die Streuung größer wird, bekommt sie Krankheitswert. Hochdruck, Blutzucker, Körpertemperatur, Entzündungsenzyme: Sobald eine bestimmte Körperfunktion über einen als normal definierten Schwankungsbereich noch oben oder unten hinaus ragt, kommt ihm deshalb ein Krankheitswert zu. Nach diesem Modell der funktionellen Störungen oder ihrem Gegenstück der morphologischen Abweichung sind die verschiedenen Sparten der Pathologie konzipiert. Eine genetische Anomalie führt zu einer Verschiebung in der enzymatischen Ausstattung der betroffenen Zellen, mit der die normalen Schwankungsbreiten für bestimmte Stoffwechselfunktionen nicht mehr erfüllt werden, oder zu ihrer kanzerogenen Entartung; in beiden Fällen treten deshalb körperliche Störungen auf. Selbst noch eine Infektion, also der Überfall durch einen Krankheitskeim und dessen Einnisten führen letztlich erst durch die Störungen im Stoffwechsel oder die Veränderung der betroffenen Zellen, durch bestimmte Blockaden oder durch die Konsequenzen der Infektabwehr zu den Symptomen einer bestimmten Infektionskrankheit. So erfolgreich dieses Modell quer über die verschiedenen Spezialisierungsrichtungen der klinischen Medizin und auch als Framework für die laborwissenschaftliche Forschung funktioniert, um so stärker hat sich damit auch die Vorstellung gefestigt bzw. verbreitet, dass mit diesem Konzept zugleich auch schon inhaltlich fixiert sei, was eigentlich Gesundheit sei, nämlich die Summe der normaler Weise zu erwarteten Funktionsparameter. Das ist die Konzeption von Gesundheit, wie sie sich im Zuge des Siegeszuges des Laborwissenschaften in der Medizin allgemein durchgesetzt hat. Und sie treibt die medizinische Forschung permanent zu weiteren Höchstleistungen auf dem Feld der Identifizierung von pathologisch relevanten Reaktionsmechanismen und Funktionsketten an. Dieses Normalisierungs-Konzept von Gesundheit ist neben allen biomedizinischen Forschungen vor allem auch sozial fest und tief in unseren westlichen Gesellschaften verankert. Wann immer einer pathologischer Parameter gefunden werden kann, 4 beweist sich damit eine medizinische Diagnose, mit der der Betroffene zugleich von der Verantwortung für die Krankheit entlastet, zur Mitwirkung bei der Wiederherstellung der Gesundheit verpflichtet und juristisch-sozial von seinen Alltagsaufgaben entbunden ist. Neben dem medizinischen Erfolg dieses Forschungsprogramms ist es gerade die fest verankerte, bewährte soziale Relevanz, die wesentlich dazu beiträgt, Gesundheit nicht mehr utopisch positiv zu bestimmen, sondern pragmatisch mittels eines Ausschlussverfahrens, nämlich als das Vorliegen bestimmter Messzahlen von einem untersuchten Körper, die alle im Rahmen der üblicherweise zu beobachtenden Streubreite liegen und (noch) nicht mit einem pathologischen Befund korrelliert sind. Diese Enthaltsamkeit der modernen Biomedizin hinsichtlich einer substanziellen, positiven Bestimmung von Gesundheit (jenseits bzw. diesseits des Vorliegens pathologischer Befunde) ist dabei gerade die Voraussetzung dafür, dass sie in eine besonders starre, weil leere, Definition von Gesundheit im Sinne eines Sets von Normalparametern umschlägt. Was Gesundheit ist, kann die Medizin eigentlich nicht sagen, aber mit jeder Untersuchung und erst recht entlang des medizintechnischen Fortschritt kann die moderne Medizin immer besser sagen, welche Krankheiten (vorläufig) ausgeschlossen werden können. Was hat nun dieser philosophische Exkurs gebracht, warum sollten Sie als Mediziner noch mehr über Gesundheit und Krankheit wissen, als Ihnen Ihre Textbücher andeuten (bzw. vorenthalten)? Der erste Punkt ist ganz einfach und nahe liegend: Sie haben bereits eine ganze Reihe Erfahrungen mit Kranksein (und vielleicht auch mit der Medizin), Sie wissen, wie die Biomedizin, die Sie jetzt gerade lernen, dieser erfahrungsmäßigen Dimension von Krankheit keinen Platz einräumen kann. Vielleicht engagieren Sie sich deshalb auch in entsprechenden medizinischen und gesundheitspolitischen Gruppen bzw. in Fachschaftsinitiativen zur persönlichen Fortbildung und im internationalen Austausch. Zweitens behalten Sie im Kopf, dass subjektive Beschwerden und objektive Befunde immer zwei verschiedenen Welten entstammen und nur punktuell, nur in glücklichen Augenblicken tatsächlich stimmig, überzeugend und restlos zusammen passen. Der Fehler liegt nicht bei der Behauptung ihres Zusammenhangs, sondern bei der Vorstellung, keine anderen Zusammenhänge berücksichtigen zu tun dürfen. Gerade als Ärztin, als Arzt benötigen Sie zusätzlich zu Ihrer medizinischen Kompetenz die Fähigkeit, Ihren Patienten gegenüber ein offenes Ohr dafür zu bewahren, wie medizinischer Befund und lebensweltliche Perspektive möglicherweise auseinanderklaffen. Nur dann haben Sie eine Chance, das medizinisch Richtige auch in der richtigen Weise wirken zu lassen. Dieses Auseinanderklaffen von lebensweltlicher und medizinischer Perspektive auf Gesundheit und Krankheit zeigt sich zur Zeit vor allem in drei Bereichen, in der Genetik, bei psychischen Störungen und bei chronischen bzw. terminalen Erkrankungen. Auf diese drei Bereiche soll zum Abschluss dieser Vorlesung jeweils noch kurz eingegangen werden, wobei sich zugleich bereits abzeichnen wird, warum und in welcher Weise Gesundheit zur einer Frage der Philosophie wird. Genetik: Die enormen Erfolge der molekularbiologischen Forschung haben in den vergangenen Jahrzehnten auf der einen Seite dazu geführt, viele Krankheiten, die bis vor kurzem noch als funktionelle Störungen (Bluthochdruck, Herzinfarkt) oder spontane Erscheinungen (diverse Krebsformen) galten, als genetisch verursachte Krankheiten zu begreifen. Obwohl diese Forschungen heute in den allermeisten Fällen keine eindeutigen kausalen Erklärungen im Sinne echter mechanistischer Erklärungen, sondern vielmehr nur Assoziationen von bestimmten Mutationen mit erhöhten 5 Erkrankungswahrscheinlichkeiten liefern, hat sich dennoch der Eindruck eingestellt, die Molekulargenetik würde diese Krankheiten vollständig aufklären und die genetische Abweichung wäre der eindeutige Defekt, der die jeweilige Krankheit wie ein Computerprogramm determiniert. Obwohl diese Forschungen also eigentlich die das Konzept von Kausalerklärungen aufweichen und unterminieren, haben die zahlreichen Entdeckungen genetischer Faktoren den Eindruck entstehen lassen, die Gesetze der Krankheiten freizulegen. – Die weiteren Fortschritte dieser Forschungen werden dieses falsche Bild zwar rasch korrigieren, aber zur Zeit stabilisiert die Molekularbiologie noch ein veraltetes und falsches Konzept mechanistischer Krankheitserklärungen, das der Komplexität organischer Prozesse nicht gerecht wird. Dieses Paradox zeigt sich insbesondere bei der Anwendung genetischer Diagnostik zu präventiven Zwecken, weil hier genetische Befunde nicht erst aufgrund entsprechender klinischer Symptome, sondern auch bei deren vollständigem Fehlen zusammengetragen werden. Diese Tests machen damit gesunde Menschen zu Patienten ohne subjektive Beschwerden und mit fraglichem Krankheitswert, weil keiner sagen kann, ob sich eine Erkrankung aufgrund einer genetischen Disposition auch tatsächlich manifestieren wird. Hier argumentiert die Medizin zu recht mit der Beruhigung, die von einem Ausschluss einer genetischen Belastung ausgeht. Aber weder sie noch die Ethik noch unsere Gesellschaft hat bislang geeignete Strategien entwickelt, wie mit „positiven“ Befunden umzugehen ist, die Anlass zur Beunruhigung bieten, aber nicht in den Bereich genetischer Determinismen fallen. Psychische Störungen: Seit gut einhundert Jahren gilt auch für den Bereich psychischer Erkrankungen das Erklärungsparadigma der Biomedizin, letztlich organische Veränderungen für alle Krankheiten aufsuchen und dingfest machen zu wollen. Neben der grundsätzlichen und uralten philosophischen Frage, wie sich Gehirn und Psyche angemessen zueinander ins Verhältnis setzen lassen, besteht in diesem Bereich vor allem auch das Problem, wie individuelle und gesellschaftliche Wahrnehmungen zur Herausbildung bestimmter Auffälligkeiten beitragen. Bis vor kurzem kalt Homosexualität eindeutig als eine Krankheit und viele hielten sie auch für organisch verursacht. Heute gilt sie als individuelle Äußerungsform menschlichen Lebens, dessen organische Verankerung kein größerer Krankheitswert zuzusprechen ist als etwa einer Linkshändigkeit. Das Beispiel verweist also darauf, dass erstens die Grenzen zwischen normal und pathologisch nicht eindeutig, exakt und biologisch definiert sind, und dass zweitens jedes Ziehen einer solchen Grenze zugleich auch eine gesellschaftlich verbindliche Norm setzt, also mehr ist als die Feststellung eines naturwissenschaftlichen Sachverhalts. Chronische Erkrankungen: Die moderne Medizin hat ihren Leistungsschwerpunkt eindeutig im Bereich akuter Störungen. Dank des medizinisch-technischen Fortschritts überleben Menschen heute eine Vielzahl von Erkrankungen, die noch bis vor kurzem tödlich verliefen. Nicht alle diese Erfolge führen aber zu einer völligen Wiederherstellung der Gesundheit, sondern zu einem Zustand teilweiser Einschränkung. Hinzu kommen die vielen Menschen, bei denen eine chronische Erkrankung vorliegt, die von der Medizin ohnehin nur eingeschränkt bewältigt wird. Diese Krankheiten sind nicht nur deswegen problematisch, weil sie zwischen die klare Unterscheidung von Gesundheit und Krankheit fallen, und weil sie eine besondere Herausforderung für die Medizin darstellen, für die nicht so recht etwas anzubieten hat. Im Hinblick auf unsere Diskussion des Gesundheitsbegriffs geben sie vor allem aber den entscheidenden Hinweis darauf, dass es offenbar sehr verschiedene Formen gibt gesund zu sein, die mit dem Normalwertkonzept nur wenig zu tun haben. Allerdings kommt es hier auf die richtige Perspektive an: Es kann nicht darum gehen, einen leidvollen und eingeschränkten Zustand beschönigend als individuelle Form von 6 Gesundheit kaschieren zu wollen. Vielmehr kann umgekehrt gerade die philosophische Analyse solcher Fälle den Blick dafür schärfen, wie die Medizin mit einem falschen und verengten Gesundheitsbegriff zusätzlichen Schaden anrichtet. Ein besonders drastisches Beispiel liefern dafür die Bemühungen der Orthopäden, Kinder der Contergan-Katastrophe per Prothesen auf Normalmaße zu trimmen. Selten wird so krass deutlich, wie ein Normalwerte immer auch als Norm zum Zwang wird, wenn nicht danach gefragt wird, was im konkreten Fall denn die angemessene Form, also die Gesundheit dieses Patienten und seines Körpers wäre. Es kann deshalb auch nicht überraschen, wenn in den vergangenen Jahren vor allem von Behindertengruppen und den so genannten Disability Studies fruchtbare Impulse ausgingen, Gesundheit und Krankheit neu zu denken, nämlich als Fähigkeit zur gelingenden Interaktion mit je spezifischen Umwelten. – Einen ähnlichen Gedanken hat Canguilhem auch in seiner Arbeit zum Normalen und Pathologischen formuliert: Gesundheit ist nicht so sehr das Entsprechen einer vorgegebenen Norm, als vielmehr die Fähigkeit zur Normsetzung, das Aufrechterhalten der Lebensvorgänge in und mit der Umwelt. In diesem Sinne gibt es keine allgemeingültige Definition des Gesundheit entlang dem Konzept der Normalwerte, aber Gesundheit kann gedacht werden als die Wahrheit eines je individuellen Körpers. – Gesundheit ist eine Frage der Philosophie, die von der Medizin in der Regel verfehlt wird, so fern sie nicht um deren Grenzen weiß. 7 Literatur Böcker, Werner et al. (Hg.): [Böcker-Denk-Heitz-Moch] Pathologie. 4. Aufl. München: Elsevier, Urban & Fischer, 2008. Canguilhem, Georges: Das Normale und das Pathologische, München: Hanser, 1974. Canguilhem, Georges: Gesundheit - eine Frage der Philosophie, Berlin: Merve, 2004 Illich, Ivan: Medical Nemesis: The Expropriation of Health, London: Calder & Boyars, 1975. Dt.: Die Enteignung der Gesundheit, Reinbek: Rowohlt, 1973. Rosenberg, Charles E.: Framing disease: illness, society, and history. In: ders. & Janet Golden (Eds.): Framing disease: Studies in Cultural History. New Brunswick NJ: Rutger University Press 1992, pp. xiii – xxvi. Rosenberg, Charles E.: Our Present Complaint: American Medicine, Then and Now. Baltimore, The Johns Hopkins University Press2007. Rothschuh, Karl Eduard (Hg.): Was ist Krankheit? Erscheinung, Erklärung, Sinngebung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1975. Rothschuh, Karl Eduard: Krankheit. In: Joachim Ritter (Hg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 4, Basel: Schwabe 1976, Spp. 1184-1190. 8