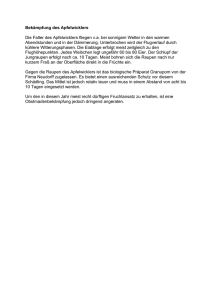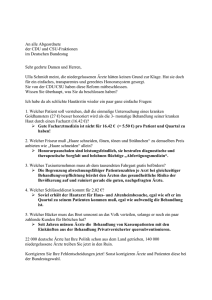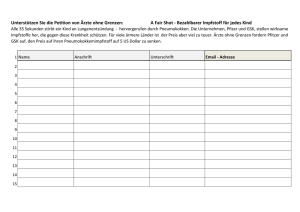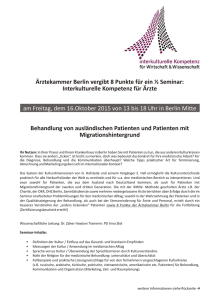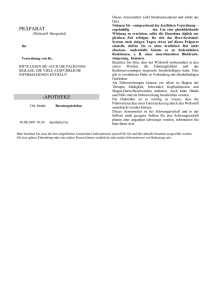Patienten werden schneller gesund, wenn Ärzte den Placebo
Werbung

Panorama Der Landbote Freitag, 10. Februar 2017 | 13 Patienten werden schneller gesund, wenn Ärzte den Placebo-Effekt gezielt einsetzen gen: Du erhältst jetzt ein Zaubermittel und reist auf einem fliegenden Teppich ins Traumland. Oft ist der Einsatz von Placebos aber ethisch fragwürdig. Das wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn ein Arzt seinem Patienten Pillen ohne Wirkstoff verabreichen würde, ihn aber glauben macht, es handle sich um ein richtiges Medikament. «Man sollte die Patienten nicht täuschen, ihnen falsche Hoffnungen machen oder eine wirksame Behandlung vorenthalten», warnt Krummenacher. Gemäss einer Umfrage der Universität Zürich behelfen sich viele Hausärzte deswegen mit sogenannten Pseudoplacebos: Sie verschreiben harmlose Mittel wie etwa Vitaminpräparate oder Salben. Damit kommen sie dem Wunsch vieler Patienten nach einem Medikament nach. Gleichzeitig erzielen sie in der Regel einen therapeutischen Erfolg. Denn auch wenn bei den jeweiligen Beschwerden des Patienten die Wirkung des Mittels nicht nachgewiesen ist, tritt der Placebo-Effekt ein und kann so den Heilungsverlauf günstig beeinflussen. MEDIZIN Wie Ärzte mit ihren Patienten sprechen, hat grossen Einfluss auf den Behandlungserfolg. Das lässt sich gezielt nutzen, um Nebenwirkungen zu vermeiden und Therapiekosten zu senken. Um ihren Haarausfall zu behandeln, wünschte sich die Patientin ein bestimmtes Aufbaupräparat auf natürlicher Basis. Bei ihrer Schwester habe das Mittel gut gewirkt. Für die behandelnde Ärztin Kai Berger war das eine schwierige Situation: Die Wirksamkeit des Produkts ist wissenschaftlich nicht erwiesen. «Ich musste versuchen, meine Meinung zurückzuhalten», sagt Berger. Denn ihr ist bewusst: Je mehr jemand an ein Mittel glaubt, desto besser wirkt es. Diesen Placebo-Effekt wollte Berger unterstützen. Da die Frau nicht wegen einer ernsthaften Erkrankung Haare verlor, hielt die Ärztin es für verantwortbar, ihrem Wunsch zu entsprechen. «Wenn das Ihrer Schwester geholfen hat, finde ich es eine gute Idee», beschied sie ihr und stellte ein Rezept aus. Nun versuchte es die Frau zunächst mit diesem Präparat. Placebo­Effekt ist Teil jeder Behandlung «Erwartungen und Befürchtungen der Patienten spielen eine wichtige Rolle dabei, wie gut eine Behandlung wirkt», sagt der Zürcher Neurowissenschaftler Peter Krummenacher. Er befasst sich seit langem mit dem Placebo-Effekt. Dabei handelt es sich um körperliche Reaktionen auf Mittel, die keinen Wirkstoff enthalten. Zahlreiche Studien haben gezeigt, wie stark Menschen auf Suggestion ansprechen. So konnten Forscher etwa nachweisen, dass teilweise dieselben Hirnareale aktiv sind, wenn jemandem statt eines starken Schmerzmittels ein Scheinmedikament ohne Wirkstoff verabreicht wird. Doch nicht nur Tabletten, sondern auch Scheinbehandlungen und sogar die Art und Weise, wie Ärzte kommunizieren, können eine Placebo-Reaktion auslösen. Einfühlsam kommunizieren: Geschichten helfen, um Kindern die Angst vor der Behandlung zu nehmen. Das spielt auch in der Praxis eine Rolle: «Der Placebo-Effekt ist auch bei den meisten wissenschaftlich erprobten Behandlungen stets Teil der Wirkung», sagt Neurowissenschaftler Krummenacher. Bereits die Erwartung, dass ein Mittel heilt, führe zur Ausschüttung körpereigener Stoffe wie etwa schmerzlindernder Endorphine. «Wenn Fachleute diese Vorgänge geschickt nutzen, müssen sie weniger Medikamente verabreichen. Das senkt sowohl die Nebenwirkungen als auch die Therapiekosten.» Um die Erkenntnisse aus der Wissenschaft in die Praxis umzu- setzen, hat Krummenacher die Firma Brainability gegründet. Mit dieser bietet er Workshops für Fachleute wie Ärzte, Pflegende und Apotheker an. Sie lernen, wie sich mit geeigneter Kommunikation die Genesung fördern lässt. «Viele Ärzte können ihre Behandlung verbessern, indem sie empathisch sind, auf Befürchtungen der Patienten eingehen sowie Worte, Mimik und Gestik bewusst einsetzen», sagt Krummenacher. Insbesondere bei Kindern spielt es eine grosse Rolle, wie ihnen eine bestimmte Behandlung erklärt wird. Krummenacher hat kürzlich die weltweit erste Place- bo-Studie an gesunden Kindern abgeschlossen. Gemeinsam mit Kollegen konnte er zeigen, dass Sechs- bis Neunjährige weniger hitzeempfindlich sind, wenn man ihnen eine blaue Salbe ohne Wirkstoff auf den Arm streicht. Ein Gerät auf dem Unterarm der 49 Probanden wurde stetig wärmer. Die Kinder konnten einen Stoppknopf drücken, sobald es ihnen zu heiss wurde. Suggestion senkt das Schmerzempfinden Der einen Gruppe sagten die Forscher, die blaue Salbe sei nötig, um die Hitzeempfindlichkeit ge- iStock nauer zu messen. Den Kindern der zweiten Gruppe suggerierten sie hingegen eine stark schmerzstillende Wirkung. Daraufhin hielten diese höhere Temperaturen aus. «Die Ergebnisse waren eindrücklich», sagt Krummenacher. Der Effekt sei zudem klarer ausgefallen als bei ähnlichen Studien mit Erwachsenen. «Kinder haben viel Fantasie und sind empfänglich für Geschichten.» Dies könnten sich etwa Anästhesisten zunutze machen, um kleinen Patienten die Angst vor einer Operation zu nehmen. Zum Beispiel, indem sie ihnen beim Verabreichen des Narkosemittels sa- Angst vor Nebenwirkungen kann krank machen Neben dem positiven Placebo-Effekt kann es durch Fehler in der Kommunikation aber auch zu schädlichen Effekten kommen. Wenn Ärzte beispielsweise sämtliche mögliche Nebenwirkungen eines Medikaments aufzählen, verunsichern sie ihre Patienten. Dennoch sind sie zu einer sorgfältigen Aufklärung über Risiken verpflichtet. Ein Dilemma, das Ärztin Kai Berger gut kennt. Etwa, wenn sie Frauen über mögliche Komplikationen der Verhütungspille informieren muss. Dann versucht sie ihnen die Angst zu nehmen, indem sie erklärt, wie selten Thrombosen bei gesunden, jungen Nichtraucherinnen ohne familiäre Vorbelastung sind. Trotz hoher Arbeitsbelastung will sich die Ärztin dafür Zeit nehmen. Denn sie weiss: «Für den Behandlungserfolg ist eine sorgfältige Kommunikation entscheidend.» Andrea Söldi Pflanzen erkennen Kleiner exotische Feinde Raubfisch mit grosser Klappe ÖKOLOGIE Indem sie Duftstoffe absondern, wehren sich Pflanzen gegen schädliche Insekten und Schnecken. Dabei können sie sogar zwischen einheimischen und exotischen Angreifern unterscheiden. Pflanzen werden von vielen verschiedenen Schädlingen befallen, beispielsweise von Läusen oder Raupen. Um sich zu verteidigen, wenden die Pflanzen einen Trick an: Sie senden bestimmte Duftstoffe aus. Diese locken weitere Tiere an, welche den Schädling bekämpfen sollen. Fressen beispielsweise Schmetterlingsraupen an ihren Blättern, lockt die Pflanze gezielt Schlupfwespen an. Diese legen ihre Eier in die Raupen und töten sie dadurch. - hoden, rscher . PRODUKTION Scitec-Media GmbH, Agentur für Wissenschatsjournalismus Leitung: Beat Glogger [email protected], www.scitec-media.ch Twitter: @scitec_media, Facebook: @wissen.news Welche Duftstoffe Pflanzen genau ausstossen, haben nun deutsche und niederländische Wissenschaftler untersucht. Sie liessen zehn verschiedene Schädlinge, darunter Raupen, Blattläuse und Schnecken, auf Testpflanzen los. Dabei verwendeten sie verschiedene Arten von Schädlingen: Einige waren einheimisch, andere stammten aus exotischen Ländern. Anschliessend analysierten die Forscher, bei welchem Schädling die Pflanze welchen Duft verströmte. Individuell abgestimmt Das Ergebnis: Je nach Schädling waren die Düfte verschieden. Die Pflanzen waren demnach in der Lage, die Angreifer auseinanderzuhalten. Ausserdem sonderten sie bei den exotischen Schädlingen andere Düfte ab als bei den einheimischen. Die Pflanzen erkannten also selbst solche Arten, mit denen sie normalerweise nicht in Kontakt kommen. Wie ihnen das gelingt, ist bisher noch nicht bekannt. Sheila Eggmann Der Barten­Drachenfisch kann Beutetiere verspeisen, die so gross sind wie er selbst. Dafür muss er sein Maul ganz weit aufsperren können. Wie er das schafft, haben französische und amerikanische Forscher nun entdeckt. Indem sie wie bei diesem Exemplar das Skelett einfärbten, fanden sie eine anatomische Besonderheit: Im Gegensatz zu anderen Fischarten sind bei einigen Barten-Drachenfischarten Kopf und Wirbelsäule nicht direkt miteinander verbunden. Stattdessen verfügen sie über eine Art zusätzliches Gelenk, dank dem sie ihr Maul bis zu 120 Grad weit aufreissen können. Zusammen mit den scharfen Zähnen macht das die Raubfische äusserst erfolgreich. ahe / Nalani Schnell, mnhn