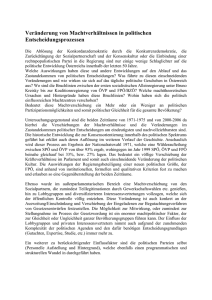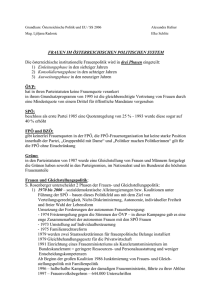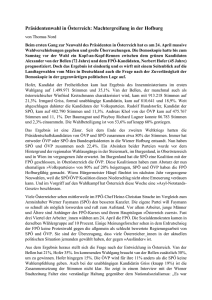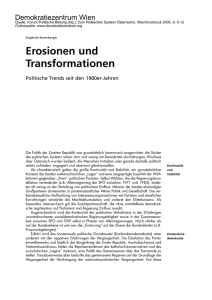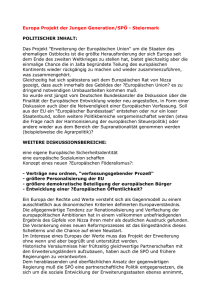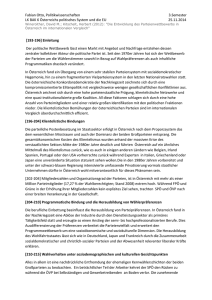Wahlbeteiligung und Parteienbindung in Österreich.
Werbung

Institut für Politikwissenschaft Universität Wien Wahlbeteiligung und Parteienbindung in Österreich. Die Anrufung des Subjekts als konstituierendes Motiv. Forschungsbericht anlässlich des Forschungspraktikums „Die Stimme abgeben?“ Lv.nr.: 696578 abgehalten von Sieglinde Rosenberger, Gilg Seeber im WiSe 2004/05 Constanze Ertl Clara Humpel Thomas Neyder [email protected] [email protected] [email protected] Wien, Februar 2004 9305079/A300 9704830/A300 0016309/A300 Inhaltsverzeichnis 1 EINLEITUNG 1 1.1 1.2 Fragestellung Hypothesen 1 2 2 AKTUELLER FORSCHUNGSSTAND 3 2.1 2.2 Sozialstrukturelle Ansätze Sozialpsychologischer Ansatz 3 4 3 EIN POSTSTRUKTURALISTISCHES ERKLÄRUNGSMODELL 6 3.1 3.2 Zugang Methodologie 6 6 4 DAS SUBJEKT 8 4.1 4.2 4.3 Subjektkonstituierung Interpellation Individuum / Individualisierung 8 9 11 5 PARTEIENSTAAT, SUBJEKT UND DEMOKRATIE 13 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Übergang Monarchie – Republik Der gemeinsame „Feind“ – Antisemitismus als integrative Klammer Konstituierung der österreichischen Demokratie und des Subjekts nach 1945 Verflechtung der „Großparteien“ mit Zivilgesellschaft und Staatsapparat Das Subjekt im Spannungsfeld von Demokratie und Markt 13 13 14 15 16 6 PARTEIEN UND WAHLEN 18 6.1 6.2 Organisationsgrad von politischen Parteien Politische Partizipation 18 19 7 AUSWIRKUNGEN AUF DIE WAHLBETEILIGUNG 23 7.1 7.2 Schlussfolgerungen Ausblick 23 24 8 LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS 25 9 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 31 10 DIAGRAMME 32 1 1 Einleitung Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist die tendenziell sinkende Wahlbeteiligung in Österreich. Um diese sinkende Wahlbeteiligung erklären zu können, sind wir der Ansicht, dass zuerst die im internationalen Vergleich demokratischer Staaten überdurchschnittlich hohe Wahlbeteiligung bis in die Mitte der 1980er Jahren erklärt werden muss. Keine der von uns berücksichtigten Quellen negiert einen Zusammenhang von Parteienbindung und Wahlbeteiligung in Österreich, jedoch werden die traditionellen Parteien als vorwiegend passive Akteure aufgefasst, welche im Prozess der fortschreitenden Individualisierung ihre Wählerinnen und Wähler verlieren. Dies wird gern mit einem Versäumnis der Parteien begründet, denen es immer seltener gelingt, die Gesamtheit der Wahlberechtigten anzusprechen und auf deren Interessen einzugehen (vgl. Diskussion mit Palme und Hofinger 15. November 2004). Wir bedienen uns in der vorliegenden Arbeit einer geschlechtergerechten Schreibweise, insofern die Kategorie Geschlecht für die spezifischen Zusammenhänge nicht von Bedeutung ist und ein entsprechender Begriff in der verwendeten Sprache existiert. Nichtsdestotrotz legen wir Wert darauf, geschlechtsspezifische Zusammenhänge auch mit den jeweiligen spezifischen Begriffen zu beschreiben, – Sprache in ihrer Funktion als Trägerin von Bedeutungen sollte mit ihren Zeichen jene Dinge benennen, welche sie erzeugt, wiewohl sich auch die Sprache der Materialität der Diskurse nicht entziehen kann. 1.1 Fragestellung Die konstant hohe Parteienbindung und die daraus resultierende hohe Wahlbeteiligung während der ersten Hälfte der Zweiten Republik sind spezifische Eigenschaften des politischen Systems Österreichs (vgl. u.a. Pelinka/Rosenberger 2003: 53f.; Müller/Plasser/Ulram 1999: 201). Eine Auswirkung der Parteienbindung auf die Wahlbeteiligung wird zwar vielfach erwähnt – historische Erklärungsansätze (abseits der Lagertheorie von A. Wandruszka) zu diesem Zusammenhang gibt es jedoch nicht. Eine Geschichte der Interaktion von Subjekt und Parteien wird in diesem Kontext als Möglichkeit erachtet, den Zusammenhang von Parteienbindung und Wahlbeteiligung in Österreich neu herauszuarbeiten. In diesem Sinne widmet sich die vorliegende Arbeit folgender zentralen Fragestellung: 1. Inwiefern besteht ein Zusammenhang von Parteienbindung und Wahlbeteiligung in Österreich abseits der traditionellen Erklärungsmuster (Lagertheorie) der „spezifisch österreichischen“ Ausgestaltung des politischen Systems? 2 Aus der Bearbeitung dieser Fragestellung ergeben sich für uns mehrere Unterfragestellungen: 1.1 In welcher historischen Phase begründet sich diese „spezifisch österreichische“ Ausgestaltung des politischen Systems? 1.2 Wodurch ist dieses österreichische Spezifikum bestimmt, und wie äußert sich dieses in der Entwicklung des politischen Systems Österreichs bis heute? 1.3 Welche Schlussfolgerungen für die Wahlbeteiligung und die Rolle der Parteien ergeben sich daraus? 1.2 Hypothesen Ausgehend von unserer zentralen Fragestellung formulieren wir folgende Hypothesen: Hypothese 1: Die besonderen Rahmenbedingungen Ende des 19. Jahrhunderts führten zu dieser „spezifisch österreichischen“ Ausgestaltung des politischen Systems. Hypothese 2: Das österreichische Spezifikum wird bestimmt durch einen bedeutenden Mangel an politischem Liberalismus, welcher im Laufe der 2. Republik an Bedeutung verliert – was zu einer Stabilisierung des politischen Systems einer repräsentativ-liberalen Demokratie führt. Hypothese 3: Die Parteien definierten sich über die Abgrenzung zu einem „fiktiven Außen“. Als das Verworfene lässt sich das Jüdisch-Liberale identifizieren. Hypothese 4: Die Parteien machten sich nicht nur bereits über Jahrhunderte vorhandene christlichantisemitische Ressentiments innerhalb breiter Bevölkerungsgruppen zunutze, sie schürten diese auch, in dem sie diese mit der Ablehnung des politischen Liberalismus verknüpften. Hypothese 5: Mit der Ausbildung eines politischen Marktes und einer damit einhergehenden Betonung des Individuums findet eine Angleichung an das fiktive Außen statt, damit verliert die bindende Klammer des Antiliberalismus und Antisemitismus an Bedeutung, die bis dahin ausschlaggebend für die hohe Wahlbeteiligung war. 3 2 Aktueller Forschungsstand 2.1 Sozialstrukturelle Ansätze 2.1.1 Mikrosoziologischer Ansatz Die 1944 von Lazarsfeld, Berelson und Gaudet durchgeführte Studie „The People’s Choice – How the Voter makes up his Mind in a Presidential Campaign“ gilt als Klassiker der modernen Wahlforschung. Gegenstand ihrer 1944 veröffentlichten Pionierstudie war die Erforschung der Entwicklung des individuellen Wahlverhaltens während des US-Präsidentschaftswahlkampfes im Jahr 1940 auf Basis einer groß angelegten Panelstudie im Kreis Erie County, Bundesstaat Ohio (vgl. Lazarsfeld/Berelson/ Gaudet 1969: 37-50). Wahlbeteiligung und Parteienbindung werden hier vorwiegend als Ergebnis der Beeinflussung des in Sozialstrukturen eingebetteten Individuums durch seine Umwelt gesehen: „Ein Mensch denkt politisch entsprechend seinem sozialen Sein. Soziale Merkmale bestimmen die politischen Präferenzen“ (Lazarsfeld/Berelson/Gaudet 1969: 62). Der Wahlkampf spielt demnach eine untergeordnete Rolle für die Wahlentscheidung: Personen, die am meisten lasen und hörten, lasen und hörten nicht nur fast die gesamte Propaganda ihrer eigenen Partei, sondern waren auch wegen ihrer starken Prädispositionen am widerstandsfähigsten gegen eine Meinungsänderung. Und diejenigen, die der Bekehrung am zugänglichsten waren – die Personen also, welche die Wahlmanager vor allem erreichen wollten – lasen und hörten am wenigsten. Dieser Zusammenhang ist das größte Hindernis für eine Änderung von Meinungen. (Lazarsfeld/Berelson/Gaudet 1969: 132) Die Politikwissenschafter Bürklin und Klein (1998: 162) führen das Sinken der Wahlbeteiligung vor allem auf einen Rückgang der affektiven Parteibindungen zurück. In Verweis auf Kleinhenz (1995:142) argumentieren sie, dass an eine Partei gebundene Individuen mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit der Wahl fernbleiben als jene, welche sich mit keiner Partei identifizieren können (vgl. Lazarsfeld/Berelson/Gaudet 1969: 132 und ebd. 80 f.). Die Auflösung der Parteibindungen sehen sie in Verbindung mit gesellschaftlicher Individualisierung. In diesem Zusammenhang vertreten wir die Auffassung, dass z.B. Bürklin und Klein den Terminus 'gesellschaftliche Individualisierung' nicht in seiner vollen Tragweite für das Funktionieren des politischen Systems erfassen; hier speziell darin, inwieweit das Verhältnis Gesellschaft und Subjekte verstanden wird. Wie wirkt Macht in Gemeinschaften? Wählen ist in diesem Sinne ein Ausdruck dieser substanzlosen, gemeinschaftlichen Macht insofern, als dass hierin die Bindung der Gemeinschaft von staatsbürgerlichen Subjekten und dem Staatsapparat als ideologische Kategorie rituell erneuert wird. 4 2.1.2 Makrosoziologischer Ansatz Ausgehend von Talcott Parsons’ Vierfelderschema zur Klassifikation der Funktionen eines sozialen Systems (vgl. Parsons 1957: 19) entwickelten Lipset und Rokkan (1969: 6-9) die Cleavage-Theorie, welche von fundamentalen Konflikten innerhalb einer Gesellschaft ausgeht. Diese Konflikte sind entlang einer territorialen (Zentrum vs. Peripherie) bzw. einer funktionalen Achse (interessenspezifische vs. ideologische Konflikte) angesiedelt (ebd. 9-11). In diesem Modell wird den Parteien sowohl eine dialektisch-integrative als auch eine vermittelnde Rolle zugeschrieben. Parteien sind sowohl das Ergebnis fundamentaler gesellschaftlicher Konflikte als auch der Ausdruck dieser Konflikte. Über die Artikulation und Verhandlung der fundamentalen gesellschaftlichen Konflikte fungieren Parteien als stabilisierende Faktoren innerhalb einer Demokratie (ebd. 3-6). Hier ist vor allem die historische Komponente des Wählens interessant. Nach Lipset und Rokkan ist an den Wahlakt eine starke historische Erfahrung gebunden: They [the voters, Anm. d. Verf.] are typically faced with choices among historically given ‘packages’ of programs, commitments, outlooks, and, sometimes, Weltanschauungen, and their current behavior cannot be understood without some knowledge of the sequences of events and the combination of forces that produced these ‘packages’. (Lipset/Rokkan 1969: 2-3) Im Zuge von Wahlen wird nicht nur die dialektische Bindung von staatsbürgerlichen Subjekten und dem Staatsapparat erneuert, gleichzeitig werden über die Parteien auch historisch determinierte Qualitäten in das Verhältnis von Gemeinschaft (Staat) und Subjekten (Staatsbürgerinnen/Staatsbürger) eingeschrieben. 2.2 Sozialpsychologischer Ansatz Ausgehend von den Ergebnissen der Lazarsfeld Studie in Erie County und bundesweiten Befragungen eines ca. 2000 Wähler und Wählerinnen umfassenden, nationalen Samples zu den USPräsidentschaftswahlen im November 1948 bzw. 1952 entwickelten Angus Campbell, Gerald Gurin und Warren E. Miller (1954) an der University of Michigan, Ann Arbor einen sozialpsychologisch orientierten Ansatz zur Erklärung des Wahlverhaltens.1 In der 1960 erschienenen Publikation ‚The American Voter’ wurden die Ergebnisse der vorangegangen Studie um Befragungen desselben Samples zu den US-Kongresswahlen 1954 bzw. den US-Präsidentschaftswahlen 1956 erweitert (Campbell u. a. 1960). 1 „The research of the Center is largely socio-psychological in orientation, being guided by the philosophy that the immediate determinants of an individual’s behavior lie more clearly in his attitudes and his perceptual organization of his environment than in either his social position or other ‘objective’ situational factors.” (Rossi 1964: 333) 5 Für die vorliegende Arbeit sind vorwiegend zwei der vier Hauptthemen der Michigan-Studie von Bedeutung: • Politische Partizipation wurde als abhängige Variable untersucht: Participation, so defined, is related to the abscence of conflicting motivation for voting for one or the other side of the contest. Conversely the more the voter’s motivation is in conflict, the less is his participation. For example, the more clearly partisan the voter is on issues, the more likely he is to be a heavy participant. (ebd.: 334) • Die individuelle Wahlentscheidung wurde als kaum von Themen und Kandidaten bestimmt bewertet, sondern in Abhängigkeit gesetzt zum Identifikations- und Bindungsgrad hinsichtlich einer Partei (vgl. ebd: 183). Darauf basierend ziehen die Studienautoren folgenden – auch für die Analyse des österreichischen politischen Systems – zentralen Schluss: It follows from our prior discussions that the strong partisan who lacks any real information permitting him to locate either party on a question of policy may find it relatively easy to presume that his chosen party is closer to his own belief regarding that policy than is the opposition. (Campbell u. a. 1960: 186) Solange also die bestehenden Strukturen nicht in Frage gestellt werden, spielt die Beurteilung aktueller Inhalte der Politik2 auf einer individuellen-gemeinschaftlichen Ebene nur eine untergeordnete Rolle für die Wahlentscheidung. 2 „Die wirklichen Zweifler – die aufgeschlossenen Wähler, die ernsthaft versuchen, die Wahlkampfthemen und die Kandidaten unbefangen danach abzuwägen, ob sie dem ganzen Land nützen, – existieren allerdings nur in einer rücksichtsvollen Wahlpropaganda, in den Lehrbüchern der Staatsbürgerkunde, in den Filmstreifen und in den Köpfen einiger politischer Idealisten. Im wirklichen Leben sind es nur wenige.“ (Lazarsfeld/Berelson/Gaudet 1969: 138) 6 3 Ein poststrukturalistisches Erklärungsmodell 3.1 Zugang Ausgehend von der begrifflichen Bearbeitung des (staatsbürgerlichen) Subjekts untersuchen wir dessen Verhältnis zu den Parteien in einem dialektischen Sinn. Auf diese Weise sollte es uns gelingen, eine konzise Beschreibung von Parteienstaat und Ausgestaltung der demokratischen Qualitäten des politischen Systems Österreichs vorzunehmen. Das Cleavage-Modell von Lipset und Rokkan dient uns als Anknüpfungspunkt für eine kritische Beurteilung des Entstehens von Parteien in Österreich. Unter Berücksichtigung der historischen Umstände verwundert es nicht, dass sowohl Sozialdemokratische Arbeiterpartei, Christlichsoziale Partei und Deutschnationale Parteien innerhalb eines relativ kurzen Zeitraumes gegründet wurden. Das mit dem Machtverlust des Kaisers einhergehende innenpolitische Vakuum wird durch die Gründung von Parteien, welche die damaligen fundamentalen gesellschaftlichen Konflikte widerspiegelten, ausgefüllt. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass die Gründung einer bürgerlich-liberalen Partei nicht erfolgt. Außerdem erscheint es notwendig zu untersuchen, inwiefern der Grundstein für die für Österreich charakteristische starke Parteibindung und die hohe Wahlbeteiligung schon in dieser Periode der Entstehung von Parteien gelegt wurde. Und was sich bis zur Mitte der 1980er Jahre verändert hat, als erstmals wieder eine neue Partei relevant werden konnte. 3.2 Methodologie In Angriffnahme der wissenschaftlichen Bearbeitung der in Kapitel 1.1 formulierten Fragestellungen bzw. der Überprüfung der in Kapitel 1.2 aufgestellten Hypothesen bedienen wir uns eines historischempirisch-dialektisch-diskursiven Zuganges. Für Foucault ist das Subjekt Ergebnis einer Verknüpfung diskursiver und nicht-diskursiver Praktiken. Aus der Anwendung von Wissen und Macht erfolgt letztendlich die Konstituierung des Subjekts im historischen Prozess der Unterwerfung (vgl. Foucault 1978: 51). In diesem Sinne betrachten wir Wahlen selbst als Folge diskursiver und nicht-diskursiver Praktiken. Demgemäß erlangt die Wahlbeteiligung, begründet in einem historischen Prozess der Unterwerfung, ihre Ausformung im Akt der Anrufung des Subjekts. Der von uns gezeichnete Diskurs hinsichtlich Individuen und Parteien erscheint einerseits als kohärente, stabile und regelhafte Struktur, jedoch andererseits auch als durch die ihm zugrunde liegenden Ereignisse bestimmt: Diese scheinbare 7 Ambivalenz findet sowohl in der Ordnung und Gewichtung des vorliegenden Materials, welche Übereinstimmungen konstruiert bzw. rekonstruiert, als auch im Blick auf Differenz und Ereignishaftigkeit (vgl. Bublitz 1999: 24) ihren Ausdruck. Die von uns gewählte Methode versucht Macht im Sinne Foucaults dort zu verorten, wo sie sowohl entsteht als auch wirkt. Weder gehen wir in normativer Hinsicht vom klassischen (utopischen) Demokratiemodell des, in Gestalt des Volkes wirkenden, allmächtigen Souveräns aus, noch versuchen wir, einem elitären, hegemonialen Parteienstaat im Sinne Max Webers den Sitz der Macht zuzuweisen. Vielmehr sind es die Zeugnisse dynamischer, historischer Prozesse, die es uns ermöglichen, eine konzise Beschreibung dessen zu erreichen, was hinter den Zeichen Wahlbeteiligung und Parteien verborgen scheint (vgl. Foucault 1981: 183-186). Demnach käme auch also auch dem Konzept der Diskursanalyse aus der „Archäologie des Wissens“ die Aufgabe zu, den gewohnten Blick auf die Gegenwart zu verändern. Aus dieser Perspektive erscheint der Umstand, dass Foucault eben nicht nur nach historischen Apriori gegliederte, durch verschiedene Positivitätstypen charakterisierte und durch distinkte diskursive Formationen aufgeteilte Aussagemengen beschreibt, sondern ausgehend von einem bestimmten Vorwissen mit Hilfe eines bestimmten methodischen Instrumentariums neue, andersartige Einheiten – die Diskurse – konstruiert, weniger als erkenntnistheoretischer Zirkel denn als erkenntnispolitische Option. (Bührmann 1999: 59) Um die „spezifisch österreichischen“ Eigenschaften des politischen Systems, die relativ konstant hohe Wahlbeteiligung bzw. Parteienkonzentration, zu erklären, müssen wir uns mit jenen Ereignissen auseinandersetzen, welche diese Qualitäten begründen. Auch bedarf es der Einbeziehung der spezifischen historischen Akte, welche den Grundstein für die Ausformung der österreichischen Demokratie legten. Darauf aufbauend werden wir die integrative Funktion der Parteien näher beleuchten und die österreichische Geschichte als eine Geschichte des subjektivierten Parteienstaates zeichnen. Um dies zu erreichen, erscheint uns eine Verbindung von quantitativen (Wahlergebnisse der österreichischen Wahlen zum Nationalrat seit 1945) und qualitativen empirischen Daten (Literatur) sinnvoll. 8 4 Das Subjekt Das Subjekt beschäftigt seit Jahrhunderten sämtliche wissenschaftliche Disziplinen. Es wird geboren und zu Grabe getragen, wieder zum Leben erweckt und neu zusammengesetzt. Einen einheitlichen Subjektbegriff gibt es nicht, auch wir wollen ihn in unserer Arbeit nicht definieren, wir wollen aber eine Begriffsklärung vornehmen, um klarzustellen, was sich die Leserin / der Leser vorzustellen hat, wenn wir auf den folgenden Seiten von „Subjekt“ sprechen. Die beiden Bedeutungen des Begriffs „Subjekt“, nämlich das griechische hypokeímenon und das lateinische subiectum, zeigen den großen philosophischen Spielraum und die Ambivalenz dieser Idee: Das subiectum als Zugrundeliegendes, dem vor allem der moderne Idealismus von Descartes bis Sartre anhängt, während postmoderne Theorien viel eher von subiectum, im Sinne des Unterworfenen, Zerfallenden sprechen (vgl. Zima 2000: XI). Der postmoderne und auch der poststrukturalistische Subjektbegriff sind damit als Kritik am Subjekt der Aufklärung zu verstehen, das als abgegrenztes, einheitliches Subjekt konstituiert ist, geleitet von Vernunft, der als objektiv, zuverlässig und universell angesehenen Quelle von Wissen. Die poststrukturalistische Subjektkritik verabschiedet das Subjekt nicht, sondern hinterfragt vielmehr seine Konstitution als Effekt gesellschaftlicher und politischer Rituale, Diskurse und Machtverhältnisse. Judith Butler (2001: 12) etwa beschreibt das Subjekt als „[...] die Wirkung eines Rückstoßes der Macht.“ Macht stellt für Butler im Rückgriff auf Foucault ein essentielles Moment ihrer Subjekttheorie dar: Der Prozess der Unterwerfung („Subjektivation“) unter Macht ist zugleich der Moment der Subjektwerdung (ebd.: 8): Verstehen wir [...] mit Foucault Macht auch als das, was Subjekte allererst bildet oder formt, was dem Subjekt erst seine schiere Daseinsbedingung und die Richtung seines Begehrens gibt, dann ist Macht nicht einfach etwas, gegen das wir uns wehren, sondern zugleich im strengen Sinne das, wovon unsere Existenz abhängt und was wir in uns selbst hegen und pflegen. (ebd.: 7 f.) 4.1 Subjektkonstituierung Die Alterität steht im Mittelpunkt von Judith Butlers Abhandlungen über die Konstituierung von Subjekten. Sie greift dabei auf Derridas Konzept des konstitutiven Außen zurück. In Anlehnung an Foucault stellt Butler fest, dass das Verschmähte, das Verbotene gleichzeitig entscheidend ist, um das Gebotene als solches zu identifizieren, zu determinieren. Die Ausschließungen seien, so Butler (1995: 67), die eigenen nicht thematisierbaren Notwendigkeiten der Einschließungen. Im Prozess der Subjektwerdung sei die Verwerfung des Anderen essentiell, so Butler. Im Zuge der Abgrenzung des Selbst von anderen Subjekten komme es notwendigerweise zu Ausschlüssen. Diese Ausschlüsse seien 9 aber - wiederum notwendigerweise - insofern wieder zum eigenen Subjekt gehörig, als es ohne sie keine Grenzen des Selbst gäbe. Ohne Ausgeschlossenes kein Eingeschlossenes. [...] ist also das Subjekt durch die Kraft des Ausschlusses und Verwerflichmachens konstituiert, durch etwas, was dem Subjekt ein konstitutives Außen verschafft, ein verwerfliches Außen, das im Grunde genommen ‚innerhalb‘ des Subjekts liegt, als dessen eigene fundierende Zurückweisung. (ebd.: 23) Butler verknüpft hier linguistische und psychoanalytische Ansätze und bestimmt das Subjekt als eine Position in der Sprache, das durch die Abgrenzung von einem konstitutiven Außen definiert wird (vgl. Engel 2002: 66). Es gelangt also erst dann zur eigenen Autonomie, wenn es die Abhängigkeit vom Außen verdrängt hat (vgl. ebd.: 66). Die Ich-Identität ist demnach denkbar instabil und muss ständig gegen eine potentielle Heimsuchung durch das Andere verteidigt werden – was passiert, indem die Abgrenzung umso rigider erfolgt (vgl. ebd.). Während feministische Theorien herausgearbeitet haben, wie dieses Verworfene weiblich konnotiert ist (siehe Irigaray, Wittig etc.), konzentriert sich Butler darauf, dass die Konstituierung beider Geschlechter auf Verwerfung basiert, nämlich jener der Homosexualität (vgl. ebd.: 67). Die Kohärenz von Identität wird bei Butler damit diskursiv hergestellt, durch permanente Wiederholung und Rituale ständig aufs Neue konstituiert und bestätigt. Die in der Psychoanalyse und bei Butler für die Subjektkonstituierung als essentiell bewertete Verwerflichmachung eines konstitutiven Außen lässt für Butler nur mehr eine Konsequenz zu: Die Infragestellung kohärenter Identitäten an sich. Wenn die Konstituierung kohärenter Identitäten der Produktion von Verwerfungen und damit rassistischer, homophober, sexistischer Ausschlussmechanismen bedarf, dann kann das politische Ziel nicht eine Pluralisierung von Subjektpositionen sein. Viel mehr müssten die Mechanismen der Ausschließung hinterfragt werden und sich schließlich darauf eingelassen werden, von der Inkohärenz von Identitäten auszugehen (vgl. ebd.: 69). 4.2 Interpellation Ins Leben gerufen wird das Subjekt, sei es mittels Anrufung oder Interpellation im Sinne Althussers oder mittels diskursiver Produktivität im Sinne Foucaults, durch eine ursprüngliche Unterwerfung unter die Macht. (Butler 2001: 8) Butler übernimmt den Begriff der Anrufung von Althusser, der davon ausgeht, dass die Subjektkonstitution im Rahmen einer Transaktion zwischen Individuen und kulturellen wie gesellschaftlichen Institutionen erfolgt, die mittels ihrer Diskurse die Perspektive des Individuums prägen. „Die gesellschaftlichen Institutionen benennen den einzelnen unter einer bestimmten Perspektive, fordern ihn auf, sich als ein Bestimmter ‚zu erkennen‘, in ihrem Spiegel zu betrachten [...]“ (Seifried 2000: 19). 10 Die Ideen, so Althusser, die das Subjekt also scheinbar freiwillig über sich selbst entwickelt, entspringen tatsächlich höchst ideologisierter Apparate und Institutionen (vgl. ebd.: 19). Das Individuum fügt sich seiner Unterwerfung und wird zum Subjekt, indem es die ihm zugewiesene gesellschaftliche Position als seine eigene annimmt. Althusser bringt dazu das Beispiel der polizeilichen Anrufung: Ein Polizist ruft einem Individuum auf der Straße „He, Sie da“ nach, das Individuum reagiert und dreht sich nach dem Polizisten um. Im Moment des Umdrehens wird es zum Subjekt, weil es die Anrufung als ihm geltend angenommen hat. Althusser meint hierzu in Umkehrung von Hegel: „Die Anrede selbst konstituiert das Subjekt innerhalb eines möglichen Kreislaufs der Anerkennung oder umgekehrt, außerhalb dieses Kreislaufs, in der Verworfenheit“ (Butler 1998: 14 f.). Für Butler stellt sich hier die Frage, warum dann aber ein bereits konstituiertes Subjekt von einer Anrufung in Angst versetzt werden kann und folgert: „Angesprochen werden bedeutet [...] nicht nur, in dem, was man bereits ist, anerkannt zu werden; sondern jene Bezeichnung zu erhalten, durch die die Anerkennung der Existenz möglich wird“ (ebd.). Während bei Althusser diese Anrufung durch eine ideologische, fast gottähnliche Instanz (Partei, Staat, Kirche etc.) erfolgt und vor allem diese Anrufung das Subjekt in einem einzelnen Akt vollständig konstituiert, streicht Butler hervor, dass jedem performativen Akt auf dem Weg der Iterabilität sein eigenes Scheitern inhärent ist, sprich Möglichkeiten des Widerstands vorhanden sind (Posselt 2003). Butler spricht hier von einer Kluft zwischen dem Sprechakt und der Verletzung, die es zwar erschwert bzw. unmöglich macht, eine Verbindung zwischen Sprechakten und verletzenden Effekten festzustellen, gleichzeitig aber Raum lässt für ein Zurück-Sprechen. Wie jeder performativer (Sprech-)Akt, kann auch die Anrufung im Sinne Austins (2003: 63-71) verunglücken. Ist auch Althussers monolither und vereinheitlichter Ideologiebegriff stark umstritten und großteils nicht mehr anwendbar, möchten wir dennoch am Konzept der Interpellation festhalten, da es verdeutlicht, dass Subjektivität zum einen nur in Gemeinschaft Sinn hat und erreichbar ist, und zum anderen zeigt, wie gesellschaftliche Intelligibilität hergestellt wird durch die Annahme subjektivierter Positionen. Das fragliche Individium [sic!] verhält sich in der einen oder anderen Weise, entscheidet sich für dieses oder jenes praktische Verhalten und nimmt vor allem als Subjekt an bestimmten geregelten Praxen teil, die die des ideologischen Staatsapparats sind, von dem seine bei vollem Bewußtsein freigewählten Ideen »abhängen«. (Althusser 1977: 137) Die Interpellation im Sinne Althussers und Butlers ist also eine Äußerung, die selbst eine zitathafte Kette von Bedeutungen, Ritualen und Konventionen anruft und dadurch ein Subjekt nicht nur durch Unterwerfung konstituiert, sondern auch seine Handlungsfähigkeit herstellt: „Das Ich, das durch die 11 Anrufung hervorgebracht wird, erlangt sein Handlungsvermögen gerade durch seine Einbezogenheit in die Machtbeziehungen, die es bekämpft.“ (Posselt 2003) Zusammenfassend lässt sich daher sagen: Das Subjekt ist die sprachliche Gelegenheit des Individuums, Verständlichkeit zu gewinnen und zu reproduzieren, also die sprachliche Bedingung seiner Existenz und Handlungsfähigkeit. Kein Individuum wird Subjekt, ohne zuvor unterworfen/subjektiviert zu werden oder einen Prozeß der ‚Subjektivation‘ (nach dem französischen assujettissement) zu durchlaufen. (Butler 2001: 15) 4.3 Individuum / Individualisierung Der Begriff des Individuums taucht erst in der Moderne auf, da - wie etwa Norbert Elias (1996: 128) meint - in der Antike noch kein Bedürfnis vorherrschend war nach einer Ich-Identität, noch war die Gruppenidentität ausreichend3 (Zima 2000: 5). Die klassische Soziologie geht von einer allmählichen Herauslösung der/des Einzelnen aus der christlich-feudalen Gemeinschaft und Freisetzung als Arbeitskraft oder Unternehmer bzw. Unternehmerin im Kapitalismus aus (ebd.). Den Begriff der Freisetzung verwendet in diesem Sinne auch Ulrich Beck, wenn er Individualisierung als Freisetzung aus Traditionen des Sexuallebens, der Ehegestaltung, der Geschlechtsrollenzuweisung und der Fixierungen von „Normalbiografien“ definiert (Eickelpasch/Rademacher 2004: 17). Diese Freisetzung ist allerdings keineswegs eine neue Erscheinung, sondern war auch schon beim Übergang von der Stände- zur Industriegesellschaft zu beobachten, wie Beck weiter festhält. Das Neue oder „Postmoderne“ an der Individualisierung ist für Matjan (1995: 6) jedoch, dass es eine Phase ist, die sowohl die Freisetzung als auch die Standardisierung von Lebensverhältnissen überlagert, ohne sie abzulösen. Die Individualisierung, wie wir sie hier verstehen, kann rückgeführt werden auf die Anrufung von Individuen als formal freie und gleiche Marktteilnehmerinnen und Markteilnehmer, Konsumentinnen und Konsumenten sowie Staatsbürgerinnen und Staatsbürger: „Der Markt strukturiert und individualisiert dabei die alltäglichen Erfahrungen, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster in Form von Konkurrenz, Lohnarbeit und Konsum“ (Naumann 2001). Waren bis vor wenigen Jahrzehnten gemeinschaftliche Erfahrungen wie Familie, Kirche, Partei und Erwerbsarbeit entscheidende Identität stiftende Angelpunkte, so ist seit den 1960er Jahren ein Aufbrechen dieser Bindungsstrukturen zu bemerken. Matjan (1995: 7) nimmt in diesem 3 „Letzten Endes liegt dieser Dichotomie [zwischen Menschen als Individuen und Menschen als Gesellschaften, Anm. d. Verf.] eine spezifische Selbsterfahrung zugrunde, die etwa seit der Renaissance für immer weitere Kreise der europäischen Gesellschaften charakteristisch ist und es zuvor vielleicht in Ansätzen für einige intellektuelle Eliten der Antike war.“ (Elias 1996: 128) 12 Zusammenhang eine Begriffsabgrenzung der unterschiedlichen Perioden vor: Die Klassen der Massengesellschaft werden ab dem Zweiten Weltkrieg abgelöst von sozialen Milieus (denen Matjan schon eine deutlich geringere sozio-moralische Bindekraft zuschreibt als den Klassen) und ab Ende der 1960er Jahre von den Lebensstilen. Während die sozialen Milieus neben den ökonomischen Widersprüchen zusehends mit weiteren Fragen wie Jugend/Alter, Stadt/Land etc. zu kämpfen hatten, sind die Lebensstile gekennzeichnet von radikaler Pluralisierung, Fragmentierung und einer Instabilität sozialer Ordnungsmuster (vgl. ebd.) Diese Instabilität macht sich - wie schon erwähnt - nicht zuletzt in Familienformen, Kirchen- und Parteienbindungen und Erwerbsarbeitsmodellen bemerkbar. Gaben diese Bindungen bisher Auskunft über die eigene Identität und damit auch über den eigenen Lebensweg, sieht sich das „flexibilisierte Subjekt“ zahllosen „Bausätzen biographischer Kombinationsmöglichkeiten“ (Beck 1986: 217) gegenübergestellt. Zwar wurde diese neu gewonnene „Freiheit“ unter anderem von Feministinnen vielfach als Chance gesehen, der rigorosen Starre des bürgerlichen Subjekts zu entgehen, (hetero-)sexistische, rassistische Mechanismen zu unterspülen und einer neuen Geschlechterpolitik Platz zu machen, doch kommt es vielfach zur „[...] ‚Retorsion‘ (Taguieff) emanzipatorisch intendierter Begriffe geschlechtlicher Differenz im Sinne der Reinstallation heterosexistischer Verhältnisse [...], die nun als selbstbewußt gewählte Lebensform erscheinen“ (Naumann 2001). Die Orientierungsmasten in der pluralisierten Gesellschaft sind wegen der zahllosen Möglichkeiten kaum mehr zu sehen, die Menschen würden durch die Fülle an Deutungs-, Stilisierungs- und Identitätsangeboten verwirrt, meinen etwa Eickelpasch und Rademacher: Was die Menschen an ‚Möglichkeitsraum‘ hinzugewonnen haben, ist immer in Gefahr, gleich wieder fremdbesetzt zu werden. [...] Marktmechanismen und gesellschaftliche Medien dringen auf breiter Front in die durch die Auflösung traditionaler Bindungen unterbestimmte Privatsphäre ein und liefern den Menschen bis in alle Fasern der Existenz an eine bislang unbekannte Außensteuerung aus. (Eickelpasch/Rademacher 2004: 23) Die zunehmend von zeitlicher Beschränkung gekennzeichneten Bindungen an Instanzen wie Familie, Beruf, Kirche, Partei etc. und die Fragmentierung der Biografien führen auch zu einer Erosion von Kollektivinteressen. „Einzelschicksale“ und „Einzelinteressen“ dominieren die Berichterstattung, Anliegen können nicht mehr zu Allgemeininteressen gebündelt wahrgenommen werden. „Insgesamt werden die Subjekte zunehmend entsolidarisiert und vereinzelt und die Rede von Chancengleichheit verschiebt sich zusehends zur Rede von individueller Leistungsbereitschaft und individuellem Scheitern.“ (Naumann 2001) 13 5 Parteienstaat, Subjekt und Demokratie 5.1 Übergang Monarchie – Republik Im absolutistischen System lag die in der Erbfolge begründete Herrschaftsgewalt beim Souverän. Während sich demokratische Institutionen - in der Verfassung von 1867 war ein, wenngleich auch faktisch rechtloses, Parlament vorgesehen - entwickelten, blieb der autokratische Charakter des politischen Systems Österreichs bis zur Ersten Republik bestehen (vgl. Pelinka 1999: 10). Seit dem Sturz der Regierung der liberalen Bourgeoisie 1879 konnte der bürgerliche Liberalismus in Österreich nie mehr jene gestaltende Rolle übernehmen, die ihm noch im Jahrzehnt zuvor zugekommen war. Stand in ihrer Politik die Aufrechterhaltung der vom Kapital abgeleiteten Herrschaft im Vordergrund, so stießen aber ihre Versuche, den Einfluss der Kirche im Staat zu limitieren, auf rege Zustimmung der Wiener Bevölkerung (vgl. Ucakar 1985: 141-214). Als Antwort auf den steigenden Zuspruch des Volkes zu diesen liberalen Tendenzen entwickelte der Klerus die Idee des christlichen Sozialismus4 (vgl. Ucakar 1985: 142). Gleichzeitig hatte sich im Schatten der tatsächlichen Verfasstheit des politischen Systems ab 1867 im cisleithanische Teil der Monarchie ein Nebeneinander von ideologisch definierten Subgesellschaften auskristallisiert (vgl. Pelinka 1999: 11f.). Als sich um 1890 aus diesen Subgesellschaften die sozialdemokratische und die christlichsoziale Partei formierten5, geschah das in beiden Fällen im Sinne einer nicht zu vernachlässigenden Abgrenzung gegenüber dem politischen Liberalismus, was bis in die Zweite Republik weitreichende Auswirkungen zeitigen sollte. (vgl. Staudinger/Müller/Steininger 1995: 161; Ucakar 1985: 225-230) 5.2 Der gemeinsame „Feind“ – Antisemitismus als integrative Klammer Die politische Kultur der Ersten Republik zeichnete sich durch ein Spezifikum aus: dem Fehlen einer liberalen Strömung. Die ehemaligen Liberalen versanken bereits in der Monarchie in die Bedeutungslosigkeit und hatten schließlich fast nur mehr in bürgerlich-jüdischen Kreisen einen Rückhalt. Das rechte politische Spektrum war in der Ersten Republik durchgehend antisemitisch. Das erklärt, warum selbst bürgerliche Juden sich gezwungen sahen, sozialdemokratisch zu wählen (Simon 1971). Der antisemitische Konsens der rechten Regierungskoalitionen übte normativ einen großen Einfluß auf die Bevölkerung aus. (Lichtblau 1995: 458 f.) 4 „Bis dorthin hatte die Kirche die bürgerlichen Interessen gegen die umstürzlerischen Sozialisten verteidigt; von nun ab wendet sie sich den vom Kapitalismus bedrängten kleinen Leuten zu und erfindet den christlichen Sozialismus“ (Renner zitiert nach Ucakar 1985: 142). 5 Deren Nachfolgerinnen, die nach 1945 eine entscheidende Rolle spielten, wiesen jedoch nicht mehr diese ideologischen Brüche auf, wie dies noch in der Ersten Republik der Fall war. 14 Einem Einfluss dem auch die Sozialdemokratische Partei wenig entgegen setzen konnte bzw. wollte. Denn während die SDAP von Christlichsozialen und Deutschnationalen zwar als „Judenschutztruppe und „verjudet“ beschimpft wurde, war sie selbst von Antisemitismus nicht frei6. Mit der Monarchie hatten die österreichischen Jüdinnen und Juden auch ihren „Schutzherrn“ verloren (vgl. Lichtblau: 457 f.). Nicht nur war der Konsens zum Schutz der jüdischen Minderheit von allen bedeutenden Parteien aufgekündigt worden, die „integrativ wirkende Klammer des Antisemitismus“ (Lichtblau 1995: 459) verband sogar politische Gegner. Auf der einen Seite, in dem sie sich wie christlichsoziale und deutschnationale Verbände direkt - zum Beispiel im Antisemitenbund - zusammenschlossen (vgl. Hofinger 1994: 85), auf der anderen Seite, in dem sie, wie die Sozialdemokraten, den antisemitischen Diskurs akzeptierten und nicht den Antisemitismus, sondern die Verknüpfung von Sozialdemokratie und Judentum zurückwiesen (vgl. Lichtblau 1995: 457 f.). 5.3 Konstituierung der österreichischen Demokratie und des Subjekts nach 1945 Nach Ende des Zweiten Weltkrieges begründeten die Nachfolgeparteien SPÖ und ÖVP sowie die KPÖ die Zweite Republik mit Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung im April 19457. Hierbei ist vor allem die besondere Situation nach den Wahlen 1945 zu berücksichtigen, welche im weiteren Verlauf eine prägende Funktion für die Entwicklung des Parteiensystems im Verlauf der ersten Hälfte der 2. Republik übernahm (vgl. Müller 1996: 59-66). Einerseits war die demonstrierte Einigkeit der Großparteien Vorrausetzung für die Erlangung der Unabhängigkeit Österreichs von den Besatzungsmächten durch den Staatsvertrag 1955, andererseits basierte diese jedoch auf der Umdeutung der Geschichte – nicht so sehr einer Verdrängung bzw. Tabuisierung der NS-Zeit und des Austrofaschismus (vgl. Enderle-Burcel 1995: 85; Appelt 1999: 104) – seit Gründung der Republik im Jahr 1918. Was unseres Erachtens hier verdrängt werden musste, war weniger die Zeit des Nationalsozialismus von 1938 bis 1945, sondern vor allem, dass alle bedeutenden österreichischen Parteien, den Weg dafür bereitet hatten. Einerseits dadurch, dass in der Ersten 6 „In einem "Der Judenschwindel" betitelten Buch versuchten sie [die SDAP, Anm. d. Verf.] sich gegenüber den Christlichsozialen und Großdeutschen sogar als die besseren, effektiveren Antisemiten zu verkaufen. Im Falle der jüdischen Kriegsflüchtlinge behauptete das Buch, lediglich die Regierung Renner, die [sozialdemokratischen, Anm. d. Verf.] Landeshauptmänner Sever und Reumann hätten sich ernsthaft bemüht, "die Ostjuden hinauszubringen" (Hinteregger 1923, 72). Mit dem zynisch-opportunistischen Vorwurf, die "arischen" Antisemiten würden gerne die materielle Unterstützung von jüdischen Kapitalisten in Anspruch nehmen, und mit hämischen Hinweisen auf die Ineffektivität antisemitischer Politik schürten die Sozialdemokraten bei ihren Mitgliedern sicherlich antijüdische Ressentiments.“ (Lichtblau 1985: 457 f.) 7 Schon der Unabhängigkeitserklärung lagen nach Pelinka (1987: 145) Gedächtnislücken zu Grunde. Die Jahre von 1938 bis 1945 wurden als Fremdherrschaft eingestuft. „[D]ie Repräsentanten des Austrofaschismus, jetzt Vertreter der neugegründeten ÖVP, konnten nun als Antifaschisten auftreten; die republikanischen, insbesondere auch sozialdemokratischen Wurzeln des Anschlussgedankens wurden vergessen. Karl Renner, Propagandist der nationalsozialistischen Ja-Parole vom April 1938, unterzeichnete nun als Vertreter der zur SPÖ gewordenen Sozialdemokratie die Unabhängigkeitserklärung“ (vgl. Pelinka 1987: 145 zitiert nach Appelt 1999: 106 f.). 15 Republik weder Sozialdemokraten noch Christlichsoziale Interesse daran hatten, eine positive Identifikation mit der Republik Österreich herzustellen (vgl. Appelt 1999: 104), und andererseits deshalb, weil zwar der Nationalsozialismus abgelehnt wurde, nicht aber der Antisemitismus. Es ist eine Ironie der österreichischen Geschichte, daß die engagiertesten Gegner des Nationalsozialismus im katholischen Lager exponierte Antisemiten waren (Eppel 1980). Ein Exempel hierfür wäre der berüchtigte Hirtenbrief des Linzer Bischofs Gföllner vom 23. Jänner 1933. Seine Angriffe galten der Vergötterung der arischen Rasse durch die Nationalsozialisten und zugleich dem postulierten internationalen jüdischen Weltgeist und gottentfremdenden Einfluß der Juden (John/ Lichtblau 1993, 305 ff.). (Lichtblau 1995: 459) Dieser nach Außen hin durch Tabuisierung und Verdrängung bestimmte Grundkonsens führte zur paradoxen Situation, dass ideologische Konfliktlinien ausgeblendet, und frühere Grundhaltungen zugunsten von Kompromissen zwischen den Parteien8 aufgegeben wurden, welche im selbst verordneten ‚Zwangsfrieden’ der späteren Koalitionsparteien ihre Ausformung fand (vgl. Winckler 1985: 295). Über die Konstituierung der österreichischen Demokratie als Zweite Republik kam es auch zu einer Einschreibung parteipolitischer Identitäten in das soeben von den Parteien SPÖ und ÖVP rekonstituierte staatsbürgerliche Subjekt. Der historische Kompromiss zwischen Kapital und Arbeit, dessen Grundstein schon durch die Formierung der Parteien in Abgrenzung zum wirtschaftlichen und politischen Liberalismus im Laufe der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelegt worden war (siehe Kapitel 5), erforderte den Einfluss der Verbände auf die Regierungspolitik der großen Koalition. Das latente Misstrauen zwischen SPÖ und ÖVP wiederum wurde durch das Proporzsystem ruhig gestellt (Hanisch 1997: 15). 5.4 Verflechtung der „Großparteien“ mit Zivilgesellschaft und Staatsapparat [P]ost-war politics in Austria has been party politics par excellence, in which the two major parties (SPÖ and ÖVP) in particular have established a substantial grip on political institutions and civil society. Scarcely any relevant appointment or decision has been made without the major parties, or in a truly `non-party´ spirit, while society itself has been colonized by party to an extent in which almost all societal organizations (from the automobile associations to the major conservationist organizations) bear a party label or have close links to one of the two major parties. (Müller 1994: 51 f) Die Konstituierung der österreichischen Demokratie durch SPÖ und ÖVP bildete die Grundlage für diese von Müller beschriebenen Entwicklungen. Die Anrufung des staatsbürgerlichen Subjekts durch die Parteien funktionierte über den Gründungsakt. Mit der schnellen Abhaltung der ersten Nationalratswahlen noch im Jahr 1945 verfestigten sich die Anrufungsstrukturen. Im Sinne von 8 Kompromisse, die sicher auch dadurch erleichtert wurden, dass in der SPÖ VertreterInnen des gemäßigtliberalen Parteiflügels nach dem Krieg, entweder von den Nationalsozialisten ermordet oder vertrieben worden waren, - jedenfalls in der Partei keine sehr einflussreiche Rolle mehr inne gehabt haben. 16 Butlers Konzept der Performativität (siehe Kapitel 4.1) diente die Wahl der Bestätigung der von SPÖ und ÖVP geschaffenen, demokratischen Republik. Die gleichzeitige Verflechtung der Großparteien SPÖ und ÖVP mit der Zivilgesellschaft und dem Staatsapparat sowie die ihnen zukommenden umfassenden Steuerungsfunktionen über die Sozialpartnerschaft waren ausschlaggebend für die starke Parteibindung und die daraus resultierende konstant hohe Wahlbeteiligung. Diese begründet sich unter anderem in der ununterbrochenen Anrufung der Subjekte durch den Parteienstaat in fast all ihren Lebenswelten: Hierzu zählen zum Beispiel Erwerbsarbeit bzw. UnternehmerInnentum, Medien, Religion, Schule, Familie und Freizeit. Wenn wir primär von der Idee des Subjekts ausgehen, welches durch die Anrufung konstituiert wird, so äußert sich das Vorhandensein von klaren politischen Anrufungsstrukturen insofern in einer hohen Parteienbindung, als jener Bindungsakt erst durch die Konstituierung und Reiteration der Anrufung des Subjekts ermöglicht wird. Nach Althusser ist die Existenz des Subjekts an die Räume ideologischer Intervention und Interpellation gebunden - außerhalb dieser kann es nicht konstituiert werden (vgl. Althusser 1977: 137). Durch die sozioökonomischen Veränderungen in den 70er Jahren findet eine Verschiebung jener Anrufungsstrukturen statt, dafür verantwortlich ist wirtschaftlicher Druck von außen, auf den die Parteien SPÖ und ÖVP reagieren müssen. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass dem unterentwickelten Liberalismus in Österreich (siehe Kapitel 5.1 und 5.2) in Folge des von außen kommenden ökonomischen Drucks begegnet wurde. 5.5 Das Subjekt im Spannungsfeld von Demokratie und Markt Wegen der Weltwirtschaftskrisen in den 70er Jahren war die austro-keynesianistische Politik der staatlichen Steuerung und Abschottung der Volkswirtschaft auf Dauer nicht mehr aufrecht zu erhalten (vgl. Butschek 1985: 156-177). Auch in der Zusammenarbeit zwischen Verbänden und Parteien in der Sozialpartnerschaft taten sich neue Konflikte auf, der in Kapitel 5.3 erwähnte historische Kompromiss zwischen Kapital und Arbeit ließ sich immer weniger rechtfertigen (vgl. Tálos 1993: 25-27; Karlhofer 1993: 126-128). Als Folge der Modernisierungsprozesse Mitte der 70er Jahre, die unter Kreisky als Reaktion auf die veränderte Situation der Weltwirtschaft eingeleitet wurden (vgl. Unger 1993: 35-38) kam es zu einer fortschreitenden Individualisierung des Subjekts. Die Einbettung des Subjekts in die Substrukturen wurde instabiler. Diese Entwicklungen äußerten sich unter anderem in einem stetigen Sinken der Mitgliederzahlen der Parteien ab Mitte (siehe Kapitel 6.1, Diagramm 2 und 3) und des Gewerkschaftsbundes ab Ende der 1980er Jahre. Im Jahr 2002 hatte der ÖGB allerdings immer noch 1.406.519 (siehe Diagramm 1). 17 Aus einer vergleichenden Perspektive sind die Beziehungen zwischen diesen Parteien [SPÖ und ÖVP, Anm.] und den Interessenorganisationen ohne Zweifel immer noch sehr intensiv und gut. Dennoch gibt es relevante Änderungen seit den späten 70er Jahren, die ihre Wurzeln in den Reaktionen der Parteien auf die Veränderungen im Wählermarkt haben. (Müller/Plasser/Ulram 1999: 238) Wie im Kapitel 4.3 abzulesen, ist der Begriff der Individualisierung eng verknüpft mit ökonomischen Veränderungen, konkret mit der Frage der Stellung des Individuums in kapitalistischen Gesellschaften. Verschärft scheint diese Fragestellung nun durch neoliberale Politiken, die den vormals keynesianistisch organisierten Staat zunehmend zurückdrängen und das marktwirtschaftliche Prinzip auch in Arbeits-, Sozial-, Familien-, Umwelt- und Bildungsagenden einschreiben. Politische Räume werden in Zeiten des Neoliberalismus und der Globalisierung, die als eine beschleunigte und intensivierte Verknüpfung des Weltmarktes mit all seinen Vor- und Nachteilen zu verstehen ist, neu verhandelt (vgl. Sauer 2001: 300): Der Globalisierungsdiskurs ist Ausdruck einer Krise des sozialen Paradigmas, in dem neue Identitäten entstehen und alte verschwinden bzw. in Frage gestellt werden. Kern der Formulierung eines neuen hegemonialen Paradigmas ist die Grenzverschiebung zwischen öffentlich und privat. Neoliberalismus bedeutet einen Paradigmenwechsel in der Definition des ‚Privaten‘: Der Markt expandiert, öffentlich-staatliche Räume schrumpfen und werden zur Unkenntlichkeit privatisiert bzw. dereguliert, während Familie und Privatheit zugleich entgrenzt werden [...]. (ebd.) Die Grenze zwischen Öffentlich und Privat wird ins Absurde verkehrt, „Öffentlichkeit ist dort, wo private Geheimnisse und Intimitäten veröffentlicht werden“(Bauman 2003: 52). Was sich nicht umstandslos in den Jargon privater Anliegen, Sorgen und Interessen ausdrücken lässt, schreibt Bauman (ebd.) zuvor, hat keine Chance Eingang zu finden in den öffentlichen Diskurs. Zwangsläufig wird auch das politische Subjekt neu definiert: Politische StaatsbürgerInnenschaft wird individualisiert und damit gekoppelt an Bildung, Einkommen, Region, Mobilität etc - Ressourcen, die unter anderem entlang der Geschlechterachse angeordnet sind (Sauer 2001: 300). Der dem Neoliberalismus immanente Privatisierungsdiskurs definiert also StaatsbürgerInnenschaft neu, indem er ihre Universalisierung sukzessive revidiert, was wiederum Auswirkungen auf die politische Partizipation hat (vgl. ebd.: 302): Output-Legitimation (in Gestalt von Anpassungsleistungen) wird tendenziell gegenüber der Input-Legitimation (demokratische Partizipation) aufgewertet, faktische Teilhabe (durch staatliche Umverteilung) wird durch das Angebot potentieller Teilhabe (durch staatlich vermittelte Chancengleichheit) verdrängt. (Brock 1998: 282) 18 6 Parteien und Wahlen In der Politikwissenschaft herrscht weitgehend darüber Einigkeit, dass das Verhältnis der Wählerinnen und Wähler zu den politischen Parteien das Wahlverhalten entscheidend beeinflusst (vgl. Bürklin/Klein 1998: 18, siehe Kapitel 2.1). Uns erscheint es im Rahmen dieser Fallstudie notwendig, einen Schritt weiter gehen, denn während SPÖ und ÖVP die österreichische Demokratie in ihrer spezifische Ausformung konstituierten und sowohl mit Staatsapparat als auch Zivilgesellschaft untrennbar verflochten sind (siehe Kapitel 5), gilt das weder für FPÖ und Grüne. SPÖ und ÖVP haben nicht nur stabile Anrufungsstrukturen geschaffen, auch die diskursiven politischen Räume wurden von den beiden „Großparteien“ besetzt. Die Gleichung kann daher für uns nur lauten, Partei ist nicht gleich Partei. 6.1 Organisationsgrad von politischen Parteien Sowohl SPÖ als auch ÖVP sind Mitgliederparteien. Während die SPÖ schon in der Ersten Republik – damals SDAP – die höchste Organisationsdichte aller sozialdemokratischen Parteien in Europa erreichte (vgl. Maderthaner 1995: 180 f)9, entwickelte sich die ÖVP erst in der Zweiten Republik zu einer Mitgliederpartei (vgl. Müller 1994: 60; Staudinger/Müller/Steininger 1995: 163 f). Von 1945 bis 1949 stieg die Zahl der SPÖ-Mitglieder von 357.818 auf 614.366, 1979 erreichte sie mit 721.262 ihren höchsten Stand, um seit damals kontinuierlich zu sinken. Im Jahr 2003 waren „nur“ noch mehr 313.469 Österreicher und Österreicherinnen SPÖ-Mitglied. (vgl. Ucakar 1997: 259; APA0160, 25.Nov 2004, siehe auch Diagramm 2) Weniger eindeutig ist die Entwicklung der Mitgliederzahlen bei der ÖVP. Vor allem wegen der dezentralen Bündestruktur der Partei und unterschiedlicher Berechnungsweisen sind exakte Zahlen nicht vorhanden. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs konnte die Partei die Zahl ihrer Mitglieder jedenfalls erheblich steigern. 1945 hatte die ÖVP 441.000 Mitglieder, im Jahr 1971 waren 564.000 Österreicherinnen und Österreicher ÖVP-Mitglied, der bisher höchste uns bekannte Wert. Bis zum Jahr 1994 sank die Zahl der ÖVP-Mitglieder langsam, aber stetig auf 433.00010 ab (vgl. Müller 1997: 269-272, siehe auch Tabelle/Diagramm 3) 11. 9 Ihren Höhepunkt erreichte die Entwicklung 1929 mit 713.834 SDAP-Mitgliedern (vgl. Maderthaner 1995: 180). 10 Die ÖVP-Mitgliederzahlen ab 1995 waren für uns leider nicht verfügbar. Nachdem uns von Seiten der ÖVPZentrale (Abteilung Dokumentation) lediglich beschieden wurden, die ÖVP habe derzeit (im Herbst 2004) etwa 600.000 Mitglieder, kontaktierten wir ÖAAB, ÖBB und ÖWB. Wir erhielten entweder gar keine Antwort oder die Auskunft, dass wegen der dezentralen Organisation der Bünde die Mitgliederzahlen in den Zentralen in Wien nicht vorlägen. 11 Wir verwenden hier die minimalen Mitgliederzahlen, die sich folgendermaßen errechnen: ÖVP-Mitglieder = (ÖAAB-Mitglieder + ÖBB-Mitglieder + ÖWB-Mitglieder) x 0.85 (vgl.: Müller 1997: 271). 19 Der Organisationsgrad beider Parteien, also der Anteil der Mitglieder sowohl an den Wählerinnen und Wählern, als auch an den Wahlberechtigen, ist im internationalen Vergleich sehr hoch. Oder wie Müller zusammenfassend feststellt: (T)he parties as membership organizations are the largest in Europe in relative terms; and, despite the small size of the country, they are also among the largest in absolut terms. This applies both to the party system as a whole when compared to other party systems, as well as to each of the individual parties when compared to other members of its respective political family. (Müller 1994: 51) Und das, obwohl die Parteimitgliedschaft sowohl bei der FPÖ, als auch bei den Grünen eine geringe Rolle spielt. Zur Illustration: Die FPÖ hatte 1986 36.683 Mitglieder. In den folgenden Jahren konnten die Freiheitlichen die Zahl ihrer Mitglieder zwar steigern, aber nicht annähernd in dem Ausmaß, wie sie bei Wahlen Stimmen gewannen12. (Müller 1994: 58, 63 f.; Luther 1997: 293). Die Grünen hatten im August 2003 3493 Mitglieder13. 6.2 Politische Partizipation „Für den Großteil der Nachkriegszeit hat das österreichische Parteiensystem ein bemerkenswertes Ausmaß an Stabilität und Konzentration gezeigt“ (Müller/Plasser/Ulram 1999: 201). Bei den Nationalratswahlen der Zweiten Republik bis 1983 hat der Anteil der Stimmen für SPÖ und ÖVP an den Wahlberechtigen bis auf zwei Ausnahmen (1949 und 195314) immer über 80 Prozent betragen. Den zweithöchsten Stimmenanteil haben die beiden (damals noch) „Großparteien“ 1975 erzielt, 85,8 Prozent der Wahlberechtigten votierten entweder für die SPÖ oder die ÖVP. (siehe auch Diagramm 4) Von 1986 bis 1999 ist eine Dekonzentration des Parteiensystems auszumachen. In dieser Phase verfügen SPÖ und ÖVP nur mehr über rund ein Drittel der Parlamentssitze (vgl. ebd.: 202). Der bisher tiefste Stand bei Nationalratswahlen wurde 1999 erreicht, nur 47,5 Prozent der Wahlberechtigten haben ihre Stimme für eine der beiden „Großparteien“ abgegeben, was für Müller/Plasser/Ulram (1999: 202) den Schluss nahe legt, „daß die traditionellen Loyalitäten zwischen Wählern und Parteien zu einem guten Teil verschwunden sind“. SPÖ und ÖVP verloren aber nicht nur Wählerinnen und Wähler sowie Mitglieder (siehe Kapitel 6.1.), auch aus den Umfragedaten können wesentliche Veränderungen abgeleitet werden: So hat die 12 1996, das letzte Jahr von dem uns die Daten vorliegen, hatte die FPÖ 44.561 Mitglieder (vgl. Luther 1997: 293). 13 Laut einer Auskunft der Bundesgeschäftsführung vom 21.12.2004 (e-mail in unserem Besitz). 14 In beiden Jahren entfielen mehr als 10 Prozent der Stimmen auf den VdU, den Vorläufer der FPÖ, der 1949 gegründet wurde. Nach Misserfolgen bei mehreren Wahlen verschärften sich interne Konflikte im VdU, „was stark national geprägten Kreisen ermöglichte, den VdU zu übernehmen und dann im Oktober1955 in der neuen, zunächst noch stärker national gefärbten FPÖ aufgehen zu lassen“ (vgl. Luther 1997: 286). In der Folge stimmten bei Nationalratswahlen bis 1983 nie mehr als 7,4 Prozent der Wahlberechtigten für die FPÖ. 20 Parteiidentifikation abgenommen, generell haben sich die abgefragten Einstellungen gegenüber den Parteien und das Wahlverhalten verändert (vgl. ebd.:205-208). Die Veränderungen aller Indikatoren – Parteiensystem-Konzentration, Parteiidentifikation, Mitgliedschaft in politischen Parteien, langfristiges und kurzfristiges Wahlverhalten und Einstellungen gegenüber den Parteien – sind konsistent. Sie zeigen, daß die Großparteien ihre Verankerung in der Wählerschaft verlieren, welche lange Zeit charakteristisch für die Politik in der Republik Österreich gewesen ist. (ebd.: 208) Dieser Prozess sei in Österreich in drei Phasen einzuteilen, wobei für uns vor allem die dritte Phase interessant ist.15 Diese Phase unterscheide sich durch den Regierungstyp („Große Koalition“) und den Charakter der Opposition (eine erstarkte FPÖ auf der einen und Grüne sowie Liberales Forum auf der anderen Seite) von den vorangegangenen. Die FPÖ konzentriere sich seit 1986 auf das Protestpotential in der WählerInnenschaft und die Betonung neuer Themen, die die Mobilisierung von Ressentiments erlaubten (vgl. ebd.: 209 f.; Plasser/Ulram/Seeber 2003: 103 f.). Nach den Nationalratswahlen 2002 konstatieren Plasser/Ulram/Seeber (2003: 103) eine temporäre Verlangsamung des Erosionsprozesses der Parteibindungen. „Die durch den Koalitionswechsel [im Jahr 2000, Anm. d. Verf.] ausgelöste Polarisierung des Parteienwettbewerbs führte offensichtlich zu einer tendenziellen Re-Stabilisierung der Parteibindungen“ (ebd.). Die Erklärung, wie dies innerhalb von nur zwei Jahren möglich sei, wo doch die „tiefreichenden Veränderungen der Sozialstruktur wie der Beziehungen zwischen Wählern und Parteien“ (ebd.) zu eben dieser Schwächung der Parteibindungen geführt hätten, bleiben sie schuldig. Müller/Plasser/Ulram (1999: 203) gehen auch auf die Entwicklung der Wahlbeteiligung bei Nationalratswahlen kurz ein. Diese sei zwar seit 1986 zurückgegangen, aber es gebe keinen einheitlichen Abwärtstrend.16 Weit mehr Bedeutung als der sinkenden Wahlbeteiligung messen sie den Stimmengewinnen der FPÖ bei. In Summe läßt sich daher sagen, daß dealignment in Österreich nicht nach dem erosionabstention-Modell (d.h. nicht [mehr] parteigebundene Wähler werden zu Nichtwählern) vor sich geht. Wie dieses Kapitel zeigt, ist es vielmehr das erosion-new-options-Modell (nicht parteigebundene Wähler wenden sich anderen Parteien zu, welches für den österreichischen Fall zutrifft. (ebd.: 203) Eine Schlussfolgerung, die einerseits verständlich ist, da den Autoren nur die Wahlergebnisse bis 1995 vorlagen, bei denen immerhin 18,4 Prozent der Wahlberechtigten für die FPÖ votierten, die Partei zwar nur leicht zulegen konnte, aber trotzdem ihr bisher höchstes Ergebnis erzielte. Andererseits 15 In der ersten Phase (bis Mitte der 1970er Jahre) habe „eine Art politischer Säkularisation“ (Müller/Plasser/Ulram 1999: 209) stattgefunden, ein langsamer Prozess, der kaum WählerInnen mit starken Parteibindungen betraf. In der zweiten Phase (von den späten 70er bis zur Mitte der 80er Jahre) habe sich ausgelöst von politischen Skandalen eine allgemeine Unzufriedenheit mit Parteien und Politikern entwickelt (vgl. ebd., Plasser/Ulram/Seeber 2003: 103 f.). 16 Den Autoren liegen nur die Daten bis 1995 vor. 21 erscheint aus heutiger Sicht, die Vernachlässigung der Nichtwählerinnen und Nichtwähler in der Analyse nicht mehr verständlich. Denn nicht nur die FPÖ, sondern auch die „Partei der NichtwählerInnen“17 hat seit Mitte der 1980er Jahre deutlich zugelegt. Im Jahr 1986 zogen es immerhin schon 9,5 Prozent der Wahlberechtigen vor, ihrer Stimme nicht abzugeben, 1994 waren es 18,1 Prozent, 1995 14 Prozent. (siehe Diagramme 5 und 6) Mit der Feststellung, dass es im Verlauf der Wahlbeteiligung bei Nationalratswahlen keinen einheitlichen Abwärtstrend gibt, haben Müller/Plasser/Ulram (1999: 203) zwar Recht, es muss aber angemerkt werden, dass auch 1995 und 2002, als die Wahlbeteiligung im Vergleich zur vorhergehenden Wahl anstieg, sie trotzdem rund 5 Prozent niedriger war, als bei den Wahlen vor 1983. (siehe Diagramm 5) Auch die Gleichzeitigkeit der Entwicklungen, dem Aufstieg der FPÖ sowie dem Einzug der Grünen ins Parlament auf der einen und dem Sinken der Wahlbeteiligung auf der anderen Seite, ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert. Daher soll an dieser Stelle zunächst auf die Bedingungen zur Entstehung einer grünalternativen Partei in Österreich eingegangen werden. Im internationalen Vergleich relativ spät entstanden in Österreich Anfang der 1970er Jahre als Folge der gesellschaftlichen Modernisierung, die neue politische Räume eröffnete (vgl. Kapitel 4.3), „im Schatten der sozialdemokratischen Aufbruchseuphorie“ (Gottweis 1997: 346) die ersten neuen sozialen Bewegungen. Hier ist einerseits die autonome Frauenbewegung zu nennen, die 1972 mit der Gründung der Aktion Unabhängiger Frauen (AUF) ihren Anfang nahm. Anstoß zur Gründung der AUF hatte übrigens ein vom Arbeitskreis „Emanzipation der Frau“ in der Jungen Generation der SPÖ veranstaltetes Seminar gegeben (vgl. Geiger/Hacker 1989: 13). Zu Beginn engagierte sich die AUF vor allem gegen die Kriminalisierung von Abtreibungen, ein Thema, das sehr bald von der SPÖ aufgegriffen wurde, was 1974 zum Beschluss der Fristenregelung führte (vgl. Rosenberger 1999: 121). Ein Beispiel dafür, dass wie Rosenberger (1999: 120) postuliert, „Frauenforderungen [in Österreich, Anm. d. Verf.] stets dann eine Chance zur Debatte und Realisierung hatten, wenn a) eine Bewegung außerhalb der Parteien „laut“ war und wenn b) sozialdemokratische Politik die Frauenforderungen als Anliegen aufgriff und zur „eigenen“ Sache machte.“ Dass die neue Frauenbewegung „nie, wie etwa zu einem gewissen Zeitpunkt in Italien, zu einer Massenbewegung [wurde]“ (Gottweis 1997: 350) lässt sich unter anderem auf die „Verstaatlichung der Frauenfrage“ seit den 1970er Jahren (Rosenberger 1999: 120) vor allem durch die SPÖ zurückführen. 17 Damit wollen wir nicht unterstellen, dass NichtwählerInnen gemeinsame Interessen haben oder gar eine homogene Gruppe darstellen. Es soll lediglich illustriert werden, dass der Anteil der NichtwählerInnen an den Wahlberechtigten das Ausmaß einer Kleinpartei erreicht hat. 22 Auf der anderen Seite entstanden – ebenfalls Anfang der 1970er Jahre – vorwiegend in Städten BürgerInneninitativen, die negative Auswirkungen der Modernisierung auf die „Umwelt“ zum Thema machten. Diesen Initiativen fehlte „allerdings noch ein massenmobilisierender Schlüsselkonflikt von überregionaler, nationaler Bedeutung“ (Gottweis 1997: 347), der in der Auseinandersetzung um die Nutzung der Atomkraft gefunden werden sollte. Eine geplante Informationskampagne der Regierung zur Vorbereitung der Inbetriebnahme des Atomkraftwerks Zwentendorf bildete den Anstoß für den bundesweiten Zusammenschluss von Atomgegnergruppen. „Die [erfolgreiche, Anm. d. Verf.] AntiAKW-Bewegung gab auch zahlreichen anderen gesellschaftskritischen Potentialen Auftrieb“ (Gottweis 1997: 348). Die etablierten Institutionen wie Parteien und Kirche reagierten beunruhigt, versuchten zunächst zu verhindern, später einzuvernehmen oder zu spalten und waren mit ihren Strategie, wie das Kommen und Gehen der […] verschiedenen Projekte und Gruppen zeigte, häufig erfolgreich. (Gottweis 1997: 349) Um den neu geschaffenen politischen Raum auf Dauer zu besetzen, blieb der Ökologie- bzw. AntiAKW-Bewegung letztlich nur die Gründung von Parteien (VGÖ bzw. ALÖ), die nach der Erfahrung von Hainburg bei den Nationalratswahlen 1986 gemeinsam kandidierten und unter dem Namen „Die Grüne Alternative (Grüne)“ den Einzug ins Parlament schafften (Dachs 1997: 305-307). Obwohl sich auch die Grünen in Abgrenzung zu den etablierten Parteien definierten, gilt das noch verstärkt für die FPÖ seit Mitte der 1980er Jahre bzw. seit der innerparteilichen Machtübernahme durch Jörg Haider im September 1986. Im Gegensatz zu den Grünen besetzten die Freiheitlichen keinen neuen politischen Raum, sondern stellten die Kritik an den von SPÖ und ÖVP geschaffenen und dominierten Anrufungsstrukturen in den Vordergrund18 (vgl. Czernin 2000: 99 f.). 18 Wie zwei der von Czernin (2000: 99 f.) zusammengestellten Zitate aus dem Jahr 1986 illustrieren: „Die alten Parteien SPÖ und ÖVP haben den Machtanspruch auf Führung der Republik verspielt, da diese das Debakel in den Staatsbetrieben durch den politischen Proporz, die Bürokratisierung der Wirtschaft sowie ein undemokratisches Kammernsystem und den Verfall der sozialen Gerechtigkeit durch Privilegienwirtschaft zu verantworten haben.“ (Freiheitlicher Pressedienst, 11. Oktober 1986, zitiert nach Czernin 2000: 99) und: „Das einzige Kriterium ist das verflixte Parteibuch in Österreich als Glücksbringer für jeden einzelnen Bürger, wenn er im öffentlichen Leben unterkommen will. […]“ (Jörg Haider in der Zeit im Bild 1, 7. November 1986, zitiert nach Czernin 2000: 99 f.) 23 7 Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung 7.1 Schlussfolgerungen Parteibindung und Parteiidentifikation sind zwar bestimmende Größen bezüglich der Wahlbeteiligung, diese werden jedoch großteils vom Verhalten und dem Charakter der Parteien beeinflusst, im Gegensatz zur geläufigen Meinung, dass diese von Veränderungen in der Sozialstruktur bzw. den Beziehungen zwischen Wählerinnen/Wählern und Parteien abhängen würden. Parteien konstituieren sich entlang vorhandener Konfliktlinien, gleichzeitig sind sie auch Ausdruck dieser Konflikte - insofern machen Parteien fundamentale gesellschaftliche Konflikte dem Individuum verfügbar, in dem sie diese bezeichnen und vermitteln (vgl. Lipset/Rokkan 1969: 3-6). Über die Verflechtung der etablierten Parteien mit Zivilgesellschaft und Staatsapparat verhandeln diese die ihnen zugrunde liegenden Differenzen und üben somit eine Art Katharsis-Effekt auf das politische System aus. Im Österreich der Zweiten Republik wurden die Konflikte von den dominierenden Parteien SPÖ und ÖVP nicht ausgeglichen, sondern im Rahmen der Konkordanzdemokratie negiert. Dies führte zu einem Erstarren des politischen Systems (und der konstant hohen Wahlbeteiligung), dessen bestimmendes Erfordernis eine den Parteien anhaftende historische Gemeinsamkeit war. Diese historische Gemeinsamkeit begründet sich in der ideologischen Ausformung der Parteien (CSP und SDAP) in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Hypothese 1). So ist die Geschichte beider Parteien mit der des Liberalismus verknüpft (Hypothese 2), insofern, dass sowohl CSP als auch SDAP in ihrer Abgrenzung zur jeweiligen politischen Gegnerin Antisemitismus instrumentalisierten (siehe Hypothese 3 und 4). Erst als SPÖ und ÖVP nicht mehr dazu in der Lage waren, gegenseitige Zugeständnisse im Sinne einer Konkordanzdemokratie einzugehen, vermochte es die FPÖ über die Kritik am von SPÖ und ÖVP dominierten politischen System auch den „Konflikt“ Antisemitismus und Xenophobie zu einem Thema zu machen: Die SPÖ wurde teilweise aus bestimmten politischen Räumen verdrängt und an ihre Stelle trat eine xenophobe, nationalistische FPÖ. Die FPÖ konnte vor allem für sich nutzen, dass sich die Einschätzung der sozialen Wirklichkeit über den Diskurs verändert hatte. Dass mit dem Aufstieg der FPÖ auch die Zahl der NichtwählerInnen zunahm, lässt sich vor allem dadurch erklären, dass die FPÖ die von SPÖ und ÖVP geschaffenen Anrufungsstrukturen in Frage stellte, es jedoch nicht vermochte alle ehemaligen SPÖ- und ÖVP-WählerInnen für sich zu gewinnen (Hypothese 5). 24 Zur gleichen Zeit gewannen in Folge der gesellschaftlichen Modernisierung auch die Grünen an Bedeutung, die sich anfänglich ebenfalls durch die Abgrenzung zu SPÖ und ÖVP definierten. Hier ist zu sagen, dass vorerst weder FPÖ noch Grüne neue stabile Anrufungsstrukturen aufbauten. Dadurch, dass sie das Subjekt – zumindest zum damaligen Zeitpunkt – vor allem über die Abgrenzung zu ÖVP und SPÖ angerufen haben, stieg auch der Anteil jener Wahlberechtigten, die sich gar nicht an der Wahl beteiligten (Hypothese 5). 7.2 Ausblick Die Koalition mit der ÖVP hat die FPÖ schlussendlich zu einer regierungsfähigen Partei gemacht, was allerdings dazu führte (führen musste), dass sie sich nicht mehr über die Abgrenzung zu den anderen etablierten Parteien definieren konnte, sondern sukzessive als eine versprengte, uneinige Ansammlung von unterschiedlichsten national-liberalen Strömungen wahrgenommen wurde (die sie auch früher schon war - zumindest vor Haiders Engagement). Dies wirkte sich insofern positiv auf das Elektorat aus, als dass nun ehemalige FPÖ-Wähler und -Wählerinnen sowohl zu etablierten Parteien zurückwanderten, als auch ehemalige Nicht-Wählerinnen und Nicht-Wähler nun wieder einer der etablierten Parteien ihre Stimme gaben (siehe Diagramm 4). Letzteres scheint vor allem darauf zurückzuführen zu sein, dass der Aufstieg der FPÖ – und ihr damit einhergehendes Einsickern in die (vormals von einer SPÖ-ÖVP Verhandlungsdemokratie dominierten) politischen Diskurse – jene Wähler und Wählerinnen von den Urnen fernhielt, welche sowohl den etablierten Parteien SPÖ und ÖVP als auch der neuen, radikalen FPÖ ambivalent gegenüberstanden. Dies verhielt sich im Fall der Grünen anders: In diesem Fall handelt es sich wirklich um eine neu entstandene Partei, in dem Sinn, dass sich die Grünen (und ihre Vorläuferparteien) auf einen neuartigen gesellschaftlichen Konflikt beziehen konnten. Die Grünen hatten und haben damit zu kämpfen, dass sich die etablierten Parteien als Reaktion auf das Auftreten einer neuen Partei anpassten und ihrerseits versuchten, in den politischen Raum „Umwelt“ vorzudringen. Allerdings scheint es, als wären die Grünen mittlerweile ein fixe Größe im österreichischen Parteiensystem (siehe Diagramm 6). Dies würde laut unserem Modell darauf hindeuten, dass sich ein Stimmengewinn der Grünen weniger negativ auf die Entwicklung der Wahlbeteiligung auswirken würde, als ein Stimmengewinn der FPÖ. Für die weitere Entwicklung der Wahlbeteiligung bei Nationalratswahlen erwarten wir, dass sie sich auf dem bestehenden Niveau (zwischen 80 und 85 Prozent) einpendelt, vorausgesetzt, dass sich in der Zusammensetzung der österreichischen Parteienlandschaft nichts ändert. 25 8 Literatur- und Quellenverzeichnis Althusser, Louis (1977, frz. Originalausgabe 1976). Ideologie und ideologische Staatsapparate. Aufsätze zur marxistischen Theorie, Hamburg/Westberlin. Appelt, Erna (1999). Österreichische Geschichtswahrnehmungen, in: Gärntner, Reinhold (Hg.): Blitzlichter. Österreich am Ende des Jahrhunderts, Innsbruck, 99-116. Austin, John L. (2002). Zur Theorie der Sprechakte. Zweite Vorlesung, in: Wirth Uwe (Hg.): Performanz. Zwischen Sprachphilosophie und Kulturwissenschaften, Frankfurt/M., 63-71. Bauman, Zygmunt (2003). Flüchtige Moderne, Frankfurt/M. Beck, Ulrich (1986). Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt/M. Brock, Lothar (1998). Die Grenzen der Demokratie. Selbstbestimmung im Kontext des globalen Strukturwandels und des sich wandelnden Verhältnisses von Staat und Markt, in: Kohler-Koch, Beate (Hg.): Regieren in entgrenzten Räumen. PVS-Sonderheft 29, Opladen, 271-292. Bublitz, Hannelore (1999). Diskursanalyse als Gesellschafts->Theorie<. „Diagnostik“ historischer Praktiken am Beispiel der >Kulturkrisen<-Semantik und der Geschlechterordnung um die Jahrhundertwende, in: Bublitz, Hannelore/Bührmann, Andrea D./Hanke, Christine/Seier, Andrea (Hg.). Das Wuchern der Diskurse: Perspektiven der Diskursanalyse Foucaults, Frankfurt/New York, 22-48. Butler, Judith (1995). Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts, Berlin. Butler, Judith (1998). Haß spricht. Zur Politik des Performativen, Berlin. Butler, Judith (2001). Psyche der Macht. Das Subjekt der Unterwerfung, Frankfurt/M. Butschek, Felix (1985). Die österreichische Wirtschaft im 20. Jahrhundert, Wien. Bührmann, Andrea D. (1999). Der Diskurs als Diskursgegenstand im Horizont der kritischen Ontologie der Gegenwart, in: Bublitz, Hannelore/Bührmann, Andrea D./Hanke, Christine/Seier, Andrea (Hg.). Das Wuchern der Diskurse: Perspektiven der Diskursanalyse Foucaults, Frankfurt/New York, 49-62. 26 Campbell, Angus/Gurin, Gerald/Miller, Warren E. (1954). The Voter decides, Evanston. Campbell, Angus/Converse, Philip E./Miller, Warren E./Stokes, Donald E. (1960). The American Voter, New York. Czernin, Hubertus (2000), (Hg.). Haider, beim Wort genommen. Wofür ich mich meinetwegen entschuldige, Wien. Dachs, Herbert (1997): Grünalternative Parteien, in: Dachs, Herbert/Gerlich, Peter/Gottweis, Herbert/Horner, Franz/Kramer, Helmut/Lauber, Volkmar/Müller, Wolfgang C./Tálos, Emmerich. (Hg.): Handbuch des politischen Systems Österreich. Die Zweite Republik (3. und erweiterte Auflage), Wien, 304-314. Diskussion mit den MeinungsforscherInnen Christoph Hofinger (SORA) und Imma Palme (IFES) im Rahmen der Lehrveranstaltung ‚Die Stimme abgeben’, Wien (15. November 2004). Eickelpasch, Rolf/Rademacher, Claudia (2004). Identität, Bielefeld. Elias, Norbert (1996, Originalausgabe 1970). Was ist Soziologie?, Weinheim/München. Enderle-Burcel, Gertrude (1995). Die österreichischen Parteien 1945 bis 1955, in: Sieder, Reinhard/Steinert, Heinz/Tálos, Emmerich (Hg.): Österreich 1945 – 1995. Gesellschaft – Politik – Kultur, Wien, 80-93. Engel, Antke (2002). Wider die Eindeutigkeit. Sexualität und Geschlecht im Fokus queerer Politik der Repräsentation, Frankfurt/M. Foucault, Michel (1977, frz. Originalausgabe 1976). Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit Band 1, Frankfurt/M. Foucault, Michel (1978, Originalausgabe 1978): Die Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit, Berlin. Foucault, Michel (1981, Originalausgabe 1973). Archäologie des Wissens, Frankfurt/M. Foucault, Michel (1986, frz. Originalausgabe 1984). Der Gebrauch der Lüste. Sexualität und Wahrheit Band 2, Frankfurt/M. 27 Foucault, Michel (1994). Omnes et singulatim. Zu einer Kritik der politischen Vernunft, in: Vogl, Joseph (Hg.): Gemeinschaften. Positionen zu einer Philosophie des Politischen, Frankfurt/M., 65-93. Geiger, Brigitte/Hacker, Hanna (1989). Donauwalzer-Damenwahl. Frauenbewegte Zusammenhänge in Österreich, Wien. Gottweis, Herbert (1997). Neue soziale Bewegungen in Österreich, in: Dachs, Herbert/Gerlich, Peter/Gottweis, Herbert/Horner, Franz/Kramer, Helmut/Lauber, Volkmar/Müller, Wolfgang C./Tálos, Emmerich. (Hg.): Handbuch des politischen Systems Österreich. Die Zweite Republik (3. und erweiterte Auflage), Wien, 342-358. Hanisch, Ernst (1997). Periodisierungsversuche des 20. Jahrhunderts, in: Dachs, Herbert/Gerlich, Peter/Gottweis, Herbert/Horner, Franz/Kramer, Helmut/Lauber, Volkmar/Müller, Wolfgang C./Tálos, Emmerich. (Hg.): Handbuch des politischen Systems Österreich. Die Zweite Republik (3. und erweiterte Auflage), Wien, 11-24. Hofinger, Niko (1994). "Unsere Losung ist: Tirol den Tirolern!". Antisemitismus in Tirol 1918-1938, in: Zeitgeschichte 21 (1994), Heft 3/4, April 1994, 83-108. Inglehart, Ronald (1998). Modernisierung und Postmodernisierung. Kultureller, wirtschaftlicher und politischer Wandel in 43 Gesellschaften, Frankfurt/New York. Karlhofer, Ferdinand (1993). Geschwächte Verbände – stabile Partnerschaft? Zur Externalisierung innververbandlicher Loyalitätsprobleme, in: Tálos, Emmerich (Hg.): Sozialpartnerschaft. Kontinuität und Wandel eines Modells, Wien, 117-130. Lazarsfeld, Paul F./Berelson, Bernard/Gaudet, Hazel (1969, amerikanische Originalausgabe 1960). Wahlen und Wähler. Soziologie des Wahlverhaltens, Neuwied/Berlin. Lemke, Thomas (1997). Eine Kritik der politischen Vernunft. Foucaults Analyse der modernen Gouvernementalität, Berlin/Hamburg. Lipset, Seymour M./Rokkan, Stein (1967). Cleavage structures, party systems, and voter alignments: An introduction, in: Lipset, Seymour M./Rokkan, Stein (Hg.): Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives, New York/London, 1-64. 28 Luther, Kurt Richard (1997). Die Freiheitlichen (F), in: Dachs, Herbert/Gerlich, Peter/Gottweis, Herbert/Horner, Franz/Kramer, Helmut/Lauber, Volkmar/Müller, Wolfgang C./Tálos, Emmerich. (Hg.): Handbuch des politischen Systems Österreich. Die Zweite Republik (3. und erweiterte Auflage), Wien, 287-303. Maderthaner, Wolfgang (1995). Die Sozialdemokratie, in: Tálos, Emmerich/Dachs, Herbert/Hanisch, Ernst/Staudinger, Anton (Hg.): Handbuch des politischen Systems Österreichs. Erste Republik 19181933, Wien, 177-194. Matjan, Gregor (1995). Individualisierung als politische Dynamik. Statt eines Vorwortes, in: BEIGEWUM, Beirat für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen (Hg.): Individualisierung und Politik. Kurswechsel, Heft 1/95, S. 5-8. Müller, Wolfgang C. (1994). The Development of Austrian Party Organizations in the Post-war Period, in: Katz, Richard S./Mair, Peter (Hg.): How Parties Organize. Change and Adaptation in Party Organizations in Western Europe, London/Thousand Oaks/New Delhi, 51-79. Müller, Wolfgang C. (1996). Political Parties, in: Lauber, Volkmar (Hg.): Contemporary Austrian Politics, Boulder, 59-102. Müller, Wolfgang C. (1997). Die Österreichische Volkspartei, in: Dachs, Herbert/Gerlich, Peter/Gottweis, Herbert/Horner, Franz/Kramer, Helmut/Lauber, Volkmar/Müller, Wolfgang C./Tálos, Emmerich. (Hg.): Handbuch des politischen Systems Österreich. Die Zweite Republik (3. und erweiterte Auflage), Wien, 265-285. Müller, Wolfgang C./Plasser, Fritz/Ulram, Peter A. (1999). Schwäche als Vorteil, Stärke als Nachteil. Die Reaktion der Parteien auf den Rückgang der Wählerbindungen in Österreich, in: Mair, Peter/Müller, Wolfgang C./Plasser, Fritz (Hg): Parteien auf komplexen Wählermärkten. Reaktionsstrategien politischer Parteien in Westeuropa, Wien, 201 - 245. Naumann, Thilo (2001). Das umkämpfte Subjekt, in: Trend Online Zeitung, 7-8/2001, http://www.trend.infopartisan.net/trd7801/t337801.html (14. Jänner 2005). ÖGB-Kurzbericht 1999-2002 (2003). Menschen sind unsere Stärke. Arbeit in einem sozialen Europa (15. ÖGB-Bundeskongress, 14. – 17. Oktober 2003, Austria Center Vienna), Wien. 29 ÖGB-Mitgliederstand am 31. Dezember 1999, http://www.oegb.at/servlet/BlobServer?blobcol=urldokument&blobheader=application%2Fpdf&blobk ey=id&blobtable=Dokument&blobwhere=1053969011655 (14.Dezember 2004). Parsons, Talcott/Smelser, Neil J. (1957). Economy and Society. A Study in the Integration of Economic and Social Theory, London. Pelinka, Anton (1993). Parteien und Verbände, in: Tálos, Emmerich (Hg.): Sozialpartnerschaft. Kontinuität und Wandel eines Modells, Wien, 69 – 78. Pelinka, Anton (1999). Demokratie: Österreich 1900 – Österreich 2000, in: Gärntner, Reinhold (Hg.): Blitzlichter. Österreich am Ende des Jahrhunderts, Innsbruck, 9-26. Pelinka, Anton/Rosenberger, Sieglinde (2003, erste Auflage 2000). Österreichische Politik. Grundlage – Strukturen – Trends, Wien. Plasser, Fritz/Ulram, Peter A./Seeber, Gilg (2003). Erdrutschwahlen: Momentum, Motive und neue Muster im Wahlverhalten, in: Plasser, Fritz/Ulram, Peter A. (Hg.): Wahlverhalten in Bewegung. Analysen zur Nationalratswahl 2002, Wien, 97-153. Posselt, Gerald (2003). Interpellation. Glossareintrag, in: produktive differenzen. forum für differenzund genderforschung. http://differenzen.univie.ac.at/glossar.php?sp=27 (14. Jänner 2004). Rosenberger, Sieglinde Katharina (1999). Das halbierte Leben, die verspätete Demokratie, die doppelte Arbeit, in: Gärtner, Reinhold (Hg.): Blitzlichter. Österreich am Ende des Jahrhunderts, Innsbruck, 117-133. Rossi, Peter H. (1964, Originalausgabe 1959). Four Landmarks in Voting Research, in: Munger, Frank/Price, Douglas (Hg.): Readings in Political Parties and Pressure Groups, New York, 304-347. Sauer, Birgit (2001): Die Asche des Souveräns. Staat und Demokratie in der Geschlechterdebatte, Frankfurt/M. Seifried, Bettina (2000, Univ.-Diss.). Talkshow als Subjektdiskurs. Sprachliche und interaktive Verfahren und Strategien einer diskursspezifischen Konstruktion von Subjektpositionen in USamerikanischen Talk-Service-Shows, Frankfurt/M. 30 Staudinger, Anton/Müller, Wolfgang C./Steininger, Barbara (1995): Die Christlichsoziale Partei, in: Tálos, Emmerich/Dachs, Herbert/Hanisch, Ernst/Staudinger, Anton (Hg.): Handbuch des politischen Systems Österreichs. Erste Republik 1918-1933, Wien, 160-176. Tálos, Emmerich (1993). Entwicklung, Kontinuität und Wandel der Sozialpartnerschaft, in: ders. (Hg.): Sozialpartnerschaft. Kontinuität und Wandel eines Modells, Wien, 11-34. Ucakar, Karl (1997). Die Sozialdemokratische Partei Österreichs, in: Dachs, Herbert/Gerlich, Peter/Gottweis, Herbert/Horner, Franz/Kramer, Helmut/Lauber, Volkmar/Müller, Wolfgang C./Tálos, Emmerich. (Hg.): Handbuch des politischen Systems Österreich. Die Zweite Republik (3. und erweiterte Auflage), Wien, 248-264. Unger, Brigitte (1993). Internationalisierung und Veränderung der Wettbewerbsbedingungen, in: Tálos, Emmerich (Hg.): Sozialpartnerschaft. Kontinuität und Wandel eines Modells, Wien, 35-49. Winckler, Georg (1985). Sozialpartnerschaft und ökonomische Effizienz, in: Gerlich, Peter/Grande, Edgar/Müller, Wolfgang C.: Sozialpartnerschaft in der Krise. Leistungen und Grenzen des Neokorporatismus in Österreich, Wien, 295-312. Zima, Peter V. (2000): Theorie des Subjekts. Subjektivität und Identität zwischen Moderne und Postmoderne, Tübingen. 31 9 Abkürzungsverzeichnis ALÖ: Alternative Liste Österreichs AUF: Aktion Unabhängiger Frauen CSP: Christlichsoziale Partei FPÖ: Freiheitliche Partei Österreichs KPÖ: Kommunistische Partei Österreichs LIF: Liberales Forum ÖAAB: Österreichischer Arbeiter- und Angestelltenbund ÖBB: Österreichischer Bauernbund ÖVP: Österreichische Volkspartei ÖWB: Österreichischer Wirtschaftsbund: SDAP: Sozialdemokratische Arbeiterpartei SPÖ: Sozialistische bzw. Sozialdemokratische Partei Österreichs VGÖ: Vereinigte Grüne Österreichs 32 10 Diagramme Diagramm 1: ÖGB-Mitglieder 1980 - 2002 1.700.000 1.650.000 1.600.000 1.550.000 1.500.000 1.450.000 1.400.000 1.350.000 1.300.000 01 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91 02 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 89 88 87 86 85 84 83 82 81 90 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 80 1.250.000 ÖGB-Mitglieder Quelle: ÖGB-Mitgliederstand 1999 und ÖGB Kurzbericht 1999-2003 33 Diagramm 2: SPÖ-Mitglieder 1945 – 2003 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1945 1949 1953 1956 1959 1962 1966 1970 1971 1975 1979 1983 1986 1990 1994 1995 1999 2002 SPÖ-Mitglieder Quelle: Ucakar 1997: 259; APA0160, 25.Nov 2004 Diagramm 3: ÖVP-Mitglieder 1945 – 1994 (Minimalversion) 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1945 1949 1953 1956 1959 1962 1966 1970 1971 1975 1979 1983 1986 1990 1994 ÖVP-Mitglieder min. Quelle: Müller 1994: 58 34 Diagramm 4: Wahlbeteiligung und Anteil der für SPÖ und ÖVP abgegebenen Stimmen an den Wahlberechtigten bei Nationalratswahlen 1945 – 2002 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 1945 1949 1953 1956 1959 1962 1966 1970 1971 1975 1979 1983 1986 1990 1994 1995 1999 2002 Wahlbetlg. in % SPÖ u. ÖVP in % SPÖ-WählerInnen in % ÖVP-WählerInnen in % 35 Diagramm 5: Anteil der NichtwählerInnen an den Wahlberechtigten bei NR-Wahlen 1945- 2002 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 1945 1949 1953 1956 1959 1962 1966 1970 1971 1975 1979 1983 1986 1990 1994 1995 1999 2002 Nicht-WählerInnen in % Diagramm 6: Anteil der FPÖ- und GrünwählerInnen an den Wahlberechtigten bei Nationalratswahlen 1945- 2002 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1945 1949 1953 1956 1959 1962 1966 1970 1971 1975 1979 1983 1986 1990 1994 1995 1999 2002 FPÖ-WählerInnen in % Grün-WählerInnen in %