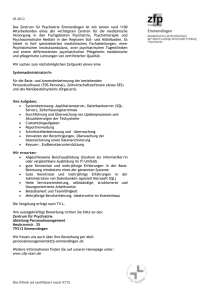Abstracts - Schizophrenie»: Rezeption
Werbung

Workshop PSYCHIATRIE – WISSEN – GESELLSCHAFT Psychiatrische Universitätsklinik Zürich & Universität Zürich, 16.–18.10.2014 Abstracts & CVs der Referierenden Themenblock 1: Erfahrung Samuel Thoma, Sektion Phänomenologische Psychopathologie und Psychotherapie, Universitätsklinikum Heidelberg Phänomenologie zwischen Mittelbarkeit und Unmittelbarkeit der Erfahrung des Wahnsinns – Überlegungen zur Angemessenheit phänomenologischpsychiatrischer Fallstudien Abstract: Karl Jaspers führte vor gut 100 Jahren die phänomenologische Forschungsrichtung systematisch in der Psychopathologie ein. Der Erforschung des subjektiven Erlebens – so verstand er die Phänomenologie – wurde von da an eine grundlegende Rolle in der Psychopathologie und Diagnostik eingeräumt: Nur durch Verständnis dessen, was der Patient auch selbst erlebt und erleidet, können psychopathologische Phänomene adäquat beschrieben und Diagnosen valide gestellt werden. Jaspers' Phänomenologie-Begriff wurde durch Veränderungen in der Phänomenologie selbst und deren Anwendung auf die Psychiatrie entscheidend erweitert. Vom Begriff des Wesens oder des Inder-Welt-Seins war es nun möglich, nicht nur einzelne Erlebnisse, sondern den weiteren ErlebnisKontext, etwa die Wahnwelt des Patienten, anschaulich zu machen. Phänomenologischpsychiatrische Einzelfallstudien, die nicht nur die gegenwärtige Welt des Wahnsinns, sondern auch seine Entwicklung in der Zeit beschreiben, nahmen hier ihren Anfang. Neben der Fülle an Material, die dabei zur Erforschung der Erfahrung zurate gezogen wurde, fallen diese Analysen vor allem dadurch auf, die Erfahrung des Betroffenen nicht durch fremde Theorien erklären zu wollen, sondern diese sich selbst erklären zu lassen. Dennoch waren es dann stets die Psychiater selbst, die in der Auslegung der Erfahrung und ihres Verlaufs das letzte und entscheidende Wort über die Erfahrung hatten, welche dann zum „Fall von …“ wurde. Wie subjektbezogen kann und will das Verständnis von „Daseinsgestalten“ und „Daseinsgängen“ (Binswanger) durch die phänomenologische Psychiatrie also sein? In meiner Darstellung möchte ich die Möglichkeiten und Grenzen phänomenologischer Einzelfalluntersuchungen für die Erforschung entfremdeter Erfahrung anhand einiger „Klassiker“ dieser Tradition ausloten. Dabei versuche ich zu zeigen, dass der phänomenologische Zu-griff auf fremde und entfremdete Erfahrung nur dann dem Über-griff entgeht, wenn er sich selbst auf Verständigung statt Verständnis einlässt. Wenn Verständigung aber etwas ist, das mindestens zwei Personen mit einschließt, dann muss letztlich der Begriff der Einzelfallstudie revidiert werden. CV: Studium der Medizin und Philosophie in Berlin und Lyon. 2012 Beginn der Facharztausbildung im Bereich Psychiatrie. Seit 2014 Unterbrechung der Ausbildung: Promotion im Fach Philosophie mit dem Thema Phänomenologisch-anthropologische Grundlagen der Sozialpsychiatrie. Diverse Publikationen im Bereich Phänomenologie, Psychopathologie, Sozialpsychiatrie. PSYCHIATRIE – WISSEN – GESELLSCHAFT: ABSTRACTS & CV –2 Wolfram Hinzen, Departament de Lingüística, Universitat de Barcelona Die Rolle der Sprache in der Transformation von Erfahrung im Denken Abstract: Sinneseindrücke beschränken sich auf unseren Körper: wir können uns davon erzählen oder ähnliche Eindrücke gemeinsam erleben, aber in einem wichtigen Sinne können wir sie nicht teilen. In der Sprache dagegen treten wir über unsere Körper hinaus: Gedankeninhalte werden (mit-) teilbar, jeder kann sie denken. Sie können für tausende von Jahren wahr bleiben, und reisen um die Welt in Millisekunden. Die Sprache, und nichts anderes, repräsentiert Erfahrung in einem propositionalen Format. Anders als Bilder haben diese Repräsentationen objektiven Gehalt: wir extrahieren Information über die Welt von sprachlichen Äusserungen. Zwar ist eine Äusserung der Ausdruck meines Gedankens; dennoch transportiert sie Information, die die Welt betrifft, verstanden als unabhängig von dem, was ich denke. Das bleibt wahr in Aussagen in der ersten Person, wie „Ich bin W.H.“ oder „Ich bin gücklich“: Auch diese Aussagen beschreiben formal Tatsachen. Im Gebrauch der ersten Person beziehe ich mich auf mich auf eine einzigartige Weise, aber meine Aussage ist deswegen nicht „subjektiv“: Das propositionale Format der Sprache bleibt dasselbe. Wahn zeigt sich im Zusammenbruch dieses Aspektes der Sprache: Wer sagt, er sei Jesus, oder seine Eltern seien die Mauren, gebraucht Sprache auf eine Weise, die die Welt nicht mehr gedankenunabhängig repräsentiert. Unser propositionales Vermögen bricht zusammen. Das Innere und Äussere, die in jedem Akt der Sprache zusammenkommen und normalerweise harmonieren, fallen auseinander. Wenn Sprache onto- und phylogenetisch der Ursprung dieses Vermögens ist, könnte eine Störung der Sprache darum ein Grundelement schizophrener Symptomatik sein. Stattdessen wird seit 100 Jahren mehrheitlich (und mit Bleuler selbst) davon ausgegangen, dass Sprachstörungen, wie sie in der Schizophrenie mindestens seit Kleist (1914) und Chaika (1974, 1977, 1982) dokumentiert sind, nur der äussere Ausdruck einer an sich sprachunabhängigen Denkstörung sind: Denken und Sprechen treten in ein asymmetrisches Verhältnis, mit einem Primat des ersteren über das letztere. Die moderne Linguistik seit Chomsky (1957) selbst unterstützt diese Sichtweise, insoweit sie, getrieben von dem Wunsch, die Linguistik als Wissenschaft zu etablieren, die Sprache allein als formales System beschreibt und daher von ihrem Bezug zum Denken systematisch abstrahiert. Erst in jüngsten Jahren sind neue Modelle von Sprachkompetenz entstanden (Chomsky, 2007; Hinzen & Sheehan, 2013), die diese Trennung aufheben, und in denen spezifische Störungen des Sprachsystems die Störung bestimmter kognitiver Funktionen voraussagen. Das Ziel dieses Vortrags ist es, diese Modelle vorzustellen und sie im Kontext dokumentierter Sprachstörungen in der Schizophrenie zu diskutieren. CV: Wolfram Hinzen ist Professor für Philosophie an der University of Durham (U.K.) und ICREAForschungsprofessor am Institut für Linguistik an der Universitat de Barcelona. Das Projekt der nichtcartesianischen Linguistik hat sich seit 2006 in drei seiner Bücher entwickelt, von Mind Design (Oxford University Press, 2006), bis An Essay on Names and Truth (OUP, 2007), und The Philosophy of Universal Grammar (OUP, 2013, with M. Sheehan). Anke Maatz, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich Das Projekt in der Sprechstunde oder die Rolle von Erfahrung in aktuellen Forschungsparadigmen: ein (selbst)kritischer Bericht Ausgehend vom Interesse der phänomenologischen Psychopathologie an der systematischen Erforschung von Erfahrung und in dem Bestreben psychische Erkrankung in ihrer Lebensbedeutsamkeit besser zu verstehen, beschäftigt sich dieser Vortrag mit den erfahrenen und erfahrenden Personen in diesem Forschungsprozess. Das heisst einerseits, den Blick auf die Person zu lenken, deren Erfahrung erforscht werden soll, andererseits, die erforschende Person als ebenfalls selber erfahrendes Subjekt zu betrachten. Aber wer ist dann wer? Lässt sich, wenn Erfahrung sowohl als Forschungsgegenstand wie auch als Mittel der Wissensproduktion im Zentrum des Forschungsprozess steht, die personelle Trennung von Forschungsobjekt und Forschungssubjekt aufrecht erhalten? Spezifisch im Kontext psychiatrischer Forschung: Sollten Psychiatrieerfahrene nicht auch diejenigen sein, die psychiatrische Erfahrung wissenschaftlich untersuchen? Wird nicht aber PSYCHIATRIE – WISSEN – GESELLSCHAFT: ABSTRACTS & CV –3 auch jede nicht durch psychische Erkrankung betroffene Forschende auf ihre eigene Art und Weise zur Erfahrenen? An dieser Stelle sollen beispielhaft Forschungsparadigmen und –arbeiten vorgestellt werden, in denen die jeweils eigene Erfahrung der Forschenden eine zentrale Rolle im Prozess der Wissensproduktion über psychische Erkrankung spielt. Dabei können grob partizipative, (Nutzer) kontrollierte und kollaborative Paradigmen unterschieden werden. Welche Fragen an unser Verständnis von Wissenschaftlichkeit ergeben sich hieraus? Chancen, Herausforderungen und Grenzen dieser Paradigmen sollen zur Debatte gestellt, und ihre Verknüpfung mit sozialpsychiatrischen Anliegen sowie mit Forschungsförderungspolitik diskutiert werden. CV: Anke Maatz studierte Philosophie und Medizin in München, Heidelberg, Jena und Durham (U.K.). Nach der medizinischen Promotion im Bereich experimenteller Bindungsforschung (Jena) und einem Aufenthalt als postgraduierte Gaststudentin im Bereich Medizinethnologie in Durham, ist sie seit Januar 2013 im interdisziplinären Projekt ‘Schizophrenie’: Rezeption, Bedeutungswandel und Kritik eines Begriffes im 20. Jh.’ als medizinische PostDoc tätig. Seit August 2013 befindet sie sich ausserdem in der Weiterbildung zur Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Themenblock 2: Sprache Britt-Marie Schuster, Institut für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft, Universität Paderborn Der Verlust der Melancholie und der Aufstieg der Depression: Sprachliche Professionalisierung und ihre Folgen Abstract: Im Vortrag soll auf der Basis psychiatrischer Monographien, Zeitschriftaufsätzen und Krankenakten gezeigt werden, wie die Krankheitsbezeichnung „Melancholie“ und das zugehörige Adjektiv „melancholisch“, die im frühen psychiatrischen Diskurs noch selbstverständlich verwendet werden, im Laufe des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts allmählich zurückgedrängt und durch die Bezeichnungen „Depression“ bzw. „depressiv“ ersetzt werden; wie Korpusstudien auf der Basis des Deutschen Textarchivs (DTA) ebenfalls deutlich machen können, wird Melancholie/melancholisch in anderen Kommunikationsdomänen allerdings noch häufig verwendet. Das Verschwinden der Melancholie deutet einen Prozess an, dessen Dynamik einer sprachhistorischen Rekonstruktion zugänglich ist. Es wird dafür argumentiert, dass dieser wesentlich auf die Durchsetzung von Psychiatrien modernen Typs zurückgeführt werden kann, mit deren Etablierung eine sprachliche Professionalisierung einhergeht. Das Konzept der „sprachlichen Professionalisierung“ wird kurz skizziert und in einigen Aspekten von den Vorstellungen der modernen Fachsprachenforschung abgegrenzt, da diese wesentliche Aspekte des psychiatrischen Fachdiskurses nicht erfasst. Die allmähliche Ablösung von Melancholie/melancholisch durch Depression/depressiv wird im Vortrag jedoch nicht als ein einfacher lexikalischer Wandel gedeutet: Im Vortrag wird die Auffassung vertreten, dass die Wahrnehmung von Krankheit in der frühen Psychiatrie stark von tradierten sozialen Typen, also „dem Melancholiker“, dem „Nostalgiker“ oder „dem Hypochonder“, und seiner Beschreibung bestimmt wird. Die Entwicklung lässt sich deshalb als eine De-Kontextualisierung begreifen, bei der alle auf den sozialen Typ hindeutenden lexikalischen Reminiszenzen abgebaut werden, was wiedrum gravierende Auswirkungen auf das Schreiben über psychisch Kranke besitzt. Zwar gehört auch die Bezeichnung „Depression“ zum historischen Bestand des psychiatrischen Wortschatzes, doch wird mit ihr (noch) kein tradierter sozialer Typ verbunden, so dass eine fachspezifische Verwendung der Bezeichnung möglich wird. Vor allem mit dieser Bezeichnung können lexikalische und semantische Demarkationslinien zu zunächst verwandten Disziplinen wie der (philosophischen) Anthropologie abgebaut und die Autonomie des psychiatrischen Diskurses unterstützt werden. CV: Studium der Deutschen Sprache und Literatur, Philosophie und Politikwissenschaft an der Philipps Universität Marburg; 1999 Promotion ebd. in der Germanistischen Sprachwissenschaft mit einer Arbeit zur „Verständlichkeit von frühreformatorischen Flugschriften“; 2006 Habilitation mit einer PSYCHIATRIE – WISSEN – GESELLSCHAFT: ABSTRACTS & CV –4 Arbeit zur Entstehung und Entwicklung der psychiatrischen Fachsprache (1800-1939) an der JustusLiebig-Universität Gießen; seit 2009 Professorin für Germanistische Sprachwissenschaft an der Universität Paderborn. Forschungsschwerpunkte u.a.: Medienlinguistik/Sprachmediengeschichte, Textsortengeschichte, Geschichte des öffentlichen Kommunizierens, Sprache und Literatur sowie historische Phraseologie, Semantik und Pragmatik. Theresa Schnedermann, Graduiertenplattform «Sprache und Wissen», Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg: Beziehungen zwischen ›Person‹ und ›Symptom‹ im Burnout-Diskurs Abstract: Der Vortrag basiert auf Analysen ihres Dissertationsprojekts zur perspektivierenden Wirkung des Mediums Sprache auf die fachliche und öffentliche Wissens- und Meinungsbildung zu einem Krankheitsbild am Beispiel des Phänomens BURNOUT. Im Fokus der Arbeit stehen die Fragen, inwieweit der zugehörige fachliche und öffentliche Diskurs dazu beiträgt, dass dieses Phänomen als neu entdecktes psychologisch-medizinisches Faktum bzw. Krankheitsbild konstituiert und rezipiert wird, wie umstritten dieses Wissen ist und welche gesellschaftlich relevanten Diskursthemen sich an dieses anschließen. Zwei Fragenkomplexe werden im Diskurs über das Phänomen BURNOUT explizit oder implizit stets mitverhandelt: 1.) Worauf referieren die Diskursakteure mit dem Ausdruck Burnout /Ausbrennen? Was klassifizieren sie als ›Symptom‹ und welche Begriffsdefinition legen sie zugrunde? 2.) In welche diskurssemantischen Beziehungen werden die Größen ›Person‹ und ›Symptom‹ zueinander gestellt? Der Zugang über die Sprachoberfläche macht die verschiedenen diskursiv konstituierten Perspektiven auf diese Themen und mit ihnen einhergehende Norm(alitäts-) und Relationsvorstellungen deutlich. Dies wird an einschlägigen Beispielen aus den Textkorpora zum Burnout-Phänomen gezeigt und zur Diskussion gestellt werden. CV: Theresa Schnedermann studierte Germanistik, Philosophie, Pädagogik und Psychologie an der Universität Heidelberg und Salamanca (Spanien). Nach dem Studium arbeitete sie als DAADSprachassistentin an der Universität Thessaloniki (Griechenland) und entwickelte Unterrichtseinheiten für das Kommunikationstraining aus dem Ausland kommender Mediziner für das Universitätsklinikum Freiburg. Derzeit promoviert sie in Heidelberg bei Prof. Dr. Ekkehard Felder zum Thema „Die sprachliche Konstituierung eines Krankheitsbildes? Diskurslinguistische Untersuchung am Beispiel des Burnout-Syndroms“. Sie ist Mitglied im Graduiertennetzwerk des Forschungsnetzwerks «Sprache und Wissen» und Promotionsstipendiatin des Evangelischen Studienwerks Villigst. Seit 2012 arbeitet sie als Redaktionsassistentin am Institut für Deutsche Sprache (Mannheim) in der Öffentlichkeitsarbeit. Ihre Forschungsinteressen liegen in den Bereichen der linguistischen Hermeneutik und Diskursanalyse, Sprachreflexion und der Fachkommunikation in Medizin, Psychiatrie und Psychologie. Yvonne Ilg, Deutsches Seminar, Universität Zürich: Von der psychiatrischen Diagnose zur alltäglichen Metapher: «Schizophrenie» in der Gemeinsprache Abstract: Seit seiner Erfindung durch den Zürcher Psychiater Eugen Bleuler 1908 hat der Schizophreniebegriff eine erstaunliche Verbreitung weit über den psychiatrischen Kontext hinaus erfahren. Schon bald von der Fachwelt aufgenommen und als psychiatrische Diagnose eingesetzt, wurden der Fachbegriff Schizophrenie und seine Derivationen wie schizophren, schizoid, Schizo im Laufe des 20. Jahrhunderts auch Teil verschiedener Gemeinsprachen, in denen sie durch metaphorische Übertragung zusätzliche Bedeutungskomponenten und kommunikative Verwendungszwecke erhalten haben. Eine Entwicklung, die wiederum auf die psychiatrische Fachwelt und insbesondere von der Diagnose Schizophrenie Betroffene zurückwirkt. PSYCHIATRIE – WISSEN – GESELLSCHAFT: ABSTRACTS & CV –5 Vor diesem Hintergrund berichtet der Vortrag aus einem sprachwissenschaftlichen Dissertationsprojekt, das nach der Übertragung des Begriffsfeldes «schizo-» in die deutsche Gemeinsprache fragt. Anhand erster (korpus-)linguistischer Analysen wird im Vortrag die Entwicklung des Begriffsfeldes im öffentlichen Diskurs nachgezeichnet. Es wird aufgezeigt, dass das Wortfeld insbesondere in den 1970er Jahren eine starke Ausbreitung erfährt, die – so wird argumentiert – auch wesentlich zur Lexikalisierung der heute verbreiteten metaphorischen Bedeutungskomponente beigetragen hat. Die zeitgleiche öffentliche Präsenz antipsychiatrischer Akteure und Inhalte scheint diese Entwicklung dabei massgeblich beeinflusst zu haben. Die Übertragung des Schizophreniebegriffs in die Gemeinsprache wird als Beispiel für die Zirkulation von (wissenschaftlichen) Begriffen und Wissensinhalten betrachtet. Die untersuchten Phänomene können zeigen, welche Faktoren die Verbreitung wissenschaftlicher Begriffe begünstigen, wie Begriffe und Wissensinhalte im öffentlichen Diskurs ihre Form verändern und wie sie auf diese Weise auf die Wissenschaft zurückwirken. Datengrundlage der Untersuchung sind umfangreiche digitale Textkorpora der deutschen Gemeinsprache (bestehend aus Wochen- und Tageszeitungen, Kulturzeitschriften, Parlamentsprotokollen u.a.), die sich über das gesamte 20. und bis ins 21. Jahrhundert erstrecken. Theoretisch-methodisch reiht sich die Arbeit in die historische Semantik, Diskurs- und Korpuslinguistik ein. CV: Studium der Germanistik, Allgemeinen Geschichte und Volkskunde in Zürich und Berlin (20042011). Hilfsassistentin im interdisziplinären Projekt Semantik des Geschmacks – Sensory Language and the Semantics of Taste der Universitäten Zürich und Basel, der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und der ETH (2009-2010). Lizentiatsarbeit zur innovativen Verwendung und Veränderung des Wortschatzes beim Reden über Geschmack (2011). Seit 2013 Doktorandin im interdisziplinären Projekt «Schizophrenie»: Rezeption, Bedeutungswandel und Kritik eines Begriffes im 20. Jahrhundert (Universität & Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, www.schizophrenie.uzh.ch). Mitglied des Graduiertenkollegs des Zentrums Geschichte des Wissens der Universität und ETH Zürich sowie der Graduiertenplattform des Forschungsnetzwerks Sprache und Wissen (RuprechtKarls-Universität Heidelberg). Ulrike Hoffmann-Richter, Suva Versicherungsmedizin, Luzern: Kommentar aus psychiatrischer Sicht CV: 1958 geboren, Studium in Ulm; 1984 Promotion über ein Thema zur Verständigung von Arzt und Patient in der Visite. 1985 bis 1990 ärztliche Tätigkeit und Weiterbildung zur Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Köln; Psychoanalytische Ausbildung; 1990 bis 1999 Oberärztin in der PUK Basel mit klinischer Tätigkeit von Akutpsychiatrie über Kurz- und Langzeitrehabilitation bis Forensik. Seit 1999 Psychiaterin im Kompetenzzentrum Versicherungsmedizin. Ab 2004 Aufbau und Leitung des Versicherungspsychiatrischen Dienstes der Suva. Wissenschaftliche Tätigkeit im Bereich Sozialpsychiatrie, Suizid, Geschichte der Psychotherapie und Psychiatrie, qualitative Methoden, vor allem in der Analyse von Gesprächen und Texten. Seit 1993 Redaktorin, seit 2001 Herausgeberin der Psychiatrischen Praxis. 1994 – 2001 Geschäftsführende Herausgeberin der «Psychotherapeutin». Ein Grundthema, das sich durch alle klinischen, wissenschaftlichen und publizistischen Tätigkeiten zieht, ist die Verständigung – zwischen Ärztin und Patient, zwischen Psychiatrie und Öffentlichkeit, zwischen Medizin und Recht. Ausgewählte Publikationen: • Der Knoten im roten Faden. Eine Untersuchung zur Verständigung von Arzt und Patient in der Visite. Bern: Peter Lang Verlag 1985 (Dissertation). • Freuds Seelenapparat. Bonn: Psychiatrie-Verlag Edition das Narrenschiff 1994. • Das Verschwinden der Biographie in der Krankengeschichte. Eine biographische Skizze. BIOS 2 (1995), S. 204-221. • Erzählen – Zur narrativen Struktur psychiatrischen Wissens. Die Psychotherapeutin 10 (1999), S. 4-12. • Psychiatrie in der Zeitung. Urteile und Vorurteile. Bonn: Psychiatrie-Verlag Edition das Narrenschiff 2000. PSYCHIATRIE – WISSEN – GESELLSCHAFT: ABSTRACTS & CV –6 • • • Psychiatrie in der Zeitung. Erfahrungen beim Zeitung lesen. Psychiatrische Praxis 27 (2000), S. 354-356. Valium als Metapher: Die therapeutische Wirkung von Valium in der Alltagsvorstellung. In: Debus S, Burmeister H.P, Floeth T, Zechert C: Semiotik und Sozialpsychiatrie, Über Sinn und Zeichen einer Fachsprache. Rehburg-Loccum: Evangelische Akademie Loccum 15/03 (2005), S. 51-67. zusammen mit Zurbriggen S: Seelische Gesundheit und Krankheit in den Massenmedien. In: Rössler W, Kawohl W: Handbuch der sozialen Psychiatrie, Band 1. Stuttgart: Kohlhammer 2013, S. 323-336. Themenblock 3: Bildpraktiken Katrin Luchsinger, Departement Kulturanalysen und Vermittlung, Zürcher Hochschule der Künste: Puff! Un autre monde! Interdisziplinäre Psychologie und Psychiatrie im 19. Jahrhundert und das beginnende Vergnügen an der Abstraktion Abstract: Der französische Grafiker Grandville veröffentlichte 1844 eine Bilderfolge unter dem Titel „Un autre monde“. Deren Hauptfigur heisst „Puff“, und mit eben diesem Geräusch verschwindet er jeweils in einer Dampfwolke. Das Buch, in dem Bilder zentral und Texte ganz peripher sind, zeigt neue Welten, Utopien, merkwürdige Transformationen und futuristische (Kristall-) architekturen, wie sie erst später an Weltausstellungen verwirklicht wurden. Grandville war überzeugt, mit seiner Serie Grundlegendes und Neues beigetragen zu haben, nämlich bewegte Bilder, die er „Transformationen“ nannte. 1876 nahm der Sinologe und Amateur der Traumforschung D’Hervey de Saint-Denys eine von Grandvilles Grafiken auf und behauptete, es müsse sich hier um eine Traumdarstellung handeln. Er selbst hatte über 6000 eigene Träume aufgezeichnet. Grandvilles Holzstich rückte damit aus dem Bedeutungsfeld der Karikatur oder der Satire über neue Techniken, neues Konsumverhalten, neue Sozialutopien, in den Bereich der eben erst erfundenen Wissenschaft der Psychologie. Der Sinologe D’Hervey de Saint-Denys verfolgte, indem er über Träume publizierte und dazu moderne Grafik beizog, einen interdisziplinären Ansatz, wie er für die Forschung der experimentellen Psychologie in ihren Anfängen üblich und auch fruchtbar war. Als Traumforscher bildete er selbst als Frontispitz in seinem Buch (Les rêves et les moyens de les diriger) einen Traum in ungewohnter Weise ab, und zwar zweigeteilt: im oberen Teil durch eine Traumszene, im unteren durch abstrakten Formen. Wie aber konnte ein Publikum um 1880 abstrakte Bilder lesen? Anhand dieses und zweier weiterer Beispiele wird untersucht, wie durch den Austausch zwischen Künstlern, Psychiatern und deren Patientinnen, die von ihren Phantasiewelten und Halluzinationen berichteten, neue Bildformen und neue Deutungsansätze entstanden. Der Künstler, der Träumer, das Medium oder die Patientin wurde in diesem Vorgehen zur Expertin, zum Experten. Es wird untersucht, in welche Diskurse der Wissenschaft Psychologen die Bildwerke einschrieben und in welcher Weise diese ein neues Bildverständnis mitprägten. CV: Studium der Kunstgeschichte, Psychologie und Heilpädagogik. Heute Dozentin an der Zürcher Hochschule der Künste. Forschungsschwerpunkt Kunst und Psychologie um 1900, Institute for Cultural Studies an der ZHdK. Von 2006–2008 und von 2010–2014 Leitung des Projekts «Bewahren besonderer Kulturgüter I & II», das eine Bestandsaufnahme der Werke erstellte, die Patientinnen und Patienten 1850 – 1930 in psychiatrischen Kliniken in der Schweiz schufen. Vgl. www.kulturgueter.ch. Die gesamte Bilddatenbank mit über 5000 Werken ist ab 2015 im Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft der Öffentlichkeit zugänglich. Die Dissertationsschrift von Katrin Luchsinger, Die Vergessenskurve. Werke von Patientinnen und Patienten in psychiatrischen Anstalten um 1900. Eine kulturgeschichtliche Untersuchung wird 2015 erscheinen. PSYCHIATRIE – WISSEN – GESELLSCHAFT: ABSTRACTS & CV –7 Veronika Rall, Seminar für Filmwissenschaft, Universität Zürich: Visuelle Epistemologien der Psychiatrie um 1900: Fotografische und filmische Evidenz zwischen Objektivität und Subjektivität Abstract: Fotografische und filmische Bilder haben seit ihrer Erfindung nicht nur neue Blicke auf den Menschen und seine Welt eröffnet, sie stützten zudem die Wissensproduktion in den Wissenschaften. Auch die junge Disziplin der Psychiatrie bediente sich dieser ‹mechanisch› produzierten und deshalb scheinbar ‹objektiven› Bilder – das betrifft sowohl Fotografien, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts in zahlreichen europäischen Psychiatrien entstanden, wie auch Lehr- und Forschungsfilme, die hier ab 1898 gedreht wurden. Das Psychische jedoch ist ein Sonderfall der Visualisierung; eine ganz spezifische, sozusagen unmögliche Sichtbarmachung auf dem Feld des Unsichtbaren, die sich von anderen technischen Leistungen wie Zeitlupe oder Vergrösserung unterscheidet. Lässt sich das Erkenntnisinteresse der wissenschaftlich-fotografischen Fixierung eines Bakteriums oder eines Milchtropfens, an der filmischen Aufnahme der ‹Kinematik der menschlichen Bewegung› oder eines Herzschlags nachvollziehen, lösen psychiatrische Bilder deshalb heute eher Erstaunen aus. Ihnen eignet ein fundamentales Paradox: Inwiefern lassen sich in einem Medium, das äussere Wirklichkeiten abzubilden vermag, die Pathologien innerer, seelischer Vorgänge darstellen? Der Vortrag untersucht dieses Paradox einerseits anhand ausgewählter Fotografien, die im Zürcher Burghölzli bzw. der ihm angeschlossenen Pflegeanstalt Rheinau ca. zwischen 1900 und 1920 entstanden, anderseits anhand einiger der überlieferten psychiatrischen Filme (entstanden 1898 unter der Leitung von Gheorghe Marinescu in Bukarest und um 1905 unter der Leitung von Arthur van Gehuchten an der Universität Leuven). Der Fokus der Untersuchung liegt dabei auf dem epistemischpsychiatrischen «Denkstil» (Ludwik Fleck), der sich in das visuelle Material einschreibt und sowohl Paradigmen der «Objektivität» (Daston / Galison) wie auch der Subjektivität zu stützen vermag. Entscheidend sind dabei die Bildpraktiken, d.h. einerseits die verschiedenen Produktionsweisen, aber auch die Zirkulation der Bilder in unterschiedlichen Dispositiven wie Patientenakten, Vorlesungen und wissenschaftlichen Publikationen. CV: Studium der Literaturwissenschaft, Philosophie und Filmwissenschaft in Frankfurt am Main; Aufbaustudium im interdisziplinären Studiengang History of Consciousness an der University of California at Santa Cruz. Promotion am Seminar für Filmwissenschaft der Universität Zürich mit der Schrift Kinoanalyse – Plädoyer für eine Re-Vision von Kino und Psychoanalyse (Marburg: Schüren, 2011). Anschliessend Koordinatorin des Doktorandenprogramms «Kino und audiovisuelle Dispositive: Diskurse und Praktiken» der Universitäten Lausanne, Lugano und Zürich. Seit 2013 Post-Doc und Koordinatorin im transdisziplinären Forschungsprojekt der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich / Universität Zürich: «Schizophrenie: Rezeption, Bedeutungswandel und Kritik eines Begriffs im 20. Jahrhundert» (www. schizophrenie.uzh.ch). Milan Scheidegger, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, Institut für Biomedizinische Technik, Universität / ETH Zürich: Ikonographie des Geistes: Epistemologie und Bildpraxis in den psychiatrischen Neurowissenschaften der Gegenwart Abstract: Unseren Geist und somit mentales Erleben, Fühlen und Denken als natürliches Geschehen zu begreifen, so lautet die als erfolgsversprechend proklamierte Forschungsstrategie der modernen Life Sciences. Gleichzeitig erleben wir mehr als wir begreifen: Zwischen Gehirn und Geist klafft eine Erklärungslücke, deren existenzielle Tragweite nur im Lichte der Differenzen in der Wissensproduktion unterschiedlicher Wissenskulturen zu erhellen ist. Im Zeitalter moderner Neurotechnologien gewinnt die Frage nach der Naturalisierbarkeit des Mentalen erneut an Aktualität und mit ihr auch die Frage nach dem Stellenwert bildgebender Verfahren als epistemischen Werkzeugen, um neue Einsichten in die Natur des menschlichen Geistes zu vermitteln. PSYCHIATRIE – WISSEN – GESELLSCHAFT: ABSTRACTS & CV –8 Besonders in der Psychiatrie wirft die metrische Objektivierung des Subjektiven kontroverse Fragen auf: Welchen erkenntnisleitenden Stellenwert hat die Vermessung biologischer Regelmässigkeiten im Gehirn im Hinblick auf das Verständnis des Leidens eines erkrankten Subjekts? Die Frage nach der wissenschaftlichen Objektivierung des Geistes zu stellen bedeutet auch, sie in Resonanz zu bringen mit der Suche nach einer angemessenen Ebene der Erklärung als Fortsetzung der Geschichte der menschlichen Wissensproduktion. CV: Promotion an der Universität Zürich in Medizin und Fortbildung am Institut für Biomedizinische Technik (Universität und ETH Zürich) im Rahmen eines neurowissenschaftlichen Doktorats in modernen bildgebenden Verfahren des Gehirns. Aktuell arbeitet er als Arzt an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich und erforscht die neurobiologischen Grundlagen veränderter Bewusstseinszustände sowie die Biomechanismen antidepressiv wirksamer Therapien. Neben der empirischen Tätigkeit erwarb er den Master in Geschichte und Philosophie des Wissens an der ETH Zürich. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Biosemiotik, die Philosophie des Geistes, die Epistemologie der Psychiatrie sowie die Neurophänomenologie veränderter Bewusstseinszustände. Themenblock 4: Gegen-/Wissen Benoît Majerus, Unité de recherche «Identités, Politiques, Societés et Espaces», Université de Luxembourg: (Not) making schizophrenia in Belgium from the 1920s to the 1950s th Abstract: In the second half of the 20 century, schizophrenia became a catchword for psychiatry in Western Europe. In my paper, I will try to show the pre-history of the viral utilisation of the word in Belgium through three different gazes. On a micro-level using the patient's records from a Brussels' asylum, I follow the introduction of the diagnosis in the daily practices of psychiatrists. On a mesolevel, I analyse the use of the word in medical journals. On a macro-level a look at four daily newspapers should give a glimpse of what schizophrenia meant in the public sphere. It should be noted that the results presented in Zürich are very hypothetical as this research is only at an early stage of advancement. CV: Associate Professor for European History at the University of Luxembourg. He has largely th published on the history of the two World Wars and on the history of psychiatry in the 20 century. His most recent book is called Parmi les fous. Une histoire de la psychiatrie au 20e siècle, Rennes, PUR, 2013. He is co-editor of the blog h-madness (http://historypsychiatry.com/) and you can follow his research on his blog (http://majerus.hypotheses.org/). Marietta Meier, Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Universität Zürich: Der Herd psychischer Störungen. Hirnmodelle in den 1950er Jahren Abstract: In der neueren Wissenschaftsforschung wird die Verbreitung von wissenschaftlich produziertem Wissen nicht als linearer, eindimensionaler Prozess verstanden, in dem Experten Laien auf allgemein verständliche Weise Wissen vermitteln, sondern als Teil vielfältiger intra-, inter- und extrawissenschaftlicher Kommunikationsprozesse, die sich wieder auf die Produktion wissenschaftlichen Wissens auswirken. Das Referat untersucht am Beispiel der Leukotomie, wie in den 1950er Jahren Wissen produziert, rezipiert und weiterentwickelt wurde – Wissen über das Hirn, psychische Störungen und deren Behandlung. Die Leukotomie oder Lobotomie, ein chirurgischer Eingriff, bei dem Verbindungen zwischen zwei Hirnarealen durchtrennt wurden, wurde 1935 entwickelt, setzte sich aber erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs durch. Die Behandlungsmethode war von Beginn weg umstritten, weil sie eine vergleichsweise hohe Sterberate aufwies, direkt in die Persönlichkeit der Patienten eingriff und auch PSYCHIATRIE – WISSEN – GESELLSCHAFT: ABSTRACTS & CV –9 einschneidende körperliche Folgen haben konnte. Nach 1945 etablierte sich die Psychochirurgie jedoch schnell. Nun galt die Leukotomie als Verfahren, das schwerwiegende Symptome bekämpfen und psychisch Kranke auf diese Weise wenigstens „sozial“ heilen konnte. Das Referat analysiert, wie die Medien in den 1950er Jahren über die Leukotomie informierten und wie Ärzte, Angehörige und Vormunde von Patienten miteinander über psychochirurgische Eingriffe kommunizierten. Im Zentrum des Beitrags stehen die Interdependenzen, die sich zwischen verschiedenen Formen von Wissen entwickelten. Dabei kann gezeigt werden, dass der Siegeszug, den die Psychochirurgie nach dem Zweiten Weltkrieg antrat, auch mit einem Wandel der Vorstellungen zusammenhängt, die eine breite Öffentlichkeit vom Gehirn und von psychischen Störungen vertrat. CV: Marietta Meier ist Historikerin, Privatdozentin an der Universität Zürich, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Universität Zürich und Dozentin an verschiedenen Universitäten. Von 2001–2006 war sie Co-Leiterin von Forschungsprojekten zur Geschichte der Psychiatrie im Kanton Zürich. Ihre Habilitationsschrift zur Geschichte der Leukotomie nach dem Zweiten Weltkrieg erscheint 2015 unter dem Titel „Spannungsherde. Psychochirurgie nach dem Zweiten Weltkrieg“ im Wallstein Verlag, Göttingen. Marietta Meier lehrt zu sozial-, kultur-, emotions-, wissenschafts- und geschlechtergeschichtlichen Themen sowie zu theoretisch-methodischen Fragen. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Psychiatrie-, Wissenschafts-, Religions- und Emotionsgeschichte des 18., 19. und 20. Jahrhunderts. Sandra Fürgut, Institut für Zeitgeschichte, München «Einbruch der Psychoanalyse»? Debatten um die Therapierbarkeit von Schizophrenie nach 1945 Abstract: Als sich in den 1950er Jahren Berichte von psychotherapeutischen Behandlungen bei schizophrenen Patientinnen und Patienten verbreiteten, führte dies in der deutschen Psychiatrie zur Hinterfragung der herrschenden Lehre und des bestehenden Wissens: Denn Schizophrenie galt vielen Psychiatern als anlagebedingt, im Verlauf als unaufhaltsam und nahezu völlig unzugänglich für psychiatrischen Einfluss. Der Beitrag geht der Frage nach, wie sich etabliertes Wissen veränderte und anpasste bzw. mit welchen Strategien es gesichert und behauptet wurde. Zwei Aspekte der Diskussion um die Therapierbarkeit von Schizophrenie sollen dafür näher beleuchtet werden. Erstens fällt auf, dass, während psychotherapeutische Ansätze tendenziell auf Akzeptanz stießen, psychoanalytische Ansätze mit dem Vorwurf konfrontiert wurden, sich einer unwissenschaftlichen Methodik zu bedienen und auf einer falschen Diagnosestellung aufzubauen. Ihre Wissenschaftlichkeit wurde grundsätzlich in Frage gestellt. Mit diesen Attacken auf die Psychoanalyse versuchte die Psychiatrie, sich in Zeiten der „Psychologisierung“ und Verbreitung populärwissenschaftlichen Wissens der eigenen wissenschaftlichen Kriterien und Standards zu versichern und damit auch den Herrschaftsanspruch auf die Erforschung und Behandlung psychischer Krankheiten gesellschaftlich zu legitimieren. Zweitens wird der Wandel des Wissens von Schizophrenie anhand der Frage diskutiert, inwieweit die psychotherapeutischen Erfolgsgeschichten, die sich nicht an die „Grenzen der traditionellen Klassifikation“ (W. v. Baeyer) hielten, schließlich auch ihren Teil zur Hinterfragung der gängigen Diagnose- und Klassifikationsschemata beitrugen. Am Beispiel der Ende der 1950er Jahre geführten Debatte über Psychotherapie und Diagnostik lässt sich beobachten, wie dem nosologischen „Ordnungswissen“ zunehmend die Forderung auf ärztliche und ganzheitliche Zuwendung zum Patienten entgegengesetzt wurde. CV: Seit 2012 Promotion zum Thema „Das Ringen um das Selbst. Schizophreniediskurse in Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur in Ost- und Westdeutschland (1950-1980)“. Gefördert durch die Studienstiftung des deutschen Volkes. Seit 2011 Wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Zeitgeschichte München; 2009 - 2011 Hilfskraft am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte (Augsburg); 2006 - 2011 Studium an der Universität Augsburg (Neuere und Neueste Geschichte, Neuere deutsche Literaturwissenschaft, Philosophie). Magisterarbeit über die „Hochschule für Gestaltung“ in Ulm. PSYCHIATRIE – WISSEN – GESELLSCHAFT: ABSTRACTS & CV –10 Marina Lienhard, Forschungsstelle für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Universität Zürich: Diktatur oder Rebellion? Schizophreniemodelle in den langen sechziger Jahren Abstract: Ausgehend von Michael Staubs These, dass das Gedankengut der Antipsychiatrie der späten sechziger und siebziger Jahre als Teil einer breiteren Wende hinzu «sozialen Diagnosen» innerhalb der Mainstream-Psychiatrie ab den fünfziger Jahren angesehen werden muss, vergleiche ich in meinem Beitrag zwei Schizophreniemodelle. Zum einen untersuche ich die Forschungsprojekte des sogenannten Palo Alto-Teams um Gregory Bateson in den 1950er Jahren, in deren Rahmen die Double-Bind-Theorie entwickelt wurde. Das Team siedelte Schizophrenie in der Kommunikation und Interaktion zwischen Familienmitgliedern an. Zum anderen analysiere ich Ronald D. Laing und Aaron Estersons Interviewprojekt mit Familien mit als schizophren diagnostizierten Kindern, welches 1964 in der Publikation der Monographie Sanity, Madness and the Family mündete und für Karrieren der Autoren einen Wendepunkt darstellte: beide verabschiedeten sich damit aus der MainstreamPsychiatrie und wandten sich alternativen Projekten zu. Dieser Vergleich soll es ermöglichen, die (unterschiedlichen) Vorstellungen von Schizophrenie und von Familie in den Blick zu nehmen, ebenso wie die implizit vorhandenen Vorstellungen von Normalität und Abnormalität. Darüber hinaus sollen folgende Fragen diskutiert werden: Wie funktionierte die Zirkulation von Wissen über Schizophrenie und Familie zwischen den USA und Europa? Wie gestaltete sich das Verhältnis zwischen Mainstream-Psychiatrie und Gegenkultur? Fand zwischen Ende der fünfziger Jahre und Ende der sechziger Jahre generell eine Radikalisierung dieser Theorien statt? Und: Kann von einer fortschreitenden Ent-Individualisierung der Schizophrenie in der Nachkriegszeit gesprochen werden? Zudem soll die Frage aufgeworfen werden, ob die AntiPsychiatrie als Gegenwissen verstanden werden kann oder ob sie nicht vielmehr als Teil eines grösseren gesellschaftlichen Diskurses angesehen werden muss. CV: Marina Lienhard hat Allgemeine Geschichte, Filmwissenschaft und Populäre Kulturen an der Universität Zürich studiert. Von 2010 bis 2013 war sie Hilfsassistentin im SNF-Forschungsprojekt Postkoloniale Schweiz von Dr. Patricia Purtschert an der ETH Zürich. 2013 schloss sie ihr Studium mit einer Masterarbeit zum Thema «Abenteurer sterben aus». Weisssein, Othering und Tropendiskurs in den Schriften und Korrespondenzen der Tropenschule und ihrer ehemaligen Schüler, 1943–1981 ab. Seit 2013 ist sie Doktorandin im interdisziplinären SNF-Projekt «Schizophrenie»: Rezeption, Bedeutungswandel und Kritik eines Begriffes im 20. Jahrhundert (UZH und Psychiatrische Universitätsklinik Zürich) sowie Mitglied des Graduiertenkollegs des Zentrums Geschichte des Wissens der Universität und ETH Zürich.