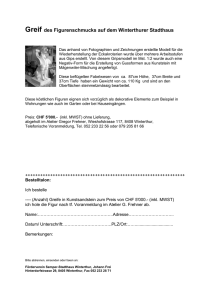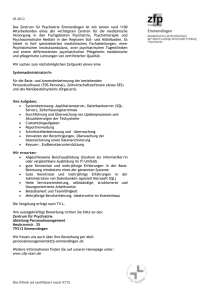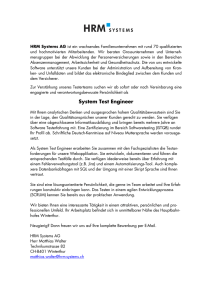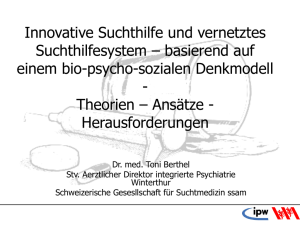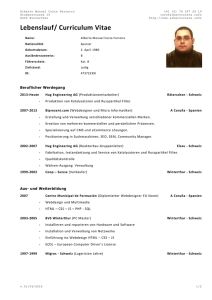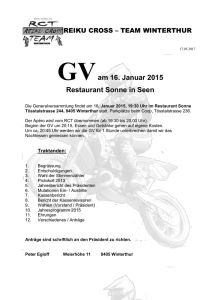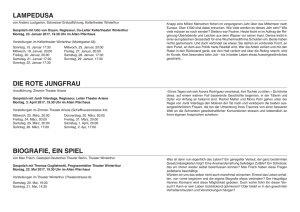„Gesund an Leib und Seele“– World Mental Health Day 2004
Werbung

1 2004 Juni Forum 2 Psychosomatik – gibt es das? 3 für Regeneration - ein vernachlässigter Aspekt im Behandlungsprozess die 3 Psychiatrieregion Hausarzt und Psychiatrie – zwei Welten? 4 Der psychiatrische Patient auf der Notfallstation Winterthur 5 Wir brauchen Zeit für das Psychische im Spitalalltag 6 Kurz und bündig „Gesund an Leib und Seele“– World Mental Health Day 2004 Lernen ist die nicht zu bremsende Lieblingsbeschäftigung unseres Gehirns. Zellen und ihre Netzwerkschaltstellen - die Synapsen - reichern sich an, wenn Zebrafinken neue Gesänge oder Taxifahrer den Stadtplan lernen. Ob sich psychiatrisches Können ebenfalls in Karten der Hirnaktivität abbildet, wird vielleicht auch einmal untersucht. Wichtig für uns ist die Frage, wie all die lernbereiten Köpfe unseres Versorgungssystems eine intelligence amplification, ein kollektives Hirn, bilden können. Eine „Lernende Organisation“ forderten Grundversorger im Winterthurer Psychiatriekonzept. Die ipw - beauftragt, einen Superorganismus der Akteure zu fördern - nimmt diese Forderungen ernst. Bescheiden ausgedrückt suchen wir Formen, welche uns ein Lernen und Verbessern im gemeinsamen Wirken am psychiatrischen Patienten ermöglichen. Die „Synapse“ soll mit dazu beitragen. Wir hoffen, unser Versorgungshirn tut es den Finken und Taxifahrern gleich. Dr. med. Andreas Andreae Chefarzt ipw Von Dr. med. Toni Berthel Stv. Chefarzt ipw Die World Federation of Mental Health WFMH („Weltverband für seelische Gesundheit“, assoziiert mit der WHO und UNO) will mit dem Weltgesundheitstag des psychisch Kranken am 10. Oktober 2004 wieder einmal darauf hinweisen, dass die kartesianische Trennung von Psyche und Körper eine falsche Prämisse im wissenschaftlichen und praktischen Verständnis von Gesundheit und Krankheitsbehandlung ist. „Mind and body are inseparable: health is a complete state of well-being - and there is no health without mental health.” Unser Gesundheitssystem folgt noch immer dem Mythos des Körper-Seele-Dualismus, gewichtet einseitig körperlich Fassbares und benachteiligt psychisch Kranke sowie Patienten mit komplexen und chronifizierenden Leiden. Das Problem liegt aber noch anderswo. 2004 ist ein olympisches Jahr und Baron de Coubertin, dem „Erfinder“ der modernen olympischen Spiele, ging es bekanntlich um den „gesunden Geist in einem gesunden Körper“. Das olympische Ideal steht dem Körper-Seele-Dualismus entgegen, aber ein anderer Dualismus ist heute die Folge: Hier die körperlich und mental gestählten, bewunderten, gut bezahlten Sportstars, dort unsere Patientinnen und Patienten mit vielen körperlichen und seelischen Gebresten. Letztere erhalten weder Applaus noch Wertschätzung. Ihr Leiden darf heute sogar von rastlosen und nimmermüden Politikern als Scheinkrankheit oder Scheininvalidität abgewertet werden. Die Stätten, in denen der gut funktionierende Körper zelebriert wird, sind zu Konsum- und Fitnesstempeln ausgebaut worden. Immer häufiger geben sich auch Spitäler ein solches Image. Die Orte, an denen Menschen behandelt werden, die älter geworden sind, sich ihre jungen Körper verstümmeln oder ihre Muskeln von den Knochen hungern, werden „ausgeblocht“ und „weggemerzt“. Mit der einseitigen Betonung der maximalen Leistung, der optimalen Ef- fizienz, der schlanken Staatsstrukturen kann vielen Pantanis, Sanierern und „Staatsverschlankern“ der Geist - oder eben die Seele - verloren gehen. Gefühle, Freude, Trauer, Angst, Leidenschaft werden im und durch den Körper ausgedrückt. Bei den einen im Ausdruck unendlicher Leistungsbreitschaft, bei den anderen in Spannungen, Schmerzen, chronischen Beschwerden. Die erfolgreiche Behandlung und Betreuung der letzteren braucht Zeit und menschliche Zuwendung. Hier sind Körperliches und Psychisches stets untrennbar. Wie sieht es im Netzwerk der integrierten Versorgung unserer Psychiatrieregion aus? Welches sind die Erfahrungen, Standpunkte und Wünsche der einzelnen Akteure, wenn es um die Beziehung zwischen Körper- lichem und Psychischem geht – in der Hausarztpraxis, in der Geronto- psychiatrie, in der Fachsprechstunde, im Spital? Im vorliegenden Forum erlauben wir uns einen kleinen Streifzug, setzen einige Spots und lassen das Gesagte für sich sprechen. 2 Psychosomatik – gibt es das? Von Dr. med. Beat R. Schaub Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie FMH Als ich gebeten wurde, einen kurzen Artikel zum Thema des diesjährigen Weltgesundheitstages der psychisch Kranken zu schreiben, dachte ich zunächst an die zahlreichen Patienten, die nach mehrfachen Abklärungen bei Spezialisten wegen unterschiedlicher Leiden schliesslich in meine Sprechstunde verwiesen wurden. Es war ihnen zuvor mitgeteilt worden, es handle sich bei ihrem Leiden um eine funktionelle Störung mit psychischer Ursache. Die erste Interpretation der Betroffenen war häufig die, dass man z.B. ihre Rückenschmerzen bisher nicht genügend ernst genommen hatte und sie nun abgeschoben würden. Diese Menschen waren zunächst weiterhin davon überzeugt, dass ein körperliches Problem Grund für ihr Leiden sei, dieses jedoch noch nicht gefunden wurde. Eine andere Betrachtungsweise musste in gemeinsamer Arbeit in den Therapiestunden entwickelt werden. Anstelle eines Ursache-Wirkung-Denkens würde ein Nebeneinander seelischer und leiblicher Erscheinungen stehen. In letzter Zeit wird man als niedergelassener Psychiater über verschiedene (Marketing-)Kanäle darauf aufmerksam gemacht, dass Herzpatienten häufig auch unter Depressionen leiden. Hier wird ein umgekehrter Schluss gezogen: ein körperliches Leiden schafft psychische Symptome. In der NZZ vom 18. Februar 2004 wird über Angststörungen berichtet: Neurowissenschafter in den USA fanden mit Hilfe der Positronenemissionstomographie (PET) bei Angstpatienten in drei bestimmten Gehirnregionen bis zu einem Drittel weniger Serotonin-Rezeptoren als bei gesunden Probanden. Die selbe Forschergruppe hatte dies auch bei depressiven Patienten gezeigt. Ob jemand eine psychische Störung entwickelt, hängt nun offenbar von der An- oder Abweseheit einzelner Rezeptoren im Gehirn ab. Anscheinend ist also nur die genetische Veranlagung und nicht etwa die Lebenserfahrung entscheidend für die Ausprägung einer Angststörung oder Depression. Die Interaktionen des untersuchten Gehirns mit seiner Umwelt scheinen unter diesem Blickwinkel irrelevant. Man könnte sagen, dass hier psychische Phänomene oder Symptome auf rein somatische Einheiten (Serotonin-Rezeptoren) reduziert werden. Seit Descartes besteht der Dualismus Bewusstsein (Ich, Psyche) und Materie (Körper, Soma). Mit ihm hat die Wissenschaftsgeschichte eine sehr nachhaltige Wendung genommen. Salopp ausgedrückt kann (wis- senschaftlich gesehen) nur sein, was vom Menschen erkennbar und somit messbar ist. Damit haben die Psychiatrie und viele psychotherpeutische Schulen ein Problem. Sie sind nicht wissenschaftlich, d.h. die Psychiatrie nur, wenn sie sich als untergeordnetes Fach der Neurowissenschaften sieht. Andere Betrachtungsweisen mussten in den Therapiestunden entwickelt werden. Nehmen wir einmal an, es gibt keinen Dualismus Psyche und Soma und keine Psychosomatik. Das heisst, dass „leben“ wieder wie damals im Althochdeutschen mit „leiben“ beschrieben werden könnte. Der Mensch drückt dann seine Haltung und Verhaltensweise, oder besser, seine Existenzweise zu seiner Umwelt immer auch leiblich aus. Ob in freudiger Erregung, unter Angst oder während heftigster Bauchschmerzen: wir sind, unter obiger Annahme, immer auch dieses Leibliche, mit all den dazugehörenden einzelnen physiologischen (und psychologischen) Phänomenen. Von einem derartigen Blickwinkel aus verschwände die so strittige Grenze zwischen der Welt der Psyche und der des messbaren Körperlichen. Anstelle eines Ursache-Wirkung-Denkens würde vielmehr ein Nebeneinander seelischer und leiblicher Erscheinungen stehen. Persönlich bevorzuge ich die Betrachtungsweise über das menschliche Dasein, bei welcher der Mensch gesehen wird als Wesen, das bei all seinen Verrichtungen, in all seinen Lebenssituationen „mit Leib und Seele“ dabei ist. Regeneration – ein vernachlässigter körperlich-seelischer Aspekt im Behandlungsprozess Von Markus Halmer Pflegefachmann Psychiatrie, Stationsleiter Therapiestation, Gerontopsychiatrisches Kompetenzzentrum ipw 3 In Anlehnung an das Konzept der Salutogenese möchte ich mich der Frage nach der Bedeutsamkeit von Regeneration in der Psychiatrie widmen. Mich leitet hier die Frage: Wieviel Aktivität braucht ein Patient, um wieder zur persönlichen Autonomie zurückzufinden? Im Idealfall gelingt es einem Behandlungsteam, mit seinen Patienten einen Therapieplan auszuhandeln, der nicht nur reflektierte Aktivitäten, sondern auch reflektierte Regenerationszeiten beinhaltet. Unter Regeneration verstehe ich ein Verhalten, das mehr Energie bringt, als dass es kostet (= positive Energiebilanz/ Erholungsgrad). Wem aber welches Regenerationsverhalten am meisten Erholung bringt, ist wohl von Mensch zu Mensch verschieden und muss somit individuell ermittelt werden. In der folgenden Falldarstellung bedeutete dies etwa tägliche Atemübungen, aktives Musikhören oder den wöchentlichen Besuch des Gottesdienstes. Der Patient musste sein Regenerationsverhalten neu entdecken, um zunehmend fähig zu werden, sich mit sich selbst und seinen Verhaltensweisen auseinanderzusetzen. Unter Regeneration verstehe ich ein Verhalten, das mehr Energie bringt, als dass es kostet. Herr X., 55 Jahre alt, wurde mit der Diagnose „Depression“ auf der Therapiestation aufgenommen. Bis vor drei Jahren war er beruflich sehr erfolgreich tätig, ging schonungslos mit sich um. Er hatte dann einen Schlaganfall erlitten, dessen Folge eine deutliche Störung seiner kognitiven Fähigkeiten nach sich zog. Nun entstand zunehmend eine Diskrepanz zwischen seinen ursprünglichen Rollenauffassungen und seinen aktuellen Fähigkeiten. Diese Spannung stieg weiter, bis hin zur Blockade und persönlichen Isolation des Patienten, der schliesslich in eine tiefe Depression fiel. „Was raubt mir Energie, und woran merke ich das?“ und „Was gibt mir Kraft, bzw. wie regeneriere ich mich?“. Die Bezugsperson reflektierte mit Herr X. wöchentlich sein Aktions- und Regenerationsverhalten, regte ihn zum Experimentieren mit neuen Verhaltensweisen an und erarbeitete mit ihm Methoden zur Selbstreflexion. Bereits die ersten geplanten Regenerationszeiten im Tagesablauf von Herr X. zeigten vor allem für ihn erstaunliche Wirkungen: Sein subjektives Befinden stieg innerhalb von wenigen Tagen an, seine Konzentrationsfähigkeit verbesserte sich kontinuierlich, und nach einigen Tagen war er wieder fähig, im stationären Rahmen seine Aktivitäten des täglichen Lebens autonom zu erledigen. In der folgenden Zeit begann Herr X. sowohl mit seiner Konzentrations- als auch seiner Regenerationsfähigkeit zu experimentieren. Nach sechs Monaten war Herr X. wieder in der Lage, selbständig längere Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu organisieren und durchzuführen, in Stresszeiten in Einkaufszentren Kommissionen zu erledigen und sich im Rahmen von Trainingswochenenden bei sich zu Hause komplett selbst zu versorgen. Nach zwei weiteren Monaten der Konsolidierung konnte Herr X. nach Hause entlassen werden. In der Arbeit mit psychiatrischen Patienten stelle ich fest, dass dem Aspekt der Regeneration in der Alltagsgestaltung oft zu wenig Bedeutung beigemessen wird (abgesehen vom nächtlichen Schlaf, der mit allen Mitteln herbeigeführt wird). Ziel muss es sein, einen Tagesrhythmus zu entwickeln, der eine Ausgewogenheit zwischen Aktivität und Regeneration in sich birgt. Eine wesentliche Aufgabe der Pflege ist es, den Patienten dabei behilflich zu sein, ihr Selbstpflegeverhalten im Bereich Erholung zu verbessern und durch Experimentieren wirksamere Methoden der Energiegewinnung zu entdecken. Als er bei uns auf der Therapiestation eintrat, zeigte Herr X. ein Bild der Hilflosigkeit, nässte ein, konnte sich nicht selbst an- und ausziehen. Im zwischenmenschlichen Kontakt wirkte er ratlos, litt unter Wortfindungsstörungen, wirkte blockiert. Seine Konzentrationsfähigkeit war so gut wie nicht vorhanden. Auch beklagte Herr X. teilweise sensorische Ausfälle in Armen und Beinen sowie eine generelle Schwäche. Die Schwerpunktfragen im achtmonatigen Pflegeprozess lauteten unter anderem: Hausarzt und Psychiatrie - zwei Welten? Von Dr. med. Georg Angele Praxis für Allgemeinmedizin FMH „Herr Doktor, jetzt müssen Sie schön lächeln!“ Kurz danach blitzt es zweimal hell auf. Etwas überrumpelt sehe ich mich zu Beginn dieser Sprechstunde einer „Fotografin“ gegenüber. Widerspruch ist zwecklos, und ich fühle mich auch geschmeichelt, dass jemand ein Foto von mir machen will. Strahlend bringt die 35-jährige Patientin zwei Aufnahmen zur nächsten Konsultation mit. Die Bilder sind überaus gelungen. Das Fotografieren sei nämlich ihr Hobby. Wenn es nur nicht so teuer wäre. Dass beim nachfol- genden Gespräch der Zeitplan nicht ganz eingehalten werden kann, ist selbstverständlich. Nach bald zwanzig Jahren hausärztlicher Praxistätigkeit komme ich so zu den ersten Bildern aus meinem Beruf, der doch mein Leben zu einem grossen Teil prägt. Warum erzähle ich Ihnen diese Geschichte? Ich lernte diese Patientin als Hausarzt einer psychiatrischen Einrichtung, „Betreutes Wohnen Elgg“, kennen. Die sechzig meist jüngeren, psychisch kranken Menschen beiderlei Geschlechts wohnen für einige Monate bis Jahre in verschiedenen Wohngruppen in Elgg und Umgebung. Der leitende Arzt 4 einer psychiatrischen Klinik deckt die Behandlung der Grundkrankheit ab. Für körperliche Erkrankungen bin ich zuständig. Diese Aufteilung entspricht nicht gerade dem Bild der integralen seelischen und körperlichen Betreuung, wie ich sie mir bei einem Hausarzt vorstelle. Heute, nach sechs Jahren Erfahrung mit dieser Lösung, hat sie mich vollständig überzeugt. Gerade bei den sehr komplexen Lebens- und Krankheitsgeschichten bin ich froh, einen kompetenten Partner für die psychiatrischen Probleme zu haben. Andererseits kann ich mich völlig auf die oft schwierige körperliche Seite konzentrieren. Viele Bewohner sind ehemalige oder noch aktive Suchtkranke. So betreue ich einige HIV-Patienten, die ich sonst nie sehen würde. Ich lernte die verschiedenen Selbstverletzungsformen kennen und musste mich auch in Problemstellungen wie die Akromegalie, eine seltene Hormonstörung, einarbeiten. Was mir fehlt ist leider öfters ein Feedback. Die Zusammenarbeit mit meinem psychiatrischen Kollegen oder den Betreuern ist klar geregelt. Wir treffen uns immer wieder zum Gedankenaustausch, ungezwungen bei einem Essen oder anderen Aktivitäten. Alle Patienten haben sich einverstanden erklärt, dass wir uns gegenseitig über die Befunde und Therapien informieren. Nach jedem Besuch geht eine Faxmitteilung an die Betreuer, die dann die somatischen Medikamente in der Praxis abholen. Die Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner von „Betreutes Wohnen Elgg“ ist für mich und meine Praxismitarbeiterinnen eine Bereicherung und gibt oft Anlass zum Schmunzeln. Aber auch die andere Seite will ich nicht verheimlichen. Die meisten Kranken des Betreuten Wohnens zeigen ausgeprägte Verhaltensauffälligkeiten und können am Empfang und im Wartezimmer schon mal für Unruhe und Stress bei den Praxisassistentinnen sorgen, besonders wenn sie warten müssen. Ich hoffe, dass ich nun nicht den Eindruck erweckt habe, ich würde mich in meiner Praxistätigkeit nur mit psychia- trischen Patienten auseinandersetzen. Hauptsächlich bin ich nämlich als „gewöhnlicher“ Hausarzt auf dem Lande tätig und betreue vom Säugling bis zu sehr alten Menschen alle, die Bedarf haben. Das Einbeziehen der Sinnfrage von Krankheiten führt mich oft in zeitliche Not. Bei den sogenannten „Normalen“ bin ich meist Psychiater und Somatiker in einem, wie es eigentlich bei einem Arzt üblich sein sollte. Gerne greife ich aber in Krisensituationen auf das KIZ der Integrierten Psychiatrie Winterthur zurück. Froh war ich auch schon über die Spezialsprechstunden an der Poliklinik, z.B. für Anorexie- und Bulimiepatientinnen. Jugendliche mit Adoleszentenkrisen, deren Behandlung meine Fähigkeiten zum Teil übersteigt, verweise ich gerne an die Beratungsstelle für Jugendprobleme an der Trollstrasse. Meist aber suche ich die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Psychologen oder Psychiatern. Was mir fehlt ist leider öfters ein Feedback, da von den ambulanten Einrichtungen meist keine schriftlichen Berichte verschickt werden. Aus Freude an der Vielfalt der menschlichen Begegnungen mache ich am liebsten alles selber. Sei dies das Nähen einer Wunde, das Impfen der Kinder, verbunden mit der Beratung der Eltern, die Suizidprophylaxe bei Informationen in der Sekundarschule oder die „kleine Psychotherapie“ bei Ehekrisen, der midlife crisis oder den Reaktionen auf die Mitteilung schwerer Erkrankungen. Das Einbeziehen der Sinnfrage von Krankheiten führt mich in meiner Sprechstunde oft in zeitliche Not. Trotzdem kann und will ich diese Fragen nicht übergehen. Mein Praxisfoto bleibt mir als schöne Erinnerung an eine dieser Begegnungen. Der psychiatrische Patient auf der Notfallstation Von Dr. med. Ursula Huber Internistische Oberärztin, Notfallstation am KSW Fast täglich wird mir als Oberärztin von der medizinischen Notfallstation ein psychiatrischer Notfall angemeldet. Meist wird die Patientin oder der Patient als „psychischer Ausnahmezustand“ angekündigt. Es ist interessant, welche Diagnosen sich wirklich hinter diesem Sammelbegriff verstecken: Es kann sich um einen schwer psychotischen Menschen handeln, einen Menschen in einer Krise wegen eines belastenden Ereignisses, einen Drogenpatienten, einen intoxikierten Patienten oder gar um jemanden, der auf Grund einer medikamentösen Therapie oder somatischen Erkrankung psychische Symptome entwickelt hat. Die Ankündigung eines Patienten mit psychischem Befund löst unterschiedliche Gefühle aus. Dieser Patient braucht mehr Geduld; Laborresultate lösen selten das Problem. Er ist vielleicht sehr unruhig, will sogar weglaufen. Er benötigt eine intensivere Aufsicht als der somatische Patient; falls es ihm schlecht geht, reicht eine Monitorüberwachung nicht aus. Es ist schwierig, dem Patienten mit psychiatrischem Befund auf der Notfallstation, wo so viel Hektik herrscht, überhaupt gerecht zu werden. Man weiss nie, ob der Herzinfarktpatient nebenan nicht vor der Verlegung auf die Intensivstation noch Rhythmusstörungen hat, sich die Bronchitis plötzlich verschlechtert, und.. und… Der psychiatrische Patient tritt meist per Ambulanz ein. Er ruft selbst an, oder Nachbarn, Mitmenschen oder die Polizei avisieren Hilfe über die Nummer 144. Glücklicherweise sind die traumatischen Einlieferungen eher selten. Damit meine ich diejenigen Patienten, die gegen ihr Einverständnis festgehalten werden müssen. Solche Situationen lösen sowohl Angst beim Patienten als auch beim Personal aus. Andererseits ist es hier für mich augenscheinlich, wie das Procedere festzulegen ist: dieser Patient muss in die Akutpsychiatrie verlegt werden, einen Psychiater brauche ich nicht erst zu bemühen. Es ist schwierig, dem Patienten mit psychiatrischem Befund auf der Notfallstation gerecht zu werden. Schwieriger wird es bei der Frau, die ihren Ehemann vor einer Woche verloren hat und nun hyperventilierend auf den Notfall kommt. Muss ich jetzt den Psychiater holen? Einfach zuhören und Verständnis zeigen? Lösungen für die nächsten Tage finden? Soll ich einfach eine Packung Lexotanil verschreiben und ich habe meine Ruhe? Eigentlich ja eine schöne Aufgabe, einem Menschen im Trauerprozess beizustehen. So lerne ich einen Menschen auf eine sehr intensive Art und Weise kennen, habe Einsicht in seine Einstellung zum Leben und kann manchmal sogar etwas für mich persönlich mitnehmen. Wenn ich nur mehr Zeit hätte…. 5 Viele Patientinnen und Patienten befinden sich aus vielen Gründen in einer schwierigen Krise. Wenn an ein Nachhausegehen nicht zu denken ist, stellt sich die Frage, ob ein stationärer Aufenthalt das Richtige ist. Seit der Eröffnung des Kriseninterventionszentrums KIZ gibt es in Winterthur eine gute Alternative zur Klinik. Motivierte Patienten kann ich hier auch ohne psychiatrisches Konsilium einweisen. Häufig aber geht es vorher darum, die Suizidalität abzuklären oder eine ambulante Therapie einzuleiten. Vielleicht kann ein Patient nicht akzeptieren, dass seine Beschwerden einen psychischen Ursprung haben, und er reagiert mit Abwehr. In dieser Situation ist eine Fachperson sicher angesagt, und ich ziehe unseren psychiatrischen Konsiliarius bei. Das bunte Bild der psychiatrischen Patienten macht die Arbeit spannend. Es liegt mir daran, dass wir somatisch tätigen Ärzte und Fachpersonen unseren Menschenverstand einsetzen, uns Zeit nehmen und versuchen, dem psychisch kranken Menschen - selbst in Extremsituationen - gerecht zu werden. Wir brauchen Zeit für das Psychische im Spitalalltag Von Dr. med. Jan Martz Oberarzt Konsiliar- und Liaisonpsychiatrie und Essstörungen, Psychiatrische Poliklinik am KSW Als Konsiliarpsychiater bin ich im Spital ab und zu beim abendlichen Kurzrapport der medizinischen Klinik dabei. Da werden zuerst die Namen der Patientinnen und Patienten vom Chefarzt in den Saal gerufen, die im Verlauf des vergangenen Tages eingetreten sind. Die zuständige Assistenzärztin deklamiert in wenigen Worten, mit welcher Diagnose der Patient hospitalisiert wurde und wie lange der Spitalaufenthalt voraussichtlich dauern wird. Mich beeindruckt dabei die Stimmung von Effizienz und Zuversicht. Ich stelle mir vor, wie dies für den Patienten der Anfang einer kurzen und intensiven Zeit darstellt, in der ein ihn in seiner Existenz bedrohendes Problem mit grosser Fachkompetenz und ausgefeilter Technik abgeklärt und oft auch gelöst werden kann. Ich komme mir manchmal wie ein Fremdkörper vor, wenn ich mir mitten in der Betriebsamkeit des Spitals Zeit nehme, einen Menschen und seine Geschichte kennen zu lernen. Manchmal jedoch gerät dieser Prozess ins Stocken. Kürzlich wurde ich zu einer betagten Dame gerufen, die nach monatelangem häufigem Erbrechen ganz abgemagert ins Spital gekommen war. In der Magenspiegelung wurden mehrfache gutartige Geschwüre festgestellt, die mit säurehemmenden Medikamenten behandelt wurden. Der Patientin ging es auch bald wieder besser: das Erbrechen hörte auf und sie begann, wieder an Gewicht zuzunehmen. Als nach zehn Tagen anlässlich eines Gesprächs mit den Angehörigen der baldige Austritt aus dem Spital thematisiert wurde, musste die Patientin plötzlich wieder im Schwall erbrechen. Die Angehörigen beschrieben verschiedene Probleme und regten eine psychiatrische Untersuchung an. So lernte ich diese, mir sofort sympathische Frau kennen. Die Begegnung mit einem Psychiater im Spital war für sie unerwartet und irritierend. Zögernd berichtete sie mir von verschiedenen Belastungen in ihrer Situation und erzählte aus ihrer Lebensgeschichte. Sie betonte jedoch ihre Zuversicht, zu Hause wieder zurecht zu kommen und zeigte vorläufig kein Interesse, psychiatrisch-psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mit ihrer Erlaubnis rief ich ihre Tochter an und besprach mit ihr die Möglichkeiten von unterstützenden Massnahmen nach der Heimkehr der Patientin. Die anschliessende Besprechung mit dem Abteilungsarzt trug massgeblich zu dessen Fallverständnis bei. Wenn während eines Spitalaufenthalts Probleme auftauchen, die sich nicht klar eingrenzen lassen, kann es Aufgabe des Konsiliarpsychiaters sein, hier den Horizont zu erweitern. Geschichte und Beziehungen der Patientin sollen integriert und Lösungen gemeinsam mit ihren Bezugspersonen gesucht werden. Die Lösungen haben dann meist ebensoviel mit dem Leben ausserhalb des Spitals zu tun wie mit der Diagnose, welche zur Einweisung führte. Solche Arbeit braucht jedoch viel Zeit, und die Zeit im Spital ist knapp und teuer. So komme ich mir manchmal wie ein Fremdkörper vor, wenn ich mir mitten in der Betriebsamkeit der Abteilung Zeit nehme, einen Menschen in seinen Bezügen zu seiner Geschichte und seiner Mitwelt kennen zu lernen. Diese Zeit ist aber kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit, um komplexe Probleme besser verstehen und bewältigen zu können. Notizen Impulstagung der Pro Mente Sana Schweiz und Integrierte Psychiatrie Winterthur. Die Tagung findet am 18. November 2004 in Winterthur unter dem Titel „Psychiatrie ohne Betten? – Möglichkeiten und Grenzen der aufsuchenden Hilfe“ mit Referaten, Workshops und Podiumsdiskussion statt. Zielpublikum sind Fachleute, Angehörige und Betroffene. Anmeldung und Infos: Pro Mente Sana Zürich, Tel. 01 361 82 72, www.promentesana.ch 6 WerkPunkt VESO - Verein für Sozialpsychiatrie Region Winterthur. Die Werkstatt Konkordia und die Werkstatt Lichtblick haben sich zum neuen Arbeitszentrum WerkPunkt VESO zusammengeschlossen und sind in neue Räumlichkeiten gezogen: WerkPunkt VESO, Pflanzschulstrasse 17, 8400 Winterthur, Tel. 052 234 80 00, mail: [email protected] ESPAS neu in Winterthur. Unter einem Dach mit dem WerkPunkt VESO bietet ESPAS Berufsmassnahmen und geschützte Arbeitsplätze im Bürobereich an. ESPAS, Stiftung für wirtschaftliche und soziale Integration Erwerbsbeeinträchtigter, Pflanzschulstrasse 17, 8400 Winterthur, Tel. 052 234 77 77, www. espas.ch ipw Info Neuer Leiter Geriatrische Versorgungseinheit. Dr. med. Christian Kandler, Facharzt für Allgemeinmedizin und Geriatrie, wird Leiter der Geriatrischen Versorgungseinheit im Gerontopsychiatrischen Kompetenzzentrum (GPKS) in der Klinik Schlosstal. Per 9. August 2004 übernimmt er die Nachfolge von Dr. Roland Wellauer, der ab 1. April 2004 die Ärztliche Leitung des städtischen Alters- und Pflegeheims Adlergarten angetreten hat. Neben der somatischen Versorgung der ipw obliegt Christian Kandler die direkte Leitung der Assessmentstation. Dr. med. Winfried Uhde, vorher Oberarzt in der Klinik Schlössli, Oetwil am See, hat per 1. Mai 2004 die Funktion als Oberarzt und Betriebsleiter der Psychotherapiestation Villa von ipw übernommen. Sanierungsprogramm 04 und ipw. Die Sparmassnahmen des Kantons haben ipw schwer getroffen. 100 Menschen verlieren innerhalb der nächsten drei Jahre ihre Stelle. Dies, weil die Geriatrische Langzeitpflege nun endgültig in die Verantwortlichkeit der Gemeinden und Städte übergeht und auf vier der geplanten sechs geronto-psychiatrischen Spezial-Stationen in der Klinik Schlosstal verzichtet werden muss. Für die betroffenen Mitarbeitenden sind intern alle möglichen Hilfsmassnahmen getroffen worden. Der Sozialplan für die 2004 Betroffenen wird dem Regierungsrat noch vor den Sommerferien zum Entscheid zugestellt. Um die zum Teil notwendige Umplatzierung von Betagten der geriatrischen Langzeitpflege kümmert sich ein internes Bewohnermanagement. Gesamtangebot des Gerontopsychiatrischen Kompetenzzentrums (GPKS). Die Klinik Schlosstal wird weiterhin den gerontopsychiatrischen Akutbehandlungsbedarf sowie den Therapie- und Rehabilitationsbedarf abdecken. Neben den bestehenden Angeboten - Akutstation, Therapiestation, Gerontopsychiatrisches Ambulatorium und Tagesklinik (GAT), Assessmentstation und Geschlossene Station A (für Demenzerkrankte mit klinisch-psychiatrischen Zusatzproblemen) werden neu eine Slow Stream Rehabilitationsstation und eine zweite geschlossene Abteilung aufgebaut. In der Slow Stream Station erhalten ältere, psychisch kranke Menschen Gelegenheit, in einem für sie angemessenen langsameren Tempo ihre Ressourcen zu trainieren, um dann an einem passenden Ort leben zu können. Die Geschlossene Station B wird Platz bieten für ältere, psychisch Erkrankte, die für ihre Rehabilitation mehr Zeit und den Schutz des geschlossenen Rahmens benötigen. Der Betrieb der beiden neuen Stationen wird Anfang 2005 aufgenommen. Regionale Psychiatriekommission Winterthur Die Regionale Psychiatriekommission (RPK) dient als Plattform aller Dienstleistungserbringer und Betroffenen in der Psychiatrieregion Winterthur. Deren Vertreter unterstützen die Koordination der psychiatrischen Angebote und fördern den Informationsaustausch zu Themen und Fragestellungen der psychiatrischen Versorgung unserer Region. Die Ende 2002 von Grund auf neu formierte RPK Winterthur tagt in der Regel zwei Mal pro Jahr. Der Ausschuss nimmt die Vorbereitung und weiteren Geschäfte wahr. Vertreten sind Entscheidungsträger folgender Organisationen: ipw Integrierte Psychiatrie Winterthur (Dr. A. Andreae), Kantonsspital Winterthur (Prof. Dr. P. E. Ballmer), Vereinigung Winterthurer PsychiaterInnen (Dr. U. Dedial), PsychotherapeutInnen-Verein Region Winterthur (Frau lic. Phil. M. Fischer), Verein für Sozialpsychiatrie VESO (Kantonsrat H. Fahrni), Departement Soziales der Stadt Winterthur (E. Schedler, Sozialamt; A. Paintner, Alter und Pflege), Ärztegesellschaft Winterthur-Andelfingen (Dr. Ch. Bovet), Verein Angehöriger Schizophreniekranker/Psychisch Kranke (VASK; Frau V. Diserens). Im letzten Jahr wurden nebst dem Informationsaustausch insbesondere folgende Themen diskutiert: Priorisierung von Entwicklungszielen für die nächsten zwei Jahre (Versorgungsplanung), Strategien zur Koordination in der Altersversorgung, Aktivierung des Themas Migrationspsychiatrie. In Zukunft sollen die Frontakteure in der regionalen Psychiatrieversorgung über jährliche Impulstagungen zur Entwicklung bzw. Optimierung von Angeboten im Netzwerk gewonnen werden. Die erste Impulstagung zum Thema Migrationspsychiatrie wird von einer Arbeitsgruppe vorbereitet und im 4. Quartal 2004 durchgeführt. Ernst Schedler, Präsident RPK Winterthur IMPRESSUM: Ausgabe: 1/2004 Auflage: 3500 Exemplare Erscheint: 3 x jährlich Satz und Gestaltung: Kurt Seiler, Zürich Druck: Fotorotar Egg/ZH Herausgeberin: ipw Integrierte Psychiatrie Winterthur, Postfach 144, 8408 Winterthur. Telefon 052 224 35 31, [email protected] Redaktion: Dr. med. Andreas Andreae (Vorsitz), Helmut Bernt, Susanne Gimmi, med. pract. Christof Kempgen, Sibylle Schröder Anmerkung der Redaktion: Zu Gunsten der Leserfreundlichkeit wurde im vorliegenden Forum auf eine konsequente männliche und weibliche Schreibweise verzichtet.