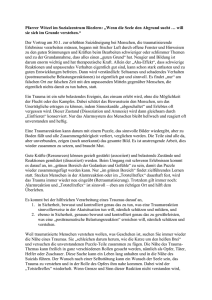Alles Trauma? - Therapeutische Praxis für Kinder, Jugendliche und
Werbung

„Alles Trauma?“ Zur Bewältigung traumatischer Erfahrungen im Kontext äußerer Bedingungen (überarbeitete Fassung eines Vortrags auf der Tagung der Bundesarbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer, „Innere Welt und äußere Gegenwart – Zur Situation von Kindern und Jugendlichen mit Flüchtlingsschicksal“, Frankfurt, 7.11.2010) Im Sommer 1996 sprach ich das erste Mal mit einem Klienten aus Bosnien. Er berichtete über seine Erlebnisse im Lager, über Flucht und Vertreibung und darüber, dass er heute noch davon träume, dass er sich insgesamt sehr verändert habe, ein anderer Mensch geworden sei, nicht mehr so fröhlich und vertrauensvoll, schlecht schlafe und sich auch tagsüber sehr angespannt fühle: ich war zum ersten Mal einem Klienten mit Symptomen begegnet, von denen ich später lernte, sie als posttraumatische Belastungsstörung zu bezeichnen. Damals habe ich nach dem Gespräch erst einmal in meine Lehrbücher geschaut, weil ich keine Ahnung hatte, wie diese Symptome einzuordnen seien. Im Psychiatrie-Lehrbuch von Bleuler fand ich damals innerhalb der 500 Seiten nur drei Sätze über die Begutachtung von Holocaust-Überlebenden. So viel zum Stand der Thematik „Trauma“ damals. Ich habe zwar damals in der hessischen Provinz gearbeitet (was ich heute noch tue), aber ich vermute, (und meine späteren Erfahrungen bestätigten das), dass außerhalb der Zentren für Flüchtlingsopfer kaum jemand damals etwas mit dem Begriff „Trauma“ anfangen konnte. Recht bald nach meinen ersten Begegnungen wurde „Trauma“ aber ein Megaseller in der Community, in den letzten 10 Jahren gab es keinen Kongress ohne das Thema, die Fachzeitschriften begannen, davon überzuquellen, heutzutage ist die Fülle an Literatur nahezu unüberschaubar, überall werden spezielle Fortbildungen angeboten, Trauma ist in aller Munde. Aber es ist auch ein Begriff, der immer noch zu einer Schockstarre oder Hyperaktionismus bei Sozialarbeitern, Beratern und auch Therapeuten führt, die schnell, oft zu schnell, meinen, für diese Probleme nicht hinreichend qualifiziert zu sein und dass die Klienten doch spezialisierten Therapien und Lösungsansätzen zuzuführen seien. Nach nun fast 15 Jahren Beratung, Therapie und auch Begutachtung von Flüchtlingen bin ich derzeit der Überzeugung, dass der Begriff „Trauma“ bzw. „traumatisiert“ gerade für den Umgang mit minderjährigen Flüchtlingen im allgemeinen wenig hilfreich ist und die Gefahr besteht, das Wesentliche von dem, was diese Kinder und Jugendlichen brauchen, nicht zu erkennen. Dazu zunächst einige klinische Fälle: 1. Rose ist eine 17 Jahre alte junge Frau, die aus Togo stammt. Seit einem Jahr ist sie in einer Jugendhilfeeinrichtung und wird in unserer Praxis ambulant betreut. Im Verlauf der Therapie vertraut sie sich ihrer Therapeutin an und berichtet, dass sie heimlich Alkohol trinkt. Die Therapeutin ermutigt sie, mit den Betreuern im Heim darüber zu reden und offen damit umzugehen. Als diese davon erfahren, wird sie umgehend in einer Suchtberatungsstelle vorgestellt. Dort berichtet sie über traumatische Erfahrungen. Sofort wird von dort aus eine stationäre Behandlung mit einer spezifischen traumatherapeutischen Zielsetzung in die Wege geleitet und vom Jugendamt aktiv betrieben. Erst als wir davon erfahren und darauf hinweisen, dass uns diese Erfahrungen durchaus bekannt sind, Rose in der ambulanten Therapie Vertrauen gefasst hat, sie jetzt regelmäßig zur Schule geht und eine Verselbständigung, Umzug in eine eigene Wohnung, anstrebt, was durch einen längeren stationären Aufenthalt gefährdet wäre, lenkt das Jugendamt ein. 2. Jane, 16 Jahre, aus Nigeria, berichtet uns in den ersten Stunden der Behandlung, dass sie nach dem frühen Tod der Eltern nicht mehr zur Schule habe gehen können und bei entfernten Verwandten als Hausmädchen untergekommen sei. Als der Hausvater ihr nachgestellt habe und sie vergewaltigte, habe sie sich zur Flucht nach Europa entschlossen. Ihrer Therapeutin, die als Kind ein paar Jahre in England gewohnt hat, fällt auf, dass Jane ein recht passables Schulenglisch spricht, was nicht recht passt zu ihren Angaben, keine Schule besucht zu haben. Als die Therapeutin weiter versucht, mit ihr die Biografie zu klären, kommt Jane nicht mehr zu den Stunden. Erst als mit ihr vereinbart wird, dass nicht die Vergangenheit im Mittelpunkt der Behandlung stehen soll, sondern ihre Probleme, die sie hier hat, ist sie bereit, die Therapie wieder aufzunehmen. 3. Ali, 15 Jahre, kommt aus Afghanistan. Schon kurz nach seiner Ankunft wird er wegen schwerer autoaggressiver Durchbrüche in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Auch unter hohen bis höchsten Dosierungen einer neuroleptisch-sedierenden Medikation lassen sein Drang, sich selbst zu verletzen (er bricht sich die Hand beim Schlag gegen die Wand), nicht nach, er wird über Wochen an sein Bett fixiert. Nach der Entlassung wird er mir vorgestellt. Er selber benennt als Problem, dass er sich so alleine und heimatlos fühle, er wisse nicht wohin. Das mache in ihm so eine Spannung, die er irgendwie loswerden müsse. Ali hat einen älteren Bruder, der mit ihm gekommen ist und schon in der Nähe von in Deutschland lebenden Verwandten lebt. In den Gesprächen wird deutlich, dass Ali gerne auch bei dieser Tante leben würde, am liebsten aber nicht direkt bei ihr, sondern in der Nähe in einer Wohnung, er möchte ihr nicht zur Last fallen, so fragt er mehrmals nach, ob die Tante auch Geld bekäme, wenn er bei ihr wohne. Die Tante beteuert auch mehrmals, er könne zu ihr, sie stellt aber keinen Antrag auf Sorgerechtsübertragung. Es wird deutlich, dass sie ihn eigentlich nicht zu sich nehmen will, dies aber deutschen Behörden nie zugeben würde. In einigen Gesprächen wird die Ambivalenz der Familie thematisiert, was Alis Spannung deutlich reduziert und es ermöglicht, die Medikation deutlich zu verringern. Ali ist dann einverstanden, in eine Jugendhilfeeinrichtung zu gehen, auch wenn diese etwas weiter weg von der Familie der Tante gelegen ist. 4. Nawid, 15 Jahre, ebenfalls aus Afghanistan, wird mir zur Traumatherapie vorgestellt. Er schlafe schlecht, zeige eine traurig-depressive Verstimmung, sei unkonzentriert in der Schule, wirke oft abwesend, ziehe sich in sein Zimmer zurück, meide Kontakte. Er spreche schlecht deutsch, während sein zwei Jahre älterer Bruder schon sehr gut in der Schule mitkomme, auch schon gut deutsch spreche, obwohl beide zusammen erst seit eineinhalb Jahren in Deutschland seien. Beide Brüder haben eine schwierige Fluchtgeschichte, sie geben an, nicht nur Krieg und Kriegshandlungen in Afghanistan erlebt zu haben, sondern auch existenziell gefährliche Situationen während ihrer Flucht. Bei der weiteren Anamneseerhebung stellt sich heraus, dass die beiden Brüder Stiefbrüder sind, der ältere schon in Afghanistan in die Schule gegangen ist, der Vater ein Beamter der Regierung war und es noch weitere ältere Brüder in Deutschland gibt. Nawid ist der Sohn einer verstorbenen Schwester der Mutter, aus einfacheren Verhältnissen, der in Afghanistan nur zwei Jahre zur Schule gegangen war. Die Betreuerin aus der Jugendhilfeeinrichtung berichtet auf meine Nachfrage, dass ihnen aufgefallen sei, dass Nawid auch vom älteren Bruder immer sehr herablassend behandelt würde, weil er ja nicht „richtig“ zur Familie gehören würde, er werde wie das letzte Rad am Wagen behandelt – und ich denke: ja, so fühlt er sich wohl auch in Deutschland. Ich denke, es wird schon klar, weshalb ich diese Einzelfälle näher beschrieben habe: neben den existenziell bedrohlichen Erfahrungen, die viele dieser Jugendlichen gemacht haben – und die gemeinhin als „traumatisierend“ gelten – geht es meist um schwierigste familiäre Verwicklungen, Loyalitätskonflikte, das Gefühl der Heimat-, Orientierungsund Familienlosigkeit. Bei genauerer Analyse stehen diese familiären Konflikte oft mehr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Jugendlichen als die von uns aus unserer europäisch-sicheren Perspektive so spektakulär anmutenden traumatischen Erfahrungen. In Supervisionen und Gesprächen mit anderen Therapeutinnen und Therapeuten wird mir ebenso immer wieder bestätigt, dass viele aus der Arbeit mit diesen Jugendlichen das Gefühl kennen, dass irgendetwas in ihrer Geschichte, die sie berichten, nicht stimmt, dass es Dinge gibt, die nicht berichtet werden und die das Bild erst rund machen würden. Das stimmt auch mit meiner Erfahrung als Gutachter überein: noch mehr als bei Erwachsenen treffe ich hier auf Fluchterzählungen, aus denen sich Ungereimtheiten ergeben, die auch bei Nachfragen meist nicht aufklärbar sind. Ich habe auch schon häufig erlebt, dass dies vor Behörden im Asylverfahren und vor Gerichten zu großen Problemen hinsichtlich der Asylanerkennung geführt hat. Ich denke, dass diese Unklarheiten in der Biografie und oft auch Fluchtgeschichte den familiären Verstrickungen und Konflikten geschuldet sind, über die die Jugendlichen oft erst nach sehr langer Zeit reden können, weil sie es als besonders illoyal gegenüber ihren Familien sehen, darüber mit Außenstehenden zu reden. Gleichzeitig sind sie auf der verzweifelten Suche nach Geborgenheit, Sicherheit und Akzeptanz. Aber das Thema Trauma und Familie ist eigentlich noch komplexer, denn gerade Kinder und Jugendliche sind für die Bewältigung traumatischer Erfahrungen auf Eltern bzw. erwachsene Bezugspersonen angewiesen, die ihnen den Schrecken der tödlichen Bedrohung nehmen und wieder Sicherheit vermitteln können. Ich erinnere mich noch an Dejan, einen 9jährigen Jungen aus Bosnien, der jeden Abend fast psychotisch anmutende hyperaktiv-impulsive Zustände entwickelte. Er hatte zusammen mit seiner Mutter die Belagerung von Sarajevo miterlebt, Nächte im Schutzbunker, ein Teil seiner Klasse war beim Angriff auf den Marktplatz von Sarajevo ums Leben gekommen, buchstäblich in die Luft geflogen. Nach langwierigen und schwierigen Familiengesprächen erfuhr ich, dass Dejan sowohl diesen Angriff als auch die Nächte im Bunker im ersten Jahr ohne besondere Auffälligkeiten bewältigt hatte. Eines Nachts aber hatte die Mutter die Situation nicht mehr ausgehalten: sie hatte das Gefühl, das Haus über ihrem Bunker sei getroffen und sie käme nicht mehr aus dem Bunker heraus. In ihrer Not ließ sie das Kind zu Boden fallen und rannte zur Tür, um diese verzweifelt zu öffnen, schrie herum und konnte nur mühsam von anderen Erwachsenen wieder zur Ruhe gebracht werden. Seit diesem Tag geriet Dejan nun in diese abendlichen Zustände und zeigte auch tagsüber Symptome äußerster Beunruhigung, die wir durchaus als flash-back-Symptomatik einordnen konnten. Natürlich war es nur möglich, diese Zusammenhänge zu erkennen, nachdem das tiefsitzende Schuldgefühl der Mutter im vertrauensvollen Gespräch thematisiert werden konnte. Ich ziehe aus dieser Erfahrung und vielen ähnlichen in anderen Therapien den Schluss, dass die Bewältigung traumatischer Erfahrungen, ja überhaupt das Entstehen von psychischen Traumafolgesymptomen bei Kindern und Jugendlichen sehr stark davon abhängt, ob die Eltern, die Familie, das soziale Umfeld trotz widriger Umstände Sicherheit und Geborgenheit vermitteln können oder nicht, d.h. noch mehr als bei Erwachsenen sind die Symptome, die sich als posttraumatische Belastungssymptome zeigen, sozial vermittelt und lassen sich nicht als unmittelbare neurobiologische Folgereaktion verstehen. Ich möchte diese Zusammenhänge noch an einem weiteren Beispiel erläutern: in einem Flüchtlingslager in Norduganda lerne ich Peter und David kennen. Bede sind 18 Jahre alt und waren fünf bis sechs Jahre vorher von der LRA, eine der grausamsten Rebellenorganisationen Afrikas, entführt worden. Beide schilderten mannigfache und mehrfache traumatisierende Situationen, die mühelos die A-Kriterien einer posttraumatischen Belastungsstörung nach ICD 10 erfüllen würden, eine Liste von Grausamkeiten, die hier kaum wiederzugeben sind: so waren sie nicht nur Zeugen von grauenhaften Massakern, sonder waren auch gezwungen worden, andere Kinder, die mit ihnen entführt worden waren, zu erschlagen, um selber zu überleben. David berichtete, dass er nach seiner Rückkehr zu seiner Familie wieder freundlich aufgenommen worden sei, dass er spüre, dass seine Eltern ihn lieben würden und er das Leben führen könne wie vor seiner Entführung. Er habe nur ca. zweimal im Monat Albträume, in denen er von der Entführung träume, er spiele Fußball mit anderen Jugendlichen, habe auch Kontakt mit Mädchen. Peter hingegen ging es schlecht: er machte einen depressiven Eindruck, er fühlte sich minderwertig, ständig müsse er daran denken, dass er ja ein Mädchen erschlagen habe, er habe deshalb auch wenig Kontakt zu Gleichaltrigen, erst recht nicht zu Mädchen, er schlafe schlecht und er würde sich auch aus Angst nicht trauen, mit den anderen Jugendlichen in den Busch zu gehen, um Honig zu sammeln oder Fische zu fangen (was die üblichen Freizeitbeschäftigungen der Jugendlichen waren). Er zeigte also alle Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung inclusive starkem Vermeidungsverhalten und einer depressiven Entwicklung. Er berichtete bezüglich seiner Familie, dass sie ihn zwar lieben würde, ja, sie würden zu ihm halten und hätten ihn wieder aufgenommen, aber er würde spüren, dass sie ihm nicht wieder trauen würden. Sie wüssten ja, was er im Busch, bei den Rebellen gemacht habe. Nein, man würde nicht darüber reden, aber sie würden ihm nicht vertrauen, es sei nicht mehr so wie vorher. Am deutlichsten werde das daran, dass die Eltern ihm nicht mehr erlauben würden, auf die jüngeren Geschwister aufzupassen, sie hätten einfach kein Vertrauen mehr in ihn, was ihn sehr bedrücken würde. Auch hier gewann ich den Eindruck, dass das Ausmaß der PTBS-Symptomatik davon abhing, wie gut es den Familien gelang, die Kinder und Jugendlichen wieder aufzunehmen bzw. ihnen zu ermöglichen, wieder vertrauensvolle Beziehungen aufzunehmen und damit an das frühere Leben und Bindungserfahrungen anzuknüpfen. Zu ergänzen ist an dieser Stelle, dass die Familie bzw. der familiäre Zusammenhalt in der ugandischen Kultur einen sehr hohen Stellenwert hat, dass die individuelle Autonomie weniger geschätzt wird und der Ausschluss aus der Familie, aus deren emotionalem Zusammenhalt, als Gefahr für das psychische Überleben erlebt wird. (s.a. Grothe, 2008) Auch in Supervisionen mit Sozialarbeiterinnnen und Sozialarbeitern, die die ehemaligen Kindersoldaten betreuten, wurde deutlich, dass nur diejenigen posttraumatische Symptome über einen längeren Zeitraum entwickelten, deren Familie oder deren Dorf mit Misstrauen und Zurückhaltung auf diese Kinder reagierten bzw. die bei Verwandten untergebracht waren, weil die Eltern nicht mehr lebten und bei denen sie sich nicht wohl fühlten und gegenüber anderen Kindern zurückgesetzt. Ich ziehe aus diesen klinischen Erfahrungen den Schluss, dass die Entwicklung und die Aufrechterhaltung posttraumatischer Symptomatik, auch einer typischen PTBSSymptomatik, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen sehr stark von den familiären und sozialen Bedingungen bestimmt wird und das Erleben auch schwerster traumatisierender Erlebnisse gegenüber diesen Faktoren zurücktritt. D.h. die posttraumatische Symptomatik ist weitaus mehr als sozial vermittelt zu sehen denn als neurobiologischer Reflex, was in gewissem Gegensatz zu manchen Facetten derzeitiger Traumadiskussion steht. Letztlich ist das ja nichts besonders Neues, wenn man auf die schon etwas älteren Ergebnisse und Konzeptualisierungen von Hans Keilson (Keilson, 1979) zurückblickt – aber die werden in vielen Publikationen schon gar nicht mehr erwähnt, so sie überhaupt zur Kenntnis genommen werden. Ein befreundeter ugandischer Psychologe hat übrigens auch versucht, diese klinischen Hinweis empirisch zu validieren und ein Ergebnis seiner Forschungen ist, dass die Rate an Suizidgedanken und -handlungen bei ehemaligen Kindersoldaten nicht mit dem Ausmaß des Erlebens grausamer und lebensbedrohlicher Situationen korrelierte, sondern mit dem Ausmaß an derzeitiger Gewalt in der Familie! (Olema, David: persönliche Mitteilung im Rahmen seiner Dissertation „Transmission of trauma in wartorn families“, Universität Mbarara/Uganda und Bielefeld/Deutschland) Nun lasse ich meine Phantasie spielen und stelle mir vor, was passieren würde, wenn sich z.B. Peter auf den Weg nach Europa machen würde, weil er es zuhause nicht mehr aushält. Über was würde er in Deutschland uns bzw. den Behörden berichten? Wenn er auch noch einen guten Schleuser hat, der ihn vorbereitet und wenn er sich mit anderen Flüchtlingen unterhält, dann wird er sicher nicht zuerst über die Schwierigkeiten in seiner Familie reden, sondern über seine Erlebnisse als Kindersoldat. Dazu käme ja auch noch, dass er höchstwahrscheinlich seine eigenen psychischen Schwierigkeiten nicht auf die familiären Probleme zurückführen würde, sondern auf seine Erlebnisse. (Dass seelische Probleme etwas mit familiären Konflikten zu tun haben, ist ja auch in unserer Kultur auf individueller und gesellschaftlicher Ebene eine Erkenntnis mit großem Widerstandspotential!) Und wenn wir als Europäer diesen Schilderungen atemlos folgen, weil sie unseren Erfahrungen so gänzlich fremd sind und so exotisch, dann wird er spüren, dass er hier Anteilnahme erfährt und dies weiter in den Mittelpunkt rücken. Damit ich richtig verstanden werde: natürlich meine ich nicht, dass wir diese schrecklichen Erfahrungen und Erlebnisse relativieren sollten. Erst wenn wir diese ernst nehmen, werden wir auch das annehmen und erfahren können, was uns der bzw. die Betreffende noch weiter mitteilen kann und will, worunter er bzw. sie weiterhin leidet. Aber wir sollten es nicht dabei belassen, sondern diesen Menschen, der vor uns sitzt, immer als einen „ganzen“ Menschen wahrnehmen, ihm zuhören und ihn in seiner Geschichte und seiner Sozialität verstehen – und nicht mit symptom- und störungsspezifischen Methoden traktieren. Der Neurobiologe Gerhard Hüther drückt dies als Hirnforscher folgendermaßen aus (Korittko, Pleyer, 2010): „Unser Gehirn ist ein Sozialorgan – und es wird Zeit, dass wir es auch so behandeln. Das menschliche Gehirn strukturiert sich anhand der im Leben gemachten Erfahrungen. Primär sind das immer Erfahrungen, die wir in der Beziehung zu anderen Menschen machen....Systemtherapeutische Lösungswege, die die ganze Familie in den Blick nehmen, sind nach allem, was Hirnforscher in den letzten Jahren herausgefunden haben, die geeignetsten Verfahren, verstrickte und verstörte Beziehungsmuster innerhalb der Familie aufzulösen und zu korrigieren. ….nur so können neue, andere neuronale Netzwerkstrukturen in ihrem Gehirn miteinander verbunden, gebahnt und nachhaltig stabilisiert werden. Dies gilt nicht zuletzt auch für Menschen, die mit traumatischem Stress umzugehen haben.“ Das bedeutet, dass es gerade für junge Menschen darum geht, die Gesamtheit ihrer Lebensbezüge im Blick zu haben und zunächst einen Rahmen für die Grundbedürfnisse zu stellen, damit sie sich entwickeln können: da es nach traumatischem Erleben, nach Erlebnissen von Flucht, Vertreibung, existenzieller Gefährdung um das Erleben von Unsicherheit, von Heimatlosigkeit und Hoffnungslosigkeit geht, bedürfen die Jugendlichen, von denen ich heute spreche, neben der Erfüllung physischer Bedürfnisse zunächst der Erfüllung elementarer psychischer Grundbedürfnisse: das Erleben einer Sicherheit, Geborgenheit und Schutz gewährenden sozialen Umgebung, Zugang zu Bildung und altersentsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten. D.h. die Herstellung rechtlicher Klarheit, ein gesicherter Aufenthalt, Zugang zu Bildungseinrichtungen, sowie eine Betreuung, die emotionale Geborgenheit und altersentsprechende Entwicklungsmöglichkeiten, d.h. v.a. auch soziale Kontakte zu Gleichaltrigen, ermöglicht, das ist die beste Traumatherapie. Im Kern bedeutet das, ihnen die Menschenrechte wieder zu geben, derer sie beraubt wurden. Nur auf dieser Grundlage können weitere, spezifische therapeutische Ansätze wirksam werden und ergänzend hilfreich sein - so sie denn noch gebraucht werden. Literatur: Grothe, K.-D.: Trauma, Kultur und Familie, Psychoanalytische Familientherapie, Nr. 16, Giessen, 2008 Keilson, H: Sequentielle Traumatisierung von Kindern, Stuttgart, 1979 Korittko, A./Pleyer, K.H.: Traumatischer Stress in der Familie, Stuttgart, 2010 Olema, David: Transmission of trauma in war-torn families, Dissertation, Mbarara/Bielefeld, in Vorbereitung Klaus-Dieter Grothe, Giessen/Hüttenberg, 28.11.2010