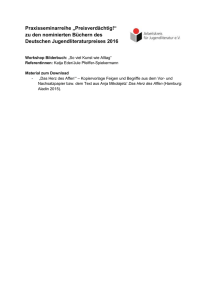Inhalt - vacat verlag
Werbung

Inhalt Einleitung l Seite 7 Biblische Geschichten l Seite 9 Der Gründungsmythos von Rom l Seite 17 Ein botanisches Wunderwerk l Seite 21 Die Feige in der Geschichte der Gärten l Seite 25 Feigenkultur in Berlin und Potsdam l Seite 33 Vom vielfältigen Nutzen der Feigen l Seite 53 Küchengeschichten l Seite 55 Das Wissen der Gärtner l Seite 71 Feigen erobern das Havelland l Seite 75 Die Plantage von Baumgartenbrück l Seite 81 Vom schamhaften Gebrauch des Feigenblattes l Seite 85 Ficus carica oder ‘Runde weiße Feige’, Feigen auf Reisen l Seite 97 Traité des Arbres Fruitiers , Duhamel/Poiteau/Turpin, Vol. 6,1855 Anhang l Seite 100 Einleitung Die Geschichte des Feigenbaumes beginnt im südlichen Vorder­ asien. Seit Jahrtausenden galten Weinstock, Olivenbaum und Feige hier als Garanten eines glücklichen Lebens. Götter und Kö­ nige haben den Feigenbaum verehrt, in Kult und Sage spielt er eine prominente Rolle. Seine großen Blätter schützten einst Adam und Eva, und in Erinnerung an das Paradies versprach die Fülle seiner süßen Früchte den Menschen gute und ausreichende Nahrung und somit Wohlstand und Frieden. l Auf den Terrassen unterhalb des Weinbergschlosses von Sanssouci wechseln sich heute Feigenbäume und Weinstöcke ab. Für die Tafel Friedrichs II., für seine Tischgesellschaften und sein persönliches Vergnügen wuchsen in den verglasten Nischen einst köstliche Tafeltrauben, während die Feigen entlang der un­ tersten Mauer gezogen wurden. Weinstöcke wie Feigenbäume hatte Friedrich bereits 1745 bei Hamburger Baumschulen bestellt, und schon wenige Jahre später wurde der Geschmack und die Güte der geernteten Feigen lobend erwähnt. »In den untersten Lagen dieser terrassenförmig eingerichteten, ebenfalls mit Glas bedeckten Mauern gedeihen die verschiedenen Feigensorten zu einer solchen Vollkommenheit, und erlangen eine Zartheit, Süsse und Saftfülle, die sich nach sachkundigem Urtheil den in Italien und Sicilien gezogenen Früchten ebenbürtig zur Seite stellen.«2 l Es war die Kunstfertigkeit der Gärtner, der es gelang, der Natur auch im Norden Europas südliche Freuden abzuringen und mit den mühsam kultivierten Früchten die fürstlichen Tafeln zu bereichern. Die Terrassen von Schloss Sanssouci, mit Feigen und Wein 6 7 »Siehst Du die alten Bäume, die Hecken, die Blumen? Das alles hat seine Geschichten, seine lieblichen heimlichen Geschichten«1 Büchner , Leonce und Lena 1836 Ein botanisches Wunderwerk G. Gallesio, Pomona Italiana , 1839 Das von Rainer Maria Rilke hier angedeutete Geheimnis des Fei­ genbaumes ist auch unter den vielen außergewöhnlichen Le­ bensgemeinschaften von Blüten und Insekten absolut einmalig. Selten haben im Reich der Natur Pflanze und Tier sich in derart zwanghafte Abhängigkeit voneinander begeben wie Feigen­ baum und Feigenwespe. Dabei hat sich ein genetischer Polymor­ phismus herausgebildet, der, kaum zu glauben, kausal bedingt durch die Kultur des Menschen befördert wurde. Er führte zu zwei Formen des Feigenbaumes, die in ihrer Entwicklung und Lebensfähigkeit sowohl aufeinander wie auch auf die ausschließ­ lich auf sie konzentrierte Gallwespe (Blastophaga psenes) ange­ wiesen sind. Die Hausfeige (Ficus carica var. domestica) besitzt in ihren Blütenständen nur weibliche Blüten, während die Holzoder Bocksfeige, (Ficus carica var. caprificus) neben den weib­ lichen auch männliche Blüten ausbildet. l Bei beiden Feigenbaumvarietäten bilden sich in der Regel dreimal im Jahr Blütenstände in den Blattachsen der Bäume. Die rundliche Gestalt dieser oft als Frucht missverstandenen Blüten­ verbände entsteht dadurch, dass die Blütenstandsachse wie eine bauchige Flasche empor wächst und die unscheinbaren kleinen Blüten von außen unsichtbar auf der Innenseite stehen. An der Spitze des Blütenstandes bleibt eine kleine Öffnung frei. Die Pol­ len der männlichen Blüten der Bocksfeige sollen nun auf die weib­ lichen Blüten der Hausfeige gebracht werden. Diesen Bestäu­ bungsvorgang übernehmen die befruchteten weiblichen Wespen, deren Larven sich in der Bocksfeige entwickelt haben und deren erste Generation im März oder April ausschlüpft. Während die 20 21 Ficus carica var. caprificus , Holz –oder Bocksfeige, Weibliche und männliche Blastophaga psenes oder Gallwespen, Feigenbaum, seit wie lange schon ist’s mir bedeutend, wie du die Blüte beinahe ganz überschlägst und hinein in die zeitig entschlossene Frucht, ungerühmt, drängst dein reines Geheimnis. Rainer Maria Rilke Vom vielfältigen Nutzen des Feigenbaumes und seiner Früchte 1797 erschien in Leipzig ein kleines A, B, C- und Lesebuch für Kinder. Jedem Buchstaben ist eine Seite mit Abbildungen ge­ widmet, zu denen es ausführliche naturwissenschaftliche Erklä­ rungen gibt. Unter ›F‹ wie Feige wird erklärt was sich aus dem Milchsaft des Feigenbaumes herstellen lässt. »Der Baum und seine unreifen Früchte enthalten eine Milch. Dieser Saft ist seifenartig scharf und hat einen etwas anfressenden Geschmack. Wenn man denselben statt der Tinte braucht und damit auf Papier schreibt, so sind die Buchstaben unsichtbar; hält man aber das Papier ans Feuer, so werden sie schwarz und sichtbar.« Aber nicht nur auf die Ge­ heimtinte wird aufmerksam gemacht. Der Saft des Feigenbaumes wird auch als Schönheitsmittel empfohlen. »Wird das Gesicht mit diesem Saft überstrichen und hernach sogleich wieder abgewaschen, so reinigt er die Haut von allen Unsauberkeiten und kann also statt eines scharfen Schönheitsmittels gebraucht werden.« l Eine Quelle für diese Beschreibungen mag die Ökonomi­ sche Enzyklopädie von Georg Krünitz von 1784 gewesen sein. Die eigentliche Quelle aber sind die Schriften des römischen Na­ turwissenschaftlers Gaius Plinius des Älteren, der dieses Wissen um den Milchsaft der Feige im ersten Jahrhundert n. Chr. notiert hat. Er verrät auch, dass die Römer diesen Milchsaft wie Lab für die Käseherstellung verwendet haben. Die Seite F aus A, B, C – und Lesebuch für Kinder von 1797 , mit einer Anleitung für Geheimtinte aus dem Milchsaft der Feige 52 53 Herrlich wie die Frühfeige vor dem Sommer, die einer erspäht und flugs aus der Hand verschlingt. Jesaja, 28.4 Ficus, Feige, Figue, Neues Buchstabier-Buch, 1778 Küchengeschichten Ficus carica ‘Feige von Portugal’, Giorgio Gallesio, Pomona Italiana, Vol. 2, 1839 54 l »Soll ich denn meine Süßigkeit und meine gute Frucht lassen, um Euch zu regieren«, fragt der Feigenbaum die anderen Bäume, die ihn zu ihrem König ausrufen wollen. Diese biblische Parabel macht deutlich, wie sehr die Menschen den hohen Zuckergehalt der Feigen liebten. Feigen haben neben Eisen, Kalium, Calcium und Vitaminen einen sehr hohen Fruchtzuckergehalt. l Die frischen Feigen wurden in Frankreich als Vorspeise, die getrockneten als Nachtisch gereicht. Frische Früchte fördern die Verdauung und wirken blutreinigend. In seinem Buch über das Landleben bezeichnet Herr von Hohberg 1687 die Feigen als das beste und edelste Obst. Als Referenz nennt er den großen grie­ chischen Philosophen Plato, der sich selbst als »Feigenfreund« be­ zeichnet hat. Auch der in der Antike berühmte Arzt Galen wird Die üblen erwähnt, der sich rühmte, sein hohes Alter dem Verzehr von Wirkungen Trauben und Feigen zu verdanken. frischer Feigen, l Dieser Begeisterung für frische Feigen widerspricht Dioscu­ H. Bock, rides, ein Militärarzt des ersten nachchristlichen Jahrhunderts. Er De Stirpium meint reife Feigen seien für den Magen schädlich. Als Autor der Historia, 1552 berühmtesten überlieferten Pharmakologie der Antike, wurde seine Meinung von den Verfassern der Kräuterbücher im 16. und 17. Jahrhundert übernommen. Die drastische Abbildung von der Wirkung frischer Feigen, die sich im Kräuterbuch des Hierony­ mus Bock schon 1552 findet, ist vielleicht dem Umstand geschul­ det, dass man in jenen Jahren im nördlichen Europa nicht viel Erfahrung mit frischen reifen Feigen hatte. Es hat der Liebe zu den Feigen nicht geschadet. Die Früchte bleiben verbunden mit der Vorstellung vom glücklichen Leben unter südlicher Sonne. 55 Feigen erobern das Havelland Lange braune Feige, Allgemeines Teutsches Gartenmagazin, 1807 Die Bemühungen des Gartenbauvereins haben im wahrsten Sinne des Wortes reiche Früchte getragen. Aus dem 1742 von hugenot­ tischen Einwanderern erworbenen Gut in der nördlich von Pots­ dam gelegenen Gemeinde Priort berichtet 1828 der Freiherr Carl August Friedrich von Monteton dem Verein über seine bemer­ kenswerte Erfolge mit dem Feigen-Freilandanbau. In seinem Gar­ ten wuchsen 20 Feigenbäume, die bereits 30 Jahre alt waren. Sie standen in warmer Lage, seitlich leicht geschützt durch höhere Bäume im lehmigen Sandboden am Hang, wie Monteton schreibt. Im Spätherbst, nachdem das Laub abgefallen war, wurden die Zweige der Feigenbäume vorsichtig zu einer möglichst verengten Krone zusammengebunden. Die Erde wurde dann hangabwärts dicht am Stamm und je nach der Länge des Baumes, zu einer fla­ chen Grube ausgehöhlt und der Baum hinein gebogen, und dann mit lockerer Erde gut zugeschüttet. Sobald es anfing stärker zu frie­ ren, wurden diese Grabhügel noch reichlich mit Bohnenranken und Laub bedeckt. So haben die Feigenbäume die strengsten Win­ ter ohne Frostschäden überstanden. Sie erreichten Stammdurch­ messer von bis zu 16 cm und stattliche Höhen zwischen 2,50 und 3,00 m. Wegen des alljährlichen Umlegens im Herbst, immer nach derselben Seite, standen die Stämme schräg und mussten gestützt werden, wenn sie im Frühling wieder aufgerichtet wurden. Sie lit­ ten zwar nicht unter den Spätfrösten, verloren aber durch die Pro­ zedur die kleinen Winterfeigen. Dennoch belief sich der jährliche Ertrag bei leichtem Gießen und Düngen auf 3 000 bis 4 000 Früchte, und das trotz der von Monteton ausdrücklich erwähnten nachläs­ sigen Pflege.52 74 75 Vom schamhaften Gebrauch des Feigenblattes Ende des 19. Jahrhunderts versuchten einige Abgeordnete im Berliner Reichstag, ein Gesetz durchzubringen, das ihre Mitbür­ ger vor Darstellungen im öffentlichen Raum schützen sollte, die »das Schamgefühl gröblich verletzen« könnten. Dieses Gesetz hätte Schutzbrille in letzter Konsequenz einen massiven Angriff auf die Freiheit für Reichstags­ der Kunst bedeutet, und Satire-Zeitschriften wie der Simplicissi­ abgeordnete mit mus wehrten sich auf ihre Art. So findet sich in einer Ausgabe leicht erregbarer von 1899 der Entwurf einer Brille für Reichstagsabgeordnete Sinnlichkeit, mit »leicht erregbarer Sinnlichkeit.« Schützen sollte die Augen Simplicissimus, dieser Reichstagsabgeordneten das sprichwörtlich gewordene 1899 Feigenblatt, von dem seit Jahrhunderten immer dann die Rede ist, wenn Tatsachen scheinheilig verschleiert werden sollen. l Jeder kennt die Geschichte von den biblischen Stammeltern, von Adam und Eva, die sich als erste Kleidung Feigenblätter wählten, nachdem sie die verhängnisvolle Frucht vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten. In der Schöpfungsgeschichte wer­ den die Folgen dieser Obstmahlzeit so beschrieben: »Da wurden ihrer beider Augen aufgetan, und wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen daraus«.60 Diese Art der Bekleidung war für Jahrhunderte in der Kunst nur Adam und Eva vorbehalten. l Die Idee, sich mit einem Feigenblatt zu bedecken, mag mit der Form des Feigenblattes zu erklären sein, das wie eine Hand aussieht, mit der man im ersten Schreck ja auch Dinge bedeckt, die man nicht zeigen möchte. Dabei wurde die formale Umset­ zung des vorgegebenen Feigenblattes ebenso unbekümmert va­ riiert wie die Darstellung des in seiner botanischen Identität un­ Adam und Eva mit ›Schurzen ‹ aus Feigenblättern. Johann Jakob Scheuchzer, Physica sacra , 1731 84 85 Feigenblätter aus Sanssouci bekannten Baumes der Erkenntnis; von Apfel bis Zitrone sind hier viele Früchte und von Ahorn bis Weinblatt viele verschie­ dene Blattformen zu entdecken. l Botanisch erfahrene Menschen wissen, dass die Variations­ breite beim Feigenblatt ohnehin sehr groß ist. Aber auch mit dieser in der Botanik als Polymorphie bezeichneten Formenviel­ falt lassen sich viele der Blätter nicht erklären, die zunächst Adam und Eva, später aber auch viele nackte heidnische Statuen bekleideten. Diese Feigenblätter, so sagt Christian Morgenstern 1894, sind der Triumph, den die moderne christliche Sittlichkeit über die heidnische Antike errungen hat. l Zunächst scheinen sich die frühen Christen mit ihren zur An­ tike in Gegensatz stehenden Moralvorstellungen nicht um die Nacktheit der heidnischen Skulpturen gekümmert zu haben, die in Italien oder Griechenland Marktplätze und Tempel schmück­ ten. Erst ab dem 4. Jahrhundert galt das Christentum als die ein­ zig wahre Religion. Damit begann die Vernichtung der heid­ nischen Kulte. Man schlug bei den männlichen Statuen allenfalls die Geschlechter ab. Aber noch kam niemand auf die Idee, nackte Figuren mit Feigenblättern zu versehen. Erst die Fülle der im 15. Jahrhundert wiederentdeckten antiken Statuen in ihrer hero­ ischen Nacktheit beunruhigte die Päpste und ihr Gefolge. Als auch biblische Helden wie David von den Künstlern der Renais­ sance nackt dargestellt wurden, kam es zu energischen Maßnah­ men von Seiten der Kirche. Zu den Beschlüssen des Reformkon­ zils von Trient im Jahre 1563 zählte der Befehl, bei religiösen Bildern alle Sinnlichkeit zu vermeiden. Aber der Triumphzug des Feigenblattes ließ noch auf sich warten. Er begann erst Mitte des 18. Jahrhunderts in Rom. l Wer alte Aufnahmen aus den Antikensammlungen nicht nur Italiens betrachtet, kann noch heute erahnen, wie durchgreifend die Schambereiche von Skulpturen, die die Zeiten nackt über­ dauert hatten, einstmals unter einem wahren Wald von Feigen­ blättern aus Metall, Stein, Gips, Papier verschwanden. »Diese Woche wird man dem Apollo, dem Laocoon und den übrigen Statuen im Belvedere ein Blech vor dem Schwanz hängen vermittelst eines Drats um die Hüften […]«, kommentierte der Antiquar Johann Joachim Winckelmann 1759 säuerlich die einschlägige Anordnung für den Vatikan.61 Stand dieses Vorgehen hier noch in der Folge der katholischen Reform des 16. Jahrhunderts, so eroberten die Fei­ genblätter im 19. und frühen 20. mit dem Siegeszug einer neuen bürgerlichen Sexualmoral die Kunstsammlungen der gesamten westlichen und westlich dominierten Welt. Dass Verbergen und Betonen aber die Kehrseiten derselben Medaille sind, wusste nicht nur Freud, sondern 1878 auch der amerikanische Reisende Mark Twain: »Es treibt einem den Sarkasmus aus allen Poren, wenn man in Rom und Florenz umhergeht und sieht, was die letzte Generation mit den Statuen angestellt hat. Diese Werke, die jahrhundertelang in unschuldiger Nacktheit dagestanden hatten, sind jetzt alle befeigenblättert. Jawohl, jedes einzelne. Niemand hat vielleicht vorher ihre Nacktheit bemerkt; niemand kann jetzt umhin, sie zu bemerken, das Feigenblatt läßt sie so ins Auge fallen.«62 Mit gutbürger­ lichem Erwerbssinn ließ sich diese Doppelsinnigkeit zu Geld machen. Als die Lachsfischer den sog. ›Lüttinger Knaben‹, den sie im Rhein gefunden hatten, 1858 in einem improvisierten ›Muse­ um‹ züchtig mit Lendenschurz versehen präsentierten, durften Schaulustige die antike Bronze für 10 Pfennige besichtigen. Das Lüpfen des Schurzes war mit 20 Pfennig zu berappen.63 86 87 Alle Gestalten sind ähnlich, und keine gleichet der anderen Goethe , Metamorphose der Pflanzen