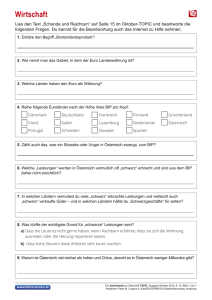China – Länderanalyse Februar 2008 - Der Host
Werbung

China – Länderanalyse Februar 2008 Hauptstadt: Peking Staatsform: Kommunistischer Staat Einwohner: 1.314,5 Mio. (2006) Amtssprachen: Chinesisch (Mandarin) Bruttoinlandsprodukt in EUR (2007f): 2380 Mrd. Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in EUR (2007f): 1800 Währung: Yuan (CNY) bzw. Renminbi (RMB) Mitgliedschaften: BIS, IAEA, IBRD, IWF, SOZ, UN, UN-Sicherheitsrat, WTO, ASEAN (Dialogpartner) Autor: Mario Wattaul +43-1-53135-403 Internet: www.investkredit.at e-mail: [email protected] Research Seite 1 13.02.2008 Inhaltsverzeichnis 1. 2. 3. Kommentar ................................................................................................. 3 Stärken-/ Schwächenprofil .......................................................................... 5 Volkswirtschaftliche Kennzahlen................................................................. 6 3.1 Aktuelle Konjunktur & Ausblick............................................................. 6 Aktuell ......................................................................................................... 6 Ausblick....................................................................................................... 7 3.2 Marktpotential....................................................................................... 8 3.3 Wettbewerbsfähigkeit ......................................................................... 13 3.4 Außenwirtschaft.................................................................................. 18 Historische Trends und Ausblick Exportsektor ......................................... 21 3.5 Staatsverschuldung............................................................................ 26 3.6 Private Verschuldung ......................................................................... 27 3.7 Stabilität.............................................................................................. 28 3.8 Geldpolitik und Finanzmarkt............................................................... 31 Geldpolitik ................................................................................................. 31 Geld- und Anleihenmarkt .......................................................................... 33 Aktienmarkt ............................................................................................... 34 4. Bankensystem .......................................................................................... 36 4.1 Struktur............................................................................................... 36 4.2 Aktuelle Entwicklungen ...................................................................... 38 5. Energiesektor............................................................................................ 41 6. Rahmenbedingungen/Weiche Faktoren ................................................... 44 6.1 Rechtssicherheit................................................................................. 44 6.2 Investitionsklima/ Unternehmensumfeld ............................................ 44 6.3 Arbeitsmarkt & Humankapital............................................................. 47 6.4 Steuern............................................................................................... 47 6.5 Korruption........................................................................................... 47 6.6 Politik.................................................................................................. 48 6.7 Terrorismus und Sicherheit ................................................................ 51 6.8 Infrastruktur ........................................................................................ 51 7. Bonität: Ratings und Risikoeinschätzung.................................................. 53 8. Externe Faktoren – Weltkonjunktur & Ölpreis........................................... 54 9. Quellen...................................................................................................... 55 Research Seite 2 13.02.2008 1. Kommentar ATTRAKTIVITÄT Der chinesische Markt besticht mit seiner enormen Größe, der Bevölkerungszahl und der noch immer sehr niedrigen Wirtschaftsleistung pro Kopf. Eine sehr hohe Investitions- und Sparquote galten bislang als Garant für zukünftige Wirtschaftsleistung. Da das bisherige chinesische Wirtschaftsmodell an seine Grenzen stößt, sollte sich das Wachstum bis 2011 auf 7-8% J/J verlangsamen. Dennoch bleibt die Wachstumsrate im internationalen Vergleich hoch. Um ein dauerhaft hohes Wachstum generieren zu können, ist es für China zunehmend wichtig höherwertigere Produkte herzustellen. Aufgrund einer zu erwartenden Änderung in der wirtschaftspolitischen Ausrichtung ist mit einem relativen Bedeutungsverlust des Exportsektors zu rechnen. Gleichzeitig sollte das Wachstum zukünftig stärker vom Binnenkonsum getrieben sein. Exportseitig ist mit einem stärkeren Vordringen Chinas in technologisch höherwertige Produktklassen zu rechnen. Die Direktinvestitionen sollten an Bedeutung verlieren. Unter einer längerfristigen Perspektive (Zeitraum > 5 Jahre) verschlechtert sich die Attraktivität aufgrund der demografischen Entwicklung und der Umweltzerstörung. Aufgrund seines diplomatischen Auftretens und der Unterlassung von politischen Forderungen gegenüber afrikanischen Regimen konnten die Chinesen sich als bedeutender Direktinvestor in Afrika etablieren und sich damit den Zugang zu wichtigen Ressourcen sichern. RISIKO Bonität Die drei Ratingagenturen bewerten das Länderrisiko Chinas unterschiedlich. Während Fitch und Moody’s Investor Service dieses bei A+ (bzw. A1) sehen, sieht S&P das Rating um einen Notch tiefer, bei A liegen. Allerdings ist der Ausblick bei S&P positiv. Insgesamt und aufgrund der historischen Entwicklung scheint daher die Gesamtnote von 2,75 angebracht. Fitch hat am 6. November 2007 sein Fremdwährungs-Staatenrating aufgrund verbesserter fiskalischer Rahmenbedingungen und einer geringeren Wahrscheinlichkeit, dass der Staat den Großbanken unter die Arme greifen muss um einen Notch von A auf A+ und das Lokalwährungsrating entsprechend von A+ auf AA- angehoben. Der Ausblick für beide Ratings wurde mit “stabil” festgesetzt. Um die starke externe Zahlungsbilanzposition Chinas zu reflektieren hat Moody's Investors Service am 26. Juli 2007 sein langfristiges Fremdwährungsanleiherating um einen Notch von A2 auf A1 angehoben. Moody’s hob auch den Trend in der Staatsverschuldung und den Fortschritt bei wirtschaftlichen Reformen positiv hervor. Der Ausblick wurde mit “stabil” festgesetzt. Auch wurden substantielle Fortschritte bei der inneren Finanzstärke und der Aufsicht über die großen staatlichen Geschäftsbanken erzielt. Der Country Ceiling für Fremdwährungs- als auch Lokalwährungseinlagen bzw. Anleihen wurde ebenfalls von A2 auf A1 angehoben. Der entsprechende Ausblick wurde mit „stabil“ festgesetzt. S&P hat am 26. Juli 2007 sein Fremdwährungs-Staatenrating von A für China bestätigt, den Ausblick jedoch von „neutral“ auf „positiv“ angehoben. Das bisherige Rating besteht seit 27. Juli 2006. Damals wurde die Anhebung mit der starken Vermögensposition Chinas gegenüber dem Ausland, dem Wachstumspotential, und dem verbesserten fiskalischen Rahmen begründet. Wirtschaftliche Stabilität Aufgrund der nach wie vor hohen Abhängigkeit vom Export, vor allem gegenüber den USA und Japan und einer sich abzeichnenden Abkühlung der Weltkonjunktur, haben sich die konjunkturellen Risiken für China spürbar erhöht. Zudem hat sich das Land in den letzten Jahren von einem reinen Assembler zum Hersteller höherwertiger Konsumprodukte und Maschinen transformiert, was seine Sensibilität gegenüber externen Konjunkturschwankungen merklich erhöht hat. Die Struktur des Wachstums ist aufgrund der nach wie vor planwirtschaftlichen Festsetzung der Zinsen durch die Zentralbank und der Kreditvergabepraxis der Banken gegenüber Staatsbetrieben hin zu Überinvestitionen, vor allem im schwerindustriellen Bereich und dem Bausektor, verzerrt. Allerdings sollten die gestiegenen Mindestreserveanforderungen der Notenbank nun erstmals bei den Research Seite 3 13.02.2008 Geschäftsbanken zu greifen beginnen. Das gegenwärtige Inflationsproblem ist primär angebotsseitig und hier vor allem auf landwirtschaftliche Probleme (Dürren im In- und Ausland) zurückzuführen. Allerdings handelt es sich hier um Ausnahmesituationen, welche nur vorübergehend bestehen sollten. Da der Yuan seinen Aufwertungstrend voraussichtlich mittelfristig fortsetzen wird, sollte dies die Importpreise dämpfen und so zur Inflationsbekämpfung beitragen. Ansteckungsgefahren durch eventuelle Währungskrisen in Schwellenländern sehen wir als gering an. Darüber hinaus verfügt das Land gegenwärtig über die höchsten Devisenreserven der Welt. Die Abhängigkeit von ausländischen Kapitalzuflüssen ist daher gering. Die Haushaltssituation des Staates gilt als gut. Auf Sektorenebene zeigt lediglich der Finanzsektor eine erhöhte Krisenanfälligkeit. Das Bankensystem konnte in den vergangenen Jahren wesentliche Reformschritte vorweisen. Dennoch gibt es Risiken aufgrund etwaiger Kreditausfälle. Die potentielle Gefahr liegt nach wie vor im Bereich der stark expandierenden Kreditvergabe. Die rasch steigenden Devisenreserven und die solide Haushaltssituation erlauben es dem Staat den Banken im Falle einer Verschlechterung ihrer Situation zu Hilfe zu kommen. In diesem Zusammenhang sind die Entwicklung der Not leidenden Kredite, der Aktien- und der Immobilienpreise genau zu beobachten. Nach dem Boom der vergangenen Jahre könnte der Aktienmarkt einbrechen und das Finanzsystem destabilisieren. Politische Stabilität Zu den größten Vorteilen Chinas zählt die interne Stabilität des politischen Systems. Mittelfristig ist nicht mit einer Änderung der politischen Ausrichtung zu rechnen. Staatspräsident Hu Jintao und Premierminister Wen Jiabao gelten in der kommunistischen Partei Chinas als konservativ und etabliert und konnten in den vergangnen Jahren ihre Position festigen. Eine Gefährdung durch interne Konflikte ist in diesem autoritären Regime unwahrscheinlich, vor allem solange es die entsprechenden wirtschaftlichen Resultate liefert. Entscheidend für die politische Stabilität in den kommenden Jahren ist, dass die rückständigen Regionen im Norden und Westen am Wachstum partizipieren und sich die dortigen Lebensbedingungen verbessern. Extern haben sich die politischen Risiken in den letzten Jahren reduziert, nachdem sich in der Frage um das nordkoreanische Atomprogramm eine Lösung abzeichnet, die USA nicht mehr bedingungslos an der Seite Taiwans stehen, und die Spannungen wegen des Leistungsbilanzüberschusses gegenüber den USA zunehmend amerikanischem Pragmatismus gewichen sind. Auch die Beziehungen zum Rivalen Indien haben sich verbessert. China versucht sich in der Region als verantwortungsvolle Großmacht zu etablieren, was ihm bislang gut gelungen ist. Mit dem nördlichen Nachbar Russland zeichnet sich ein Zweckbündnis ab, welches primär darauf abzielt die amerikanische Dominanz zu brechen. Rahmenbedingungen Die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft sind zwiespältig. Zu den Hauptschwächen Chinas gehört die Korruption. Diese ist vor allem auf Lokalebene stark ausgeprägt und einer der Hauptgründe für das bislang schwache Bankensystem des Landes. Ein großer Missstand ist nach wie vor die fehlende Transparenz sowohl im Geschäftsleben als auch bei politischen Entscheidungen. Die geplante Öffnung des Dienstleistungssektors (Eisenbahn, Telekommunikation, Flugverkehr) würde eine spürbare Dynamik in diesen unterentwickelten Sektor generieren und das Wirtschaftswachstum auf eine breitere Basis stellen. Der Zugang zum chinesischen Bankensektor für ausländische Banken gilt nach wie vor als sehr schwierig. Auch die unzureichende Liberalisierung der Kapitalverkehrsbilanz ist ein Schwachpunkt der chinesischen Wirtschaftspolitik. Im Bereich Eigentumsrechte (Enteignungsrisiko), freier Warenverkehr und Staatshaushalt ist China im internationalen Vergleich vorbildhaft. Die politische Einschätzbarkeit Chinas ist sehr gut. Instabilität könnte sich bestenfalls aufgrund sozialer Unruhen infolge schwerer wirtschaftlicher Probleme ergeben. Solange dies jedoch nicht gegeben ist, sollte das politische System stabil bleiben. In wirtschaftlicher Hinsicht hat sich die Einschätzbarkeit in den letzten Jahren stark verbessert, sie bleibt aber weit hinter europäischen Standards. Insbesondere die Transparenz wirtschaftspolitischer Entscheidungen ist nicht gegeben. Die Informationslage zu chinesischen Firmen ist, sofern diese nicht im Ausland gelistet sind, relativ dürftig. Auf Unternehmensebene agiert das Management weitgehend aus Eigenmotiven, corporate governance befindet sich noch in den Kinderschuhen. Wirtschaftliche Statistiken werden nach wie vor durch das Ausland kritisch betrachtet, jedoch hat sich deren Qualität in den vergangenen Jahren zunehmend verbessert. Positiv ist die hohe mediale Präsenz Chinas. Research Seite 4 13.02.2008 2. Stärken-/ Schwächenprofil Stärken Schwächen Langfristig / strukturell Langfristig / strukturell Die chinesische Wirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren weiter geöffnet Der Aufbau eines leistungsfähigen Exportsektors erforderte die Modernisierung des chinesischen Wirtschaftssystems Spar- und Investitionsquote sind sehr hoch und relativ ausgeglichen Bankensektor beginnt sich zu öffnen Hohes Wachstum in technischer Effizienz und Arbeitsproduktivität Kurzfristig / konjunkturell Hoher Zufluss an ausländischen Direktinvestitionen Indikatoren für außenwirtschaftliches Gleichgewicht deuten auf geringe Ansteckungsgefahr hin - ein hoher Leistungsbilanzüberschuss macht das Land immun gegenüber Währungskrisen Geringe Auslandsverschuldung bei hohen Währungsreserven Noch gut ausgebildete und relative billige Fachkräfte verfügbar Kurzfristig / konjunkturell Research Die Umweltzerstörung bedroht die längerfristigen Wachstumsperspektiven Chinas Kapital/Investitionsbasiertes Wachstum langfristig nicht aufrechtzuerhalten Shift von Assembler hin zu Herstellung höherwertigerer Produkte – erhöhte Exportelastizität als Funktion der Weltkonjunktur Kreditvergabe erfolgt nicht entsprechend dem eingegangenen Risiko Hohe Anzahl versteckter Arbeitsloser – vor allem in der sanierungsbedürftigen Staatsindustrie Fachkräftemangel Ineffizienter Ressourceneinsatz – hoher Energieverbrauch pro BIP-Einheit Abhängigkeit von ausländischen Rohstoffen Überalterung aufgrund der 1-Kind-Politik Korruption Ineffiziente Verwaltung Soziale Unruhen sind aufgrund der zunehmenden Unterschiede in der chinesischen Gesellschaft nicht auszuschließen Konflikt mit Taiwan kocht immer wieder auf Seite 5 Regierung hat bislang keinen Weg gefunden die Wirtschaft abzukühlen Steigender Lohndruck aufgrund mangelnder Fachkräfte Mögliche Spannungen mit USA wegen Wechselkurs Gefährdung des chinesischen Exports durch Protektionismus der Handelspartner Yuan-Bindung/ widersprüchliche Geldpolitik Steigende Nachfrageelastizität – Wachstum wird abhängiger vom Ausland Nach wie vor stark abhängig vom Export Risiken am Aktien- und Immobilienmarkt haben sich merklich erhöht 13.02.2008 3. Volkswirtschaftliche Kennzahlen 3.1 Aktuelle Konjunktur & Ausblick Aktuell Das Wirtschaftswachstum, das in den vergangenen Quartalen stets im 2-stelligen Bereich lag, hat sich im 3. und 4. Quartal 2007 leicht abgeschwächt und betrug 11,5% J/J bzw. 11,2% J/J (Q2 07: 11,9%). In der Vergangenheit wurde das Wachstum primär vom Exportsektor und den Investitionsausgaben getragen. Das Wachstum konnte auf den Investitionssektor und teilweise auf den privaten Konsum verlagert werden, der Beitrag des Außensektors ist etwas zurückgegangen. Für das Gesamtjahr 2007 ergibt sich eine Wachstumsrate von 11,4% J/J. Die Wertschöpfung stieg im Jahr 2007 entsprechend auf 2380 Mrd. € (2006: 2108 Mrd.). Im Jahr 2006 betrug das Wirtschaftswachstum laut Global Insight 11,1% J/J, nach 10,4% J/J im Jahr zuvor. Für die ersten 3 Quartale des Jahres 2007 ergibt sich ein Wachstum des Agrarsektors um 4,3% J/J, in der Industrie um 13,5% J/J und im Dienstleistungssektor um 11% J/J. Die Ausrüstungsinvestitionen konnten in den ersten 3 Quartalen um 25,7% J/J zulegen, diese Rate ist um 0,2% niedriger als jene im 1. Halbjahr 2007. Die Investitionen im Immobilienbereich beschleunigten sich auf 30,3% nach 28,5% im ersten Halbjahr. Die Exporte konnten mit einer Rate von 27,1% J/J zulegen, nach 27,6% im ersten Halbjahr. Die Importe wuchsen in den ersten drei Quartalen mit einer Jahresrate von 19,1% (H1 2007: 18.2%). Nachdem das Wirtschaftswachstum von 1995 bis 2004 weit unter Potential wuchs, liegt das chinesische Wirtschaftswachstum erst seit 2005 über seinem langfristigen Potentialwachstum. Es kann daher noch nicht von extremen Überhitzungserscheinungen der chinesischen Wirtschaft gesprochen werden. Wirtschaftswachstum Einzelhandelsumsatz 16% 30 Reales BIP-Wachstum (% J/J) Potentialwachstum 14% Einzelhandelsumsatz [% J/J] 25 12% 20 10% 15 8% 10 1990 1993 1996 Quelle: Global Insight 1999 2002 2005 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 19 99 19 98 19 97 0 0% 19 96 2% 19 95 5 19 93 4% 19 94 6% -5 Quelle: Global Insight In den letzten Monaten des Jahres 2007 zeigte sich eine Abschwächung der Exportwachstumsrate was auf eine abkühlende Weltwirtschaft zurückzuführen sein dürfte. Sollte sich der Trend fortsetzen, wovon wir ausgehen, ist mit einem niedrigeren Außenbeitrag zum chinesischen BIP und entsprechend niedrigerem Wirtschaftswachstum zu rechnen. Robust zeigte sich in den letzten Monaten des Jahres 2007 der Einzelhandel. Das entsprechende Umsatzwachstum beschleunigte sich bis November 2007 auf 18,8% J/J. Allerdings dürfte die steigende Inflationsrate dabei eine große Rolle gespielt haben. Research Seite 6 13.02.2008 Ausblick Wettbewerbsfähigkeit Marktpotential Für 2008 und 2009 wird von Global Insight ein Wachstum von 10,4% bzw. 9,4% J/J prognostiziert. Chinas nominelle Wirtschaftsleistung könnte demnach im Jahr 2008 jene Deutschlands übersteigen und das Land damit zur drittgrößten Wirtschaftsmacht der Welt, hinter den USA und Japan, aufsteigen. Noch bleibt unklar, wie weit sich die zuletzt vollzogene monetäre Straffung auf die Investitionen auswirken wird. Zwar sind die Realzinsen nach wie vor negativ, was in Kombination mit einem hohen Wirtschaftswachstum einen starken Investitionsanreiz schafft, doch könnte das gestiegene Mindestreserveerfordernis durch die Notenbank die Banken nun zwingen ihre Kreditvergaben einzuschränken, was gewisse Investitionsprojekte treffen würde. Aufgrund der weit reichenden Korruption im chinesischen Bankensystem bleibt abzuwarten, wie effektiv die Vorgaben zum Kreditwachstum und die Mindestreservesätze eingehalten werden. Der private Konsum entwickelt sich positiv, sein Wachstum reicht jedoch noch nicht aus einen stärkeren Rückgang in der Exportkonjunktur auszugleichen. Somit sollten trotz der gestrafften Geldpolitik und der internationalen Kreditverknappung die Investitionen die wichtigste Stütze für das Wachstum der chinesischen Volkswirtschaft in den kommenden Quartalen sein. 1994 Durchschnitt 1996-2005 2005 2006 2007 2008 2009 2013 Bevölkerung [in Mio.] 1198,5 1278,4 1307,6 1314,5 1322,1 1329,8 1337,5 1368,5 BIP, nominal [Mrd. €] 471,4 1401,5 1805,6 2108,4 2380,0 2717,0 3441,0 5943,6 BIP pro Kopf [€] 393 1091 1381 1604 1800 2059 2644 4648 BIP, reale Wachstumsrate [% J/J] 13,1 9,2 10,4 10,8 11,5 10,4 9,4 7,0 Bruttoinvestitionsquote in % des BIP 42,2 39,9 43,3 44,2 Bruttosparquote [in % des BIP] 44,0 42,8 49,0 50,3 50,7 50,9 50,7 49,2 Verhältnis Bruttospar-/Bruttoinvestitionsquote 1,04 1,07 1,13 1,14 Marktkapitalisierung in % des BIP 7,8 14,5 11,8 10,2 34,9 Wachstum Arbeitsproduktivität [% J/J] 21,0 20,2 19,5 Direktinvestitionen in % des BIP 6,0 3,4 3,5 3,0 Direktinvestitionen in % der Bruttogesamtinvestitionen 14,3 8,4 Exportwachstum, real [in % J/J] Bestand Direktinvestitionen am BIP [in %] 8,1 6,7 21,0 20,6 Offenheitsmaß I [Außenhandel in % des BIP] 41,3 51,2 69,0 72,4 Realer Wechselkurs 81,5 99,8 98,5 100,8 102,8 Stabilität Steuereinnahmen [in % des BIP] Inflation [% J/J] 24,2 0,9 1,8 1,5 4,8 5,8 4,3 3,1 Wechselkurs zu EURO [Einheiten pro €] 10,24 9,03 10,20 10,01 10,42 10,50 9,46 8,04 7,61 6,96 6,44 5,94 -0,82 -0,88 -0,50 Wechselkurs zu USD [Einheiten pro $] 8,62 8,24 8,19 7,97 Devisenreserven [in Mrd. €] 44,60 350,89 661,00 851,69 17,6 15,7 40,8 56,2 58,3 59,8 9,9 11,4 11,8 431,4 271,7 159,4 147,9 598,7 443,8 405,7 M2 Wachstum [in % J/J] Geldmenge M1/BIP [in %] Geldmultiplikator (M2/M0) [in %] Geldmenge M1/ Devisenreserven [in %] Private Staatsvers Verschuldung chuldung Außenwirtschaftliches Gleichgewicht Geldmenge M2/Devisenreserven [in %] Externe Schuldendienstquote im Verhältnis zum BIP 16,7 12,3 2,0% Externer Schuldendienst/Exporte [%] 8,89 3,10 % Anteil Privat an langfr. Außenverschuldung 0,7% 37,9% Außenverschuldung/Kreditvergabe Inland 20,1% 9,3% Auslandsschuld, gesamt in % des BIP 18,0 12,5 kurzfristige Auslandsschuld in % der Reserven 33,0 18,0 Kurzfr. Außen-/Gesamtaußenverschuldung [in %] 17,4 52,6 Externer Zinsendienst/ Exporte [%] 3,82 0,74 % der Tilgung an externen Schuldendienst 0,57 Importdeckung der Devisenreserven [in Monaten] 6,7 13,0 15,7 17,1 Leistungsbilanz in % des BIP 1,24 3,73 7,17 9,45 Verschuldung öffentlicher Sektor in % des BIP 2,44 Budgetdefizit in % des BIP -1,19 -1,66 -1,25 3,77 -0,70 Verschuldung des priv. Sektors bei Banken [% des BIP] 85,2 113,1 113,9 113,6 Verschuldunsgrad des privaten Sektors [% des BIP] 0,1 -0,88 Primärdefizit in % des BIP Inlandskredit [Mrd. €] Kreditwachstum % J/J 421,54 2,3 1839,82 2439,00 2886,91 16,0 10,7 16,3 Quelle: Global Insight Research Seite 7 13.02.2008 3.2 Marktpotential Die Transformation der chinesischen Wirtschaft begann in den späten 70er Jahren unter dem damaligen Führer Deng Xiaoping. Die Reformen führten in den darauf folgenden Jahrzehnten zu einem rasanten Wirtschaftswachstum. Der langsame Übergang von einem Planwirtschaftssystem zu einem marktwirtschaftlichen System vermied den Kollaps wie bei den Radikaltransformationen in vielen osteuropäischen Ländern zu beobachten war. Durch die Schaffung sogenannter Sonderwirtschaftszonen mit steuerlichen Anreizen konnten ausländische Unternehmungen in das Land gelockt werden und damit wurde der für China wichtige Technologietransfer beschleunigt. Die Produktion basierte zunächst auf arbeitsintensive Veredelungsproduktion, welche aufgrund der niedrigen Löhne in China einen erheblichen Standortvorteil genoss. Trotz einiger Überhitzungserscheinungen zählt das makroökonomische Umfeld zu den Stärken Chinas. Nach wie vor bietet China mit seiner wachsenden Mittelschicht ein großes Absatzpotential auch für ausländische Firmen. Daneben haben der WTO-Beitritt und der sich verbessernde Schutz für Investitionen und Patente zu einer Verbesserung der Marktchancen westlicher Unternehmen beigetragen. Die Größe des Landes, die Bevölkerungszahl und die noch immer sehr niedrige Wirtschaftsleistung pro Kopf weisen auf ein enormes wirtschaftliches Potential hin. Eine sehr hohe Investitions- und Sparquote gelten kurz- bis mittelfristig hierbei als Garant für zukünftige Wirtschaftsleistung. Die Prognosen gehen mehrheitlich davon aus, dass sich die Wachstumsrate trotz der Dämpfungsmaßnahmen von Seiten der chinesischen Regierung bis 2010 nur minimal abschwächen wird. Zusammensetzung des BIP nach Sektoren 2007 Landwirtschaft 11% Bergbau & Energie 15% Dienstleistungen 40% Verarbeitendes Gewerbe 34% Quelle: Global Insight Der Anteil des Agrarsektors an der Wirtschaftsleistung hat sich seit 1990 mehr als halbiert. Dennoch ist sein Anteil im Vergleich zu Industrieländern noch relativ hoch. Aus Autarkiemotiven und der Selbstdefinition Chinas als Arbeiter- und Bauernstaat ist die Stellung des Agrarsektors in der Gesellschaft sehr hoch. Research Seite 8 13.02.2008 Zusammensetzung des BIP nach Sektoren BIP pro Kopf 1800 100% BIP pro Kopf [€] Dienstleistungen 1600 Industrie Landwirtschaft 80% 1400 1200 60% 1000 800 40% 600 400 20% 200 0 0% 1970 1975 1980 Quelle: Global Insight 1985 1990 1995 2000 1993 2005 1996 1999 2002 2005 Quelle: Global Insight Die aktuelle Demographie in China ist noch äußerst günstig, da der „Mittelbau“ in der Alterspyramide sehr groß ist und der Altenquotient sehr gering. Die Überalterungstendenz zeigt sich jedoch bereits in einem Anstieg des Altenquotients. Eine sinkende Geburtenrate hat zudem auch die sozialen Kosten für Kindererziehung stark reduziert. Längerfristig führt diese Entwicklung jedoch zu einer enormen Kostenzunahme im Gesundheitswesen und im staatlichen Pensionssystem, da der derzeitige Mittelbau dann verstärkt auf Unterstützung angewiesen sein wird, während gleichzeitig die Anzahl der erwerbsfähigen Personen stark abnimmt. Ein wesentlicher Schlüssel zur langfristigen Gewährleistung hoher Wachstumsraten ist eine umfassende Reform des Finanzsektors. Nach wie vor fehlt China das für eine Markwirtschaft wichtige Zustandekommen der Zinssätze durch Angebot und Nachfrage. Wegen der negativen Realzinsen, kommt es zu einem unerwünschten Zwangssparen und einer Fehlallokation des Kapitals zugunsten kapitalintensiver Sektoren und des Investitionssektors (=Verlängerung der Produktionswege). Es kommt daher zu einer chronischen Überproduktion in diesen Sektoren bei gleichzeitigem relativem Mangel im Konsumbereich. Die künstlich niedrig gehaltene Währung forciert diesen Prozess noch. Nach wie vor ist die Zusammensetzung des BIP einseitig und in Richtung Außenwirtschaftssektor und Investitionen verzerrt. Um den nötigen Kapitalstock (hohe Abschreibungen!) aufrechtzuerhalten, ist eine hohe Spar- und Investitionsquote erforderlich. Der private Konsum gilt daher als unterentwickelt. Ein weiterer Grund für die hohe Sparquote ist die unzureichende Finanzintermediation. Die staatlich bzw. teilstaatlichen chinesischen Banken vergeben die Kredite bevorzugt an die marode Staatswirtschaft, der private Sektor dagegen muss einen Großteil der Investitionen durch einbehaltene Gewinne finanzieren. Um unter Beibehaltung der gegenwärtigen Wirtschaftsstruktur weiterhin hohe Wachstumsraten generieren zu können, wäre ein weiterer Anstieg der Spar- und Investitionsquote erforderlich, was sich dämpfend auf den chinesischen privaten Konsum auswirken würde. Da dies ab einen gewissen Punkt nicht mehr möglich sein wird, ist davon auszugehen, dass das gegenwärtige Wirtschaftsmodell längerfristig nicht aufrechtzuerhalten sein wird. Um eine höhere Nachhaltigkeit des Wachstums zu erreichen, wäre es erforderlich den Anteil der Investitionen und des Exports relativ zu senken und den privaten Konsum zu stärken. Gleichzeitig sollten auch die außenwirtschaftlichen Ungleichgewichte abgebaut werden. Die chinesische Regierung beabsichtigt unter dem Stichwort „harmonische Gesellschaft“ die Qualität des Wirtschaftswachstums von einem energiegetriebenen, exportorientierten, kapitalintensiven Wachstum in ein sozial- und umweltpolitisch nachhaltigeres Wachstum (unter Beibehaltung der hohen Wachstumsrate der Vergangenheit) zu transformieren. Research Seite 9 13.02.2008 Ein Arbeitspapier der Weltbank vom September 20071 hat drei mögliche Szenarien für die weitere wirtschaftliche Entwicklung Chinas untersucht. Das erste Szenario unterstellt eine Beibehaltung des jetzigen Wirtschaftsmodells, das zweite Modell geht von einer Verlagerung der wirtschaftlichen Prioritäten aus, darunter Reformen im Fiskal-, Finanz- und Preisfestsetzungssystem, im Arbeitsmarkt und bei der Migrationpolitik. Aufgrund dieser Schwerpunktverlagerung würde sich der Bedarf an Kapitalakkumulation drastisch reduzieren und sich die Produktivität erhöhen, da weniger Beschäftigte im relativ unproduktiven Landwirtschaftssektor beschäftigt werden würden. Ein drittes Szenario geht von noch größeren und radikaleren Reformanstrengungen im Bereich Umwelt und „sozialer Gerechtigkeit“ aus. In diesem Szenario ergäbe sich jedoch eine starke Reduktion der langfristigen Wachstumsrate. Die steigende Kapitalintensität der Produktion macht eine stetig steigende Spar- und Investitionsquote erforderlich. Das erzielte Wachstum war primär auf die gestiegene Kapitalakkumulation zurückzuführen. Im Jahr 2006 belief sich die Bruttoinvestitionsquote bereits auf 45% und die Sparquote erreichte 51% der gesamten Wertschöpfung. Im Unterschied zu anderen aufstrebenden Ländern wurden die Investitionen weitgehend durch inländische Ersparnisse des Unternehmenssektors finanziert. Direktinvestitionen spielten jedoch eine große Rolle im Technologietransfer. Daraus resultierte ein hoher Leistungsbilanzüberschuss der sich im Jahr 2006 bereits auf 9,45% des BIP belief. Die Investitionen in den Kapitalstock wiederum wurden durch künstlich niedrig gehaltene Zinsen und diverser nach unten verzerrter Inputpreise sowie einer unterbewerteten Währung zusätzlich gefördert. Die Entwicklung des Dienstleistungssektors wurde bislang vernachlässigt. Die Entwicklung dieses Sektors leidet unter Überregulierung und Beschränkungen sowie der Diskriminierung privaten Konkurrenten. Folgende Probleme ergeben sich unter Beibehaltung des gegenwärtigen kapitalintensiven Wirtschaftsmodells: - Die Finanzierung der Investitionen ist langfristig nicht gesichert. Das gegenwärtige Modell erfordert immer höhere Spar- und Investitionsquoten. Würde sich die bisherigen Wachstumsraten fortsetzen, müsste die Sparquote in den kommenden Jahrzehnten auf 50-60% ansteigen! (siehe übernächste Tabelle) Quelle: World Bank China Research Paper No. 7, Rebalancing China’s Economy — Modelling a Policy Package, September 2007 - China, das bereits jetzt stark auf ausländische Rohstoffe angewiesen ist, würde noch stärker von ausländischen Rohstoffen abhängig. Der hohe 1 World Bank China Research Paper No. 7, Rebalancing China’s Economy — Modelling a Policy Package, Jianwu He/ Louis Kuijs, September 2007 Research Seite 10 13.02.2008 Ressourcenverbrauch und Schadstoffausstoß gefährden Folgeschäden in China würden drastisch zunehmen. die Umwelt. Die - Das kapitalgetriebene Wachstum generiert aufgrund der geringen Arbeitsintensität nur wenig Beschäftigung, in Kombination mit der hohen Wertschöpfung ergeben sich wachsende soziale Ungleichgewichte. Die Industrie ist vor allem im städtischen Bereich konzentriert, die Landbevölkerung partizipiert nur wenig am Wachstum. - Der weitere Aufbau von Industriekapazitäten im verarbeitenden Bereich führt tendenziell zu einem noch stärkeren Exportüberschuss Chinas. Szenarien „Status quo“ und „moderate Neugewichtung“: Verlauf Spar- & Investitionsquote (2005-2045) „Status quo“ und „moderate Neugewichtung“ Quelle: World Bank China Research Paper No. 7, Rebalancing China’s Economy — Modelling a Policy Package, September 2007 Es wird ersichtlich, dass das bisherige Modell (Status quo) kaum fortführbar ist! Szenario 2 („moderate Neugewichtung“), welches weitgehend mit den Vorschlägen der chinesischen Regierung vom März 2007 übereinstimmt, erfordert eine wesentliche Stärkung des privaten Konsums und des Dienstleistungssektors. In diesem Szenario hat der Dienstleistungssektor einen höheren Anteil am Wirtschaftswachstum. Ausgehend von einem durchschnittlichen Anteil der Industrie von 49% im Zeitraum 1993-2005 würde sich deren Anteil bis 2035 um 13 Prozentpunkte auf 36% reduzieren. Gleichzeitig würde sich der Anteil des Dienstleistungssektors an der Gesamtwirtschaftsleistung um 20 Prozentpunkte erhöhen. Ausgabenseitig betrachtet ergäbe sich eine spürbare Erhöhung des Wachstumsbeitrags der durch den privaten Konsum geleistet wird, bei entsprechendem Bedeutungsverlust der Investitionen und des Exportsektors. Research Seite 11 13.02.2008 Wachstumspfade Szenario „Status quo“ und „moderate Neugewichtung“ Quelle: World Bank China Research Paper No. 7, Rebalancing China’s Economy — Modelling a Policy Package, September 2007 Um dieses Ziel zu erreichen müssten folgende Maßnahmen getroffen werden: - Verlagerung der staatlichen Ausgaben weg von Investitionen hin zu Gesundheit, Bildung und sozialer Sicherheit. Derzeit beabsichtigt die Regierung, die Ausgaben für Bildung auf 4% des BIP anzuheben, und es besteht das Versprechen der Regierung, in ländlichen Gegenden die Finanzierung von 9 Pflichtschuljahren zu tragen. Bereits beschlossen wurde auch die kostenlose medizinische Grundversorgung. Eine umfassende Gesundheitsreform wird derzeit erarbeitet. - beschleunigte Öffnung und Reform des Finanzsektors um die Effizienz der Kapitalallokation zu erhöhen und weniger investitionsgetriebenes Wachstum zu generieren. - Schaffung einer Dividendenpolitik der staatlichen Unternehmungen und Verbesserung der corporate governance, sodass der Hang zu Überinvestitionen der Staatsbetriebe eingeschränkt wird. Dies ist bereits für 2008 vorgesehen. Setzung mehrerer preis- und steuerpolitischer Maßnahmen, die zum Ziel haben, die relative Attraktivität zwischen Industrie und Dienstleistungssektor zugunsten letzterem zu verlagern: - Zulassung höherer Flexibilität Leistungsbilanzüberschusses. in der Wechselkursbildung zum Abbau des - Veränderung der Inputpreise für das verarbeitende Gewerbe (Boden, Energie, Wasser und sonstige natürliche Ressourcen), sodass diese stärker den relativen Knappheiten entsprechen. Bereits jetzt gibt es diesbezügliche Planungen in den Bereichen Industrie-, Fiskal- und Steuerpolitik, welche auf einen verbesserten Umweltschutz abzielen, u.a. ist eine Kraftstoffsteuer geplant. - Beseitigung steuerlicher Anreizverzerrungen zugunsten der Industrie u.a. durch Steuerbegünstigungen von Direktinvestitionen, im Bereich des Mehrwertsteuersystems und bei der Körperschaftssteuer. Bereits beschlossen ist die Vereinheitlichung der Steuersätze für in- und ausländische Unternehmen. Ein neuer Förderkatalog über die favorisierten Sektoren bei ausländischen Direktinvestitionen in China ist seit 1. Dezember 2007 in Kraft. Laut NDRC zielt der neue Katalog darauf ab die industrielle Research Seite 12 13.02.2008 Struktur des Landes zu verbessern, Energie einzusparen, die Umwelt zu schützen; den exzessiven Leistungsbilanzüberschuss zu reduzieren, die regionalen Ungleichgewichte zu reduzieren und die nationale Sicherheit zu erhöhen. Der neue Katalog soll die Ansiedelung von Hightechindustrien und von Firmen im Bereich neue Materialtechnologien fördern und die Ansiedelung von Unternehmen in den Bereichen, in denen chinesische Unternehmen bereits über ausgereifte Produktionstechnologien und hohe Produktionskapazitäten verfügen, hemmen. Im Dienstleistungsbereich wird verstärkt auf die Ansiedelung von Outsourcingunternehmen und Logistik abgezielt. Im Bereich der Ressourcenschonung und des Umweltschutzes sieht der Katalog eine verstärkte Förderung von Recyclingbetrieben und erneuerbarer Energien, Schadstoffreduktionstechnologien ab. Die Ansiedelung von Sektoren, welche starke Umweltzerstörung nach sich ziehen, wird stark eingeschränkt oder verboten. - Beseitigung der verbliebenen Tätigkeitsbeschränkungen im Bereich des Dienstleistungssektors. Aufbrechung von Monopolen und Oligopolen im Dienstleistungsbereich. Um den Wettbewerb zu intensivieren wurde am 30. August 2007 das erste Antimonopolgesetz Chinas beschlossen. Dieses soll mit 1. August 2008 in Kraft treten und löst mehrere zersplitterte Gesetze über Verbraucherschutz und unlauteren Wettbewerb ab. Der Staatsrat hat bereits im März 2007 ein Papier veröffentlicht, welches eine Öffnung der Dienstleistungssektoren (u.a. Telekommunikation, Eisenbahn und Flugverkehr) für private und ausländische Wettbewerber vorschlägt, um so das Wachstum des Dienstleistungssektors anzuregen. Erleichterung im Bereich der Personenfreizügigkeit und beim Grundstückserwerb. Dies zielt darauf ab, die Migration zwischen Stadt und Land zu erleichtern und so die ländliche Armut zu lindern. Wanderarbeiter sollten bei ihren Arbeitsstätten in den verstärkten Genuss von Sozialleistungen kommen. Institutionelle Reformen um lokalen Entscheidungsträgern stärkere Anreize und bessere Mittel zu geben diese Reformen umzusetzen. Szenario 3 (radikale Neugewichtung der Wirtschaftssektoren) zielt verstärkt auf den Bereich Umweltschutz und „soziale Gerechtigkeit“ und hätte bedeutend höhere Kosten in Form von entgangenem Wirtschaftswachstum. Die Wirtschaftsleistung in den energieintensiven Sektoren würde sich bis 2035 gegenüber Szenario 2 um 15% reduzieren. Dieses Szenario sieht unter anderem die beschleunigte Schließung von Fabriken und Minen mit veralteter Produktionstechnik, beschleunigte steuerliche Abschreibung von Produktionsanlagen, Anhebung der Körperschaftsteuer auf 30% und Verteilung der Mehreinnahmen an Niedrigeinkommensbezieher in den ländlichen Bereichen vor. 3.3 Wettbewerbsfähigkeit Bedingt durch die seit 1994 bestehende Währungsbindung des Yuan gegenüber dem US-Dollar in Kombination mit einem starken Disinflationstrend seit dieser Zeit hat die chinesische Währung real abgewertet und so das rapide Wachstum der Exportindustrie gestützt. Diese Bindung bestand bis Mitte 2005. Seither wird eine leichte Aufwertung gegenüber dem Dollar zugelassen. Aufgrund der Handelsvorteile, die den Chinesen durch die Wechselkursentwicklung entstanden, musste bislang externer Druck zur Beschleunigung dieses Aufwertungstrends auf die chinesische Regierung ausgeübt werden. Die hohe Exportabhängigkeit sollte sich, wie am sich abschwächendem Exportwachstum im Vergleich zum BIP-Wachstum ersichtlich, in den nächsten Jahren schrittweise reduzieren. Dennoch bleibt der Exportsektor eine wesentliche Stütze des chinesischen Wachstums und die Offenheit der Research Seite 13 13.02.2008 chinesischen Wirtschaft gegenüber dem Ausland nimmt Auslandsinvestoren in den kommenden Jahren weiter attraktiv. weiter zu. China bleibt für In den vergangenen Jahren wurde von vielen Seiten die Befürchtung gehegt, dass die chinesischen Unternehmen aufgrund steigender unausgelasteter Kapazitäten, steigenden Inputpreisen, insbesondere Rohstoffen und Arbeit zunehmend unprofitabel wirtschaften und das chinesische investitionsgetriebene und energieintensive Wachstum daher nicht aufrechtzuerhalten wäre. Trotz gestiegener Faktorpreise kam es in den meisten Sektoren jedoch nicht zum befürchteten Rückgang der Gewinnmargen, im Gegenteil, diese konnten bislang sogar zulegen. Gewinnmargen in % Quelle: World Bank China Research Paper No. 8: Raw material prices, wages, and profitability in China’s industry — How was profitability maintained when input prices and wages increased so fast?, Oktober 2007 Umsatz, Gewinn Verarbeitende Industrie (Prozentänderung ggü. Vorjahr) Quelle: World Bank China Research Paper No. 8: Raw material prices, wages, and profitability in China’s industry — How was profitability maintained when input prices and wages increased so fast? Als Gründe für die Robustheit der chinesischen Unternehmensgewinne werden genannt: drastisch gestiegene Effizienz in der Verarbeitung von Halbfertiggütern, ein starkes Wachstum in der Arbeitsproduktivität gemessen in der Wertschöpfung pro Beschäftigten und ein Rückgang in der Steuerlast gemessen als Anteil am Bruttowert der hergestellten Güter.2 Die Inputpreise haben sich seit dem Jahr 2002 signifikant erhöht. Im Durchschnitt stiegen diese im betrachteten Zeitraum um 34%. Da jedoch der Preisanstieg sehr unterschiedlich ausfiel und verschiedene Sektoren eine unterschiedliche Inputstruktur aufweisen, waren die Sektoren unterschiedlich stark vom Preisanstieg betroffen. Im Kernbereich des verarbeitenden Gewerbes ist die Differenz zwischen dem Preisanstieg bei Endgütern und jenen der Inputpreise von 4 Prozentpunkte im Jahr 2005 auf 4,3 Prozentpunkte im Jahr 2006 angestiegen.3 Zwar stiegen auch die Preise der Endprodukte im selben Zeitraum, jedoch lag der Anstieg wesentlich unter jener der Inputfaktoren, wodurch unter normalen Umständen ein starker Druck auf die Gewinnmargen resultiert. Daneben gab es im gleichen Zeitraum einen starken Lohnanstieg von 2 World Bank China Research Paper No. 8: Raw material prices, wages, and profitability in China’s industry — How was profitability maintained when input prices and wages increased so fast?, Song-Yi Kim, Louis Kuijs, Oktober 2007 3 core manufacturing enthält nicht die Sektoren Bergbau, Kokerei, Gas- und Ölraffinierung, Elektrizitätserzeugung, Wärmekraft und Wasserversorgung Research Seite 14 13.02.2008 durchschnittlich 10-15%, der ebenfalls Druck auf die Gewinnmargen ausgeübt hat. Dies alles wurde aber durch die Zunahme der Produktivität mehr als ausgeglichen. Die international in USD fakturierten Rohstoffpreise verzeichneten einen starken Anstieg seit 2002. Bedingt durch den steigenden Ölpreis zogen die Yuan-basierten Preise im Zeitraum 2004-2006 um durchschnittlich 29% an. Nicht-energetische Rohstoffe verzeichneten ebenfalls im Durchschnitt einen Anstieg von 17%, wobei die Preise für Metalle und Mineralien sich im genannten Zeitraum um 36% erhöhten. Weltmarktpreise, chinesische Großhandelspreise (% J/J) Quelle: World Bank China Research Paper No. 8: Raw material prices, wages, and profitability in China’s industry — How was profitability maintained when input prices and wages increased so fast?, Oktober 2007 Insgesamt lag der Preisanstieg für Rohstoffe in China jedoch unter den entsprechenden internationalen Teuerungsraten. Insbesondere die Preise für Aluminium, Stahl und Ölprodukte stiegen in China nur unterproportional an. Der Anstieg für Ölprodukte fiel geringer aus, da die chinesische Regierung über Preiskontrollen den chinesischen Markt von der internationalen Entwicklung abschirmt. Im Bereich Stahl und Aluminium haben hohe Überkapazitäten im Inland die Margen reduziert, was für verarbeitende Betriebe den Kostendruck reduzierte. Aufgrund des starken Einsatzes von Metallen und den starken Anstieg bei Metallpreisen stellte sich die relative Preisentwicklung im Bereich Maschinenbau am schlechtesten dar. In der Ölraffinerierung und im Bergbau, welche nicht zum Kern des verarbeitenden Sektors gezählt werden, verzeichneten die Verkaufspreise einen höheren Anstieg als die Inputkosten. Research Seite 15 13.02.2008 Gewichtete Rohstoffkosten (2002 =100) Quelle: World Bank China Research Paper No. 8: Raw material prices, wages, and profitability in China’s industry — How was profitability maintained when input prices and wages increased so fast?, Oktober 2007 Outputpreise (2002 =100) Quelle: World Bank China Research Paper No. 8: Raw material prices, wages, and profitability in China’s industry — How was profitability maintained when input prices and wages increased so fast?, Oktober 2007 Relative Preise (Input/Output) (2002 =100) Quelle: World Bank China Research Paper No. 8: Raw material prices, wages, and profitability in China’s industry — How was profitability maintained when input prices and wages increased so fast?, Oktober 2007 Research Seite 16 13.02.2008 Zwei Gründe gab es die den Kosten- und Margendruck für die Unternehmen, welche aus den gestiegenen Rohstoffpreisen und dem hohen Lohnwachstum entstanden, entschärften: - Der starke Rückgang in den Mengenverhältnissen der Halbfertigprodukte zu den Endprodukten zeigt die stark gestiegene technische Effizienz der chinesischen Unternehmen. Der Anteil der Halbfertigprodukte an den Fertiggütern zu konstanten Preisen ging im Zeitraum 2003 bis 2006 von 74% auf 67% zurück. Insbesondere im Maschinenbau kam es zu einer starken Erhöhung der technischen Effizienz. Relatives Verhältnis Input/Outputpreise (in %) Quelle: World Bank China Research Paper No. 8: Raw material prices, wages, and profitability in China’s industry — How was profitability maintained when input prices and wages increased so fast?, Oktober 2007 - Daneben konnte die stark steigende Arbeitsproduktivität einen erheblichen Teil des Lohnanstiegs abfangen, wodurch die Lohnstückkosten weniger stark anstiegen. Wachstumsraten in Arbeitsproduktivität nach Sektoren (%) Quelle: World Bank China Research Paper No. 8: Raw material prices, wages, and profitability in China’s industry — How was profitability maintained when input prices and wages increased so fast?, Oktober 2007 Research Seite 17 13.02.2008 3.4 Außenwirtschaft In Relation zu seinem Bruttossozialprodukt ist China am Welthandel übermäßig präsent, was die Bedeutung des Exportsektors für die chinesische Wirtschaft widerspiegelt. Chinas wichtigster Handelspartner exportseitig ist seit kurzem die EU. Allerdings haben die USA noch immer einen sehr hohen Stellenwert. Auch Japan hat in den vergangenen Jahren als Absatzmarkt an Bedeutung verloren. Eine wichtige Rolle als Absatzmarkt spielen auch zunehmend die ölexportierenden Länder des Nahen Ostens, Lateinamerika und Russland. Auf der Importseite kommt Japan eine bedeutendere Rolle zu. China ist nach wie vor auf ausländische Technologieimporte angewiesen und für japanische Maschinenbauunternehmen ein überragender Absatzmarkt. Wichtigste Ausfuhrgüter sind Büromaschinen, Textilprodukte, Kommunikationsausstattung und Elektroartikel. Auch den Metallprodukten kommt ein hoher Stellenwert zu. Auf der Importseite sind die Gütergruppen Halbleiter, Rohöl, Maschinen und Büromaschinen von Bedeutung. Beim Warenexport sind vor allem arbeitsintensive Güterexporte dominierend. Aufgrund des rapide steigenden Rohstoffeigenverbrauchs ist der Export von Rohölprodukten, Erzen und Nahrungsmitteln seit 1990 zurückgegangen. Die Handelsbilanz hat sich seit 2003 stark verbessert und wies 2006 einen Rekordüberschuss von knapp 174 Mrd. € aus. Dies entspricht rund 8,2% des BIP. Der steigende Handelbilanzüberschuss in den letzten Jahren war eine Folge des starken Exportwachstums bei abnehmender Dynamik des Importwachstums. Für 2007 wird ein leichter Rückgang des Handelsbilanzüberschusses auf 8,1% des BIP erwartet und Global Insight prognostiziert bis zum Jahr 2011 einen stetigen Rückgang des Handelsbilanzüberschusses auf 2,3% des BIP. Die private Nachfrage sollte die relative Bedeutung des Handelsbilanzüberschusses in den kommenden Jahren allmählich reduzieren. Die Dynamik des Exportwachstums sollte in den nächsten Jahren stark abnehmen, während die Importe weiterhin robust hohe Wachstumsraten aufweisen sollten. Erste Abschwächungstendenzen in der Exportdynamik waren schon in der 2. Hälfte des Jahres 2007 feststellbar. Einen wesentlichen Unsicherheitsfaktor für den chinesischen Handelsbilanzüberschuss stellt die ausländische Nachfrage in den kommenden Jahren dar. Die Wechselkurspolitik besitzt aufgrund der absoluten Kostenvorteile Chinas derzeit noch eine geringe Bedeutung für die Handelsbilanzentwicklung. Handelsbilanz Dienstleistungsbilanz 4,5 40,0 Handelbilanz [in % des BIP] 4,0 Importe, Waren [in % des BIP] 35,0 Exporte, Waren [in % des BIP] 3,5 30,0 3,0 2,5 25,0 2,0 20,0 Dienstleistungsbilanz [in % des BIP] 1,5 15,0 10,0 1,0 Importe, Dienstleistungen [in % des BIP] 0,5 Exporte, Dienstleistungen [in % des BIP] 0,0 5,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 -0,5 0,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 -1,0 Quelle: Global Insight Quelle: Global Insight Im Bereich der Dienstleistungen musste in den vergangenen Jahren ein stetiges, hartnäckiges, wenn auch kleines Defizit verzeichnet werden. Der chinesische Dienstleistungssektor ist nach wie vor unterentwickelt, was diesen im internationalen Vergleich wenig wettbewerbsfähig macht. Die Dienstleistungsbilanz sollte daher auch in den kommenden Jahren weiterhin negativ bleiben. Allerdings gibt es von Seiten der chinesischen Regierung Initiativen um den Dienstleistungssektor zu stärken, was sich positiv auf die Dienstleistungsbilanz der kommenden Jahre auswirken könnte. Research Seite 18 13.02.2008 Einkommensbilanz Transferbilanz 1,40 2,50 Einkommensbilanz, netto Einkommensbilanz, Aktiva [in % des BIP] Einkommensbilanz, Passiva [in % des BIP] 2,00 Transferbilanz [in % des BIP] 1,20 Transferbilanz, Staat, netto [in % des BIP] 1,00 Transferbilanz, sonstige Sektoren, netto [in % des BIP] 1,50 1,00 0,50 0,80 0,00 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0,60 -0,50 0,40 -1,00 -1,50 0,20 -2,00 0,00 1996 -2,50 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 -0,20 -3,00 Quelle: Global Insight, IWF Quelle: Global Insight, IWF Die Einkommensbilanz hat sich aufgrund der zunehmenden Investitionen chinesischer Unternehmungen im Ausland und steigender Zinseinkünfte aus ausländischen Wertpapieren in den vergangenen Jahren systematisch verbessert. Zuvor wies die Einkommensbilanz aufgrund der Repatriierung von Gewinnen durch ausländische Direktinvestoren ein stetiges Defizit auf. Für die kommenden Jahre ist aufgrund der verstärkten Internationalisierung chinesischer Unternehmen und steigender Devisenreserven mit einer weiteren Verbesserung der Einkommensbilanz zu rechnen. Die Leistungsbilanz hat sich seit 2004 stetig verbessert. Wies diese im Jahr 2004 noch einen Überschuss im Ausmaß von knapp 37 Mrd. € oder 3,6% des BIP aus, so betrug der Überschuss im Jahr 2006 bereits rund 176 Mrd. € oder 9,5% des BIP. Für das Jahr 2007 wird ein leichter Rückgang auf rund 9,1% des BIP erwartet. Global Insight prognostiziert jedoch in weiterer Folge eine mehr oder weniger stetige Verschlechterung der Leistungsbilanz auf 1,7% des BIP bis zum Jahr 2011. Der Rückgang ergibt sich aus einer erwarteten Verschlechterung der Handelsbilanz. Ein wesentliches Risiko für diese Prognose stellt der weitere Verlauf der Weltkonjunktur und somit der ausländischen Nachfrage dar. Insgesamt bereitet die prognostizierte Entwicklung der Leistungsbilanz aber noch wenig Grund zur Sorge. Vielmehr kann von einer Normalisierung gesprochen werden. Leistungsbilanz Direktinvestitionen 5,0 12,0 Direktinvestitionen, netto [in % des BIP] Leistungsbilanz, netto [in % des BIP] Direktinvestitionen, Exporte [in % des BIP] Direktinvestitionen, Importe [in % des BIP] Handelbilanz [in % des BIP] 10,0 4,0 Dienstleistungsbilanz [in % des BIP] Einkommensbilanz, netto 8,0 Transferbilanz [in % des BIP] 3,0 6,0 2,0 4,0 2,0 1,0 0,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 -2,0 -1,0 -4,0 Quelle: Global Insight Quelle: Global Insight Die Direktinvestitionen nach China im Jahr 2006 beliefen sich auf rund 62,3 Mrd. €, was rund 3% des BIP entspricht. Seit 2003 zeigt sich erstmals ein deutlicher Trend hin zu Investitionen chinesischer Firmen im Ausland. Im Jahr 2006 beliefen sich diese bereits auf 14,2 Mrd. € oder 0,7% des BIP. Insgesamt ergibt sich daher für die Direktinvestitionsbilanz Chinas eine mehr oder weniger starke Abnahme im Überschuss gegenüber dem Rest der Welt. Dies ist auf die verstärkten Internationalisierungsbemühungen chinesischer Firmen zurückzuführen und die abnehmende relative Bedeutung ausländischer Direktinvestitionen in China. Die zunehmende Kapitalverkehrsliberalisierung und die Bemühungen der chinesischen Regierung die Bedeutung des Exportsektors zu reduzieren lassen eine Fortsetzung dieses Trends erwarten. Research Seite 19 13.02.2008 Eine deutliche Ausweitung der Portfolioinvestitionen der Chinesen zeigte sich in den vergangenen Jahren. Diese ergeben sich aus der zunehmenden Kapitalverkehrsliberalisierung und dem staatlich/strategischen Investitionsfonds. Auf der Verbindlichkeitsseite zeigt sich ebenfalls ein deutlicher Anstieg. Dieser ergibt sich großteils aus dem chinesischen Aktienboom und dem starken Zufluss aus dem Ausland in chinesische Aktien. Insgesamt zeigt sich ein deutlicher Überhang chinesischer Portfolioinvestitionen im Ausland im Vergleich zu Portfolioinvestitionen durch Ausländer in China. Chinas Devisenreserven haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen und sind inzwischen noch vor Japan, das bislang diese Stelle innehatte, weltweit die höchsten. Die Devisenreserven legten alleine im Jahr 2007 um mehr als 460 Mrd. USD auf 1528,2 Mrd. USD zu. Entsprechend dem starken Devisenzufluss betrug die Importdeckung, zur Abdeckung der zu leistenden Zahlungen für Importe (in Monaten), Ende 2007 knapp 17 Monate. Dies ist im internationalen Vergleich sehr hoch und beweist Chinas Fähigkeit, das bestehende Importniveau längere Zeit alleine durch die angesammelten Devisenreserven zu finanzieren. Devisenreserven Struktur Auslandsverschuldung 80 25 1.800 Außenverschuldung/Kreditvergabe Inland in % Devisenreserven [Mrd. USD] Auslandsschuld, gesamt in % des BIP 1.600 70 kurzfristige Auslandsschuld in % der Reserven 20 1.400 60 1.200 50 15 1.000 40 800 10 30 600 20 400 5 200 10 07 1993 1996 1999 2002 2005 20 05 04 06 20 20 03 20 20 01 00 02 20 20 20 98 99 97 Quelle: Global Insight 19 19 96 19 19 94 95 19 19 0 0 19 93 0 Quelle: Global Insight Die Außenverschuldung Chinas in Relation zum BIP hat sich in den letzten Jahren stark reduziert. Dies ist nicht verwunderlich, zumal China über eine außerordentlich hohe Sparquote verfügt und das Land entsprechend unabhängig von ausländischer Finanzierung ist. Seit 2002 befindet sich die Außenverschuldung in Relation zur inländischen Kreditvergabe unter 10% des BIP, die Auslandsverschuldung als Anteil am BIP stagnierte in den letzten Jahren im Bereich von 10-15% der Gesamtwirtschaftsleistung. Einen deutlichen Rückgang verzeichnete die kurzfristige Verschuldung in Relation zu den Devisenreserven. Dies ist aufgrund des hohen Handelsbilanzüberschusses Chinas und damit verbunden den rasch wachsenden Devisenreserven nicht verwunderlich. Die Risiken einer Zahlungsbilanzkrise sind damit als gering anzusehen. Eine verringerte Auslandsverbindlichkeit des Staates wurde teilweise durch eine verstärkte Verschuldung des privaten Sektors im Ausland kompensiert, der Privatanteil an den langfristigen Auslandsschulden Chinas ist entsprechend angestiegen. Research Seite 20 13.02.2008 Struktur langfristige Auslandsverschuldung Externer Schuldendienst 140 40% 120 35 14 Externe Schuldendienst [Mrd.€] - rechte Skala Externe Schuldendienstquote in % des BIP - linke Skala Externer Schuldendienst/Exporte [%] - linke Skala % Anteil Privat an langfr. Außenverschuldung rechte Skala Auslandsschulden, Privatsektor, langfristig [Mrd. €] - linke Skala Auslandsschulden, öffentlicher Sektor, langfristig [Mrd. €] - linke Skala 35% 12 30 10 25 8 20 6 15 4 10 2 5 30% 100 25% 80 20% 60 15% 40 10% 20 5% 0 0 0 0% 1993 1996 Quelle: Global Insight 1999 2002 1993 1996 1999 2002 2005 2005 Quelle: Global Insight Aufgrund der geringen Auslandsverschuldung und der hohen Bonität Chinas hat das Land nur einen verhältnismäßig geringen Schuldendienst zu leisten. Das Verhältnis Schuldendienstquote in Relation zu den Exporteinnahmen ist in den vergangenen Jahren nicht zuletzt aufgrund der enorm angestiegenen Exportleistung stark zurückgegangen. 2005 betrug diese lediglich 3,1% der Exporteinnahmen. Die Schuldendienstquote in Relation zum BIP belief sich im Jahr 2005 auf 1,2% des BIP, das ist im internationalen Vergleich minimal. Aufgrund der im internationalen Vergleich äußerst niedrigen Außenverschuldung in Relation zum BIP und dem geringen Aufwand für Schuldentilgungen in Relation zu den Exporteinnahmen scheint eine Krise ausgelöst durch abfließendes internationales Kapital sehr unwahrscheinlich. Im Fall Chinas ergibt sich eine Krise eher aus dem Unwillen des Auslandes chinesische Importe aufzunehmen oder der beschränkten Aufnahmefähigkeit für chinesische Güter. Historische Trends und Ausblick Exportsektor In den vergangenen Jahren wurde der wachsende Handelsbilanzüberschuss durch den absoluten Wettbewerbsvorteil Chinas (beinahe unerschöpflich, konkurrenzlos billiger Faktor Arbeit) und seiner Wechselkurspolitik begründet, welche darauf ausgelegt war die Exportchancen chinesischer Unternehmen im Ausland zu maximieren. Bedingt durch den derzeitigen Abschwung in den USA und Japan wird darüber diskutiert, inwieweit sich dies auf das chinesische Wachstum auswirken könnte. Entscheidend zur Beantwortung dieser Frage sind das Ausmaß und die Stabilität der chinesischen Export- und Importelastizität. Sind diese im Hinblick auf externe Nachfrageschocks oder internationaler Preise niedrig, dann hat eine Änderung der externen Bedingungen, wie beispielsweise eine Wachstumsabschwächung im Ausland oder sich ändernde Wechselkurse, nur einen geringen Effekt auf Chinas Wirtschaftswachstum und seinen Handelsbilanzüberschuss. Nach einem Jahrzehnt kräftigen Wachstums ist China nun, hinter den USA und Deutschland, der 3. größte Exporteur weltweit. Research Seite 21 13.02.2008 Chinas Exporte (USA, Japan, EU, ASEAN) 500 in Mrd. € 450 Exporte ASEAN 400 Exporte Japan Exporte European Union Exporte USA 350 300 250 200 150 100 50 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Quelle: Global Insight Aufgrund eines rapiden Exportwachstums und einer rückläufigen Dynamik im Importwachstum hat sich gleichzeitig der Handelsbilanzüberschuss stark ausgeweitet. Weltmarktanteile in % Wachstumsraten Außenhandel (% J/J) Quelle: IMF Working Paper (WP/07/266) China’s Changing Trade Elasticities, Jahangir Aziz, Xiangming Li, November 2007 Die wirtschaftliche Liberalisierung und Deregulierung, Privatisierung und der große Zustrom an Direktinvestitionen haben den Anteil der verstaatlichten Kombinate am Gesamtexport Chinas in den letzten Jahren stark reduziert. Betrug der Anteil dieser im Jahr 1995 noch rund 2/3, ist dieser bis 2006 auf rund 20% zurückgegangen. Exporte nach Eigentümerstatus (in %) Importe nach Eigentümerstatus (in %) Quelle: IMF Working Paper (WP/07/266) China’s Changing Trade Elasticities, Jahangir Aziz, Xiangming Li, November 2007 Betrachtet man die Zusammensetzung der Exporte zeigt sich, dass der Anteil der preisunelastischen Exportgüter, wie beispielsweise Grundstoffe, zwischen 1995 und 2006 von 15% auf nur noch 3% zurückgegangen ist, jene typischerweise preissensitive Wirtschaftsgüter, wie beispielsweise Maschinen und Elektronik, im selben Zeitraum von 20% auf 60% angestiegen ist. Research Seite 22 13.02.2008 Zusammensetzung der Exporte Zusammensetzung der Importe Quelle: IMF Working Paper (WP/07/266) China’s Changing Trade Elasticities, Jahangir Aziz, Xiangming Li, November 2007 Innerhalb der einzelnen Güterkategorien zeigt sich auch eine starke Tendenz hin zu höherwertigeren Produktion, wobei sich zeigt, dass diese ebenfalls eine höhere Preiselastizität als Low-Techprodukte aufweisen. Sophistikation-Index Exporte Sophistikation-Index für gesamten Außenhandel Quelle: IMF Working Paper (WP/07/266) China’s Changing Trade Elasticities, Jahangir Aziz, Xiangming Li, November 2007 Quelle: IMF Working Paper (WP/07/214): The Shifting Structure of China’s Trade and Production, Li Cui and Murtaza Syed, September 2007 Einen starken Wandel gab es in den vergangenen Jahren im Handel mit chinesischen Veredelungsprodukten. China galt in den 90ern noch als eine verlängerte Werkbank, welche komplexe Inputs importierte und diese zu Konsumgütern für westliche Absatzmärkte verarbeitete. Geänderte Wechselkurse bzw. die globale Nachfrage hatten in diesem Modell nur einen geringen Einfluss auf die chinesische Handelsbilanz. Sinkende Exporte aufgrund einer nachlassenden Weltkonjunktur oder aufgrund einer Aufwertung des Yuan zogen automatisch einen geringeren Bedarf nach importierten Gütern nach sich, was die Handelsbilanz und das Wirtschaftswachstum stabilisierten. Dies garantierte dem chinesischen Wirtschaftsmodell bislang hohe und vor allem stabile Wirtschaftswachstumsraten. Zwar liegt der Anteil des Handels mit Verarbeitungsgütern nach wie vor bei rund 50% der Exporte, der Anteil der klassischen Assemblyexporte fiel bis 2006 jedoch auf rund 10%, eine Halbierung gegenüber 1992. Der Inlandsanteil an Nicht-Assembly Verarbeitungsexportgütern stieg im selben Zeitraum jedoch von 20% auf 35%. Research Seite 23 13.02.2008 Entwicklungen Processing Trade (in %) Quelle: IMF Working Paper (WP/07/266) China’s Changing Trade Elasticities, Jahangir Aziz, Xiangming Li, November 2007 Gleichzeitig drangen die chinesischen Exporteure in höherwertige Produktkategorien vor, welche auch zunehmend mittels inländischen Inputfaktoren hergestellt werden konnten. Der zunehmende Anteil inländischer Inputs an den Endprodukten hat ebenfalls die Reagibilität der Produzenten im Hinblick auf Wechselkursschwankungen erhöht. Bei einem niedrigen Inlandsanteil an den verarbeitenden Exportgütern hat eine Wechselkursaufwertung nur einen geringen Einfluss auf den Export da dieser negative Effekt inputseitig über eine verringerte Importrechnung weitestgehend kompensiert werden kann. Dieser gegenläufige Effekt reduziert sich jedoch mit zunehmendem Inlandsanteil bei den Inputfaktoren. Daneben hat sich auch der Anteil der Maschinenbaugüter an den gesamten verarbeitenden Gütern mehr als verdoppelt. Da der Absatz industrieller Güter stärkeren konjunkturellen Zyklen unterworfen ist als beispielsweise jener der Konsumgüter, erhöht dies zusätzlich die Sensitivität der chinesischen Exporte im Hinblick auf die relativen Preisniveaus (= realer Wechselkurs) und der ausländischen Nachfrage. Sektorale Zusammensetzung der Processing Exporte Quelle: IMF Working Paper (WP/07/266) China’s Changing Trade Elasticities, Jahangir Aziz, Xiangming Li, November 2007 Die Verschiebung von Assembly basierten Gütern hin zu hochwertigen Gütern hat auch eine Veränderung der regionalen Handelsbilanzen zur Folge. Hatte China früher aufgrund der Einfuhr von Halbfertigwaren ein hohes Handelsbilanzdefizit gegenüber der Region Südostasien, so ist dieses seit einiger Zeit wieder tendenziell rückläufig. Research Seite 24 13.02.2008 Chinas regionale Handelsbilanz (in Mrd. USD) Quelle: IMF Working Paper (WP/07/266) China’s Changing Trade Elasticities, Jahangir Aziz, Xiangming Li, November 2007 Der IWF4 stellte im November 2007 fest, dass sich die aggregierte Exportelastizität des Landes aufgrund der geänderten Zusammensetzung der Exportgüter, besonders im Hinblick auf die Hochwertigkeit der chinesischen Exportgüter, signifikant erhöht habe. Damit wird die chinesische Wirtschaft schwankungsanfälliger und abhängiger von Weltkonjunktur und realen Wechselkurs. Das Arbeitspapier des IWF geht davon aus, dass sich die Elastizität im Hinblick auf die ausländische Nachfrage im Zeitraum 2000-2006 im Vergleich zum Zeitraum 1995-1999 auf 4,3 von ursprünglich 3,6 und die Preiselastizität sich entsprechend von -1,3 auf -2 erhöht haben. Die folgenden Abbildungen zeigen rollierende Regressionen für unterschiedliche Elastizitäten. Absolut betrachtet hat sich die Exportelastizität im Hinblick auf die ausländische Nachfrage sowie dem relativen Preisniveaus stark erhöht. Die Importelastizitäten im Hinblick auf die inländische Nachfrage und das relative Preisniveau zeigen jedoch nur eine geringe Veränderung im selben Zeitraum, was mit der nur geringen Veränderung in der Importzusammensetzung in Übereinstimmung gebracht werden kann. Der Rückgang in der Importelastizität als Funktion der inländischen Nachfrage ist auf den zunehmenden Einsatz inländischer Inputfaktoren (Kapital, Arbeit, Halbfertigwaren) zurückzuführen. Nachfrageexportelastizität Exportelastizität als Funktion des realen Wechselkurses Quelle: IMF Working Paper (WP/07/266) China’s Changing Trade Elasticities, Jahangir Aziz, Xiangming Li, November 2007 4 IMF Working Paper (WP/07/266): China’s Changing Trade Elasticities, Jahangir Aziz, Xiangming Li, November 2007 Research Seite 25 13.02.2008 Importelastizität als Funktion der inl. Nachfrage Importelastizität als Funktion der relativen Preise Quelle: IMF Working Paper (WP/07/266) China’s Changing Trade Elasticities, Jahangir Aziz, Xiangming Li, November 2007 Innerhalb der einzelnen Branchen zeigen sich stark unterschiedliche Elastizitäten. Die Exportelastizitäten sind stärker ausgeprägt als die Importelastizitäten, wobei die Exportelastizitäten am stärksten in den Sektoren Industriegüter, Maschinenbau und Elektro-/Elektronik ausgeprägt sind. Diese sind am niedrigsten im Bereich der Grundstoffe. Sektorale Handelselastizität als Funktion der Nachfrage Sektorale Elastizität des Handels als Funktion der Preise Quelle: IMF Working Paper (WP/07/266) China’s Changing Trade Elasticities, Jahangir Aziz, Xiangming Li, November 2007 Aus der gestiegenen Nachfrageelastizität der chinesischen Exportgüter ergibt sich eine stärkere Abhängigkeit der chinesischen Wirtschaft bezüglich der Weltkonjunktur. Ein 1%-iger Rückgang in der externen Nachfrage hätte demnach einen 4½ Prozent-Rückgang in den chinesischen Exporten beziehungsweise einen Rückgang von 0,75 Prozentpunkten im Bruttoinlandsprodukt zur Folge. Aus der gestiegenen Exportpreiselastizität ergibt sich implizit, dass eine Reduktion in den Exporten einer verringerten realen Aufwertung bedarf (Exportpreiselastizität: 1995−1999: -1.3; 2000−2006: -2). Es zeigt sich, dass der Effekt eines globalen Nachfragerückgangs weit stärker wiegt als eine Änderung des realen Wechselkurses. 3.5 Staatsverschuldung Das Staatsbudget verzeichnete im Jahr 2006 mit 148,3 Mrd. Yuan ein leichtes Defizit von 0,7% des BIP. Laut chinesischem Finanzministerium lagen die Staatseinnahmen im Jahr 2006 bei 3.873,1 Mrd. Yuan (~18,5% des BIP). Dies waren 9,3% mehr als zunächst budgetiert und 769,4 Mrd. Yuan oder 24,3% mehr als im Jahr 2005. Die Staatsausgaben beliefen sich im Jahr 2006 auf 4.021,3 Mrd. Yuan (19,2% des BIP), 4,8% höher als zunächst budgetiert und 628,3 Mrd. Yuan oder 18,5% höher als im Jahr 2005. Laut Finanzministerium wird das Defizit mit 245 Mrd. Yuan budgetiert, wobei sich die Research Seite 26 13.02.2008 Staatseinnahmen demnach auf 4.406.5 Mrd. Yuan (18,3% des BIP) und die Staatsausgaben auf 4,651,5 Mrd. Yuan (19,3% des BIP) belaufen sollen. Für das Jahr 2007 wird ein leicht höheres Budgetdefizit von 0,9% des BIP erwartet. Es gilt jedoch zu berücksichtigen, dass in diesem Budget nicht die staatlichen, oftmals verlustträchtigen Großbetriebe enthalten sind. Diese finanzieren ihren Betrieb durch die Aufnahme von Krediten im staatlichen Bankensektor. Das offizielle Budgetdefizit fällt daher geringer aus als das tatsächliche. Budgetdefizit 1,0 0,5 Budgetdefizit in % des BIP - linke Skala 0,0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 Quelle: Global Insight Die chinesische Staatsverschuldung in Prozent des BIP war Ende 2006 im internationalen Vergleich mit 16,9% des BIP äußerst niedrig. Der Anteil der Zinszahlungen am Staatshaushalt ist sehr niedrig. Dies ergibt sich zum einem aus der geringen Verschuldung und zum anderem aus dem niedrigen Zinsniveau. Allerdings wird diese niedrige Verschuldung des Staates bei Berücksichtigung der Sozialversicherungssysteme erheblich schlechter. Unter einer langfristigen Perspektive ist dieses Defizit kritisch zu hinterfragen. Zum einem entstehen dem chinesischen Sozialsystem aufgrund der rapiden Überalterung langfristig ein Finanzierungsproblem, zum anderen beruht das chinesische Wirtschaftswachstum zu einem Gutteil auf dem Raubbau an der Umwelt. Die Beseitigung der Folgen der Umweltzerstörung wird längerfristig jedoch zu höheren Kosten führen, welche den Staatshaushalt dann verschlechtern sollten. 3.6 Private Verschuldung Die inländische Verschuldung in Relation zum Bruttoinlandsprodukt ist für ein Schwellenland außerordentlich hoch. Die hohe Verschuldung ergibt sich hauptsächlich aus den in der Vergangenheit vergebenen Krediten zur Stützung der Staatswirtschaft und der hohen Sparquote. Demgegenüber ist der Kreditanteil der privaten Haushalte an den Gesamtausleihungen weit geringer. Die gesamten Aktiva des Bankensystems lagen Ende 2007 noch immer bei mehr als 200% des BIP, was international gesehen außerordentlich hoch ist. Die Kreditwachstumsraten haben seit 2005 stark an Dynamik gewonnen. Im September 2007 legten die Forderungen der Banken gegenüber dem Privatsektor auf Jahressicht um 19,5% zu, die entsprechende Inlandskreditvergabe stieg um 17,3% J/J. Research Seite 27 13.02.2008 Kreditvolumen Kreditwachstum 3500 30 50 Inlandskredit [Mrd. €] - linke Skala Kreditwachstum % J/J - rechte Skala Forderungen ggü. Privatsektor [% p.a.] 45 Inlandskreditvergabe [% p.a.] 3000 25 40 2500 35 20 30 2000 15 1500 25 20 10 15 1000 10 5 500 5 0 0 0 1993 1996 1999 2002 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2005 Quelle: Global Insight Quelle: Global Insight Die Verschuldung der privaten Haushalte bei Banken lag im Jahr 2006 bei über 110% des BIP. Die Verschuldung des privaten Sektors in Relation zum BIP war im Jahr 2005 aufgrund der hohen Ersparnisse der chinesischen Haushalte und der privaten Unternehmen mit 2,3% des BIP im internationalen Vergleich äußerst niedrig, was die Verschuldung der privaten Haushalte bei Banken aus Sicht der Risikoeinschätzung relativiert. Verschuldung privater Sektor 140 4,0 Verschuldung des priv. Sektors bei Banken [in % des BIP] -- linke Sk. Verschuldunsgrad des privaten Sektors [% des BIP] - rechte Sk. 3,5 120 3,0 100 2,5 80 2,0 60 1,5 40 1,0 20 0,5 0,0 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005 Quelle: Global Insight 3.7 Stabilität Trotz enormen Wirtschaftswachstums, steigender Rohstoffkosten (insbesondere Rohöl) und hohen Geldmengenwachstums befand sich die Verbraucherpreisinflation in den letzten Jahren auf sehr niedrigem Niveau. Dies lässt sich mit dem Aufbau enormer Überkapazitäten im industriellen Bereich und hohem Produktivitätswachstum erklären. Bedingt durch die Überkapazitäten fiel es den chinesischen Betrieben, vor allem in den boomenden Bereichen Stahl, Aluminiumerzeugung, Zement und Kupfer in den vergangenen Jahren äußerst schwer, gestiegene Kosten auf ihre Kunden zu überwälzen. Gestiegene Rohstoffkosten konnten von den Unternehmen durch hohe Arbeitsproduktivitätsfortschritte und verbesserte technische Effizienz im Ressourceneinsatz weitgehend kompensiert werden. Daneben wurde die Inflation durch zahlreiche staatlich administrierte Höchstpreise, welche weit unter dem Weltmarktniveau liegen, hintangehalten. Der Inflationsdruck hat sich seit Mitte 2006 spürbar verschärft. Im November 2007 erreichte die Teuerungsrate ihren vorläufigen Spitzenwert von 6,9% J/J. Die jüngste Inflationsentwicklung ist jedoch nicht ausschließlich auf eine überhitzte Wirtschaft mit hohem Auslastungsgrad zurückzuführen, sondern liegt primär in der Angebotsseite von landwirtschaftlichen Produkten begründet. Die Überkapazitäten im industriellen Bereich erzeugen nach wie vor einen deflationären Sog. Der weltweite Bioenergieboom und lokale Dürren haben zuletzt zu einem starken Anstieg im Preis von Soja, Reis und Getreide geführt. Daneben haben sich die Fleischpreise in China in den vergangenen Monaten drastisch erhöht. Da dies ein vorübergehendes Phänomen zu sein scheint, ist jedoch Research Seite 28 13.02.2008 mittelfristig wieder mit einem Nachlassen des Preisdrucks zu rechnen. Während der Konsumentenpreisindex sich in den ersten 11 Monaten des Jahres 2007 lediglich um 4,6% J/J erhöht hat, stiegen die Lebensmittelpreise im selben Zeitraum um 18,2% J/J an. Hierbei ist auch zu bedenken, dass die Nahrungsmittel im Güterkorb der chinesischen Haushalte einen weit höheren Anteil besitzen als dies in westlichen Industrieländern der Fall ist. Premierminister Wen Jiabao kündigte im Januar 2007 die Absicht der Regierung an, die Preise für Ölprodukte, Erdgas und Elektrizität in naher Zukunft einfrieren zu wollen, um so die Inflation einzudämmen. Die Regierung beabsichtige bestimmte Preise, falls notwendig, nach oben zu begrenzen und die Erhöhung von Gebühren des öffentlichen Verkehrs und für die Schulen einzufrieren und Schritte gegen etwaige Preismanipulationen zu setzen. Jedoch wurde nicht spezifiziert, wie lange diese Maßnahmen bestehen bleiben sollen. Dies ist der erste Schritt in Richtung staatlicher Festsetzung der Preise seit Anfang der 90er. Verbraucherpreise Prognose 30 8 Inflation [% J/J] 7 25 6 5 20 Prognose 4 15 3 2 10 1 5 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 -1 20 01 20 00 0 0 -2 Quelle: Global Insight 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 Quelle: Gloabl Insight Global Insight sieht die Inflationsrate im Jahr 2008 im Jahresschnitt aufgrund der hohen Nahrungsmittelpreise weiter auf 5,8% J/J (2007: 4,8%) steigen. Diese sollte sich in den nächsten Jahren nur langsam zurückbilden. Für 2012 wird eine Inflationsrate von 3,5% J/J prognostiziert. Die Inflation sollte auch aufgrund der stetigen Aufwertung des Yuan gegenüber dem Dollar aufgrund niedrigerer Importkosten tendenziell wieder abnehmen. Die chinesische Währung (Renmimbi) war bis Mitte 2005 mit einem fixen Wechselkurs von 8,28 an die US-Währung angebunden. Nicht zuletzt aufgrund des heftigen Drucks seitens der US-Regierung hat die chinesische Notenbank den Wechselkurs freigegeben, dieser wertet seither graduell gegenüber dem US-Dollar auf. Der Aufwertungstrend erfolgt allerdings äußerst zögerlich und nicht in dem Ausmaß, wie dies oft von anderen Ländern gefordert wird. Aufgrund der Bindung an den USDollar und der vergleichsweise niedrigen chinesischen Inflationsrate hat die chinesische Währung in den vergangenen Jahren real gegenüber ihren Haupthandelspartnern ständig abgewertet. Dadurch sind auch chinesische Produkte zunehmend wettbewerbsfähiger geworden. Zuletzt hat der Druck von Seiten der USA, nicht zuletzt aufgrund der stark gestiegenen Importpreise, die chinesische Währung aufzuwerten etwas nachgelassen, während sich der politische Druck von europäischer Seite aufgrund des wachsenden Handelsdefizits mit China erhöht hat. Gegenüber dem Euro ergab sich aufgrund der Dollarschwäche sogar eine Abwertung der chinesischen Währung in den vergangenen Jahren. Aufgrund der zuletzt hohen chinesischen Inflation scheint sich der Widerwille von chinesischer Seite gegen eine Aufwertung der Landeswährung etwas reduziert zu haben. Im Dezember 2007 verzeichnete die Währung gegenüber dem Dollar die stärkste Aufwertung seit Einführung des crawling peg im Juli 2005. Research Seite 29 13.02.2008 Wechselkurse Prognose 12,0 12 10,0 10 8,0 8 6,0 6 4,0 4 Prognose 2,0 2 Wechselkurs zu EURO, Periodenende [Einheiten pro €] Wechselkurs zu EURO [Einheiten pro €] Wechselkurs zu USD, Periodenende [Einheiten pro USD] Wechselkurs zu USD [Einheiten pro $] 07 06 20 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 20 04 05 20 03 20 20 01 02 20 00 20 20 98 99 19 19 97 96 19 19 94 95 19 19 0 19 93 0,0 Quelle: Global Insight Quelle: IWF Ein rascherer Aufwertungstrend gilt in den nächsten Monaten als wahrscheinlich, zumal dies dazu beitragen sollte die überhitzte Wirtschaft abzukühlen bzw. die Inflationsentwicklung abzuschwächen. Sollte sich die Weltwirtschaft in den kommenden Quartalen stärker als erwartet abschwächen und sich auch die chinesische Wirtschaft spürbar abschwächen, ist mit einer Verlangsamung des Aufwertungstrends zu rechnen. Global Insight sieht den nominellen Wechselkurs zum US-Dollar bis 2011 graduell bis auf 6,03 Yuan pro US-Dollar aufwerten. Bei einer Erholung des Dollars gegenüber dem Euro ergäbe sich gegenüber dem Euro in den kommenden Jahren sogar eine noch stärkere Aufwertung des Yuans als gegenüber der US-Währung. Bis 2011 würde der Wechselkurs demnach auf 8,35 Yuan pro Euro sinken. Die Entwicklung der Geldmengenaggregate verlief in den letzten Jahren sehr volatil, jedoch durchwegs mit hohen 2-stelligen Wachstumsraten. Trotz der Dämpfungsmaßnahmen der chinesischen Behörden hat sich die Wachstumsdynamik zwischen September 2006 und November 2007 deutlich erhöht. Das hohe Wachstum ergab sich aus den hohen Devisenzuflüssen und der zunehmenden Kreditaufnahme im Inland. Im November 2007 wuchs diese mit einer Jahresrate von 18,45%, verzeichnete aber im Dezember erstmals überraschend einen deutlichen Einbruch auf 16,7% J/J. Geldmenge Geldmengenmultiplikator 14 24 Geldmultiplikator (M2/M0) [in %] 14 4 12 2 10 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20 20 20 20 20 02 20 20 Quelle: Global Insight 07 6 06 16 05 8 04 18 03 10 01 20 20 12 00 Geldmenge M2 [% J/J] 22 Quelle: Global Insight Entsprechend dem rapiden Geldmengenwachstum und der hohen Kreditvergabe hat sich der M2Multiplikator in den letzten Jahren stark erhöht. Das Verhältnis des Geldmengenaggregats M2 zu Devisenreserven (M2/R) ist in den vergangenen Jahren aufgrund des enormen Kreditwachstums stark angestiegen, was üblicherweise eine erhöhte Krisenwahrscheinlichkeit anzeigt. Da das starke Geldmengenwachstum jedoch überwiegend durch stark steigende inländische Kreditvergabe gespeist wird, relativiert sich die Aussagekraft dieses Indikators etwas. Research Seite 30 13.02.2008 Geldmenge M2/Devisenreserven Kreditwachstum 30 1400 Geldmenge M1/ Devisenreserven [in %] Kreditwachstum % J/J Geldmenge M2/Devisenreserven [in %] 1200 25 1000 20 800 15 600 10 400 5 200 0 0 1993 1996 Quelle: Global Insight 1999 2002 1994 2005 1997 2000 2003 2006 Quelle: Global Insight Eine Verringerung des Kreditwachstums ist bislang kaum zu beobachten. Nachdem sich das Kreditwachstum zwischen 2004 und 2006 deutlich beschleunigte, ging im Jahr 2007 die Dynamik nur minimal auf 16,1% J/J zurück. 3.8 Geldpolitik und Finanzmarkt Geldpolitik Struktur Die chinesische Geldpolitik zielt primär auf die Steuerung des Wechselkurses zum US-Dollar und die Geldmenge. Als Steuerungsinstrumente werden hier sehr direktgreifende Maßnahmen wie Kredithöchstgrenzen und die Mindestreserveerfordernis für Finanzinstitute verwendet. Seit 1999 gibt es zudem indirekte Mittel wie Offenmarktoperationen zur Steuerung der Geldmenge und der Liquidität. Aktuelle Entwicklung Die chinesische Zentralbank verkündete am 20. Dezember 2007 einen weiteren Zinsschritt, welcher ab dem darauffolgenden Tag effektiv wurde. Der 1-jährige Kreditzins wurde durch die People’s Bank of China (PBoC) auf 7,47 % von zuvor 7,29% angehoben. Seit Jahresbeginn 2007 wurde dieser 6 Mal um insgesamt 135 Basispunkte erhöht. Für Kredite mit längeren Laufzeiten und Hypothekenkrediten blieben die Zinssätze unverändert. Im Jahr 2007 war dies der sechste Zinsschritt nach oben und der erste Zinsschritt, nachdem die Notenbank ihren geldpolitischen Kurs von „prudent“ auf monetäre Straffung änderte. Am deutlichsten fiel die Zinsanhebung bei Spareinlagen mit einer Laufzeit kleiner als 1 Jahr aus. Gleichzeitig wurde jedoch der Zinssatz für Sichteinlagen um 9 Basispunkte reduziert! Der Zinsschritt mit der relativen stärkeren Anhebung der Einlagensätze zeigt, dass die Notenbank nun stärker fokussiert ist die Inflation durch höhere Sparanreize einzudämmen als über höhere Kreditzinsen den überhitzten Investitionssektor zu dämpfen. Research Seite 31 13.02.2008 Zinssatzänderung am 21. Dezember 2007 durch People's Bank of China Einlagensätze 3 Monate 6 Monate 1 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre Kreditsätze 6 Monate 1 Jahre 1-3 Jahre 3-5 Jahre > 5 Jahre Hypothekensätze < 5 Jahre > 5 Jahre Veränderung zuletzt 0,45 0,36 0,27 0,18 0,18 0,09 3,33 3,78 4,14 4,68 5,40 5,85 0,09 0,18 0,09 0,09 0 6,57 7,47 7,56 7,74 7,83 0 0 4,77 5,22 Der Mindestreservesatz wurde zuletzt am 25. Januar 2008 um 0,5 Prozentpunkte erhöht und soll etwa 190 Mrd. Yuan aus dem Bankensystem entziehen. Dies war die 11. Anhebung seit Jahresbeginn 2007. Insgesamt wurde die Mindestreserve damit seit Beginn 2007 um 600 Basispunkte auf 15% angehoben und ist auf einem historischen Spitzenwert angelangt. Gleichzeitig wurden für das Jahr 2008 Kreditobergrenzen angekündigt. Ausblick Es bleibt fraglich, ob die zuletzt ergriffene Anhebung der Einlagezinsen den gewünschten Effekt einer Inflationsabschwächung hat. Bei der gegenwärtig hohen Inflation von rund 7% und Einlagezinssätzen im Bereich von 3,33% – 5,85%, ergibt sich für Sparer eine negative Realverzinsung, was die Attraktivität von Sparen signifikant reduziert und Alternativen, wie beispielsweise den Aktienmarkt, attraktiver erscheinen lässt. Gleichzeitig bleibt fraglich, ob eine angebotsinduzierte Inflation durch Zinsanhebungen effektiv unterbunden werden kann bzw. soll. Auf der Kreditseite sind die Opportunitätskosten für Investitionsprojekte in Form von Kreditzinsen ebenfalls sehr gering. Bei einem nominellen BIP-Wachstum von über 15% ergibt sich ebenfalls eine stark negative reale Verzinsung, was den Anreiz für Investitionen tendenziell erhöht. Da der chinesische Kapitalmarkt bislang noch weitgehend unterentwickelt ist und sich die Betriebe weitgehend durch einbehaltene Gewinne refinanzieren, ist die chinesische Wirtschaft bislang nur wenig zinssensitiv. Mehr als die Hälfte aller Investitionen erfolgt über einbehaltene Gewinne. Ein weiterer Grund für die fehlende Zinssensitivität dieser Unternehmungen sind auch die mangelnden Investitionsalternativen. Aufgrund der hohen Reserven der chinesischen Banken wurden die mehrmaligen Anhebungen der Mindestreserve bislang nicht schlagend. Es bleibt fraglich, ob die letzten Schritte durch die PBoC den gewünschten Erfolg zeigen werden. Die beste Methode die Investitionen und die Inflation zu bremsen und gleichzeitig die Wirtschaft auf ein binnengetriebenes Wachstum umzustellen, wäre daher eine stärkere Aufwertung der Landeswährung gegenüber den Haupthandelspartnern zuzulassen. Die zuletzt gesetzten Schritte, wie die beobachtete beschleunigte Aufwertungstendenz des Yuans, scheinen auch darauf hinzudeuten, dass dies politisch gewollt sei. Der PBoC entfiele die Aufgabe ständig die steigende Geldmenge zu sterilisieren. Eine Aufwertung würde darüber hinaus die Agrarimporte verbilligen und so die Teuerung im Bereich der Lebensmittel dämpfen. Research Seite 32 13.02.2008 Finanzmarkt China 2007M7 2007M8 2007M9 2007M10 Devisenreserven [Mrd. USD] 1.385,20 1.408,64 1.433,61 1.455,00 Wechselkurs zu EURO, Periodenende [Einheiten pro €] 10,38 10,34 10,64 10,78 10,92 10,75 Wechselkurs zu USD, Periodenende [Einheiten pro USD] 7,57 7,55 7,51 7,46 7,40 7,30 Geldmarktzins [% p.a] 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 Realzinsen, kurzfristig [% p.a.] 1,26 0,65 1,03 0,68 0,32 0,51 Rendite Staatsanleihen, langfristig [% p.a] 7,38 7,56 7,83 7,83 7,83 7,83 2007M11 2007M12 1.528,20 Quelle: Global Insight Geld- und Anleihenmarkt Der chinesische Anleihemarkt gilt derzeit noch als klein und unterwickelt. In Verhandlungen erzielten im Dezember 2007 die USA und China die Übereinkunft, dass es künftig ausländischen Unternehmen gestattet ist, Aktien und Anleihen am chinesischen Markt zu emittieren. Dies ist aufgrund der enormen Sparquote der Chinesen und den bislang unzureichenden Sparalternativen vor allem im Anleihenbereich interessant und könnte in den kommenden Jahren zu einer spürbaren Belebung des chinesischen Anleihemarkts führen. Zinsen und Renditen seit 1992 Zinsstrukturkurve – Staatliche Nullkuponanleihen 18 5 Geldmarktzins [% p.a] 16 Rendite Staatsanleihen, langfristig [% p.a] 4,5 Einlagezinssatz [in %] 14 Kreditzins [in %] 12 4 10 8 3,5 6 3 4 2 2,5 1 Quelle: Global Insight 20 06 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Laufzeit 20 07 20 05 20 03 20 04 20 01 20 02 20 00 19 99 19 98 19 97 19 96 19 95 19 94 19 93 0 Quelle: Reuters Der chinesische Anleihenmarkt ist bei den kurzlaufenden Anleihen durch eine normale Zinskurve und bei den langlaufenden Anleihen durch eine inverse Struktur geprägt. Im 2-jährigen Bereich ist die Rendite mit derzeit5 3,70% sehr niedrig. Der Zinswendepunkt ergibt sich bei 11-jährigen Anleihen mit einer Rendite von 4,62%. Die Rendite von Nullkuponanleihen mit 20 Jahren Restlaufzeit beträgt derzeit 4,31%. 5 24. Januar 2008 Research Seite 33 13.02.2008 Aktienmarkt Aktienindices Shanghai A und B seit 1993 450 7000 Shanghai B-Share Index - linke Sk. Shanghai A-Share Index - rechte Sk. 400 6000 350 5000 300 250 4000 200 3000 150 2000 100 1000 50 Ja n. 06 Ja n. 07 Ja n. 08 Ja n. 04 Ja n. 05 Ja n. 01 Ja n. 02 Ja n. 03 Ja n. 99 Ja n. 00 Ja n. 96 Ja n. 97 Ja n. 98 0 Ja n. 94 Ja n. 95 Ja n. 92 Ja n. 93 0 Trotz Rekordwirtschaftswachstums gehörte der chinesische Aktienmarkt 2004 und 2005 zu den schwächsten weltweit. Dies lag unter anderem an der Flut von Erstemissionen, der Sorge über einen erneuten Ausbruch der Vogelgrippe, dem Handelsstreit über Textileinfuhren nach Europa und den USA, den staatlichen Maßnahmen zur Dämpfung des Wirtschaftswachstums und vor allem den Beschränkungen für ausländische Investoren. Das Börsenklima hat sich jedoch seit Jahresanfang 2006 erheblich verbessert. Quelle: Reuters In weiterer Folge kam es aufgrund der Chinaeuphorie im Ausland und dem dadurch bedingten Kapitalzufluss aber auch aufgrund der mangelnden Geldanlagealternativen in China selbst zu einem explosionsartigen Anstieg der Aktienkurse am Aktienmarkt in Shanghai und Shenzen. Die Bewertung der chinesischen Aktien in Hongkong, wo Ausländer die Möglichkeit haben H-Aktien zu erwerben, blieb dagegen relativ moderat. Chinesen war es bislang nicht erlaubt H-Aktien zu erwerben. Im Herbst 2007 zogen aber auch hier die Kurse deutlich an, nachdem am Markt über eine Liberalisierung dieser Bestimmungen spekuliert wurde. H-Aktien notieren nach wie vor mit einem starken Diskont gegenüber den A- und B-Aktien. Die chinesischen Indizes zählten 2007 zu den stärksten Indizes weltweit. Bereits 2006 konnten Abzw. B-Aktien in Shanghai um 130,6% bzw. 110% zulegen und im Jahr 2007 verzeichneten diese Indices einen weiteren Anstieg von 96% bzw. 181%. Ihre bislang historischen Höchststände ereichten die Indices im Oktober 2007. Seit dem Höchststand von 6196,97 Punkten hat der Shanghai A-Aktien Index bis Mitte Januar 2008, nicht zuletzt aufgrund der weltweiten Kreditkrise, jedoch mehr als 20% verloren. Der Shanghai B-Aktien Index hat ebenfalls von seinem Höchststand von 384,12 bis Mitte Januar 2008 mehr als 20% an Wert verloren. Belastet wurde der Markt im Januar 2008 auch durch die Gerüchte wonach auch chinesische Banken aufgrund ihres Engagements am amerikanischen Hypothekenmarkt Milliardenabschreibungen vorzunehmen hätten. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis der Indizes Shanghai SE Composite, Shanghai SE A-Shares, Shanghai SE B-Shares und Hang Seng China Enterprise Index für 2008 liegt derzeit bei 42,76 bzw. 37,1; 78,13 und 17,68.6 Der Aufschlag der in China notierten Aktien gegenüber den in Hongkong gelisteten Aktien erreichte im Januar 2007 mit 100% ein Rekordniveau und gilt als Indikator für spekulative Exzesse am chinesischen Aktienmarkt. Die Marktkapitalisierung der A-Aktien in Shanghai belief sich Ende Dezember 2007 auf rund 26.850 Mrd. Yuan (~€ 2.500 Mrd.). Dies sind rund 105% der chinesischen Wirtschaftsleistung im Jahr 2007. Die entsprechende Marktkapitalisierung der B-Aktien belief sich auf 134 Mrd. Yuan (~ €12,5 Mrd.). Ende Dezember 2007 notierten an der Shanghaier Börse 850 A-Aktien und 54 B-Aktien. Der starke Kursanstieg hat die Marktkapitalisierung chinesischer Unternehmen dermaßen gesteigert, dass sich nun etliche chinesische Firmen unter den teuersten der Welt befinden. Im November 2007 war PetroChina die erste Aktie weltweit die jemals die 1000 Mrd. USD Marke an Marktkapitalisierung überschreiten konnte. Neben Petrochina haben sich auch die Aktien der Unternehmen China Life, Sinopec, ICBC, China Mobile zu internationalen Schwergewichten entwickelt. 6 Bloomberg 23.1.2008 Research Seite 34 13.02.2008 Im Januar 2008 gab die China Securities Regulatory Commission bekannt, dass die Schaffung eines Wachstumssegments ähnlich der amerikanischen Nasdaq im ersten Halbjahr 2008 geplant sei. Der zu schaffende Markt zielt dabei auf kleine, innovative Unternehmungen ab und erfordert weniger Auflagen als am Standardmarkt. Um gelistet werden zu dürfen ist ein Grundkapital von mindestens 30 Mio. Yuan (~ USD 4,2 Mio.) erforderlich. Aufgrund der inzwischen hohen Bewertung der Aktien am Festland und eines Abflauens der Gewinndynamik aufgrund der leichten konjunkturellen Abkühlung haben sich die Risiken am chinesischen Aktienmarkt erhöht. Ein weiteres Risiko besteht auch in einer möglichen weiteren Straffung der chinesischen Geldpolitik. Hintergrund Ursprünglich war die Hauptintention bei der Schaffung des chinesischen Aktienmarkts, den Staatsbetrieben Zugang zum Kapital der chinesischen Haushalte und ausländischer Investoren zu verschaffen und so den Staatshaushalt zu entlasten. China Aktien werden häufig in drei Kategorien eingestuft: Ashares, B-shares und H-Aktien. A- und B-Aktien sind ausschließlich Inländern zum Kauf vorbehalten. A-Aktien sind nach chinesischem Recht gegründete Unternehmungen die in Yuan notieren und bis vor kurzem ausschließlich Inländern vorbehalten waren. Mittlerweile sind diese jedoch auch für so genannte „qualified institutional investors“ zugänglich. B-Aktien sind nach chinesischem Recht gegründete Unternehmungen und werden in ausländischer Währung in China gehandelt. In der Vergangenheit waren diese ausschließlich Ausländern vorbehalten. H-Aktien sind Aktien chinesischer Unternehmungen, die an der Hongkonger Börse notieren. AAktien galten in der Vergangenheit als wenig liquide, wodurch sich deren Entwicklung von anderen Aktiengattungen abkoppelte. Research Seite 35 13.02.2008 4. Bankensystem 4.1 Struktur Das chinesische Bankensystem ist 2-stufig angelegt. Die Banken operieren unter der People’s Bank of China (PBoC). Im April 2003 wurden die regulatorischen Funktionen der PBoC in die China Banking Regulatory Commission (CBRC) transferiert. Die chinesische Notenbank ist weisungsgebunden. Ihre Politik ist daher stark durch die Interessen der chinesischen Regierung beeinflusst. Der Bankensektor wurde im Vorfeld des Beitritts zur WTO radikal reformiert, wobei dieser Prozess noch immer nicht vollständig abgeschlossenen ist. In der Vergangenheit wurde dem chinesischen Bankensektor die Verantwortung auferlegt mittels Krediten die marode Staatsindustrie am Leben zu halten. Dies hatte eine starke Anhäufung an so genannten „faulen Krediten“ zur Folge. Die Zinssätze kommen nach wie vor nicht durch den Marktmechanismus zu stande, sondern werden den Banken durch die PBoC vorgeschrieben und die Zentralbank sorgt durch die Vorgabe von Mindestreservesätzen und Kreditvergabeobergrenzen für eine starke Reglementierung des Marktes. Aufgrund des hohen staatlichen Einflusses in der Kreditvergabe war und ist der Bankensektor durch eine hohe Korruption geprägt. Die staatlichen Großbanken haben in Vorbereitung auf die neu eintretende ausländische Konkurrenz mit Dezember 2006 ihren Kampf gegen Korruption verschärft. Viele Banken verweisen auf den Umstand, dass sie ihr Risikomanagement/-IT verbessert haben und sich ihre Kreditvergabepraxis geändert hat. Bis jetzt haben die Änderungen geringe Wirkung auf die Vergabepraxis gezeigt. Im März 2006 stellte der IWF fest, dass die Banken nach wie vor bei der Kreditvergabe die maroden staatseigenen Firmen favorisieren und daher kaum Rentabilität oder Kreditrisiko in Betracht ziehen. Trotz großer Aktienemissionen durch chinesische Staatsbanken in den letzten Jahren und der Öffnung des Finanzsektors für ausländische Konkurrenten ist der Bankenmarkt in China nach wie vor stark durch staatliche Finanzinstitute geprägt. An der Spitze des Bankensystem befinden sich die großen, teilstaatlichen Geschäftsbanken: Agricultural Bank of China, Bank of China (BOC), China Construction Bank (CCB) and Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Diese entstanden im Zuge der Reform des Ein-Bankensystems Anfang der 1980er. Verteilung Aktiva Bankensystem Verteilung Passiva Bankensystem Sonstige Institute 26% Sonstige Institute 26% Kommunale Banken 6% Staatliche Kommerzbanken 54% Kommunale Banken 6% Aktienbanken (JSCB) 14% Aktienbanken (JSCB) 14% Quelle: CBRC Research Staatliche Kommerzbanken 54% Quelle: CBRC Seite 36 13.02.2008 Da de facto kein Anleihemarkt vorhanden ist und es für Unternehmen bislang kaum die Möglichkeit gab Anleiheemissionen zu tätigen, ist der Kreditmarkt des Landes im internationalen Vergleich überproportional groß. Die gesamten Aktiva des Bankensystems lagen 2007 noch immer bei mehr als 200% des BIP, was international gesehen außerordentlich hoch ist. Bilanz Finanzinstitute Quartalsende September 2007 in Mrd. Yuan Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 45.928,88 48.513,00 50.616,31 Aktiva 17,2 18,5 20,3 Wachstumsrate %J/J Passiva Wachstumsrate %J/J 43.544,42 16,3 45.953,50 17,7 47.836,97 19,4 Quelle: CRBC Staatlich kontrollierte Kommerzbanken (SCB) machen nach wie vor über 50% der Gesamtaktiva und Gesamtpassiva im Bankensystem aus. Ihre Bedeutung nimmt nur langsam aber stetig ab. Daneben nehmen auch die 3 Förderbanken eine wichtige Rolle im chinesischen Bankensystem ein: China Development Bank, China Export & Import Bank, Agricultural Development Bank of China. Bilanz Staatliche Kommerzbanken Quartalsende September 2007 in Mrd. Yuan Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 25.347,02 26.444,73 27.462,98 Aktiva 14,0 14,6 17,0 Wachstumsrate %J/J 55,2 54,5 54,3 Anteil in % Passiva Wachstumsrate %J/J Anteil 23.930,42 12,8 55,0 24.991,76 14,1 54,4 25.889,85 16,3 54,1 * SOCB: Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Agricultural Bank of China (ABC), Bank of China (BOC), China Construction Bank (CCB), Bank of Communications (BOCOM) Quelle: CRBC Aktienbanken (JSCB) verfügen über eine breitere Eigentümerstruktur als die staatlichen bzw. teilstaatlichen SCB. Unter anderem weisen sie häufig eine Auslandsbeteiligung oder eine Beteiligung einer ländlichen Kreditgenossenschaft auf. Bilanz Aktienbanken (JSCB) Quartalsende September 2007 in Mrd. Yuan Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 5.690,29 6.423,93 6.879,17 Aktiva 22,5 30,1 34,6 Wachstumsrate %J/J 12,4 13,2 13,6 Anteil in % Passiva Wachstumsrate %J/J Anteil 5.474,79 21,9 12,6 6.138,64 28,2 13,4 6.577,45 33,2 13,7 * JSCB: CITIC Industrial Bank, Everbright Bank of China, Huaxia Bank, Guangdong Development Bank, Shenzhen Development Bank, China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Industrial Bank, China Minsheng Banking Co. , Evergrowing Bank, China Zheshang Bank, China Bohai Bank Quelle: CRBC Research Seite 37 13.02.2008 Bilanz Kommunale Banken Quartalsende September 2007 in Mrd. Yuan Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 2.680,64 2.917,65 3.090,58 Aktiva 28,3 26,9 27,7 Wachstumsrate %J/J 5,8 6 6,1 Anteil in % Passiva Wachstumsrate %J/J Anteil 2.549,12 27,1 5,8 2.780,00 25,9 6,0 2.918,88 25,8 6,1 Quelle: CRBC Bilanz Sonstige Institute Quartalsende September 2007 in Mrd. Yuan Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 12.210,93 12.726,69 13.183,58 Aktiva 19,4 19,6 19,0 Wachstumsrate %J/J 26,6 26,2 26,0 Anteil in % Passiva Wachstumsrate %J/J Anteil 11.590,08 19,1 26,6 12.043,10 18,9 26,2 12.450,79 18,2 26,0 Quelle: CRBC Per 31. Mai 2007 bestand das Bankensystem aus 3 Förderbanken, 5 staatlichen Kommerzbanken, 12 Aktienbanken, 113 Kommunale Banken, 16.869 ländlichen Kleinbanken, 70 Finanzierungsunternehmen, 54 Trust- und Investmentgesellschaften, 6 Leasingbanken, der Postbank und ausländischen Banken. Im Dezember 2006 wurden die Restriktionen für Auslandsbanken erheblich gelockert. Die Regierung hob einige Beschränkungen für den Besitz von Banken durch Ausländer auf. Unter den Auslandsbanken gibt es derzeit einen starken Trend zur Körperschaftsgründung unter chinesischem Recht. Ein Hauptkritikpunkt dieser Banken nach der Öffnung des chinesischen Bankenmarktes sind die oft widersprüchlichen regulatorischen Vorgaben durch den Staat und nach wie vor bestehende Kapitalverkehrskontrollen. Wesentliche ausländische Banken in China sind: Citibank, HSBC, Goldman Sachs, Standard Chartered und Morgan Stanley. Deren Geschäftsfokus liegt in den Bereichen der Exportfinanzierung und dem Investmentbanking, allerdings gewinnt das Retail Banking zunehmend an Bedeutung. 4.2 Aktuelle Entwicklungen Im Januar 2008 wurden größere Unregelmäßigkeiten bei den Banken festgestellt. Diese betrugen insgesamt 860 Mrd. Yuan (119 Mrd. USD), was ungefähr dem dreifachen Jahresgewinn der chinesischen Großbanken aggregiert entspricht. Die chinesischen Großbanken verzeichneten laut China Banking Regulatory Commission zusammen 2007 einen Jahresgewinn von 299 Mrd. Yuan. In einer Veröffentlichung am 5. Juli 2007 wurde für 2006 ein aggregierter Vorsteuergewinn von 240,9 Mrd. Yuan angegeben. Laut China Banking Regulatory Commission betrugen die Aktiva aller Banken per 31. 12. 2007 52,6 Billionen Yuan. Research Seite 38 13.02.2008 Quelle: Foreign Affairs Division International Department China Banking Regulatory Commission, 17. Juli 2007, Melbourne Gemäß offiziellen Angaben konnte der Anteil der notleidenden Kredite an dem Gesamtkreditportfolio der Geschäftsbanken bis 30. September 2007 auf durchschnittlich 6,17%, von 28% im Jahr 2003 reduziert werden. Große Fortschritte konnten vor allem im Bereich der staatlichen Großbanken erzielt werden. Deren notleidende Kredite an der Kreditsumme liegen nur noch leicht über dem Durchschnitt der Banken insgesamt. "Non Performing Loans" - Geschäftsbanken Ende-September 2007 Q1 Q2 Q3 Anteil an Anteil an Anteil an Ausstehenden Ausstehenden Ausstehenden gesamter gesamter gesamter Betrag Betrag Betrag Kreditvergabe Kreditvergabe Kreditvergabe NPL Fünf-Kategorien Klassifikation 1245,57 6,63 1266,15 6,45 1251,78 6,17 Substandard 261,32 1,39 244,16 1,24 228,45 1,13 Doubtful 517,66 2,75 501,70 2,56 479,57 2,36 Loss 466,59 2,48 520,29 2,65 543,76 2,68 1161,42 7,02 1186,06 6,91 1174,18 6,63 1061 8,20 1087,51 8,14 1079,82 7,83 100,42 2,78 98,55 2,59 94,36 2,41 Kommunale Banken 65,96 4,52 62,59 3,95 60,72 3,67 Ländliche Kleinbanken 15,06 5,32 14,60 4,8 13,51 4,21 Ausländische Banken 3,13 0,62 2,90 0,51 3,38 0,54 nach Bankkategorie Große Geschäftsbanken staatlich Geschäftsbanken (SOCB) Aktienbanken (JSCB) Anmerkung: 1. Geschäftsbanken inklusive staatliche Geschäftsbanken, Aktienbanken, Kommunale Banken, ländliche Kleinbanken und ausländische Banken. Großbanken enthalten: state-owned commercial banks (SOCB) und joint stock commercial banks (JSCB). SOCB enthalten: Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Agricultural Bank of China (ABC), Bank of China (BOC), China Construction Bank (CCB) und Bank of Communications (BOCOM). JSCB enthalten: CITIC Industrial Bank, Everbright Bank of China, Huaxia Bank, Guangdong Development Bank, Shenzhen Development Bank, China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Industrial Bank, China Minsheng Banking Co. , Evergrowing Bank, China Zheshang Bank und China Bohai Bank. Research Seite 39 13.02.2008 2007M7 2007M8 2007M9 Auslandsverbindlichkeiten Bankensektor [% p.a.] 2,87 10,87 10,06 Einlagezinssatz [in %] 3,33 3,60 Kreditzins [in %] 6,84 7,02 351,00 342,00 342,00 Spread Kredit- über Einlagezinssatz 2007M10 2007M11 2007M12 3,87 3,87 3,87 4,14 7,29 7,29 7,29 7,47 Forderungen ggü. Privatsektor [% p.a.] 17,96 18,69 19,46 Inlandskreditvergabe [% p.a.] 16,18 16,42 17,26 Fremdwährungskonten in % der Gesamtliquidität 28,16 29,00 28,65 Fremdwährungskonten in % aller Einlagen 30,30 31,23 30,91 Quelle: Global Insight 34 32 Bedeutend für das chinesische Bankensystem sind auch die hohen Fremdwährungseinlagen. Diese ergeben sich vor allem aus dem hohen Leistungsbilanzüberschuss Chinas und der nur teilweisen Sterilisierung des Dollarzuflusses durch die PBoC. 30 28 26 24 22 Fremdwährungskonten in % der Gesamtliquidität Fremdwährungskonten in % aller Einlagen 20 Jan 95 Jan 96 Jan 97 Jan 98 Jan 99 Jan 00 Jan 01 Jan 02 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Quelle: Global Insight Research Seite 40 13.02.2008 5. Energiesektor Der chinesische Energiesektor unterscheidet sich grundlegend vom globalen Energiemix. Während weltweit der Schwerpunkt der Energieversorgung bei Erdöl liegt und Erdgas eine immer wichtigere Bedeutung zukommt, setzte China bislang zur Deckung seiner Energie primär auf billige, inländische aber auch sehr umweltfeindliche Kohle zur Generierung von Strom und Wärme. Aufgrund der Umweltprobleme in China und des zunehmenden Individualverkehrs zeigt sich jedoch auch in China eine zunehmende Bedeutung von Erdöl und Erdgas. Relativ unbedeutend werden auf absehbare Zeit dagegen die Kernenergie und alternative Energien bleiben, trotz einer Vielzahl an geplanten Reaktoren. Energiemix 2006 Energiemix 2006 - Global Wasserkraft 6% Nuklearenergie 1% Wasserkraft 6% Erdöl 21% Nuklearenergie 6% Erdöl 36% Erdgas 3% Kohle 28% Kohle 69% Erdgas 24% Quelle: BP Statistical Review 2007 Quelle: BP Statistical Review 2007 China ist, hinter den USA, seit kurzem der weltweit zweitgrößte Ölverbraucher und der drittgrößte Rohölimporteur. Allerdings verfügt das Land nach wie vor über relativ hohe Ölreserven. Diese liefen sich laut Oil & Gas Journal (OGJ) per Januar 2006 auf 18,3 Mrd. Fass. Die statische Reichweite dieser Reserven betrug laut BP Statistical Review 2007 per Ende 2006, unter der Voraussetzung einer konstanten auf gegenwärtigem Niveau befindlichen Produktion, noch 12 Jahre. Die inländische Produktion hat in den vergangenen Jahren ein Plateau ausgebildet und die Wachstumsraten sind nur noch gering. Die International Energy Agency schätzt die Produktion im Jahr 2007 auf 3,8 Mio. Fass/Tag und für 2008 wird eine Produktion von 3,9 Mio. Fass pro Tag prognostiziert.7 Ölangebot, Nachfrage, Bilanz Statische Reichweite Reserven 100 10 Nachfrage Produktion Überschuss-/Defizit 8 90 80 70 6 60 4 50 40 2 30 0 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 -2 2002 2005 2008 20 10 Quelle: BP Statistical Review 2007, IEA 7 Nicht-OPEC Ex-Sowjetunion Welt OPEC OECD Norwegen Großbritannien Kanada + Ölsand USA Mexiko China Indonesien Kanada Ägypten Malaysia Oman Algerien Brasilien Indien Angola Australien Katar Equador Russland Sudan Nigeria Libyen Aserbaidschan Saudi Arabien Iran Venezuela Kasachstan Kuwait Irak -6 Vereinigte Arab. Emirate 0 -4 Quelle: BP Statistical Review 2007 IEA Oil Market Report, Dezember 2007 Research Seite 41 13.02.2008 Die Importquote Chinas wird daher in den nächsten Jahren weiter steigen und so Aufwärtsdruck auf den weltweiten Ölpreis generieren. China ist seit 1993 mit steigender Tendenz Nettoimporteur von Rohöl. Für 2008 ist bereits mit einer Importquote von über 51% zu rechnen. Die Importe kommen hauptsächlich aus dem Nahen Osten, wobei durch den Bau alternativer Pipelines, insbesondere Richtung Sibirien und in den kaspischen Raum und das starke Engagement chinesischer Ölfirmen in Afrika versucht wird die Energieversorgung breiter zu diversifizieren. Importquote 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 -10% -20% -30% -40% -50% Quelle: BP Statistical Review 2007, IEA Die Atasu-Alashankou Pipeline von Kasachstan nach China wurde Mitte 2006 mit einer Kapazität von in Betrieb 1,7 Million Tonnen Rohöl genommen. Die Pipeline ist jedoch für eine Kapazität von 10 Mio. Tonnen pro Jahr (~200.000 b/d) ausgelegt. Das nach China transportierte Öl stammt aber bisher aus Russland und dem Kumkol Feld (im Norden Kasachstans). Im September 2007 startete die russische TNK-BP Rohöllieferungen nach China über die neue Exportroute von Atasu nach Alashankou in China. Die Pumpstation in Atasu vermengt Rohöl das aus dem kasachischen Ölfeld Kumkol kommt mit Rohöl aus der Region Westsibirien. Die Pipeline müsste weiter Richtung Westen zu den neuen Ölfeldern an der kaspischen See herangeführt werden, um auch diese Region an China anzubinden. Der inländische Konsum belief sich laut International Energy Agency im Jahr 2007 auf 7,53 Mio. Fass/Tag und für 2008 wird ein Verbrauch von 7,96 Mio. Fass pro Tag erwartet.8 Wie die Revisionen für den Verbrauch zeigen, hatte der bisherige Ölpreisanstieg kaum Auswirkungen auf den chinesischen Konsum. Der negative Preiseffekt auf die Ölnachfrage wird weitgehend durch den Einkommenseffekt eines stark steigenden Bruttoinlandsprodukts kompensiert. Auch sind die inländischen Ölproduktpreise weitestgehend staatlich administriert, wodurch die Profitabilität der inländischen Ölfirmen bei gleichzeitig steigenden Einkaufspreisen für Rohöl leidet und diese wenig Anreiz hatten den Markt zu versorgen, was sich in China dann des öfteren in Benzinrationierungen bemerkbar macht. In der Vergangenheit zeigte sich des Öfteren sogar, dass genehmigte Preiserhöhungen die Nachfrage beflügelten, da die Ölfirmen dadurch einen höheren Anreiz hatten, diese zu bedienen. Es bleibt daher fraglich, inwieweit ein weiter steigender Ölpreis sich dämpfend auf die chinesische Nachfrage auswirken wird. Erst bei einem sehr großen Preissprung oder einen signifikanten Rückgang des chinesischen Wirtschaftswachstums ist mit einer Verlangsamung der chinesischen Ölnachfragedynamik zu rechnen! 8 IEA Oil Market Report, Dezember 2007 Research Seite 42 13.02.2008 Zusammenhang Wirtschaftswachstum/Ölnachfrage IEA Monatliche Revisionen Verbrauch 8,50 20 2005 2006 2007 2008 8,00 15 7,50 10 7,00 5 6,50 6,00 0 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 5,50 -5 Ölnachfragewachstum (in % p.a.) 5,00 Jul Wirtschaftswachstum, real (in % p.a.) Okt Jan ex ante Schätzungen für Jahr t -10 Quelle: BP Statistical review 2007, IEA Apr Jul Okt Jan Nachfrageschätzungen für aktuelles Jahr t Apr ex post Schätzungen für Jahr t Quelle: IEA Die noch immer niedrige Wirtschaftleistung pro Kopf und der noch immer niedrige Ölverbrauch pro Kopf zeigen das enorme Nachfragepotential in China in den kommenden Jahrzehnten. BIP pro Kopf/ Ölverbrauch pro Kopf BIP pro Kopf/ Ölverbrauch pro Kopf 35 40 35 Australia Austria Belgium Canada China France Germany Greece India Indonesia Ireland Italy Japan Malaysia Netherlands New Zealand Philippines Portugal Spain Switzerland Thailand Turkey United Kingdom United States China 30 Greece India 25 Ölverbrauch in Fass pro Kopf Ölverbrauch in Fass pro Kopf 30 USA 25 20 15 USA Indonesia Malaysia 20 Philippines 15 Portugal Griechenland, Spanien Spain 10 Thailand China, Indien, Philippinen, Thailand, Türkei 10 Österreich Turkey 5 5 United States China, Indien 0 0 0 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 BIP pro Einwohner (in USD) BIP pro Einwohner (in USD) Quelle: BP Statistical Review 2007, Global Insight Research Quelle: BP Statistical Review 2007, Global Insight Seite 43 13.02.2008 6. Rahmenbedingungen/Weiche Faktoren 6.1 Rechtssicherheit Das Rechtssystem hat sich in den vergangenen Jahren erheblich verbessert und es kann inzwischen bereits in vielen Bereichen von einer „rule of law“ gesprochen werden. Die Einführung einer Marktwirtschaft hat in den vergangenen Jahren zu einer stetigen Herausbildung eines Privatrechts geführt. Dieses ist in vielen Bereichen auf dem Stand der Zeit, allerdings in einigen Bereichen auch lückenhaft. Da die Justiz unter der direkten Kontrolle der KPC steht, haben Unternehmen und Private vor Gericht gegenüber den Interessen des Staates bzw. der Repräsentanten oft das Nachsehen. 9 Quelle: Weltbank 6.2 Investitionsklima/ Unternehmensumfeld Gemäß World Business Report 2008 hat sich das Investitionsklima in China im Jahr 2007 weiter verbessert. Chinas Rang im Ländervergleich verbesserte sich von 93 auf 83. Wesentliche Fortschritte konnten in den Bereichen Genehmigungen, Zugang zu Kapital und im Insolvenzrecht erzielt werden. Chinas komparative Stärken liegen in den Bereichen Registrierung von Eigentum (Rang: 29), im grenzüberschreitenden Warenverkehr (Rang: 42), der Durchsetzung von Verträgen (Rang: 20) und dem Insolvenzrecht (Rang: 57). Defizite sind insbesondere in den Bereichen Unternehmensgründung (Rang: 135), Genehmigungsverfahren und Bewilligungen (Rang: 175) und dem administrativen Aufwand zur Bezahlung von Steuern (Rang: 168) vorhanden. Im Vergleich zur Vorjahreserhebung ist China im Ländervergleich in den Bereichen Unternehmensgründung, Genehmigungen, Arbeitsrecht, Registrierung von Eigentum und im Bereich internationaler Warenaustausch zurückgefallen, während das Ranking in den Bereichen Investorenschutz, Bezahlung von Steuern unverändert blieb. Verbesserungen konnten in den Bereichen Zugang zu Kapital, der Durchsetzung von Verträgen und bei Insolvenzverfahren erzielt werden. 9 Percentile Rank zeigt die Prozentanzahl aller übrigen Länder weltweit, deren Rating sich unter dem Chinas befindet. Das Gesamtrating setzt sich unter anderem aus den Teilrating von OECD Development Center African Economic Outlook, Bertelsmann Transformation Index, Freedom House Countries at the Crossroads, EIU Economist Intelligence Unit, FRH Freedom House, World Economic Forum Global Competitiveness Survey, Gallup World Poll, Reporters Without Borders Press Freedom Index; WMO Global Insight Business Conditions and Risk Indicators zusammen. Die strichlierten Linien geben das 90 Prozent Konfidenzintervall für diese Größe an; d.h.: es besteht eine 90%-ige Wahrscheinlichkeit, dass die entsprechende Variable sich im Bereich zwischen den strichlierten Linien befindet. Research Seite 44 13.02.2008 Ein neues Grundstücksgesetz stellt nun Privateigentum offiziell jenem von staatlichem Eigentum gleich. Die Anzahl der möglichen Vermögensgegenstände, die als Sicherheiten dienen können, wurde erweitert (Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Lagerbestände). Auch wurde ein neues Insolvenzgesetz verabschiedet, welches den Forderungen der Kreditgeber im Insolvenzfall Vorrang gewährt. Durch die elektronische Erteilung von Baugenehmigungen wurde der administrative Zeitaufwand wesentlich verkürzt. Quelle: Weltbank Doing Business in 2008 Quelle: Weltbank Doing Business in 2008 Quelle: Weltbank Doing Business in 2008 Quelle: Weltbank Doing Business in 2008 Quelle: Weltbank Doing Business in 2008 Quelle: Weltbank Doing Business in 2008 Durch die Stärkung der Rechte der Kapitalgeber im neuen Insolvenzrecht und das neue Eigentumsrecht wird die Anzahl der möglichen Sicherstellungen um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Lagerbestände erweitert. Es wird geschätzt, dass so 2.000 Mrd. USD an „totem“ Research Seite 45 13.02.2008 Kapital so für chinesische Unternehmungen nutzbar gemacht Kapitalbeschaffung für chinesische Firmen erheblich erleichtert. werden kann und die Durch die verschärfte Informationspflicht der Unternehmen wurde die Transparenz chinesischer Firmen wesentlich erhöht und der Aktionärsschutz in China erheblich verbessert. Quelle: Weltbank Doing Business in 2008 Quelle: Weltbank Doing Business in 2008 Besonders effizient und kostengünstig zeigt sich die staatliche Verwaltung im Bereich des internationalen Warenhandels und dem damit verbundenen administrativen Aufwand. Quelle: Weltbank Doing Business in 2008 Quelle: Weltbank Doing Business in 2008 Die Qualität des regulatorischen Rahmens hat sich in den vergangenen Jahren wieder verbessert, nachdem China im Ländervergleich bis 2002 stetig in diesem Bereich abrutschte. Im Jahr 2006 befand sich China damit im Mittelfeld. Quelle: Weltbank Research Seite 46 13.02.2008 Auf relativ hohem Niveau befindet sich der Indikator Effektivität der staatlichen Handlungen. Allerdings konnten in diesem Bereich in den letzten Jahren keine weiteren wesentlichen Verbesserungen erreicht werden, woraus eine Stagnation im Ländervergleich resultiert. Quelle: Weltbank 6.3 Arbeitsmarkt & Humankapital China verfügt über eine gut ausgebildete, junge Erwerbsbevölkerung. Im akademischen Bereich ist ein Großteil dieser in der Lage sich auf Englisch zu verständigen und die Kenntnisse in Englisch nehmen in der restlichen Bevölkerung zu. Eine Einschränkung für die Verfügbarkeit des Faktors Arbeit ergibt sich aus der Genehmigungspflicht für eine Übersiedelung. Trotz hoher und versteckter Arbeitslosigkeit in den westlichen und nördlichen Regionen ist die Mobilität eingeschränkt, während gleichzeitig in der Vergangenheit sektorale Engpässe in den Küstenregionen auftraten. Aufgrund der Bestimmungen gibt es eine hohe Anzahl von Wanderarbeitern. Aufgrund der rapiden Alterung ist jedoch längerfristig mit einer starken Verknappung im Arbeitsangebot zu rechnen. 6.4 Steuern Das chinesische Steuersystem gilt als sehr komplex. Zwar sind die Steuersätze relativ niedrig jedoch zählen zu den Hauptkritikpunkten: Überschneidung der Einhebung durch lokale und überregionale Behörden, Steuern sind oft willkürlich festgelegt, werden willkürlich eingehoben und ändern sich häufig. 6.5 Korruption Trotz Fortschritten in der Korruptionsbekämpfung gilt diese noch immer als virulent. Gemäß 2007 Corruption Perceptions Index von Transparency International hielt das Land im Jahr 2007 gemeinsam mit Indien den 72. Platz10 (zum Vergleich: Rumänien: 69; Serbien: 79, Russland: 143). Die Korruption reicht in China bis in die höchsten Ämter, auch die Justiz ist davon betroffen. Hauptursache für die hohe Korruption ist die mangelnde Transparenz und die Überschneidung von öffentlichen Aufgaben und privaten Nebentätigkeiten von Beamten und Politikern. Die Korruption ist besonders häufig in den Bereichen Finanz, Banken, Bausektor sowie der öffentlichen Auftragsvergabe anzutreffen. Die Problematik ergibt sich auch aus dem Umstand, dass es für Geschäftsabschlüsse erforderlich ist eine enge Beziehung mit einem potentiellen Geschäftskunden aufzubauen, was oft mit Geschenken verbunden ist. In der Vergangenheit wurden bereits drastische Schritte ergriffen um potentielle Täter abzuschrecken. Allerdings hält sich die Korruption nach wie vor sehr hartnäckig. Auch darf die Kommunistische Partei nicht allzu viele Korruptionsfälle aufdecken, da sie dadurch ihr eigenes Image ramponieren würde. Dessen sind sich auch die Täter bewusst. Darüber hinaus trifft die strafrechtliche 10 Länder mit niedrigen Rang haben eine vergleichsweise niedrige Korruption Research Seite 47 13.02.2008 Verfolgung meist nur jene, die nicht hinreichende Kontakte nach „oben“ haben. Ein weiterer Grund für die hohe Korruption ist die schwerfällige Bürokratie. Korruption gilt weitläufig als Mittel Verfahren erheblich zu beschleunigen. Quelle: Weltbank 6.6 Politik Das politische Umfeld schneidet im Ländervergleich relativ schlecht ab. Es ist jedoch mit keinen politischen Krisen zu rechnen. Dies lässt sich damit begründen, dass eine Opposition nicht existiert, um die herrschende kommunistische Partei herauszufordern. Instabilität ergäbe sich beispielsweise nur aus Aufständen verarmter Bauern und Landbewohnern oder es könnten infolge erhöhter Preise Unruhen entstehen, welche jedoch kein systembedrohendes Ausmaß annehmen sollten. Der steigende Wohlstand des Landes sollte in den kommenden Jahren mit dazu beitragen soziale Spannungen abzubauen. Quelle: Weltbank Inland Die politische Macht in China wird in der Kommunistischen Partei zentralisiert. Hu Jintao wurde im Oktober 2007 beim 17. Kongress der Kommunistischen Partei Chinas zum zweiten Mal zum Vorsitzenden wiedergewählt. Dies ist seine zweite und letzte Amtszeit, sie beträgt 5 Jahre. Die Kommunistische Partei wird durch mehrere Flügel geprägt. Hu Jintao gelang es seit Beginn seiner Amtszeit, seine Position durch die Verabschiedung seines Programms als etablierte Parteitheorie und die Unterbringung einiger Vertrauensleute in wichtigen Positionen entscheidend zu verbessern. Zwar gibt es in der KPC mehrere Flügel, jedoch stimmen diese in der Zielsetzung des Parteiprogramms weitestgehend überein und mittelfristig stehen auch keine bedeutenden Änderungen an der Führungsspitze der Partei an. Unter der so genannten 4. Generation der politischen Führer unter Research Seite 48 13.02.2008 Präsident Hu Jintao und Premierminister Wen Jiabao ist eine Fortsetzung der Reform Agenda „Schaffung einer harmonierenden Gesellschaft“ zu erwarten. Dieses Programm verfolgt die Zielsetzung die unterentwickelten westlichen Provinzen und die ländlichen Regionen am Aufschwung stärker teilhaben zu lassen und so sozialen Spannungen vorzubeugen. Daneben wird die Zielsetzung verfolgt die verbliebene Staatsindustrie weiter zu sanieren und „grünes“, also umweltfreundlicheres Wachstum zu schaffen. Spannungen könnten sich erst im Vorfeld der nächsten Wahl des Parteivorsitzenden im Jahr 2012 ergeben. Kurzfristig bis mittelfristig sollte das politische System daher stabil bleiben. Auch langfristig besteht ein politisches Risiko wohl nur im Falle eines Einbruches in der Wirtschaftsaktivität, welcher dann die sozialen Probleme weiter zuspitzt. Der Abbau der Armut in den ländlichen Regionen gilt langfristig als entscheidend für den Machterhalt der KPC. Die „Demokratisierung“ durch die Direktwahlen von Volksvertretern auf Kommunalebene zeigte bislang wenig Auswirkung auf das Gesamtsystem. Auch haben sie nicht zu einer Stärkung der Verantwortlichkeit der Verwaltung gegenüber der Bevölkerung beigetragen. Eine Gefährdung durch politische Herausforderer scheint auf absehbare Zeit wenig realistisch. In China ist auch eine zusehende Diversifikation der Macht feststellbar. Hatten frühere Parteivorsitzende weitestgehende absolute Macht, so befindet sie sich jetzt in mehreren Händen. Zudem gibt es einen Trend hin zu mehr Föderalismus, nachdem erkannt wurde, dass die Zentralisierung der Kompetenzen bei der Zentralregierung zur Überforderung letzterer führte. Auf lokaler Ebene werden auch zusehends lokale Eigeninteressen vertreten, wodurch sich eine höhere Ressourceneffizienz ergibt. Dies gilt vor allem für die erfolgreichen Regionen an der Küste, während die rückständigen Gebiete im chinesischen Hinterland zunehmend auf die Hilfe der Zentralregierung angewiesen sind. Der Föderalismus ist durch Lippenbekenntnisse und Unterwürfigkeit gegenüber der Zentralregierung gekennzeichnet, wobei die Umsetzung der Vorgaben weitgehend aufgrund von Eigeninteressen auf lokaler Ebene geprägt ist. Den Provinzen kommt eine zunehmende Bedeutung in der Umsetzung der “harmonischen Gesellschaft” zu, indem sie für einen Großteil der damit verbundenen Ausgaben im Sozialbereich und der Gesundheit und Bildung verantwortlich sind. Um diese Aufgaben zu schultern sind die Provinzen auf hohe Steuereinnahmen angewiesen. Gleichzeitig haben Unternehmen das Recht „mit den Füßen“ über die jeweiligen lokalen Standortbedingungen abzustimmen. Ein verschärfter Standortwettbewerb zwischen den einzelnen Provinzen hat wesentlich zur erhöhten Effizienz der Lokalverwaltungen beigetragen. Außenpolitik Die chinesische Außenpolitik zielt nach wie vor auf Sicherung der chinesischen Interessen und Großmachtambitionen unter der Doktrin des „Friedlichen Aufstiegs Chinas“. Durch diplomatische Lösungen sollen Konflikte weitgehend vermieden werden. Um sich den Zugang zu Märkten und die für China wichtigen Bodenschätze zu sichern, ist China an einer friedlichen wirtschaftlichen Integration in die Weltwirtschaft interessiert. Im Hintergrund werden, soweit dies vertretbar ist, protektionistische Maßnahmen für die eigene Wirtschaft getroffen und es findet eine starke militärische Aufrüstung statt. Gegenüber Taiwan und dessen Unabhängigkeitsbestrebungen wird eine nationalistische Rhetorik betrieben, die von Zeit zu Zeit durch heftiges Säbelrasseln unterstrichen wird. Hauptgegner um die Vorherrschaft in asiatisch-pazifischen Raum sind dabei die USA und ihre Verbündeten in der Region. Gleichzeitig ist China jedoch noch auf die USA als wichtigen Absatzmarkt angewiesen. USA China und die USA weisen eine sehr komplexe Beziehung auf, welche durch gegenseitige Abhängigkeit in wirtschaftlichen und einigen politischen Bereichen (z.b.: Nordkorea) und gegenseitiges Misstrauen andererseits gekennzeichnet ist. Trotz der wirtschaftlichen Öffnung Chinas und dessen Integration in die Weltwirtschaft misstrauen in den USA viele politische Kreise den politischen Ambitionen Chinas. Es besteht die Befürchtung, dass China eine Vorherrschaft im asiatischen Raum aufbauen wolle. Ein zusätzlicher Belastungsfaktor ist die Taiwanfrage. Research Seite 49 13.02.2008 Taiwanesische Politiker hatten in der Vergangenheit unter dem vermeintlichen Schutz durch den Verbündeten durch Unabhängigkeitsbestrebungen die Volksrepublik mehrmals provoziert. Mittlerweile üben selbst die USA Druck auf ihren Verbündeten Taiwan aus sich in der Rhetorik zu mäßigen, da sich die USA zunehmend bewusst sind, dass ein Konflikt mit China große Opfer erfordern würde. In China wiederum wird der US-Außenpolitik häufig unterstellt, Chinas Einfluss begrenzen zu wollen indem es schwach und geteilt bleibe. Trotz dieser Gegensätze ist eine zunehmende Kooperation in vielen Fragen beobachtbar. Dies betrifft vor allem das nordkoreanische Atomprogramm und auch in Fragen der chinesischen Wechselkurs- und Handelspolitik zeichnet sich eine zunehmende Dialogbereitschaft der USA ab. Japan Die chinesisch-japanischen Beziehungen sind nach wie vor durch die japanischen Kriegsgräuel in China und die Besetzung des Landes zwischen 1931 und 1945 schwer belastet. Bislang wenige Früchte zeigten die japanischen Investitionen in China und der verstärkte Handel zwischen beiden Staaten. Nach wie vor werden die Beziehungen durch chinesische Reparationsforderungen und das Nichteinstehen Japans für die Kriegsverbrechen belastet. Weitere Spannungspunkte sind die japanischen Ambitionen als ständiges Mitglied in den UN-Sicherheitsrat aufgenommen zu werden und die territorialen Ansprüche beider Länder im südchinesischen Meer, wo Öl- und Gasvorräte vermutet werden. Japan ist besorgt über die militärische Aufrüstung Chinas, und China unterstellt Japan, ähnlich wie den USA, China vom Aufstieg abhalten zu wollen. Russland Die Beziehungen zwischen China und Russland haben sich in den vergangenen Jahren nicht zuletzt aufgrund der Expansion des nord-atlantischen Bündnisses und der amerikanischen Asienpolitik wesentlich verbessert. Beide Länder sehen sich durch die USA und ihre Verbündeten zunehmend eingekreist und isoliert. Gleichzeitig handelt es sich um ein Zweckbündnis, welches unter Abwesenheit der äußeren Umstände rasch die Gegensätze zwischen beiden Ländern aufdecken würde. Russlands Sorge galt lange der Unterwanderung Sibiriens durch chinesische Migranten und man unterstellte China, sich dieses rohstoffreiche Territorium aneignen zu wollen. Auch gab es aus der Vergangenheit bereits einen Konflikt über den gemeinsamen Grenzverlauf beider Staaten, der sogar in offenen kriegerischen Handlungen mündete. Mit dem Widererstarken Russlands als außenpolitischer Machtfaktor und dem Bewusstsein der technologischen Überlegenheit der russischen Streitkräfte haben sich die Beziehungen in den letzten Jahren erheblich verbessert. Ein Freundschaftsvertrag im Jahr 2001 und die Unterstützung des russischen WTO-Beitritts durch China haben die Beziehungen weiter entspannt. Beide Länder sind Motor der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) und es besteht mittlerweile eine strategische Zusammenarbeit, die zuletzt sogar in gemeinsamen Militärmanövern mündete. Beide Länder sehen sich auch durch den militanten Islam bedroht. Für Russland ist die Annäherung an China auch eine Möglichkeit, seine Abhängigkeit vom europäischen Energieabsatzmarkt zu reduzieren. Taiwan China sieht Taiwan nach wie vor als “abtrünnige Provinz” und beansprucht Taiwan als Teil der Volksrepublik China. Die Unabhängigkeitsbestrebungen Taiwans sind zuletzt jedoch deutlich abgeflaut, nachdem taiwanesische Politiker zunehmend erkennen mussten, dass ihre Ambitionen nicht durch ihren Verbündeten USA unterstützt würden. Auch zeigt sich, dass der Konflikt mit dem Festlandchinesen die wirtschaftliche Entwicklung Taiwans bremst. Research Seite 50 13.02.2008 Indien Auch die Beziehungen zu Indien sind durch starke Widersprüche gekennzeichnet. Zwischen China und Indien gibt es nach wie vor einen Grenzstreit, welcher 1962 sogar zu kriegerischen Handlungen führte. Indien ist die militärische Zusammenarbeit Chinas mit seinem Hauptrivalen Pakistan ein “Dorn im Auge”. Für Irritationen sorgt auch die US-amerikanische Hilfe in der friedlichen Nutzbarmachung der Atomenergie in Indien. China sah in der Zusammenarbeit einen weiteren Beweis für die Eingrenzungspolitik der USA. Dies wird jedoch hauptsächlich den USA vorgeworfen. Jedoch haben sich die Beziehungen in den letzten Jahren spürbar verbessert und im Januar 2008 konnte ein Übereinkommen über eine tiefere wirtschaftliche Zusammenarbeit erzielt werden. Beide Länder vorfolgen dabei ihre Eigeninteressen. China möchte seine Position als regionaler Machtfaktor und verantwortliche Großmacht stärken und mehr Einfluss auf die Länder Myanmar (Burma), Bhutan und Nepal ausüben. Indien verfolgt das Ziel die Zusammenarbeit Chinas und Pakistans zu unterminieren. Aus pragmatischen Überlegungen beider Seiten heraus ist mit keinen akuten Spannungen zu rechnen. Südkorea Die chinesisch-südkoreanischen Beziehungen werden nach wie vor durch den Kalten Krieg geprägt, indem China im Koreakrieg an der Seite Nordkoreas kämpfte. Seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen im Jahr 1992 hat sich das Klima jedoch wesentlich verbessert und beide Länder sehen die verstärkte wirtschaftliche Kooperation als positiv. 6.7 Terrorismus und Sicherheit Eine der größten Bedrohungen für den Frieden in China stellen soziale Unruhen dar. Einerseits sind diese auf verarmte Bauern zurückzuführen, die besonders oft unter Behördenwillkür und Zwangsumsiedlungen zu leiden haben und andererseits auf Arbeiter, welche durch die Reform der staatlichen Kombinate ihre Stelle verloren haben. Letztere sind überwiegend im Nordosten des Landes zu finden, der ein Zentrum der Schwerindustrie ist. In dieser Region sind auch die meisten Ausstände zu verzeichnen. Die Machthaber waren im Jahr 2007 sehr über die großen Preisanstiege bei Nahrungsmittel beunruhigt, da diese schon in der Vergangenheit die klassischen Auslöser für Unruhen in diesen Regionen waren. Um die Lage zu beruhigen wurden im Januar 2008 Preisobergrenzen für bestimmte Lebensmittel und Energie festgesetzt. Separistische, islamistische Gruppen befinden sich vor allem im Nordwesten des Landes. Die Terrorgefahr gilt jedoch als gering. 6.8 Infrastruktur Als relativ gut kann die chinesische Infrastruktur eingestuft werden. Trotz enormer Investitionen in den vergangenen Jahren ist diese aufgrund des enormen Wirtschaftswachstums jedoch stets an ihrer Kapazitätsgrenze. Die Qualität der Infrastruktur weist jedoch große regionale Unterschiede auf: Die westlichen Provinzen gelten als unterentwickelt, während in vielen Küstenstädten und insbesondere in Hongkong eine ausgezeichnete Infrastruktur vorzufinden ist. Die Häfen sind weitgehend gut ausgebaut und am neuesten Stand, was sich in besonders niedrigen Transportkosten bemerkbar macht. Die Eisenbahn gilt nach wie vor als das wichtigste chinesische Transportmittel. Allerdings ist sie aufgrund der steigenden Pendleranzahl und der zu erbringenden Gütertransportleistung (insbesondere Kohletransport aus den westlichen Provinzen) an ihr Limit gestoßen. Ein groß Research Seite 51 13.02.2008 angelegtes Investitionsprogramm, mit Fokus auf die westlichen Provinzen, soll in den nächsten Jahren weitere Kapazitäten schaffen. Chinesische Großstädte gelten bereits jetzt durch den Straßenverkehr als chronisch verstopft. Im Januar 2005 wurde ein 2000 Mrd. Yuan Investitionsprogramm verabschiedet, welches das derzeitige Schnellstraßen- und Autobahnnetz bis 2030 von derzeit 30,000 km auf 85,000 km ausbauen soll. Das Telekommunikationsnetz des Landes ist in den Küstenregionen bereits sehr gut ausgebaut. Im Hinterland gilt es aber als veraltet. Research Seite 52 13.02.2008 7. Bonität: Ratings und Risikoeinschätzung China 2007M7 2007M8 2007M9 2007M10 2007M11 Sovereign rating, foreign currency, Standard & Poor's A A A A A 2007M12 A Sovereign rating, foreign currency, Moody's A2 A1 A1 A1 A1 A1 Sovereign rating, foreign currency, Global Insight BBB+ A- A- A- A- A- Sovereign rating, foreign currency, Fitch Ratings A A A A A+ A+ Sovereign rating, foreign currency, consensus A A A A A A Quelle: Global Insight Fitch erhöhte am 6. November 2007 sein Fremdwährungs-Staatenrating aufgrund verbesserter fiskalischer Rahmenbedingungen und einer geringeren Wahrscheinlichkeit, dass der Staat den Großbanken unter die Arme greifen muss, um einen Notch von A auf A+ und das Lokalwährungsrating entsprechend von A+ auf AA-. Der Ausblick für beide Ratings ist “stabil”. Die stetige Verbesserung in den öffentlichen Finanzen und in der Außenposition eröffnet der Regierung die notwendige Flexibilität für eine etwaige Unterstützung des Bankensektors. (Notenschlüssel siehe Anhang) Um die starke externe Zahlungsbilanzposition Chinas zu reflektieren, hat Moody's Investors Service am 26. Juli 2007 sein langfristiges Fremdwährungsanleihenrating um einen Notch von A2 auf A1 angehoben. Moody’s hob auch den Trend in der Staatsverschuldung und den Fortschritt bei wirtschaftlichen Reformen positiv hervor. Gleichzeitig wurde auch das Rating von Hongkong und Macau angehoben. Der Ausblick wurde mit “stabil” festgesetzt. Laut Moody’s wird China durch seine gute Zahlungsbilanzposition von externen Schocks abgeschirmt und die Regierung ist in der Lage, größere und tiefere Strukturreformen durchzuführen. Trotz der Aufwertung des Yuan ist der Exportsektor nach wie vor stark. Der Beitritt zur Welthandelsorganisation WTO und hohe Direktinvestitionszuflüsse hätten die Wettbewerbsfähigkeit des Landes erhöht und es zum drittgrößten Exporteur der Welt gemacht. Der Country Ceiling für Fremdwährungs- als auch Lokalwährungseinlagen bzw. Anleihen wurde ebenfalls von A2 auf A1 angehoben. Der Ausblick wurde mit „stabil“ festgesetzt. Auch wurden substantielle Fortschritte bei der inneren Finanzstärke und der Aufsicht über die großen staatlichen Geschäftsbanken erzielt. S&P hat am 26. Juli 2007 sein Fremdwährungs-Staatenrating für China von A bestätigt, den Ausblick jedoch von „neutral“ auf „positiv“ angehoben. Das bisherige Rating bestand seit 27. Juli 2006. Die Anhebung wurde mit der starken Vermögensposition des Landes gegenüber dem Ausland, dem Wachstumspotential, und dem verbesserten fiskalischen Rahmen begründet. 20 18 16 14 S&P 12 10 Sovereign rating, foreign currency, Standard & Poor's 8 Sovereign rating, foreign currency, Moody's 6 Sovereign rating, foreign currency, Global Insight Sovereign rating, foreign currency, Fitch Ratings 4 Sovereign rating, foreign currency, consensus 2 AAA AA+ AA AAA+ A ABBB+ BBB BBBBB+ BB BBB+ B BCCC+ CCC CCCCC C D SD New Fitch 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 NA AAA AA+ AA AAA+ A ABBB+ BBB BBBBB+ BB BBB+ B BCCC+ CCC CCCCC C DDD DD D New Moodys Aaa Aa1 Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa1 Caa2 Caa3 Ca C 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 D New 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 19 99 19 98 19 97 19 96 19 95 19 94 19 93 0 Quelle: Global Insight Research Seite 53 13.02.2008 8. Externe Faktoren – Weltkonjunktur & Ölpreis In den USA zeichnet sich im Jahr 2008 eine spürbare Abschwächung der Konjunktur ab. Da diese nach wie vor einen wichtigen Absatzmarkt für China darstellen, ist mit einem negativen Effekt auf den chinesischen Exportsektor zu rechnen. Eine Verlangsamung der US-Konjunktur hat voraussichtlich jedoch einen dämpfenden Effekt auf die Rohstoffpreise, wovon China profitieren könnte. Auch in Japan ist mit einem Rückgang der Wirtschaftsdynamik zu rechnen. In den vergangenen Monaten wurden bereits die BIP-Prognosen für 2008 durch die BOJ und die japanische Regierung drastisch zurückgenommen. Insbesondere der japanische Binnenkonsum und die Bauwirtschaft schwächeln. Da das Wirtschaftswachstum derzeit stark vom Export getragen wird und sich die Weltkonjunktur abschwächen dürfte ist mit einer stärkeren chinesisch-japanischen Rivalität bei den Exporten zu rechnen. Die Eurozone hat sich in den vergangenen Jahren zum wichtigsten Exportmarkt Chinas entwickelt. Bislang entwickelte sich diese sehr robust. Allerdings zeigen einige Immobilienmärkte in Europa deutliche Einbrüche, was sich negativ auf den Konsum auswirken dürfte. Auch ist Europa stärker von der Kreditkrise betroffen. Aufgrund der ebenfalls hohen Exportabhängigkeit des europäischen Wachstums und der derzeitigen Eurostärke könnte sich der Druck von Seiten der Europäer auf China im Hinblick auf den Wechselkurs des Yuan erhöhen, was sich dämpfend auf die Exportchancen Chinas auswirken könnte. Die Ölpreise verharrten im Herbst und in den Wintermonaten 2007/08 entgegen dem saisonalen Trend auf hohem Niveau. Der Ölpreis für leichtes US-Öl der Sorte WTI belief sich im Jahresdurchschnitt 2007 auf USD 72,34/Fass. Unsere Ölpreisprognose wurde damit deutlich überschritten. Im 2. Halbjahr 2007 wurde der Ölpreis hauptsächlich spekulativ getrieben. Die zunehmende Rolle von Rohstoffen als alternative Investments verstärkte den Aufwärtstrend ebenso wie der Verfall des Dollars. Aufgrund stark gestiegener Inputpreise, Materialknappheiten und technischer Probleme verzögerte sich die Inbetriebnahme einiger wichtiger Ölfelder, was sich preistreibend auf den Ölpreis auswirkte. Ergebnisse aus Ölmarktanalyse Mai 2007 Nachdem wir in unseren beiden letzten Analysen zum Ölpreis noch keine große Angebotsreaktion auf die höheren Ölpreise erkennen konnten, zeichnet sich nun eine starke Ausweitung der Kapazitäten in den nächsten Jahren ab. Ölfirmen scheinen ihre Rentabilitätserwartung in den vergangenen Monaten weiter angehoben zu haben und dementsprechend wurden einige Projekte zusätzlich in Angriff genommen. Zahlreiche Projekte sind dadurch zusätzlich in die Planungsphase eingetreten und könnten möglicherweise im Zeitraum 2007-2012 für zusätzliches Angebot sorgen. Wesentliche Unsicherheitselemente sind die zukünftige OPEC-Politik, wetter- und technisch bedingte Verzögerungen bei der Installation neuer Anlagen, Investitionsstopps der Ölfirmen aufgrund steigender Kosten (Material, Personal, Lizenzkosten,….), verstärkte Investitionen in politisch instabile Regionen, geopolitischen Spannungen (Terrorismus, islamischer Fundamentalismus, Nahostkrise), Naturkatastrophen, knappe Raffineriekapazitäten, insbesondere in den USA, weitere Verschärfungen bei den Emissionsstandards. In unserem Basisszenario gehen wir davon aus, dass die angekündigten Projekte nicht in vollem Umfang umgesetzt werden können. Dies betrifft vor allem die jüngst verlautbarten Planungen der OPEC und Projekte, die sich noch in der Frühphase befinden. 2005 Rohölpreis WTI (Jahresdurchschnitt) [$/Fass] Änderung zu Vorjahr Research 56,64 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 66,05 63,55 60,13 58,17 60,66 66,35 86,24 16,61% -3,79% -5,38% -3,26% 4,28% 9,37% 29,99% Seite 54 13.02.2008 Trotz der revidierten Daten können wir jedoch noch keine grundsätzliche Trendwende am Ölmarkt erkennen. Zwar sollte sich der Ölpreis in den nächsten Jahren zurückbilden, jedoch besteht langfristig weiterhin die Gefahr wieder steigender Preise für den Fall, dass die erforderlichen Investitionen in die Ölwirtschaft nicht getätigt werden. Ein „Schweinezyklus“, d.h. Überinvestitionen aufgrund des angestiegenen Ölpreises, die später zu einer deutlichen Preiskorrektur nach unten führen, zeichnet sich bislang noch nicht ab. Insbesondere ab dem Jahr 2011 ist die Preisprognose sehr unsicher. 9. Quellen BP Statistical Review 2007 CIA Worldfactbook Global Insight International Energy Agency Oil Market Report, Dezember 2007 IMF Working Paper (WP/07/266) China’s Changing Trade Elasticities, Jahangir Aziz, Xiangming Li, November 2007 IMF Working Paper (WP/07/214) The Shifting Structure of China’s Trade and Production, Li Cui and Murtaza Syed Reuters U.S. Energieministerium World Bank China Research Paper No. 8: Raw material prices, wages, and profitability in China’s industry — How was profitability maintained when input prices and wages increased so fast?, Song-Yi Kim, Louis Kuijs, Oktober 2007 World Bank China Research Paper No. 7, REBALANCING CHINA’S ECONOMY—MODELING A POLICY PACKAGE, Jianwu He/ Louis Kuijs, September 2007 World Bank Doing Business 2008 Research Seite 55 13.02.2008 Investkredit Bank AG – Research Weitere Publikationen und Länderberichte finden Sie auf www.volksbank.at und www.investkredit.at Falls Sie auf unseren e-mail-Publikationen-Verteiler aufgenommen werden möchten, senden Sie uns ein mail an [email protected] oder füllen das Bestellformular auf der Homepage aus. Verfügbare Publikationen: Wochenkommentar (D) Marktperspektiven (D) Monatskommentar (D) Financial Markets Monthly (E) Zins- und FX-Perspektiven (D) Aktienmarkt-Perspektiven (D) CEE Quarterly (E) CEE Currencies Monthly (E) Sonstige Publikationen (D, E) Investkredit Bank AG - Research Dipl.-Vw. Uta Pock +43-1-53135 – 531 Mag. Friedrich Glechner, CFA – 684 Mag. Mathias Lahnsteiner – 469 Mag. Mario Wattaul – 403 Mag. Claudia Zauchinger – 569 Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Aussagen dienen lediglich der unverbindlichen Information basierend auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Person(en) zum Redaktionsschluss. Jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Erstellung dieses Berichts, insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit der angeführten Daten sowie der erstellten Prognosen, ist ausgeschlossen. Research Seite 56 13.02.2008